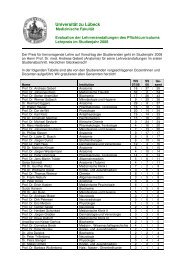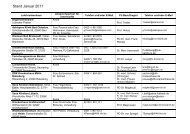PDF, 2 MB - Universität zu Lübeck
PDF, 2 MB - Universität zu Lübeck
PDF, 2 MB - Universität zu Lübeck
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Prof. Dr. Peter DominiakRektor der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>Prof. Dr. Werner SolbachDekan der Medizinischen FakultätProf. Dr. Enno HartmannDekan der Technisch-Naturwissenschaftlichen FakultätKontaktAnett BraunerEvaluationsbeauftragte der Medizinischen Fakultät<strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>Ratzeburger Allee 16023538 <strong>Lübeck</strong>Tel. 0451 – 500 5084E-Mail: brauner@<strong>zu</strong>v.uni-luebeck.de
VorwortDie Qualität der Lehre wird vor allem dann nachhaltig verbessert, wenn sich alle Beteiligten,insbesondere Studenten und Dozenten, intensiv und systematisch mit ihr auseinandersetzen.Außerdem ist der kritische, aber gleichzeitig kollegiale Blick von außen sehr hilfreich.Deshalb haben die fünf <strong>zu</strong>m Verbund norddeutscher <strong>Universität</strong>en gehörenden MedizinischenFakultäten 1 beschlossen, gemeinsam das Studium der Humanmedizin an ihren Einrichtungen<strong>zu</strong> evaluieren.Zunächst wurde ein einheitliches Format festgelegt, nach dem der Aufbau und Ablauf desStudiums der Humanmedizin an den fünf Fakultäten beschrieben werden sollen. DiesesFormat orientiert sich an folgenden zwei Quellen:• Globale Standards der World Federation for Medical Education (WFME) <strong>zu</strong>r Qualitätsverbesserungder Medizinischen Ausbildung und• Bericht der Sachverständigenkommission <strong>zu</strong>r Bewertung der Medizinischen Ausbildungin Baden-Württemberg.An der Medizinischen Fakultät der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> wurde daraufhin eine Arbeitsgruppeunter Federführung des Studiendekans eingerichtet, die in Zusammenarbeit mit dem Studienausschusseinen ersten Entwurf der Beschreibung des Studiums der Humanmedizin in<strong>Lübeck</strong> erarbeitet hat. Dieser Bericht wurde dann mit der Bitte um Ergän<strong>zu</strong>ngen und Kritik<strong>zu</strong>nächst den gewählten Repräsentanten der <strong>Universität</strong> 2 und danach etwa 150 Personen<strong>zu</strong>geschickt, die in verantwortlicher Position an der Lehre beteiligt sind. Natürlich wurdenauch die <strong>Lübeck</strong>er Studenten in diesen Prozess einbezogen (Semestersprecher, Fachschaft,AStA). Alle Rückmeldungen wurden in den vorliegenden Bericht eingearbeitet.Sie halten nun eine Broschüre in den Händen, die zwei Ziele verfolgt. Einerseits soll sie deminternationalen Gutachtergremium, das im Rahmen des gemeinsamen Evaluationsprozessesim Januar 2007 nach <strong>Lübeck</strong> kommen wird, ein klares Bild über die hiesige Situation vermitteln.Andererseits soll die vorliegende Broschüre den Studenten und Dozenten als Diskussionsgrundlagedienen, um so gemeinsam und gezielt das Studium der Humanmedizin in <strong>Lübeck</strong>weiterentwickeln <strong>zu</strong> können.<strong>Lübeck</strong>, den 20. November 2006Dipl.-Psych. Anett BraunerEvaluationsbeauftragte der Medizinischen FakultätProf. Dr. med. Jürgen WestermannStudiendekan der Medizinischen Fakultät1 Medizinischen Fakultäten Greifswald, Hamburg, Kiel, <strong>Lübeck</strong> und Rostock2 Rektor und Prorektoren, Kanzlerin, Dekane und Prodekane beider Fakultäten, StudienausschussIII
Inhalt1 KURZBESCHREIBUNG DER FAKULTÄT .......................................................................12 AUFGABE UND ZIELSETZUNG......................................................................................73 AUSBILDUNGSPROGRAMM ..........................................................................................93.1 Struktur und Studienplan ........................................................................................93.2 Curriculumsmodell und Lehrmethoden.................................................................133.3 Curriculumssteuerung und -weiterentwicklung .....................................................164 STUDENTEN..................................................................................................................224.1 Bewerber ..............................................................................................................224.2 Auswahlverfahren .................................................................................................224.3 Zulassungszahlen und Studiendauer ...................................................................244.4 Förderung .............................................................................................................244.5 Engagement .........................................................................................................295 DOZENTEN....................................................................................................................315.1 Personelle Rahmenbedingungen .........................................................................315.2 Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ................................................325.3 Anreizsystem für Forschung und Lehre................................................................336 RESSOURCEN ..............................................................................................................356.1 Lehrbudget und Mittel<strong>zu</strong>weisung ..........................................................................356.2 Einrichtungen für die theoretische Ausbildung .....................................................366.3 Einrichtungen für die klinische Ausbildung ...........................................................366.4 Bibliothek ..............................................................................................................377 ERGEBNISSE ................................................................................................................397.1 Prüfungsergebnisse..............................................................................................397.2 Prüfungsmethoden ...............................................................................................407.3 Medizinische Promotionen....................................................................................418 LEITUNG UND VERWALTUNG.....................................................................................439 EVALUATION.................................................................................................................459.1 Evaluationen durch das Studiendekanat ..............................................................459.2 Weitere Evaluationen auf dem Campus ...............................................................5210 WEITERENTWICKLUNGEN UND ZIELE ......................................................................5311 ANHANG ........................................................................................................................57V
KURZBESCHREIBUNG DER FAKULTÄT1 KURZBESCHREIBUNG DER FAKULTÄTDie <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> wurde 1964 als zweite Medizinische Fakultät der <strong>Universität</strong> Kieleingerichtet und 1973 als Medizinische Hochschule <strong>Lübeck</strong> eine selbstständige wissenschaftlicheEinrichtung (Anhang 1). Heute besteht sie aus zwei Fakultäten, der MedizinischenFakultät und der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (Anhang 2), die gemeinsamvier Studiengänge anbieten: Humanmedizin, Computational Life Science, Informatik undMolecular Life Science. Zum Wintersemester 06/07 sind in diesen Studiengängen insgesamt2.348 Studenten 3 eingeschrieben.Zusammen mit der benachbarten Fachhochschule wird der Masterstudiengang BiomedicalEngineering/Medizintechnik (Unterrichtssprache: Englisch) und der Studiengang Medizintechnikdurchgeführt, <strong>zu</strong>sammen mit der International School of New Media der MasterstudiengangDigital Media und <strong>zu</strong>sammen mit der Fern<strong>Universität</strong> in Hagen der FernstudiengangMedizinische Informatik. Obwohl die Medizinische Fakultät an allen Studiengängensubstantiell beteiligt ist, liegt ihr Schwerpunkt auf dem Studiengang Humanmedizin. Hier sind<strong>zu</strong>m Wintersemester 06/07 insgesamt 1.472 Studenten eingeschrieben (Tabelle 1). Im Rahmender jährlichen Aufnahme haben 183 Studenten im Oktober 2006 mit dem Studium derHumanmedizin in <strong>Lübeck</strong> begonnen (Anhang 68). Damit studieren knapp 2/3 der Studentender <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> Humanmedizin.Tabelle 1: Anzahl der Medizinstudenten vom WS 02/03 bis WS 06/07Anzahl männlich weiblich ausländischSemester gesamt Anzahl % Anzahl % Anzahl %WS 02/03 1545 576 37,3 969 62,7 142 9,1SS 03 1444 538 37,7 906 62,7 137 9,5WS 03/04 1523 544 35,7 979 64,3 143 9,4SS 04 1436 517 36,0 919 64,0 142 9,9WS 04/05 1549 557 36,0 992 64,0 161 10,4SS 05 1454 515 35,4 939 64,6 152 10,4WS05/06 1530 530 34,6 1000 65,4 159 10,4SS 06 1435 495 34,4 940 65,5 155 10,8WS 06/07 1472 495 33,6 977 66,3 151 10,2Der Studiengang wird von 73 hauptamtlichen Professoren (C4/W3, C3/W2) in 49 Einrichtungender <strong>Universität</strong> und im Forschungszentrum Borstel (FZB) getragen, wobei 64 Professuren<strong>zu</strong>r Medizinischen Fakultät und neun <strong>zu</strong>r Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultätgehören (Anhang 59). Fünf Professoren gehören beiden Fakultäten an. Zusätzlich gibt es an3 Wenn im folgenden Text von Studenten, aber auch Professoren, Dozenten, Mitarbeitern <strong>zu</strong> lesen ist, sind damit selbstverständlichauch immer Studentinnen, Professorinnen, Dozentinnen, Mitarbeiterinnen gemeint. Auf die explizite Nennung derweiblichen Form wird nur aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichtet.1
KURZBESCHREIBUNG DER FAKULTÄTder Fakultät drei Juniorprofessuren. Daraus resultiert ein formales Betreuungsverhältnis von19 Studenten pro Professor.Zur Durchführung des Studienganges Humanmedizin erhält die Medizinische Fakultät einejährliche Zuweisung vom Land Schleswig-Holstein (33,15 Millionen Euro für das Jahr 2006).Schwerpunkte der Fakultät in Forschung und LehreIn ausgewählten naturwissenschaftlichen Fächern werden die Medizinstudenten gemeinsammit Studenten der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät unterrichtet. Das Curriculumist so organisiert, dass genügend Freiraum für das wissenschaftliche Arbeiten im Rahmeneiner Promotion und Engagement der Studenten <strong>zu</strong>r persönlichen Weiterentwicklung bleibt.Die Ausbildung der Medizinstudenten findet auf dem übersichtlichen und den Dialog förderndenCampus der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> statt (Anhang 5, Anhang 6). Dies und die enge Verflechtungzwischen der Medizinischen und Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät bildeneine wesentliche Grundlage für das <strong>Lübeck</strong>er Konzept der Medizinerausbildung. Diedurch die Vorgaben der neuen Approbationsordnung notwendigen Änderungen in der Medizinerausbildungab Oktober 2003 wurden in <strong>Lübeck</strong> nicht durch die Entwicklung eines vollständigneuen Konzeptes umgesetzt. Vielmehr hat sich die Medizinische Fakultät bewusstda<strong>zu</strong> entschlossen, auf den vorhandenen und bewährten Strukturen auf<strong>zu</strong>bauen, lokaleStärken <strong>zu</strong> nutzen und durch innovative Weiterentwicklungen sinnvoll <strong>zu</strong> ergänzen. Das <strong>Lübeck</strong>erUnterrichtskonzept besteht aus drei Säulen:Das Curriculum: Gemeinsam getragenBeide Fakultäten haben <strong>zu</strong>sammen ein straffes Curriculum mit dem Ziel entwickelt, die <strong>Lübeck</strong>erMedizinstudenten nicht nur <strong>zu</strong> sehr guten Leistungen in den mündlich-praktischenund schriftlichen Prüfungen <strong>zu</strong> führen, sondern ihnen auch die praktischen, kommunikativenund ethischen Grundlagen <strong>zu</strong> vermitteln, die für einen professionellen und dennoch empathischenUmgang mit ihren Patienten notwendig sind. Als ein wichtiger Schritt auf diesem Wegwurde für jede Pflichtveranstaltung eine Kurzbeschreibung auf die Internetseite des Studiendekanatsgestellt, die für alle Studenten und Dozenten frei <strong>zu</strong>gänglich ist (Anhang 32). Damitist ein Dialog entstanden - sowohl zwischen Dozenten einzelner Disziplinen als auch zwischenStudenten und Dozenten - der die Weiterentwicklung des Curriculums außerordentlichfördert. Zurzeit werden für die einzelnen Fächer Lehrziele erarbeitet. Damit diese nicht nurinnerhalb der Studienabschnitte (Vorklinik, Klinik und Praktisches Jahr), sondern auch zwischenden Abschnitten abgestimmt sind, wurde von der Medizinischen Fakultät entschieden,dass ein Studiendekanat für die Organisation des gesamten Medizinstudiums vom ersten bis<strong>zu</strong>m zwölften Semester verantwortlich ist.2
KURZBESCHREIBUNG DER FAKULTÄTDie medizinische Promotion: Wichtiger Bestandteil der AusbildungWir bilden unsere Medizinstudenten so aus, dass sie im dritten Studienjahr die Entscheidungtreffen können, mit welchem Thema sie sich im Rahmen einer Promotion auf einem hohenwissenschaftlichen Niveau auseinandersetzen möchten. Um die Studenten bei diesem Vorhaben<strong>zu</strong> unterstützen, hat die Fakultät zwei Maßnahmenpakete umgesetzt. Erstens ist dasMedizinstudium so organisiert, dass die vorlesungsfreie Zeit komplett erhalten bleibt (22 Wochen)und jeder Student am Ende des laufenden Semesters seinen Stundenplan für daskommende Semester kennt. Damit sind wichtige Vorausset<strong>zu</strong>ngen bezüglich der zeitlichenRessourcen und Planungssicherheit geschaffen, die für eine anspruchsvolle Promotion notwendigsind. Zweitens werden schon in der Vorklinik in Zusammenarbeit mit den Kollegenaus der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät die naturwissenschaftlichen Grundlagenfür eine qualitativ hoch stehende Promotion gelegt. Dieser Anspruch wird dann im klinischenAbschnitt durch ein zentrales Doktorandenseminar, durch ein Stipendiensystem und eineausgezeichnet arbeitende Promotionskommission weiter verfolgt (Anhang 73).Da die Dissertationen vorwiegend im Bereich der Forschungsschwerpunkte der beiden Fakultätenangefertigt werden, arbeiten in den Labors häufig Doktoranden aus dem Bereich derMedizin mit Studenten aus anderen naturwissenschaftlichen Studiengängen (Bachelor- undMasterarbeit), naturwissenschaftlichen Doktoranden und Postdoktoranden <strong>zu</strong>sammen.Durch diese Zusammenarbeit in den Labors wird die Qualität der medizinischen Dissertationenentscheidend gefördert. Im Durchschnitt werden 70% eines Medizinerjahrgangs in <strong>Lübeck</strong>promoviert. Da jeder Doktorand etwa 2.000 Stunden in seine Arbeit investiert 4 , spieltdiese eine große Rolle in der Ausbildung der Medizinstudenten. Gleichzeitig leisten Medizindoktorandeneinen unverzichtbaren Beitrag für die erfolgreiche Arbeit der <strong>Lübeck</strong>er Forschungsschwerpunkte(Anhang 7).Die Studenten: Mehr als nur StudierendeWir erwarten von unseren Studenten mehr, als nur <strong>zu</strong> lernen und die Angebote der <strong>Universität</strong><strong>zu</strong> konsumieren. Sie sollen sich vielmehr aktiv in das akademische Leben einbringen.Dies wird von der Fakultät unter anderem durch folgende Maßnahmen gefördert:• Studenten sind nicht nur formal, sondern aktiv gestaltend in sämtlichen Gremien der MedizinischenFakultät und der <strong>Universität</strong> tätig. Die Fakultät fördert diese Aktivitäten unteranderem auch durch die Auslobung des jährlichen Preises für besonderes studentischesEngagement, der im Rahmen der Promotionsfeier vergeben wird (Anhang 66).4 Weihrauch, M., Strate, J., Pabst, R. (2003). Die medizinische Dissertation – kein Auslaufmodell. Dtsch Med Wochenschr 128,2583-2587.3
KURZBESCHREIBUNG DER FAKULTÄT• Vom Studiendekanat wurde ein funktionierendes Mentorenprogramm etabliert, in dessenRahmen sich eine Gruppe von durchschnittlich zehn Studenten aus mehreren Studienjahrenmehrmals im Jahr mit ihrem Mentor trifft (Anhang 43). Einmal im Jahr kommen alleMentorengruppen im Rahmen der Veranstaltung ‚Uni im Dialog’ <strong>zu</strong>sammen, die in der<strong>Universität</strong>skirche St. Petri durchgeführt wird (Anhang 44). Die Kommunikation mit denStudenten wird auch dadurch intensiviert, dass es in <strong>Lübeck</strong> ein breit gefächertes Gesprächs-und Beratungsangebot (Anhang 34) gibt und dass jeder Student <strong>zu</strong> Studienbeginneinen kostenlosen und lebenslang gültigen E-Mail-Account erhält.• Um ihren Erfahrungshorizont <strong>zu</strong> erweitern, sollen möglichst viele Studenten einen Teilihres Studiums im Ausland absolvieren. Bereits jetzt verbringen mehr als 50% der MedizinstudentenTeile ihrer Famulatur, des Praktischen Jahres oder ein Semester im Ausland(Anhang 64). Eine Befragung der <strong>Lübeck</strong>er Medizinstudenten aus dem Jahr 2006hat gezeigt, dass <strong>zu</strong>künftig über 60% einen Auslandsaufenthalt während ihres Studiumsplanen. Das Studiendekanat sorgt deswegen durch intensive Beratung und flexible Organisationdafür, dass Pflichtkurse vor- oder nachgeholt werden können, um einen Auslandsaufenthaltso einfach wie möglich <strong>zu</strong> machen und eine Verlängerung der Studiendauer<strong>zu</strong> vermeiden.Auf diese Weise ist in <strong>Lübeck</strong> ein Curriculum etabliert, dass nicht nur alle Anforderungen derÄAppO erfüllt, sondern auch der Kernforderung des B<strong>MB</strong>F, des Wissenschaftsrates und derDFG nach einem wissenschaftsorientiertem Medizinstudium erfolgreich nachkommt 5 .Zugleich deckt sich das <strong>Lübeck</strong>er Curriculum vollständig mit dem von der Bundesvertretungder Medizinstudierenden in Deutschland vorgeschlagenen Kerncurriculum für die MedizinischeAusbildung in Deutschland 6 .Stärken der Medizinischen FakultätDie Medizinische Fakultät legt großen Wert darauf, dass die einzelnen Lehrveranstaltungeninnerhalb eines Studienabschnittes (Vorklinik, Klinik, Praktisches Jahr) und zwischen denAbschnitten möglichst gut aufeinander abgestimmt sind. Damit sollen unnötige Wiederholungenvermieden und so das im Vergleich <strong>zu</strong> vielen anderen Studiengängen sehr volle Pflichtcurriculumso schlank wie möglich gehalten werden. Im Folgenden werden <strong>zu</strong>nächst kurz dieCharakteristika der einzelnen Studienabschnitte geschildert und dann die Steuerungsinstrumentedargestellt.5 Kernforderungen. Hochschulmedizin der Zukunft: Ziele und Visionen für die klinische Spitzenforschung. Gemeinsamer Workshopvon B<strong>MB</strong>F, DFG und Wissenschaftsrat im Mai 2004 in Berlin.6 BVMD (2006). Kerncurriculum für die Medizinische Ausbildung in Deutschland – Ein Vorschlag der MedizinstudierendenDeutschland.4
KURZBESCHREIBUNG DER FAKULTÄTStärken innerhalb der StudienabschnitteIn der Vorklinik sind die Lehrveranstaltungen so auf die vier Semester aufgeteilt, dass dieeinzelnen Semester von den Studenten als gleichmäßig anspruchsvoll empfunden werden,obwohl eine unterschiedliche Pflichtstundenzahl <strong>zu</strong> absolvieren ist (220 Stunden jeweils im1. und 2. Semester, 200 Stunden im 3. Semester und 150 Stunden im 4. Semester). Durchdiese Struktur, durch die Einbindung vieler klinischer Inhalte und durch ein intensives Beratungsangebotwird erreicht, dass den meisten Studenten schon am Ende des 1. Studienjahresklar wird, ob das Medizinstudium für sie persönlich der richtige Studiengang ist. In <strong>Lübeck</strong>haben die Studenten, die ohne Schwierigkeiten die Anforderungen des 1. Studienjahresbewältigen, auch im Verlauf des weiteren Studiums keine Probleme mit den auf sie <strong>zu</strong>kommendenBelastungen. Weniger als 5% der Studenten geben das Medizinstudium in <strong>Lübeck</strong>im Laufe der Vorklinik auf (Anhang 68).In der Vorklinik wird ein „bunter Strauß“ an Wahlfächern angeboten. Institute der Medizinischenund Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät haben sich <strong>zu</strong>m „Zentrum für medizinischeStruktur- und Zellbiologie“ <strong>zu</strong>sammengeschlossen, um mit Hilfe der Wahlfächer schonin diesem Stadium der Ausbildung die Freude an und die Grundlage für wissenschaftlichesArbeiten <strong>zu</strong> legen (Anhang 8). Ein Ziel der vorklinischen Ausbildung besteht darin, dass die<strong>Lübeck</strong>er Medizinstudenten den schriftlichen Teil des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfungsicher bestehen. Im Vergleich mit anderen Fakultäten legen wir hier also Wert auf einegeringe Misserfolgsquote. Im mündlich-praktischen Teil sollen unsere Studenten exzellentePrüfungsleistungen erbringen (Anhang 70).Die Klinik beginnt im 3. Studienjahr mit einem 14-tägigen Block Problemorientiertes Lernen<strong>zu</strong>m Thema Umweltmedizin und mit dem klinischen Untersuchungskurs, der im Wintersemesterwöchentlich für jeden Studenten zwei Nachmittage umfasst. Schon im 4. Studienjahrfinden sieben Blockpraktika statt unter anderem in den Fächern Chirurgie, Innere Medizinund Pädiatrie. Diese sind so organisiert, dass die entsprechenden Inhalte den Studentenvorher bekannt sind und sie genügend Zeit haben, diese vor- und nach<strong>zu</strong>bereiten. Einepharmakologische und eine pathologische Konferenz bilden die Klammer für das 4. Studienjahr.Das 5. Studienjahr beginnt mit den Blockpraktika Allgemeinmedizin und Psychiatrie.Dann folgt der Unterricht in Neurologie und den „kleinen“ klinischen Fächern (Augenheilkunde,Dermatologie, HNO, Orthopädie und Urologie). Auch in der Klinik verfolgt die MedizinischeFakultät die Politik, viele verschiedene Wahlfächer an<strong>zu</strong>bieten.Im Praktischen Jahr besteht ein intensiver Kontakt mit den akademischen Lehrkrankenhäusernund –praxen (Anhang 24). Es wurde vereinbart, dass eine Finanzierung nicht mehr, wiebisher, pro Student und Tertial stattfindet, sondern Lehrkrankenhäuser und die einzelnen5
KURZBESCHREIBUNG DER FAKULTÄTKliniken des <strong>Universität</strong>sklinikums projektbezogene Anträge an das Studiendekanat stellenkönnen, die der konkreten Verbesserung der Ausbildung im Praktischen Jahr dienen. Zurzeitwerden die Kliniken für Chirurgie und Innere Medizin mit jeweils einer halben BAT IIa-Stelleunterstützt. Dadurch konnte eine Seminarreihe (Anhang 25), ein PJ-Pass (Anhang 26) undein Repetitorium <strong>zu</strong>r Vorbereitung auf den Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (Anhang42) entwickelt und etabliert werden.Stärken der SteuerungsinstrumenteDie Basis für den Erfolg der Medizinischen Fakultät in der Ausbildung ihrer Medizinstudenten(Anhang 75, Anhang 76) liegt vor allem in ihrer Geschlossenheit. Diese wird <strong>zu</strong>m einenmaßgeblich durch das Mentorenprogramm der Medizinischen Fakultät gefördert (Anhang43). Zum anderen wird sie dadurch erreicht, dass Projekte gemeinsam vorbereitet werden(Anhang 9) und vor etwaigen Entscheidungen die Entscheidungsgrundlagen Dozenten undStudenten transparent vorliegen.Außerdem werden die akademischen Gremien kontinuierlich über laufende Entwicklungeninformiert. Der Studiendekan gehört der wöchentlichen Dekanatsrunde an und hat im Rahmenjeder Konventssit<strong>zu</strong>ng einen eigenen Tagesordnungspunkt. Am Semesterende findet<strong>zu</strong>dem eine zentrale Evaluation aller Pflichtlehrveranstaltungen statt. Die Ergebnisse werdenauf der Internetseite des Studiendekanats zeitnah veröffentlicht, so dass von intern und externauf sie <strong>zu</strong>gegriffen werden kann. Das Studiendekanat nimmt Kontakt <strong>zu</strong> den Verantwortlichenauf, deren Lehrveranstaltungen von den Studenten schlecht bewertet wurden undgemeinsam werden Maßnahmen erarbeitet, um derartige Situationen <strong>zu</strong> verbessern. Auchim Praktischen Jahr evaluiert jeder Student seine Tertiale (Anhang 57). Die Ergebnisse werdenauf der Internetseite des Studiendekanats veröffentlicht. Da die Medizinische Fakultätüber mehr PJ-Plätze verfügt, als für die Ausbildung ihrer Studenten notwendig sind und diePlätze nach den Wünschen der Studenten vergeben werden, wird in Zukunft der Wettbewerbder einzelnen Kliniken um die PJ-Studenten mit da<strong>zu</strong> beitragen, dass das Ausbildungsniveauim Praktischen Jahr ständig steigen wird.Seit dem Studienjahr 2004 geht die Lehre mit 20% in die leistungsbezogene Mittelvergabeder Medizinischen Fakultät ein. Dabei spielen die Evaluationsergebnisse durch die Studenteneine herausragende Rolle. In <strong>Lübeck</strong> entscheiden also auch die Studenten mit ihrer Evaluationdarüber, wie die finanziellen Mittel der Fakultät auf die Institute und Kliniken verteiltwerden.6
AUFGABE UND ZIELSETZUNG2 AUFGABE UND ZIELSETZUNGDie Medizinische Fakultät der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> hat die Aufgabe, die anspruchsvollenVorgaben der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) um<strong>zu</strong>setzen. In der ÄAppO sind folgendeAusbildungsziele definiert:„Ziel der ärztlichen Ausbildung ist der wissenschaftlich und praktisch in der Medizinausgebildete Arzt, der <strong>zu</strong>r eigenverantwortlichen und selbständigen ärztlichen Berufsausübung,<strong>zu</strong>r Weiterbildung und <strong>zu</strong> ständiger Fortbildung befähigt ist. Die Ausbildungsoll grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in allen Fächernvermitteln, die für eine umfassende Gesundheitsversorgung der Bevölkerung erforderlichsind. Die Ausbildung <strong>zu</strong>m Arzt wird auf wissenschaftlicher Grundlage und praxis-und patientenbezogen durchgeführt.“ (ÄAppO vom 27.Juni 2002, § 1 Abs. 1)Diese Vorgaben der ÄAppO sind in dem Leitbild für die Lehre der Fakultät konkretisiert:„Die Studenten können die häufigsten sowie die lebensbedrohlichen Gesundheitsstörungenerkennen und behandeln. Sie beherrschen die hier<strong>zu</strong> notwendigen klinischpraktischenFertigkeiten. Als Ausdruck ihrer positiven und professionellen Haltunggegenüber Patienten haben sie Kommunikationstechniken für die meisten Situationendes klinischen Alltags eingeübt. Im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens könnensie sich Informationen beschaffen und diese kritisch bewerten.“Dieses Leitbild richtet sich nicht primär an die Öffentlichkeit. Es spiegelt vielmehr das Ergebniseines internen Verständigungsprozesses wider und hat für die Mitglieder der MedizinischenFakultät handlungsleitenden Charakter. Abgeleitet wurde dieses Leitbild aus den Ergebnisseneines zweitägigen Workshops <strong>zu</strong>r strategischen Ausrichtung der Lehre im Juni2004. An dem von einem externen Moderator geleiteten Workshop nahmen die Kanzlerin der<strong>Universität</strong>, der Dekan und der Studiendekan der Medizinischen Fakultät, Lehrstuhlinhaber,wissenschaftliche Mitarbeiter, studentische Vertreter sowie Vertreter aus dem Bereich derVerwaltung teil. Das Ergebnis (Anhang 9) wurde mit allen Lehrstuhlinhabern und Studentenvertreternabgestimmt und im Dezember 2004 einstimmig vom Konvent der MedizinischenFakultät verabschiedet. Damit wurden als übergeordnete Ausbildungsziele für Absolventender Medizinischen Fakultät <strong>Lübeck</strong> folgende Punkte vereinbart:• Medizinisches Fachwissen. Der Student soll am Ende seiner Ausbildung die wichtigstenErkrankungen vor allem aus dem Bereich der Allgemeinmedizin diagnostizieren und behandelnkönnen.• Praktische Fertigkeiten. Jeder Student hat bis <strong>zu</strong>m Ende seiner Ausbildung Gelegenheit,bestimmte Fertigkeiten in einem definierten Umfang strukturiert <strong>zu</strong> üben und sich an<strong>zu</strong>eignen.Der Student soll entsprechend der Bedeutung des jeweiligen Faches für einen7
AUFGABE UND ZIELSETZUNGgewissen Zeitraum ganztägig in die klinische Versorgung eingebunden sein und hierbeiPatienten betreuen und vorstellen können.• Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren. Die Studenten sollen <strong>zu</strong> einem vorgegebenenklinischen Thema aus verschiedenen Quellen Informationen beschaffen und sienach Evidenzgraden beurteilt präsentieren können.• Soziale Kompetenz. Der Student soll <strong>zu</strong>m Ende des Studiums für alle relevanten Situationenseines Berufes ausgebildet sein. Hier<strong>zu</strong> gehören unter anderem die Fähigkeit <strong>zu</strong>einem angemessenen Umgang mit Patienten, das Überbringen von schlechten Nachrichtenund Teamfähigkeit am Arbeitsplatz.Bis Ende 2007 wird konkret festgelegt, wo und in welchem Umfang diese Ausbildungsziele inden Bereichen Pflichtcurriculum, Promotion und Mentorenprogramm umgesetzt werden. Diesmündet dann in die Erstellung von Lehrzielkatalogen für alle Veranstaltungen. Erste Ergebnisseliegen für das Praktische Jahr (PJ) in Form des „PJ-Passes“ (Anhang 26) für die FächerInnere Medizin und Chirurgie vor, die das Minimum der <strong>zu</strong> beherrschenden Wissensgebieteund Fertigkeiten enthalten. Im Anschluss daran werden rückwärts gehend Lehrziele fürdie klinischen und danach für die vorklinischen Fächer formuliert (Anhang 10). Als Ausgangspunktdafür dienen den Einrichtungen die Kurzbeschreibungen, die für alle Lehrveranstaltungenauf den Internetseiten des Studiendekanats vorliegen (Anhang 32).Die Ausarbeitung der Lehrzielkataloge ist für die Einrichtungen mit einem erheblichen Aufwandverbunden. Deshalb können die Einrichtungen eine über die Basisausstattung für Forschungund Lehre hinausgehende finanzielle Unterstüt<strong>zu</strong>ng für die Umset<strong>zu</strong>ng dieser Anforderungerhalten. Außerdem ist der Ausarbeitungsstand der Lehrzielkataloge ein Kriterium beider leistungsbezogenen Mittelvergabe im Bereich Lehre und damit eine indirekte Unterstüt<strong>zu</strong>ngder Einrichtungen bei der Formulierung von Lehrzielen.Die Formulierung von Lehrzielen durch die Institutionen ist eine Seite der Medaille, ihre Vermittlungdie zweite. Mit anderen Worten: Gut formulierte Lehrziele allein sorgen nicht für einenlehrzielorientierten Unterricht. Deswegen wird in der zentralen Lehrevaluation durch dasStudiendekanat am Semesterende auch erfasst, ob Lehrziele definiert und vermittelt wurden.Alle Unterrichtsveranstaltungen haben das Ziel, die <strong>Lübeck</strong>er Studenten optimal auf den Erstenund Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung vor<strong>zu</strong>bereiten. Dabei wird zwischen denschriftlichen und mündlich-praktischen Abschnitten dieser Prüfung unterschieden. Währendim schriftlichen Teil das sichere Bestehen im Vordergrund steht, sollen im mündlichpraktischenTeil hervorragende Leistungen gezeigt werden (siehe Kapitel 10, S. 56). Nichtdas Auswendiglernen von Faktenwissen steht im Vordergrund, sondern das sichere Anwendenvon Wissen und kommunikative Fertigkeiten.8
AUSBILDUNGSPROGRAMM3 AUSBILDUNGSPROGRAMM3.1 Struktur und StudienplanDie im Oktober 2003 in Kraft getretene ÄAppO regelt das Medizinstudium folgendermaßen:Das Studium gliedert sich in zwei Abschnitte – den vorklinischen und den klinischen. Denvorklinischen Abschnitt bildet das naturwissenschaftliche Grundstudium, Psychologie undEthik mit vier Semestern Mindeststudienzeit. Er wird mit dem Ersten Abschnitt der ÄrztlichenPrüfung abgeschlossen. Anschließend folgt der klinische Abschnitt mit sechs SemesternMindeststudienzeit, bevor die Qualifikation für das PJ erworben ist. Das PJ gliedert sich indrei Abschnitte à 16 Wochen. Jeweils ein Abschnitt wird in den Fächern Chirurgie und InnereMedizin absolviert, ein weiterer in einem klinisch-praktischen Wahlfach. Nach dem PJ wirddas Studium mit dem Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung abgeschlossen. Die MedizinischeFakultät fördert das Anfertigen einer Doktorarbeit während des Medizinstudiums unddie aktive Teilnahme am Mentorenprogramm.Im vorklinischen Abschnitt sind 17 Leistungsnachweise <strong>zu</strong> erwerben (Anhang 13), im klinischenAbschnitt 39 (Anhang 17). Insgesamt sind laut ÄAppO in der Vorklinik mindestens 784Stunden Pflichtunterricht vorgesehen. In der Klinik sind es mindestens 868 Stunden Pflichtunterricht,bevor der Student das PJ beginnen kann. Jeder Student muss dabei in beidenAbschnitten jeweils ein Wahlfach belegen (Anhang 14, Anhang 18). Darüber hinaus sind inder Vorklinik ein dreimonatiges Pflegepraktikum und eine Ausbildung in Erster Hilfe <strong>zu</strong> absolvieren.Beides kann bereits nach dem Abitur und vor dem Studium geleistet und dann aufdas Studium angerechnet werden. Im klinischen Abschnitt ist <strong>zu</strong>sätzlich eine viermonatigeFamulatur in der vorlesungsfreien Zeit <strong>zu</strong> erbringen. Die ÄAppO gibt nur einen groben Rahmenfür das Medizinstudium vor. Der genaue Aufbau und Inhalt des Studienganges Medizinan der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> ist durch die Studienordnung geregelt (www.medizin.uniluebeck.de/interessierte/pdf/SO-Medizin_050208.pdf).Für jede Veranstaltung des Pflichtcurriculumsgibt es im Internet eine Kurzbeschreibung, in der Vorausset<strong>zu</strong>ngen, Inhalte, Ziele,Zeitdauer und Scheinkriterien festgelegt sind (Anhang 32).Studienablauf in <strong>Lübeck</strong>Im 1. Semester werden die naturwissenschaftlichen Grundlagen gelegt und das Fach Anatomiebeginnt mit dem Präparierkurs. Außerdem werden praktische Übungen in den dreiSchwerpunkten der <strong>Lübeck</strong>er vorklinischen Ausbildung abgehalten: Notfallmedizin (Anhang21), Gesprächsführung und Untersuchungstechniken (Anhang 15). Während des gesamtenSemesters kommen Kollegen aus der Klinik in die Unterrichtveranstaltungen der Vorklinik,um durch Vorlesungen und Patientenvorstellungen deutlich <strong>zu</strong> machen, welche Bedeutung9
AUSBILDUNGSPROGRAMMdie vorklinische Ausbildung für die spätere ärztliche Tätigkeit hat (Berufsfelderkundung). Zusätzlichgibt es Angebote, die helfen, das Lernen <strong>zu</strong> lernen (Anhang 38).Im 2. Semester wird der Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern und in derMakroskopischen Anatomie abgeschlossen. Es findet der Kurs der Mikroskopischen Anatomiestatt (‚Histo-Kurs’). Während des gesamten Semesters kommen auch hier Kollegen ausder Klinik in die Unterrichtveranstaltungen der Vorklinik. Alle Studenten, die weniger als zweiDrittel der für das 1. und 2. Semester empfohlenen „Scheine“ bestanden haben, werden amEnde des Semesters <strong>zu</strong> einer Beratung in das Studiendekanat gebeten.Im 3. Semester beginnt der Unterricht in den Fächern Biochemie und Physiologie (Anhang16) und der anatomische Unterricht wird in den ersten fünf Wochen mit der Neuroanatomieabgeschlossen. Der Schwerpunkt Gesprächsführung wird im Rahmen des Faches ‚MedizinischePsychologie und Soziologie’ intensiv fortgesetzt. Durch das Wahlfach ist es möglich,Gebiete gezielt <strong>zu</strong> vertiefen (Anhang 14).Im 4. Semester werden die Fächer Biochemie, Medizinische Psychologie und Soziologie,Physiologie und das Wahlfach abgeschlossen. Alle Fächer sind so organisiert, dass eine optimaleVorbereitung auf den mündlichen und schriftlichen Teil des Ersten Abschnitts der ÄrztlichenPrüfung erfolgen kann. So wird beispielsweise vom Institut für Anatomie nach Pfingstendas Repetitorium ‚Anatomie in fünf Tagen’ angeboten, in der Dozenten der Anatomie dieStudenten ganztägig über fünf Tage auf diesen Prüfungsteil vorbereiten (Anhang 41).Das 5. Semester beginnt mit einem zwei Wochen umfassenden Abschnitt des ProblemorientiertenLernens (POL) im Fach Klinische Umweltmedizin (Anhang 39). Während dieser Zeitfindet nur noch der ‚Untersuchungskurs’ statt, der in diesem Semester hauptsächlich vonChirurgen und Internisten ausgerichtet wird und sechs Stunden pro Woche umfasst. Nachdem POL-Abschnitt wird der ‚Untersuchungskurs’ fortgesetzt und es beginnt der Unterricht inden klinisch-theoretischen Fächern (Ethik, Mikrobiologie (Anhang 20), Pathologie, Pharmakologie)und den klinischen Fächern (Notfallmedizin, Nuklearmedizin, Strahlentherapie, Radiologie).Weiterhin wird im Rahmen der Wahlfächer in das ‚Wissenschaftliche Arbeiten’ eingeführtund es wird empfohlen, sich in dieser Phase des Studiums eine Doktorarbeit <strong>zu</strong> suchen.Unterstüt<strong>zu</strong>ng hierfür wird den Studenten <strong>zu</strong>m Beispiel in dem zentralen Doktorandenseminar‚Suchen und Finden einer Doktorarbeit’ gegeben (Anhang 72).Im 6. Semester folgt der zweite Teil des ‚Untersuchungskurses’, der in diesem Semesterhauptsächlich von den Gynäkologen und Pädiatern ausgerichtet wird und es wird der Unterrichtin den klinisch-theoretischen Fächern (Ethik, Humangenetik, Klinische Chemie, Mikrobiologie,Pathologie, Pharmakologie) und den klinischen Fächern (Notfallmedizin, Nuklearmedizin,Radiologie, Strahlentherapie) fortgesetzt. Auch in diesem Semester wird im Rah-10
AUSBILDUNGSPROGRAMMmen der Wahlfächer in das ‚Wissenschaftliche Arbeiten’ eingeführt und es wird noch einmalempfohlen, sich spätestens in dieser Phase des Studiums eine Doktorarbeit <strong>zu</strong> suchen.Im 7. Semester findet der Unterricht in Form von Blockpraktika statt. Es können drei bis vierPraktika aus sieben Bereichen ausgewählt werden (Anästhesie (Anhang 21), Chirurgie, Gynäkologie,Innere Medizin, Pädiatrie, Rechtsmedizin, Sozialmedizin (Anhang 40)). Parallelwerden die ‚Klinisch-Pathologische Konferenz’ und die ‚Klinische Pharmakologie, Pharmakotherapie’abgehalten, die wöchentlich - fallorientiert und interdisziplinär - Aspekte der Diagnoseund Therapie behandeln. Spätestens in dieser Phase des Studiums sollte mit derDoktorarbeit begonnen worden sein. Im 8. Semester werden die restlichen drei bis vierBlockpraktika absolviert. Parallel werden die ‚Klinisch-Pathologische Konferenz’ und die ‚KlinischePharmakologie, Pharmakotherapie’ abgeschlossen.Das 9. Semester beginnt <strong>zu</strong>nächst mit dem vierwöchigen Blockpraktikum Allgemeinmedizinfür die eine Hälfte des Jahrgangs und dem POLI-Praktikum ‚Psychiatrie/PsychosomatischeMedizin’ (Anhang 22) für die andere Hälfte des Jahrgangs. In dieser Zeit findet parallel nurder Unterricht in den klinischen Fächern statt (Augenheilkunde, Dermatologie, HNO, Neurologie,Orthopädie, Urologie), den so genannten Mittwochskursen. Nach dem Blockpraktikumbeginnen die Vorlesungen aller Fächer sowie die Kurse in den klinisch-theoretischen Fächern(Arbeitsmedizin, Medizinische Informatik, Medizinische Biometrie) und den Querschnittsbereichen‚Medizin des Alterns und des alten Menschen’ sowie ‚Infektiologie, Immunologie’.Das 10. Semester verläuft wie das 9. Semester. Die Studenten besuchen die andereHälfte der Veranstaltungen des fünften Studienjahres.Die drei von der ÄAppO geforderten fächerübergreifenden Leistungsnachweise werden mitfolgenden Disziplinen abgedeckt: 1. Pathologie; Pharmakologie, Toxikologie; Klinische Chemie,Laboratoriumsdiagnostik, 2. Chirurgie; Innere Medizin; Frauenheilkunde, Geburtshilfe;Kinderheilkunde (‚Untersuchungskurs’) und 3. Neurologie; Psychiatrie, Psychotherapie; PsychosomatischeMedizin und Psychotherapie. Seit dem Wintersemester 06/07 wird in <strong>Lübeck</strong>fächerübergreifend Palliativmedizin gelehrt (Anhang 28). Auch darüber hinaus ist der Studienaufbaudisziplinübergreifend ausgerichtet. Neben der engen Verzahnung von Vorklinikund Klinik stellen <strong>zu</strong>m Beispiel die ‚Klinische Pharmakologie, Pharmakotherapie’ und die‚Klinisch-pathologische Konferenz’ im vierten Studienjahr disziplinübergreifende Veranstaltungendar, ebenso ‚Infektiologie, Immunologie’ im fünften Studienjahr oder das Wahlfach‚Gender in der Medizin’ (Anhang 19). Neben den Pflichtveranstaltungen wird das Unterrichtsangebotin allen Bereichen durch fakultative Veranstaltungen ergänzt. Querschnittsbereichewie Prävention oder Gesundheitsförderung sind im Blockpraktikum Sozialmedizin verankert.Darüber hinaus werden einige Wahlfächer im Bereich Alternativmedizin angeboten(Traditionelle Chinesische Medizin, Naturheilverfahren).11
AUSBILDUNGSPROGRAMMIm 11. und 12. Semester findet das PJ statt, das in universitären Einrichtungen, in akademischenLehrkrankenhäusern und Allgemeinarztpraxen (Anhang 23, Anhang 24) absolviertwerden kann. Die praktische Arbeit in den Kliniken wird durch eine Seminarreihe PJ (Anhang25) ergänzt. Nach dem PJ haben die Studenten den Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfungab<strong>zu</strong>legen. Direkt im Anschluss an die bestandene Prüfung kann die Approbation beantragtwerden.Verknüpfung mit dem GesundheitswesenIm Blockpraktikum Sozialmedizin findet eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteurendes Gesundheitswesens statt, unter anderem mit der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein,dem Gesundheitsamt <strong>Lübeck</strong>, ambulanten Pflegediensten der Caritas oderDiakonie, der Koordinationsstelle für Selbsthilfegruppen, der gesetzlichen und der privatenKrankenversicherung (Anhang 40). Daneben sind wissenschaftliche Aktivitäten <strong>zu</strong> nennen,die das Institut für Sozialmedizin <strong>zu</strong>sammen mit oder im Auftrage von gesetzlichen Krankenversicherungen,der gesetzlichen Rentenversicherung, dem Gesundheitsamt <strong>Lübeck</strong>, derKassenärztlichen Vereinigung und der Ärztekammer Schleswig-Holstein sowie mit unseremSozialministerium durchführt.Das Institut für Arbeitsmedizin gibt durch regelmäßig stattfindende Betriebsbegehungen denStudenten einen Einblick in unterschiedliche Industriebetriebe und dort auftretende betriebsmedizinischeHerausforderungen. In Einzelterminen erhalten Interessierte Einblicke indas berufsgenossenschaftliche Begutachtungsverfahren. Auch auf wissenschaftlichem Gebietwurden Kooperationsprojekte mit Krankenkassen, betriebsärztlichen Betreuungseinrichtungenund dem Sozialministerium durchgeführt, unter anderem ist das Institut zentralerKnotenpunkt im Netzwerk „Gesundheit am Arbeitsplatz - GESA“.Übergangsmodule im letzten StudienjahrDas seit Frühjahr 2006 bestehende Career Center der <strong>Universität</strong> bietet Studenten, Absolventenund <strong>Universität</strong>smitarbeitern Seminare für den leichteren Einstieg in das Berufslebenan. Da<strong>zu</strong> gehören Seminare <strong>zu</strong>r Konfliktbewältigung, <strong>zu</strong>r Bewältigung von Prüfungsangst,<strong>zu</strong>m Trainieren von Bewerbungsgesprächen, <strong>zu</strong>r Selbstpräsentation und <strong>zu</strong>m Erwerb allgemeinerKommunikationskompetenzen. Außerdem haben Studenten die Möglichkeit einesindividuellen Bewerbungscoachings.Da das Curriculum des Medizinstudiums übervoll ist und vor einer Niederlassung in der Praxisoder Leitungsverantwortung in der Klinik eine mehrjährige Weiterbildungszeit liegt, musssehr sorgfältig abgewogen werden, welche Inhalte während der Ausbildung und welche währendder Weiterbildung vermittelt werden.12
AUSBILDUNGSPROGRAMM3.2 Curriculumsmodell und LehrmethodenBei der Umset<strong>zu</strong>ng des Studienplanes setzt die Fakultät auf die herkömmliche Semesterstrukturund ein Hybridmodell aus traditionellen und neuen Formaten. Ganz traditionell wirdder Stoff in Vorlesungen und Kursen eingeführt und in den da<strong>zu</strong>gehörigen Seminaren vertieft.Ergänzt werden diese herkömmlichen Unterrichtsformen durch die neuen Blockpraktika,den Unterricht in den Querschnittfächern und durch die neuen Unterrichtsformen ProblemorientiertesLernen und Repetitorium. Werden neue Unterrichtsmethoden eingeführt, erfolgteine Evaluation der Veranstaltung, bei der die Organisation und der individuelle Lernerfolgder Studenten erfasst werden. Die praktische Umset<strong>zu</strong>ng unserer Ausbildungsziele geschiehtin drei Bereichen:• Im Pflichtcurriculum ziehen sich bei der Ausgestaltung der von der ÄAppO vorgeschriebenenVorlesungen, Kurse und Seminare drei Kernthemen wie ein roter Faden durch diePflichtveranstaltungen mehrerer Studienjahre: Notfallmedizin, Gesprächsführung, KörperlicheUntersuchung. Am weitesten entwickelt ist bisher das Thema Notfallmedizin(Anhang 21). Weitere Kernthemen (<strong>zu</strong>m Beispiel Immunologie) befinden sich in Planung.• Die Medizinische Fakultät erwartet, dass die Mehrheit der Studenten während ihres Medizinstudiumsselbstständig einen Bereich wählt, mit dem sie sich eigenständig und aufhohem Niveau beschäftigen. Dies soll in den ausgewiesenen Bereichen der <strong>Lübeck</strong>erForschung geschehen (Anhang 7). Deswegen hält <strong>Lübeck</strong> an der medizinischen Promotionfest. Zurzeit werden rund 70% der Studenten eines Jahrganges promoviert (Anhang74). Im Rahmen der Dissertation, die durch diverse Doktorandenseminare einzelner klinischerund theoretischer Einrichtungen unterstützt wird, erfolgt die intensive wissenschaftlicheAuseinanderset<strong>zu</strong>ng mit einem ausgewählten medizinischen Thema. Bereits <strong>zu</strong> Beginndes klinischen Studienabschnitts haben die Studenten die Möglichkeit, sich in einemzentralen Doktorandenseminar (Anhang 72) mit allen Aspekten einer Doktorarbeit vertraut<strong>zu</strong> machen. Diese als Ringvorlesung organisierte Veranstaltung wird pro Semestervon rund 120 Studenten besucht und unterstützt die Studenten bei der Themenfindungund den ersten Schritten der praktischen Umset<strong>zu</strong>ng der Arbeit.• Die Fakultät erwartet von ihren Studenten des Weiteren, dass sie sich über ihr Studiumhinaus engagieren. Da<strong>zu</strong> gehören die Teilnahme am Mentorenprogramm der Fakultät(Anhang 43) und die Mitarbeit in den Gremien (Anhang 2). Aber auch das Mitwirken imChor oder Orchester der <strong>Universität</strong>, die Teilnahme am Studium Generale (Anhang 45),dem Literarischen Kolloquium oder der Sonntagsvorlesung (Anhang 46) wird gefördert.Gezielt unterstützt die Fakultät Auslandsaufenthalte ihrer Studenten. So können beispielsweiseLeistungsnachweise <strong>zu</strong> einem früheren Zeitpunkt im Studium erworben wer-13
AUSBILDUNGSPROGRAMMden, als vorgesehen; die im Ausland erworbenen Scheine werden so weit wie möglichanerkannt. Die Medizinische Fakultät ist sich bewusst, dass neben dem formalen Lernenin Lehrveranstaltungen das informelle Lernen durch vielfältige Aktivitäten im sozialen,kulturellen und sportlichen Bereich eine sehr wichtige Rolle spielt. Deswegen fördert die<strong>Lübeck</strong>er Fakultät das Engagement der Studenten für das akademische Leben ihrer <strong>Universität</strong>.Problemorientiertes LernenDie Lehrveranstaltung Klinische Umweltmedizin wird vom Institut für Arbeitsmedizin in Formdes problemorientierten Unterrichts disziplinübergreifend organisiert und in den ersten beidenWochen des klinischen Studienabschnittes durchgeführt (Anhang 39). Vormittags findenjeweils zwei Vorlesungen statt, der Nachmittag ist für Kleingruppenarbeit mit geschulten Tutorenvorgesehen. Aufgabe der Studenten ist es, verschiedene Facetten eines Falles in allgemeinverständlicherForm auf einem Poster dar<strong>zu</strong>stellen und einer Jury <strong>zu</strong> erläutern. Diedrei besten Poster werden prämiert und in der <strong>Universität</strong> ausgestellt. Die Gruppenarbeit,das Poster und die da<strong>zu</strong>gehörige Posterpräsentation werden in die Note des Leistungsnachweiseseinbezogen. Ärzte, die als Tutor am POL Umweltmedizin teilnehmen, werden ineiner Schulung der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik auf diese Tätigkeit vorbereitet(Anhang 49).Als POL-Veranstaltung ist ebenso das POLI-Praktikum ‚Psychiatrie, Psychotherapie undPsychosomatische Medizin’ (Anhang 22) im fünften Studienjahr konzipiert. Damit werden in<strong>Lübeck</strong> alte und bewährte (Vorlesungen, Seminare, Praktika) mit neuen und viel versprechendenUnterrichtsformen (Problemorientiertes Lernen) erfolgreich kombiniert.KompaktunterrichtDas Fach ‚Medizin des Alterns und des alternden Menschen’ wird seit dem WS 06/07 Studentendes fünften Semesters als Blockseminar am Wochenende angeboten. Neben theoretischenEinheiten <strong>zu</strong> Psychiatrie, Geriatrie und Orthopädie haben die Studenten einen Behinderungsparcours<strong>zu</strong> absolvieren. Dabei simulieren sie beispielsweise mit einer Frenzelbrilledie Augenprobleme älterer Menschen, mit Orthesen die Versteifungen der EllbogenundKniegelenke und mit verzerrt dargebotenen Radiosequenzen die Hörprobleme ältererMenschen. Ziel dieser Veranstaltung ist es, neben der Vermittlung von Fachwissen erfahrungsorientiertauf spezifische Probleme älterer Menschen aufmerksam <strong>zu</strong> machen, damitdie angehenden Ärzte mehr Geduld und Verständnis für ältere Menschen aufbringen.14
AUSBILDUNGSPROGRAMMRepetitorienIm Herbst 2006 wurde erstmals ein Repetitorium Innere Medizin als Prüfungsvorbereitung fürden Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung durchgeführt (Anhang 42). In acht Tagen wurdendie prüfungsrelevanten Themen aus allen Teilgebieten der Inneren Medizin wiederholt.Vormittags wurde der Stoff in Vorlesungsform aufgearbeitet, nachmittags in Kleingruppen inForm von Übungen und Fallbesprechungen vertieft. Dieses Repetitorium soll da<strong>zu</strong> beitragen,dass sich die Studenten während des PJ vollständig auf die praktische Arbeit am Krankenbettkonzentrieren und trotzdem ein ausgezeichnetes Examen ablegen.Repetitorien finden auch in anderen Lehrveranstaltungen statt, beispielsweise im Kurs Augenheilkunde,Physik und in Anatomie (Anhang 41). Im Fach Medizinische Psychologie undMedizinische Soziologie fand im SS 06 erstmals ein dreitägiges Repetitorium speziell fürausländische Studenten <strong>zu</strong>r Vorbereitung auf den Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfungstatt. In Kleingruppen wurde intensiv der Gegenstandskatalog von Kasten und Sabel (13.Auflage) und Probeklausuren vom IMPP bearbeitet.Wissenschaftliches ArbeitenDie Medizinische Fakultät ist bestrebt, gezielt den Kontakt ihrer Studenten mit der Wissenschaft<strong>zu</strong> fördern und den Weg dafür <strong>zu</strong> ebnen, dass die <strong>Lübeck</strong>er Studenten im Rahmenihres Studiums wissenschaftliche Arbeiten auf höchstem Niveau anfertigen können. Da<strong>zu</strong>wurde ein Maßnahmenbündel etabliert, das in fünf Punkten <strong>zu</strong>sammengefasst werden kann:• Bereits im 1. Semester wird der Kontakt <strong>zu</strong>r Wissenschaft dadurch gebahnt, dass imRahmen des Mentorenprogramms ein enger Kontakt zwischen dem Studenten und einemWissenschaftler seiner Wahl hergestellt wird (Anhang 43).• In der vorklinischen, aber auch in der klinischen Ausbildung enthält das Pflichtcurriculumgezielt Inhalte, die den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion auf dem jeweiligenGebiet wiedergeben (Anhang 16, Anhang 20).• Die wissenschaftliche Beurteilung von klinischem Vorgehen (Evidenzbasierte Medizin)wird schon in der Vorklinik im Fach ‚Einführung in die Klinische Medizin’ gelehrt und imklinischen Unterricht im ‚Praktikum Sozialmedizin’ weitergeführt (Anhang 27, Anhang 40).• Die entscheidende Rolle in der wissenschaftlichen Ausbildung der Medizinstudentenspielt die Doktorarbeit. Durch eine effektive Organisation des Pflichtcurriculums werdendie dafür benötigten Freiräume bereitgehalten, <strong>zu</strong>m Beispiel durch den Erhalt der Semesterferien.Die Fakultät bietet das Wahlfach „Suchen und Finden einer Doktorarbeit“ an,um da<strong>zu</strong> bei<strong>zu</strong>tragen, dass die <strong>zu</strong>künftigen Doktoranden eine passende Betreuung fin-15
AUSBILDUNGSPROGRAMMden (Anhang 72). Schließlich sorgt die Arbeit der Promotionskommission dafür, dass dasNiveau der <strong>Lübeck</strong>er Dissertation gehalten und weiterentwickelt wird (Anhang 73).• Eine weitere Förderung erfährt die medizinische Doktorarbeit durch das jährliche Auslobenvon zehn Stipendien. Schließlich werden für die besten Promotionen jährlich Preisevergeben (Anhang 66).Befähigung <strong>zu</strong>m lebenslangen LernenUnter dem in der ÄAppO enthaltenen Ziel, dass die Absolventen <strong>zu</strong>r Weiterbildung und <strong>zu</strong>ständiger Fortbildung befähigt sind, wird in <strong>Lübeck</strong> die Befähigung der Studenten <strong>zu</strong>m ‚lebenslangenLernen’ verstanden, also dem formalen und informellen Lernen an verschiedenenLernorten über die gesamte Lebensspanne 7 . In der Lebensphase junger Erwachsener,in der meistens die erste Berufsausbildung erworben wird, spielt vor allem das selbst gesteuerteund eigenverantwortliche Lernen sowie die Nut<strong>zu</strong>ng fremd organisierter Lernangeboteeine entscheidende Rolle.Dem trägt die Medizinische Fakultät <strong>Lübeck</strong> durch den Aufbau ihres Curriculums und durchein breit gefächertes Angebot an Pflicht-Wahlfächern sowohl im vorklinischen als auch imklinischen Studienabschnitt Rechnung. Zusammen mit der für Erstsemester angebotenenLehrveranstaltung ‚Lernen lernen’ (Anhang 38) und mit dem Angebot einer individuellenLernberatung durch Mitarbeiter der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik kann den Studentensomit der Einstieg in das enorme Lernpensum während des Studiums und die Entwicklungeffektiver Lerntechniken erleichtert werden. In den praktischen Studienanteilen (<strong>zu</strong>m BeispielAnatomie am Lebenden, Untersuchungskurs, Blockpraktika, Praktisches Jahr) aber auchdem POL können die Studenten das bis dahin erworbene Fachwissen anwenden. Durch denfrühzeitigen Praxisbe<strong>zu</strong>g werden Wissens- und Fertigkeitslücken erfahrbar – und regen sodas eigenverantwortliche Lernen weiter an.3.3 Curriculumssteuerung und -weiterentwicklungSteuerung des laufenden CurriculumsDas derzeit gültige Curriculum und damit das Studium der Medizin an der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>ist durch die Studienordnung geregelt. Die Studienordnung wurde vom Studiendekanatvorbereitet und anschließend auf Vorschlag des Studienausschusses vom Konvent der MedizinischenFakultät auf seiner Sit<strong>zu</strong>ng am 02. Juni 2003 beschlossen.7 BLK (2004). Strategie für lebenslanges Lernen in der Bundesrepublik Deutschland. Bonn.16
AUSBILDUNGSPROGRAMMZur Steuerung des Curriculums verfügt die Fakultät über mehrere Instrumente. Durch diekontinuierliche Evaluierung aller Pflichtveranstaltungen am Semesterende wird sehr schnelldeutlich, ob die einzelnen Lehrveranstaltungen regelmäßig stattfinden und wie ihre Qualitätvon den Studenten eingeschätzt wird. Bei Lehrveranstaltungen, die nicht regelmäßig stattfandenund/oder <strong>zu</strong> den von den Studenten am schlechtesten bewerteten Veranstaltungengehören, nehmen <strong>zu</strong>nächst Vertreter des Studiendekanats Kontakt mit dem Verantwortlichenauf. Gemeinsam wird versucht, Abhilfe <strong>zu</strong> schaffen. Sehr viele Probleme lassen sich durchkleine, schnell umsetzbare strukturelle Änderungen lösen. Es gibt aber auch Fälle, die ausverschiedenen Gründen auf dieser Ebene nicht <strong>zu</strong> lösen sind. Dann befasst sich der Studienausschussmit dieser Problematik. Wenn auch auf dieser Ebene keine Lösung gefundenwird, kann der Studienausschuss als „ultima ratio“ dem Konvent vorschlagen, sowohl denZeitanteil der Lehrveranstaltung im Curriculum als auch die finanziellen Mittel, die der Institutionfür die Durchführung der Lehre <strong>zu</strong>gewiesen werden, <strong>zu</strong> kürzen.Damit es nicht <strong>zu</strong> derartigen Situationen kommt, unternimmt die Fakultät große Anstrengungen,die didaktischen Fähigkeiten ihrer Hochschullehrer <strong>zu</strong> fördern. Es werden regelmäßigWorkshops von der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik durchgeführt (Anhang 47). Die Fakultätbetont auf vielen Ebenen die Wichtigkeit des Engagements und das Können ihrer Dozentenim Bereich der Lehre. Ausdruck dafür ist beispielsweise die Berücksichtigung der Lehrein der leistungsbezogenen Mittelvergabe. Ebenso wird der Stellenwert der Lehre in Habilitationsverfahrenbetont, die nur dann eröffnet werden, wenn entsprechende Leistungsnachweiseim Lehrbereich vorliegen. Habilitanden der Medizinischen Fakultät wird die Teilnahmean hochschuldidaktischen Weiterbildungsmaßnahmen empfohlen (Anhang 50). Schließlichgehört <strong>zu</strong> einem Berufungsverfahren an der Medizinischen Fakultät auch eine Vorlesung vorStudenten.Fazit: Viele Änderungen des Curriculums sind rein praktischer Natur. So sollte beispielsweiseauf Wunsch der Studenten der Zeitpunkt einer Klausur verlegt oder auf Wunsch einesDozenten ein Vorlesungsplatz getauscht werden. Derartige Anliegen wurden meist ohneSchwierigkeiten gemeinsam mit der Lehrkoordinatorin umgesetzt. Nur selten musste derStudienausschuss damit befasst werden, bisher noch nie der Konvent.Weiterentwicklung des CurriculumsDie Erarbeitung der langfristigen Weiterentwicklung des Curriculums obliegt dem Studienausschuss.Seine Arbeit wird wesentlich durch zwei Analysen gestützt: Die Analyse der „gefühlten“Belastung und die Analyse des Anteils und der Kosten am Gesamtcurriculum.17
AUSBILDUNGSPROGRAMMAnalyse der „gefühlten“ BelastungIn der seit 2001 8 durchgeführten Studienabschnittsbefragung der Studenten nach Beendigungder Vorklinik kristallisierte sich die „gefühlte“ Belastung der Studenten im Verlauf derVorklinik als wesentlicher Parameter <strong>zu</strong>r Steuerung der Studienorganisation heraus. Die „gefühlte“Belastung wird erfasst, indem die Studenten rückblickend die Gesamtbelastung injedem Semester der Vorklinik bewerten (fünfstufige Antwortskala von „keine Belastung“ über„optimale Belastung“ bis „Überlastung“). Der Rücklauf dieser Befragung liegt pro Jahr beietwa 90%.Eines der Hauptergebnisse der ersten Befragung im Herbst 2001 war, dass die Studentensich im dritten und teilweise auch im vierten Semester deutlich überlastet fühlten, im erstenund zweiten Semester dagegen eher unterfordert (Abbildung 1). Damit einher ging ein mäßigesAbschneiden in der Ärztlichen Vorprüfung. Insgesamt belegte <strong>Lübeck</strong> im Herbst 2001Platz 20 unter den 35 Medizinischen Fakultäten (Abbildung 2).Wie beurteilen Sie die Gesamtbelastung in den ersten vier Semestern?1. Semester2. Semester3. Semester4. SemesterÜberlastung 55hohe Belastung 44optimale Belastung 33Mittelwertegeringe Belastung 22keine Belastung 1Herbst 2001Herbst 2002Herbst 2003MesszeitpunktHerbst 2004Herbst 20051Fehlerbalken: +/- 1,00 SDAbbildung 1: Retrospektive Beurteilung der Belastung der Studenten vom 1. bis <strong>zu</strong>m 4. Semester der Vorklinik über einen Verlaufvon fünf Jahren8 Die Fragebögen für den Herbst 2006 sind noch nicht ausgewertet (Stand 23. November 2006).18
AUSBILDUNGSPROGRAMMEin Abgleich mit dem Studienplan des dritten Semesters zeigte, dass der Hauptgrund für dieÜberlastung der Studenten darin lag, dass im dritten Semester, wie an vielen Fakultäten üblich,sowohl der komplette Kursus der Makroskopischen Anatomie als auch die erste Hälfteder Praktika Biochemie und Physiologie stattfanden. Die Dozenten der vorklinischen Fächereinigten sich deswegen im Herbst 2001 dahingehend, den Kursus der MakroskopischenAnatomie und die Seminare im Fach Anatomie vom dritten Semester in das erste und zweiteSemester <strong>zu</strong> verlegen. Damit findet nun im ersten Studienjahr deutlich mehr Unterricht statt(rund 220 Stunden Pflichtlehrveranstaltungen pro Semester) als im zweiten Studienjahr (rund200 Stunden im 3. Semester und 150 Stunden im 4. Semester).1Ärztliche Vorprüfung (IMPP)Rangplätze der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> im Bundesvergleich6Rangplatz1116212631PhysiologieBiochemieAnatomiealle FächerHerbst2001Herbst2002Herbst2003Herbst2004Herbst2005Herbst2006Abbildung 2: Rangplätze der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> in der Ärztlichen Vorprüfung (ab 2006: Erster Abschnitt der Ärztlichen Prüfung)in den Fächern Anatomie, Biochemie und Physiologie sowie in allen Fächern <strong>zu</strong>sammenDiese Verlegung hat bis Herbst 2005 da<strong>zu</strong> geführt, dass die subjektive Belastung im drittenund vierten Semester deutlich <strong>zu</strong>rückgegangen und in den ersten beiden Semestern, in denensich die Studenten <strong>zu</strong>vor unterfordert fühlten, angestiegen ist, so dass jetzt die „gefühlte“Belastung über alle vier Semester der Vorklinik gleichmäßig verteilt ist (Abbildung 1). Damiteinher geht eine signifikant bessere Beurteilung der Studienorganisation (Schulnote 1,8 imHerbst 2005; 3,4 im Herbst 2002). Außerdem hätten 92% der Studenten im Herbst 2005 <strong>Lübeck</strong>wieder als Studienort gewählt (Herbst 2002: 71%). Ebenfalls deutlich verbessert habensich die schriftlichen Leistungen in den „großen“ vorklinischen Fächern. Insgesamt belegte19
AUSBILDUNGSPROGRAMM<strong>Lübeck</strong> im Herbst 2005 Platz fünf unter den 31 Medizinischen Fakultäten (Abbildung 2). Allerdingsmuss hier berücksichtigt werden, dass im Herbst 2005 das erste Mal die Prüfungnach neuer ÄAppO durchgeführt wurde und hier eher die leistungsstarken Studenten (Studentenin Regelstudienzeit) teilnahmen. Das Nachlassen der schriftlichen Prüfungsnoten imHerbst 2006 wird noch einer eingehenden Analyse unterzogen. Eine Korrelationsanalysezeigt zwar, dass die schriftlichen Prüfungsnoten mit der Zufriedenheit der Studienorganisationund der Zufriedenheit mit der vorklinischen Ausbildung insgesamt <strong>zu</strong>sammenhängen,allerdings sind die Verbesserungen in den schriftlichen Prüfungsleistungen sicher nicht nurauf die organisatorischen Veränderungen in der Vorklinik <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>führen.Fazit: Der Parameter der „gefühlten Belastung“ erlaubt das schnelle und einfache Identifizierenjener Strukturen im Curriculum, die verändert werden müssen. Eine gleichmäßige Verteilungder Pflichtstunden im Curriculum der Vorklinik allein ist nicht ausreichend. Zusätzlichmuss der studentische Arbeitsaufwand, der für eine erfolgreich absolvierte Lehrveranstaltungnotwendig ist, berücksichtigt werden. So kann sich bei den Studenten auch bei sehr unterschiedlicherStundenanzahl (220 versus 150) eine optimale Belastung in jedem Semesterder Vorklinik einstellen. Die kontinuierliche Erhebung der „gefühlten Belastung“ ermöglichtes, den Erfolg der getroffenen Maßnahmen langfristig <strong>zu</strong> überprüfen. Damit kann ein Projektden Mitgliedern der Fakultät transparent dargestellt werden. Dies ist die wichtigste Vorausset<strong>zu</strong>ngdafür, dass es von einer großen Mehrheit gemeinsam getragen wird und damit langfristigErfolg hat.Analyse des Anteils und der Kosten der einzelnen Fächer am GesamtcurriculumIm Frühjahr 2006 wurde ermittelt, welchen Anteil jedes Fach am Pflichtcurriculum erbringt.So werden <strong>zu</strong>m Beispiel von dem Unterricht, der in den Semestern fünf bis zehn stattfindet,jeweils 10% von der Chirurgie und 10% von der Inneren Medizin bestritten (Tabelle 2; Spalte„Aufwand pro Fach“). Da auch bekannt ist, wie viele Semesterwochenstunden (SWS) dieeinzelnen Einrichtungen für ihren Unterricht benötigen, kann ausgerechnet werden, wie aufwändigder entsprechende Unterricht für die Fakultät ist und wie sich die einzelnen Institutionenhierin unterscheiden (Tabelle 2; Spalte „Aufwand pro Prozent Gesamtunterricht“).Basierend auf diesen Daten und den aktuellen Evaluationen wird der Studienausschuss imLaufe des Studienjahres 2007 einen Vorschlag <strong>zu</strong>r Weiterentwicklung des bestehenden Curriculumserarbeiten, der dann allen Einrichtungsleitern mit der Bitte um eine Stellungnahme<strong>zu</strong>geleitet wird. Nach einer ausführlichen Diskussion in der gesamten Fakultät wird der Konventhierüber dann abschließend entscheiden.20
AUSBILDUNGSPROGRAMMTabelle 2: Anteil der Fächer am klinischen Unterricht und dafür benötigte Semesterwochenstunden (SWS)FachUnterricht proStudent undFach in derKlinik(in %)Aufwand proFach(in SWS)Aufwand proProzent Gesamtunterricht(in SWS)Chirurgie 9,9 117,2 11,8Innere Medizin 9,9 90,8 9,2Pharmakologie, Toxikologie und KlinischePharmakologie/Pharmakotherapie8,1 20,3 2,5Hygiene, Mikrobiologie, Virologie undInfektiologie, Immunologie7,0 21,1 3,0Kinderheilkunde 6,4 40,4 6,3Pathologie und Klinisch-pathologischeKonferenz6,1 17,6 2,9Frauenheilkunde, Geburtshilfe 5,2 42,2 8,1Anästhesiologie und Notfallmedizin 4,2 50,7 12,4Neurologie 3,7 21,2 5,7Augenheilkunde 3,4 27,2 8,0Psychiatrie und Psychotherapie 3,1 67,6 21,8Allgemeinmedizin 3,0 11,4 3,8Dermatologie, Venerologie 2,9 31,1 10,7Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik 2,7 18,6 6,9Rechtsmedizin 2,6 19,8 7,6Sozialmedizin und Querschnittbereiche 3,10, 12 9 sowie Epidemiologie2,3 19,7 8,6Urologie 2,2 9,9 4,5Medizinische Biometrie 2,0 7,9 4,0Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin 2,0 6,8 3,4Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 1,4 24,5 17,5Humangenetik 1,4 5,4 3,8Radiologie 1,3 12,0 10,0Strahlentherapie und Nuklearmedizin 1,3 11,3 9,4Orthopädie 1,2 6,1 5,1Medizinische Informatik 1,0 1,4 1,4Psychosomatische Medizin und Psychotherapie0,8 1,1 1,4Arbeitsmedizin 0,5 1,0 2,0Lesebeispiel: 9,9% des gesamten Pflichtunterrichts eines Studenten im klinischen Abschnitt entfallenauf das Fach ‚Chirurgie’ (Spalte 1). Für die chirurgischen Kliniken bedeutet die Durchführung diesesUnterrichts für alle Studenten jährlich ein Aufwand von insgesamt 117,2 SWS (Spalte 2). Der Quotientaus dem „Aufwand pro Fach“ und den „Unterricht pro Student und Fach in der Klinik“ gibt an, dass einProzent des gesamten Unterrichts in ‚Chirurgie’ mit einem Aufwand von 11,8 SWS berechnet werdenkann (Spalte 3).9 3 = Gesundheitsökonomie, Gesundheitssystem, Öffentliche Gesundheitspflege. 10 = Prävention, Gesundheitsförderung. 12 =Rehabilitation, Physikalische Medizin, Naturheilverfahren21
STUDENTEN4 STUDENTEN4.1 BewerberDie <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> bemüht sich schon früh um geeignete Studenten für das Medizinstudium.So werden Schüler und potentielle Studienplatzbewerber auf Messen, durch Vorträgein Schulen, durch den Tag der offenen Tür und den <strong>Lübeck</strong>er Hochschultag über dasStudium der Medizin informiert. Eine Umfrage unter den Studenten, die im Herbst 2006 neuan die <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> gekommen sind, hat gezeigt, dass sie auf das Medizinstudiumin <strong>Lübeck</strong> vor allem durch das exzellente Abschneiden der Fakultät in verschiedenen Rankingsaufmerksam geworden sind (Anhang 75, Anhang 76).Die Anzahl der Bewerbungen für einen Studienplatz der Medizin in <strong>Lübeck</strong> ist in den letztenfünf Jahren kontinuierlich angestiegen. So lagen im WS 05/06 insgesamt 7.850 Bewerbungenauf die knapp 180 Studienplätze vor, während es in diesem Jahr (WS 06/07) schon8.666 Bewerbungen waren (Anhang 67).4.2 AuswahlverfahrenUm Medizin in <strong>Lübeck</strong> studieren <strong>zu</strong> können, benötigte man im Verfahren der Abiturbesten imWS 05/06 und im WS 06/07 einen Notendurchschnitt im Abitur von 1,1. Im hochschuleigenenAuswahlverfahren, das die Medizinische Fakultät bisher an die ZVS delegiert hat und dassich auch nach der Abiturnote richtet, hat sich die Situation <strong>zu</strong>gespitzt, denn der benötigteNotendurchschnitt ist von 1,6 auf 1,5 angestiegen. Einerseits ist diese Entwicklung erfreulich,da sie zeigt, wie begehrt ein Studienplatz in <strong>Lübeck</strong> ist. Andererseits ist sie aber auch erschreckend.Denn mit einer Abiturnote, die nur ein Zehntel darunter liegt, muss man im Augenblickacht Semester auf einen Medizinstudienplatz warten. Dies ist eine unhaltbare Situation,denn je nachdem auf welche Schule man geht oder wie gut man sich mit dem Lehrerversteht, ist schnell ein Zehntel gewonnen oder verspielt. Oder, um es wissenschaftlicher <strong>zu</strong>sagen, der Messfehler in diesem System ist viel größer als das Zehntel, das über die Zukunftder Schüler entscheidet.Mit den seit Herbst 2005 gültigen Änderungen im Auswahlverfahren für <strong>zu</strong>lassungsbeschränkteStudiengänge soll den Hochschulen mehr Autonomie bei der Auswahl ihrer Studenten<strong>zu</strong>gestanden werden. Es können nun 60% der Bewerber von den Hochschulen(Hochschulquote) <strong>zu</strong>m Studium <strong>zu</strong>gelassen werden. Dabei ist es den Hochschulen im Rahmender Gesetzgebung des Landes freigestellt, für die Hochschulquote eigene Auswahlverfahren<strong>zu</strong> etablieren oder die Auswahl nach fest<strong>zu</strong>legenden Kriterien weiterhin von der ZVSdurchführen <strong>zu</strong> lassen.22
STUDENTENEine wesentliche Rolle für hochschulinterne Auswahlverfahren spielen Auswahlgespräche, indenen auch Schüler mit einem knapp unter dem Numerus Clausus (NC) liegenden Notendurchschnitteine Chance erhalten - wenn sie sich aufgrund ihres bisherigen Engagementsals geeignet erweisen. Deswegen möchte die Medizinische Fakultät mindestens 60% derMedizinstudenten in einem eigenen Auswahlverfahren <strong>zu</strong>lassen. Da<strong>zu</strong> sollen Auswahlgesprächemit den Kandidaten geführt werden. Dies ist nach dem Hochschul<strong>zu</strong>lassungsgesetz(HZG) in Schleswig-Holstein auch <strong>zu</strong>lässig.Problematisch ist allerdings das hochschuleigene Vorauswahlverfahren, das über die ein<strong>zu</strong>ladendenKandidaten entscheidet. Hier lässt das HZG Schleswig-Holstein nur folgende <strong>zu</strong>berücksichtigende Aspekte <strong>zu</strong>: Die Abiturnote, gewichtete Einzelnoten, fachspezifische Studierfähigkeitstests,Berufsausbildung und Berufstätigkeit, Grad der Ortspräferenz oder eineVerbindung aus allen Aspekten. Die Berücksichtigung des Lebenslaufes oder eines Motivationsschreibensvor der Einladung der Kandidaten - wie bei Stellenbeset<strong>zu</strong>ngen üblich - istnicht möglich. Zum Vergleich: Im Rahmen einer Stellenbeset<strong>zu</strong>ng geht man meistens in zweiSchritten vor. Zunächst werden die Bewerbungsunterlagen gesichtet und vor allem auch aufGrund des Lebenslaufes eine Auswahl der Kandidaten getroffen, die <strong>zu</strong>m Gespräch eingeladenwerden. Im Rahmen des Vorstellungsgespräches erfolgt dann die Festlegung auf denBewerber, der die Stelle erhalten wird. Es ist klar, dass gerade der erste Auswahlschritt vongroßer Bedeutung ist (Auswahl der Kandidaten aufgrund des bisherigen Lebenslaufes/Engagements).Dieser Auswahlschritt wird jedoch vom HZG nicht <strong>zu</strong>gelassen. Dies führtda<strong>zu</strong>, dass, wie auch schon vor der Einführung des hochschulinternen Bewerbungsverfahrens,die „Einserkandidaten“ überwiegen. Die daran anschließenden Auswahlgespräche ander <strong>Universität</strong> sind wenig sinnvoll, da sie viel Arbeit bedeuten, aber durch die Vorauswahlnach Noten nur wenig Auswahl <strong>zu</strong>lassen.Zurzeit werden Gespräche mit dem Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehrgeführt mit dem Ziel, schon für das WS 07/08 ein Auswahlverfahren <strong>zu</strong> konzipieren, das diesenNamen auch verdient. Sobald die gesetzlichen Rahmenbedingungen für das Auswahlverfahrenvorliegen, wird die Fakultät unter Mithilfe der <strong>zu</strong>ständigen Gremien (Studienausschuss,Studiendekanat) das Profil festlegen, das ein Kandidat aufweisen muss, um in <strong>Lübeck</strong>einen Studienplatz <strong>zu</strong> erhalten und das konkrete Verfahren erarbeiten. Ab<strong>zu</strong>sehen istbereits, dass dabei neben der Abiturnote und bisherigen Berufserfahrungen auch soziale undkommunikative Kompetenzen eine Rolle spielen werden.Eine vernünftige, faire und transparente Auswahl der <strong>zu</strong>künftigen Studenten trägt nicht nurda<strong>zu</strong> bei, die angespannte Situation in den Schulen <strong>zu</strong> verbessern, sondern ist auch die Einzelmaßnahme,mit der Exzellenz in Forschung und Lehre an der Medizinischen Fakultät <strong>Lübeck</strong>am nachhaltigsten gesteigert werden kann.23
STUDENTEN4.3 Zulassungszahlen und StudiendauerIn <strong>Lübeck</strong> beginnen jedes Wintersemester etwa 180 Studenten das Studium der Medizin.Der Anteil der Studienanfängerinnen liegt pro Jahr bei durchschnittlich 67%, der der ausländischenStudenten bei 7%. Weniger als 5% der Studenten exmatrikulieren sich im vorklinischenStudienabschnitt, <strong>zu</strong>m Beispiel wegen nicht bestandener Prüfungen (Anhang 68).Rund 85% der Studenten, die in <strong>Lübeck</strong> den ersten Studienabschnitt absolvieren, gehenauch in <strong>Lübeck</strong> in den klinischen Studienabschnitt über. Im klinischen Studienabschnitt verlassenpro Semester durchschnittlich 23 Studenten die Medizinische Fakultät (Anhang 69).Im Jahr 2006 betrug in <strong>Lübeck</strong> die durchschnittliche Studiendauer 14 Semester (Anhang 69).Das liegt 1,5 Semester über der Regelstudienzeit und knapp über dem Bundesschnitt (13,8Semester). Bis <strong>zu</strong>m Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (neue ÄAppO) studierten 2006die <strong>Lübeck</strong>er Studenten 4,9 Semester (Anhang 68). In ihrer Studienzeit fertigten 70% der<strong>Lübeck</strong>er Studenten eine Doktorarbeit an, die etwa 2.000 Arbeitsstunden erforderte 10 .In einer Abfrage des Studierenden-Service-Center bei höheren Semestern im Frühjahr 2006wurden neben der zeitlichen Belastung der Doktorarbeit hauptsächlich folgende Gründe fürdie Verlängerung der Studiendauer genannt: Finanzielle Gründe, schwere chronische Erkrankungen,Elternzeiten und die Betreuung von pflegebedürftigen Familienangehörigen.Werden solche Fälle bekannt, bietet das Studierenden-Service-Center in Zusammenarbeitmit dem Studiendekanat eine Studien- und Berufsberatung an.4.4 FörderungDie <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> ist „klein, aber fein“. Eine der individuellen Stärken dieser kleinenCampusuniversität ist die Förderung der Studenten von Studienbeginn bis <strong>zu</strong>m -abschluss.Neben regelmäßig stattfindenden Beratungsstunden erhalten die Studenten an „potentiellkritischen“ Punkten im Studium (Studienbeginn, Prüfungen, Beginn der klinischen Ausbildung,Beginn des PJ) und beim Erstellen ihrer Promotion besondere Hilfestellung. Darüberhinaus wurde mit dem <strong>Lübeck</strong>er Mentorenprogramm eine Plattform geschaffen, mit der dieKommunikation auf dem Campus und das Engagement der Studenten entscheidend gefördertwerden.10 Weihrauch, M., Strate, J., Pabst, R. (2003). Die medizinische Dissertation – kein Auslaufmodell. Dtsch Med Wochenschr128, 2583-2587.24
STUDENTENBeratungEin großer Teil der Beratung der Medizinstudenten wird von den Mitarbeitern des Studiendekanatsder Medizinischen Fakultät geleistet. Das Studiendekanat wird vom Studiendekangeleitet, der von vier Mitarbeitern unterstützt wird: der Lehrkoordinatorin, der Evaluationsbeauftragten,dem EDV-Koordinator und der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik. Der Studiendekanund die Mitarbeiter des Studiendekanats beraten die Studenten in regelmäßig stattfindendenInformationsveranstaltungen in organisatorischen und fachlichen Studienangelegenheiten(Anhang 34). Da<strong>zu</strong> gehören Informationsveranstaltungen vor Beginn eines neuenStudienabschnittes und die Vorbereitung der Erstsemester auf die Bewältigung des immensenLernpensums durch die Veranstaltung ‚Lernen lernen’ (Umfang: 20 Stunden pro Jahr).Daneben werden vom Studiendekan und von der Lehrkoordinatorin regelmäßig Sprechstundenangeboten (Umfang: 168 Stunden pro Jahr). Zweimal im Jahr findet die Kurseinteilungfür das kommende Semester statt. Erfahrungsgemäß ist in diesem Zeitraum der Beratungsbedarfder Studenten höher. Deswegen bietet die Lehrkoordination <strong>zu</strong>sammen mit demEDV-Koordinator während der Kurseinteilung <strong>zu</strong>sätzliche Sprechstunden an (Umfang: 60Stunden pro Jahr). Der EDV-Koordinator außerhalb der Kurseinteilung, die Arbeitsstelle fürHochschuldidaktik und die Lehrevaluation stehen für Beratungen bei Bedarf <strong>zu</strong>r Verfügung(Nut<strong>zu</strong>ng: 168 Stunden pro Jahr).Studenten, die am Ende eines Studienjahres weniger als zwei Drittel der Leistungsnachweiseerbracht haben, werden <strong>zu</strong> einem obligatorischen Beratungsgespräch <strong>zu</strong>m Studiendekangebeten, in dem sowohl die Ursachen der fehlenden Scheine, die individuellen Ressourcendes Studenten und die mögliche Hilfestellung durch das Studiendekanat erörtert werden.Das gleiche gilt für Studenten, die zweimal eine universitätsinterne Prüfung nicht bestandenhaben. Wird auch im dritten Anlauf diese Prüfung nicht bestanden, muss ein Härtefallantragbeim Studienausschuss gestellt werden. In Einzelfällen wird dann auch ein psychologischesGutachten <strong>zu</strong>r Situation der Studenten eingefordert, welches von der Klinik für Psychiatrieund Psychotherapie oder der Psychologin des Studentenwerks beigebracht werden kann.Seit 2003 führt das Studiendekanat ein- bis zweimal jährlich einen Informationsabend <strong>zu</strong>mThema ‚Praktisches Jahr’ durch. Im November 2006 hat sich erstmals ein Teil der PJ-Beauftragten unserer akademischen Lehrkrankenhäuser persönlich vorgestellt. Diese Präsentationenwerden fortan ein fester Bestandteil des Programms sein.Jedes Jahr <strong>zu</strong> Beginn des Wintersemesters wird von Studenten aus höheren Semestern(Fachschaft und AStA) eine Einführungswoche für die Erstsemester organisiert. In fünf Tagen,die in der Woche vor Vorlesungsbeginn liegen, werden alle für die Vorklinik relevantenFragen behandelt: Vorstellung aller Fächer, Rundgang über den Campus, durch die Biblio-25
STUDENTENthek und Labore, Stadtrallye, Kennenlern-Party (Anhang 29). Im Rahmen dieser Einführungswocheerhalten die Studenten in ihrer Erstsemestertasche unter anderem einen Wegweiserfür alle studienrelevanten Fragen von A wie Ausbildungsförderung bis Z wie Zulassungmit den da<strong>zu</strong>gehörigen Ansprechpartnern (Anhang 30).Die <strong>Universität</strong> stellt diverse Beratungseinrichtungen für studentische Angelegenheiten <strong>zu</strong>rVerfügung. Neben der allgemeinen Beratung <strong>zu</strong> allen Statusfragen bietet das Studierenden-Service-Center Beratung <strong>zu</strong> berufsrelevanten Fragestellungen im Career Center an. Ergänztwird der Service durch die Beratung der Frauenbeauftragten sowie ein umfangreiches Beratungsprogrammdurch das Akademische Auslandsamt.Das Studentenwerk berät in allen Fragen <strong>zu</strong>m BAFöG und Wohnen und ist Ansprechpartnerfür soziale Belange (Allgemeine soziale Fragen, Kindertagesstätten, Psychologische Beratung,Internationales). Studienbegleitend bieten alle in der Lehre involvierten Ärzte Sprechstundenan.StipendienZur finanziellen Förderung von Doktorarbeiten im Bereich der experimentellen Medizin wurde2002 im Dekanat der Medizinischen Fakultät das Stipendienprogramm „Experimentelle Medizin“eingerichtet. Im Herbst 2006 wurde dieses Stipendienprogramm auf Doktorarbeitenaus allen Bereichen der Medizin ausgedehnt und heißt nun „PromotionsstipendienprogrammExzellenz-Medizin“. Von den Stipendiaten wird die regelmäßige Teilnahme an einem fächerübergreifendenund interdisziplinären Doktorandenseminar erwartet.Bewerben können sich Medizinstudenten der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>, die den Ersten Abschnittder Ärztlichen Prüfung erfolgreich absolviert haben und sich im fünften bis achten Fachsemesterbefinden. Auf der Grundlage vorangegangener Studienleistungen, einer ausführlichenProjektskizze, der Begutachtung des Projektes durch einen Hochschullehrer und einesGutachtens vom Mentor wählt eine Kommission, bestehend aus Mitgliedern des Studienausschussesund der Forschungskommission, geeignete Projekte aus. Es werden bis <strong>zu</strong> zehnStipendien pro Jahr vergeben.Gefördert werden die Stipendiaten über einen Zeitraum von höchstens 18 Monaten mit monatlich500 €. Zusätzlich können Reisekosten und ein Sachkosten<strong>zu</strong>schuss bis <strong>zu</strong> jeweils1.000 € übernommen werden. In den Jahren 2003 bis 2006 wurden bei 34 eingereichtenAnträgen 16 Stipendien vergeben.26
STUDENTENMentorenprogramm und ‚Uni im Dialog’Im Rahmen der Studentenbetreuung wurde das <strong>Lübeck</strong>er Mentorenprogramm umstrukturiertund im Sommer 2005 mit einer Veranstaltung in der <strong>Universität</strong>skirche neu gestartet(Anhang 43). Seither haben sich 690 Studenten in 84 Mentorengruppen eingetragen 11 .Schirmherr des Mentorenprogramms ist Björn Engholm, Ministerpräsident a. D. und Vorsitzenderdes Hochschulbeirats der <strong>Universität</strong>. Zur Umstrukturierung des Mentorenprogrammsgehört ein vom EDV-Koordinator entwickeltes datenbankgestütztes Online-Programm. Diesesermöglicht es den Studenten, sich interaktiv für einen Mentor ihrer Wahl <strong>zu</strong> entscheiden.Ziel des <strong>Lübeck</strong>er Mentorenprogramms ist die Stärkung des Dialogs zwischen den Studentenund allen an Lehre und Forschung Beteiligten der <strong>Universität</strong> und des Klinikums. Mit dieserIntensivierung des Dialogs verfolgt die Medizinische Fakultät zwei Ziele:• Förderung jedes einzelnen Studenten in seinem erfolgs- und <strong>zu</strong>kunftsorientierten Fortkommenund damit auf seinem Weg <strong>zu</strong>m exzellenten Arzt und/oder Wissenschaftler.• Weiterentwicklung der <strong>Universität</strong> als akademische Bildungseinrichtung und der CorporateIdentity auf dem Campus.Inhaltlich ist in Anlehnung an die oben genannten Ziele langfristig folgende Entwicklung angestrebt:• Attraktive und wissenschaftlich bedeutsame Jobangebote für Studenten und Absolventenwerden durch den Ausbau von Netzwerken steigen.• Durch eine starke Corporate Identity wird sich der Kreis der Alumni erhöhen und derenKompetenzen an die Uni <strong>zu</strong>rückfließen.• Die Lehre wird durch den Austausch der Mentoren untereinander und den Kontakt zwischenMentoren und Studenten qualitativ optimiert hinsichtlich der Ausdehnung und Abstimmungdes fächerübergreifenden Unterrichts, der Erhöhung der hochschuldidaktischenWeiterbildung und der Entstehung von neuen Lehrangeboten.Das <strong>Lübeck</strong>er Mentorenprogramm wird in seiner Durchführung organisatorisch durch denEinsatz einer im Studiendekanat entwickelten Webplattform unterstützt. Jeder Mentor stelltsich im Internet passwortgeschützt in einem kurzen Profil vor. Diese Profile können von denStudenten eingesehen werden. Je nach Präferenz kann sich jeder Studierende bei einemMentor über das Internet anmelden. Über diese Webplattform kann der Mentor mit den Studenten(und umgekehrt) Kontakt aufnehmen und <strong>zu</strong> den Treffen der Gruppe einladen.Ein weiteres Angebot der Fakultät <strong>zu</strong>r Stärkung des Dialogs auf dem Campus ist die jährlichstattfindende Veranstaltung ‚Uni im Dialog’. Damit wird nicht nur der Dialog innerhalb der11 Stand 23. November 200627
STUDENTEN<strong>Universität</strong> und des Klinikums gestärkt, sondern darüber hinaus soll der Kontakt <strong>zu</strong>r Stadt<strong>Lübeck</strong> mit ihren Vertretern aus Wissenschaft, Politik und Kultur gefördert werden. So hat imFrühjahr 2006 unter dem Titel ‚<strong>Universität</strong> und Rathaus im Dialog’ die zweite Veranstaltungin der <strong>Universität</strong>skirche stattgefunden (Anhang 44). Auch im Jahr 2007 wird diese Veranstaltungfortgeführt.AustauschprogrammeIm Rahmen des Medizinstudiums gibt es in <strong>Lübeck</strong> einen regen Austausch mit dem Ausland.Dabei kommen ausländische Studenten nach <strong>Lübeck</strong> und es gehen <strong>Lübeck</strong>er Studenten füreine Weile ins Ausland.Ausländische Studenten in <strong>Lübeck</strong>Pro Jahr werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen etwa 7% ausländische Studentenfür den Studiengang Medizin immatrikuliert (Anhang 68). Sie kommen hauptsächlichaus Norwegen und China, daneben aus über 50 weiteren Ländern (Tabelle 3).Tabelle 3: Die häufigsten Herkunftsländer der ausländischen Studenten in <strong>Lübeck</strong>Herkunftsländer derausländischen Studentenim Studienjahr 2006Herkunftsländer derausländischen Studentenim Studienjahr 2007LandNorwegen 26 16China 13 14Bulgarien 9 8Israel 10 8Kamerun 8 8Türkei 9 8Im Rahmen des Sokrates/Erasmus-Programms wurden im Studienjahr 2006 insgesamt 22Plätze für Medizinstudenten aus dem Ausland <strong>zu</strong>r Verfügung gestellt. Davon wurden nurzwei Plätze genutzt. Daneben besteht für ausländische Studenten die Möglichkeit, im Rahmender Direktpartnerschaften einen Teil ihres Studiums in <strong>Lübeck</strong> <strong>zu</strong> verbringen. Im Studienjahr2006 standen dafür insgesamt 14 Plätze <strong>zu</strong>r Verfügung, neun davon wurden genutzt(Anhang 63).Dies weist darauf hin, dass international noch nicht bekannt genug ist, wie ausgezeichnetman in <strong>Lübeck</strong> Medizin studieren kann. Bestehen hingegen persönliche Beziehungen, ist eskeine Schwierigkeit, ausländische Studenten für <strong>Lübeck</strong> <strong>zu</strong> begeistern.28
STUDENTEN<strong>Lübeck</strong>er Studenten im Ausland<strong>Lübeck</strong>er Medizinstudenten können im Rahmen der Austauschprogramme Teile ihres Studiumsim Ausland verbringen. Dabei standen im Jahr 2006 über das Sokrates/Erasmus-Programm insgesamt 23 Plätze <strong>zu</strong>r Verfügung, davon wurden 21 genutzt. Im Rahmen derDirektpartnerschaften standen 10 bereit, davon wurden alle genutzt (Anhang 64).Die Austauschaktivitäten werden vom Akademischen Auslandsamt der <strong>Universität</strong> organisiertund es betreut die ausländischen Studenten. Da<strong>zu</strong> verfügt es über einen Etat von etwa100.000 € pro Jahr, wovon die Hälfte über Drittmittel eingeworben wird.Neben diesen Austauschprogrammen haben die Studenten die Möglichkeit, selbst organisierteTeile der Famulatur oder des Praktischen Jahres im Ausland <strong>zu</strong> verbringen. In denJahren 2004 bis 2006 leisteten 59 Studenten einen Teil ihrer Famulatur im Ausland ab, wobeieinige Studenten mehrfach im Ausland waren. Insgesamt wurden 332 Famulatur-Wochen im Ausland verbracht (Anhang 64). Beliebtestes Land war Norwegen.Die meisten Auslandsaufenthalte erfolgen im Rahmen des Praktischen Jahres (PJ). Für dasJahr 2005 wurden 56 Anträge genehmigt, ein Tertial des PJ im Ausland <strong>zu</strong> verbringen, imJahr 2006 waren es 53 Anträge. Es ist auch möglich, zwei Tertiale im Ausland <strong>zu</strong> verbringen.Da<strong>zu</strong> muss ein Antrag an den Studiendekan gestellt werden, der detailliert darlegt, warumdieses Vorgehen für den beruflichen Weg notwendig ist. Zusammen mit dem Fachvertretervor Ort und dem Landesprüfungsamt wird dann über den Antrag entschieden. Etwa 5% der<strong>Lübeck</strong>er Studenten machen von dieser Möglichkeit Gebrauch.Insgesamt verbringen also pro Jahr etwa 25 <strong>Lübeck</strong>er Medizinstudenten über das Sokrates/Erasmus-Programmund Direktpartnerschaften, ungefähr 25 Studenten innerhalb ihrerFamulatur und etwa 50 Studenten im Rahmen des PJ einen Teil ihres Studiums im Ausland.Über einen Zeitraum von vier Jahr betrachtet, kann man aus den vorliegenden Daten schließen,dass 55% der <strong>Lübeck</strong>er Medizinstudenten im Rahmen ihres Studiums Erfahrung imAusland sammeln.4.5 EngagementDie <strong>Lübeck</strong>er Fakultät legt großen Wert auf Engagement und Beteiligung der Studenten,<strong>zu</strong>m Beispiel an der akademischen Selbstverwaltung. An der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> bringtsich die studentische Vertretung – Fachschaften und AStA – aktiv in alle Gremien der akademischenSelbstverwaltung ein (Anhang 3).Darüber hinaus gibt es zwischen der studentischen Vertretung und dem Studiendekanat einenregelmäßigen Austausch. Die Studenten werden einbezogen, wenn es um strukturelle29
STUDENTENVeränderungen und die Evaluation des Unterrichts geht. Beispielsweise wurde aufgrund studentischerAnregungen der Teilschein Medizinische Biometrie vom dritten auf das fünfteStudienjahr verlegt. Über die zentrale Semesterevaluation haben die Studenten außerdemdirekten Einfluss auf die leistungsbezogene Mittelvergabe der Fakultät.In <strong>Lübeck</strong> werden die Studenten auch in die Öffentlichkeitsarbeit der <strong>Universität</strong> eingebunden.Beispielsweise wurde bei der im Jahr 2005 durchgeführten Werbekampagne „Ich studierein <strong>Lübeck</strong>, weil…“ <strong>zu</strong>sammen mit einer <strong>Lübeck</strong>er Werbeagentur 12 ein Postkartensetentworfen. Auf den Postkarten sind <strong>Lübeck</strong>er Medizinstudenten mit der Begründung ihrerStudienortwahl abgebildet. Diese Postkarten wurden von den <strong>Lübeck</strong>er Studenten gezielt inder Studienplatzbewerbungsphase an ihren „Heimat-Gymnasien“ verteilt. Die Studenten, diesich an dieser Werbekampagne beteiligten, wurden auf der Veranstaltung ‚Uni im Dialog2005’ ausgezeichnet. Eine der sechs Postkarten ist nachfolgend abgebildet 13 .Die <strong>Lübeck</strong>er Studenten engagieren sich aktiv politisch und unterstützen damit die Entwicklungder Hochschule. Ein Beispiel hierfür ist die Initiative des AStA „<strong>Lübeck</strong> kämpft für seineUni“. Diese Initiative ist als Reaktion auf das Eckpunktepapier des schleswig-holsteinischenWissenschaftsministers Dietrich Austermann aus den Studentenvertretungen der <strong>Universität</strong>hervorgegangen und kämpft für den Erhalt der Unabhängigkeit der <strong>Lübeck</strong>er <strong>Universität</strong>. DieMitglieder dieser Initiative wurden 2006 auf der Veranstaltung ‚Uni im Dialog’ mit dem Preisfür besonderes studentisches Engagement geehrt (Anhang 66).12Dr. Walter Hollender, mzz - Mittel <strong>zu</strong>m Zweck, Agentur für Markenphilosophie,-inszenierung und Kommunikation, Willy-Brandt-Allee 31a, Media Docks, 23554 <strong>Lübeck</strong> und Norbert Weidemann, Fotograf, Holsteinischer Kamp 104, 22081 Hamburg13 Die restlichen Postkarten sind auf der Internetseite des Studiendekanats <strong>zu</strong> finden: http://www.medizin.uniluebeck.de/index.php?c_id=76&n_id=6530
DOZENTEN5 DOZENTEN5.1 Personelle RahmenbedingungenZahlenverhältnis Studenten - DozentenAn der Lehre im Studiengang Medizin sind 46 Einrichtungen der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> beteiligt.Insgesamt sind an diesen Einrichtungen 76 Professoren und rund 677 wissenschaftlicheVollkräfte beschäftigt (Anhang 59). Bei 76 am Medizinstudium beteiligen Professoren undderzeit 1.472 eingeschriebenen Studenten der Medizin beträgt das formale Betreuungsverhältnis1 <strong>zu</strong> 19. Im Studienjahr 2006 wurden <strong>zu</strong>sätzlich 24 Lehraufträge vergeben (Anhang12). Schwerpunkt dabei ist die Sprachförderung (Fremdsprachen, Deutsch für Ausländer).Je nach Einrichtung sind die wissenschaftlichen Vollkräfte in unterschiedlichem Maße anForschung, Lehre und Krankenversorgung beteiligt. In den Instituten der Vorklinik sind allewissenschaftlichen Mitarbeiter entsprechend ihres Lehrdeputates an der Lehre beteiligt. Inden Kliniken und klinisch-theoretischen Instituten kann die Beteiligung der Ärzte an der Lehreüber zwei verschiedene Wege abgebildet werden: Zurzeit ist für jedes Institut ein normativerWert festgelegt, der den Anteil des wissenschaftlichen Personals auf Haushaltsstellen (ohneÜberstunden und Drittmittelpersonal) angibt, von dem angenommen wird, dass er Vollzeit fürZwecke von Forschung und Lehre <strong>zu</strong>r Verfügung steht. Die Werte gehen von 20% für operativ/chirurgisch ausgerichtete Einrichtungen bis <strong>zu</strong> 100% für theoretische Einrichtungen. InZukunft wird im Rahmen der Trennungsrechnung aufgrund der real geleisteten Lehre dieAnzahl der tatsächlich notwendigen wissenschaftlichen Vollkräfte pro Einrichtung bestimmt.PrüfungstätigkeitMit der neuen ÄAppO ist nicht nur die Lehrbelastung erheblich gestiegen (in der Vorklinikvon 630 auf 784 Stunden), auch die Belastung der Einrichtungen durch Prüfungen hat sichverdoppelt. Nach alter ÄAppO wurden die Studenten in zwei Fächern jeweils in Vierergruppenvon zwei Dozenten maximal drei Stunden geprüft (bei 50 Gruppen 300 Dozentenstunden).Nach neuer ÄAppO werden die Studenten in drei Fächern jeweils in Vierergruppenmaximal vier Stunden von drei Dozenten geprüft (bei 50 Gruppen 600 Dozentenstunden).Auch im klinischen Abschnitt hat sich der Prüfungsaufwand mit der neuen ÄAppO verändert.Zwar entfällt ein Examen, dafür aber erhöht sich der Aufwand für Organisation und Durchführungdes Abschlussexamens nach dem Praktischen Jahr. In diesem Herbst hat erstmalig derZweite Abschnitt der Ärztlichen Prüfung in seiner neuen Form stattgefunden. Der mündlichpraktischeTeil hat sich von einem auf zwei Tage verdoppelt. Abgesehen vom zeitlichenMehraufwand für Prüfer und Prüflinge wird diese Umstrukturierung von den Studenten als31
DOZENTENeine große psychische Belastung empfunden. Endgültige Ergebnisse <strong>zu</strong>m schriftlichen Teildes neuen Zweiten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung liegen <strong>zu</strong>m jetzigen Zeitpunkt nochnicht vor. Ersten Angaben des IMPP und der Studenten <strong>zu</strong>folge wurde das Examen alsschwierig und in Abschnitten nicht vergleichbar mit früheren Examina empfunden.5.2 Förderung des wissenschaftlichen NachwuchsesFür die Medizinische Fakultät stellt die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses dielogische Fortset<strong>zu</strong>ng der wissenschaftlichen Ausbildung der Medizinstudenten dar. Hier<strong>zu</strong>hat sie Fördermaßnahmen für die Bereiche Lehre und Forschung etabliert.Im Bereich LehreAllen Lehrenden der <strong>Universität</strong> steht <strong>zu</strong>r Verbesserung ihrer Lehrfähigkeit das Curriculumder Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik <strong>zu</strong>r Verfügung. Neben dem von der Arbeitsgemeinschaftfür Hochschuldidaktik akkreditierten Grundmodul mit neun Workshops werden weiterefünf Workshops <strong>zu</strong> diversen Themen angeboten (Anhang 47). Im Jahr 2006 wurden bislangsechs Workshops mit durchschnittlich 13 Teilnehmern durchgeführt (Anhang 48). Die Arbeitsstellefür Hochschuldidaktik unterstützt die Dozenten auch beim Einsatz des Mobi-TED ® -Systems, mit dem schnell und direkt Befragungen und Tests im Hörsaal durchgeführtwerden können. Die Ergebnisse stehen dem Dozenten sofort <strong>zu</strong>r Verfügung. Auch beim Einsatzdes im Studiendekanat entwickelten Programms <strong>zu</strong>r Generierung und Auswertung vonMultiple-Choice-Fragebögen kann die Hilfestellung der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik inAnspruch genommen werden.Für die Etablierung des Problemorientierten Lernens (POL) werden Tutoren benötigt, diediese Methode kennen gelernt haben. Wissenschaftliche Mitarbeiter und Studenten werdenspeziell geschult, um POL-Gruppen leiten <strong>zu</strong> können (Anhang 49). Einrichtungen werden beider Formulierung von Lehrzielen unterstützt (Anhang 10).Habilitanden haben die Möglichkeit, sich in ‚Crash-Kursen’ auf die künftige Lehre inWorkshops und durch individuelles Coaching vor<strong>zu</strong>bereiten. Der Habilitationsausschussempfiehlt die Teilnahme an mindestens drei hochschuldidaktischen Seminaren und die Inanspruchnahmedes Beratungsangebotes der Hochschuldidaktik (Anhang 50). Außerdem engagiertsich die Fakultät in der Förderung der Lehrenden auch dadurch, dass sie Anträge <strong>zu</strong>rFörderung der Lehre, genauso wie die <strong>zu</strong>r Forschung, begutachtet und im Falle der BewilligungMittel <strong>zu</strong>r Verfügung stellt (Anhang 51). Seit 2006 wird ein Mitglied der MedizinischenFakultät ideell, organisatorisch und finanziell beim Erwerb des ‚Master of Medical Education’unterstützt (Anhang 53).32
DOZENTENIm Bereich ForschungWissenschaftler, die jünger als 34 Jahre sind, können im Rahmen der fakultätsinternen „Anschubförderung“Mittel von bis <strong>zu</strong> 37.500 € für ihre Projekte beantragen (Anhang 52). Füralle Wissenschaftler besteht die Möglichkeit, im Rahmen eines der von der Fakultät gefördertenSchwerpunktprogramme Förderanträge <strong>zu</strong> stellen (Anhang 7).Für Wissenschaftlerinnen mit Kindern hält die Fakultät Mittel bereit, um sicher<strong>zu</strong>stellen, dasseine bereits fortgeschrittene Habilitationsarbeit auch auf hohem Niveau fertig gestellt werdenkann (Anhang 52). Schließlich zeichnet die Fakultät auch exzellente Arbeiten ihrer jungenWissenschaftler mit attraktiven Preisen aus.5.3 Anreizsystem für Forschung und LehreLeistungsbezogene MittelvergabeEngagement in Forschung und Lehre beruht in <strong>Lübeck</strong> nicht nur auf dem Interesse der Dozentenund Studenten, sondern wird auch strukturell gefördert. Zur ex-post-Anerkennung vonLeistungen in Forschung und Lehre wird seit 2001 die leistungsbezogene Mittelvergabedurchgeführt (Abbildung 3), die auf wissenschaftsbezogenen Parametern basiert:• Publikationen (Originalien mit/ohne Impact-Faktor, Beiträge in Lehr- und Handbüchern,Herausgebertätigkeiten)• Drittmittel (verausgabte, gewichtete Drittmittel)• Nachwuchsförderung (Dissertation und Habilitationen (inkl. Frauenförderung), Stipendien,Nachwuchspreise, Rufe)• Transferleistungen (Ämter an der <strong>Universität</strong>/UK S-H, Ämter (inter-) national, Kongresse,Veranstaltungen, Patente)• seit 2004 Lehre (Evaluation, Zusatzengagement in der Lehre, Lehrbelastung).Im Jahr 2005 wurden hierfür 1,6 Millionen Euro (4,8% des Landes<strong>zu</strong>schusses) ausgeschüttet,2006 waren es 1,7 Millionen Euro (5,5%). Für das Jahr 2007 sind 3 Millionen Euro (9%)vorgesehen. Jede Säule wird <strong>zu</strong>rzeit mit 20% gewichtet.In die Säule ‚Lehre’ gehen mit jeweils einem Drittel quantitative und qualitative Kriterien derLehrleistung ein: Evaluation der Lehrveranstaltungen durch die Studenten, Zusatzengagementder Institutionen im Bereich Lehre (<strong>zu</strong>m Beispiel Erstellung von Lehrzielkatalogen, Teilnahmeder Dozenten an hochschuldidaktischen Weiterbildungsmaßnahmen oder am disziplinübergreifendenPOL Klinische Umweltmedizin) sowie die Lehrbelastung der Einrichtungen.33
DOZENTENLeistungsbezogene Mittelvergabe der Medizinischen FakultätPublikationen20%Drittmittel20%Nachwuchsförderung20%Transferleistungen20%Lehre20%Evaluation der Lehrveranstaltungen (33%)Zusatzengagement in der Lehre (33%)Lehrbelastung (33%)Abbildung 3: Leistungsbezogene Mittelvergabe der Medizinischen Fakultät <strong>Lübeck</strong>, 20% der leistungsbezogenen Mittelvergabegehen in den Bereich LehreIn jedem dieser drei Bereiche werden institutionsbezogen drei Gruppen gebildet (Spitzen-,Mittel- und Schlussgruppe). Je nach Gruppen<strong>zu</strong>gehörigkeit werden an die Institutionen 8, 4,oder 0 Punkte vergeben. Am Schluss werden für jede Einrichtung die erreichten Punkte aufsummiert(maximal 24). In Abhängigkeit von der Gesamtpunktzahl aller Einrichtungen undder <strong>zu</strong>r Verfügung stehenden Summe ist jeder Punkt einen bestimmten Betrag wert. Je nacherreichter Punktzahl werden den Einrichtungen Gelder <strong>zu</strong>gewiesen. Im Studienjahr 2004wurden für die Lehre im Rahmen der LbMV 300.000 € an 37 Institute und Kliniken für Leistungenin der Lehre vergeben (Anhang 60). Die einzelnen Institutionen erhielten zwischen 0und 16.000 €. Im Studienjahr 2005 wurden 330.000 € im Rahmen der LbMV vergeben(Anhang 61).LehrpreisGute Lehre wird in <strong>Lübeck</strong> auch öffentlich anerkannt. Da<strong>zu</strong> wurde im Studienjahr 2004 erstmalsder Lehrpreis für hervorragende Lehre vergeben. Der Preisträger wird im Rahmen derzentralen Semesterevaluation ermittelt, in der die Studenten um entsprechende Vorschlägegebeten werden. Es gewinnt der Dozent mit den meisten Nennungen im Studienjahr. DerPreisträger wird auf den Internetseiten des Studiendekanats bekannt gegeben und auf derim Frühjahr stattfindenden Promotionsfeier ausgezeichnet. Finanzielle Mittel sind mit demPreis (bislang) nicht verbunden. Die bisherigen Preisträger sind Anhang 66 <strong>zu</strong> entnehmen.34
RESSOURCEN6 RESSOURCEN6.1 Lehrbudget und Mittel<strong>zu</strong>weisungFür <strong>Lübeck</strong> betrug der Landes<strong>zu</strong>schuss für Forschung und Lehre (FuL) 2006 insgesamt33.149.900 €, der gemäß Konventsbeschluss vom 07. November 2005 folgendermaßen verteiltwerden soll:Basisausstattung (21 Millionen Euro)Diese dient der Finanzierung der Grundausstattung (Personal und Sachmittel) für FuL. In derBasisausstattung für Forschung und Lehre sind für jede Einrichtung ein C4-Professor (Lehrdeputat6 SWS), ein wissenschaftlicher Assistent (6 SWS), ein Medizinisch-Technischer Assistent,ein Sekretär und Sachmittel enthalten (Gesamtsumme Basisausstattung pro Einrichtung:306.000 €). Obliegt der Einrichtung mehr als 12 SWS Lehre pro Jahr, so werden <strong>zu</strong>sätzlicheGelder für Personal und Sachmittel <strong>zu</strong>r Verfügung gestellt.Gemeinkostenumlage (3,3 Millionen Euro)Diese Mittel dienen <strong>zu</strong>r Finanzierung der Inanspruchnahme von Infrastruktur des UK S-H(Personalwesen, Drittmittelverwaltung, Facilitymanagement, technischer Dienst, Reinigung,sonstige Verwaltung und Dienstleistungen durch Vorgänge, die rein durch Forschungs- undLehrtätigkeit verursacht werden). Für die Zukunft wird zwischen dem Dekan der MedizinischenFakultät und dem Vorstand des Klinikums ein pauschaler Betrag von 12% des Landes<strong>zu</strong>schussesFuL vereinbart.Besondere Forschungs- und Lehrvorhaben (4,8 Millionen Euro)Diese Mittel werden gemäß §126, Abs. 3, Satz 7 HSG SH für die interne Forschungsförderung(Schwerpunkte, Anschub- und Auslauffinanzierungen, Stipendienprogramme), für dieFörderung der Lehre (Evaluation, Hochschuldidaktik), die Abdeckung von Verpflichtungenaus Berufungs- und Bleibeverhandlungen sowie für die Finanzierung der für die Wissenschaftsadministrationnotwendigen personellen und sachlichen Ausstattung der Fakultät eingesetzt.Leistungsorientierte Mittelvergabe (4 Millionen Euro)Diese setzt sich aus fünf Säulen <strong>zu</strong>sammen: Publikationen, Drittmittel, Nachwuchsförderung,Transferleistungen und Lehre. Alle fünf Säulen gehen mit dem gleichen Gewicht in die Berechnungein (Abbildung 3, S. 35).35
RESSOURCEN6.2 Einrichtungen für die theoretische AusbildungInsgesamt steht der <strong>Universität</strong> für Forschung und Lehre eine Fläche von 14.811 m 2 <strong>zu</strong>r Verfügung.Bei <strong>zu</strong>rzeit 1.472 Studenten der Medizin stehen damit für jeden Studenten rund 10m 2bereit. In der Gesamtfläche sind 16 Hörsäle mit insgesamt 1.628 Plätzen enthalten (Anhang65). Derzeit wird auf dem Campus ein neues Audimax für die <strong>Universität</strong> und die Fachhochschule<strong>Lübeck</strong> <strong>zu</strong>r Erweiterung der Hörsaal- und Seminarraumkapazitäten errichtet. Es entstehenvier Hörsäle mit insgesamt 1.042 Sitzplätzen, drei Seminarräume (insgesamt 180Plätze) und ein Klausurenraum (80 Plätze). Das Gebäude wird voraussichtlich <strong>zu</strong>m SS 08 inBetrieb genommen. Eine bauliche Erweiterung der Vorklinik ist bei der Hochschulleitung inPlanung.6.3 Einrichtungen für die klinische AusbildungDas <strong>Universität</strong>sklinikum Schleswig-Holstein (UK S-H) ist ein Krankenhaus der Maximalversorgung,das alle von der ÄAppO geforderten Ausbildungsbereiche vor Ort abdeckt. Im Jahr2005 standen für die rund 1.200 Betten in <strong>Lübeck</strong> 647 Patientenzimmer in einer Gesamtgebäudeflächevon 178.000 m2 <strong>zu</strong>r Verfügung. Es wurden rund 44.000 Fälle stationär und rund4.500 Fälle teilstationär behandelt. Die durchschnittliche stationäre Verweildauer lag bei 8,46Tagen.Neben der Nut<strong>zu</strong>ng der modernen Ausstattung in den Kliniken und Laboratorien steht denStudenten im Bereich der Notfallmedizin <strong>zu</strong>sätzliches ausbildungstechnisches Gerät <strong>zu</strong>r Verfügung:Der <strong>Lübeck</strong>er Anästhesie- und Reanimationssimulator (LARS) ermöglicht die Simulationvon medizinischen Notfällen, Narkosen und Narkosezwischenfällen. Er ist in diePflichtveranstaltungen eingebunden und kann auch für <strong>zu</strong>sätzliches Training genutzt werden.Die Kooperation mit dem Masterstudiengang Biomedical Engineering an der Fachhochschule<strong>Lübeck</strong> bietet eine vorteilhafte Anbindung an die neuesten medizintechnischen Entwicklungen,von denen Forschung und Lehre profitieren.Die außeruniversitären Einrichtungen, die an der Ausbildung beteiligt sind – Lehrkrankenhäuserund Lehrpraxen für Allgemeinmedizin (Anhang 24) – erfüllen ebenfalls die Anforderungender ÄAppO. Vor Vertragsschluss hat eine Kommission der Medizinischen Fakultät<strong>zu</strong>sammen mit einem Studenten alle Einrichtungen besucht und sich von Ausstattung undfachlicher Ausrichtung überzeugt. Es sind Vereinbarungen geschlossen worden, die dieDurchführung des Unterrichts gemäß ÄAppO gewährleisten. Die PJ-Beauftragten der Krankenhäuserund Praxen stehen mit den entsprechenden Kliniken aus dem UK S-H und demStudiendekanat in regelmäßigem Austausch, um die Ausbildung an das Curriculum an<strong>zu</strong>-36
RESSOURCENpassen und gemeinsam weiter<strong>zu</strong>entwickeln. Die Evaluation des PJ (Anhang 57) unterstütztdie Qualitätssicherung der Kooperationspartner, die auch in Informationsveranstaltungen fürStudenten eingebunden werden.Auch <strong>zu</strong>künftig wird die Medizinische Fakultät Projekte, die der Weiterentwicklung der Lehrein den Lehrkrankenhäusern und -praxen dienen, mit Hilfe des PJ-Etats finanziell unterstützen.Für die Organisation des PJ verfügt die Medizinische Fakultät über einen Etat von330.000 € für das Jahr 2006 14 . Zurzeit werden daraus finanziert:• Jeweils eine halbe BAT-IIa Stelle für die Koordination der chirurgischen Kliniken und derKliniken für Innere Medizin.• Verschiedene Ausbildungsprojekte für das PJ in den allgemeinmedizinischen Praxen.• Ab Dezember 2006 eine Sachbearbeiterstelle (BAT VIb) im Dekanat <strong>zu</strong>r Unterstüt<strong>zu</strong>ngder PJ-Einteilung und Kooperation mit den Lehrkrankenhäusern und allgemeinmedizinischenPraxen.6.4 BibliothekDie Zentrale Hochschulbibliothek (ZHB) befindet sich auf dem Campus der <strong>Universität</strong> undbeherbergt Bücher und Zeitschriften der <strong>Universität</strong> und der Fachhochschule <strong>Lübeck</strong>. ImJahr 2005 waren insgesamt 441.250 bibliographische Einheiten vorhanden, davon 208.140Bücher, ca. 106.000 Mikrofiche (überwiegend Dissertationen) und 463 Zeitschriften. Darüberhinaus hielt die Bibliothek 1.137 Online-Zeitschriften <strong>zu</strong>r Nut<strong>zu</strong>ng vor (Anhang 62). Genutztwurde die Bibliothek im Jahr 2005 von insgesamt 6.443 Lesern, darunter 2.280 Studentenund 624 wissenschaftliche Mitarbeiter der <strong>Universität</strong>. Außerdem wird die Bibliothek von Studentenund Mitarbeitern der Fachhochschule und einigen auswärtigen Lesern frequentiert.Der Etat für das Jahr 2005 betrug ohne Sondermittel 511.300 € (Anhang 62). Davon wurdenrund 420.000 € für Erwerbungen der <strong>Universität</strong> verwendet, der Rest für die Fachhochschule.Der größte Anteil des <strong>Universität</strong>setats wurde <strong>zu</strong>r Finanzierung von Zeitschriften genutzt(rund 380.000 €), etwa 40.000 € für Bücher. Bei einem Durchschnittspreis von 60 € pro Buchreichte diese Summe <strong>zu</strong>m Kauf von 670 Exemplaren. Problematisch sind insbesondere diejährlich steigenden Kosten für elektronische Zeitschriften bei gleich bleibendem Etat. Dasführt zwangsläufig <strong>zu</strong> einer geringeren Investition im Lehrbuchbereich. Die un<strong>zu</strong>reichendeBestückung der Bibliothek insbesondere mit aktuellen Lehrbüchern ist aus Sicht der Studentendie größte Schwäche der Bibliothek. Durch eine Sonder<strong>zu</strong>weisung aus dem Programm14 Zuwendungsbescheid vom Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr vom 02.01.2006; Punkt 1.4 Zuschuss fürAufwendungen für die praktische Ausbildung in Akademischen Lehrkrankenhäusern und Lehrpraxen: für nichtinvestive Aufwendungen:304.400 €, für Investitionen 25.500 €.37
RESSOURCEN<strong>zu</strong>r Modernisierung der Hochschulbibliotheken im Rahmen des Schleswig-Holstein-Fondserhielt die ZHB 2005 <strong>zu</strong>sätzlich 70.249 €. Dafür wurden weitere 1.258 Bücher erworben.Im Gebäude verteilt befinden sich insgesamt 197 Arbeitsplätze, weiterhin zwei Gruppenarbeitsräumemit 12 und 24 Plätzen, ein Stillarbeitsraum mit 10 Plätzen und 20 Arbeitskabinen.Außerdem ist in der Bibliothek ein Rechnerpool mit 20 Computern untergebracht, allerdingsohne Druckerstation. Aus Sicht der Studenten ist eine Vergrößerung des Rechnerpools miteiner Druckmöglichkeit wünschenswert. Die auf dem Campus bereits vorhandenen Hot-Spots sollen ausgebaut werden, so dass die Studenten mit W-LAN vom gesamten Campusgeländeins Internet können. Unklar ist <strong>zu</strong>rzeit die Frage der technischen Betreuung derRechner, dies wird <strong>zu</strong>rzeit auf Rektoratsebene geklärt.Die Bibliothek wird intensiv von Lerngruppen genutzt. Positiv hervor<strong>zu</strong>heben ist außerdemdie leichte und luftige Architektur, die viel Licht ins Gebäude lässt. Gerade diese Architekturist jedoch gleichzeitig eine Schwachstelle der Hochschulbibliothek. Ohne Trennwände breitetsich der Schall ungehindert im Gebäude aus. Stilles Arbeiten ist somit selbst in den Arbeitskabinennicht möglich, da diese nach oben hin offen sind. Das Gebäude selbst ist nicht klimatisiertund wird im Winter als <strong>zu</strong> kalt und im Sommer als <strong>zu</strong> heiß befunden. Für das imJahr 1977 erbaute Gebäude plant die <strong>Universität</strong>, das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaftund Verkehr in Kiel und das Landesbauamt eine bauliche Modernisierung. Die Planungendafür sind noch nicht abgeschlossen. Im Jahr 2007 wird <strong>zu</strong>nächst das Büchermagazinim Keller erweitert, in dem dann Bücher aus der Fachhochschule und aus dem Magazindes ersten Stocks der Bibliothek aufgenommen werden. Der frei werdende Platz im erstenStock wird für ein Freihandmagazin und voraussichtlich fünf weitere Arbeitskabinen genutzt.Im Gespräch ist weiterhin die Abtrennung des gesamten Eingangs- und Thekenbereichs vomübrigen Bibliothekbereich mit Glaswänden, so dass in der Bibliothek auch stilles Arbeitenmöglich ist. Aus diesem Grund sollen auch die Arbeitskabinen überdacht werden. Weiterhinsollen eventuell das Dach und ein Teil der Fenster saniert werden und es soll ein dritterGruppenarbeitsraum mit 12 Plätzen entstehen.Zurzeit hat die Bibliothek wochentags von 9.00 bis 19.00 Uhr (dienstags bis 20.00 Uhr) geöffnet,die Leihstelle jeweils bis 18.00 und am Samstag von 9.30 bis 13.00 Uhr. Aus Sicht derStudenten wäre eine Verlängerung der Öffnungszeiten wochentags von 8.00 bis 21.00 Uhr,samstags von 9.00 bis 18.00 und sonntags von 10.00 bis 18.00 Uhr wünschenswert. Demgegenübersteht die jeweils einjährige Stellenwiederbeset<strong>zu</strong>ngssperre bei Mitarbeiterwechsel,die möglicherweise sogar <strong>zu</strong> einer Verkür<strong>zu</strong>ng der Öffnungszeiten führt.38
ERGEBNISSE7 ERGEBNISSE7.1 PrüfungsergebnisseGrundlage der Ausführungen <strong>zu</strong> den Prüfungsergebnissen sind die vom IMPP extra aufbereitetenDaten der Jahre 2003 bis 2005 <strong>zu</strong>r Ärztlichen Vorprüfung und <strong>zu</strong>m Zweiten Abschnittder Ärztlichen Prüfung nach der alten ÄAppO.Ärztliche VorprüfungIn <strong>Lübeck</strong> bestanden in den Studienjahren 2003 bis 2005 zwischen 74% und 78% der Studentendie erste schriftliche Prüfung (Ärztliche Vorprüfung, alte ÄAppO). Für den Herbst2005 ist folgende Besonderheit <strong>zu</strong> berücksichtigen: Neben der Ärztlichen Vorprüfung nachalter ÄAppO fand gleichzeitig erstmals der Erste Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nach neuerÄAppO statt. An der Prüfung nach alter ÄAppO nahm kein Student der Referenzgruppe 15 teil,an der Prüfung nach neuer ÄAppO dagegen nur Studenten der Referenzgruppe. Es ist an<strong>zu</strong>nehmen,dass die Studenten, die innerhalb der Mindeststudienzeit das erste Staatsexamenabsolvieren, leistungsstärker sind als die Studenten, die nach fünf oder sechs Semesternerstmals <strong>zu</strong>r Prüfung antreten. Insofern muss bei der Beurteilung der Erfolgsquote auchdas Ergebnis nach neuer ÄAppO berücksichtigt werden: Im Herbst 2005 lag die Erfolgsquoteder schriftlichen Prüfung für die <strong>Lübeck</strong>er Studenten bei 96,6% (Bundesschnitt 94,4%).In der mündlichen Prüfung nach alter ÄAppO lag für die <strong>Lübeck</strong>er Studenten die Erfolgsquotezwischen 85% und 96%. In Anhang 70, Graphik 1 sind die Erfolgsquoten der <strong>Lübeck</strong>erStudenten in der schriftlichen und mündlichen Ärztlichen Vorprüfung abgebildet. Zum Vergleichsind die durchschnittlichen Prüfungsnoten aller fünf an der Evaluation beteiligten <strong>Universität</strong>enabgebildet.Die Prüfungsnoten der <strong>Lübeck</strong>er Studenten im mündlichen Teil der Ärztlichen Vorprüfungliegen zwischen 2,5 und 3,4 und damit rund eine Note höher als die Prüfungsnoten in derschriftlichen Prüfung (zwischen 3,5 und 4,5, Anhang 70, Graphik 2). Zwischen Studentenund Studentinnen besteht bei den Prüfungsnoten kein systematischer Unterschied. Allerdingszeigen die ausländischen Studenten in <strong>Lübeck</strong> sowohl bei den schriftlichen als auchbei den mündlichen Prüfungen etwas schlechtere Leistungen (rund 0,5 Notenpunkte,Anhang 70, Graphik 3).Zwischen den Prüfungsfächern der Vorklinik lassen sich deutliche Unterschiede erkennen(Anhang 70, Graphik 4). Zwar zeigen die Studenten in Physik von Prüfungszeitpunkt <strong>zu</strong> Prü-15 Studenten, die innerhalb der Mindeststudienzeit am ersten Staatsexamen teilnehmen, also nach 4 Semestern.39
ERGEBNISSEfungszeitpunkt deutliche Leistungsschwankungen, insgesamt jedoch überdurchschnittlicheErgebnisse. Im Fach Chemie/Biochemie dagegen zeigen die Studenten in allen sechs betrachtetenPrüfungszeitpunkten deutlich unterdurchschnittliche Prüfungsergebnisse. Beziehtman die Fachergebnisse des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung nach neuer ÄAppOvom Herbst 2005 16 mit ein, so ist ersichtlich, dass die <strong>Lübeck</strong>er Studenten im Fach Chemie/Biochemiemit 76% gelöster Aufgaben nun über dem Bundesschnitt (74% gelöster Aufgaben)liegen.Zweiter Abschnitt der Ärztlichen PrüfungDie Erfolgsquote liegt sowohl für den mündlichen als auch für den schriftlichen Teil dieserPrüfung zwischen 96% und 100% (Anhang 71, Graphik 1). Bei den Prüfungsnoten ist dagegenwie bei der Ärztlichen Vorprüfung ein deutlicher Unterschied zwischen dem mündlichenund schriftlichen Teil <strong>zu</strong> erkennen. In der mündlichen Prüfung liegen die Noten zwischen 1,7und 2,0 - und damit rund eine Note besser als in der schriftlichen Prüfung, in der Noten fürdie <strong>Lübeck</strong>er Studenten zwischen 2,7 und 3,1 liegen (Anhang 71, Graphik 2). Studentinnenund Studenten zeigen in diesem Prüfungsabschnitt vergleichbar gute Prüfungsnoten. Dieausländischen Studenten weisen in der schriftlichen Prüfung noch immer etwas schlechtereNoten als deutsche Studenten auf. In der mündlichen Prüfung ist der Unterschied zwischendeutschen und ausländischen Studenten deutlich <strong>zu</strong>rückgegangen (Anhang 71, Graphik 3).Auch in diesem Prüfungsabschnitt sind deutliche Unterschiede der studentischen Leistungenin den verschiedenen Fächern <strong>zu</strong> beobachten. Die besten Leistungen zeigen die Studentenin den Fächern Ophthalmologie, Dermatologie und HNO. Hier zeigen die <strong>Lübeck</strong>er Studentenimmer überdurchschnittlich gute Leistungen. In den Fächern Spezielle Pathologie, Notfallmedizinund Sozialmedizin dagegen schwanken die Ergebnisse von Prüfungszeitpunkt <strong>zu</strong>Prüfungszeitpunkt deutlich um den standardisierten Mittelwert über alle 36 <strong>Universität</strong>en(Anhang 71, Graphik 4).7.2 PrüfungsmethodenAlle Ausführungen <strong>zu</strong> den Prüfungen sind in der Studienordnung (§12) geregelt. Leistungsnachweisewerden nur bei regelmäßiger und erfolgreicher Teilnahme an den Lehrveranstaltungenvergeben. Klausuren, die nicht bestanden werden, können maximal zweimal wiederholtwerden. Vor der letztmaligen Wiederholung ist ein Beratungsgespräch mit dem Studiendekanobligatorisch. Wird die Prüfung auch im dritten Versuch nicht bestanden, kann einHärtefallantrag beim Studienausschuss gestellt werden (Anhang 36). In begründeten Fällen16 Das vollständige Ergebnis für diesen Prüfungszeitpunkt ist den Internetseiten des IMPP <strong>zu</strong> entnehmen (www.impp.de).40
ERGEBNISSEist dann ein vierter Versuch möglich, ansonsten wird die Exmatrikulation eingeleitet. In <strong>Lübeck</strong>bestehen 63% der Studenten die Prüfung im vierten Anlauf, wenn der Härtefall vomStudienausschuss positiv beschieden wurde (Anhang 37).Fakultätsinterne Prüfungen <strong>zu</strong>m Erwerb der Scheine werden von den jeweiligen Fachverantwortlichen<strong>zu</strong>sammengestellt. Ihnen obliegt auch die Festlegung der Bestehensgrenzenund der Bewertungskriterien. Auf externe Fragenpools, <strong>zu</strong>m Beispiel vom IMPP, wird dabeinicht <strong>zu</strong>rückgegriffen. Die meisten schriftlichen Prüfungen werden in Multiple-Choice-Formam Ende des Semesters durchgeführt. In einigen Fächern wird das Leistungsniveau derStudenten nicht in Klausurform, sondern mit mündlichen Prüfungen in Kleingruppen getestet(<strong>zu</strong>m Beispiel Makroskopische Anatomie; Hygiene, Mikrobiologie und Virologie; Untersuchungskurs).Im POL „Klinische Umweltmedizin“ werden ausgehend von den Ausbildungszielen neue Beurteilungsverfahrenerprobt. Im POL ist neben der Vermittlung von Faktenwissen im Bereichder klinischen Umweltmedizin und der Notwendigkeit des vernetzten Denkens auch dasEinüben von kooperativem Lernen und Arbeiten intendiert. Deswegen wird hier am Endekeine Klausur geschrieben. Der Leistungsnachweis wird aufgrund mehrerer Kriterien vergeben:1. regelmäßige Teilnahme, 2. Qualität eines selbst erstellten Posters und der Präsentationdes Posters vor einer Jury, 3. Bewertung der Gruppenarbeit durch den Tutor.Zurzeit wird in der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik an der Realisierung einer Klausurfragen-Datenbankgearbeitet. Damit wird es <strong>zu</strong>künftig möglich sein, die Fragen in einer Klausurnach statistischen Kennwerten (Schwierigkeitsindex) <strong>zu</strong>sammen<strong>zu</strong>stellen. Darüber hinauswird die Möglichkeit in Betracht gezogen, Klausuren mit Mobi-TED ® <strong>zu</strong> schreiben. Dafür sindnoch die rechtlichen Möglichkeiten <strong>zu</strong> prüfen, ebenso die Zuverlässigkeit dieses Verfahrens.7.3 Medizinische PromotionenIn den Jahren 2003 bis 2005 wurden insgesamt 415 Promotionen erfolgreich abgeschlossen,davon insgesamt 227 (= 54,7%) von Studentinnen. Damit werden in <strong>Lübeck</strong> jedes Jahr rund70% der Studenten eines Jahrgangs promoviert. In den Jahren 2003 bis 2005 wurden 6%der Promotionen mit der Note „summa cum laude“ und 32% mit „magna cum laude“ abgelegt(Anhang 74). Die Noten der Studentinnen insgesamt (MW = 1,82) unterscheiden sich statistischnicht von den Noten der Studenten (MW = 1,85). Durch ein zentrales Doktorandenseminar(Anhang 72) und eine Promotionskommission (Anhang 73) wird die Qualität der Arbeitenständig überwacht und verbessert.41
ERGEBNISSETeile der 415 Doktorarbeiten wurden bisher in insgesamt 164 wissenschaftlichen Artikeln<strong>zu</strong>sammengefasst und konnten in international anerkannten Zeitschriften mit Peer-Review-Verfahren publiziert werden (40% der Doktorarbeiten). In 26% der Publikationen waren dieMedizindoktoranden die Erstautoren. Insgesamt ist davon aus<strong>zu</strong>gehen, dass mehr als 50%der <strong>Lübeck</strong>er Promotionen in einer Publikation münden, da es erfahrungsgemäß manchmaleinige Zeit dauert, bis die Ergebnisse der Doktorarbeit eingereicht werden können. Außerdemhat das Vorhandensein einer Publikation maßgeblichen Einfluss auf die Note der Doktorarbeit.Die medizinische Promotion ist also nicht nur ein wichtiger Bestandteil der <strong>Lübeck</strong>erMedizinerausbildung, sondern stärkt auch wesentlich die Forschung der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong><strong>Lübeck</strong>. Damit bildet sie die entscheidende Klammer zwischen Forschung und Lehre und istein nicht weg<strong>zu</strong>denkender Aspekt in der akademischen Ausbildung der angehenden Mediziner.42
LEITUNG UND VERWALTUNG8 LEITUNG UND VERWALTUNGFür das Curriculum des Medizinstudiums ist der Konvent der Medizinischen Fakultät verantwortlich.Dort werden die vom Studienausschuss erarbeiteten Konzepte beraten und entschieden.Das Studiendekanat arbeitet einerseits dem Studienausschuss <strong>zu</strong> und ist andererseitssowohl für die Umset<strong>zu</strong>ng der Konventbeschlüsse als auch für die operative Steuerungdes Studienganges <strong>zu</strong>ständig. Für die Lehre im jeweiligen Fachgebiet sind die Lehrstuhlinhaberverantwortlich. Der Studiendekan leitet das Studiendekanat, das aus fünf Personenbesteht:• Anett Brauner (Dipl.-Psych.), Evaluationsbeauftragte• Priv. Doz. Dr. Hans-Jürgen Friedrich, Hochschuldidaktik• Susanne Reinke (MA), Lehrkoordinatorin• Wolfgang Riese (Dipl.-Inform.), EDV-Koordinator• NN, Koordination des Praktischen JahresDa der Studiendekan Mitglied des Konvents und Vorsitzender des Studienausschusses ist,läuft die Steuerung und Weiterentwicklung des Curriculums auf allen drei Ebenen ohne Reibungsverluste.Wichtigste Kommunikationsplattform des Studiendekanats ist ihre Website(www.medizin.uni-luebeck.de, Anhang 31). Damit steht allen Interessierten, Studenten undDozenten eine zentrale Anlaufstelle <strong>zu</strong>r Verfügung, auf der sie sich rund um das Studium in<strong>Lübeck</strong> informieren können. In dieser Website sind die verschiedenen Systeme (<strong>zu</strong>m Beispieldas Kursanmeldesystem e-LOKS, Mentorenprogramm, Online-Evaluation und der <strong>Lübeck</strong>erE-Mail-Account LEA) zentral <strong>zu</strong> erreichen. Die Studenten wählen dort ihre Kurse,evaluieren das abgelaufene Semester und erhalten ihren persönlichen Kursplan. Außerdemsind dort die Beschreibungen aller Pflichtveranstaltungen und der Wahlfächer abgelegt sowiedie allgemeinen Stundenpläne für die Semester und die Evaluationsergebnisse.Eine entscheidende Maßnahme <strong>zu</strong>r erfolgreichen Organisation der Lehre in <strong>Lübeck</strong> bildet dieOnline-Kursanmeldung und –<strong>zu</strong>teilung, die über das Internet aufgerufen werden kann(Anhang 33). Das System trägt den Namen e-LOKS (elektronisches <strong>Lübeck</strong>er-Online-Kursbuchungs-System). Die Kursanmeldung erfolgt ortsunabhängig während des laufendenSemesters und ermöglicht eine abgeschlossene Kurseinteilung für das Folgesemester vorBeginn der vorlesungsfreien Zeit. Individuelle Wünsche der Studenten (Fächer, Belegung<strong>zu</strong>sammen mit einem bestimmten Kommilitonen) können dabei berücksichtigt werden. JedemStudenten ist damit eine zeitliche Planungssicherheit für Famulaturen, Dissertationenund Auslandsaufenthalte gegeben. Darüber hinaus können Studenten mit Kindern und solche,die ihr Studium selbst finanzieren müssen, ihre Terminpläne rechtzeitig koordinieren43
LEITUNG UND VERWALTUNGund abstimmen. Jeder Student kann im Netz seinen Stundenplan für das nächste Semesterabrufen, einschließlich Rotationsschemata und Unterteilung der Gruppen. Gleichzeitig stehenden Dozenten die Daten für die Ausstellung der <strong>zu</strong>m Teil komplexen Leistungsnachweisenach neuer ÄAppO <strong>zu</strong>r Verfügung (lediglich die Note muss ergänzt werden). Mittelse-LOKS wurden <strong>zu</strong>m SS 06 und WS 06/07 insgesamt 348 Gruppen für unterschiedlichePflichtveranstaltungen eingeteilt. Nur durch die Online-Kurseinteilung war es möglich, in <strong>Lübeck</strong>trotz der Umset<strong>zu</strong>ng der neuen ÄAppO alle Pflichtveranstaltungen auch weiterhin imSemester an<strong>zu</strong>bieten und so die vorlesungsfreie Zeit <strong>zu</strong> erhalten. Dadurch entstanden Freiräume,so dass während des Medizinstudiums im Rahmen der Doktorarbeit wissenschaftlichgearbeitet werden kann und ein funktionierendes Mentorenprogramm eingeführt werdenkonnte.Zusätzlich sind in <strong>Lübeck</strong> folgende EDV-Maßnahmen <strong>zu</strong>r Unterstüt<strong>zu</strong>ng des Studienplansund der Lehre etabliert:<strong>Lübeck</strong>er Ewiger E-Mail-Account (LEA): Um die Erreichbarkeit unserer Studentenwährend ihres Studiums und danach <strong>zu</strong> verbessern, ist mit Beginn des WS 05/06 dasLEA-System in Betrieb genommen worden. Jedem Studenten steht seitdem ein 200<strong>MB</strong> großes elektronisches Postfach unter Vorname.Nachname@medizin.uniluebeck.de<strong>zu</strong>r Verfügung, welches auch nach dem Studium kostenlos weiterverwendetwerden kann.UnivIS: Mit dem Informationssystem UnivIS steht Dozenten und Studenten ein Personen-,Einrichtungs- und Raumverzeichnis <strong>zu</strong>r Verfügung. In diesem stehen alleKontaktdaten der <strong>Universität</strong>smitarbeiter und der Einrichtungen der <strong>Universität</strong>. Zusätzlichbeinhaltet es die Raumplanung für die Hörsäle der <strong>Universität</strong>.Die Arbeit der Studiendekanatsmitarbeiter wird durch eine Reihe sich regelmäßig wiederholenderAufgaben in definierten Angelegenheiten determiniert: Einführung, Evaluation,Kurseinteilung, Mentorenprogramm, Praktisches Jahr (Anhang 35). In regelmäßigen Teambesprechungenwird die gemeinsame Arbeit reflektiert, der Studiendekan informiert überaktuelle Entwicklungen und bespricht mit allen Mitarbeitern anstehende Aufgaben und Probleme.Auf Initiative des Studiendekanats werden <strong>zu</strong> wichtigen Themen der Lehre fakultätsweiteWorkshops durchgeführt. Neben dem Workshop <strong>zu</strong>r strategischen Ausrichtung derLehre im Juni 2004 (Anhang 9) wurde im Juli 2006 ein weiterer Workshop <strong>zu</strong>r Aktualisierungder Internetpräsenz des Studiendekanats abgehalten.Zusammen mit dem Dekanat (Anhang 4) verfügt das Studiendekanat über einen Sachkostenetatin Höhe von 100.000 € pro Jahr. Die vom Studiendekanat und Studierenden-Service-Center erbrachten Leistungen sind Anhang 30 <strong>zu</strong> entnehmen.44
EVALUATION9 EVALUATIONDie Evaluation der Lehrveranstaltungen der Medizinischen Fakultät liegt im Verantwortungsbereichdes Studiendekans. Jeweils am Ende des Semesters bewerten die Studenten überein internetgestütztes Verfahren alle Pflichtlehrveranstaltungen. Die Ergebnisse werden <strong>zu</strong>nächstden Direktoren der Institute und Kliniken mit der Möglichkeit <strong>zu</strong> einer Stellungnahmevorgelegt und zwei Wochen später unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften imInternet veröffentlicht (http://www.medizin.uni-luebeck.de/evaluation/). Damit können alle ander Lehre Beteiligten auf diese Informationen <strong>zu</strong>greifen, aber auch Schüler, die die <strong>Universität</strong><strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> in die engere Wahl für das Studium der Humanmedizin gezogen haben.Daneben werden vom Studierenden-Servicecenter und den Institutionen weitere Evaluationendurchgeführt.9.1 Evaluationen durch das StudiendekanatLehrveranstaltungenIn die Evaluation des Studiendekanats werden alle Lehrveranstaltungen des Pflichtcurriculumseinbezogen, seit WS 05/06 auch die Wahlfächer und seit SS 06 die Lehraufträge. NeueUnterrichtsformen werden in den ersten zwei bis drei Semestern mit einer Evaluation begleitet,um organisatorische Schwachstellen identifizieren und verbessern <strong>zu</strong> können. Von dieserForm der Evaluation waren beispielsweise die Blockpraktika des vierten Studienjahres unddas POL Klinische Umweltmedizin betroffen. Ebenso wurde das im September 2006 erstmaligstattfindende Repetitorium Innere Medizin evaluiert.Derzeit problematisch sind doppelt ausgeführte Evaluationen der Lehrveranstaltungen. EinigeInstitutionen führen neben der zentralen Evaluation durch das Studiendekanat <strong>zu</strong>sätzlichdifferenzierte eigene Befragungen der Studenten durch, die in der Ausführlichkeit nicht durchdas Studiendekanat geleistet werden können und die manchmal die Ausdauer der Studentenauf eine harte Probe stellen. Andere Institutionen erfassen die gleichen Merkmale wie diezentrale Evaluation. Es ist angestrebt, diese Doppelevaluationen künftig soweit wie möglich<strong>zu</strong> reduzieren. Zum Teil wird die Befragung der Studenten direkt vor der Klausur <strong>zu</strong>mScheinerwerb durchgeführt, womit der subjektive Eindruck entstehen könnte, dass die Anonymitätder Befragung beeinträchtigt sein könnte. Insgesamt wird das bestehende Systemder Evaluation jedoch von den <strong>Lübeck</strong>er Studenten und Dozenten getragen.45
EVALUATIONZieleIn der neuen ÄAppO ist geregelt, dass Lehrveranstaltungen regelmäßig auf ihren Erfolg <strong>zu</strong>evaluieren und die Ergebnisse bekannt <strong>zu</strong> geben sind (§ 2 Abs. 9). Ähnlich ist es im HRG(2002) formuliert: „Die Studierenden sind bei der Bewertung der Qualität der Lehre <strong>zu</strong> beteiligen.Die Ergebnisse der Bewertungen sollen veröffentlicht werden“ (§ 6). Ziel der Evaluationkann also sowohl der Erfolg der Lehrveranstaltungen als auch deren Qualität sein. Bei derKonzeption der Evaluation waren weitere fakultätsinterne Vorgaben <strong>zu</strong> berücksichtigen:• Die Evaluation der Lehrveranstaltungen soll <strong>zu</strong> einer Verbesserung der allgemeinenLehrqualität führen.• Die Ergebnisse der Lehrveranstaltungsevaluation sollen vergleichbar sein und in die leistungsbezogeneMittelvergabe einbezogen werden.Außerdem war bei der Entwicklung des Evaluationsverfahrens <strong>zu</strong> beachten, dass nur beigenügend hohem Rücklauf und einem hohem Informationsgehalt die Ergebnisse von denDozenten als <strong>zu</strong>verlässiger Ausdruck der Studentenmeinung akzeptiert werden. Die Akzeptanzder Ergebnisse ist der erste Schritt <strong>zu</strong>r Verbesserung der Lehrveranstaltungen. Ein hinreichendhoher Rücklauf und vergleichbare Ergebnisse sind ebenso notwendig, wenn dieDaten in die leistungsbezogene Mittelvergabe integriert werden sollen. Ein hoher Rücklaufwird nur dann erreicht, wenn die Studenten gezielt und so ökonomisch wie möglich befragtwerden. Deswegen wurde die Evaluation der Lehrveranstaltungen an die elektronischeKurseinteilung gekoppelt. Beim Aufrufen der individuellen Kurspläne werden die Studentenaufgefordert, die im laufenden Semester besuchten Lehrveranstaltungen des Pflichtcurriculums<strong>zu</strong> evaluieren.Valide Erfassungsinstrumente <strong>zu</strong>r Qualität der Lehrveranstaltungen umfassen in der Regel20 und mehr Items. Bei durchschnittlich 6 bis 7 besuchten Lehrveranstaltungen pro Semester,die am Semesterende von den Studenten über das Internet <strong>zu</strong> bewerten sind, ist diesden Studenten aus Kosten- und Motivationsgründen nicht <strong>zu</strong><strong>zu</strong>muten. Deswegen konzentriertsich die Medizinische Fakultät bei der Evaluation der Lehrveranstaltungen auf die subjektiveBewertung des Lehrerfolges, einer Dimension der Lehrqualität.VerfahrensweisenBei der Operationalisierung des Kriteriums „Erfolg der Lehrveranstaltungen“ hat sich die MedizinischeFakultät am Heidelberger Inventar <strong>zu</strong>r Lehrveranstaltungsevaluation (HILVE) vonHeiner Rindermann (2001) 17 orientiert. Aus der Skala „Lernerfolg“ wurden acht Items entnommenund mit zwei Items <strong>zu</strong>r Formulierung von Lehrzielen ergänzt. Jede Lehrveranstal-17 Rindermann, H. (2001). Lehrevaluation. Landau: Verlag Empirische Pädagogik.46
EVALUATIONtung des Pflichtcurriculums wird also mit zehn Items bewertet (Anhang 56). Zusätzlich könnendie Studenten <strong>zu</strong> jeder Lehrveranstaltung freie Kommentare abgeben. Bei den Lehrveranstaltungen,bei denen eine Differenzierung <strong>zu</strong>m Beispiel nach den unterrichtenden Dozentenmöglich ist, wird eine dozentenbezogene Evaluation vorgenommen - sofern die beteiligtenDozenten damit einverstanden sind. Außerdem werden die Studenten in jedem Semester<strong>zu</strong> diversen Themen aus dem Fakultätsleben, ihrer persönlichen Situation (Erwerbstätigkeit)oder <strong>zu</strong>r Studien<strong>zu</strong>friedenheit insgesamt befragt (geschlossenes und offenes Antwortformat).Der Fragebogen ist auf den Internetseiten des Studiendekanats ein<strong>zu</strong>sehen 18 und nur für die<strong>Lübeck</strong>er Medizinstudenten für zwei bis drei Wochen <strong>zu</strong>r Bearbeitung freigeschaltet.Beim Einloggen müssen sich die Studenten zwar mit Name und Matrikelnummer identifizieren,diese Daten werden aber nicht gespeichert, so dass die Evaluation anonym ist. Insgesamtvertrauen die Studenten auf die Anonymität der Befragung: Weniger als fünf Studierendepro Semester zweifeln an der Anonymität und lehnen aus diesem Grunde die Teilnahmeab. Die Teilnahme an der Evaluation war bisher freiwillig. Eine verpflichtende Evaluation wirdeingeführt, wenn der Rücklauf der freiwilligen Evaluation unter 60% liegt. In den Evaluationender letzten Semester wurden zwischen 68% und 78% der <strong>Lübeck</strong>er Studenten erreicht.Letztendlich teilgenommen haben jeweils 65% der Studenten (SS 06: 65%; WS 05/06: 64%;SS 05: 63%; WS 04/05: 66%).Andere vom Studiendekanat durchgeführte Evaluationen liegen in Papierform vor (Vorklinik,Blockpraktika, Repetitorium, POL Umweltmedizin).GütekriterienDa die zehn Items der Evaluation ein geschlossenes Antwortformat aufweisen, die Darbietungüber das Internet für alle Studenten gleich ist und für die Auswertung Mittelwerte undStandardabweichung berechnet werden, ist von einer hinreichenden Objektivität der Befragungaus<strong>zu</strong>gehen.Die Zuverlässigkeit der Evaluation wurde für das Item „Gesamtnote“ im Zusammenhang miteiner differenzierteren Evaluation der Blockpraktika des vierten Studienjahres geprüft. Da<strong>zu</strong>wurden 644 Bewertungen aus zwei Befragungen (Onlineevaluation, ausführlichere Papierversion)veranstaltungsbezogen auf Personenebene <strong>zu</strong>sammengeführt und miteinander verglichen.Erstes Ergebnis dieser Analyse ist, dass die Rangreihe der Veranstaltungsbewertungin beiden Evaluationen identisch ist: Das Blockpraktikum Anästhesiologie wurde in beidenBefragungen als das beste bewertet. Das zweite Ergebnis dieser Analyse ist, dass alleBlockpraktika in der Papierversion besser bewertet wurden als in der Onlineevaluation. Der18 http://www.medizin.uni-luebeck.de/index.php?c_id=131&n_id=119&s_id=147
EVALUATIONMittelwertsunterschied beträgt über alle Blockpraktika hinweg 0,17 Notenpunkte (t-Test fürabhängige Stichproben, T(643) = 6.06, α < .05). Da dies für alle Blockpraktika gleichermaßengilt, kann dieser Effekt als Störvariable vernachlässigt werden, wird aber in folgenden Analysennoch <strong>zu</strong> klären sein. Die Retestreliabilität lag bei r tt = .74 und ist als ausreichend <strong>zu</strong> betrachten(Anhang 58).Die acht Items, die aus dem Fragebogen von Heiner Rindermann (2001) entnommen wurden,gehören <strong>zu</strong>r Dimension Lehrerfolg. Diese Items weisen eine interne Konsistenz vonCronbach α = .93 auf. Damit ist davon aus<strong>zu</strong>gehen, dass sie tatsächlich eine Dimension repräsentieren(Anhang 58).Veröffentlichung der ErgebnisseDie Ergebnisse der zentralen Semesterevaluation werden auf den Internetseiten des Studiendekanatsin zwei Schritten veröffentlicht.1. Passwortgeschützte Veröffentlichung nur für die Einrichtungsdirektoren. Die Instituts- undKlinikdirektoren bekommen nach der Auswertung der Daten per E-Mail den Link und dasPasswort <strong>zu</strong>gesendet. Sie haben zwei Wochen Zeit, sich die Ergebnisse an<strong>zu</strong>sehen und ihreAnmerkungen <strong>zu</strong>r Evaluation oder <strong>zu</strong> den Ergebnissen an das Studiendekanat <strong>zu</strong> senden,die dann <strong>zu</strong>sammen mit den Ergebnissen im Internet veröffentlicht werden.2. Allgemeine Veröffentlichung der Evaluationsergebnisse. Die Ergebnisse, die <strong>zu</strong>vor nurden Einrichtungsdirektoren <strong>zu</strong>gänglich waren, werden für alle Beteiligten frei geschaltet. SowohlDozenten als auch Studenten werden in einer E-Mail mit dem entsprechenden Link aufdie Ergebnisse hingewiesen. Die freien Anmerkungen der Studenten <strong>zu</strong> einzelnen Lehrveranstaltungenoder Dozenten werden nicht veröffentlicht. Sie werden vertraulich behandeltund bei Interesse den betroffenen Dozenten <strong>zu</strong>gesendet.Alle Lehrveranstaltungen <strong>zu</strong>sammen werden im Studienjahr 2006 von den Studenten mit dererfreulichen Durchschnittsnote 2,5 bewertet (Abbildung 4, S. 52, Abbildung 5, S.53). Damithat sich der <strong>Lübeck</strong>er Unterricht im Vergleich <strong>zu</strong>m Vorjahr, das mit 2,7 bewertet wurde(Anhang 54, Anhang 55), verbessert. Neben der Globalbewertung ist im Internet für jedeLehrveranstaltung eine Detailanalyse veröffentlicht (Anhang 56).48
EVALUATIONKonsequenzenEvaluation ist nicht Selbstzweck 19 , sondern sie muss einen praktischen Nutzen aufweisen.Der praktische Nutzen besteht für die Fakultät und die Studenten in der Verbesserung derLehrqualität. Die Veröffentlichung der Ergebnisse kann Dozenten motivieren, an der Verbesserungihrer Lehrveranstaltungen <strong>zu</strong> arbeiten. Sie kann aber auch genau das Gegenteil bewirken:Die Ergebnisse werden abgewertet oder ignoriert 20 . Deswegen gehen wir in <strong>Lübeck</strong>einen Schritt weiter und versuchen in Beratungsgesprächen nach Veranstaltungshospitationengemeinsam mit den betroffenen Dozenten nach Lösungen <strong>zu</strong> suchen.Mindestens einmal im Studienjahr werden die am schlechtesten bewerteten Lehrveranstaltungenvon Mitarbeitern des Studiendekanats besucht. Der Besuch erfolgt nach Anmeldung,so dass die Dozenten informiert sind. Im Anschluss an die Veranstaltungshospitation wird einTermin für ein Beratungsgespräch vereinbart, in dem die Beobachtungen der Hospitationund die Ergebnisse der Evaluation thematisiert werden. Zusammen werden Maßnahmenerarbeitet, die <strong>zu</strong> einer Verbesserung der Lehrqualität führen könnten. Diese können in einerorganisatorischen Veränderung bestehen (Zusammenlegung von Terminen, Verlegung derVeranstaltung in ein anderes Studienjahr), in der Modifizierung der Unterrichtsmethode (praxisorientierter,stärkerer Einbe<strong>zu</strong>g der Studenten in den Unterricht) oder in der Erstellungneuer Unterrichtsmaterialien (Skript, Überarbeitung der Präsentation). Aus den diskutiertenMaßnahmen werden einzelne herausgegriffen und es werden Ziele da<strong>zu</strong> vereinbart, derenErreichung nach gegebener Zeit überprüft wird.Soweit möglich, unterstützt das Studiendekanat die Dozenten bei der Umset<strong>zu</strong>ng dieserMaßnahmen. In den Fällen, in denen aus verschiedensten Gründen auf dieser Ebene keineLösungen <strong>zu</strong> finden sind, wird der Studienausschuss einberufen. Wenn auch auf dieserEbene keine Lösung gefunden werden konnte, kann der Studienausschuss als „ultima ratio“dem Konvent geeignete Methoden vorschlagen.Zusätzlich finden <strong>zu</strong> einzelnen evaluierten Studienabschnitten (Vorklinik) oder Veranstaltungsformen(z.B. Blockpraktika) Treffen des Studiendekans mit den verantwortlichen Dozentenstatt, in denen die konkreten Ergebnisse und <strong>zu</strong>künftige Maßnahmen besprochenwerden.Neben der Beratung wird das Ergebnis der Semesterevaluation wie vorgesehen als ein Parameterin die leistungsbezogene Mittelvergabe einbezogen. Im Studienjahr 2004 wurden imBereich Lehre insgesamt 300.000 € unter den Einrichtungen verteilt (Anhang 60), im Studienjahr2005 insgesamt 330.000 € (Anhang 61).19 Wottawa, H. & Thierau, H. (1998). Lehrbuch Evaluation. Bern: Hans-Gruber Verlag.20 Rindermann, H. (2001). Lehrevaluation. Landau: Verlag Empirische Pädagogik.49
EVALUATIONKursus dermakroskopischen AnatomiePraktikum BerufsfelderkundungPraktikum <strong>zu</strong>r Einführungin die klinische MedizinSeminar AnatomieSpitzengruppeMittelwert über alleScheine (MW = 2,45)Kursus dermikroskpischen AnatomiePraktikum PhysiologieMittelgruppeSeminar PhysiologieKursus MedizinischePsychologie/SoziologiePraktikum Biochemie/MolekularbiologiePraktikum Chemie für MedizinerPraktikum derBiologie für MedizinerPraktikum dermedizinischen TerminologieSchlussgruppePhysik für MedizinerSeminar Biochemie/MolekularbiologieSeminar MedizinischePsychologie/Soziologiesehr 1,00 gut 2,00 gut befriedigend 3,00 ausreichend 4,00genügend5,00ungenügend6,00Mittelwerte mit <strong>zu</strong>gehörigem 95%-KonfidenzintervallAbbildung 4: Gesamtbewertung der nach Scheinen <strong>zu</strong>sammengefassten Lehrveranstaltungen des vorklinischenStudienabschnittes im Studienjahr 2006Legende <strong>zu</strong>r Abbildung 4:In der obigen Darstellung sind die Lehrveranstaltungen des Studienjahres 2006 für die Scheine gemäßder neuen ÄAppO <strong>zu</strong>sammengefasst und jeweils in drei Gruppen eingeteilt (Spitzengruppe,Mittelgruppe, Schlussgruppe). Diese Einteilung wurde in Anlehnung an das Ranggruppenverfahrendes CHE entwickelt. Dabei wird der Mittelwert der <strong>zu</strong> einem Schein gehörigen Lehrveranstaltungen inseiner relativen Position <strong>zu</strong>m Gesamt-Mittelwert (Mittelwert über alle Scheine, blau gestrichelte Linie)in eine Ranggruppe eingeordnet. Maßgeblich für die Einordnung in eine Ranggruppe ist das 95%-Konfidenzintervall um den Mittelwert für den Schein, welches neben der Anzahl auch die Homogenitätder Urteile berücksichtigt. Schein-Mittelwerte, deren Konfidenzintervalle außerhalb des Gesamtmittelwertesliegen, werden einer Extremgruppe <strong>zu</strong>gerechnet, die übrigen der Mittelgruppe.50
EVALUATIONAnästhesiologieDermatologie, VenerologieHals-Nasen-OhrenheilkundeHygiene, Mikrobiologie, VirologieInfektiologie, Immunologie (Q)Kinderheilkunde (BP)Mittelwert über alleScheine (MW = 2,45)Klin. Pharmakologie, Pharmakotherapie (Q)NeurologiePharmakologie, ToxikologiePsychiatrie, PsychotherapiePsychosom. Medizin und PsychotherapieSpitzengruppeRechtsmedizinUrologieAllgemeinmedizin (BP)Arbeits-/, Sozialmedizin, SozialmedizinBildgeb. Verfahren, Strahlenschutz (Q)ChirurgieChirurgie (BP)FrauenheilkundeGesundheitsökonomie...-pflege (Q)Innere MedizinKinderheilkundeMittelgruppeKlinische Chemie, LaboratoriumsdiagnostikOrthopädiePrävention, Gesundheitsförderung (Q)Notfallmedizin (Q)Rehabilitation...Naturheilverfahren (Q)AllgemeinmedizinArbeits-/Sozialmedizin: ArbeitsmedizinAugenheilkundeEpidemiolog. med. Biometrie, Informatik (Q)Frauenheilkunde (BP)HumangenetikGeschichte, Theorie, Ethik der Medizin (Q)SchlussgruppeInnere Medizin (BP)Klinisch-pathologische Konferenz (Q)Klinische Umweltmedizin (Q)Pathologiesehr gut gut befriedigend ausreichend genügend ungenügend1,002,003,004,005,006,00Mittelwert mit <strong>zu</strong>gehörigem 95%-KonfidenzintervallAbbildung 5: Gesamtbewertung der nach Scheinen <strong>zu</strong>sammengefassten Lehrveranstaltungen des klinischenStudienabschnittes im Studienjahr 2006 (Q = Querschnittfach, BP = Blockpraktikum). Legendesiehe vorhergehende Seite.51
EVALUATIONStudienabschnitteSeit dem Jahre 2001 wird retrospektiv der vorklinische Studienabschnitt bewertet. Da<strong>zu</strong> bekommendie Studenten <strong>zu</strong> Beginn des klinischen Studienabschnittes einen Fragebogen vorgelegt,in dem verschiedene Aspekte <strong>zu</strong>r Studienorganisation („gefühlte Belastung, sieheAbschnitt 3.3, S. 16) und <strong>zu</strong> den Fächern erfragt werden. Diese Evaluation wird ebenfallsvom Studiendekanat vorgenommen und spielt <strong>zu</strong>sammen mit der Lehrveranstaltungsevaluationeine wesentliche Rolle bei der Weiterentwicklung des Curriculums.Seit Herbst 2006 werden auch die PJ-Tertiale über das Internet von den Studenten bewertet(Anhang 57). Diese Evaluation ist für die Studenten verpflichtend, die Ergebnisse werdenklinik- bzw. stationsbezogen im Internet veröffentlicht und können von nachfolgenden Studentenbei der Wahl ihrer PJ-Stationen herangezogen werden.9.2 Weitere Evaluationen auf dem CampusDas Studierenden-Service-Center führt Befragungen der Studienanfänger, Studienabbrecherund Absolventen durch. Die Ergebnisse dieser Befragungen werden dem Studiendekanat<strong>zu</strong>r Verfügung gestellt.Die Qualität der Betreuung der Doktorarbeiten wird seit dem Sommer 2006 in einer studentischenInitiative in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sozialmedizin genauer analysiert.Da<strong>zu</strong> werden alle Doktoranden nach Abgabe ihrer Arbeit angeschrieben und um die Beantwortungeiniger Fragen <strong>zu</strong>r Qualität der Betreuung gebeten. Die Ergebnisse sollen in aggregierterForm den Studenten und Institutionen <strong>zu</strong>gänglich gemacht werden.52
WEITERENTWICKLUNGEN UND ZIELE10 WEITERENTWICKLUNGEN UND ZIELEDie <strong>zu</strong>künftige Entwicklung eines Studienganges hängt auch maßgeblich von der allgemeinenpolitischen Situation ab. Deswegen wird im Folgenden kurz auf diesen Aspekt eingegangen.Allgemeine politische SituationIn den nächsten 40 Jahren wird in Deutschland die Anzahl der Menschen im Alter von 20 bis40 Jahren von fast 25 Millionen auf unter 15 Millionen <strong>zu</strong>rückgehen 21 . Diese Altersgruppestellt das Rückgrat und den Motor unserer Gesellschaft dar. Ein Bundesland wird nur dannlangfristig für seine Bürger vernünftig sorgen können, wenn es im Wettbewerb um diese Altersgruppebesteht. Erfolgreiche <strong>Universität</strong>en sind ein Magnet für diese Altersgruppe, da sieexzellente Studenten und Dozenten mit ihren Familien anziehen. Außerdem sind <strong>Universität</strong>enein entscheidendes Forum für die notwendige Durchführung des Dialogs zwischen denGenerationen.Trotzdem finanziert Schleswig-Holstein seine <strong>Universität</strong>en un<strong>zu</strong>reichend. Pro Einwohnergibt es 40% weniger aus als im Bundesschnitt (118 € gegen 192 €) und liegt damit hinterallen anderen Bundesländern, nur das Saarland gibt noch weniger für seine <strong>Universität</strong>enaus 22 . Schon jetzt führt diese Politik da<strong>zu</strong>, dass Schleswig-Holstein verglichen mit dem Bundesschnittin der Anzahl der Studenten ein Minus von fast 40% hat (1.458 versus 2.227 Studentenpro 100.000 Einwohner 23 ), nur Brandenburg hat noch weniger Studenten. Damitherrscht in Schleswig-Holstein eine Atmosphäre, die einer erfolgreichen Weiterentwicklunguniversitärer Strukturen abträglich ist.Auch die Medizinerausbildung wird in Schleswig-Holstein unterdurchschnittlich finanziert, nur70% dessen, was im Bundesschnitt dafür ausgegeben wird 24 . Trotzdem hat die MedizinischeFakultät in <strong>Lübeck</strong> überdurchschnittliche Leistungen in den Bereichen Forschung und Lehreerbracht. So wirbt der <strong>Lübeck</strong>er Professor deutlich mehr Drittmittel ein (270.000 €) als seinKollege in Deutschland (Bundesdurchschnitt: 254.000 €) 25 . In <strong>Lübeck</strong> schließen mehr Stu-21 Birg, H. (2001). Die demographische Zeitenwende. Der Bevölkerungsrückgang in Deutschland und Europa. München: C. H.Beck.22 Expertenkommission unter Vorsitz von Prof. Dr. Hans-Uwe Erichsen (2003). Zur Entwicklung der Hochschulen in Schleswig-Holstein. Empfehlungen der von der Landesrektorenkonferenz und der Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Forschung undKultur eingesetzten Expertenkommission.23 ebd.24 ebd.25 Wissenschaftsrat (11.11.2005). Stellungsnahme <strong>zu</strong> Leistungsfähigkeit, Ressourcen und Größe universitätsmedizinischerEinrichtungen.53
WEITERENTWICKLUNGEN UND ZIELEdenten ihr Studium in Regelstudienzeit ab (57%) als im Bundesdurchschnitt (48%) 26 . Zudemwird die Ausbildung der Medizinischen Fakultät bei diversen Rankings exzellent beurteilt(Anhang 75, Anhang 76).Hauptgrund für diese überdurchschnittlichen Leistungen ist die Autonomie der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong><strong>Lübeck</strong>. Da es keinen „Königsweg“ für die erfolgreiche Durchführung von Forschung undLehre gibt, ist die Autonomie einer <strong>Universität</strong> das entscheidende Instrument, um die vor Ortvorhandenen Ressourcen <strong>zu</strong> bündeln und gezielt weiter<strong>zu</strong>entwickeln. Diese Autonomie hates gestattet, inhaltlich und organisatorisch ein Pflichtcurriculum auf höchstem Niveau auf<strong>zu</strong>bauenund gleichzeitig so schlank <strong>zu</strong> halten, dass die Studenten in <strong>Lübeck</strong> Zeit haben, imRahmen einer Promotion ein selbst gewähltes Thema auf wissenschaftlichem Niveau <strong>zu</strong>bearbeiten. Auf diese Weise ist in <strong>Lübeck</strong> ein Curriculum etabliert, dass nicht nur alle Anforderungender ÄAppO erfüllt, sondern auch der Kernforderung des B<strong>MB</strong>F, des Wissenschaftsratesund der DFG nach einem wissenschaftsorientiertem Medizinstudium erfolgreichnachkommt 27 . Zugleich deckt sich das <strong>Lübeck</strong>er Curriculum vollständig mit dem von derBundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland vorgeschlagenen Kerncurriculumfür die Medizinische Ausbildung in Deutschland 28 .Durch den schon vom Kabinett verabschiedeten Entwurf des neuen Hochschulgesetzes inSchleswig-Holstein wird die Autonomie der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> jedoch entscheidend beschnitten.Bisher haben die Gremien der <strong>Universität</strong> über die Verteilung von etwa 55 MillionenEuro jährlich entschieden. In Zukunft sollen es nur noch 22 Millionen Euro sein. Mehr alsdie Hälfte, nämlich 33 Millionen Euro, soll von einem Gremium verteilt werden, das in seinerMehrheit aus Mitgliedern besteht, die nicht von der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> gewählt sind.Wenn diese Situation nicht geändert wird, dann ist nicht nur das bisher Erreichte gefährdet,sondern dann fehlt auch die notwendige Basis dafür, dass sich <strong>Lübeck</strong> in Forschung undLehre erfolgreich weiterentwickeln kann.26 Wissenschaftsrat (11.11.2005). Stellungsnahme <strong>zu</strong> Leistungsfähigkeit, Ressourcen und Größe universitätsmedizinischerEinrichtungen.27 Kernforderungen. Hochschulmedizin der Zukunft: Ziele und Visionen für die klinische Spitzenforschung. Gemeinsamer Workshopvon B<strong>MB</strong>F, DFG und Wissenschaftsrat in Mai 2004 in Berlin.28 BVMD (2006). Kerncurriculum für die Medizinische Ausbildung in Deutschland – Ein Vorschlag der MedizinstudierendenDeutschland.54
WEITERENTWICKLUNGEN UND ZIELEDie nächsten MaßnahmenUm die hervorragende Stellung im Bereich der Lehre weiter aus<strong>zu</strong>bauen, werden neben demErhalt der Autonomie der <strong>Universität</strong> und der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Curriculumsfolgende Projekte in Angriff genommen:• Zulassung der Medizinstudenten über Auswahlgespräche: Dies ist die Einzelmaßnahme,die <strong>zu</strong> der deutlichsten Leistungssteigerung der Medizinischen Fakultät in Forschung undLehre führen wird. Zunächst sollen 60% der Studenten über dieses Verfahren aufgenommenwerden. Langfristig wollen wir alle unsere Studenten auf diese Weise rekrutieren.• Elektronische Scheinschreibung: Bisher hat das Studiendekanat nur Daten darüber, wiedie Studenten eingeteilt wurden, nicht jedoch, ob sie den Kurs auch erfolgreich bestandenhaben. Diese Informationen sind jedoch für eine effiziente Kurseinteilung dringendnotwendig und bilden die Vorausset<strong>zu</strong>ng für das angestrebte elektronische Studienbuch.Strukturell werden wir daran arbeiten, dass nicht nur die Zuteilung <strong>zu</strong> Kursen und Seminarenzentral über das Internet organisiert ist, sondern auch zentral erfasst werden kann,ob der einzelne Student die Lehrveranstaltung erfolgreich absolviert hat. Damit könnendie vorhandenen Ressourcen noch effektiver eingeplant werden. Außerdem wird nochschneller klar, welche Studenten von einer Beratung profitieren würden.• Entwicklung der Prüfungskultur: Zukünftig soll in <strong>Lübeck</strong> die Prüfungskultur weiter entwickeltwerden, um so noch stärker das Lernverhalten der Studenten steuern <strong>zu</strong> können(Lehrzielformulierung). Dadurch wird es <strong>zu</strong> einer besseren Abstimmung der Unterrichtsinhaltezwischen den einzelnen Disziplinen kommen und die Prüfungsleistungen der <strong>Lübeck</strong>erStudenten werden sich weiter verbessern. Außerdem sollen schriftliche Multiple-Choice-Prüfungen weiter in den Hintergrund rücken und mehr und mehr durch interaktivePrüfungen ersetzt werden (Anhang 11).• Entwicklung eines Stipendiensystems: Die Ausweitung des Pflichtcurriculums durch dieneue ÄAppO wird da<strong>zu</strong> führen, dass sich die Studiendauer für Medizinstudenten erhöhenwird. Immer mehr Studenten werden darauf angewiesen sein, sich <strong>zu</strong>sätzliche Finanzierungsquellen<strong>zu</strong> erschließen. Die Medizinische Fakultät hat es sich <strong>zu</strong>r Aufgabe gemacht,durch Stipendien und Mittel für Hilfswissenschaftlerstellen dafür <strong>zu</strong> sorgen, dass ein großerTeil der Medizinstudenten in einem Bereich Geld verdienen kann, der ihr Studiumfördert.• Erweiterung des Raumangebotes: Zusammen mit der Technisch-NaturwissenschaftlichenFakultät streben wir einen Erweiterungsbau im vorklinischen Bereich an (etwa3.000 m 2 ), um Kurse und Seminare noch effektiver durchführen <strong>zu</strong> können.55
WEITERENTWICKLUNGEN UND ZIELEMessbare ZieleUm überprüfen <strong>zu</strong> können, ob der Weg, den die Fakultät eingeschlagen hat, auch erfolgreichist, wird sich <strong>Lübeck</strong> an folgenden objektivierbaren Indikatoren orientieren, die in den nächstenfünf Jahren erreicht werden sollen:• Die Anzahl der Bewerbungen für <strong>Lübeck</strong> soll von jetzt etwa 8.000 auf über 10.000 gesteigertwerden.• Im schriftlichen Teil der beiden ärztlichen Prüfungen soll die Misserfolgsquote der <strong>Lübeck</strong>erStudenten deutlich geringer sein als im Bundesschnitt. In den mündlichen Prüfungensoll die Note „zwei“ als Durchschnittsnote erreicht werden.• Auch weiterhin sollen mindestens 70% der Studenten während des Studiums eine Doktorarbeitanfertigen, die <strong>zu</strong> über 70% in Zeitschriften mit Peer-Review-Verfahren publiziertwerden sollen.• Der Anteil der Studenten, die während ihres Studiums einen Auslandsaufenthalt absolvieren,soll auf über 60% ansteigen.• Trotz des übervollen Curriculums, der Promotion, des Auslandsaufenthalts und des Engagementsfür die eigene <strong>Universität</strong> soll die durchschnittliche Studiendauer 14 Semesternicht überschreiten.FazitInsgesamt wird die Fakultät fortfahren, auf Bewährtem auf<strong>zu</strong>bauen, Neues vorsichtig hin<strong>zu</strong><strong>zu</strong>fügenund beides sorgfältig und effektiv <strong>zu</strong> organisieren. Dadurch entstehen zeitliche Freiräume,die unsere Studenten <strong>zu</strong>r Mitarbeit in der Forschung im Rahmen einer Doktorarbeit,<strong>zu</strong>r Teilnahme am Mentorenprogramm und <strong>zu</strong>m Blick über den Tellerrand nutzen sollen. In<strong>Lübeck</strong> werden auch in Zukunft Pflichtcurriculum und akademischer Aspekt nebeneinanderstehen und so <strong>zu</strong> einem Medizinstudium führen, dem man „Exzellenz ohne Spektakel“ bescheinigenkann 29 .29 DIE ZEIT, 13.07.200656
ANHANG11 ANHANGA. Allgemeine InformationenAnhang 1 bis Anhang 12 ....................................................................................................59B. Ablauf des StudiumsAnhang 13 bis Anhang 28 .................................................................................................73C. Betreuung der StudentenAnhang 29 bis Anhang 46 .................................................................................................93D. Unterstüt<strong>zu</strong>ng der DozentenAnhang 47 bis Anhang 53 ...............................................................................................117E. EvaluationAnhang 54 bis Anhang 58 ...............................................................................................125F. RessourcenAnhang 59 bis Anhang 65 ...............................................................................................131G. ErgebnisseAnhang 66 bis Anhang 76 ...............................................................................................13957
ANHANG58
ANHANGA. ALLGEMEINE INFORMATIONENAnhang 1Historie der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>Anhang 2Organigramm der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>Anhang 3GremienAnhang 4Dekanat der Medizinischen FakultätAnhang 5Lageplan der <strong>Universität</strong> und des KlinikumsAnhang 6Stadtplanausschnitt <strong>Lübeck</strong>Anhang 7Forschungsschwerpunkte der Medizinischen FakultätAnhang 8Zentrum für medizinische Struktur- und Zellbiologie (ZMSZ)Anhang 9Weiterentwicklung der Lehre - Strategie-WorkshopAnhang 10Weiterentwicklung der Lehre - Projekt ‚Lehrzielkataloge’Anhang 11Weiterentwicklung der Lehre - Projekt ‚Professionell PrüfenAnhang 12Lehraufträge der <strong>Universität</strong>59
ANHANGAnhang 1Historie der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>1. Nachfolgend finden Sie eine kurze Übersicht <strong>zu</strong>r jungen Geschichte der <strong>Universität</strong><strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>:1912 Heil- und Pflegeanstalt Strecknitznach 1945Städtisches Krankenhaus Ost3. November 1964 Medizinische Akademie <strong>Lübeck</strong> (2. Medizinische Fakultät der Christian-Albrechts-<strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> Kiel), klinischer Abschnitt des Studiengangs Humanmedizin7. Mai 1973 Medizinische Hochschule <strong>Lübeck</strong>1979 Vorklinisch-Naturwissenschaftliche Fakultät (heute: Technisch-Naturwissenschaftliche Fakultät)WS 1983/84Aufnahme des Studienbetriebs im vorklinischen Abschnitt des Medizinstudiums10. Mai 1985 Medizinische <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>WS 1993/94WS 2001/02Studiengang InformatikStudiengang Molekulare Biotechnologie (seit SS 2002: Molekular Life Science)29. Mai 2002 <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>WS 2002/03Studiengang Computational Life Science2. Folgende Rektoren/Präsidenten haben die <strong>Universität</strong> bisher geleitet:• Prof. Dr. med. Friedhelm Oberheuser(Rektor 1973 - 1975)• Erhard D. Klinke(Präsident 1975 - 1987)• Prof. Dr. med. Peter C. Scriba(Rektor 1987 – 1989)• Prof. Dr. med. Wolfgang Henkel(Rektor 1990 - 1996)• Prof. Dr. med. Dr. h.c. mult. Wolfgang Kühnel(Rektor 1996 - 1999)• Prof. Dr. med. Hans Arnold(Rektor 1999 - 2002)• Prof. Dr. rer. nat. Alfred X. Trautwein(Rektor 2002 - 2005)• Prof. Dr. med. Peter Dominiak(Rektor seit 01.05.2005)60
ANHANGAnhang 2Organigramm der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>RektoratRektor2 ProrektorenKanzlerinKonsistorium18 Mitglieder der Gruppen im Verhältnis 6:3:6:3Rektorat, Dekane und Frauenbeauftragte mit Antragsrechtund beratender StimmeSenat13 Mitglieder derGruppen imVerhältnis7:2:2:2Rektorat, Dekaneund FrauenbeauftragtemitAntragsrechtund beratenderStimmeStändigeund nichtständigeAusschüsseAStAStudierendenparlamentGruppe derHochschullehrerGruppe deswissenschaftl.DienstesGruppe derStudierendenGruppe desnichtwissen.DienstesKonvent der Technisch-NaturwissenschaftlichenFakultätDekan21 Mitglieder der Gruppen imVerhältnis 11:4:4:2Frauenbeauftragte mit Antragsrechtund beratender StimmeKonvent der MedizinischenFakultätDekan21 Mitglieder der Gruppen imVerhältnis 11:4:4:2Frauenbeauftragte mit Antragsrechtund beratender StimmeStändige undnicht-ständigeAusschüsseGemeinsamerHabilitationsausschussStändige undnicht-ständigeAusschüsse® R. Labahn, aktualisiert durch M. Rudolph, 27.05.200661
ANHANGAnhang 3Gremien der <strong>Universität</strong> und der Fakultät1. Gremien des SenatsAusschussHochschullehrerWissenschaftlicheMitarbeiterStudierendeNichtwissenschaftlicheMitarbeiterZentraler Studienausschuss 5 2 2 -Zentraler Haushalts- undPlanungsausschussZentraler Ausschuss fürForschung und Wissenstransfer7 2 2 15 2 2 1Zentraler Frauenausschuss 1 1 1 1Kommission <strong>zu</strong>r Förderungdes wiss. NachwuchsesKoordinierungsausschussZentrale Hochschulbibliothek3 1 1 -2 1 1 -2. Gremien des Konvents der Medizinischen FakultätAusschussHochschullehrerWissenschaftlicheMitarbeiterStudierendeNichtwissenschaftlicheMitarbeiterHabilitationskommission 3 1 - -Promotionskommission 12 4 2 -Studienausschuss 4 2 1 -Ausschuss für Lehrkrankenhäuser 3 1 1 -Ständige Strukturkommission 9 2 2 -Forschungskommission 8 2 1 -3. Mitglieder des StudienausschussesAus der Gruppe der Hochschullehrer:• Prof. Dr. med. Jürgen Westermann, Anatomie• Prof. Dr. med. Gabriele Gillessen-Kaesbach, Humangenetik• Prof. Dr. med. Peter Mailänder, Plastische Chirurgie• Prof. Dr. med. Dr. phil. Hans-Heinrich Raspe, SozialmedizinAus der Gruppe der Wissenschaftlichen Mitarbeiter:• Prof. Dr. med. Jürgen Brinckmann, Dermatologie• Dr. med. Martin Lindig, AnästhesiologieAus der Gruppe der Studenten:• Thomas Demming62
ANHANGAnhang 4Dekanat der Medizinischen Fakultät1. StrukturDekan/in<strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>Medizinische FakultätProdekan/in 2 Prodekan/in 1 Studiendekan/inWissenschaftAkademischeSelbstverwaltungLehreForschungsförderungLOM/LbMVKennzahlensystemeTrennungsrechnung,Basisausstattung FuLBerichtswesenStrukturentwicklungHaushalt, GrundsatzangelegenheitenBerufungenEthikkommission, KEKKonvent, StrukturkommissionStudierendenangelegenheitenLehrkoordinationEvaluationHochschuldidaktikIT- Organisation2. Dekanatsmitglieder von Juli 2006 – Juni 2008DekanProf. Dr. med. Werner SolbachApp. 3040/2800, Fax 3026/2749werner.solbach@ukl.uni-luebeck.de1. ProdekanProf Dr. med. Klaus DiedrichApp. 2133, Fax 2139klaus.diedrich@uk-sh.de2. ProdekaninProf. Dr. med. Barbara WollenbergApp. 2240, Fax 4192Barbara.Wollenberg@hno.uni-luebeck.deStudiendekanProf. Dr. med. Jürgen WestermannApp. 4000, Fax 4034westermann@anat.uni-luebeck.de3. Fachbereichs-GeschäftsführerMartin RudolphApp. 3006, Fax 3026rudolph@<strong>zu</strong>v.uni-luebeck.de63
ANHANGAnhang 5Lageplan der <strong>Universität</strong> und des Klinikums64
Legende <strong>zu</strong>m Lageplan1 Verwaltung des Klinikums (mit Haus 35 und 36 a)2 Rektorat und Zentrale <strong>Universität</strong>sverwaltung4 Institut für Medizinische Biometrie und Statistik3-7 Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie8 Psychosomatik (Medizinische Klinik II)10 Klinik für Dermatologie und Venerologie12 Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Klinik für Neurochirurgie13 Klinik für Anästhesiologie, Klinik für Herzchirurgie, Klinik für Urologie undTransplantationszentrum21 Lehrauftrag Allgemeinmedizin, Fachschaft Computer Sciences undHörsäle R 1, R 322 Nephrologische Gemeinschaftspraxis23 Institut für Neuroendokrinologie, Klinik für Plastische Chirurgie, Handchirurgieund Intensiveinheit für Schwerbrandverletzte24 Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA), Fachschaft Medizin,25 Klinik für Neurologie27 Klinik für Kiefer- und Gesichtschirurgie (mit Haus 26)28 Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (mit Haus 26)29 Klinik für Augenheilkunde, Hörsäle 4, 4a31 Institut für Immunologie und Transfusionsmedizin, Blutspendedienst,33 Institut für Technische Informatik34 Sozialtherapeutisches Zentrum, Café „Altes Kesselhaus“ (Klinik fürPsychiatrie und Psychotherapie)37 Krankenpflegeschulen, Schwesternschülerinnenwohnheim40 (Zentralklinikum) - Hörsäle Z 1/2 und 3, Medizinische Kliniken I, II und III,Klinik für Chirurgie, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Klinik für Kinderchirurgie,Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin, Klinik für Strahlentherapie,Poliklinik für Rheumatologie, Institut für Neuroradiologie, Sozialdienst,Studiendekanat der Medizinischen Fakultät, Zentrallabor/KlinischeChemie, Liegend-, Not- und Unfallaufnahme, Uni-Shop, Personalkasino,Cafeteria und Frisör50 (Transitorium) - Klinik für Orthopädie, Orthopädische Werkstatt, Institut fürMolekulare Medizin, Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene,Institut für Pathologie, Institut für experimentelle und klinische Pharmakologieund Toxikologie und Klinisch-Experimentelle ForschungseinrichtungANHANG53 Hörsaal T 154 Betriebskindergarten „Uni-Zwerge“59 Mensa, Geschäftsstelle <strong>Lübeck</strong> des Studentenwerks Schleswig-Holstein60 Zentrale Hochschulbibliothek <strong>Lübeck</strong>, Dekanat der MedizinischenFakultät61 Institut für Chemie, Institut für Physik, Institut für Physiologie, FachschaftMolecular Life Science, Hörsäle V 1 und V 262 Institut für Biochemie, Institut für Medizinische Molekularbiologie63 Institut für Anatomie, Institut für Biologie und Gemeinsame Tierhaltung64 Institut für Informationssysteme, Institut für Medizinische Informatik, Institutfür Mess- und Automatisierungstechnik (Medizintechnik), Institut Multimedialeund Interaktive Systeme, Institut für Neuro- und Bioinformatik, Institutfür Robotik und Kognitive Systeme, Institut für Signalverarbeitungund Prozessrechentechnik, Institut für Softwaretechnik und Programmiersprachen,Institut für Telematik, Institut für Theoretische Informatik, Medizintechnik(mit Fachhochschule <strong>Lübeck</strong>), Zentrum für Fernstudium undWeiterbildung und Dekanat der Technisch-NaturwissenschaftlichenFakultät70 Turmgebäude, Hörsäle H 1 und H 271 Kirche, Krankenhausseelsorge72 Institut für Humangenetik73 Institut für Arbeitsmedizin, Institut für Medizinische Psychologie, BetriebsärztlicherDienst und Schwesternwohnheim74 Versorgungseinrichtungen des Klinikums75 MTA-Schule76-79 Versorgungseinrichtungen des Klinikums80 Gästehaus der <strong>Universität</strong>81 Institut für Biomedizinische Optik82 Begegnungszentrum der <strong>Universität</strong>83 Ronald McDonald-Haus für Kinderhilfe84 Haus für Spiel- und Beschäftigungstherapie65
ANHANGAnhang 6Stadtplanausschnitt <strong>Lübeck</strong>66
ANHANGAnhang 7Forschungsschwerpunkte der Medizinischen FakultätAn der Medizinischen Fakultät gibt es vier Forschungsschwerpunkte (Stand November 2006). In einemForschungsschwerpunkt sind intern geförderte Schwerpunktprogramme der Fakultät und externgeförderte Forschungsprojekte gebündelt. Im Folgenden sind Dauer und jährliche Fördersumme der<strong>zu</strong> einem Forschungsschwerpunkt <strong>zu</strong>sammengefassten Forschungsprojekte aufgeführt.Forschungsschwerpunkt Infektion und EntzündungLaufzeitFördersummepro Jahr (in €)Extern geförderte Projekte• B<strong>MB</strong>F-Netz „Entzündliche rheumatische Systemerkrankungen“ 2000 - 2006 233.333• B<strong>MB</strong>F-Netz „CAPNETZ 30 – Ambulant erworbenePneumonie“, in <strong>Lübeck</strong> mit zwei Teilprojekten vertreten:- CAPNETZ LCC 2002 - 2006 187.000- CAPNETZ Epidemiologie, Statistik, Versorgungsforschung 2005 - 2007 130.000Intern geförderte Schwerpunktprogramme• Schwerpunktprogramm Autoimmunität 2006 - 2007 200.000• Schwerpunktprogramm Körpereigene Infektabwehr 2000 - 2006 303.333Forschungsschwerpunkt GenomforschungExtern geförderte Projekte• EU-Projekt „Cardiogenics“ 2006 - 2010 2.500.000• B<strong>MB</strong>F - Nationales Genomforschungsnetz 2 „Herz-Kreislauf“ 2004 - 2007 333.333• B<strong>MB</strong>F – Kompetenznetz „Herzinsuffizienz“ 2003 - 2008 150.000Intern gefördertes Schwerpunktprogramm• Infrastrukturmaßnahme „Genomforschung“ 2006 200.000Forschungsschwerpunkt Endokrine Steuerung und RegulationExtern geförderte Projekte• SFB 654 „Schlaf und Plastizität“ (16 Teilprojekte, Phase 1) 2005 - 2009 1.462.800• KFG 31 126 „Selfish Brain: Gehirnglukose und MetabolischesSyndrom“2004 - 2010 800.000• B<strong>MB</strong>F-Netz „Störung der somatosexuellen Differenzierung undIntersexualität“, Teilprojekt „Klinische Auswirkungen und molekulare2004 - 2006 45.000Grundlagen von Störungen der AndrogenbiosyntheseIntern gefördertes Schwerpunktprogramm• Schwerpunktprogramm Reproduktionsmedizin 2003 - 2006 216.666Forschungsschwerpunkt Biomedizinische TechnologienExtern gefördertes Projekt• B<strong>MB</strong>F-Projekt SOMIT 32 – Verbund FUSION 33 2005 - 2010 772.468Intern geförderte Schwerpunktprogramme:• Schwerpunktprogramm Regenerative Medizin 2006 250.000• Universitärer Schwerpunkt „Medizintechnik“ 2006 250.00030 CAP: Community Acquired Pneumonia31 KFG: Klinische Forschergruppe32 SOMIT: Schonendes Operieren mit innovativer Technik33 FUSION: Future environment for gentle liver surgery using image-guided planning and intra-operative navigation67
ANHANGAnhang 8Zentrum für medizinische Struktur- und Zellbiologie (ZMSZ)Die Stärke der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> (UzL) liegt in der interdisziplinären Zusammenarbeit einer Vielzahlvon Forschungsinstituten <strong>zu</strong>r Erforschung und Behandlung von Krankheiten. Um dies deutlich <strong>zu</strong>machen, haben sich im Jahre 2005 Institute der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (TNF)und der Medizinischen Fakultät (MF) der <strong>Universität</strong>, sowie das Forschungszentrum Borstel <strong>zu</strong>m Zentrumfür medizinische Struktur- und Zellbiologie (ZMSZ) <strong>zu</strong>sammengeschlossen.Das Zentrum besteht aus 13 Instituten, deren Leiter teilweise beiden Fakultäten angehören:• Anatomie (UzL: MF, TNF),• Biochemie (UzL: TNF),• Biologie (UzL: TNF),• Biomedizinische Optik (UzL: MF, TNF),• Chemie (UzL: TNF),• Immunchemie und Biochemische Mikrobiologie (FZB: TNF),• Immunologie und Zellbiologie (FZB: MF),• Medizinische Mikrobiologie und Hygiene (UzL: MF, TNF),• Molekulare Medizin (UzL: MF, TNF),• Medizinische Molekularbiologie (UzL: TNF),• Pharmakologie (UzL: MF),• Physik (UzL: TNF),• Physiologie (UzL: MF, TNF).Das ZMSZ hat sich <strong>zu</strong>m Ziel gesetzt, die lokalen Stärken in der Forschung auf dem Gebiet der medizinischenStruktur- und Zellbiologie aus<strong>zu</strong>weiten, indem gemeinsame Forschungsprojekte initiiert unddurchgeführt werden sollen. Das Zentrum ist überregional mit anderen Forschungsinstituten der LifeSciences, wie z.B. dem Tropeninstitut (Bernhard-Nocht-Institut) und dem DESY in Hamburg, sowieder <strong>Universität</strong> Kiel im Rahmen der Entzündungsforschung und von Sonderforschungsbereichen (<strong>zu</strong>mBeispiel SFB 654) vernetzt. Damit verfügen die <strong>Lübeck</strong>er Medizinstudenten über eine ausgezeichnetePlattform, um Medizinische Dissertationen auf höchstem Niveau anfertigen <strong>zu</strong> können.Welche Fragestellungen erforscht das ZMSZ?Die Forschungsaktivitäten des ZMSZ beschäftigen sich vor allem mit der Aufklärung der molekularenGrundlagen und der Funktion von Zellen, Viren und Biomolekülen, um unter anderem folgende Fragestellungenbeantworten <strong>zu</strong> können:• Wie erkennt ein Virus oder Bakterium die menschliche Zelle?• Wie gelangt virale Erbsubstanz <strong>zu</strong>m Zellkern?• Welche Entzündungssubstanzen sind für eine Diagnose entscheidend?• Wie gelangen Antigene durch die Schleimhaut?• Welche Wirkstoffe können die Infektionen stoppen (Medikamententwicklung)?• Wie können Zellen genutzt werden, um Geweberegeneration <strong>zu</strong> induzieren?Leiter dieses Zentrums ist Prof. Dr. Enno Hartmann.68
ANHANGAnhang 9Weiterentwicklung der Lehre - Strategie-WorkshopResümee <strong>zu</strong>m ‚Strategieworkshop Lehre’Der am 18. und 19. Juni 2004 durchgeführte ‚Strategieworkshop Lehre’ an der Medizinischen Fakultät der <strong>Universität</strong><strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> wurde vom Studiendekanat initiiert. Teilgenommen haben die Kanzlerin, der Dekan, Lehrstuhlinhaber,wissenschaftliche Mitarbeiter, studentische Vertreter sowie Vertreter aus dem Bereich der Verwaltung.Unter Moderation eines externen Beraters wurde in diesem Workshop ein Projektplan erstellt, dessen Realisierungeinen Beitrag <strong>zu</strong>r qualitativen Verbesserung der Lehre in der humanmedizinischen Ausbildung leisten wird.Ziel ist es, mit diesem Projekt die Lehre in <strong>Lübeck</strong> <strong>zu</strong> optimieren, um 1. exzellente Ärzte und Wissenschaftleraus<strong>zu</strong>bilden und damit der ethischen Verantwortung von Seiten der Ausbilder ebenso wie den Bedürfnissen derGesellschaft nach einer bestmöglichen medizinischen Versorgung gerecht <strong>zu</strong> werden und 2. die <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong><strong>Lübeck</strong> als Studienort noch attraktiver <strong>zu</strong> machen, exzellente Studenten für <strong>Lübeck</strong> <strong>zu</strong> gewinnen und langfristigden Standort als einen der besten in Deutschland <strong>zu</strong> wahren. Das Hauptziel des Projektes liegt in der Definition,Abstimmung und Umset<strong>zu</strong>ng messbarer Ausbildungsziele in vier großen Themenbereichen, die wir an dieserStelle kurz ausführen:1. Medizinisches Fachwissen: Der Student soll am Ende seiner Ausbildung die 50 wichtigsten Erkrankungender Allgemeinarztpraxis diagnostizieren und behandeln können.2. Praktische Fertigkeiten: Jeder Student hatte bis <strong>zu</strong>m Ende seiner Ausbildung die Gelegenheit bestimmteFertigkeiten in einem bestimmten Umfang strukturiert <strong>zu</strong> üben und sich an<strong>zu</strong>eignen. Hier<strong>zu</strong> soll der Studententsprechend der Bedeutung eines jeweiligen Faches für einen gewissen Zeitraum ganztägig in die klinischeVersorgung eingebunden sein und hierbei jeweils zwei Patienten pro Woche betreuen und vorstellenkönnen.3. Soziale Kompetenz: Der Student soll <strong>zu</strong>m Ende des Studiums für alle relevanten Situationen seines Berufesausgebildet sein. Hier<strong>zu</strong> gehören u. a. die Fähigkeit <strong>zu</strong> einem angemessenen Umgang mit Patienten, dasÜberbringen von schlechten Nachrichten und Teamfähigkeit am Arbeitsplatz.4. Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren: Der Student soll <strong>zu</strong> einem vorgegebenen klinischen Themaaus mindestens vier Quellen Informationen beschaffen und sie nach Evidenzgraden präsentieren können.Die Lernzielkataloge gilt es im Einzelnen im Rahmen des Projektes für jeden Themenbereich aus<strong>zu</strong>arbeitenbzw. <strong>zu</strong> erweitern, sofern bereits Ansätze formuliert sind. Alle Lehrziele werden transparent und somit mess- undprüfbar sein. Die Ausformulierung und Abstimmung der Überprüfung wird ebenfalls im Projekt geschehen.Ferner sind folgende Schwerpunkte außerhalb der Lerninhalte in diesem Projektplan vorgesehen, um die obengenannten Ziele <strong>zu</strong> erreichen: Student, Marketing, Leistungsanreize, Hochschuldidaktik, Infrastruktur. Der Studentsoll durch ein obligatorisches Mentorenprogramm mit messbaren Zielset<strong>zu</strong>ngen und einer Gruppengrößevon maximal fünf bis sechs Studenten ergänzt werden. Gezielte Marketingmaßnahmen beabsichtigen die Bekanntheitund Attraktivität der Medizinischen Fakultät <strong>Lübeck</strong> <strong>zu</strong> steigern. Dies soll mittels eines von der Stadtaufgelegten Studenten-Paketes geschehen, das noch bessere Bedingungen für das Semesterticket schafft, dasAngebot an Studentenpreisen erhöht und durch ein Theater-Ticket einen kulturellen Beitrag leistet. Der Projektplansieht ferner vor, Leistungsanreize für die Umset<strong>zu</strong>ng exzellenter Lehre in einem Umfang von zehn Auszeichnungenpro Studienjahr ein<strong>zu</strong>führen. Hier wird <strong>zu</strong>m einen die Vergabe einer Urkunde für eine unterrichtendeInstitution vorgeschlagen und <strong>zu</strong>m anderen die Vergabe geldwerter Vorteile für Lehrende (viermal) und Lernende(fünfmal). Alle Auszeichnungen sollen der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Im Bereich der Infrastrukturist beabsichtigt, nach Befragung der Studenten die Rahmenbedingungen <strong>zu</strong> verbessern. Hier<strong>zu</strong> gehörenz. B. Bibliotheksöffnungszeiten, Online Lizenzen, Computerräume für Studenten, Buchsortiment, Zugang <strong>zu</strong>Institutsbibliotheken und Lernprogramme. Zur Ausarbeitung dieser Zielset<strong>zu</strong>ng einschließlich ihrer Messbarkeitwird eine eigene Arbeitsgruppe eingesetzt.Zum Projektrahmen ist <strong>zu</strong> ergänzen, dass die Dauer des Projektes auf drei Jahre angelegt ist und die Kosten mit1 Mio. € eingeschätzt werden. Für alle Projektabschnitte werden Arbeitsgruppen gebildet. Bezüglich des zeitlichenAblaufs gibt es folgenden Überblick: Nach Genehmigung des Projektes können die Arbeitsgruppen spätestensAnfang 2005 ihre Arbeit beginnen, um <strong>zu</strong>m Ende des Jahres 2005 die Ausbildungsziele und anderen Zielset<strong>zu</strong>ngendieses Projektes abgestimmt <strong>zu</strong> haben. Die Umset<strong>zu</strong>ng wird dann von Anfang 2006 bis Mitte 2007erfolgen.Für weitere Ausführungen stehen das Studiendekanat sowie alle Workshop-Beteiligten jederzeit gern <strong>zu</strong>r Verfügung.69
ANHANGAnhang 10Weiterentwicklung der Lehre - Projekt ‚Lehrzielkataloge’Ein wesentlicher Teil der Curriculumentwicklung in der Medizinerausbildung ist nach KERN 34 die Formulierungvon Lehrzielen. Basierend auf dem Ergebnis des Strategie-Workshops <strong>zu</strong>r Entwicklung derLehre (Anhang 9) werden, beginnend mit dem Praktischen Jahr, für alle Ausbildungsbereiche desMedizinstudiums sukzessive Lehrziele formuliert. Dies wird die Koordination der Fächer untereinanderbefördern und einen wesentlichen Anstoß <strong>zu</strong> lehrzielorientierten Prüfungsformen geben. Ziel desProjekts ist die Kompilation eines Gesamt-Lehrziel-Katalogs für die Mediziner-Ausbildung in <strong>Lübeck</strong>.Lehrziele sind an ‚Gesundheitsstörungen’ 35 ausgerichtet. Das angestrebte Niveau des Könnens derStudenten wird festgelegt. Die Gesundheitsstörung:• ist bekannt,• kann diagnostiziert werden,• kann behandelt (therapiert) werden (in verschiedenen Graden der Selbstständigkeit).Die Beschreibung der Lehrziele geschieht in den formalen Kategorien:• Kenntnisse (knowledge),• Fertigkeiten (skills) und• Einstellungen (attitudes).Die Bestandteile eines ausformulierten Lehrziels sind:Wer [1] tut [2], wie viel (wie gut) [3], was [4] und wann [5]?[1] = Person; [2] = Aktion; [3] = Bedingung; [4] = Inhalt; [5] =Zeit+ Positives Beispiel:Der Student des 6. Semesters [1] kann nach dem Radiologie-Kurs [5] in einem p. a.-Röntgenbild desThorax Verschattungen des Lungenparenchyms mit einer Größe von mehr als 2 cm Durchmesser [4] inmehr als 80% der Fälle [3] identifizieren [2].- Negatives Beispiel:Der Student ist fähig, Verschattungen des Lungenparenchyms <strong>zu</strong> erkennen.Die Entwicklung der Lehrzielkataloge folgt einem standardisierten Ablauf (zehn Schritte):1. Entscheidung, von welchen Quellen ausgegangen werden soll: welche Gegenstandskataloge,welche Lehrbücher sind relevant?2. Festlegung, für welchen Ausbildungsabschnitt Lehrziele formuliert werden sollen. Zuordnung derInhalte <strong>zu</strong> den Abschnitten.3. Konsenserreichung über die Relevanz der Teilthemen (<strong>zu</strong>m Beispiel durch Ratingverfahren).4. Festlegung auf eine Anzahl der Lehrziele pro Teilgebiet und kognitive Leistungsstufe, auf der einLehrziel formuliert werden soll. (Wissen, Verstehen, Anwenden, Beurteilen, …), Hilfsmittel: Matrix.5. Festlegung der Arbeitstechnik.6. Festlegen der Hilfsmittel (Karteikarte mit Gebiets- und Leistungsstufen-Signatur; Verwendung e-lektronischer Hilfsmittel).7. Redaktionskonferenz, die für jedes Lehrziel strikt überprüft,- ob das erwünschte und beobachtbare Endverhalten (Leistung),- die wichtigsten Bedingungen, unter denen das Verhalten gezeigt werden soll,- der Beurteilungs- oder Bewertungsmaßstab ausformuliert worden sind.8. Ausrichtung der Lehrveranstaltungen nach diesen Zielen.9. Veröffentlichung vor den Lehrveranstaltungen und vor den Leistungsüberprüfungen.10. Evaluation des Lehrzielorientierten Vorgehens (mit vor<strong>zu</strong>sehender Revision der Lehrziele).34 Kern, D. E. et al.: Curriculum Development for Medical Education: A Six-Step Approach35 Sprachgebrauch des IMPP70
ANHANGAnhang 11Weiterentwicklung der Lehre - Projekt ‚Professionell Prüfen’Projekt ‚Professionell Prüfen’ (Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik)ProjektskizzeDie Lehrenden und Prüfenden der Medizinischen Fakultät der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> bringendas Prüfungswesen in den nächsten Jahren auf einen hohen Standard. Es wird wirklich dasgeprüft, was für die Ausübung der ärztlichen Tätigkeit notwendig ist. Es wird mit adäquaten Methodengeprüft, die ihrerseits notwendigen Anforderungen genügen.Nach der Vorstellung, dass Prüfungen das Curriculum beeinflussen (Asessment drives Curriculum),werden sich bei Veränderung der Prüfungen auch Auswirkungen auf den Lehrplan ergeben.Ein Ergebnis wird sein, dass Lehrziele formuliert werden und dass die Abfolge des Studiumsgeändert wird.Durch Verwendung verschiedener Prüfungsformen (MC, OSCE, DOPS, Mini-Cex, Portfolio,OSLER) werden auch verschiedene Lehrformen notwendig. Die Organisation der Prüfungenwird sich teilweise ändern. Es wird erhoben werden, welchen Ressourcenbedarf professionellePrüfungen nach sich ziehen. Ein Zwischenergebnis des Projekts ist eine ausformulierte Prüfungsordnung.Im Verlauf des Projekts wird ein Handbuch über Prüfungen erstellt, in dem dasPrüfungswesen von verschiedenen Seiten betrachtet wird.Zeit- und RessourcenplanungDas Projekt erstreckt sich über zwei Jahre. Ressourcenbedarfsermittlung und Zeitplanerstellungsind in Arbeit.Produkte des Projekts• Prüfungshandbuch• Annotierte Literaturübersicht über Prüfungen• Projektpläne, Checklisten und Durchführungsanleitungen für die verschiedenen Prüfungsarten• Prüfungsmanagement-(IT-)System• Mustersammlung von Fragen, Fragen-Pools• Workshop-Konzepte für Weiterbildungsthemen• Beurteilungen von technischen Unterstüt<strong>zu</strong>ngen (Mobi-TED ® , PC-gestützte Systeme<strong>zu</strong>r Prüfungsdurchführung)Geplante Aktivitäten• Durchführung mehrerer Workshops (neben den bereits bestehenden), <strong>zu</strong>m Beispiel <strong>zu</strong>rErstellung von MC-Klausuren, <strong>zu</strong>r Prüfungsform OSCE, Prüfertraining. Eine Bedarfserhebungwird weitere Themen identifizieren.• ‘Tagung’ mit Fachleuten auf diesem Gebiet (hier ist eine Nutzenabwägung notwendig).• Dienstreisen <strong>zu</strong> verschiedenen Fakultäten, die bereits Aktivitäten auf dem Gebiet derPrüfungen vorweisen können.• Ausbildung von Simulationspatienten• Einrichtung eines Skill-LabsBereits durchgeführte Aktivitäten• Vortrag über die Gestaltung von Prüfungssprechstunden• Workshops über Mündliche Prüfungen und Prüfungssprechstunden• Beratung (Coaching) von Studenten vor Prüfungen (Lernberatung)• Entwicklung eines System <strong>zu</strong>r Erstellung und Auswertung von ‘abschreibsicheren’ MC-Klausuren und dessen Einsatz• Beratung in der Praxis bei der Formulierung von MC-Fragen, Erstellung von Cut-Offs,Anlegen einer MC-Fragen-Datenbank71
ANHANGAnhang 12Lehraufträge der <strong>Universität</strong>Im Studienjahr 2006 wurden an der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> insgesamt 24 Lehraufträge vergeben.Schwerpunkt ist dabei die Sprachförderung.Lehrauftrag SWS im WS 05/06 SWS im SS 06Allgemeinmedizin (3 Lehrbeauftragte) 6 6Arbeitsmedizin 1 Einzelstunde 1 EinzelstundeDeutsch Grundkurs - 2Deutsch Mittelstufe - 2Englisch für Studierende der Medizin 2 2Französisch Grundkurs 2 -Französisch Mittelstufe - 2Musik und Computer 2 2Norwegisch Grundkurs - 2Software Engineering 2 -Spanisch Grundkurs 2 2Spanisch Mittelstufe 2 -Traditionelle Chinesische Medizin, Akupunktur 2 2Tropenmedizin - 1,6<strong>Universität</strong>schor 2 2<strong>Universität</strong>sorchester 2 272
ANHANGB. ABLAUF DES STUDIUMSVorklinikAnhang 13Pflichtcurriculum VorklinikAnhang 14Wahlfächer in der VorklinikAnhang 15Beispiel 1. Studienjahr: AnatomieAnhang 16Beispiel 2. Studienjahr: PhysiologieKlinikAnhang 17Pflichtcurriculum KlinikAnhang 18Wahlfächer in der KlinikAnhang 19Beispiel Wahlfach: Gender in der MedizinAnhang 20Beispiel 3. Studienjahr: Hygiene, Mikrobiologie und VirologieAnhang 21Beispiel 4. Studienjahr: Blockpraktikum AnästhesiologieAnhang 22Beispiel 5. Studienjahr: Psychische StörungenPraktisches JahrAnhang 23PJ-Einrichtungen des UK S-H (Campus <strong>Lübeck</strong>)Anhang 24Akademische LehrkrankenhäuserAnhang 25PJ in der Inneren MedizinAnhang 26„PJ-Pass“ für die Innere Medizin / ChirurgieSonstigesAnhang 27Evidenzbasierte Medizin im MedizinstudiumAnhang 28Palliativmedizin im Pflichtcurriculum73
ANHANGAnhang 13Pflichtcurriculum VorklinikIn der ÄAppO sind die Leistungsnachweise festgelegt, die im vorklinischen Abschnitt <strong>zu</strong> erwerbensind. Nachstehender Tabelle ist institutionsbezogen die Art des Unterrichts (Vorlesung, Praktikum,Seminar) 36 und der Umfang für den Erwerb der Leistungsnachweise <strong>zu</strong> entnehmen, deren Besuch beider Meldung <strong>zu</strong>m Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nach<strong>zu</strong>weisen sind. Außerdem gibt sie an,in welchem Semester die Leistungsnachweise <strong>zu</strong> erwerben sind.Der Begriff der SWS hat eine unterschiedliche Bedeutung, je nach dem, ob er aus der Sicht der Studentenoder der Dozenten angewandt wird. Wenn er, wie in dieser Tabelle, aus Sicht der Studentengenutzt wird, müssen die angegebenen Zahlen mit der Wochenanzahl eines Semesters multipliziertwerden, um die absolute Anzahl der akademischen Stunden <strong>zu</strong> erhalten. Beispielsweise hat das Praktikumder Physik einen Umfang von 42 akademischen Stunden (3 SWS x 14 Wochen). Wird der BegriffSWS aus Sicht des Dozenten benutzt, muss er mit der Anzahl der Wochen eines Studienjahres,WS und SS, multipliziert werden. Um also für eine Studentengruppe die 42 akademischen Stundendes Praktikums für Physik ab<strong>zu</strong>halten, muss ein Dozent mit 1,5 SWS eingesetzt werden (1,5 SWS x28 Wochen = 42 akademische Stunden).Leistungsnachweisgemäß Anhang 1 der ÄAppOInstitutionVorlesungenPraktikumSeminar ISeminar IISeminar III<strong>zu</strong> erwerben inSemesterKursus der Makroskopischen Anatomie Institut für Anatomie 12 9 - - - 1 und 2Kursus der Medizinischen Psychologieund Medizinischen SoziologieInstitut für Med. Psychologie 3 1 - - - 3Kursus der Mikroskopischen Anatomie Institut für Anatomie 4 3 - - - 2Praktikum der Berufsfelderkundung Institut für Anatomie - 1 - - - 1 und 2Praktikum der Biochemie/MolekularbiologieInstitut für Biochemie 8 5 - - - 3 und 4Praktikum der Biologie Institut für Biologie 4 4 - - - 1Praktikum der Chemie Institut für Chemie 6 4 - - - 1 und 2Praktikum der medizinischenInstitut für Medizin- undTerminologieWissenschaftsgeschichte- 1 - - - 1Praktikum der Physik Institut für Physik 5 3 - - - 1 und 2Praktikum der Physiologie Institut für Physiologie 11 6 - - - 3 und 4Praktikum <strong>zu</strong>r Einführung in dieInstitut für SozialmedizinKlinische MedizinMedizinische Kliniken- 2 - - - 1Seminar Anatomie Institut für Anatomie - - 2 1 4 1 bis 3Seminar Biochemie/Molekularbiologie Institut für Biochemie - - 1 1 1 3 und 4Seminar der Medizinischen Psychologieund Medizinischen Soziologie jeweilsmit klinischen BezügenInstitut für Med. PsychologieInstitut für HumangenetikInstitut für Medizin- undWissenschaftsgeschichte- - 1 1 1 3 und 4Seminar Physiologie Institut für Physiologie - - 1 1 1 3 und 4Wahlfach Alle Institutionen 1 1 - - - 3 oder 4Summe SWS 54 40 5 4 7Summe akademischer Stunden 756 560 70 56 98Vorgaben ÄAppO --- 630 56 98Seminar I: Seminare nach Anlage 1 ÄAppO; Seminare II: Seminare nach § 2 Abs. 2 Satz 5 ÄAppO (weitere Seminare mit klinischemBe<strong>zu</strong>g); Seminare III: Seminare nach § 2 Abs. 2 Satz 5 ÄAppO (Seminare als integrierte Veranstaltung mit Einbeziehungklinischer Fächer)36 Angaben in SWS74
ANHANGAnhang 14Wahlfächer in der VorklinikIm vorklinischen Studienabschnitt muss ein Leistungsnachweis in einem Wahlfach erbracht werden.Seit dem Studienjahr 2005 werden folgende Wahlfächer angeboten (durchschnittlicher Umfang: 2SWS):InstitutionWahlfächerInstitut für Anatomie • Chirurgische und topographische Anatomie für Fortgeschrittene• Diagnostischer Ultraschall – Physik und Anwendung• Funktionelle Anatomie des Immunsystems• Klinisch-funktionell orientierte mikroskopische AnatomieKlinik für Anästhesiologie • Literarisches ColloquiumInstitut für Biochemie • BiochemieInstitut für Biologie • ZellbiologieInstitut für Chemie • NMR-Spektroskopie und Organische Chemie• Biophysikalische Chemie - Strukturen von BiomolekülenInstitut für Medizin- undWissenschaftsgeschichteInstitut für MedizinischePsychologie• Geschichte der Medizintechnik• Arzt und Patient in der Literatur und der Medizin derKlassik und Romantik• Patient und Arzt im DialogInstitut für Physik • Biophysik IInstitut für Physiologie • Sportphysiologie - unter besonderer Berücksichtigungdes Breitensports• Molekularbiologie und Therapie endokriner Erkrankungen(nur WS)• Endokrinologie der Niere (nur SS)Klinik für Plastische Chirurgie • Gender in der MedizinInstitut für Sozialmedizin • Klinische Rehabilitation - Ringvorlesung75
ANHANGAnhang 15Beispiel 1. Studienjahr: AnatomieDer Unterricht im Fach Anatomie: Lehre aus einem GussAllgemeinesDer Anatomieunterricht spielt im Medizinstudium eine große Rolle. Von den rund 1.500 Stunden Unterricht,die jeder Student im Rahmen seiner zweijährigen vorklinischen Ausbildung erhält, entfallen in<strong>Lübeck</strong> 500 Stunden auf das Fach Anatomie und decken vier von 17 Pflichtveranstaltungen ab.Didaktisches PrinzipIn einer Einführungsveranstaltung gleich <strong>zu</strong> Beginn des Studiums werden die Ziele des Anatomieunterrichtsbesprochen. Schon im ersten Semester beginnt der Kursus der Makroskopischen Anatomie.Der Unterricht in Anatomie erstreckt sich über alle vier Semester der Vorklinik. Dabei werden die einzelnenThemenblöcke stets auf die folgende Weise bearbeitet. Zunächst werden die notwendigenGrundlagen in der Vorlesung vermittelt. Dann bereiten sich die Studenten mit Hilfe eines Skripts aufden Kurs vor. Im Skript sind die Lern- und Präparierziele präzise aufgeführt, so dass eine selbstständigeVorbereitung ermöglicht wird. Im Präparierkurs, der 14 Tage nach der Behandlung des Themasin der Vorlesung stattfindet, wird das erworbene Wissen begreifbar gemacht. Zusammen mit Kollegenaus der Klinik wird in einer gemeinsamen Veranstaltung, die wöchentlich stattfindet und thematischmit dem Kurs abgestimmt ist, kontinuierlich die klinische Relevanz des Erarbeiteten überprüft. Anschließendwerden die Themen in Seminaren, die in Form der „Anatomie am Lebenden“ abgehaltenwerden, vertieft und hinterfragt. Der Lernfortschritt wird wöchentlich durch kurze mündliche Testatekontrolliert, um auf ein kontinuierliches Lernverhalten hin<strong>zu</strong>wirken und bei Schwierigkeiten schnellhelfen <strong>zu</strong> können. Dabei werden die Studenten in den Kursen und Seminaren von denselben Dozentenbetreut, so dass über 2,5 Semester ein sehr persönlicher Kontakt entsteht. Fragen und Probleme(auch persönlicher Art) können so schnell und kompetent geklärt werden.Die Inhalte des Anatomieunterrichts werden in Absprache mit den Studenten aktualisiert. Dabei helfendie institutsinternen Evaluationsergebnisse, die regelmäßig erhoben und für alle <strong>zu</strong>gänglich auf derInternetseite des Instituts für Anatomie veröffentlicht werden. Durch die Vorlesung und die Internetseitedes Instituts werden die verschiedenen Veranstaltungen der Anatomie für die Studenten <strong>zu</strong> einemAngebot aus einem Guss koordiniert.AblaufAuf diese Weise werden im 1. Semester die Themen Rumpf, untere und obere Extremität, im 2. Semesterdie Themen Thorax, Kopf, Abdomen und Becken (koordiniert mit der mikroskopischen Anatomie)und in der ersten Hälfte des 3. Semesters das Thema Neuroanatomie abgehandelt.Am Ende des 4. Semesters, das den Abschluss der vorklinischen Ausbildung bildet, steht die Gedenkfeierfür die Körperspender. Der Gottesdienst wird von den beiden Studentenpastoren gehalten undvon den Studenten musikalisch ausgestaltet. Die Studenten statten den Körperspendern auch dadurchihren Dank ab, indem sie die Namen der Verstorbenen, eingebettet in Fürbitten, vorlesen undfür jeden von ihnen eine Kerze entzünden.76
ANHANGAnhang 16Beispiel 2. Studienjahr: PhysiologieDer Unterricht im Fach Physiologie: Grundlage ärztlicher Diagnostik und TherapieDefinition: Die Physiologie als integrative vorklinische Wissenschaft, die primär das Verständnis derLebensvorgänge im gesunden menschlichen Organismus beschreibt, vermittelt Grundkenntnisse, diees den Studenten während der klinischen Weiterbildung ermöglichen, Erkrankungen <strong>zu</strong> erkennen undadäquat <strong>zu</strong> behandeln. Gesundheit beruht auf dem funktionierenden Miteinander - der Kommunikationüber Zell-Zellkontakte, Nerven und Hormone - der Zellen, Organe und Organsysteme des Gesamtorganismus.Krankheit resultiert, wenn diese Kommunikation gestört ist.Curriculare Unterrichtsveranstaltungen: Grundlegendes Element ist die Hauptvorlesung, diezweisemestrig mit 5 SWS gehalten wird. Diese Vorlesung ist mit den praktischen Übungen im WS:animalische Physiologie (Aufbau und Kommunikation von Zellverbänden, Muskulatur, Sinne, höhereFunktionen des ZNS, neurovegetative Regulationen, Ernährung und Energiehaushalt) und im SS:vegetative Physiologie (Kreislaufsystem, Blut, Atmung und Säurebasenhaushalt, Niere, Endokrinologie)koordiniert. Bereits in diesem Stadium sollten Medizinstudenten gute Kenntnisse der Anatomiehaben, auf die aufgebaut werden kann. Mit der Biochemie überlappende Themen (Blut, Endokrinologie,etc.) werden möglichst komplementär behandelt. Ziel ist es dabei, den Studenten ein gutes Verständnispathophysiologischer Funktionsabläufe unter Einbeziehung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse<strong>zu</strong> vermitteln. Dies wird durch den gemeinsamen Besuch der Veranstaltung durch Studentender Bachelor/Master-Studiengänge Molecular Life Science und Computational Life Science gefördert,weil damit verstärkt das gemeinsame Spektrum vom Molekül bis <strong>zu</strong>m Krankenbett betrachtet undseitens der Studenten diskutiert wird. Die wesentlichen Inhalte der Vorlesungen werden den Studentenpasswortgeschützt über das Netzwerk der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong>m Eigenstudium <strong>zu</strong>r Verfügung gestellt. Inden Praktischen Übungen (pro Semester 7 x 5 bis 6 Stunden) bearbeiten die Studenten medizinischrelevante Aufgaben unter Anleitung, Aufsicht und Verantwortung ausgebildeter Lehrkräfte (Gruppengröße15 bis 20). Unter Berücksichtigung studentischer Evaluation konnte v.a. in atmosphärischerHinsicht die Akzeptanz der Übungen weiter verbessert werden. Dank der lokalen Unterstüt<strong>zu</strong>ng durchklinische Institutionen führen die Studenten technisch sehr anspruchsvolle Untersuchungen an sichselber durch (z.B. Schlaf-EEG-Registrierung, Darstellung sensorisch evozierter Hirnpotentiale,Elektromyographie, computergestützte statische Perimetrie, Audiometrie, EKG, Lungenfunktionsprüfungen).Zur Vorbereitung bekommen die Studenten ausführliche gedruckte Anleitungen. Zudem wirdder Inhalt der Übungen unter technischen und medizinischen Gesichtspunkten in einem 1,5-stündigenSeminar vor den Übungen besprochen, wobei den Studenten Gelegenheit gegeben wird, eigenständigReferate <strong>zu</strong> halten. In einer Abschlussbesprechung werden die Ergebnisse der experimentellenÜbungen nicht nur unter theoretischen Gesichtspunkten diskutiert sondern insbesondere auch derpathophysiologische Hintergrund beleuchtet. Darüber hinaus nimmt jeder Student pro Semester anzwei Zusatzseminaren teil, in denen er vertiefende Vorträge über (patho)physiologische Themen hält,<strong>zu</strong> denen keine praktischen Übungen durchgeführt werden (u.a. Stoffaustausch zwischen Zellen, Ernährung,Verdauung, Sexualfunktionen, Schwangerschaft und Geburt). Jeder Student ist angehalten,mindestens zwei Übungsseminar-Referate und ein Zusatzseminar-Referat pro Studienjahr <strong>zu</strong> halten.Somit schulen die angehenden Ärzte auch ihre Präsentations- und Artikulationsfähigkeiten. ZumNachweis der erfolgreichen Teilnahme an den praktischen Übungen und den Seminaren werden regelmäßigmündliche sowie schriftliche Prüfungen nach dem Multiple-Choice-Verfahren durchgeführt.Fakultative Lehrveranstaltungen: In ‚Virtuelles Physiologie-Labor’ (zweisemestrig, 2 SWS) wirdinteressierten Studenten die Möglichkeit gegeben, mittels Computersimulationsprogrammen physiologischeSachverhalte PC-gestützt intensiver <strong>zu</strong> analysieren. Außerdem stehen nach Absprache diePC-Labore und die Instituts-Videothek für das Eigenstudium <strong>zu</strong>r Verfügung. Studenten, die sich bereitsin diesem frühen Stadium für aktuelle Forschungsfragen interessieren, nehmen am wöchentlichenPhysiologisches Kolloquium teil. Darüber hinaus bieten Mitarbeiter des Instituts die Pflichtwahlfächer"Molekularbiologie und Therapie endokriner Erkrankungen" (WS) und "Sportphysiologie"(SS) an, in denen nicht nur durch Frontalpräsentationen der Dozenten der Physiologie und klinischerKollegen, sondern auch durch Vorträge und Rollenspiele (Arzt, Patient) der Studenten tiefergehendephysiologisch-chemische und pharmakologische bzw. sportmedizinische Kenntnisse vermittelt werden(auch unter Nut<strong>zu</strong>ng englischsprachiger Literatur). Im WS wird <strong>zu</strong>dem der Workshop für Doktoranden<strong>zu</strong>r Verbesserung der Vortrags- und Redetechnik angeboten. Mit diesem Lehrangebot soll beiden Studenten über die allgemeinen Prüfungsanforderungen hinausgehend Interesse an krankheitsorientierterForschung geweckt werden.77
ANHANGAnhang 17Pflichtcurriculum KlinikDie ÄAppO legt die Leistungsnachweise fest, die im klinischen Abschnitt <strong>zu</strong> erwerben sind. Die nachstehendeTabelle umfasst institutionsbezogen die Leistungsnachweise, die bei der Meldung <strong>zu</strong>mZweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nach<strong>zu</strong>weisen sind 37 . Dieses klinische Pflichtcurriculum hateinen Umfang von insgesamt 868 akademischen Stunden, ohne Vorlesungen.Leistungsnachweisegemäß § 27 ÄAppOInstitutionVorlesungPraktikumSeminarUnterricht amKrankenbettSemesterAllgemeinmedizin Lehrauftrag für Allgemeinmedizin 1 - 0,5 - 9 oder 10Anästhesiologie Klinik für Anästhesiologie 2 - - 2 7 oder 8Arbeitsmedizin, SozialmedizinInstitut für Sozialmedizin - - 1 - 7 oder 8Institut für Arbeitsmedizin 1 - - - 9 oder 10Augenheilkunde Klinik für Augenheilkunde 3 - - 1 9 oder 10Chirurgie Kliniken für Chirurgie 1 - - 2 5Dermatologie, VenerologieKlinik für Dermatologie und Venerologie3 - 1 1 9 oder 10Frauenheilkunde, GeburtshilfeKlinik für Frauenheilkunde undGeburtshilfe1 - - 0,5 6Hals-Nasen-OhrenheilkundeKlinik für Hals,- Nasen,- und Ohrenheilkunde1 - - 1,5 9 oder 10Humangenetik Institut für Humangenetik 2 - - - 6Hygiene, Mikrobiologie, VirologieInstitut für Medizinische Mikrobiologieund Hygiene5 4 - - 5 oder 6Innere Medizin Kliniken für Innere Medizin 1 - - 2 5KinderheilkundeKlinik für Kinder- und Jugendmedizin2 - - 1 6Klinische Chemie, LaboratoriumsdiagnostikZentrallabor / Klinische Chemie 2 2 - - 6Neurologie Klinik für Neurologie 3 - - 2 9 oder 10Orthopädie Klinik für Orthopädie 1 - - 1 9 oder 10Pathologie Institut für Pathologie 4 1 - - 5 bis 6Pharmakologie, ToxikologieInstitut für experim. und klin.Pharmakologie u. Toxikologie4 4 - - 5 bis 6Psychiatrie und PsychotherapiePsychosomatische Medizinund PsychotherapieKlinik für Psychiatrie und Psychotherapie2 - 2 - 9 oder 10Klinik für Psychosomatik 1 - - - 9 oder 10Rechtsmedizin Institut für Rechtsmedizin 2 2 - - 7 oder 8Urologie Klinik für Urologie 1 - - 1 9 oder 10Wahlfach Alle - 1 - - 5 bis 1037 Angaben in Semesterwochenstunden78
ANHANGFortset<strong>zu</strong>ng Anhang 17Pflichtcurriculum KlinikQuerschnittsfächerBildgebende Verfahren, Strahlenbehandlung,StrahlenschutzEpidemiologie, medizinischeBiometrie und medizinischeInformatikGeschichte, Theorie, Ethik derMedizinGesundheitsökonomie, Gesundheitssystem,ÖffentlicheGesundheitspflegeInfektiologie, ImmunologieKlinisch-pathologische KonferenzKlinische Pharmakologie/PharmakotherapieInstitution- Klinik für Radiologie undNuklearmedizin- Klinik für Strahlentherapie- Institut für Sozialmedizin- Institut für MedizinischeBiometrie und Statistik- Institut für Med. InformatikInstitut für Medizin- und WissenschaftsgeschichteVorlesungPraktikumSeminarUnterricht amKrankenbettSemester2 2 - - 5 bis 63 2,5 - -7 oder 8,9 oder 101 1 - - 5 oder 6Institut für Sozialmedizin 1 - - - 7 oder 8Institut für Medizinische Mikrobiologieund Hygiene2 - - - 9 oder 10Institut für Pathologie 4 - - - 7 bis 8Institut für experim. und klin.Pharmakologie u. Toxikologie4 - - - 7 bis 8Klinische Umweltmedizin Institut für Arbeitsmedizin 2 - 2 - 5Medizin des Alterns und desalten MenschenLehrauftrag für Allgemeinmedizin1 - 1 - 9 oder10Notfallmedizin Klinik für Anästhesiologie 1 1 - - 5 oder 6Prävention, GesundheitsförderungInstitut für Sozialmedizin 1 - - - 7 oder 8Rehabilitation, PhysikalischeMedizin, NaturheilverfahrenInstitut für Sozialmedizin 1 - - - 7 oder 8BlockpraktikaAllgemeinmedizinLehrauftrag fürAllgemeinmedizin- - - 2 9 oder 10Chirurgie Kliniken für Chirurgie 6 - - 6 7 oder 8FrauenheilkundeKlinik für Frauenheilkundeund Geburtshilfe4 - - 3 7 oder 8Innere Medizin Kliniken für Innere Medizin 6 - - 6 7 oder 8KinderheilkundeKlinik für Kinder- und Jugendmedizin4 - - 2 7 oder 8Summe SWS 86 20,5 7,5 34Summe akademische Stunden 1.204 287 105 476Vorgaben ÄAppO --- 392 47679
ANHANGAnhang 18Wahlfächer in der KlinikIm klinischen Studienabschnitt muss ein Leistungsnachweis in einem Wahlfach erbracht werden. Seitdem Studienjahr 2005 werden rund 60 Wahlfächer angeboten, die durchschnittlich einen Umfang vonzwei Semesterwochenstunden haben. Hier finden Sie eine Auswahl:InstitutionWahlfächerKlinik für Anästhesiologie • Notfallmedizin und Notarztwagenpraktikum• Schmerzerkrankungen – Schmerztherapie• Anästhesiologische IntensivmedizinKlinik für Augenheilkunde • Augenheilkunde: Operative TechnikenInstitut für Biomedizinische Optik • LasermedizinKliniken für Chirurgie • Kieferchirurgie• Kinderchirurgische Sonografie• Kindertraumatologie• Plastische Chirurgie• Unfallchirurgische VisiteKliniken für Innere Medizin • Einführung in die Echokardiographie• Einführung in die Elektrokardiographie• Einführung in die Pathophysiologie respiratorischerInfektionen• Intensivmedizin• Klinische Infektiologie• Klinische und psychosomatische Fallvorstellungenin norwegisch bzw. bilingual norwegisch/deutsch• Neurowissenschaftliche Grundlagen• Umwelt und LungeKlinik für Kinder- und Jugendmedizin • Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie• Sozialpädiatrie / Neuropädiatrie / EntwicklungsneurologieKlinik für Neurologie • Ambulante neurologische FalldemonstrationenKlinik für Orthopädie • Poliklinische VisiteKlinik für Psychiatrie und Psychotherapie • Psychiatrie und Psychotherapie: StationspraktikumKlinik für Radiologie und Nuklearmedizin • Ultraschalldiagnostik (Sonographie)Institut für Sozialmedizin • Doktorandenseminar: Suchen, Finden, Vorbereiteneiner Dissertation• Evidenzbasierte medizinische Rehabilitation beichronisch Kranken: Forschungsstrategien undProjekteLehrbeauftragte für Allgemeinmedizin • Naturheilverfahren• Traditionelle Chinesische Medizin80
ANHANGAnhang 19Beispiel Wahlfach: Gender in der MedizinMit dieser Veranstaltung, die federführend von Prof. Dr. med. Marianne Schrader organisiert wird,sollen Studenten der Medizin bereits am Beginn ihrer Ausbildung für das Thema „Gender“ in der Medizinsensibilisiert werden. Im Sommersemester 2006 befanden sich 84% (n = 30) der anwesendenStudenten im vorklinischen Studienabschnitt. Davon haben alle den Leistungsnachweis nach einerschriftlichen Prüfung erlangt. Damit wurde das Ziel erreicht, Gender-spezifisches Wissen schon früh inder sensiblen Lernphase den Studenten <strong>zu</strong> vermitteln.Mit dieser Veranstaltung werden zwei Ziele verfolgt:• Das in neuester Zeit erworbene Wissen <strong>zu</strong>r Unterschiedlichkeit in der Biologie der Geschlechterund die• Unterschiede durch das soziokulturelle Geschlecht auf Gesundheit und Krankheit bei Frauen undMännern in der Lehre besonders heraus<strong>zu</strong>stellen.Dieses Wahlfach wurde erstmals im Sommersemester 2004 in Absprache mit dem Studiendekan angebotenund wird seitdem jeweils im Sommersemester gelesen. Das Thema „Gender“ in der Medizinbetrifft fast alle Fächer der vorklinischen und klinischen Ausbildung. Deswegen kann eine solche Veranstaltungnur themen- und fächerübergreifend angeboten werden. Bisher wurden Vorlesungen aus16 vorklinischen und klinischen Fächern angeboten. Im Folgenden sind vier Themen als Beispiel aufgeführt:„Biologie + Kultur = Geschlechterrollenverteilung oder wie werden wir <strong>zu</strong> Mädchen/Jungen?“(Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Prof. Dr. Ute Thyen. Diese Vorlesung bildete bisher immerden Auftakt der Vorlesungsreihe.)„Empfinden wir den Schmerz alle gleich?“(SS 04 Klinik für Anästhesiologie, PD Dr. Angela Roth-Isigkeit)„Depressionen bei Männern und Frauen; warum Frauen jammern und Männer sich umbringen“(SS 05 Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Prof. Dr. Ullrich Schweiger)„Herzinsuffizienz – Erkranken Männer und Frauen gleichermaßen?“(SS 06 Medizinische Klinik I Rotenburg/Wümme, Prof. Dr. Jürgen Potratz)LehrmaterialienDa sich das Gelehrte noch nicht in Lehrbüchern nachlesen lässt, wird den Studenten das Lehrmaterialelektronisch <strong>zu</strong>r Verfügung gestellt.EvaluationJede Vorlesung dieser Veranstaltungsreihe wird evaluiert. Ergebnis dieser Evaluation ist, dass alleThemen als überdurchschnittlich relevant für Beruf, Praxis und/oder Gesellschaft angesehen werden.Der Stoff wird als eher anspruchsvoll von den Studenten beurteilt. Besonders positiv wurde die Vermittlungdes neuen Wissens auf das Interesse am Studium und die Motivation, sich im Selbststudiummit den Inhalten <strong>zu</strong> beschäftigen, beurteilt. Insgesamt wird die Vorlesungsreihe deutlich besser beurteiltals die Veranstaltungen des Pflichtcurriculums. Die Vorbereitung des SS 07 erfolgt <strong>zu</strong>sammen mitStudenten des letzten Wahlfach-Semesters.InnovationSeit dem Herbst 2004 wird einmal pro Jahr, initiiert vom Zentrum für Geschlechterforschung an derCharité/Berlin, ein europaweiter Workshop für Gender in der Lehre abgehalten. Dort wurde 2004 die<strong>Lübeck</strong>er Veranstaltungskonzeption auf Einladung vorgestellt. In diesem Workshop wurde das <strong>Lübeck</strong>erModell als hervorragende und zielführende Implementierung neuen Gender-spezifischen Wissensin das Pflichtcurriculum des Medizinstudiums bewertet.81
ANHANGAnhang 20Beispiel 3. Studienjahr: Hygiene, Mikrobiologie und VirologieDas Fach Hygiene, Mikrobiologie und Virologie wird mit einer Hauptvorlesung sowie dem <strong>zu</strong>gehörigenPraktikum im 3. Studienjahr angeboten. Ziel der Veranstaltungen ist die Vermittlung von Kenntnissenpathogener Mikroorganismen sowie der Diagnostik und der Therapie von Infektionskrankheiten. Hier<strong>zu</strong>werden im Rahmen der Hauptvorlesung einzelne Erreger organbezogen im Kontext <strong>zu</strong> den verursachtenInfektionskrankheiten dargestellt und die an der Pathogenese beteiligten Virulenzfaktoren mitihrer Funktion in der Pathogen-Wirts-Interaktion erläutert. Die Möglichkeiten und Limitierungen antimikrobiellerTherapie werden parallel erörtert. Im Rahmen des Praktikums wird durch eigene Anschauungdas in der Hauptvorlesung vermittelte Wissen vertieft. Gleichzeitig werden die wichtigstenPrinzipien der klassischen mikrobiologischen Diagnostik sowie der molekularbiologischen Diagnostikdurch die selbstständige Durchführung diagnostischer Testverfahren erlernt. Hierbei wird neben derDurchführung ein Hauptaugenmerk auf die Auswertung und Interpretation der Testverfahren gelegt,um das Verständnis der Wertigkeit der Verfahren im klinischen Alltag <strong>zu</strong> vermitteln. Die Kombinationaus Vorlesung und <strong>zu</strong>gehörigem Praktikum mit anschließender mündlicher Prüfung stellt eine bewährteForm des Unterrichts des Faches dar und wird von vielen <strong>Universität</strong>en in ähnlicher Form angeboten.Zu Beginn jedes Praktikumstages findet ein kurzes Repetitorium der vorausgegangenen Themenstatt. Auf diese Weise wird das erlernte Wissen vertieft und die Studenten werden auf die mündlicheAbschlussprüfung vorbereitet.Abstimmung mit den anderen Fächern des PflichtcurriculumsDas Fach Hygiene, Mikrobiologie und Virologie baut maßgeblich auf die in den vorklinischen FächernAnatomie, Biochemie, Biologie, Chemie und Physik vermittelten Grundlagen auf und dient als wichtigeVorbereitung auf die Anforderungen während der folgenden klinischen Fächer (Diagnostik, Therapie,Prävention von Infektionserkrankungen). Hierbei ist das Fach durch das Auftreten von Infektionskrankheitenin nahe<strong>zu</strong> allen klinischen Disziplinen eng mit diesen Fächern verbunden. Gleichzeitig istdas Fach im Rahmen der Lehre über Therapiemöglichkeiten für Infektionskrankheiten eng an diePharmakologie gebunden.Einfluss des Konzeptes auf andere VeranstaltungenDie in <strong>Lübeck</strong> entwickelte Neuordnung des Teils Hygiene in Form der Lösung vorgegebener Aufgabenund Präsentation in einem wissenschaftlichen Samstagssymposium wurde von mindestens drei <strong>Universität</strong>en(Berlin, Tübingen, Heidelberg) nach Vorstellung am Rande von Fachkongressen übernommen.Weiterhin wurden durch kontinuierliche Anpassung des vermittelten Stoffes zeitnah neue diagnostischeVerfahren und neu entdeckte Infektionserreger in das Lehrprogramm aufgenommen.Auswirkungen der Evaluationsergebnisse der Studenten und Meinungen der Fachkollegen aufdie Entwicklung der VeranstaltungErfreulicherweise werden die Lehrbemühungen des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygienein <strong>Lübeck</strong> seit vielen Jahren sehr gut evaluiert. Durch Diskussion bei Negativbewertungen mitallen Beteiligten sowie einem institutsinternen Wettbewerb (bester Dozent des Institutes) wird die Lehrekontinuierlich verbessert.Transfer der Erkenntnisse und Erfahrungen über den eigenen Wirkungskreis hinausWeiterhin gibt es ein Patenprinzip, bei dem erfahrene Dozenten neue Dozenten mit in die Veranstaltungnehmen und diese bei den ersten eigenen Veranstaltungen begleiten. Hierdurch werden die Erkenntnisseund Erfahrungen durch Vorbild weitergegeben.82
ANHANGAnhang 21Beispiel 4. Studienjahr: Blockpraktikum AnästhesiologieDie Klinik für Anästhesiologie veranstaltet für Studenten im 4. Studienjahr ein zweiwöchiges Blockpraktikummit dem Ziel, den Studenten das klinische Tätigkeitsgebiet der Anästhesie vor<strong>zu</strong>stellen unddie wissenschaftlichen Grundlagen <strong>zu</strong> vermitteln. Diese Veranstaltung ist in eine mehrstufige Ausbildungsstruktureingebettet, die den Studenten die Grundlagen der Notfallmedizin nahe bringt. DasBlockpraktikum Anästhesiologie ist die intensive Phase der Ausbildung <strong>zu</strong>r Vermittlung einer allgemeinenNotfallkompetenz. Die Ausbildung Notfallmedizin unterteilt sich in sechs Abschnitte und erstrecktsich über das gesamte Studium:1. Vorklinischer Abschnitt: Ausbildung in Erster Hilfe mit intensiven praktischen Übungen.2. Klinik, 3. Studienjahr: Vertiefung der Kenntnisse durch das Notfallpraktikum (Querschnittfach).3. Klinik, 4. Studienjahr: Hauptvorlesung Anästhesie und Notfallmedizin.4. Klinik, 4. Studienjahr: Im Blockpraktikum Anästhesiologie werden integrale Bestandteile der Notfallmedizinwie Intubation, Beatmung und Notfallmedikamente „am Patienten“ weiter unterrichtet.5. Klinik, 4. Studienjahr: Im Notarztwagenpraktikum nehmen die Studenten über mehrere Dienstschichtenam regulären Notarztdienst der Hansestadt <strong>Lübeck</strong> teil. Sie sind dabei fest in die notfallmedizinischeTätigkeit eingebunden und tragen Verantwortung für die Dokumentation, Angehörigenbetreuungund Therapieassistenz. Dadurch verlieren die Studenten die natürliche Angst vordem plötzlichen Notfall und lernen ein strukturiertes Verhalten in kritischen Notfällen.6. Praktisches Jahr: Ergänzt wird die Notfallausbildung durch ein Reanimationstraining und durchbegleitende Kurse und Praktika, die von Studenten organisiert werden.Innovative Aspekte der VeranstaltungDie praktische Ausbildung im regulären Notarztdienst im Sinne eines Rund-um-die-Uhr-Dienstes mitstrukturierter Einbindung des Praktikanten stellt eine in Deutschland einmalige Möglichkeit für Studentendar, tiefe Einblicke in dieses interdisziplinäre Gebiet <strong>zu</strong> bekommen. Im Blockpraktikum Anästhesiologiewurde durch Einsatz eines Narkosesimulators (LARS) ein neuer Weg in der praktischen Ausbildungeingeschlagen. Die Studenten sind in Gruppen <strong>zu</strong> zwei Personen angehalten, eine Narkoseeinleitungan einer elektronisch aus dem Nachbarraum gesteuerten Simulationspuppe durch<strong>zu</strong>führen.Dem Ausbildungsstand entsprechend können verschiedene „Komplikationen“ auftreten, die mit demerlernten Wissen behandelt werden müssen. Die Simulatorausbildung wird Studenten aus dem 4.Studienjahr und Studenten im Praktischen Jahr angeboten. Den Rückmeldungen <strong>zu</strong>folge steigert diepraktische Ausbildung das Engagement und die Begeisterung beim Erlernen von Basiswissen, aberauch von grundlegenden Reaktionsweisen. Neu eingeführt wurde eine Unterrichtseinheit, in der Kleingruppenden Umgang mit Patienten in kritischen und schwierigen Situationen üben können. Da<strong>zu</strong>kommt eine ausgebildete Schauspielerin <strong>zu</strong>m Einsatz, die eine Patientin mit soeben diagnostiziertenmetastasierenden Brustkrebs und starken Schmerzen darstellt.Die Erfahrungen aus der Lehre wurden auf internationalen Kongressen und Tagungen präsentiert.Hohes Interesse an unseren Erfahrungen und Möglichkeiten des Transfers zeigt auch die medizintechnischeIndustrie, die Mitarbeiter schulen lässt und Besuchern die Simulatoranlagen zeigt.Einfluss des Konzeptes auf andere VeranstaltungenIn der deutschen Fachgesellschaft für Anästhesiologie werden in einem Forum der Lehrverantwortlichenneue Entwicklungen an einzelnen <strong>Universität</strong>en dargestellt, diskutiert und - wenn ein Konzeptüberzeugen konnte - kopiert. Die sehr positiven Erfahrungen mit der Simulatorausbildung haben <strong>zu</strong>einem regen Austausch von Ausbildungsprinzipien auch innerhalb der <strong>Lübeck</strong>er <strong>Universität</strong> geführt.Wirkung der Evaluation und Meinungen der Fachkollegen auf die Entwicklung der LehrveranstaltungNeben der zentralen Semesterevaluation durch das Studiendekanat wurde eine individuelle Abschlussbesprechungfür die zehn Studenten einer Blockpraktikumsgruppe etabliert. Es wird der Stundenplanmit allen Elementen besprochen und bei Kritik gemeinsam nach Lösungen gesucht. GefundeneLösungen werden zügig umgesetzt. Dieses Vorgehen hatte in den letzten Semestern weitgehendeÄnderungen <strong>zu</strong>r Folge. Dieser Werkstattcharakter mit Einbindung der Studenten in die Praktikumsgestaltungist Grundlage der anhaltend optimalen Evaluationsbewertung.83
ANHANGAnhang 22Beispiel 5. Studienjahr: Psychische StörungenIn den letzten Jahren wurde die Lehre in den psychosozialen Fächern grundlegend <strong>zu</strong> einem vierwöchigenLehrblock umstrukturiert, um verstärkt Konzepte des problemorientierten Lernens <strong>zu</strong> berücksichtigen.Seit dem Sommersemester 2003 wird der Block „Psychische Störungen“ gemeinsam vonder Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (Prof. Hohagen), der Polikinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie(Prof. Knölker) und der Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie (PD Jantschek)durchgeführt. Der Unterricht richtet sich an Studenten des 5. Studienjahres. Eine Einführung in diepsychiatrische Anamneseerhebung haben die Studenten bereits im interdisziplinären Untersuchungskursdes 3. Studienjahres erhalten.Einordnung der Veranstaltung in das Profil des StudiengangsDer Block „Psychische Störungen“ setzt sich <strong>zu</strong>sammen aus:• einer fortlaufenden interdisziplinären Vorlesung, die der systematischen Wissensvermittlung <strong>zu</strong>den wichtigsten psychischen Krankheitsbildern dient. Der Vorlesungszyklus gliedert sich in elfDoppelstunden (Dstd.) Psychiatrie und Psychotherapie, 2,5 Dstd. Kinder- und Jugendpsychiatriesowie 2,5 Dstd. Psychosomatik und Psychotherapie. Die wichtigsten Vorlesungsfolien werden täglichnach der Vorlesung ins Internet gestellt.• dem POLI-Praktikum „Psychiatrie und Psychotherapie“ (Problem-Orientiertem Lernen und Interviewtechnik).Diese Kurse laufen über den gesamten POLI-Block, d.h. für jeden Studenten insgesamt16 Termine à drei Stunden. Im Rahmen des Praktikums erlernen die Studenten die Anamnese-und Befunderhebung. Anhand der Exploration eigener Patienten werden von den StudentenFragestellungen <strong>zu</strong> den entsprechenden Krankheitsbildern entwickelt. Das Erarbeiten der Antwortenerfolgt in Kleingruppen im Selbststudium, die Ergebnisse werden in der folgenden Stunde vorgestelltund diskutiert. Jeder Kurs hat maximal zehn Teilnehmer und wird von zwei Dozenten geleitet.• den Praktika „Kinder-Jugendpsychiatrie“ und „Psychosomatik und Psychotherapie“. Jeder Studentmuss an beiden Praktika über jeweils eine Woche teilnehmen (d.h. 2 x 4 Dstd.).Lehrziele (Fertigkeiten):• Selbständige Durchführung eines psychiatrischen Interviews/ Anamnesegespräches mit psychischerkrankten Patienten,• Erhebung des psychopathologischen Befundes,• Systematisches Erstellen einer psychiatrischen/psychosomatischen Krankengeschichte,• Formulieren von Fragestellungen <strong>zu</strong> einzelnen Krankheitsbildern anhand von Fallbeispielen,• Selbständiges Erarbeiten von Lösungen.Lehrziele (Kenntnisse):• Kenntnisse über die Symptomatik der wichtigsten psychiatrischen und psychosomatischen Krankheitsbilder,• Kenntnisse in Epidemiologie und Ätiologie (einschließlich neurobiologischer Grundlagen) von psychiatrischenund psychosomatischen Erkrankungen,• Einordnung psychopathologischer Befunde unter Einbeziehung von psychiatrischen und somatischenDifferentialdiagnosen,• Prinzipielle Kenntnisse über das Erstellen von multimodalen Therapieplänen unter Berücksichtigungpharmakologischer, psychotherapeutischer wie soziotherapeutischer Aspekte.84
ANHANGFortset<strong>zu</strong>ng Anhang 22Beispiel 5. Studienjahr: Psychische StörungenPrinzipieller Ablauf eines POLI-Praktikums:Interviewtechniken und Gesprächsführung:In den ersten Stunden des Praktikums findet <strong>zu</strong>nächst eine Einführung in die Gesprächsführungund Interviewtechniken (z.B. mittels Rollenspiel) statt. Mit der Gruppe wird die formale und inhaltlicheGestaltung eines Anamnesegespräches erarbeitet und geübt. Wenn gewünscht, kann Videofeedbackgenutzt werden. Zurzeit wird ein von der Forschungsförderung der <strong>Universität</strong> finanziertesProjekt durchgeführt, in dem das Erlernen kommunikativer interpersoneller Fertigkeiten und Interviewtechnikenim Vordergrund steht.Problem-Orientiertes Lernen anhand von Fallbeispielen:Im weiteren Verlauf des Praktikums besteht eine POLI-Einheit jeweils aus zwei Doppelstunden anzwei aufeinander folgenden Tagen. Jede POLI-Einheit widmet sich dann einem Krankheitsbild.Ausgangspunkt ist die Exploration (Anamnesegespräch) eines Patienten durch einen Studenten.Alternativ da<strong>zu</strong> können auch Patientenvideos oder so genannte „Papierfälle“ verwandt werden,wenn keine geeigneten Patienten erreichbar sind. Nach der Exploration werden im 1. Schritt <strong>zu</strong>nächstVerständnisfragen <strong>zu</strong>r Exploration geklärt, im 2. Schritt Fragen und Hypothesen <strong>zu</strong> demexplorierten Fall gesammelt (z.B. leidet Herr X an einer Alkoholabhängigkeit? Wie lauten die Kriterien,die dafür erfüllt sein müssen?). Im 3. Schritt werden die Fragen geordnet und <strong>zu</strong>sammengefasst.Im 4. Schritt werden anhand der im 3. Schritt formulierten Fragen die Aufgaben formuliert,die in Kleingruppen bis <strong>zu</strong>r nächsten Stunde bearbeitet werden sollen, und diese Aufgaben an dieKleingruppen verteilt. Im 5. Schritt werden am Folgetag die Ergebnisse <strong>zu</strong>sammengetragen unddiskutiert. Die <strong>zu</strong>sammengefassten POLI-Ergebnisse werden an alle Gruppenmitglieder verteilt.Im 6. Schritt erfolgt eine kurze Evaluation der POLIs. Der Tutor kann hier wichtige Anregungen fürdas nächste POLI bekommen.Leistungsbewertung:Grundlage der Leistungsbewertung sind die Anfertigung einer Krankengeschichte sowie das Bestehender Abschlussklausur (30 Fragen <strong>zu</strong>m Fach Psychiatrie, zehn Fragen <strong>zu</strong>m Fach Psychosomatik sowiezehn Fragen <strong>zu</strong>m Fach Kinder- und Jugendpsychiatrie). Die Fächer Psychiatrie/Psychotherapie undPsychosomatik werden getrennt benotet. Seit dem SS 05 wird für die Fächer Psychiatrie/Psychotherapie,Neurologie und Psychosomatik ein fächerübergreifender Schein erstellt, in dem die Einzelnotender Fächer aufgeführt sind. Zudem wird eine Gesamtnote nach dem Schlüssel je 45% Psychiatrie/Psychotherapieund Neurologie sowie 10% Psychosomatik errechnet.Auswirkungen der Evaluationsergebnisse der Studenten und Meinungen der Fachkollegen aufdie Entwicklung der VeranstaltungDie Verbesserung der Lehre ist ein zentrales Anliegen. Während des Blockes „Psychische Störungen“werden die Vorlesungen täglich evaluiert. Der Dozent erhält am Morgen des Folgetages die Evaluationsergebnisseseiner Vorlesung vom Vortag, so dass er diese bei der Planung der folgenden Vorlesungberücksichtigen kann. Alle Praktikumskurse werden am Ende des Blockes von den Studentenevaluiert. Neben einer Gesamtauswertung erhält jeder Dozent die individuelle Auswertung seinesKurses. Die Gesamtergebnisse werden auf der Homepage der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapieveröffentlicht.Die Evaluationsergebnisse werden regelmäßig in Konferenzen mit den Dozenten der Vorlesungenund Kurse diskutiert und Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Vor Beginn des Blockunterrichtes findetfür die Dozenten der Kurse ein halbtägiger Workshop statt, in dem diese didaktisch geschult werden.85
ANHANGAnhang 23PJ-Einrichtungen des UK S-H (Campus <strong>Lübeck</strong>)Insgesamt stehen im UK S-H <strong>Lübeck</strong> den Studenten 26 Einrichtungen <strong>zu</strong>r Verfügung, in denen sie ihrPraktisches Jahr ableisten können.Kliniken, in denen das Tertial Innere Medizin abgeleistet werden kann• Medizinische Klinik I• Medizinische Klinik II• Medizinische Klinik IIIKliniken, in denen das Tertial Chirurgie abgeleistet werden kann• Klinik für Chirurgie• Klinik für Kinderchirurgie• Klinik für UnfallchirurgieEinrichtungen, in denen das Tertial für das Wahlfach abgeleistet werden kann• Institut für Immunologie und Transfusionsmedizin• Institut für Medizinische Hygiene und Mikrobiologie• Institut für Pathologie• Klinik für Anästhesiologie• Klinik für Augenheilkunde• Klinik für Dermatologie• Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe• Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde• Klinik für Herzchirurgie• Klinik für Kiefer- und Gesichtschirurgie• Klinik für Kinder- und Jugendmedizin• Klinik für Neurochirurgie• Klinik für Neurologie• Klinik für Orthopädie• Klinik für Plastische Chirurgie• Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie• Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin• Klinik für Strahlentherapie• Klinik für Urologie86
ANHANGAnhang 24Akademische Lehrkrankenhäuser und -praxenNachstehende elf Akademische Lehrkrankenhäuser sind neben dem UK S-H an der studentischenAusbildung im Praktischen Jahr beteiligt. Zusätzlich aufgeführt sind die Akademischen Lehrpraxen derAllgemeinmedizin, die seit August 2006 ebenfalls im Praktischen Jahr ausbilden.Lehrkrankenhäuser und –praxenAsklepios Klinik Bad Oldesloe, Schützenstraße55, 23843 Bad OldesloeCurschmann-Klinik, Timmendorfer Strand,Saunaring 6, 23669 TimmendorfKlinikum Itzehoe, Robert-Koch-Straße 2,25524 ItzehoeKlinikum Neustadt, Schön Kliniken, Am Kiebitzberg10, 23730 NeustadtKrankenhaus Großhansdorf, Wöhrendamm80, 22927 GroßhansdorfMedizinische Klinik (und Forschungszentrum)Borstel, Parkallee 35, 23845 BorstelRheumaklinik Bad Bramstedt, Oskar-Alexander-Straße 26, 24576 Bad BramstedtSana Kliniken <strong>Lübeck</strong>, Kronsforder Allee 71-73, 23560 <strong>Lübeck</strong>Sana Kliniken Ostholstein, Klinik Eutin, Hospitalstraße22, 23701 EutinUnfallkrankenhaus Boberg, Bergedorfer Straße10, 21033 HamburgWestküstenklinikum (Brunsbüttel und) Heide,Esmarchstraße 50, 25746 HeideHausärztliche Lehrpraxen in <strong>Lübeck</strong>und Umgebung, stellvertretend Herr Prof. Dr.med. Jens-Martin Träder, Peter-Monnik-Weg 3,23562 <strong>Lübeck</strong>PJ-AusbildungsfächerAnästhesiologie, Chirurgie, Gynäkologie,Innere Medizin, RadiologieInnere MedizinAnästhesiologie, Chirurgie, Gynäkologie,Innere Medizin, Neurologie, Pädiatrie, Psychiatrie,Radiologie, UrologieAnästhesiologie, Chirurgie, Innere Medizin,OrthopädieInnere MedizinInnere MedizinInnere MedizinAnästhesiologie, Chirurgie, Innere MedizinAnästhesiologie, Chirurgie, Gynäkologie,Innere Medizin, PädiatrieChirurgieAnästhesiologie, Chirurgie, Innere Medizin,Geriatrie, Gynäkologie, Neurochirurgie, Pädiatrie,Psychiatrie, RadiologieAllgemeinmedizin87
ANHANGAnhang 25PJ in der Inneren MedizinEinordnung in das Profil des StudiengangsAls letzter Abschnitt des Medizinstudiums kommt dem Praktischen Jahr eine besondere Bedeutung<strong>zu</strong>: nicht <strong>zu</strong>letzt durch Wegfall des „Arzt im Praktikum“ dient er der Vorbereitung der Studenten aufihre praktische ärztliche Tätigkeit. Im Vordergrund steht somit die Umset<strong>zu</strong>ng des theoretischen Wissensaus dem Studium in die praktische Patientenversorgung.Als Pflichttertial wird das Fach „Innere Medizin“ von jedem Studenten vier Monate durchlaufen. Dabeibesteht die Möglichkeit, diese Zeit an der Heimatuniversität, einem <strong>zu</strong>geordneten Lehrkrankenhausoder auch an einem äquivalenten Krankenhaus im Ausland <strong>zu</strong> absolvieren. Das Fach „Innere Medizin“verknüpft als zentrales klinisches Fach Aspekte aus vielen Teilgebieten der Medizin: die Grundlagenaus der Vorklinik werden ebenso benötigt wie klinische Grundlagenfächer (Pathologie, Pharmakologieoder Mikrobiologie). Je nach Krankheitsbild ergeben sich häufig Überschneidungen mit anderen Fachrichtungenwie z.B. der Chirurgie, Dermatologie oder Psychiatrie. Dieses fächerübergreifende Denkensteht auch bei der Ausbildung im Praktischen Jahr im Vordergrund.Die Uniklinik in <strong>Lübeck</strong> bietet als Haus der Maximalversorgung eine PJ-Ausbildung in sämtlichen Teilbereichender Inneren Medizin an: die Medizinische Klinik I umfasst die Bereiche Gastroenterologie,Nephrologie, Endokrinologie und Hämatologie/Onkologie, die Medizinische Klinik II repräsentiert dieBereiche Angiologie und Kardiologie und die Medizinische Klinik III bildet Studenten in der Pulmologieund Infektiologie aus. Außerdem besteht die Möglichkeit, das PJ in der Notaufnahme, den Intensivstationenoder der Transplantationsstation <strong>zu</strong> absolvieren.Um Studenten einen größeren Einblick in das Fach <strong>zu</strong> gewähren, wird das PJ-Tertial Innere Medizinam UK S-H in zwei Teilbereiche von jeweils acht Wochen gesplittet. So können die Studenten zweiBereiche der Inneren Medizin intensiv kennen lernen und sich dennoch effektiv einarbeiten. Darüberhinaus besteht jederzeit die Möglichkeit, Einblick in die Funktionseinrichtungen, wie <strong>zu</strong>m Beispiel dieGastroskopie oder das Herzkatheterlabor, <strong>zu</strong> erlangen. Die Einteilung in die verschiedenen Fachbereicheerfolgt je nach Kapazität der Stationen und Neigung der Studenten. Bei der Ausbildung stehtdas Erlernen von selbständigem Arbeiten unter Aufsicht und Betreuung der Stationsärzte im Vordergrund,so dass „eigene“ Patienten von der Aufnahme bis <strong>zu</strong>r Entlassung von den PJ-Studenten eigenständigbetreut werden.Verbesserung durch NeustrukturierungAls Reaktion auf die veränderte Approbationsordnung (Wegfall des ersten und zweiten Staatsexamens)wurden seit etwa einem Jahr grundlegende Veränderungen im Praktischen Jahr in der InnerenMedizin in <strong>Lübeck</strong> vorgenommen. Der Wegfall der „großen“ Prüfung direkt vor dem PJ sowie derLerndruck für das neue „Hammerexamen“ nach Abschluss des Praktischen Jahres machten dieseNeuerungen notwendig. Für die Einführung der neuen Projekte wurde eigens eine halbe Stelle füreine Ärztin als PJ-Koordinatorin geschaffen.Als Orientierung, welche klinischen Fähigkeiten und Fertigkeiten nach Abschluss des PraktischenJahres beherrscht werden sollen, wurde der PJ-Pass eingeführt. Im praktischen Kitteltaschenformatkann so jederzeit auf die Lehrziele in den Rubriken Untersuchung, Diagnostik und Therapie <strong>zu</strong>rückgegriffenwerden.Eine weitere Neuerung stellt der Lehrzielkatalog „Leitsymptome Innere Medizin“ dar(www.medizin.uni-luebeck.de/studierende/pdf/Leitsymptome_Innere_Medizin.pdf), in dem 16 wichtigeLeitsymptome der Inneren Medizin dargestellt sind. Der Fokus wurde hierbei auf die Rubriken Diagnostikund Differentialdiagnostik gelegt, um dem Studenten <strong>zu</strong> erleichtern, aus der Fülle der möglichenDiagnosen die passende aus<strong>zu</strong>wählen. Durch dieses leitsymptomorientierte Vorgehen wird <strong>zu</strong>meinen dem neuen fallorientierten Examen Rechnung getragen, <strong>zu</strong>m anderen dem Einstieg in den Praxisalltag,bei dem sich der Arzt nicht einem Krankheitsbild, sondern primär einem Leitsymptom gegenübergestelltsieht.88
ANHANGFortset<strong>zu</strong>ng Anhang 25PJ in der Inneren MedizinAbgestimmt auf diese 16 Leitsymptome wird in den 16 Wochen des PJ-Tertials wöchentlich ein PJ-Seminar (siehe nachfolgende Tabelle) <strong>zu</strong> einem der Symptome angeboten, wobei immer ein PJ-Student einen Patienten mit dem passenden Leitsymptom vorstellt.Datum Leitsymptom Dozent Fallvorstellung31.05.06 1. Diabetes mellitus Schütt Kasper 43L07.06.062. Herzrasen/Palpitation (ohneFall)Wiegand14.06.06 3. Metabolisches Syndrom Wellhöner Mirbach 41c21.06.06 4. Thoraxschmerz Kurz Schröder 42c28.06.06 5. Fieber Lange Wüstenberg LA05.07.06 6. Ödeme Nitschke Lorentzen 43c12.07.06 7. Ikterus Witthöft Mohr 11a19.07.06 8. Gelenkschwellung/-schmerz Lamprecht Kannmacher 43b26.07.06 9. Synkope Bode Soetbeer LA02.08.06 10. Husten/Dyspnoe Schaaf Tosun 43L09.08.06 11. Diarrhoe Weitz Niederquell 11T16.08.0612. „Leistungsknick“, B-SymptomatikSimon Kühn-Remale 44b23.08.06 13. „Bauchschmerz“ Homann Kleinelanghorst 41b30.08.06 14. Sepsis Dodt Stäcker 43c06.09.06 15. Anurie/Oligurie Jabs Matthes 42c13.09.06 16. Lymphknotenschwellung Peters, St. Wilske St.8Darüber hinaus wurde im Herbst 2006 erstmals das Repetitorium „Innere kompakt“ als Reaktionauf die veränderte Prüfungssituation angeboten (Anhang 42).Evaluation und WirkungskreisDie Neuerungen im Praktischen Jahr wurden durchweg positiv von den Studenten aufgenommen. BeiFragen oder Problemen <strong>zu</strong>m PJ in der Inneren Medizin stehen jederzeit der PJ-Beauftragte und diePJ-Koordinatorin den Studenten und Ärzten <strong>zu</strong>r Verfügung. Ab August dieses Jahres gibt es eine verpflichtendeOnline-Evaluation für das Praktische Jahr, deren Ergebnisse es ermöglichen werden, weitereVerbesserungen an<strong>zu</strong>streben.Die Pilotprojekte „PJ-Pass“, „Leitsymptomkatalog“, „Leitsymptomorientierte Seminarreihe“ sowie dasRepetitorium „Innere kompakt“ dienen anderen klinischen Fächern wie der Chirurgie als Anhaltspunkt,mit ähnlichen Projekten nach<strong>zu</strong>ziehen. Auch die Lehrkrankenhäuser der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> orientierensich an diesem Modell. Über <strong>Lübeck</strong>s Grenzen hinaus stieß diese Neustrukturierung auf Interesseund wurde im Rahmen eines Artikels im Deutschen Ärzteblatt 38 über den eigenen Wirkungskreishinaus weitergegeben.38 Kühn J, Westermann J, (2006). Praktisches Jahr: Zwischen Patientenwohl und „Hammerexamen“, Deut Ärztebl;103:A1654-689
ANHANGAnhang 26„PJ-Pass“ für die Innere Medizin / ChirurgieDer <strong>Lübeck</strong>er PJ-Pass Innere Medizin imKitteltaschenformat enthält die klinischenFähigkeiten und Fertigkeiten, die vom Studentenam Ende der klinischen Ausbildungerworben sein sollen. Das vorgegebeneKreuz in unten stehender Tabelle zeigt dieerwartete Tiefe des Könnens in den einzelnenBereichen der Inneren Medizin an. DieBegriffe sind dabei folgendermaßen definiert:TheorieDer Student muss theoretisch den Lehrstoffkennen (Prinzip, [Kontra]-Indikationen,Durchführung, Komplikationen).GesehenDer Student muss das theoretische Wissenbesitzen und die Tätigkeit einmal durchgeführthaben bzw. gesehen haben, wie einekunstgerechte Durchführung aussieht.GetanDer Student muss das theoretische Wissenbesitzen und muss die Tätigkeit unter Anleitungmindestens einige Male (>3mal)durchgeführt haben.BeherrschenDer Student muss das theoretische Wissenund ausführliche Erfahrung in der Anwendungund Durchführung besitzen.Abbildung 6: Titelblatt des PJ-Passes Innere MedizinDer Student soll darüber hinaus wie in der nachfolgenden Tabelle markieren, welche Stufe für diejeweilige Fertigkeit im Laufe des PJ-Tertials Innere Medizin erreicht wurde, um eventuelle Diskrepanzenzwischen Erwartung und tatsächlich Erreichtem erkennen und beheben <strong>zu</strong> können. Am Ende desTertials soll der erreichte Ausbildungsstand mithilfe des ausgefüllten Passes <strong>zu</strong>sammen mit dembetreuenden Stationsoberarzt kritisch evaluiert und durch Gegenzeichnung bestätigt werden.Therapeutische Maßnahmen Theorie Gesehen Getan BeherrschenLegen eines peripheren venösen ZugangesXIntravenöse InjektionXSubkutane InjektionXIntramuskuläre InjektionXImmunisierungenXLegen eines zenatralnervösen KathedersXEntfernen eines zentralvenösen KathedersXAnschluss zentralnervöser PortXSpülen/Verplombung zentralnervöser PortXAnlage transurethraler BlasenkathederXAnlage suprapubischer BlasenkathederXAnlage MagensondeXPleuradrainageX90
ANHANGAnhang 27Evidenzbasierte Medizin im MedizinstudiumMehrfach im Verlauf des Studiums werden Studierende mit der Methodik des wissenschaftlichen Arbeitenskonfrontiert. Bereits im ersten Semester werden die Studenten in der Lehrveranstaltung Einführungin die klinische Medizin mit den Prinzipien des "Clinical Reasoning" und "Clinical DecisionMaking" bekannt gemacht. Gemäß einem standardisierten "approach to the patient" werden:• Die Elemente Anamnese, klinische, Labor- und apparative Untersuchungen <strong>zu</strong>r Diagnosefindungthematisiert,• Prognose, Therapie-, Präventions-, und Rehabilitationsstrategien erörtert,• kommunikationswissenschaftliche Grundlagen sowie ethische Entscheidungsprinzipien angesprochen,und schließlich• translationale Forschung im Schnittfeld zwischen Grundlagenforschung und klinischer Anwendungsowie Aspekte der Evidenzbasierten Medizin mit der Intention der kritischen Bildung eines Methodenbewusstseinsbeleuchtet.Der äußere formale Rahmen ist die so genannte Vorlesung, die didaktischen Elemente fächern sichdabei jedoch breiter als sonst üblich auf: Unter anderem Patientenvorstellungen, interaktiver Diskurs,sowie Video- und Audio-Präsentationen, insbesondere über das Internet.Im vierten Studienjahr nehmen die Studenten am obligaten zweiwöchigen Blockpraktikum Evidenzbasierteund soziale Medizin teil (Unterricht pro Student ca. 50 Stunden). Dabei wird in Gruppen vonmaximal 20 Studenten <strong>zu</strong>nächst erarbeitet, warum Mediziner einen „klinischen“ Informationsbedarfhaben könnten und wie konkrete Fragen eines Mediziners in diesem Zusammenhang aussehen. Erstdann wird mit den Studenten das Bewerten von klinischen Studien und die Relevanz der Studien fürdie Lösung eines „klinischen Problems“ erarbeitet (Anhang 40). Diese Problematik wird im fakultativenGrund- und Aufbaukurs Evidenzbasierte Medizin weitergeführt, der einmal pro Jahr vom Institut fürSozialmedizin angeboten wird.An dem viertägigen Grund- und Aufbaukurs Evidenzbasierte Medizin können interessierte Studentenaus dem klinischen Studienabschnitt und Ärzte teilnehmen. Seit 2001 werden diese Kurse vom Zentrumfür Fernstudium und Weiterbildung mitorganisiert.Die Praxis der Evidenzbasierten Medizin erfordert in der klinischen Situation die Integration der Ergebnisseevaluativer (bewertender) Forschung mit der individuellen ärztlichen Erfahrung. Konkretwerden aus alltäglichen klinischen Problemen empirisch beantwortbare präzise Fragen entwickelt, umdie beste verfügbare "externe" Evidenz systematisch <strong>zu</strong> suchen und kritisch auf ihre Validität und Angemessenheitprüfen <strong>zu</strong> können. Der Grundkurs richtet sich an Studenten der Medizin und jüngereAssistenten. In dem Kurs werden Kenntnisse und Fähigkeiten <strong>zu</strong>r Bewältigung einer evidenzbasiertenEntscheidungsfindung vermittelt. Hier<strong>zu</strong> gehören die Überset<strong>zu</strong>ng eines klinischen Problems in einekonkrete Fragestellung, die Literaturrecherche und die kritische Bewertung von Studienergebnissenund ihrer Anwendbarkeit. Der Aufbaukurs wurde für Teilnehmer konzipiert, die bereits über Grundkenntnissein evidenzbasierter Medizin verfügen: Klinisch tätige Ärzte, Public-Health-Studenten sowiePersonen aus anderen Bereichen der medizinischen Versorgung. In diesem Kurs werden die vorhandenenKenntnisse und Fähigkeiten aufgefrischt und vertieft sowie die kritische Diskussion gefördert.Beide Kurse vermitteln die Inhalte in einer Mischung aus Unterrichtsveranstaltungen:• Plenarvorlesungen geben Einblick in themenübergreifende Aspekte der EbM und Gesundheitsversorgungund bieten ein ideales Diskussionsforum.• Kleingruppenarbeiten (max. 10 Personen) nehmen den größten Raum im Rahmen der Veranstaltungenein und geben Gelegenheit <strong>zu</strong> Erwerb und Vertiefung von Kenntnissen in der kritischen Literaturbewertung.• Methodenseminare und "Refresher" sind spezifisch für die Vermittlung von methodischen Kenntnissenkonzipiert.• Praktische Übungen am Computer unter fachkundiger Anleitung vermitteln und vertiefen Fähigkeitenin der Literaturrecherche.• Die weitgehend parallelen 3,5-tägigen Kurse schließen mit einer Podiumsdiskussion.91
ANHANGAnhang 28Palliativmedizin im PflichtcurriculumBereits seit einigen Jahren werden grundlegende Aspekte der Palliativmedizin im Rahmen einer zweistündigenVorlesung im Fach Allgemeinmedizin vermittelt. Seit dem WS 06/07 wird Palliativmedizinfächerübergreifend gelehrt. Die Studenten erhalten im Rahmen von fachbezogenen Pflichtveranstaltungen,die über das gesamte klinische Studium verteilt sind, insgesamt 22 Unterrichtsstunden, indenen sie die speziellen Bedürfnisse schwerkranker und sterbender Menschen teils in Vorlesungen,überwiegend jedoch in Seminaren kennen lernen. Die Verteilung des Unterrichts auf verschiedeneFächer wurde gewählt, um <strong>zu</strong> betonen, dass Patienten aus ganz unterschiedlichen Bereichen betroffensind, und dass in der Palliativmedizin die unbedingte Notwendigkeit <strong>zu</strong>r interdisziplinären Zusammenarbeitbesteht. Die Unterrichtsstunden verteilen sich folgendermaßen auf die klinischen Fächer:Fach Beginn StundenStudienjahrStrahlentherapie WS 06/07 3 3Anästhesiologie WS 06/07 3 4Gynäkologie SS 07 2 4Innere Medizin SS 07 2 4Psychiatrie SS 07 3 5ThemaGrundlagen der Palliativmedizin, PalliativeStrahlen- und ChemotherapieSymptomkontrolle des Schmerzes in der PalliativmedizinSymptomkontrolle der Flüssigkeitseinlagerungin Körperhöhlen (Aszites, Pleuraerguss) undWundversorgungFlüssigkeitshaushalt und Ernährung in derpalliativen Situation (Diarrhoe, Obstipation,Ileus)Kommunikation im palliativen Kontext, „BreakingBad News“Allgemeinmedizin WS 06/07 2 5 Ethische und rechtliche DifferenzierungDermatologie SS 07 2 5HNO WS 06/07 3 5Urologie SS 07 2 5Schaffung eines sozialen Netzes in der palliativenVersorgung, Ambulante/ StationäreVernet<strong>zu</strong>ng, TeamarbeitSymptomkontrolle Atemnot in der Palliativmedizinund palliative SedierungSymptomtherapie und psychosoziale Aspektein der SterbephaseDie Unterrichtsform richtet sich nach der jeweiligen Thematik. Die Studenten sollen in überwiegendinteraktiv gestaltetem Unterricht anhand von Falldarstellungen erfahren, dass palliativmedizinischePatienten eine umfassende, ganzheitliche Versorgung benötigen, um Leiden physischen, psychischen,sozialen oder spirituellen Ursprungs <strong>zu</strong> lindern oder ihm vor<strong>zu</strong>beugen. Es soll ebenfalls vermitteltwerden, dass sowohl die Begleitung und Unterstüt<strong>zu</strong>ng der Patienten als auch die Betreuung derAngehörigen eine vorausschauende Vernet<strong>zu</strong>ng der Versorgungsstrukturen einschließt. Neben Ärztenmit palliativmedizinischer Zusatzbezeichnung unterrichten Pflegekräfte mit Palliative Care Ausbildungsowie eine Psychologin mit langjähriger Erfahrung in der Therapie palliativer Patienten. In allen klinischenFächern wird auf die besondere Zielset<strong>zu</strong>ng in der Betreuung dieser Patienten hingewiesen: imVordergrund steht nicht mehr die Heilung, sondern die Verbesserung der Lebensqualität. So rückt -neben der Vermittlung von Wissen über die Behandlung von Schmerzen, Atemnot, Verwirrung undAngst - die Diskussion ethischer, rechtlicher und psychosozialer Aspekte in den Vordergrund. Nebendem Erlernen spezifischer Fähigkeiten und Fertigkeiten soll insbesondere die Weiterentwicklung derpersönlichen und fachlichen Einstellung gefördert werden.Außerdem gibt es sowohl in der Vorklinik (Gesprächsführung in der Palliativen Lebenssituation; Wahlfaches„Gesprächsführung“; Institut für Medizinische Psychologie) als auch in der Klinik Zusatzangeboteauf freiwilliger Basis. Zurzeit wird die Implementierung entsprechender Unterrichtsinhalte in dieverschiedenen Abschnitte des Praktischen Jahres geplant und die Einrichtung eines Lehrstuhls fürPalliativmedizin in <strong>Lübeck</strong> diskutiert.92
ANHANGC. Betreuung der StudentenBetreuung durch organisatorische MaßnahmenAnhang 29Vorwoche für die ErstsemesterAnhang 30Wegweiser für alle studentischen AngelegenheitenAnhang 31Kommunikationsplattform des StudiendekanatsAnhang 32Kurzbeschreibung im Internet: Beispiel RechtsmedizinAnhang 33KursanmeldungAnhang 34Beratungs- und Informationsangebote des StudiendekanatsAnhang 35Feste Termine des StudiendekanatsAnhang 36HärtefallanträgeAnhang 37Härtefallanträge - EntscheidungenUnterstüt<strong>zu</strong>ng durch UnterrichtAnhang 38„Tag des Lernens“Anhang 39POL Klinische Umweltmedizin im 3. StudienjahrAnhang 40Blockpraktikum Soziale und Evidenzbasierte Medizin im 4. StudienjahrAnhang 41Repetitorium im 2. Studienjahr: „Anatomie in fünf Tagen“Anhang 42Repetitorium im 6. Studienjahr: Innere MedizinUnterstüt<strong>zu</strong>ng durch MentoringAnhang 43MentorenprogrammAnhang 44Uni im DialogAnhang 45Studium GeneraleAnhang 46Weitere fakultative Veranstaltungen93
ANHANG94
ANHANGAnhang 29Vorwoche für die ErstsemesterZu Beginn des WS 06/07 fand <strong>zu</strong>m dritten Mal die Einführungswoche für die Studenten der Medizinischenund der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät statt, organisiert vom AStA und den Fachschaften.Dort sollen die Studenten ihre Kommilitonen und ihre <strong>Universität</strong> kennen lernen. Die Erstsemesterwerden von „Ersthelfern“ begleitet – das sind Studenten aus höheren Semestern und allenStudiengängen, die den Erstsemestern bei der Orientierung an der <strong>Universität</strong> helfen. Tagsüber stellenLehrstuhlinhaber und Dozenten ihr Fach vor, abends gibt es ein Rahmenprogramm.Der Stundenplan für die Vorwoche des WS 06/07 ist nachfolgender Tabelle <strong>zu</strong> entnehmen.Zeit091011Montag(09. Oktober)Das MedizinstudiumBegrüßungsveranstaltungPetri-KircheLabahn12 Check-In1314151617Check-InOrgavor Z1/2Eröffnungmed. Vorw.WestermannZ1/2EinführungStudiumWestermannZ1/2EinführungMedizinstudiumWestermannZ1/2Eröffnung TNFDienstag(10. Oktober)EinführungAnatomieWestermannZ1/2Umgangmit demLeichnamEggersÖffnungszeit AStAMathe VorkursMittwoch(11. Oktober)Leben undWohnen inHLKuhleEinführungPhysikPaulsenMathe VorkursMesseEinrichtungen der<strong>Universität</strong>BrunchFachschaftenAltes Kesselhaus(Hs. 34)Z1/2 Gremien der<strong>Universität</strong>UmesKurseMathe VorkursKurseMathe VorkursDonnerstag(12. Oktober)EinführungChemieWeimarVorstellungder klin.VorlesungenKleinTipps fürErstisvon uns füreuchÖffnungszeit AStAMedizinischeTerminologieKanzKurseMathe VorkursMathe VorkursFreitag(13. Oktober)EinführungBiologieBerufsfelderfürMedizinerEvaluation/SchlussÖffnungszeit AStA2021KneipentourStadtführungSportfestUni-KinoVorwochen-Party95
ANHANGAnhang 30Wegweiser für alle studentischen AngelegenheitenDer nachfolgende ‚Wegweiser’ für studentische Angelegenheiten dient Studenten als Hilfestellung, dierichtigen Ansprechpartner für die vielseitigen Themen im Studium <strong>zu</strong> finden. Alle Erstsemester werdenab Oktober 2006 diesen Wegweiser im Erstsemester-Infoheft finden, das in der Vorwoche mit der‚Begrüßungstüte’ von der Fachschaft und dem AStA vergeben wird.Liebe Studierende,das Studierenden-Service-Center und das Studiendekanat heißen Sie noch einmal ganz herzlich willkommen<strong>zu</strong> Ihrem Medizinstudium an der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>. Wir möchten Ihnen unsere Aufgabenbereichevorstellen, damit Sie wissen, wer Ihnen welche Fragen rund um Ihr Studium beantwortenkann.Das Studierenden-Service-Center (SSC) gehört <strong>zu</strong>r Zentralen <strong>Universität</strong>sverwaltung, die Bereiche<strong>zu</strong>m Studentenstatus betreut, die alle Studiengänge betreffen, wie z. B. die Zulassungsstelle und dasAkademische Auslandsamt. Das Studiendekanat ist ein Bereich des Dekanats der Medizinischen Fakultät(MF), das Sie in allen Angelegenheiten berät, die die Lehre, ihre Organisation und Entwicklungausschließlich im Studiengang Humanmedizin anbelangen.Hier die Aufgabenbereiche und ihre Ansprechpartner im Überblick. Im Anschluss finden Sie die Kontaktdatenaller Ansprechpartner.Thema Ansprechpartner BereichAusbildungsförderung (z. B. BaföG) Voigt SSCAustauschprogramme (z. B. Erasmus und Sokrates) Maaß SSCBehindertenberatung Voigt SSCBescheinigungen für bisher absolvierte Leistungsnachweise Mathias MFBewerbungen von ausländischen Studenten Maaß SSCBewerbungen für deutsche Studenten A-L Freiberg SSCBewerbungen für deutsche Studenten M-Z Bergmann SSCBeurlaubung Bergmann/ Freiberg SSCEinschreibung Bergmann/ Freiberg SSCEmpfehlungsschreiben des Dekans (‚letter of recommendation’) Mathias MFExmatrikulation Bergmann/ Freiberg SSCGasthörerschaft Voigt SSCGrundsatzfragen Westermann MFHärtefallantrag Reinke/ Westermann MFHochschuldidaktik Friedrich MFHomepage Riese MFImmatrikulationsbescheinigungen Bergmann/ Freiberg SSCKooperation mit der <strong>Universität</strong>skirche ‚Uni im Dialog’ Reinke MFKursanmeldung und -einteilung (Online-Kursanmeldung) Riese MFKursanmeldung für Nachrücker und Studienortwechsler Reinke MFLehre Humanmedizin Reinke MFLehrevaluation Brauner MFLehrkrankenhäuser Reinke MFLehrpreis Brauner/ Reinke MFLerncoaching für Studierende Friedrich MFMentorenprogramm Reinke MFÖffentlichkeitsarbeit und Werbung Reinke MFPartneruniversitäten Maaß SSCPraktisches Jahr Reinke MFPromotion Puhl SSCPrüfungen (Semesterabschlussklausuren etc.) Reinke MFPrüfungsamt Puhl SSC96
ANHANGFortset<strong>zu</strong>ng Anhang 30Wegweiser für alle studentischen AngelegenheitenThema Ansprechpartner BereichSemesterbeitrag Bergmann/ Freiberg SSCSemesterrückmeldungen Bergmann/ Freiberg SSCStiftungen und Stipendien Reinke/ Voigt MF/ SSCStudentenpreis Reinke MFStudienberatung allgemein Voigt SSCStudienberatung ausländischer Studenten Maaß SSCStudienberatung Humanmedizin Reinke/ Westermann MFStudienorganisation Reinke MFStudienplatztausch Bergmann/ Freiberg SSCZulassung Bergmann/ Freiberg SSCAnsprechpartner Bereich KontaktAngelika Bergmann SSC, Haus 2täglich 9-12 Uhr0451/500-3020freiberg@<strong>zu</strong>v.uni-luebeck.deTermine nach AbspracheDipl.-Psych. Anett Studiendekanat der MF, Evaluation,0451/500-5084BraunerHaus 60, Raum 22brauner@<strong>zu</strong>v.uni-luebeck.deElke Freiberg SSC, Haus 2PD. Dr. rer. physiol.Hans-Jürgen FriedrichMalin MaaßMonika MathiasStudiendekanat der MF, Arbeitsstelle fürHochschuldidaktik, Zentralklinikum, EG,Raum 9 (rechts hinter dem Kiosk vomHaupteingang kommend)SSC, Akademisches Auslandsamt / InternationalOffice, Haus 2Dekanat der MF, Sekretariat der Dekanatsgeschäftsstelle,Haus 60, Raum 25Sabine Puhl SSC, Zentrales Prüfungsamt, Haus 2Susanne Reinke, M.A.Dipl.-Inform. WolfgangRieseStudiendekanat der MF, Lehrkoordination,Zentralklinikum, EG, Raum 10(rechts hinter dem Kiosk vom Haupteingangkommend)Studiendekanat der MF, EDV-Koordinator, Haus 60, Raum 22Dr. phil. Sabine Voigt SSC, Dezernatsleitung, Haus 2Prof. Dr. med. JürgenWestermannStudiendekan, Institut für Anatomie,Haus 63, 1. Stocktäglich 9-12 Uhr0451/500-3021 bergmann@<strong>zu</strong>v.uni-luebeck.deTermine nach Absprache0451/500-6711friedrich@<strong>zu</strong>v.uni-luebeck.detäglich 9-12 Uhr0451/500-3012maass@<strong>zu</strong>v.uni-luebeck.detäglich von 9 bis 12 Uhr0451/500-3040mathias@<strong>zu</strong>v.uni-luebeck.detäglich 9-12 Uhr0451/500-3031puhl@<strong>zu</strong>v.uni-luebeck.deDienstag von 9 bis 11.30 Uhr,Donnerstag von 10 bis 12 Uhrund nach Absprache0451/500-6710reinke@<strong>zu</strong>v.uni-luebeck.deTermine nach Absprache0451/500-5085riese@<strong>zu</strong>v.uni-luebeck.detäglich 9-12 Uhr0451/500-3009voigt@<strong>zu</strong>v.uni-luebeck.deTermin nach Absprache0451/500-4000 und 4031westermann@anat.uniluebeck.de97
ANHANGAnhang 31Kommunikationsplattform des StudiendekanatsDer Internetauftritt des Studiendekanats ist die Kommunikationsplattform für alle an der Lehre Beteiligten.Über die Startseite www.medizin.uni-luebeck.de können alle Informationen und interaktiven Elementeaufgerufen werden:• E-Mail-Account,• Kursanmeldung,• Mentorenprogramm,• Persönlicher Kursplan,• PJ-Anmeldung,• PJ-Evaluation,• Semesterevaluation.Außerdem werden hier die Evaluationsergebnisse veröffentlicht.98
ANHANGAnhang 32Kurzbeschreibung im Internet: Beispiel RechtsmedizinAlle anderen Kurzbeschreibungen sind im Internet unter http://www.medizin.uni-luebeck.de <strong>zu</strong> finden.Name der Lehrveranstaltung Rechtsmedizin (Blockpraktikum)Beginn der VeranstaltungTypus der LV(Vorlesung, Seminar, Klin. Sem,Praktikum)Generelles Ziel der LVIntegration, Verknüpfung mitanderen LVZielgruppeEingangsvorausset<strong>zu</strong>ngen (evtl.Art u. Zeit der Überprüfung)Umfang der LV (akad. Stundenpro Student(in))GruppengrößeInhalte der LV (Themen, Reihenfolge,Schwerpunkte)Methodik, Didaktik und Formder LVLernziele (Kenntnisse)(Was soll der Stud. wissen undverstanden haben)Lernziele (Fertigkeiten)(Was soll der Stud. nach der LVpraktisch zeigen können)Haltungen / Lernziele anderer(höherer) ArtArt der LeistungsüberprüfungKriterien für eine Scheinvergabe(Teile, Gewichtung, Benotungsmaßstab)siehe gesonderte TabelleVorlesung und Kurs (Blockpraktikum mit integrierten Seminarenund einem Zusatztermin mit zwei Seminaren an einem Sonnabendpro Semester)Korrekte Durchführung einer Leichenschau mit Ausstellung derTodesbescheinigung; Dokumentation und Bewertung von Verlet<strong>zu</strong>ngsspuren,Recherche und Präsentation eines fallbezogenenThemas; Grundlagen des Medizinrechtes und der Medizinethikkeine3./4. klinisches SemesterEingangstestat <strong>zu</strong>r aufgeführten Themenliste5-10 min mündliches Testat als Einzelprüfung20 h Unterricht im Blockpraktikum, 10 h eigenständiges Arbeiten<strong>zu</strong>r Vorbereitung des Fallseminars, 4 h Sondertermin (Seminare)an einem Sonnabend pro Semester, 1 SemesterwochenstundeVorlesungLeichenschau, Todesbescheinigung, Obduktion, Wundmorphologie,Psychopathologie, Arztrecht und –ethik, Alkohologie, Toxikologie,Serologie, VerkehrsunfallrekonstruktionAllgemeine Einführung in das Praktikum; praktische Anleitung und<strong>zu</strong>nehmend eigenständige Durchführung der Leichenschau; Ausstellender Todesbescheinigung anhand der erhobenen Befunde;innere Leichenschau; Beschreiben und Erkennen <strong>zu</strong>nächst vonEinzelverlet<strong>zu</strong>ngen bei Lebenden und Toten, dann von komplexenBefunden in Seminarform; Erarbeitung von arztrechtlichen (Sorgfaltspflicht,Behandlungsfehler, Tötungsdelikte) und arztethischenFragen (Sterbehilfe) anhand von Kasuistiken im Rahmen von Seminaren,basierend auf Referaten; Vermittlung von psychopathologischenund arztrechtlichen Grundkenntnissen im Rahmen einesfallbezogenen Seminars; Vermittlung eines Überblicks der für diepraktische ärztliche Tätigkeit relevanten rechtsmedizinischen Teilgebietein Seminarform (Alkohologie, Toxikologie, DNA-Analytik,Verkehrsunfallrekonstruktion)Durchführung einer Leichenschau, Ausfüllen der Todesbescheinigung,Grundlagen des Leichen- und Obduktionswesens, SystematischeErhebung und Beschreibung von Verlet<strong>zu</strong>ngen / Grundlagender Wundmorphologie, Aufgabengebiete und Tätigkeitsfeld derRechtsmedizinBefähigung <strong>zu</strong>r korrekten Durchführung einer Leichenschau undAusfüllen der Todesbescheinigung anhand der erhobenen Befunde,Beschreibung und Befunderhebung von Verlet<strong>zu</strong>ngenEigenständige Literaturecherche und Ausarbeitung eines Themas<strong>zu</strong> rechtlichen, arztethischen oder allgemeinen medizinischen Frageninkl. KurzvortragEingangstestat, Klausur, (Teilnahme an der Klausur nur nach Besuchder Vorlesung über zwei Semester möglich , d.h. frühestensab 8. Fachsemester), Schriftlich ausgearbeitetes ReferatAusreichende Punktzahl bei der KlausurSchriftliches ReferatKeine Fehltermine (Nachholtermine werden angeboten)Zuständig für Fragen Dr. med. W. Früchtnicht; Tel: 2755Letzte Änderung: 05.09.200699
ANHANGAnhang 33KursanmeldungKurz vor Ende eines laufenden Semesters haben die Studenten die Möglichkeit, sich online für dieKurse des nachfolgenden Semesters an<strong>zu</strong>melden. Dabei können sie angeben, mit wem sie <strong>zu</strong>sammeneingeteilt werden möchten. Diese Wünsche werden bei der Einteilung weitgehend berücksichtigt.Im Folgenden ist die Kursanmeldung für die Veranstaltungen des dritten Studienjahres <strong>zu</strong> sehen.Nach vier Wochen ist vom Studiendekanat die Kurseinteilung mit Hilfe von e-LOKS vorgenommenworden und die Studenten können im Internet ihren persönlichen Kursplan für das nächste Semesteraufrufen. In der folgenden Abbildung ist der persönlicher Stundenplan für einen Studenten des 3. Studienjahresabgebildet. Die Ziffern in Zeile 1 geben das Jahr und die Kalenderwochen an, in denen derUnterricht für diesen Studenten stattfindet – 614 bedeutet z.B. Jahr 2006, Kalenderwoche 14. In diesemBeispiel hat der Student die Lehrveranstaltungen:• Bildgebende Verfahren, Teil Strahlenschutz und Nuklearmedizin,• Humangenetik• Hygiene, Mikrobiologie, Virologie• Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik• Notfallmedizin• Pathologie im wöchentlichen Wechsel mit• Pharmakologie, Toxikologie und den• U-Kurs<strong>zu</strong>gewiesen bekommen. In der Spalte „Info“ findet der Student weiterführende Informationen <strong>zu</strong>mjeweils <strong>zu</strong>geteilten Kurs. In diesem Fall hat der Student „Hygiene, Mikrobiologie, Virologie“ am Donnerstagund „Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik“ am Montag. In „Notfallmedizin“ ist er inGruppe 7 eingeteilt (der genaue Rotationsplan für die Notfallmedizin befindet sich auf der Homepage).Die beiden Kurse „Pathologie“ und „Pharmakologie, Toxikologie“ wechseln sich wochenweise ab,wobei die „B-Gruppen“ mit „Pharmakologie, Toxikologie“ beginnen und die „A-Gruppen“ mit „Pathologie“.In den Wochen, in denen er den jeweiligen Kurs besucht, befindet sich ein „*“ im Kursplan.Der „U-Kurs“ findet immer montags oder dienstags statt. „Unser Student“ ist in Gruppe 24 eingeteilt,die immer dienstags ihren Kurs hat. Die Abfolge, in der er die jeweiligen Kliniken besuchen soll, ist imdanach folgenden Rotationsplan angegeben. Die Termine „unseres Studenten“ sind mit einem rotenKreis gekennzeichnet.100
ANHANGFortset<strong>zu</strong>ng Anhang 33KursanmeldungDienstagKW 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28Pädiatrie17 17 17 20 20 20 15 15 15 21 21 21Pädiatrie23 23 23 28 28 28 25 25 25 22 22 22Pädiatrie19 19 19 18 18 18 16 16 16Pädiatrie24 24 24 27 27 27 26 26 26Gynäkologie 18 16 18 20 19 17 15 21 15 19 21 16 17 20Gynäkologie 27 26 27 28 24 23 25 22 25 24 22 26 23 28Psychiatrie - - - - 19 21 18 17 20 15 16Psychiatrie - - - - 24 22 27 23 28 25 26Urologie 16 18 15 17 21 19 20Urologie 26 27 25 23 22 24 28Augenheilkunde 20 15 18 16 17 19 21Augenheilkunde 28 25 27 26 23 24 22DermatologieDermatologie15 20 16 21 17 19 1825 28 26 22 23 24 27101
ANHANGAnhang 34Beratungs- und Informationsangebote des StudiendekanatsDas Studiendekanat bietet regelmäßige Beratungs- und Informationstermine an. Darüber hinaus könnenTermine außerhalb der Sprechzeiten vereinbart werden. Die Beratungen lassen sich in drei Kategorien<strong>zu</strong>ordnen:Regelmäßige InformationsveranstaltungenZielgruppe InhaltUmfang proVeranstaltung(in Stunden proJahr)Tag der offenen Tür 5SchülerMesse ‚Einstieg Abi’ 20<strong>Lübeck</strong>er Hochschultag 10Vorträge in Gymnasien 10StudienanfängerEinführung in das Medizinstudium im Rahmen der Einführungswoche2Veranstaltung ‚Lernen lernen’ 81. StudienjahrSemesterabschlussbesprechung am Ende des 1. Semestersund Vorbereitung auf das 2. Semester2Semesterabschlussbesprechung am Ende des 2. Semesters2und Vorbereitung auf das 3. Semester2. Studienjahr Besprechung <strong>zu</strong>m Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 23. Studienjahr Einführung in den klinischen Studienabschnitt 24. und 5. StudienjahrInformationsveranstaltung <strong>zu</strong>m PJ 2Summe 65Sprechstunden des StudiendekanatsUmfang proVeranstaltung(in Stunden)Zielgruppe InhaltproWocheproJahrSprechstunde des Studiendekans 2 56Studienberatung der Lehrkoordinatorin <strong>zu</strong> allen Themen derLehre, Organisation und Durchführung des Studiums4 112Studenten allerSemesterSprechstunden <strong>zu</strong>m Thema Evaluation und EDV-Koordination4 112Individuelle Lernberatung durch die Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik2 56Sondersprechstunden der Lehrkoordinatorin und des EDV-Koordinators <strong>zu</strong>r Kurseinteilung60Summe 396Obligatorische StudienberatungZielgruppeStudenten allerSemesterInhaltBeratung durch den Studiendekan, wenn am Ende einesStudienjahres weniger als zwei Drittel der Leistungsnachweiseerreicht wurdenBeratung durch den Studiendekan, wenn eine universitätsinternePrüfung zweimal nicht bestanden wurdeBeratungenpro Jahr102004: 712005: 572006: 32102
ANHANGAnhang 35Feste Termine des StudiendekanatsAus den regelmäßigen Informationsveranstaltungen des Studiendekanats ergibt sich neben den Beratungsterminenfolgender Terminablauf für das Studienjahr:ZeitpunktOktoberNovemberDezemberJanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberAngelegenheitEinführung: Erstsemester und VorklinikEinführung: Fünftes Semester und KlinikDoktorarbeit: Start der Reihe: Suchen und Finden einer DoktorarbeitMentorenprogramm: Aktualisierung der Termine für das erste Treffen des SemestersEvaluation: Ergebnisse werden allen Interessierten <strong>zu</strong>gänglich gemachtBegutachtung: Poster im Rahmen von „POL Umweltmedizin“Praktisches Jahr: Info-Abend inklusive Vorstellung der PJ-KrankenhäuserPraktisches Jahr: Freischalten der Online-Wahl der PJ-EinteilungPraktisches Jahr: Bekanntgabe der vorläufigen ErgebnissePraktisches Jahr: Letzte KorrekturenPraktisches Jahr: Bekanntgabe der endgültigen ErgebnisseKurseinteilung: Online-Wahl für die Kurse des nächsten SemestersKurseinteilung: Bekanntgabe der ErgebnisseEvaluation: Evaluationsportal wird für die Studenten geöffnetKurseinteilung: Letzte KorrekturenKurseinteilung: Bekanntgabe der endgültigen ErgebnisseMentorenprogramm: Beginn der Planung Uni im DialogBesprechung: Wie war des 1. Semester und wie wird das 2. Semester ablaufenEvaluation: Evaluationsportal wird geschlossen, DatenauswertungKurseinteilung: Versenden der Teilnehmerlisten an die InstitutionenMentorenprogramm: Planung Uni im DialogEvaluation: Ergebnisse werden den Direktoren der Institute und Kliniken <strong>zu</strong>geschicktHomepage: Aktualisierung aller InterneteinträgeMentorenprogramm: Planung Uni im DialogEvaluation: Ergebnisse werden allen Interessierten <strong>zu</strong>gänglich gemachtPraktisches Jahr: Freischalten der Online-Wahl der PJ-EinteilungMentorenprogramm: Planung Uni im DialogPraktisches Jahr: Bekanntgabe der vorläufigen ErgebnissePraktisches Jahr: Letzte KorrekturenMentorenprogramm: Uni im DialogKurseinteilung: Online-Wahl für Kurse des nächsten SemestersPraktisches Jahr: Bekanntgabe der endgültigen ErgebnisseKurseinteilung: Bekanntgabe der ErgebnisseEvaluation: Evaluationsportal wird für die Studenten geöffnetKurseinteilung: Letzte KorrekturenKurseinteilung: Bekanntgabe der endgültigen ErgebnisseBesprechung: Wie war das 2. Semesters und wie wird das 3. Semester ablaufenEvaluation: Evaluationsportal wird geschlossen, DatenauswertungHomepage: Aktualisierung aller InterneteinträgeKurseinteilung: Versenden der Teilnehmerlisten an die InstitutionenEvaluation: Ergebnisse <strong>zu</strong> den Einrichtungsleitern103
ANHANGAnhang 36Härtefallanträge - KriterienHat ein Student dreimal eine universitätsinterne Prüfung nicht bestanden, muss ein strukturierter Härtefallantragbeim Studienausschuss gestellt werden, wenn das Studium fortgesetzt werden soll. Indem Antrag muss ersichtlich sein, um welchen Schein es sich handelt, wie das bisherige Studiumverlaufen ist und über welche Ressourcen der Student verfügt. Die Leitfragen <strong>zu</strong>r Beantwortung dieserFragen sind im Folgenden aufgeführt.Angaben für den Studienausschuss <strong>zu</strong>rAnerkennung als Härtefall(Stand: Juli 2006)Bitte nehmen Sie in jedem Fall <strong>zu</strong> den unten aufgeführten Punkten Stellung. Alle weiterenAngaben, die helfen Ihre Situation <strong>zu</strong> verstehen, sind von großem Nutzen. Ihr Antragmuss im Studiendekanat oder im Sekretariat des Instituts für Anatomie abgegeben werdensowohl in elektronischer Form als auch als Ausdruck:• Für welchen Schein wollen Sie als Härtefall anerkannt werden?• Haben Sie bereits schon einmal einen Härtefallantrag gestellt (wenn ja, wannund in welchem Fach)?• Bitte geben Sie die drei Termine an, an welchen die Prüfungen stattfanden, dieSie nicht bestanden haben.• Wann findet die Klausur/Prüfung statt, an der Sie teilnehmen wollen?• Warum betrachten Sie sich als Härtefall und wie hat sich Ihre Situation seit demBeratungsgespräch verändert? (max. 1 Seite)• Wieso glauben Sie, dass Sie die Prüfung beim nächsten Mal bestehen werden?(max. 1 Seite)• Stellungnahme Ihres Mentors <strong>zu</strong> diesem Härtefallantrag• Seit wann studieren Sie Medizin?• Wann wollen Sie sich <strong>zu</strong>m Ersten/Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung melden?• Welche Scheine fehlen Ihnen noch, um sich dafür <strong>zu</strong> melden?• Haben Sie alle anderen Scheine beim ersten Versuch erhalten? Wenn „nein“,führen Sie bitte einzeln die „Historie“ der betreffenden Scheine auf (Bitte als Tabelleaufführen).Bitte geben Sie für jede von Ihnen im Rahmen Ihres Medizinstudiums abgelegte Prüfungdie von Ihnen erreichte Punktzahl an. Führen Sie bitte <strong>zu</strong>sätzlich auf, wie viele Punktejeweils maximal möglich gewesen wären (Bitte als Tabelle aufführen).104
ANHANGAnhang 37Härtefallanträge - EntscheidungenSeit 2004 wurden 42 Härtfallanträge 39 beim Studienausschuss gestellt. Davon wurden 35 Anträge(83%) positiv entschieden, bei sieben Studenten (17%) wurde er abgelehnt. Von diesen 35 Studentensind 26 <strong>zu</strong>r vierten Prüfung angetreten. Davon haben 22 die Prüfung bestanden. Damit bestehen rund63% der Studenten die Prüfung im vierten Anlauf, wenn der Härtefall vom Studienausschuss positivbeschieden wurde.Jahr 2004Entscheidung desStudienausschussPrüfungwurde …1. Biochemie positiv nicht angetreten, da vorher exmatrikuliert2. Pharmakologie positiv nicht bestanden3. Pharmakologie positiv bestanden4. Pharmakologie negativ5. Biochemie negativ6. Biochemie negativ7. Pharmakologie positiv bestanden8. Biochemie positiv bestanden9. Biochemie positiv bestanden10. Pharmakologie positiv nicht angetreten11. Augenheilkunde positiv bestanden12. Pharmakologie positiv nicht angetreten, da vorher exmatrikuliert13. Biologie/Biochemie positiv bestandenJahr 200514. Biochemie positiv nicht angetreten, da vorher exmatrikuliert15. Biochemie positiv bestanden16. Biochemie positiv bestanden17. Biologie positiv bestanden18. Biochemie positiv bestanden19. Biochemie positiv nicht angetreten, da vorher exmatrikuliert20. Biochemie positiv bestanden21. Biochemie positiv bestanden22. Pharmakologie positiv nicht angetreten23. Biochemie positiv nicht bestanden24. Biochemie negativ25. Biochemie negativ26. Pharmakologie negativ27. Biochemie positiv bestanden28. Biochemie positiv bestanden29. Biologie positiv bestanden30. Histologie positiv nicht bestanden31. Biochemie positiv bestandenJahr 200632. Biologie positiv bestanden33. Biochemie positiv bestanden34. Physiologie positiv nicht angetreten35. Physiologie positiv bestanden36. Biologie positiv nicht angetreten37. Biologie negativ38. Pharmakologie positiv findet noch statt39. Biochemie positiv nicht bestanden40. Biochemie positiv bestanden41. Biochemie positiv bestanden42. Biochemie positiv bestanden39 Stand 01. November 2006105
ANHANGAnhang 38„Tag des Lernens“Studienanfänger in der Medizin sehen sich mit einer ungeheuren Menge an Stoff konfrontiert. Da teilweisedie adäquaten Strategien fehlen, kann dies <strong>zu</strong> Stress und Überforderung führen. Die ArbeitsstelleHochschuldidaktik bietet ein Forum, um diese Probleme <strong>zu</strong> beleuchten und <strong>zu</strong> diskutieren undhofft, dass sich neue Perspektiven für die Studenten ergeben.Von den Erstsemestern werden Lernempfehlungen erfragt. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dieseBefragung wiederholt werden. Die Ergebnisse beider Befragungen werden miteinander verglichen.Tag des LernensSa., 22. 10. 05 ab 9:00 im Z1/Z2für Studienanfänger (Erstsemester des Studiengangs Humanmedizin)- Eine Veranstaltung der Arbeitsstelle Hochschuldidaktik -09:00 Aspekte des studentischen Lernens (FRIEDRICH)Selbst- und Zeitorganisation, Lernstrategien, „Lerntipps“, Stress10:00 Lernen in Gruppen (BRAUNER)Wann und wie? Schwierigkeiten und Vorteile11:00 Besonderheiten des Lernens in der Anatomie (EGGERS)11:30 Erfahrungen und Hinweise von Studierenden aus älterenSemesternFragen und AntwortenIn der Mittagspause:BITTE SELBST FÜR VERPFLEGUNG SORGEN!=> Bücherverkauf des Asta für die Erstsemester!Mini-Präsentation des örtlichen Buchhandels13:00 Vergabe einer kostenlosen E-Mail-Adresse? (RIESE)Wie komme ich an meine Adresse?14:00 Kurz-Test <strong>zu</strong>m Finden des eigenen Lernstils (anonym)14:30 Welche Lernempfehlungen kann ich (Studenten des erstenSemesters) geben?106
ANHANGAnhang 39POL Klinische Umweltmedizin im 3. StudienjahrKlinische Umweltmedizin ist nach der neuen ÄAppO ein Querschnittsbereich, der gemäß eines Fakultätsbeschlussesin Form des Problemorientierten Lernens (POL) nach einem modifizierten Harvard-Modell vermittelt wird. Der Kurs findet <strong>zu</strong> Beginn des klinischen Studienabschnittes in einem zweiwöchigenBlock statt. Währendessen absolvieren die Studenten parallel nur den Untersuchungskurs.Da in der Umweltmedizin große Teile des Wissens noch nicht gefestigt im Sinne von evidenzbasiertsind, werden in den Vorlesungen vor allem die verschiedenen Herangehensweisen an umweltmedizinischeProbleme mit folgenden immanenten Fragen thematisiert:• Welche Umweltfaktoren sollten bei Kausalüberlegungen <strong>zu</strong> Krankheiten berücksichtigt werden?• Gibt es eine „typische“ Umweltkrankheit?• Wie kann in Grenzbereichen des medizinischen Fachwissens ärztliches Handeln dennoch evidenzbasiert,selbstkritisch und strukturiert differentialdiagnostisch ausgerichtet werden?Der Unterricht gliedert sich in eine täglich zweistündige Vorlesung mit Dozenten aus 15 Fachgebietenund Fallarbeit in Kleingruppen. Neben einem Beispielfall wird in den zwei Wochen ein durch den Tutorerstelltes Fallbeispiel bearbeitet. Die Ergebnisse werden vor hochrangig besetzten Posterkommissionenvorgestellt, diskutiert und bewertet. Scheinkriterien sind die regelmäßige Teilnahme an den Gruppenterminen,die Posterbewertung durch die Kommission, eigene Bewertung fremder Poster und ggf.eine vom Tutor fest<strong>zu</strong>legende Leistungsdifferenzierung.Das maßgeblich in <strong>Lübeck</strong> entwickelte Curriculum für Klinische Umweltmedizin wird von der DeutschenGesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin bundesweit <strong>zu</strong>r Anwendung empfohlen 40 .Die Umset<strong>zu</strong>ng wurde evaluiert, erste Ergebnisse sind publiziert 41 . Weitere Publikationen, auch überdie Schwierigkeiten der Evaluation interdisziplinär angelegter Vorlesungsreihen, sind in Vorbereitung.Datum 16.10.06 17.10.06 18.10.06 19.10.06 20.10.06Zeit (Beginn) Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag08:0009:0010:0011:0012:0013:0014:00Z3: Vorlesung <strong>zu</strong>mUntersuchungskursT1: Studiendekan:Begrüßung und Einführungin das 3.StudienjahrT1: PsychiatrieUmwelt und PsycheUntersuchungskurs14 – 18 UhrZ3: Organisation:POL praktischZ3: Arbeitsmedizin:Was ist klinischeUmweltmedizinZ3: Dermatologie:Licht und HautUntersuchungskurs14 – 18 UhrT1: Hygiene:SchimmelpilzbelastungenvonInnenräumenT1: Allgemeinmed.:Kommunikation mitUmweltkrankenT1: Organisation:PostererstellungT1: Radiologie: natürlicheund zivilisatorischeStrahlenbelastungT1: Gastroenterologie:Magen-Darm-ErkrankungenT1: Genetik:UmweltgenetikT1: Allgemeinmed.:„Umweltkranke“ in derärztlichen PraxisDatum 23.10.06 24.10.06 25.10.06 26.10.06 27.10.06Zeit (Beginn) Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag08:0009:00Z3: Vorlesung <strong>zu</strong>mUntersuchungskurs10:0011:0012:0013:0014:00T1: Arbeitsmedizin:Arbeit und UmweltT1: Arbeitsmedizin:Umweltfaktor ErnährungUntersuchungskurs14 – 18 UhrZ3: HNO: Allergienund HNO-ErkrankungenZ3: HNO: LärmbedingteErkrankungenUntersuchungskurs14 – 18 UhrT1: Anästhesiologie:MCST1: Arbeitsmedizin:Klima und GesundheitT1: Arbeitsmedizin:SchlafT1: Pulmologie: A-temwegs- und LungenerkrankungenT1: Krebsregister:Umweltfaktoren undKrebsclusterT1: Organisation:Abschlussbesprechung40 Weiler SW, Bäuerle V, Friedrich HJ, Nowak D: Themen- und Lernzielkatalog „Klinische Umweltmedizin“. Umweltmed ForschPrax 2005; 10; 239-245; Weiler SW, Bäuerle V, Friedrich HJ, Nowak D: Themen- und Lernzielkatalog „Klinische Umweltmedizin“.Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2005; 40; 314-32141 Weiler SW, Wussow A, Tiedje T, Kessel R: "Klinische Umweltmedizin" mittels POL in frühen klinischen Semestern, GMS ZMed Ausbild 2005; 22(4):Doc97107
ANHANGAnhang 40Blockpraktikum Soziale und Evidenzbasierte Medizin im 4. StudienjahrDas Blockpraktikum „Soziale und Evidenzbasierte Medizin" wird im 4. Studienjahr angeboten. Für dieVeranstaltung wurden folgende übergreifende Lehrziele formuliert:• Qualitativ hochwertige wissenschaftliche Informationen in Entscheidungsprozesse am Patientenund in den Systemkontext einbeziehen können.• Informationen <strong>zu</strong>m Gesundheits- bzw. Krankheits<strong>zu</strong>stand von Bevölkerungsgruppen auffindenund nutzen können sowie Informationen <strong>zu</strong>m Gesundheits- bzw. Krankheits<strong>zu</strong>stand von Individuen(= diagnostische Informationen) interpretieren können.• Medizinische und soziale Folgen von Krankheit konzeptionell beschreiben und für ein Individuumbeurteilen können.• Wirksamkeit und Risiken von präventiven und therapeutischen Interventionen gegeneinanderabwägen können.• Möglichkeiten und Grenzen der medizinischen Rehabilitation als Maßnahme <strong>zu</strong>r Bewältigung vonKrankheitsfolgen kennen.• Die Rollen unterschiedlicher Leistungserbringer und ihre Kooperationsnotwendigkeiten im deutschenGesundheitssystem kennen.• Das Gesundheitssystem als Wirtschaftssystem verstehen.Die Pflichtveranstaltung wird durchgängig (Winter- und Sommersemester) als 14-tägiges Blockpraktikumfür Gruppen von bis <strong>zu</strong> 20 Studenten angeboten; jede Gruppe wird von einem Dozenten aus demInstitut für Sozialmedizin betreut. Der Unterricht der ersten Woche ist eher theoretisch ausgerichtetund findet im Institut für Sozialmedizin statt. Die ersten vier Tage der Woche sind der Vermittlung dernotwendigen Kenntnisse <strong>zu</strong>r Erarbeitung von evidenzbasierten Entscheidungen in den BereichenKrankheitshäufigkeit, Diagnostik, Prognose, Therapie und Gesundheitsökonomie gewidmet. Hier<strong>zu</strong>werden klinische Fallvignetten und exemplarisch ausgewählte Fachliteratur verwendet. Am letztenTag kommen die im Laufe der Woche erworbenen Kenntnisse bei der kritischen Bewertung einerScreeningmaßnahme <strong>zu</strong>r Anwendung. Dieser Tag wird gänzlich durch Referate von Studenten gestaltet,in denen die im Laufe der Woche erworbenen Kenntnisse <strong>zu</strong>r Anwendung kommen.In der zweiten Woche des Blockpraktikums steht das Kennenlernen und Verstehen des deutschenGesundheitssystems im Vordergrund. Die eine Hälfte der Zeit ist Hospitationen, die andere den Hospitationsberichtengewidmet. Insgesamt stehen etwa 15 Hospitationsstellen <strong>zu</strong>r Verfügung, die an dreiTagen der Woche von Kleingruppen bis <strong>zu</strong> fünf Studenten besucht werden. Dabei werden die BereicheRehabilitationswesen (ambulante und stationäre Rehaeinrichtungen, Tagesklinik), Kostenträgerschaft(private und gesetzliche Krankenversicherer, Rentenversicherung, Kassenärztliche Vereinigung)und Kooperation (Gesundheitsamt, Selbsthilfe, Pflege, Apotheke) aufgesucht. In durch Leitfragenstrukturierten Kurzreferaten stellen die Studenten, die eine Hospitationsstelle besucht haben,ihren Kommilitonen die wichtigsten Charakteristika der jeweiligen Institution vor. Der Dozent aus demInstitut für Sozialmedizin übernimmt dabei eine Moderatorenrolle. Das Praktikum wird durch eine Vorlesung<strong>zu</strong> internationalen Gesundheitssystemen ergänzt.Die Lernzielkontrolle erfolgt durch Bewertung von Referaten und mündlicher Mitarbeit. Zusätzlich <strong>zu</strong>den Bescheinigungen nach der AO erhalten die Studenten eine Bescheinigung über die Teilnahme aneinem EbM-Kurs nach dem Curriculum der Bundesärztekammer.Die Veranstaltung wird hausintern und fakultätsintern evaluiert. Dabei gilt die hausinterne Evaluationvor allem auch der Aufdeckung von Verbesserungspotential. Im Vergleich <strong>zu</strong> den anderen Fächerndes klinischen Studienabschnitts liegen die Bewertungen durch die Studenten im oberen Mittelfeld.108
ANHANGFortset<strong>zu</strong>ng Anhang 40Blockpraktikum Soziale und Evidenzbasierte Medizin im 4. StudienjahrEinordnung der Veranstaltung in das Profil des StudiengangesDie Veranstaltung setzt die Wahrnehmung der Fakultät um, dass medizinische Versorgung auf individuelleraber auch auf systemischer Ebene auf wissenschaftlicher Basis <strong>zu</strong> erfolgen hat. Diese grundsätzlicheHaltung wird bereits in der vorklinischen Veranstaltung „Einführung in die klinische Medizin"vorbereitet. Im Blockpraktikum „Soziale und Evidenzbasierte Medizin" werden die notwendigen Kenntnisseund Fähigkeiten, systematisch wissenschaftliche Informationen auf<strong>zu</strong>finden, ihre Qualität <strong>zu</strong>bewerten, die Ergebnisse <strong>zu</strong> interpretieren und in Entscheidungskontexten um<strong>zu</strong>setzen, vermittelt.Diese Kenntnisse und Fähigkeiten sind in den anschließenden klinischen Praktika unmittelbar verwertbar.Abstimmung mit den anderen Fächern des PflichtcurriculumsDie Inhalte des Blockpraktikums (der ersten Woche) sind vor allem mit den Inhalten der Veranstaltungendes Institutes für Biometrie und medizinische Statistik abgestimmt um Synergien <strong>zu</strong> erreichen undRedundanzen <strong>zu</strong> vermeiden. Weitere Abstimmungen erfolgen mit den Lehrplänen des zentralen Doktorandenseminarsund des Wahlfachs für klinische Rehabilitationsmedizin.Innovative Aspekte der Veranstaltung<strong>Lübeck</strong> ist bisher, neben den Reformstudiengängen in Hamburg, Berlin und Witten-Herdecke, dieeinzige medizinische Fakultät, die das vollständige Curriculum für Evidenzbasierte Medizin in eineklinische Pflichtveranstaltung integriert.Auswirkungen der Evaluationsergebnisse der Studenten und Meinungen der Fachkollegen aufdie Entwicklung der VeranstaltungIn der Evaluation wird die Qualität der Gesamtveranstaltung wie auch der Einzeltermine von den Studentenmit Schulnoten bewertet. Zusätzlich wird am letzten Praktikumstermin um mündliches Feedbackgebeten. Die bisherigen Evaluationsergebnisse (auch der Vorgängerveranstaltungen) haben <strong>zu</strong>grundlegenden Veränderungen des Veranstaltungskonzeptes geführt:• Aufgabe der Plenarvorlesung, Einführung der Kleingruppen.• Aufgabe der 1x pro Woche stattfindenden Veranstaltung <strong>zu</strong>gunsten des Blockunterrichtes.• Integration einer POL Einheit (Screening).• Gestaltung der zweiten Praktikumswoche vorwiegend durch die Studenten selbst.• Aufgabe aller „Vorlesungseinheiten" bis auf „Internationale Gesundheitssysteme".• Verzicht auf eine Klausur.Noch nicht befriedigend umgesetzt werden konnte eine engere Anbindung an Veranstaltungen derklinischen Fächer mit Besprechung von „realen" klinischen Problemfällen.Transfer der Erkenntnisse und Erfahrungen über den eigenen Wirkungskreis hinausÜber das Blockpraktikum wurde in der Zeitschrift für ärztliche Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen42 sowie auf der GMDS-Tagung 2005 43 berichtet.42 Gerhardus A, Muth C, Lühmann D: Anpassung des Curriculums Evidenzbasierte Medizin für unterschiedliche Zielgruppen.Erfahrungen aus dem Aufbaustudiengang Public Health in Hannover und der Humanmedizinausbildung in <strong>Lübeck</strong>. Zeitschriftfür ärztliche Fortbildung und Qualitätssicherung im Gesundheitswesen 98:155-161, 2004-04-2243 Ingenerf J, König IR, Linder R, Lühmann D, Pöppl SJ, Raspe H, Ziegler A (2005). Querschnittsbereich „Epidemiologie, medizinischeBiometrie und medizinische Informatik“ im Studiengang „Humanmedizin“ der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>. In: Proc. derGMDS-Jahrestagung, Sept. 2005 in Freiburg, online unter http://www.egms.de/en/meetings/gmds2005/05gmds517.shtml109
ANHANGAnhang 41Repetitorium im 2. Studienjahr: „Anatomie in fünf Tagen“Um für das Fach Anatomie die Qualität und Effizienz der Prüfungsvorbereitung <strong>zu</strong> steigern, wird vonDozenten des Instituts für Anatomie eine gezielte examensorientierte Lehrveranstaltung <strong>zu</strong>r Vorbereitungauf das schriftliche und mündliche „Physikum“ angeboten. Dabei ist es nicht das Ziel, das Selbststudiumder Studenten <strong>zu</strong> ersetzen, sondern diese lediglich durch professionelle Hilfe dabei <strong>zu</strong> unterstützenund durch die Fokussierung auf klinik- und prüfungsrelevante Inhalte deren eigene Prüfungsvorbereitungeffizienter <strong>zu</strong> machen.Im vierten Semester wird jeweils in der Woche nach Pfingsten die Frontalveranstaltung „Anatomie infünf Tagen“ angeboten. Sie wird von über 90% aller Studenten des Jahrganges besucht, umfasst sowohlVorlesungsstunden als auch Kommentare <strong>zu</strong> Original-Prüfungsfragen. Die Teilnahme ist freiwilligund kostenlos. Durch die Einwerbung von Sponsorengeldern kann den Studenten Kaffee und Kuchen<strong>zu</strong>r Verfügung gestellt werden.Die Evaluation zeigt, dass die Veranstaltung den Studenten maßgeblich dabei hilft, sich auf die Prüfungvor<strong>zu</strong>bereiten. Außerdem trägt sie da<strong>zu</strong> bei, die Angst vor der bevorstehenden Prüfung <strong>zu</strong> reduzierenund die Prüfungsergebnisse <strong>zu</strong> verbessern. Nachfolgender Abbildung ist der Stundenplan des<strong>zu</strong>letzt durchgeführten Durchganges dieser Veranstaltung <strong>zu</strong> entnehmen.110
ANHANGAnhang 42Repetitorium im 6. Studienjahr: Innere MedizinDie Veränderungen im Prüfungsablauf durch die neue Approbationsordnung veranlasste die Klinik fürInnere Medizin am Campus <strong>Lübeck</strong> ein Projekt <strong>zu</strong>r „Verbesserung der Lehre im Praktischen Jahr“ <strong>zu</strong>starten. Da den Studenten nach neuer ÄAppO die Vorbereitungsphasen auf das alte erste und zweiteStaatsexamen fehlen, wird ihnen im Rahmen dieses Projektes eine Möglichkeit geboten, das fehlendeWissen strukturiert auf<strong>zu</strong>arbeiten. Neben der Neustrukturierung der PJ-Seminare, der Einführungeines PJ-Passes und eines Lernzielkatalogs „Leitsymptome Innere Medizin“ ist das Repetitorium „Innerekompakt“ eine viel versprechende Neuerung.Vom 13. bis 22. September 2006 wurde das Repetitorium erstmalig von den drei Medizinischen Klinikensowie der Klinik für Rheumatologie des UK S-H, Campus <strong>Lübeck</strong> angeboten. Dieser „Crash-Kurs“richtet sich an Studenten im Praktischen Jahr und dient als Prüfungsvorbereitung auf das alte dritteStaatsexamen bzw. auf das neue zweite Staatsexamen („Hammerexamen“). In acht Tagen werdendie wichtigsten prüfungsrelevanten Themen aller Fachbereiche der Inneren Medizin wiederholt: Vormittagsals kurze und prägnante Darstellung der Inhalte im Rahmen des Frontalunterrichts, nachmittagsals interaktiver Kleingruppenunterricht. Dabei kommt am Nachmittag der Bearbeitung von Fallbeispielenanhand von Röntgenbildern, Blutbefunden, EKGs u.ä. eine besondere Bedeutung <strong>zu</strong>, daman auf diese Weise dem neuen fallorientierten Schwerpunkt des neuen Examens gerecht wird.In Vorgesprächen mit den Dozenten, die <strong>zu</strong>m großen Teil selbst im Examen prüfen, wurde ein detaillierterStundenplan erarbeitet. Durch Poster, Flyer und mündliche Ankündigung wurde die Veranstaltungden Studenten näher gebracht. Die Resonanz unter den Studenten war so hoch, dass alle 75Anmeldungsplätze belegt waren. Diese Teilnehmerbeschränkung war aufgrund einer Begren<strong>zu</strong>ng derdrei Kleingruppen auf maximal 25 Personen notwendig, da sonst eine sinnvolle Diskussion der Fallbeispielenicht mehr möglich gewesen wäre. Der Teilnehmerbeitrag von 50 € wurde <strong>zu</strong>sammen mitSponsorengeldern für Werbungskosten, Lehrunterlagen, Getränkeversorgung, Kantinenessen fürStudenten und ein Dozentenhonorar verwendet. Dabei sollten die anfallenden Kosten gedeckt, aberkeine Gewinne erzielt werden.Mit der Evaluation am Ende des Repetitoriums konnten die Studenten Ablauf und Inhalt der Veranstaltungbewerten, und so dabei helfen, <strong>zu</strong>künftige Repetitorien <strong>zu</strong> verbessern. Die Rückmeldungen derDozenten werden ebenfalls in diese Planungen einbezogen.Momentan bietet die Klinik für Innere Medizin in <strong>Lübeck</strong> als einzige klinische Einrichtung ein derartigesRepetitorium an, andere Kliniken – z.B. die Chirurgie – planen, der Idee eines „Crah-Kurses“ <strong>zu</strong> folgen.So lässt sich das Repetitorium „Innere kompakt“ als Leitprojekt sehen, dessen Erfahrungen fürweitere Projekte genutzt werden können. Nachfolgender Abbildung ist der Stundenplan des erstenDurchganges dieses Repetitoriums <strong>zu</strong> entnehmen.Zeit09:00-10:0010:15-11:1511:30-12:3013:30-14:1514:30-15:1515:30-16:15Mittwoch13.09.06Angiologie/KardiologieEinführungpAVK, TVT,AortenaneurysmaArt. Hypertonie+PharmakotherapieKl. Kreislauf,Cor pulmonale,LungenembolieDonnerstag14.09.06KardiologieIschämischeHerzerkr.(KHK, MI)HerzinsuffizienzHRST+ Pharmakotherapie(Antiarrhythmika)Freitag15.09.06Pulmologie/InfektiologieAsthmabronchiale,COPD,LungenemphysemBronchialkarzinom,PleuraergußinterstitielleLungenerkrankungenPneumonie,Tuberkulose,Endokarditis,HIVMontag18.09.06Gastroenterol.Oberer GI-TraktUnterer GI-TraktLeberGallePankreasDienstag19.09.06HämatologieHämorrhagischeDiathesen,ThrombophilieAnämien,Thrombozytopenien,Transfusionsindikationen,HämosideroseLeukämien,maligneLymphome,Chemotherapie12:30-13:30 MittagspauseMittwoch20.09.06NephrologieGlomeruläreKrankheitenTubulointerstitielleNierenerkrankungen,Säure-Basen-HausehaltAkutes/chronischesNierenversagen,NierenersatzverfahrenDonnerstag21.09.06Endokrinol.Diabetesmellitus,MetabolischesS.Hypophyse,NebennierenundGonadenFreitag22.09.06Rheumatol.Rheumat.ArthritisSchilddrüse,Nebenschilddrüse,Knochenstoffw.SpondylarthritidenKollagenosenFallübung Fallübung Fallübung Fallübung Fallübung Fallübung Fallübung VaskulitidenFallübung Fallübung Fallübung Fallübung Fallübung Fallübung Fallübung FallübungFallübung Fallübung Fallübung Fallübung Fallübung Fallübung FallübungEvaluationAbschlussgespräch111
ANHANGAnhang 43MentorenprogrammDas <strong>Lübeck</strong>er Mentorenprogramm wurde im Sommer 2005 umstrukturiert und neu gestartet. Seitherhaben sich 690 Studenten in 84 Mentorengruppen 44 eingetragen. Das <strong>Lübeck</strong>er Mentorenprogrammdient der Stärkung des Dialogs zwischen den Studenten und allen an Lehre und Forschung Beteiligtender <strong>Universität</strong> und des Klinikums.Als Schirmherr konnte Björn Engholm, Mitglied des Hochschulbeirats und Ministerpräsident a. D.,gewonnen werden, der auf der Homepage des Studiendekanats die Teilnehmer des Mentorenprogrammsmit folgendem Beitrag begrüßt:Auf ins MentorenprogrammDie <strong>Universität</strong> <strong>Lübeck</strong> bietet viele Vorteile; einer der größten ist ihreKleinheit. Die Überschaubarkeit der Gemeinschaft der Lehrenden undLernenden in Klinikum und Fakultäten, die interpersonale Nähe unddie Unmittelbarkeit der Kontakte bieten die einmalige Chance, eine inMassenuniversitäten unmögliche „Corporate Identity“ <strong>zu</strong> entwickeln.Mit etwas Glück mehr noch: eine „Corporate Culture.“Je mehr Lehrende und Lernende sich im und am Mentorenprogramm beteiligen, destogrößer der Nutzen für alle. Die Lernenden erhalten Informationen, Anregungen, Ratschlägeund Wegweisungen; die Lehrenden Rückkopplungen über ihre Arbeit und Arbeitsweisenund substantielle Einblicke in das Feld der Nachwuchstalente; alle stärken ihre fachlichen,intellektuellen und ästhetischen Kompetenzen.Die <strong>Universität</strong> als Gemeinschaft der Fragenden und Wissenden, der unbestechlich nachWahrheit Suchenden: das ist die Basis von und für Exzellenz! Ein vielfältiges Mentorenprogrammwird die junge <strong>Universität</strong> <strong>Lübeck</strong> auf diesem Wege nachhaltig beflügeln.Björn Engholm44 Stand: 14. November 2006112
ANHANGAnhang 44Uni im Dialog - Einladungsplakat 2006Das neue <strong>Lübeck</strong>er Mentorenprogramm wurde im Frühjahr 2005 mit einem Abend des Dialogs in der<strong>Universität</strong>skirche St. Petri <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> neu gestartet. ‚Uni im Dialog’ findet seitdem jährlich statt.113
ANHANGAnhang 45Studium GeneraleDas seit 1983 bestehende Studium Generale an der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> wird von der Hanseatischen<strong>Universität</strong>sstiftung <strong>Lübeck</strong> unterstützt, die sich die weitere Entwicklung der Wissenschaftenund des Hochschulwesens in der Hansestadt <strong>Lübeck</strong> <strong>zu</strong>m Ziel gesetzt hat. Seit dem Wintersemester88/89 stehen die Vorträge jeweils unter einem gemeinsamen Semesterthema. Das Thema des Wintersemesters06/07 lautet „Ethos“.Die Leitung des <strong>Lübeck</strong>er Studium Generale liegt bei Professor Dr. Detlef Kömpf, <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>.Gast für das Thema des Wintersemesters 06/07 ist Björn Engholm.Die Vorträge sind öffentlich. Sie finden während der Vorlesungszeiten einmal im Monat donnerstags,19.15 Uhr, im Großen Hörsaal des Zentralklinikums (Z 1/2) statt.„Ethos" lautet das Thema des <strong>Lübeck</strong>er Studium Generale im Wintersemester 2006/07.Die Vorträge stehen im Rahmen der Reihe "Was ist der Mensch? Natur - Kultur".19.10.2006: Zwischen Ethos und Business - Medizin inZeiten ökonomischer Diktate (Prof. Dr. Siegfried Geyer,Hannover)16.11.2006: Über den Hunger nach Glück - Sehnsuchtsutopieeiner Rückkehr ins verlorene Paradies (Prof. Dr.Maja Wicki, Zürich)14.12.2006: Menschenbild - zwischen Ethos und Ökonomie(Prof. Dr. Oskar Negt, Hannover)Ethos (Grafik: Hanne Kühner)18.1.2007: Kultur? Kultur! Kultur und Identität in Zeiten derGlobalisierung (Prof. Dr. Adolf Muschg, Zürich)8.2.2007: Vor Gott und den Menschen - Der ethische Auftrag der Kirche in unsererZeit (Bischof Dr. Wolfgang Huber, Berlin)114
ANHANGAnhang 46Weitere fakultative Veranstaltungen1. SonntagsvorlesungDie Idee der Sonntagsvorlesungen wurde im Dezember 2001 geboren, mit dem Gedanken, für dieBevölkerung der Stadt <strong>Lübeck</strong> und Umgebung interessante Themen aus dem medizinischen und/oderdem naturwissenschaftlichen Bereich in populärwissenschaftlicher Form vor<strong>zu</strong>tragen. Die Sonntagsvorlesungenstehen also unter dem Motto: „<strong>Universität</strong> in der Stadt. Begegnungen zwischen Öffentlichkeitund Wissenschaft“. Ziel ist es, die <strong>Universität</strong> mit ihrer Forschung vom Campus mitten in dieStadt <strong>zu</strong> tragen; Menschen und Wissenschaft, <strong>Universität</strong> und Stadt mögen sich begegnen. Die ersteSonntagsvorlesung fand am 7. April 2002 statt. Bis einschließlich Sommersemester 2006 haben 35Sonntagsvorlesungen stattgefunden. Die wissenschaftliche Organisation obliegt Prof. Dr. Dr. h.c.Wolfgang Kühnel. Für diese Veranstaltungsreihe stellt die Stadt den Audienzsaal im Rathaus derHansestadt <strong>Lübeck</strong>, Breite Straße 62, <strong>zu</strong>r Verfügung. Seither finden dort die Sonntagsvorlesungenwährend des Semesters jeweils am ersten Sonntag des Monats von 11.30 bis 12:30 Uhr statt. DerEintritt ist frei.Sonntagsvorlesungen im WS 06/07• November 2006: "Zeit und Gehirn. Gehirnzeit", Prof. Dr. Detlef Kömpf, Klinik für Neurologie• Dezember 2006: "Software - eine merkwürdige Ware" (Prof. Dr. Walter Dosch, Institut für Softwaretechnikund Programmiersprachen)• Januar 2007: "Intelligente autonome Roboter - Vision oder Wirklichkeit?" (Prof. Dr. ErikMaehle, Institut für Technische Informatik)• Februar 2007: "Emanuel Geibel - <strong>Lübeck</strong>s vergessener Nationaldichter" (Prof. Dr. Hans Wißkirchen,Direktor der Kulturstiftung Hansestadt <strong>Lübeck</strong>, Honorarprofessor für Neue Deutsche Literaturder <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>)2. Literarisches ColloquiumDas <strong>Lübeck</strong>er Literarische Colloquium bietet regelmäßige Dichterlesungen und literaturwissenschaftlicheSeminare an. Es wurde vom Literaturnobelpreisträger Günter Grass in der <strong>Universität</strong><strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> anlässlich der Entgegennahme der Ehrendoktorwürde der Medizinischen Fakultät angeregtund wird von ihm unterstützt. Im Wintersemester 06/07 findet im Rahmen des LiterarischenColloquiums ein literaturwissenschaftliches Seminar <strong>zu</strong> der Lesereihe "LiteraTour Nord" statt.Studenten der Medizin an der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> können durch die erfolgreiche Teilnahme andieser Veranstaltung einen Schein für das erforderliche Wahlfach im Grundstudium erwerben.Anmeldung ist unter Tel. 0451/500-4057 oder per Email erforderlich. Der Eintritt <strong>zu</strong>r Dichterlesungist frei, für Studenten gilt dies auch für die Seminare. Für Nichtstudenten wird pro Seminarveranstaltungein Kostenbeitrag von 10 Euro erhoben.Literarisches Colloquium im WS 06/07• 19.10.06 (<strong>zu</strong>r Lesung von Gregor Hens "In diesem neuen Licht" am 23.10.06)• 09.11.06 (<strong>zu</strong>r Lesung von Angela Krauss "Wie weiter" am 13.11.06)• 30.11.06 (<strong>zu</strong>r Lesung von Marlene Streeruwitz "Entfernung" am 04.12.06)• 21.12.06 (<strong>zu</strong>r Lesung von Thomas Hettche "Woraus wir gemacht sind" am 08.01.07)• 25.01.07 (<strong>zu</strong>r Lesung von Thomas Hürlimann "Vierzig Rosen" am 29.01.07)• 08.02.07 (<strong>zu</strong>r Lesung von Katharina Hacker "Die Habenichtse" am 19.02.07)115
ANHANG116
ANHANGD. Unterstüt<strong>zu</strong>ng der DozentenDurch HochschuldidaktikAnhang 47Hochschuldidaktik – CurriculumAnhang 48Hochschuldidaktik - Durchgeführte WorkshopsAnhang 49Hochschuldidaktik – POL-TutorenschulungAnhang 50Hochschuldidaktik – Angebot für HabilitandenDurch finanzielle RessourcenAnhang 51Förderprogramm für die LehreAnhang 52Förderprogramme für NachwuchswissenschaftlerAnhang 53Master of Medical Education117
ANHANGAnhang 47Hochschuldidaktik – CurriculumFür die Weiterentwicklung ihrer Lehrfähigkeiten können Dozenten der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> das Curriculumder Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik in Anspruch nehmen. Das Curriculum ist systematisch aufgebaut undwurde am 12.02.05 von der Arbeitsgemeinschaft für Hochschuldidaktik 45 (AHD) akkreditiert.Zielstellung des Curriculums der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik ist es, Dozenten bei der Planung undDurchführung von Lehrveranstaltungen <strong>zu</strong> unterstützen, und darüber hinaus die Dozenten durch Einzelberatungen<strong>zu</strong> einem reflektierten Umgang mit der eigenen Lehrtätigkeit an<strong>zu</strong>regen. Dementsprechend lassensich die Angebote der <strong>Lübeck</strong>er Hochschuldidaktik in zwei Komponenten aufteilen: Weiterbildungs-Workshops und Beratung.Die Weiterbildungs-Workshops sind in der Regel zweitägig und umfassen jeweils 20 Lehreinheiten à45 Minuten. Folgende Workshops werden angeboten:Grundlagen-Workshops• Zeit- und Selbstmanagement• Projektorganisation• Kreativität, DenkwerkzeugeMethoden-Workshops• Vortragen, Präsentieren, VisualisierenDieser Workshop kann in zwei Teile geteilt werden mit den Schwerpunkten Vortragstechnik(Körpersprache) und Visualisierung• ModerationsmethodeVeranstaltungsbezogene Workshops• Vorlesungen vorbereiten, durchführen und evaluieren• (Klein-)Gruppenarbeit anleiten• POL Problemorientiertes Lernen, (Anhang 49)Prüfungs-Workshops• Mündliche Prüfungen• Klausurerstellung und -auswertung (in Vorbereitung)Workshops in Erprobung• Projektorientiertes Lernen• Planung, Datenerfassung und Auswertung von Umfragen• Vorgehen bei der Erstellung einer Web-Site• Prüfungsberatung in SprechstundenWichtigster Aspekt der Beratung im Rahmen der hochschuldidaktischen Weiterbildung ist Anregung<strong>zu</strong>r Reflektion über die eigene Lehrtätigkeit und –fähigkeit. Dabei folgen wir einem von uns entwickelten'Reflexions-Modell für die eigene Lehre', das an das Modell der themenzentrierten Interaktion (TZI)angelehnt ist. Dieses Modell umfasst die Elemente: Dozent, Student, Stoff/Lehrziele und den Kontextin dem sich Lehre und Lernen abspielt. Die Beziehungen zwischen den Elementen des Lehr- undLernsettings werden hierbei gemeinsam einer systematischen Analyse unterzogen. Das Beratungsangebotumfasst:• Anleitung und Begleitung der gegenseitigen Hospitation der Lehrenden in Lehrveranstaltungen• Moderation kollegialer Beratung• (Video-)Coaching für Sequenzen in den verschiedenen Lehrformaten• Anleitung <strong>zu</strong>r Erstellung eines LehrportfoliosDie Inanspruchnahme der Beratung mit kollegialer Beratung, Hospitation, (Video-)Coaching und Portfolio-Erstellungumfasst 20 Lehreinheiten.Für Habilitanden wurde aus dem Curriculum der <strong>Lübeck</strong>er Hochschuldidaktik eine komprimierte undan die Adressaten angepasste Modifizierung vorgenommen (Anhang 50).45 http://www.ahd-hochschuldidaktik.de/118
ANHANGAnhang 48Hochschuldidaktik - Durchgeführte WorkshopsIn den Jahren 2004 bis 2006 wurden zwischen fünf und neun Workshops mit durchschnittlich 13 Teilnehmerndurchgeführt. Die Workshops umfassen im Durchschnitt 20 Stunden.Termine 2006 (Stand Oktober 2006)• 08.11.06, Workshop „Erstellung und Auswertung von Multiple-Choice-Klausuren“ (L)• 27./28.09.06, Workshop „POL (Problemorientiertes Lernen)“ - gleichzeitig Schulungskurs fürkünftige POL-Tutoren (H)• 06.09.06, Übungen in „Lernziel-Formulierungen“ am Bsp. des Notfallmedizinischen Praktikums(L)• 01.07.06, Workshop „Website“ - Die Website des Studiendekanats als zentrales Steuerungsinstrumentfür das Management von Studium und Lehre.• 22./23.03.06, Workshop „Zeit- und Selbstmanagement“ - Veranstaltungsort: Kiel (I)• 24.02.06, Workshop „Vorlesung und Vortrag“ (H)Termine 2005• 29.11.05, ‚Daten von Projekten erfassen, auswerten und darstellen’ (Fortset<strong>zu</strong>ng des Projektorganisations-Workshopsvom 27./28. 4. 05) (I)• 19.10.05, „Kreativitätsmethoden“ (I)• 07.10.05, „Anleiten von Kleingruppenarbeit (unter besonderer Berücksichtigung der POL-Methode)“ = Vorbereitungs-Workshop für POL-Tutoren des Querschnittfaches „Medizin desAlters und des alternden Menschen“ (L)• 23.09.05, „Anleiten von Kleingruppenarbeit (unter besonderer Berücksichtigung der POL-Methode)“ = Vorbereitungs-Workshop für POL-Tutoren des Querschnittfaches „Medizin desAlters und des alternden Menschen“ (L)• 27./28.04.05, Projektmanagement (Titel der Veranstaltung: „Das Geheimnis erfolgreicher Projekte“)(I)Termine 2004• 11.12.04, „Mündliche Prüfungen“ (L)• 10.12.04, „Kreativitätsmethoden“ (I)• 08.10.04, „Anleiten von Kleingruppenarbeit (unter besonderer Berücksichtigung der POL-Methode)“ = Vorbereitungs-Workshop für POL-Tutoren des Querschnittfaches „KlinischeUmweltmedizin“ (L)• 26./27.08.04, Projektmanagement „Projekte erfolgreich planen leiten und durchführen“ (I)• 05.07.04, Kreativitätsmethoden in Forschung und Lehre (Forschungszentrum Borstel) (H)• 26./27.04.04, Projektmanagement „Projekte erfolgreich planen leiten und durchführen“ (I)• 27.03.04, „Anleiten von Kleingruppenarbeit (unter besonderer Berücksichtigung der POL-Methode)“ = Vorbereitungs-Workshop für POL-Tutoren des Querschnittfaches „Medizin desAlters und des alternden Menschen“ (L)• 26.03.04, „Anleiten von Kleingruppenarbeit (unter besonderer Berücksichtigung der POL-Methode)“ = Vorbereitungs-Workshop für POL-Tutoren des Querschnittfaches „Medizin desAlters und des alternden Menschen“ (L)• 12.01.04, „Didaktische Visualisierung“ (Forschungszentrum Borstel)Legende:S = StudierendeL = LehrendeH = HabilitandenI = Innerbetriebliche Fortbildung119
ANHANGAnhang 49Hochschuldidaktik – POL-TutorenschulungNeben den traditionellen Lehrformen wird in <strong>Lübeck</strong> das Problemorientierte Lernen (POL), eine Formdes selbstgesteuerten Lernens, angeboten. Derzeit wird POL in einem Querschnittsfach eingesetzt(Klinische Umweltmedizin). POL wird in Kleingruppenarbeit durchgeführt und ist damit sehr personalintensiv.Eines der Probleme ist die Rekrutierung und Ausbildung von ärztlichen Tutoren.Die Hochschuldidaktische Arbeitsstelle bietet für die Ausbildung der ärztlichen Mitarbeiter als Tutorenspezielle, auf den Adressatenkreis <strong>zu</strong>geschnittene Workshops an.Beispiel einer Ankündigung:Workshop: Problemorientiertes Lernen (POL) – Wissen aktiv erarbeitenFr/Sa 29./30. 9. 06, Seminarraum Karp in der Informatik1. Tag: ‚POL-Methode kennen lernen und einüben’Anhand eines konkreten Falls und mithilfe einer bestimmten Systematik erschließen sichdie Studierenden aktiv neue Lerngebiete.Ziel des Problemorientierten Lernens ist es, den Studierenden nicht nur Wissen <strong>zu</strong> vermitteln,sondern sie in sozialen und kommunikativen Kompetenzen sowie in der Problembearbeitungsfähigkeit<strong>zu</strong> stärken.In dieser Weiterbildungsveranstaltung lernen die Teilnehmer die Methode des ProblemorientiertenLernens durch eigenes Tun in der Studierenden- und in der Tutor-Rolle kennen.Es wird dabei der klassische 'Siebenschritt' durchlaufen, wie er in der McMaster-University und in Havard entwickelt worden ist.Die Rolle als POL-Tutor wird reflektiert und die eigene Gruppenmoderationsfähigkeit weiterentwickelt.Weiterhin soll versucht werden, die Grundidee des Konstruktivismus vor<strong>zu</strong>stellen unddas Modell einer Didaktik nachhaltigen Studierens <strong>zu</strong> behandelnDie Teilnehmer erproben sich in der Anleitung von Kleingruppenarbeit, in InteraktionsundInterventionstechniken, sie wenden Feedback- und Reflexionsmethoden an.2. Tag: ‚Fallschreiben’Es wird erkundet, wie man von der ÄAppO <strong>zu</strong> Lehrzielen kommt.Es soll geübt werden, übergeordnete Lehrziele <strong>zu</strong> formulieren, wie auchLehrziele auf verschiedenen Schwierigkeitsstufe <strong>zu</strong> finden. Diese sollen in eine Matrix‚Lehrziele * Fälle’ eingebettet werden.Es folgt eine Übung im Fallschreiben, die Fälle sollen anschließend präsentiert und diskutiertwerden.Eine Feedback- und Reflexionsphase schließt den Schulungs-Workshop ab.120
ANHANGAnhang 50Hochschuldidaktik – Angebot für HabilitandenBasierend auf dem Rahmenkonzept für die Hochschuldidaktik in <strong>Lübeck</strong> hat der Habilitationsausschussin seiner Sit<strong>zu</strong>ng am 03. Juni 2003 ein Minimalprogramm für Habilitanden verabschiedet. Darinheißt es:Es wird empfohlen, dass Habilitanden an drei Seminaren teilnehmen:• ‚Vorlesungen planen und durchführen’• ‚Lernen in (Klein-)Gruppen anleiten (einschließlich POL-Ansätze)’• ‚Vortrags- und Präsentationstechnik’Ferner empfiehlt der Habilitationsausschuss die Inanspruchnahme des Beratungsangebotes:• Es sollte eine Veranstaltungshospitation mit Feedback und/oder kollegialer Beratung stattfinden• Für den Probevortrag/die Antrittsvorlesung sollte ein Coaching (mit Video-Feedback) in Anspruchgenommen werdenDie <strong>zu</strong> besuchenden Seminare umfassen jeweils zwei Tage (meistens Freitagnachmittag bis Sonntagmittag),die Hospitation mit Feedback oder das Coaching nehmen einen Tag in Anspruch.Über die absolvierten Komponenten der hochschuldidaktischen Weiterbildung werden vom DekanBescheinigungen ausgestellt. Dieses komprimierte Angebot für Habilitanden wurde aus dem akkreditiertenGrundmodul der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik entwickelt und an die Bedürfnisse der Adressatenangepasst.121
ANHANGAnhang 51Förderprogramm für die LehreProgramm <strong>zu</strong>r Förderung der LehreBesteht seit 2000ZielgruppeFörderung von Projekten, die sich auf die Ergän<strong>zu</strong>ng und Verbesserungder Qualität der Lehre im Studiengang Medizin beziehen- Entwicklung eines neuen Lehr- und Lernkonzepts oder wesentlicheVerbesserung bestehender KonzepteAuswahlkriterien- Muss Unterrichtsformen betreffen, die der aktuellen Approbationsordnungentsprechen- Muss in das Pflichtcurriculum integriert sein- Muss möglichst viele Studenten erreichenAuswahlkommissionForschungskommissionFörderdauer pro Teilnehmer 12 MonateFördervolumen pro Teilnehmer bis <strong>zu</strong> 50.000 €Ergebnisüberprüfung /QualitätssicherungAbschlussberichtBewilligungsquote Bewerbungen Bewilligungen Quote (in %)• 2003 2 1 50• 2004 5 2 40• 2005 3 2 67• 2006 0 0 -122
ANHANGAnhang 52Förderprogramme für Nachwuchswissenschaftler1. AnschubfinanzierungBesteht seit 1996Anträge <strong>zu</strong>r Anschubförderung von kleineren innovativen ProjektenZielgruppeaus allen Bereichen der Medizin mit dem Ziel der Vorbereitungvon später extern <strong>zu</strong> fördernden Drittmittelprojekten.- junge Wissenschaftler bis 34 Jahre (in begründeten Fällenwerden Ausnahmen gemacht)Auswahlkriterien- originelle Idee- <strong>zu</strong>r Anschubfinanzierung, besonders wenn eine externe Drittmittelförderung<strong>zu</strong> erwarten istAuswahlkommissionForschungskommissionFörderdauer pro Teilnehmer bis <strong>zu</strong> 24 MonatenFördervolumen pro Teilnehmer bis <strong>zu</strong> 37.500 €Ergebnisüberprüfung /QualitätssicherungAbschlussberichtBewilligungsquote Bewerbungen Bewilligungen Quote (in %)• 2003 24 13 54• 2004 29 18 62• 2005 46 19 41• 2006 52 19 372. Habilitationsförderung für ÄrztinnenBesteht seit 2003ZielgruppeFörderung von habilitierenden Ärztinnen mit Kind/ern, die sich inder Endphase ihrer Habilitation befinden.- Ärztinnen mit hervorragenden wissenschaftlichen Entwicklungsperspektiven- klinisch tätige Ärztinnen mit Kind/ern, die sich in der EndphaseAuswahlkriterienihrer Habilitation befinden- Antragstellung frühestens 3 Jahre nach der Promotion- Abschlussfinanzierung der Habilitation (z. B. Freistellung vonder klinischen Tätigkeit)AuswahlkommissionForschungskommissionFörderdauer pro Teilnehmer bis <strong>zu</strong> 12 MonateFördervolumen pro Teilnehmer Personalstelle nach BAT IIaErgebnisüberprüfung / QualitätssicherungAbschlussberichtBewilligungsquote Bewerbungen Bewilligungen Quote (in %)• 2003 2 1 50• 2004 0 0 -• 2005 2 0 0• 2006 0 0 -123
ANHANGAnhang 53Master of Medical EducationAllgemeinesIn einem zweijährigen berufsbegleitenden medizindidaktischen Studium können Hochschuldozenten,die an der Planung und Durchführung des Medizinstudiums verantwortlich beteiligt sind, den „Masterof Medical Education” (MME) erwerben. Im Rahmen dieses Studienganges wird den Teilnehmern dieChance eröffnet, sich aus der Praxis heraus mit modernen Ausbildungstheorien und Lehrmethodenauseinander <strong>zu</strong> setzen und ihrerseits in ihren Fakultäten als Multiplikatoren neuer Wege in der medizinischenAusbildung, insbesondere didaktischer Techniken, kompetent aktiv <strong>zu</strong> werden.Die Zielset<strong>zu</strong>ng des MME ist die Erhöhung der Qualität der Lehre, die Professionalisierung der MedizinischenAusbildung, die Qualifizierung von Multiplikatoren und Führungspersonen an MedizinischenFakultäten sowie die Förderung des bundesweiten Austausches zwischen den Fakultäten. Die Kostenbetragen für den Studiengang 18.000 Euro. Im Rahmen des Programms „Neue Wege in der Medizinerausbildung“vom „Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft“ und der „Heinz-Nixdorf Stiftung“werden jeder deutschen Fakultät zwei Stipendien ermöglicht, die die Hälfte der Kosten decken.Situation in <strong>Lübeck</strong>Die Medizinische Fakultät der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> und das Studiendekanat sind sich der Bedeutungeiner herausragenden Lehre an den <strong>Universität</strong>en bewusst und setzen sich mit Nachdruck für eineVerbesserung der Lehr- und Lernsituation ein. Die Qualifizierung der Dozenten ist dabei ein wesentlicherBaustein, der durch Angebote der Arbeitstelle für Hochschuldidaktik systematisch vorangetriebenwird.Der Studiengang MME ist für die Fakultät eine wichtige Möglichkeit, einzelne Dozenten intensiv weiter<strong>zu</strong>bilden,um die Qualität der Lehre kontinuierlich <strong>zu</strong> verbessern. Für das Jahr 2006 wurde ein Mitgliedder Fakultät, Herr Dr. med. Peter Iblher (Klinik für Anästhesiologie) ausgewählt, der für seinLehrengagement durch die „Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin“ mit dem„Thieme-Teaching-Award 2006“ ausgezeichnet wurde. Die Fakultät unterstützt seine Teilnahme injeder Hinsicht und ist sich der Chancen und Möglichkeiten dieses Studiums bewusst.So wird <strong>zu</strong>m einen die Hälfte der Kosten für den Studiengang in Höhe von 9.000 Euro übernommen.Des Weiteren wird Herr Iblher insbesondere bei der Planung und Durchführung der Studienprojekteund der Master-These durch das Studiendekanat und die Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik betreutund beraten. Während den Zeiten der Pflichtpräsenzen wird Herr Dr. Iblher von der Arbeit in der Klinikfreigestellt124
ANHANGE. EVALUATIONAnhang 54Evaluation der Pflichtlehrveranstaltungen der Vorklinik, Studienjahr 2005Anhang 55Evaluation der Pflichtlehrveranstaltungen der Klinik, Studienjahr 2005Anhang 56Differenziertes Auswertungsblatt der Online-EvaluationAnhang 57Evaluation eines PJ-TertialsAnhang 58Gütekriterien der Onlineevaluation125
ANHANGAnhang 54Evaluation der Pflichtlehrveranstaltungen der Vorklinik, Studienjahr 2005Globalbeurteilung der Lehrveranstaltungen des vorklinischen Studienabschnittes(nach Scheinen) Studienjahr 2005Kursus der makroskop. AnatomiePraktikum der BerufsfelderkundungPraktikum der PhysiologieSpitzengruppePraktikum Einf. in die klin. MedizinSeminar AnatomieKursus der mikroskop. AnatomiePrakt. Biochemie/MolekularbiologieMittelgruppePraktikum der Chemie für MedizinerSeminar PhysiologieKursus Med.Psychologie/SoziologiePraktikum der Biologie für MedizinerSchlussgruppePraktikum der med. TerminologiePraktikum der Physik für MedizinerSem. Biochemie/MolekularbiologieSem. Med. Psychologie/Soziologiesehr gut gut befriedigend ausreichend genügend ungenügendMittelwerte mit <strong>zu</strong>gehörigem 95%-KonfidenzintervallOnline-Evaluation am Ende des SemestersDie <strong>Lübeck</strong>er Studenten bewerten die Lehrveranstaltungen des Pflicht-Curriculums kurz vor Endeeines jeden Semesters. Dabei haben sie die Möglichkeit, mit insgesamt 10 Items alle von ihnen besuchtenLehrveranstaltungen des aktuellen Semesters <strong>zu</strong> bewerten. Für das Item „Gesamtnote“ liegteine Schät<strong>zu</strong>ng der Reliabilität vor (r tt = .74). Zielgruppe der Online-Befragung sind alle Studenten derMedizinischen Fakultät. Der Rücklauf betrug im Studienjahr 2005 rund 65%.In der obigen Darstellung sind die Lehrveranstaltungen des Studienjahres 2005 (WS 04/05 und SS05) für die Scheine gemäß neuer ÄAppO <strong>zu</strong>sammengefasst und in jeweils drei Gruppen eingeteilt(Spitzen-, Mittel-, Schlussgruppe). Diese Einteilung wurde in Anlehnung an das Ranggruppenverfahrendes CHE entwickelt. Dabei wird der Mittelwert der <strong>zu</strong> einem Schein gehörigen Lehrveranstaltungenin seiner relativen Position <strong>zu</strong>m Gesamt-Mittelwert (Mittelwert über alle Scheine, blau gestrichelteLinie, MW = 2,7) in eine Ranggruppe eingeordnet. Maßgeblich für die Einordnung in eine Ranggruppeist das 95%-Konfidenzintervall um den Mittelwert für den Schein, welches neben der Anzahl auchdie Homogenität der Urteile berücksichtigt. Schein-Mittelwerte, deren Konfidenzintervalle außerhalbdes Gesamtmittelwertes liegen, werden einer Extremgruppe <strong>zu</strong>gerechnet, die übrigen der Mittelgruppe.126
ANHANGAnhang 55Evaluation der Pflichtlehrveranstaltungen der Klinik, Studienjahr 2005Globalbeurteilung der Lehrveranstaltungen des klinischen Studienabschnittes(nach Scheinen) Studienjahr 2005Anästhesiologie (BP)AugenheilkundeBP KinderheilkundeSpitzengruppeChirurgieDermatologie, VenerologieInfektiologie, Immunologie (Q)Innere MedizinHals-, Nasen-, OhrenheilkundeHygiene, Mikrobiologie, VirologiePharmakologie, ToxikologiePsychiatrie, PsychotherapiePsychosomat. Medizin & PsychotherapieNeurologieNotfallmedizin (Q)Rechtsmedizin (BP)UrologieArbeits-/, Sozialmedizin: Teil SozialmedizinBP AllgemeinmedizinBP ChirurgieMittelgruppeBP Innere MedizinFrauenheilkundeGesundheitsökonomie...-pflege (Q)KinderheilkundeKlinische Chemie, Laboratoriumsdiagn.Klin. Pharmakologie, Pharmakotherapie (Q)Prävention, Gesundheitsförderung (Q)Rehabilitation...Naturheilverfahren (Q)Arbeits-, Sozialmedizin: Teil Arbeitsmed.Bildgebende Verfahren (Q)BP FrauenheilkundeSchlussgruppeEpidemiolog., Med.Biometrie, Informatik (Q)Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin (Q)HumangenetikKlinisch-pathol. Konferenz (Q)Klinische Umweltmedizin (Q)OrthopädiePathologiesehr gut gut befriedigend ausreichend genügend ungenügendMittelwerte mit <strong>zu</strong>gehörigem 95%-KonfidenzintervallLegende siehe Anhang 54127
ANHANGAnhang 56Differenziertes Auswertungsblatt der Online-Evaluation: BeispielJedes Semester werden alle Lehrveranstaltungen des Pflichtcurriculums online von den Studentenevaluiert. Das Ergebnis für jede Lehrveranstaltung wird in der unten abgebildeten Form auf den Internetseitendes Studiendekanats veröffentlicht. Zusätzlich sind alle Lehrveranstaltungen eines Studienjahres(Item „Gesamtnote“) auf einer Seite <strong>zu</strong>sammengefasst. Die freien Anmerkungen der Studentenwerden nur den betroffenen Dozenten <strong>zu</strong>gänglich gemacht. Im Folgenden sind die Items der Evaluationund das Auswertungsblatt für das ‚Praktikum Berufsfelderkundung’ vom SS 2006 <strong>zu</strong> sehen.<strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>Ergebnis der Online-Evaluation im SS 2006für die Lehrveranstaltung:„Praktikum der Berufsfelderkundung“ (1. Studienjahr)________________________________________________________________________1. Rücklaufquote: 82,7%Anzahl der Studierenden, die diese LV besucht haben sollten (Kurs<strong>zu</strong>teilung): n = 179Anzahl der Studierenden, die eine Bewertung für diese LV abgegeben haben: n = 1482. ErgebnisseDie Studierenden haben die Lehrveranstaltung hinsichtlich ihres persönlichen Lernerfolges und derRelevanz der Lehrveranstaltungsinhalte bewertet. Bei Aussagen, die nicht auf die Veranstaltung<strong>zu</strong>treffen, konnte die Antwortvorgabe „kann ich nicht beurteilen“ markiert werden.Antwortskala: 1 = trifft absolut <strong>zu</strong> 4 = trifft eher nicht <strong>zu</strong>2 = trifft überwiegend <strong>zu</strong> 5 = trifft überwiegend nicht <strong>zu</strong>3 = trifft eher <strong>zu</strong> 6 = trifft absolut nicht <strong>zu</strong>Hier folgen die Mittelwerte und Standardabweichungen der studentischen Beurteilung der LehrveranstaltungPraktikum der Berufsfelderkundung:Ich habe mich schon vor der Veranstaltung sehr für die Inhalte dieser Veranstaltunginteressiert.Im Vergleich <strong>zu</strong> vorher interessiere ich mich jetzt mehr für die Inhalte dieser Veranstaltung.Der Inhalt der Veranstaltung als solches ist relevant (Beruf / Praxis / Gesellschaft).Es wurden konkrete Lernziele formuliert: Ja: 56,1 %Nein: 24,3 %Keine Angabe: 18,2 %MeanSD1,7 1,01,5 0,91,3 0,7Wenn ja, diese Lernziele habe ich erreicht. 1,5 0,7Ich habe viel gelernt in der Veranstaltung. 1,6 0,9Ich habe etwas Sinnvolles und Wichtiges in der Veranstaltung gelernt. 1,4 0,9Die Veranstaltung hat da<strong>zu</strong> motiviert, sich selbst mit den Inhalten <strong>zu</strong> beschäftigen. 1,6 1,0Der Besuch der Veranstaltung hat sich gelohnt. 1,3 0,7Wenn man alles in einer Note <strong>zu</strong>sammenfassen könnte, würde ich der Lehrveranstaltungfolgende Gesamtnote geben (Schulnoten von 1 bis 6):1,3 0,7Freie Anmerkungen der Studierenden <strong>zu</strong>r Lehrveranstaltung:Bitte anfordern bei: A. Brauner, Tel. 0451- 500 5084, E-Mail: brauner@<strong>zu</strong>v.uni-luebeck.de128
ANHANGAnhang 57Evaluation eines PJ-TertialsJedes Tertial wird von den Studenten mit einem Online-Fragebogen evaluiert. Die Fragen <strong>zu</strong>m Tertialsind nachfolgend <strong>zu</strong> sehen. Neben den geschlossenen Fragen sind Freitextkommentare vorgesehen.Um den Leistungsnachweis von der Institution über das Ableisten des Tertials <strong>zu</strong> bekommen, sollendie Studenten eine Bescheinigung der Evaluation vorlegen.Theoretische Ausbildung 1 2 3 4 5 6FrageirrelevantEs haben regelmäßig Seminare stattgefunden. Die Themen der Fortbildungen waren relevant für das Tertial. Die Qualität der Seminare war hoch. Mir stand ausreichend aktuelle Fachliteratur (Lehrbücher, Fachzeitschriften,Up to date) <strong>zu</strong>r Verfügung. Die Fortbildungen waren gut organisiert (Informationen im Vorfeld,pünktlicher Beginn). Ich fühle mich dadurch auf den schriftlichen Teil der Zweiten ÄrztlichenPrüfung gut vorbereitet. Ich fühle mich dadurch auf den mündlichen Teil der Zweiten ÄrztlichenPrüfung gut vorbereitet. Gesamtnote für die theoretische Ausbildung (Schulnoten 1 bis 6). Praktische AusbildungDie praktische Ausbildung fand überwiegend „am Patienten“ statt. Ich hatte die Möglichkeit, „eigene“ Patienten von der Aufnahme bis<strong>zu</strong>r Entlassung <strong>zu</strong> betreuen. Ich hatte auch nichtausbildungsrelevante Tätigkeiten <strong>zu</strong> erledigen(Kopieren, Akten verteilen, Brötchen kaufen?) (1 = ja, 6= nein). Ich fühlte mich ausgenutzt. Meine Vorkenntnisse wurden angemessen bei der praktischenArbeit berücksichtigt. Die praktische Arbeit war gut organisiert. Die Anforderungen waren: 1 = viel <strong>zu</strong> niedrig / 6 = viel <strong>zu</strong> hoch. Gesamtnote für die praktische Ausbildung (Schulnoten 1 bis 6). Integration in Stationsalltag / BetreuungIch hatte einen festen Betreuer / Mentor (1 = ja, 6= nein). Die Betreuung durch den Mentor war gut. Ich fühlte mich im ärztlichen Bereich integriert. Ich fühlte mich vom Pflegepersonal akzeptiert / integriert. Gesamtnote für die Integration in den Stations- / Praxisalltag(Schulnoten 1 bis 6). Gesamtnote für die individuelle Betreuung durch den Mentor/ Ansprechpartner (Schulnoten 1 bis 6). Organisation / AllgemeinesEs war möglich, Lernfreizeit <strong>zu</strong> nehmen (1 = ja, 6 = nein). Die Verpflegung war für mich kostenlos (1 = ja, 6 = nein). Ich habe einen Zuschuss für die Verpflegung bekommen(1 = ja, 6 = nein). Uns PJlern stand ein Arbeitsraum <strong>zu</strong>r Verfügung (1 = ja, 6 = nein). Der Arbeitsraum war ausreichend ausgestattet. Uns PJlern wurde eine kostenlose Unterkunft gestellt(1 = ja, 6 = nein). Die Unterkunft war gut. Die Lernziele waren klar definiert (1 = ja, 6 = nein). Die definierten Lernziele wurden erreicht. Insgesamt habe ich 1 = viel weniger / 6 = viel mehr als das ärztlichePersonal der Station gearbeitet. Insgesamt empfand ich meinen Arbeitsplatz attraktiv. Diese PJ-Einrichtung kann ich meinen Kommilitonen empfehlen. Gesamtnote für die Organisation (Schulnoten 1 bis 6). 129
ANHANGAnhang 58Gütekriterien der Onlineevaluation1. ReliabilitätIm Studienjahr 2005 wurde für das Item „Gesamtnote“ die Retestreliabilität geprüft. Da<strong>zu</strong> wurden dieDaten von sechs der sieben neu eingeführten Blockpraktika des vierten Studienjahres, die in Papierformvorlagen, und die Daten der Onlinebefragung veranstaltungsbezogen auf Personenebene <strong>zu</strong>sammengeführt.Die Retestreliabiliät für n = 644 Paare liegt bei .738.Der Vergleich der Mittelwerte auf Veranstaltungsebene zeigt, dass die Ergebnisse der Onlineevaluationfür das Item „Gesamtnote“ insgesamt etwas niedriger ausfallen als für die ausführlichere Befragungin der Papierversion (Mittelwertsunterschied = 0,17 Notenpunkte). Die relative Position der Mittelwerteverändert sich jedoch nicht.Gesamtnote PapierGesamtnote OnlineBP Anästhesiologie (n = 116)BP Chirurgie* (n = 96)BP Frauenheilkunde* (n = 81)BP Innere Medizin* (n = 87)BP Kinderheilkunde* (n = 139)1 = sehr gut2 = gut3 = befriedigend4 = ausreichend5 = genügend6 = ungenügendBP Rechtsmedizin (n = 125)123Mittelwert der Gesamtnote für die Blockpraktika des Studienjahres2005 mit <strong>zu</strong>gehörigem 95%-Konfidenzintervall(* = Differenz zwischen beiden Fragebogenversionen istmit alpha < .05 signifikant, t-Test für abhängige Stichproben, 2-seitig)4562. Interne Konsistenz der ItemsDie acht aus dem Fragebogen HILVE von Rindermann (2001) entnommenen Items sind der Skala„Lehrerfolg“ <strong>zu</strong><strong>zu</strong>ordnen. Die interne Konsistenz dieser acht Items liegt bei Cronbach alpha = .94 (Datenstammen ebenfalls aus der Onlinebefragung des Studienjahres 2005, Blockpraktika). Dies legtnahe, dass diese Items tatsächlich eine gemeinsame Dimension repräsentieren.130
ANHANGF. RessourcenAnhang 59Stellensituation (SOLL) und Haushalts<strong>zu</strong>weisungAnhang 60LbMV – Lehre für das Studienjahr 2004Anhang 61LbMV – Lehre für das Studienjahr 2005Anhang 62Bestand und Haushaltsmittel der Zentralen HochschulbibliothekAnhang 63Ausländische Studenten in <strong>Lübeck</strong>Anhang 64<strong>Lübeck</strong>er Studenten im AuslandAnhang 65Hörsäle der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>131
ANHANGAnhang 59Stellensituation (SOLL) und Haushalts<strong>zu</strong>weisungInstitutionFakultätC4/W3C3/W2WissenschaftlicheMitarbeiter 2BasisausstattungFuL(in € für 2006) 3Institut für Anatomie MF+TNF 1 1 - 9,0 1.522.415 RInstitut für Arbeitsmedizin MF 1 - 2,0 322.470 DInstitut für Biochemie TNF 1 - 7,0 1.045.442 RInstitut für Biologie TNF 1 - 4,0 793.911 RInstitut für Chemie TNF 1 - 4,0 621.105 RInstitut für Humangenetik MF 1 1 4,2 362.650 DInstitut für Immunologie und Transfusionsmedizin MF 1 - 11,8 321.000 DInstitut für Med. Biometrie und Statistik MF 1 - 3,0 708.159 DInstitut für Med. Informatik TNF 1 1 8,0 980.520 RInstitut für Med. Mikrobiologie und Hygiene MF+TNF 1 1 2 4,8 897.356 DInstitut für Medizin- und Wissenschaftsgeschichte MF+TNF 1 1 1 2,0 433.470 RInstitut für Medizinische Psychologie MF 1 - 1,0 333.250 DInstitut für Molekulare Medizin MF+TNF 1 1 - 5,2 321.000 DInstitut für Neuroendokrinologie MF - 1 1,0 304.000 DInstitut für Neuroradiologie MF - 1 6,4 304.000 DInstitut für Pathologie MF 1 2 14,3 611.064 DInstitut für Pharmakologie und Toxikologie MF 1 - 7,5 714.639 DInstitut für Physik TNF 1 - 5,0 700.861 RInstitut für Physiologie MF+TNF 1 1 - 7,0 1.169.884 RInstitut für Rechtsmedizin MF - - 4,0 261.268 DInstitut für Sozialmedizin MF 1 1 2,3 603.017 DKlinik für Kiefer- und Gesichtschirurgie MF - - 7,8 116.620 DKlinik für Anästhesiologie MF 1 1 79,4 1.081.435 DKlinik für Augenheilkunde MF 1 1 13,1 709.133 DKlinik für Chirurgie MF 1 2 47,2 695.647 DKlinik für Dermatologie und Venerologie MF 1 1 13,2 436.763 DKlinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe MF 1 2 35,1 806.443 DKlinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde MF 1 1 17,4 649.750 DKlinik für Herzchirurgie MF 1 1 19,4 368.607 DKlinik für Kinder- und Jugendmedizin 6 MF 1 1 38,1 942.889 DKlinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie MF 1 - 2,8 321.490 DKlinik für Kinderchirurgie MF 1 1 13,0 363.930 DKlinik für Neurochirurgie MF 1 1 18,6 405.093 DKlinik für Neurologie MF 1 1 24,7 486.888 DKlinik für Orthopädie MF - 1 9,3 321.000 DKlinik für Plastische Chirurgie MF - 1 15,4 320.200 DKlinik für Psychiatrie und Psychotherapie 6 MF 1 1 21,0 864.536 DKlinik für Radiologie und Nuklearmedizin MF 1 - 25,2 569.873 DKlinik für Strahlentherapie MF 1 - 12,9 321.000 DKlinik für Unfallchirurgie 4,5 MF 1 1 11,0 328.219 DKlinik für Urologie MF 1 1 14,4 339.130 DLehrauftrag Allgemeinmedizin 7 MF - - - 70.000 RMedizinische Klinik I 6 MF 1 1 59,3 1.396.407 DMedizinische Klinik II MF 1 1 45,3 858.946 DMedizinische Klinik III (FZB) MF 1 - 8,2Immunchemie und Biochemische Mikrobiologie (FZB) TNF 1 - 566.096 R,D53Immunologie und Zellbiologie (FZB) MF 1 -Medizinische Klinik IV 8,4 MF 1 1 3,8 405.271 DZentrallabor /Klinische Chemie MF - 1 3,8 382.570 DGesamt 41 32 725,9 27.459.4171 Doppelmitgliedschaft der MF und TNF2 Alle Wissenschaftliche Mitarbeiter der Einrichtung für Forschung, Lehre und Krankenversorgung, ohneProfessuren, Drittmittel- und Doktorandenstellen3 Zuweisungen aus dem Dekanatshaushalt (D)/ Rektoratshaushalt (R) nur für Zwecke der Forschung und Lehre4C4-/W3-Stiftungsprofessur5 C3-/W2--Stiftungsprofessur6<strong>zu</strong>züglich einer W1-Juniorprofessur (insgesamt drei Juniorprofessuren)7 Lehrauftrag mit einer Honorarprofessur8Poliklinik für Rheumatologie132
ANHANGAnhang 60LbMV – Lehre für das Studienjahr 2004EinrichtungOnline-EvaluationRanggruppeZusatzengagementRanggruppeLehrbelastungRanggruppeΣZugewieseneMittel(in €)Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 8 8 8 24 15.792Med. Mikrobiologie und Hygiene 8 8 8 24 15.792Pharmakologie und Toxikologie 8 8 8 24 15.792Anästhesiologie 8 8 4 20 13.160Kinder- und Jugendpsychiatrie 8 4 8 20 13.160Klinische Chemie 8 4 8 20 13.160Psychiatrie und Psychotherapie 8 4 8 20 13.160Chirurgie 4 8 4 16 10.528Kinder- u. Jugendmedizin 8 4 4 16 10.528Kinderchirurgie 4 4 8 16 10.528Med. Klinik II 8 8 0 16 10.528Med. Klinik III 4 4 8 16 10.528Neurochirurgie 4 4 8 16 10.528Neurologie 8 4 4 16 10.528Rheumatologie 4 4 8 16 10.528Sozialmedizin 4 8 4 16 10.528Unfallchirurgie 4 4 8 16 10.528Augenheilkunde 8 0 4 12 7.896Chirurgie/Plastische Chirurgie 4 0 8 12 7.896Dermatologie und Venerologie 4 4 4 12 7.896Humangenetik 4 8 0 12 7.896Orthopädie 4 4 4 12 7.896Pathologie 0 8 4 12 7.896Urologie 4 8 0 12 7.896Arbeitsmedizin 0 8 0 8 5.264Biometrie u.Statistik 0 8 0 8 5.264Herzchirurgie 4 0 4 8 5.264Kieferchirurgie 4 0 4 8 5.264Med. Klinik I 4 4 0 8 5.264Med. Psychologie 0 4 4 8 5.264Radiologie 0 8 0 8 5.264Frauenheilkunde und Geburtshilfe 0 0 4 4 2.632Strahlentherapie u. Nuklearmedizin 0 4 0 4 2.632Immunol. u. Transfusionsmedizin 0 0 0 0 0Molekulare Medizin 0 0 0 0 0Neuroendokrinologie 0 0 0 0 0Neuroradiologie 0 0 0 0 0Summe 460 302.680133
ANHANGAnhang 61LbMV – Lehre für das Studienjahr 2005Zuwei-Zusatz-LbMV /Online- engage-mentoffen aus betragNoch sungs-LehrbelastungLehreEvaluation(Ranggruppegruppe)Gruppe) Σ (in €) (in €) (in €)(Rang-(Rang-2005 2004 2005EinrichtungHals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 8 8 8 24 16.800 0 16.800Kinder- und Jugendmedizin 8 8 4 20 14.000 2.428 16.428Kinderchirurgie 8 4 8 20 14.000 2.428 16.428Anästhesiologie 8 8 4 20 14.000 0 14.000Kinder- und Jugendpsychiatrie 8 4 8 20 14.000 0 14.000Neurologie 8 8 4 20 14.000 0 14.000Psychiatrie, Psychotherapie 8 4 8 20 14.000 0 14.000Rheumatologie 8 4 8 20 14.000 0 14.000Sozialmedizin 8 8 4 20 14.000 0 14.000Pharmakologie 4 4 8 16 11.200 2.292 13.492Chirurgie 8 4 4 16 11.200 0 11.200Med. Klinik II 8 8 0 16 11.200 0 11.200Med. Klinik III 4 4 8 16 11.200 0 11.200Med. Mikrobiologie, Hygiene 8 0 8 16 11.200 0 11.200Neurochirurgie 8 0 8 16 11.200 0 11.200Unfallchirurgie 8 0 8 16 11.200 0 11.200Dermatologie, Venerologie 4 4 4 12 8.400 2.496 10.896Augenheilkunde 4 0 8 12 8.400 0 8.400Frauenheilkunde 0 4 8 12 8.400 0 8.400Herzchirurgie 8 0 4 12 8.400 0 8.400Immunologie 8 4 0 12 8.400 0 8.400Klinische Chemie 4 0 8 12 8.400 0 8.400Med. Klinik I 4 8 0 12 8.400 0 8.400Pathologie 0 8 4 12 8.400 0 8.400Sek. Plastische Chirurgie 8 0 4 12 8.400 0 8.400Urologie 4 0 4 8 5.600 2.496 8.096Arbeitsmedizin 0 8 0 8 5.600 0 5.600Biometrie und Statistik 0 8 0 8 5.600 0 5.600Kieferchirurgie 4 0 4 8 5.600 0 5.600Orthopädie 0 4 4 8 5.600 0 5.600Humangenetik 0 4 0 4 2.800 0 2.800Med. Psychologie 0 0 4 4 2.800 0 2.800Radiologie und Nuklearmedizin 0 4 0 4 2.800 0 2.800Molekulare Medizin 0 0 0 0 0 0 0Neuroendokrinologie 0 0 0 0 0 0 0Neuroradiologie 0 0 0 0 0 0 0Strahlentherapie 0 0 0 0 0 0 0Summe 456 319.200 12.140 331.340134
ANHANGAnhang 62Bestand und Haushaltsmittel der Zentralen HochschulbibliothekBestand 2004 2005Veränderungin %Bibliographische Einheiten 433.824 441.250 +1,7Buchbinderbände 204.470 208.140 +1,8Laufende Zeitschriften und Serien in Printform(Anzahl der Titel)564 463 -17,9Kostenpflichtige Online-Zeitschriften 1050 1137 +8,3Erwerbungsmittel (in €) 2004 2005Veränderungin %Haushaltsmittel 511.300 511.300 0Sondermittel für Zeitschriften 42.107 43.384 +3,0Sondermittel für Bücher 13.500 70.249 +420,4Gesamt 566.907 624.933 +10,2135
ANHANGAnhang 63Ausländische Studenten in <strong>Lübeck</strong>1. Im Rahmen des Sokrates/ErasmusprogrammsAusländische Studenten in <strong>Lübeck</strong>bestehtseitPartneruniversitätLandSpanienUniversidat deBarcelonaFrankreichUniversité deCaenÖsterreichMedizinische<strong>Universität</strong>Niederlande RijksuniversiteitGroningenUniversity ofRumänienMedicine andPharmacy „Gr.T. Popa“SpanienUniversidat deMurciaItalienUniversitá degliStudi di ParmaKatholiekeBelgien UniversiteitLeuven (nur PJ)NorwegenUniversitetet iBergen (nur PJ)ItalienUniversità degliStudi di BariUngarnSemmelweis<strong>Universität</strong>vorhandenePlätze2006 2005 2004vorhandenevor-genutztegenutzte handenePlätze Plätze Plätze PlätzegenutztePlätze2 2 2 92 2 2 1 102 2 2 2 92 2 1 2 92 2 1 2 92 2 2 92 2 2 1 92 2 2 42004 2 4 2 1 62006 2 1 102006 2 1 10Summe 22 2 20 2 18 52. Im Rahmen der DirektpartnerschaftenbestehtseitMaximaleAustauschdauer(in Monaten)vorhandenePlätzeAusländische Studenten in <strong>Lübeck</strong>2006 2005 2004genutztePlätzevorhandenePlätzegenutztePlätzevorhandenePlätzegenutztePlätzeMaximaleDauerdes Austausches(in Monaten)Land PartneruniversitätBukowinischeUkraine Staatl. Med. <strong>Universität</strong>2005 4 4 2Norwegen<strong>Universität</strong> Bergen 1989 8 4 8 3 8 7 4Estland <strong>Universität</strong> Tartu 1989 2 1 2 2 2 2 4Summe 14 9 10 5 10 9136
ANHANGAnhang 64<strong>Lübeck</strong>er Studenten im Ausland1. Im Rahmen des Erasmus/Sokratesprogrammes und der Direktpartnerschaften<strong>Lübeck</strong>er Studenten im Ausland2006 2005 2004Land Partner-universitätArtder Partner-schaftvorhandenePlätzegenutztePlätzevorhandenePlätzegenutztePlätzevorhandenePlätzegenutztePlätzeSpanienUniversidat deBarcelonaErasmus 2 2 2 2 2 2Frankreich Université de Caen Erasmus 3 3 3 3 3 3ÖsterreichMedizinische <strong>Universität</strong>Erasmus 2 2 2 2 2 2NiederlandeGroningenRijksuniversiteitErasmus 2 2 2 1 2 2University ofRumänienMedicine andPharmacy „Gr. T.Erasmus 2 1 2 - 2 2Popa“SpanienUniversidat deMurciaErasmus 2 2 2 2 2 2ItalienUniversitá degliStudi di ParmaErasmus 2 2 2 2 2 2BelgienKatholieke UniversiteitLeuven (nur PJ)Erasmus 2 2 2 1 2 -NorwegenUniversitetet i Bergen(nur PJ)Erasmus 4 5 4 4 - -UngarnSemmelweis <strong>Universität</strong>Erasmus 2 -Spanien(ab 2007)UkraineUniversidad MiguelHernandez de Elche(nur PJ)Bukowinische Staatl.Med. <strong>Universität</strong>ErasmusDirekt - - - - - -Norwegen <strong>Universität</strong> Bergen Direkt 4 5 4 4 4 4Estland<strong>Universität</strong> Tartu(nur Famulatur)Direkt 4 4 4 4 4 4ChinaZhejiang UniversityHangzhouDirekt 2 2 2 2 2 2Summe 33 32 31 27 27 25Für die Anerkennung der im Ausland erbrachten Leistungsnachweise durch das Landesprüfungsamtbenötigen die Studenten zwei Formulare: einen Anrechnungsantrag (http://www.uniluebeck.de/studium/ssc/pdfdateien/206antr_anrech_stud.pdf)und - nachdem das Transcript of Recordvorgelegt wurde - eine vom Auslandsamt ausgestellte Bescheinigung. Beide Formulare werden andas Landesprüfungsamt geschickt, welches den Studenten einen Anrechnungsbescheid <strong>zu</strong>schickt.Dieser Bescheid ersetzt die Scheine und wird bei der Prüfungsanmeldung <strong>zu</strong>sammen mit den anderenScheinen vorgelegt. Das Landesprüfungsamt erkennt keine Teilscheine an. Wenn Teilleistungenim Ausland absolviert worden sind (z.B. Praktika ohne Klausuren), können diese nur intern von denProfessoren der jeweiligen Kliniken anerkannt werden. Den Schein für dieses Fach stellt dann die<strong>Universität</strong> aus. Obwohl nach neuer ÄAppO alle Leistungsnachweise benotet sein müssen, werdendie Noten der als äquivalent anerkannten Leistungsnachweise aus dem Ausland nicht mit ins Abschlusszeugnisaufgenommen. Dort steht dann lediglich „bestanden“.2. Im Rahmen von FamulaturenJahr 2004 Jahr 2005 Jahr 2006 46Anzahl der Famulatur-Wochen im Ausland: 85 157 90Anzahl der Studenten, die im Ausland waren: 19 24 16Durchschnittliche Dauer der Famulatur im Ausland (in Wochen): 5 7 646 Stand November 2006137
ANHANGAnhang 65Hörsäle der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>Zurzeit verfügt die <strong>Universität</strong> über 1.628 Sitzplätze in den Hörsälen. Mit der Inbetriebnahme des Audimaxim SS 08 kommen weitere 1.042 Plätze da<strong>zu</strong>.AusstattungHörsaal GebäudeAnzahl derSitzplätzeAudimax 1 Audimax (noch im Bau) 576 • • • • •Z 1/2 Zentralklinikum 318 • • • • •V 1 Vorklinik, Haus 61 198 • • • • • •V 2 Vorklinik, Haus 61 198 • • • • • •Audimax 2 Audimax (noch im Bau) 180 • • • • •Audimax 3 Audimax (noch im Bau) 170 • • • • •T 1 Transistorium 162 • • • • • •Z 3 Zentralklinikum 159 • • • • • •H 1 Turmgebäude, Haus 70 140 • • • • •Audimax 4 Audimax (noch im Bau) 116 • • • • •H IMWG IMWG, Königstraße 42 100 • • • • • •Hörsaal 4a Augenheilkunde, Haus 29 57 • • • •Hörsaal R3 Telematik, Haus 21 55 • • •Hörsaal 4a Augenheilkunde, Haus 29 50 • • • •BMO R 60Biomedizinische Optik,Peter-Monnik-Weg 450 • • • • •H 2 Turmgebäude, Haus 70 40 • • • • •Hörsaal R1 Telematik, Haus 21 36 • •H1 / SFS Mathematik, Wallstraße 40 25 • •H2 / SFS Mathematik, Wallstraße 40 25 • •H3 / SFS Mathematik, Wallstraße 40 15 •TafelFernseherVideorecorderOverheadDiaprojektorBeamerInternetanschluss138
ANHANGG. ErgebnissePreiseAnhang 66Preise in der FakultätZulassung und StudiendauerAnhang 67Bewerber pro StudienplatzAnhang 68Studenten in der VorklinikAnhang 69Studenten in der KlinikIMPP-ErgebnisseAnhang 70Ärztliche VorprüfungAnhang 71Zweiter Abschnitt der Ärztlichen PrüfungPromotionenAnhang 72Doktorandenseminar ‚Suchen, Finden, Vorbereiten einer Dissertation’Anhang 73PromotionskommissionAnhang 74Promotionen – Häufigkeiten und NotenRankingsAnhang 75CHE Hochschulranking Studienjahr 2007Anhang 76CHE Alumni-Befragung 2004139
ANHANGAnhang 66Preise in der FakultätPreis für studentisches Engagement auf Vorschlag des StudienausschussesStudienjahr 2006Judith Bethke, Christian Idel, Thomas Kötter, Maren Kunze, Bernd Lechtenberg, Martin Schröder,Johannes Waldmann und Philipp Wewering. Durch die Aktionen rund um das Thema „<strong>Lübeck</strong> kämpftfür seine Uni“ haben sie in beispielhafter Weise <strong>zu</strong>r Weiterentwicklung der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> beigetragen.Studienjahr 2005Umeswaran Arunagirinathan, Vitus Nowotny, Thomas Kötter, Mirca Windmöller, Julia Caspary, AnnikaHanning, Philipp Moritz Rumpf, Julika Ribbat, Verena Mackens, Rani Naser für die Unterstüt<strong>zu</strong>ng desWerbeflyers „Ich studiere in <strong>Lübeck</strong>, weil…“.Studienjahr 2004Judith Bethke, Maren Kunze, Carsten Neubauer, Mark Schenk, Tanja Trefzer, Markus Wedemeyer fürdas Programm „Einführungswoche für Studienanfänger in <strong>Lübeck</strong>“.Lehrpreis auf Vorschlag der StudentenStudienjahr 2006Herr Prof. Dr. Werner Solbach, Institut für Medizinische Mikrobiologie und HygieneStudienjahr 2005Herr Dr. Reinhard Eggers, Institut für AnatomieStudienjahr 2004Herr Prof. Dr. Werner Solbach, Institut für Medizinische Mikrobiologie und HygienePreise im Rahmen der PromotionStaatlicher Fakultätspreis der Medizinischen Fakultät, Vorschlag der Promotionskommission2003: Jörg Hammers, Doktorvater Prof. Dr. med. H. Kirchner, Institut für Transfusionsmedizin undImmunologie2004: Wiebke Birnbaum, Doktorvater Prof. Dr. med. O. Hiort, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin2005: Steffen Gais, Doktorvater Prof. Dr. rer. soc. J. Born, Klinische ForschergruppeOtto-Roth-Preis, Vorschlag der Promotionskommission2003: Barbara Scheuerer, Doktorvater Priv.-Doz. Dr. rer. nat. F. Petersen, Forschungszentrum Borstel2005: Dmitry Cherkasov, Doktorväter Prof. Dr. rer. nat. W. Traut, Institut für Biologie und Prof. Dr.med. E. Schwinger, Institut für HumangenetikZonta-Preis, externer Preis2006: Petra Jost, Doktorvater Priv.-Doz. Dr. med. Johannes Klein, Medizinische Klinik I140
ANHANGAnhang 67Bewerber pro StudienplatzDie Anzahl der Bewerber pro Studienplatz wurde bis WS 04/05 von der ZVS ermittelt und veröffentlicht.Mit den Änderungen beim Auswahlverfahren geht ein neuer Berechnungsmodus einher. Seit WS05/06 werden die Bewerbungen im Rahmen der Wartezeitquote durch die Anzahl der <strong>zu</strong> vergebendenStudienplätze geteilt. Das Ergebnis nach diesem Berechnungsverfahren ist folgender Graphik <strong>zu</strong> entnehmen.Bewerber pro Studienplatz<strong>Lübeck</strong>Bund54,543,5Bewerber32,521,510,50WS 01/02 WS 02/03 WS 03/04 WS 04/05 WS 05/06 WS 06/07Alternativ kann die Anzahl der Bewerbungen pro Studienplatz ermittelt werden, indem für alle dreiAuswahlbereiche (Abiturbestenquote, Wartezeitquote und Hochschulquote) inklusive aller Ortspräferenzenalle Nennungen <strong>zu</strong>sammengezählt und durch die Anzahl der <strong>zu</strong> vergebenden Studienplätzegeteilt werden. Das Ergebnis dieser Methode ist nachfolgender Graphik <strong>zu</strong> entnehmen.Bewerbungen pro Studienplatz<strong>Lübeck</strong>Bund50Bewerbungen403020100WS 05/06 WS 06/07141
ANHANGAnhang 68Studenten in der Vorklinik1. AufnahmeStudienjahr Anzahl männlich weiblich ausländisch 47gesamt Anzahl % Anzahl % Anzahl %2000 211 79 37,4 132 62,6 14 6,62001 217 70 32,3 147 67,7 14 6,52002 189 61 32,3 128 67,7 14 7,42003 191 60 31,4 131 68,6 14 7,32004 177 48 59 33,3 118 66,7 14 7,92005 183 48 26,2 138 75,4 14 7,72006 185 48 25,9 137 74,1 14 7,62007 183 61 33,3 122 66,7 14 7,72. ExmatrikulationStudienjahrExmatrikulationgesamt davon im 1. Sem. davon im 2. Sem. davon im 3. Sem.2000 5 0 5 02001 2 0 2 02002 5 0 5 02003 9 0 2 72004 2 0 2 02005 13 0 5 82006 6 0 1 53. Studiendauer bis <strong>zu</strong>r Ärztlichen Vorprüfung (alte AO) und Anzahl der Studenten inRegelstudienzeitStudienjahrDurchschnittlicheStudiendauer Bundesschnitt(in Semestern)DurchschnittlicheStudiendauer in <strong>Lübeck</strong>(in Semestern)2002 4,8 4,72003 4,8 4,72004 4,9 4,92005 Noch nicht verfügbar 4,72006 Noch nicht verfügbar 4,947 Nur Bildungsausländer48 Im WS 2003/04 haben 30 <strong>zu</strong>sätzliche Studenten eingeklagt. Diese so genannte 30iger Kohorte wird de jure im WS 2003/04geführt, tatsächlich konnte sie sich erst durch die gerichtliche Zeitverzögerung <strong>zu</strong>m WS 2004/05 einschreiben.142
ANHANGAnhang 69Studenten in der Klinik1. AufnahmeSJAufnahme 7. Semester undAufnahme 5. und 6. SemesterhöherSemesterausländ.Anzahl in %<strong>Lübeck</strong>ergesamt ♂ ♀2000WS 99/00 138 56 82 5 121 87,7 20 3 17 4SS 00 44 20 24 3 41 93,2 20 8 12 72001WS 00/01 117 49 68 6 102 87,2 16 10 6 1SS 01 53 20 33 3 37 69,8 13 7 6 52002WS 01/02 147 49 98 6 122 83,0 9 2 7 3SS 02 52 21 31 3 40 76,9 10 5 5 42003WS 02/03 146 41 105 5 122 83,6 14 4 10 2SS 03 61 22 39 7 48 78,7 14 3 11 72004WS 03/04 160 53 107 12 118 73,8 18 4 14 3SS 04 32 16 16 9 31 96,9 16 7 9 102005WS 04/05 137 50 87 9 116 84,7 12 4 8 2SS 05 35 12 23 4 26 74,3 17 6 11 102006WS 05/06 132 51 81 9 121 91,7 17 7 10 1SS 06 56 14 42 5 54 96,4 2 0 2 02007 WS 06/07 134 43 91 7 122 91,0 7 1 6 22. ExmatrikulationExmatrikulationSJ Semester Gesamtdavonim 5.Sem.davonim 6.Sem.davonim 7.Sem.davonim 8.Sem.davonim 9.Sem.gesamt♂ ♀ ausländ.davonim 10.Sem.davonim 11.Sem.2000WS 99/00 17 1 2 4 2 0 7 0 1SS 00 27 2 9 4 4 2 3 3 02001WS 00/01 24 5 3 3 0 1 11 0 1SS 01 31 1 3 1 2 3 11 1 92002WS 01/02 29 5 2 2 1 1 10 4 4SS 02 28 0 10 2 7 1 6 0 22003WS 02/03 25 2 3 2 1 1 13 2 1SS 03 30 3 5 2 6 0 9 3 22004WS 03/04 10 2 2 0 0 1 4 0 1SS 04 28 1 5 1 2 9 8 1 12005WS 04/05 10 1 0 0 0 2 6 1 0SS 05 22 0 4 0 0 11 6 0 12006WS 05/06 38 1 0 0 1 0 4 1 31SS 06 27 5 0 0 3 0 11 2 62007 WS 06/07 2 0 0 0 0 0 0 0 23. Studiendauer bis <strong>zu</strong>m Dritter Abschnitt der Prüfung (alte AO) und Anzahl der Studentenin RegelstudienzeitStudienjahrDurchschnittlicheStudiendauer Bundesschnitt(in Semestern)DurchschnittlicheStudiendauer in <strong>Lübeck</strong>(in Semestern)2001 14,1 14,32002 13,8 14,22003 13,8 14,72004 13,8 14,52005 13,8 13,92006 Noch nicht verfügbar 14,0davonim 12.Sem.143
ANHANGAnhang 70Ärztliche Vorprüfung1. Bestehensquoten (in %)10080604020mündlich, <strong>Lübeck</strong>ermündlich, Gesamt*schriftlich, <strong>Lübeck</strong>erschriftlich, Gesamt*0Studienjahr 2003 Studienjahr 2004 Studienjahr 20052. Prüfungsnoten12345mündlich, <strong>Lübeck</strong>ermündlich, Gesamt*schriftlich, <strong>Lübeck</strong>erschriftlich, Gesamt*6Frühjahr 2003 Herbst 2003 Frühjahr 2004 Herbst 2004 Frühjahr 2005 Herbst 20053. Vergleich der Prüfungsnoten deutscher und ausländischer Studenten in <strong>Lübeck</strong>12345mündlich, deutschmündlich, ausländischschriftlich, deutschschriftlich, ausländisch6Frühjahr 2003 Herbst 2003 Frühjahr 2004 Herbst 2004 Frühjahr 2005 Herbst 2005* Gesamtergebnis für alle fünf an der Evaluation beteiligten <strong>Universität</strong>en (Greifswald, Hamburg, Kiel, <strong>Lübeck</strong>, Rostock).144
ANHANGFortset<strong>zu</strong>ng Anhang 70Ärztliche Vorprüfung4. Fächer in der VorklinikUm die Leistungen der Studenten aller 36 Medizinischen Fakultäten <strong>zu</strong> einem Prüfungszeitpunkt inden Fächern direkt miteinander vergleichen <strong>zu</strong> können, wurden die Rohwerte in den Fächern (d.h. dieerreichten Punktzahlen) in Standardwerte Z umgerechnet (Mittelwert = 500, Standardabweichung =100). Den Standardwerten ist unmittelbar <strong>zu</strong> entnehmen, ob sie überdurchschnittlich (größer als 500)oder unterdurchschnittlich (kleiner als 500) sind.In der folgenden Abbildung sind die Prüfungsergebnisse (Z-Werte) der <strong>Lübeck</strong>er Studenten im Vergleich<strong>zu</strong> den bundesweit erreichten Ergebnissen dargestellt.550540530520510500490480470460450440430420Frühjahr 2003 Herbst 2003 Frühjahr 2004 Herbst 2004 Frühjahr 2005 Herbst 2005Physik Physiologie Anatomie Psychologie/Soziologie Biologie Chemie/Biochemie145
ANHANGAnhang 71Zweiter Abschnitt der Ärztlichen Prüfung1. Bestehensquoten (in %)10080604020mündlich, <strong>Lübeck</strong>ermündlich, Gesamt*schriftlich, <strong>Lübeck</strong>erschriftlich, Gesamt*0Studienjahr 2003 Studienjahr 2004 Studienjahr 20052. Prüfungsnoten12345mündlich, <strong>Lübeck</strong>ermündlich, Gesamt*schriftlich, <strong>Lübeck</strong>erschriftlich, Gesamt*6Frühjahr 2003 Herbst 2003 Frühjahr 2004 Herbst 2004 Frühjahr 2005 Herbst 20053. Vergleich der Prüfungsnoten deutscher und ausländischer Studenten in <strong>Lübeck</strong>12mündlich, deutsch345mündlich, ausländischschriftlich, deutschschriftlich, ausländisch6Frühjahr 2003 Herbst 2003 Frühjahr 2004 Herbst 2004 Frühjahr 2005 Herbst 2005* Gesamtergebnis für alle fünf an der Evaluation beteiligten <strong>Universität</strong>en (Greifswald, Hamburg, <strong>Lübeck</strong>, Kiel, Rostock).146
ANHANGFortset<strong>zu</strong>ng Anhang 71Zweiter Abschnitt der Ärztlichen Prüfung4. Fächer in der KlinikUm die Leistungen der Studenten aller Medizinischen Fakultäten <strong>zu</strong> einem Prüfungszeitpunkt in denFächern direkt miteinander vergleichen <strong>zu</strong> können, wurden die Rohwerte in den Fächern (d.h. dieerreichten Punktzahlen) in Standardwerte Z umgerechnet (Mittelwert = 500, Standardabweichung =100). Den Standardwerten ist unmittelbar <strong>zu</strong> entnehmen, ob sie überdurchschnittlich (größer als 500)oder unterdurchschnittlich (kleiner als 500) sind.In der folgenden Abbildung sind die Prüfungsergebnisse (Z-Werte) der <strong>Lübeck</strong>er Studenten im Vergleich<strong>zu</strong> den bundesweit erreichten Ergebnissen dargestellt.550Frühjahr 2003 Herbst 2003 Frühjahr 2004 Herbst 2004 Frühjahr 2005 Herbst 2005540530520510500490480470DermatologieHNO Urologie PädiatrieOphthalmologieNervenheilkundeAllgemeinmedizinOrthopädieChirurgieInnereMedizinKlin.PharmakologieRechtsmedizin550Frühjahr 2003 Herbst 2003 Frühjahr 2004 Herbst 2004 Frühjahr 2005 Herbst 2005540530520510500490480470StatistikundInformatikZMKKlin.RadiologieHygieneTherapiechron.SchmerzenSpez.PathologieGynäkologieNaturheilverfahrenAnästhesiologieArbeitsmedizinNotfallmedizinSozialmedizin147
ANHANGAnhang 72Doktorandenseminar ‚Suchen, Finden, Vorbereiten einer Dissertation’Das Wahlfach ‚Suchen, Finden, Vorbereiten einer Dissertation' wird im klinischen Studienabschnittangeboten, richtet sich aber in erster Linie an Studenten des dritten Studienjahres. ÜbergeordnetesZiel der Veranstaltung ist es, den Studenten Hilfestellung <strong>zu</strong>m Suchen und Finden eines den persönlichenInteressen und Erwartungen entsprechenden Dissertationsthemas <strong>zu</strong> geben. Weiterhin sollengrundlegende Kenntnisse in den <strong>zu</strong>m Erstellen einer Dissertation notwendigen praktischen Fertigkeitenvermittelt werden. Aus der Perspektive der Fakultät erhofft man sich durch die Veranstaltung eineAnhebung der durchschnittlichen studienmethodischen Qualität der in <strong>Lübeck</strong> durchgeführten Dissertationsvorhaben<strong>zu</strong> erreichen.Die Veranstaltung wird jeweils im Wintersemester als Vorlesungsreihe (2 SWS) mit anschließenderDiskussion angeboten. Studenten, die die Veranstaltung regelmäßig besucht haben (mindestens 11von 14 Terminen), erhalten eine Bescheinigung, die dem in der Promotionsordnung gefordertenNachweis der Teilnahme an einem Doktorandenseminar genügt. Um die Veranstaltung als Wahlfachwerten <strong>zu</strong> lassen, ist <strong>zu</strong>sätzlich das Bestehen einer Multiple-Choice-Klausur erforderlich.Die abschließende Evaluation der Veranstaltung erfragt die Wahrnehmung der Qualität und des Nutzensder Veranstaltung durch die Studenten und soll vor allem Optimierungspotential aufdecken. Koordinationund Evaluation erfolgen durch das Institut für Sozialmedizin unter enger Einbindung desStudiendekanats.InhalteDie Inhalte der Veranstaltung lassen sich drei thematischen Blöcken <strong>zu</strong>ordnen. Der Block A umfasstEinführungen: <strong>zu</strong>m wissenschaftlichen Arbeiten allgemein; <strong>zu</strong> Art und Umfang von Dissertationen; <strong>zu</strong>rVereinbarkeit von Dissertationen mit dem regulären Studium; <strong>zu</strong>m formalen Ablauf eines Dissertationsvorhabens;<strong>zu</strong> den wichtigsten Inhalten der Promotionsordnung und <strong>zu</strong>r Rolle von Ethik- und Tierversuchskommission.Die Inhalte werden vom Studiendekan, vom Vorsitzenden der Promotionskommissionsowie dem Direktor des Instituts für Sozialmedizin vorgetragen.In den Veranstaltungen des Blocks B werden Konzepte, Anforderungen, Umset<strong>zu</strong>ngsmöglichkeitenund Beispiele von Dissertationsvorhaben in den verschiedenen medizinischen Forschungsrichtungenvorgestellt. Sie sollen den Studenten die Themenwahl nach persönlichen Präferenzen erleichtern. ImEinzelnen werden hier angesprochen: Dissertationen in der Grundlagenforschung, für die relevantenFächer stellvertretend präsentiert durch den Ordinarius der Mikrobiologie; Dissertation in der klinischenGrundlagenforschung („Bench-to-Bedside-Research"), für die relevanten Fächer stellvertretendpräsentiert durch einen Dozenten aus der Chirurgie; Dissertationen in der klinischen Forschung, fürdie relevanten Fächer stellvertretend präsentiert durch einen Dozenten aus der Kinder- und Jugendmedizin;Dissertationen in der Medizingeschichte und Dissertationen in der Epidemiologie und Versorgungsforschung,für die relevanten Fächer stellvertretend präsentiert durch einen Dozenten fürklinische Epidemiologie. Alle Vorlesungen des Blocks B werden unterstützt durch die Präsentation vonabgeschlossenen oder laufenden Dissertationsvorhaben durch Doktoranden aus den jeweiligen Forschungsrichtungen.Der Block C gilt der Vermittlung von Kenntnissen, die für die praktische Durchführung eines Dissertationsvorhabenswichtig sind. Angesprochen werden die Aspekte: Projektmanagement; Literaturrecherche;Fragebogengestaltung und Vorbereitung von statistischen Auswertungen. Die Referenten fürdiesen Themenblock kommen aus dem Studiendekanat, aus dem Institut für Sozialmedizin und demInstitut für Medizinische Biometrie und Statistik.148
ANHANGFortset<strong>zu</strong>ng Anhang 72Doktorandenseminar ‚Suchen, Finden, Vorbereiten einer Dissertation’Einordnung der Veranstaltung in das Profil des StudiengangsDie Veranstaltung zielt auf die allgemeine Befähigung der Studenten <strong>zu</strong>m wissenschaftlichen Arbeiten.Im Gegensatz <strong>zu</strong> klinik- bzw. institutsinternen „Anleitungen <strong>zu</strong>m wissenschaftlichen Arbeiten" istsie nicht auf einen spezifischen Forschungszweig ausgerichtet, sondern will einen Überblick über dieim medizinischen Bereich angewandten Forschungsansätze geben. Dabei finden neben Grundlagenforschungund „Bench-to-Bedside"-Ansätzen besonders die klinische und Versorgungsforschung Beachtung.Abstimmung mit den anderen Fächern des PflichtcurriculumsIn die Veranstaltung sind Referenten aus verschiedenen klinischen und theoretischen Disziplinen eingebunden,die jeweils die Perspektive einer Forschungsrichtung repräsentieren. Inhaltliche Überschneidungenkönnten sich mit den im vierten bzw. fünften Studienjahr angesetzten PflichtveranstaltungenSozialmedizin und Medizinische Biometrie und Epidemiologie (Querschnittsbereich Q1) ergeben.Hier werden durch die eingebundenen Referenten Redundanzen vermieden, in dem die im Wahlfachvermittelten Inhalte vorbereitenden Charakter für die späteren Veranstaltungen haben. Mit denklinischen Fächern sind keine inhaltlichen Überschneidungen <strong>zu</strong> befürchten. Die im Wahlfach vermitteltenstudienmethodischen Kenntnisse sind jedoch geeignet, ein besseres Verständnis für in klinischenLehrveranstaltungen präsentierte aktuelle Forschungsergebnisse <strong>zu</strong> vermitteln.Innovative Aspekte der VeranstaltungFür die Medizinische Fakultät der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> stellt das im Wintersemester 05/06 erstmalsangebotene fachübergreifende Doktorandenseminar eine Neuerung dar.Auswirkungen der Evaluationsergebnisse der Studenten und Meinungen der Fachkollegen aufdie Entwicklung der VeranstaltungIn der Evaluation wird die Qualität der Gesamtveranstaltung wie auch der Einzeltermine von den Studentenmit Schulnoten bewertet. Zusätzlich wird am letzten Vorlesungstermin um mündliches Feedbackgebeten. Die bisherigen Evaluationsergebnisse machten keine grundlegenden Anpassungen desVeranstaltungskonzeptes erforderlich. Innerhalb der einzelnen Termine wurden jedoch, angeregtdurch das mündliche Feedback, mit einigen Dozenten Schwerpunktset<strong>zu</strong>ng und inhaltliche Ausgestaltungder Vorlesung adjustiert. Aus der Sicht der Studenten wurden insbesondere die Präsentationenvon laufenden / abgeschlossenen Dissertationsvorhaben durch die Doktoranden als besonders informativund anschaulich beurteilt. In der Konsequenz wurde dieser Aspekt bei der zweiten Durchführungder Vorlesungsreihe besonders betont.Transfer der Erkenntnisse und Erfahrungen über den eigenen Wirkungskreis hinausInnerhalb der Medizinischen Fakultät ist die Veranstaltung bekannt. Über die Medizinische Fakultätder <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> hinaus, ist bisher durch das koordinierende Institut für Sozialmedizin keinesystematische Weitergabe von Erkenntnissen und Erfahrungen erfolgt.149
ANHANGAnhang 73PromotionskommissionDie Promotion – eine intensive wissenschaftliche AusbildungProf. Dr. med. Karl F. Klotz, Vorsitzender des PromotionsausschussesDie Medizinische Fakultät der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> hat als Hochschule das Recht, den akademischenTitel des Doktors <strong>zu</strong> verleihen und nutzt dies auch als Chance, den wissenschaftlichen Nachwuchsaus<strong>zu</strong>bilden. Da<strong>zu</strong> muss sich der Doktorand einem Promotionsverfahren unterziehen. An der<strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> sind neben der klassischen Doktorarbeit von Medizinern auch Promotionen vonAkademikern anderer Fachrichtungen und von sehr guten Fachhochschulabsolventen möglich. DasVerfahren <strong>zu</strong>r Promotion stellt eine sehr intensive Ausbildung dar, da dem Doktoranden in persönlicherund individueller, oft auch zeitaufwändiger Weise, durch die Doktormutter/den Doktorvater andereMitarbeiter der beteiligten Institution wissenschaftliches Arbeiten von der Planung bis <strong>zu</strong> der Erstellungder Promotionsschrift beigebracht wird.Wie läuft das Promotionsverfahren grundsätzlich ab?Jeder habilitierte Mitarbeiter der Medizinischen Fakultät kann Doktorarbeiten betreuen. Nachdem überAushänge, Forschungsberichte, direkte Ansprache oder die Dissertationsbörse Doktorand und Doktormutter/Doktorvater<strong>zu</strong>einander gefunden haben, wird eine gemeinsame Doktorandenvereinbarunggetroffen, in der sich beide Seiten <strong>zu</strong> einer gewissenhaften Arbeit und Betreuung und gegenseitigeUnterstüt<strong>zu</strong>ng in angemessener Zeit verpflichten. Danach folgt die Phase der Studienplanung und-vorbereitung. Dann kann die eigentliche Arbeit im Labor, am Patienten oder in der Bibliothek beginnen.Bis dann in enger Zusammenarbeit mit der Doktormutter/dem Doktorvater die Schrift erstellt wordenist, können durchaus einige Jahre vergehen.Welche Anstrengungen unternimmt der Promotionsausschuss, um eine sehr hohe Qualität derDoktorarbeiten <strong>zu</strong> gewährleisten?Bei der Bewertung der Dissertationen im Promotionsverfahren wird jede Arbeit in mehreren Stufenvon mehreren Professoren begutachtet. Zunächst werden zwei Wissenschaftler beauftragt, unabhängigvoneinander ein Gutachten <strong>zu</strong> der Schrift <strong>zu</strong> erstellen. Dabei wird die Arbeit intensiv aufgerollt undes kann <strong>zu</strong> Empfehlungen eines Gutachters kommen, die die Arbeit noch einmal verbessern können.Kommen beide Gutachter <strong>zu</strong> dem Schluss, dass die Arbeit als Promotionsleistung angenommen werdensoll, beschäftigt sich der Promotionsausschuss mit dem Werk. Dieser Ausschuss besteht aus 18Mitgliedern, davon 16 Wissenschaftler und zwei Vertreter der Studentenschaft. Ein Professor desAusschusses wird beauftragt, die Doktorarbeit und die Gutachten kritisch <strong>zu</strong> würdigen und im Ausschussvor<strong>zu</strong>tragen. Wenn alle an der Bewertung Beteiligten <strong>zu</strong> der Ansicht kommen, dass es sich umeine hervorragende Arbeit handelt, die die Note 1,0 verdient, wird <strong>zu</strong>r Bestätigung dieser Einschät<strong>zu</strong>ngein drittes Gutachten eines Professors einer anderen <strong>Universität</strong> eingeholt. Außerdem mussdiese Note auch durch den Konvent der Fakultät bestätigt werden. Dann kann das Prädikat „summacum laude“ verliehen werden. Weitere Prädikate sind „magna cum laude“, „cum laude“ und „rite“.Wenn alle Schritte der Begutachtung und Diskussion durchlaufen sind, wird die Arbeit für drei Wochenhochschulöffentlich ausgelegt, so dass alle promovierten Mitglieder der <strong>Universität</strong> die Arbeit nocheinmal einer Prüfung unterziehen können. Dann wird der Doktorand gebeten, ihre oder seine Arbeitvor einem Prüfungsausschuss bestehend aus drei Professoren mündlich <strong>zu</strong> verteidigen. Dies ist dieletzte Hürde vor der Verleihung des Doktortitels durch den Dekan der Medizinischen Fakultät, die imRahmen einer akademischen Feier am Ende eines Semesters geschieht.Die Medizinische Fakultät fördert die Publikation der Dissertationsarbeiten, indem sehr gute Prädikatenur verliehen werden, wenn die Arbeit in einer international anerkannten Zeitschrift publiziert wurde.Um ausgezeichnete Promotionsarbeiten noch weiter <strong>zu</strong> fördern, hat die <strong>Universität</strong> ein hoch dotiertesStipendienprogramm aufgelegt. Alle Doktoranden können sich um eine achtzehnmonatige Förderungvon 500 € monatlich und <strong>zu</strong>sätzlichen Reisekosten<strong>zu</strong>schüssen bewerben.An der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> gibt es eine Reihe von Auszeichnungen für exzellente Doktorarbeiten.Zu dem jährlich verliehenen Staatlichen Fakultätspreis und dem zweijährlich verliehenen Otto-Roth-Preis kamen im Herbst 2006 noch der Zonta-Promotionspreis für hervorragende Dissertationen vonDoktorandinnen und 2007 der Preis der <strong>Lübeck</strong>er Sparkassenstiftung hin<strong>zu</strong>.150
ANHANGAnhang 74Promotionen – Häufigkeiten und Noten1. Absolute Häufigkeit der PromotionenJahrAnzahlmännlichweiblichgesamt Anzahl % Anzahl %2003 124 48 38,7 76 61,32004 139 68 48,9 71 51,12005 152 72 47,4 80 52,62. Häufigkeit der Promotionen pro Studienjahr (in %)908070in Prozent6050403020100Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2003 Jahr 2004 Jahr 2005Berechnungsgrundlage ist die Anzahl der Studienanfänger 7 Jahre <strong>zu</strong>vor3. Häufigkeitsverteilung der Noten im Promotionsverfahren (in %)Jahr 2003 Jahr 2004 Jahr 2005706050in Prozent403020100summa cum laude magna cum laude cum laude rite151
ANHANGAnhang 75CHE Hochschulranking Studienjahr 2007Das CHE-Hochschulranking hat alle deutschsprachigen <strong>Universität</strong>en, an denen Humanmedizin studiertwerden kann, hinsichtlich 26 verschiedener Kriterien untersucht. Im Gegensatz <strong>zu</strong> anderen Rankingswerden hier keine Rangplätze vergeben. Stattdessen wird jede Hochschule in jedem Kriteriumeiner Spitzen-, Mittel- oder Schlussgruppe <strong>zu</strong>gewiesen. Die Daten hierfür werden alle drei Jahre vomCHE direkt von den <strong>Universität</strong>en erhoben. Im Folgenden ist für fünf Kriterien die Kurzauswertung <strong>zu</strong>sehen (vollständige Auswertung unter: http://www.das-ranking.de/che7/). Dabei liegt <strong>Lübeck</strong> als einzige<strong>Universität</strong> in vier von fünf Kriterien in der Spitzengruppe.<strong>Universität</strong>RWTH AachenUni Basel (CH)FU BerlinHU BerlinUni Bern (CH)Uni BochumUni BonnTU DresdenUni Duisburg-EssenUni DüsseldorfUni Erl.-Nürnb. / ErlangenUni Frankfurt a.M.Uni FreiburgUni Genève / Genf (CH)Uni GiessenUni GöttingenUni GreifswaldUni Halle-WittenbergUni HamburgMH HannoverUni Heidelberg Med. FakultätUni Heidelberg, MannheimUni JenaUni KielUni KölnUni Lausanne (CH)Uni LeipzigUni <strong>Lübeck</strong>Uni MagdeburgUni MainzUni MarburgLMU MünchenTU MünchenUni MünsterUni RegensburgUni RostockUni Saarbrücken / HomburgUni TübingenUni UlmUni Witten / Herdecke (priv.)Uni WürzburgUni Zürich (CH)StudiensituationgesamtBetreuungErläuterungSpitzengruppe Mittelgruppe SchlussgruppeAbsteiger Aufsteiger nicht geranktBettenausstattungWiss.VeröffentlichungenReputationbei Professoren152
ANHANGAnhang 76CHE Alumni-Befragung 2004Im Jahr 2004 führte das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) eine landesweite Befragung derAbsolventen durch und erfasste, wie gut das Studium der Humanmedizin berufsrelevante Kompetenzenvermittelte und wie es organisiert war. Insgesamt wurden Daten von 4.720 Absolventen einbezogen,die zwischen 1996 und 2002 ihre Approbation erhalten haben. Die nachfolgende Abbildung zeigt,dass <strong>Lübeck</strong> im Bereich der Kompetenzvermittlung bis auf die Bereiche Teamarbeit und BWL-Kenntnisse (jeweils Mittelgruppe) in allen Indikatoren in der Spitzengruppe liegt. Bei der Bewertungdes Studiums (nächste Seite) liegt die Medizinische Fakultät ebenfalls in 14 von 18 Indikatoren in derSpitzengruppe. Die Struktur des Studienangebotes, die Breite des Lehrangebotes und die technischeAusstattung der <strong>Universität</strong> liegen in der Mittelgruppe, die Ausstattung der Bibliothek in der Schlussgruppe.153
ANHANGFortset<strong>zu</strong>ng Anhang 76CHE Alumni-Befragung 2004ErläuterungSpitzengruppe Mittelgruppe Schlussgruppe154