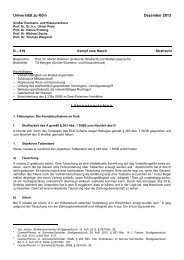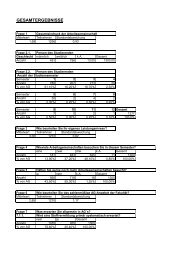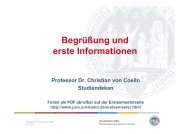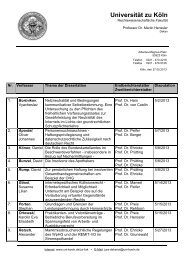Kölner Konferenz Arbeitsrecht und Methode
Kölner Konferenz Arbeitsrecht und Methode
Kölner Konferenz Arbeitsrecht und Methode
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Kölner</strong> <strong>Konferenz</strong> „<strong>Arbeitsrecht</strong> <strong>und</strong> <strong>Methode</strong>“<br />
Freitag <strong>und</strong> Samstag, 1. <strong>und</strong> 2. Oktober 2010<br />
Universität zu Köln<br />
Recht ist die Kunst des Guten <strong>und</strong> Gerechten – so steht es in den Digesten des Celsus. Im<br />
demokratischen Rechtsstaat liegt die Definitionskompetenz hierfür freilich primär beim<br />
Gesetzgeber, dessen Vorgaben der Richter in denkendem Gehorsam umzusetzen hat.<br />
Doch wie hat er zu entscheiden, wenn ihm der Gesetzgeber keine Vorgaben macht, wo er<br />
welche machen müsste? Wie hat er mit inkohärenten Vorgaben <strong>und</strong> einer Rechtsordnung<br />
voller Widersprüche umzugehen?<br />
Das <strong>Arbeitsrecht</strong> zeigt die Dringlichkeit dieser Fragen besonders deutlich auf. Aufgr<strong>und</strong> der<br />
in viele Einzelgesetze zersplitterten Regelungen ist es kaum möglich, ein einheitliches<br />
Wertungssystem zu schaffen. Hinzu kommt, dass der parlamentarische Gesetzgeber in<br />
Fragen des kollektiven <strong>Arbeitsrecht</strong>s regelungsscheu, vielleicht sogar partiell<br />
regelungsunfähig ist. Die Gerichte werden dann zu Ersatzgesetzgebern, etwa im<br />
Arbeitskampfrecht, dessen Gr<strong>und</strong>prinzipien der Erste Senat des B<strong>und</strong>esarbeitsgerichts<br />
zurzeit gr<strong>und</strong>legend umgestaltet.<br />
Ein weiterer aktueller Brennpunkt ist die fortschreitende Rechtsvereinheitlichung in Europa.<br />
Gerade im <strong>Arbeitsrecht</strong>, das mit 20 Verordnungen <strong>und</strong> 100 Richtlinien in besonderem Maße<br />
betroffen ist, stellen sich zahlreiche methodische Fragen. Es geht vor allem um das<br />
Verhältnis des nationalen <strong>und</strong> des europäischen Gesetzgebers sowie um die<br />
Kompetenzverteilung zwischen dem Europäischen Gerichtshof <strong>und</strong> den nationalen<br />
Gerichten. Exemplarisch zu nennen sind die Vorgaben des EuGH zur Rechtmäßigkeit<br />
grenzüberschreitender Arbeitskämpfe trotz fehlender Gesetzgebungskompetenz der<br />
Europäischen Union, die dem deutschen Verständnis der Arbeitskampffreiheit diametral<br />
entgegenstehen. Unsicherheit herrscht zudem über die Reichweite der richtlinienkonformen<br />
Auslegung oder Rechtsfortbildung, die das Spannungsverhältnis zwischen dem Gebot<br />
effektiver Richtlinienumsetzung <strong>und</strong> der richterlichen Gesetzesbindung betrifft.<br />
Die aufgeworfenen methodischen Fragen haben zugleich eine verfassungs- <strong>und</strong><br />
staatsrechtliche Dimension. <strong>Methode</strong>nfragen sind Verfassungsfragen. Sie betreffen die<br />
reale Normsetzungsmacht im Staat. Die Wahl der Auslegungsmethode bestimmt nicht<br />
selten das Ergebnis des Rechtsstreits. Im Gegensatz dazu steht die Vernachlässigung der<br />
<strong>Methode</strong>nlehre in der juristischen Ausbildung.<br />
Die von der Fritz Thyssen Stiftung geförderte <strong>Kölner</strong> <strong>Konferenz</strong> „<strong>Arbeitsrecht</strong> <strong>und</strong> <strong>Methode</strong>“<br />
wird das methodische Vorgehen anhand wichtiger <strong>und</strong> praxisrelevanter arbeitsrechtlicher<br />
Brennpunkte hinterfragen. Sie richtet sich vornehmlich an die <strong>Arbeitsrecht</strong>swissenschaft<br />
<strong>und</strong> den fortgeschrittenen wissenschaftlichen Nachwuchs.<br />
Dr. Clemens Höpfner<br />
Dr. Felipe Temming<br />
3