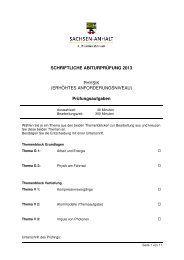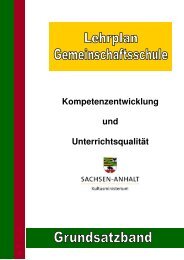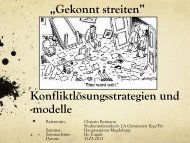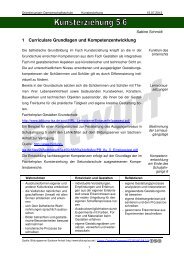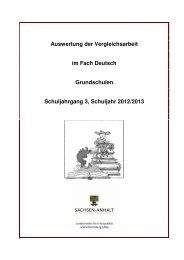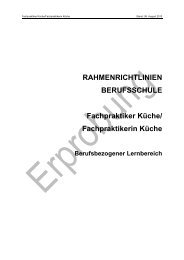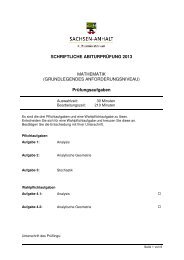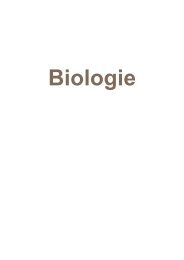Kriterien zur EntËœwicklung, Evaluation und Fortschreibung von Schul ...
Kriterien zur EntËœwicklung, Evaluation und Fortschreibung von Schul ...
Kriterien zur EntËœwicklung, Evaluation und Fortschreibung von Schul ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Dr. Margit Colditz Abschlusstagung KES<br />
3 Ergebnisse des Modellversuchs „<strong>Kriterien</strong> <strong>zur</strong> Entwicklung,<br />
<strong>Evaluation</strong> <strong>und</strong> <strong>Fortschreibung</strong> <strong>von</strong> <strong>Schul</strong>programmen<br />
(KES)“<br />
Dr. Margit Colditz<br />
Sehr geehrter Herr Minister, meine sehr<br />
verehrten Damen <strong>und</strong> Herren, liebe<br />
Kolleginnen <strong>und</strong> Kollegen,<br />
im Namen aller am Modellversuch<br />
„<strong>Kriterien</strong> <strong>zur</strong> Entwicklung, <strong>Evaluation</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Fortschreibung</strong> <strong>von</strong> <strong>Schul</strong>programmen<br />
(KES)“ Beteiligten möchte ich Sie zu<br />
unserer Abschlussveranstaltung herzlich<br />
in Dessau begrüßen. Wir freuen uns<br />
außerordentlich, dass Sie unserer<br />
Einladung in so großer Zahl Folge<br />
geleistet haben. Ist doch Ihre Teilnahme<br />
für uns Ausdruck dafür, dass im Land<br />
Sachsen-Anhalt <strong>Schul</strong>programme zuneh<br />
mend als geeignetes Mittel <strong>zur</strong> Qualitätssicherung <strong>und</strong> Qualitätssteigerung schulischer Arbeit<br />
ansehen werden.<br />
Als wir Ende 1999 an der IGS Halle das Startsignal zum Modellversuch KES gegeben<br />
haben, konnten wir nicht erahnen, dass dieser eine solche Eigendynamik entwickeln würde.<br />
Wahrnehmbar war ein wachsendes Interesse an unseren Erfahrungen <strong>und</strong> Ergebnissen;<br />
immer häufiger wurde die Frage an uns gestellt, ob – <strong>und</strong> wenn ja – unter welchen Bedingungen<br />
<strong>Schul</strong>programme <strong>zur</strong> Qualitätssteigerung beitragen können.<br />
Aus unserer Sicht können wir heute mit Fug <strong>und</strong> Recht sagen, dass sich das Engagement<br />
der Beteiligten gelohnt hat. An den <strong>Schul</strong>en wurden <strong>Schul</strong>entwicklungsprozesse in Gang<br />
gesetzt bzw. dort – wo bereits Erfahrungen mit <strong>Schul</strong>programm- oder <strong>Schul</strong>profilarbeit vorlagen<br />
– effizienter gestaltet. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe <strong>Schul</strong>beratung konnten ihre<br />
Professionalität hinsichtlich Beratung <strong>und</strong> <strong>Evaluation</strong> erhöhen.<br />
Bevor ich zum eigentlichen Thema meines Beitrages „Ergebnisse des Modellversuchs“<br />
komme, möchte ich – <strong>zur</strong> deren besserer Einordnung – einen kurzen Einblick in die Ziele <strong>und</strong><br />
Arbeitsstrukturen <strong>von</strong> KES geben: Unser Landesvorhaben „<strong>Kriterien</strong> <strong>zur</strong> Entwicklung, Eva-<br />
1
Dr. Margit Colditz Abschlusstagung KES<br />
luation <strong>und</strong> <strong>Fortschreibung</strong> <strong>von</strong> <strong>Schul</strong>programmen (KES)“ ist eingebettet in das BLK-Programm<br />
„Qualitätsverbesserung in <strong>Schul</strong>en <strong>und</strong> <strong>Schul</strong>systemen“, an dem sich nahezu alle<br />
B<strong>und</strong>esländer beteiligt haben.<br />
Dieses b<strong>und</strong>esweite Programm QuiSS orientierte auf vier Arbeitsbereiche 1 :<br />
– Im Zentrum aller Maßnahmen <strong>zur</strong> Qualitätsverbesserung standen Unterricht <strong>und</strong> Erziehung.<br />
Sie sollten gerichtet sein auf die Schaffung innovativer Lernsituationen <strong>und</strong> die<br />
Förderung selbstgesteuerten <strong>und</strong> kooperativen Lernens.<br />
Die Realisierung dieses Arbeitsbereiches ist ohne drei weitere, die sich als Instrumente <strong>und</strong><br />
Verfahren um sie herum ranken, nicht denkbar:<br />
– <strong>Schul</strong>entwicklung erfordert eine erhöhte Professionalität, <strong>von</strong> Lehrkräften, <strong>Schul</strong>leitungen<br />
<strong>und</strong> <strong>Schul</strong>behörden.<br />
– Entsprechende Unterstützungs- <strong>und</strong> Kontrollsysteme sind ein<strong>zur</strong>ichten bzw. zu effektivieren,<br />
vor allem um die <strong>Schul</strong>en auf ihrem Weg der <strong>Schul</strong>entwicklung zu beraten <strong>und</strong><br />
deren Tun durch <strong>Evaluation</strong> zu begleiten.<br />
– Pädagogische <strong>Schul</strong>entwicklung ist vor allem auch nicht ohne eine entsprechende<br />
planerische Organisation zu bewältigen, zum Beispiel um die Zusammenarbeit in <strong>Schul</strong>netzwerken<br />
oder die Arbeit mit <strong>Schul</strong>programmen zu ermöglichen.<br />
Arbeitsbereiche im BLK-Programm QuiSS<br />
Planerische<br />
Organisation<br />
Steigerung<br />
der Qualität<br />
<strong>von</strong> Unterricht<br />
<strong>und</strong> Erziehung<br />
Erhöhung der<br />
Professionalität<br />
Abschlusstagung KES, Dessau, 28.04.2004<br />
Unterstützungs- <strong>und</strong><br />
Kontrollsysteme<br />
1 BUND-LÄNDER-KOMMISSION FÜR BILDUNGSPLANUNG UND FORSCHUNGSFÖRDERUNG (Hrsg.): Qualitätsverbesserung<br />
<strong>von</strong> <strong>Schul</strong>en <strong>und</strong> <strong>Schul</strong>systemen. Gutachten zum Programm <strong>von</strong> Prof. Dr. RAINER<br />
BROCKMEYER. (Materialien <strong>zur</strong> Bildungsplanung <strong>und</strong> Forschungsförderung, Heft 71). Bonn 1999.<br />
2
Dr. Margit Colditz Abschlusstagung KES<br />
Den am BLK-Programm beteiligten Ländern wurde durch die B<strong>und</strong>-Länder-Kommission für<br />
Bildungsplanung <strong>und</strong> Forschungsförderung relative Freiheit in der Schwerpunktsetzung gegeben.<br />
So verfolgten z. B. Rheinland-Pfalz die Qualifizierung <strong>von</strong> <strong>Schul</strong>entwicklungsmoderatoren,<br />
Bremen die Erarbeitung schulinterner Curricula auf der Basis neu in Kraft gesetzter Lehrpläne,<br />
Niedersachsen die interne <strong>und</strong> externe <strong>Evaluation</strong> <strong>von</strong> <strong>Schul</strong>entwicklungsprozessen.<br />
Wir in Sachsen-Anhalt legten den Schwerpunkt auf die Arbeit mit <strong>Schul</strong>programmen. Damit<br />
wandten wir uns allen vier hier aufgezeigten Arbeitsbereichen zu.<br />
Folgende Ziele wurden für den Modellversuchs KES formuliert 2 :<br />
3<br />
Ziele <strong>von</strong> KES<br />
� Erarbeitung, <strong>Evaluation</strong> <strong>und</strong> <strong>Fortschreibung</strong><br />
qualitätssichernder <strong>Schul</strong>programme, die auf<br />
Unterricht fokussiert sind<br />
� Qualifizierung der <strong>Schul</strong>aufsicht für die Beratung<br />
der <strong>Schul</strong>en <strong>und</strong> für die externe <strong>Evaluation</strong> der<br />
<strong>Schul</strong>programmarbeit<br />
� Zusammenarbeit in Netzwerken<br />
� Verbreitung <strong>und</strong> Transfer <strong>von</strong> Erfahrungen <strong>und</strong><br />
Ergebnissen<br />
Hauptziel:<br />
Ableitung <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>zur</strong> <strong>Schul</strong>programmarbeit<br />
Abschlusstagung KES, Dessau, 28.04.2004<br />
Unser Hauptziel bestand darin, aus den gemachten <strong>und</strong> auch b<strong>und</strong>esweit vorliegenden Erfahrungen<br />
<strong>Kriterien</strong> <strong>zur</strong> <strong>Schul</strong>programmarbeit abzuleiten, was sich auch in der Bezeichnung<br />
unseres Modellversuchs „<strong>Kriterien</strong> <strong>zur</strong> Entwicklung, <strong>Evaluation</strong> <strong>und</strong> <strong>Fortschreibung</strong> <strong>von</strong><br />
<strong>Schul</strong>programmen (KES)“ wiederspiegelt.<br />
2 Antrag auf Teilnahme am BLK-Programm „Qualitätsverbesserung durch Steigerung der<br />
Innovationsfähigkeit <strong>und</strong> der Selbstwirksamkeit in <strong>Schul</strong>en <strong>und</strong> <strong>Schul</strong>systemen (QuiSS)“. Ms.<br />
Magdeburg 1999.
Dr. Margit Colditz Abschlusstagung KES<br />
Zur Umsetzung dieser Ziele war nicht unbedeutend, dass die am Modellversuch Beteiligten<br />
in einer effektiven Organisationsstruktur/in einem Netzwerk arbeiten konnten <strong>und</strong> ein projektinternes<br />
Unterstützungssystem entstanden ist:<br />
Zwölf allgemein bildende <strong>Schul</strong>en unterschiedlicher <strong>Schul</strong>formen <strong>und</strong> Entwicklungsstände<br />
hinsichtlich Qualitätssicherung fanden sich in zwei <strong>Schul</strong>sets zusammen. Bei den Erfahrungsaustauschen<br />
<strong>und</strong> Workshops zeigte sich, dass die <strong>Schul</strong>form (sei es nun eine Gr<strong>und</strong>schule,<br />
Sonderschule, Sek<strong>und</strong>arschule, Gesamtschule oder ein Gymnasium) einer guten<br />
Kooperation keine Grenzen setzt, wenn im Mittelpunkt das gemeinsame Vorgehen im <strong>Schul</strong>entwicklungsprozess<br />
steht. Auch wurde die Kommunikation durch <strong>Schul</strong>en mit Erfahrungen<br />
auf dem Gebiet der Qualitätssteigerung, wie die Sek<strong>und</strong>arschule Parey, bereichert.<br />
Begleitet <strong>und</strong> beraten wurden die <strong>Schul</strong>en durch ein projektinternes Unterstützungssystem.<br />
Dieses war getragen durch<br />
– die AG <strong>Schul</strong>beratung<br />
– die wissenschaftliche Begleitung durch die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,<br />
Fachbereich Erziehungswissenschaften,<br />
– eine Projektleitung, angesiedelt am LISA.<br />
Erst durch dieses Unterstützungssystem wurden prozessbegleitende Workshops, Beratungsgespräche,<br />
Befragungen, Interviewstudien bzw. Feedbacks möglich.<br />
Da Modellversuche kein Selbstzweck sind, sondern vor allem darauf abzielen, als Pilotvorhaben<br />
Erfahrungen für Andere aufzubereiten, möchten ich im Folgenden Ergebnissen <strong>von</strong><br />
KES aufzeigen <strong>und</strong> damit ggf. ihrer <strong>Schul</strong>programmarbeit neue Impulse geben. Dies wird in<br />
gebotener Kürze geschehen müssen, so dass ich auf die sich nach der Mittagspause anschließende<br />
Arbeitsgruppentätigkeit verweisen möchte, in der die <strong>von</strong> mir gemachten Aussagen<br />
eine praxisorientierte Untersetzung erfahren werden.<br />
Am Anfang bewegten uns alle folgende zwei Leitfragen, die wir versuchten, im Laufe des<br />
Modellversuchs zu beantworten:<br />
<strong>Schul</strong>programme werden mittler-<br />
– Was ist ein <strong>Schul</strong>programm <strong>und</strong> was sollte es weile b<strong>und</strong>esweit <strong>und</strong> auch inter-<br />
beinhalten?<br />
national als bedeutsames Instru-<br />
– Wie entsteht ein <strong>Schul</strong>programm <strong>und</strong> wie arbeitet ment der Qualitätsentwicklung<br />
man damit?<br />
der Einzelschule angesehen.<br />
Lassen Sie mich zunächst einige Aussagen zum Produkt <strong>Schul</strong>programm machen:<br />
<strong>Schul</strong>programme werden mittlerweile b<strong>und</strong>esweit <strong>und</strong> auch international als bedeutsames<br />
Instrument der Qualitätsentwicklung der Einzelschule angesehen.<br />
4
Dr. Margit Colditz Abschlusstagung KES<br />
Herr Dr. Eisenmann warf heute morgen bereits die Frage danach auf, was denn nun ein<br />
<strong>Schul</strong>programm sei. Wir schlagen folgende kurze Definition vor:<br />
„Das <strong>Schul</strong>programm ist ein Arbeitsprogramm. Es dokumentiert neben dem bislang<br />
Erreichten Ziele <strong>und</strong> konkrete Umsetzungsschritte <strong>und</strong> gibt auch an, wann <strong>und</strong> wie eine<br />
<strong>Schul</strong>e überprüft, ob die Ziele erreicht wurden.“<br />
Wenn es also zu einem wahren Arbeitsprogramm werden soll, wollten wir wissen, was es<br />
beinhalten sollte.<br />
Unsere Erfahrung besagt, dass es – unabhängig <strong>von</strong> den schulspezifischen Vorhaben –<br />
Aussagen zu nachfolgenden Punkten enthalten bzw. folgende <strong>Kriterien</strong> erfüllen muss:<br />
5<br />
<strong>Kriterien</strong> für ein <strong>Schul</strong>programm<br />
� Ausgangssituation der <strong>Schul</strong>e<br />
� Leitbild der <strong>Schul</strong>e<br />
� Entwicklungsschwerpunkte der <strong>Schul</strong>e<br />
� Ziele <strong>und</strong> Teilziele<br />
� Qualitätskriterien <strong>und</strong> Indikatoren<br />
� Maßnahmenkatalog<br />
� Konkrete Maßnahmen<br />
� Verantwortlichkeiten<br />
� Zeitplan<br />
� Zwischenüberprüfungen, <strong>Evaluation</strong><br />
Abschlusstagung KES, Dessau, 28.04.2004<br />
– Zunächst sollte die Ausgangssituation der <strong>Schul</strong>e beschrieben werden. Dazu können<br />
gehören: Lage, Größe, Einzugsbereich, Traditionen, Erreichtes/Vorzeigbares, aber auch<br />
Probleme/Reserven.<br />
– Wichtig ist, dass sich die <strong>Schul</strong>e ein Leitbild gibt. Ein Leitbild ist eine einprägsame Zielvorstellung,<br />
die aus Leitsätzen bestehen kann. ES hat längerfristige Gültigkeit <strong>und</strong> hilft<br />
die Außenwirksamkeit der <strong>Schul</strong>e zu erhöhen.<br />
Das Leitbild der <strong>Schul</strong>e mit Ausgleichsklassen Astrid-Lindgren in Burg enthält z. B.<br />
folgenden Leitsatz: „Wir wollen eine <strong>Schul</strong>e sein, in der jeder hinsichtlich seiner<br />
individuellen Bedürfnisse <strong>und</strong> Erfordernisse gefordert <strong>und</strong> gefördert wird.“
Dr. Margit Colditz Abschlusstagung KES<br />
Einige <strong>Schul</strong>en haben ihrem Leitbild ein Motto voran gestellt, so die Astrid-Lindgren-<br />
<strong>Schul</strong>e „Eine <strong>Schul</strong>e zum Wohlfühlen“, die IGS Halle „Eine <strong>Schul</strong>e für (H)alle“ oder die<br />
Fröbelschule Halle „Entdecke deine Fähigkeiten“.<br />
– An das Leitbild der <strong>Schul</strong>e sollten sich Entwicklungsschwerpunkte anschließen, auf die<br />
sich die <strong>Schul</strong>e verständigt hat. Die Entwicklungsschwerpunkte sind zeitlich begrenzter<br />
als das Leitbild <strong>und</strong> sollten für die nächsten drei bis fünf Jahre im Zentrum der Arbeit<br />
stehen. Wir empfehlen, nur wenige auszuwählen. Den Rat <strong>von</strong> Prof. Brockmeyer auf<br />
unserer Eröffnungsveranstaltung, sich auf wenige Schwerpunkte zu beschränken,<br />
mussten viele <strong>von</strong> uns schmerzlich verstehen lernen. Manchen wurde erst bei der Vorbereitung<br />
der <strong>Evaluation</strong> bewusst, dass ihre Ziele zu umfangreich oder zu unkonkret waren,<br />
um ihre Umsetzung überprüfen zu können.<br />
Die Sek<strong>und</strong>arschule Holleben legte in ihrem <strong>Schul</strong>programm zum Beispiel einen Entwicklungsschwerpunkt<br />
auf die „Erhöhung der Methodenkompetenz ihrer Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schüler“.<br />
– Die vereinbarten Entwicklungsschwerpunkte sind durch Ziele <strong>und</strong> Teilziele zu untersetzen.<br />
Diese dürfen nicht zu abstrakt sein, sind eindeutig zu formulieren <strong>und</strong> müssen<br />
überprüfbar sein. Vor allem dürfen sie nicht mit Maßnahmen verwechselt werden –<br />
einigen <strong>Schul</strong>en wurde z. T. erst im Prozess der <strong>Evaluation</strong> klar, dass z. B. „das Durchführen<br />
einer Schilf“ oder die „Verbesserung der Arbeit in den Fachschaften“ keine Ziele,<br />
sondern Maßnahmen zum Erreichen <strong>von</strong> Zielen sein können. Um beim Beispiel der<br />
Sek<strong>und</strong>arschule Holleben zu bleiben, lautet hier das Ziel: „Verbesserung der Fähigkeit<br />
der Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler, mit Texten umzugehen“.<br />
Die Ziele sind dann wiederum durch Qualitätskriterien <strong>und</strong> Indikatoren zu konkretisieren.<br />
Hier ist die Frage danach zu stellen, woran festgemacht werden kann, ob das Ziel<br />
erreicht wurde. Ein Qualitätskriterium zum „Beispiel Textarbeit“ lautet: „Die Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schüler können aus einem Sachtext die wesentlichen Informationen entnehmen.“<br />
Die Arbeitsgruppe 4 wird sich intensiver mit der Konkretisierung <strong>von</strong> Entwicklungsschwerpunkten<br />
befassen.<br />
– Die Umsetzung der vereinbarten Ziele muss durch einen Maßnahmenkatalog begleitet<br />
werden. Dieser sollte konkrete Maßnahmen, Verantwortlichkeiten, einen Zeitplan <strong>und</strong><br />
Vorhaben zu Zwischenüberprüfungen <strong>und</strong> <strong>zur</strong> <strong>Evaluation</strong> enthalten, z. B., dass mit den<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler die 5-Schritt-Lese-Methode trainiert wird <strong>und</strong> Leseanalysen<br />
durchgeführt werden.<br />
Der Maßnahmenkatalog gehört zu einem <strong>Schul</strong>programm dazu. Allerdings kann er auch<br />
als Anhang geführt werden. Sinn macht dies zum Beispiel dann, wenn die <strong>Schul</strong>e mit<br />
dem <strong>Schul</strong>programm Öffentlichkeitsarbeit betreibt <strong>und</strong> Außenstehende über ihre Ziele<br />
informieren möchte, dann sind Termine <strong>und</strong> Namen zweitrangig.<br />
6
Dr. Margit Colditz Abschlusstagung KES<br />
Ist ein solches schulspezifisches Programm entstanden, muss es aber auch zu einem<br />
Arbeitsinstrument werden, darf nicht in einer Schublade verschwinden <strong>und</strong> z. B. nur bei<br />
<strong>Schul</strong>besuchen hervorgeholt werden.<br />
Ich komme damit zum zweiten Fragenkomplex: Welche Prozesse müssen ablaufen, um zu<br />
einem <strong>Schul</strong>programm zu kommen, mit dem auch erfolgreich gearbeitet wird?<br />
Europaweite Erfahrungen besagen, dass es sich dabei um einen ganzen „Zyklus der Qualitätsentwicklung“<br />
handelt. Qualitätsdiskussion setzt voraus, dass<br />
– <strong>Schul</strong>en zunächst eigenverantwortlich ihre Qualität mittels einer Bestandsanalyse hinter-<br />
7<br />
fragen,<br />
– die gewonnenen Erkenntnisse reflektieren, Perspektiven <strong>und</strong> Visionen diskutieren,<br />
– schulspezifische Ziele <strong>und</strong> Maßnahmen in einem <strong>Schul</strong>programm mit konkreten Terminen<br />
<strong>und</strong> Verantwortlichkeiten festschreiben <strong>und</strong><br />
– im Kollegium an der Umsetzung der Ziele <strong>und</strong> Maßnahmen arbeiten.<br />
– Da <strong>Schul</strong>programme eine Orientierungshilfe für das pädagogische Handeln darstellen,<br />
sind sie letztlich auch der Maßstab, an dem die Entwicklung der Einzelschule durch<br />
<strong>Evaluation</strong> zu messen ist,<br />
– was wiederum zu einer Reflexion der Ergebnisse führen soll.<br />
<strong>Schul</strong>programm<br />
Ziele <strong>und</strong> Vorhaben<br />
Zyklus der <strong>Schul</strong>entwicklung<br />
Umsetzung<br />
konkreter<br />
Maßnahmen<br />
Qualitätsdiskussion<br />
Reflexion<br />
der Ergebnisse<br />
Abschlusstagung KES, Dessau, 28.04.2004<br />
<strong>Evaluation</strong><br />
Bestandsaufnahme
Dr. Margit Colditz Abschlusstagung KES<br />
Dieser „Zyklus der Qualitätsentwicklung“ 3 bildete auch die Gr<strong>und</strong>lage für unser Vorgehen im<br />
Modellversuch KES in drei Arbeitsphasen:<br />
Beginnend mit 1999<br />
– waren bis 2001 durch die KES-<strong>Schul</strong>en <strong>Schul</strong>programme zu entwickeln.<br />
– Die zweite Arbeitsphase erstreckte sich über zwei <strong>Schul</strong>jahre. Sie war ausgefüllt mit der<br />
Umsetzung der <strong>Schul</strong>programme. Parallel dazu musste aber bereits langfristig die interne<br />
sowie externe <strong>Evaluation</strong> vorbereitet <strong>und</strong> durchgeführt werden.<br />
– In der dritten Arbeitsphase erfolgte auf der Basis der <strong>Evaluation</strong>sergebnisse die <strong>Fortschreibung</strong><br />
der <strong>Schul</strong>programme.<br />
Arbeitsphasen in KES<br />
� Umsetzung der <strong>Schul</strong>programme<br />
� interne <strong>und</strong> externe <strong>Evaluation</strong><br />
� Transfer <strong>von</strong> Ergebnissen<br />
2. Phase (2001 - 2003)<br />
� Entwicklung <strong>von</strong> <strong>Schul</strong>programmen<br />
� Erfahrungsaustausch/Beratung<br />
1. Phase (1999 - 2001)<br />
� <strong>Fortschreibung</strong> der <strong>Schul</strong>programme<br />
� Transfer <strong>von</strong> Ergebnissen<br />
3. Phase (2003 - 2004)<br />
Abschlusstagung KES, Dessau, 28.04.2004<br />
Eingeschlossen darin war immer auch das Ziel des Transfers <strong>von</strong> Ergebnissen:<br />
o So sind im Arbeitsprozess zwei Handreichungen entstanden (2002 „Auf dem Weg zum<br />
<strong>Schul</strong>programm“ 4 <strong>und</strong> 2003 „Interne <strong>und</strong> externe <strong>Evaluation</strong> <strong>von</strong> <strong>Schul</strong>programmarbeit“ 5 ),<br />
3 Q. I. S. – Qualität in <strong>Schul</strong>e, BmuK, Wien 1999<br />
4 LANDESINSTITUT FÜR LEHRERFORTBILDUNG, LEHRERWEITERBILDUNG UND UNTERRICHTSFORSCHUNG VON<br />
SACHSEN-ANHALT (Hrsg.): Auf dem Weg zum <strong>Schul</strong>programm – Prozesse <strong>und</strong> Erfahrungen der<br />
Modellversuchsschulen <strong>von</strong> KES. Halle 2002.<br />
5 LANDESINSTITUT FÜR LEHRERFORTBILDUNG, LEHRERWEITERBILDUNG UND UNTERRICHTSFORSCHUNG VON<br />
SACHSEN-ANHALT (Hrsg.): Interne <strong>und</strong> externe <strong>Evaluation</strong> <strong>von</strong> <strong>Schul</strong>programmarbeit – Prozesse<br />
<strong>und</strong> Erfahrungen aus dem Modellversuch KES. Halle 2003.<br />
8
Dr. Margit Colditz Abschlusstagung KES<br />
diese Erfahrungsberichte wurden allen <strong>Schul</strong>en des Landes kostenfrei <strong>zur</strong> Verfügung gestellt:<br />
Die Nachfrage ist nach wie vor groß, die erstgenannte Handreichung ist bereits<br />
vergriffen; sie ist aber <strong>von</strong> der Website des Modellversuchs auf dem Landesbildungsserver<br />
unter www.kes.bildung-lsa.de herunterladbar.<br />
o Unsere Internetpräsentation, die professionell <strong>von</strong> unserem Projektkoordinator Herrn<br />
Biehl gepflegt wird, enthält darüber hinaus eine kommentierte Literaturliste <strong>und</strong> Links zu<br />
weiteren Websites mit Informationen <strong>und</strong> Anregungen <strong>zur</strong> <strong>Schul</strong>- <strong>und</strong> Unterrichtsentwicklung.<br />
o Transfer wurde aber auch durch Veröffentlichungen <strong>von</strong> KES-Akteuren im LISA-Jahrbuch<br />
<strong>und</strong> in Fachzeitschriften sowie durch die Gestaltung <strong>von</strong> zahlreichen landesweiten, regionalen<br />
<strong>und</strong> schulinternen Fortbildungsveranstaltungen erreicht.<br />
Wenn Sie sich nochmals die drei Arbeitsphasen <strong>von</strong> KES vor Augen führen, ist zu erkennen,<br />
dass wir bestrebt waren, den vorhin aufgezeigten Zyklus der Qualitätsentwicklung gemeinsam<br />
innerhalb <strong>von</strong> viereinhalb Jahren einmal zu durchlaufen. Sie werden sicher nachvollziehen<br />
können, dass dieses parallele Arbeiten nicht ganz problemlos abgelaufen sein wird.<br />
Denn: So wie <strong>Schul</strong>programmarbeit nicht „<strong>von</strong> oben“ verordnet werden kann, ist es auch<br />
wenig hilfreich, einen Arbeitsrhythmus streng vorzugeben, ohne die Bedingungen vor Ort zu<br />
berücksichtigen.<br />
Das Gymnasium Philanthropinum z. B. hat in der letzten Arbeitsphase sein <strong>Schul</strong>programm<br />
u. a. auch deshalb noch nicht fortgeschrieben, weil es im Sommer mit dem Fürst-Franz-<br />
Gymnasium Dessau fusionieren wird. Erst dann macht es Sinn, sich im Kollegium auf gemeinsame<br />
Entwicklungsschwerpunkte zu verständigen.<br />
Bei aller Heterogenität durchliefen alle am<br />
Nunmehr liegen an elf <strong>Schul</strong>en<br />
Modellversuch Beteiligten einen Arbeits- <strong>und</strong><br />
fortgeschriebene <strong>Schul</strong>programme<br />
Lernprozess, der <strong>von</strong> Aufbruch <strong>und</strong> Zielgerichtet-<br />
vor, mit denen auch nach KESheit,<br />
mitunter aber auch <strong>von</strong> Überlastung <strong>und</strong><br />
Abschluss gearbeitet werden wird.<br />
Resignation <strong>und</strong> dann wieder erneuter Motivation<br />
gekennzeichnet war.<br />
Nunmehr liegen an elf <strong>Schul</strong>en fortgeschriebene <strong>Schul</strong>programme vor, mit denen auch nach<br />
KES-Abschluss gearbeitet werden wird. Die <strong>Schul</strong>programme 2004 können seit einigen<br />
Tagen auf unserer Internetpräsentation eingesehen werden. An dieser Stelle wollen wir aber<br />
auch selbstkritisch sein: Nicht alle unsere <strong>Schul</strong>programme erfüllen bereits die eingangs genannten<br />
<strong>Kriterien</strong> für ein gutes <strong>Schul</strong>programm. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Insgesamt<br />
besagt aber unsere Erfahrung: Ein <strong>Schul</strong>programm kann nur so gut wie der <strong>Schul</strong>entwicklungsprozess<br />
sein, in dem es entstanden ist <strong>und</strong> in dem mit ihm gearbeitet wird.<br />
9
Dr. Margit Colditz Abschlusstagung KES<br />
Deshalb möchte ich abschließend noch auf Ergebnisse des Modellversuchs hinsichtlich<br />
<strong>Kriterien</strong> guter <strong>Schul</strong>programmarbeit eingehen.<br />
<strong>Kriterien</strong> für <strong>Schul</strong>programmarbeit<br />
� Einbeziehen des gesamten Kollegiums<br />
� Beteiligung <strong>von</strong> Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern sowie Eltern<br />
� fördernde <strong>und</strong> fordernde <strong>Schul</strong>leitung<br />
� Entwickeln <strong>von</strong> Kommunikations- <strong>und</strong> Kooperationsstrukturen<br />
� Arbeit einer Steuergruppe<br />
� Beschluss durch die Gesamtkonferenz<br />
� interne <strong>und</strong> externe <strong>Evaluation</strong><br />
Abschlusstagung KES, Dessau, 28.04.2004<br />
– <strong>Schul</strong>programmarbeit kann nur erfolgreich verlaufen, wenn es zum Anliegen des<br />
gesamten Kollegiums wird, wenn gemeinsame Ziele auch gemeinsam umgesetzt<br />
werden. Damit unterscheidet sie sich <strong>von</strong> Einzelaktivitäten, die mitunter nur <strong>von</strong> einer<br />
Facharbeitsgruppe verantwortet werden. Um z. B. Vorhaben zu bündeln <strong>und</strong> gemeinsam<br />
neue Entwicklungsschwerpunkte abzuleiten, haben sich SCHilF’s in Form <strong>von</strong> Zukunftswerkstätten<br />
zu Beginn eines <strong>Schul</strong>jahres bewährt. Näheres dazu in den AG 1, 5 <strong>und</strong> 8.<br />
– Darüber hinaus ist für <strong>Schul</strong>enwicklungsprozesse bedeutsam, nicht nur im Kollegium<br />
selbst Entwicklungsziele zu formulieren, sondern alle an <strong>Schul</strong>e Beteiligte einzubeziehen.<br />
Dazu gehören insbesondere die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler sowie deren Eltern. Ihre<br />
Sichtweisen, Erfahrungen, Erwartungen <strong>und</strong> auch Vorschläge unterscheiden sich z. T.<br />
<strong>von</strong> denen des Kollegiums <strong>und</strong> sind zu berücksichtigen, will man diesen Personenkreis<br />
<strong>zur</strong> Mitarbeit motivieren.<br />
Auf einzelne diesbezügliche Aktivitäten können wir in KES verweisen, so wurden z. B. mit<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern sowie Eltern Zukunftswerkstätten <strong>und</strong> Befragungen im<br />
Rahmen <strong>von</strong> Bestandsanalysen <strong>und</strong> <strong>Evaluation</strong>en durchgeführt. Jedoch sind hier noch<br />
nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Unter Leitung <strong>von</strong> Herrn Prof. Wenzel der Martin-<br />
Luther-Universität Halle-Wittenberg wird im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung<br />
10
Dr. Margit Colditz Abschlusstagung KES<br />
–<br />
unseres Modellversuchs die Schüler- <strong>und</strong> Elternpartizipation in <strong>Schul</strong>entwicklungsprozessen<br />
untersucht. Ich verweise hier auch auf die AG 7 <strong>und</strong> eine im Herbst dieses<br />
Jahres zu dieser Thematik erscheinende Handreichung.<br />
Wenn man allein die Vielfalt der Beteiligten betrachtet, wird deutlich, dass der <strong>Schul</strong>leitung<br />
eine besondere Bedeutung zukommt. Ihre Rolle kann nicht oft genug als eine<br />
wesentliche Gelingensbedingung für <strong>Schul</strong>programmarbeit thematisiert werden. Die<br />
Palette des Rollenverständnisses ist aber gegenwärtig noch sehr breit gefächert. Um es<br />
überspitzt zu sagen, reicht sie <strong>von</strong> Skepsis oder gar Ablehnung bis hin zu Überregulierung.<br />
<strong>Schul</strong>programmarbeit verlang aber einen „goldenen Mittelweg“, bei dem eine<br />
fördernde <strong>und</strong> fordernde <strong>Schul</strong>leitung Konsens bei den Beteiligten über eine Entwicklungsperspektive<br />
zu erreichen sucht. Ich verweise an dieser Stelle auf die Tätigkeit in der<br />
AG 2 „Rolle <strong>und</strong> Aufgaben der <strong>Schul</strong>leitung“, die heute besonderen Zuspruch findet.<br />
– Wenn es gelingen soll, dass alle an <strong>Schul</strong>e Beteiligte ein <strong>Schul</strong>programm entwickeln, mit<br />
ihm arbeiten, es evaluieren <strong>und</strong> fortschreiben, sind gut funktionierende Kommunikations<strong>und</strong><br />
Kooperationsstrukturen eine wesentliche Voraussetzung. Die <strong>Schul</strong>programmarbeit<br />
an der Gr<strong>und</strong>schule Gneisenauring in Magdeburg konnte zum Beispiel nach ihrer Fusion<br />
mit der Gr<strong>und</strong>schule Nordwest im Sommer 2003 nur deshalb erfolgreich fortgesetzt<br />
werden, weil durch das große Engagement der KES-Steuergruppe, in der auch die<br />
<strong>Schul</strong>leiterin maßgeblich mitarbeitet, gelang, in Wenn es gelingen soll, dass<br />
neuen Strukturen gemeinsame Ziele zu vereinbaren alle an <strong>Schul</strong>e Beteiligte ein<br />
<strong>und</strong> an ihrer Umsetzung zu arbeiten.<br />
<strong>Schul</strong>programm entwickeln, mit<br />
– Eben fiel der Begriff Steuergruppe. An jeder <strong>Schul</strong>e ihm arbeiten, es evaluieren<br />
sollte unbedingt eine solche eingerichtet werden. <strong>und</strong> fortschreiben, sind gut<br />
Sie setzt sich aus Kolleginnen <strong>und</strong> Kollegen sowie funktionierende Kommunika-<br />
einem Mitglied der <strong>Schul</strong>leitung zusammen – tions- <strong>und</strong> Kooperationsstruk-<br />
denkbar ist auch die Mitarbeit eines Vertreters des turen eine wesentliche Voraus-<br />
Schüler- <strong>und</strong> Elternrates. Die Aufgabe einer setzung.<br />
–<br />
Steuergruppe besteht vor allem darin, <strong>Schul</strong>entwicklungsprozesse<br />
zu koordinieren, nicht aber das <strong>Schul</strong>programm allein zu schreiben.<br />
Näheres dazu in den AG 3 <strong>und</strong> AG 8.<br />
Wenn <strong>Schul</strong>programmarbeit zum Anliegen aller an <strong>Schul</strong>e Beteiligten werden soll, sind<br />
Beschlüsse der Gesamtkonferenz als formaler Akt bedeutsam. Sei es die Entscheidung,<br />
ein <strong>Schul</strong>programm zu entwickeln, ein erstelltes oder fortgeschriebenes in Kraft zu<br />
setzen – immer werden dabei Verbindlichkeiten hergestellt, zu denen man sich dann<br />
auch bekennen muss. Zudem kann das <strong>Schul</strong>programm nach der Beschlussfassung<br />
auch veröffentlicht werden <strong>und</strong> Einblick in Philosophie <strong>und</strong> Ziele der <strong>Schul</strong>e geben.<br />
11
Dr. Margit Colditz Abschlusstagung KES<br />
– Fester Bestandteil <strong>von</strong> erfolgreicher <strong>Schul</strong>programmarbeit ist auch die interne <strong>und</strong><br />
externe <strong>Evaluation</strong>, die ich abschließend besonders hervor heben möchte. Es war für uns<br />
alle eine neue Aufgabe, <strong>Evaluation</strong>skonzepte zu erstellen, mit unterschiedlichen<br />
Methoden <strong>und</strong> Instrumenten zu evaluieren, Eva-Berichte zu schreiben <strong>und</strong> Feedbackkonferenzen<br />
zu den Ergebnissen durchzuführen. In drei prozessbegleitenden Workshops<br />
bereiteten wir uns darauf vor.<br />
Von besonderem Interesse war das Verfolgen des eingangs genannten Ziels, die externe<br />
<strong>Evaluation</strong> durch die <strong>Schul</strong>aufsicht durchführen zu lassen. Unter der Leitung der AG<br />
<strong>Schul</strong>beratung arbeiteten Teams, die sich vor allem aus Referentinnen <strong>und</strong> Referenten<br />
der <strong>Schul</strong>ämter, aber auch aus weiteren Vertretern des öffentlichen Lebens zusammensetzten.<br />
Die meisten <strong>von</strong> ihnen sitzen heute unter uns. Ihnen kann bescheinigt werden,<br />
dass sie sich dieser Aufgabe gestellt haben, wodurch neue Wege schulaufsichtlichen<br />
Handelns beschritten werden konnten. Verweisen möchte ich hierzu auf die Arbeitsgruppen<br />
6, 9 <strong>und</strong> 10.<br />
Die eben aufgezeigten <strong>Kriterien</strong> für eine gelingende <strong>Schul</strong>programmarbeit erfüllen nicht den<br />
Anspruch auf Vollständigkeit <strong>und</strong> kommen auch erst in ihrem Zusammenwirken zum Tragen.<br />
Sie machen aber deutlich, <strong>und</strong> dabei fühlen wir uns durch die Ausführungen <strong>von</strong> Herrn Prof.<br />
Jürgens bestätigt, dass <strong>Schul</strong>programmarbeit<br />
– einerseits motivierte <strong>Schul</strong>en erfordert,<br />
– andererseits aber auch eines Unterstützungssystems bedarf.<br />
Uns ist bewusst, dass auch außerhalb <strong>von</strong> KES an vielen <strong>Schul</strong>en im Land bereits ähnlich<br />
gute Arbeit geleistet wird – <strong>und</strong> das nicht erst seit Inkraftsetzung des Erlasses <strong>zur</strong> <strong>Schul</strong>programmarbeit<br />
vom 14. Mai 2003. Diesen <strong>Schul</strong>en, aber auch denen, die bislang <strong>Schul</strong>entwicklung<br />
noch nicht so sehr in ihr Blickfeld gerückt haben, hoffen wir mit unserer heutigen<br />
Veranstaltung Anregungen <strong>und</strong> neue Impulse geben zu können.<br />
Ich möchte diesen Vormittagsteil nicht abschließen, ohne Dank zu sagen. Mein Dank gilt<br />
– den KES-<strong>Schul</strong>en,<br />
– der AG <strong>Schul</strong>beratung <strong>und</strong> den externen <strong>Evaluation</strong>steams<br />
– Herrn Prof. Wenzel mit seinen Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeitern,<br />
– Frau Dr. Bethke vom Kultusministerium als Mitglied der KES-Lenkungsgruppe,<br />
– den QuiSS-Mitstreiterinnen <strong>und</strong> -mitstreitern der anderen B<strong>und</strong>esländer,<br />
– den Referenten des heutigen Tages,<br />
– dem gastgebenden Philanthropinum,<br />
– <strong>und</strong> natürlich auch Herrn Biehl <strong>und</strong> Frau Groh als Mitgliedern der Projektleitung für ihr<br />
Engagement im Modellversuch.<br />
12