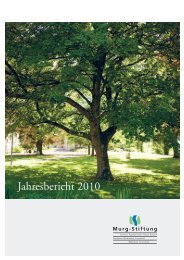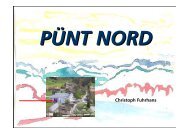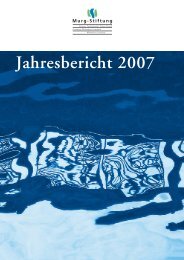Jahresbericht Murg-Stiftung 2006
Jahresbericht Murg-Stiftung 2006
Jahresbericht Murg-Stiftung 2006
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong>
<strong>Stiftung</strong>szweckZweck der <strong>Murg</strong>-<strong>Stiftung</strong> ist die Einrichtung und derBetrieb geeigneter Arbeitsstätten, um den psychisch Behinderteneine ihrer Individualität entsprechende Tätigkeitund Verdienstmöglichkeit zu bieten, sowie die Schaffungweiterer Einrichtungen wie Beratungsstellen, Wohnheimeusw. Ambulatorium und Beratungsstelle des Externen PsychiatrischenDienstes Sirnach sind der <strong>Murg</strong>-<strong>Stiftung</strong> angeschlossen.<strong>Stiftung</strong>sratDr. med. Markus Binswanger, LittenheidHumbert Entress, Präsident, AadorfMyrta Klarer, SirnachDr. med. Ulrich Paul Rotach, OberwangenHans Schwyn, Vizepräsident, Littenheid
<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong>Liebe Leserinnen und LeserDie Beiträge der Mitarbeiter undKlienten* des Wohnheims und derGeschützten Werkstätte der <strong>Murg</strong>-<strong>Stiftung</strong> befassen sich mit demThema der Förderung der Selbstständigkeitpsychisch Behindertermit dem Ziel eines möglichst selbstbestimmten Lebens.Dieser Weg ist schwierig, anspruchsvoll und verlangt vonallen Beteiligten viel Engagement und Durchhaltevermögen.Vor allem die Veränderungen in der Arbeitswelt mitder Automatisation von Routinearbeiten oder der Verlagerungvon Arbeitsplätzen ins Ausland erschwert den Betroffenendie Möglichkeit einer Reintegration in den normalenArbeitsmarkt, fehlen doch einfachere Arbeiten, welcheohne Zeitdruck ausgeführt werden können.Dank der Zusammenarbeit mit der «Virtuellen Werkstatt»,welche zentral für viele Geschützte WerkstättenArbeitsaufträge beschafft und dann zur Bearbeitung weiterleitet,war unsere Geschützte Werkstätte gut ausgelastet. ImVergleich zu früher hat die Zahl der Firmen, für die wirAufträge ausführen durften, deutlich zugenommen und fürdie Zukunft gewinnt der eingeschlagene Weg einer professionellengemeinsamen Arbeitsbeschaffung an Bedeutungfür die Sicherung eines geeigneten und ausreichendenArbeitsangebotes.Der Alltag im Wohnheim bietet mit seinen vielen hauswirtschaftlichenTätigkeiten ein gutes Übungsfeld zur Förderungder Eigeninitiative und Übernahme von mehr Verantwortungfür sich selbst und die Bewohnergruppe. Einehohe Hürde stellt jeweils der Schritt nach draussen, in eineexterne Wohngelegenheit, dar: Es braucht eine lange, sorgfältigeVorbereitung und schlussendlich viel Mut, um dasVertraute, Gewohnte zu verlassen und sich auf eine neueUmgebung und neue Bekanntschaften einzulassen. Umsoerfreulicher ist es, dass über die letzten Jahre betrachtetjeweils einem Drittel bis der Hälfte der Bewohner dieserSchritt gelingt.Im Externen Psychiatrischen Dienst in Sirnach stiegen<strong>2006</strong> die Anmeldungen und die Zahl der betreuten Patientenim ärztlichen Ambulatorium wie in der Beratungsstelle,wobei knapp ein Drittel der Patienten von sich aus denDienst aufsuchen. Eine deutliche Zunahme um 60 % stelltenwir bei den Anmeldungen durch die niedergelassenenÄrzte fest. Mit Beiträgen zu den Themen Depression,Burnout, Mobbing und Erläuterungen zur 5. IV-Revisionschildern die Mitarbeiter des Dienstes aktuelle Themen ausihrem Berufsalltag, welche auch in unserer Gesellschaftdiskutiert werden. Ein niederschwelliges sozialpsychiatrischesAngebot, wie es der EPD Sirnach für unsere Regiondarstellt, spürt sehr direkt und früh gesellschaftliche Veränderungenund muss immer wieder neu seine Angebote aufwechselnde Patientenbedürfnisse ausrichten.Im Namen des <strong>Stiftung</strong>srates danke ich den Verantwortlichenund den Mitarbeitern ganz herzlich für ihr Engagementund ihre Leistungsbereitschaft im vergangenen Jahrim Interesse unserer Klienten.Hans Schwyn, Vizepräsident1* Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wählen wir jeweils diemännliche Form, die weibliche Form ist immer mit einbezogen.
<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> des Wohnheims und derGeschützten WerkstätteUrs Zürcher, Gesamtleiter Wohnheim und Geschützte Werkstätte2 Was folgt nach einemAufenthalt im Wohnheimresp. in der GeschütztenWerkstätte?Seit über 10 Jahren beschäftigenwir uns intensiv mit Fragen, diesich auf den Aufenthalt unsererKlienten, dessen Qualität und Nutzen beziehen. Im Zugeverschiedener Diskussionen im Hause, aber auch in denFachzeitschriften haben wir uns in letzter Zeit nun vermehrtauch mit der Phase vor und insbesondere nach demAufenthalt in unserem Wohnheim und in der GeschütztenWerkstätte auseinandergesetzt.Es ist uns ein Anliegen, dass die Klienten möglichst denWohn- und Arbeitsplatz haben, der es ihnen erlaubt, sichhin zu einer möglichst hohen Selbständigkeit weiterzuentwickeln.Die Mehrheit unserer Klienten wünscht sich oftauch mehr Autonomie und mehr Eigenständigkeit.Alles zu seiner ZeitEs bestehen jedoch immer wieder viele Grenzen, die dieseFörderung ver- oder behindern. In der frühen Phase desWohnheimaufenthalts sind es meist die Institution selber,die Behörden oder andere mit der Aufsicht des Klientenbetrauten Personen, die aufgrund der bestehenden Situationmeist zu Recht auf den schutzgebenden Rahmen desWohnheims und der Geschützten Werkstätte nicht verzichtenmöchten. In diesem Abschnitt braucht der Klient diepädagogisch/psychiatrische Betreuung des Wohnheim- undWerkstättepersonals. In vielen Fällen würde aber nach einergewissen Zeit (dies ist individuell) eine Luftveränderunggut tun. Konkret heisst dies eine weniger intensiv betreuteund auch finanziell günstigere Wohnform oder/und einWechsel in eine Werkstatt mit erhöhten Anforderungenoder gar in einen geschützten Arbeitsplatz in der freienWirtschaft.Die Gründe, dass diese Schritte weniger oft getan werden,sind sehr unterschiedlich. Interessant dabei ist, dassder Klient selber seiner «Förderung» im Wege steht. Erfühlt sich wohl im Wohnheim und der Geschützten Werkstätte.Er kennt in der Zwischenzeit seine Betreuer wie auchdie Kultur der Institution. Dies gibt ihm eine Sicherheit,die er nicht aufs Spiel setzen möchte. Auch Behörden, Vormünderetc. sind oft zurückhaltend, wenn es um die Fragegeht, die Situation, die sich sehr bewährt hat, die demKlienten endlich etwas Boden unter den Füssen gegebenhat, zu verändern. Ein bedeutender Hinderungsgrund fürdie Veränderung ist das Nichtbestehen entsprechenderAngebote resp. das Angebot besteht, es hat aber keinenfreien Platz. Dies trifft in ausgeprägtem Masse auf dieArbeitssituation zu, welche den Klienten bei den weiterenSchritten in die Selbständigkeit kaum Möglichkeiten bietet.Beiträge zum ThemaDie folgenden Beiträge der Mitarbeiter des Wohnheimsund der Werkstätten wie auch die Interviews mit denBewohnern des Wohnheims sollen die Chancen undSchwierigkeiten bezüglich der Förderung und Weiterentwicklungder Selbständigkeit im Detail beleuchten.Unsere Aufgabe wird es sein, zukünftig unsere Aufmerksamkeitverstärkt auf Möglichkeiten zu richten, die denKlienten (Lebens-)Schritte nach dem Wohnheim in dierichtige Richtung und zum richtigen Zeitpunkt erlauben.Gemeinsam mit den Angehörigen, Fürsorgern, Vormündernund anderen Menschen, die unsere Klienten auf ihremWeg begleiten, dafür zu sorgen, dass Schnittstellen zu Brückenund zu begehbaren Übergängen werden. Alle Beteiligtenmüssen verstärkt zusammenarbeiten und den KlientenMut machen, im richtigen Moment den Schritt aus demwohlbehüteten, vielleicht manchmal gar überbehütetenMilieu des Wohnheims und/oder der Geschützten Werkstättezu machen.
<strong>2006</strong> – das JubiläumsjahrDas Jahr <strong>2006</strong> war geprägt durch kleine Festivitäten ausAnlass des 10-jährigen Jubiläums von Wohnheim undWerkstätte. Am 1. Juli <strong>2006</strong> durften wir eine grosse Anzahlvon Angehörigen, Besuchern und Mitgliedern des <strong>Stiftung</strong>sratszu einem Apéro und Nachtessen begrüssen. Beidieser Gelegenheit konnten wir auch das extra aus Anlassdes Jubiläums vom Künstler Simeun Moravac zusammenmit Klienten geschaffene Kunstwerk vor demHaus Erle einweihen. Das Jubiläum gab auchGelegenheit, uns der regionalen Presse wiedereinmal in Erinnerung zu rufen. Die vonden Journalisten geschriebenen Beiträge mitFotos haben uns natürlich sehr gefreut –Echos darauf blieben auch nicht aus. Quasials Fachbeitrag aus Anlass des Jubiläums hattenwir die Ehre, die Mitglieder von INSOS-Ostschweiz zur Frühjahrstagung inLittenheid zu begrüssen. Der Fachbeitragvon Urs Gasser, Bereichsleiter Pflege und PädagogikJugendpsychiatrie der Klinik Littenheid, war ein Input zurBetreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.Abgeschlossen haben wir unser 10-jähriges Bestehen miteinem Tagesausflug auf den Säntis mit allen Klienten undMitarbeitern von Wohnheim und Geschützter Werkstätte,welcher nicht zuletzt dank der guten Laune aller Mitgereistenund dem wundschönen Wetter ein voller Erfolg war –ein guter Ausgangspunkt für die nächsten Jahre.Alle Beteiligten müssen verstärkt zusammenarbeitenund den Klienten Mut machen,im richtigen Moment den Schritt aus dem wohlbehüteten,vielleicht manchmal gar überbehütetenMilieu des Wohnheims und/oder derGeschützten Werkstätte zu machen.DankDanken möchte ich allen, die in irgendeiner Weise zumGelingen beigetragen haben. Oft sind es kleine Beiträge,die wir kaum zur Kenntnis nehmen können, die aber einwichtiges Puzzleteil zum Ganzen beisteuern. Selbst wennunsere Dankesliste noch so lang ist – wir wissen, dass wirnie allen danken können. Speziell danken möchte ich denKlienten, den Mitarbeitern, den Mitgliedern des <strong>Stiftung</strong>srates,den zuweisenden Stellen, den Lieferanten unsererWerkstätten, den Behörden, den Auditoren unseres Qualitätsmanagements,aber auch den Mitarbeitern der KlinikLittenheid, welche uns im Alltag mit ihren Supportleistungenunterstützen. Ihnen allen danken wir und sagen aberzugleich: Wir sind auch zukünftig auf Ihre Unterstützungangewiesen.3
<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> des Wohnheims und der Geschützten WerkstättenIntegration und Rehabilitation – ist dies in derheutigen Gesellschaft noch umsetzbar?Gabriella Capassi, Bereichsleiterin Wohnheim4 Integration– Wiederherstellung eines Ganzen– Wiederherstellung einer Einheit,Vervollständigung– Einbeziehung, Eingliederung inein grösseres Ganzes–Zustand, in dem sich etwasbefindet, nachdem es integriert worden ist– Berechnung eines IntegralsReintegration– Wiedereingliederung– Wiederherstellung (veraltet)Rehabilitation– Wiedereingliederung eines kranken, körperlich odergeistig Behinderten in das berufliche und gesellschaftlicheLeben– Der Rehabilitierung dienende Anstalt– Rehabilitativ, die Rehabilitation betreffend, ihr dienendWiedereingliederung– Wieder eingliedernGesellschaftliche Integration würde Lebensqualitätschaffen!Auch in unserer Institution zeigt sich, dass etwa ein Dritteldes Klientels heute schon in der Lage wäre, autonomer zuwohnen und zu arbeiten, dieses Potenzial aber nicht umsetzt,obwohl Klienten wie Betreuer mehr Autonomie wünschen.Sicher sind es auch die Betreuer, die unserem neu eingetretenenKlientel noch nicht mehr Autonomie zutrauenoder davon abraten.Wir haben nur noch wenige Klienten, die schon übereinige Jahre bei uns sind und keinen Schritt nach vornemachen wollen. Sie hätten das vorhandene Potenzial,haben aber Angst zu versagen, Angst vor Neuem und vorVeränderungen, aber auch davor, dass man ihnen zuwenigzutraut. Zudem mangelt es an integrationsgerichteten Konzeptenund Einrichtungen.Resignative ZufriedenheitWir verfügen über ein gut ausgebautes Versorgungsnetz mitWohnheim und Werkstätten für psychisch kranke Menschen,die früher in Kliniken (Langzeit) hospitalisiertwaren. Der Schritt aus diesen Einrichtungen hinaus inunsere Gesellschaft, vor allem in den beruflichen Alltag,gelingt eher selten.Ich bin überzeugt, dass es unseren Klienten heute zwarbesser geht als vor dem Wohnheimeintritt, dass aber beivielen kein Austritt absehbar ist, und sie mit längerer Aufenthaltsdauerim Wohnheim deutlich weniger Veränderungswilleund deutlich mehr Zufriedenheit zeigen alsKlienten mit kürzerer Aufenthaltsdauer. Das würde bedeuten,dass die Klienten nach mehreren Jahren in unserer Einrichtungfast wunschlos glücklich sind. Fühlen sie sich zuHause oder handelt es sich um eine Art resignative Zufriedenheit?Auf Grund der engen Zusammenarbeit, die wir durchunser QM aufgebaut haben, kann ich sagen, dass in unserenWohngruppen gut und engagiert mit unseren Klientengearbeitet wird. Das Problem liegt nicht im personellen,sondern im konzeptionellen Bereich. Anders als in der Pflegeund Medizin gibt es für die Rehabilitation keine gemeinsameFachsprache oder gemeinsame Prinzipien und Methoden.Die Rehabilitation kann nur wirksam sein, wenn rehabilitativesund psychiatrisches Wissen verbunden werden.Wie werden wir leben? Unsere Zukunft beginnt jetzt!
ArbeitWird uns die Arbeit ausgehen?Wie flexibel und mobil kann Arbeit werden?Entsteht ein neues Proletariat?Wenn man Luftschlösser gebaut hat, muss man seineArbeit daran nicht als vertan abschreiben; Luftschlössergehören in die Luft. Nun errichte man darunter dasFundament.Henry David Thoreau5Erfolgreich sein heisst, anders sein als die anderen.Woody AllenWohlstandIst immer mehr Konsum unser Schicksal?Geht die Schere zwischen Arm und Reichimmer weiter auseinander?Wird die Welt wohlhabender oder ärmer?Zuerst fühlen die Menschen das Notwendige, dann achtensie auf das Nützliche, darauf bedenken sie das Bequeme,weiter erfreuen sie sich am Gefälligen, später verdirbt sieder Luxus und zuletzt werden sie toll und vernichten ihrErbe.Giambattista Vico
<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> des Wohnheims und der Geschützten WerkstättenGemeinsam den Weg derWiedereingliederung gestaltenStefan Kaiser Aral, Wohngruppenleiter Sonnegg6 Das Thema Wiedereingliederungund Integration ist ein Schwerpunktunserer Arbeit. Es steht beiuns unter anderem im Leitbild,dass es ein Ziel ist, die Selbst- undEigenständigkeit zu fördern, dieKlienten schrittweise unter Einbezugihrer Individualität in die Arbeitswelt einzugliedern.Wer weiss eigentlich wie genau Bescheid?Beim Eintritt in unsere Institution ist es oft unklar, wo derKlient mit seiner Behinderung genau steht und wie erdamit umgehen kann. Kliniken, Stationen, Wohngruppen,Therapeuten, Ämter, Arbeitgeber und Angehörige beurteilenden Klienten nach unterschiedlichen Kriterien. DieZielsetzungen, aus denen Klienten kommen, richten sichnach den unterschiedlichsten Konzepten. Zusätzlich gehenbei einem Wechsel der Institution wichtige Teile derLebensgeschichte und Information verloren. Das Gleichewiederholt sich, wenn ein Klient bei uns wieder austritt.Die Zuständigkeit und Verantwortungder Institution endet beim Austritt. Wasbleibt, sind der Klient, Angehörige undeventuell die Vormundschaftsbehörden.Unseres Erachtens ist gerade dieZusammenarbeit über diese Schnittstellenhinweg sehr zentral für gute Erfolgschancen vonKlienten. Reden wir in diesen Übergangssituationen allevom Gleichen? Die Hürden, die der Klient in eine selbständigereSituation nehmen muss, sind gerade bei einemWechsel von Wohnen und Arbeiten hoch und brauchenbesondere Aufmerksamkeit und nicht einen besondersschwierigen Informationsfluss und eine besonders schwierigeOrganisation.Gibt es ein Instrument zur Erstellung undSicherheit der Prognose?In der interdisziplinären Zusammenarbeit übernehmen jenach betrieblichen und persönlichen Ressourcen verschiedenePersonen in der Betreuungskette zum Teil auch gleichzeitigAufgaben. Die Art und Methode der Kommunikationist sehr unterschiedlich. Es fehlen übergeordnete Standards.Auch die Zusammenarbeit mit Vormundschaftsbehördenist davon nicht ausgeschlossen. Nach unsererErfahrung bekommen gerade schon länger bevormundeteKlienten oft zuwenige Chancen für Schritte in die Selbständigkeit.In der Vergangenheit hatten diese oft schonMisserfolge bei Wiedereingliederungsschritten. Für Behördenist das Risiko, dass Kosten und Mehraufwand entstehen,oft grösser als die Erfolgschancen. Darüber hinauskann der Klient in der jeweiligen Institution nur soweitLernschritte und Erfahrungen machen, wie sie ihm durchdas Konzept geboten werden. Weitere Erfolg zur Selbständigkeitmuss der Klient am neuen Ort mit dem weiterenSchritt in die Selbständigkeit erfahren, um daraus wiederlernen zu können. Wer aber kann Sicherheit auf Erfolgebieten und wer beurteilt eine Prognose mit welchen Kriterien?Auch da fehlen übergreifende Instrumente.Arbeitgebern der freien Wirtschaft fehlt es anAnreizen finanzieller und praktischer Art, um sichpsychisch behinderten Personen anzunehmen.
Ist Arbeit etwas für gesunde Menschen?Integration bei der Arbeit ist eine besondere Herausforderung.Die Betreuung von Klienten mit einer psychischenBehinderung braucht gut abgestimmte Kommunikation,Verständnis und Wissen über die Art der Erkrankung undwie sie sich bei der betroffenen Person äussert. Die Hürdensind gerade hier sehr hoch bis unüberwindbar. Arbeitgeberndes 1. Arbeitsmarktes, also der freien Wirtschaft,fehlt es an Anreizen finanzieller und praktischer Art, umsich vor allem psychisch behinderten Personen anzunehmen.Wer sind verbindliche Ansprechpartner, wer entwickeltKonzepte? Aus einer umfassenden Erhebung derFachstelle für Psychiatrie BL, in der unter anderem 745KMU-Betriebe in Baselland befragt wurden, geht deutlichhervor, dass Personen mit einer psychischen Behinderungsehr geringe Chancen haben, eine Anstellung zu bekommen.Aussagen und Fragen zur gemeinsamen Gestaltung derWiedereingliederung:– Es braucht verbindlich Fall-, Job-Manager.– Übergeordnete Standards und andere Hilfsmittel zurBeurteilung eines Falles müssen entwickelt werden.– Kostenträger müssen Projekte initiieren und finanzieren.– Eine gemeinsame Sprache (Fachsprache) muss sich etablieren.– Datenschutzbestimmungen für Klienten müssen befriedigendgeregelt sein.– Wer übernimmt die Verantwortung für Vorstösse undEntwicklungen im Bereich Integration und Wiedereingliederung?– Wer betreibt mit welchen Mitteln Öffentlichkeitsarbeitbei Arbeitgebern, Behörden usw.?– Finanzielle Anreize für Arbeitgeber müssen geschaffenwerden.– Behinderten-Qualitätslabel für Arbeitgeber.– Es braucht politischen und gesellschaftlichen Willen, umder Ausgrenzung von Behinderten entgegenzutreten.Konträre Interessen und RessourcenDrei Aussagen aus «Ethische Grundsätze für Pflege» SRK1990:– Achtet und fördert die Autonomie des Klienten.– Unterstützt und verhilft dem Klienten zu Informationen,die es ihm ermöglichen, die Pflege und Behandlung zuverstehen und mitzuentscheiden.– Ist sich bewusst, dass der Klient in einem Abhängigkeitsverhältniszu ihr steht und missbraucht diese Tatsachenicht.Drei Aussagen zur Gesellschaft:– Spardruck bei Sozialleistungen.– Individualisierung und Erfolgsdruck verdrängen ethischeGrundwerte.– In Politik und Wirtschaft kämpfen die Parteien um unterschiedlicheSchwerpunkte und Prioritäten. Lösungswegefür den Sozialbereich sind meist nicht sehr attraktivund somit nicht in den vorderen Rängen der Dringlichkeit.7
<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> des Wohnheims und der Geschützten WerkstättenAuch die Nacht hat eine ZukunftRadmila Miljkovic, Nachtwache WohnheimCorinne Klopfer, Nachtwache Wohnheim8Bis heute gibt es keine plausible Erklärung zum Zweck desSchlafs, lediglich einige Hypothesen, die jedoch alle unbefriedigendsind. Zwei davon wollen wir hier kurz erwähnen:1. Die Regenerative Hypothese besagt, dass Schlafschlichtweg der Erholung der Organe dient. Dafürspricht, dass nach dem Schlaf viele Körperfunktionenbesser funktionieren als nach einer lange Wachphase.Doch auch im Schlaf sind nicht alle Körperfunktionenausgeschaltet: Schaltet jemand das Licht an, so meldendie Augen Helligkeit. Auch andere Organe haben ihreaktiven Phasen während der Nacht und am Tag.2. Die Psychische Hypothese bezieht sich auf die Tatsache,dass wir im Schlaf Erlebnisse der Wachphase verarbeiten.Der Schlaf hilft, neue Erfahrungen einzuordnenund positive wie negative Erfahrungen in Form vonTräumen zu verarbeiten. Psychologen schätzen, dass einMensch, der zu lange Zeit ohne ausreichenden Schlafist, für psychische Störungen anfälliger wird.Unser Beitrag zur Rehabilitation undIntegrationFür die meisten unserer Bewohner reicht schon das Wissenunserer Anwesenheit, damit sie sich sicher und entspannterfühlen. Andere, die mit Schlafproblemen, Ängsten etc. zutun haben oder in einer Krisensituation stecken, sind froh,eine kompetente Ansprechperson zu haben. SchlechteAngewohnheiten wie nächtlicher Heisshunger, Rauchen,übermässiger Kaffeekonsum etc. verschwinden leider nichtvon heute auf morgen. Es braucht immer wieder Gesprächeund Abmachungen. Im Zentrum unseres Tuns steht derMensch als Ganzes.Wir versuchen zusammen mit dem Klienten individuelleStrategien (Schlafrituale, Spaziergang, warmes Bad,Schlaftee) zu erarbeiten. Ziel ist es, Krisen in der Nachtohne fremde Hilfe zu überstehen. Zudem versuchen wirauch den Tagdienst zu unterstützen. Es ist uns wichtig, dassder Tag-Nacht-Rythmus eingehalten wird, damit am TagLeistungen zur Alltagsbewältigung erbracht werden können.Wir sorgen dafür, dass die Bewohner nachts nichtgestört werden und schlafen können.Jeder Klient hat Ressourcen – diese gilt es zu erschliessen,zu fördern und den Klienten damit aus einer Abhängigkeitzu einem möglichst selbständigen und selbstbestimmtenLeben zu führen. Förderung findet während24 Stunden statt!In unserer schnelllebigen Zeit sind immer mehr Menschengrossem Stress ausgesetzt. Die Folgen sind Schlafprobleme,Kopfschmerzen, Ängste, innere Unruhe, Panikattacken,Heisshunger etc.Alle diese Beschwerden kennen auch unsere Bewohnernur allzu gut. Sie sind zum Teil Begleiterscheinungen ihrerKrankheit. Um so wichtiger ist es für sie zu wissen, dass siein der Nacht nicht allein sind und auch nachts Lösungenfür ihre Probleme gesucht werden – immer mit dem Ziel zuvermehrter Eigenständigkeit.
«Mein Hauptziel ist es, selbständig zu wohnen»Interview von Carmen Lehnherr, Betreuerin, mitHerrn D. M., Wohngruppe ErleD. M., Jahrgang 1979, ist am 22. Januar 2004 in dieWohngruppe Erle eingetreten. Er war seit seinem 17.Lebensjahr in einer psychiatrischen Klinik hospitalisiert,zuletzt auf einer geschlossenen Abteilung.Herr M., Sie haben sich bereit erklärt, einige Fragen zubeantworten. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedankenund gleich mit einer Kernfrage beginnen. Wasbedeutet für Sie Integration?Für mich bedeutet dies eins: Funktionieren.Sie sind nun drei Jahre in der Wohngruppe Erle. WennSie so zurückblicken von damals bis heute, was könnenSie dazu sagen?Am Anfang war ich weniger leistungsfähig, ich hatte auchsehr viele Medikamente, ein schlechtes Körpergefühl.Wenn ich es mit heute vergleiche, funktioniere ich selbständiger,habe weniger Medikamente, habe mehr Körpergefühl.Ich habe mich nicht verändert, sondern die Situationhat sich verändert.nicht oder nur teilweise von der IV zu leben. Dabei wurdemir diese gar aufgedrängt, als ich das erste Mal in die Klinikkam.Wann fühlen Sie sich sicher?Wenn ich irgendwo wohnen kann, wenn ich ein eigenesZimmer habe, wie jetzt, wenn ich die Türe nachtsabschliessen kann, wenn ich akzeptiert werde und wenn ichAbstand nehmen kann.Was sind Ihre Ziele?Manchmal weiss ich nicht, was ich will. Wenn ich etwashabe, dann weiss ich, was ich habe. Wenn ich so nachdenke,dann möchte ich gerne in einer offenen Werkstatt arbeitenund selbständig in einer eigenen Wohnung leben.9Soweit ich mich erinnere, hat sich Ihre Einstellung zurArbeit von damals bis jetzt auch wesentlich verändert.Wie sehen Sie das?Das hat auch mit den Situationen zu tun. Ich habe hiermehr Eigenverantwortung gelernt, weil mir das wieder indie Hände gegeben wurde, Stück für Stück durch Abmachungenund Eigenerfahrung. Vorher bestand nur Kontrolle;je mehr ich Druck bekam, desto weniger funktionierteich. Auf meine Wünsche ist niemand eingegangen, meineMeinung hat nicht gezählt. Ich war zuerst gar nicht odernur beschränkt fähig, etwas zu tun. Darauf ist man hierauch eingegangen. Jetzt halte ich eine Halbtagesstruktur inder Werkstatt und finde teils Arbeiten auch gut. Ich gehegern ins Lager und mache gerne «Anzündhölzli» fürs Cheminée.Mein Hauptziel ist es, selbständig zu wohnen unddarum bleibe ich dran.Könnten Sie sich vorstellen, ohne Unterstützung vonder IV zu leben?Wenn ich soviel Eigenleistung erbringen könnte sicher.Doch ich weiss, dass es bei mir noch viel Zeit braucht, um
<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> des Wohnheims und der Geschützten Werkstätten«Ich wollte schon immer eine geschützteArbeitsstelle haben»Interview von Cornelia Sabitzki, Betreuerin, mit Herrn X.,Wohngruppe Sonnegg10Herr X. ist 44 Jahre alt und lebt seit 1996 in der WohngruppeSonnegg.Hr. X., Sie leben seit 10 Jahren in der Sonnegg, wohaben Sie vorher gelebt?Im Grossen und Ganzen bei meiner Mutter. Vor der Sonneggwar ich drei Jahre in der Klinik Littenheid.Haben Sie einmal daran gedacht, das Wohnheim Sonneggzu verlassen und woanders zu leben?Nein, ich habe selber nie daran gedacht. Vor einem Jahrmachte mein Vormund den Vorschlag, in ein Heim nachEinsiedeln zu gehen. Ich wollte mich aber nicht den Leutendort anpassen und hatte Zweifel, mit ihnen zusammenlebenzu können, ausserdem bin ich nun schon so lange hier.Welche Gründe gab es damals für den Eintritt in dieWohngruppe Sonnegg?Ich war arbeitslos und bekam keine Unterstützung vomSozialamt. Dann hatte ich kein Geld mehr, drehte krummeDinger, um wenigstens im Gefängnis unterzukommen. Ichwollte keinesfalls zu meiner Mutter zurück, aber die Polizeibrachte mich in die Klinik. Seit 1995 bekomme ich eineIV-Rente.Sie arbeiten ganztags in der Geschützten Werkstätte der<strong>Murg</strong>-<strong>Stiftung</strong>. Was genau ist Ihre Aufgabe dort?Ich wollte schon immer eine geschützte Arbeitsstelle haben,ich muss z. B. Kuverts leimen, Hölzer spalten oder Joghurtprodukteverpacken.Was gefällt Ihnen an der Geschützten Werkstätte ambesten?Die sitzende Tätigkeit, regelmässige Arbeitszeiten, Feierabendum 16 Uhr und dass man während der Arbeit Radiohören kann.Welcher Arbeit sind Sie davor nachgegangen und habenSie einen Beruf erlernt?In einer Schweinezucht im Kanton Schwyz war ich dreiMonate. Dann zwei Jahre in einer Betonfabrik, wo z. B.Treppen- und Fassadenelemente gegossen wurden. Auf demBau habe ich auch gearbeitet. Aber immer war ich derjenige,der einfach so gegangen ist, einmal weil es Verständigungsproblememit neuen Arbeitskollegen gab. Eigentlichwollte ich Spengler/Sanitär lernen, habe jedoch nach zehnMonaten abgebrochen, es war geistig zu schwer zu verstehen.Was sind für Sie persönlich Vor- bzw. Nachteile an einerWohngemeinschaft wie in der Sonnegg?Vorteile sind, dass man nicht allein ist, die Mahlzeitengemeinsam einnimmt, Mitbewohner im gleichen Alter hat,die Versorgung mit Medikamenten und die Arbeit in derGeschützten Werkstätte. Nachteile sind, dass man nur alle14 Tage Wochenendurlaub mit einer Übernachtung nehmenkann, aber das ist ja wegen der Gemeinschaft, damitdie Gruppe nicht auseinander fällt. Gruppenangebote nachder Arbeit sind nicht gut, hingegen Ämtlis wie Putzen oderKochen sind in Ordnung.Innerhalb der Wohngruppe gibt es regelmässige Freizeitangebote,welche die Klienten mitbestimmen. Anwelchen Aktivitäten nehmen Sie gerne teil?Beim Bowlen, Billard, Schwimmen und an Ausflügen wiez. B. auf den Säntis bin ich sehr gerne dabei.Haben Sie abgesehen von diesen Angeboten weitereInteressen oder Hobbys, denen Sie in der Sonneggnachgehen können?Spazieren gehen oder vor der Sonnegg rauchen, da im HausRauchverbot ist. Ausserdem lese ich die Zeitung und jassegern.Ihre Familienangehörigen wohnen im Kanton Schwyz,in welcher Form halten Sie Kontakt zu ihnen?Meine Mutter ruft mich alle 14 Tage an. Alle drei Wochenbesuche ich sie, mein Bruder ist auch dort. Ich gehe abernur für eine Nacht dorthin, da beide mir Dinge aus derVergangenheit nachtragen. Länger würde ich sowieso nichtzu Besuch bleiben wollen.
In der Wohngruppe Sonnegg leben 14 Menschen ineiner Art Wohngemeinschaft zusammen. War es in denvergangenen Jahren für Sie möglich, Bekanntschaften,vielleicht sogar Freundschaften, innerhalb dieser Gruppezu schliessen?Nein, ich kann keine engere Freundschaften schliessen.Flüchtige Bekanntschaften wären in Ordnung, engereBeziehungen könnten in Abhängigkeit ausarten, das willich nicht.11Welches sind Ihre persönlichen Wünsche für dieZukunft?Dass ich einigermassen harmonisch leben kann, keineKrankheiten wie z. B. Trägheit, Bettlägerigkeit oder Übergewichtbekomme und dass ich heiter und fröhlich seinkann.
<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> des Wohnheims und der Geschützten WerkstättenArbeitsfähigkeit und SozialisationThomas Volk, Leiter Geschützte Werkstätte12 Im Zentrum unserer Förderungsbemühungenstehen der Erhaltund die Verbesserung der Arbeitsfähigkeitunserer Klienten. Voneiner Grundarbeitsfähigkeit redenwir dann, wenn ein Klient einegewisse Konstanz im Arbeitsprozesserreicht, d. h. er kommt regelmässig und pünktlich.Ebenso ist die Qualität der geleisteten Arbeit auf einemgewissen Niveau, um die Qualitätsansprüche unserer Kundenzu erfüllen.In unserer Geschützten Werkstätte, wo bis zu 20 Leuteauf relativ engem Raum zusammenarbeiten, gehört eintragbares Sozialverhalten des Klienten ebenfalls zu denGrundarbeitsfähigkeiten. In unserer Werkstattordung habenwir dies folgendermassen formuliert: «Jeder/Jede in derWerkstatt ist bemüht, sich so zu verhalten (Wortwahl,Lautstärke, Gesprächsthemen, Gesprächsdauer etc.), dasser die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nichtstört und auf Dauer von der Arbeit ablenkt.»Fehlverhalten stört den WerkstattbetriebAb wann gegebenenfalls eine «Störung» vorliegt und welcheMassnahme zu treffen ist, definiert die Gruppenleitung inder Regel nach ihrem Ermessen. Dies erweistsich als eine nicht immer einfache Aufgabe.Dazu kommt, dass in den Pausenzeiten dieKlienten für sich sind und die während derArbeitszeit unterbundenen Konflikte dortdann zum Ausbruch kommen können. Kommenim Einzelfall noch Handgreiflichkeitenhinzu, wird die Situation für alle schnelluntragbar und die Angst und das Entsetzen aller über einensolchen Vorfall bringen den Werkstattbetrieb quasi zumErliegen. Restriktive Massnahmen, wie ein (schriftlicher)Verweis oder sogar die Kündigung helfen dann nur für denMoment.Die Suche nach den UrsachenSo machten wir uns bald einmal, zuerst im Team, auf dieSuche nach den Ursachen für das «Fehlverhalten» oder «diezum Teil vorherrschende eher aggressive, provokativeGrundstimmung» einzelner Klienten. Dabei kamen wirzum Ergebnis, dass eigentlich zuerst einmal geklärt werdenmuss, was ein sogenannt «normales Verhalten bzw. einFehlverhalten» alles beinhaltet. Wir waren uns darüberschnell einmal einig, was alles («welches Verhalten») gegebensein muss, damit wir das Arbeitsklima bezüglich derZusammenarbeit als angenehm empfinden. Wie verhältsich das aber bei unseren Klienten?Von der Werkstattsitzung zum WorkshopDie Antwort auf diese Frage haben wir versucht, in einerWerkstattsitzung zusammenzutragen. Genauer gesagt,stellten wir den Klienten drei Fragen: «Welche Erwartungen,Wünsche und Befürchtungen habe ich an meineArbeitskollegen bezüglich des Umgangs mit mir?» Die Antwortenhierauf waren sehr vielfältig und keineswegs ungewöhnlich.So war z. B. viel die Rede von Rücksicht, Verständnis,Respekt, Korrektheit und Fairness auf derWunsch- und Erwartungsseite und von Streit, Unhöflichkeit,Gemeinheit und Gewalt auf der Befürchtungsseite.Ziel ist es nun, auf der Grundlage dieser Äusserungen inweiteren Workshops gemeinsam Mittel und Wege zu finden,wie wir in der Werkstätte die Wünsche nach einemfriedlichen, entspannten Arbeitsklima erfüllen können. IchIn unserer Geschützten Werkstätte, wo bis zu20 Leute auf relativ engem Raum zusammenarbeiten,gehört ein tragbares Sozialverhaltendes Klienten zu den Grundarbeitsfähigkeiten.möchte das Ergebnis sicher nicht an dieser Stelle vorwegnehmen,doch haben wir viel erreicht, wenn wir die vorherzitierte Werkstattordnung mit folgendem, wenn auch nurähnlich lautenden Satz ergänzen können: «Unsere Stärke istvielmehr, dass wir ein Team sind und uns gegenseitig unterstützenbei der Arbeit, um für unsere Kunden die besteQualität zu gewährleisten.»
Statistik Wohnheim und GeschützteWerkstätten13Klientinnen und Klienten im Wohnheim per 31.12.<strong>2006</strong>Alter Männer Frauen Total15–19 0 1 120–24 3 3 625–29 7 3 1030–34 1 0 135–39 2 2 440–44 3 0 345–49 1 0 150–54 2 1 355–59 1 0 160–64 0 0 0Total 20 10 30Nach Kantonen am 31.12.<strong>2006</strong>KlientenGlarus 2Schwyz 13St.Gallen 2Thurgau 6Uri 1Zürich 2Zug 3Luzern 1Total 30Belegung im WohnheimTage2002 9’4392003 8’9282004 9’4152005 9’846<strong>2006</strong> 10’136Mutationen Klienten Wohnheim <strong>2006</strong>EintritteAustritteFrauen 3 5Männer 8 3Total 11 8Mutationen Klienten Geschützte Werkstätte <strong>2006</strong>EintritteAustritteFrauen 5 1Männer 11 7Total 16 8Geleistete Arbeitsstunden in der Geschützten Werkstätte und den EinzelarbeitsplätzenPlätze Stunden <strong>2006</strong> Stunden 2005 Stunden 2004Total 30 33’973 34’242 31’867,25Aufträge von externen Unternehmen ermöglichen unsdie Aufrechterhaltung unserer Werkstätte und die Sicherstellungeiner Tagesstruktur für unsere Klienten. Wirdanken folgenden Firmen für ihre Aufträge:Baukaderschule, St. Gallen; Designdruck, Henau; Hauri AG,Bischofszell; Hunter Douglas, Wängi; IDonnect, Schaffhausen;Johnson Diversey, Münchwilen; Littenheid – Klinik fürPsychiatrie und Psychotherapie, Littenheid; Opdi Werk,Frauenfeld; Plasan AG, Zuzwil; Rosskopf Hans, Rickenbach;Schloss Herdern, Herdern; Sonderegger AG, Wil;Virtuelle Werkstatt Ostschweiz (VWO); Valida, St. Gallen;Dreischiibe, Herisau; Bildungsstätte Sommeri, Sommeri;Heimstätte Wil, Wil
<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2006</strong> desExternen Psychiatrischen Dienstes SirnachDr. med. Christine Nussbaumer, Leitende Ärztin14 Ein Teil unserer Patienten ist von derWeiterentwicklung der Invalidenversicherungder Schweiz direktbetroffen. Mit der 5. IV-Revisionsoll die stark defizitäre Invalidenversicherungfinanziell entlastet werden,einerseits durch eine rascheEingliederung von kranken Menschen, andererseits durcheinen erschwerten Zugang zur Rente. Ob die 5. IV-Revisionnun angenommen oder abgelehnt wird, die Frage bleibt: Waspassiert mit älteren, chronisch psychisch kranken Menschen,die arbeitslos sind, keine Rente zugesprochen bekommen undteilleistungsfähig sind? Eine Antwort sollte nicht nur auf derfinanziellen Ebene gesucht werden. Nein, es ist auch einegesellschaftliche Frage: Sollen diese Menschen (also ein Teilunserer Patienten) aus der Gesellschaft ausgegrenzt werdenund Sozialhilfe beziehen? Unser Sozialarbeiter Daniel Mollsetzt sich in seinem Artikel mit der 5. IV-Revision und densich daraus ergebendenFragenauseinander.Der Ausdruck«Mobbing» istin aller Munde,aber wissen wireigentlich, wasgenau Mobbingist? Gaby Krohn,unsere Sozialarbeiterin, beschreibt in ihrem Artikel die genaueDefinition, die Auswirkungen von Mobbing und was Betroffeneunternehmen können.Unsere Psychologin Katharina Allenspach stellt in ihremArtikel dar, dass es sinnvoll ist, sich genau zu überlegen, obman bei jeder psychischen Störung Medikamente einsetzensoll. Aus psychodynamischer Sicht verbergen sich manchmalhinter diesen Krankheiten ungelöste, noch nicht bewussteKonflikte, die durch Medikamente noch mehr zugedeckt werden.Oder aus verhaltenstherapeutischer Sicht kann eine tiefergehende Heilung z. B. einer Phobie durch Medikamentewie Benzodiazepine verhindert werden.Sich einzugestehen, dass man nicht mehr leistungsfähig ist,ist für die meisten von uns schwer. Trotzdem sprechen z. B.Politiker offen darüber und in Inseraten werben Klinikeneifrig, solche Personen zu behandeln. Leistungsknicke könnenverschiedene Ursachen haben, am bekanntesten sind dasBurnout und die Depression, zwei Störungen, die manchmalsehr eng miteinander verknüpft sind. Claudia Willeke (Assistenzärztin)und Klaus Elbs (Oberarzt) setzen sich in ihrenArtikeln mit diesen Themen auseinander.Sich einzugestehen, dass man nicht mehrleistungsfähig ist, ist für die meisten von unsschwer. Trotzdem sprechen z. B. Politikeroffen darüber und werben Kliniken in Inseratenfür Behandlungen.
Statistik<strong>2006</strong> haben die Anmeldungen erneut zugenommen undzwar beim Ambulatorium um 10 % (von 247 auf 272) undbei der Beratungsstelle um 8 % (von 103 auf 111). Einerseitsnehmen wir mit Freude davon Kenntnis, dass unser EPDeinen solchen Zulauf hat, andererseits sind wir darauf angewiesen,dass wir Patienten nach Abklärungsphase und ersterKrisenintervention für längere Psychotherapien an niedergelassenePsychiater weiterweisen können, was in unsererRegion schwierig sein kann. Die Zunahme der Anmeldungenist sicher auch darauf zurückzuführen, dass die Angstsprechstundevon Herrn Klaus Elbs grossen Anklang gefundenhat. Die Steigerung der Anmeldezahl brachte demAmbulatorium auch eine Steigerung der Konsultationsanzahl(von 3226 auf 3549) und Konsultationsstunden (von2712 auf 2920). Hingegen nahmen die Konsultationsstundenbei der Beratungsstelle ab; offensichtlich bestand nurwenig Bedarf nach länger dauernden Betreuungen.Die Altersgruppe der 35- bis 54-Jährigen war im Ambulatoriumwie auch in der Beratungsstelle am meisten vertreten.Eine leichte Zunahme gegenüber 2005 gab es auch beiden über 64-Jährigen.Bezüglich der Diagnoseverteilung zeigten sich <strong>2006</strong> keinegrossen Änderungen, ausser einer deutlichen Erhöhungder neurotischen Störungen, was die bereits erwähnte Nachfragebei der Angstsprechstunde widerspiegelt. Auffällig istdie Geschlechterverteilung: Bei einer grossen Mehrheit derMänner wurde eine Abhängigkeit (67 %) oder eine Schizophrenie(81 %) diagnostiziert, währenddem bei den Frauenaffektive (69 %) und neurotische Störungen (60 %) häufigerdiagnostiziert wurden.Bei den Gutachten sind die IV-Aufträge erneut starkgesunken. Dies bereitete uns Sorgen, da unsere Assistenzärztefür die FMH-Ausbildung Gutachten verfassen müssen.Gespräche mit der IV-Stelle brachten diesbezüglich eineKlärung.Bei den Zuweisungen haben die niedergelassenen Ärzteviel mehr Patienten angemeldet als 2005. Ein Grund ist,dass immer mehr Patienten das Hausarztmodell benutzen.15
Fragen zum Umgang mit Psychopharmakalic. phil. Katharina Allenspach, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP16 Wann braucht es eigentlich Medikamenteund wann nicht? Wie langesollten sie genommen werden?Wann ist es besser, sie auch wiederabzusetzen? Wann schaden Medikamente?Warum, in welcher Hinsichtschaden sie? Wann schadet es, sienicht zu nehmen?Diese Fragen beschäftigen Behandelnde ebenso wiePatienten. Sie sind komplex und müssen in jedem Fall individuellentschieden werden. Manchmal fällt die Entscheidungleicht – oft aber muss man abwägen und man kann sichso oder so entscheiden.Klar ist es bei schweren psychischen Krankheiten wieSchizophrenien oder schweren Depressionen. Dort könnendie Einschränkungen so gravierend sein, dass eine medikamentöseBehandlung unbedingt indiziert ist. Zum Teil könnendie Betroffenen selbst kaum mehr beurteilen bzw. einsehen,dass sie dringend Medikamente nehmen sollten. Fachpersonenmüssen dann diese Entscheidung übernehmen undmanchmal hartnäckige Überzeugungsarbeit leisten. Auchnach der Genesung ist häufig eine kontinuierliche Medikamenteneinnahmezur Verhinderung erneuterschwerer Krankheitsepisoden notwendig.Aber wie ist es bei leichteren Depressionen, beiAnpassungsstörungen nach belastenden Lebensereignissenoder in belastenden Lebenssituationen?Wie ist es während sensibler Lebensphasen wieAdoleszenz, Geburt des ersten Kindes oder Krisenum die Lebensmitte? Wie ist es bei chronischenBefindlichkeitsstörungen, bei in der Persönlichkeit verankertenErlebnisweisen, wo sich Zustände von Leere, von depressivenEinbrüchen, von Stimmungsschwankungen abwechselnmit Zeiten relativen Wohlbefindens?Dort muss in erster Linie der Patient entscheiden, mussVor- und Nachteile einer Medikamenteneinnahme für sichabwägen. Den Behandelnden kommt die Rolle von beratendenExperten zu. Die Gewichtung von Argumenten für odergegen eine medikamentöse Behandlung hängt nicht (nur)von «harten Fakten» ab, sondern auch von Werten, Einstellungenund Vorstellungen über psychische Prozesse. Es stellensich Fragen wie: Wo liegen die Grenzen zwischen krankund gesund, zwischen tolerierbarem Leiden einerseits unduntolerierbarem psychischem Leiden andererseits? Wo wärees möglich und ausreichend, äussere Belastungen zu verändern?Wo wäre es in einer bestimmten Lebensphase oder imVerlauf einer Behandlung auch wichtig, durch depressiveGefühle hindurchzugehen? Ergäben sich daraus auch Chancen,Reifungsschritte vollziehen zu können, was letztlich zunachhaltigeren Verbesserungen führen kann. Wann ist es fürjunge Menschen in der Adoleszenz sinnvoll bzw. kontraindiziert,stimmungsausgleichende und stabilisierende Medikamenteeinzunehmen? Bis zu welchem Ausmass sind beispielsweiseStimmungsschwankungen und negative Gefühle notwendigeEntwicklungsmotoren und wann behindern sie dieEntwicklung?Manchmal lohnt sich die Anstrengung, Krisenzeiten auchohne medikamentösen Schutz und Ausgleich durchzustehen;manchmal ist es falsch, auf den beherzten Einsatz von Medikamentenzu verzichten, weil die Person zu lange gefangenbleibt in ihrem psychischen Leiden und sich die Krankheitchronifiziert.Wann ist welche Strategie besser? Gescheiter ist man oftim Nachhinein. Oder positiver formuliert: Oft muss manBis zu welchem Ausmass sind Stimmungsschwankungenund negative Gefühlenotwendige Entwicklungsmotoren und wannbehindern sie die Entwicklung?ausprobieren und die Betroffenen spüren dann rasch, wie dasMedikament bei ihnen wirkt, ob es ihnen gut tut oder nichtund wann sie es wagen können, wieder darauf zu verzichten.Allerdings frage ich mich, ob heute der Verzicht nicht tendenziellzu kurz kommt gegenüber einem zu bedenkenlosenEinsatz von Psychopharmaka. Behandlungsentscheidungenwerden ja nicht nur von individuellen Überlegungen beeinflusst,sondern sind vom gesellschaftlichen Kontext abhängig.Die Einstellung zum Aushalten von seelischem Schmerzhat sich wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten eher inRichtung geringerer Toleranz gewandelt. Hellhörig macht indiesem Zusammenhang, dass in den letzten Jahren der Kon-
sum von Antidepressiva in der Schweiz um 30 Prozent gestiegenist. Einerseits mag das daran liegen, dass neue Medikamenteimmer besser, das heisst nebenwirkungsärmer undgezielter wirken. Andrerseits kann es auch damit zusammenhängen,dass heute immer stärker rasches Funktionieren undvolle Leistung gefordert sind und auch der Druck wächst, beiverminderter Belastbarkeit rasch zu Medikamenten zu greifen,um wieder fit zu sein.Skepsis ist angebracht angesichts des wachsenden ökonomischenDrucks auf rasche und effiziente Behandlungen, seies seitens Kostenträger wie Taggeldversicherern oder Krankenkassen,sei es seitens Gesundheitspolitik, sei es seitensArbeitgeber. Diese Druckfaktoren gilt es kritisch zu reflektieren.Im Dienste langfristiger und nachhaltiger positiverEffekte auf die psychische Gesundheit scheint es mir wichtig,dass sich sowohl Behandelnde wie auch Patienten gemeinsamin relativer Unabhängigkeit für oder gegen den Einsatz vonMedikamenten entscheiden können.17
<strong>Jahresbericht</strong> des Externen Psychiatrischen Dienstes SirnachBurnoutDr. med. Claudia Willeke, Assistenzärztin18Burnout ist ein Begriff, der heutzutageimmer häufiger gebrauchtwird, nicht zuletzt auch in unserempsychiatrisch-psychotherapeutischenArbeitsfeld, der aber imeigentlichen Sinn (noch) keineeigene Diagnose darstellt. Aufgrundder einschneidenden Konsequenzen, die dieserZustand für den Betroffenen und sein privates sowie beruflichesUmfeld mit sich bringen kann, möchte ich im Folgendeneine Übersicht zu den Bereichen «Erkennen/Verstehen»und «Vorbeugen/Behandeln» geben.Zuerst eine kurze Begriffsdefinition:Unter Burnout (englisch: to burn out = ausbrennen) verstandman ursprünglich die negativen Folgen der beruflichenÜberbeanspruchung mit übermässiger Erschöpfung,innerer Distanziertheit und schliesslich Leistungsabfall.Inzwischen handelt es sich um ein äusserst komplexesBeschwerde- bzw. Leidensbild, das zwar immer mehrBetroffene belastet, aber nur zögerlich Eingang in Wissenschaftund Lehre und damit auch in Praxis und Beratungfindet (Zitat aus: Prof. Dr. V. Faust «Psychosoziale Gesundheit»).I. Erkennen/Verstehena) Äussere AuslöserfaktorenHierbei werden kontinuierlich neue Belastungsformendazugezählt, daher führe ich nur die derzeit häufigstgenannten auf: hohe Arbeitsbelastung, schlechte Arbeitsbedingungenund schlechtes Betriebsklima, Mobbing,Schichtarbeit, Termin-/Zeitnot, rasch wechselnde Arbeitsanforderung,kein Rückhalt durch den Vorgesetzten.b) Psychologische AspekteDie Bedeutung der oben genannten äusseren Belastungenlässt sich für den Betroffenen nur nach dessen subjektivenGrenzen gemäss seiner geistigen, seelischen, körperlichenund psychosozialen Fähigkeiten ermessen. Oft wirkt schondie Diskrepanz zwischen hohem persönlichem Einsatz unddem «grauen Arbeitsalltag» ernüchternd. Die erwartetenErfolge und die Anerkennung bleiben aus, was häufig nichtnur als Kränkung, sondern als persönliche Niederlageerlebt wird. Im Laufe der Zeit führt dies im Krankheitsfallzusammen mit äusseren Faktoren zu einer erheblichenBeeinträchtigung des Selbstwertgefühls mit Sinnleere,Kommunikationsstörungen, schliesslich auch depressivund ängstlich gefärbten Erschöpfungszuständen und vegetativenFunktionsstörungen (Herz-Kreislauf, Magen-Darm, Wirbelsäule-Beschwerden etc.). Selbstbehandlungsversuchemit Alkohol, Medikamenten oder Drogen verschlimmernnicht selten die Situation. Einen weiterenAspekt bilden ein überstarkes Streben nach Selbstbestätigungund das Gefühl, eigentlich nur über Leistung undAnpassung liebenswert und akzeptabel zu sein.In den oben aufgeführten Punkten werden sich zwar diemeisten Menschen in einer oft abgeschwächten Form zeitweisewieder erkennen, alarmierend werden sie jedoch erstdann, wenn sich die Mühsal des Alltags in ein Leidensbildverwandelt, das den Betroffenen Schritt für Schritt in eineselbstzerstörerische Krankheit hinabzieht.c) Phasen des Burnouts– Warnsymptome der Anfangsphase (Stimmungslabilität,verminderte Erholungsfähigkeit, Infektanfälligkeit,chronische Müdigkeit)– Reduziertes Engagement– Depressive und aggressive Reaktionen– Abbau von Leistungsfähigkeit, Motivation undKreativität– Psychosomatische Reaktionen (Herz-Kreislauf,Magen-Darm-Beschwerden)– Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, SuizidneigungHäufig scheuen die Betroffenen über lange Zeit das Inanspruchnehmenprofessioneller Hilfe («Burnout oder ähnlicheshaben nur Schwächlinge»), so dass als psychosozialeKonsequenzen familiäre und Partnerschaftsprobleme undsteigender Alkohol-, Nikotin- und Medikamentenkonsumauftreten können. Einige der schwerwiegendsten Krankheitsfolgenkonzentrieren sich jedoch auf den Arbeitsplatz:Desillusionierung, Versagen, wachsender Widerstand, täglichzur Arbeit zu gehen, sozialer Rückzug, wachsendeFehlzeiten, seelische Verhärtung und Sarkasmus/Zynismus.
Die genannten Symptome fallen auf den Betroffenenzurück und verstärken damit noch die eingeschlageneNegativspirale, welche dann in Verzweiflung, Perspektivelosigkeitund Suizidneigung münden kann. Daher stelltsich berechtigterweise die Frage nach Vorbeugung undTherapiemöglichkeiten.II. Vorbeugen/BehandelnZunächst ist es wichtig zu realisieren, dass das «Ausbrennen»jeden treffen kann.a) Als wichtige Präventionsfaktoren gelten:– Längerfristig das Einteilen des Einsatzes gemäss der eigenenFähigkeiten am Arbeitsfeld, was auch bedeutet, keineüberhöhten Ansprüche mehr an sich selber zu stellen.– Eine gesunde Lebensführung mit besonderer Beachtungder kleinen, ganz individuellen Unterstützungsmassnahmen.Zu diesen zählt vor allem ausreichend Schlaf. Eingenügendes Schlafquantum ist eine der wichtigstenMassnahmen gegen psycho-physischen Verschleiss imAllgemeinen und das Burnout-Syndrom im Speziellen.– Auch physikalische Behandlungsmassnahmen (je nachSchwachpunkt Schulter-Nacken-Massagen, medizinischeBäder etc.) können zur allgemeinen Kräftigung erfolgreichsein.– Regelmässige körperliche Aktivität im vernünftigen Mass(Spazierengehen, Fahrrad fahren, Schwimmen, Gartenarbeit,Joggen etc.).– Das Erlernen von Entspannungstechniken, dazu gehörenAutogenes Training, Yoga, Progressive Muskelrelaxationnach Jacobsen, bei welchen ein regelmässiges Trainierenunabdingbar ist.– Last but not least die Empfehlung, Hobbys wieder zuentdecken und ihnen nachzugehen sowie soziale Kontaktezu pflegen.b) Therapie des Burnout-SyndromDazu gibt es bis heute leider kaum gesichertes Wissen. Ameffektivsten ist wohl eine individuell angepasste Behandlung.Als erstes gilt es, die oben genannten Selbstbehandlungsmöglichkeiten(vgl. Präventivmassnahmen) zu nutzen.Psychotherapeutisch kommen häufig verhaltenstherapeutischorientierte Empfehlungen zum Einsatz, welche dieUmverteilung der Energien vom Aufgaben- auf den Freizeitbereich,die Optimierung der individuellen Zeitplanung,das Anwenden von Entspannungsverfahren und dasErarbeiten der einer Störung zugrunde liegenden Belastungsfaktorenumfassen. Gegen eine Rückfallgefahr wirdeine individuelle Checkliste mit den Warnsymptomen undentsprechenden Verhaltensstrategien erstellt. Das Therapiezielist die überdauernde Veränderung der Lebensgewohnheitenund eine Verbesserung der Selbsteinschätzung.Pharmakotherapeutische Interventionen sind derzeit nochumstritten. Häufig werden zunächst pflanzliche Heilmittel(Johanniskraut, Baldrian, Hopfen, Kava-Kava) eingesetzt.Ansonsten bieten sich je nach Beschwerdebild und dessenAusprägung zeitlich begrenzt schlaffördernde und Beruhigungsmittel,Antidepressiva und niedrig potente Neuroleptikazur Behandlung an.Der vorliegende Artikel basiert im Wesentlichen auf denAngaben des oben zitierten Prof. Dr. Volker Faust, welchenich abschliessend noch zum eingehenderen Studium alsLiteraturhinweis anfügen möchte:V. Faust: «Seelische Störungen heute». CH. Beck, München,1999.19Diese Aufzählung wird beim Durchlesen zwar niemandenüberraschen, die genannten Punkte jedoch wirklich ernstzu nehmen und in die eigene Lebensführung zu integrieren,erfordert einiges an Einsatz und Durchhaltewillen,bringt vielen Menschen aber nicht nur eine gute Burnout-Prophylaxe, sondern auch mehr Vitalität und Lebensfreudeein.
<strong>Jahresbericht</strong> des Externen Psychiatrischen Dienstes SirnachDepression – eine Volkskrankheit?Dr. med. Klaus Elbs, Oberarzt20Im folgenden Beitrag möchte ichauf das, neben den Angststörungenam häufigsten auftretende psychiatrischeKrankheitsbild, die Depression,eingehen und dabei aktuelleErklärungs- und Diagnosemodellesowie Behandlungsstrategien vorstellen.Aufgrund der unterschiedlichen Ein- respektiveAusschluss- sowie Diagnosekriterien und Erfassungsinstrumenteder veröffentlichten Studien zur Auftretenshäufigkeitvon Depressionen ist es schwierig, genaue Zahlen zuerheben. Im internationalen Vergleich liegen die Lebenszeitprävalenzratenfür eine depressive Episode zwischen ca.4,6 % bis über 9 % der Bevölkerung des jeweiligen Landes.Frauen sind etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer.Die Erkrankung tritt bei Verwandten ersten Grades 1,5- bis3-mal so häufig auf wie in der Allgemeinbevölkerung, dabeiprädisponieren chronische körperliche Erkrankungen undder Missbrauch psychotroper Substanzen für das Auftreteneiner Depression. Etwa die Hälfte der an einer Depressionerkrankten Menschen leidet gleichzeitig an einer weiterenpsychiatrischen Erkrankung wie einer Angststörung,Suchtmittelabhängigkeit oder einer Persönlichkeitsstörung.Eine depressive Episode kann in jedem Alter auftreten,der Häufigkeitsgipfel liegt jedoch in der zweiten Hälftedes zweiten Lebensjahrzehntes. Die depressiven Symptomekönnen sich über Tage bis Wochen entwickeln oder imRahmen einer schweren psychosozialen Belastungssituationabrupt auftreten. Dabei scheinen belastende Ereignissehäufiger einer ersten depressiven Episode voranzugehen,bei erneuten Episoden findet sich oft kein unmittelbarerAuslöser mehr. Möglicherweise führen die während derDepression nachweisbaren biologischen Veränderungenvon neuronalen Strukturen zu einer erhöhten Anfälligkeitfür weitere Störungsepisoden.Diagnose/DifferentialdiagnoseDer Begriff Depression ist im allgemeinen Sprachgebrauchunscharf und bedarf einer genaueren Definition. So wird erumgangssprachlich als Synonym für eine traurige Stimmungslageeingesetzt, im psychiatrischen Sinn kann sowohlein einzelnes Symptom (z. B. depressive Herabgestimmtheit),ein Syndrom (mehrere charakteristische Symptome)oder eine Krankheit gemeint sein. Als Stimmung oderEmotion stellt das depressive Erleben eine allen Menschengleichermassen bekannte, normale Erfahrung dar. DieUnterscheidung zwischen «normalem» und krankhaftemHerabgestimmtsein ist im Einzelfall nicht einfach, wobeieine depressive Verstimmung anhaltend ist und eine überdas von dem Betroffenen bisher erlebte Ausmass an Stimmungsschwankungenhinausgehende Veränderung darstellt,die in ausgeprägter Form nicht mehr mit «Willenskraft»zu beherrschen ist. Eine Depression hat Auswirkungenauf den Antrieb, auf biologische und kognitiveFunktionen im Körper. Moderne, operationalisierteDiagnosesysteme haben die ursprüngliche Einteilung vondepressiven Störungsbildern verlassen, nachdem sich imRahmen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse die vorherdiagnostisch verankerte Ursachenzuschreibung nicht bestätigenliess. Sowohl das weltweit eingesetzte internationaleKlassifikationssystem für psychische Krankheiten ICD-10wie auch das in den USA eingesetzte DSM IV beschränkensich auf die Beschreibung des Schweregrades einer Depressionund des Krankheitsverlaufes.Die möglichen Krankheitszeichen einer Depression umfassen(4):Mindestens zwei der folgenden Symptome (respektive dreider Symptome bei schwerer Depression):1. depressive Stimmung in einem für die Patienten deutlichenund ungewöhnlichen Ausmass, die meiste Zeitdes Tages, fast jeden Tag, im Wesentlichen unbeeinflusstvon äusseren Umständen und mindestens zwei Wochenanhaltend2. Freud- und Interessenverlust, auch an Aktivitäten, dienormalerweise angenehm waren3. verminderter Antrieb oder gesteigerte Ermüdbarkeit
Zusätzlich eines oder mehrere der folgenden Symptome:1. Verlust des Selbstvertrauens oder des Selbstwertgefühls2. unbegründete Selbstvorwürfe oder ausgeprägte, unangemesseneSchuldgefühle3. wiederkehrende Gedanken an den Tod oder an Suizid4. Klagen über oder Nachweis eines verminderten DenkoderKonzentrationsvermögens, Unschlüssigkeit oderUnentschlossenheit5. psychomotorische Agitiertheit oder Hemmung (subjektivoder objektiv)6. Schlafstörungen7. Appetitverlust oder gesteigerter Appetit mit entsprechenderGewichtsveränderungEinteilung der Ausprägungsgrade der Depression entsprechendden obgenannten Kriterien:– Leichte Depression: 2 der Symptome 1–3, Gesamtzahl 4– Mittelgradige Depression: 2 der Symptome 1–3, Gesamtzahlmindestens 6– Schwere Depression: 3 der Symptome 1–3, Gesamtzahlmindestens 8Nach Hell und Böker der Psychiatrischen UniversitätsklinikZürich (2) ist eine Depression eine biosoziale Grundstörung(beinhaltet eine Verlangsamung von mentalenAbläufen wie Denken, Erinnern und eine Verlangsamungvon Bewegungsabläufen) mit einer Beeinträchtigung derexekutiven (steuernden Hirn-) Funktionen, welche bei denBetroffenen gleichzeitig eine destruktive Grundhaltung imSinne einer negativen Selbstseinschätzung aktiviert.DepressionsformenEine depressive Störung kann sich individuell sehr unterschiedlichdarstellen. So gibt es Unterschiede in der Beeinträchtigungder Psychomotorik, der Schlafarchitektur, demAppetit, aber auch in der Selbstwahrnehmung und dennegativen Kognitionen bezogen auf die Umwelt und dassoziale Bezugssystem. Eine Depression wird von manchenMenschen als «innere Leere» und Abwesenheit von jeglichenEmotionen beschrieben, andere Patienten haben einrein körperbezogenes Krankheitskonzept und erleben«ihre» Depression vor allem als organbezogene Beschwerdenbei Fehlen einer schulmedizinisch nachweisbarenOrganpathologie.– Seit Kindheit bestehende oder zumindest langfristige(mind. 2 Jahre), leichtere depressive Verstimmung (Dysthymie,früher depressive Neurose genannt) ist klar voneiner depressiven Episode entsprechend den obgenanntenICD-10 Kriterien zu unterscheiden. Dabei kann einBetroffener mit einer Dysthymie zusätzlich eine depressiveEpisode entwickeln und erfüllt dann die Kriterieneiner «Double Depression», einer doppelten Depression.– Zusätzlich zu den obgenannten Diagnosekriterien (ICD-10) können bei schweren depressiven Zuständen psychotischeSymptome wie Wahngedanken und Halluzinationenauftreten. Man spricht dann von einer wahnhaftenDepression.– Es gibt unterschiedliche Verlaufsformen. Es kommeneinmalige depressive Episoden genauso vor wie rezidivierendeVerlaufsformen mit vollständiger/teilweiser Rückbildungder Symptome zwischen den Episoden.– Neben «unipolaren», also zwischen einem depressivenund normalpsychischen Zustand oszillierenden Verlauf,gibt es bei ca. 35 % der Erkrankten (1) «bipolare» oderauch manisch-depressive Krankheitsbilder. Die Betroffenenerleben neben den depressiven Phasen intermittierendmanische oder zumindest hypomanische Zustände,in denen sie eine gesteigerte Aktivität und ein gesteigertesSelbstwertgefühl entwickeln, das mit Grössenideeneinhergehen kann. In der Manie sind die Betroffenenleicht ablenkbar, haben ein gesteigertes Mitteilungsbedürfnisund ein geringes Schlafbedürfnis.– Frauen sind in Phasen hormoneller Umstellung wie z. B.vor der Periode, nach einer Schwangerschaft (vor allemWochenbett) oder in der Menopause in besonderemMasse gefährdet, depressive Zustände zu entwickeln.– Eine in der Häufigkeit zunehmende, neue Krankheitsentität,die bisher noch keinen Eingang in die Klassifikationssystemegefunden hat und deswegen noch unscharfdefiniert ist, kann als Sonderform der Depression verstandenwerden: das Burnout Syndrom. Dabei findensich die typischen depressiven Symptome vor allem imZusammenhang mit der Situation am Arbeitsplatz.21
<strong>Jahresbericht</strong> des Externen Psychiatrischen Dienstes Sirnach22 ErklärungsmodelleAus Sicht der aktuellen Depressionsforschung ist diedepressive Störung als «zirkulärer» Prozess zu verstehen, inwelchem biologische, psychologische und soziale Faktorenin unterschiedlicher Ausprägung aufeinander einwirkenund die jeweilige, hochindividuelle Symptomkonstellationhervorrufen. Einflussgrössen respektive triggernde Faktorenkönnen sein:– Frühkindliche Traumatisierungen (nicht kompensierterfrüher Elternverlust, chronische Spannungssituationen,unterdrückte Autonomiebestrebungen, Missbrauchserfahrungenu. a.) können zu einem negativen Selbstkonzeptführen, was mit einem erhöhten Risiko einhergeht,im späteren Leben auf Enttäuschungen und Verlustedepressiv zu reagieren (2).– Biological priming: Veränderung der Neurotransmitter-Rezeptorausstattung nach Virusinfektion (3) oder frühkindlicherHirnschaden nach Geburtskomplikation steigerndie Anfälligkeit für depressive Störungsbilder.– Genetische Dispositionen können zu überschiessendenReaktionen von neurohumeral gesteuerten, biologischenAktivierungsmustern (z. B. Fluchtreflex) führen. Diesführt über eine vermehrte Produktion von Stresshormonen(vor allem Cortisol) zu lang andauernden Erregungszuständen,welche die neuronalen Schaltkreise in einemandauernden «Stress- und Alarmzustand» halten.Dadurch werden einzelne Hirnregionen (u. a. die Amygdala,Teil des limbischen Systems) nachhaltig verändert.– Nach Ausbruch einer Depression entwickelt die Störungvor allem im unbehandelten Zustand eine biologischeEigendynamik.– Aktuelle Belastungssituationen wie Verlust der sozialenRolle, Trauer und Verlust, Arbeitslosigkeit, gehen einerersten depressiven Episode häufig voraus.– Dysbalance der Neurotransmitter respektive der entsprechendenRezeptoren in den Hirnregionen, die für dieEmotionsregulation verantwortlich gemacht werden(limbisches System). Es bleibt dabei unklar, in wie weitdie genannten Veränderungen ursächlich für die Entwicklungder Depression zu sehen sind oder ob sie dieEndstrecke eines «depressiogenen Prozesses» sind.– Die «gelernte Hilflosigkeit» entsteht, wenn ein Individuumeine von ihm für feindselig oder Angst erregendgehaltene Situation nicht kontrollieren kann, gleich welcheStrategien es anwendet. Der sich in dieser Situationentwickelnde depressive Zustand geht mit einer Zunahmevon Beta-Rezeptoren einher, der sich nach einerBehandlung mit Antidepressiva wieder zurückbildet (3).BehandlungsansätzeNach einer ausführlichen Abklärungsphase, in der einHauptaugenmerk auf möglicherweise vorhandener Suizidalitätliegt, wird das therapeutische Vorgehen in Abhängigkeitder genauen Diagnose und dem Gefährdungspotentialfestgelegt. Grundsätzlich ist es von grosser Wichtigkeit,dass sich der depressiv Erkrankte in seiner verändertenGefühls- und Gedankenwelt verstanden und angenommenfühlt. Nachdem Menschen in einer Depression häufigweniger «schwingungsfähig» sind, d. h. sie können sichemotional schlechter auf ihr jeweiliges Gegenüber einstellen,machen sie während ihrer Krankheit häufig die Erfahrung,dass sich Menschen von ihnen abwenden. Im Falledes behandelnden Therapeuten werden sie in ihremZustand akzeptiert, ohne mit Schuldgefühlen reagieren zumüssen. Ausführliche Informationen über Krankheitsentstehung,Behandlungsoptionen, Krankheitsverlauf undPrognose sollen dem Patienten Hoffnung vermitteln,schliesslich sind depressive Erkrankungen sehr gut behandelbarund eine vollständige Genesung realistisch (beiangemessener Behandlung sind bis zu 80 % der Patientennach vier bis acht Wochen symptomfrei (1)). FlankierendeMassnahmen beinhalten die temporäre Entlastung aus denindividuellen Verantwortlichkeiten (soweit möglich:Arbeitsplatz, Familie), wenn möglich unter Einbezug desArbeitgebers und der Angehörigen.Je schwerer ausgeprägt eine depressive Episode ist,desto mehr empfiehlt sich der Behandlungsversuch miteinem antidepressiven Medikament. Diese Medikamentengruppeumfasst die bereits Ende der 50er-Jahre eingeführtenTrizyklischen Antidepressiva, die eine hohe Wirksamkeitbesitzen und bei spezieller Indikation auch heutenoch eingesetzt werden. Aufgrund des günstigeren Nebenwirkungsprofilsliegt der Einsatz der neuen Generationvon Antidepressiva (SSRI = Serotoninwiederaufnahme-
hemmer, NASSa = Noradrenalin- und spezifischer Serotoninaufnahmehemmer,SNRI = Serotonin- und Noradrenalinwiederaufnahmehemmer,NARI = Noradrenalinwiederaufnahmehemmer,MAO-Hemmer = Monoaminooxidasehemmer)nahe. Grundsätzlich ist zu sagen, dass antidepressiveMedikamente keine Abhängigkeit erzeugen und in derRegel gut vertragen werden. Jeder Behandlungsversuchsollte bei akzeptabler Verträglichkeit mit genügend hohenDosen und ausreichender Dauer erfolgen und auch nachRückbildung der depressiven Symptome bis zu einerGesamteinnahmedauer von ca. sechs Monaten fortgesetztwerden. Bei wiederholten depressiven Episoden gibt es dieEmpfehlung der entsprechenden Fachgesellschaften, einelängerfristige antidepressive Prophylaxe durchzuführen.Natürlich müssen die Empfehlungen für den Einzelfallüberprüft werden. Ein Absetzungsversuch sollte wegenmöglicher Absetzungsphänomene über einen Zeitraum vonein bis zwei Wochen unter vorsichtiger Dosisreduktionerfolgen.Spezifische psychotherapeutische Verfahren setzen ander veränderten Wahrnehmung des depressiven Menschenan, der sich hilflos und ausgeliefert fühlt und der seine eigeneExistenz in Frage stellt. Aus kognitivverhaltenstherapeutischerSicht werden negative Denkschemata gemeinsamerkannt und einer bewussten Bearbeitung zugeführt. Dienegative Sicht des Selbst, der Umwelt und der Zukunftwird hinterfragt und individuelle Ressourcen (Kraftquellen)werden gestärkt.Aus psychodynamischer Sicht werden verinnerlichteBeziehungen, unbewusste Konflikte, überhöhte Selbstansprücheund Schuldgefühle unter Berücksichtigung vonÜbertragungs- und Gegenübertragungsphänomenen bearbeitet.Eine Spezialform der Depressionsbehandlung ist die alsKurztherapie konzipierte, interpersonelle Psychotherapienach Klerman (1), die einen Fokus innerhalb des depressivenErlebens wählt (Verlust sozialer Rollen, pathologischeTrauer, dysfunktionale Kommunikationsstile und interpersonelleKonflikte) und diese aufschlüsselt.Die Indikation für eine Psychotherapie wird in Abhängigkeitvon der Krankheitsausprägung, Introspektionsfähigkeitund Änderungsmotivation des Patienten gestellt. Beischweren Depressionen sollte eine psychotherapeutischeBehandlung nach Studienlage mit einem Antidepressivumkombiniert werden. Bei leichten bis mittelschwerenDepressionen ist eine alleinige psychotherapeutischeBehandlung denkbar.Weiterführende Informationen zum Thema Depression imInternet finden sie hier:– http://leitlinien.net/(aktuelle therapeutische Behandlungsrichtlinien)– http://www.depression.unizh.ch/therapieformen/thklinik/thkliniklow/klpraxis.html(Internetauftritt der Psychiatrischen UniversitätsklinikZürich)– http://www.nimh.nih.gov/healthinformation/depressionmenu.cfm(aktuelle Informationen zum Thema Depression aus denUSA)– http://moodgym.anu.edu.au/(australisches, interaktives kognitiv behavioralesTrainingsprogramm für depressiv erkrankte Menschen:gut gemacht und kostenlos)– http://de.wikipedia.org/wiki/Depression(gute Zusammenfassung des Krankheitsbildes)– http://www.kompetenznetz-depression.de/(gut verlinktes und aktuell gehaltenes Kompetenznetzum Thema Depression im deutschsprachigen Raum)Verwendete Literatur:1. E. Schramm (1998) «Interpersonelle Psychotherapie»,2. Auflage, Verlag Schattauer2. Internetauftritt von H. Böker und D. Hell mit demTitel «Integrative Therapie der Depression», PsychiatrischeUniversitätsklinik Zürich3. J. Aldenhoff (1997) «Überlegungen der Psychobiologieder Depression», Nervenarzt: Springer Verlag4. H. Dilling, W. Mombour, M. H. Schmid (1999)«Internationale Klassifikation psychischer Störungen»,3. Auflage, Verlag Hans-Huber23
<strong>Jahresbericht</strong> des Externen Psychiatrischen Dienstes SirnachÜberblick über Hintergründe und Zielsetzungender 5. IV-RevisionDaniel Moll, dipl. Sozialarbeiter FH24Seit geraumer Zeit ist in denMedien die vom Bund lancierte5. IV-Revision ein Dauerbrenner.Erst stelle ich mir die Frage, wasdie IV ist und auf welchem Hintergrundsie entstanden ist. Ergänzendmöchte ich an dieser Stellefesthalten, dass der untenstehende grobe Überblick auf derdem Referenten bekannten Literatur aufbaut und somitdiese Darstellungen widerspiegelt.Die Invalidenversicherung existiert seit dem 19. Juni1959. Ziel der Invalidenversicherung war, Menschen, welcheaufgrund lang andauernder oder dauerhafter Erkrankungkeinen Erwerb mehr erzielen können, wieder eineExistenz zu ermöglichen. Diese Zielsetzung ist heute nochdieselbe. Über die Jahrzehnte hat die Zahl der IV-Rentnerstark zugenommen. 1990 war der Anteil an der Gesamtbevölkerung2,8 %, bis zum Jahr 2004 ist der Anteil auf4,8 % gestiegen. Auch das Bild der Erkrankungen der Menschen,welche von der Invalidenversicherung anhängigsind, hat sich über die Jahrzehnte verändert. Markant beidieser Entwicklung ist, dass der Anteil von psychisch krankenMenschen stark zugenommen hat, was zu diversenpolitischen Debatten geführt hat.Aufgrund dieser Zunahme wurde erkennbar, dass dasgängige Modell der IV nicht mehr den aktuellen Gegebenheitenentspricht. Vo kurzem lag die daraus resultierende5. IV-Revision aufgrund des zustande gekommenen Volksreferendums,welches vorwiegend von Behindertenorganisationenlanciert wurde, dem Volk zur Abstimmung vor.Dies hat mich motiviert, die Zielsetzungen dieser Gesetzesrevisionetwas genauer zu durchleuchten.Durch die Zunahme der «IV-Fälle» hat bei der Invalidenversicherungeine Kostenexplosion stattgefunden.Daher wurden Massnahmen definiert, welche einenKostenabbau bei der Invalidenversicherung bezwecken sollen.Grundsätzlich soll die Zahl der Neuberentungen gesenktwerden. Bereits verankert ist im bestehenden IV-Gesetz derGrundsatz «Eingliederung vor Rente». Dieser Grundsatz sollnun durch verschiedene Massnahmen ausgebaut werden.Potenzielle IV-Fälle sollen daher früher erfasst werden können,was die IV «Früherfassung» nennt. Dadurch soll eineInvalidisierung dieser Personen verhindert werden können.Es sollen sämtliche Organe, welche von länger andauernderKrankheit betroffen sind (z. B. Versicherungen, Einrichtungender beruflichen Vorsorge, Sozialhilfe, Arbeitgeber,Ärzte etc.) in diese Früherfassung miteinbezogen werden.Gesetzlich soll geregelt werden, dass der Datenaustauschzwischen diesen Organen möglich wird. So sollen diese verschiedenenInstanzen bei Anzeichen von längerer Abwesenheitvom Arbeitsplatz eine Meldung bei der IV machenkönnen. Kritisch zu betrachten ist, dass gemäss der 5. IV-Revision diese fremden Instanzen eine Meldung bei der IVmachen können, auch gegen den Willen der betroffenenPersonen. Aufgrund dieser Meldung entscheidet diezuständige IV-Stelle, ob Frühinterventionen angezeigtsind.Ab dem Zeitpunkt der Meldung über die nun bei der IVversicherte Person existiert für diese eine Mitwirkungspflicht,was bedeutet, dass diese an jeder zumutbaren Massnahmeteilnehmen muss. Bei der Frühintervention wirdnun geprüft, welche Art von Massnahme zur Erhaltung desbestehenden Arbeitsplatzes oder zur Wiedereingliederunggeeignet sein könnte. Dabei prüft die IV folgende Möglichkeiten:– Anpassung des Arbeitsplatzes– Ausbildungskurse– Arbeitsvermittlung– sozialberufliche Rehabilitation– BeschäftigungsmassnahmenDiese Massnahmen gelten für die ersten sechs Monate abder Anmeldung, der sogenannten Interventionsphase.Während dieser Zeit hat die versicherte Person keinAnrecht auf Taggelder, die materielle Versorgung soll überTaggelder der Krankentaggeldversicherung oder Unfallversicherung,Arbeitgeber oder Fürsorge laufen.Sollte nach Ablauf der ersten sechs Monate eine Wiedereingliederungnicht erfolgreich gewesen sein, werden sogenannteIntegrationsmassnahmen, welche wiederum auf dieberufliche Eingliederung abzielen, geprüft. Diese weiterePhase dauert ein Jahr. Während dieser Zeit werden auch
Massnahmen beruflicher Art durchgeführt wie Berufsberatung,erstmalige berufliche Ausbildung, Umschulung,Arbeitsvermittlung und/oder Kapitalhilfe. Während einerMassnahme erhält die versicherte Person allenfalls Taggelder.Dabei wurde die bestehende Mindestgarantie derHöhe des Taggeldes aufgehoben. Dies bedeutet, dass für dieVersicherten nicht grundsätzlich ein Anspruch auf Taggelderexistiert. Beibehalten wurde der Anspruch auf Wartezeittaggelder,welche allerdings auf zwei Monate beschränktwerden.Ein Rentenanspruch existiert, wenn eine versicherte Personwährend eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruchdurchschnittlich zu mindestens 40 % arbeitsunfähig war.Der Rentenanspruch setzt frühestens sechs Monate nach derAnmeldung ein. Da es keine Nachzahlung von Leistungenmehr geben wird, müssen sich versicherte Personen spätestenssechs Monate nach Einsetzender Arbeitsunfähigkeit bei der IVanmelden, wenn sie ihren Rentenanspruchvollumfänglich wahrenwollen. Ein Rentenanspruch existiert,wenn die Erwerbsfähigkeitdurch zumutbare Eingliederungsmassnahmennicht wiederhergestelltwerden konnte. Der Grundsatz «Eingliederung vorRente» wird durch die 5. IV-Revision ersetzt durch «Eingliederungstatt Rente».Der Invaliditätsbegriff, welcher im «Allgemeinen Teil desSozialversicherungsrechts ATS» festgehalten ist, wirdmittels der 5. IV-Revision ebenfalls ersetzt. Er besteht nunaus folgenden drei Elementen:– Ein Gesundheitsschaden, der sich auf die Arbeitsfähigkeitauswirkt (medizinisches Element)– Eine bleibende oder längere Zeit dauernde Erwerbsunfähigkeit(wirtschaftliches Element)– Ein Kausalzusammenhang zwischen dem medizinischenund dem wirtschaftlichen ElementEs sind weitere Massnahmen geplant, welche zur Kostenreduktionbeitragen sollen. Nachfolgend werde ich über dieseeinen groben Überblick geben:– Bis anhin wurde bei Personen, welche vor dem 45. Altersjahrinvalid wurden, ein sogenannter Karrierezuschlageingerechnet. Dieser wird aufgehoben.– Bis anhin wurden durch die IV zur beruflichen Eingliederungsogenannte medizinische Massnahmen unternommen.Diese müssen neu von der Krankenversicherunggetragen werden.– Mit der 4. IV-Revision, welche seit Beginn des Jahres2004 Gültigkeit hat, wurden die Zusatzrenten für Ehegattenaufgehoben. Bestehende Zusatzrenten wurdenweiter bezahlt. Nun werden mit der 5. IV-Revision sämtlicheZusatzrenten aufgehoben.Das Bild der Erkrankungen der Menschen, welchevon der IV abhängig sind, hat sich verändert. Markantbei dieser Entwicklung ist, dass der Anteil vonpsychisch kranken Menschen stark zugenommen hat.Abschliessen möchte ich diesen Bericht mit ein paar persönlichenGedanken. Die IV ist ein System, das sich gegenwärtigdeutlich neuen Gegebenheiten anpassen muss. Einigeswurde bereits mit der Einführung der 4. IV-Revisiongetan. Die 5. IV-Revision beinhaltet ebenfalls gute Ansätze.Mit dem Grundsatz «Wiedereingliederung» wird primärdie Wirtschaft konfrontiert. Diese steht jedoch seit Jahrenunter immer grösserem Druck, welcher sich auf die Arbeitnehmendenniederschlägt. Es sind Leistung und Effizienzgefragt. Aus meiner Arbeitspraxis weiss ich, dass ein Verschwindenvon Nischenarbeitsplätzen feststellbar ist. Hatnun die Wirtschaft ein Interesse, invaliditätsgefährdeteoder bereits invalidisierte Menschen wieder einzubinden?Die 5. IV-Revision bietet der Wirtschaft weder Anreize,noch nimmt sie diese in die Pflicht, wieder vermehrt Menschenmit Einschränkung, Handicap oder Behinderung zuintegrieren. Für mich ist somit die Zielsetzung der Wiedereingliederung,welche mit der 5. IV-Revision vordergründigwird, fraglich.25
<strong>Jahresbericht</strong> des Externen Psychiatrischen Dienstes SirnachMobbingGaby Krohn, dipl. Sozialarbeiterin FH26Die menschliche Kommunikationist vielschichtig! Da werden schrägeBlicke geworfen, da wird jemandemder Rücken zugekehrt, dawird mit den Augen gestrahlt undvon den Lippen gelesen, da errötetjemand (aus Verlegenheit oder vielleichtaus Freude oder...?), da wird gejauchzt und gesungenoder ganz einfach mündlich etwas mitgeteilt, da werdenDaten und Bilder per E-Mail übermittelt, aber die Botschaftist unklar, da tönt die telefonische Antwort derKollegin ziemlich kurz angebunden usw. Kurz: Sprache,Mimik, Gestik, Körperhaltung, Ton und Lautstärke derStimme bestimmen das tägliche Miteinander.Kommunikation hat somit auch ihre Tücken, dennnicht immer werden die Botschaften so gedeutet, wie sieder Absender auch gemeint hat. Und damit beginnen oftdie Schwierigkeiten und Missverständnisse. Doch wannspricht man von Mobbing?Heutzutage ist Mobbing als Begriff in der Arbeitsweltbekannt und wird schnell einmal verwendet, um Situationenzu beschreiben, wo Personen nicht miteinander auskommen,die Kommunikation nicht funktioniert und esscheinbar keine Lösungen gibt. Andererseits existieren zuRecht Mobbing-Situationen, welche nicht oder viel zu spätals solche erkannt werden. In all diesen Situationen spieltdie Kommunikation die zentrale Rolle.Als erstes muss klar sein, was unter dem Begriff Mobbingzu verstehen ist: Mobbing leitet sich aus dem englischenVerb to mob ab und wird unteranderem übersetzt mit anpöbeln,schikanieren, bedrängen. Mobbingkann am Arbeitsplatz, in der Schule,in Vereinen usw. stattfinden. Fachleutedefinieren Mobbing als «negativeHandlungen und Verhaltensweisenvon Personen oder Gruppen, diegegen eine bestimmte Person oder Gruppe gerichtet sind,immer wieder, systematisch und absichtlich über einen längerenZeitraum hinweg vorkommen, von der betroffenenPerson als feindselig, demütigend oder verletzend erlebtwerden und mit denen die betroffene Person nicht aus eigenerKraft fertig wird». Kommen solche Mobbing-Handlungenmindestens einmal in der Woche und seit mindestenseinem halben Jahr vor, gilt eine Person oder Gruppe alsgemobbt.Da Mobbing in unterschiedlichen Formen daherkommt, unterscheidet man fünf Arten von Mobbing-Handlungen:– Angriffe auf die Möglichkeit, sich mitzuteilen: nicht ausredenlassen, unterbrechen, anschreien, Informationenvorenthalten oder falsche Informationen weitergeben,wie Luft behandeln.– Angriffe auf die sozialen Beziehungen: allgemeine Kontaktverweigerung,das Opfer wird nicht mehr gegrüsstoder angesprochen, Isolierung, Versetzung an einen abgelegenenArbeitsplatz.– Angriffe auf das soziale Ansehen: lächerlich machen,Gerüchte verbreiten, öffentliches Blossstellen, preisgebenvon vertraulichen Informationen, abschätzige Bemerkungenüber das Privatleben oder das Aussehen.– Angriffe auf die Qualität der Berufs- oder Lebenssituation:schikanöse oder erniedrigende Arbeitszuweisung,ungerechtfertigte Kritik an der Arbeitsweise und Leistung,Entziehen wichtiger Aufgaben.– Angriffe auf die Gesundheit: physische Bedrohung, Tätlichkeiten,Arrangieren von Unfällen, sexuelle Belästigung.Um einschätzen zu können, ob tatsächlich eine Mobbing-Situation vorliegt, bieten die Mobbing-BeratungsstelleWenn erst einmal ein Mobbingprozess am laufenist, sind die Betroffenen meist schon so weit gesundheitlichangeschlagen und eingeschüchtert, dass derKonflikt kaum mehr gütlich bereinigt werden kann.Zürich (www.mobbing-beratungsstelle.ch) und der BeobachterRatgeber «Mobbing – was tun?» je einen Fragebogenfür den Selbsttest an.Die von Mobbing betroffenen Personen leiden früheroder später unter gesundheitlichen Beeinträchtigungen:
Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen bishin zu Depressionen, Selbstmordgedanken und völligerArbeitslosigkeit. In der Folge werden oft Angehörige undFreunde vernachlässigt, sodass die Betroffenen zusätzlich ineine soziale Isolation geraten.Aus gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gründen istes unbedingt notwenig, dass sich Betroffene Hilfe holen,wenn sie die Situation nicht alleine klären können. Zudemraten Fachleute, nicht zu lange mit der Klärung zu wartenund Unstimmigkeiten möglichst schnell anzusprechen.Wenn erst einmal ein Mobbingprozess am laufen ist, sinddie Betroffenen meist schon so weit gesundheitlich angeschlagenund eingeschüchtert, dass der Konflikt kaummehr gütlich bereinigt werden kann. Hilfe von aussen könnenHausärzte, Psychologen oder Beratungsstellen bieten.Ein weiterer Weg ist, sich auf Recht und Gesetz zu berufen.Es besteht die Möglichkeit, entweder den Mobber selberoder, in der Arbeitswelt, den Arbeitgeber zu belangen.Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer gegenübergesetzliche Pflichten zu erfüllen, d. h. er hat unter anderemeine sogenannte Fürsorgepflicht, d. h. gemäss Art. 328 ORmuss er «die Persönlichkeit des Arbeitnehmers achten undschützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksichtnehmen und für die Wahrung der Sicherheit sorgen». Auchim Arbeitsgesetz ist Ähnliches verankert: Der Arbeitgebermuss «die erforderlichen Massnahmen zum Schutz derpersönlichen Integrität der Arbeitnehmer vorsehen» (Art.6 ArG, Art. 2 ArGV 3). Kurz zusammengefasst bedeutetdies, dass der Arbeitgeber weder selber mobben, noch diesdurch Dritte zulassen darf, sondern dies im Bedarfsfallvielmehr verhindern muss.Beträchtlich schwieriger ist es, gegen den Mobber vorzugehen,da mit ihm keine vertraglichen Beziehungenbestehen. Bestimmte Mobbing-Handlungen könnenjedoch strafrechtlich verfolgt werden, wenn es sich um übleNachrede gemäss Art. 173 des Schweizerischen Strafgesetzbuches(StGB), Verleumdung gemäss Art. 174 StGB, umBeschimpfung gemäss Art. 177 StGB, um Drohung gemässArt. 180 StGB, Nötigung gemäss Art. 181 StGB, um einfacheKörperverletzung gemäss Art. 123 StGB oder umsexuelle Belästigung gemäss Art. 187 bis 200 StGB handelt.Wenn es in erster Linie jedoch um den eigenen Rufgeht, ist eine Zivilklage wegen Verletzung der Persönlichkeitgemäss Art. 28ff. ZGB möglich. Ausserdem kann auchauf Schadenersatz oder Genugtuung geklagt werden, wenndie Vorraussetzungen gemäss Art. 41 OR erfüllt sind. Strafklagenwerden von Fachleuten nur in schwerwiegendenFällen empfohlen und wenn klare Beweise vorliegen, dendie Prozesse ziehen sich meistens hin und sind für dieBetroffenen zusätzlich belastend.In jedem Fall ist wichtig, Beweise zu sammeln, dennohne diese wird kaum etwas zu bewegen sein.Weitere nützliche Internet-Adressen sind: www.mobbingswiss.ch,www.mobbing-zentrale.ch, www.mobbinginfo.chLiteraturquelle: «Mobbing – was tun?» Aus der ReiheBeobachter Ratgeber27
<strong>Jahresbericht</strong> des Externen Psychiatrischen Dienstes SirnachJahresstatistik für Ambulatorium undBeratungsstelle28Betreute Patienten/Klienten 2005 <strong>2006</strong> Frauen MännerAmbulatorium 483 485 50,7% 49,3%Beratungsstelle 192 209 50,5% 49,5%Total EPD 675 694Erst- und Wiederanmeldungen 2005 <strong>2006</strong>Ambulatorium 247 272Beratungsstelle 103 111Zeitaufwand AmbulatoriumKonsultationen (Anzahl) 3’226 3’549Patientenbezogener Aufwand (Stunden) 2’712 2’920Zeitaufwand Beratungsstelle (Stunden)Sozialberatung und Betreuung von Klienten 1’707 1’606Kurzberatungen 18 5HausbesucheAmbulatorium 18 31Alter der Neu- und Wiedereintritte im Ambulatorium Männer Frauen TotalBis 17 7 (5%) 12 (10%) 19 (7%)18–24 18 (12%) 25 (20%) 43 (16%)25–34 27 (18%) 18 (15%) 45 (16%)35–44 42 (28%) 28 (23%) 70 (26%)45–54 36 (24%) 22 (18%) 58 (21%)55–64 8 (6%) 12 (10%) 20 (7%)65–74 2 (1%) 3 (2%) 5 (2%)75–84 5 (4%) 2 (1%) 7 (3%)85 und älter 3 (2%) 2 (1%) 5 (2%)Total 148 (100%) 124 (100%) 272 (100%)
29Alter der Neu- und Wiedereintritte auf der Beratungsstelle Männer Frauen TotalBis 17 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)18–24 5 (8%) 11 (22%) 16 (14%)25–34 11 (18%) 10 (20%) 21 (19%)35–44 21 (35%) 17 (33%) 38 (35%)45–54 19 (32%) 8 (15%) 27 (24%)55–64 4 (7%) 5 (10%) 9 (8%)65–74 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)75–84 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)Total 60 (100%) 51 (100%) 111 (100%)Diagnosen der Neu- und Wiedereintritte (ICD-10) <strong>2006</strong> Frauen Männerkeine Diagnose 27 41% 59%F0 = organische Störungen einschliesslich symptomatische 6 33% 67%psychische StörungenF1 = psychische und Verhaltensstörungen durch 16 19% 81%psychotrope SubstanzenF2 = Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen 21 24% 76%F3 = affektive Störungen 72 69% 31%F4 = neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen 94 60% 40%F5 = Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen 3 67% 33%und FaktorenF6 = Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen 18 72% 28%F7 = Intelligenzminderung 2 50% 50%F8 = Entwicklungsstörungen 0 0% 0%F9 = Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn 13 38% 62%in der Kindheit und Jugend
<strong>Jahresbericht</strong> des Externen Psychiatrischen Dienstes Sirnach30Gutachten 2005 <strong>2006</strong>Fahrtauglichkeitsabklärungen 7 5Militärgutachten 2 0Strafrechts- und Zivilrechtsgutachten 2 1Vormundschaftsgutachten 1 0IV-Gutachten 8 2Wohnkantone der Patienten/Klienten 2005 <strong>2006</strong> 2005 <strong>2006</strong>AmbulatoriumBeratungsstelleHinterthurgau 81,0% 78% 89,7% 90,6%Übriger Thurgau 2,3% 4,4% 0% 0,3%Kanton St. Gallen 8,5% 10,1% 8,6% 7,2%Andere 8,2% 7,5% 1,7% 1,9%Zuweiser der Neu- und Wiedereintritte 2005 <strong>2006</strong>Von sich aus 182 121Niedergelassene Ärzte 65 104PK Littenheid 18 33Amt/Behörden/Gericht 8 8PK Münsterlingen 2 5Andere Institutionen und Wohnheime 10 14Versicherungen 8 1KS Frauenfeld 0 2Andere PK/Spitäler 1 6Familienmitglieder/Drittpersonen 4 21Interne Anmeldung 52 65Unbekannt 0 3Total 350 383
31Spenden <strong>2006</strong>Im Jahr <strong>2006</strong> wurde die <strong>Murg</strong>-<strong>Stiftung</strong> von folgenden Personen,Behörden und Institutionen unterstützt:Altersheim Hof Haslach, Au; Bäni-Müller Albert, Münchwilen;Baumberger Jürg und Elo, Sirnach; Bolli-Griesser J.J. Dr.,Frauenfeld; Brunner und Schär Treuhand AG, Aadorf;Bürgergemeinde Baar, Baar; Eberle Nafag AG, Nafag Ecosan,Gossau; Evangelische Kirchenpflege, Sirnach; GeigenmüllerHans Dr. med., Busswil; Gemballa Gerhard, Lantsch;Götz-Morgenthaler Marianne und Ruedi, Wängi; GrossmannUlric, Schaffhausen; Häberli Thomas, Steckborn; Hagen Bürobedarf,Münchwilen; Härdi Ruth, Moosleerau; Hösli Jost Dr.und Zingg Christoph Dr., Wattwil; Huber Nelli, Wil; JägerPeter, Wil; JohnsonDiversey Eur.B.V., Münchwilen; KruckerEugen, Wilen; Leutenegger Urs, Zuzwil; Lundbeck (Schweiz)AG, Glattbrugg; Maurer Elsa, Otelfingen; Meyerhans Luzius,Wil; Müller Alfred, Romanshorn; Politische Gemeinde,Lommis; Prematic AG, Affeltrangen; Presern Ziga Dr. med.dent., Wil; Stocker Regula, Schaffhausen; Strüby Marie, Ibach;Zoller Benno, Henau.Den Spendern danken wir herzlich für ihre Unterstützung.
<strong>Murg</strong>-<strong>Stiftung</strong> Littenheid32Bilanz per 31.12.<strong>2006</strong>Betrag in Fr.AktivenFlüssige Mittel 901’080.74Forderungen aus Leistungen 292’503.10Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 1’276’033.47Total Aktiven 2’469’617.31PassivenKreditoren 28’563.05Darlehen 2’056’594.25Rückstellungen 256’798.23Passive Rechnungsabgrenzungsposten 2’500.00<strong>Stiftung</strong>skapital 20’000.00Freies <strong>Stiftung</strong>svermögen 65’343.65Gewinnvortrag 26’468.46Vorschlag 13’349.67Total Passiven 2’469’617.31Gewinn- und Verlustrechnung <strong>2006</strong>AufwandPersonalaufwand 2’670’323.25Warenaufwand 294’473.95Unterhalt, Reparaturen und Energie 12’284.95Anlagenutzung 558’391.80Zinsaufwand 46’008.20Verwaltungsaufwand 170’663.00Übriger Betriebsaufwand 54’243.55Total Aufwand 3’806’388.70ErtragKostgelder 1’216’320.00Medizinische Leistungen 720’168.52Zinsertrag 893.75übriger Betriebsertrag 48’362.86Erträge des Betriebes 1’985’745.13Beitrag Bundesamt für Sozialversicherung 1’489’578.32Übrige Beiträge 64’776.00Kanton Thurgau, Externer Psychiatrischer Dienst 280’000.00Verrechnung mit Defizit Externer Psychiatrischer Dienst 2003 –361.08Beiträge 1’833’993.24Total Ertrag 3’819’738.37RekapitulationTotal Aufwand 3’806’388.70Total Ertrag 3’819’738.37Vorschlag 13’349.67
So erreichen Sie uns:<strong>Murg</strong>-<strong>Stiftung</strong>CH-9573 LittenheidTelefon: 071 929 60 60, Fax: 071 929 60 30info@murg-stiftung.ch, www.murg-stiftung.chWohnheim/Geschützte Werkstätten LittenheidWohngruppe ErleGeschützte WerkstätteCH-9573 Littenheid CH-9573 LittenheidTelefon: 071 929 66 80 Telefon: 071 929 66 75erle@murg-stiftung.ch gewe@murg-stiftung.chWohngruppe SonneggCH-9573 LittenheidTelefon: 071 929 66 90sonnegg@murg-stiftung.chExterner Psychiatrischer DienstAmbulatorium und BeratungsstelleCH-8370 SirnachTelefon: 071 969 55 10, Fax: 071 969 55 11epd@murg-stiftung.ch