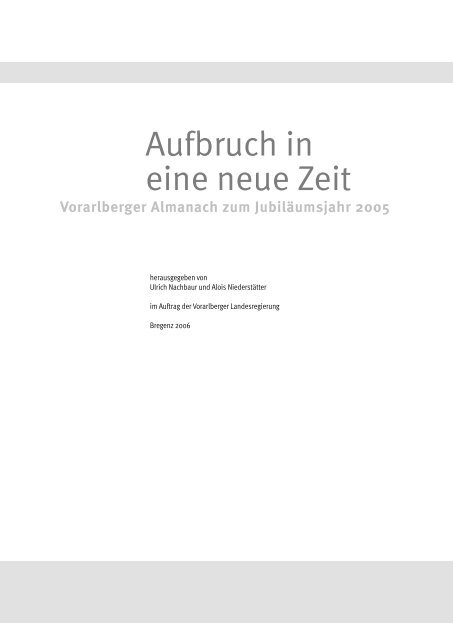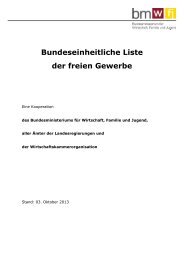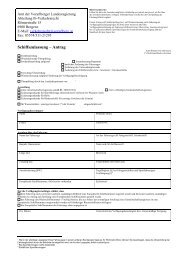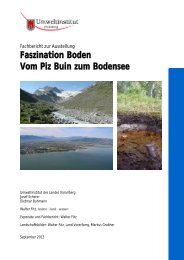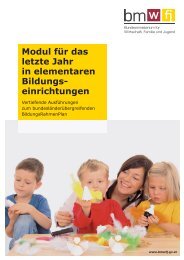Werner Bundschuh, Vom Wandern und Ankommen (PDF) - Vorarlberg
Werner Bundschuh, Vom Wandern und Ankommen (PDF) - Vorarlberg
Werner Bundschuh, Vom Wandern und Ankommen (PDF) - Vorarlberg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Aufbruch ineine neue Zeit<strong>Vorarlberg</strong>er Almanach zum Jubiläumsjahr 2005herausgegeben vonUlrich Nachbaur <strong>und</strong> Alois Niederstätterim Auftrag der <strong>Vorarlberg</strong>er LandesregierungBregenz 2006
Vortragswesen Volkshochschule BregenzBregenz, Landesarchiv, 7. März 2005<strong>Werner</strong> <strong>B<strong>und</strong>schuh</strong> (geb. 1951 in Dornbirn), Dr. phil., MAS (Civic Education), seit 1975 Professor amB<strong>und</strong>esgymnasium Dornbirn, seit 1983 Lehrbeauftragter des Studienzentrums Bregenz, Obmann derJohann-August-Malin-Gesellschaft.<strong>Vom</strong> <strong>Wandern</strong> <strong>und</strong> <strong>Ankommen</strong><strong>Werner</strong> <strong>B<strong>und</strong>schuh</strong>Vor sechs Jahren haben Rudolf Giesinger <strong>und</strong> Harald Walser dasHeimatbuch Altach der Öffentlichkeit präsentiert. Bei der Konzeptiondieses Bandes erfolgte ein Paradigmenwechsel in der Geschichteder <strong>Vorarlberg</strong>er Heimatbücher, die bis zu diesem Zeitpunkt inder Regel nicht ganz frei waren von „Alemannentümelei“. Altachentschied sich, im Heimatbuch jene zu Wort kommen zu lassen,die die jüngste Geschichte der Gemeinde ganz entscheidend mitgeprägthaben: die Zuwanderer <strong>und</strong> Zuwanderinnen.Die Migrationsgeschichtsforschung in diesem Land steckt nochweitgehend in den Kinderschuhen. Die neueren historischenAnalysen der Zuwanderung nach <strong>Vorarlberg</strong> wählten, soweit sienicht der Grabherr-Veiterschen Tradition des „Alemannorassismus“verpflichtet waren, im Wesentlichen einen sozio-strukturellenoder einen sozio-kulturellen Zugang: Das Gemeinsame allerdieser Arbeiten – erwähnt sei Erika Thurners Studie „Der goldeneWesten“ - ist, dass sie die individuellen Lebensgeschichten dermigrierenden Frauen <strong>und</strong> Männer, also die subjektive Dimensionihrer Wanderungserfahrung, fast völlig ausblenden.Beim Altacher Heimatbuch habe ich einen neuen, bislang in der<strong>Vorarlberg</strong>er Geschichtsschreibung noch nicht beschrittenen Wegeingeschlagen. In habe einen biographischen Zugang gewählt<strong>und</strong> erzähle die Lebensgeschichten aus der Innenperspektive derZuwanderer (ohne die sozio-strukturellen Aspekte zu vernachlässigen).Damit erhält die Zuwanderung ein Gesicht – nämlichdas der Menschen, die diese Zuwanderung wagen, erleiden,ihre Unwägbarkeiten durchleben (müssen) <strong>und</strong> erfolgreich – mitdem „<strong>Ankommen</strong>“ in <strong>Vorarlberg</strong> – für sich oder zumindest fürihre Kinder abschließen. Dadurch entsteht eine „Innensicht“ derArbeitsmigration, wie es auch (zum ersten Mal in <strong>Vorarlberg</strong> <strong>und</strong>mit anderen Mitteln) die Ausstellung „Lange Zeit in Österreich −40 Jahre Arbeitsmigration aus der Türkei“ im Jüdischen Museumin Hohenems kürzlich getan hat. Aus diesem Anlass ist auch dasBuch „<strong>Vom</strong> <strong>Wandern</strong> <strong>und</strong> vom <strong>Ankommen</strong>“ erschienen .Nach Altach hat Tosters (im Jahre 2002), dann im letzten JahrMäder diesen biographischen Migrantenansatz fortgeführt: Alledrei Gemeinden haben dabei eine Erfahrung gemacht: DieseLebensgeschichten sind auf ein besonderes Interesse gestoßen<strong>und</strong> haben sehr anregende Diskussionen hervorgerufen.Dass die Oral history-Arbeit besonderen Schwierigkeitenunterliegt – über die methodischen Probleme müsste eigensreferiert werden – ist die eine Seite. Die andere Seitesind die Ängste – z.B. vor den Nachbarn/dem Gemeindeumfeld–, die immer wieder zu überwinden waren. EinenFall werde ich exemplarisch ausführen.Der Beitrag im Altach-Buch trägt den Titel: „Fremd fühlteman sich schon...“Tosters: „ Zunächst hat man uns angeschaut, als wären wirbunte H<strong>und</strong>e...“Mäder: „Dass ich in Mäder landen werde...“Die Titel repräsentieren Kernerfahrungen der diversen Zuwanderer/innen.Und die ausgewählten Biographien geben dasSpektrum der <strong>Vorarlberg</strong>er Zuwanderergeschichte wieder.Ich darf einige anführen:Altach:Ottilie Tötsch stammt aus dem Südtirol – Hintergr<strong>und</strong> istalso die Option während der Mussolini-Ära.Anton <strong>und</strong> Cäcilia Podgornik sind slowenischen Ursprungs,sie wollten nicht unter den Kommunisten leben.Rudolf Czizegg wird unter dem Titel „Auch als Steirer warman ein Fremder“ vorgestellt.Richard Pleschberger aus Kärnten heiratete eine Altacherin,„das erleichterte das Heimischwerden schon“.Iwan <strong>und</strong> Anna Baricevics Leben wurden durch den Balkankriegtief greifend verändert.Und Hümmet Gürleyen aus Sinope (Türkei), der 1971 nachAltach kam, hatte sich sein Leben zunächst anders vorgestellt:„Die Fabrikarbeit entspricht nicht meiner Schulbildung“ist das Leitmotiv seiner Lebensgeschichte.Und wer denkt bei Zuwanderung schon an die Lawinenopfer imGroßen Walsertal von 1954? „Durch die Lawinen haben wir allesverloren“ – so Mathilde Müller. Es wird Jahrzehnte dauern,bis sie sich – die Fremde – in Altach heimisch fühlen wird.Einige gr<strong>und</strong>sätzliche Bemerkungen zur Zuwanderungsgeschichtein <strong>Vorarlberg</strong>:Seite 119
<strong>Vorarlberg</strong> zählt seit der Mitte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts zu den bedeutendstenIndustrieregionen Österreichs. Parallel dazu entwickeltees sich zum klassischen Arbeitszuwanderungsland.Es lassen sich (mindestens) sieben große Zuwanderungswellenfeststellen:- Italienisch sprechende Tiroler/innen aus dem Trentino(nach 1870 bis 1914) für den Einsatz in der Textilindustrie,im Baugewerbe <strong>und</strong> bei Verkehrsbauten wie der Arlbergbahn.Also die Trentiner/innern. Diese Zuwanderungswelleist durch den Forschungsband Burmeister/Rollinger(Hg) mittlerweile bestens erforscht.- Dann deutschsprachige Zuwanderer aus den Kronländernder (ehemaligen) Habsburger Monarchie in den beiden Jahrzehntenvor <strong>und</strong> nach der Jahrh<strong>und</strong>ertwende von 1900.- Südtiroler <strong>und</strong> Südtirolerinnen nach dem Hitler-Mussolini-Abkommen1939.- Fremd- <strong>und</strong> Zwangsarbeiter während der nationalsozialistischenHerrschaft (besonders Polen, Franzosen, Jugoslawen<strong>und</strong> Ukrainerinnen).- „Reichsdeutsche“ <strong>und</strong> Heimatvertriebene („Volksdeutsche“/ „Sudetendeutsche“).- Nach dem Zweiten Weltkrieg „InnerösterreicherInnen“aus der Steiermark, aus Kärnten <strong>und</strong> den anderen B<strong>und</strong>esländern,vor allem aus Tirol.- schließlich ab den Sechzigerjahren die „GastarbeiterInnen“aus Ex-Jugoslawien <strong>und</strong> der Türkei.Dazu diverse kleinere Wellen wie etwa nach dem Ungarnaufstand1956 – erforscht von Kollege Wolfgang Weber.Alle Neuankömmlinge hatten als „Landfremde“ zunächstmit vorherrschenden ideologischen Gr<strong>und</strong>musterzu kämpfen: Seit dem 19. Jahrh<strong>und</strong>ert setzte sich in<strong>Vorarlberg</strong> bei den herrschenden konservativen Elitendie Vorstellung vom eigenständigen, katholischen <strong>und</strong>„alemannischen Ländle“ durch. Die Ideologen dieses„Alemannen-Mythos“ schürten gezielt die Angst vor der„Überfremdung“ <strong>und</strong> setzten ihn zur politischen Machterhaltungein.Die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik veränderte danndie heimische Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialstruktur nachhaltig. DieUmstellung der Textilbetriebe auf kriegsbedingte Rüstungsproduktionführte zu einer Diversifikation der Industrieproduktion,eisen- <strong>und</strong> metallverarbeitende Betriebe siedelten sichan <strong>und</strong> wurden zu einem wichtigen Faktor in der heimischenWirtschaft. <strong>Vorarlberg</strong> war für die Nachkriegszeit gut gerüstet.Und nach der Überwindung der unmittelbaren Nachkriegsnotbenötigte die heimische Industrie vermehrt Arbeitskräfte. DieseArbeitsmigranten/innen kamen diesmal aus „Innerösterreich“,aus Kärnten, aus der Steiermark, aus dem Burgenland,aus Oberösterreich oder aus Osttirol. Wegen der besseren Verdienst-<strong>und</strong> Beschäftigungsmöglichkeiten wanderten TausendeMenschen nach <strong>Vorarlberg</strong> zu. Sie fanden – im vermeintlich„goldenen“ Westen – vorwiegend im Baugewerbe, in der Textilindustrie<strong>und</strong> im Gastgewerbe Arbeit.Die innerösterreichische Arbeitsmarktbinnenwanderung genügtein den Sechzigerjahren nicht mehr: Arbeitskräfte fehltenzunächst vor allem in der Baubranche, denn für gewissemanuelle Hilfsarbeiten ließen sich immer schwerer einheimischeArbeitskräfte finden. Deshalb wurden zusehendsausländische Arbeitnehmer angeworben. Die Sozialpartnereinigten sich schließlich auf so genannte „Kontingentierungsvereinbarungen“für „Fremdarbeiter“. Zunächst dominiertendie Arbeitnehmer aus dem ehemaligen Jugoslawien,dann jene aus der Türkei. Doch nicht nur die zuwanderndenjugoslawischen <strong>und</strong> türkischen Arbeitskräfte wurden mitstarken Vorurteilsmustern konfrontiert. Viele Einheimischesahen ihre eigene Lebensart durch „die Fremden“ bedroht.Im Gegensatz zu diesen mittlerweile recht gut erforschtenZuwanderungswellen behandelte die Regionalgeschichtsschreibungden Zuzug der „Reichsdeutschen“, „Volksdeutschen“,Sudetendeutschen <strong>und</strong> Heimatvertriebenen bisherstiefmütterlich. Im Tosters-Buch kommen sie zu Wort: ChristaMarkowski, Olly Nietschmann <strong>und</strong> Johanna Burtscher.Oder der „Alemanne des Balkans“ – Gantscho Dimitrov.Ehrlich: Wer weiß schon etwas über die bulgarischen Gärtnerin <strong>Vorarlberg</strong>?Seite 120
Gastarbeiter in Dornbirn 1969„Du nix alles schreiben, sonst ich tot“ – hat mir Salco Zucicaus Bosnien mit auf den Weg gegeben. Und manches bliebtatsächlich letztlich unveröffentlicht. So z.B. die Biographievon N.N. aus Mäder:Es ist eine Biographie aus einer Zuwanderer-Gruppe, diein der <strong>Vorarlberg</strong>er Geschichtsschreibung bis heute nichtadäquat beachtet wurde: die Menschen aus dem „Sudetentland“,aus Böhmen <strong>und</strong> Mähren. Der Erzähler hat dieAbdruck-Genehmigung letztlich verweigert, weil ihn das Erzählen,die Erinnerung aufgewühlt, so aufgeregt hat, dasssein Ges<strong>und</strong>heitszustand darunter gelitten hat. Er will – sosagt er – nur noch seine Ruhe im Dorf haben.N.N. (Jahrgang 1932) wurde in Reichenberg/Liberec im „Sudetengau“(einst Tschechoslowakei) geboren. Nach einerwahren Odyssee, hervorgerufen durch die Vertreibung derdeutschsprachigen Bevölkerung im Zuge der Benes-Dekrete,landete er als dreizehnjähriger Knabe am 1. September1945 als „Heimatvertriebener“ mit seiner Mutterin <strong>Vorarlberg</strong>. Bis zum heutigen Tag beschäftigen ihn seinetraumatischen Kindheits- <strong>und</strong> Jugenderlebnisse so, dasser sie nur mit großer Mühe erzählen kann. Die Reaktionenam Stammtisch auf seine Lebensgeschichte haben tiefeSpuren hinterlassen: „Dr. N.“, wie er von seinen Mitdiskutantenscherzhaft genannt wurde, artikulierte dort eineklare ablehnende Position zum Krieg <strong>und</strong> zum Verhaltender deutschen Wehrmacht. Und damit befand er sich in derMinderheit. „Wenn dieser Artikel erscheint, werden die Unbelehrbarenwieder das Maul über mich zerreißen, wie siees immer getan haben. Diese Ewiggestrigen, die ein Lebenlang von ihrer tollen Soldatenzeit geschwärmt haben. Ichhabe so Schreckliches gesehen <strong>und</strong> erfahren, dass ich dasnie verstehen konnte, wie man dieses Grauen im Nachhineinnoch zu verherrlichen versucht hat. Aber zweifelsohnehatten diese <strong>und</strong>ifferenzierten Verteidiger der Hitlerarmeedie Oberhoheit beim Frühschoppen, sie waren in der Überzahl.Aber wer in der Überzahl ist, muss noch nicht Rechthaben!“N.N. wurde als uneheliches Kind geboren. Mutter G. (Jahrgang1913), eine „Kaisermühlerin“ aus Wien, hatte inReichenberg im Sudetenland als Dienstmagd bei einerjüdischen Familie eine Stellung erhalten. „Hüte dich vorWeihrauch <strong>und</strong> Knoblauch!“, habe sie ihm als Lebensmaximemit auf den Weg gegeben. „Denn sie hat es bei ihrenHerrschaften nicht immer gut getroffen.“ Von seinem Vater,der eine Konditorei in Reichenberg besaß, weiß er wenig zuerzählen, ebenso von seinem kurzfristigen Stiefvater, dendie Mutter 1938 in Wien kennen gelernt hatte <strong>und</strong> der bereitsam 4. Kriegstag – im September 1939 – gefallen ist.Die Kindheits- <strong>und</strong> Jugendjahre sind vom Pendeln zwischender Tschechoslowakei <strong>und</strong> Wien gekennzeichnet. Eingeschultwurde K.P. in Wien, doch dann ist seine Mutter nachFriedek-Mistek in Mähren gezogen. „Nachdem sie nochim Jahre 1939 zur Arbeitsleistung in einer Munitionsfabrikdienstverpflichtet wurde, begann meine Zeit in Jugendheimen.Ich konnte ja nicht bei ihr bleiben, deshalb war siegezwungen, mich irgendwo unterzubringen.“Diese Zeit hat beim Erzähler Spuren hinterlassen. Er hat sichtlichMühe, seine Erregung zu unterdrücken. Die Erinnerung andie brachialen Erziehungsmethoden ist auch nach mehr alssechs Jahrzehnten schmerzhaft: „Da herrschte eine eiserneDisziplin. Wer sich bei der Essenausgabe nicht an das Stillegebotgehalten hat, bekam zehn Schläge mit dem Rohrstock.Überhaupt wurde bei jedem noch so kleinen Verstoß gegen dierigide Hausordnung geschlagen. Oft <strong>und</strong> heftig. Das Heim warstreng, sehr, sehr streng. Und ganz klar ideologisch ausgerichtet.Der Heimleiter war ein Nazi, der uns Kinder paramilitärischerzogen hat. Da hat es Fahnenappelle gegeben, <strong>und</strong> im Heimhat es aus Rassegründen keine Tschechen gegeben.“Der ausgezeichnete Volksschüler bestand die Aufnahmeprüfungfür das Reichsoberrealgymnasium in Reichenberg,das er vom Herbst 1942 bis Herbst 1944 besuchte. Dannmusste wegen Kohlemangels das Unterrichten eingestelltwerden. Zu dieser Zeit quoll die Stadt bereits von Flüchtlingenaus Ostpreußen über.Seite 121
Einigermaßen hungerfrei überleben konnte man nur, wennes gelang, ein Zubrot zu organisieren. „Meine Mutter wardiesbezüglich eine Koriphäe. Sie war ein W<strong>und</strong>er im Organisieren.Über den Jeschken, unseren Hausberg, ist sieins Tschechische hinübergegangen <strong>und</strong> zu Weihnachten1944/45 hat sie von dort einen Hasen mitgebracht. Die SA-Stiefel von ihrem ersten Mann, Stragga, hat sie in Korn umgetauscht.Wir haben es in der Kaffeemaschine gemahlen<strong>und</strong> dann daraus Brot gebacken. Einen großen Vorteil hattemeine Mutter beim Tauschen: Sie konnte Tschechisch.“Auf die Frage, wie er das Verhältnis von deutsch- <strong>und</strong> tschechischsprachigerBevölkerung in Erinnerung habe, antwortetK.P. sehr klar: „In meiner Kindheitserinnerung bestandzunächst eine gewisse Koexistenz zwischen den Deutschen<strong>und</strong> den Tschechen. Das hat sich nach Lidice jedoch starkgeändert. Das im Protektorat Böhmen <strong>und</strong> Mähren gelegeneDorf wurde nach dem Attentat auf den ReichsprotektorSS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich 1942 völlig ausgelöscht.Alle Männer wurden ermordet, die Frauen ins KZgesteckt. Damit war die Beziehung zwischen den Deutschen<strong>und</strong> den Tschechen völlig vergiftet.“In diese Zeit fällt der Besuch der gymnasialen Unterstufevon K.P. <strong>und</strong> ein Lehrer hat sich tief in sein Gedächtnis eingegraben:Professor Klein.„Lehrerpersönlichkeiten können einen für das ganze Lebenprägen. Bei mir war es jedenfalls so. Ich erinnere mich sehrgenau an Professor Klein. Er war nach den Nürnberger Rassegesetzenein Halbjude <strong>und</strong> trug einen Kaftan. Aber ohnedie Halbjuden im Lehrkörper hätte die Schule nicht funktioniert.Was dann mit diesen Lehrern passiert ist, weiß ichnicht, ihr Schicksal ist mir unbekannt.“K.P. erzählt von Professor Klein drei zentrale Erlebnisse. „AlsSchüler macht man manche Dummheit. Eine Mutprobe bestanddarin, den Stuhl von Professor Klein, der uns in Deutsch<strong>und</strong> Geschichte unterrichtet hat, mit Gummi Arabicum zu beschmieren.Er hat sich niedergesetzt <strong>und</strong> dabei seinen Rockruiniert. Die Folgen waren für mich fürchterlich. Ich musstebei der Schadenswiedergutmachung mitzahlen, <strong>und</strong> imHeim habe ich für diesen Streich, bei dem ich beteiligt war,zehn bis zwanzig Schläge auf den nackten Hintern erhalten.In dieser Nacht habe ich fürchterlich geweint, weil ich mich sogeschämt habe. Das vergisst man ein Leben lang nicht. AberProfessor Klein hat mich trotzdem geschätzt. Vor allem nacheinem Deutschaufsatz zum Thema ‚Der Staat’. Ich weiß heutenoch genau, was ich geschrieben habe. Ich habe geschrieben:,Der Staat ist im Einzelnen ohne Bedeutung. Sein Wertliegt in der Einheit der Nationen.’ Dafür habe ich einen Einserbekommen, <strong>und</strong> ich durfte zu Professor Klein als eine Art‚Privatschüler‘ kommen. Er hat mein Interesse für Geschichte<strong>und</strong> Literatur geweckt - <strong>und</strong> dafür bin ich ihm bis heute dankbar.“Dass er als „arischer Jugendlicher“ bei einem „Halbjuden“Bücher auslieh, missfiel seinen Kameraden. „In einerNacht- <strong>und</strong> Nebelaktion haben sie mir einen Sack über denKopf gestülpt <strong>und</strong> mich fürchterlich vermöbelt. Das war dieStrafe dafür, dass ich bei Professor Klein gewesen war, vondem ich so viel gelernt habe.“Das Jahr 1945 brachte auch für ihn gr<strong>und</strong>legende Änderungen.Zunächst entkam er der Tyrannei des Heimes. Seine Mutterwar der Fabrikarbeit entkommen <strong>und</strong> erzeugte in Heimarbeitfür Feuerzeuge Dochte. Da sie nun eine kleine Wohnung hatte,konnte er zu ihr ziehen. Ende März rückte jedoch die Front näher:„Wir hörten ständig die Stalinorgeln von Görlitz her, <strong>und</strong>wir ahnten schon damals, dass wir nicht bleiben würden können.Mit den Benesch-Dekreten war dann die Vertreibung fix.Meine Mutter galt als Sudetendeutsche, ich als Österreicher.Bereits im Mai räumten die tschechischen Milizen unserenStraßenzug. Fürchterlich war das. 30 kg Gepäck durften wirmitnehmen, nicht mehr. Ich hatte mein HJ-Zelt in einen Seesackumfunktioniert. Auf dem Platz, wo wir antreten mussten, habendie Tschechen wahllos in das Gepäck hinein geschossen– <strong>und</strong> dann kam die schreckliche Bahnfahrt nach Zittau.“K.P. war zum Zeitpunkt der Vertreibung dreizehn Jahre alt.Als Fluchtort hatte seine Mutter <strong>Vorarlberg</strong> ins Auge gefasst.In Koblach wohnte ihre Taufgotta Maria Amann (geb.Seite 122
Schrammel), die sie mehrmals besucht hatte. Und noch einenGr<strong>und</strong> gab es für sie, in Richtung Ländle zu flüchten:Professor Klein hatte ihr ans Herz gelegt, sie möge dafürsorgen, dass der Bub, der beachtliche Lateinkenntnisseaufwies <strong>und</strong> 1940 getauft worden war, die Stella Matutinain Feldkirch besuchen könne. „Daraus ist letztlich leidernichts geworden. Mir fehlten zwei Jahre Gymnasium – durchdie Flucht musste ich das Gymnasium nach der 2. Klasseabbrechen. Nach <strong>Vorarlberg</strong> sind wir nach einer wahrenOdyssee gelangt, aber für mich war es dann unmöglich, dieGymnasialjahre nachzuholen. Dazu haben die finanziellenMittel einfach nicht gereicht. Wie gerne hätte ich die Stellabesucht, aber das Schicksal hat es nicht gewollt. Aber wirmussten schließlich froh sein, dass wir mit dem Leben davongekommen sind. Die Monate auf der Flucht, die kannman sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wie knapp wirdem Tod entronnen sind. Und wir sind nicht direkt nach <strong>Vorarlberg</strong>geflüchtet. Da hat es Zwischenstationen gegeben.Zittau – Dresden – Wien – <strong>Vorarlberg</strong>!“Beim Erzählen durchlebt K.P. die Schrecken der Fluchterneut. „Ich war Augenzeuge, wie ein Soldat im überfülltenZug von einer Frau eine Uhr haben wollte. Sie gab sienicht her. Da hat er seine Pistole gezogen <strong>und</strong> kurzerhandabgedrückt! Vor meinen Augen! Und den Leichnam hat eraufgehoben <strong>und</strong> einfach hinausgeworfen! Ein menschlichesLeben war damals nichts wert, man war der Willkürvöllig ausgeliefert!“ Und völlig ausgeliefert war seine Mutterauch der russischen Soldateska im Zeltlager von Zittau.„Wir waren in Zittau in Großzelten, die vom deutschenRoten Kreuz aufgestellt worden waren, untergebracht. Unddort ist es vermutlich passiert. Ich weiß es nicht mit h<strong>und</strong>ertprozentigerSicherheit, aber ich habe keinen Zweifeldaran: Meine Mutter ist von einem russischen Soldatenvergewaltigt worden <strong>und</strong> war schwanger. Sie hat einenAbortus eingeleitet, an dessen Spätfolgen sie schließlichgestorben ist. Ab 1947 hat sie ständig geblutet <strong>und</strong> niemandkonnte ihr helfen. Sie hatte Gebärmutterkrebs – mitnur acht<strong>und</strong>dreißig Jahren ist sie unter fürchterlichenQualen verstorben.“Von Zittau ging es nach Dresden. Die Tage in der zerstörtenStadt waren grauenvoll. „Das kann sich der Menschkaum vorstellen. Als Historiker wissen Sie: In der Nachtvom 13. <strong>und</strong> 14. Februar 1945 <strong>und</strong> bei Tagangriffen amfolgenden Tag durch die alliierten Luftstreitkräfte wurdediese Stadt weitgehend dem Erdboden gleichgemacht.Dabei war die Stadt damals unverteidigt <strong>und</strong> mit Flüchtlingenüberfüllt. Musste das sein? Tausende <strong>und</strong> AbertausendeTote. Wir kamen im Juni nach Dresden. Trümmer,ausgebrannte Ruinen – <strong>und</strong> Bauchtyphus. DasGrauen ist mit Worten nicht zu schildern.“Mit einem Flüchtlingstreck ging es weiter. „Wir wollten RichtungWien. Aber es ging nichts mehr. So mussten wir zu Fußweiter. Und bei Hof war die Demarkationslinie zwischen denRussen <strong>und</strong> den Amerikanern. Die Nacht an dieser Grenzewerde ich mein Lebtaglang nicht vergessen: Wir waren zufünft. Meine Mutter, Steffi, eine Fre<strong>und</strong>in von ihr, zwei fronterfahreneLandser aus Norddeutschland <strong>und</strong> ich. Ohne diebeiden alten Kriegshasen hätten wir diese Nacht nicht überlebt.Wir standen in dieser stockdunklen Nacht unter einemViadukt im Wasser. Der mitgenommene Wäschekoffer löstesich im Wasser auf, sodass meine Mutter meinen Seesackausgeleert hat. In ihm waren meine Bücher. Ich wollte meineLatein-, Deutsch-, Geographie- <strong>und</strong> Geschichtebücherretten. In dieser Nacht sind sie davongeschwommen. DieRussen wollten Grenzübertritte verhindern <strong>und</strong> schossenwahllos drauflos. Um fünf Uhr sind wir dann im Sprunglaufüber die Autobahn gehetzt. Der Seesack mit Wäsche war soschwer, dass meine Mutter kaum drüber gekommen ist. DieLandser haben uns einzeln in den Graben auf der amerikanischenSeite hinübergebracht.“Doch auch in Hof herrschte das absolute Chaos. „Drei Tagelang blieben wir ohne jedes Essen. Da ich Englisch konnte,versuchte ich mein Glück bei einem amerikanischen Soldatenetwas Essbares zu ergattern. Doch der hat nur vor michhingespuckt. Welcher Hass muss gegen ‚die Deutschen’ beiihm vorhanden gewesen sein! Die ehemaligen KZ-Insassenwurden bevorzugt weiterbefördert, wir hatten dann dasSeite 123
Glück, auf einem offenen Lastwagen mit Anhänger nachNürnberg mitgenommen zu werden. Dort, wo der ‚Führer’einst seine inszenierten Parteitage abgehalten hatte, gabes nur noch Schutt: Der Bahnhof war eine Schutthalde– <strong>und</strong> dazwischen wir im Regen. Denn als wir ankamen,schüttete es tagelang. Doch mit einem Zug ging es schließlichweiter über Regensburg nach Passau <strong>und</strong> von dort andie österreichische Grenze.“An dieser Stelle kann der Erzähler seine Tränen nicht mehrunterdrücken. „In Schärding ist meine Mutter mit mir in eineKirche gegangen. Sie war nicht sehr fromm, sie hatte mitder Kirche nichts am Hut. Aber dort sagte sie zu mir: ‚Junge,wir sind endlich zu Hause!’ Und wir weinten beide.“Doch „zu Hause“ waren die beiden noch lange nicht. Über Linz– das in der russischen Zone lag – erreichten sie Ende AugustWien. Doch der Aufenthalt beim Großvater währte nur kurz.„Er konnte uns auch nicht helfen. Wir drei – die Mutter, ihreFre<strong>und</strong>in <strong>und</strong> ich - blieben nur vier, fünf Tage dort. Denn es gabeinfach nichts zu essen. Deshalb packten wir unsere Habseligkeitenzusammen <strong>und</strong> mit Hilfe einer Tschechin, die meineMutter kennen gelernt hatte, konnten wir wieder die russischeZone verlassen. Über Hochfilzen sind wir zu Fuß weitermarschiert,irgendwo sind wir wieder in einen Zug eingestiegen<strong>und</strong> am 1. September 1945 haben wir in der Nacht Koblach erreicht.Wir mussten uns in der Dunkelheit zur Gota schleichen,denn wir hatten keine gültigen Papiere. Die ganze Zeit hattenwir keine gültigen Papiere! Deswegen hatten wir auch vor denfranzösischen Soldaten, den Marokkanern, Angst. Ein Lebenohne Papiere war äußerst schwierig. Uns durchzufüttern warfür die Gota eine fast unmögliche Aufgabe. Aber der KoblacherBürgermeister Georg Längle hat es für uns gerichtet: Wir habenEssensmarken bekommen, <strong>und</strong> er hat uns ordentlich angemeldet.Jetzt waren wir wirklich zu Hause.“Doch für den dreizehnjährigen Knaben stehen bittere <strong>und</strong>konfliktreiche Jahre bevor. In der Pubertät ringt er mit seinerkränkelnden Mutter, <strong>und</strong> er erfährt, dass Lehrjahre keineHerrenjahre sind. Und ein Thema beschäftigt K.P. ganz besonders.„Wie wäre mein Leben verlaufen, wenn mich derKrieg nicht am Besuch des Gymnasiums gehindert hätte?Wie für viele in meiner Generation haben die Kriegswirrnisse,Vertreibung <strong>und</strong> Flucht einen Bildungsunterbruch gebracht.Heute gibt es Umstiegsmöglichkeiten im Bildungsbereich– aber damals? Ich wurde in Koblach noch einmaleingeschult. Ich besuchte die Volksschule <strong>und</strong> habe dortmeinen Abschluss gemacht. Lehrer Benz war ein guter Pädagoge,aber es stört mich heute noch, dass ich nicht maturierenkonnte. Der Traum von der Stella blieb ein Traum.Es war einfach kein Geld vorhanden, ein weiter führenderSchulbesuch war unmöglich.“Und so wurde der bildungswillige Gymnasiast aus ReichenbergHirtenbub im Schwefelbad in Hohenems. „Die erstenNachkriegsjahre waren im Allgemeinen kein Honiglecken.Aber als Hütebub ist es mir dort richtig schlecht gegangen.Das Essen war wirklich nicht ‚dick’, ich kann sagen, ich hattefast Hunger. Hašeks Soldat Schwejk hätte gesagt: ‚DasEssen war gut, aber es reichte nicht für mich.’ Und deshalbhabe ich mich – ohne meine Mutter zu fragen – nach einemanderen Platz umgesehen. So bin ich bei Rudolf Spiegel amBach gelandet <strong>und</strong> habe Schafe gehütet, denen ich fast bisnach Lustenau nachlaufen bin. Zumindest ein ausreichendesFrühstück hat es gegeben, aber die Verpflegung tagsüberwar sehr unregelmäßig. Und wenn man als Hirtenbubnicht aufgepasst hat, dann hat es schon einmal Schlägegegeben. Wie damals, als mir die Schafe in den Rübenackergeraten sind.“Ps. Mutter war in dieser Zeit Offiziersköchin bei den Franzosenin Feldkirch. Im Jahre 1947 suchte der Zimmermann EliasEnder aus Mäder eine Haushälterin. Sie bekam die Stelle<strong>und</strong> heiratete bereits im folgenden Jahr ihren Arbeitgeber.„Es war für mich eine schwierige Lebensphase. Ich sollteeine Lehrstelle bei der Bäckerei Schnell antreten. Aber Bäckerwar das Letzte, was ich werden wollte. Ich landete dannbeim Bürstenmacher Altmann in Hohenems <strong>und</strong> von dortbin ich bei Nacht <strong>und</strong> Nebel in den Bregenzer Wald gegangen<strong>und</strong> habe im Sägewerk bei Rudolf Natter gearbeitet.“Seite 124
Der frühe Tod der Mutter stellte eine tiefe Zäsur dar. „Ich warnun allein, ich war ein Vollwaise, hatte niemanden mehr,denn bei meinem Stiefvater wollte <strong>und</strong> konnte ich nicht bleiben.Zum Glück habe ich meine Frau Bernhardina, eine „Urmäderin“,kennen gelernt. Dann ist alles schnell gegangen:Ich war zwanzig, meine Frau ein Jahr jünger. Am Todestagmeiner Mutter, am 9. August 1952 haben wir im Gallusstiftin Bregenz geheiratet. Das ganze Dorf hat gemault. Sie warin anderen Umständen, <strong>und</strong> darüber haben damals nochdie Leute das Maul zerrissen. Besonders Pfarrer Gächter hatuns schief angeschaut.“Die junge Familie wohnte mit ihren beiden Kindern in sehr bescheidenen<strong>und</strong> beengten Verhältnissen in Untermiete, dannerwarb N.N. in Altach das 300 Jahre alte „Susanna Hüsle“(Kirchstr. 7). „Diese Jahre waren keine guten Jahre, die kannman abhaken“, sagt er. Von 1954 bis zu seiner Pensionierungim Jahre 1990 arbeitete er als Grenzgänger in der Schweiz inder Stickerei. „Meine Frau wollte im Dorf bauen. Die Gr<strong>und</strong>stückspreisewaren sehr niedrig. 1964 haben wir mit viel, vielEigenleistung mit dem Bau des Einfamilienhauses begonnen,in dem wir heute leben. Drei Jahre lang haben wir wirklich geschuftet,bis wir einziehen konnten. Schichtarbeit – <strong>und</strong> dannauf den Bau. Mit einem Maurer haben wir den Rohbau hochgezogen.Von der Bank haben wir keinen Kredit erhalten. So warich völlig in den Klauen meines Chefs, der die Notlage ausgenützthat. Und auch nach dem Einzug ist es weiter gegangen.Richtig fertig wird man ja nie! Heute merke ich diese Schindereiim Kreuz, ich habe von damals ein Rückenleiden. Denn auchder Garten hat viel Arbeit gegeben. Und bei mir musste allesimmer in Ordnung sein. Bevor ich in die geliebten Berge gegangenbin, musste der Rasen gemäht sein.“Über seine Stellung in der Gemeinde sagte er: „Die ‚Altmäderer’waren konziliant, das war ein separates Völklein, demder Most <strong>und</strong> der Schnaps am nächsten stand. Bei einerFronleichnamsprozession hat Pfarrer Gohm die Gaffer in der‚Krone’ einmal als ‚Mosttröttel’ beschimpft... Viele musstenauspendeln, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Unddann ist man am Sonntag im Gasthaus gesessen <strong>und</strong> hatdebattiert. Zwar habe ich mich schnell an den Dialekt gewöhnt,doch manchmal bin ich ins Hochdeutsche verfallen– <strong>und</strong> da haben sie mir den Spitznamen ‚Dr. N.’ verpasst.“Bei diesen Stammtischdiskussionen gaben die „Kameradschaftsbündler“den Ton an. „Mit meiner pazifistischenGr<strong>und</strong>haltung bin ich allerdings oft schlecht angekommen.Aber ich habe in meiner Jugend so viel Schreckliches gesehen,dass ich den Krieg zu hassen gelernt habe. Und dashabe ich nie verhehlt. Damit war ich allerdings in einer Außenseiterposition.Ich habe zum Beispiel gesehen, wie inReichenberg ein Neunzehnjähriger als Deserteur erschossenwurde. Die ‚Kettenh<strong>und</strong>e’ der Militärpolizei haben ihnaus dem Zug herausgeholt. Dann mussten alle vier Fähnlein– 120 Mann – zu einem Appell antreten <strong>und</strong> er wurdevor meinen Augen exekutiert. Diesen Anblick habe ich nievergessen können <strong>und</strong> er hat mich in meinen pazifistischenGr<strong>und</strong>gedanken gestärkt.“Die Konflikte mit den alten Kameradschaftsbündlern, die imDorf den Ton angaben, haben ihn fast zermürbt <strong>und</strong> dieseDiskussionen um die Wehrmacht haben zu einem gewissenRückzug aus dem Dorfleben geführt. „Ab 1967 bin ich dannin die Berge gegangen ...“ Und an dieser Stelle möchte ichabbrechen ...Neuankömmlinge hatten es immer schwer. Und eines wurdevon allen gefordert: sich anzupassen. Junge, belastbare <strong>und</strong>fügsame Arbeitskräften waren gewünscht, die bei Nicht-Bedarfwieder ins Ursprungsland zurückgeschickt werdenkonnten. Dies hatte weitgehende Auswirkungen auf derenLebensperspektive <strong>und</strong> deren Integrationsbemühungen.Die Mehrheit der Arbeitsmigranten plante keinen ständigenAufenthalt in <strong>Vorarlberg</strong>, die ökonomischen Realitätenprolongierten jedoch die Anwesenheit im Lande <strong>und</strong> machteneine Rückkehr in die Heimat für die meisten unmöglich.Mit der Familiennachholung bzw. mit Eheschließungen imZuwanderungsland veränderten sich ihre Lebenspläne. Siewurden notgedrungenerweise mit der Zeit „<strong>Vorarlberg</strong>er“oder „<strong>Vorarlberg</strong>erin“.Seite 125
Die ausgewählten exemplarischen Lebensläufen, die„Zuwanderer(innen)biographien“, zeigen, wie differenziertdieses Land zu betrachten ist: Altach unterscheidet sichvon Tosters, Mäder ist – auf Gr<strong>und</strong> der unterschiedlichenMigration – anders als z.B. Götzis.Als Markus Barnay 1988 seine Studie „Die Erfindung des<strong>Vorarlberg</strong>ers. Ethnizitätsbildung <strong>und</strong> Landesbewusstseinim 19. <strong>und</strong> 20. Jahrh<strong>und</strong>ert“ veröffentlichte, war die Entrüstungin Teilen der so genannten „Landeselite“ noch groß:Das Buch rüttelte an einem Quasi-Dogma des Landesselbstverständnisses,nämlich daran, dass hier „Alemannen“ leben<strong>und</strong> die Kultur in diesem Land von ihnen geprägt wird.Das „alemannische Ländle“ <strong>und</strong> der „Alemannen-Mythos“gehörten auch zum weitgehend unhinterfragten Repertoireder Landesgeschichtsschreibung. Das hat sich geändert,der Mythos ist zumindest im wissenschaftlichen Diskursgebrochen – <strong>und</strong> dennoch lohnt es sich in Zusammenhangmit der Zuwanderungsgeschichte – <strong>und</strong> den damit verb<strong>und</strong>enengesellschaftlichen Veränderungen – auf diese „Alemannnen-Geschichte“einen Blick zu werfen.Die Forscher waren sich über den Ursprung der <strong>Vorarlberg</strong>er/innenin der 1. Halfte des 20.Jhs. durchaus nicht einig.Bei Barnay heißt es: „Wir finden also in <strong>Vorarlberg</strong> nach Ansichtder verschiedenen Forscher neben übereinstimmendfestgestellten Alemannen, Walsern, Rätern <strong>und</strong> Romanen:Reste einer rätisch-alpinen Bevölkerung mit gallischenEinflüssen, Venetoillyrier, Kelten, Ligurer, Spuren von Lenzerschwaben,Juthungen, Goten, Franken, Thüringern, Tirolern,Bayern <strong>und</strong> Paduren, Angehörige der alpinen <strong>und</strong>ostischen ebenso wie solche der dinarischen Rasse nebstentsprechenden Mischungen, sowie echte Arier, Nachkommeneiner Pfahlbau-Rasse <strong>und</strong> Abkömmlinge der mediterranenRasse.“Als „uralemannisch“ galten die Bregenzerwälder. Alois HildebrandBerchtold wollte es genau wissen <strong>und</strong> untersuchte1931 „das Volkstum in <strong>Vorarlberg</strong>“.Um die „deutsche Stammeseigenart“ aus der Nähe zu betrachten,begaben sich Berchtold <strong>und</strong> ein Forscherkollegevor Ort: „Um ihre Köpfe zu studieren, betraten wir einenkleinen Viehmarkt, der soeben stattfand. Während sie dasschöne Braunvieh mit Kennerblicken maßen <strong>und</strong> betrachteten,betrachteten <strong>und</strong> maßen wir zwei ihre seltsam geschnittenenKöpfe <strong>und</strong> Gesichter: strenge Linien, edle Züge,durchgeprägte Charaktere, lässige oder bewußtsichereHaltung, mit nordischen, dinarischen <strong>und</strong> einigen alpinenKöpfen. Der Langkopf fehlt hier fast ganz, wie überhaupt in<strong>Vorarlberg</strong> <strong>und</strong> seiner Umgebung. Der Typen sind mehrere,darunter auch ein dunkler, fast schwarzer, aber die Reinzüchtungder verschiedenen Typen ist überall spürbar.“Aus Berchtolds Bericht geht nicht hervor, ob er auch versuchte,einen reingezüchteten Bregenzerwälder zu kaufen.Doch er trifft eine erstaunliche Feststellung: „Dem Bregenzerwaldangeschlossen ist der Vorderwald, bestehend ausfünf Gemeinden. Er ist völkisch <strong>und</strong> rassisch ganz andersgeartet als der Hinterwald.“Mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden – statistische Angabenzu Körpergröße, Schädelform, blonder <strong>und</strong> brauner Typ– näherte sich Hermann Gsteu den „somatischen Eigenschaften“der <strong>Vorarlberg</strong>er im Jahre 1932: Die Ergebnisseder Studien waren allerdings ernüchternd: „Im BregenzerWalde herrscht der blonde hellhäutige Typ vor; die vielenRotblonden müssen einem jeden Besucher auffallen, wennes auch nicht immer Langschädel sind. Besonders dieSchuljugend zeigt einen erheblichen Satz von Blonden,Blauäugigen <strong>und</strong> Hellhäutigen, wogegen die Erwachsenenimmer dunkler werden. Das südliche <strong>Vorarlberg</strong> spiegelt inden braunen Typen die rätoromanische Bevölkerung wider.Auffallend ist, daß die Montafonerinnen durchweg besondersdunkel gefärbt sind. [...] Auch unter den Walserinnenbegegnen uns neben echten deutschen Gesichtern einzelneGestalten, die äußerst fremd erscheinen. [...] Im wesentlichenzeigt das Aussehen der Walser aber deren germanischeAbkunft.“Seite 126
Diesen „Rassenforschern“ ist es trotz aller Bemühungennicht gelungen, schlüssige Theorien über die Abstammungder <strong>Vorarlberg</strong>er zu entwerfen <strong>und</strong> zu belegen. So bliebenletztlich nur zwei Möglichkeiten: Entweder man akzeptierte,dass von einer eindeutigen oder gar einheitlichen Abstammungder <strong>Vorarlberg</strong>er überhaupt keine Rede sein konnte<strong>und</strong> dass vor allem die Zugehörigkeit zur „germanischenRasse“ mehr hoffnungsvolle Spekulation als gesicherte Erkenntniswar. Oder man verzichtete auf wissenschaftlicheGründlichkeit <strong>und</strong> entschied sich für eine Version, die zwarnicht stimmte, aber schon lange genug verbreitet wordenwar, um plausibel zu klingen. Letzteres machten die Vertreterder politischen <strong>und</strong> publizistischen Öffentlichkeit. Dabeieinigten sie sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner,der etwa folgender Aussage von Landeshauptmann Dr. OttoEnder entsprach: „Der Abstammung nach überwiegt dasAlemannentum; der südlichste Teil war ehemals romanisch,ist aber längst germanisierte Bevölkerung“.Genug damit: Ich erspare Ihnen jetzt den Exkurs zu Grabherr<strong>und</strong> Veiter <strong>und</strong> die Darstellung des Alemannenmythos<strong>und</strong> seine Auswirkungen in der Landespolitik bis in die 80erJahre des vergangenen Jahrh<strong>und</strong>erts!Für die vielen Steirer <strong>und</strong> Kärntner Zuwanderbiographiensteht jene von Rudolf Czizegg (Jahrgang 1933). Er kam am21. September 1953 nach Altach. Er gehört jener Minderheitvon Arbeitsmigranten an, die nicht im Baugewerbe oder inder Textilbranche tätig war. Sein gelernter Beruf war Frisör.Als Neunzehnjähriger verließ er seinen Geburtsort Kindbergin der Steiermark, um im „Goldenen Westen“ Arbeitzu suchen. Über Annoncen in der Lokalzeitung wurden diehervorragenden Arbeitsplatzchancen in <strong>Vorarlberg</strong> angepriesen.Seine Ankunft im „Ländle“ schildert er folgendermaßen:„Ich bin die Nacht mit dem Zug durchgefahren <strong>und</strong> bin umca. 6 Uhr in der Früh in Hohenems angekommen. Dort habeich den Bahnhofsvorstand gefragt, ob er einen Frisör wisse,der Arbeit habe. Er sagte mir, geradeaus in der Nähesei einer, ich solle ihn einfach fragen. Ich wartete bis kurznach 7 Uhr <strong>und</strong> läutete dann beim Frisör Alois Fenkart. Zumeiner großen Überraschung musste ich – es war Samstag– sofort anfangen <strong>und</strong> den ganzen Tag durcharbeiten!Aber noch größer war meine Überraschung am Sonntag. Ichwar evangelisch – das sagte ich jedoch nicht! Der Meisterweckte mich zeitig in der Früh <strong>und</strong> ich musste mit ihm indie Kirche gehen. Nach der Kommunion zupfte er mich amÄrmel <strong>und</strong> wir gingen ins Geschäft zurück. Dort wartetenschon die ersten K<strong>und</strong>schaften <strong>und</strong> so stand ich wieder imEinsatz. Jetzt wusste ich, was ‚schaffa’ bedeutete <strong>und</strong> fürmich fing eine harte Zeit an. Aber schließlich war ich insLändle gekommen um etwas zu verdienen. Und das tat ichnicht schlecht ...“An seinen Lohn kann er sich heute noch gut erinnern: „Ichverdiente 200 Schillinge in der Woche <strong>und</strong> durfte beim Meisterwohnen.“ Diese Wohnmöglichkeit brachte jedoch nichtnur Vorteile mit sich. Damit war auch eine strenge Kontrolleder Lebensgewohnheiten verb<strong>und</strong>en. Allerdings machtesich der Neuankömmling auch wenige Illusionen über seinensozialen Status: „Meine Situation war mir klar: Du bistein Fremder, der nichts hat <strong>und</strong> du musst dich anpassen.Und natürlich war ich zunächst sehr allein. Am Montaghatte ich frei, aber ich kannte niemanden, wirklich niemanden.Mein größtes Problem war in der Eingewöhnungszeitsicherlich die Sprache, denn ich verstand zunächst kaumetwas.“Im Jahre 1953 wechselte er nach Altach. Beim neuen Meisterblieb er acht Jahre. Zunächst wohne er mit acht anderenKostburschen, ebenfalls „Innerösterreicher“, zusammen.Die sozialen Kontakte beschränkten sich zunächst auf„innerösterreichische Binnenkontakte. Zu den ‚Altachern‘hatten wir sehr wenig Beziehung. Die Einheimischen hattendie Auffassung, ‚Hast nix, bist nix‘, aber sie waren bis zumAufkommen der Stickerei in den sechziger Jahren ja selberarm. Mit den Jungen entwickelte sich mit der Zeit ein besseresVerhältnis.“Seite 127
Da der gelernte Frisör wegen des Verdienstes nach <strong>Vorarlberg</strong>gekommen war, begann er nebenbei in der Stickereials Nachseher zu arbeiten: „Das hieß 14 oder 15 St<strong>und</strong>enArbeit pro Tag. Aber wenn man jung ist, hält man das aus.Schließlich bin ich hierher ja nicht zum Faullenzen gekommen.Und wenn du fremd bist, mußt du doppelt so viel arbeiten.Da man in der Stickerei damals sehr gut verdiente,wurde sie mein Hauptberuf.“In Altach lernte er seine Frau Christine, die wie er aus derSteiermark (aus Fronleiten) stammte, kennen. Seit ihrerfrühesten Jugend kannte sie materielle Not <strong>und</strong> Armut: IhrVater, Maurer von Beruf <strong>und</strong> Sozialdemokrat aus Überzeugung,war in den Dreißigerjahren jahrelang arbeitslos <strong>und</strong>konnte seine vielköpfige Kinderschar kaum ernähren. EineSchwester war bereits in der Textilfabrik Albert Ender & Co.beschäftigt <strong>und</strong> lockte sie mit ihrem Verdienst nach Altach.„Ich wollte nach der ersten Woche schon wieder weg, aberals ich beim ersten Zahltag mit den Überst<strong>und</strong>en 600 S bekommenhabe, da fühlte ich mich tatsächlich im ‚goldenenWesten‘. Jetzt konnte ich mich mit dem Gedanken des Bleibensanfre<strong>und</strong>en, trotz des Zimmers ohne Heizung, trotzder Sprache, die ich nicht verstanden habe. Anfangs wares schon sehr hart hier in Altach. Ein Glück war für michKäthe Aberer, die aus Hohenems hierher gezogen war. Weilsie selbst ‚fremd‘ gewesen ist, hatte sie so viel Verständnisfür uns Zugezogenen. Bei ihr bin ich untergekommen. Sieist die Güte selbst gewesen, ein richtiger Mutterersatz.“Als Rudolf Czizegg seine künftige Gattin kennen lernte, warer in Altach in dreifacher Hinsicht als „Fremder“ ausgegrenzt:Er stammte aus einem ausgesprochen sozialdemokratischenMilieu <strong>und</strong> war deshalb ein „Roter“, er war als Steirer ein„Nichtalemanne“ <strong>und</strong> gehörte als Protestant in einer katholischdominierten Umwelt zu einer religiösen Minderheit.Sein zentraler Erinnerungsatz heute: „Die Jugoslawen <strong>und</strong>die Türken wurden in den sechziger Jahren wesentlich besseraufgenommen als wir ‚Innerösterreicher‘ in den Fünfzigern.Denn Altach war damals noch eine sehr geschlossene Gesellschaft,in der es die Fremden nicht leicht hatten.“Dass es „im Dorf besser war, katholisch zu sein“, merkteer bei seiner Verehelichung mit seiner katholischen Frau.Besonders die Familie seiner Schwägerin, die in Altacheinen Unternehmer geheiratet hatte, wollte das „Mischehenproblem“gelöst sehen. Auch der Pfarrer „wollte wegender Kinder eine katholische Hochzeit. Mir machte es nichtsaus, <strong>und</strong> die zwei Kinder wurden dann eben katholisch erzogen.Als Neuankömmling muss man eben Kompromisseschließen – in <strong>Vorarlberg</strong> vielleicht ein bisschen mehr alsanderswo.“Ihm war von allem Anfang an klar, „dass er einem ungeheurerAnpassungsdruck gerecht werden musste. Denn um imDorf akzeptiert zu werden, musste man ‚körig si‘, <strong>und</strong> dashieß, nicht aufzufallen.“ Um ein „köriga“ Altacher zu werden,benötigte Herr Czizegg nach Eigeneinschätzung „so 15bis 20 Jahre“. Dass man „Unterdörfler“ war, habe man imAlltag schon ein bisschen zu spüren bekommen. Heute mitAugenzwinkern: „I bi körig worra!“Kurt Greussing behandelt in seinem Vorwort zu „<strong>Vom</strong> <strong>Wandern</strong><strong>und</strong> <strong>Ankommen</strong>“ wichtige Gr<strong>und</strong>aspekte der Arbeitszuwanderung,vor allem von Menschen aus Nicht-EU-Ländern.In den vergangenen Jahren hat sich mit den nach <strong>Vorarlberg</strong>zugewanderten Frauen <strong>und</strong> Männern aus Nicht-EU-Ländernein stiller, aber revolutionärer Wandel vollzogen: Ihre Aufenthaltsperspektivehat sich stabilisiert. Aus weitgehendbeliebig disponierbaren Verschubmassen der Konjunkturensind Menschen mit Aufenthaltsrecht, ja vielfach österreichischeStaatsbürgerinnen <strong>und</strong> Staatsbürger geworden.Die Frage ist nur: warum sind sie dann − im populärenDiskurs ebenso wie in der öffentlichen Rede − immer noch„Ausländer“, „Fremde“, „Türken“, „Jugos“, <strong>und</strong> eben nichtwie der große Rest: „<strong>Vorarlberg</strong>er“?Die <strong>Wandern</strong>den sind angekommen, aber in den meistenFällen noch lange nicht als „<strong>Vorarlberg</strong>er“ zu Hause. Die Ankunftsbereitschaftbei zahlreichen Migrantinnen <strong>und</strong> Mig-Seite 128
anten ist merklich größer als die Empfangsbereitschaft derAufnahmegesellschaft. Für diese Tatsache spielt die veröffentlichteMeinung eine nicht unwesentliche Rolle.Mit der Verfestigung der „Gastarbeiter“ als Teil der <strong>Vorarlberg</strong>erSozialstruktur in den 1980er Jahren − aus Zuwanderernwurden nach <strong>und</strong> nach Einwanderer, auch wenn dieAufenthaltsperspektiven <strong>und</strong> -rechte des Einzelnen nachwie vor völlig unsicher waren − änderte sich auch der Blicketlicher Historiker auf die Migrantinnen <strong>und</strong> Migranten.Bahnbrechend waren hier etwa der Bludenzer Geschichtsvereinunter der Verantwortung von Manfred Tschaikner.Die nun folgende Befassung mit Zuwanderung − auf Seitenkritischer („alternativer“, „linker“) Historiker ebenso wie,noch wichtiger, auf Seiten der Vertreter der Zuwanderungsminderheitenselbst − war durch mindestens drei Elementegekennzeichnet:- durch eine Sicht auf die eigene Geschichte auf der Basis einerNeuerschließung von Quellen <strong>und</strong> nicht auf der Gr<strong>und</strong>lagevon kolportierten Geschichten <strong>und</strong> Vorurteilen;- durch ein offensives Bekenntnis zur Existenz als Zuwanderergruppe;- <strong>und</strong> durch ein wachsendes − <strong>und</strong> öffentlich artikuliertes− Bewusstsein von <strong>Vorarlberg</strong> als klassischem Einwanderungsland.Am 27. Juni 1990 versammelten sich in Bludenz 350 ältereTrentinerInnen aus dem ganzen Land zu einem Treffen mitLandeshauptmann Martin Purtscher. Die Sensation dieserVeranstaltung war die Schluss-Passage in der Rede desLandeshauptmanns: „Ich weiß, dass Ihren Eltern, Großeltern<strong>und</strong> Urgroßeltern, vielleicht auch noch Ihnen selbstin schwerer Zeit viel Unrecht getan wurde. Und als Landeshauptmannvon <strong>Vorarlberg</strong> stehe ich nicht an, Sie heutenoch im Namen des Landes für jede Ungerechtigkeit <strong>und</strong>Lieblosigkeit um Verzeihung zu bitten.“Das erste Zuwandererfest fand im Herbst 1993 in Bregenzstatt: Ein interkulturelles Fest organisiert von dem aus Oberösterreichstammenden Vereinsreferenten der Stadt Bregenz,dem heute hier anwesenden Hans Kallinger. Es standunter dem Motto „Unser aller Ländle“. Die <strong>Vorarlberg</strong>erLandesregierung unter Landeshauptmann Purtscher widmetediesem Fest eine eigene Nummer des an alle Haushalteversandten „<strong>Vorarlberg</strong>-Berichts“ (Heft 75/1993).Interessant sind die auf dem Titelblatt dieser Schrift aufgelistetenZuwandererminderheiten: Walser, Trentiner,Südtiroler, Osttiroler, Oberösterreicher, Steirer, Kärntner,Burgenländer, Serben, Kroaten, Slowenen <strong>und</strong> Türken. DasBregenzer Zuwandererfest wurde, im Zweijahresrhythmus,zur Tradition. Heute (2004) sind dort 17 ethnische Gruppen,die über eigene Vereine verfügen, vertreten − neben denbereits genannten unter anderen Filipinas, Marokkaner,Polen <strong>und</strong> Schwarz-Afrikaner.Das Ungewöhnliche an dieser Entwicklung: Die Vertreter der„Trentiner“ oder „Welschen“ machten sich zum Motor fürdie öffentliche Präsentation der übrigen Zuwanderer-Minderheiten.Man kann die politische Wirkung solcher Festenicht hoch genug einschätzen: Zum ersten Mal verstecktensich Zuwanderer nicht mehr oder identifizierten sich lediglichin ihren Traditionsvereinen als Migranten; sondern siemachten ihre Existenz als Zuwanderer öffentlich − <strong>und</strong> damitim Wortsinn politisch. Denn nun konnte jeder, auch der<strong>Vorarlberg</strong>-bornierteste Gemeinde- oder Landespolitiker,sehen: Es gibt Zuwanderer in diesem Land, <strong>und</strong> es gibt viele,sehr, sehr viele...Der Erfolg des offensiven Auftretens der „Trentiner“ waralso ein Paradigmenwechsel in der offiziellen Sicht der <strong>Vorarlberg</strong>erRegierung auf die Landesgeschichte – weg vomAlemanno-Zentrismus, hin zur gr<strong>und</strong>sätzlichen Akzeptanz<strong>Vorarlberg</strong>s als eines recht bunt gemusterten Zuwanderungslands.Auswirkungen solcher Schritte, in Form einer Verbesserungder Situation der Migranten, setzten freilich nur langsamein (etwa die großzügigere Regelung der Aufenthaltsgewäh-Seite 129
einer anderen leben wir, hat mein Vater gesagt – unter welcherwir sterben werden, wissen wir noch nicht, füge ich beiihm hinzu.“Nuray Sönmez hat ein Gedicht geschrieben. Ich möchte siebitte, es uns vorzulesen:gseha, dass mir o ned so schlecht siand, wia sies gmoandhond. Usgschlossa vo dr paar Lüt, egal welchara Rasse es oimmer ischt, nemlich guti <strong>und</strong> schlechti giats überall, abrmir hoffen, dass dia guti in Überzahl siand. Wenn ma dochuf dieser Wealt friedlich miteinander leba ka, warum noh sofeindselig zuanander si!Nuray: „Ich habe es im Dialekt geschrieben, <strong>und</strong> es behandeltdas Thema, über das wir gerade gesprochen haben.Ich habe ihm den Titel ‚Miteinander’ gegeben, denn nur sokann man friedlich zusammen leben.“MiteinanderUngföhr vor drißg, vierzg Johr siand dia ersta Türka do gsi.Ida Hoamt hons sie sich vo der Frou, Kiand, Eltara <strong>und</strong> Verwandtaverabschiadat.Mit a kle Häs im Koffer, a kle Breand i da Naylontäscha <strong>und</strong>a kle Geld im Sack, hot die Reise ins frömde Land agfanga.Nach zwo, drü Täg siand sie ako im Ländle. Ufgregt siandsie gsi, was sie alls gseha hond, anderst bauti Hüser, hellhütige,blondi Menscha, dia ena frömd agschout <strong>und</strong> üseridia frömd agschout hond. Denn hons versuacht an Dachüberm Kopf zu fianda.Mit da andra Landsmä hoans sie i a Gmeinschafts-Zimmeragwohnt. Nocha onera Wiele heat die Arbeitssuchi agfanga.Es war alles so schwer für sie. Ma hot Sproch net verstanda,<strong>und</strong>s Ikofa war am Schwirigsta, hons ned sega künna, wassie wella hond.Mit Händ <strong>und</strong> Füaß honds sie sich zverständiga versuacht.Jeder ischt jedem usm Weg ganga, alli bedi Sita hond da Kontaktzeinander vermida, jo halt weil ma anander net kennthot. Sie heand sich denkt, mir sparend fest, denn gommaeh wider hoam. So isches aber net ko, wia sie sich vorgstellthond. Ma hot sie as Leba do im Ländle gwöhnt. Dennhät ma langsam gegasitig zum Grüaßa agfanga <strong>und</strong> gseha,dass ma ko Angscht vo anander ha muss. Johre später hättma denn Kiand <strong>und</strong> Kegl uffa gholt. Sit dem leaben sie Seitian Seiti mit der <strong>Vorarlberg</strong>er zemma. Mir hond gseha, dassdia <strong>Vorarlberg</strong>er ganz netti Lüt siand <strong>und</strong> natürli hond sie oSeite 132