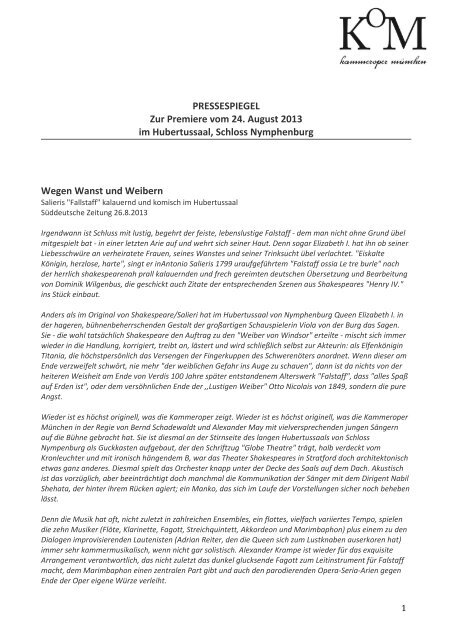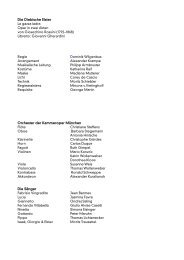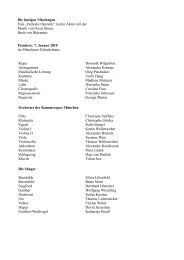Pressespiegel - Kammeroper München
Pressespiegel - Kammeroper München
Pressespiegel - Kammeroper München
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
PRESSESPIEGELZur Premiere vom 24. August 2013im Hubertussaal, Schloss NymphenburgWegen Wanst und WeibernSalieris "Fallstaff" kalauernd und komisch im HubertussaalSüddeutsche Zeitung 26.8.2013Irgendwann ist Schluss mit lustig, begehrt der feiste, lebenslustige Falstaff - dem man nicht ohne Grund übelmitgespielt bat - in einer letzten Arie auf und wehrt sich seiner Haut. Denn sogar Elizabeth I. hat ihn ob seinerLiebesschwüre an verheiratete Frauen, seines Wanstes und seiner Trinksucht übel verlachtet. "EiskalteKönigin, herzlose, harte", singt er inAntonio Salieris 1799 uraufgeführtem "Falstaff ossia Le tre burle" nachder herrlich shakespearenah prall kalauernden und frech gereimten deutschen Übersetzung und Bearbeitungvon Dominik Wilgenbus, die geschickt auch Zitate der entsprechenden Szenen aus Shakespeares "Henry IV."ins Stück einbaut.Anders als im Original von Shakespeare/Salieri hat im Hubertussaal von Nymphenburg Queen Elizabeth I. inder hageren, bühnenbeherrschenden Gestalt der großartigen Schauspielerin Viola von der Burg das Sagen.Sie - die wohl tatsächlich Shakespeare den Auftrag zu den "Weiber von Windsor" erteilte - mischt sich immerwieder in die Handlung, korrigiert, treibt an, lästert und wird schließlich selbst zur Akteurin: als ElfenköniginTitania, die höchstpersönlich das Versengen der Fingerkuppen des Schwerenöters anordnet. Wenn dieser amEnde verzweifelt schwört, nie mehr "der weiblichen Gefahr ins Auge zu schauen", dann ist da nichts von derheiteren Weisheit am Ende von Verdis 100 Jahre später entstandenem Alterswerk "Falstaff", dass "alles Spaßauf Erden ist", oder dem versöhnlichen Ende der ,,Lustigen Weiber" Otto Nicolais von 1849, sondern die pureAngst.Wieder ist es höchst originell, was die <strong>Kammeroper</strong> zeigt. Wieder ist es höchst originell, was die <strong>Kammeroper</strong><strong>München</strong> in der Regie von Bernd Schadewaldt und Alexander May mit vielversprechenden jungen Sängernauf die Bühne gebracht hat. Sie ist diesmal an der Stirnseite des langen Hubertussaals von SchlossNympenburg als Guckkasten aufgebaut, der den Schriftzug "Globe Theatre" trägt, halb verdeckt vomKronleuchter und mit ironisch hängendem B, war das Theater Shakespeares in Stratford doch architektonischetwas ganz anderes. Diesmal spielt das Orchester knapp unter der Decke des Saals auf dem Dach. Akustischist das vorzüglich, aber beeinträchtigt doch manchmal die Kommunikation der Sänger mit dem Dirigent NabilShehata, der hinter ihrem Rücken agiert; ein Manko, das sich im Laufe der Vorstellungen sicher noch behebenlässt.Denn die Musik hat oft, nicht zuletzt in zahlreichen Ensembles, ein flottes, vielfach variiertes Tempo, spielendie zehn Musiker (Flöte, Klarinette, Fagott, Streichquintett, Akkordeon und Marimbaphon) plus einem zu denDialogen improvisierenden Lautenisten (Adrian Reiter, den die Queen sich zum Lustknaben auserkoren hat)immer sehr kammermusikalisch, wenn nicht gar solistisch. Alexander Krampe ist wieder für das exquisiteArrangement verantwortlich, das nicht zuletzt das dunkel glucksende Fagott zum Leitinstrument für Falstaffmacht, dem Marimbaphon einen zentralen Part gibt und auch den parodierenden Opera-Seria-Arien gegenEnde der Oper eigene Würze verleiht.1
Dem gebürtigen Wiener Florian Pejrimovsky musste man für die Titelpartie nicht extra den Bauch ausstopfenund auch musikalisch gab er der Figur pralles Format. Robert Schär trumpfte als Mr. Ford tenoral auf, littaber etwas unter Premierennervosität, was man vom exzellenten, kernig und doch fein timbrieren BaritonPhilipp Jekal in der (weitaus kleineren) Rolle des Mr. Slender nicht behaupten kann. Viel Spaß an den schonim Titel (.,Les tre burle") genannten ziemlich derben Scherzen hatten Florence Losseau (Mrs. Slender) undnoch mehr Athanasia Zöhrer (Mrs. Ford), die auch in den Dialogen ihre Bühnenpräsenz voll ausspielenkonnte.Da Antonio Salieri und sein Textdichter Carlo Prospero De Franceschi das Liebespaar aus Shakespeares"Weibern", also Fenton und Anna {im Gegensatz zu Verdi und Nicolai) in ihrer Version eliminiert haben, rückthier das wunderbar komisch und barfuß agierende Buffo-Paar Bardolf (Carl Rumstadt) und Betty (KatharinaKonradi) ins Zentrum eines sehens- und hörenswerten Abends.KLAUS KALCHSCHMIDSchwerenöter in schwerer NotDie <strong>Kammeroper</strong> <strong>München</strong> und Antonio Salieris "Falstaff" auf Schloss NymphenburgAbendzeitung 26.8.2013Kein Verdi-Jahr bei der <strong>Kammeroper</strong> <strong>München</strong>. Ihren "Falstaff" bezieht die Truppe im Jahr, in dem ItaliensMusikdrama-Gigant seinen 200. Geburtstag feiert, bei Antonio Salieri. Diese Adaption von "Die lustigenWeiber von Windsor" entstand 94 Jahre vor jener Giuseppe Verdis, die üblicherweise auf den Spielplänensteht. Unüblich auch der Auftritt des Dirigenten: Der begrüßt das Publikum nicht aus dem Graben, sondernerklimmt zunächst ein Baugerüst, auf dem sein Orchester thront.Zu den nur drei Holzbläsern und fünf Streichern sowie, für die wenigen zarten Momente, ein Lautenspieler,kommen Akkordeon und Marimbaphon hinzu. Deren spezielle Färbungen geben dem knapp geschnittenenund präzise musizierenden Klangkörper unter dem Dach des Hubertussaals im Schloss Nymphenburg Fülle.Dirigent Nabil Shehata schafft mit diesem Instrumentarium einen sehr transparenten und originellen Sound.Die Position des Orchesters über der Szene ist dabei nicht wirklich neu: Schon im Globe Theatre saßen dieMusiker auf einer Hochbühne. Und es ist vor allem das Stammhaus William Shakespeares aus dem 16.Jahrhundert, auf das sich die Inszenierung von Bernd Schadewald und die Ausstattung von Irene Edenhofer-Welzl berufen. Da das Theater der elisabethanischen Zeit sich nicht als Kunsttempel verstand, sondern alsEntertainment für alle, haut der Regisseur, wenn es um Klamotte geht, ordentlich auf die Pauke. Ihm zurSeite steht die Übersetzung des Librettos, die Dominik Wilgenbus fertigte: Muntere, nicht selten intelligenteGirlanden von Alliterationen, aber auch allzu unkritisches Herüberretten vonhistorischem Machismo in dieGegenwart. Titelheld ist der Wiener Florian Pejrimovsky, der von Erscheinung und Stimme her fast zu knuffigerscheint für den unersättlichen und egofixierten Schwerenöter in schwerer Not.Das sehr junge Team von Sängerinnen und Sängern zeigt sich blendend aufgelegt. Vor allem AthanasiaZöhrer erweist sich als Mrs. Ford nicht nur als Meisterin des Flirtens, sondern verfügt über einen frischenSopran, mit dem sie auch die Verschattungen ihrer Partie bewältigen kann. Das Zentrum aber ist Viola vonder Burg als Königin Elisabeth I. in einer zusätzlichen Rahmenhandlung. Die Schauspielerin, die sich in<strong>München</strong>s Off- Szene bedauerlicherweise rar gemacht hat, legt mit kunstvoll kehligem Timbre eine Queen aufdie Bretter, die sich als hexenhaft herrische Regiedespotin lustvoll verwirklicht.Mathias Hejny2
Und die Queen ist auch dabeiDie Münchner <strong>Kammeroper</strong> zeigt im Nymphenburger Hubertussaal Salieris "Falstaff'Münchner Merkur – Kultur vom 26.08.2013Es war schon klar, dass beim Shakespeare-Thema Falstaff der Komponist Antonio Salieri - nach Verdi, nachLortzing- den dritten Platz belegt. Daher hat Dominik Wilgenbus für das diesjährige Sommerstück derMünchner <strong>Kammeroper</strong> im Nymphenburger Hubertussaal als Übersetzer und Bearbeiter auch beherzteingegriffen, hat eine Person dazugeschrieben, die Dialoge und Arientexte frei nach- und umgedichtet. Und·das - wir kennen ihn als sonst geschickten Librettisten - diesmal mit allzu vielen Kalauern und arg biederenVersen ("Der Mann ist verbittert! die Frau lacht sich schlapp - da beißt mal die Maus keinen Faden nichtab!").Leider hat er das Stück, das Alexander Krampe wieder amüsant und sensibel auf elf Instrumente reduzierte,auch unnötig verlängert. Dreieinhalb Stunden- das hält dieser Salieri nicht aus, der zwar mit hübschen Arienaufwartet, aber mit einer lähmend spannungsarmen Handlung. Wo Verdi einen triumphierenden undkeinesfalls geschlagenen Falstaff mit "Alles ist Spaß auf Erden" enden lässt, stehen hier die Worte "Niemehr", nämlich Böses tun. Eine klägliche, nicht einmal ironisch genommene Quintessenz.Pfiffig ist nur die dazu erfundene Queen (Titania), die messerscharf und böse immer vergeblich auf Tempound Witz dringt. Viola von der Burg, ein Wahnsinnstyp in Stimme, Haltung und Allüre, macht das soglänzend, dass sie die Kritik an der braven Aufführung gleich mitliefert.Inszenieren sollte eigentlich Bernd Schadewald, der krankheitshalber in den letzten 14 Tagen die Regie anAlexander May abgeben musste. Möglich, dass dadurch nun weder der eine noch der andere ein passablesKonzept hingestellt hat. Heraus kam Konvention recht abgestandener Art mit nur wenigen frischenMomenten. Die <strong>Kammeroper</strong> blieb unter ihren Möglichkeiten.Von den Sängern schlugen sich gut Florian Pejrimovsky (Falstaff), Anastasia Zöhrer (Mrs. Ford) und, mitweitem Abstand am besten, ein genuines Bühnen- und Stimmtalent, Katharina Konradi aus Kirgisistan alsHausmädchen Betty.In flauen Momenten und nicht nur dann richtete man Blick und Ohren ganz auf die Empore über der Szene,wo Nabil Shehata mit seinem solistischen Orchester einen glänzend geprobten, federleicht und elegantgenommenen Salieri dirigierte. Das freundliche Stammpublikum war's zufrieden.BEATE KAYSER3
BR-Klassik vom 26.08.2013"Falstaff" mit der <strong>Kammeroper</strong> <strong>München</strong>Fast 100 Jahre vor Giuseppe Verdis "Falstaff" hat Antonio Salieri seine Version dieser Geschichte auf dieBühne gebracht. Am Samstag feierte Salieris "Falstaff" in der Inszenierung der <strong>Kammeroper</strong> <strong>München</strong>Premiere. Das Motto für die Produktionen dort lautet: "Jung-frech-unkonventionell-anders".Baustelle im Hubertussaal? Ein mit schwarzen Vorhängen verhülltes Metallgerüst verstellt die Front desRaums. „Globe Theatre“ ist darauf zu lesen. Wir sind also bei Shakespeare. Ganz oben, unter der Decke,sitzen zehn Instrumentalisten. Über eine schmale Treppe klettert Dirigent Nabil Shehata zu seinen Musikernhoch – und sorgt mit ihnen von der ersten Sekunde an für ein Klangwunder.Leichtfüßig-elegante LesartTransparent und brillant wird hier musiziert: die Instrumentalisten der <strong>Kammeroper</strong> <strong>München</strong> sind allesamtVirtuosen. Pfiffig und überaus stimmungsvoll hat Arrangeur Alexander Krampe Salieris Orchesterpartitur fürdieses kleine Ensemble bearbeitet. Marimbaphon und Akkordeon verleihen der Musik eine eigentümlichmelancholische und exotische Note. Eigentlich ist Salieris „Falstaff“ nichts für romantische Seelen - aber dieleichtfüßig-elegante Lesart der <strong>Kammeroper</strong> <strong>München</strong> nimmt dem Stück in vielen Szenen dieBodenständigkeit.Königin Elisabeth die Erste als neue FigurGesungen wird auf deutsch – in der witzig-spritzigen Neuübersetzung des <strong>Kammeroper</strong>-MitbegründersDominik Wilgenbus. Regisseur Bernd Schadewald hat sich eine zusätzliche Figur einfallen lassen: KöniginElisabeth die Erste, Auftraggeberin dieser Komödie, eine Sprechrolle. Viola von der Burg im schlichtenorange-roten Kostüm und mit kunstvoll verdrechseltem Kopfschmuck ist der Clou dieser Inszenierung undverleiht ihrer Majestät Grandezza und fein abgezirkelte Komik - mit exaltierten Gesten und hoheitsvollartikulierendem Damenbass:Diese Königin nimmt nicht huldvoll ein ihr gewidmetes Theaterstück entgegen, nein: sie liest im Manuskriptmit, kritisiert und korrigiert die Auftritte der Akteure, führt Regie. Und füttert zwischendurch denhingebungsvoll für sie aufspielenden Lautenisten mit Schokoküssen.Anrührende PoesieDieser „Falstaff“ prunkt nicht mit überaus originellen inszenatorischen Details: schwarze Vorhänge dienen alsVersteck, das Hirschgeweih ist ein Hirschgeweih und der dicke Ritter landet wirklich im Waschkorb. Das kenntman schon. Von anrührender Poesie aber ist das Schlussbild: wenn sich der Wald von Windsor für ein paarlange Augenblicke in eine dunkelrot ausgeleuchtete Kaschemme verwandelt, in der die Paare dieserGeschichte traurig tanzend vergeblich nach der Liebe suchen.Darstellerische und musikalische PräzisionFaszinierend ist die darstellerische und musikalische Präzision, mit der in dieser Produktion gearbeitet wird.Die Ensembles gelingen allesamt hinreißend. Sängerische Königin des Abends ist die erst 24-jährige BerlinerinAthanasia Zöhrer als Mrs. Ford - eine brillante Komödiantin mit klangschönem, sicherem und beweglichemSopran. An das silbrig glänzende Timbre einer Reri Grist erinnert die Stimme der bezaubernden KatharinaKonradi als Zofe Betty. Der Wiener Florian Pejrimovsky stürzt sich mit prächtigem Bariton und mutigemEinsatz seines fülligen Körpers in seine Rolle.Leid tut einem dieser Ritter von der traurigen Gestalt allerdings nicht – doch auch das ist eher Salierianzulasten, dem mehr an Bestrafung und deftigem Spaß und weniger an Versöhnung liegt. Für die echtenLiebesgefühle sind vielleicht doch Nicolai und Verdi zuständig.4
MUCBOOK vom 28.08.2013So ging man mit aufdringlichen Verehrern umVon Corinna KlimekDie <strong>Kammeroper</strong> <strong>München</strong> begeistert wieder mit einer witzigen Bearbeitung einerkomischen Oper, auch wenn diese, anders als die Cenerentola im Vorjahr, kleineLängen aufweist. Falstaff ist ein in die Jahre gekommener Ritter, Alkoholiker undewig pleite. Der Ausweg aus seiner Misere schein eine Liebschaft mit Mrs Ford zusein, über die er an den Geldbeutel ihres Mannes rankommt. Oder doch lieber mitMrs Slender? Ach was, Falstaff ist nicht zurückhaltend und versucht gleich beideFrauen zu verführen. Die sind aber schlauer als er und verbünden sich gegen ihn. So landet der dicke Rittermal in der Themse, mal wird er ordentlich durchgeprügelt und am Ende gar fast zu Tode gekitzelt. Hilfeerhalten die beiden Frauen von ihren Ehemännern, wobei Mr Ford erst mal für seine Eifersucht bestraftwerden muss, was die beiden Frauen aber auch mit links machen.Das Libretto von Salieris Bearbeitung des Shakespeare-Stoffes ist auf Italienisch, und wie es gute Tradition beider <strong>Kammeroper</strong> <strong>München</strong> ist, hat Dominik Wilgenbus sich an eine Neuübersetzung gemacht undherausgekommen ist eine witzige, freche und zeitlose Komödie. Der große Opernlibrettist Lorenzo da Pontesoll übrigens selbst für Übersetzungen gewesen sein und folgerichtig wurden Mozarts große Opern imdeutschsprachigen Raum auch auf Deutsch gesungen. Übertitelungsanlagen sind kein Ersatz für eine guteÜbersetzung.Wilgenbus hat sich aber nicht nur der Übersetzung angenommen, sondern hat auchnoch eine Figur hinzuerfunden: Königin Elizabeth I, die sich persönlich von demneuen Stück des großen Barden überzeugen möchte und dann in den Handlungeingreift und sich zum Beispiel mit Falstaff einen Schlagabtausch liefert oder mitdem Lautenisten erst flirtet, nur um ihm dann einen Schaumkuss ins Gesicht zudrücken. Viola von der Burg beeindruckte in der Rolle mit kehliger Stimme undresolutem Auftreten und an ihr lag es sicher nicht, dass sich die Figur irgendwann abnutzte. So gut die Figurauch hineingepasst hat, am Ende wurde ich ihrer überdrüssig.Aber das ist auch schon der einzige Kritikpunkt, den ich an diesem Abend habe. Die Gebrauchsmusik Salieris,die an sehr vielen Stellen stark an Mozart erinnerte, vor allem an den Figaro, wird oft als langweiligbeschrieben, davon war keine Spur. Das Arrangement von Alexander Krampe für die Münchner <strong>Kammeroper</strong>war wieder einmal ein klangliches Erlebnis, außergewöhnlich durch Marimbaphon und Akkordeon und genauzugeschnitten auf das Orchester, das aus nur 10 Musikern besteht, aber eine Klangfülle mit unglaublicherVirtuosität erzeugte. Das Orchester, das mit seinem wie immer hervorragenden musikalischen Leiter NabilShehata unter der Decke klebte, entzückte durchgängig, obwohl die Musiker wohl am meisten unter dergroßen Wärme im Saal zu leiden hatten.400 Sängern hätten sich um die Rollen beworben, erzählten Dominik Wilgenbus und der Direktor der<strong>Kammeroper</strong> Christoph Gördes in der Einführung vor der Vorstellung. 200 hätten sie sich angehört und manmerkte an diesem Abend, dass sie sich wirklich die besten herausgepickt hatten. Die <strong>Kammeroper</strong> <strong>München</strong>legt Wert auf die Förderung junger Musiker und so war auch die erst 24-jährige Athanasia Zöhrer aus Berlinin der Partie der Mrs Ford der Star des Abends. Trotz ihrer jugendlichen Erscheinung verkörperte sie einegestandene Frau, die sich eines lästigen Verehrers erwehren muss, glaubhaft. Ihr wunderbarer Sopranüberstrahlte mit Leichtigkeit alle Ensembles. Ebenfalls aufmerken lies die nur ein Jahr ältere KirgisinKatharina Konradi in der Rolle der Dienerin Betty. Besonders gut gelungen ist die Besetzung des Falstaff mitdem Wiener Florian Pejrimovsky, von Statur und Stimme prädestiniert für diese Rolle. Robert Schär als MrFord. Philipp Jekel als Mr. Slender, Florence Losseau (in der letzten Spielzeit als Schlaues Füchslein amGärtnerplatztheater zu sehen) als Mrs Slender sowie Carl Rumstadt als Bardolf ergänzten das sängerisch wieszenisch hochklassige Ensemble.5
Weitere Vorstellungen bis 14.09.2013, jeweils 19.30 Uhr (sehr hörenswerteEinführung um 18.30 Uhr) im Hubertussaal des Schlosses Nymphenburg. Karten von25€ bis 58€, Ermäßigung für Schüler und Studenten. Am 28., 29. Und 31.8. sowieam 01.09. jeweils um 15 Uhr gibt es eine Kindervorstellung des Stückes RitterFalstaff oder drei Streiche für ein Schepperfass!, eine kleine Oper für Kinder ab 4Jahren und die ganze Familie, Musik von Antonio Salieri, spielen wird dasFigurentheater Moritz Trauzettel. Karten zu 13€ bwz 9€ können ebenfalls über die <strong>Kammeroper</strong> <strong>München</strong>bezogen werden.THEATER TO GO vom 26.08.2013Ein Mann, vom Schlemmen aufgedunsen, alt und verdorbenAntonio Salieris „Falstaff“ auf Schloss NymphenburgVon Thomas Kuchlbauer„Und ich Dummer darf den Schlummer von dem Schlemmer dann bewachen!“ stöhnt Bardolf neben seinemschnarchenden Dienstherren Sir John Falstaff. Er lehnt sich gähnend an dessen fettleibigen und aufgeblähtenBauch an und fällt mit den Worten „Du kannst auch gleich ins Hospiz gehen, weil’s im Gefängnis mit Falstaffviel zu eng is‘!“ ebenfalls in tiefen Schlaf.Trotz des mindestens genauso übergewichtigen Verdi-Jahres befinden wir uns nicht in einer „Falstaff“-Aufführung von Verdi, sondern in der von Antonio Salieri fast 100 Jahre zuvor komponierten Version. Die<strong>Kammeroper</strong> <strong>München</strong> setzt das 1799 erfolgreich uraufgeführte, heute aber völlig unbekannte Werk, imHubertussaal auf Schloss Nymphenburg in Szene. Ähnlich wie bei Verdi steht auch hier die Titelfigur Falstaffim Zentrum des Geschehens: durch Intrigen und Bühnenbriefe wirbelt er die Ehen der Pärchen Ford, Slenderund die Liebschaft seines Dieners auf, wobei er schlussendlich selbst das Nachsehen hat. Dass die Oper denDa Ponte-Opern Mozarts, offensichtliche Vorbilder Salieris, oder dem Meisterwerk Verdis das Wasser reichenkann, wäre jedoch eine schamlose Übertreibung.Dass sie in <strong>München</strong> dennoch erstaunlich gut funktioniert, liegt an der aktualisierten und modernenNeufassung des Librettos von Dominik Wilgenbus. In seiner intelligenten und durch gewitzte Zitateangereicherten Fassung wird die Handlung von Salieris Oper direkt für Queen Elisabeth I. gegeben, die es sichnicht nehmen lässt, als Regisseurin in die Aufführung von Shakespeares „Falstaff“ einzugreifen. Unterstütztwird diese „Theater auf dem Theater“-Situation durch das Bühnenbild von Irene Edenhofer-Welzl, die miteiner Baugerüstkonstruktion auch auf die öffentlichen Theatergebäude um 1600 verweist: eine kleine undeinsehbare Bühnenplattform mit Bühnenvorhang, wenige Requisiten, Versenkungsmöglichkeiten und dasOrchester über der Bühne stellen einige Beispiele dafür dar. Dem gegenüber stehen Elemente des höfischenTheaters, wie Elisabeth, Brokat im Hintergrund und Schloss Nymphenburg als Aufführungsort. Mit dieserLesart reiht sich das Produktionsteam zudem in die „Theater auf dem Theater“-Inszenierungen der MünchnerRezeptionsgeschichte des Falstaff-Stoffes der letzten Jahre ein.Die beiden Spielebenen werden permanent vermischt, wobei die Trennung zwischen Figuren im Stück undDarstellern im Gespräch mit Elisabeth sehr durchlässig ist. Aus dieser Spannung ergeben sich in derAufführung äußerst reizvolle Figurenportraits: Mrs. Ford wird beispielsweise als Sängerin gezeigt, die es leidist, Komödienglück vorzuspielen. Stattdessen will sie sich lieber um ihr Privatleben kümmern, was die6
Sängerin Athanasia Zöhrer besonders treffend in ihrer letzten Arie zum Ausdruck bringt. Neben einerintensiven Darstellung ihrer emotionalen Verfasstheit gelingen ihr die großen Linien mühelos. Äußerst lyrischund innerlich wird dagegen ihr Gatte Mr. Ford von Robert Schär gegeben. Der Regisseur Bernd Schadewaldzeigt diese Figur im Spannungsfeld zwischen gespielter Liebe, Geschlechterrollen und Transvestismus. AuchElisabeth muss sich zwischen dem Ausleben ihrer Sexualität, Propagandatheater und freier Kunst immerwieder neu definieren, was Viola von der Burg eindrucksvoll gelingt. Ebenso stehen die übrigen Solisten durchFrische und ihren jugendlichen Spieleifer auf der Positivliste, wobei vor allem noch Florian Pejrimovsky alsFalstaff zu hervorzuheben ist, der sich mit wuchtigem Bariton seinen Weg durch das Gewirr an Spielebenenschlägt.Begleitet werden sie dazu vom Orchester der <strong>Kammeroper</strong> <strong>München</strong> unter dem Dirigat von Nabil Shehata,dem es trotz der ungewöhnlichen Position über dem Bühnengeschehen gelingt, den Kontakt zu den Sängernnicht zu verlieren. Das musikalische Arrangement von Alexander Krampe stellt ein weiteres Positivum derAufführung dar: Wie bei vielen Kammerfassungen ist auch hier zu beobachten, dass die individuellenInstrumente nicht in einem überbordenden Orchesterklang untergehen, sondern vielmehr individuellwahrgenommen werden können. Besonders gelungen ist der Einbezug von Akkordeon und Marimbaphon,wodurch der Humor auch auf musikalischer Ebene fortgesetzt wird.Am Schluss des Abends, dem durchaus einige Kürzungen gut getan hätten, scheint es, als ob die Verwischungder Spielebenen überwunden sei und die einzelnen Paare ihre persönlichen Konflikte behoben hätten.Dadurch gestärkt bieten sie Falstaff keine Angriffsfläche mehr für seine Liebeleien und versuchen ihn förmlichvon der Bühne herunterzutreiben.Premiere: 24. August 2013, besuchte Vorstellung: 25. August 2013; weitere Vorstellungen: 28., 29., 31.August, 01., 04., 05., 07., 08., 11., 12, 14. September 2013.<strong>Kammeroper</strong> <strong>München</strong>, Gollierstraße 70, 80339 <strong>München</strong>Tel. +49 (89) 4520 561-0k.wernicke@kammeroper-muenchen.comwww.kammeroper-muenchen.com7