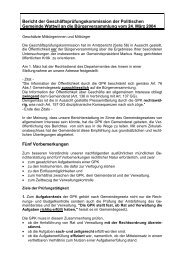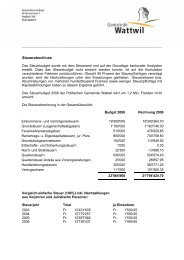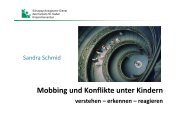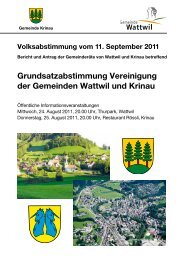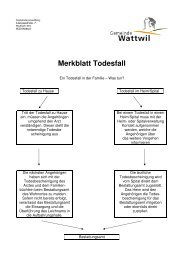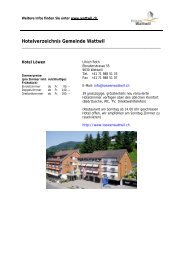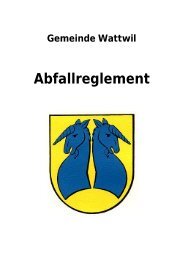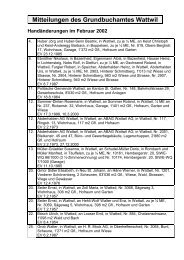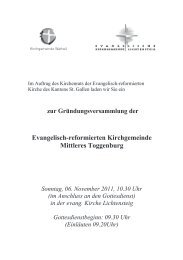GRUNDWASSER-WÄRMEPOTENTIAL IM TALBODEN VON EBNAT ...
GRUNDWASSER-WÄRMEPOTENTIAL IM TALBODEN VON EBNAT ...
GRUNDWASSER-WÄRMEPOTENTIAL IM TALBODEN VON EBNAT ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>GRUNDWASSER</strong>-<strong>WÄRMEPOTENTIAL</strong><br />
<strong>IM</strong> <strong>TALBODEN</strong> <strong>VON</strong> <strong>EBNAT</strong>-KAPPEL UND WATTWIL<br />
Bearbeitung Geologie:<br />
Potentialanalyse<br />
St. Gallen / Wil, 29. Juni 2011<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG<br />
9015 St.Gallen - Winkeln<br />
Schoretshuebstrasse 23<br />
Tel 071/371 17 33<br />
Fax 071/371 29 70<br />
E-Mail lh.winkeln@haering-geo.ch www.haering-geo.ch<br />
Bearbeitung Wärmenutzungspotential:<br />
8592 Uttwil (TG)<br />
Im Müsli 37, Postfach 61<br />
Tel 071/461 22 82<br />
Fax 071/461 22 83<br />
E-Mail lh.uttwil@haering-geo.ch<br />
Ingenieurbüro Calorex, Widmer & Partner AG<br />
Gallusstrasse 35, 9500 Wil<br />
Telefon: 071 / 913 27 70, Telefax: 071 / 913 27 89<br />
info@calorex.ch<br />
Projektleiter: Urs Zwingli
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite I<br />
INHALTSVERZEICHNIS<br />
Vorwort von Thomas Grob, Geschäftsführer energietal toggenburg .......................... 1<br />
1. AUSGANGSLAGE UND ZIELSETZUNG .................................................................. 2<br />
1.1 Ausgangslage ............................................................................................................ 2<br />
1.2 Auftrag ....................................................................................................................... 2<br />
1.3 Aufgabenstellung / Zielsetzung .................................................................................. 2<br />
2. GRUNDLAGEN ......................................................................................................... 3<br />
2.1 Geologisch-hydrogeologische Karten ........................................................................ 3<br />
2.2 Untersuchungsperimeter ........................................................................................... 3<br />
2.3 Vorhandene Bohrungen ............................................................................................. 3<br />
2.4 Datenlogger ............................................................................................................... 4<br />
2.5 Grundwasserschutzzonen und –areale ...................................................................... 4<br />
2.6 Belastete Standorte ................................................................................................... 4<br />
3. DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN ............................................................................... 5<br />
4. GESETZLICHE GRUNDLAGEN ............................................................................... 5<br />
4.1 Grundsätze ................................................................................................................ 5<br />
4.2 Bestimmungen des Bundes ....................................................................................... 5<br />
4.3 Bestimmungen des Kantons ...................................................................................... 7<br />
4.4 Wegleitungen des Bundes ......................................................................................... 7<br />
4.5 Planerischer Grundwasserschutz .............................................................................. 7<br />
5. BEWILLIGUNGSVERFAHREN ................................................................................. 8<br />
5.1 Grundsätze ................................................................................................................ 8<br />
5.2 Wasserrechtsverleihungsverfahren ............................................................................ 8<br />
6. GEOLOGISCHE UND HYDROGEOLOGISCHE VERHÄLTNISSE ........................... 9<br />
6.1 Geologische Übersicht ............................................................................................... 9<br />
6.2 Felsuntergrund ........................................................................................................ 10<br />
6.2.1 Ebnat-Kappel ............................................................................................ 10<br />
6.2.2 Wattwil ...................................................................................................... 10<br />
6.3 Hydrogeologie ......................................................................................................... 10<br />
6.4 Durchlässigkeit ........................................................................................................ 11<br />
6.5 Transmissivität ......................................................................................................... 12<br />
6.6 Grundwasserspiegel ................................................................................................ 12<br />
6.6.1 Allgemeine Bemerkungen ......................................................................... 12<br />
6.6.2 Talboden von Ebnat-Kappel ..................................................................... 13<br />
6.6.3 Talboden von Wattwil ............................................................................... 14<br />
6.7 Grundwasserneubildung .......................................................................................... 14<br />
6.7.1 Allgemeine Bemerkungen ......................................................................... 14<br />
6.7.2 Talboden von Ebnat-Kappel ..................................................................... 14<br />
6.7.3 Talboden von Wattwil ............................................................................... 15<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite II<br />
6.8 Wasserqualität ......................................................................................................... 15<br />
7. HYDROTHERMIE ................................................................................................... 16<br />
7.1 Jahresverlauf der Grundwassertemperatur .............................................................. 16<br />
7.2 Talboden von Ebnat-Kappel .................................................................................... 16<br />
7.3 Talboden von Wattwil .............................................................................................. 18<br />
7.4 Auswirkungen auf die Nutzung ................................................................................ 18<br />
8. WÄRMENUTZUNG ................................................................................................. 19<br />
8.1 Grundwasserwärmenutzungskarte .......................................................................... 19<br />
8.1.1 Einteilung in verschiedene Bereiche ......................................................... 19<br />
8.1.2 Vorgehen zur Erstellung der Karte ............................................................ 19<br />
8.1.3 Verbotene und ungeeignete Gebiete ........................................................ 21<br />
8.1.3.1 Grundwasserschutzzonen und –areale .................................................... 21<br />
8.1.3.2 Belastete Standorte ................................................................................. 21<br />
8.1.3.3 Geologische und hydrogeologische Gründe ............................................ 21<br />
8.1.4 Mässig geeignete Gebiete ........................................................................ 22<br />
8.1.5 Mässig bis gut geeignete Gebiete ............................................................. 22<br />
8.1.6 Gut bis sehr gut geeignete Gebiete .......................................................... 22<br />
8.1.7 Hinweise zur Anwendung der Grundwasserwärmenutzungskarte............. 23<br />
8.2 Approximative Hochrechnung auf das nutzbare Wärmepotential ............................. 23<br />
9. WÄRMENUTZUNGSPOTENTIAL ........................................................................... 25<br />
9.1 Ausgangslage und Zielsetzung ................................................................................ 25<br />
9.1.1 Ausgangslage ........................................................................................... 25<br />
9.1.2 Auftrag ...................................................................................................... 26<br />
9.1.3 Aufgabenstellung / Zielsetzung ................................................................. 26<br />
9.2 Grundlagen .............................................................................................................. 26<br />
9.2.1 Grundwassertemperaturen ....................................................................... 26<br />
9.2.2 Grundwasserfördermenge ........................................................................ 32<br />
9.2.3 Grundwasserabkühlung ............................................................................ 34<br />
9.2.4 Spezifische Wärmenutzung ...................................................................... 35<br />
9.2.5 Anzahl Wärmenutzungsanlagen ............................................................... 37<br />
9.2.6 Gewinnungsfaktor ..................................................................................... 39<br />
9.2.7 Prinzipielle Einbindung ............................................................................. 42<br />
9.2.8 Grundwasser-Entnahme ........................................................................... 49<br />
9.2.9 Grundwasser-Rückgabe ........................................................................... 50<br />
9.3 Wärmenutzungspotential Ebnat-Kappel ................................................................... 51<br />
9.4 Wärmenutzungspotential Wattwil ............................................................................. 57<br />
9.5 Zusammenfassung .................................................................................................. 63<br />
10. SCHLUSSWORT .................................................................................................... 64<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite III<br />
ANHANG<br />
Nr. 1: Verwendete Unterlagen<br />
Nr. 2: Übersichtsplan Ebnat-Kappel mit Standorten der Datenlogger<br />
Nr. 3: Übersichtsplan Wattwil mit Standorten der Datenlogger<br />
Nr. 4: Wasserrechtsverleihungsverfahren; Wichtige Unterlagen<br />
Nr. 5: Grundwasserspiegelmessungen Ebnat-Kappel<br />
Nr. 6: Grundwasserspiegelmessungen Wattwil<br />
Nr. 7: Grundwassertemperaturen Ebnat-Kappel<br />
Nr. 8: Grundwassertemperaturen Wattwil<br />
Nr. 9: Jahresverlauf der Grundwassertemperaturen beim Profil Bürstenfabrik<br />
Nr. 10: Profilmessungen Temperatur und Leitfähigkeit an verschiedenen Messstellen<br />
Nr. 11: Auflistung aller Bohrungen mit Angaben zur Ergiebigkeit<br />
Nr. 12: Bohrprofile 2010<br />
BEILAGEN<br />
Nr. 1: Grundlagenkarte Teil Ebnat-Kappel; Plan Nr. 2009-135/1<br />
Nr. 2: Grundlagenkarte Teil Wattwil Süd; Plan Nr. 2009-135/2<br />
Nr. 3: Grundlagenkarte Teil Wattwil Nord; Plan Nr. 2009-135/3<br />
Nr. 4: Geologisches Profil 1; Plan Nr. 2009-135/4<br />
Nr. 5: Geologisches Profil 2; Plan Nr. 2009-135/5<br />
Nr. 6: Geologisches Profil 3; Plan Nr. 2009-135/6<br />
Nr. 7: Geologisches Profil 4; Plan Nr. 2009-135/7<br />
Nr. 8: Grundwasserwärmenutzungskarte Teil Ebnat-Kappel; Plan Nr. 2009-135/8<br />
Nr. 9: Grundwasserwärmenutzungskarte Teil Wattwil Süd; Plan Nr. 2009-135/9<br />
Nr. 10: Grundwasserwärmenutzungskarte Teil Wattwil Nord; Plan Nr. 2009-135/10<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 1<br />
Vorwort von Thomas Grob, Geschäftsführer energietal toggenburg<br />
Grundwasser ist ein guter Energieträger in der Familie der untiefen, geothermischen Wärmenutzungen.<br />
Das Wärmepotential von Grundwasser ist bis zu 30% höher als bei den häufig<br />
verwendeten Erdsonden und noch höher, als bei Luft-Wasser-Wärmepumpen. Die Bohrungen<br />
müssen wesentlich weniger tief erfolgen als bei Erdsonden, was sich auch auf die Erstellungskosten<br />
positiv auswirkt. Die Realisierung von Grundwassernutzungen ist mit Risiken<br />
verbunden, da nur mit Bohrungen abschliessend festgestellt werden kann, ob genügend<br />
nutzbares Wasser vorhanden ist.<br />
Die Gemeinden Ebnat-Kappel und Wattwil verfügen über grössere, zusammenhängende<br />
Grundwasserleiter im besiedelten Gebiet. Aufgrund der starken Nachfrage für die Nutzung<br />
von erneuerbaren Energien ist der Druck auf die Grundwassernutzung stark gestiegen.<br />
Grundwasser hat aber auch andere wichtige Funktionen, beispielsweise für die Entwicklung<br />
der Gewässer, der Wasserspeicherung für die Natur und die Trinkwasserversorgung.<br />
Mit der Potentialanalyse Wattwil – Ebnat-Kappel soll untersucht werden, wie gross das nutzbare<br />
Potential ist, wo es vorhanden ist und in welcher Art es genutzt werden kann. Die Analyse<br />
soll den Investoren helfen, die Beurteilung auf einer guten Basis vornehmen und die<br />
Risiken eindämmen zu können. Die Behörden sollen eine Grundlage für die Bewilligungserteilung<br />
und die zielgerichtete Nutzung erhalten. Die Analyse deckt auch einen wichtigen Teilbereich<br />
für die Erarbeitung eines Energiekonzepts ab.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 2<br />
1. AUSGANGSLAGE UND ZIELSETZUNG<br />
1.1 Ausgangslage<br />
Im Talboden der Gemeinden Ebnat-Kappel und Wattwil im Toggenburg sind grössere zusammenhängende<br />
Grundwasservorkommen vorhanden. Die Grundwasservorkommen liegen<br />
teilweise im besiedelten Gebiet, weshalb sie sich für die Energienutzung eignen könnten.<br />
In der "Familie der Geothermie" ist das Grundwasser ein guter Energieträger. Mittels Wärmepumpen,<br />
welche dem Grundwasser Wärme entziehen und auf ein höheres nutzbares<br />
Energieniveau heben, kann Heizenergie gewonnen werden. Das Grundwasser eignet sich<br />
aufgrund seiner Reinheit und seiner relativ gleichmässigen Temperatur als Wärmequelle für<br />
Wärmepumpen. Durch die Rückgabe des Grundwassers in das gleiche Grundwasservorkommen<br />
kann eine Beeinträchtigung der Grundwassermenge verhindert werden.<br />
Eine mögliche Grundwassernutzung ist abhängig von der Ergiebigkeit des Grundwasserleiters<br />
an einem gewissen Standort. Bei zu geringen Grundwassermächtigkeiten, bei Standorten<br />
innerhalb eines Katastereintrags oder bei Standorten innerhalb einer Grundwasserschutzzone<br />
oder eines Grundwasserschutzareals sind Grundwassernutzungen ausgeschlossen.<br />
Aufgrund dieser Kriterien gibt es innerhalb eines Grundwasservorkommens unterschiedlich<br />
geeignete Gebiete zur Nutzung des Grundwassers als Wärmequelle.<br />
Die energetische Nutzung des Grundwassers ermöglicht die Reduzierung von fossilen und<br />
anderen umweltbelastenden Energiequellen. Gegenüber den häufig verwendeten Erdwärmesonden<br />
ist das Wärmepotential von Grundwasser deutlich höher und die geringere Bohrtiefe<br />
wirkt sich positiv auf die Erstellungskosten aus.<br />
1.2 Auftrag<br />
Die energietal toggenburg mit Sitz in Wattwil hat 2009 zusammen mit den Gemeinden und<br />
Wasserversorgungen Ebnat-Kappel und Wattwil sowie dem Amt für Umwelt und Energie<br />
St.Gallen (AFU) das Projekt Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil lanciert.<br />
Die Projektleitung, vertreten durch Thomas Grob, beauftragte unser Büro, für das definierte<br />
Untersuchungsgebiet eine Potentialanalyse durchzuführen. Der Untersuchungsperimeter<br />
umfasst die Talebene zwischen Ebnat-Kappel im Südosten und Wattwil im Nordwesten. In<br />
der Potentialanalyse soll ermittelt werden, in welchen Gebieten Grundwasser zu Wärmezwecken<br />
genutzt werden könnte.<br />
1.3 Aufgabenstellung / Zielsetzung<br />
Im Zusammenhang mit der Potentialanalyse mussten folgende Aufgaben erfüllt werden:<br />
� Beschaffung der vorhandenen Unterlagen in den Archiven der Gemeinden, des AFU’s,<br />
der Wasserversorgungen und privater Büros;<br />
� Auswertung der hydrogeologischen Grundlagen im Talboden von Ebnat-Kappel und<br />
Wattwil im Hinblick auf die potentielle Nutzung des Grundwassers als Wärmequelle;<br />
� Ergänzung der hydrogeologischen Daten mit neuen Bohrungen;<br />
� Erstellen und Betreiben eines Messstellennetzes (Datenlogger);<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 3<br />
� Erhebung hydrogeologisch relevanter Daten (Mächtigkeit und Durchlässigkeit des<br />
Grundwasserleiters, Schwankungen des Grundwasserspiegels, Jahres–Temperaturverlauf);<br />
� Darstellung der Grundwasserleiter in Querprofilen.<br />
Das Projektziel umfasst<br />
� die planerische Darstellung der differenzierten Grundwassergebiete in Bezug auf das<br />
nutzbare Wärmepotential;<br />
� die Erarbeitung einer Entscheidungsgrundlage für die Beratung von Wärmebezügern.<br />
2. GRUNDLAGEN<br />
2.1 Geologisch-hydrogeologische Karten<br />
Für die Erarbeitung der Potentialanalyse waren die folgenden Karten von Bedeutung:<br />
� Kantonale Gewässerschutzkarte;<br />
� Kantonale Grundwasserkarte;<br />
� Geologischer Atlas der Schweiz 1 : 25'000, Blatt Nesslau (Nr. 1114), unpubliziert;<br />
� Hydrogeologische Karte der Schweiz 1 : 100'000, Blatt Toggenburg (Nr. 5), inkl. Erläuterungen.<br />
2.2 Untersuchungsperimeter<br />
Der Untersuchungsperimeter umfasst die Talebene von Ebnat-Kappel bis Wattwil und wird<br />
seitlich gegeben durch die Begrenzungslinie des Grundwasserleiters aus der kantonalen<br />
Grundwasserkarte.<br />
2.3 Vorhandene Bohrungen<br />
Aufgrund diverser geologischer und hydrogeologischer Abklärungen (Grundwasserevaluationen,<br />
Baugrunduntersuchungen, Untersuchungen zur Erdwärmenutzung, Grundwasserfassungen,<br />
Altlastenabklärungen etc.) gibt es im Talboden von Ebnat-Kappel und Wattwil eine<br />
Vielzahl an Aufzeichnungen von Sondierbohrungen. Mehr als dreihundertzwanzig Bohrprofile<br />
konnten in den Archiven des Kantons und der Gemeinden sowie in unserem Archiv ausfindig<br />
gemacht und ausgewertet werden. Die Bohrprofile enthalten wichtige Informationen über den<br />
Aufbau des Untergrundes sowie über die Lage und den Aufbau der Grundwasserleiter und<br />
des Grundwasserstauer. Einige der Bohrprofile bzw. die dazugehörigen Berichte beinhalten<br />
zusätzliche Angaben über die Lage des Grundwasserspiegels, über die Durchlässigkeit des<br />
Grundwasserleiters (“k-Wert“) und über die nachgewiesene oder vermutete Ergiebigkeit.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 4<br />
Die Datendichte innerhalb des Untersuchungsperimeters variiert sehr stark. Es gibt Gebiete<br />
wie z.B. bei der Firma Neher in Ebnat-Kappel und bei den Firmen Heberlein und Högg in<br />
Wattwil, wo viele neuere Bohrungen mit nützlichen Informationen vorhanden sind. Im Gegensatz<br />
dazu sind zwischen den Dörfern Ebnat-Kappel und Wattwil oder nördlich von Wattwil<br />
nur wenige Bohraufnahmen vorhanden.<br />
In überbauten Gebieten, wo grundsätzlich das Interesse für eine Grundwassernutzung ausgewiesen<br />
wäre, aber bisher ausreichende Informationen bezüglich der Grundwassernutzung<br />
fehlten, wurden sechs neue Bohrungen (Bohrprofile vgl. Anhang Nr. 12) abgeteuft. Mit den<br />
neu gewonnen hydrogeologischen Kenndaten konnten wichtige Informationslücken geschlossen<br />
werden.<br />
2.4 Datenlogger<br />
Die Grundwasservorkommen entlang der Thur sind z.T. stark von der Wasserführung der<br />
Fliessgewässer, insbesondere von der Thur, abhängig. Bei Hochwasser steigt der Grundwasserspiegel<br />
deutlich an, bei Trockenheit sinkt er. Ähnlich reagiert die Grundwassertemperatur<br />
auf die saisonalen Temperaturschwankungen der Oberflächengewässer, aber auch auf<br />
Witterungseinflüsse. Damit eine gesicherte Aussage bzgl. den Grundwassertemperaturen,<br />
dem Niveau des Grundwasserspiegels – und somit der nutzbaren Wassermenge – und dem<br />
Einfluss der Fliessgewässer auf die Grundwasservorkommen vorgenommen werden konnte,<br />
wurde in einigen ausgewählten Bohrungen Datenlogger eingebaut (vgl. Anhang Nr. 2 und<br />
Nr. 3). Im Gebiet Ebnat-Kappel mussten ältere Bohrungen für den Einbau des Datenloggers<br />
reaktiviert werden. Die Datenlogger zeichneten stündlich den Grundwasserspiegel und die<br />
Grundwassertemperatur auf.<br />
Zudem wurden uns von der DK Ebnat-Kappel die Grundwasserspiegelaufzeichnungen der<br />
Grundwasserfassung (GWF) Rohrgarten zur Verfügung gestellt.<br />
2.5 Grundwasserschutzzonen und –areale<br />
Die Standorte der Grundwasserschutzzonen und –areale im Untersuchungsgebiet wurden<br />
aus der kantonalen Gewässerschutzkarte entnommen. Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen<br />
sind innerhalb der Grundwasserschutzzonen und –areale keine Entnahmebrunnen<br />
und Versickerungsbauwerke für die Nutzung von Grundwasser zu Heiz- und Kühlzwecken<br />
erlaubt.<br />
2.6 Belastete Standorte<br />
Aufgrund der unbestimmten Risiken und des Aufwandes bei einer Grundwasserwärmenutzungsanlage<br />
innerhalb eines belasteten Standorts wird vom Bau einer Grundwasserwärmenutzungsanlage<br />
in belasteten Standorten abgeraten. Die belasteten Standorte im Talboden<br />
von Ebnat-Kappel und Wattwil wurden aus dem kantonalen Kataster der belasteten Standorte<br />
(KbS) des Geoportals übernommen.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 5<br />
3. DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN<br />
Im Rahmen dieser Potentialanalyse wurden folgende Arbeiten ausgeführt:<br />
� Archivrecherchen zur Beschaffung der vorhandenen hydrogeologischen Daten;<br />
� Erstellen der Übersichtskarten für die Gemeinden Ebnat-Kappel und Wattwil mit allen<br />
relevanten Messstellen, Grundwasserschutzzonen und –arealen sowie belasteten<br />
Standorten;<br />
� Erfassen der Grundlagendaten in einer Datenbank;<br />
� Auswertung der Grundlagendaten;<br />
� Installation und Betreuung von fünfzehn Datenloggern;<br />
� Ergänzung der hydrogeologischen Grundlagen mit sechs zusätzlichen Kernbohrungen;<br />
� Auswertung der Grundwasserspiegeldaten (Grundwasserstände aus historischen und<br />
aktuellen Bohraufzeichnungen, Datenlogger);<br />
� Auswertung der Wassertemperaturmessungen (Datenlogger);<br />
� Erfassen ausgewählter Temperaturprofile in Bohrungen und Grundwasserfassungen;<br />
� Erstellen der geologischen und hydrogeologischen Querprofile in Ebnat-Kappel und<br />
Wattwil;<br />
� Graphische Darstellung der Nutzbarkeit des Grundwassers in Grundwasserwärmenutzungskarten;<br />
� Erstellung eines hydrogeologischen Berichtes.<br />
4. GESETZLICHE GRUNDLAGEN<br />
4.1 Grundsätze<br />
Der qualitative und quantitative Schutz von Grundwasservorkommen ist von zentraler Bedeutung,<br />
um die Vorkommen für künftige Generationen sicherzustellen. Die Nutzung des<br />
Grundwassers birgt bei unsachgemässem Bau und Betrieb Risiken für die Qualität und bei<br />
zu hoher Entnahme für die Quantität des Grundwassers. Der Gesetzgeber hat deshalb auf<br />
Bundes- und Kantonsebene mit Gesetzen, Weisungen und Wegleitungen einen rechtlichen<br />
Rahmen definiert. Diese gesetzlichen Grundlagen regeln das Vorgehen auch für die Wärmenutzung<br />
aus dem Grundwasser.<br />
4.2 Bestimmungen des Bundes<br />
Auf Bundesebene sind für die Wärmenutzung aus dem Untergrund insbesondere die Gesetze<br />
und Verordnungen zum Gewässerschutz von Bedeutung. Die folgenden eidgenössischen<br />
Rechtsgrundlagen sind insbesondere massgebend:<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 6<br />
Bundesverfassung der Schweiz. Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101)<br />
� Art. 76: Der Bund legt Grundsätze über die Erhaltung und die Erschliessung der Wasservorkommen,<br />
über die Nutzung der Gewässer zur Energieerzeugung und für Kühlzwecke<br />
sowie über andere Eingriffe in den Wasserkreislauf fest und erlässt unter anderem<br />
Vorschriften über den Gewässerschutz.<br />
Gewässerschutzgesetz vom 24. Januar 1991 (GSchG, SR 814.20)<br />
� Art. 3: Das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer schreibt eine allgemeine Sorgfaltspflicht<br />
vor und verpflichtet jedermann, alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt<br />
anzuwenden, um nachteilige Einwirkungen auf die Gewässer zu vermeiden.<br />
� Art. 19 Abs. 2: Das Gewässerschutzgesetz verlangt eine kantonale Bewilligung für Bauten,<br />
Anlagen, Grabungen, Erdbewegungen und ähnliche Arbeiten in besonders gefährdeten<br />
Bereichen, wenn sie die Gewässer gefährden können.<br />
� Art. 43 Abs. 3: Grundwasservorkommen dürfen nicht dauernd miteinander verbunden<br />
werden, wenn dadurch Menge oder Qualität des Grundwassers beeinträchtigt werden<br />
können.<br />
Ferner sind die Artikel 4, 20, 21 und 45 GSchG zu beachten.<br />
Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV, SR 814.201)<br />
� Art. 31: Bei der Erstellung von Anlagen in Gebieten mit nutzbaren Grundwasservorkommen<br />
sind besondere Schutzmassnahmen einzuhalten. Als Schutzmassnahmen<br />
nennt die Verordnung die Massnahmen nach Anhang 4 Ziffer 2 GSchV sowie Überwachungs-,<br />
Alarm- und Bereitschaftsdispositive.<br />
� Art. 32: Für Anlagen in besonders gefährdeten Bereichen, die eine Gefahr für die Gewässer<br />
darstellen können, konkretisiert Artikel 32 GSchV die in Artikel 19 Absatz 2<br />
GSchG statuierte Bewilligungspflicht. Insbesondere für Bohrungen in Gebieten mit nutzbaren<br />
Grundwasservorkommen nennt Artikel 32 GSchV die Bewilligungspflicht explizit.<br />
Der Gesuchsteller muss den Nachweis erbringen, dass die Anforderungen zum Schutz<br />
der Gewässer erfüllt sind. Zum Schutz der Gewässer legt die kantonale Fachstelle Auflagen<br />
und Bedingungen sowie die Anforderungen an die Stilllegung der Anlage fest. Sie<br />
erteilt eine Bewilligung, wenn ein ausreichender Schutz der Gewässer gewährleistet<br />
werden kann.<br />
� Anhang 2 Ziffer 21: In diesem Anhang werden die allgemeinen Anforderungen an die<br />
Wasserqualität unterirdischer Gewässer geregelt. So darf gemäss Absatz 3 die Temperatur<br />
des Grundwassers durch Wärmeeintrag oder Wärmeentzug gegenüber dem natürlichen<br />
Zustand um höchstens 3 Grad Celsius verändert werden, wobei örtlich eng begrenzte<br />
Temperaturveränderungen vorbehalten bleiben. Absatz 4 enthält Anforderungen,<br />
die bei der Versickerung von Abwasser zu beachten sind und gemäss Absatz 5<br />
dürfen durch Versickerungsanlagen und Wasserentnahmen die schützende Deckschicht<br />
möglichst nicht verletzt und die Hydrodynamik nicht derart verändert werden, dass sich<br />
nachteilige Auswirkungen auf die Wasserqualität ergeben.<br />
Im Übrigen sind auch Artikel 29 und der Anhang 4 GSchV relevant.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 7<br />
4.3 Bestimmungen des Kantons<br />
Gemäss Art. 76 Abs. 4 BV verfügen die Kantone über die Wasservorkommen. Es liegt also<br />
im Kompetenzbereich der Kantone, die Wassernutzung durch Verleihung von Nutzungsrechten<br />
zu erlauben.<br />
Auf kantonaler Ebene ist neben den gewässerschutzrechtlichen Bestimmungen bei der<br />
Grundwassernutzung auch das kantonale Gesetz über die Gewässernutzung (sGS 751.1)<br />
relevant:<br />
� Art. 13: Die Errichtung und der Betrieb von Wärmepumpen bedürfen einer Verleihung<br />
des zuständigen Departements.<br />
� Art. 16: Das Verleihungsgesuch (mit Anlagebeschrieb und Projektplänen) wird in den<br />
Gemeinden, in denen die zu nutzenden Gewässerabschnitte liegen, während dreissig<br />
Tagen zur Einsicht aufgelegt.<br />
� Art. 19: Die Verleihung ist zu erteilen, falls der Staat von dem ihm zustehenden Vorzugsrecht<br />
keinen Gebrauch machen will und falls eine Gefährdung öffentlicher Interessen<br />
nicht zu befürchten ist.<br />
4.4 Wegleitungen des Bundes<br />
Die Wegleitung Grundwasserschutz 1 präzisiert, dass die Wärmenutzung insgesamt, also<br />
unter Berücksichtigung aller im betrachteten Grundwassergebiet installierten Anlagen, die<br />
natürliche saisonale Temperatur des Grundwassers um nicht mehr als 3 °C verändern darf.<br />
Im Umkreis von maximal 100 m um das Versickerungsbauwerk ist jedoch eine Temperaturveränderung<br />
von mehr als 3 °C zulässig.<br />
Weiter steht im gleichen Kapitel geschrieben, dass zum Schutz vor einer Verschmutzung des<br />
versickernden Wassers, Vorkehrungen zu treffen sind, welche eine Verschmutzung, z.B.<br />
durch ein Leck in der Wärmetauscheranlage, rechtzeitig erkennen lassen. Zudem ist sicherzustellen,<br />
dass keine Schadstoffe aus Drittquellen in die Versickerungsanlage gelangen können.<br />
Ferner ist auch die Vollzugshilfe "Wärmenutzung aus Boden und Untergrund" (BAFU 2009)<br />
zu beachten.<br />
4.5 Planerischer Grundwasserschutz<br />
Um den Schutz bestehender und künftiger Trinkwasserfassungen sicherzustellen und die für<br />
die Trinkwasserversorgung nutzbaren unterirdischen Gewässer zu erhalten, wurde der Gewässerschutzbereich<br />
Au bezeichnet. Grundwasserschutzzonen und –areale befinden sich<br />
immer im Gewässerschutzbereich Au. Innerhalb von Grundwasserschutzzonen und –arealen<br />
sind Grundwasserwärmenutzungen nicht zugelassen. Für die Rückgabe bzw. Rückversickerung<br />
des abgekühlten oder erwärmten Wassers ist zudem ein Mindestabstand zu bestehenden<br />
Grundwasserschutzzonen und –arealen einzuhalten.<br />
1 Wegleitung ‚Grundwasserschutz’ (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, BUWAL, 2004,<br />
heute Bundesamt für Umwelt, BAFU), Seite 66; Kapitel: Wärmenutzung aus dem Untergrund<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 8<br />
In folgender Tabelle sind die Möglichkeiten der Wärmenutzung aufgelistet:<br />
Grundwassergebiet und Grundwassernutzung Gewässerschutz- Anlagegrösse für die<br />
bereich/Zone S Wärmenutzung<br />
Für die Wassergewin- Grundwasserschutzzonen S Wärmenutzung nicht<br />
nung genutzte oder nutz- und –areale<br />
zulässig<br />
bareGrundwasservor- Mittlere bis grosse Grund- Au<br />
Festlegung in Grundkommen<br />
sowie die zu wassermächtigkeitwasserwärmenut<br />
ihrem Schutz notwendi- Geringe Grundwasser- Au<br />
zungsplangen<br />
Randgebiete<br />
mächtigkeit oder<br />
-ergiebigkeit<br />
Gebiete ausserhalb von Kein für die Wassergewin- üB, Ao<br />
Kleinanlagen möglich<br />
nutzbaren Grundwassernung nutzbares Grundwasleiternservorkommen<br />
vorhanden<br />
Tabelle 4.1: Mögliche Nutzung der Grundwasserwärme aus hydrogeologischer Sicht (In Anlehnung an<br />
die Zusammenstellung in der Planungshilfe "Wärmenutzung von Grundwasser"; Baudirektion Kanton<br />
Zürich, Juni 2008)<br />
5. BEWILLIGUNGSVERFAHREN<br />
5.1 Grundsätze<br />
Die Bewilligungspraxis soll sicherstellen, dass die unterirdischen Gewässer auch zukünftigen<br />
Generationen eine sichere und einwandfreie Trinkwassergewinnung ermöglichen. Deshalb<br />
ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Anlagen unabdingbar. Für die Bewilligung<br />
zum Entzug von Wärme aus dem Grundwasser sind die kantonalen Behörden zuständig. Im<br />
Kanton St.Gallen ist dies das Amt für Umwelt und Energie (AFU SG).<br />
Die Errichtung und der Betrieb von Wärmepumpenanlagen mit Nutzung von Wasser bedarf<br />
gemäss dem Gesetz über die Gewässernutzung (sGS 751.1) einer Verleihung (Konzession)<br />
des Baudepartmentes. Zusätzlich ist eine gewässerschutzrechtliche Bewilligung notwendig<br />
und eine kommunale Baubewilligung kann erforderlich sein.<br />
5.2 Wasserrechtsverleihungsverfahren<br />
Die Darstellung des gesamten Wasserrechtsverleihungsverfahren (Vorabklärung, Gesuchseinreichung<br />
und Bewilligungsverfahren) und die wichtigsten Unterlagen für die Gesuchsstellung<br />
sind im Anhang Nr. 4 zusammengestellt.<br />
Im Internet wird das Wasserrechtsverleihungsverfahren unter der folgenden Adresse beschrieben:<br />
http://www.umwelt.sg.ch/home<br />
-> Recht und Verfahren<br />
->Bewilligungsverfahren<br />
-> Gewässernutzung/Wasserbau<br />
-> Verleihungen und Bewilligungen<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 9<br />
6. GEOLOGISCHE UND HYDROGEOLOGISCHE VERHÄLTNISSE<br />
6.1 Geologische Übersicht<br />
Der Talboden zwischen Ebnat-Kappel und Lichtensteig wird geprägt durch ein glazial übertieftes<br />
Becken, welches in Ebnat-Kappel durch mehrere Felsschwellen in Mulden unterteilt<br />
wird. Die Felsoberfläche wurde durch den Thurgletscher geformt, der ein Tal von einer Breite<br />
zwischen 750 bis 1250 m gestaltete. Die Talmulde verläuft mehrheitlich quer zum Streichen<br />
der Gesteinsschichten. Somit fallen die Gesteinsschichten in der subalpinen Molasse mit<br />
einer Neigung von durchschnittlich ca. 45° in südöstliche Richtung und in der flachliegenden<br />
Molasse mit einer durchschnittlichen Neigung von 40° in nordwestliche Richtung 2 .<br />
Bei seinem letzten Rückzug in Richtung Alpen gegen Ende der letzten Eiszeit (Würmeiszeit)<br />
vor etwa 10'000 Jahren hinterliess der Thurgletscher zwischen Lichtensteig und Ebnat-<br />
Kappel eine mit Grundmoräne überzogene Wanne, worin sich durch das Schmelzwasser ein<br />
Gletschersee bildete. Dieser See wurde durch die Thur vom Mündungsbereich im Raum Ebnat-Kappel<br />
her langsam mit Geschiebe aufgefüllt, wobei die grobkörnigen Bestandteile bereits<br />
bei der Einmündung, die feinkörnigen Ablagerungen (Ton, Silt) weiter von der Einmündung<br />
weggetragen und abgelagert wurden. Aus diesem Grunde reichen die sandigen Schotter<br />
mit wechselndem Siltgehalt bei Untersand bis auf den felsigen Stauer (Profil 1), während<br />
weiter nördlich die sandigen Kiesschichten von hauptsächlich siltigen Schichten unterlagert<br />
sind. Die mächtigen Siltablagerungen in den Profilen 3 und 4 (Wattwil) zeigen die weit von<br />
der Mündung entfernten Seeablagerungen an.<br />
Nach dem Rückzug des Gletschers lagerten in den Randgebieten des Taltroges kleinere<br />
Bäche Schutt und Geröll ab, die sich aufgrund der z.T. gleichzeitigen Ablagerung mit den<br />
Schottern oder den Seeablagerungen verzahnten. Im Einzugsgebiet der Nebenbäche besteht<br />
der Fels hauptsächlich aus Kalksandstein, weshalb der Bachschutt überwiegend aus<br />
sandigem Material aufgebaut und nicht sehr gut durchlässig ist.<br />
Durch den Abtrag der Felsschwelle unterhalb Lichtensteig senkte sich der Wasserspiegel<br />
des Schmelzwassersees allmählich ab, bis er ganz verlandete. Die Thur bildete ein Flusssystem<br />
aus und begann den ehemaligen Seeboden mit ihrem Geschiebe aufzuschottern.<br />
Dabei konnten sich teilweise Flussrinnen auch in die unterliegenden Einheiten etwas eintiefen,<br />
was im Profil 3 mit dem ehemaligen Verlauf der Thur deutlich zu erkennen ist. Mit der<br />
Aufschotterung wurden die Seeablagerungen mit einer bis zu 7 m mächtigen Schicht aus<br />
Thurschottern überdeckt. Die Thurschotter bestehen nicht nur aus gut durchlässigen sandigen<br />
Kiesschichten. Lehmige Zwischenlagen und Sandlinsen sind Zeugen geringer Wasserführung.<br />
Vereinzelt sind an den Talhängen Reste von Schotterterrassen anzutreffen, wie z.B. beim<br />
Kloster St. Maria in Wattwil. Diese bis zu 60 m mächtige Schotterterrasse wurde in der<br />
Würmzeit durch Ablagerungen des Feldbaches und möglicherweise auch der Thur gebildet.<br />
2 Die Profile im Anhang wurden ungefähr parallel zum Streichen der Gesteinsschichten gezeichnet,<br />
weshalb das Fallen der Schichten in den Querprofilen nicht ersichtlich ist.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 10<br />
6.2 Felsuntergrund<br />
6.2.1 Ebnat-Kappel<br />
Die Gemeinde Ebnat-Kappel liegt tektonisch gesehen im Gebiet der subalpinen (aufgeschobenen)<br />
Molasse. Die im Vorland der Alpen abgelagerten Gesteine der Unteren Süsswassermolasse<br />
USM (Sandstein, Mergel, Nagelfluh) wurden vor ein paar Millionen Jahren von<br />
der nach Norden greifenden Alpenbildung durch die helvetischen Decken überfahren und<br />
dachziegelartig gegen Norden geschoben. Der Übergang von der subalpinen Molasse in die<br />
flachliegende Molasse liegt zwischen Ebnat-Kappel und Wattwil. Nebst diesem Übergang<br />
gibt es zwischen Ebnat-Kappel und Wattwil auch den Übergang von der USM über die Obere<br />
Meeresmolasse OMM in die Obere Süsswassermolasse OSM.<br />
Die Felsoberfläche im Talboden von Ebnat-Kappel weist ein ausgeprägtes Relief auf. Bei der<br />
evangelischen Kirche Ebnat und dem Schulhaus Schafbüchel zieht ein Molasse-Querriegel<br />
durch, der gegen den Schwarzen Steg absinkt, am anderen Thurufer aber rasch wieder ansteigt.<br />
Diese Felsschwelle bot dem Thurgletscher einen erhöhten Erosionswiderstand und<br />
führte zur Ausbildung einer Mulde im vorgelagerten Gebiet. Zwischen Schafbüchel und<br />
Rohrgarten ist der Felsverlauf mehrheitlich flach. Bei der evangelischen Kirche Kappel zieht<br />
in den Talboden wieder ein Felskopf hinein, der steil gegen die GWF Unterdorf abfällt. Bei<br />
der Brücke vor dem Restaurant Schützengarten und östlich der Felsensteinstrasse belegen<br />
weitere Felsaufschlüsse die Unterteilung der Mulde in einzelne Wannen.<br />
Im Profil 1 wird die Felsoberfläche in der nordöstlichen Talmulde bei der Bohrung 52-86 in<br />
15.5 m Tiefe und in der südwestlichen Talmulde bei der Thur in der Bohrung SB 7-69 in 13.5<br />
m Tiefe unter der Terrainoberfläche angetroffen. Die Tiefe des Fels ist im Profil 2 durch die<br />
Bohrung 59-86 (nicht ganz im Zentrum der Mulde) auf 20.5 m unter der Oberfläche gegeben.<br />
6.2.2 Wattwil<br />
In Wattwil besteht der Felsuntergrund aus Gesteinen der OSM (Miocaen, ca. 22.5 bis 5 Mio.<br />
Jahre alt; schwach bis mittelstark verfestigte Nagelfluh, Sandstein und Mergellagen). Die<br />
Felsoberfläche weist ein gleichmässigeres Relief auf als in Ebnat-Kappel und liegt im Talboden<br />
bis 130 m unter Terrain. In den Profilen 3 und 4 wird der Fels jeweils nur in Erdwärmesondenbohrungen<br />
erreicht, der Felsverlauf ist somit grösstenteils unbekannt.<br />
6.3 Hydrogeologie<br />
Den eigentlichen Grundwasserleiter im Talboden zwischen Ebnat-Kappel und Wattwil bilden<br />
die gut durchlässigen sandigen Thurschotter mit wechselndem Siltgehalt. Die Grundwasser<br />
führenden Schichten werden je nach Standort in unterschiedlichen Tiefen von Molassefels,<br />
Grundmoräne oder Seebodenlehm unterlagert. Die gut wasserdurchlässigen Schichten sind<br />
nicht durchgehend verfolgbar: kaum wasserdurchlässige Felsrippen, schlecht durchlässige<br />
Seitenmoränen oder feinkörnige Stillwassersedimente vermindern die Mächtigkeit der<br />
grundwasserführenden Schicht. Die Speisung des Grundwasserleiters erfolgt durch Hangwasser,<br />
versickernde Niederschläge und Infiltrat aus Oberflächengewässern.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 11<br />
Im Bereich der Flussmündung im früheren See ist die Mächtigkeit der wasserführenden<br />
Schotter grösser. Mit zunehmender Entfernung von der Mündung nimmt die Mächtigkeit ab.<br />
Deshalb weisen die wasserführenden Schotter im Talboden von Ebnat-Kappel eine grössere<br />
Mächtigkeit auf.<br />
Das Grundwasservorkommen bei Untersand wird durch einen Molasse-Querriegel beim<br />
Schafbüchel vom unteren, durch die Brunnen Rohrgarten und Gill genutzten Grundwasservorkommen<br />
getrennt. Oberhalb des Schafbüchels beträgt die Mächtigkeit des wassergefüllten<br />
Grundwasserleiters überall weniger als 10 m, während sie unterhalb bis auf über 20 m<br />
ansteigen kann. Durch die Erosion des Gletschers bildete sich vor dem Querriegel bei<br />
Schafbüchel eine Wanne, welche mit Thurschotter aufgefüllt wurde. Diese Wanne bildet ein<br />
natürliches Grundwasserreservoir.<br />
Im Talboden von Wattwil liegt der schlecht durchlässige Seebodenlehm nur wenige Meter<br />
unter der Oberfläche. Die geringmächtigen Schotter, welche unter dem Wasserspiegel der<br />
Thur liegen, können kein grösseres Grundwasservorkommen bilden. Die Lage des Grundwasserspiegels<br />
wird durch den Vorfluter (Thur) bestimmt. Steigt die Abflussmenge in der<br />
Thur, nimmt die Grundwassermächtigkeit und somit die nutzbare Entnahmemenge zu. In<br />
Trockenzeiten und bei geringen Abflussmengen sinken erfahrungsgemäss auch der Grundwasserspiegel<br />
und somit auch die Entnahmemenge.<br />
Das Profil 3 zeigt die Grundwasserverhältnisse im Bereich der Blockfabrik in Wattwil. Linksseitig<br />
der Thur gibt es einen Grundwasserleiter, der aufgrund seiner Durchlässigkeit und der<br />
Mächtigkeit der wasserführenden Schicht eine Grundwassernutzung ermöglicht. Rechtsseitig<br />
der Thur hingegen ist die Mächtigkeit der wasserführenden Schicht gering, denn eine<br />
schlecht durchlässige Schicht verhindert die Thurinfiltration und somit die Möglichkeit einer<br />
Grundwassernutzung.<br />
Die Schotterterrasse beim Kloster in Wattwil bildet eine Ausnahme in der Grundwassermächtigkeit<br />
für Wattwil. Die wasserführenden Schichten erreichen hier eine Mächtigkeit von bis zu<br />
20 m. Das Grundwasser wird hauptsächlich durch den Zufluss von Hangwasser und Bachinfiltrat<br />
des Feldbaches gebildet.<br />
6.4 Durchlässigkeit<br />
Die Durchlässigkeit eines Lockergesteins wird mit dem Durchlässigkeitsbeiwert k beschrieben.<br />
Er hat die Masseinheit einer Geschwindigkeit (m/s) und wird meist durch Pumpversuche<br />
ermittelt. Ein sauberer Kies weist einen k-Wert von ca. 10 -2 m/s auf, ein dichter Lehm einen<br />
k-Wert von 10 -7 m/s. Ein Kies ist demzufolge bis zu 100‘000 mal durchlässiger als ein Lehm.<br />
Die Durchlässigkeiten der wasserführenden Schichten im Talboden von Ebnat-Kappel bis<br />
Wattwil variieren von schlecht (k-Wert weniger als 10 -6 m/s) bis sehr gut (mehr als 10 -2 m/s).<br />
In der nachfolgenden Tabelle sind für verschiedene Lockergesteine die Grössenordnungen<br />
für den k-Wert zusammengefasst:<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 12<br />
Beschreibung der wasserführenden Schichten<br />
k-Wert (m/s)<br />
sauberer Kies sauberer Thurschotter 1*10 -2 – 5*10 -2<br />
leicht siltig, sandiger Kies Thurschotter 1*10 -3 – 5*10 -3<br />
siltig, sandiger Kies mit Steinen und<br />
grösseren Blöcken<br />
Bachschuttkegel 5*10 -4 – 5*10 -3<br />
siltig, sandiger Kies Bachschotter 5*10 -4 – 1*10 -3<br />
stark siltig, sandiger Kies fluvioglaziale Ablagerung 1*10 -4 – 1*10 -3<br />
Sand mit wenig Kies Bachablagerung 1*10 -4 – 5*10 -4<br />
sauberer bis siltiger Fein- bis Mittelsand Stillwassersedimente 5*10 -5 – 1*10 -4<br />
(toniger) Silt Seebodenlehm (Stauer) < 1*10 -6<br />
Tabelle 6.1: Grössenordnungen für den k-Wert<br />
6.5 Transmissivität<br />
Die Durchlässigkeit alleine erlaubt keine Aussage über die förderbare Menge in einem<br />
Grundwasserleiter. Die Fördermenge kann besser mit der Transmissivität T eines Grundwasserleiters<br />
abgeschätzt werden. Diese ergibt sich aus dem Produkt der mittleren Mächtigkeit<br />
des Grundwasserleiters und dem Durchlässigkeitsbeiwert. Somit können sowohl mässig<br />
gut durchlässige Schichten mit grosser Grundwassermächtigkeit (z.B. beim Kloster Wattwil)<br />
als auch gut durchlässige Schichten mit geringer Grundwassermächtigkeit (z.B. bei den Bohrungen<br />
Högg Wattwil) hohe Transmissivitäten aufweisen, wo hohe Pumpmengen möglich<br />
sind.<br />
Die Transmissivität kann nur zuverlässig bestimmt werden, wenn nebst dem k-Wert auch die<br />
Schwankungen des Grundwasserspiegels, und somit die minimale Mächtigkeit des Grundwasserleiters,<br />
bekannt sind (siehe Kapitel 6.6).<br />
6.6 Grundwasserspiegel<br />
6.6.1 Allgemeine Bemerkungen<br />
Während der Planungsphase für eine Grundwasserwärmenutzung sollten die Schwankungen<br />
des Grundwasserspiegels bekannt sein. Es darf nicht ein einmalig gemessener Spiegel<br />
als Mittelwert angenommen werden. Sinkt der Grundwasserspiegel während einer längeren<br />
Trockenzeit stark ab, so muss die wasserführende Schicht immer noch genügend Wasser für<br />
die Wärme-/Kältenutzung liefern können. Durch die Installation und das Auslesen der Daten<br />
von mehreren Datenloggern im Untersuchungsgebiet konnten wichtige Informationen über<br />
die Schwankungen des Grundwasserspiegels gewonnen werden. Der Grundwasserspiegel<br />
wurde in diesen Messstellen stündlich aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen mit den Datenloggern<br />
dienen auch als Anhaltspunkte in den umliegenden Gebieten, aufgrund der z.T. stark<br />
variierenden Verhältnisse im Untergrund dürfen diese Messungen aber nicht ohne weitere<br />
Abklärung übernommen werden.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 13<br />
Bei den meisten Bohrprofilen, die eine Angabe zum Grundwasserspiegel enthalten, ist ein<br />
einmalig gemessener Grundwasserspiegel angegeben. In einem hydrogeologischen Bericht<br />
werden die Witterungsverhältnisse selten beschrieben, weshalb meist nicht bekannt ist, ob<br />
es sich bei der Angabe des Grundwasserspiegels um einen hohen oder tiefen Wert handelt.<br />
Falls in einem Bohrprofil mehrere Grundwasserspiegel angegeben sind, wurde für die Berechnung<br />
der Transmissivität jeweils der tiefste Wert (geringste Wasserführung) berücksichtigt.<br />
Der Grundwasserspiegel ist insbesondere im Gebiet Wattwil von der Wasserführung der<br />
Thur abhängig und reagiert synchron auf Niederschlagsereignisse und somit auf Schwankungen<br />
des Thurspiegels. Grössere und auch kleinere Hochwasserereignisse in der Thur<br />
zeichnen sich durch einen raschen Anstieg in den Grundwasserspiegeln aus. Langandauernde<br />
niederschlagsfreie Zeiträume führen zu einem geringen Thurabfluss und somit zu einem<br />
tiefen Grundwasserspiegel. Die Korrelationen zwischen dem Thurabfluss und dem<br />
Grundwasserspiegel sind in der Nähe der Thur am stärksten. Bei Grundwasserfassungen<br />
wird der Grundwasserspiegel zusätzlich durch die künstliche Absenkung bei Pumpbetrieb<br />
beeinflusst.<br />
6.6.2 Talboden von Ebnat-Kappel<br />
Im Gebiet Ebnat-Kappel sind in den Bohrungen KB 1-2008, KB 55-86, KB 58-86, KB 59-86,<br />
KB 65-86 sowie in den Grundwasserfassungen Morga und Gill seit Juli 2008 Datenlogger<br />
installiert (vgl. Anhang Nr. 2). In der GWF Rohrgarten wird der Grundwasserspiegel ebenfalls<br />
aufgezeichnet. Die grafische Auswertung der Aufzeichnungen ist in Anhang Nr. 5 dargestellt.<br />
Die nachfolgende Tabelle zeigt die minimalen und maximalen Grundwasserstände sowie die<br />
Schwankungsbereiche und die mittleren Grundwasserspiegel für die Messstellen in Ebnat-<br />
Kappel.<br />
Messstelle<br />
KB<br />
55-86<br />
KB<br />
58-86<br />
KB<br />
59-86<br />
KB<br />
65-86<br />
KB<br />
1-2008<br />
GWF<br />
Gill 3<br />
GWF<br />
Rohr-<br />
GWSp<br />
Min. GWSp 630.61 625.21 624.34 631.76 624.04 624.13 623.35 621.24<br />
Max. GWSp 632.47 626.77 626.41 632.91 626.66 626.76 625.47 622.20<br />
Amplitude 1.86 1.56 2.07 1.15 2.62 2.63 2.12 0.96<br />
mittlerer GWSp 631.16 625.74 625.07 632.26 625.48 625.64 624.14 621.67<br />
Tabelle 6.2: Schwankungen des Grundwasserspiegels in Ebnat-Kappel<br />
garten 3<br />
GWF<br />
Morga 3<br />
Die Schwankung des Grundwasserspiegels, gemessen über ca. zweieinhalb Jahre, variiert<br />
somit je nach Standort zwischen 1.1 m und 2.6 m. Die Schwankung ist umso grösser, je näher<br />
die Messstelle bei der Thur liegt: in der Bohrung KB 65, die mehr als 250 m von der Thur<br />
entfernt liegt, wurden die geringsten Schwankungen gemessen. In der Bohrung KB 59, die<br />
unmittelbar neben der Thur liegt, wurden die grössten Schwankungen registriert.<br />
3 Entspricht nicht den natürlichen Grundwasserspiegelschwankungen, da starke Beeinflussung durch<br />
kontinuierlichen Pumpbetrieb<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 14<br />
6.6.3 Talboden von Wattwil<br />
Im Gebiet Wattwil sind in den Grundwasserfassungen Rickenhof und Bunt, sowie in den<br />
Bohrungen Högg KB 3 Süd, Högg KB 4 Nord, Oerlikon (KB 1-2010), Thuraustrasse 17 (KB1-<br />
2009, Bahnhofstrasse 7 (KB 5-2010), und Gemeindehaus (KB 1-2010) ab August 2008 Datenlogger<br />
installiert (vgl. Anhang Nr. 3). Die Messungen sind in Anhang Nr. 6 dargestellt.<br />
In der nachfolgenden Tabelle sind die minimalen und maximalen Grundwasserstände sowie<br />
die Schwankungsbereiche und die mittleren Grundwasserspiegel für die Messstellen in<br />
Wattwil aufgelistet.<br />
Messstelle<br />
Rickenhof <br />
Thuraustr.<br />
17<br />
Bunt Högg<br />
KB 4<br />
Högg<br />
KB 3<br />
Gemein-<br />
Bahnhofstr.<br />
Oerlikon<br />
GWSp<br />
Nord Süd dehaus 7<br />
Min. GWSp 614.31 607.38 602.36 610.36 611.94 606.15 607.82 609.20<br />
Max. GWSp 616.38 609.60 604.58 613.38 613.98 607.60 609.61 611.67<br />
Amplitude 2.07 2.22 2.22 3.02 2.04 1.45 1.79 2.47<br />
mittlerer GWSp 615.06 607.97 603.10 611.53 612.72 606.47 608.38 609.86<br />
Tabelle 6.3: Schwankungen des Grundwasserspiegels in Wattwil<br />
Die Schwankungen des Grundwasserspiegels im Gebiet Wattwil sind von grosser Bedeutung,<br />
weil die Thurschotter in Wattwil nur eine mittlere Grundwassermächtigkeit von 2 - 3 m<br />
aufweisen. In niederschlagsarmen Zeiten kann die Grundwassermächtigkeit weniger als einen<br />
Meter betragen. Auffallend ist, dass in Wattwil (im Gegensatz zu Ebnat-Kappel) die<br />
Amplitude der Grundwasserspiegelschwankungen unabhängig vom Thurabstand ist.<br />
6.7 Grundwasserneubildung<br />
6.7.1 Allgemeine Bemerkungen<br />
Grundwasser wird durch versickertes Niederschlagswasser, durch die Zufuhr von Hangwasser<br />
und durch infiltriertes Oberflächenwasser gebildet. Von den Niederschlägen versickert<br />
ungefähr ein Drittel und führt zur Grundwasserneubildung. Im Talboden von Ebnat-Kappel<br />
und Wattwil beträgt das langjährige Niederschlagsmittel rund 1'850 mm pro Jahr (Station<br />
Ebnat-Kappel, 623 m ü.M.).<br />
6.7.2 Talboden von Ebnat-Kappel<br />
Mit diversen Markierversuchen konnte der Nachweis erbracht werden, dass die Thur sowohl<br />
bei Niedrig- wie auch bei Hochwasser in die genutzten Grundwasservorkommen Untersand,<br />
Rohrgarten und Unterdorf 4 infiltriert. Die Infiltration verläuft bei Hochwasser deutlich rascher<br />
als bei normaler Wasserführung. Weitere hydrogeologische Abklärungen und die Grundwasserisohypsen<br />
(Darstellung der Wasseroberfläche mit Höhenlinien) belegen jedoch, dass zumindest<br />
die Fassungen Rohrgarten und Unterdorf 5 auch, oder vor allem, durch Hangwasser<br />
und lokal versickernde Niederschläge gespeist werden.<br />
4 Markierungsversuche Thur: Nachweis der hydraulischen Verbindungen zwischen der Thur und den<br />
Pumpwerken Untersand, Rohrgarten und Unterdorf, Dr. O. Lienert, 22. Juli 1992<br />
5 Chlorierte Kohlenwasserstoffe im Talboden von Ebnat-Kappel, Dr. O.Lienert, 31. Mai 1988<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 15<br />
In der links der Thur liegenden Bohrung SB 1-69 (VB Buechen) konnte während einem Markierversuch<br />
6 kein Thurinfiltrat nachgewiesen werden. Dieses Vorkommen wird möglicherweise<br />
nur durch lokal versickernde Niederschläge und Hangwasser gespeist.<br />
6.7.3 Talboden von Wattwil<br />
Im Talboden von Wattwil liegt das Thurbett auf weiten Strecken tiefer als der gut durchlässige<br />
Schotter. Die Thur wirkt somit bei normalen Wasserverhältnissen als Vorfluter. Bei steigendem<br />
Thurspiegel oder während der Entnahme von Grundwasser kann der Grundwasserspiegel<br />
lokal unter den Thurspiegel sinken und Thurwasser infiltriert in das Grundwasservorkommen.<br />
Dies kann durch die Bohrungen der Firma Högg bestätigt werden, wo das Grundwasser<br />
bei Niedrigwasser der Thur mit einem Gefälle von 1.0 bis 1.5% von Südsüdwesten in<br />
Richtung Thur fliesst. Bei Hochwasser hingegen infiltriert Thurwasser in den Grundwasserleiter.<br />
Auch bei den ehemaligen Grundwasserfassungen Feldmühle ist eine Thurinfiltration nur bei<br />
Hochwasser nachgewiesen, wobei die Infiltration nicht unmittelbar bei den Fassungen, sondern<br />
stromaufwärts 7 erfolgt. Das Grundwasservorkommen wird hauptsächlich aus infiltrierendem<br />
Bachwasser des Feldbaches gespeist.<br />
In den Fassungen Rickenhof und Bunt hingegen wurde bei normaler Wasserführung nach<br />
1.5 Tagen und bei Hochwasser bereits nach einem Tag Thurinfiltrat nachgewiesen 6 . Nebst<br />
den Thurinfiltraten speisen aber auch hier versickernde Niederschläge und Bachinfiltrate (gilt<br />
für Rickenhof) das Grundwasservorkommen.<br />
6.8 Wasserqualität<br />
Die Grundwasserqualität im Talboden von Ebnat-Kappel und Wattwil wurde in vielen Untersuchungen,<br />
insbesondere bei Trinkwasserfassungen, analysiert. Grundsätzlich ist das<br />
Grundwasser in chemischer wie auch in bakteriologischer Hinsicht gut und erfüllt die gesetzlichen<br />
Anforderungen an Trinkwasser.<br />
Die Mineralisation und der Chemismus unterscheiden sich in den verschiedenen Proben. In<br />
der ehemaligen GWF Feldmühle wurden vergleichsweise eher tiefe Werte für die Leitfähigkeit<br />
(ca. 350 µS/cm) und die Gesamthärte (ca. 20 °fH) gemessen, in der GWF Unterdorf eher<br />
hohe Werte (ca. 570 µS/cm, ca. 28 °fH). In der GWF Bunt variiert die Leitfähigkeit in den<br />
Analysen zwischen 320 – 450 µS/cm und die Gesamthärte zwischen 21 – 31 °fH. Eine geringe<br />
Härte und weniger starke Mineralisation des Grundwassers deuten darauf hin, dass<br />
weiches Oberflächenwasser aus einem Oberflächengewässer ohne nennenswerte Verweildauer<br />
in den Bodenschichten in den Grundwasserleiter infiltriert.<br />
Aufgrund der allgemein guten Qualität des unbeeinflussten Grundwassers im Talboden von<br />
Ebnat-Kappel und Wattwil spielt die Wasserqualität bei der Beurteilung des nutzbaren<br />
Grundwasserpotentials eine untergeordnete Rolle. Nicht zu vernachlässigen sind jedoch<br />
Schadstoffe, die aus Altlasten stammen können. Im Bereich von Altlasten sind differenzierte<br />
Abklärungen bzgl. Wasserqualität unabdingbar.<br />
6 Hydrogeologische Abklärungen im Zusammenhang mit dem Markierversuch Thur - Versuchsbrunnen<br />
Buechen, Geologiebüro Lienert & Haering AG, 7. November 2005<br />
7 Markierungsversuche Thur: Nachweis der hydraulischen Verbindungen zwischen der Thur und den<br />
Pumpwerken Rickenhof, Feldmühle und Bunt, Dr. O. Lienert, 10. November 1992<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 16<br />
7. HYDROTHERMIE<br />
7.1 Jahresverlauf der Grundwassertemperatur<br />
Das Grundwasser weist in der Regel eine relativ ausgeglichene, nahe bei der mittleren jährlichen<br />
Lufttemperatur liegende Temperatur auf. Die saisonalen Schwankungen der Lufttemperatur<br />
werden in der Grundwassertemperatur widerspiegelt. Je nach Verweildauer des<br />
Grundwassers im Untergrund ist die saisonale Schwankung der Grundwassertemperatur<br />
aber zeitlich verschoben gegenüber der Lufttemperatur. Rasche Infiltration von Oberflächengewässer<br />
ins Grundwasser, z.B. bei einem Hochwasser der Thur, führt zu raschen und grossen<br />
Schwankungen in der Grundwassertemperatur.<br />
In grösserer Distanz zur Infiltration, d.h. in seitlicher Entfernung als auch in der Tiefe, wo sich<br />
‘echtes‘ Grundwasser befindet, weist das Grundwasser geringere Temperaturschwankungen<br />
auf und die zeitliche Verschiebung gegenüber dem saisonalen Verlauf der Lufttemperatur ist<br />
grösser. Durch die stündlichen Messungen der Datenlogger im Untersuchungsgebiet konnten<br />
wichtige Informationen über den Verlauf der Grundwassertemperatur gewonnen werden.<br />
Zur Charakterisierung des Tiefenverlaufs der Grundwassertemperatur, wurden in Ebnat-<br />
Kappel bei einigen tieferen Bohrungen (KB 55, KB 58, KB 59 und GWF Rohrgarten), welche<br />
eine Grundwassermächtigkeit grösser als 6 m aufweisen, Temperatur- und Leitfähigkeitsprofile<br />
aufgenommen. Dazu wurden in Meterschritten von der Grundwasseroberfläche bis zum<br />
Grund der Bohrung jeweils die Temperatur und die Leitfähigkeit gemessen. Die Ergebnisse<br />
der Profilaufnahmen sind im Anhang Nr. 10 ersichtlich.<br />
7.2 Talboden von Ebnat-Kappel<br />
Die grafische Auswertung der Datenlogger von Ebnat-Kappel ist in Anhang Nr. 7 dargestellt.<br />
In der nachfolgenden Tabelle sind die Messtiefen, die minimalen und maximalen Grundwassertemperaturen<br />
sowie die Schwankungsbereiche aufgelistet.<br />
Messstelle KB KB KB KB KB GWF GWF<br />
55-86 58-86 59-86 65-86 1-2008 Gill Morga<br />
Messtiefe (m.ü.M) 624.64 621.92 617.49 630.61 624.14 622.51 619.75<br />
Tiefe unter mittl. GWSp 6.5 3.8 7.6 1.7 1.3 3.1 1.9<br />
Min. Temp. 9.2 7.5 3.8 11.1 9.5 8 7.9 5.9<br />
Max. Temp. 12.3 12.9 13.9 11.5 13 12.9 14.6<br />
Amplitude 3.1 5.4 10.1 0.4 3.5 5 8.7<br />
Tabelle 7.1: Grundwassertemperaturen in Ebnat-Kappel<br />
8 In der Grafik im Anhang Nr. 6 sind in der Bohrung KB 1-2008 Anfang 2009 einzelne Ausreisser mit<br />
tieferen Temperaturen ersichtlich. Dabei handelt es sich um technische Probleme oder der Datenlogger<br />
wurde für kurze Zeit ausgebaut. Diese Messungen widerspiegeln nicht den natürlichen Verlauf der<br />
Grundwassertemperatur.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 17<br />
Im Abschnitt Ebnat-Kappel wurden Temperaturschwankungen zwischen 0.4 °C (KB 65) und<br />
10.1 °C (KB 59) gemessen. Die hohen Temperaturschwankungen in der Bohrung KB 59 lassen<br />
sich mit der geringen Distanz zur Thur erklären. Starke Temperatureinbrüche sind z.B.<br />
im Frühling während der Schneeschmelze zu verzeichnen.<br />
In der Bohrung KB 59 sind in den durchgeführten Messprofilen (Temperatur und Leitfähigkeit)<br />
deutlich zwei verschiedene Grundwasserhorizonte zu erkennen. Sowohl die gemessene<br />
Wassertemperatur wie auch die elektrische Leitfähigkeit verändern sich zwischen 7 bis 12 m<br />
Tiefe deutlich. Im Winter ist der Einfluss des Thurinfiltrats (das Thurwasser weist Temperaturen<br />
um 7 °C und eine Leitfähigkeit von 250 – 350 µS/cm auf) in den oberen Schichten des<br />
Grundwassers deutlich messbar. In den tieferen Schichten ist das ganze Jahr eine mehr oder<br />
weniger konstante Wassertemperatur von rund 11 °C und eine Leitfähigkeit bei 520-560<br />
µS/cm vorhanden. Hier ist ‚echtes‘ Grundwasser ohne nennenswertes Thurinfiltrat vorhanden.<br />
Die Temperaturprofile in den Bohrungen KB 55, KB 58, KB 59 und GWF Rohrgarten belegen,<br />
dass die Grundwassertemperatur stark von der Messtiefe abhängig ist.<br />
Grundwassertemperaturen beim Profil Bürstenfabrik:<br />
Die zeitliche und auch die räumliche Verschiebung der Temperaturen sind in einem Vergleich<br />
der Bohrungen KB 1-2008 (Bürstenfabrik), KB 58, KB 59 und GWF Gill, welche auf<br />
einer Profillinie ungefähr senkrecht zur Talachse liegen, gut ersichtlich. Um die Grafik übersichtlicher<br />
zu gestalten, wurde die Messreihen geglättet (Anhang Nr. 9). Folgende Schlüsse<br />
können aus der Darstellung gezogen werden:<br />
� Die maximalen Grundwassertemperaturen werden - je nach Standort – nicht in den<br />
Sommermonaten, sondern erst zwischen September und Februar erreicht. Eine zeitliche<br />
Verschiebung der Grundwassertemperaturen gegenüber den jahreszeitlichen<br />
Schwankungen der Lufttemperatur ist klar nachweisbar.<br />
� Die maximalen wie auch die minimalen Temperaturen werden zuerst in der Bohrung<br />
KB 59, dann in KB 1-2008, danach in der GWF Gill und mit ca. zwei Monaten Verspätung<br />
auch in KB 58 gemessen. Diese Reihenfolge entspricht den zunehmenden<br />
Distanzen der Bohrungen zur Thur und belegt eine räumliche Verschiebung der<br />
Temperaturen.<br />
� Die Schwankungsbereiche unterscheiden sich je nach Bohrstandort: in KB 59 sind<br />
Werte zwischen 4 bis 14 °C möglich, in KB 58 und in der GWF Gill liegen sie zwischen<br />
7.5 bis 13°C und in KB 1-2008 ist der Schwankungsbereich bei 9.5 bis 13°C.<br />
Die Verschiebung der Grundwassertemperatur im Vergleich zur saisonalen Lufttemperatur<br />
um bis zu einem halben Jahr kann auch mit den langjährigen Messreihen im Zusammenhang<br />
mit den Trinkwasseranalysen in der GWF Rohrgarten belegt werden (Probe Dezember<br />
2010: 11.5 °C und Probe Juni 2010: 7.7 °C (22 m Tiefe ab OK Terrain).<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 18<br />
7.3 Talboden von Wattwil<br />
Die grafische Auswertung der Datenlogger von Wattwil ist in Anhang Nr. 8 dargestellt.<br />
In der nachfolgenden Tabelle sind die Messtiefen, die minimalen und maximalen Grundwassertemperaturen<br />
sowie die Schwankungsbereiche aufgelistet.<br />
Messstelle Rickenhof <br />
Thuraustr.<br />
17<br />
Bunt Högg<br />
KB 4<br />
Nord<br />
Högg<br />
KB 3<br />
Süd<br />
Gemeindehaus <br />
Bahnhofstr.<br />
7<br />
Oerlikon<br />
Messtiefe<br />
(m.ü.M) 611.36 604.93 600.14 608.54 611.11 604.91 605.63 608.26<br />
Tiefe unter<br />
mittl. GWSp 3.7 3.0 3.0 3.0 1.6 1.6 2.8 1.6<br />
Min. Temp. 5.3 8.9 5 7.6 2.9 7.9 12.9 7.2<br />
Max. Temp. 13.5 14.2 13.6 11.6 11.1 13.3 15.8 12.9<br />
Amplitude 8.2 5.3 8.6 4 8.2 5.4 2.9 5.7<br />
Tabelle 7.2: Grundwassertemperaturen in Wattwil<br />
Die Temperaturschwankungen im Abschnitt Wattwil liegen zwischen 2.9 °C (Bahnhofstr. 7)<br />
und 8.6 °C (Bunt).<br />
Im Gebiet Wattwil fehlen Temperaturprofile senkrecht zur Thur, welche die Abhängigkeit der<br />
Distanz zur Thur belegen. Bei allen Messstationen werden die maximalen bzw. die minimalen<br />
Grundwassertemperaturen ungefähr gleichzeitig gemessen. Die zeitliche Verschiebung<br />
gegenüber der Lufttemperatur beträgt zwei bis drei Monate.<br />
7.4 Auswirkungen auf die Nutzung<br />
Den Schwankungen der Grundwassertemperaturen infolge des Anlagestandortes und geologischen<br />
Verhältnisse ist bei der Planung und Dimensionierung der Anlagekomponenten<br />
Rechnung zu tragen. Grundsätzlich sollten die festgestellten Schwankungen der Grundwassertemperaturen<br />
bei der Planung der Wärmenutzungsanlagen keine Probleme darstellen, es<br />
müssen jedoch die gesetzlichen Vorschriften unter Punkt 4 sowie der Stand der Technik in<br />
jedem Falle berücksichtigt und eingehalten werden. Bei sehr tiefen Grundwassertemperaturen<br />
muss gewährleistet werden, dass in den Komponenten (Verdampfer, Wärmetauscher<br />
Zwischenkreislauf) keine Frostschäden auftreten können, allenfalls müssen diesbezüglich<br />
konzeptionelle Redundanzen vorgesehen werden.<br />
Die Feststellungen aus den Temperaturprofilen in den verschiedenen Bohrungen können für<br />
die Optimierung der Bezugstiefe einer Pumpe von Interesse sein, denn die Temperatur des<br />
Grundwassers und dessen Schwankungen können für den Wärmebezug bzw. für die Kühlung<br />
eine wichtige Rolle spielen.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 19<br />
8. WÄRMENUTZUNG<br />
8.1 Grundwasserwärmenutzungskarte<br />
8.1.1 Einteilung in verschiedene Bereiche<br />
In einem Gebiet mit Grundwasservorkommen gibt es unterschiedlich geeignete Zonen zur<br />
Nutzung des Grundwassers. Die Grundwasserwärmenutzungskarte unterteilt ein solches<br />
Gebiet in Zonen mit unterschiedlichem Nutzungspotential. Das Nutzungspotential ergibt sich<br />
aus der Wassermenge, die permanent aus dem Grundwasservorkommen gefördert werden<br />
kann, ohne das Grundwasservorkommen nachhaltig zu übernutzen (Feldergiebigkeit).<br />
An wenigen Stellen im Untersuchungsgebiet wurde die nutzbare Wassermenge und somit<br />
das Nutzungspotential mit Langzeitpumpversuchen nachgewiesen; hier spricht man von einer<br />
echten Feldergiebigkeit. Werden bei Sondierbohrungen nur Kurzpumpversuche durchgeführt,<br />
so kann die nutzbare Ergiebigkeit annäherungsweise prognostiziert werden. In Gebieten<br />
ohne Pumpversuch musste die Ergiebigkeit anhand von hydrogeologischen Angaben<br />
geschätzt werden, was – der Natur entsprechend – mit grossen Unsicherheiten verbunden<br />
ist.<br />
Die thermische Grundwassernutzung in Grundwasserschutzzonen oder –arealen ist verboten<br />
und in belasteten Standorten wird aufgrund der Risiken und dem Aufwand davon abgeraten.<br />
Zonen-<br />
Eignung Prognostizierte<br />
Zuteilung<br />
Ergiebigkeit (l/min)<br />
A1 gut bis sehr gut geeignet (Industrie) ≥ 250<br />
A2 mässig bis gut geeignet (MFH) 150-250<br />
B mässig geeignet (EFH) 50-150<br />
C ungeeignet
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 20<br />
Zonen- Eignung Prognostizierte Transmissivität<br />
Zuteilung<br />
Ergiebigkeit<br />
(l/min)<br />
(m 2 Mächtigkeit der<br />
wasserführen-<br />
/s) den Schicht (m)<br />
A1 gut bis sehr gut<br />
geeignet<br />
≥ 250 ≥ 2*10-2 ≥ 1.2<br />
A2 mässig bis gut<br />
geeignet<br />
150-250 5*10 -3 - 2*10 -2 ≥ 1.2<br />
B mässig geeignet 50-150 1*10 -4 – 5*10 -3 ≥ 1.2<br />
C ungeeignet
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 21<br />
Damit aus den einzelnen Bohrungen ein Gesamtbild erstellt werden konnte, wurden die Bohrungen<br />
durch Interpretationen miteinander verknüpft. Dabei ist es wichtig, das geologische<br />
Wissen und die bisherigen hydrogeologischen Erkenntnisse zu berücksichtigen. Nützliche<br />
Erkenntnisse lieferte die Grundwasserkarte im Untersuchungsgebiet. Die Differenzen zwischen<br />
der Grundwasserkarte und der Grundwasserwärmenutzungskarte entstehen, weil die<br />
Grundwasserkarte nur eine Einteilung nach der Mächtigkeit der wasserführenden Schicht<br />
darstellt und im Gegensatz zur Grundwasserwärmenutzungskarte die Durchlässigkeit der<br />
Schicht nicht berücksichtigt. Weitere nützliche Informationen lieferte die geologische Karte.<br />
Die Felsaufschlüsse konnten direkt auf die Grundwasserwärmenutzungskarte übernommen<br />
werden und wurden mit einer dunkelbraunen Schraffur dargestellt. Die auf der geologischen<br />
Karte dargestellten Schotterflächen konnten aufgrund der Grundwasserverhältnisse nicht<br />
direkt übernommen werden, waren aber bei der Interpretation trotzdem von Nutzen. Schwierigkeiten<br />
bei der Erstellung der Grundwasserwärmenutzungskarte bereiteten vor allem diejenigen<br />
Gebiete, in welchen nur wenige Bohrungen über einen grösseren Bereich vorhanden<br />
sind.<br />
8.1.3 Verbotene und ungeeignete Gebiete<br />
8.1.3.1 Grundwasserschutzzonen und –areale<br />
Im Talboden von Ebnat-Kappel und Wattwil gibt es mehrere Grundwasserfassungen mit<br />
Schutzzonen (provisorisch oder rechtskräftig) und Gebiete mit Grundwasserschutzarealen.<br />
Gemäss dem planerischen Grundwasserschutz sind Wärmenutzungen von Grundwasser in<br />
Grundwasserschutzzonen und –arealen nicht zulässig, weshalb diese Gebiete auf der Karte<br />
mit einer blauen Farbe hinterlegt sind. Bei einer allfälligen Aufhebung von Grundwasserschutzzonen<br />
oder –arealen müsste die Grundwasserwärmenutzungskarte angepasst werden.<br />
8.1.3.2 Belastete Standorte<br />
Im Untersuchungsgebiet gibt es gemäss dem kantonalen Kataster der belasteten Standorte<br />
(KbS) eine Vielzahl unterschiedlich belasteter Standorte. In belasteten Standorten können<br />
mit spezifischen Auflagen Grundwasserwärmenutzungsanlagen erlaubt werden. Aufgrund<br />
des schwer abschätzbaren Aufwandes wird jedoch von einer Grundwassernutzung abgeraten.<br />
Die belasteten Standorte werden deshalb auf der Grundwasserwärmenutzungskarte rot<br />
dargestellt. Es ist darauf hinzuweisen, dass sich nicht nur im belasteten Standort selbst,<br />
sondern auch im Abstrombereich eines belasteten Standortes Schadstoffe befinden können.<br />
Das Grundwasser im Abstrombereich eines belasteten Standortes sollte deshalb nur nach<br />
detaillierten Abklärungen für Wärmezwecke genutzt werden.<br />
8.1.3.3 Geologische und hydrogeologische Gründe<br />
Aus geologischer und hydrogeologischer Hinsicht gibt es drei Gründe, warum ein Gebiet für<br />
die Grundwasserwärmenutzung ungeeignet ist:<br />
� Es ist kein Grundwasser vorhanden.<br />
� Der Grundwasserleiter weist für eine Nutzung eine zu geringe Durchlässigkeit auf.<br />
� Die Mächtigkeit der wasserführenden Schicht ist kleiner als 1.2 m.<br />
Mögliche Gründe, dass kein oder nur wenig Grundwasser vorhanden ist, sind nahe an der<br />
Terrainoberfläche liegende Stauer oder fehlende Infiltration von Thur- und Hangwasser.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 22<br />
8.1.4 Mässig geeignete Gebiete<br />
Als mässig geeignete Gebiete werden Zonen betrachtet, die zwischen 50-150 l/min 10 Grundwasser<br />
liefern können und somit nur für Heizzwecke in einem Einfamilienhaus in Frage<br />
kommen.<br />
In Ebnat-Kappel gibt es zwei solche zusammenhängende Gebiete. Ein Gebiet befindet sich<br />
im Umfeld der GWF Untersand und zieht mit einem Ausleger bis ins Oberstufenzentrum<br />
Wier. Das zweite Gebiet umrahmt die gut geeigneten Gebiete bei Rohrgarten und Unterdorf<br />
und zieht mit zwei Auslegern in Richtung Wattwil.<br />
In Wattwil gibt es mehrere kleinere solche Gebiete wie z.B. bei den Hochhäusern in Uelisbach<br />
und beim Spital Wattwil. Ein grösseres Gebiet befindet sich rund um die GWF Bunt bis<br />
zur Firma Schiess in Lichtensteig.<br />
8.1.5 Mässig bis gut geeignete Gebiete<br />
Mässig bis gut geeignete Gebiete sind jene Bereiche mit einer angenommenen Fördermenge<br />
von 150 – 250 l/min.<br />
In Ebnat-Kappel gibt es vier Gebiete, die sich mässig bis gut für die Grundwassernutzung<br />
eignen. Ein Gebiet liegt vor dem Molassequerriegel beim Schafbüchel. Das nächste Gebiet<br />
liegt in der Umgebung zwischen GWF Rohrgarten, Gill und Bürstenfabrik. Das dritte Gebiet<br />
umgibt die GWF Unterdorf und Buechen und das vierte Gebiet liegt im Umfeld der Morga.<br />
Mässig bis gut geeignete Gebiete gibt es in Wattwil bei der GWF Rickenhof, in einem grösseren<br />
Bereich im Talboden von Wattwil zwischen der Firma Högg und dem Gemeindehaus,<br />
in je einem Bereich bei der GWF Bunt und östlich des Bahnhofs Lichtensteig. In einigen dieser<br />
mässig bis gut geeigneten Gebiete besteht die Möglichkeit, dass sie auch grössere Wassermengen<br />
liefern könnten.<br />
8.1.6 Gut bis sehr gut geeignete Gebiete<br />
Gut bis sehr gut geeignete Gebiete sind Bereiche, in welchen in einzelnen Bohrungen Fördemengen<br />
von mehr als 250 l/min nachgewiesen worden sind.<br />
Die gut bis sehr gut geeigneten Gebiete im Talboden von Ebnat-Kappel befinden sich innerhalb<br />
der mässig bis gut geeigneten Gebiete.<br />
Im Talboden von Wattwil gibt es zwei Bereiche, welche gut bis sehr gut geeignet sind. Dies<br />
wäre einerseits beim Kloster Wattwil und andererseits südlich der Kantonsschule Wattwil.<br />
10 50 - 150 l/min entsprechen einer Verdampferleistung von 10 – 30 kW<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 23<br />
8.1.7 Hinweise zur Anwendung der Grundwasserwärmenutzungskarte<br />
Die beiliegende Grundwasserwärmenutzungskarte gibt einen Überblick und liefert Anhaltspunkte<br />
für die mögliche Wärmenutzung von Grundwasser mittels Wärmepumpen im Talboden<br />
von Ebnat-Kappel und Wattwil. Sie dient den Gemeinden und interessierten Nutzern als<br />
Planungsgrundlage, nicht aber für die Detailprojektierung. Für ein definiertes Nutzungsvorhaben<br />
kann mit Hilfe der Karte bestimmt werden, in welchen Gebieten weitere Untersuchungen<br />
sinnvoll sind und zu einem Erfolg führen können. Für eine Nutzung müssen in jedem Fall<br />
die Grundwasserverhältnisse in weiteren Untersuchungen im Detail abgeklärt werden.<br />
Die Abgrenzungen zwischen den einzelnen Gebieten, welche in der Natur fliessend sind,<br />
sind meist interpretiert und dürfen nicht als exakte Grenzen zwischen zwei Gebieten angesehen<br />
werden. An einigen Stellen wurden der Übergang zwischen zwei Gebieten und die<br />
Unsicherheit in diesem Gebiet mit einem schraffierten Bereich dargestellt.<br />
Die Angaben zu den förderbaren Grundwassermengen müssen mit Vorsicht betrachtet werden:<br />
� An einem Standort, der in der Zone B (grün) liegt, müssen nicht zwingend 150 l/min<br />
Grundwasser gefördert werden können. Es kann durchaus sein, dass die Ergiebigkeit<br />
nur wenig mehr als 50 l/min beträgt.<br />
� Das Gebiet der Zone A2 (hellblau) liegt meist im Bereich alter Flussablagerungen.<br />
Wird hier eine grössere Sandlinse im Schotter angebohrt, nimmt die Mächtigkeit der<br />
wasserführenden Schicht und somit die förderbare Wassermenge deutlich ab.<br />
Die Angaben zur nutzbaren Fördermenge gelten nur für den unbeeinflussten Zustand. Werden<br />
an einem Standort mehrere Grundwasserfassungen nebeneinander erstellt, so sinken<br />
die Einzelleistungen, im Gesamten kann aber insbesondere bei geringmächtigen Grundwasserleitern<br />
mehr Grundwasser gefördert werden.<br />
8.2 Approximative Hochrechnung auf das nutzbare Wärmepotential<br />
Die Energie, welche in den verschiedenen Gebieten aus dem Grundwasser genutzt werden<br />
kann, lässt sich aus der angenommenen Fördermenge berechnen. Die Energiemenge wird<br />
in Tabelle 8.3 mit zwei Werten angegeben: Einerseits in kWh/Tag, wobei bei der Berechnung<br />
angenommen wird, dass die Energie 24 h pro Tag benötigt wird. Andererseits in kWh/Jahr,<br />
wobei die Berechnung für den Fall durchgeführt wurde, dass die Energie über ein ganzes<br />
Jahr 24 h pro Tag benötigt wird. Falls der Energieverbrauch nicht über 24 h pro Tag sondern<br />
nur während wenigen Stunden gebraucht wird, muss abgeklärt werden, wie sich die Energiegewinnung<br />
verändert.<br />
Die Umrechnung von der Wassermenge (m 3 ) auf die Energie (kWh) wurde mit einem Faktor<br />
von 3.5 durchgeführt. Die Abkühlung von 1 m 3 Wasser um 3 °C entspricht einer Energiemenge<br />
von 3.5 kWh. Die Werte in folgender Tabelle zeigen die Energiemenge für die<br />
Grundwassernutzung in einer bestimmten Zone. Beim Abteufen von zwei oder mehreren<br />
Bohrungen in unmittelbarer Nähe zueinander kann diese Energiemenge aber nicht gewährleistet<br />
werden.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 24<br />
Zonen-<br />
Zuteilung<br />
A1<br />
A2<br />
B<br />
Eignung<br />
gut bis sehr gut<br />
geeignet (Industrie)<br />
mässig bis gut geeignet<br />
(MFH)<br />
mässig geeignet<br />
(EFH)<br />
Angenommene Entziehbare Energiemengen<br />
Fördermenge<br />
bei Dauerbetrieb<br />
(l/min) kWh/Tag kWh/Jahr<br />
≥ 250 > 1’200 > 450’000<br />
150-250 ~1’000 ~360’000<br />
50-150 ~500 ~180’000<br />
C ungeeignet
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 25<br />
9. WÄRMENUTZUNGSPOTENTIAL<br />
9.1 Ausgangslage und Zielsetzung<br />
9.1.1 Ausgangslage<br />
Mit dem Steigen der Energiepreise hat auch ein steigendes Interesse an erneuerbaren<br />
Energien stattgefunden, so dass der Wunsch nach alternativen Konzepten zur Wärmeerzeugung<br />
gestiegen ist.<br />
Im Jahre 2008 konnte durch unsere Firma die erste Wärmepumpenanlage mit Wärmegewinnung<br />
aus dem Grundwasser im Toggenburg (Alterswohnungen Thuraustrasse, 9630 Wattwil)<br />
geplant und erstellt werden.<br />
Seither hat ein grosses Interesse an der Wärmegewinnung aus dem Grundwasser stattgefunden<br />
und sowohl öffentliche wie auch private Bauherren interessierten sich betreffend deren<br />
Nutzbarkeit.<br />
Grundwasserwärmepumpe Alterswohnungen, Thuraustrasse 17, 9630 Wattwil<br />
Heizleistung: 20 kW, für Raumheizung und Warmwasser, mit Zwischenkreislauf,<br />
Grundwasserfördermenge 5 m3/h.<br />
Der Talboden der Gemeinden Ebnat-Kappel und Wattwil verfügt über grössere zusammenhängende<br />
Grundwasservorkommen, jedoch waren deren Grundlagen und Daten nicht vollständig<br />
vorhanden, so dass jeweilige Anfragen von Interessenten einen erheblichen Aufwand<br />
für die notwendigen Vorabklärungen mit sich brachten.<br />
Um dem steigenden Interesse gerecht zu werden und daraus eine optimale Nutzung und<br />
Bewirtschaftung der Ressource Grundwasser sicherstellen zu können, wurde vom Verein<br />
Energietal Toggenburg die Ausarbeitung einer umfassenden Studie in Auftrag gegeben.<br />
Die Projektvorstellung erfolgte im Dezember 2009, danach wurden die Arbeiten gemäss Projektdefinition<br />
von allen Beteiligten in Angriff genommen.<br />
Durch den Geologen wurde festgestellt, dass für eine gute Aussagekraft weitergehende<br />
Messungen über eine längere Zeitdauer notwendig sind, so dass Grundwassertemperaturen,<br />
Grundwasserspiegel, Probebohrungen, Pumpversuche an vielen Messstellen durchgeführt<br />
wurden.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 26<br />
Im April 2011 wurde durch das Geologiebüro Lienert & Haering AG die Potentialanalyse mit<br />
Bericht fertiggestellt, diese Arbeiten und Ergebnisse bilden die Basis für die weiterführende<br />
Beurteilung des Wärmenutzungspotentiales.<br />
Vom Verein Energietal Toggenburg wurde ursprünglich definiert, dass die Gesamtstudie bis<br />
spätestens Dezember 2010 fertiggestellt werden soll.<br />
Der Zeitaufwand für die geologischen Abklärungen war wesentlich grösser, so dass durch<br />
den Auftraggeber neu festgelegt wurde, dass die Gesamtstudie bis spätestens Ende Juni<br />
2011 fertiggestellt werden muss.<br />
Mit Vorliegen des geologischen Berichtes konnten diese Arbeiten und der Gesamtbericht<br />
nun termingerecht erstellt und abgeschlossen werden.<br />
9.1.2 Auftrag<br />
Der Auftrag ist gemäss dem Arbeitspapier Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-<br />
Kappel/Wattwil vom Dezember 2009 definiert und wird für die Bearbeitung des Auftrages<br />
angewendet.<br />
9.1.3 Aufgabenstellung / Zielsetzung<br />
Aus der Projektdefinition Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel/Wattwil vom Dezember<br />
2009 ergeben sich folgende Arbeiten bzw. Leistungen:<br />
� Beschaffung der vorhandenen Grundlagen<br />
� Hochrechnung der kategorisierten Grundwassergebiete auf das nutzbare Wärmepotential<br />
� Graphische Darstellung der nutzbaren Potentiale<br />
Der komplette Bericht betreffend des Wärmenutzungspotentiales wurde so aufgebaut und<br />
angeglichen, so dass eine Integration in das vorliegende Dokument möglich ist.<br />
9.2 Grundlagen<br />
Als Grundlage für die Beurteilung des Wärmenutzungspotentiales sowie aller daraus abgeleiteten<br />
notwendigen Berechnungen erfolgten anhand von:<br />
Grundwasser-Wärmepotential im Talboden von Ebnat-Kappel und Wattwil<br />
Potentialanalyse<br />
Geologiebüro Lienert & Haering AG, 9015 St. Gallen<br />
Die weiteren Grundlagen sind in dieser Studie unter Angabe der jeweiligen Quelle aufgeführt.<br />
9.2.1 Grundwassertemperaturen<br />
Grundsätzlich zeichnet sich Grundwasser durch vergleichsweise konstante und auch in den<br />
Wintermonaten hohe Temperaturen aus. Daher ist Grundwasser grundsätzlich bestens für<br />
die Nutzung durch Wärmepumpen geeignet.<br />
Zu den natürlichen Beeinflussungen der Grundwassertemperatur zählen saisonal bedingte<br />
Temperaturschwankungen mit typischerweise verringerten Temperaturen im Winter.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 27<br />
Dies ist insbesondere bei der Planung von Grundwasserwärmepumpen in flachen Grundwasserleitern<br />
mit geringer ungesättigter Zone zu beachten, da in diesen Fällen nicht von<br />
einer natürlichen Temperatur von dauerhaft 10-12 °C ausgegangen werden kann.<br />
Oftmals treten auch bereichsweise anthropogen beeinflusste Grundwassertemperaturen auf.<br />
Ursache für anthropogene Veränderungen der Grundwassertemperatur können bereits vorhandene<br />
thermische Nutzungen des Grundwasserleiters oder die Abwärme von Industrieanlagen<br />
sein.<br />
In solchen Fällen würde sich der Betrieb einer Grundwasserwärmepumpe mit einem Temperaturentzug<br />
grundsätzlich regulierend auf den Temperaturhaushalt des Grundwassers auswirken.<br />
In der Nähe von oberirdischen Gewässern, die Wasser an den umliegenden Grundwasserleiter<br />
abgeben, sind ebenfalls teilweise erhebliche Temperaturveränderungen gegeben.<br />
Insbesondere in den Wintermonaten können im Nahfeld der oberirdischen Gewässer vergleichsweise<br />
niedrige Grundwassertemperaturen auftreten, die den Betrieb von Grundwasserwärmepumpen<br />
einschränken können.<br />
Wie die nachfolgenden Ergebnisse der Messungen von Lienert & Haering AG aufzeigen,<br />
können die Grundwassertemperaturen je nach Standort teilweise extrem abweichen.<br />
Es können selbst erhebliche Abweichungen innerhalb der Fassung in Abhängigkeit der Tiefe<br />
festgestellt werden, so dass je nach Anwendungszweck (Heizen, Kühlen) unter Umständen<br />
Massnahmen an der Anlagekonzeption notwendig sind.<br />
Hinweise zur Anlageplanung:<br />
� Vorabklärungen Geologe<br />
Die zu erwartenden Grundwassertemperaturen müssen vorgängig durch den Anlageplaner<br />
zusammen mit dem Geologen detailliert geklärt werden.<br />
� Anlagekonzeption<br />
Sämtliche Apparate und Installationen müssen dementsprechend dimensioniert werden,<br />
damit auch noch ein einwandfreier Betrieb unter Beachtung der tiefsten Grundwassertemperaturen<br />
gewährleistet werden kann.<br />
Es wird empfohlen, zusätzlich für aussergewöhnliche Anomalien (saisonale, witterungsbedingte<br />
Einflüsse oder Vorkommnisse) Reserven oder Redundanzen vorzusehen.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 28<br />
Grundwassertemperaturen Ebnat-Kappel:<br />
Die Grundwassertemperaturen wurden durch Lienert & Haering AG mittels Datenlogger aufgezeichnet<br />
und in Anhang Nr. 7 grafisch dargestellt:<br />
Die Verschiebung der Grundwassertemperaturen im Vergleich zur saisonalen Lufttemperatur<br />
um bis zu einem halben Jahr kommt der Nutzung mit Wärmepumpen entgegen, da dann<br />
tendenziell beim Bedarf der grössten Heizleistungen und Vorlauftemperaturen die höchsten<br />
Grundwassertemperaturen vorliegen.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 29<br />
Die Grundwassertemperaturen wurden an den verschiedenen Bohrungen mittels Datenlogger<br />
aufgezeichnet, nachfolgend ist der Jahresverlauf der Grundwassertemperaturen beim<br />
Profil Bürstenfabrik (Anhang Nr. 9, KB 1-2008) aufgeführt.<br />
Der Jahreszeitliche Verlauf der Grundwassertemperaturen ist für alle 4 aufgezeichneten<br />
Messstellen ersichtlich, folgende Feststellungen können daraus abgeleitet werden:<br />
� Der jahreszeitliche Verlauf ist bei allen 4 Messstellen mit geringen Abweichungen von<br />
ca. 2°C praktisch parallel.<br />
� Einzig die Messstelle KB 59 (Thur) weist tiefere Werte auf, was jedoch auf die Infiltration<br />
von Thurwasser während den Frühlingsmonaten (Schneeschmelze) zurückzuführen<br />
ist.<br />
� Tiefste Grundwassertemperatur GWF Gill: 8.5°C<br />
� Höchste Grundwassertemperatur: 12.5°C<br />
� Die tiefsten Grundwassertemperaturen werden im Frühling (März, April, Mai) festgestellt<br />
� Die höchsten Grundwassertemperaturen werden im Herbst (August, September, Oktober<br />
festgestellt.<br />
Im weiteren ist aus diesen Messungen gut ersichtlich, dass der Jahresverlauf der Grundwassertemperaturen<br />
der Witterung bzw. den Jahreszeiten folgt.<br />
Aus diesem kann im weiteren abgeleitet werden, dass die Grundwassernutzung im Grundsatz<br />
als oberflächennahe Geothermie betrachtet werden kann und demzufolge sich das<br />
Energiepotential wahrscheinlich auch analog der oberflächennahen Erdwärmenutzung verhalten<br />
könnte.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 30<br />
Grundwassertemperaturen Wattwil:<br />
Die Grundwassertemperaturen wurden durch Lienert & Haering AG mittels Datenlogger aufgezeichnet<br />
und in Anhang Nr. 8 grafisch dargestellt:<br />
Es kann festgestellt werden, dass die Grundwassertemperaturen in Wattwil tendenziell tiefer<br />
als diejenigen in Ebnat-Kappel liegen.<br />
Diesbezüglich stellt dies sicher höhere Anforderungen an die Standortwahl und Anlagekonzeption<br />
von künftigen Grundwasserwärmenutzungsanlagen.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 31<br />
Einfluss der Grundwasser-Entnahmetemperatur:<br />
Aus den Grundlagen der Thermodynamik der Wärmepumpe und deren Effizienz ergibt sich,<br />
dass die Entnahmetemperatur des Grundwassers einen massgeblichen Einfluss auf die<br />
Wärmepumpenleistung hat.<br />
110%<br />
105%<br />
100%<br />
95%<br />
90%<br />
85%<br />
92%<br />
Aenderung WP-Leistung in Funktion der<br />
Wärmequellentemperatur<br />
100%<br />
80%<br />
5 °C 7.5 °C 10 °C<br />
Wärmequellentemperatur<br />
Die Grafik stellt den Verlauf der Wärmepumpenleistung in Funktion der Wärmequellentemperatur<br />
dar.<br />
Ausgehend von einer Entnahmetemperatur von 7.5°C ergibt sich eine Leistungsreduktion<br />
von -8% bei einer Reduktion der Wärmequellentemperatur auf 5°C sowie eine Leistungszunahme<br />
von +8% bei einer Erhöhung der Wärmequellentemperatur auf 10°C.<br />
Genau umgekehrt proportional verhält sich der Verlauf des Energieverbrauches, so dass bei<br />
einer Reduktion der Wärmequellentemperatur auf 5°C sich ein Mehrverbrauch von +8% einstellen<br />
wird.<br />
Grundlage Studie:<br />
Entnahmetemperatur, Nutzungstemperatur WP = 7.5°C<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg<br />
108%
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 32<br />
9.2.2 Grundwasserfördermenge<br />
Die Grundwasserfördermengen wurden durch Lienert & Haering AG aufgrund der geologischen<br />
Analysen prognostiziert und das Gebiet in folgende Gruppen unterteilt:<br />
� Mässig geeignete Gebiete, Fördermenge 50-150 l/min.<br />
Berechnungen: Fläche gemäss Kataster, Fördermenge 100 l/min.<br />
� Mässig bis gut geeignete Gebiete, Fördermenge 150-250 l/min.<br />
Berechnungen: Fläche gemäss Kataster, Fördermenge 200 l/min.<br />
� Gut bis sehr gut geeignete Gebiete, Fördermenge >250 l/min.<br />
Berechnungen: Fläche gemäss Kataster, Fördermenge 300 l/min.<br />
Im weiteren wurden auch folgende Zwischengebiete ausgeschieden:<br />
� Bereich zwischen ungeeignetem und mässig geeignetem Gebiet<br />
Berechnungen: Fläche gemäss Kataster, Fördermenge 50 l/min.<br />
� Bereich zwischen mässig und mässig bis gut geeignetem Gebiet<br />
Berechnungen: Fläche gemäss Kataster, Fördermenge 150 l/min.<br />
� Bereich zwischen mässig bis gut und gut bis sehr gut geeignetem Gebiet<br />
Berechnungen: Fläche gemäss Kataster, Fördermenge 250 l/min.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 33<br />
Mit den vorstehenden Grundwasserfördermengen (l/min.) und der spezifizierten Grundwasserabkühlung<br />
(K) können die Entnahmeleistungen (kW) pro Grundwasser-Entnahmestelle<br />
berechnet werden.<br />
Tabelle:<br />
Übersicht Gebietseinteilung, Fördermengen und Heizleistungen pro Entnahmestelle:<br />
Gebiet<br />
(-)<br />
Bereich<br />
zwischen ungeeignet und mässig<br />
Gebiet<br />
mässig geeignet<br />
Bereich<br />
zwischen mässig bis gut geeignet<br />
Gebiet<br />
mässig bis gut geeignet<br />
Bereich<br />
mässig bis gut und gut bis sehr gut<br />
Gebiet<br />
gut bis sehr gut geeignet<br />
Fördermenge Abkühlung COP Heizleistung<br />
(l/min.) (K) (-) (kW)<br />
50 4 4.00 19<br />
100 4 4.00 37<br />
150 4 4.00 56<br />
200 4 4.00 74<br />
250 4 4.00 93<br />
300 4 4.00 112<br />
Bemerkungen:<br />
In der Tabelle sind die zu erwartenden Heizleistungen (kW) mit den Mittelwerten der prognostizierten<br />
Fördermengen errechnet worden.<br />
Daraus kann aufgrund der jeweiligen Gebietseinteilung des Geologen die zu erwartende<br />
Heizleistung pro Entnahmestelle abgeleitet werden.<br />
Für Objekte mit grösseren Heizleistungen ist zusammen mit dem Geologen die Erhöhung<br />
der Fördermenge pro Entnahmestelle zu prüfen oder es sind mehrere Entnahmestellen zu<br />
einer grösseren Anlage zusammenzufassen.<br />
Beispiel Grundwasser-Entnahmebrunnen: Beispiel Grundwasser-Unterwasserpumpen:<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 34<br />
9.2.3 Grundwasserabkühlung<br />
Die Wegleitung Grundwasserschutz präzisiert, dass die Wärmenutzung insgesamt, also unter<br />
Berücksichtigung aller im betrachteten Grundwassergebiet installierten Anlagen, die natürliche<br />
saisonale Temperatur des Grundwassers um nicht mehr als 3°C verändern darf.<br />
Im Umkreis von maximal 100 m um das Rückversickerungsbauwerk ist jedoch eine Temperaturveränderung<br />
von mehr als 3°C zulässig.<br />
Aus oekologischer wie auch oekonomischer Sicht ist anzustreben, dass nur diejenige<br />
Grundwassermenge gefördert werden soll, die für einen einwandfreien Betrieb und zur Einhaltung<br />
der gesetzlichen Vorgaben benötigt wird.<br />
Bei Erhöhung der Grundwasser-Abkühlung verringert sich die Grundwassermenge und der<br />
Energiebedarf zur Grundwasserförderung fällt entsprechend tiefer aus.<br />
Die gesetzliche Regelung lässt zu, dass höhere Grundwasser-Abkühlungen als 3 K möglich<br />
sind und demzufolge aus den vorgenannten Gründen angestrebt werden sollten.<br />
140%<br />
120%<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
75%<br />
Aenderung WP-Leistung in Funktion der<br />
Grundwasserabkühlung<br />
100%<br />
0%<br />
3 °C 4 °C 5 °C<br />
Grundwasserabkühlung<br />
Die Grafik stellt den Verlauf der Wärmepumpenleistung in Funktion der Grundwasserabkühlung<br />
dar.<br />
Ausgehend von einer Abkühlung von 4°C ergibt sich eine Leistungsreduktion von -25% bei<br />
einer Reduktion der Abkühlung auf 3°C sowie eine Leistungszunahme von +25% bei einer<br />
Erhöhung der Abkühlung auf 5°C.<br />
Grundlage Studie:<br />
Grundwasserabkühlung WP = 4 K<br />
Entnahmetemperatur, Nutzungstemperatur WP = 7.5°C<br />
Rückgabetemperatur, Nutzungstemperatur WP = 3.5°C<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg<br />
125%
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 35<br />
9.2.4 Spezifische Wärmenutzung<br />
Allgemein zugängliche Daten zu Wärmeausbreitungen von Grundwasserwärmepumpen sowie<br />
Berechnungsmodelle zur Beurteilung, wie sich die thermische Nutzung des Grundwasserkörpers<br />
regional auf das Gesamtsystem auswirkt sind praktisch nicht vorhanden.<br />
Im Rahmen dieser Studie kann aufgrund der vorhandenen Grundlagen lediglich eine Abschätzung<br />
des Nutzungspotentiales aufgrund des Flächenkatasters erfolgen, da weiterführende<br />
Berechnungen und Simulationen den Rahmen dieser Arbeit übersteigen würden.<br />
Es wurde daher versucht, aufgrund von vorhandenen Grundlagendaten sowie auch von einfachen<br />
Modellberechnungen das zu erwartende spezifische Nutzungspotential der oberflächennahen<br />
thermischen Nutzung des Grundwassers zu bestimmen.<br />
Bei der Wärmeausbreitung in Grundwasserleitern sind grundsätzlich folgende Mechanismen<br />
beteiligt:<br />
� Ausbreitung mit der Abstandsgeschwindigkeit (Konvektion)<br />
� Vermischung durch hydrodynamische Dispersion<br />
� Wärmeaustausch mit der Atmosphäre<br />
� Wärmespeicherung im System grundwassererfüllter Porenraum/Korngerüst<br />
� Wärmeaustausch an den Flanken und an der Sohle des Temperaturfelds (Konduktion)<br />
Spezifisches Nutzungspotential:<br />
Die gesamte Herleitung des zu erwartenden Nutzungspotentiales erfolgte anhand des Nutzungsmechanismus<br />
der oberflächennahen Geothermie.<br />
Diese Überlegung wird auch dahingehend gestützt, dass aufgrund der Grundwassertemperaturmessungen<br />
eine Parallelität zu den Jahreszeiten bzw.Verlauf der Jahrestemperaturen<br />
festgestellt werden kann.<br />
Herleitung Variante 1: Modell Erdwärmeregister<br />
Spezifische Entzugsleistung: 30 W/m2<br />
Nutzungszeit: 2`000 h/a<br />
Spezifische Entzugsenergie: 60.00 kWh/m2*a<br />
Herleitung Variante 2: Modell Erdwärmekörbe<br />
Spezifische Entzugsleistung: 500 W/Korb<br />
Nutzungszeit: 2`000 h/a<br />
Spezifische Fläche: 16 m2/Korb<br />
Spezifische Entzugsenergie: 62.50 kWh/m2*a<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 36<br />
Herleitung Variante 3: Modell Temperaturfeldberechnung<br />
Aufgrund der Simulation der Temperaturfeldberechnung<br />
wird aufgrund der 1°C-Isotherme die spezifische<br />
Entzugsenergie berechnet.<br />
Entzugsenergie: 45`000 kWh/a<br />
Temperaturfeld 1°C Isotherme: 900 m2<br />
Spezifische Entzugsenergie: 50.00 kWh/m2*a<br />
Herleitung Variante 4: Energieinhalt Grundwasser<br />
Grundwassermächtigkeit: 3 m<br />
Temperaturnutzung: 4 K<br />
Spezifische Fläche: 1 m2<br />
Spezifische Entzugsenergie: 15.00 kWh/m2*a<br />
Herleitung Variante 5: Energieinhalt Grundwasser<br />
Grundwassermächtigkeit: 6 m<br />
Temperaturnutzung: 4 K<br />
Spezifische Fläche: 1 m2<br />
Spezifische Entzugsenergie: 30.00 kWh/m2*a<br />
Aufgrund der vorstehenden fünf Herleitungs-Methoden ist ersichtlich, dass von einer zu erwartenden<br />
spezifischen Entzugsenergie von 15-60 kWh/m2*a ausgegangen werden kann.<br />
Es ist zu erwarten, dass die Resultate der Varianten 4 und 5 infolge der thermischen Regeneration<br />
überschritten werden dürften, so dass für die weiteren Berechnungen von 40<br />
kWh/m2*a ausgegangen wird.<br />
Grundlage Studie:<br />
Spezifische Wärmenutzung: 40 kWh/m2*a<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 37<br />
9.2.5 Anzahl Wärmenutzungsanlagen<br />
Bei der oberflächennahen Geothermie besteht das grösste Risiko in einer Übernutzung der<br />
Geothermiepotentiale.<br />
Wenn benachbarte Geothermieanlagen sich gegenseitig beeinflussen, kann die Grundwassertemperatur<br />
der im Abstrom des Grundwassers gelegenen Anlage so weit abgesenkt werden,<br />
dass die Wärmepumpe nur noch mit einer sehr ungünstigen Leistungszahl betrieben<br />
werden kann.<br />
Diese negativen Einflüsse müssen deshalb bereits im Vorfeld der Planungsarbeiten sorgfältig<br />
abgeklärt werden, so dass die negative Beeinflussung zum vorneherein verhindert und<br />
soweit möglich ausgeschlossen werden kann.<br />
Es muss mit der sorgfältigen Anordnung der Anlagen und deren Komponenten verhindert<br />
werden, dass der im Abstrom gelegene Nutzer mit höherem Antriebsenergiebedarf und weniger<br />
mit Erdwärme heizt.<br />
Das tückische daran ist, dass die Fläche im Abstrom des Grundwassers je nach geologischen<br />
Verhältnissen sehr gross sein kann und diese Auswirkungen deshalb zwingend vorgängig<br />
sorgfältig durch den Geologen berechnet bzw. simuliert werden müssen.<br />
Die Grösse der durch die Grundwasserrückgabe verursachten “Kältefahne“ und deren Auswirkungen<br />
richtet sich nach der Anlagegrösse sowie auch den geologischen Verhältnissen<br />
und kann im Rahmen dieser Studie nicht detailliert behandelt werden.<br />
Nachfolgend sind als Beispiel die Auswirkungen der Grundwasserrückgabe einer Wärmepumpe<br />
mit einer Heizleistung von 27 kW aufgeführt:<br />
Temperaturfeldberechnung Jahresmittel: Temperaturfeldberechnung Winter-Lastfall:<br />
Unter Ansatz der mittleren Jahresentnahme Für den Lastfall Winter ergibt sich die Reichberechnet<br />
sich die Reichweite der 1°C-Isotherme weite der 1°C-Isotherme mit einer Grösse<br />
mit einer Grösse von 113 m x 8 m. von 166 m x 16 m.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 38<br />
Zur Verdeutlichung der Auswirkungen sind nachfolgend die modellierten Auswirkungen der<br />
Kältefahnen im Limmatgrundwasserstrom dargestellt:<br />
In Grundwasserfliessrichtung können je nach Anlagegrösse Grundwasserabkühlungen bis zu<br />
3°C in den Abstrom markierten Bereichen festgestellt werden.<br />
Grundlage Studie:<br />
Die Auswirkungen verursacht durch die Kältefahne der Grundwasserrückgabe<br />
richtet sich nach Anzahl und Grösse der Anlagen sowie auch der geologischen<br />
Verhältnisse und kann in dieser Studie nicht detailliert behandelt werden.<br />
Die Berücksichtigung dieses Parameters ist mit dem Gewinnungsfaktor vorzunehmen.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 39<br />
9.2.6 Gewinnungsfaktor<br />
Aufgrund des Flächenkatasters wurden durch Lienert & Haering AG die Gebiete sowie deren<br />
prognostizierte Grundwasserfördermenge ermittelt.<br />
Mittels der spezifischen Wärmenutzung (kWh/m2*a) kann aufgrund des Flächenkatasters<br />
(m2) das theoretische Wärmenutzungspotential ermittelt werden.<br />
Dieses theoretische Wärmenutzungspotential wird jedoch in der Praxis nicht vollständig ausgeschöpft<br />
werden können, so dass zur Berücksichtigung der nachfolgenden Einflüsse der<br />
Gewinnungsfaktor zur Ermittlung des effektiv zu erwartenden Wärmenutzungspotentiales<br />
miteinbezogen werden muss:<br />
� Bauzone<br />
Einfluss der Bauzone<br />
Das Gebiet liegt ausserhalb der Bauzone, so dass eine unmittelbare Nutzung<br />
zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich ist.<br />
� Bebauung<br />
Einfluss der Bebauung<br />
Das Gebiet ist vollständig bebaut oder liegt in Verkehrswegen (Strassen oder Plätze)<br />
bzw. es ist derzeit keine Bebauung vorhanden,<br />
so dass eine unmittelbare Nutzung zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich ist.<br />
� Wärmenutzungsanlagen<br />
Einfluss der Wärmenutzungsanlagen<br />
Die mögliche Anzahl der Wärmenutzungsanlagen wird von deren Grösse<br />
und den geologischen Verhältnissen beeinflusst.<br />
Ausschnitt Zonenplan Ebnat-Kappel:<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 40<br />
Ausschnitt Zonenplan Wattwil:<br />
Die Ermittlung des Wärmenutzungspotentiales für die Studie durch Ausscheidung aufgrund<br />
des heutigen Zonenplanes sowie deren Bebauung würde aus unserer Sicht zu keinem aussagekräftigen<br />
Ergebnis führen.<br />
So ist es z.B. möglich, dass in den nächsten Jahren Gebiete umgezont oder bebaut werden.<br />
Im speziellen wäre es aber auch denkbar, dass Grundwasser aus z.B. ausserhalb der<br />
Bauzone liegenden Gebieten intensiv genutzt werden könnten und mittels Heizzentrale und<br />
Wärmenetzen die produzierte Energien zu den Wärmebezügern geführt werden.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 41<br />
Wärmenutzungspotential<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
Wärmenutzungspotential in Funktion Gewinnungsfaktor<br />
0%<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />
Gewinnungsfaktor<br />
Grundlage Studie:<br />
Ermittlung des zu erwartenden Wärmenutzungspotentiales<br />
aufgrund des theoretischen Potentials unter Berücksichtigung<br />
des Gewinnungsfaktors.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 42<br />
9.2.7 Prinzipielle Einbindung<br />
Die einschlägigen gesetzlichen Anforderungen und Vorschriften wurden durch Lienert &<br />
Haering AG detailliert aufgeführt, so dass im nachfolgenden lediglich die wichtigsten technischen<br />
Anforderungen beschrieben werden.<br />
Prinzipdarstellung einer Grundwasserwärmepumpenanlage:<br />
Entnahme-<br />
temperatur<br />
� Wärmepumpe<br />
Leistungsdimensionierung durch Fachmann auf das Objekt abgestimmt gemäss den<br />
gültigen SIA-Normen und Regeln der Technik.<br />
� Entnahmebrunnen<br />
Dimensionierung, Anordnung durch Geologen.<br />
� Rückgabebrunnen<br />
Dimensionierung, Anordnung durch Geologen.<br />
� Entnahmetemperatur<br />
Gemäss örtlichen und geologischen Verhältnissen festzulegen<br />
Abhängig von Hydraulik (Systemtrennung)<br />
Rückgabe-<br />
temperatur<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 43<br />
� Rückgabetemperatur<br />
Gemäss örtlichen und geologischen Verhältnissen festzulegen<br />
Abhängig von Hydraulik (Systemtrennung)<br />
� Mindestabstand Entnahmebrunnen - Rückgabebrunnen<br />
Dimensionierung, Anordnung durch Geologen.<br />
Nutzungsprinzip Generell:<br />
Mit Grundwasserwärmepumpen wird der Wärmeinhalt des Grundwassers als regenerative<br />
Energiequelle für Heiz- und Kühlzwecke genutzt. Dazu wird über einen Entnahmebrunnen<br />
Grundwasser gefördert, dem mittels Wärmetauscher Energie entzogen (für Heizzwecke)<br />
bzw. zugeführt (für Kühlzwecke) wird.<br />
Anschließend wird das thermisch veränderte Grundwasser wieder in denselben Grundwasserleiter<br />
zurückgegeben.<br />
Die vorstehende Grafik zeigt das generelle Nutzungsprinzip bei Direktnutzung.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 44<br />
Nutzungsprinzip ohne Zwischenkreislauf:<br />
Die gesetzlichen Vorschriften und Empfehlungen können den Einbau eines Zwischenkreislaufes<br />
verlangen, damit allfällige Verunreinigungen des Grundwassers hervorgerufen durch<br />
Leckagen oder Undichtigkeiten im Kältekreislauf verhindert werden können.<br />
� Vorteile ohne Zwischenkreislauf<br />
höhere Eintrittstemperatur in Wärmepumpe, dadurch bessere Effizienz<br />
weniger Apparate, geringerer Platzbedarf und Investitionskosten<br />
Keine zusätzliche Umwälzpumpe im Zwischenkreislauf<br />
� Nachteile ohne Zwischenkreislauf<br />
Risiko der Grundwasser-Verunreinigung bei Kältekreislauf-Leckagen<br />
Risiko der Verschmutzung des Verdampfers durch Sand etc.<br />
Risiko der Korrosion des Verdampfers<br />
Prinzipschema ohne Zwischenkreislauf:<br />
Die Grundwasserpumpen fördern das Grundwasser vom Entnahmebrunnen direkt durch den<br />
Verdampfer und danach zum Rückgabe-Bauwerk.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 45<br />
Nutzungsprinzip mit Zwischenkreislauf:<br />
Die gesetzlichen Vorschriften und Empfehlungen können den Einbau eines Zwischenkreislaufes<br />
verlangen, damit allfällige Verunreinigungen des Grundwassers hervorgerufen durch<br />
Leckagen oder Undichtigkeiten im Kältekreislauf verhindert werden können.<br />
Im Zwischenkreislauf muss ein von den Behörden zugelassener Wärmeträger verwendet<br />
werden.<br />
� Vorteile mit Zwischenkreislauf<br />
kein Risiko der Grundwasser-Verunreinigung bei Kältekreislauf-Leckagen<br />
kein Risiko der Verschmutzung des Verdampfers durch Sand etc.<br />
kein Risiko der Korrosion des Verdampfers<br />
� Nachteile mit Zwischenkreislauf<br />
tiefere Eintrittstemperatur in Wärmepumpe, dadurch schlechtere Effizienz<br />
mehr Apparate, grösserer Platzbedarf und Investitionskosten<br />
zusätzliche Umwälzpumpe im Zwischenkreislauf<br />
Damit der Temperaturverlust durch den zusätzlichen Wärmetauscher des Zwischenkreislaufes<br />
möglichst gering gehalten werden kann, sollte die Auslegung des Wärmetauschers mit<br />
einer Grädigkeit von maximal 1-2 Kelvin (K) erfolgen.<br />
Auch wenn dadurch die Investitionskosten durch die grösseren Wärmetauscherflächen höher<br />
liegen, kann dies doch durch die höhere Effizienz auf die lange Nutzungsdauer bezogen<br />
kompensiert werden.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 46<br />
Zwischenkreislauf mit Plattenwärmetauscher (Heizen/Kühlen):<br />
Prinzipschema mit Zwischenkreislauf:<br />
Die Grundwasserpumpen fördern das Grundwasser vom Entnahmebrunnen durch den<br />
Wärmetauscher des Zwischenkreislaufes und danach zum Rückgabe-Bauwerk.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 47<br />
Prinzipschema Heizungsanlage Alterswohnungen, Thuraustrasse 17, 9630 Wattwil:<br />
Vorlauftemperaturen:<br />
Wärmepumpen weisen die beste Effizienz auf, wenn die Temperaturdifferenz zwischen Verdampfer<br />
und Kondensator möglichst gering gehalten werden kann.<br />
Für Heizsysteme bzw. deren Wärmeabgabesysteme bedeutet dies, dass eine Dimensionierung<br />
der Heizflächen mit möglichst tiefen Vorlauftemperaturen angestrebt werden sollte.<br />
Im Hinblick auf die Abschätzung des Wärmepotentiales für Ebnat-Kappel und Wattwil wurde<br />
dem Umstand Rechnung getragen, dass es sich bei einer künftigen Beheizung mehrheitlich<br />
um bestehende Gebäude handeln dürfte, welche demzufolge auch höhere Vorlauftemperaturen<br />
benötigen.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 48<br />
Grafik Heizkurve:<br />
60 °C<br />
55 °C<br />
50 °C<br />
45 °C<br />
40 °C<br />
35 °C<br />
30 °C<br />
25 °C<br />
20 °C<br />
-10 °C<br />
-8 °C<br />
-6 °C<br />
-4 °C<br />
-2 °C<br />
0 °C<br />
2 °C<br />
4 °C<br />
Heizkurve<br />
6 °C<br />
8 °C<br />
10 °C<br />
Die vorstehende Heizkurve beruht auf einem Wärmeabgabesystem mit notwendigen Vorlauftemperaturen<br />
von 55°C bei einer Aussenlufttemperatur von -10°C.<br />
Bei der häufigsten Aussentemperatur während der Heizperiode von 3-4°C ergibt sich eine für<br />
die Heizperiode massgebliche durchschnittliche Vorlauftemperatur von 40°C.<br />
Grundlage Studie:<br />
Energienutzung mittels Wärmepumpe mit Elektroantrieb<br />
Vorlauftemperatur WP = 40°C<br />
Arbeitszahl WP COP = 4.50<br />
Jahresarbeitszahl WP JAZ = 4.00<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg<br />
12 °C<br />
14 °C<br />
16 °C<br />
18 °C<br />
20 °C<br />
Vorlauf<br />
Rücklauf
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 49<br />
9.2.8 Grundwasser-Entnahme<br />
Die Anordnung und Dimensionierung der Grundwasser-Entnahme hat gemäss den gültigen<br />
gesetzlichen Vorschriften und Empfehlungen durch den verantwortlichen Geologen zu erfolgen.<br />
Die Brunnenleistung hängt vor allem von den hydrogeologischen Gegebenheiten ab und<br />
muss eine Dauerentnahme für den Nenndurchfluss der angeschlossenen Wärmepumpe gewährleisten.<br />
Dieser beträgt je nach gewählter Grundwasser-Abkühlung 0.2 bis 0.3 m³/h pro 1 kW Verdampferleistung.<br />
Die Brunnenleistung muss über einen Pumpversuch nachgewiesen werden.<br />
Aufbau eines Förderbrunnens:<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 50<br />
9.2.9 Grundwasser-Rückgabe<br />
Die Anordnung und Dimensionierung der Grundwasser-Rückgabe hat gemäss den gültigen<br />
gesetzlichen Vorschriften und Empfehlungen durch den verantwortlichen Geologen zu erfolgen.<br />
Die Leistung der Grundwasser-Rückgabe hängt vor allem von den hydrogeologischen Gegebenheiten<br />
ab und muss eine Dauerrückgabe für den Nenndurchfluss der angeschlossenen<br />
Wärmepumpe gewährleisten.<br />
Aufbau eines Rückgabe-Bauwerkes:<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 51<br />
9.3 Wärmenutzungspotential Ebnat-Kappel<br />
Die Gemeinde Ebnat-Kappel weist eine Einwohnerzahl von knapp 5`000 Personen auf,<br />
die gesamte Gemeindefläche beträgt 43.5 km2.<br />
Mit den vorliegenden Grundlagendaten und Berechnungen ist es möglich,<br />
die folgenden Kennzahlen zu berechnen:<br />
� Wärmenutzungspotential absolut<br />
Durch die Berechnung des theoretischen Wärmenutzungspotentiales<br />
und Berücksichtigung des Gewinnungsfaktores kann das absolute<br />
Wärmenutzungspotential in MWh/a ausgewiesen werden.<br />
Dadurch können Aussagen zur Energieeinsparung, Substitution<br />
von Energieträgern und Schadstoffreduktionen gemacht werden.<br />
� Wärmenutzungspotential relativ<br />
Interessant für die Beurteilung des Wärmenutzungspotentiales<br />
ist der Vergleich mit dem bisherigen Energieverbrauch.<br />
Hierfür wird aufgrund von statistischen Zahlen der bisherige Energieverbrauch<br />
ermittelt und mit dem Wärmenutzungspotential verglichen.<br />
Dadurch können Aussagen zum möglichen Deckungsgrad<br />
aufgrund des Wärmenutzungspotentiales gemacht werden.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 52<br />
Wärmenutzungspotential absolut:<br />
Aufgrund der Beilage Nr. 8 Übersichtsplan Ebnat-Kappel Grundwasserwärmenutzungskarte<br />
von Lienert & Haering AG wurden aufgrund des Flächenkatasters sowie der prognostizierten<br />
Fördermengen das nachfolgende theoretische Wärmenutzungspotential ermittelt:<br />
Nr. Bezeichnung Eignung Fördermenge Fläche Energiegew innung Energieproduktion Antriebsenergie Leistung Leistung Anzahl<br />
Max. Gesamt Anlagen<br />
0.04 4.00 4.00 2'000<br />
(-) (Name) (-) (l/min) (m2) (MWh/a) (MWh/a) (MWh/a) (kW) (kW) (-)<br />
8.1 Untersand gut bis sehr gut (>250 l/min) 300 20'000 800 1'067 267 112 533 5<br />
8.2 Untersand mässig bis gut (150-250 l/min) 200 35'000 1'400 1'867 467 74 933 13<br />
8.3 Untersand mässig (50-150 l/min) 100 75'000 3'000 4'000 1'000 37 2'000 54<br />
8.4 Rorgarten gut bis sehr gut (>250 l/min) 300 20'000 800 1'067 267 112 533 5<br />
8.5 Rorgarten mässig bis gut (150-250 l/min) 200 45'000 1'800 2'400 600 74 1'200 16<br />
8.6 Rorgarten mässig (50-150 l/min) 100 135'000 5'400 7'200 1'800 37 3'600 97<br />
8.7 Underdorf gut bis sehr gut (>250 l/min) 300 1'000 40 53 13 112 27 0<br />
8.8 Underdorf mässig bis gut (150-250 l/min) 200 5'000 200 267 67 74 133 2<br />
8.9 Underdorf mässig (50-150 l/min) 100 15'000 600 800 200 37 400 11<br />
8.10 Au gut bis sehr gut (>250 l/min) 300 5'000 200 267 67 112 133 1<br />
8.11 Au mässig bis gut (150-250 l/min) 200 25'000 1'000 1'333 333 74 667 9<br />
8.12 Au mässig (50-150 l/min) 100 75'000 3'000 4'000 1'000 37 2'000 54<br />
8.13 Stegrüti ungeeignet bis mässig 50 60'000 2'400 3'200 800 19 1'600 86<br />
Total 516'000 20'640 27'520 6'880 13'760 351<br />
� Nr.<br />
Fortlaufende Nummer des Gebietes<br />
� Bezeichnung<br />
Flurname des Gebietes<br />
� Eignung<br />
Eignung gemäss Lienert & Haering AG<br />
� Fördermenge<br />
prognostizierte Fördermenge gemäss Lienert & Haering AG, als Mittelwert eingesetzt<br />
� Fläche<br />
Fläche des Gebietes anhand Karte ermittelt<br />
� Energiegewinnung<br />
Berechnete Energiegewinnung aufgrund der spezifischen Wärmenutzung 40<br />
kWh/m2*a bezogen auf die dazugehörige Fläche<br />
� Energieproduktion<br />
Berechnete Energieproduktion mit Wärmepumpe mit Elektroantrieb<br />
mit Jahresarbeitszahl 4.00<br />
� Antriebsenergie<br />
Berechnete Antriebsenergie mit Wärmepumpe mit Elektroantrieb<br />
� Leistung Max.<br />
Berechnete Maximale Heizleistung mit Wärmepumpe mit Elektroantrieb,<br />
Jahresarbeitszahl 4.00, Grundwasserabkühlung 4K, bez. auf eine Entnahmestelle<br />
� Leistung Gesamt<br />
Berechnete Gesamtleistung aufgrund der Energieproduktion und 2`000 h/a Volllaststunden<br />
� Anzahl Anlagen<br />
Berechnete theoretische Anzahl Anlagen bzw. Entnahmestellen aufgrund der Leistung<br />
Max. und Leistung Gesamt ermittelt<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 53<br />
Das theoretische Wärmenutzungspotential bei einer Fläche von 516`000 m2 ergibt eine<br />
Energieproduktion von 27`520 MWh/a, dies entspricht einer Gesamtleistung von<br />
13`760 kW mit 351 Anlagen bzw. Entnahmestellen.<br />
Wie in Kapitel 9.2.6 Gewinnungsfaktor aufgeführt, muss zur Abschätzung des effektiv in<br />
Funktion der Bauzone, Bebauung und Anzahl Wärmenutzungsanlagen der der Betrachtung<br />
zugrunde gelegte Gewinnungsfaktor berücksichtigt werden.<br />
Für die der Betrachtung zugrunde gelegten Gewinnungsfaktoren schlagen wir gemäss heutigem<br />
Kenntnisstand folgende Szenarien vor:<br />
Worst Case Szenario: Gewinnungsfaktor 10%<br />
Moderates Szenario: Gewinnungsfaktor 20%<br />
Best Case Szenario: Gewinnungsfaktor 30%<br />
Energie (MWh/a)<br />
30'000<br />
25'000<br />
20'000<br />
15'000<br />
10'000<br />
5'000<br />
Energie in Funktion Gewinnungsfaktor<br />
0<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />
Gewinnungsfaktor<br />
Energiegewinnung Energieproduktion Antriebsenergie<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 54<br />
Nr. Szenario Gew innungsfaktor Energiegew innung Energieproduktion Antriebsenergie Leistung Leistung Anzahl<br />
Max. Gesamt Anlagen<br />
(-) (Name) (MWh/a) (MWh/a) (MWh/a) (kW) (kW) (-)<br />
0% 0 0 0 0 0<br />
Worst Case 10% 2'064 2'752 688 1'376 35<br />
Moderat 20% 4'128 5'504 1'376 2'752 70<br />
Best Case 30% 6'192 8'256 2'064 4'128 105<br />
40% 8'256 11'008 2'752 5'504 141<br />
50% 10'320 13'760 3'440 6'880 176<br />
60% 12'384 16'512 4'128 8'256 211<br />
70% 14'448 19'264 4'816 9'632 246<br />
80% 16'512 22'016 5'504 11'008 281<br />
90% 18'576 24'768 6'192 12'384 316<br />
100% 20'640 27'520 6'880 13'760 351<br />
Übersicht der Szenarien:<br />
Worst Case Szenario: Gewinnungsfaktor 10%<br />
Energiegewinnung: 2`064 MWh/a<br />
Energieproduktion: 2`752 MWh/a<br />
Antriebsenergie: 688 MWh/a<br />
Leistung Gesamt: 1`376 kW<br />
Anzahl Anlagen/Entnahmestellen: 35 Stk.<br />
Substitution Heizoel: 275`200 Liter/a<br />
CO2-Reduktion: 750 To/a<br />
Moderates Szenario: Gewinnungsfaktor 20%<br />
Energiegewinnung: 4`128 MWh/a<br />
Energieproduktion: 5`504 MWh/a<br />
Antriebsenergie: 1`376 MWh/a<br />
Leistung Gesamt: 2`752 kW<br />
Anzahl Anlagen/Entnahmestellen: 70 Stk.<br />
Substitution Heizoel: 550`400 Liter/a<br />
CO2-Reduktion: 1`500 To/a<br />
Best Case Szenario: Gewinnungsfaktor 30%<br />
Energiegewinnung: 6`192 MWh/a<br />
Energieproduktion: 8`256 MWh/a<br />
Antriebsenergie: 2`064 MWh/a<br />
Leistung Gesamt: 4`128 kW<br />
Anzahl Anlagen/Entnahmestellen: 105 Stk.<br />
Substitution Heizoel: 825`600 Liter/a<br />
CO2-Reduktion: 2`250 To/a<br />
Hinweis:<br />
Um die gemäss den vorstehenden Szenarien aufgeführten Energieproduktionen erreichen zu<br />
können, erhöht sich der durch den Antrieb der zur Wärmeerzeugung notwendigen Wärmepumpen<br />
benötigte elektrische Energiebedarf um 688-2`064 MWh/a.<br />
Bei den aufgeführten CO2-Reduktionen handelt es sich um eine Abschätzung auf der Basis<br />
der Wärmeerzeugung mittels Oelheizungen.<br />
Die CO2-Emissionen der Elektrizitätserzeugung für die Antriebsenergie der Wärmepumpen<br />
wurde dabei nicht berücksichtigt.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 55<br />
Energiegewinnung nach Gebieten:<br />
In der nachfolgenden Grafik ist die Energiegewinnung nach Gebieten dargestellt:<br />
70%<br />
Energiegewinnung nach Gebieten<br />
gut bis sehr gut (>250 l/min) mässig bis gut (150-250 l/min)<br />
mässig (50-150 l/min)<br />
9%<br />
Aufgrund des grossen Flächenanteiles weisen die Gebiete mit mässiger Eignung den mit<br />
70% grössten Anteil an der Wärmegewinnung auf. Die an sich mässig bis gut (21%) und gut<br />
bis sehr gut (9%) geeigneten Gebiete weisen wegen ihres geringeren Flächenanteils auch<br />
kleinere Anteile an der Wärmegewinnung auf.<br />
Dieser Umstand ist diesbezüglich wichtig, da aus diesen Gründen speziell die Förderung und<br />
Verbreitung der Wärmegewinnung mittels Grundwasserwärmepumpen auch in den vermeintlich<br />
nur “mässig“ geeigneten Gebieten gefördert werden sollte.<br />
Im weiteren lässt sich daraus auch Aussagen, dass tendenziell weniger grössere Anlagen<br />
ausgeführt werden können und sich deshalb eine Häufung von Anlagen im Bereich der mässig<br />
geeigneten Gebiete mit Fördermengen von 50-150 l/min. einstellen werden könnte.<br />
Aus bewilligungstechnischer Sicht der kantonalen Stellen wäre eine Konzentration auf weniger,<br />
dafür grössere Anlagen wünschenswert, dies wird jedoch je nach angestrebtem Gewinnungsfaktor<br />
aufgrund der vorstehend aufgeführten Gründen nicht möglich sein.<br />
Aus diesen Gründen und zur Erreichung des angestrebten Gewinnungsfaktores muss die<br />
Handhabung der Bewilligungspraxis unter Umständen angepasst werden.<br />
Das Ziel von wenigen, dafür grösseren Anlagen zur Nutzung des Grundwasserpotentiales<br />
könnte nur im Zusammenhang mit der Errichtung von lokalen Nahwärmeverbünden zur<br />
gleichzeitigen Versorgung mehrerer Gebäude erreicht werden.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg<br />
21%
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 56<br />
Wärmenutzungspotential relativ:<br />
Über den bisherigen Energieverbrauch für Raumwärme und Warmwasser liegen keine aktuellen<br />
Daten oder Erhebungen vor, so dass diese aufgrund von statistischen Zahlen abgeschätzt<br />
werden müssen.<br />
Die durch das Bundesamt für Statistik erhobenen Daten weisen aus, dass der Gesamtverbrauch<br />
nach Verwendungszweck Raumwärme und Warmwasser ca. 300 PJ pro Jahr beträgt.<br />
Umgerechnet auf die Einwohnerzahl der Schweiz von 7.50 Mio. ergibt dies einen spezifischen<br />
Energiebedarf für Raumwärme und Warmwasser von ca. 10 MWh/a pro Einwohner.<br />
Aufgrund des spezifischen Energiebedarfes für Raumwärme und Warmwasser pro Einwohner<br />
von ca. 10 MWh/a wird der für den Flächenkataster massgebende Energiebedarf für<br />
Raumwärme und Warmwasser mit 25`000 MWh/a abgeschätzt.<br />
Diagramm Deckungsgrad nach Szenarien:<br />
35%<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
11%<br />
Deckungsgrad nach Szenarien<br />
22%<br />
Je nach Szenario kann durch die Nutzung des Wärmepotentiales aus der Grundwassernutzung<br />
zur Wärmeproduktion für Raumwärme und Warmwasser im betrachteten Flächenkataster<br />
ein Deckungsgrad von 11% bis 33% gemessen am bisherigen Energiebedarf erreicht<br />
werden.<br />
Es ist zu beachten, dass dieser Anteil durch die Reduktion des Energieverbrauches durch<br />
die Effizienzverbesserungen (Dämmungen) der Gebäudehülle entsprechend vergrössert<br />
werden könnte.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg<br />
33%<br />
Worst Case Moderat Best Case
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 57<br />
9.4 Wärmenutzungspotential Wattwil<br />
Die Gemeinde Wattwil weist eine Einwohnerzahl von knapp 8`200 Personen auf,<br />
die gesamte Gemeindefläche beträgt 44.0 km2.<br />
Mit den vorliegenden Grundlagendaten und Berechnungen ist es möglich,<br />
die folgenden Kennzahlen zu berechnen:<br />
� Wärmenutzungspotential absolut<br />
Durch die Berechnung des theoretischen Wärmenutzungspotentiales<br />
und Berücksichtigung des Gewinnungsfaktores kann das absolute<br />
Wärmenutzungspotential in MWh/a ausgewiesen werden.<br />
Dadurch können Aussagen zur Energieeinsparung, Substitution<br />
von Energieträgern und Schadstoffreduktionen gemacht werden.<br />
� Wärmenutzungspotential relativ<br />
Interessant für die Beurteilung des Wärmenutzungspotentiales<br />
ist der Vergleich mit dem bisherigen Energieverbrauch.<br />
Hierfür wird aufgrund von statistischen Zahlen der bisherige Energieverbrauch<br />
ermittelt und mit dem Wärmenutzungspotential verglichen.<br />
Dadurch können Aussagen zum möglichen Deckungsgrad<br />
aufgrund des Wärmenutzungspotentiales gemacht werden.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 58<br />
Wärmenutzungspotential absolut:<br />
Aufgrund der Beilagen Nr. 9 Übersichtsplan Wattwil Teil Süd Grundwasserwärmenutzungskarte<br />
und Nr. 10 Übersichtsplan Wattwil Teil Nord Grundwasserwärmenutzungskarte<br />
von Lienert & Haering AG wurden aufgrund des Flächenkatasters sowie der prognostizierten<br />
Fördermengen das nachfolgende theoretische Wärmenutzungspotential ermittelt:<br />
Nr. Bezeichnung Eignung Fördermenge Fläche Energiegew innung Energieproduktion Antriebsenergie Leistung Leistung Anzahl<br />
Max. Gesamt Anlagen<br />
0.04 4.00 4.00 2'000<br />
(-) (Name) (-) (l/min) (m2) (MWh/a) (MWh/a) (MWh/a) (kW) (kW) (-)<br />
9.1 Wis ungeeignet bis mässig 50 80'000 3'200 4'267 1'067 19 2'133 115<br />
9.2 Färch/Au mässig bis gut (150-250 l/min) 200 80'000 3'200 4'267 1'067 74 2'133 29<br />
9.3 Au mässig bis gut und gut bis sehr gut 250 30'000 1'200 1'600 400 93 800 9<br />
10.1 Zentrum gut bis sehr gut (>250 l/min) 300 13'000 520 693 173 112 347 3<br />
10.2 Feldmühle gut bis sehr gut (>250 l/min) 300 30'000 1'200 1'600 400 112 800 7<br />
10.3 Enetbrugg mässig (50-150 l/min) 100 35'000 1'400 1'867 467 37 933 25<br />
10.4 Zentrum mässig bis gut (150-250 l/min) 200 160'000 6'400 8'533 2'133 74 4'267 57<br />
10.5 Post mässig (50-150 l/min) 100 15'000 600 800 200 37 400 11<br />
10.6 Post ungeeignet bis mässig 50 25'000 1'000 1'333 333 19 667 36<br />
10.7 Wenkenrüti mässig (50-150 l/min) 100 5'000 200 267 67 37 133 4<br />
10.8 Hintere Schomatten ungeeignet bis mässig 50 30'000 1'200 1'600 400 19 800 43<br />
10.9 Flooz/Wis mässig bis gut (150-250 l/min) 200 10'000 400 533 133 74 267 4<br />
10.10 Flooz mässig (50-150 l/min) 100 100'000 4'000 5'333 1'333 37 2'667 72<br />
10.11 Unterer Flooz mässig bis gut und gut bis sehr gut 250 30'000 1'200 1'600 400 93 800 9<br />
Total 643'000 25'720 34'293 8'573 17'147 422<br />
� Nr.<br />
Fortlaufende Nummer des Gebietes<br />
� Bezeichnung<br />
Flurname des Gebietes<br />
� Eignung<br />
Eignung gemäss Lienert & Haering AG<br />
� Fördermenge<br />
prognostizierte Fördermenge gemäss Lienert & Haering AG, als Mittelwert eingesetzt<br />
� Fläche<br />
Fläche des Gebietes anhand Karte ermittelt<br />
� Energiegewinnung<br />
Berechnete Energiegewinnung aufgrund der spezifischen Wärmenutzung 40<br />
kWh/m2*a bezogen auf die dazugehörige Fläche<br />
� Energieproduktion<br />
Berechnete Energieproduktion mit Wärmepumpe mit Elektroantrieb<br />
mit Jahresarbeitszahl 4.00<br />
� Antriebsenergie<br />
Berechnete Antriebsenergie mit Wärmepumpe mit Elektroantrieb<br />
� Leistung Max.<br />
Berechnete Maximale Heizleistung mit Wärmepumpe mit Elektroantrieb,<br />
Jahresarbeitszahl 4.00, Grundwasserabkühlung 4K, bez. auf eine Entnahmestelle<br />
� Leistung Gesamt<br />
Berechnete Gesamtleistung aufgrund der Energieproduktion und 2`000 h/a Volllaststunden<br />
� Anzahl Anlagen<br />
Berechnete theoretische Anzahl Anlagen bzw. Entnahmestellen aufgrund der Leistung<br />
Max. und Leistung Gesamt ermittelt<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 59<br />
Das theoretische Wärmenutzungspotential bei einer Fläche von 643`000 m2 ergibt eine<br />
Energieproduktion von 34`293 MWh/a, dies entspricht einer Gesamtleistung von<br />
17`147 kW mit 422 Anlagen bzw. Entnahmestellen.<br />
Wie in Kapitel 9.2.6 Gewinnungsfaktor aufgeführt, muss zur Abschätzung des effektiv in<br />
Funktion der Bauzone, Bebauung und Anzahl Wärmenutzungsanlagen der der Betrachtung<br />
zugrunde gelegte Gewinnungsfaktor berücksichtigt werden.<br />
Für die der Betrachtung zugrunde gelegten Gewinnungsfaktoren schlagen wir gemäss heutigem<br />
Kenntnisstand folgende Szenarien vor:<br />
Worst Case Szenario: Gewinnungsfaktor 10%<br />
Moderates Szenario: Gewinnungsfaktor 20%<br />
Best Case Szenario: Gewinnungsfaktor 30%<br />
Energie (MWh/a)<br />
40'000<br />
35'000<br />
30'000<br />
25'000<br />
20'000<br />
15'000<br />
10'000<br />
5'000<br />
Energie in Funktion Gewinnungsfaktor<br />
0<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />
Gewinnungsfaktor<br />
Energiegewinnung Energieproduktion Antriebsenergie<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 60<br />
Nr. Szenario Gew innungsfaktor Energiegew innung Energieproduktion Antriebsenergie Leistung Leistung Anzahl<br />
Max. Gesamt Anlagen<br />
(-) (Name) (MWh/a) (MWh/a) (MWh/a) (kW) (kW) (-)<br />
0% 0 0 0 0 0<br />
Worst Case 10% 2'572 3'429 857 1'715 42<br />
Moderat 20% 5'144 6'859 1'715 3'429 84<br />
Best Case 30% 7'716 10'288 2'572 5'144 126<br />
40% 10'288 13'717 3'429 6'859 169<br />
50% 12'860 17'147 4'287 8'573 211<br />
60% 15'432 20'576 5'144 10'288 253<br />
70% 18'004 24'005 6'001 12'003 295<br />
80% 20'576 27'435 6'859 13'717 337<br />
90% 23'148 30'864 7'716 15'432 379<br />
100% 25'720 34'293 8'573 17'147 422<br />
Übersicht der Szenarien:<br />
Worst Case Szenario: Gewinnungsfaktor 10%<br />
Energiegewinnung: 2`572 MWh/a<br />
Energieproduktion: 3`429 MWh/a<br />
Antriebsenergie: 857 MWh/a<br />
Leistung Gesamt: 1`715 kW<br />
Anzahl Anlagen/Entnahmestellen: 42 Stk.<br />
Substitution Heizoel: 342`900 Liter/a<br />
CO2-Reduktion: 950 To/a<br />
Moderates Szenario: Gewinnungsfaktor 20%<br />
Energiegewinnung: 5`144 MWh/a<br />
Energieproduktion: 6`859 MWh/a<br />
Antriebsenergie: 1`715 MWh/a<br />
Leistung Gesamt: 3`429 kW<br />
Anzahl Anlagen/Entnahmestellen: 84 Stk.<br />
Substitution Heizoel: 685`900 Liter/a<br />
CO2-Reduktion: 1`900 To/a<br />
Best Case Szenario: Gewinnungsfaktor 30%<br />
Energiegewinnung: 7`716 MWh/a<br />
Energieproduktion: 10`288 MWh/a<br />
Antriebsenergie: 2`572 MWh/a<br />
Leistung Gesamt: 5`144 kW<br />
Anzahl Anlagen/Entnahmestellen: 126 Stk.<br />
Substitution Heizoel: 1`028`800 Liter/a<br />
CO2-Reduktion: 2`850 To/a<br />
Hinweis:<br />
Um die gemäss den vorstehenden Szenarien aufgeführten Energieproduktionen erreichen zu<br />
können, erhöht sich der durch den Antrieb der zur Wärmeerzeugung notwendigen Wärmepumpen<br />
benötigte elektrische Energiebedarf um 857-2`572 MWh/a.<br />
Bei den aufgeführten CO2-Reduktionen handelt es sich um eine Abschätzung auf der Basis<br />
der Wärmeerzeugung mittels Oelheizungen.<br />
Die CO2-Emissionen der Elektrizitätserzeugung für die Antriebsenergie der Wärmepumpen<br />
wurde dabei nicht berücksichtigt.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 61<br />
Energiegewinnung nach Gebieten:<br />
In der nachfolgenden Grafik ist die Energiegewinnung nach Gebieten dargestellt:<br />
45%<br />
Energiegewinnung nach Gebieten<br />
gut bis sehr gut (>250 l/min) mässig bis gut (150-250 l/min)<br />
mässig (50-150 l/min)<br />
7%<br />
Aufgrund der grossen Flächenanteile weisen die Gebiete mit mässiger Eignung (45%) und<br />
mässig bis guter Eignung (48%) den grössten Anteil an der Wärmegewinnung auf. Die an<br />
sich gut bis sehr gut (7%) geeigneten Gebiete weisen wegen ihres geringeren Flächenanteils<br />
auch kleinere Anteile an der Wärmegewinnung auf.<br />
Dieser Umstand ist diesbezüglich wichtig, da aus diesen Gründen speziell die Förderung und<br />
Verbreitung der Wärmegewinnung mittels Grundwasserwärmepumpen auch in den vermeintlich<br />
nur “mässig“ oder “mässig bis gut“ geeigneten Gebieten gefördert werden sollte.<br />
Im weiteren lässt sich daraus auch Aussagen, dass tendenziell weniger grössere Anlagen<br />
ausgeführt werden können und sich deshalb eine Häufung von Anlagen im Bereich der mässig<br />
geeigneten Gebiete mit Fördermengen von 50-150 l/min. sowie im Bereich der mässig<br />
bis gut geeigneten Gebiete mit Fördermengen von 150-250 l/min. einstellen werden könnte.<br />
Aus bewilligungstechnischer Sicht der kantonalen Stellen wäre eine Konzentration auf weniger,<br />
dafür grössere Anlagen wünschenswert, dies wird jedoch je nach angestrebtem Gewinnungsfaktor<br />
aufgrund der vorstehend aufgeführten Gründen nicht möglich sein.<br />
Aus diesen Gründen und zur Erreichung des angestrebten Gewinnungsfaktores muss die<br />
Handhabung der Bewilligungspraxis unter Umständen angepasst werden.<br />
Das Ziel von wenigen, dafür grösseren Anlagen zur Nutzung des Grundwasserpotentiales<br />
könnte nur im Zusammenhang mit der Errichtung von lokalen Nahwärmeverbünden zur<br />
gleichzeitigen Versorgung mehrerer Gebäude erreicht werden.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg<br />
48%
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 62<br />
Wärmenutzungspotential relativ:<br />
In der Masterarbeit “Abschätzung und Umweltbewertung des Strom- und Heizenergieverbrauchs<br />
der Gemeinde Wattwil“ HS 2009 Umweltingenieurwissenschaften (Verfasser Simon<br />
Nusch) wurde der bisherige Energieverbrauch für Raumwärme und Warmwasser errechnet<br />
und mit 186`000 MWh/a aufgeführt.<br />
Die durch das Bundesamt für Statistik erhobenen Daten weisen aus, dass der Gesamtverbrauch<br />
nach Verwendungszweck Raumwärme und Warmwasser ca. 300 PJ pro Jahr beträgt.<br />
Umgerechnet auf die Einwohnerzahl der Schweiz von 7.50 Mio. ergibt dies einen spezifischen<br />
Energiebedarf für Raumwärme und Warmwasser von ca. 10 MWh/a pro Einwohner.<br />
Aufgrund des spezifischen Energiebedarfes für Raumwärme und Warmwasser pro Einwohner<br />
von ca. 10 MWh/a wird der für den Flächenkataster massgebende Energiebedarf für<br />
Raumwärme und Warmwasser mit 50`000 MWh/a abgeschätzt.<br />
Diagramm Deckungsgrad nach Szenarien:<br />
25%<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
7%<br />
Deckungsgrad nach Szenarien<br />
14%<br />
Je nach Szenario kann durch die Nutzung des Wärmepotentiales aus der Grundwassernutzung<br />
zur Wärmeproduktion für Raumwärme und Warmwasser im betrachteten Flächenkataster<br />
ein Deckungsgrad von 7% bis 21% gemessen am bisherigen Energiebedarf erreicht werden.<br />
Es ist zu beachten, dass dieser Anteil durch die Reduktion des Energieverbrauches durch<br />
die Effizienzverbesserungen (Dämmungen) der Gebäudehülle entsprechend vergrössert<br />
werden könnte.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg<br />
21%<br />
Worst Case Moderat Best Case
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 63<br />
9.5 Zusammenfassung<br />
Mit der vorliegenden Studie wurde aufgrund der geologischen Untersuchungen und Auswertungen<br />
das theoretische Wärmenutzungspotential ermittelt.<br />
Das ermittelte theoretische Wärmenutzungspotential wird jedoch aufgrund der Faktoren Lage<br />
der Bauzone, Art der Bebauung sowie Anzahl der Wärmenutzungsanlage in der Praxis<br />
nicht vollständig ausgeschöpft werden können.<br />
Zur Berücksichtigung dieser Faktoren kann das effektiv zu erwartende Wärmenutzungspotential<br />
zusammen mit dem Gewinnungsfaktor bestimmt werden.<br />
Den Betrachtungen wurden folgende Szenarien zugrunde gelegt:<br />
Worst Case Szenario: Gewinnungsfaktor 10%<br />
Moderates Szenario: Gewinnungsfaktor 20%<br />
Best Case Szenario: Gewinnungsfaktor 30%<br />
In der Studie sind die massgebenden Parameter wie Grundwassertemperaturen, Grundwasserfördermengen,<br />
Grundwasserabkühlung, Spezifische Wärmenutzung und Anzahl Wärmenutzungsanlagen<br />
definiert, Abweichungen können mittels Korrekturfaktoren sowie dem Gewinnungsfaktor<br />
berücksichtigt werden.<br />
Ebnat-Kappel:<br />
Der Flächenkataster der möglichen Grundwassernutzung beträgt 516`000 m2.<br />
Je nach Szenario kann eine Energieproduktion zwischen 2`752-8`256 MWh/a ausgewiesen<br />
werden, dadurch kann eine Heizoelmenge zwischen 275`200-825`600 Liter/a bzw. eine<br />
CO2-Reduktion zwischen 750-2`250 Tonnen/a sowie ein Deckungsgrad des bisherigen<br />
Energiebedarfes zwischen 11-33% erreicht werden.<br />
Wattwil:<br />
Der Flächenkataster der möglichen Grundwassernutzung beträgt 643`000 m2.<br />
Je nach Szenario kann eine Energieproduktion zwischen 3`429-10`288 MWh/a ausgewiesen<br />
werden, dadurch kann eine Heizoelmenge zwischen 342`900-1`028`800 Liter/a bzw. eine<br />
CO2-Reduktion zwischen 950-2`850 Tonnen/a sowie ein Deckungsgrad des bisherigen<br />
Energiebedarfes zwischen 7-21% erreicht werden.<br />
Sowohl für Ebnat-Kappel wie auch Wattwil kann festgestellt werden, dass aufgrund der grossen<br />
Flächenanteile die Gebiete mit mässiger Eignung und mässig bis guter Eignung den<br />
grössten Anteil am Wärmenutzungspotential aufweisen.<br />
Dieser Umstand ist diesbezüglich wichtig, da aus diesen Gründen speziell die Förderung und<br />
Verbreitung der Wärmegewinnung mittels Grundwasserwärmepumpen auch in diesen Gebieten<br />
vorangetrieben werden sollte.<br />
Aus diesen Gründen lässt sich ableiten, dass bei einer intensiven Nutzung des Wärmepotentiales<br />
tendenziell eine grössere Anzahl kleinerer Anlagen erstellt werden wird.<br />
Grundsätzlich wäre eine Konzentration auf weniger, dafür grössere Anlagen wünschenswert,<br />
zur Erreichung des angestrebten Gewinnungsfaktores muss die Handhabung der Anlageanzahl,<br />
deren gegenseitigen Beeinflussung und Bewilligungspraxis unter Umständen angepasst<br />
werden.<br />
Mit Vorliegen dieser Studie kann aufgezeigt werden, dass mit dem Wärmenutzungspotential<br />
aus der Energieproduktion der Grundwassernutzung ein erheblicher Anteil am bisherigen<br />
Energiebedarf gedeckt werden könnte.<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg
Grundwasser-Wärmepotential Ebnat-Kappel / Wattwil Seite 64<br />
Die erfolgreiche Umsetzung und Erreichung eines hohen Gewinnungsfaktores setzen jedoch<br />
eine umfassende Information aller Beteiligten voraus, so dass einerseits vom Wärmenutzungspotential<br />
Kenntnis genommen wird und andererseits durch eine optimale Planung eine<br />
möglichst umfassende Nutzung der vorhandenen Energie im Grundwasser erfolgen kann.<br />
10. SCHLUSSWORT<br />
Im gesamten Untersuchungsgebiet wurden über 320 Bohrungen ausgewertet und interpretiert.<br />
Die z.T. kleinräumigen geologischen Strukturen ergaben bei der Auswertung gewisse<br />
Interpretationsprobleme, die mit jeder neuen geologischen und hydrogeologischen Abklärung<br />
besser zu verstehen sind. Neue hydrogeologische Erkenntnisse sind in der Grundwasserwärmenutzungskarte<br />
aufzunehmen und von Fall zu Fall muss die Grundwasserwärmenutzungskarte<br />
anhand der neuen Informationen angepasst werden.<br />
Die Studie ergab, dass im Talboden von Ebnat-Kappel und Wattwil ein beachtliches nutzbares<br />
Grundwasserwärmepotential existiert. Das Grundwasser wird im Talboden jedoch auch<br />
durch eine Vielzahl von unverzichtbaren Trinkwasserfassungen genutzt, weshalb die Planung<br />
und Ausführung von Grundwasserwärmepumpen koordiniert durchgeführt werden<br />
muss. Die Trinkwassergewinnung darf durch die Errichtung von Grundwasserwärmepumpen<br />
nicht beeinträchtigt werden. Wenn immer möglich sollten Grossanlagen mit einer Leistung<br />
von über 50 - 100 kW kleineren Anlagen vorgezogen werden. Bei geringmächtigen Wasservorkommen<br />
wie beispielsweise im Dorf Wattwil, sind grössere Anlagen aus hydrogeologischer<br />
Sicht meist nur als Kombination von mehreren kleinen Fassungen möglich.<br />
St. Gallen / Wil, 29. Juni 2011<br />
GEOLOGIEBÜRO Ingenieurbüro<br />
LIENERT & HAERING AG CALOREX, Widmer & Partner AG<br />
Christoph Haering Urs Zwingli<br />
Dipl. Geologe ETH/SIA Eidg. Dipl. Heizungsplaner<br />
GEOLOGIEBÜRO LIENERT & HAERING AG / CALOREX, Widmer & Partner AG Energietal Toggenburg