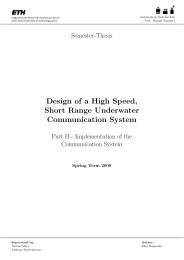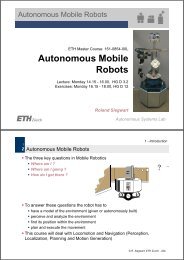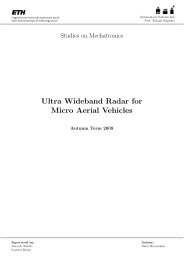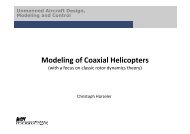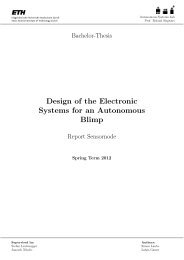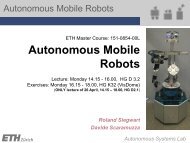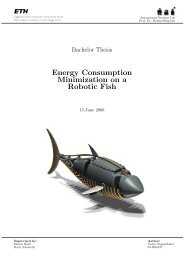Section 5 Produktstrukturierung im primären Entwicklungsprozess
Section 5 Produktstrukturierung im primären Entwicklungsprozess
Section 5 Produktstrukturierung im primären Entwicklungsprozess
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Strukturierung der KundenbedürfnisseKlassifikation von Ausprägungen:• kardinal zB: Länge 13.5m, 14.2m• ordinal zB: Länge in Stufen Gruppe 1: 10m; Gruppe 2: 10-20m• nominal zB: Farbe rot, blau, grün(binär, Untergruppe von nominal: zB: Entscheid ja / neinAusprägungstypAnforderungsliste:kardinalModifikationAusprägungstypneu strukturiert:kardinal (freie Variable)ordinalnominal(binär)ordinale Stufen (kleine Stufenzahl)nominal (weniger Ausprägungen)Klassierung der kardinalen Anforderungengegeben: Bedürfnisverteilung der Bereichsforderungen der Kunden-Merkmale (KM):Kunden-Merkmal:Ausprägung (Bsp): 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30Verteilung: 1 8 3 12 24 6 29 13 2 1 1 100%Kanalisieren derAusprägungen zu 10
Geometrische ReihenIn der Stufenbildung von Ausprägungen werden vielfach geometrischeReihen verwendetGeometrischer Stufensprung:zB.: Länge:n-te Ausprägung:n-te Länge:ϕ = ( Ausprägung1) /( Ausprägung0 )ϕ L = ( Länge1)/( Länge0 )nAusprägung( n ) = Ausprägung(0 ) ⋅ϕ4Länge( 4 ) = Länge(0 ) ⋅ϕ LEin weiterer Vorteil dieser Reihen ist, dass sich die weiterenphysikalischen Grössen, z.B. das Volumen, die Leistung, .... auch mitentsprechenden Reihen bilden lassen3zB.: Volumen ϕVolumen= ϕLängeGeometrische ReihenGenormt hat sich eine geometrische Reihenbildung Rn, welche eine fixeAnzahl von Stufen (n) pro Dekade definiert:ϕnn = 10R5 : fünf Stufen pro DekadeR10: zehn Stufen pro DekadeR20.... R40ϕ55 = 10 ≅1.6ϕ1010 = 10 ≅1.25ϕ20 ≅ 1.12; ϕ40≅ 1.06Man unterscheidet zwischen• konstanten Stufensprüngen in Reihen (zB. sind alle Stufen gemäss R10)bzw.• veränderlichen Stufensprünge bei welchen zB. die Bereiche mit kleinererHäufigkeit von Kundenbedürfnis in einer gröberen Stufung (zB.R5)vorliegen und in Bereichen von Bedürfnishäufung in eine feinere Stufung(zB.:R20) strukturiert ist
Geometrische ReihenBeispiele von Stufungen:A : konstante StufungB-E : veränderliche Stufung(Pahl/Beitz: Konstruktionslehre; Springer)Geometrische ReihenWahl der Stufung:Im praktischen Fall wird der max<strong>im</strong>ale und der min<strong>im</strong>ale Bereichswert(beide meist kardinal) als Eckwerte genommen und entschieden, in wievielen Ausprägungsgliedern der Bereich abgedeckt werden soll.B maxB minzn: max<strong>im</strong>ale Ausprägung: min<strong>im</strong>ale Ausprägung: Anzahl von Ausprägungs-Gliedern: Anzahl der Sprünge (n=z-1)ϕ(z 1)B= − maxBminAbgleich der Stufung mit• Normreihung (Wahl einer Reihung, welche obige Stufung bestmöglicherfüllt)• mit der Bedürfnisverteilung (u.U. teilweise veränderliche Stufung)• mit Konkurrenzabgleichmit dem Ziel der Min<strong>im</strong>ierung der Anzahl Ausprägungsstufen undbestmöglicher Abdeckung der Bedürfnisse.Eine Anpassung dieser Gliederung erfolgt iterativ zu einem späterenZeitpunkt, wenn die Gestaltungsmerkmale und deren Auswirkungenfestliegen.
Geometrische ReihenBeispiel:Die Anforderungsliste für die Durchflussmenge eines Ventils schreibtmin<strong>im</strong>al 2Liter pro Minute und max<strong>im</strong>al 15 Liter pro Minute vor. DerBereich soll mit 6 Ausprägungen (5 Stufen) abgedeckt werden.Wahl R5ϕ = (5) 15 = 1.4921. IterationAusprägung Durchfluss1 2.02 3.03 4.54 6.85 10.06 15Diskussions-Iteration:• Wegfall von Ausprägung 6 ausSicht des Marketing denkbar• Stufung von A5 auf A6 mit R10abdecken• Wegfall von Stufen, weil kleineBedürfnishäufung an diesen Stellen(zB: Wegfall von A3 und diebestehenden Kundenbedürfnissemit A4 abdecken)• Diskussion der Positionierung derKonkurrenz; Erkennen vonBedürfnislücken• etc., ...QFD (Quality Function Deployment)— Systematische Umsetzung von Kundenanforderung, sowie eigenerProduktziele in Produktmerkmale und quantifizierbare Forderungen andie Produkt- bzw. die Prozessentwicklung, sowie die Beschaffung unddie Produktion— Basiert auf 4 Houses of Quality (HofQ)-> Gegenüberstellung zweierProduktsichten1. HofQ: Umsetzung derKundenanforderungen in charakt.Entwicklungsmerkmale2. HofQ: Korrelation Entwicklungsmerkmalein Teile- bzw.Baugruppeneigenschaften3. HofQ: Überführen Teileeigenschaftenin dieProzesseigenschaften der Fertigung4. HofQ: kritischen Prozesseigenschaftenmit der Produktionstechnologiein Verbindung gebracht(Qualitätssicherung)
1. House of Quality: EigenschaftenSystematische Erfassung der Kundenwünsche— Gewichtetes Mapping Kundenwünsche – Produkteigenschaften— Konkurrenzvergleich— Zielangaben bez.Produkteigenschaften1. House of Quality— Bsp. Kompakt-kamera
1. HofQ— Korrelationsmatrix— Gewichtetes MappingKundenwünsche –Produkteigenschaften— ZulässigerWertebereich in denFeldern [1 (schwacheKorrelation), 3, 9(starke Korrelation)]1. HofQ— Dachmatrix— Darstellung der Korrelationenbei den Produkteigenschaften— Ziel: Input für dieProduktentwicklung -> welcheProdukteigenschaftenunterstützen sich und welcheüben gegenseitig einen negativenEinfluss aus— Qualitativ +, 0, -
1. HofQ— technische Zielwerte— quantifizierbareEntwicklungsziele— FestforderungenSchwierigkeitsgradZielforderungenQuality Function Deployment— 2. HofQ: KorrelationEntwicklungs-merkmale inTeile- bzw.Baugruppeneigenschaften— 3. HofQ: Überführen Teileeigenschaftenin dieProzesseigenschaften derFertigung— 4. HofQ: kritischeProzesseigenschaften mitder Produktionstechnologiein Verbindung gebracht(Qualitätssicherung)Literatur:Saatweber, J. (1997). Kundenorientierung durch QualityFunction Deployment; Systematisches Entwickeln vonProdukten und Dienstleistungen. München, Carl HanserVerlag.King, B. (1994). Quality function deployment doppelt soschnell wie die Konkurrenz. München, St. Gallen, gfmtVerlag.
Zielsetzung Funktionsstruktur— Hierarchische Anordnung der Funktionen— Basis für die Definition der Produktstruktur— Zusammenführung der beteiligten Bereiche(Konstruktion, Steuerungstechnik, Elektrik)— Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses überdie Funktionsweise des zukünftigen Produktes— Parallelisierung von Arbeitsschritten— Einheitliche & konsistente Datenverwaltung— Wiederverwendung bereits vorhandener Daten undInformationenErmitteln der Funktionsstruktur— Die Gesamtfunktion des technischen Systems, deren Teilfunktionensowie ihre Gliederung und Kombination zu Strukturen bilden dieGrundlage für die Suche nach Lösungen.Das Arbeitsergebnis dieses Schrittes sind eine oder mehrereFunktionsstrukturen, die auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen unddurch verschiedene Darstellungsformen beschrieben sein können.— Ziel:— Übersicht über das technische Systemverschaffen— Lösungsneutrale Darstellung desSystems— Richtige Abstraktionsebene, sonst zunahe am IST-Zustand des bestehendesProduktes— Analyse von Wirkungen, Zwecken undKonzepten— Unterscheidung der wesentlichen undweniger wichtigen Funktionen <strong>im</strong> SystemTechnisches SystemGesamtaufgabeA1 2 3 4 5Teilfunktionen
Ermitteln der Funktionsstruktur— Beschreibung:— Substantivierte Verben benutzt (keine Passivform oder Hilfsverbenmöglich)KraftKraftaufnehmenleiten— Drei Grössen:StoffEnergieInformation— 12 Stammfunktionen, einschliesslich der Umkehrfunktion [nachBreiing]:— Erzeugen – Vernichten— Speichern – Entleeren— Leiten – Sperren— Ändern – Rückändern— Wandeln – Rückwandeln— Verknüpfen - VerzweigenStammfunktionen (SF)— Erzeugen: SF aller entstehungs-abhängigen Funktionen, durchEnergie, Stoff und Information— Speichern: SF aller zeit-abhängigen Funktionen, durch dieEnergie, Stoff und Information in ihren momentanen Zuständenbeharren— Leiten: SF aller orts-abhängigen Funktionen, die durch Energie,Stoff und Information transportiert bzw. in ihren Koordinatenverschoben werden— Ändern: SF aller grössen-abhängigen Funktionen, durch dieEnergie, Stoff und Information in ihren D<strong>im</strong>ensionen verändertwerden— Wandeln: SF aller art-abhängigen Funktionen, durch dieEnergie, Stoff und Information in ihren Eigenschaftenumgewandelt werden— Verknüpfen: SF aller mengen-abhängigen Funktionen, durch dieunterschiedliche Mengen von Energie, Stoff und Informationzusammengefasst werden
Zwei Arten von Funktionsstrukturen— Beispiel: Verschlussmechanismus für Autoklavdeckel— HierarchischVerschiessen (Sperren)Schliessen Dichten ÖffnenBewegen Positionieren Verriegeln Entriegeln Bewegen— Ablauforientiert: Darstellung von Stoff, Energie und InformationSchliessenergieSchliesssignalDeckel offenSchliessenDichtenDeckel geschlossenÖffnungsenergieÖffnungssignalDeckel geschlossenÖffnenDeckel offenFunktionsstruktur: ablauforientiert— Detailliertere Darstellung: nötig zur Erfassung des zuentwickelnden VariantenproduktesSchliessenergieSchliesssignalDeckel offenSchliesskraft und–bewegungerzeugenSchliesskraft und–bewegungübertragenDichtenDeckel geschlossenÖffnungsenergieÖffnungssignalDeckel geschlossenÖffnungskraft und–bewegungerzeugenÖffnungskraft und–bewegungübertragenDeckel offen
InformationEnergieInformationEnergieEnergieMaterialEnergieMaterialEnergieAblaufbezogene Darstellungeiner FunktionsstrukturEnergieMechatronische Funktionsstruktur— Die erweiterte Funktionsstruktur dient als Ausgangslage für dieParallelisierung der Abläufe in den Domänen der EntwicklungKonzept Entwurf Detaillierung Realisierung<strong>Entwicklungsprozess</strong>Funktion 1Funktion 2Funktion 3Funktion 4MechatronischeFunktionsstrukturSteuerungSequential Functional Chart (Ablaufsprache) & I/O-ListE-CADI/O-Liste & Aktor/Sensor InformationenM-CADAktor/Sensor Informationen, HauptbaugruppenNutzen— Einbezug der Elektrik und der Steuerungstechnik in derkonzeptionellen Phase der Produktentwicklung— Koordination der Anforderungen, Aktivitäten über diemechatronische Produktstruktur— Parallelisierung der Abläufe in den Abteilungen entlangder Produktentwicklung— Frühere Verifizierung des Steuerung mit dem virtuellenModellSteuerung S<strong>im</strong>ulation 3D Visualisierung
Aufbau1. 1 Best<strong>im</strong>mung der Kundenkriterien2. 2 Auswahl der technischen Lösungen (ähnlich wie der morph.Kasten)3. 3 Konzeptgenerierung4. 4 Konzeptbewertung5. 5 Modulverbesserung und Opt<strong>im</strong>ierungBest<strong>im</strong>mung der Kundenkriterien— Begleitendes Beispiel: Mobiltelefon— 1. House of Quality: mit Zusatzspalte „Modularität“— Ziel: Darstellung Zus.-hang Kundekriterien -ProdukteigenschaftenProdukt EigenschaftenSt<strong>im</strong>me des KundenModularitätGrösse der BedienelementeLogischer AufbauLesbarkeitStossfestWärmebeständigkeitLebensdauerAufladefunktion der BatterieVerwendungsintervallLebensdauer der BatterieFormFarbenVerfügbarkeit 1 1 1 1 3 9 1Stabilität 9 9 1einfache Verwendung (Ergonomie) 9 9 9 3 9 3einfacher Wiedereinsatz 3 3 3 9einfach zu transportieren 3 9angenehmer Klang 9 3einfache Bedienung 3 9günstig 1 1 9 9 1Vorderseite individualisierbar 9 1 1 9
Auswahl der technischen Lösungen— Definition der hierarchischen FunktionsstrukturSchnurlosestelefonierenSystemschützenNummereingebenEnergiespeichernKommunikationaufbauenKommunikationdurchführenNummereintippenNummerkontrollieren— Best<strong>im</strong>mung der FunktionsträgerMobiltelefonGehäuseTastatur Display Batterie Antenne SprechanlageAuswahl der technischen Lösungen— Funktionsträger und Funktionsstruktur können in mehrereniterativen Schritten detailliert werdenMobiltelefonGehäuseTastatur Display Batterie Antenne SprechanlageVorderteilLeiterplatteLautsprecherHinterteilMikrofon— Detaillierungsgrad: bis zu den einfachen Komponenten(Artikelnummer)
Konzeptgenerierung— Gegenüberstellung der Funktionsträger mit den Module Driversin der MIM (Module Indication Matrix)— Wertebereich wie <strong>im</strong> QFD [1,3,9]LautsprecherMikrofonTastaturLeiterplatteDisplayBatterieAntenneGehäuse VorderseiteGehäuse HinterteilGruppenModule DriverProduktentwicklung Carry over (Plattform - Standard) 9 9 9Technologien9 9 3Geplante Änderungen1 9 9VariabilitätTechnische SpezifikationProd.-Gestaltung 9 9ProduktionGleichteile9 9 9 9 9 9 9 9 9Prozess/OrganisationQualität spezifische Überprüfung 9 3Einkauf Zukaufkomponenten 9 9 9 3 9 3 9 9 9Vertriebsaktivität Wartung1nach dem Verkauf Upgrade1FirmenspezifischRecycling 1Produktstrategie3 139Summe 27 27 28 32 30 31 19 36 36Module Driver— Carry over: Dieser Funktionsträger als Modul definieren, dadieser in zukünftigen Generationen auch eingebaut wird?— Technologie: Dieser Funktionsträger als Modul definieren, da inabsehbarer Zukunft die verwendete Technologie geändert wird?— Geplante Änderungen: Sind Änderungen bez. den Eigenschafendes Funktionsträgers geplant?— Technische Spezifikationen: Wird der Funktionsträger mitVarianten versehen?— Produkt-Gestaltung: Untersteht dieser Funktionsträger Modenund Trends?— Gleichteile: Sieht der Funktionsträger in allen/einigen oderkeinen der Varianten physisch gleich aus?
Module Driver— Prozess: Hat der Funktionsträger spezielle Anforderungen bez.Fertigungsverfahren, Montage usw.?— Spezifische Überprüfung: Müssen spezifische Prüfverfahrenangewendet werden?— Zukaufkomponenten: Kann dieser Funktionsträger zugekauftwerden oder untersteht dieser einer „make or buy“ Überlegung?— Wartung: Ist es möglich, dass der Funktionsträger besserdemontierbar ist, falls es als Modul definiert wird?— Upgrade: Kann das Upgrade vereinfacht werden, wenn derFunktionsträger einfach austauschbar ist?— Recycling: Ist es möglich, dass die umweltverschmutzendenMittel des Systems <strong>im</strong> Funktionsträger vorhanden sind?Modularisierung— Anzahl Module: Wurzel aus Anzahl Einzelteile (Mobiltelefon ca. 6Module)— Vorgehen1. Module mit der höchsten Summenzahl2. Integration von Modulen mit ähnlichem oder gleichem Muster (vonden gleichen Module Drivers beeinflusst)LausprecherMikrofonTastaturLeiterplatteDisplayBatterieAntenneGehäuse VorderseiteGehäuse HinterteilGruppenModule DriverProduktentwicklung Carry over (Plattform - Standard) 9 9 9Technologien9 9 3Geplante Änderungen1 9 9VarietätTechnische SpezifikationProd.-Gestaltung 9 9ProduktionGleichteile9 9 9 9 9 9 9 9 9Prozess/OrganisationQualität spezifische Überprüfung 9 3Einkauf Zukaufkomponenten 9 9 9 3 9 3 9 9 9Vertriebsaktivität Wartung1nach dem Verkauf Upgrade1FirmenspezifischRecycling 1Produktstrategie3 139Summe 27 27 28 32 30 31 19 36 36
Modularisierung— Mögliche Module nach dem ersten Schritt:— Leiterplatte— Display— Batterie— Gehäuse Vorderseite— Gehäuse Hinterteil— Mögliche Module nach dem zweiten Schritt:— Leiterplatte + Antenne— Display— Batterie— Gehäuse— Interaktion (Lautsprecher, Mikrofon und Tastatur)Konzeptbewertung— Untersuchung der Schnittstellen zwischen den Modulen— spielen eine zentrale Rolle <strong>im</strong> Produkt— sind ein Mass für die Flexibilität und die Erzeugung der Varietät <strong>im</strong>Variantenprodukt— Unterscheidung zwischen— fixen Schnittstellen (Kräfteübertragung) (k)— beweglichen Schnittstellen (Energieübertragung) (e)LeiterplatteDisplayBatterieGehäuseInteraktione eek k kk
Auswertung der Konzepte— Ziel: alle Interaktionen in einer Linie oder Diagonale— Grund: Vereinfachung der Montage— Alle Module einzeln vormontiert – Endmontage sequentiell undeinfach (<strong>im</strong>mer nur eine Interaktion zwischen zwei Modulen!)LeiterplatteDisplayBatterieGehäuseInteraktione eek k k Leiterplatte Interaktion DisplaykMontage umein zentralesElement„Hamburger“MontageGehäuse Elektronik Batterie— Problemfeld: Gehäuse-Display— Mögliche Lösung: Integration des Displays in das GehäusemodulModulverbesserung und Opt<strong>im</strong>ierung— Opt<strong>im</strong>ierung nach verschiedenen Gesichtspunkten— Montagereihenfolge,Ziel: Produktvarietät am Schluss der Montagereihenfolgeeinfliessen lassen— Demontage von wartungsintensiven Modulen— Kosten-, Zeitopt<strong>im</strong>ierung in der Fertigung, Montage und Logistik-> Prozessopt<strong>im</strong>ierung
Modular Product Architecture— Serie von Untersuchungen am Center for Innovation in ProductDevelopment MIT— Ziel: Kostenbewusste und marktgerechte Modularisierung vonProdukten (Produktplattformen)— Eigenschaften— Systematische Vorgehensweise für die Modulgestaltung,insbesondere bei Produktplattformen geeignet— <strong>Produktstrukturierung</strong> mittels „Modularity Matrix“— Berücksichtigung von Funktionsstruktur, Varietät, Kosten undHerstellbarkeitVorgehensweise— 1 Best<strong>im</strong>mung der Varietät der Produkte <strong>im</strong> Portfolio— 2 Definition der Funktionsstruktur des Variantenproduktes— 3 Erstellung der Modularisierungskonzepte mittels derModularity Matrix— 4 Bewertung und Auswahl des auszuführenden Konzeptes
Best<strong>im</strong>mung der Varietät der Produkte <strong>im</strong> Portfolio— Begleitendes Beispiel:— Elektrogeräte für den Haushalt:Akku-Bürste – Akku-Bohrer und Akku-Schraubenzieher— Eruieren:— Nachfragevarietät des Marktes und— Gebrauchsvarietät des Produktes eines jeden Kunden (Erweiterung desFunktionsspektrums)— Bsp. mit QFD oder Merkmalsbaum— Ausarbeitung von Produktkonzepten für alle Ausprägungen (Akku-Bürste – Akku-Bohrer und Akku-Schraubenzieher) als Basis für daszukünftige AngebotDefinition der Funktionsstruktur— Best<strong>im</strong>mung der Funktionsstruktur jedes Gerätes:z.B. Akku-Bürste
Definition der Funktionsstruktur— Best<strong>im</strong>mung der Funktionsstruktur jedes Gerätes:z.B. Akku-SchraubenzieherBest<strong>im</strong>mung der übergreifenden Prod.Struktur— Best<strong>im</strong>mung der max<strong>im</strong>alen Funktionsstruktur
Übergreifende FunktionsstrukturModule aus der Funktionsstruktur1. Dominant Flow: in der Funktionsstruktur werden die Energie-,Stoff- und Informationsvorgänge analysiert. Wird ein Vorgangdes Systems erkannt, der verschiedene Funktionen tangiert undeine Eingangs- und ein Ausgangsfunktion aufweist, werden diebetroffenen Funktionen zu einem Modul zusammengefasst.2. Branching Flows: sind Funktionen, welche einenVerzweigungsvorgang auslösen. Aus einem Eingang werden zweiKetten von Folgevorgängen ausgelöst. Solche Funktionenwerden als Module definiert.3. Transformation/Conversion: es handelt sich dabei umFunktionen, welche Energie-, Stoff- oder Informationsvorgängein eine andere Form umwandeln. Ein Benzinmotor wandelt Stoff(Benzin) bekanntlich in Energie (thermische und mechanischeEnergie) um. Solche Funktionen werden auch als Moduledeklariert.
Modulbildungaus 1.aus 2. und 3.aus 1.Modularity MatrixSpaltenweise Eintragen der ModuleFunktiongezielte AusprägungenBatterie positionieren 1 1 2Batterie dichten ja - -Energie erzeugen 1 1 2Batterie entdichten ja - -Batterie entfernen 1 1 2Netzschalter einschalten ein/aus vorwärts/rückwärts/aus vorwärts/rückwärts/aus/sperrenEnergie wandeln Motor A Motor B Motor CDrehrichtung sperren - ja -Leistungsstärke best<strong>im</strong>men - - 5 stufigLeistung übertragen Welle Welle WelleKraft auf Ob. anbringen Bürste Schraubenzieher Schraubenzieher/Bohrwkz.Feinpositionierung ermöglichen Handgriff Produktform HandgriffWerkzeug positionieren dreieckiges Loch achteckiges Loch BohrfutterWerkzeug sichern Schnapphacken Schapphacken Bohrfuttergehäuse
Modularity MatrixGemeinsame Funktionen: reihenweise eintragenFunktiongezielte AusprägungenBatterie positionieren 1 1 2Batterie dichten ja - -PotentielleStandardisierungskandidaten:-1 Batterie-2 Motoren-1 WelleEnergie erzeugen 1 1 2Batterie entdichten ja - -Batterie entfernen 1 1 2Netzschalter einschalten ein/aus vorwärts/rückwärts/aus vorwärts/rückwärts/aus/sperrenEnergie wandeln Motor A Motor B Motor CDrehrichtung sperren - ja -Leistungsstärke best<strong>im</strong>men - - 5 stufigLeistung übertragen Welle Welle WelleKraft auf Ob. anbringen Bürste Schraubenzieher Schraubenzieher/Bohrwkz.Feinpositionierung ermöglichen Handgriff Produktform HandgriffWerkzeug positionieren dreieckiges Loch achteckiges Loch BohrfutterWerkzeug sichern Schnapphacken Schapphacken BohrfuttergehäuseModularisierung mit der Modularity-Matrix— Überlappung der Module und StandardfunktionenFunktiongezielte AusprägungenBatterie positionieren 1 1 2Batterie dichten ja - -Energie erzeugen 1 1 2Batterie entdichten ja - -Batterie entfernen 1 1 2Netzschalter einschalten ein/aus vorwärts/rückwärts/aus vorwärts/rückwärts/aus/sperrenEnergie wandeln Motor A Motor B Motor CDrehrichtung sperren - ja -Leistungsstärke best<strong>im</strong>men - - 5 stufigLeistung übertragen Welle Welle WelleKraft auf Ob. anbringen Bürste Schraubenzieher Schraubenzieher/Bohrwkz.Feinpositionierung ermöglichen Handgriff Produktform HandgriffWerkzeug positionieren dreieckiges Loch achteckiges Loch BohrfutterWerkzeug sichern Schnapphacken Schapphacken Bohrfuttergehäuse
Modularity-Matrix— Diskussion von möglichen SzenarienBatterie:— Standardisieren:1 Leistungsstufe, <strong>im</strong>mer wasserdicht oder1 Leistungsstufe und zwei Varianten (wasserdicht für Bürste undnicht wasserdicht)Motor:— Standardisieren:1,2 oder 3 Motorvarianten?— Zwei Aspekte beleuchtet: produktspezifische Faktoren undproduktübergreifende Faktoren— Unterstützung bei der Modulbildung, Unterstützung bei derDefinition von Standardmodulen und bei der Erzeugung derVariantenvielfalt— Verschiedene mögliche Konzepte erarbeiten, wie die Produktemodularisiert werden könnenBewertung der Konzepte— Entscheidungskriterien (Bsp.)— technologische Reife,— Kernkompetenz,— Entwicklungszeit,— Komplexität,— Strategische Bedeutung,— Kosten,— Herstellbarkeit,— Montage,— Modularisierbarkeit usw.