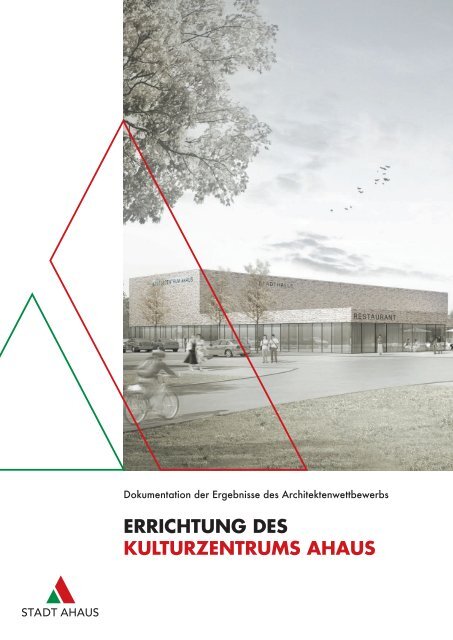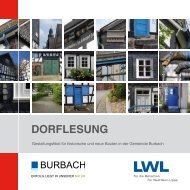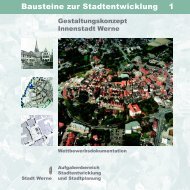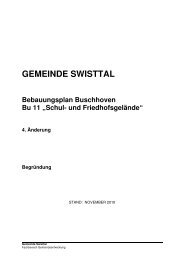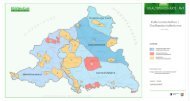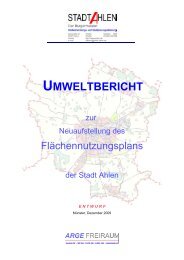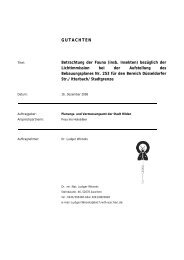ERRICHTUNG DES KULTURZENTRUMS AHAUS
ERRICHTUNG DES KULTURZENTRUMS AHAUS
ERRICHTUNG DES KULTURZENTRUMS AHAUS
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />
<strong>ERRICHTUNG</strong> <strong>DES</strong><br />
<strong>KULTURZENTRUMS</strong> <strong>AHAUS</strong>
Impressum<br />
Herausgeber und<br />
Wettbewerbsauslober<br />
Stadt Ahaus<br />
Fachbereich Stadtplanung<br />
Rathausplatz 1<br />
48683 Ahaus<br />
Ansprechpartner: Walter Fleige<br />
Tel.: 0 25 61 / 72 - 43 0<br />
Fax: 0 25 61 / 72 - 81 - 43 0<br />
E-Mail: w.fleige@ahaus.de<br />
Web: www.ahaus.de<br />
Wettbewerbsbetreuung und<br />
Dokumentation<br />
Norbert Post • Hartmut Welters<br />
Architekten & Stadtplaner GmbH<br />
Arndtstraße 37<br />
44135 Dortmund<br />
Tel.: 02 31 / 44 73 48 - 60<br />
Fax: 02 31 / 55 44 44<br />
E-Mail: info@post-welters.de<br />
Web: www.post-welters.de<br />
Wettbewerbsbetreuung und<br />
Vorprüfung:<br />
Christine Dern, Ellen Wiewelhove<br />
Dokumentation - Redaktion,<br />
Layout und Satz:<br />
Christine Dern<br />
Fotonachweis:<br />
Post • Welters<br />
2 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs
Inhaltsverzeichnis<br />
Vorwort 5<br />
Aufgabenstellung 7<br />
Rahmenbedingungen 7<br />
Allgemeine Planungsaufgabe und Ziele 9<br />
Wettbewerbsverfahren 13<br />
Die Teilnehmer 13<br />
Ablauf des Wettbewerbs 13<br />
Besetzung des Preisgerichts 14<br />
Übersicht Wettbewerbsergebnis 16<br />
Preisträger 16<br />
2. Rundgang 17<br />
1. Rundgang 19<br />
Übersicht Modellfotos 21<br />
Der 1. Preis 22<br />
Der 2. Preis 28<br />
Der 3. Preis 32<br />
Anerkennung 36<br />
Anerkennung 40<br />
Anerkennung 44<br />
2. Rundgang 48<br />
1. Rundgang 57<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 3
4 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs
Vorwort<br />
Die Stadt Ahaus plant im Umfeld der<br />
heutigen Stadthalle die städtebaulich-architektonische<br />
Neuordnung zur<br />
Errichtung des Kulturzentrums. Diese<br />
setzt sich zusammen aus der gerade<br />
fertig gestellten Volkshochschule und<br />
der Musikschule sowie dem im Rahmen<br />
des Wettbewerbs zu planenden<br />
Ensemble aus Stadtbücherei, Stadthalle<br />
und Gastronomie einschließlich<br />
der angrenzenden Freianlagen. Das<br />
benachbarte evangelische Gemeindezentrum<br />
sowie die Ev. Christus-Kirche<br />
sollen dazu einbezogen werden.<br />
Das Wettbewerbsgebiet liegt im nördlichen<br />
Innenstadtbereich, am Übergang<br />
der Innenstadt zu den nördlich angrenzenden<br />
Wohngebieten. Am heutigen<br />
Standort der Stadthalle soll durch die<br />
Bündelung verschiedener kommunaler<br />
und kirchlicher Einrichtungen ein kultureller<br />
Schwerpunkt – das Kulturzentrum<br />
Ahaus – entstehen.<br />
Um eine angemessene Lösung zu finden,<br />
wurde ein Wettbewerb durchgeführt.<br />
Die Planungsaufgabe gliederte<br />
sich in einen hochbaulichen und einen<br />
freiraumplanerischen Teil. Aus diesem<br />
Grund richtete sich die Aufgabe<br />
an Teams aus Architekten und Landschaftsplanern.<br />
Ziel des Wettbewerbs war es, ein identitätsstiftendes<br />
Konzept zu erhalten,<br />
das den städtebaulich und funktional<br />
anspruchsvollen Rahmenbedingngen<br />
auch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit,<br />
der Zukunftsfähigkeit und der<br />
Nachhaltigkeit Rechnung trägt und in<br />
Zukunft Anlaufpunkt für die verschiedenen<br />
kulturellen Veranstaltungen der<br />
Stadt Ahaus sein kann. Die Einrichtungen<br />
sollten durch ein angemessenes<br />
Ensemble zusammenwachsen, dabei<br />
aber ihre eigene Identität im Gesamt-<br />
ensemble definieren und atmosphärisch<br />
erlebbar machen. Eine harmonische<br />
Einfügung in das Ahauser<br />
Stadtbild soll Ziel für die Planung und<br />
Realisierung sein.<br />
Die Ergebnisse des Wettbewerbs ha-<br />
ben deutlich gemacht, dass ein der-<br />
artiges Verfahren entscheidend dazu<br />
beitragen kann, für eine so bedeuten-<br />
de Aufgabe eine konsensorientierte<br />
und qualitativ hochwertige Lösung zu<br />
finden. Den Teilnehmern und den Mitgliedern<br />
des Preisgerichts danke ich<br />
für das Gelingen dieses Wettbewerbs.<br />
Ich bin davon überzeugt, dass mit den<br />
Ergebnissen eine gute Grundlage für<br />
die weitere planerische Diskussion und<br />
Umset- zung gelegt worden ist, um ein<br />
neues Kulturzentrum in Ahaus zu etablieren.<br />
Felix Büter<br />
Bürgermeister der Stadt Ahaus<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 5
Van-Heyden-Straße<br />
6 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />
Heusstraße<br />
Bernsmannskamp<br />
Vagedesstraße<br />
Windmühlentor<br />
Wüllener Straße<br />
Kirmesplatz<br />
Kreuzstraße<br />
Frauenstraße<br />
Wessumer Straße<br />
Wallstraße<br />
Markt<br />
Lageplan des<br />
Wettbewerbsgebiets<br />
Musikschule und VHS<br />
Evangelisches Dorothee-<br />
Sölle-Gemeindehaus<br />
Kirche der<br />
Ev. Christusgemeinde<br />
Stadthalle<br />
Zufahrt zum Kirmesplatz<br />
Luftbild des Wettbewerbsgebiets
Bernsmannkampschule<br />
Neubau VHS und Musikschule<br />
Aufgabenstellung<br />
Rahmenbedingungen<br />
Das neue Kulturzentrum liegt im nördlichen<br />
Innenstadtbereich, am Übergang<br />
der Innenstadt zu den nördlich angrenzenden<br />
Wohngebieten. Die Innenstadt<br />
mit Marktplatz, Schloss und Fußgängerzone<br />
ist fußläufig etwa 300 m vom<br />
Plangebiet entfernt. Der Großteil der<br />
Umgebung ist geprägt durch ein- bis<br />
zweigeschossige Wohnbebauung mit<br />
kleineren Nahversorgungseinheiten<br />
und Gastronomieeinrichtungen. Es<br />
handelt sich hierbei zumeist um freistehende<br />
Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser,<br />
welche durch großzügige<br />
Grünflächen aufgewertet werden.<br />
Das Plangebiet wird begrenzt von der<br />
Wüllener Straße sowie der angrenzenden<br />
Bebauung im Süden, von der<br />
Heusstraße und der Vagedesstraße im<br />
Westen, vom Bernsmannskamp und<br />
Windmühlentor sowie der Bebauung<br />
der Bernsmannskampschule mit VHS<br />
und Musikschule im Norden und der<br />
Wohnbebauung bzw. Ev. Kirche sowie<br />
der Wessumer Straße im Osten. Weiterhin<br />
soll südlich der Wüllener Straße<br />
das Plangebiet mit der Innenstadt verknüpft<br />
werden.<br />
Insgesamt besitzt das Plangebiet eine<br />
Fläche von ca. 17.000 qm inkl. der<br />
Grundfläche der bestehenden Gebäude<br />
der Bernsmannskampschule<br />
mit VHS und Musikschule, Stadthalle,<br />
Kirche und des Gemeindehauses. Das<br />
Gebiet südlich der Wüllener Straße<br />
weist eine Fläche von etwa 880 qm<br />
auf. Die Fahrbahn der Wüllener Straße<br />
soll in Ihrer Lage und Funktionalität<br />
nicht verändert werden.<br />
Heutige Situation<br />
Gegenwärtig sind bereits mit der<br />
Stadthalle, der Evangelischen Christusgemeinde,<br />
dem evangelischen Dorothee-Sölle-Gemeindehaus<br />
und der<br />
Bernsmannskampschule, nun genutzt<br />
durch VHS und Musikschule, mehrere<br />
öffentliche Institutionen an diesem<br />
Standort vertreten. Diese stehen heute<br />
in einem räumlichen Zusammenhang,<br />
der durch die Umstrukturierung und<br />
Bündelung städtebaulich noch stärker<br />
und klarer definiert werden soll.<br />
Durch die Bündelung mehrerer Kultureinrichtungen<br />
an einem Standort können<br />
in beachtlichem Umfang Synergien<br />
generiert werden. So soll beispielsweise<br />
ein neuer Veranstaltungsraum in<br />
der Stadthalle auch für Veranstaltungen<br />
der Bücherei, der VHS und der<br />
Musikschule zur Verfügung stehen.<br />
Die Ende der 50er Jahre geplante<br />
Stadthalle wurde seinerzeit mit einem<br />
maximalen Platzangebot von 550<br />
Plätzen errichtet. Heute reicht dieses<br />
Platzangebot für die fast 40.000<br />
Einwohner in Ahaus nicht mehr aus.<br />
Die sehr intensive Nutzung vor dem<br />
Hintergrund recht unterschiedlicher<br />
Veranstaltungskonzepte war bis zur<br />
Schließung der Halle nur mittels einer<br />
flexiblen Bestuhlung von Saal und Foyer<br />
möglich.<br />
Um den zusätzlichen Raumbedarf für<br />
die Stadthalle zu schaffen, war es im<br />
Wettbewerb freigestellt, ein Konzept<br />
eines Umbaus/Erweiterung oder eines<br />
Neubaus vorzuschlagen.<br />
Die heutige Stadtbücherei ist 1955 als<br />
»Schlossbücherei« gegründet worden<br />
und 1985 vom Schloss in das alte Kreishaus<br />
umgezogen. 1992 hat die Stadt<br />
Ahaus die Bücherei vom Kreis Borken<br />
übernommen. Die Bücherei hat seit<br />
ihrer Gründung eine kontinuierliche<br />
Aufwärtsentwicklung genommen. Sie<br />
hat heute deutlich über 4.000 Leser,<br />
jährlich 240.000 Ausleihen und einen<br />
Medienbestand von knapp 68.000<br />
Medien.<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 7
Die Stadt Ahaus hat in den vergangenen<br />
Jahren sehr gute Erfahrungen mit<br />
der Stadthallengastronomie gemacht.<br />
Egal ob im Bereich des Services für<br />
Großveranstaltungen oder auch für<br />
kleinere Events hat sich das Restaurant<br />
mit seinem Angebot zu einem integralen<br />
Bestandteil der Stadthalle entwickelt.<br />
Dies wird allgemein geschätzt<br />
und soll auch in Zukunft ein Teil des<br />
Standortkonzeptes bleiben.<br />
Grün- und Freiraum<br />
Zwischen den Gebäuden sind zur<br />
Zeit befestigte und unbefestigte Freiflächen<br />
angelegt, welche zum Teil als<br />
Stellplatzflächen südlich der Stadthalle<br />
oder für Außengastronomie genutzt<br />
werden.<br />
Die Grünflächen sind als Wiesen ohne<br />
weitere Bepflanzung ausgeführt. Verschiedene<br />
größere Einzelbäume verteilen<br />
sich über das Plangebiet. Die<br />
Grünflächen um die Gebäude der<br />
Evangelischen Kirchengemeinde befinden<br />
sich in Besitz der Kirche und<br />
sollen zukünftig an den neuen Freibereich<br />
angebunden werden.<br />
Die derzeit eingelagerte Skulptur »Annäherung«<br />
von Piotr Sonnewend, die<br />
früher zwischen Evangelischer Kirche<br />
und Stadthalle aufgestellt war, soll<br />
nach Fertigstellung des Gesamtkomplexes<br />
wieder in diesem Bereich aufgestellt<br />
werden.<br />
Planungsrecht<br />
Nach dem zur Vorbereitung des<br />
Wettbewerbs gegenwärtigem Kenntnisstand<br />
ist die Aufstellung eines Bebauungsplans<br />
nicht erforderlich. Gegebenenfalls<br />
muss das Planungsrecht<br />
vorhabenbezogen angepasst werden.<br />
Die neue Konzeption gilt es in seiner<br />
Höhe und Kubatur städtebaulich sinnvoll<br />
in die Umgebung einzufügen.<br />
8 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />
Haupteingang der Stadthalle<br />
oben: Gastronomie<br />
rechts: Ansicht der Stadthalle<br />
von der Wüllener Straße<br />
Freifläche zwischen Stadthalle (links) und Gemeindehaus/Kirche (links)
Allgemeine Planungsaufgabe<br />
und Ziele<br />
Für die Teilnehmer des Wettbewerbs<br />
wurden die folgenden Ziele und Aufgabenstellungen<br />
formuliert:<br />
Das neue Gebäude für Stadthalle, Bücherei<br />
und Gastronomie muss sich harmonisch<br />
in die Architektur der Stadt<br />
Ahaus einfügen. Durch bewusste Betonung<br />
ist ein städtebaulicher Akzent<br />
möglich.<br />
Stadthalle<br />
Die Stadthalle wird, und soll auch in<br />
Zukunft, als eine »Bürgerhalle« bzw.<br />
»Mehrzweckhalle« genutzt werden.<br />
Hier finden nicht nur Theatervorstellungen<br />
und Konzerte, sondern auch<br />
Messen, Ausstellungen, Vorträge sowie<br />
Bankettveranstaltungen und Feiern<br />
statt. Dies bedeutet, dass ein hohes<br />
Maß an Flexibilität die Funktionalität<br />
des Raumprogramms bestimmen muss.<br />
Die Barrierefreiheit für alle öffentlich<br />
zugänglichen Bereiche wird als zeitgemäßer<br />
Standard vorausgesetzt.<br />
Um den zusätzlichen Raumbedarf für<br />
die Stadthalle zu schaffen, kann diese<br />
entweder erweitert bzw. umgebaut<br />
oder neu gebaut werden.<br />
Der große Saal in der Stadthalle soll<br />
neu entwickelt werden: Der Hauptbaukörper<br />
ist ausschließlich für Veranstaltungen<br />
zu konzipieren. Bei<br />
Bankettveranstaltungen soll das Foyer<br />
dem großen Saal zugeschlagen werden<br />
können, so dass mit ausreichend<br />
Sitzplätzen an Tischen verschiedenste<br />
Wünsche in Bezug auf die Möblierung<br />
umgesetzt werden können. Des<br />
Weiteren kann das Foyer aber auch<br />
abgetrennt werden, so dass ein Raum<br />
entsteht, der unabhängig von den übrigen<br />
Räumlichkeiten in der Stadthalle<br />
funktioniert.<br />
Kern der Stadthalle ist der »Große<br />
Saal« mit mindestens 650 Sitzplätzen<br />
bei ansteigender Reihenbestuhlung<br />
und 450 Plätzen bei ebenerdiger Bankettbestuhlung.<br />
Die Errichtung eines<br />
Front-of-House-Bereiches, in welchem<br />
die Techniker für Licht und Ton sitzen,<br />
im hinteren Teil der Halle ist heute<br />
selbstverständlicher Standard.<br />
Im Foyer sind neben den Zugängen zu<br />
den Veranstaltungsbereichen die Garderobenanlage<br />
und eine Bar bzw. Cafeteria<br />
mit Loungezone vorzusehen.<br />
Dieser Bereich sollte insgesamt hell<br />
und attraktiv gestaltet werden.<br />
Im hinteren Bereich an der Straße<br />
Bernsmannskamp/Vagedesstraße<br />
soll ein Eingang für die Künstler und<br />
die Anlieferung von Kulissen etc. geschaffen<br />
werden. Auch der Orchestergraben<br />
und die Technikräume im<br />
Untergeschoss sollen auf diese Weise<br />
erschließbar sein.<br />
Stadtbücherei<br />
Die Stadtbücherei stellt als zweiter,<br />
zentraler Baustein ein wichtiges Element<br />
im Ensemble dar und soll deshalb<br />
ähnlich wie die Stadthalle eine<br />
deutliche Ablesbarkeit erhalten.<br />
Die Stadtbücherei soll sich zum neu geschaffenen<br />
Außenraum öffnen und die<br />
innenräumliche Struktur von außen erahnen<br />
lassen. Der Eingangsbereich ist<br />
so zu gestalten, dass genügend Raum<br />
für Orientierung und Service gegeben<br />
sind.<br />
Durch den geplanten Umzug der<br />
Stadtbücherei in das »Kulturzentrum«<br />
ergeben sich einerseits vielfältige Synergieeffekte<br />
(gemeinsame Nutzung<br />
verschiedener Veranstalter von unterschiedlichen<br />
Versammlungsstätten)<br />
aber auch eine mögliche Ausweitung<br />
der Nutzung von »Nichtlesern«<br />
z.B. durch die Inanspruchnahme von<br />
EDV-Arbeitsplätzen sowie Lese-, Entspannungs-<br />
und Spielbereichen in der<br />
Bücherei. Daher ist es besonders wichtig,<br />
dass das Anforderungsprofil der<br />
Stadtbücherei zukunftsorientiert auf<br />
das gewandelte Lese- und Lernverhalten<br />
reagiert. Das besondere Ambiente<br />
einer Stadtbücherei nimmt heute einen<br />
viel größeren Stellenwert ein, als es<br />
dies in der Vergangenheit tat.<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 9
Auch hier wird die Barrierefreiheit<br />
sowohl für den Publikumsbereich wie<br />
auch den Verwaltungsbereich als<br />
grundlegend und selbstverständlich<br />
angesehen.<br />
Die Stadtbücherei soll über die herkömmlichen<br />
Angebote einer Bücherei<br />
hinaus ein ansprechender Treffpunkt<br />
für die Nutzer werden. Ein Markt- und<br />
Stöberbereich soll als Schaufenster<br />
der Bücherei funktionieren und dem<br />
Besucher eine erste Orientierung über<br />
die Vielseitigkeit des Buch- und Medienangebots<br />
bieten. Hier finden sich<br />
Buch- und Medienausstellungen zu aktuellen<br />
Themen, Neuerscheinungen,<br />
Lesetipps, Veranstaltungshinweise und<br />
Bürgerinformationen.<br />
Die Hauptnutzfläche der Freihandbereiche<br />
teilt sich in die folgenden<br />
Fachbereiche auf und soll durch ein<br />
Lesecafé ergänzt werden:Sachliteratur,<br />
Jugendbücherei, Kinderliteratur,<br />
Belletristik.<br />
Zwischen den Regalen sind diverse<br />
Lese- und Recherchemöglichkeiten vorzusehen.<br />
Die Neuerwerbungen und<br />
Bestseller sollen eingangsnah präsentiert<br />
werden, so dass auch von außen<br />
bereits die aktuellen Bücher sichtbar<br />
sind. Die Anordnung der Regale ist flexibel<br />
wählbar. Allerdings sollen klare<br />
Räume gebildet und eine leichte Orientierung<br />
gewährleistet werden und<br />
kein beliebiges Labyrinth entstehen.<br />
Um auch in einigen Jahren noch aktuelle<br />
Angebote anbieten zu können,<br />
ist eine hohe Flexibilität der Räumlichkeiten<br />
von hoher Bedeutung. Das bedeutet,<br />
dass spätere Veränderungen<br />
wie beispielsweise Regalumstellungen,<br />
eine neue Möblierung der Lesezonen<br />
oder die Installation modernerer, neuer<br />
Technik möglich sein müssen. Aus<br />
diesem Grund sollten möglichst wenig<br />
feste Einbauten und leichte Trennwände<br />
zum Einsatz kommen.<br />
Gastronomie<br />
10 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />
Die Gastronomie sollte die Möglichkeit<br />
erhalten, sich mit dem Gastraum zum<br />
neu gestalteten Platz hin zu öffnen<br />
und Außengastronomie zur Belebung<br />
des Platzes anzubieten. Weiterhin sollte<br />
die Gastronomie an das Foyer der<br />
Stadthalle und der Bücherei angegliedert<br />
sein, um möglichst weitgehende<br />
Synergien zwischen diesen Bereichen<br />
zu erzeugen. Der Gastraum soll durch<br />
ein abgetrennt nutzbares »Kaminzimmer«<br />
ergänzt werden, welches für<br />
kleinere Veranstaltungen separat vermietet<br />
werden kann. Die Gastronomie<br />
muss unabhängig von Bücherei und<br />
Stadthalle nutzbar sein.<br />
Raumprogramm<br />
Folgende Flächen müssen in den Planungen<br />
untergebracht werden:<br />
Stadthalle 2.390 qm<br />
Stadtbücherei 1.255 qm<br />
Gastronomie 325 qm<br />
Summe 3.970 qm<br />
Erschließung und<br />
ruhender Verkehr<br />
Das Plangebiet inkl. der verschiedenen<br />
Haupteingänge des Kulturzentrums<br />
wird für Besucher mit Pkw von der<br />
Wüllener Straße erschlossen. Die Zahl<br />
der bislang auf dem Gelände vorhandenen<br />
Stellplätze (45 auf dem Grundstück<br />
plus 35 weitere entlang Bernsmannskamp<br />
und Vagedesstraße) soll<br />
soweit wie möglich wiederhergestellt<br />
werden. Weitere Stellplätze befinden<br />
sich auf dem Kirmesplatz. Die Einfahrt<br />
zum Kirmesplatz liegt gegenüber der<br />
Stadthalle und ist so zu gestalten, dass<br />
eine leichte Orientierung für Besucher<br />
bei größeren Veranstaltungen gegeben<br />
ist. Die Wüllener Straße selbst<br />
darf nicht verändert werden und ist in<br />
Lage und Verlauf beizubehalten.
Ebenfalls sollen auf dem Vorplatz Abstellmöglichkeit<br />
für Fahrräder in möglichst<br />
großer Anzahl angeboten werden.<br />
Diese sind dezentral in der Nähe<br />
der jeweiligen Eingänge zu verteilen.<br />
Die rückwärtige Erschließung vom<br />
Bernsmannskamp ist für die Anlieferung<br />
mit Pkw oder Lkw vorbehalten.<br />
Die Anlieferung soll möglichst wenig<br />
störend für den laufenden Betrieb der<br />
angrenzenden Bücherei erfolgen können.<br />
Das neue Kulturzentrum soll eine klare<br />
Wegeführung sowohl im Innen- wie<br />
auch im Außenraum erhalten. Dabei<br />
sind Nutzer, Personal und Waren<br />
gleichwertig angemessen zu berücksichtigen.<br />
Die Orientierung im Gebäude<br />
soll einfach und übersichtlich und<br />
von außen klar erkennbar sein, welcher<br />
Gebäudeteil des Kulturzentrums<br />
betreten wird.<br />
Auch in Bezug auf die Verkehrsflächen<br />
soll ein optimierter Baukörper entworfen<br />
werden. Jede Etage erhöht den<br />
Anteil an Verkehrsfläche wie Aufzüge<br />
oder Treppen und es werden zusätzliche<br />
Informationsstellen notwendig.<br />
Es ist selbstverständlich, dass alle Bereiche<br />
für alle Nutzer zugänglich sein<br />
müssen. Mobilitäts- und Sehbehinderte<br />
müssen sämtliche Bereiche ohne<br />
fremde Hilfe und Umwege, extern wie<br />
intern, gleichberechtigt erreichen können.<br />
Zielvorgaben für Grün- und Freiraum<br />
Die Zusammengehörigkeit der einzelnen<br />
Kultureinrichtungen zu einem<br />
Kulturzentrum soll auch über die Gestaltung<br />
des Freiraums verdeutlicht<br />
werden. Darüber hinaus soll die Gestaltung<br />
des Freiraums auch die funktionale<br />
und gestalterische Anbindung<br />
des Kulturzentrums an die Innenstadt<br />
beinhalten.<br />
In enger Zusammenarbeit mit der<br />
Evangelischen Kirchengemeinde soll<br />
der öffentliche Raum, als Verbindung<br />
zwischen den einzelnen Kultureinrichtungen,<br />
neu gestaltet werden.<br />
Der Kirmesplatz steht als Stellplatzfläche<br />
für große Veranstaltungen zur<br />
Verfügung. Daher sollte freiraumplanerisch<br />
ein Übergang über die Wüllener<br />
Straße geschaffen werden, um<br />
den Kirmesplatz so verkehrstechnisch<br />
und stadträumlich an das neue Kulturzentrum<br />
anzubinden.<br />
Wirtschaftlichkeit in Bau und<br />
Betrieb<br />
Die Stadt Ahaus legt hohen Wert auf<br />
die Wirtschaftlichkeit des Umbaus<br />
bzw. Neubaus in der Bauphase sowie<br />
im Betrieb. Dies ist bei der Wahl von<br />
Materialien und Konstruktion dringend<br />
zu beachten. Von den Planern war<br />
die Machbarkeit eine Neubaus wirtschaftlich<br />
zu prüfen. Insgesamt sollen<br />
sich die baulichen Lösungen nicht am<br />
Maßstab des technisch Machbaren<br />
orientieren sondern daran, was wirklich<br />
notwendig und damit ökonomisch<br />
vertretbar ist.<br />
Dazu sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:<br />
• kompakte, klare und funktionale<br />
Grundrissorganisation,<br />
• Reduzierung der Verkehrsfläche<br />
auf ein notwendiges Maß,<br />
• natürliche Belichtung der Räume,<br />
• Verzicht auf aufwendige Konstruktionen,<br />
• Minimierung der Oberfläche/Kompaktheit<br />
• Optimierung des Verhältnisses von<br />
verglaster zu geschlossener Fassadenfläche,<br />
• Angemessenheit der Materialwahl,<br />
geringe Vielfältigkeit, Instandsetzungsfähigkeit,<br />
Alterungsfähigkeit<br />
des Materials.<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 11
Auch auf ökologische Aspekte ist bereits<br />
während des Wettbewerbsentwurfs<br />
zu achten. So gilt es, den Energiebedarf<br />
durch passive Maßnahmen<br />
gering zu halten. Hierzu sind vor allem<br />
eine optimierte Tageslichtnutzung und<br />
eine sinnvolle Ausrichtung der Räume<br />
in Bezug auf die Sonneneinstrahlung<br />
zu berücksichtigen. Durch eine gute<br />
thermische Qualität, hohe Fugendichtheit<br />
und eine wärmebrückenfreie<br />
Konstruktion der Gebäudehülle ist der<br />
energetische Gebäudestandard zu<br />
optimieren. Möglichkeiten zur Integration<br />
einer aktiven Solarenergienutzung<br />
(z.B. Fotovoltaik) in das architektonische<br />
Konzept werden ausdrücklich<br />
begrüßt.<br />
12 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />
oben:<br />
Ev. Dorothee-Sölle-Gemeindehaus<br />
rechts:<br />
Ev. Christus-Kirche<br />
Bühnenturm der Stadthalle<br />
Zufahrt zum Kirmesplatz
Eindrücke der<br />
Preisgerichtssitzung im Ratssaal<br />
der Stadt Ahaus<br />
Wettbewerbsverfahren<br />
Auslober des Wettbewerbs war die<br />
Stadt Ahaus.<br />
Die Organisation und Betreuung des<br />
einstufigen, begrenzten, anonymen<br />
Wettbewerbs gemäß den Regeln für<br />
die Auslobung von Wettbewerben<br />
2004 (RAW) erfolgte durch das Büro<br />
Norbert Post • Hartmut Welters, Architekten<br />
& Stadtplaner GmbH aus<br />
Dortmund.<br />
Die Teilnehmer<br />
Die Gesamtzahl wurde auf 20 Teilnehmer<br />
beschränkt. Neben sechs eingeladenen<br />
Teilnehmern wurden weitere<br />
14 Teilnehmer – davon fünf in der<br />
Kategorie »Junge/Kleine Büroorganisation«<br />
und neun in der Kategorie<br />
»Erfahrenes Büro« – durch ein vorgeschaltetes<br />
EU-weit ausgeschriebenes<br />
Losverfahren gemäß den Regelungen<br />
der Vergabeordnung für freiberufliche<br />
Leistungen (VOF) ermittelt.<br />
Folgende sechs Büros wurden direkt<br />
zur Teilnahme am Wettbewerb zugeladen:<br />
• Architekten Bathe + Reber, Dortmund<br />
• Feja + Kemper Architekten, Recklinghausen<br />
• Halfmann Architekten, Köln<br />
Eindruck des Einführungskolloquiums im Ev. Dorothee-Sölle-Gemeindehaus<br />
• m. schneider a. hillebrandt architektur,<br />
Köln<br />
• Peter Bastian, Münster<br />
• Tenhündfeld Architekten GmbH,<br />
Ahaus<br />
Die neun folgenden Büros wurden in<br />
der Kategorie »Erfahrenes Büro« zur<br />
Teilnahme am Wettbewerb ausgelost:<br />
• Bez+Kock Architekten Generalplanergesellschaft<br />
mbH, Stuttgart<br />
• Funke + Popal Architekten, Oberhausen<br />
• Selgascano, Madrid<br />
• Architekten Schmidt-Schicketanz<br />
und Partner GmbH, München<br />
• ap plan mory osterwalder vielmo<br />
architekten- und ingenieurges. mbh,<br />
Stuttgart<br />
• Klaus Roth Architekten BDA, Berlin<br />
• Molestina Architekten GmbH, Köln<br />
• office03, waldmann & jungblut gbr,<br />
Köln<br />
• Roswag Architekten - Gesellschaft<br />
von Architekten mbH, Berlin<br />
Die nachfolgend aufgeführten fünf Büros<br />
wurden in der Kategorie »Junge<br />
bzw. Kleine Büroorganisation« ausgelost:<br />
• Holzhausen Zweifel Architekten,<br />
Zürich<br />
• töpfer.beruleit.architekten, Berlin<br />
• B19 Architekten, Weimar<br />
• C1Architekten, Stuttgart<br />
• berger röcker architekten, Stuttgart<br />
Ablauf des Wettbewerbs<br />
Die Teilnehmer erhielten Anfang No-<br />
vember 2011 die Planunterlagen.<br />
Am 14. November 2011 fanden eine<br />
Preisgerichtsvorbesprechung und ein<br />
Einführungskolloquium mit Teilnehmern<br />
und Jurymitgliedern statt, bei denen<br />
intensive Diskussionen der Aufgabenstellung<br />
zwischen Preisgericht und den<br />
teilnehmenden Büros geführt wurden.<br />
Zudem bot dieser Tag die Gelegenheit<br />
zur Besichtigung der Stadthalle mitsamt<br />
ihres Umfelds.<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 13
Die Entwurfsvorschläge mussten bis<br />
zum 2. März 2012 eingereicht werden.<br />
Am 23. April 2012 tagte das unabhän-<br />
gige Preisgericht zur Beurteilung der<br />
Arbeiten.<br />
Anschließend findet ein Verhandlungsverfahren<br />
nach VOF mit den Preisträgern<br />
statt.<br />
Die Jury setzte sich aus den nachfol-<br />
gend genannten Personen zusam-<br />
men.<br />
Besetzung des Preisgerichts<br />
Stimmberechtigte Mitglieder<br />
• Dr. Kristin Ammann-Dejozé, Vorsitzende<br />
des Gestaltungsbeirates der<br />
Stadt Ahaus, Architektin und Stadtplanerin,<br />
Münster<br />
• Felix Büter, Bürgermeister, Stadt<br />
Ahaus<br />
• Heiner Farwick, Architekt und<br />
Stadtplaner, Ahaus (Vorsitz)<br />
• Alfons Gerick, stellv. Ausschussvorsitzender<br />
Schule und Kultur, Stadt<br />
Ahaus<br />
• Franz-Josef Große-Berg, Ausschussvorsitzender<br />
Schule und Kultur,<br />
Stadt Ahaus<br />
• Wolfgang Klein, stellv. Ausschussvorsitzender<br />
Stadtentwicklung, Planen<br />
und Verkehr, Stadt Ahaus<br />
• Reinhard Miermeister, Architekt,<br />
Landeskirchenbaudirektor, Leiter<br />
des Baureferats des Landeskirchenamtes<br />
der Evangelischen Kirche in<br />
Westfalen (beim Preisgericht vertreten<br />
durch<br />
Roland Berner, Architekt, Baureferat<br />
des Landeskirchenamtes der<br />
Evangelischen Kirche in Westfalen)<br />
• Prof. Christa Reicher, Architektin<br />
und Stadtplanerin, Aachen<br />
• Thomas Vortkamp, Ausschussvorsitzender<br />
Stadtentwicklung, Planen<br />
und Verkehr, Stadt Ahaus<br />
• Christine Wolf, Landschaftsarchitektin,<br />
Bochum<br />
14 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />
Stellvertreter<br />
• Hans-Georg Althoff, Erster Beigeordneter,<br />
Stadt Ahaus<br />
• Walter Fleige, Leiter des Fachbereichs<br />
Stadtplanung, Stadt Ahaus<br />
• Reinhard Horst, Mitglied im Ausschuss<br />
Stadtentwicklung, Planen<br />
und Verkehr, Stadt Ahaus<br />
• Prof. Peter Jahnen, Architekt und<br />
Stadtplaner, Aachen<br />
• Hermann Kühlkamp, Verwaltungsvorstand,<br />
Stadt Ahaus<br />
• Hiltrud Lintel, Landschaftsarchitektin,<br />
Düsseldorf<br />
• Helmut Riesenbeck, stellv. Vorsitzender<br />
des Gestaltungsbeirates der<br />
Stadt Ahaus, Architekt und Stadtplaner,<br />
Warendorf<br />
• Josef Schmeing, Architekt, Ahaus<br />
• Renate Schulte, Mitglied im Ausschuss<br />
Schule und Kultur, Stadt<br />
Ahaus<br />
Sachverständige Berater<br />
und Vorprüfer<br />
• Julia Althaus, Dipl.-Ing. Raumplanung,<br />
Stadt Ahaus<br />
• Georg Beckmann, Beigeordneter,<br />
Stadt Ahaus<br />
• Willy Bartkowski, Evangelische<br />
Christus Kirchengemeinde, Ahaus<br />
• Christine Dern, Dipl.-Ing. Architektur,<br />
Büro Post • Welters, Dortmund<br />
• Hermann Lefering, Leiter des Fachbereichs<br />
BIldung, Kultur und Sport,<br />
Stadt Ahaus<br />
• Dr. Margret Karras, stv. Fachbereichsleiterin<br />
Bildung, Kultur, Sport,<br />
Stadt Ahaus<br />
• Maria zu Klampen, Leiterin der<br />
städtischen Bücherei, Stadt Ahaus<br />
• Hermann Kühlkamp, Leiter Vorstandsbereich<br />
III, Stadt Ahaus<br />
• Ellen Wiewelhove, Architektin, Büro<br />
Post • Welters, Dortmund
Eindrücke<br />
der Preisgerichtssitzung<br />
am 23. April 2012<br />
im Ratssaal der Stadt Ahaus<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 15
Übersicht<br />
Wettbewerbsergebnis<br />
Preisträger<br />
1. Preis<br />
16 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />
Architektur: Modell Nr. 1<br />
C1Architekten, Stuttgart<br />
Darius Cwienk<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
g2-Landschaftsarchitekten, Stuttgart<br />
Jan-Frieso Gauder<br />
2. Preis<br />
Architektur: Modell Nr. 2<br />
Halfmann Architekten, Köln<br />
Martin und Ulrike Halfmann<br />
Mitarbeiter: Bettina Brüggemann, Christian Richter,<br />
Yasemin Caglar, Constantin Keßler<br />
Modellbau: Architekturmodelle Thomas Halfmann, Köln<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
arbos Freiraumplanung GmbH & Co.KG, Hamburg<br />
Greis.Köster.Metzger<br />
3. Preis<br />
Architektur: Modell Nr. 3<br />
Bez+Kock Architekten Generalplaner GmbH, Stuttgart<br />
Martin Bez, Thorsten Kock<br />
Mitarbeiter: Tilman Rösch<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Lohrberg Stadtlandschafts Architektur, Stuttgart<br />
Dirk Meiser<br />
Tragwerk:<br />
Weischede, Herrmann + Partner, Stuttgart<br />
Visualisierung:<br />
Renderbar Jörg Röhrich<br />
Anerkennung<br />
Architektur: Modell Nr. 4<br />
Funke + Popal Architekten, Oberhausen<br />
Lena Popal, Werner Funke<br />
Mitarbeiter: Katharina Überschär, Britta Mauritz<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Förder Landschaftsarchitekten, Essen
Anerkennung<br />
Architektur: Modell Nr. 5<br />
B19 ARCHITEKTEN BDA, Weimar<br />
Marc Rößling, Matthias Döhrer<br />
Mitarbeiter: Nadja Unger<br />
Modellbau: Modellwerk, Weimar<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Büro Nordpark, Erfurt<br />
Ansgar Heinze<br />
Haustechnik:<br />
IBP GmbH, Erfurt<br />
F.U. Pöhlmann<br />
Anerkennung<br />
Architektur: Modell Nr. 6<br />
berger röcker architekten (GbR), Stuttgart<br />
Daniel Berger<br />
Mitarbeiter: Tim Gork, Jan Stahl<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Specht Landschaftsarchitektur, Tübingen<br />
Hans Specht<br />
2. Rundgang<br />
Architektur: Modell Nr. 7<br />
Bathe + Reber Architekten, Dortmund<br />
Georg Bathe, Eva Reber<br />
Mitarbeiter: Sebastian Jazwierski<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Club L94 Landschaftsarchitekten GmbH, Köln<br />
Burkhard Wegener<br />
Mitarbeiter: Andrea Junges<br />
Raumakustik:<br />
Peutz Consult GmbH<br />
Dipl.-Phys. Klaus-Hendrik Lorenz-Kierakiewitz<br />
Architektur: Modell Nr. 8<br />
Tenhündfeld Architekten, Ahaus<br />
Christian Tenhündfeld<br />
Mitarbeiter: Caroline Wittenbrink<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Brandenfels, Münster<br />
Gordon Brandenfels<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 17
18 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />
Architektur: Modell Nr. 9<br />
Klaus Roth Architekten, Berlin<br />
Klaus Roth<br />
Mitarbeiter: A. Tazawa, S. Lindell, H. Kummerow, I. Matei<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Landschaftsplaner Büro Henningsen BDLA, Berlin<br />
Hr. Henningsen, Fr. Sabaw<br />
Architektur: Modell Nr. 10<br />
SelgasCano, Madrid<br />
José Selgas Rubio, Lucia Cano Pintos, Martin Hochrein<br />
Mitarbeiter: Laura Culiáñez, Lorena del Rio, Mario Escudero<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Arquitectura Agronomia SLP, Barcelona<br />
Teresa Gali Izard, Jordi Nebot<br />
Architektur: Modell Nr. 11<br />
Peter Bastian Architekten BDA, Münster<br />
Peter Bastian<br />
Mitarbeiter: Lisa Vorderderfler, Marco Münsterteicher, Sven Helms,<br />
Katrin Jüttner, Florian Walter, Sonja Klück<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Wiggenhorn & van den Hövel Landschaftsarchitekten BDLA, Hamburg<br />
Martin van den Hövel, Hubert Wiggenhorn<br />
Mitarbeiter: Hanna Heitkamp<br />
Brandschutz:<br />
Hölscher Branschutz Konzepte<br />
Haustechnik:<br />
Zonzalla Ingenieure<br />
Architektur: Modell Nr. 12<br />
Architekten Schmidt-Schicketanz und Partner GmbH, München<br />
Christoph Nagel-Hirschauer<br />
Mitarbeiter: Miriam Balz, Christian Rogner, Carolin Berger<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Lex Kerfers_Landschaftsarchitekten BDLA, Bockhorn<br />
Rita Lex-Kerfers<br />
Mitarbeiter: Gianluca Dello Buona<br />
Visualisierung:<br />
Rakete GmbH, München
Architektur: Modell Nr. 13<br />
Roswag Architekten – Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin<br />
Eike Roswag<br />
Mitarbeiter: Marine Miroux, Michael Kandel, Ivonn Kramm, Anja Mocker,<br />
Christoph Hager, Alexander Leh- mann, Matthew Crabbe<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
freianlage.de Landschaftsarchitektur, Potsdam<br />
Christof Staiger<br />
Mitarbeiter: Ulrich Grünmüller, Silvia Zimmermann<br />
Brandschutz:<br />
Dipl.-Ing. Architekt Ilko M. Mauruschat, Berlin<br />
Architektur: Modell Nr. 14<br />
Feja + Kemper Architekten, Recklinghausen<br />
Mitarbeiter: Sebastian Allkemper, Tim Siegeler<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Davids, Terfrüchte + Partner, Essen<br />
Peter Davids<br />
Mitarbeiter: Daniel Schürmann<br />
Brandschutz:<br />
BKK, Warendorf<br />
Statik:<br />
Gehlmann + Lammering, Billerbeck<br />
Architektur: Modell Nr. 15<br />
office03, Waldmann + Jungblut GbR, Köln<br />
Dirk Waldmann, Berthold Jungblut<br />
Mitarbeiter: Florian Graus<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
A24 Landschaft, Berlin<br />
Steffan Robel<br />
Mitarbeiter: Shyuenwen Shyu<br />
1. Rundgang<br />
Architektur: Modell Nr. 16<br />
m.schneider a.hillebrandt architekten, Münster<br />
Prof. i.V. Martin Schneider, Prof. Annette Hillebrandt<br />
Mitarbeiter: Dirk Becker<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Breimann & Bruun Garten und Landschaftsarchitekten MAA, Hamburg<br />
Brandschutz: Ing.-Büro Leiermann, Dormagen<br />
Haustechnik und Bauphysik: Pfeil & Koch Ingenieurgesellschaft, Köln<br />
Städtebau: Prof. Joachim Schultz-Granberg, Berlin<br />
Tragwerk: IFS Ber. Ingenieure für Bauwesen<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 19
20 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />
Architektur: Modell Nr. 17<br />
ap plan mory osterwalder vielmo architekten- und ingenieurgesellschaft mbH,<br />
Stuttgart<br />
Julian Vielmo<br />
Mitarbeiter: Michael Glowasz, Sven Schmidtgen, Felipe Espinosa-Caro<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Weidinger Landschaftsarchitekten, Berlin<br />
Jürgen Weidinger<br />
Mitarbeiter: Luca Torini<br />
Technische Gebäudeausrüstung: KE&S GbR, Berlin | Hr. Schimo-Lema<br />
Tragwerk: EHS Stuttgart GmbH, Stuttgart | Hr. Dr. Grunert<br />
Bühnentechnik: Bühnenplanung Kottke GmbH, Bayreuth | Hr. Kottke<br />
Architektur: Modell Nr. 18<br />
Molestina Architekten GmbH, Köln<br />
Prof. Juan Pablo Molestina<br />
Mitarbeiter: Laura Garcia Blanco, Mark Aseltine, Stephan Schorn<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
FSWLA Landschaftsarchitektur, Düsseldorf<br />
Thomas Fenner<br />
Mitarbeiter: Simon Quindel<br />
Haustechnik:<br />
Planungsgemeinschaft Haustechnik, Becker – Huke – Hoffmann, Dormagen<br />
Statik:<br />
IDK Kleinjohann GmbH & Co.KG, Köln<br />
Architektur: Modell Nr. 19<br />
Holzhausen Zweifel Architekten, Zürich<br />
Sebastian Holzhausen, Hannes Zweifeld<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Rosenmayr Landschaftsarchitektur, Zürich<br />
Matthias Rosenmayr<br />
Bauphysik und Akustik:<br />
BAKUS Bauphysik und Akustik GmbH, Zürich<br />
Visualisierung:<br />
Yoshihiro Nagamine Visualisierungen, Zürich
1. Preis (1)<br />
2. Preis (2)<br />
3. Preis (3)<br />
Anerkennung (4)<br />
Anerkennung (5)<br />
Übersicht Modellfotos<br />
Anerkennung (6)<br />
2. Rundgang (7)<br />
2. Rundgang (8)<br />
2. Rundgang (9)<br />
2. Rundgang (10)<br />
2. Rundgang (11)<br />
2. Rundgang (12)<br />
2. Rundgang (13)<br />
2. Rundgang (14)<br />
2. Rundgang (15)<br />
1. Rundgang (16)<br />
1. Rundgang (17)<br />
1. Rundgang (18)<br />
1. Rundgang (19)<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 21
Der 1. Preis<br />
Architektur:<br />
C1Architekten,<br />
Stuttgart<br />
Darius Cwienk<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
g2-Landschaftsarchitekten,<br />
Stuttgart<br />
Jan-Frieso Gauder<br />
Lageplan: Städtebauliche Figur und Freiflächengestaltung<br />
22 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs
Fassadenschnitt und Ansicht<br />
Südansicht von der Wüllener Straße<br />
Auszüge aus dem<br />
Erläuterungstext laut Verfasser<br />
Das städtebauliche Konzept verfolgt<br />
das Ziel, den Gedanken des übergreifenden<br />
Kulturzentrums optimal zu<br />
unterstützen. Im Zusammenspiel mit<br />
den freiräumlichen Elementen soll ein<br />
Ort entstehen, der diese besondere<br />
Nutzung spürbar werden lässt. Das<br />
neue Gebäudeensemble bildet mit<br />
der bestehenden Kirche einen großzügigen,<br />
mulifunktionalen Platz an der<br />
Wüllener Straße, der als Auftakt und<br />
Erschließungselement für das gesamte<br />
Areal dient. Gleichzeitig lenkt der mäanderförmige<br />
Baukörper in die Tiefe<br />
des Geländes, hin zum neu gestalteten<br />
Hof der Musikschule. Dabei entsteht<br />
einen Abfolge öffentlicher Räume von<br />
unterschiedlicher Art und Dichte. Die<br />
Gliederung des Baukörpers orientiert<br />
sich an der Kleinteiligkeit des Umfelds.<br />
Der Vorplatz ist das außenräumliche<br />
Erschließungselement für den Eingang<br />
von Stadthalle und Bibliothek. Er dient<br />
ebenso als Erweiterung des daran<br />
angebundenen Foyers der Stadthalle,<br />
und wird durch das Restaurant mit<br />
Außengastronomie zusätzlich belebt.<br />
Es entstehen vielerlei Sichtbezüge zwischen<br />
Stadthalle, Bibliothek, Kirche,<br />
Plätzen und Straße. Vom Markt in<br />
der Altstadt aus ist der Baukörper der<br />
Stadthalle sichtbar.<br />
Die Kette der Freiräume wird mit einem<br />
einheitlichen Belag verknüpft, der<br />
durch unterschiedliche Inlays strukturiert<br />
wird. Dieser Belag quert die Wül-<br />
lener Straße und bindet so die Besucherströme<br />
vom Kirmesplatz aus an.<br />
Die Inlays beinhalten unterschiedliche<br />
Funktionen.<br />
Die Funktionsbereiche der Bibliothek<br />
und der Stadthalle werden durch ein<br />
eingeschossiges Band verknüpft, bleiben<br />
jedoch für sich ablesbar. Der<br />
gemeinsame Eingangsbereich ist multifunktional<br />
nutzbar und lässt sich sowohl<br />
zur Bibliothek als auch zur Stadthalle<br />
zuschalten. Die Anordnung der<br />
Gastronomie ermöglicht das Catering<br />
von Foyer und Bibliothek und kann ins<br />
Stadthallenfoyer erweitert werden.<br />
Während sich das Foyer der Stadthalle<br />
zum Platz hin orientiert, ist die Bibliothek<br />
im ruhigeren und begrünten<br />
Bereich des Areals angeordnet. Dabei<br />
bestehen gleichwohl klare Sichtbezüge<br />
von und zur Wüllener Straße. Die<br />
Funktionsbereiche der Bibliothek sind<br />
klar strukturiert und dennoch flexibel.<br />
Das Foyer der Stadthalle lässt sich sowohl<br />
zur Halle, als auch zum Platz hin<br />
öffnen und ermöglicht daher Veranstaltungen<br />
im Außenbereich.<br />
Die Fassade des mäanderförmigen<br />
Baukörpers besteht im oberen Bereich<br />
aus einer vorgesetzten Mauerwerksschale<br />
aus Klinker, ein Brückenschlag<br />
zur umgebenden Bebauung. Der untere<br />
Bereich des Baukörpers ist mit<br />
einem Wechsel aus vertikal angeordneten<br />
Verglasungen und Faserzementpaneelen<br />
bekleidet.<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 23
Der 1. Preis<br />
Grundriss Erdgeschoss<br />
Ostansicht<br />
24 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs
Grundriss Obergeschoss<br />
Längsschnitt durch den Saal Querschnitt durch den Saal<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 25
Der 1. Preis<br />
Eingangssituation und Außengastronomie<br />
Blick von der Wüllener Straße<br />
26 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs
Modellfoto<br />
Beurteilungstext der Jury<br />
Die städtebauliche Grundidee, das<br />
Kulturzentrum um einen richtig angeordneten<br />
und proportionierten Platz<br />
als Auftakt anzuordnen, wird positiv<br />
beurteilt. Es wird eine reizvolle Abfolge<br />
von unterschiedlichen Platz- und<br />
Straßenräumen geschaffen. Die bisher<br />
eher »verloren« stehende Kirche<br />
ist gut eingebunden. Die Bibliothek ist<br />
als zweigeschossiger Baukörper als<br />
Gegenüber zum Gemeindehaus angemessen<br />
und nimmt vorhandene Baufluchten<br />
richtig auf. Die Platzgestaltung<br />
mit der geschützten Anordnung<br />
der Außengastronomie wird positiv<br />
beurteilt. Die differenzierte Ausformulierung<br />
der Außenräume erscheint<br />
durchdacht und angemessen. Die Freiflächen<br />
der Kirche sind gut eingebunden.<br />
Das Kulturzentrum ist als Ensemble<br />
gut erkennbar bei gleichzeitiger Ablesbarkeit<br />
der einzelnen Bereiche. Die<br />
Proportionen der Baukörper sind richtig<br />
gewählt und fügen sich in die Umgebung<br />
ein. Die klare, unprätentiöse<br />
Architektursprache überzeugt dabei.<br />
Der Gedanke eines weitgehend gläsernen<br />
Erdgeschosses mit »schwebenden«,<br />
massiven Ziegelfassaden wird<br />
positiv gesehen und schafft eine hohe<br />
Identität des Gebäudes.<br />
Im Inneren sind die Funktionsbereiche<br />
Stadthalle, Bibliothek und Gastronomie<br />
gut um ein verbindendes Foyer<br />
angeordnet, das vielfältige Zuschalt-<br />
barkeiten ermöglicht und die Funktionsabläufe<br />
bei Veranstaltungen gut<br />
überlegt darstellt. Die WC-Anlage der<br />
Stadthalle im Untergeschoss ist denkbar,<br />
die Nebenräume der Bühne sind<br />
direkt dem Bühnenbereich zugeordnet,<br />
liegen allerding ebenfalls vollständig<br />
im Untergeschoss. Das Platzangebot<br />
im Saal ist sowohl bei Reihen- wie<br />
auch bei Bankettmöblierung knapp<br />
aber noch ausreichend; zu kritisieren<br />
ist der zu niedrige Schnürboden bzw.<br />
die dann fehlende Seitenbühne. Die<br />
Bibliothek weist Flächenüberhänge<br />
auf, funktioniert aber mit zwei Ebenen<br />
insgesamt gut. Durch Lufträume und<br />
zwei offene Treppen sind die Ebenen<br />
attraktiv miteinander verbunden, wenn<br />
auch hierdurch ein etwas höherer Erschließungsaufwand<br />
erforderlich ist.<br />
Die fehlende direkte Anbindung der<br />
Bibliothek an die Gastronomie wird<br />
für akzeptabel gehalten.<br />
Die Arbeit stellt insbesondere wegen<br />
ihrer hohen städtebaulichen und<br />
funktionalen Qualitäten einen guten<br />
Beitrag zur Lösung der Aufgabenstellung<br />
dar. Der Entwurf liegt hinsichtlich<br />
Kubatur- und Flächenkennwerten im<br />
durchschnittlichen bis unteren Bereich.<br />
Zusammen mit der klaren Baukörperstruktur<br />
und Fassadengestaltung lässt<br />
dies trotz eines hohen A/V-Verhältnisses<br />
eine wirtschaftliche Realisierung<br />
erwarten.<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 27
Der 2. Preis<br />
Architektur:<br />
Halfmann Architekten, Köln<br />
Martin und Ulrike Halfmann<br />
Mitarbeiter: Bettina Brüggemann,<br />
Christian Richter, Yasemin Caglar,<br />
Constantin Keßler<br />
Modellbau: Architekturmodelle<br />
Thomas Halfmann, Köln<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
arbos Freiraumplanung<br />
GmbH & Co.KG, Hamburg<br />
Greis.Köster.Metzger<br />
Lageplan: Städtebauliche Figur und Freiflächengestaltung<br />
28 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs
Fassadenschnitt und Ansicht<br />
Südansicht von der Wüllener Straße<br />
Auszüge aus dem<br />
Erläuterungstext laut Verfasser<br />
Fünf Jahrzehnte lang hat der Backsteinbau<br />
aus den fünfziger Jahren den<br />
Ort geprägt. Es liegt nahe, den Altbau<br />
als identitätsstiftendes Volumen zu bewahren,<br />
von allem Ballast und Zierrat<br />
der letzten Jahrzehnte zu entkleiden<br />
und als Mitte des Kulturzentrums neu<br />
zu definieren. Der Körper der Halle<br />
wird freigestellt, gerahmt und neu inszeniert.<br />
Drei Elemente bilden das Ensemble:<br />
Die metallverkleidete Halle wird zum<br />
Nukleus der Anlage, die Ziegelklammer<br />
reagiert auf die städtebauliche<br />
Situation und definiert neue Raumkanten,<br />
der transparente Zwischenraum<br />
bildet einen gedeckten Stadtplatz als<br />
Zentrum für die Bürger. Diesem Gedanken<br />
folgend werden Saal und Bühnenturm<br />
erhalten, modernisiert und<br />
mit einem neuen Blechmantel umhüllt.<br />
Diese golden schimmernde Skulptur<br />
wird von einem zweigeschossigen Ziegelbau<br />
umgriffen. Der Zwischenraum<br />
wird zum Foyer des Gebäudes, das<br />
sich als Teil der Platzfläche neu ausrichtet<br />
und mit den umgebenden Kulturbauten<br />
kommuniziert.<br />
So wird das Kulturzentrum Teil eines<br />
neuen urbanen Freiraums, der Musikschule,<br />
Gemeindezentrum und Kirche<br />
verknüpft. Er teilt sich in eine grüne<br />
Mitte mit einem baumüberstandenen<br />
Plätzchen und einen neuen Stadtplatz,<br />
über den das Gebäude von allen Seiten<br />
erschlossen wird. Zwischen Ziegelrahmen<br />
und Stadthalle öffnet sich das<br />
Foyer transparent und hell zur Stadt,<br />
wird mit durchlaufender Pflasterung<br />
Teil des Freiraums und mit Glasstreifen<br />
von oben belichtet.<br />
Im Süden setzt das Bibliotheksgebäude<br />
den Straßenraum der Wüllener Straße<br />
fort und leitet auf den Platz. Die Südostecke<br />
ist unterschnitten und bietet neben<br />
dem Haupteingang von Bibliothek<br />
und Halle Platz für eine großzügige<br />
Bar und das Restaurant. Die dienende<br />
Spange im Norden schirmt den Saal<br />
vom Bernsmannskamp ab.<br />
Die zweigeschossige Bibliothek ist um<br />
ein Zentrum angeordnet, das als Teil<br />
des Foyers Ein- und Ausblicke zulässt.<br />
Die obere Ebene wird über eine Freitreppe<br />
erschlossen und öffnet sich mit<br />
einer Galerie zur Mitte. Die Geometrie<br />
des Baukörpers ermöglicht nahezu<br />
selbstverständlich eigenständige Teilbereiche<br />
und Leselounges.<br />
Im Schwerpunkt des Foyers verknüpfen<br />
Restaurant und Bar Innenbereich<br />
und Außenbereich. Beide werden<br />
über einen zentralen Küchenblock im<br />
Norden versorgt, der direkt beliefert<br />
werden kann. Eine Außengastronomie<br />
ist auf dem Platz ebenso möglich wie<br />
auf der Besucherterrasse.<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 29
Der 2. Preis<br />
Grundriss Erdgeschoss<br />
Eingangssituation von der Wüllener Straße<br />
Blick entlang der Wüllener Straße<br />
30 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs
Modellfoto<br />
Beurteilungstext der Jury<br />
Die städtebauliche Einordnung der<br />
Gesamtkomposition aus Bestandsgebäude<br />
mit umschließender neuer zweigeschossiger<br />
Gebäudespange wird<br />
aufgrund seiner neuen städtebaulichen<br />
Raumbildung – Platz vor der Kirche,<br />
Baumhain mit Skulptur und Freifläche<br />
vor der Bernsmannskampschule – positiv<br />
bewertet. Der Baumhain funktioniert<br />
als Schutz und Quartiersplatz mit<br />
hoher Aufenthaltsqualität. Die Zuordnung<br />
der Stellplatzanlagen im Westen<br />
und Norden angrenzend erscheint<br />
richtig, die Stellplatzanzahl ist allerdings<br />
zu gering. Die allseitige Erschließung<br />
des Kulturzentrums ist überzeugend.<br />
Der Zugang zur Bibliothek im<br />
Süden erscheint etwas zu klein.<br />
Die Erschließung ist gleichzeitig eine<br />
Bestätigung der richtigen Lage der<br />
Einzelbereiche im Gesamtkomplex,<br />
d.h. die Lage der Bibliothek und des<br />
Foyers zur Wüllener Straße und die<br />
Lage der Nebenräume zur Nordsei-<br />
te. Die grundrissliche Gestaltung der<br />
Bibliothek auf zwei Ebenen wird positiv<br />
bewertet; die natürliche Belichtung<br />
erscheint stellenweise zu gering. Die<br />
Gastronomie ist im Erdgeschoss ebenfalls<br />
funktional organisiert; allerdings<br />
wird die Lage der Außengastronomie/<br />
Besucherterrasse im 1. Obergeschoss<br />
an der Nordseite kritisiert. Der Erhalt<br />
der Stadthalle ist insgesamt und im Besonderen<br />
im Zusammenhang mit dem<br />
angrenzenden Foyer sehr zu würdigen.<br />
Es ist dem Entwurf nicht anzulasten,<br />
dass die Raumbegrenzungen die<br />
Nutzungsmöglichkeiten einschränken;<br />
eine Verlängerung in das Foyer hinein<br />
wäre zwar möglich, aber weder funktional<br />
noch von der Raumqualität wünschenswert.<br />
Es ist daher zu fragen,<br />
ob es richtig ist, diesen bestehenden<br />
Raum für größere Besucherzahlen zu<br />
ertüchtigen. Aufgrund der Größe der<br />
Spangenumbauung vor allem bezüglich<br />
der Kubatur liegt der Entwurf wirtschaftlich<br />
eher im oberen Bereich.<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 31
Der 3. Preis<br />
Architektur:<br />
Bez+Kock Architekten<br />
Generalplaner GmbH, Stuttgart<br />
Martin Bez, Thorsten Kock<br />
Mitarbeiter: Tilman Rösch<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Lohrberg Stadtlandschafts<br />
Architektur, Stuttgart<br />
Dirk Meiser<br />
Tragwerk:<br />
Weischede, Herrmann + Partner,<br />
Stuttgart<br />
Visualisierung:<br />
Renderbar Jörg Röhrich<br />
Lageplan: Städtebauliche Figur und Freiflächengestaltung<br />
32 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs
Fassadenschnitt und Ansicht<br />
Südansicht von der Wüllener Straße<br />
Auszüge aus dem<br />
Erläuterungstext laut Verfasser<br />
Die neue Stadthalle mit Bibliothek und<br />
Restaurant steht als präzise geformtes<br />
solitäres Objekt im städtischen Raum<br />
des Kulturzentrums und wird so als<br />
wesentlicher, konstituierter Bestandteil<br />
des Areals wahrgenommen. Der sorgsame,<br />
gleichsam maßgeschneiderte<br />
Zuschnitt des polygonalen Baukörpers<br />
integriert und positioniert dieses<br />
Gebäude sehr genau im stadträumlichen<br />
Kontext und spannt zusammen<br />
mit der evangelischen Kirche einen<br />
neuen Platz auf, der eindeutig als Mitte<br />
des Kulturforums wahrgenommen<br />
wird. Dieser Platz ist an der Wüllener<br />
Straße gelegen und bezieht durch die<br />
versetzte Gegenüberstellung von Gebäuden<br />
und Baumpaketen das sich<br />
nach Norden erweiternde Kulturforum<br />
bis hin zur Musikschule mit ein. Die<br />
Stadthalle gibt dem Kulturplatz insbesondere<br />
von der Stadtmitte kommend<br />
eine eindeutige Fassung. Aus dieser<br />
Richtung hat der Besucher direkt die<br />
Haupteingangsseite im Blick. Die hinter<br />
die Kante des plastisch ausformulierten<br />
Daches eindrehende Leitwand<br />
schafft einen überdachten Vorbereich<br />
und markiert so den Haupteingang<br />
zum Foyer. Die südliche Gebäudefront<br />
vermittelt durch ihre Außerwinkligkeit<br />
zwischen den Richtungen der Kirche<br />
und der Straßenrandbebauung der<br />
Wüllener Straße.<br />
Vom Foyer aus, das direkt vom Kulturforum<br />
betreten wird, sind alle öffentlichen<br />
Nutzungsbereiche des Gebäudes<br />
erschlossen. Direkt vor dem Besucher<br />
befindet sich der Zugang zum Saal.<br />
Im Foyer zur Linken befinden sich der<br />
Eingang zum Restaurant sowie die<br />
Schanktheke im Foyerraum selbst.<br />
Ebenfalls zur Linken führt eine großzügige<br />
Treppe auf die Galerieebene<br />
des Foyers. Nach rechts vom Haupteingang<br />
aus gesehen befindet sich der<br />
Zugang zur Bibliothek, die sich über<br />
zwei Geschosse entwickelt und über<br />
zwei Lufträume zu einer räumlichen<br />
Einheit verwoben ist. Das Restaurant<br />
kommt an der Süd-West-Ecke des Gebäudes<br />
zu liegen und befindet sich dadurch<br />
an der Schnittstelle von Außenraum,<br />
Foyer und Saal.<br />
In seiner Außenwirkung wird das Gebäude<br />
bestimmt vom Dreiklang der<br />
Materialien Backstein, Weißbeton<br />
und Glas. Während der Backstein an<br />
die lokale Bautradition anknüpft und<br />
einen sehr deutlichen Bezug zum Ort<br />
herstellt, verleiht das plastisch geformte<br />
Weißbetondach dem Gebäude einen<br />
zeitgemäß skulpturalen Ausdruck<br />
und macht es so eindeutig zum Kulturbau.<br />
Die Rhythmisierung der Fassade<br />
entsteht aus den jeweiligen Notwendigkeiten<br />
des Innenraums angepassten<br />
vertikalen Öffnungen, die jeweils<br />
vom Boden bis zum Dach reichen.<br />
Eine zentrale langgestreckte Freiraumachse<br />
bindet die einzelnen Bereiche<br />
des neuen Kulturzentrums zusammen.<br />
Sie fungiert als Rückgrat für das neue<br />
Kulturzentrum und wird als attraktive<br />
Promenade angelegt, die von der<br />
Musikschule im Norden bis zur neuen<br />
Stadthalle an der Wüllener Straße<br />
reicht. Das Promenadenband endet<br />
auf dem neuen Stadtplatz, der den<br />
Schwerpunkt der städtebaulichen<br />
Neuordnung bildet.<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 33
Der 3. Preis<br />
Grundriss Erdgeschoss<br />
Eingangssituation von der Wüllener Straße<br />
34 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />
Blick von der Galerie ins Foyer
Modellfoto<br />
Beurteilungstext der Jury<br />
Das städtebauliche Konzept basiert<br />
auf der Grundidee, über ein streng<br />
gegliedertes Promenadenband die unterschiedlichen<br />
Stadträume in Nord-<br />
Süd-Richtung mit den angrenzenden<br />
Bausteinen des Kulturzentrums in Beziehung<br />
zu setzen. Der neue Stadtplatz<br />
schafft einen überzeugenden<br />
räumlichen Dialog zwischen Kirche<br />
und Kulturzentrum. Ein winkelförmiger<br />
Solitärbaukörper definiert deutliche<br />
Grenzen zwischen dem rückwärtigen<br />
Bereich und einer repräsentativen öffentlichen<br />
Eingangsseite. Im Westen<br />
sind unter einem Baumdach die Stellplätze<br />
und Fahrräder sinnvoll untergebracht<br />
sowie die notwendigen Flächen<br />
für die Anlieferung.<br />
Die Anordnung der Nutzungsbereiche<br />
– Bibliothek, Stadthalle und Gastronomie<br />
– ist folgerichtig aus dem Kontext<br />
entwickelt. Das zentrale Foyer fungiert<br />
als Bindeglied zwischen den Nutzungen,<br />
geht jedoch einher mit funktionalen<br />
Schwächen. Es kann den zentralen<br />
Nutzungsbereichen nicht direkt zugeordnet<br />
werden. Die unterschiedlichen<br />
Nutzungsansprüche können zu Konflikten<br />
führen. Der Veranstaltungssaal<br />
funktioniert mit Einschränkungen. Bei<br />
einer Bankettbestuhlung stellen sich<br />
Platzprobleme dar. Der Bühnenturm<br />
verfügt nicht über die notwendige<br />
Höhe. In der Bibliothek ist der Backoffice-Bereich<br />
nicht klar der Theke im<br />
Eingangsbereich zugeordnet und führt<br />
zu Einschränkungen in der Funktionalität.<br />
Die Gastronomie ist nach Süden<br />
orientiert, ohne den Stadtplatz hinreichend<br />
zu nutzen. Mit der architektonischen<br />
Gestaltung wird ein Dreiklang<br />
aus Backstein, Weißbeton und Glas<br />
verfolgt, der an die lokale Bautradition<br />
anknüpft. Der zweigeschossige<br />
Baukörper mit einer Überhöhung im<br />
Bereich des Saals erhält mit der umlaufenden<br />
Attika einen überzeugenden<br />
Abschluss. Die innere Raumfügung<br />
mit Erschließungstreppen und Blickbeziehungen<br />
gewährleistet interessante<br />
Raumerlebnisse.<br />
Der kompakte Baukörper erscheint<br />
wirtschaftlich realisierbar, dabei stellen<br />
die zweigeschossige Halle und die<br />
große Glasfläche im Eingangsbereich<br />
eine Einschränkung der Wirtschaftlichkeit<br />
dar.<br />
Insgesamt stellt der Entwurf einen<br />
überzeugenden Beitrag zur Aufgabenstellung<br />
dar, dessen Qualität vor allem<br />
in der klaren Haltung zum Stadtraum<br />
und in der architektonischen Sprache<br />
besteht.<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 35
Anerkennung<br />
Architektur:<br />
Funke + Popal Architekten,<br />
Oberhausen<br />
Lena Popal, Werner Funke<br />
Mitarbeiter: Katharina Überschär,<br />
Britta Mauritz<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Förder Landschaftsarchitekten,<br />
Essen<br />
Lageplan: Städtebauliche Figur und Freiflächengestaltung<br />
36 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs
Fassadenansicht<br />
Südansicht von der Wüllener Straße<br />
Auszüge aus dem<br />
Erläuterungstext laut Verfasser<br />
Der Neubau entwickelt sich auf polygonalem<br />
Grundriss im westlichen Bereich<br />
des Plangebietes. Er belässt einen<br />
großen, lang gestreckten, zusammenhängenden<br />
Freiraum in der Mitte des<br />
Plangebietes, der alle am »Anger«<br />
liegenden Nutzungen zusammenfasst:<br />
VHS, Musikschule, evangelische Kirche<br />
mit Gemeindehaus und das Kulturzentrum<br />
mit Stadthalle, Bücherei und<br />
Gastronomie. Von der Musikschule<br />
im Norden über die Wüllener Straße<br />
hinweg bis zum Kirmesplatz im Süden<br />
bildet dieser Freiraum eine neue »Kulturachse«.<br />
Lage und Form des Baukörpers<br />
werden bestimmt durch den<br />
Verlauf der umliegenden Verkehrsstraßen.<br />
Das Obergeschoss des Baukörpers<br />
schwenkt leicht nach Osten aus und<br />
nimmt so eine Beziehung auf zu den<br />
nördlich liegenden Nutzungen der VHS<br />
und der Musikschule. Mit unterschiedlichen<br />
Eingangssituationen öffnet sich<br />
der Baukörper. Auf der Südseite liegt<br />
der Haupteingang zur Stadthalle. Ein<br />
weiterer Zugang befindet sich auf der<br />
Ostseite am Anger. Auf der Südwestseite<br />
öffnet sich der Saal über eine<br />
große Fensterfläche zum dort gelegenen<br />
Freiraum, der sowohl Aufenthaltsqualität<br />
bei Veranstaltungspausen,<br />
wie auch mit seinen Sitzstufen Raum<br />
für kleine Veranstaltungen im Freien<br />
bietet. Die geforderte Vernetzung wie<br />
auch die erwartete Zirkulation zwischen<br />
den Nutzungselementen führen<br />
zu einem großen Foyer, welches sich<br />
als verbindendes Element an die unterschiedlichen<br />
Funktionsbereiche legt. Es<br />
entsteht ein Baukörper, der sich in der<br />
Form einer Spirale um den zentralen<br />
Innenhof aufwärts schraubt. Auf diese<br />
Art und Weise werden Stadthalle,<br />
Bücherei und Gastronomie miteinander<br />
verknüpft und können in vielfältiger<br />
Weise zusammengeschaltet werden.<br />
Alle Funktionen liegen auf einer<br />
Ebene – Stadthalle und Gastronomie<br />
vollständig, die publikumsintensiven<br />
Teilbereiche der Bücherei ebenfalls,<br />
Hauptflächen der Bücherei dagegen<br />
bieten im Obergeschoss Rückzug und<br />
Ruhe. Stadthallenfoyer, Gastronomie<br />
und Lesecafé öffnen sich zum zentral<br />
gelegenen Innenhof.<br />
In freier Faltung legt sich das Dach<br />
über spiralförmig anwachsende Höhen<br />
von Erd- und Obergeschoss. Fenstersequenzen<br />
folgen dem Verlauf des<br />
Daches. Sie bilden die Anforderung<br />
der jeweiligen Nutzung an die Belichtung<br />
ab, bieten aber darüber hinaus<br />
Aus- und Einblicke dort, wo das<br />
Gebäude Beziehungen aufnimmt zur<br />
Nachbarschaft.<br />
Der Blick auf die Fassade des Erdgeschosses<br />
bzw. dem »Gebäudesockel«<br />
trifft auf den vertrauten, bodenständigen<br />
Klinkerstein, darüber löst sich<br />
das ansteigende Volumen von diesem<br />
Sockel ab und präsentiert sich in freier<br />
Form mit homogener Struktur aus<br />
strahlend hellem Putz.<br />
Belagsbänder aus großformatigen<br />
Platten leiten und lenken den Besucher<br />
von der Fußgängerzone zu dem neuen<br />
Ensemble. Eine großzügige Platzfläche<br />
erstreckt sich von der Volkshochschule<br />
und Musikschule über die<br />
Straße hinweg: der Anger.<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 37
Anerkennung<br />
Grundriss Erdgeschoss<br />
Eingangssituation von der Wüllener Straße<br />
Blick entlang der Kulturachse Richtung Wüllener Straße<br />
38 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs
Modellfoto<br />
Beurteilungstext der Jury<br />
Die Vernetzung der einzelnen Kultureinrichtungen<br />
erfolgt über eine zentrale<br />
Grünachse, deren Gestaltung jedoch<br />
eher beliebig erscheint. Der Neubau<br />
reagiert nur bedingt auf diese Achse:<br />
Der Haupteingang ist zur Wüllener<br />
Straße orientiert, die Theater-Terrasse<br />
befindet sich gar auf der der Achse<br />
abgewandten Seite. Die Einfügung<br />
der gewählten Gebäudegroßform erscheint<br />
städtebaulich unbefriedigend.<br />
Das nordöstliche Ausschwenken des<br />
Obergeschosses in Richtung VHS und<br />
Musikschule wird gewürdigt.<br />
Die Funktionalität der einzelnen Nutzungsbereiche<br />
ist gegeben, allerdings<br />
wirkt die innere Zuordnung wenig<br />
überzeugend. Negativ erscheint die<br />
stark flächenbeanspruchende Grundform,<br />
insbesondere das Atrium wird<br />
kritisch gesehen. Die geschlossenen<br />
Außenwandflächen im Garderobenbereich<br />
schotten das Entree zur Kirche<br />
hin ab und wirken wenig einladend.<br />
Die Wirtschaftlichtkeit des Entwurfs<br />
wird – auch unter Berücksichtigung<br />
der WDVS-Fassade gewürdigt, allerdings<br />
entspricht die Ausbildung der<br />
Fassaden nicht der gewünschten Bedeutung<br />
eines Kulturzentrums.<br />
Insgesamt stellt der Entwurf vor allem<br />
aus funktionaler Sicht der verschiedenen<br />
Funktionsbereiche einen guten<br />
Beitrag zur Lösung der Aufgabenstellung<br />
dar.<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 39
Anerkennung<br />
Architektur:<br />
B19 ARCHITEKTEN BDA, Weimar<br />
Marc Rößling, Matthias Döhrer<br />
Mitarbeiter: Nadja Unger<br />
Modellbau: Modellwerk, Weimar<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Büro Nordpark, Erfurt<br />
Ansgar Heinze<br />
Haustechnik:<br />
IBP GmbH, Erfurt F.U. Pöhlmann<br />
Lageplan: Städtebauliche Figur und Freiflächengestaltung<br />
40 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs
Fassadenschnitt und Ansicht<br />
Südansicht von der Wüllener Straße<br />
Auszüge aus dem<br />
Erläuterungstext laut Verfasser<br />
Um den Neubau der Stadthalle gestaltet<br />
sich der Außenraum als offener,<br />
weiter Freiraum, die angrenzenden<br />
Gebäude einschließend. Der Stadtraum<br />
wird als solcher wahrnehmbar<br />
und bezieht sich auf die Stadthalle,<br />
den Platz und das Kirchenareal. Die<br />
Räume des Kulturzentrums und der<br />
Freiraum korrespondieren miteinander<br />
und gehen ineinander über. Städtebaulich<br />
wird die vorhandene Stadtstruktur<br />
aufgenommen und fortgeschrieben.<br />
Der Platz vor der Stadthalle markiert<br />
den Schwerpunkt. Die funktionelle<br />
Struktur wird neu organisiert, so wird<br />
die Verbindung zum Festplatz klar gestärkt<br />
und der Bezug zum Stadtkern<br />
definiert. Das neue Kulturzentrum ist<br />
ein moderner, zeitgenössischer Baukörper,<br />
der sich in seiner Größe und<br />
Formgebung auf das bestehende Ensemble<br />
bezieht.<br />
Die Grundrisse von Gebäude und Außenanlagen<br />
beziehen sich direkt auf<br />
die Außenraumelemente und werden<br />
in das bestehende System eingegliedert.<br />
Prägendes Element ist der großzügige<br />
Vorplatz am Haupteingang<br />
des Kulturzentrums. Der Platz bietet<br />
eine weithin sichtbare Akzentuierung<br />
des Neubaus, sodass vom Festplatz<br />
und aus der Stadt kommend eine direkte<br />
Sicht- und Funktionsverbindung<br />
entsteht. Die Kulturmeile ist die zen-<br />
trale Wegeachse des Kulturquartiers.<br />
Mit seiner Funktionsschicht führt die<br />
Kulturmeile die Besucher in das Areal<br />
ein und lädt mit seinen Begrünungen<br />
und Laubbäumen zum Verweilen und<br />
Genießen ein.<br />
In der schlichten formalen Sprache<br />
der Baukörper wird eine klare, zeitgemäße<br />
Interpretation der Kubatur des<br />
Kulturzentrums geschaffen. Es wird ein<br />
eigenständiger Baustein hinzugefügt,<br />
der sich durch die Aufnahme wichtiger<br />
Bezüge in das historische Ensemble<br />
einfügt. Das Sockelgeschoss mit seiner<br />
strukturierten Klinkerfassade fasst die<br />
verschiedenen hohen Baukörper lesbar<br />
als ein Gebäude zusammen und<br />
vermittelt zu der Kleinteiligkeit der Umgebungsbebauung.<br />
Die glatten Kuben<br />
der Obergeschosse aus weißem Klinker<br />
sind die Fortsetzung und zugleich<br />
der Kontrast zu dem ornamentalen Sockelgeschoss.<br />
Das eingeschossige Foyer ist mit seiner<br />
großzügigen Öffnung klar vom Stadtplatz<br />
aus als Haupteingang erkennbar<br />
und dient als repräsentativer Empfang<br />
und Verteiler der Besucherströme. Der<br />
offen gestaltete Vorplatz bietet mit<br />
dem Restaurant nicht nur einen Platz<br />
zum Verweilen, sondern zieht sich wie<br />
ein städtischer Teppich in die Kulturmeile<br />
hinein. Die Bibliothek orientiert<br />
sich im nördlichen Gebäudeteil mit<br />
dem Bezug zur VHS und der Außenraumverknüpfung<br />
zur Kulturmeile.<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 41
Anerkennung<br />
Grundriss Erdgeschoss<br />
Eingangssituation von der Wüllener Straße<br />
Blick von der Norden entlang der Kulturachse<br />
42 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs
Modellfoto<br />
Beurteilungstext der Jury<br />
Der zweifach gewinkelte Kubus bildet<br />
im Bereich der Wüllener Straße einen<br />
Platzraum in angemessener Größe mit<br />
einer positiven Einbindung der Kirche.<br />
Gleichzeitig führt er die vorhandenen<br />
Baustrukturen am Bernsmannskamp<br />
folgerichtig fort. Es ergibt sich durch<br />
die Baustruktur eine Nord-Süd-Wegeverbindung<br />
innerhalb des Kulturzentrums<br />
bis hin zum Kirmesplatz. Die<br />
vorgeschlagene Lage und Höhe der<br />
Baukörper von Stadthalle und Bibliothek<br />
sowie dem Restaurant direkt am<br />
Platz erscheinen angemessen. Der eingeschossige<br />
Zwischenbaukörper bildet<br />
den Hauptzugang zur Stadthalle,<br />
nutzt aber die Chance der Nord-Süd-<br />
Durchlässigkeit leider nicht. Bibliothek<br />
und Gastronomie werden jeweils über<br />
die Nord-Süd-Verbindung erschlossen.<br />
Die Nutzungsverteilung ist nachvollziehbar<br />
und positiv zu bewerten. Die<br />
entstehenden Stadträume sind richtig<br />
gesetzt, der Stadthallen-Kubus wirkt<br />
angemessen prägnant. Das Zusammenwirken<br />
von Gebäude und Freiraum<br />
erscheint gut gelöst. Die differenzierte<br />
Ausbildung eines grünbetonten<br />
Bandes einerseits und eines steinernen<br />
Erschließungsbandes andererseits<br />
wird den unterschiedlichen Nutzungsansprüchen<br />
gerecht.<br />
Das Gesamtgebäude wie auch die<br />
jeweiligen Funktionsbereiche sind gut<br />
organisiert, allerdings existieren deutliche<br />
Mängel: Die Bankettbestuhlung<br />
erscheint unfunktional hinsichtlich der<br />
Anzahl der Stühle. Der Bühnenbereich<br />
ist aufgrund des fehlenden Schnürbodens<br />
und der fehlenden Seitenbühne<br />
in seiner Grundrissgestaltung wenig<br />
funktional.<br />
Die architektonische Gestaltung wirkt<br />
karg, die überlangen geschlossenen<br />
Flächen überzeugen nicht. Trotz zusätzlicher,<br />
nicht geforderter Flächen<br />
im Innenraum erscheint eine durchschnittlich<br />
wirtschaftliche Realisierung<br />
möglich.<br />
Insgesamt wird vor allem der städtebauliche<br />
Ansatz des Entwurfs vom<br />
Preisgericht gewürdigt.<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 43
Anerkennung<br />
Architektur:<br />
berger röcker architekten (GbR),<br />
Stuttgart<br />
Daniel Berger<br />
Mitarbeiter: Tim Gork, Jan Stahl<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Specht Landschaftsarchitektur,<br />
Tübingen<br />
Hans Specht<br />
Lageplan: Städtebauliche Figur und Freiflächengestaltung<br />
44 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs
Fassadenschnitt und Ansicht<br />
Südansicht von der Wüllener Straße<br />
Auszüge aus dem<br />
Erläuterungstext laut Verfasser<br />
Die drei geforderten Einrichtungen<br />
werden in einem Baukörper zum neuen<br />
Kulturzentrum vereint. Lage und<br />
Dimension des Neubaus orientieren<br />
sich grob am Bestand der alten Stadthalle.<br />
Über annähernd quadratischer<br />
Grundfläche erheben sich (von Süden<br />
nach Norden) die Bereiche Stadtbücherei,<br />
Stadthalle und Gastronomie.<br />
Die öffentliche Erschließung erfolgt<br />
von Osten über den neuen Platz. Dieser<br />
verläuft in Verlängerung der von<br />
Norden ankommenden Vagedesstrasse<br />
und geht nach Osten hin in einen<br />
öffentlichen Grünzug über. Die Anlieferzonen<br />
befinden sich, dem Publikum<br />
abgewandt auf der Nord- und<br />
Westseite.<br />
Über einer ringsum verglasten Erdgeschosszone<br />
erhebt sich ein an allen vier<br />
Ecken überhöhter massiver Baukör-<br />
per, der die inneren Funktionen nach<br />
außen wiederspiegelt. So werden der<br />
Bühnenturm mit angrenzenden Umkleiden<br />
und Lagerräumen, der Gastraum<br />
und die Bücherei mit ihren zwei Hochpunkten<br />
nach außen hin sichtbar. Die<br />
Höhenstaffelung entspricht auch der<br />
inneren Hierarchie. Durch diese wenigen<br />
Deformationen erhält der Baukörper<br />
eine klare und kraftvolle Erscheinung.<br />
Gleichzeitig fügt sich dieser in<br />
Bezug auf Materialität und Körnung<br />
harmonisch in den Bestand ein. Die<br />
strenge Kubatur wird zudem durch<br />
seine Geschlossenheit und homogene<br />
Materialität unterstrichen.<br />
Die einfache Formensprache und reduzierte<br />
Materialität verleihen dem<br />
Gebäude eine angemessen stilvolle<br />
und klassische Eleganz. Der erdige<br />
Klinker harmoniert mit dem umgebenden<br />
Grün und vermittelt am Übergang<br />
zur Stadt.<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 45
Anerkennung<br />
Grundriss Erdgeschoss<br />
Eingangssituation von der Wüllener Straße<br />
Blick von Norden Richtung Wüllener Straße<br />
46 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs
Modellfoto<br />
Beurteilungstext der Jury<br />
Mit seiner eindeutigen Haltung, der<br />
Komposition einer großvolumigen<br />
Ziegelskulptur auf gläsernem Sockelgeschoss<br />
erzeugt der Entwurf eine<br />
große Signifikanz. Die quadratische<br />
Grundrissfigur des Gesamtbaukörpers<br />
liegt parallel zur Straße Bernsmannskamp<br />
und nimmt mit seiner nordöstlichen<br />
Ecke die Bauflucht der westlichen<br />
Randbebauung der Vagedesstraße<br />
auf. Als Solitär gelingt durch diese<br />
Setzung eine eindeutige Zonierung<br />
und Raumbildung im städtebaulichen<br />
Sinne. Die dargestellte Höhenstaffelung<br />
des Gebaüdes reagiert angemessen<br />
auf die angrenzende Bebauung,<br />
lediglich der durch den Schnürboden<br />
des Bühnenhauses bedingte hohe Gebäudeteil<br />
wirkt zu den angrenzenden<br />
Stadträumen hin unmaßstäblich hoch<br />
und beeinträchtigt die Belichtung der<br />
angrenzenden Wohnbebauung. Die<br />
dargestellte Außenraumgestaltung<br />
lässt eine Fortsetzung der körperhaft<br />
reduzierten Ziegelarchitektur erkennen,<br />
ohne jedoch die geforderten<br />
städtebaulichen Zusammenhänge und<br />
Übergänge nachzuweisen.<br />
Durch die Setzung der skulpturalen<br />
Form entstehen insbesondere für<br />
die Funktionsbereiche der Bibliothek<br />
Mängel wie separat zu erschließende<br />
Obergeschosse, die nach Ansicht des<br />
Preisgerichtes ohne grundsätzliche Änderung<br />
des Entwurfs nicht heilbar sind.<br />
Unverständlich bleibt, dass trotz Neuplanung<br />
die geforderte Funktionalität<br />
und Größe des Saalraumes insbesondere<br />
bei einer Bankettbestuhlung nicht<br />
gegeben erscheint. Die Systematik der<br />
Belichtung folgt im Erdgeschoss dem<br />
Bild eines gläsernen Sockels, in den<br />
Obergeschossen dem eines schwebenden<br />
Monoliths. Hierdurch bedingt müssen<br />
Belichtungsanlagen in den Obergeschossen<br />
optisch in den Hintergrund<br />
treten. Das Preisgericht bezweifelt im<br />
Sinne einer Gebrauchsfähigkeit die<br />
Funktionalität der vorgeschlagenen<br />
Fensteranlagen hinter einer perforierten<br />
Ziegelfassade.<br />
Im Hinblick auf die geforderte Wirtschaftlichkeit<br />
bestehen Zweifel bezüglich<br />
der Nachhaltigkeit (Dauerhaftigkeit)<br />
von Dach- und Attikaflächen aus<br />
bewitterten Ziegeln. Eine wirtschaftliche<br />
Erstellung des Gebäudekomplexes<br />
erscheint nur bedingt möglich.<br />
Insgesamt wird die Haltung des Entwurfs<br />
gewürdigt, Schwächen in Funktionalität<br />
und Nachhaltigkeit lassen<br />
eine Weiterverfolgung des Konzeptes<br />
jedoch fraglich erscheinen.<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 47
2. Rundgang<br />
Architektur:<br />
Bathe + Reber Architekten,<br />
Dortmund<br />
Georg Bathe, Eva Reber<br />
Mitarbeiter: Sebastian Jazwierski<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Club L94 Landschaftsarchitekten<br />
GmbH, Köln<br />
Burkhard Wegener<br />
Mitarbeiter: Andrea Junges<br />
Raumakustik:<br />
Peutz Consult GmbH - Dipl.-Phys.<br />
Klaus-Hendrik Lorenz-Kierakiewitz<br />
Lageplan: Städtebauliche Figur und Freiflächengestaltung<br />
48 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />
Blick in Richtung Hautpeingang<br />
Modellfoto
Blick in Richtung Hautpeingang<br />
Modellfoto<br />
Lageplan: Städtebauliche Figur und Freiflächengestaltung<br />
Architektur:<br />
Tenhündfeld Architekten, Ahaus<br />
Christian Tenhündfeld<br />
Mitarbeiter: Caroline Wittenbrink<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Brandenfels, Münster<br />
Gordon Brandenfels<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 49
2. Rundgang<br />
Architektur:<br />
Klaus Roth Architekten, Berlin<br />
Klaus Roth<br />
Mitarbeiter: A. Tazawa, S. Lindell,<br />
H. Kummerow, I. Matei<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Landschaftsplaner Büro<br />
Henningsen BDLA, Berlin<br />
Hr. Henningsen, Fr. Sabaw Blick in Richtung Hautpeingang<br />
Lageplan: Städtebauliche Figur und Freiflächengestaltung<br />
Modellfoto<br />
50 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs
Blick in Richtung Hautpeingang<br />
Modellfoto<br />
Lageplan: Städtebauliche Figur und Freiflächengestaltung<br />
Architektur:<br />
SelgasCano, Madrid<br />
José Selgas Rubio, Lucia Cano Pintos,<br />
Martin Hochrein<br />
Mitarbeiter: Laura Culiáñez,<br />
Lorena del Rio, Mario Escudero<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Arquitectura Agronomia SLP,<br />
Barcelona<br />
Teresa Gali Izard, Jordi Nebot<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 51
2. Rundgang<br />
Architektur:<br />
Peter Bastian Architekten BDA,<br />
Münster<br />
Peter Bastian<br />
Mitarbeiter: Lisa Vorderderfler,<br />
Marco Münsterteicher, Sven Helms,<br />
Katrin Jüttner, Florian Walter,<br />
Sonja Klück<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Wiggenhorn & van den Hövel<br />
Landschaftsarchitekten BDLA,<br />
Hamburg<br />
Martin van den Hövel,<br />
Hubert Wiggenhorn<br />
Mitarbeiter: Hanna Heitkamp<br />
Brandschutz:<br />
Hölscher Branschutz Konzepte<br />
Haustechnik: Zonzalla Ingenieure<br />
Lageplan: Städtebauliche Figur und Freiflächengestaltung<br />
52 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />
Blick in Richtung Hautpeingang<br />
Modellfoto
Blick in Richtung Hautpeingang<br />
Modellfoto<br />
Lageplan: Städtebauliche Figur und Freiflächengestaltung<br />
Architektur:<br />
Architekten Schmidt-Schicketanz<br />
und Partner GmbH, München<br />
Christoph Nagel-Hirschauer<br />
Mitarbeiter: Miriam Balz,<br />
Christian Rogner, Carolin Berger<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Lex Kerfers_Landschafts-<br />
architekten BDLA, Bockhorn<br />
Rita Lex-Kerfers<br />
Mitarbeiter: Gianluca Dello Buona<br />
Visualisierung:<br />
Rakete GmbH, München<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 53
2. Rundgang<br />
Architektur:<br />
Roswag Architekten –<br />
Gesellschaft von Architekten<br />
mbH, Berlin<br />
Eike Roswag<br />
Mitarbeiter: Marine Miroux,<br />
Michael Kandel, Ivonn Kramm,<br />
Anja Mocker, Christoph Hager,<br />
Alexander Lehmann,<br />
Matthew Crabbe<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
freianlage.de<br />
Landschaftsarchitektur, Potsdam<br />
Christof Staiger<br />
Mitarbeiter: Ulrich Grünmüller,<br />
Silvia Zimmermann<br />
Brandschutz:<br />
Dipl.-Ing. Architekt Ilko<br />
M. Mauruschat, Berlin<br />
Lageplan: Städtebauliche Figur und Freiflächengestaltung<br />
54 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />
Blick in Richtung Hautpeingang<br />
Modellfoto
Blick in Richtung Hautpeingang<br />
Modellfoto<br />
Lageplan: Städtebauliche Figur und Freiflächengestaltung<br />
Architektur:<br />
Feja + Kemper Architekten,<br />
Recklinghausen<br />
Mitarbeiter: Sebastian Allkemper,<br />
Tim Siegeler<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Davids, Terfrüchte + Partner,<br />
Essen<br />
Peter Davids<br />
Mitarbeiter: Daniel Schürmann<br />
Brandschutz:<br />
BKK, Warendorf<br />
Statik:<br />
Gehlmann + Lammering, Billerbeck<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 55
2. Rundgang<br />
Architektur:<br />
office03, Waldmann + Jungblut<br />
GbR, Köln<br />
Dirk Waldmann, Berthold Jungblut<br />
Mitarbeiter: Florian Graus<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
A24 Landschaft, Berlin<br />
Steffan Robel<br />
Mitarbeiter: Shyuenwen Shyu<br />
Lageplan: Städtebauliche Figur und Freiflächengestaltung<br />
56 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />
Blick in Richtung Hautpeingang<br />
Modellfoto
Blick in Richtung Hautpeingang<br />
Modellfoto<br />
Architektur:<br />
ap plan mory osterwalder<br />
vielmo architekten- und<br />
ingenieurgesellschaft mbH,<br />
Stuttgart<br />
Julian Vielmo<br />
Mitarbeiter: Michael Glowasz, Sven<br />
Schmidtgen, Felipe Espinosa-Caro<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Weidinger Landschaftsarchitekten,<br />
Berlin<br />
Jürgen Weidinger<br />
Mitarbeiter: Luca Torini<br />
TGA: KE&S GbR, Berlin<br />
Hr. Schimo-Lema<br />
Tragwerk: EHS Stuttgart GmbH,<br />
Stuttgart | Hr. Dr. Grunert<br />
Bühnentechnik: Bühnenplanung<br />
Kottke GmbH, Bayreuth | Hr. Kottke<br />
Lageplan<br />
Blick in Richtung Hautpeingang<br />
Modellfoto<br />
1. Rundgang<br />
Architektur:<br />
m.schneider a.hillebrandt<br />
architekten, Münster<br />
Prof. i.V. Martin Schneider,<br />
Prof. Annette Hillebrandt<br />
Mitarbeiter: Dirk Becker<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Breimann & Bruun Garten und<br />
Landschaftsarchitekten MAA,<br />
Hamburg<br />
Brandschutz:<br />
Ing.-Büro Leiermann, Dormagen<br />
Haustechnik und Bauphysik: Pfeil &<br />
Koch Ingenieurgesellschaft, Köln<br />
Städtebau: Prof. Joachim Schultz-<br />
Granberg, Berlin<br />
Tragwerk:<br />
IFS Ber. Ingenieure für Bauwesen<br />
Lageplan<br />
Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 57
1. Rundgang<br />
Architektur:<br />
Molestina Architekten GmbH,<br />
Köln<br />
Prof. Juan Pablo Molestina<br />
Mitarbeiter: Laura Garcia Blanco,<br />
Mark Aseltine, Stephan Schorn<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
FSWLA Landschaftsarchitektur,<br />
Düsseldorf<br />
Thomas Fenner<br />
Mitarbeiter: Simon Quindel<br />
Haustechnik:<br />
Planungsgemeinschaft Haustechnik,<br />
Becker – Huke – Hoffmann,<br />
Dormagen<br />
Statik:<br />
IDK Kleinjohann GmbH & Co.KG,<br />
Köln<br />
Modellfoto<br />
Blick in Richtung Hautpeingang<br />
Modellfoto<br />
58 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />
Blick in Richtung Hautpeingang<br />
Lageplan<br />
Lageplan<br />
Architektur:<br />
Holzhausen Zweifel Architekten,<br />
Zürich<br />
Sebastian Holzhausen,<br />
Hannes Zweifel<br />
Landschaftsarchitektur:<br />
Rosenmayr<br />
Landschaftsarchitektur, Zürich<br />
Matthias Rosenmayr<br />
Bauphysik und Akustik:<br />
BAKUS Bauphysik und Akustik<br />
GmbH, Zürich<br />
Visualisierung:<br />
Yoshihiro Nagamine Visualisierungen,<br />
Zürich