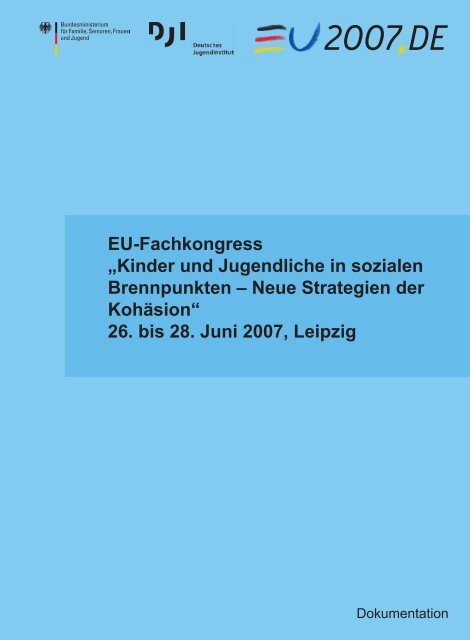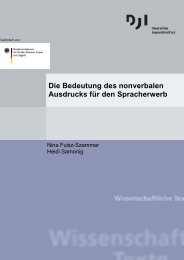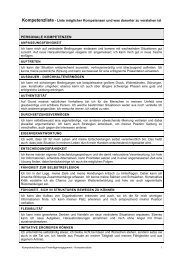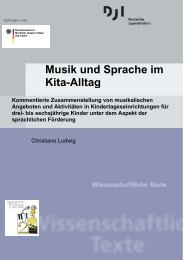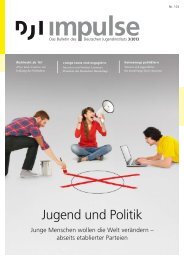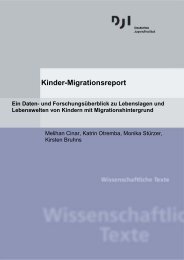Kinder und Jugendliche in sozialen Brennpunkten - Deutsches ...
Kinder und Jugendliche in sozialen Brennpunkten - Deutsches ...
Kinder und Jugendliche in sozialen Brennpunkten - Deutsches ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
EU-Fachkongress<br />
„<strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong><br />
<strong>Brennpunkten</strong> – Neue Strategien der<br />
Kohäsion“<br />
26. bis 28. Juni 2007, Leipzig<br />
Dokumentation
EU-Fachkongress<br />
„<strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong><br />
<strong>Brennpunkten</strong> – Neue Strategien der<br />
Kohäsion“<br />
26. bis 28. Juni 2007, Leipzig<br />
Dokumentation
Die Wissenschaftliche Begleitung der Programme „Entwicklung <strong>und</strong> Chancen<br />
junger Menschen <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong>“ <strong>und</strong> „Lokales Kapital für soziale<br />
Zwecke“ wird durch das B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong><br />
Jugend (BMFSFJ) f<strong>in</strong>anziell gefördert.<br />
© 2007 <strong>Deutsches</strong> Jugend<strong>in</strong>stitut e. V.<br />
Abteilung Jugend <strong>und</strong> Jugendhilfe<br />
Nockherstr. 2, 81541 München<br />
Telefon: +49 (0)89 62306-211<br />
Fax: +49 (0)89 62306-162<br />
Internet: http://www.dji.de<br />
Projekt „Entwicklung <strong>und</strong> Chancen junger<br />
Menschen <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong>“<br />
Außenstelle Halle<br />
Franckeplatz 1, Haus 12/13<br />
06110 Halle<br />
Telefon: +49 (0)345 68178-35<br />
Fax: +49 (0) 345 68178-47<br />
Layout: Heike Kießler<br />
Druck: Digital Druckservice Halle GmbH
Inhaltsverzeichnis<br />
E<strong>in</strong>leitung ................................................................................................................. 3<br />
Programm ................................................................................................................ 8<br />
Arbeitsgruppe 1: Bildung........................................................................................ 12<br />
Präsentation Polen......................................................................................... 12<br />
Präsentation Portugal..................................................................................... 18<br />
Berichterstattung AG 1................................................................................... 21<br />
Arbeitsgruppe 2: Beschäftigung............................................................................. 24<br />
Präsentation Ungarn ...................................................................................... 24<br />
Präsentation Irland ......................................................................................... 30<br />
Berichterstattung AG 2................................................................................... 36<br />
Arbeitsgruppe 3: Multikulturelles Zusammenleben................................................ 39<br />
Präsentation Tschechische Republik............................................................. 39<br />
Präsentation Litauen ...................................................................................... 46<br />
Präsentation Europarat .................................................................................. 51<br />
Berichterstattung AG 3................................................................................... 55<br />
Arbeitsgruppe 4: Ressortübergreifende Strategien für soziale Brennpunkte ........ 57<br />
Präsentation Deutschland .............................................................................. 57<br />
Präsentation Frankreich ................................................................................. 61<br />
Präsentation Großbritannien .......................................................................... 67<br />
Berichterstattung AG 4................................................................................... 71<br />
Arbeitsgruppe 5: Lokale Strategien zur Aktivierung beschäftigungswirksamer<br />
<strong>und</strong> sozialer Potentiale im Rahmen des ESF-Instruments der ger<strong>in</strong>gen<br />
Zuschussbeträge (Small Grants) ........................................................................... 74<br />
Präsentation Deutschland .............................................................................. 74<br />
Präsentation Italien......................................................................................... 81<br />
Präsentation Großbritannien .......................................................................... 87<br />
Berichterstattung AG 5................................................................................... 90<br />
Prof. Salvador Parrado: Good Governance – Was zeichnet gute Praxis aus? ..... 92<br />
Prof. Ra<strong>in</strong>er Kilb: Sozialräumliche Politikstrategien zur Verh<strong>in</strong>derung<br />
sozialer Exklusion .................................................................................................. 96<br />
Prof. Howard Williamson: Die europäische Jugendpolitik ................................... 106<br />
Dr. Christian Lüders: Versuch e<strong>in</strong>er ersten Zwischenbilanz................................ 114<br />
Integrationsstrategien für benachteiligte <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong><br />
– wohlfahrtsstaatlicher Kontext sowie<br />
programm- <strong>und</strong> problemspezifische E<strong>in</strong>flussfaktoren ......................................... 118<br />
Teilnehmer/<strong>in</strong>nen<br />
Referent/<strong>in</strong>nen<br />
Austeller/<strong>in</strong>nen<br />
Kulturacts
Dr. Susann Burchardt, Dr. Heike Förster, Tatjana Mögl<strong>in</strong>g<br />
<strong>Deutsches</strong> Jugend<strong>in</strong>stitut e.V. Halle<br />
E<strong>in</strong>leitung<br />
Der hier dokumentierte europäische Fachkongress „<strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong><br />
<strong>Brennpunkten</strong> – Neue Strategien der Kohäsion“ wurde vom B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familien,<br />
Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft veranstaltet<br />
<strong>und</strong> fand vom 26. bis 28. Juni 2007 mit ca. 400 <strong>in</strong>ternationalen Teilnehmer/<strong>in</strong>nen<br />
im Congress-Center Leipzig statt.<br />
Mit dem Kongress wurde der <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> im Jahre 2004 begonnene <strong>und</strong> <strong>in</strong> Straßburg 2006<br />
fortgeführte europäische Diskussionsprozess über Handlungskonzepte <strong>und</strong> Integrationsstrategien<br />
für junge Menschen <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong>, benachteiligten städtischen <strong>und</strong><br />
ländlichen Gebieten fortgesetzt.<br />
In Berl<strong>in</strong> <strong>und</strong> Straßburg wurde deutlich, dass sich die vorhandenen Probleme <strong>in</strong> den europäischen<br />
Ländern zum Teil stark unterscheiden. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen<br />
Begleitung des Programms „Entwicklung <strong>und</strong> Chancen junger Menschen <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong><br />
<strong>Brennpunkten</strong> (E&C)“ <strong>und</strong> anderer Studien unterstreichen dies: benachteiligte Stadtteile<br />
<strong>und</strong> Regionen <strong>in</strong> Europa weisen meist erhebliche sozialräumliche <strong>und</strong> sozialstrukturelle<br />
Unterschiede auf <strong>und</strong> s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> sich sehr <strong>in</strong>homogen. Entsprechend unterschiedlich s<strong>in</strong>d die<br />
jeweiligen Herangehensweisen an die Bearbeitung der Probleme <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong>.<br />
E<strong>in</strong> systematischer Vergleich der zugr<strong>und</strong>e liegenden nationalen Politikstrategien ist auf<br />
europäischer Ebene bislang nicht erfolgt.<br />
Die lokalen Akteure <strong>in</strong> den europäischen Ländern stellen immer wieder fest, dass sie bei<br />
der Beschreibung der Problemlagen <strong>in</strong> ihren benachteiligten Gebieten auf sehr unterschiedliche<br />
Datenlagen zurückgreifen können. Das führt dazu, dass Kommunen, die über wenig<br />
konkretes Wissen zu Rahmenbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> Problemlagen verfügen, sehr große Schwierigkeiten<br />
mit dem Entwurf konkreter Entwicklungsziele für ihre benachteiligten Stadtteile<br />
haben. Dies führt zu Unsicherheiten, welche Strategien <strong>und</strong> Verfahren für die Verbesserung<br />
der Lebenslagen <strong>und</strong> Chancen der <strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> diesen Gebieten greifen bzw. welche<br />
spezifischen Herangehensweisen vor Ort notwendig s<strong>in</strong>d.<br />
Vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> bestand das Ziel des europäischen Fachkongresses <strong>in</strong> Leipzig<br />
dar<strong>in</strong>, nationale Strategien <strong>und</strong> Programme aus unterschiedlichen europäischen Ländern<br />
sowie ihre nationalstaatlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen, <strong>in</strong>stitutionellen Voraussetzungen <strong>und</strong><br />
Umsetzungen vor Ort zu vergleichen. Es sollten Geme<strong>in</strong>samkeiten <strong>und</strong> Unterschiede heraus<br />
gearbeitet <strong>und</strong> e<strong>in</strong> europäischer Prozess geme<strong>in</strong>samen Lernens angestoßen werden.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus sollten Empfehlungen für die Entwicklung von Strategien zur Integration<br />
junger Menschen <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong> an die EU-Mitgliedstaaten <strong>und</strong> die europäische<br />
Ebene abgeleitet werden.<br />
Der europäische Fachkongress <strong>in</strong> Leipzig nahm die unterschiedlichen gesamtstaatlichen<br />
<strong>sozialen</strong> <strong>und</strong> politischen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen der verschiedenen nationalen Strategien <strong>und</strong><br />
Programme für <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong> <strong>in</strong> den Blick.<br />
Das Sozialstaatskonzept e<strong>in</strong>es Landes gibt die allgeme<strong>in</strong>en Kriterien für politische, wirtschaftliche<br />
<strong>und</strong> soziale Entscheidungen vor, z. B. wer welche <strong>sozialen</strong> Dienste <strong>und</strong> Fürsor-<br />
3
geleistungen erhält <strong>und</strong> unter welchen Bed<strong>in</strong>gungen diese Leistungen von wem erbracht<br />
werden. Unterschiede <strong>in</strong> diesen Konzepten bewirken unterschiedliche nationale politische<br />
Programme, Förderstrategien, Maßnahmen <strong>und</strong> Projekte.<br />
Dies sichtbar zu machen, war e<strong>in</strong> Anliegen des Kongresses. Unter Berücksichtigung des<br />
jeweiligen nationalen Sozialstaatskonzeptes sollten zum e<strong>in</strong>en die Erarbeitung der nationalen<br />
Strategien <strong>und</strong> Programme <strong>und</strong> zum anderen deren konkrete Umsetzung auf der regionalen<br />
bzw. lokalen Ebene betrachtet werden.<br />
Für den Vergleich verschiedener nationaler Strategien, ihre E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> europäische<br />
Entwicklungen, die Berücksichtigung der aktuellen fachwissenschaftlichen Diskussion sowie<br />
die Darstellung der Vor-Ort-Umsetzung wurden verschiedene Arbeits- <strong>und</strong> Präsentationsformen<br />
gewählt.<br />
Vertreter der europäischen, nationalen <strong>und</strong> lokalen Ebene verdeutlichten <strong>in</strong> politischen<br />
Statements die Notwendigkeit der Beschäftigung mit den Integrations- <strong>und</strong> Ausgrenzungsproblemen<br />
von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong>. Gerd Hoofe (Staatssekretär<br />
im B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend), Jérôme Vignon<br />
(Europäische Kommission, Generaldirektion Beschäftigung, Soziales <strong>und</strong> Chancengleichheit)<br />
<strong>und</strong> Burkhard Jung (Oberbürgermeister der Stadt Leipzig) betonten die Bedeutung<br />
des Kongresses <strong>und</strong> der geme<strong>in</strong>samen Suche nach übertragbaren Lösungsansätzen zum<br />
Wohl der <strong>in</strong> der EU lebenden <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n. Jungen Menschen die Voraussetzungen<br />
für e<strong>in</strong>e gel<strong>in</strong>gende Integration zu schaffen, hat für alle drei politischen Ebenen, die<br />
B<strong>und</strong>esregierung, die Europäische Kommission sowie die Kommunen oberste Priorität.<br />
Geme<strong>in</strong>sam wurden die Stärkung der lokalen Ebene <strong>und</strong> die Förderung sozialräumlicher<br />
Ansätze <strong>in</strong> den Städten <strong>und</strong> Geme<strong>in</strong>den Europas gefordert.<br />
Gerd Hoofe führte aus, dass die B<strong>und</strong>esregierung es als ihre Aufgabe ansieht, allen <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n<br />
<strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe zu eröffnen. „Deshalb haben<br />
wir e<strong>in</strong>en Schwerpunkt unserer Politik auf die verstärkte Förderung benachteiligter<br />
junger Menschen gelegt <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Reihe von Förderprogrammen aufgelegt. Wir dürfen<br />
niemanden aufgeben <strong>und</strong> müssen für alle <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> die Möglichkeit schaffen,<br />
ihre Fähigkeiten <strong>und</strong> Talente zu entwickeln“, so Hoofe. E<strong>in</strong>ige B<strong>und</strong>esprogramme für benachteiligte<br />
junge Menschen, wie „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ (LOS), „Entwicklung<br />
<strong>und</strong> Chancen junger Menschen <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong>“ (E&C), „Schulverweigerung<br />
– Die 2. Chance“ sowie „Kompetenzagenturen“ wurden im Verlauf des Kongresses<br />
präsentiert.<br />
Drei Plenarvorträge steckten den <strong>in</strong>haltlichen Rahmen der Tagung ab. Prof. Salvador<br />
Parrado (Governance International) aus Spanien thematisierte die <strong>in</strong>stitutionellen <strong>und</strong> adm<strong>in</strong>istrativen<br />
Strukturen auf nationaler, regionaler <strong>und</strong> lokaler Ebene, <strong>in</strong> denen Programme<br />
für sozial benachteiligte <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> entwickelt <strong>und</strong> umgesetzt werden. Er plädierte<br />
für e<strong>in</strong>e ressortübergreifende Governance-Perspektive, um den wachsenden Anforderungen<br />
an die Erbr<strong>in</strong>gung sozialer Leistungen gerecht zu werden. Prof. Ra<strong>in</strong>er Kilb<br />
(Fachhochschule Mannheim) aus Deutschland stellte das Konzept sozialräumlicher Arbeit<br />
als Möglichkeit, <strong>sozialen</strong> Ausgrenzungsprozessen von <strong>Jugendliche</strong>n zu begegnen, vor. Prof.<br />
Howard Williamson von der Universität Glamorgan <strong>in</strong> Großbritannien verdeutlichte die<br />
Perspektiven e<strong>in</strong>er europäischen Jugendpolitik <strong>und</strong> problematisierte die „w<strong>und</strong>en Punkte“<br />
4
europäischer Förderstrategien <strong>und</strong> Programme: Wie können bereits ausgegrenzte <strong>K<strong>in</strong>der</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> <strong>und</strong> deren Familien erreicht werden <strong>und</strong> wo muss angesetzt werden, um<br />
generelle Lösungen zu entwickeln?<br />
In fünf thematischen Arbeitsgruppen präsentierten Vertreter/<strong>in</strong>nen aus zehn verschiedenen<br />
EU-Ländern ihre Erfahrungen mit nationalen, regionalen <strong>und</strong> lokalen Programmen,<br />
es wurden Handlungsempfehlungen für die Jugendpolitik auf nationaler <strong>und</strong> europäischer<br />
Ebene sowie der Fachpraxis erarbeitet. Insbesondere wurden Verfahren <strong>und</strong> Wege von der<br />
nationalen Erarbeitung von Förderprogrammen bis h<strong>in</strong> zur lokalen Umsetzung präsentiert<br />
<strong>und</strong> verglichen. Die Präsentationen erfolgte <strong>in</strong> den thematischen Arbeitsgruppen „Bildung“,<br />
„Beschäftigung“, „Multikulturelles Zusammenleben“, „Ressortübergreifende Strategien<br />
für soziale Brennpunkte“ sowie „Lokale Strategien zur Aktivierung beschäftigungswirksamer<br />
<strong>und</strong> sozialer Potenziale im Rahmen des ESF-Instruments der Small Grants“.<br />
Die vorliegende Dokumentation verzichtet auf e<strong>in</strong>e vollständige Wiedergabe der e<strong>in</strong>zelnen<br />
Länderpräsentationen. Stattdessen werden die <strong>in</strong>haltlichen Kernaussagen zur Entwicklung<br />
<strong>und</strong> Implementierung der Programme <strong>und</strong> Strategien dargestellt.<br />
Im Anschluss an die Diskussionen <strong>in</strong> den Arbeitsgruppen konnten die Teilnehmer/<strong>in</strong>nen<br />
beim Besuch von sechs verschiedenen Praxisprojekten, die <strong>in</strong>haltlich auf die<br />
Themen der Arbeitsgruppen abgestimmt waren, e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die lokale Umsetzung<br />
deutscher Jugendhilfestrategien <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong> der Stadt Leipzig gew<strong>in</strong>nen. E<strong>in</strong>e<br />
Projektmesse mit 33 Ständen von Mikroprojekten aus neun EU-Ländern, die im Rahmen<br />
des ESF gefördert werden, r<strong>und</strong>ete das Arbeitsprogramm des Kongresses ab. Diese Projekte<br />
waren <strong>in</strong>haltlich vor allem auf die Verbesserung der beruflichen Integrationschancen von<br />
<strong>Jugendliche</strong>n ausgerichtet. Besonders lebendig wurde der Kongress durch die Aktivitäten<br />
von Teilnehmer/<strong>in</strong>nen aus verschiedenen Projekten (z. B. Tanz, Musik, Film). Mehr über<br />
diese Projektmesse <strong>und</strong> die Aussteller/<strong>in</strong>nen können Sie auf der Internetseite der Regiestelle<br />
des Programms „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ (http://www.losonl<strong>in</strong>e.de/content/e378/e7708/<strong>in</strong>dex_ger.html)<br />
erfahren. Dort ist auch e<strong>in</strong> Film abrufbar,<br />
der im Verlauf des Kongresses entstanden ist <strong>und</strong> dieser Dokumentation beiliegt.<br />
Kar<strong>in</strong> Reiser (Abteilungsleiter<strong>in</strong> <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugend im B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie,<br />
Senioren Frauen <strong>und</strong> Jugend) <strong>und</strong> Karel Bartak (Europäische Kommission, Generaldirektion<br />
Jugend <strong>und</strong> Bildung), griffen <strong>in</strong> ihren Abschlussstatements die Aussagen von Staatsekretär<br />
Gerd Hoofe <strong>und</strong> Jérôme Vignon auf <strong>und</strong> unterstrichen die große gesellschaftliche <strong>und</strong><br />
politische Verantwortung, soziale Ausgrenzung von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n zu verh<strong>in</strong>dern<br />
bzw. zu stoppen. Wenn soziale <strong>und</strong> berufliche Integration erreicht werden soll, müssten<br />
vor allem die Übergänge von der Schule <strong>in</strong>s Erwerbsleben für junge Menschen gel<strong>in</strong>gen.<br />
Kar<strong>in</strong> Reiser griff e<strong>in</strong> Ergebnis der nationalen Präsentationen auf dem Kongress auf: In<br />
allen europäischen Ländern gibt es <strong>in</strong> den <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong> das Phänomen der Ausgrenzung<br />
sozial schwacher <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>r. Sie warnte davor, dass sich „<strong>in</strong>dividuelle<br />
soziale Benachteiligungen <strong>und</strong> die Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong> überlagern<br />
<strong>und</strong> oftmals Problem verschärfende Spiralen bilden“. „Durchbrochen werden können<br />
diese nur“, so Reiser, „wenn die <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n <strong>und</strong> ihre Familien <strong>in</strong> diesen<br />
Gebieten e<strong>in</strong>e besondere, <strong>in</strong>dividuelle Förderung erhalten <strong>und</strong> gleichzeitig Eigen<strong>in</strong>itiative<br />
5
<strong>und</strong> Aktivität von ihnen e<strong>in</strong>gefordert wird.“ Kar<strong>in</strong> Reiser hob die Bedeutung kle<strong>in</strong>er Initiativen<br />
<strong>und</strong> Organisationen hervor, die „die Brücken der Integration“ oftmals besser schlagen<br />
können – durch ihre flexible Herangehensweise, die <strong>in</strong>dividuelle Betreuung <strong>und</strong> persönliche<br />
Nähe zu den <strong>Jugendliche</strong>n.<br />
Sehr deutlich wies sie darauf ihn, dass der soziale Raum stärker als bisher geme<strong>in</strong>samer<br />
Bezugspunkt der jugendpolitischen nationalen <strong>und</strong> europäischen Strategien se<strong>in</strong> muss.<br />
Dem konnte sich Karel Bartak anschließen, der sehr deutlich machte, dass durch das europäische<br />
Programm ‚Jugend <strong>in</strong> Aktion’ künftig auch stärker die benachteiligten <strong>Jugendliche</strong>n<br />
erreicht <strong>und</strong> e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en werden sollen. „Es geht vor allem darum, dass nicht nur e<strong>in</strong><br />
Dialog zwischen der EU <strong>und</strong> den <strong>Jugendliche</strong>n geführt werden soll, sondern dass dieser<br />
verstärkt zwischen den <strong>Jugendliche</strong>n <strong>und</strong> ihren Geme<strong>in</strong>den vor Ort stattf<strong>in</strong>den muss.“<br />
Den Schlusspunkt bildeten die Plädoyers von Ulrich Bohner (Kongress der Geme<strong>in</strong>den<br />
<strong>und</strong> Regionen des Europarats) <strong>und</strong> Brith Fäldt (Stadträt<strong>in</strong> <strong>in</strong> Pitea, Schweden) für e<strong>in</strong>e<br />
Stärkung der lokalen <strong>und</strong> kommunalen Ebene. Diese sei „die gesellschaftliche <strong>und</strong> politischen<br />
Ebene, auf der die gesamtgesellschaftlichen Problemlagen ihren konkreten Ausdruck“<br />
fänden. Ulrich Bohner verwies unter anderem auf die Initiativen des Europarates,<br />
die notwendigen Integrationsprozesse für Migranten auf der lokalen Ebene zu unterstützen<br />
<strong>und</strong> illustrierte dies am Beispiel des Netzwerkes von Kommunen <strong>und</strong> Regionen „Cities for<br />
Local Integration Policy“ (CLIP), <strong>in</strong> dem seit 2003 25 Großstädte geme<strong>in</strong>sam arbeiten.<br />
Brith Fäldt machte darauf aufmerksam, dass die europäische Jugend-Charta e<strong>in</strong> wesentliches<br />
Moment enthält, das die Veränderung der Stellung der Politik zu Jugend verdeutlicht:<br />
„Es geht um das Recht der Jugend, gehört zu werden <strong>und</strong> die Idee, die jungen Menschen<br />
als Bürger zu sehen – nicht als gesellschaftliches Problem oder als Zielgruppe.“ Wenn diese<br />
Idee auf allen Ebenen von der europäischen bis zur lokalen verwirklicht würde, wären wir<br />
<strong>in</strong> der Jugendpolitik e<strong>in</strong> ganzes Stück weiter, so Brith Fäldt.<br />
E<strong>in</strong>e erste <strong>in</strong>haltliche Bilanz zog Dr. Christian Lüders (<strong>Deutsches</strong> Jugend<strong>in</strong>stitut, München).<br />
Er sieht folgende Aspekte bei der Bekämpfung sozialer Problemlagen bei <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n<br />
<strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> benachteiligten Gebieten als wesentlich an:<br />
1. Integrierte Handlungsstrategien zur Verbesserung der Lebenslagen von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n<br />
<strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> benachteiligten Stadtgebieten s<strong>in</strong>d dann erfolgreich, wenn sie<br />
<strong>in</strong> nationale <strong>und</strong> vor allem ressortübergreifende Strategien e<strong>in</strong>gebettet s<strong>in</strong>d.<br />
2. E<strong>in</strong>e nationale ressortübergreifende Strategie ist e<strong>in</strong>e Rahmenbed<strong>in</strong>gung, die notwendig,<br />
jedoch alle<strong>in</strong> nicht h<strong>in</strong>reichend ist. Um diese Strategie zu e<strong>in</strong>er Wirkung vor<br />
Ort zu br<strong>in</strong>gen, ist die strategische E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung von NGO’s <strong>und</strong> der Wirtschaft <strong>in</strong><br />
umfassendem S<strong>in</strong>ne unerlässlich.<br />
3. Die Präsentationen zeigen, dass es vor allem darauf ankommt, nicht nur für die<br />
Zielgruppen zu arbeiten, sondern vor allem mit ihnen. Es müssen Gestaltungsräume<br />
für die <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n selbst geschaffen werden. Veränderungen s<strong>in</strong>d<br />
nur dann nachhaltig zu erreichen, wenn den <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n Beteiligungsmöglichkeiten<br />
geboten werden, die nicht nur formal gelten, sondern ernst<br />
geme<strong>in</strong>t s<strong>in</strong>d.<br />
6
4. Aus e<strong>in</strong>er europäischen Perspektive wird sichtbar, dass es nicht nur um benachteiligte<br />
Stadtgebiete, sondern auch um die Entwicklung von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n<br />
<strong>in</strong> strukturschwachen Gebieten geht.<br />
Die vorliegende Dokumentation be<strong>in</strong>haltet schwerpunktmäßig die Kurzfassungen der<br />
Länderpräsentationen <strong>in</strong> den Arbeitsgruppen sowie die entsprechenden Berichterstattungen<br />
mit den Handlungsempfehlungen. Darüber h<strong>in</strong>aus werden die Hauptreferate <strong>in</strong> gekürzter<br />
Fassung wiedergegeben.<br />
Dr. Susann Burchardt, Dr. Heike Förster <strong>und</strong> Tatjana Mögl<strong>in</strong>g vom Deutschen Jugend<strong>in</strong>stitut<br />
greifen <strong>in</strong> ihrem <strong>in</strong>haltlichen Beitrag die Perspektive verschiedener wohlfahrtsstaatlicher<br />
Kontexte auf, um e<strong>in</strong>en besseren systematischen Vergleich der verschiedenen vorgestellten<br />
nationalen Strategien zu ermöglichen. Zum Schluss des Beitrages werden die Kernergebnisse<br />
der Konferenz formuliert.<br />
Für die Optimierung von zukünftigen EU-Strategien <strong>und</strong> EU-Programmen zur Integration<br />
von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> benachteiligten Gebieten sollten die unterschiedlichen<br />
nationalen Wege der Beobachtung <strong>und</strong> Förderung dieser Gebiete <strong>und</strong> der <strong>in</strong> ihnen<br />
lebenden Bevölkerungsgruppen systematisch verglichen werden. Vor- <strong>und</strong> Nachteile der<br />
verschiedenen nationalen Wege sollten ausgelotet werden, um ökonomisch, fachlich s<strong>in</strong>nvolle<br />
<strong>und</strong> leistungsfähige, geme<strong>in</strong>same Verfahren zu entwickeln. Wir hoffen, e<strong>in</strong>en Beitrag<br />
auf der Suche nach geme<strong>in</strong>sam begehbaren Wegen im Kampf gegen soziale Ausgrenzung<br />
von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> Europa zu leisten.<br />
7
Programm<br />
EU-Fachkongress „<strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong><br />
– Neue Strategien der Kohäsion“<br />
Der europäische Fachkongress „<strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong> – Neue<br />
Strategien der Kohäsion“ stellt e<strong>in</strong> breites Spektrum sehr unterschiedlicher nationaler Strategien<br />
zur Verbesserung der Integration von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong><br />
vor. Es sollen <strong>in</strong>sbesondere die unterschiedlichen Verfahren <strong>und</strong> Wege von der<br />
Erarbeitung bis zur Umsetzung der Strategien unter den jeweiligen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
vor Ort dargestellt <strong>und</strong> mite<strong>in</strong>ander verglichen werden. Mit dem EU-Kongress will das<br />
B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend die Erarbeitung geme<strong>in</strong>samer<br />
europaweiter Handlungsstrategien anregen.<br />
Auf e<strong>in</strong>er Projektmesse werden ausgewählte lokale Projekte zur <strong>sozialen</strong> <strong>und</strong> beruflichen<br />
Integration besonders benachteiligter Personen aus neun europäischen Ländern vorgestellt,<br />
die durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) im Rahmen der Verordnung (EG) Nr.<br />
1784/1999, Artikel 4(2) gefördert werden. Aus Deutschland präsentieren sich <strong>in</strong>sbesondere<br />
Projekte aus dem B<strong>und</strong>esprogramm „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ (LOS).<br />
Dienstag, 26. Juni 2007<br />
Tagesmoderation Alexandra Tapprogge, Moderator<strong>in</strong> des Politikformats giga real <strong>und</strong><br />
Spiegel TV<br />
12:00 Uhr Anmeldung der Kongressteilnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Kongressteilnehmer<br />
Besuch der Projektmesse<br />
14:00 Uhr Grußwort<br />
Burkhard Jung, Oberbürgermeister der Stadt Leipzig<br />
Eröffnung<br />
• Gerd Hoofe, Staatssekretär, B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie,<br />
Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend<br />
• Jérôme Vignon, Direktor für Sozialschutz <strong>und</strong> soziale Integration,<br />
Europäische Kommission, Generaldirektion Beschäftigung, Soziale<br />
Angelegenheiten <strong>und</strong> Chancengleichheit<br />
15:00 Uhr Talkr<strong>und</strong>e<br />
Gerd Hoofe, Jérôme Vignon sowie Hassan Akkouch, Esra Demirci<br />
<strong>und</strong> Ivan Stefanovic von der Streetdance Connection<br />
15:30 Uhr Kaffeepause<br />
Besuch der Projektmesse<br />
16:30 Uhr Good Governance – Was zeichnet gute Praxis aus?<br />
Prof. Salvador Parrado, Governance International, Spanien<br />
17:15 Uhr Ende des 1. Kongresstages<br />
19:30 Uhr Empfang im Neuen Rathaus Leipzig<br />
Mittwoch, 27. Juni 2007<br />
Tagesmoderation Dr. Christian Lüders, <strong>Deutsches</strong> Jugend<strong>in</strong>stitut<br />
09:00 Uhr E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> die Arbeit der Arbeitsgruppen<br />
8
09:30 Uhr 5 Arbeitsgruppen mit Länderpräsentationen zu folgenden Themen:<br />
AG 1: Bildung<br />
Polen: Programm „Equal Opportunities“ – Verbesserung der Bildungschancen<br />
für <strong>Jugendliche</strong> <strong>in</strong> ländlichen Räumen<br />
• Grzegorz Manko, Polnische <strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendstiftung<br />
• Marc<strong>in</strong> Siñczuch, Jugendforschungszentrum des Institutes für angewandte<br />
Sozialwissenschaften, Universität Warschau<br />
• Dom<strong>in</strong>ika Walczak, Institut für angewandte Sozialwissenschaften,<br />
Universität Warschau<br />
Portugal: Programm „Escolhas“– Verbesserung der Chancengleichheit<br />
<strong>und</strong> <strong>sozialen</strong> Integration<br />
• Pedro Calado, Projektkoord<strong>in</strong>ator Lissabon<br />
• Bruno Varela, Cool Generation Project, Lissabon<br />
• Nuno Cristova, Cool Generation Project, Lissabon<br />
• Maria Virg<strong>in</strong>ia Sousa, Instituto National di Habitas, Porto<br />
Moderation: Dr. Elke Schreiber, <strong>Deutsches</strong> Jugend<strong>in</strong>stitut<br />
AG 2: Beschäftigung<br />
Ungarn: „Neue Dienste – Beschäftigung für <strong>Jugendliche</strong>“<br />
• Gabriella Tölgyes, M<strong>in</strong>istry of Social Affairs and Labour<br />
• Dr. Tamás Ganczer, South-Transdanubian Regional Labour Centre<br />
Irland: „Youthreach“ – Qualifi zierungs-<strong>und</strong> Beschäftigungsprogramm<br />
für benachteiligte <strong>Jugendliche</strong><br />
• Dr. Dermot Stokes, Nationaler Koord<strong>in</strong>ator „Youthreach“, Dubl<strong>in</strong><br />
• Stephen McCarthy, City of Dubl<strong>in</strong>, Vocational Education Commitee<br />
• Christ<strong>in</strong>a Carolan, Youthreach Local Centre Dubl<strong>in</strong><br />
• Angelique Kelly, Youthreach Local Centre Dubl<strong>in</strong><br />
Moderation: Dr. Heike Förster, <strong>Deutsches</strong> Jugend<strong>in</strong>stitut<br />
AG 3: Multikulturelles Zusammenleben<br />
Tschechische Republik: Integrationsstrategien für junge Roma am<br />
Beispiel des IQ Roma Servis<br />
• Katarína Klamková, o.s. IQ Roma Servis, Brno<br />
• Sona Kotibova, Schlesische Diakonie<br />
Litauen: „Geme<strong>in</strong>dezentren für Roma“ als Beispiel für neue Integrationsstrategien<br />
<strong>in</strong> Litauen<br />
• Graz<strong>in</strong>a Savickaja, Department of National m<strong>in</strong>orities and<br />
Lithuanians liv<strong>in</strong>g abroad<br />
• Svetlana Novopolskaja, Roma Community Center, Vilnius<br />
• Dr. Tadas Leoncikas, Centre of Ethnic Studies (CES), Vilnius<br />
Europarat: „Alle Anders – Alle Gleich“, Kampagne des Europarats<br />
für Vielfalt, Teilhabe <strong>und</strong> Menschenrechte<br />
• Kathr<strong>in</strong> Groth, Programmverantwortliche Deutschland<br />
Moderation: Dr. René Bendit, <strong>Deutsches</strong> Jugend<strong>in</strong>stitut<br />
AG 4: Ressortübergreifende Strategien für soziale Brennpunkte<br />
Deutschland: Programmplattform „Entwicklung <strong>und</strong> Chancen junger<br />
Menschen <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong>“ (E&C)<br />
• Peter Kupferschmid, B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren,<br />
Frauen <strong>und</strong> Jugend<br />
• Dr. Susann Burchardt, <strong>Deutsches</strong> Jugend<strong>in</strong>stitut<br />
• Ra<strong>in</strong>er Prölß, Stadt Nürnberg<br />
9
10<br />
Frankreich: Programm „Réussite éducative à la DIV“ – Bildungsprogramm<br />
für <strong>Jugendliche</strong> <strong>in</strong> problematischen Stadtteilen<br />
• Philippe Choffel, Leiter der Nationalen Beobachtungsstelle für<br />
problematische Stadtteile, Paris<br />
• Yves Goepfert, Leiter des Programms „Réussite éducative à la<br />
DIV“, Paris<br />
• Frederic Bourthoumieu, GIP Centre Essonne, Courcouronnes<br />
Großbritannien: Programm „Childrens F<strong>und</strong>“ – Reduzierung sozialer<br />
Ausgrenzung von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n<br />
• Prof. Marian Barnes, Nationale Programmevaluation, Brighton<br />
• Kate Morriss, Nationale Programmevaluation, Birm<strong>in</strong>gham<br />
• Ela<strong>in</strong>e Morrisson, Manchester Childrens F<strong>und</strong><br />
Moderation: Hartmut Brocke, Stiftung SPI<br />
AG 5: Lokale Strategien zur Aktivierung beschäftigungswirksamer<br />
<strong>und</strong> sozialer Potentiale im Rahmen des ESF-Instruments<br />
der ger<strong>in</strong>gen Zuschussbeträge (Small Grants)<br />
Erfahrungen aus europäischer Sicht:<br />
• Heribert Lange, EU-Kommission, Generaldirektion Beschäftigung,<br />
soziale Angelegenheiten <strong>und</strong> Chancengleichheit<br />
Deutschland: ESF-B<strong>und</strong>esprogramm „Lokales Kapital für soziale<br />
Zwecke“ (LOS)<br />
• Dr. Sven-Olaf Obst, B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren,<br />
Frauen <strong>und</strong> Jugend<br />
• Christoph Schwamborn, Regiestelle LOS<br />
• Petra Meier to Berndt-Seidl, Oberbürgermeister<strong>in</strong> der Stadt L<strong>in</strong>dau<br />
Italien: ESF-Programm „Sovvenzione Globale – Piccoli Sussidi“ <strong>und</strong><br />
dessen Umsetzung <strong>in</strong> der Region Piemonte<br />
• Prof. Dott. Maurizio Ambros<strong>in</strong>i, Universität Milano<br />
• Dott. Luciano Ambrosio, Union.Etica, Region Piemonte<br />
Großbritannien: Das Londoner ESF-Programm „Fast Forward<br />
Grants“<br />
• David Moynihan, Greater London Enterprise (GLE)<br />
Moderation: Claudia Fligge-Hoffjann, B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie,<br />
Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend<br />
12:00 Uhr Mittagspause Besuch der Projektmesse<br />
13:30 Uhr Fortsetzung der 5 Arbeitsgruppen mit Länderpräsentationen<br />
16:00 Uhr Sozialräumliche Politikstrategien zur Verh<strong>in</strong>derung sozialer Exklusion<br />
Prof. Dr. Ra<strong>in</strong>er Kilb, Fachhochschule Mannheim, Fakultät für<br />
Sozialwesen<br />
17:00 Uhr Kaffeepause<br />
Besuch der Projektmesse<br />
17:30 Uhr Thematischer Besuch ausgewählter Projekte <strong>in</strong> verschiedenen Leipziger<br />
Stadtteilen<br />
Thema 1: Beschäftigung<br />
Projekt „Kompetenzagentur“: IB Leipzig, Leipzig Eutritzsch<br />
Projekt zur Integration besonders benachteiligter <strong>Jugendliche</strong>r <strong>in</strong> Bildung,<br />
Ausbildung <strong>und</strong> Beschäftigung
Thema 2: Bildung<br />
Projekt „2. Chance“: Plan L e.V., Leipzig Connewitz<br />
Projekt zur Wiedere<strong>in</strong>gliederung von Schulverweigerern <strong>in</strong> die Schulen<br />
<strong>und</strong> Erhöhung ihrer Chancen auf e<strong>in</strong>en Schulabschluss<br />
Thema 3: Kulturelle Jugendarbeit<br />
Offener Jugendtreff: Geyserhaus e. V., Leipzig Eutritzsch<br />
Offener Jugendtreff mit erweiterten kulturellen, musischen <strong>und</strong> kreativen<br />
Angeboten, wie Theater <strong>und</strong> Klangspielplatz<br />
Thema 4: Offene Jugendarbeit<br />
Offene Angebote: Jugendclub Rabet, Leipzig Neuschönefeld<br />
Offene Angebote des Jugendclubs Rabet <strong>und</strong> weiterer Träger im<br />
Leipziger Osten, wie das LOS-Projekt für junge Mütter „Me<strong>in</strong> Weg<br />
zurück <strong>in</strong>s Berufsleben“<br />
Thema 5: Interkulturelle Arbeit<br />
Projekt „Interkulturelles Lager“, Leipzig Grünau<br />
Filmvorführung <strong>und</strong> Diskussion mit der 55. Mittelschule <strong>und</strong> der<br />
Regionalen Arbeitsstelle für Ausländerfragen (R AA)<br />
Thema 6: Lokale Strategien durch Small Grants<br />
Projekte „Entdeckertour – Erstellung e<strong>in</strong>es Stadtteilführers“ <strong>und</strong><br />
„Wir leben hier – Me<strong>in</strong>e neue Heimat Leipziger Osten“, Leipziger<br />
Osten<br />
Führung durch ausgewählte LOS-Projekte<br />
19:30 Uhr Ende des 2. Kongresstages<br />
Donnerstag, 28. Juni 2007<br />
Tagesmoderation Alexandra Tapprogge<br />
09:00 Uhr <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong> – Neue Strategien<br />
der Kohäsion<br />
Kar<strong>in</strong> Reiser, Abteilungsleiter<strong>in</strong> <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> Jugend, B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium<br />
für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend<br />
09:15 Uhr Perspektiven e<strong>in</strong>er europäischen Jugendpolitik aus der Sicht der Europäischen<br />
Kommission<br />
Karel Bartak, Referatsleiter Jugendpolitiken, Europäische Kommission,<br />
Generaldirektion Bildung <strong>und</strong> Jugend<br />
09:30 Uhr Nationale Politiken zur Integration von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n für<br />
soziale Brennpunkte im europäischen Vergleich<br />
• Prof. Howard Williamson, University of Glamorgan,<br />
Großbritannien<br />
• Dr. Christian Lüders, <strong>Deutsches</strong> Jugend<strong>in</strong>stitut<br />
10:15 Uhr Kaffeepause<br />
10:45 Uhr Präsentation der Ergebnisse der Arbeitsgruppen<br />
12:15 Uhr Der Mehrwert für europäische Kommunen, persönliche E<strong>in</strong>schätzung<br />
der Tagung • Ulrich Bohner, Kongress der Geme<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Regionen<br />
des Europarates • Brith Fäldt, Councillor of Pitea, Schweden<br />
12:45 Uhr Stimmen zum Fachkongress, e<strong>in</strong>gefangen durch das Quartiersfernsehen<br />
„Schillerplatz“, Ludwigshafen, Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz<br />
13:00 Uhr Ende des Kongresses<br />
11
Arbeitsgruppe 1: Bildung<br />
Präsentation Polen<br />
Marc<strong>in</strong> Sińczuch, Ph.D., Institut für<br />
Angewandte Sozialwissenschaften,<br />
Universität Warschau<br />
Grzegorz Mańko, Polnische <strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong><br />
Jugendstiftung, Warschau<br />
Dom<strong>in</strong>ika Walczak, Institut für<br />
Sozialforschung, Universität Warschau<br />
12<br />
v. l.: G. Mańko D. Walczak M. Sińczuch<br />
Programm „Equal Opportunities“<br />
– Verbesserung der Bildungschancen für <strong>Jugendliche</strong> <strong>in</strong><br />
ländlichen Räumen<br />
Benachteiligte Gebiete <strong>in</strong> Polen: Def<strong>in</strong>ition <strong>und</strong> Maßnahmen – Aus der<br />
Perspektive der Regierung<br />
Die Def<strong>in</strong>ition von „benachteiligten Gebieten“ ist im öffentlichen Diskurs <strong>in</strong> Polen durch<br />
zwei wesentliche Merkmale gekennzeichnet. „Rückständigkeit“ wird mit ländlichen Gebieten<br />
verb<strong>und</strong>en, die sich <strong>in</strong> bestimmten Teilen des Landes – nämlich dem Nordosten <strong>und</strong><br />
dem Südosten Polens – f<strong>in</strong>den.<br />
Obwohl die Anzahl der E<strong>in</strong>wohner <strong>in</strong> den ländlichen Gebieten Polens tendenziell s<strong>in</strong>kt<br />
<strong>und</strong> der Lebensstandard i. d. R. steigt, sche<strong>in</strong>en die Unterschiede zwischen den Lebensstandards<br />
<strong>in</strong> der Stadt <strong>und</strong> auf dem Land doch noch immer beträchtlich zu se<strong>in</strong>. Die negativen<br />
Auswirkungen der ländlichen Lage auf Bildung <strong>und</strong> Beschäftigungsgrad kann auf der<br />
Gr<strong>und</strong>lage von drei Haupt<strong>in</strong>dikatoren beschrieben werden:<br />
Zugang zu vorschulischer Bildung – In den ländlichen Gebieten Polens wesentlich<br />
schlechter als <strong>in</strong> den Städten. Im urbanen Umfeld übersteigt der durchschnittliche Anteil<br />
der <strong>K<strong>in</strong>der</strong> zwischen 3 <strong>und</strong> 5 Jahren, die <strong>in</strong> den Genuss e<strong>in</strong>er vorschulischen Bildung<br />
kommen, 52 %, wogegen er <strong>in</strong> ländlichen Gebieten bei knapp 16 % liegt.<br />
Leistung – Die schulischen Leistungen, gemessen anhand von verschiedenen Prüfungen<br />
<strong>und</strong> Tests, verdeutlichen die signifikanten Unterschiede zwischen den Schülern, die Schulen<br />
<strong>in</strong> den Städten besuchen bzw. dort leben (<strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> mittelgroßen <strong>und</strong> großen<br />
Städten) <strong>und</strong> jenen aus Dörfern.<br />
Arbeitslosenquote – Die Arbeitslosenquote der <strong>Jugendliche</strong>n auf dem Land ist jedoch<br />
vergleichbar mit der <strong>in</strong> der Stadt. Aber e<strong>in</strong>geschränkte Möglichkeiten, e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gerer Verdienst<br />
<strong>und</strong> H<strong>in</strong>dernisse im beruflichen Werdegang kennzeichnen die Situation der jungen<br />
Erwachsenen auf dem Lande. 2007 betrug die Arbeitslosenquote bei <strong>Jugendliche</strong>n zwischen<br />
18 <strong>und</strong> 19 Jahren auf dem Land 34 % (städtische <strong>Jugendliche</strong>: 33 %) <strong>und</strong> bei <strong>Jugendliche</strong>n<br />
zwischen 20 <strong>und</strong> 24 Jahren 24,8 % (städtische <strong>Jugendliche</strong>: 30 %).<br />
Das größte nationale Programm zur Egalisierung der Bildungschancen von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong><br />
<strong>Jugendliche</strong>n aus benachteiligten Gebieten ist e<strong>in</strong> Nationales Programm für die Jahre 2006<br />
bis 2008 „Befähigung <strong>und</strong> Unterstützung der lokalen Selbstverwaltung <strong>und</strong> von Nichtregie-
ungsorganisationen auf dem Gebiet der Egalisierung der Bildungschancen <strong>und</strong> -<br />
möglichkeiten von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n“.<br />
Die Ziele dieses Programms s<strong>in</strong>d:<br />
− Sensibilisierung von Eltern <strong>und</strong> Lehrern für die schulischen Bedürfnisse der<br />
<strong>K<strong>in</strong>der</strong>,<br />
− Entwicklung <strong>und</strong> Umsetzung regionaler oder lokaler Programme zur Egalisierung<br />
der Bildungschancen mit dem Schwerpunkt e<strong>in</strong>er Qualitätssteigerung des<br />
Bildungssystems <strong>und</strong> der E<strong>in</strong>führung von Lösungen, die die Wirksamkeit der<br />
Bildung <strong>und</strong> der Erziehung steigern,<br />
− Anpassung der Bildung an die Bedürfnisse e<strong>in</strong>er wissensbasierten Wirtschaft,<br />
− Umsetzung e<strong>in</strong>es neuen Modells für die Arbeit mit Schülern mit dem Fokus auf<br />
zunehmende Schlüsselkompetenzen <strong>und</strong> -fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen,<br />
später Arbeit zu f<strong>in</strong>den,<br />
− Vorbeugen e<strong>in</strong>es Schulabbruchs trotz Schulpflicht oder des Verlassens der<br />
Schule auf e<strong>in</strong>em niedrigeren Bildungsstand,<br />
− Verstärken der erzieherischen Funktion von Schule, Familie <strong>und</strong> lokaler Geme<strong>in</strong>de,<br />
− Gestalten der Freizeit der Schüler, <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> den Sommerferien,<br />
− Aufbau von Abteilungen der örtlichen Verwaltung zur Entwicklung <strong>und</strong><br />
Durchführung von Bildungsprogrammen sowie für die Beantragung von EU-<br />
Fördermitteln.<br />
Das hier vorgestellte Programm geht davon aus, dass die voranstehend dargelegten Ziele<br />
von lokalen Regierungs<strong>in</strong>stitutionen umgesetzt werden, wogegen die Institutionen der<br />
Staatsregierung (Vertretungen der Woiwodschaften) <strong>in</strong> diesem Fall e<strong>in</strong>e Rolle als Kreditgeber<br />
spielen.<br />
Die Idee des Projektes ist e<strong>in</strong>deutig von den Verfahren <strong>in</strong>spiriert, die seit Jahren im<br />
Nichtregierungsbereich bzw. <strong>in</strong> europäischen Programmen Anwendung f<strong>in</strong>den: Bestimmen<br />
von Prioritäten, Entwicklung <strong>und</strong> Durchführung der Projekte/Programme, Ernennung<br />
e<strong>in</strong>es Bewertungsausschusses, Vorbereitung von Berichten <strong>und</strong> Auswertung.<br />
Die Vorteile e<strong>in</strong>er solchen Lösung s<strong>in</strong>d die Flexibilität des Programms, die Möglichkeit,<br />
es an die lokalen Bedürfnisse anzupassen, klare Regeln. Die Regierung sammelt bei Auftreten<br />
von Problemen bei der Umsetzung des Programms Informationen <strong>und</strong> reagiert umgehend.<br />
E<strong>in</strong> Beispiel hierfür ist die Änderung des Beitrags der lokalen Verwaltung von 50 %<br />
auf 30 %. Der im Pilotprogramm geforderte Anteil erwies sich als zu hoch, was dazu führte,<br />
dass die lokalen Behörden e<strong>in</strong>en Großteil dieser Ressourcen nicht verwendeten.<br />
Das Beispiel verdeutlicht wichtige Punkte, die mit dem Funktionieren des Projektes zusammenhängen,<br />
bei dem zentrale <strong>und</strong> lokale Aspekte verb<strong>und</strong>en werden. Zusammengefasst<br />
ließe sich Folgendes sagen: Die Unterstützung auf zentraler Ebene sollte <strong>in</strong> der Entwicklung<br />
universeller <strong>und</strong> dennoch flexibler Instrumente <strong>und</strong> Verfahren bestehen, die <strong>in</strong><br />
lokalen Geme<strong>in</strong>den verwendet werden können, um Barrieren, Ungleichheiten <strong>und</strong> Bedürfnisse<br />
<strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>enen Maßnahmen <strong>und</strong> Möglichkeiten professionell zu ermitteln.<br />
Zweitens sollte die zentrale Regierung wo erforderlich helfen, Perspektiven auszutauschen<br />
sowie Horizonte <strong>und</strong> Ideendatenbanken dah<strong>in</strong>gehend zu erweitern, wie Bildungs<strong>und</strong><br />
Lebensmöglichkeiten von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n egalisiert werden können. Drittens<br />
ist es die Aufgabe der zentralen Regierung, funktionierende Kommunikationssysteme<br />
13
<strong>und</strong> Mechanismen für den Erfahrungsaustausch aufzubauen, die alle Projektteilnehmer<br />
mite<strong>in</strong>ander verb<strong>in</strong>den. Und schließlich ist die zentrale Regierung h<strong>in</strong>sichtlich der Umsetzung<br />
der Beurteilungs- <strong>und</strong> Bewertungsverfahren für die Projekte verantwortlich. Diese<br />
Verfahren sollen sich nicht nur auf die Kontrolle konzentrieren, sondern wichtiger noch<br />
darauf, den lokalen Regierungen <strong>und</strong> NGOs, die spezielle Maßnahmen durchführen, e<strong>in</strong><br />
Feedback zu geben. Die lokale Regierung <strong>und</strong> lokale NGOs sollten dabei e<strong>in</strong>e kluge, kontextbezogene<br />
Unterstützung erhalten, die eher aus e<strong>in</strong>er Reihe von Instrumenten besteht<br />
als aus vorgefertigten Lösungen. In den Geme<strong>in</strong>den sollten verschiedene Formen des Dialogs<br />
gefördert werden, die die Stimme der jungen Menschen, ihrer Eltern <strong>und</strong> Vertreter<br />
jener Institutionen e<strong>in</strong>b<strong>in</strong>den, die für <strong>und</strong> mit jungen Menschen arbeiten.<br />
Die Perspektive der Nichtregierungsorganisationen: „Equal Opportunities“-Programm<br />
Das „Equal Opportunities“-Programm der Polnisch-Amerikanischen Stiftung für Freiheit<br />
[Polish-American Freedom Fo<strong>und</strong>ation] wird von e<strong>in</strong>er Nichtregierungsorganisation, der Polnischen<br />
<strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendstiftung, geleitet. Das Programm wurde zum ersten Mal im Jahr<br />
2001 durchgeführt.<br />
Zweck des „Equal Opportunities“-Programms ist es, Maßnahmen zu unterstützten, die<br />
auf e<strong>in</strong>e Stärkung der Gesellschaft aktiver, junger Menschen abzielen. Menschen, die sich<br />
der Tatsache bewusst s<strong>in</strong>d, dass sie ihr Schicksal selbst <strong>in</strong> die Hand nehmen können, gestalten<br />
ihre eigene Zukunft. Wir versuchen Lebensbed<strong>in</strong>gungen zu schaffen, die es den jungen<br />
Menschen <strong>in</strong> ländlichen Gegenden <strong>und</strong> kle<strong>in</strong>en Städten ermöglichen, sich so zu entwickeln,<br />
wie die <strong>Jugendliche</strong>n aus den großen Städten.<br />
Es ist möglich, <strong>und</strong> es muss erreicht werden, dass die <strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n aus verschiedenen<br />
Bildungsangeboten von mehr als e<strong>in</strong>er Institution oder Organisation auswählen<br />
können. In den meisten polnischen Dörfern bietet die Schule als e<strong>in</strong>zige Institution Bildungsmaßnahmen<br />
an. Aus unserer Sicht sollte es <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er gut funktionierenden Geme<strong>in</strong>de<br />
auch e<strong>in</strong> Kulturzentrum geben, e<strong>in</strong>e Kirche mit Angeboten für <strong>Jugendliche</strong> <strong>und</strong> letzten<br />
Endes auch kle<strong>in</strong>e, lokale Organisationen. Diese spielen im Bereich der Bildung e<strong>in</strong>e außerordentlich<br />
wichtige Rolle.<br />
Dann gibt es noch e<strong>in</strong>e andere wichtige Bed<strong>in</strong>gung, die wir erfüllen sollten, um Bildungsmöglichkeiten<br />
gerechter gestalten zu können. Junge Menschen sollten als „Subjekt“<br />
<strong>und</strong> nicht als „Objekt“ unserer Maßnahmen behandelt werden.<br />
Die Annahme, dass das größte Problem des polnischen Bildungswesens Geldmangel ist,<br />
ist <strong>in</strong> Polen weit verbreitet. Tatsächlich stimmt das aber nicht. Es ist nicht wahr, dass wir<br />
mit Geld kohärente Strategien gestalten können. Es ist nachgewiesen, dass Geld nur dann<br />
richtig e<strong>in</strong>gesetzt wird, wenn es für wertvolle Projekte verwendet wird. Aus diesem Gr<strong>und</strong><br />
wurde die f<strong>in</strong>anzielle Unterstützung des „Equal Opportunities“-Programms von e<strong>in</strong>er Vielzahl<br />
von gr<strong>und</strong>legenden Schulungen, Beratungen <strong>und</strong> Treffen der Programmleiter begleitet.<br />
Maßnahmen, die im Rahmen des Programms ergriffen werden, können <strong>in</strong> drei gleiche<br />
Bereiche unterteilt werden. Der erste Bereich s<strong>in</strong>d die Kredite (von 2.000 bis 5.000 € pro<br />
Jahr). In der 6-jährigen Programmlaufzeit haben wir über 3 Millionen € <strong>in</strong> über 1.000 Projekten<br />
vergeben. Dieses Jahr planen wir, weitere 500.000 € <strong>in</strong> 200 Projekte zu <strong>in</strong>vestieren.<br />
14
Der zweite Bereich ist die gr<strong>und</strong>legende Unterstützung für Menschen, die Projekte umsetzen<br />
(Akademie des Equal Opportunities-Programms). Die Ziele der Akademie liegen <strong>in</strong><br />
der Organisation von Schulungen <strong>und</strong> Beratungen <strong>und</strong> der Förderung der wertvollsten, im<br />
Rahmen des „Equal Opportunities“-Programms, umgesetzten Projekte. Im Jahr 2006 haben<br />
wir die Bibliothek des Equal Opportunities-Programms gegründet. Drei Bücher wurden<br />
veröffentlicht: Leitfäden über bewährte Verfahren, die die Umsetzung ausgewählter<br />
Projekt <strong>in</strong> neuen Geme<strong>in</strong>den ermöglichen.<br />
Die dritte Komponente der Programmstruktur ist das Führungsnetzwerk. Dabei handelt<br />
es sich um e<strong>in</strong>e virtuelle Geme<strong>in</strong>de von Menschen, die Projekte umsetzen.<br />
Die Schwerpunktsetzung auf substanzielle Werte der Projekte hat dazu geführt, dass unsere<br />
Methode das Interesse nicht nur lokaler Organisationen geweckt hat, sondern auch<br />
von Institutionen, die auf nationaler Ebene agieren. Zum Beispiel der Organisatoren des<br />
landesweiten Programms „School of equal opportunities“ [Schule gleicher Möglichkeiten], das<br />
aus dem Europäischen Sozialfonds f<strong>in</strong>anziert wird.<br />
Die Ergebnisse unserer Aktivitäten können auf drei Ebenen betrachtet werden. Die<br />
Projektteilnehmer erhalten die Möglichkeit, wichtige Fähigkeiten zu entwickeln – mehr als<br />
250.000 junge Menschen haben an den gestifteten Projekten teilgenommen. Menschen, die<br />
Projekte umsetzen, erhalten Zugang zu wertvoller Erfahrung <strong>und</strong> dem erforderlichen Wissen.<br />
Das betrifft ca. 500 Menschen, die Projekte durchführen. Und schließlich erhalten die<br />
Geme<strong>in</strong>den, <strong>in</strong> denen die Projekte durchgeführt werden, die Chance, aus den Beispielen<br />
der Egalisierung von Bildungsmöglichkeiten zu lernen. So wurden auch aufgr<strong>und</strong> unserer<br />
Projekte mehr als 100 Nichtregierungsorganisationen gegründet.<br />
Die Bildungsreform von 1999 als e<strong>in</strong> Instrument (?) zur Egalisierung<br />
von Bildungsmöglichkeiten 1<br />
Die Reform <strong>in</strong> Kürze<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Ziele der Reform von 1999:<br />
− Steigerung des Bildungsniveaus der Gesellschaft durch Förderung der Sek<strong>und</strong>är-<br />
<strong>und</strong> der höheren Bildung,<br />
− Egalisierung von Bildungsmöglichkeiten,<br />
− Maßnahmen zur Qualität der Bildung, die als e<strong>in</strong> wesentlicher Bestandteil des<br />
Erziehens betrachtet wird.<br />
E<strong>in</strong> ernstes Problem des polnischen Bildungssystems vor der Reform von 1999 war der<br />
kont<strong>in</strong>uierliche Rückgang der Anzahl von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n im Schulalter, der auf die demografische<br />
Entwicklung zurückzuführen war.<br />
Die Schulen wurden immer leerer, die Kosten für ihren Unterhalt blieben jedoch gleich.<br />
Es war nötig, die Leitung der Schulen <strong>in</strong> den lokalen Regierungen zu koord<strong>in</strong>ieren.<br />
Andere Probleme waren: Das ungleiche Unterrichtsniveau <strong>in</strong> den unterschiedlichen<br />
Schulen, die ungleiche Verteilung von Bildungsmöglichkeiten junger Menschen mit unter-<br />
1 Die nachfolgende Charta basiert auf e<strong>in</strong>er Studie, die die Autoren unter Lehrern durchgeführt haben. Die Ergebnisse<br />
dieser Studie s<strong>in</strong>d zu f<strong>in</strong>den bei: Walczak D., Zahorska M. 2006: Krajobraz po .reformie. Op<strong>in</strong>ie nauczycieli na temat<br />
reformy edukacji z 1999 roku, Wrocław <strong>und</strong> werden veröffentlicht bei: Zahorska M., Walczak D., O osobliwościach<br />
nauczycielskiej duszy w: Nowak A., W<strong>in</strong>kowska-Nowak K., Rycielska L., Szkoła w dobie <strong>in</strong>ternetu (im Druck).<br />
15
schiedlichen H<strong>in</strong>tergründen <strong>und</strong> der ger<strong>in</strong>ge Anteil von Schülern an allgeme<strong>in</strong>en weiterführenden<br />
Schulen <strong>und</strong> derer, die die Universität besuchten.<br />
Als Lösung für viele dieser Probleme wurde e<strong>in</strong>e Änderung des Schulsystems vorgeschlagen.<br />
Statt des alten Systems – 8 Jahre Gr<strong>und</strong>schule + 4 Jahre weiterführende Schule,<br />
wurde es geändert <strong>in</strong> 6 Jahre Gr<strong>und</strong>schule + 3 Jahre weiterführende Schule gimnazjum + 3<br />
Jahre höhere Gymnasialstufe. Die E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>er höheren Gymnasialstufe hatte, so<br />
schien es, e<strong>in</strong>e gr<strong>und</strong>legende Bedeutung für die Egalisierung der Bildungschancen. Den<br />
höheren Gymnasialstufen wurde e<strong>in</strong>e besonders gute Ausstattung versprochen, sodass sie<br />
wirklich als Orte fungieren können, an denen die jungen Menschen gleich s<strong>in</strong>d.<br />
Me<strong>in</strong>ungen der Lehrer über die Reform von 1999<br />
Den Lehrern zufolge waren die Ziele <strong>und</strong> Mittel der Reform von Anfang an unrealistisch.<br />
Viele Schüler können nicht mit e<strong>in</strong>em neuen, unbekannten Schulumfeld umgehen.<br />
Besuchen <strong>K<strong>in</strong>der</strong> mit unterschiedlichen H<strong>in</strong>tergründen e<strong>in</strong>e Schule, kann das zu e<strong>in</strong>er<br />
Egalisierung der Chancen führen, vorausgesetzt, die Schüler mit unterschiedlichen H<strong>in</strong>tergründen<br />
nehmen mite<strong>in</strong>ander Kontakt auf <strong>und</strong> kooperieren. In der Realität können dabei<br />
leider viele H<strong>in</strong>dernisse auftreten: E<strong>in</strong>s davon ist e<strong>in</strong> nicht funktionierendes Schulbussystem.<br />
Es gibt nicht genügend Schulbusse, der Fahrplan ist nicht kompatibel mit außerschulischen<br />
Kursen, was zur E<strong>in</strong>führung getrennter Klassen führt – solcher für lokale <strong>und</strong> solcher<br />
für pendelnde <strong>K<strong>in</strong>der</strong>. Das verstärkt die Gegensätze zwischen diesen beiden Gruppen<br />
von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>in</strong>tensiviert die Entfremdung der pendelnden <strong>K<strong>in</strong>der</strong>.<br />
Schulen <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>en Städten oder Dörfern verfügen über weniger f<strong>in</strong>anzielle Mittel für<br />
außerschulische Aktivitäten oder zusätzliche Kurse. Aus diesem Gr<strong>und</strong> nimmt das Missverhältnis<br />
zwischen Schülern aus den Dörfern <strong>und</strong> Städten zu, <strong>in</strong>sbesondere weil Letztere<br />
häufig kostenpflichtige Privatkurse besuchen.<br />
Schüler, die eigentlich <strong>in</strong> Klassen mit weniger als 20 Schülern unterrichtet werden sollen,<br />
werden häufig <strong>in</strong> Klassen gesteckt, <strong>in</strong> denen mehr als 30 oder 40 <strong>K<strong>in</strong>der</strong> sitzen.<br />
Die Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen stehen der Notwendigkeit e<strong>in</strong>er Egalisierung der Bildungsmöglichkeiten<br />
entgegen.<br />
Als Folge der Reform stieg die Anzahl der Schüler an allgeme<strong>in</strong>bildenden weiterführenden<br />
Schulen. Derzeit ist e<strong>in</strong> großer Anteil der Schüler an allgeme<strong>in</strong>bildenden weiterführenden<br />
Schulen <strong>in</strong>tellektuell oder mental nicht ausreichend vorbereitet, um an solchen Schulen<br />
zu lernen. Das Niveau der allgeme<strong>in</strong>bildenden Gymnasien sank sichtbar, wobei die Ausbildung<br />
<strong>in</strong> der neuen Art von Gymnasien, sogenannten „Profil“-Gymnasien, unter jedem<br />
Qualitätsstandard liegt. Die E<strong>in</strong>führung der Profil-Gymnasien wird mit Blick auf die Qualität<br />
der Schulbildung <strong>und</strong> der gleichen Gestaltung von Bildungsmöglichkeiten, <strong>in</strong>sbesondere<br />
von Möglichkeiten, e<strong>in</strong>e Neue Matura abzulegen (e<strong>in</strong>e standardisierte Prüfung nach der<br />
E<strong>in</strong>führung des Gymnasiums 2005) als etwas Künstliches <strong>und</strong> Negatives wahrgenommen.<br />
16
Zusammenfassung<br />
Die Me<strong>in</strong>ung der Lehrer der weiterführenden Schulen <strong>und</strong> der gymnasialen Oberstufe zur<br />
Bildungsreform von 1999 ist e<strong>in</strong>deutig negativ <strong>und</strong> pessimistisch. Alle Lehrer, mit denen<br />
wir gesprochen haben, hatten Probleme damit, der Reform auch nur e<strong>in</strong>e positive Seite<br />
abzugew<strong>in</strong>nen, wogegen es ihnen nicht schwer fiel, die negativen Punkte aufzuzählen. Lehrer<br />
haben den E<strong>in</strong>druck, dass Sie materiell zurückstecken müssen, weniger respektiert werden<br />
<strong>und</strong> die soziale Bedeutung ihres Berufsstands nicht anerkannt wird. Gleichzeitig s<strong>in</strong>d<br />
die Erwartungen der Schüler, Eltern <strong>und</strong> Direktoren an die Lehrer hoch.<br />
Die Lehrer glauben, dass e<strong>in</strong> Gr<strong>und</strong> für die Mängel der Bildungsreform von 1999 dar<strong>in</strong><br />
besteht, dass zu wenig Lehrer <strong>in</strong> die Entwicklung der Reform <strong>in</strong>volviert waren. Sie behaupten,<br />
dass e<strong>in</strong>e solch lange Liste von Schwachpunkten der Reform das Ergebnis e<strong>in</strong>er mangelnden<br />
Kooperation zwischen den Gestaltern der Reform <strong>und</strong> den Lehrern ist, deren e<strong>in</strong>zige<br />
Rolle bei der Reform dar<strong>in</strong> bestand, sie <strong>in</strong> die Praxis umzusetzen.<br />
17
Präsentation Portugal<br />
Pedro Calado, nationaler Koord<strong>in</strong>ator<br />
„Escolhas“, Lissabon<br />
Nuno Christova, Projekt Cool-<br />
Generation, Monte de Caparica<br />
Maria Virg<strong>in</strong>ia Sousa, Instituto National di<br />
Habitas, Lissabon<br />
18<br />
P. Calado N. Christova M.V. Sousa<br />
Programm „Escolhas“ –<br />
Verbesserung der Chancengleichheit <strong>und</strong> <strong>sozialen</strong> Integration<br />
Interventionsstrategien<br />
Nationale Pläne<br />
Wie werden benachteiligte <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> verstanden <strong>und</strong> <strong>in</strong> den übergreifenden<br />
nationalen Plänen betrachtet?<br />
PNAI (Nationaler Aktionsplan für Soziale E<strong>in</strong>gliederung)<br />
Der Nationale Aktionsplan gegen Armut <strong>und</strong> für soziale E<strong>in</strong>gliederung wurde als Reaktion<br />
auf die geme<strong>in</strong>samen, vom Europäischen Rat von Lissabon (März 2000) vere<strong>in</strong>barten<br />
Ziele zu Armut <strong>und</strong> sozialer Ausgrenzung entwickelt <strong>und</strong> <strong>in</strong> den Nationalen Bericht zu<br />
Sozialschutz <strong>und</strong> sozialer E<strong>in</strong>gliederung (2006 bis 2008) aufgenommen, der den Nationalen<br />
Aktionsplan zur E<strong>in</strong>gliederung für 2006 bis 2007 be<strong>in</strong>haltet.<br />
PNACE (Portugiesisches Nationales Aktionsprogramm für Wachstum <strong>und</strong> Beschäftigung<br />
2005 bis 2008)<br />
Das Nationale Aktionsprogramm für Wachstum <strong>und</strong> Beschäftigung 2005 bis 2008 ist<br />
die Reaktion der portugiesischen Regierung auf die durch die erneuerte Lissabonner Strategie<br />
vorgeschlagenen Herausforderungen. Dabei handelt es sich um e<strong>in</strong>en <strong>in</strong>tegrierten Satz<br />
von 125 Schlüsselmaßnahmen zur Transformation <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Reform, die der wirtschaftlichen<br />
<strong>und</strong> <strong>sozialen</strong> Situation angepasst ist <strong>und</strong> den Schwerpunkt auf drei Bereiche legt:<br />
Makroökonomie, Mikroökonomie <strong>und</strong> Qualifikation, Beschäftigung <strong>und</strong> sozialer Zusammenhalt.<br />
Dabei handelt es sich um e<strong>in</strong> wesentliches Programm der Modernisierung mit sektoralen<br />
Programmen quer durch alle Bereiche, <strong>in</strong>sbesondere dem Stabilitäts- <strong>und</strong> Wachstumsprogramm<br />
(PEC), dem Technologieplan (PT) <strong>und</strong> dem Nationalen Beschäftigungsplan (PNE).<br />
PNE (Nationaler Aktionsplan für Beschäftigung)<br />
Der PNE basiert auf den EU-Richtl<strong>in</strong>ien im Bereich Beschäftigung. Er wendet diese<br />
Richtl<strong>in</strong>ien auf die portugiesische Realität an. Der NAP 2005-2008, der Teil des Nationalen<br />
Aktionsprogramms für Wachstum <strong>und</strong> Beschäftigung ist, zielt darauf ab, den Schwierigkeiten<br />
der wirtschaftlichen Situation oder den strukturellen E<strong>in</strong>schränkungen, die die Entwicklung<br />
des Beschäftigungssystems <strong>und</strong> damit e<strong>in</strong>hergehend die Entwicklung des Landes<br />
verlangsamen, auf <strong>in</strong>tegrierte <strong>und</strong> kohärente Weise mit makro- <strong>und</strong> mikroökonomischen<br />
Politiken zu begegnen.
H<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>em lokalen Ansatz: Aktive Partnerschaften zur <strong>sozialen</strong> E<strong>in</strong>gliederung zwischen<br />
Staat <strong>und</strong> Zivilgesellschaft<br />
In Portugal hat die Integration des Kampfes gegen Armut <strong>und</strong> soziale Ausgrenzung <strong>in</strong> die<br />
aktive Sozialpolitik der vergangenen Jahre e<strong>in</strong> Engagement für aktive Partnerschaften zwischen<br />
dem Staat <strong>und</strong> der Zivilgesellschaft gefördert, die auf die Verhandlung, E<strong>in</strong>igung <strong>und</strong><br />
die geteilte Verantwortung für e<strong>in</strong>e effektivere Umsetzung dieser Maßnahmen abzielt. Gute<br />
Beispiele für diese Praxis der E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> Involvierung s<strong>in</strong>d Partnerschaften (nationale,<br />
regionale oder lokale) mit dem Ziel, durch die Koord<strong>in</strong>ation der Fähigkeiten Synergien<br />
r<strong>und</strong> um geme<strong>in</strong>same Ziele zu bilden. Dazu gehören der Kampf gegen Armut <strong>und</strong> soziale<br />
Ausgrenzung <strong>und</strong> die Konsolidierung des <strong>sozialen</strong> Zusammenhalts.<br />
Soziales Netzwerk-Programm<br />
Das Soziale Netzwerkprogramm ist e<strong>in</strong> strukturelles Programm <strong>und</strong> wesentliches Instrument<br />
für die lokale Entwicklung, <strong>und</strong> zwar durch die Umsetzung Geme<strong>in</strong>de-basierter<br />
strategischer Planungsverfahren, die e<strong>in</strong>e Gr<strong>und</strong>lage für soziale Intervention bilden. In diesen<br />
Verfahren ist es erforderlich, zusammengetragene Sozialdiagnosen zu verwenden, e<strong>in</strong><br />
lokales Informationssystem zu implementieren <strong>und</strong> e<strong>in</strong>en <strong>sozialen</strong> Entwicklungsplan zu<br />
organisieren.<br />
Die Konsolidierung dieser Netzwerke, die effektive <strong>und</strong> dynamische Partnerschaften<br />
se<strong>in</strong> sollen, ist <strong>in</strong> den Lokalen Sozialen Aktionskomitees (CLAS, auf Geme<strong>in</strong>deebene) <strong>und</strong><br />
den Kirchlichen Sozialausschüssen (CSF) umgesetzt; Plattformen für die Planung <strong>und</strong> Koord<strong>in</strong>ation<br />
von lokaler sozialer Intervention, die <strong>in</strong> der Lage s<strong>in</strong>d, alle Bürger zu mobilisieren.<br />
Nationale Kommission für den Schutz von gefährdeten <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n<br />
Die Kommissionen für den Schutz von gefährdeten <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n s<strong>in</strong>d<br />
nicht richterliche, offizielle Institutionen, die funktional autonom s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> mit dem Ziel<br />
handeln, die Rechte von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n zu fördern <strong>und</strong> Gefahrensituationen<br />
von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n zu verh<strong>in</strong>dern bzw. zu beenden.<br />
Diese Schutzausschüsse basieren auf der Partizipation der Geme<strong>in</strong>schaft <strong>und</strong> der lokalen<br />
Regierung, was <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Partnerschaft zwischen den Institutionen <strong>und</strong> Ressorts zum<br />
Ausdruck kommt, die die lokalen Dynamiken zugunsten der Prävention <strong>und</strong> des Schutzes<br />
von risikogefährdeten <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n nutzen.<br />
Bildungsgebiete prioritärer Intervention<br />
Zwischen den Schuljahren 1996/97 <strong>und</strong> 1998/1999 wurde e<strong>in</strong> Experiment <strong>in</strong> Bezug auf<br />
e<strong>in</strong>e andere Art der Beziehung zwischen den drei Schulformen <strong>und</strong> der Vorschulbildung<br />
durchgeführt. Diese bezogen sich auf territórios educativos de <strong>in</strong>tervenção prioritária<br />
(TEIP), die sich <strong>in</strong> den Gegenden mit den schwersten <strong>sozialen</strong>, wirtschaftlichen <strong>und</strong> kulturellen<br />
Problemen mit e<strong>in</strong>er großen Anzahl von Schülern, die <strong>in</strong> bestimmte Bildungs-<br />
Fördermaßnahmen e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d <strong>und</strong>/oder mit multikulturellem Integrationsbedarf,<br />
bef<strong>in</strong>den. Diese Initiative wurde 2006/2007 wieder aufgenommen <strong>und</strong> zwar mit dem Ziel<br />
lokale Projekte zu entwickeln, um die Qualität der Bildung <strong>und</strong> die Förderung des gleichberechtigten<br />
Zugangs zu Schule <strong>und</strong> Erfolg zu verbessern.<br />
Besondere Ziele: Verbesserung des Bildungsumfelds <strong>und</strong> der Qualität des Lernens unter<br />
Schülern, <strong>in</strong>tegrierte <strong>und</strong> koord<strong>in</strong>ierte Vision der Schulpflicht, die e<strong>in</strong>e engere Beziehung<br />
19
zwischen den drei verschiedenen Schulformen der Gr<strong>und</strong>bildung <strong>und</strong> Vorschulbildung<br />
begünstigt; Gestaltung von Bed<strong>in</strong>gungen, die den Kontakt zwischen Schulen <strong>und</strong> Arbeitsleben<br />
erleichtern; progressive Koord<strong>in</strong>ation von Bildungspolitiken <strong>und</strong> Koord<strong>in</strong>ation der<br />
Erfahrungen der Schulen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em bestimmten geografischen Gebiet mit den umliegenden<br />
Geme<strong>in</strong>den.<br />
Programme <strong>und</strong> Maßnahmen <strong>in</strong> gefährdeten Gegenden, Arbeit mit <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n<br />
<strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n<br />
Choices Programm<br />
Das Choices-Programm ist als e<strong>in</strong>e Reaktion auf den Anstieg der Jugendkrim<strong>in</strong>alität zu<br />
verstehen, der im August 2000 e<strong>in</strong> massives Medien<strong>in</strong>teresse gef<strong>und</strong>en hatte. Die Existenz<br />
von gefährlichen Gruppen mit schwierigen <strong>sozialen</strong> H<strong>in</strong>tergründen, meist aus benachteiligten<br />
Stadtteilen, führte zur M<strong>in</strong>isterentscheidung 108/2000 die die Weichen für zwei Reaktionsweisen<br />
stellte: erstens die notwendigen Bed<strong>in</strong>gungen für die Umsetzung e<strong>in</strong>es neuen<br />
<strong>K<strong>in</strong>der</strong>schutzgesetzes <strong>und</strong> e<strong>in</strong>es Jugendstrafrechts (1999) zu schaffen, die die Opfer von<br />
den jugendlichen Straftätern separieren, <strong>und</strong> zweitens Prävention – delegiert an die nationale<br />
Kommission für den <strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendschutz, die Entwicklung von Programmen mit<br />
dem Ziel der Krim<strong>in</strong>alitätsprävention <strong>und</strong> der Integration der <strong>Jugendliche</strong>n aus den am<br />
meisten benachteiligten Gebieten <strong>in</strong> Lissabon – Oporto <strong>und</strong> Setúbal. So ist das Choices-<br />
Programm <strong>in</strong>s Leben gerufen worden.<br />
E<strong>in</strong> besonderer Schwerpunkt wurde <strong>in</strong> der Präsentation auf e<strong>in</strong>s der 120 lokalen f<strong>in</strong>anzierten<br />
Projekte gelegt: „Cool Generation“-Project aus Almada <strong>in</strong> den Vororten von Lissabon.<br />
Initiative Kritische Urbane Gebiete<br />
Dies ist e<strong>in</strong> Nationales Programm, das vom Staatsm<strong>in</strong>ister für Landplanung <strong>und</strong> Städte<br />
geleitet wird <strong>und</strong> e<strong>in</strong> Instrument der Städtepolitik ist.<br />
Ziel ist es, <strong>in</strong> Gegenden zu <strong>in</strong>tervenieren, die kritische Schwachpunkte aufweisen <strong>und</strong> <strong>in</strong>tegrierte<br />
sozial-territoriale Maßnahmen zu ergreifen. Es begann mit e<strong>in</strong>er Versuchsphase <strong>in</strong><br />
drei Gegenden (Cova da Moura – Madora; Lagarteiro – Porto <strong>und</strong> Vale da Amoreira –<br />
Moita): In die Initiative waren sieben M<strong>in</strong>isterien <strong>in</strong>volviert (Präsident, Umwelt, Arbeit <strong>und</strong><br />
soziale Sicherheit, Inneres, Ges<strong>und</strong>heit, Bildung <strong>und</strong> Kultur), derzeit beteiligen sich jedoch<br />
91 Institutionen/Organisationen/lokale Verbände mit Plänen, die auf e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen<br />
Diagnose basieren <strong>und</strong> von der Gruppe der lokalen Partner erstellt wurden.<br />
Beide Programme s<strong>in</strong>d durch Folgendes gekennzeichnet:<br />
− Ziel der Intervention ist die E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung der benachteiligten <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n,<br />
− Aktive Partnerschaften mit Staat, lokalen Organisationen <strong>und</strong> der Zivilgesellschaft,<br />
− Übergreifendes, geteiltes, partizipatives, gebietsübergreifendes <strong>und</strong> auf mehreren<br />
Ebenen agierendes Führungssystem mit e<strong>in</strong>er Reihe von nationalen, regionalen<br />
<strong>und</strong> lokalen Akteuren,<br />
− Integrierte Projekte mit sozial-territorialer Gr<strong>und</strong>lage,<br />
− Mobilisieren von Projekten mit voraussichtlich strukturellen Auswirkungen,<br />
20
− Von Innovationen geleitete Interventionen,<br />
− Strategische Koord<strong>in</strong>ation <strong>und</strong> Teilhabe lokaler Akteure.<br />
Fragen für die Diskussion <strong>in</strong> der Arbeitsgruppe<br />
− Wie können verschiedene Akteure <strong>in</strong>volviert werden (Staat, lokale Organisationen<br />
<strong>und</strong> Geme<strong>in</strong>schaften), um den Schwerpunkt der Maßnahmen auf das Gebiet<br />
zu verlagern?<br />
− Wie kann von e<strong>in</strong>er nationalen Strategie <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er Reihe sektoraler Maßnahmen<br />
zu e<strong>in</strong>er auf e<strong>in</strong>e Gegend (Bereich, Ort, etc.) konzentrierte Maßnahme übergegangen<br />
werden?<br />
− Wie kann e<strong>in</strong> kohärenter <strong>und</strong> gut <strong>in</strong>tegrierter Rahmen für die Vielzahl der Mechanismen<br />
<strong>und</strong> Akteure bereitgestellt werden?<br />
− Wie wird die Vielseitigkeit der lokalen Partnerschaften rational gestaltet <strong>und</strong> organisiert,<br />
wobei die vielschichtigen Strukturen unterliegenden Ausrichtungen<br />
<strong>und</strong> die Möglichkeit gewahrt werden, an der Gestaltung, Planung, Umsetzung<br />
<strong>und</strong> Beurteilung von Sozialpolitiken teilzunehmen.<br />
Berichterstattung AG 1: Bildung<br />
Peter Bischoff<br />
E<strong>in</strong>führung<br />
Im Workshop 1 g<strong>in</strong>g es um das Thema Bildung <strong>und</strong> Bildungschancen.<br />
Präsentiert wurden hierbei Beiträge aus Polen <strong>und</strong> Portugal.<br />
Die polnische Präsentation bezog sich auf die Vorstellung des im Rahmen der ‚nationalen<br />
Jugendstrategie’ gegenwärtig laufenden, nationalen Programms ‚Elicitation and support<br />
for Local Self-Government and Non-Governmental Organizations <strong>in</strong> the field of equal<strong>in</strong>g<br />
educational chances and opportunities of children and youth’ (2006-2008), welches sich<br />
<strong>in</strong>sbesondere der Angleichung der Bildungschancen von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> Polen<br />
widmet. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf ländliche Regionen <strong>und</strong> Geme<strong>in</strong>den. Des<br />
Weiteren wurde das seit 2001 laufende, außerstaatliche, von der polnisch-amerikanischen<br />
Stiftung ‚Freedom Fo<strong>und</strong>ation’ getragenen Programm ‚Equal Opportunities’ vorgestellt.<br />
Im Rahmen der portugiesischen Präsentation wurden drei Programmbauste<strong>in</strong>e der Nationalen<br />
Strategie im Umgang mit <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> benachteiligten Gebieten<br />
vorgestellt (‚Choices Programme’/ ‚Cool Generation Project’/ ‚Critical Urban Areas Initiative’),<br />
die sich schwerpunktmäßig auf Regionen <strong>und</strong> Gebiete beziehen, die seit 1975 e<strong>in</strong>er<br />
starken Zuwanderung aus ehemaligen Kolonialländern unterliegen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e hohe Konzentration<br />
von Familien mit Migrationsh<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> aufweisen.<br />
Geme<strong>in</strong>samkeiten<br />
Als Geme<strong>in</strong>samkeiten der jeweiligen nationalen Vorgehensweisen kann die E<strong>in</strong>bettung <strong>und</strong><br />
Verankerung der vorgestellten Programme <strong>und</strong> Programmbauste<strong>in</strong>e <strong>in</strong> Nationale Strategien<br />
hervorgehoben werden, die von Akteuren verschiedener Regierungsgremien <strong>und</strong> -<br />
<strong>in</strong>stitutionen, von lokalen Adm<strong>in</strong>istrationen sowie von unabhängigen Organisationen<br />
(NGO’s) getragen <strong>und</strong> umgesetzt werden.<br />
21
Unterschiede<br />
Unterschiede zwischen beiden Ländern zeigten sich vor allem bei der Def<strong>in</strong>ition der Zielgruppen<br />
<strong>und</strong> Zielstellungen sowie im H<strong>in</strong>blick auf die Umsetzung <strong>und</strong> Steuerung der Programme:<br />
In Polen liegt der Focus gegenwärtig auf Prozessen der Bildungsbenachteiligung von<br />
<strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> den ländlichen Regionen Polens.<br />
Insgesamt handelt sich hierbei eher um e<strong>in</strong>en präventiven Ansatz (Angleichung der Bildungschancen<br />
<strong>und</strong> der Bildungszugänge).<br />
Die Hauptzielstellung liegt auf der Verbesserung der Bildungschancen <strong>in</strong> strukturschwachen<br />
ländlichen Regionen sowie auf der Angleichung der Bildungsstrukturen <strong>in</strong> urbanen<br />
<strong>und</strong> ländlichen Räumen.<br />
Die Steuerung <strong>und</strong> Umsetzung der Programme ist aus unserer Sicht (noch) als eher<br />
verwaltungsdom<strong>in</strong>iert (<strong>in</strong>stitutionell vernetzte Steuerung <strong>und</strong> Umsetzung) zu beschreiben.<br />
Die Arbeit erfolgt dabei nicht ressortübergreifend. Besonders hervorzuheben ist, dass es <strong>in</strong><br />
Polen ke<strong>in</strong>e eigene m<strong>in</strong>isterielle Zuständigkeit für die Jugend gibt, sondern sie wird als<br />
Querschnittsaufgabe <strong>in</strong> den anderen M<strong>in</strong>isterien bearbeitet.<br />
Für Portugal kann e<strong>in</strong>e stärkere Fokussierung auf die allgeme<strong>in</strong>e soziale Integration von<br />
<strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n mit Migrationsh<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> aus benachteiligten Gebieten <strong>und</strong><br />
Regionen (Gebiete <strong>und</strong> Regionen mit hoher Konzentration von Migrant/<strong>in</strong>nen) hervorgehoben<br />
werden, wobei dieser Focus ursprünglich vorrangig auf Krim<strong>in</strong>alitätsprävention<br />
ausgerichtet war. In der Zwischenzeit ist dieses Programm direkt als <strong>in</strong>term<strong>in</strong>isterielle Aufgabe<br />
bei der Regierung angesiedelt. Dadurch ergibt sich e<strong>in</strong>e Zuständigkeit aller Ressorts an<br />
der Umsetzung des Programms.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus s<strong>in</strong>d für Portugal aufgr<strong>und</strong> der langjährigen Erfahrungen im H<strong>in</strong>blick<br />
auf die Umsetzung von <strong>sozialen</strong> Programmen stärker entwickelte Vernetzungsansätze (partizipativ;<br />
<strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>är; generationenübergreifend; nachbarschaftliche Strukturen) deutlicher<br />
sichtbar.<br />
Insgesamt handelt es sich um e<strong>in</strong>en Interventionsansatz (explizite Auswahl von Problemgebieten<br />
mit deutlicher Exklusion, hoher Krim<strong>in</strong>alität <strong>und</strong> ausgeprägter Bildungsverweigerung)<br />
mit e<strong>in</strong>em gegenwärtig e<strong>in</strong>setzenden Übergang zu e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>teragierenden <strong>und</strong><br />
partizipativen Steuerung <strong>und</strong> Umsetzung. Dies verdeutlicht sich u. a. <strong>in</strong> dem <strong>in</strong>novativen<br />
Ansatz, Multiplikatoren aus der Zielgruppe der benachteiligten <strong>Jugendliche</strong>n zu gew<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> im Rahmen der Projektrealisierung partnerschaftlich e<strong>in</strong>zusetzen.<br />
22
Handlungsempfehlungen<br />
Für die zukünftige Arbeit mit <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> benachteiligten Gebieten wurden<br />
im Rahmen der beiden Präsentationen folgende Handlungsempfehlungen formuliert:<br />
1. Die Notwendigkeit, zukünftig von den bislang vorrangig <strong>in</strong>tervenierenden Strategien<br />
<strong>und</strong> Maßnahmen zu <strong>in</strong>teraktiven <strong>und</strong> stärker partizipativen Strategien<br />
<strong>und</strong> Maßnahmen überzugehen (Portugal).<br />
2. Die Programme stärker an den konkreten Bedarfen <strong>und</strong> Problemen der Zielgruppen<br />
auszurichten (Interagierende Arbeitsweise) (Portugal).<br />
3. Die Kompetenzen im Bereich der lokalen Projektbeantragung <strong>und</strong> des lokalen<br />
Projektmanagements zu fördern <strong>und</strong> zu stärken (Polen).<br />
4. Die Kommunikation zwischen den beteiligten Akteuren sowie den Zielgruppen<br />
zu optimieren (Portugal/Polen) (Zirkuläre Beteiligungs- <strong>und</strong> Steuerungsverfahren:<br />
Portugal).<br />
5. Die Verfahren der Projektevaluation zu verbessern <strong>und</strong> effektiver zu gestalten<br />
(Polen).<br />
6. Insgesamt e<strong>in</strong>e stärkere Partizipation der betroffenen <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n<br />
im H<strong>in</strong>blick auf die Entwicklung von Projekten <strong>und</strong> Maßnahmen zu ermöglichen<br />
(Polen/Portugal).<br />
23
Arbeitsgruppe 2: Beschäftigung<br />
Präsentation Ungarn<br />
Gabriella Tölgyes, M<strong>in</strong>isterium für Soziales <strong>und</strong><br />
Arbeit, Ungarn<br />
Tamás Ganczer, Regionales Arbeitszentrum<br />
Südtransdanubien<br />
„Neue Dienste – Beschäftigung für<br />
<strong>Jugendliche</strong>“<br />
Die ungarische Beschäftigungspolitik für <strong>Jugendliche</strong><br />
In Ungarn führte der Regimewechsel ähnlich wie <strong>in</strong> anderen ehemals sozialistischen Ländern<br />
zu dramatischen Änderungen des Arbeitsmarktes. Die Entwicklung <strong>und</strong> der schnelle<br />
Anstieg der Arbeitslosigkeit trafen junge Menschen besonders hart. Gleichzeitig ist die Inaktivität<br />
– e<strong>in</strong>e der größten Herausforderungen für die ungarische Beschäftigungspolitik –<br />
<strong>in</strong>sbesondere unter den jungen Menschen besonders verbreitet.<br />
Die Beschäftigungsquote junger Menschen (zwischen 15 <strong>und</strong> 24 Jahren) lag 2003 bei<br />
27,5 % <strong>und</strong> damit deutlich unter dem EU-Durchschnitt (38,4 %). Die wirtschaftliche Aktivität<br />
dieser Altersgruppe ist weiterh<strong>in</strong> gesunken (2006: 26,8 %), was dem allgeme<strong>in</strong>en<br />
Trend vorangegangener Jahre entspricht.<br />
Nach dem starken Anstieg um den Zeitpunkt des Regimewechsels verr<strong>in</strong>gerte sich die<br />
Arbeitslosigkeit als Ergebnis der Bildungsexpansion <strong>und</strong> des kurzen wirtschaftlichen Aufschwungs.<br />
Ab 2001 jedoch stieg die Arbeitslosenquote der 15- bis 24-jährigen wieder, erreichte<br />
Anfang 2004 15,5 % <strong>und</strong> überstieg die Quote von 1998 um 1,5 %. Die Arbeitslosenquote<br />
unter <strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> Ungarn war zu dem Zeitpunkt zweie<strong>in</strong>halbmal höher als<br />
die durchschnittliche Arbeitslosenquote der Bevölkerung zwischen 15 <strong>und</strong> 64 Jahren.<br />
2006 sank die Arbeitslosenquote bei <strong>Jugendliche</strong>n um 0,3 Prozentpunkte auf 19,1 %.<br />
Die Anzahl der jungen Arbeitslosen betrug 64.100, das s<strong>in</strong>d 2.800 weniger als im vorangegangenen<br />
Jahr. Jeder dritte junge Arbeitslose hatte als höchsten Schulabschluss e<strong>in</strong>en allgeme<strong>in</strong>en<br />
Abschluss. Unter ihnen betrug die Arbeitslosenquote 31,8 %. Die <strong>Jugendliche</strong>n,<br />
die nicht von der Bildungsexpansion <strong>in</strong> den letzten Jahren profitieren konnten <strong>und</strong> ohne<br />
Fähigkeiten <strong>in</strong> den Arbeitsmarkt entlassen wurden, suchten i. d. R. länger nach Arbeit.<br />
Mehr als e<strong>in</strong> Drittel (38,4 %) der 15- bis 24-jährigen Arbeitslosen waren Langzeitarbeitslose<br />
<strong>und</strong> m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong> Jahr lang auf Arbeitssuche. Die Arbeitslosenquote betrug bei jenen mit<br />
e<strong>in</strong>em allgeme<strong>in</strong>en Schulabschluss, e<strong>in</strong>er Berufsausbildung oder dem Abschluss e<strong>in</strong>er Handelsschule<br />
als höchstem Abschluss 41 %.<br />
24
Schwierigkeiten der <strong>Jugendliche</strong>n<br />
Der E<strong>in</strong>tritt junger Menschen <strong>in</strong> den Arbeitsmarkt wird <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie durch e<strong>in</strong>en offensichtlichen<br />
Mangel an Arbeitserfahrungen <strong>und</strong>/oder ihre unzureichende Qualifikation beh<strong>in</strong>dert.<br />
Letztere ist gelegentlich mit unzureichenden Kompetenzen <strong>und</strong> mangelnder Motivation<br />
gekoppelt.<br />
Während der Ausbildung sammeln die <strong>Jugendliche</strong>n, wenn überhaupt, dann nur sehr<br />
wenige Arbeitserfahrungen, wogegen Arbeitgeber nach „fertigen“ Arbeitnehmern suchen,<br />
die bereits über Berufserfahrungen, Fähigkeiten <strong>und</strong> Wissen verfügen. Die Aufnahme der<br />
ersten Beschäftigung wird zeitlich nach h<strong>in</strong>ten verschoben, sodass die Sozialisierung im<br />
Arbeitsleben wesentlich später beg<strong>in</strong>nt.<br />
Das andere große H<strong>in</strong>dernis, mit dem <strong>Jugendliche</strong> beim E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> den Arbeitsmarkt<br />
konfrontiert werden, ist die offensichtliche Diskrepanz zwischen Ausbildung <strong>und</strong> Fähigkeiten.<br />
Da die Arbeitsmarktchancen für junge Menschen mit e<strong>in</strong>em höheren Abschluss lange<br />
Zeit am besten waren, ist der Wunsch der jungen Leute nach e<strong>in</strong>er höheren Bildung gleichzeitig<br />
gestiegen. Jetzt herrscht e<strong>in</strong> Überangebot von Universitäts- <strong>und</strong> College-Absolventen<br />
(<strong>in</strong>sbesondere aus den weichen Wissenschaften), wogegen es <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Gegenden des<br />
Landes e<strong>in</strong>en ernsthaften Mangel an ausgebildeten Arbeitern gibt. Der Wunsch nach höherer<br />
Bildung <strong>in</strong> den letzten Jahren hat dazu geführt, dass sich nur e<strong>in</strong> Drittel aller Bildungsmaßnahmen<br />
auf die Arbeiter konzentriert <strong>und</strong> zwei Drittel auf die so genannten „Bürotätigkeiten“,<br />
wogegen der Arbeitsmarkt genau das Gegenteil benötigt.<br />
Die Tatsache, dass die Anzahl der Schüler <strong>in</strong> Berufsausbildung <strong>und</strong> -schulungen gesunken<br />
ist, führt zu ernsthaften Spannungen auf dem Arbeitsmarkt. Mittelfristige Arbeitsmarktprognosen<br />
zeigen im Gegensatz dazu, dass die Nachfrage vor allem nach Arbeitern<br />
steigen wird.<br />
<strong>Jugendliche</strong>, die das Schulsystem mit e<strong>in</strong>em niedrigen Abschluss verlassen oder die<br />
Schule frühzeitig abbrechen, s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er schwierigeren Situation. Sie werden sehr wahrsche<strong>in</strong>lich<br />
aus dem Arbeitsmarkt gestoßen oder werden den E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> den Arbeitsmarkt<br />
als äußerst schwer empf<strong>in</strong>den. Das wird anhand der Tatsache deutlich, dass der Anteil der<br />
Menschen mit e<strong>in</strong>em niedrigen Schulabschluss <strong>in</strong> der Arbeitslosenquote weiterh<strong>in</strong> kont<strong>in</strong>uierlich<br />
abnimmt.<br />
Diese <strong>Jugendliche</strong>n s<strong>in</strong>d besonders gefährdet, e<strong>in</strong>e illegale, nicht deklarierte Arbeit aufzunehmen.<br />
Vom offiziellen Arbeitsmarkt abgelehnt, neigen sie dazu, jede verfügbare Jobmöglichkeit<br />
zu ergreifen, die ihnen irgende<strong>in</strong>e Art von E<strong>in</strong>kommen sichert. Die Gefahr ist,<br />
dass diese Art befristeter Beschäftigung schließlich zu e<strong>in</strong>em Dauerzustand wird, der die<br />
E<strong>in</strong>gliederung der <strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e bezahlte offizielle Arbeit beh<strong>in</strong>dert.<br />
Maßnahmen <strong>und</strong> Programme der ungarischen Regierung<br />
Maßnahmen zur Förderung von Beschäftigung <strong>und</strong> der Schaffung von Arbeitsplätzen<br />
− Aufnahme <strong>in</strong> Stipendien – Unterstützung junger Absolventen beim Sammeln<br />
erster Arbeitserfahrungen. Das Programm bietet niedrigere Lohnsteuern für<br />
Menschen bis 30 Jahre, wodurch die E<strong>in</strong>stellung jüngerer Arbeitnehmer für den<br />
Arbeitgeber günstiger wird.<br />
25
− START Programm – Förderung der Beschäftigung von jungen Menschen, <strong>in</strong>dem<br />
den Arbeitgebern für zwei Jahre e<strong>in</strong> verm<strong>in</strong>derter Lohnsteuersatz garantiert<br />
wird.<br />
− Förderung freiwilliger Arbeit, um <strong>Jugendliche</strong>n zu helfen, Arbeitserfahrungen<br />
zu sammeln.<br />
− Bereitstellen von Unternehmenskrediten zu e<strong>in</strong>fachen Bed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> Steuererleichterungen<br />
für junge Leute.<br />
− Bereitstellung von Vermittlung <strong>und</strong> Schulung unternehmerischer Fertigkeiten <strong>in</strong><br />
<strong>und</strong> außerhalb der Schulen.<br />
Maßnahmen für e<strong>in</strong>e stärkere Verb<strong>in</strong>dung zwischen Schule <strong>und</strong> Arbeit:<br />
− Zugangsbeschränkungen für den Zugang zu höherer Bildung, basierend auf der<br />
Nachfrage des Arbeitsmarktes auf nationaler <strong>und</strong> regionaler Ebene.<br />
− Gewährleisten der Qualitätssicherung im Bereich Bildung <strong>und</strong> Überwachung<br />
der Karriereschritte.<br />
− Verbesserung des Abprüfens von Fähigkeiten <strong>in</strong> den Bereichen Bildung <strong>und</strong><br />
Schulung.<br />
− Unterstützung von „tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g on-the-job“.<br />
Maßnahmen <strong>und</strong> Programm zur Unterstützung der Beschäftigung junger Menschen:<br />
− Unterstützung der Beschäftigung von Frauen durch <strong>K<strong>in</strong>der</strong>betreuung, e<strong>in</strong>schließlich<br />
untypischer Formen der Beschäftigung (z. B. Teilzeitarbeit).<br />
− Initiieren von Kampagnen, um Arbeitgebern <strong>und</strong> potenziellen Arbeitnehmern<br />
untypische Formen der Beschäftigung zu erläutern <strong>und</strong> somit deren Akzeptanz<br />
zu fördern.<br />
− Fortsetzen des „Take a step forward"-Programms, das es Menschen mit e<strong>in</strong>em<br />
niedrigeren Bildungsstand ermöglicht, ihre Ausbildung <strong>und</strong> Schulung wieder<br />
aufzunehmen.<br />
− Fördern der Verbesserung der Kompetenzen von Langzeitarbeitslosen.<br />
− Initiieren von gezielten, komplexen Entwicklungsprogrammen, e<strong>in</strong>schließlich<br />
der Entwicklung der lokalen Wirtschaft, der Wohnungs<strong>in</strong>frastruktur, des Verkehrswesen,<br />
der Berufsausbildung, der Bildung, der Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Wohlfahrtsorganisation<br />
u. Ä., um die E<strong>in</strong>wohner von benachteiligten Regionen (<strong>in</strong><br />
erster L<strong>in</strong>ie Roma, junge <strong>und</strong> <strong>in</strong>aktive Bevölkerung) zu erreichen.<br />
− Fortsetzen der Unterstützungsprogramme junger Agrar-Unternehmer.<br />
− Förderung <strong>und</strong> Unterstützung über das traditionelle on-the-job-Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g h<strong>in</strong>aus,<br />
<strong>und</strong> zwar jener Schulungsmaßnahmen, die die Anpassung an die technologischen<br />
Veränderungen leichter machen <strong>und</strong> Führungsfähigkeiten<br />
<strong>und</strong> -fachwissen verbessern, um die Arbeitgeber dazu zu br<strong>in</strong>gen, die Schulung<br />
ihrer Mitarbeiter als e<strong>in</strong>e lohnende Investition zu betrachten.<br />
− Unterstützung der Entwicklung von Lehrplänen <strong>und</strong> entsprechendem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong>material,<br />
das <strong>in</strong> der Berufs- <strong>und</strong> Erwachsenenbildung verwendet wird,<br />
Unterstützung der Fortbildung von Sem<strong>in</strong>arleitern, Tra<strong>in</strong>ern, Lehrern <strong>und</strong> Dozenten,<br />
die im Bereich der Berufsausbildung <strong>und</strong>/oder Erwachsenenbildung tätig<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
− Förderung der wissensbewahrenden Möglichkeiten <strong>in</strong> ländlichen Gebieten<br />
durch Unterstützung von Agrar-Unternehmen.<br />
26
Unterstützung der Arbeitsmarktdienste<br />
− Agenturen dazu br<strong>in</strong>gen, die jungen Menschen bei ihrer Jobsuche im Rahmen<br />
des Programms „First step <strong>in</strong> the labour market“ [Erster Schritt auf den Arbeitsmarkt]<br />
zu unterstützen, das überall im Land verfügbar ist. Diese Dienste umfassen:<br />
Berufsberatung, Jobmessen, Berufs<strong>in</strong>formationszentren, Information <strong>und</strong><br />
Beratung durch das Internet.<br />
− Erweiterung des Informationssystems, das jungen Menschen bei den Entscheidungen<br />
zu ihrem beruflichen Werdegang hilft, damit die Betroffenen die bestmöglichen<br />
Entscheidungen treffen.<br />
− Unterstützung der Entwicklung, Verwendung <strong>und</strong> Verbreitung neuer Techniken<br />
zur Jobsuche.<br />
− E<strong>in</strong>richten von Berufs-Informationszentren <strong>in</strong> den Bildungse<strong>in</strong>richtungen.<br />
„New Services – Employment of Youth“ („Neue Dienste – Beschäftigung<br />
für <strong>Jugendliche</strong>“)<br />
Die Arbeitsmarktsituation der Region der drei Bezirke (Somogy, Baranya <strong>und</strong> Tolna) muss<br />
sich ändern. Die Region Südtransdanubien liegt im südlichen Teil Ungarns. Im <strong>in</strong>ternationalen<br />
Vergleich gehört sie zu den am wenigsten entwickelten Regionen.<br />
Dort gibt es mehr als 60.000 gemeldete Arbeitssuchende, viele von ihnen s<strong>in</strong>d seit mehr<br />
als 6 Monaten arbeitslos. Die Arbeitslosenquote liegt bei 12,9 %, also über dem Landesdurchschnitt<br />
<strong>und</strong> dem der EU. E<strong>in</strong> Gr<strong>und</strong> für diese hohe Arbeitslosenquote s<strong>in</strong>d die vielen<br />
unterentwickelten Kle<strong>in</strong>stdörfer ohne geeignete Infrastruktur.<br />
Geschichte<br />
Das Projekt basiert auf e<strong>in</strong>em französischen Modell. Das M<strong>in</strong>isterium für Arbeit <strong>und</strong> soziale<br />
Kohäsion Frankreichs <strong>und</strong> das ungarische M<strong>in</strong>isterium haben 2002 e<strong>in</strong>en Kooperationsvertrag<br />
unterzeichnet <strong>und</strong> die Anwendung der französischen Vorgehensweise vere<strong>in</strong>bart.<br />
Das Projekt startete am 1. Januar 2004 <strong>und</strong> endete am 31. Dezember 2006, die Vorbereitungen<br />
begannen jedoch schon 2003.<br />
Zu der Zeit arbeiteten die Arbeitsagenturen <strong>in</strong> Ungarn auf Länderebene mehr oder weniger<br />
getrennt vone<strong>in</strong>ander. Das Neue an dem Projekt war, dass die Arbeitsagenturen der<br />
drei Bezirke sich zusammenschlossen, um dieses Projekt durchzuführen. So war dies das<br />
erste bedeutende Projekt auf regionaler Ebene. Seitdem kooperieren die Arbeitsagenturen<br />
auf regionaler Basis.<br />
Das Projekt wurde von den drei Arbeitsagenturen <strong>in</strong> Südtransdanubien (Arbeitsagenturen<br />
<strong>in</strong> Somogy, Tolna, Baranya) <strong>und</strong> dem Regionalen Schulungszentrum Pécs geleitet. Das<br />
Schulungszentrum war für die professionelle Entwicklung verantwortlich.<br />
50 % der f<strong>in</strong>anziellen Mittel kamen von den Arbeitsagenturen <strong>und</strong> 50 % stammten aus<br />
dem Haushalt des Arbeitsmarktfonds.<br />
Ziele<br />
Das Ziel des Programms war die Schaffung von Arbeitsplätzen durch Unterstützung der<br />
Schaffung neuer Dienste mit dem Ziel, persönliche Dienste oder Aktivitäten anzubieten,<br />
die die Interessen <strong>und</strong> Bedürfnisse e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>schaft berücksichtigen, die bereits nachgefragt<br />
worden waren, bisher aber nicht auf Marktebene umgesetzt werden konnten, was auf<br />
e<strong>in</strong>en Mangel an e<strong>in</strong>er stabilen Nachfrage <strong>und</strong> zahlenden K<strong>und</strong>en zurückzuführen war.<br />
27
Langfristige Ziele:<br />
− Sicherstellen beruflicher Perspektiven für die Programmteilnehmer<br />
− Gestaltung wirtschaftlicher Unabhängigkeit <strong>und</strong> Nachhaltigkeit durch Bereitstellen<br />
e<strong>in</strong>er Nachfrage von zahlenden K<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Ausschreibung für die neuen<br />
Dienste<br />
− Schaffen neuer Arbeitsplätze <strong>und</strong> Berufe durch die E<strong>in</strong>führung neuer Dienste<br />
Kurzfristige Ziele:<br />
− E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>den von 100 jungen Menschen zwischen 16 <strong>und</strong> 30 Jahren <strong>in</strong> das Projekt<br />
der Region Südtransdanubien<br />
− Errichten neuer Dienstleistungen <strong>und</strong> Tätigkeiten auf Gr<strong>und</strong>lage der Bedürfnisse<br />
der lokalen Geme<strong>in</strong>schaft <strong>in</strong> folgenden Bereichen:<br />
− Soziales<br />
− Tourismus<br />
− Umweltschutz, Umweltmanagement<br />
− Regionalentwicklung<br />
Die Zielgruppe waren jene jungen, arbeitslosen Menschen zwischen 16 <strong>und</strong> 30 Jahren, die<br />
e<strong>in</strong>en Sek<strong>und</strong>arschul-, e<strong>in</strong>en Universitäts- oder College-Abschluss hatten.<br />
Wir garantierten jenen Vorrang, die<br />
− <strong>in</strong> weniger entwickelten Gebieten lebten,<br />
− mehr als 6 Monate lang arbeitslos gemeldet waren.<br />
Subventionen<br />
Nach der Vorbereitungsphase wandten wir uns 2003 <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er offenen Ausschreibung an<br />
Unternehmer. Das Projekt f<strong>in</strong>anzierte Schulungen, Gehälter <strong>und</strong> Lohnnebenkosten. Darüber<br />
h<strong>in</strong>aus berieten wir die Arbeitnehmer <strong>und</strong> Arbeitgeber das ganze Projekt über kont<strong>in</strong>uierlich.<br />
Die Subventionen betrugen:<br />
− Schulungsunterstützung <strong>in</strong> Höhe von 1.200 Euro pro Kopf<br />
Wir verwendeten diesen Betrag, um Schulungen zu f<strong>in</strong>anzieren, die die Teilnehmer selbst<br />
aussuchen konnten.<br />
− Lohnunterstützung <strong>und</strong> Erstattung der Lohnnebenkosten. Das Projekt war <strong>in</strong> 3<br />
Abschnitte von jeweils e<strong>in</strong>em Jahr unterteilt. Die Unterstützung nahm ab. Im<br />
ersten Jahr waren es 100 %, im zweiten Jahr 80 % <strong>und</strong> im dritten Jahr 60 %.<br />
Der maximal verfügbare Betrag betrug 300 Euro/Kopf/Monat. Das waren<br />
41 % mehr als der ungarische M<strong>in</strong>destbruttolohn. (Der M<strong>in</strong>destbruttolohn betrug<br />
2004 nur 212 Euro.)<br />
Das Projekt unterstützte darüber h<strong>in</strong>aus die Schaffung neuer Dienste mit kont<strong>in</strong>uierlicher<br />
Beratung.<br />
Entwicklung <strong>in</strong>dividueller Fähigkeiten<br />
Neben der Beratung übernahm das Regionale Schulungszentrum die Verantwortung für die<br />
Entwicklung der Angestellten.<br />
Das war der zweite Schwerpunkt des Projektes, schließlich sprechen wir hier über nagelneue<br />
Dienste.<br />
28
Diese Dienste waren neu, weil sie <strong>in</strong> der entsprechenden Region zuvor nicht existiert<br />
hatten. Die Nachfrage war vorhanden, jedoch gab es ke<strong>in</strong>e zahlenden K<strong>und</strong>en.<br />
Die <strong>in</strong>dividuelle Verbesserung der Fähigkeiten wurde durch Mitarbeiter des Regionalen<br />
Schulungszentrums Pécs durchgeführt. In e<strong>in</strong>em ersten Schritt führten die Berater e<strong>in</strong>e<br />
kompetenzbasierte Jobanalyse durch. In jenen Fällen, wo e<strong>in</strong>e weitere Berufsausbildung<br />
erforderlich war, wurde die Richtung der Schulung festgelegt. Die beliebtesten Kurse waren:<br />
Projektmanagement, EU-Studien, IT- <strong>und</strong> Sprachkurse.<br />
Unterstützte Bereiche<br />
Die meisten neuen Dienste wurden im Bereich Soziales <strong>und</strong> Regionalentwicklung e<strong>in</strong>geführt.<br />
Mehr als 40 % der neuen Dienste entstanden im <strong>sozialen</strong> Bereich. In diesem Sektor<br />
zielt die Mehrheit der neuen Dienste auf die Alten- <strong>und</strong> <strong>K<strong>in</strong>der</strong>pflege <strong>und</strong> die Unterstützung<br />
der lokalen Geme<strong>in</strong>schaft ab.<br />
E<strong>in</strong> anderes wichtiges Ergebnis ist, dass 64 % unserer Zielgruppe Universitäts- <strong>und</strong> College-Abschlüsse<br />
<strong>und</strong> 30 % von ihnen ihren Sek<strong>und</strong>arschulabschluss hatten. Obgleich das<br />
erreichbare Gehalt nicht so hoch war, war die Anzahl der professionellen Teilnehmer bemerkenswert.<br />
Ergebnisse<br />
Das Projekt half der Zielgruppe, sich selbst den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes anzupassen<br />
<strong>und</strong> erfahrene Arbeitssuchende zu werden.<br />
Es half ihnen darüber h<strong>in</strong>aus, unabhängiger <strong>und</strong> selbstbewusster zu werden, mit klaren<br />
Zielen.<br />
Andere sehr wichtige Ergebnisse waren die Entwicklung ihrer Anpassungsfähigkeit <strong>und</strong><br />
ihrer Sichtweisen.<br />
Das <strong>in</strong>novative Ergebnis des Projektes war die Schaffung neuer Arbeitsplätze wie dem<br />
regionalen Abfallmanager, dem Assistenten für Regionalentwicklung, dem Tourismusmanager<br />
<strong>und</strong> dem Umweltschutzbeauftragten.<br />
Das Projekt unterstützte e<strong>in</strong>e große Bandbreite von Organisationen: Vere<strong>in</strong>igungen,<br />
Stiftungen, Geme<strong>in</strong>den, Unternehmer, Aktiengesellschaften, GmbHs. Die Anzahl der<br />
NGOs war herausragend, was zu e<strong>in</strong>er Stärkung des Nichtregierungsbereichs beigetragen<br />
hat.<br />
Am Ende des Projektes waren 122 von 159 Teilnehmern gut geschult <strong>und</strong> angestellt. Da<br />
die Ergebnisse des Projektes überzeugend waren, haben wir bereits e<strong>in</strong>e neue Ausschreibung<br />
lanciert, die sich an weitere 100 junge Arbeitnehmer richtet.<br />
F<strong>in</strong>anzierung des Projektes<br />
Ungarischer Staatshaushalt: Mittel aus zentralen <strong>und</strong> dezentralen Maßnahmen<br />
Weitere Informationen:<br />
M<strong>in</strong>isterium für Soziales <strong>und</strong> Arbeit, Ungarn<br />
1054 Budapest, Alkotmány u. 3.<br />
E-Mail: <strong>in</strong>fo@szmm.gov.hu<br />
Internet: www.szmm.gov.hu<br />
29
Präsentation Irland<br />
Dr. Dermot Stokes, Nationaler Koord<strong>in</strong>ator,<br />
Youthreach<br />
Stephen McCarthy, Bildungsbeauftragter,<br />
Stadt Dubl<strong>in</strong> VEC<br />
Angelique Kelly, Koord<strong>in</strong>ator<strong>in</strong>, Cruml<strong>in</strong><br />
Youthreach, Dubl<strong>in</strong> 12<br />
Christ<strong>in</strong>a Carolan, ehemalige Youthreach<br />
Teilnehmer<strong>in</strong><br />
30<br />
v. l.: D. Stokes, St. McCarthy, C. Carolan, A. Kelly<br />
„Youthreach“ – Qualifizierungs-<br />
<strong>und</strong> Beschäftigungsprogramm für benachteiligte <strong>Jugendliche</strong><br />
Beschäftigungskontext<br />
In den letzten fünfzehn Jahren hat die irische Wirtschaft tief greifende Veränderungen<br />
durchgemacht. Dort, wo es e<strong>in</strong>e hohe Arbeitslosigkeit gab, herrschten ger<strong>in</strong>ge Erwartungen<br />
<strong>und</strong> endemische, strukturelle Emigration sowohl der Hoch- als auch der Niedrigqualifizierten.<br />
Nun ist dort die Arbeitslosigkeit niedrig, die Erwartungen s<strong>in</strong>d hoch, <strong>und</strong> es ist e<strong>in</strong><br />
deutlicher Zuzug zu verzeichnen. E<strong>in</strong> großer Anteil der Arbeitskräfte verfügt über Zusatzqualifikationen,<br />
allerd<strong>in</strong>gs gibt es auch e<strong>in</strong>en hohen Anteil von Menschen mit Sek<strong>und</strong>arschulabschluss<br />
oder e<strong>in</strong>em niedrigeren Abschluss. Außerdem ist der Analphabetismus bei<br />
Erwachsenen, <strong>in</strong>sbesondere unter älteren Arbeitern, auch verbreitet. Die Teilnahme an<br />
Fortbildungen <strong>und</strong> Schulungen ist ger<strong>in</strong>g; e<strong>in</strong> Mangel an Fähigkeiten ist <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Bereichen<br />
offensichtlich. Diese wurden weitestgehend durch die Immigration hochqualifizierter<br />
Menschen besetzt. In Irland gibt es schätzungsweise 280.000 Ausländer im Alter von 15<br />
Jahren <strong>und</strong> älter. Die prognostizierte Migration für 2007 beträgt 55.000. Es wird geschätzt,<br />
das Irland zwischen 2006 <strong>und</strong> 2020 950.000 weitere Arbeitnehmer benötigen wird, 310.000<br />
von ihnen werden immigrieren.<br />
2007 veröffentlichte die Expert Group on Future Skill Needs [Expertengruppe zur Ermittlung<br />
zukünftigen Qualifikationsbedarfs] ihren Bericht Tomorrow’s Skills: Towards a<br />
National Skills Strategy. [Die Qualifikationen von morgen: H<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>er nationalen Qualifikationsstrategie]<br />
Um e<strong>in</strong>e neue wissensbasierte Wirtschaft zu werden, die effektiv auf dem<br />
globalen Markt mithalten kann, muss Irland die Qualifikationen der dort lebenden Bevölkerung<br />
fördern, die Partizipation an der erwerbstätigen Bevölkerung steigern <strong>und</strong> weiterh<strong>in</strong><br />
hochqualifizierte Migranten anwerben. Es ist jetzt üblich, die Qualifikationen der Arbeitskräfte<br />
im Allgeme<strong>in</strong>en um e<strong>in</strong>en Grad des National Framework of Qualifications [Nationaler<br />
Qualifikationsrahmen] (NFQ, www.ngai.ie) anzuheben.<br />
Es ist jedoch auch anerkannt, dass die starke Nachfrage nach ger<strong>in</strong>g qualifizierten Arbeitskräften<br />
derzeit zu e<strong>in</strong>er schwachen Leistung des Bildungswesens beiträgt, da der E<strong>in</strong>zelne<br />
eher motiviert wird, sich e<strong>in</strong>e Arbeit zu suchen, anstatt se<strong>in</strong>e Ausbildung fortzusetzen.
Frühzeitiges Verlassen der Schule <strong>und</strong> das Youthreach-Programm<br />
Unsere Präsentation konzentriert sich auf das Youthreach-Programm, das die wesentliche<br />
nationale Reaktion darstellt <strong>und</strong> sich an jene richtet, die die Schule frühzeitig verlassen haben.<br />
Wenn wir die 1990 geborene Kohorte nehmen – das wären <strong>in</strong> Irland ca. 55.000 <strong>K<strong>in</strong>der</strong>,<br />
so werden 1,5 % dieser Kohorte die Schule direkt nach der Gr<strong>und</strong>schule 2 verlassen, 3,5 %<br />
werden e<strong>in</strong>e weiterführende Schule ohne Abschluss verlassen, 18 % bis 19 % werden weniger<br />
als den Sek<strong>und</strong>arschulabschluss erreichen <strong>und</strong> 25 % werden mit weniger als 5 D 3 Noten<br />
auf dem Abschlusszeugnis aus dem Schulsystem ausscheiden. Das s<strong>in</strong>d stabile Zahlen, die<br />
trotz substanzieller Investitionen <strong>in</strong> präventive Maßnahmen gegen e<strong>in</strong>en frühzeitigen<br />
Schulabgang seit e<strong>in</strong>em Jahrzehnt gleich bleibend s<strong>in</strong>d.<br />
Es gibt zahlreiche Gründe, weshalb wir davon betroffen s<strong>in</strong>d. Zunächst ist es <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Gesellschaft, die für die Idee der Gleichberechtigung im Bildungswesen e<strong>in</strong>tritt, <strong>in</strong>akzeptabel,<br />
dass e<strong>in</strong>er von vier Schülern die Schule mit unzureichenden Qualifikationen verlässt.<br />
Zweitens untergräbt e<strong>in</strong> so hoher Anteil frühzeitiger Schulabgänger dort, wo wir versuchen,<br />
die Lissabonner Ziele zu erreichen <strong>und</strong> die Qualifikationen der Arbeitskräfte anzuheben,<br />
unsere Möglichkeiten, unsere Ziele zu erfüllen. Drittens s<strong>in</strong>d uns die Folgen e<strong>in</strong>er ger<strong>in</strong>gen<br />
Qualifikation für den beruflichen Werdegang e<strong>in</strong>er Person durchaus bewusst. Sie<br />
wird eher arbeitslos, ihre Arbeit ist schlechter bezahlt <strong>und</strong> unsicherer. Wenn sie arbeitslos<br />
wird, wird sie länger warten <strong>und</strong> härter nach e<strong>in</strong>er neuen Arbeit suchen müssen <strong>und</strong> diese<br />
wird im Gegenzug schlechter bezahlt <strong>und</strong> unsicherer se<strong>in</strong> als andere. Die Gefahr der <strong>sozialen</strong><br />
Ausgrenzung ist die Folge. Schließlich s<strong>in</strong>d uns auch die verschiedenen negativen Zusammenhänge<br />
<strong>und</strong> Assoziationen, die mit e<strong>in</strong>em frühzeitigen Verlassen der Schule e<strong>in</strong>hergehen,<br />
bewusst.<br />
Unsere Reaktion besteht aus drei großen Strängen. Der erste bezieht sich auf die Ebene<br />
der Servicearchitektur. Wir versuchen, e<strong>in</strong> Klima zu schaffen, das die Zusammenarbeit<br />
fördert, die <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>in</strong> den Mittelpunkt stellt <strong>und</strong> Grenzen zwischen den Diensten <strong>und</strong> Bereichen<br />
überw<strong>in</strong>det. Der zweite ist e<strong>in</strong>e Bandbreite präventiver Maßnahmen <strong>und</strong> Strukturen<br />
<strong>in</strong> den Sozialdiensten <strong>und</strong> Schulen, wie beispielsweise die DEIS-Initiative 4 . Der dritte<br />
Strang bezieht sich auf außerschulische Maßnahmen, im Wesentlichen das Youthreach-<br />
Programm <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Reihe <strong>in</strong>formeller Jugenddienste <strong>und</strong> -projekte.<br />
Diese Stränge werden anhand e<strong>in</strong>er Bandbreite von Gr<strong>und</strong>satzvere<strong>in</strong>barungen deutlich,<br />
wie beispielsweise der nationalen Partnerschaftsvere<strong>in</strong>barung Towards 2016, dem Nationalen<br />
Entwicklungsplan 2007 bis 2013 <strong>und</strong> dem Nationalen Aktionsplan für soziale E<strong>in</strong>gliederung<br />
2007 bis 2016. Wir haben darüber h<strong>in</strong>aus versucht, transversale Mechanismen zu<br />
entwickeln, die die verschiedenen M<strong>in</strong>isterien mite<strong>in</strong>ander verb<strong>in</strong>den, die für die Jugenddienste<br />
verantwortlich s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong>sbesondere das Büro des M<strong>in</strong>isters für <strong>K<strong>in</strong>der</strong>. Wir haben<br />
auch e<strong>in</strong>en breiten gesetzlichen Rahmen angelegt, dem die Bereitstellung von Diensten für<br />
<strong>Jugendliche</strong> unterliegt. Dies s<strong>in</strong>d deutliche Veränderungen gegenüber der Vergangenheit,<br />
2 Gr<strong>und</strong>schule <strong>in</strong> Irland umfasst sechs Schuljahre (primary school).<br />
3 In Irland werden die Kurse nach den Schwierigkeitsgraden gewählt <strong>und</strong> danach auch benotet.<br />
4 Siehe www.education.ie<br />
31
als der Governancerahmen aus e<strong>in</strong>er Fülle unzusammenhängender Gesetzgebungen <strong>und</strong><br />
m<strong>in</strong>isterieller Erlässe <strong>und</strong> Direktiven bestand.<br />
Anders als <strong>in</strong> den meisten anderen europäischen Ländern spielen die Geme<strong>in</strong>den ke<strong>in</strong>e<br />
direkte Rolle bei der Weiterbildung oder der Bereitstellung von Sozialdiensten oder Schulungen<br />
für junge Menschen. Im Allgeme<strong>in</strong>en betont das irische System die Allgeme<strong>in</strong>bildung<br />
bis h<strong>in</strong> zur Sek<strong>und</strong>arstufe. Zu e<strong>in</strong>er frühzeitigen Berufswahl wird nicht geraten. Für<br />
jene, die die Schule frühzeitig verlassen, ist Youthreach die erste Anlaufstelle. Berufsbildungskomitees<br />
(VECs) s<strong>in</strong>d Agenturen, die Weiterbildung anbieten <strong>und</strong> koord<strong>in</strong>ieren.<br />
Dank der Entwicklung des NFQ gibt es nun e<strong>in</strong>en vere<strong>in</strong>heitlichenden Rahmen für Qualifikationen.<br />
Youthreach wird als der flexible Fre<strong>und</strong> des Schul- <strong>und</strong> Fortbildungssystems bezeichnet.<br />
Es wurde 1988 für die Soziale Garantie <strong>in</strong>s Leben gerufen. Es ist e<strong>in</strong> nationales Programm,<br />
dessen Bereitstellung jedoch auf lokaler Ebene erfolgt. Es begründet sich auf drei Phasen –<br />
Engagement, Gründung, Fortschritt. Auf nationaler Ebene wird es von zwei M<strong>in</strong>isterien,<br />
dem M<strong>in</strong>isterium für Bildung <strong>und</strong> Wissenschaft <strong>und</strong> dem M<strong>in</strong>isterium für Unternehmen, Handel <strong>und</strong><br />
Beschäftigung geleitet. E<strong>in</strong>e starke Betonung kommt dabei der Arbeit zwischen den Sektoren<br />
<strong>und</strong> Agenturen zu, obgleich anerkannt ist, dass diese schwierig umzusetzen ist. Das Programm<br />
wird <strong>in</strong> 90 Bildungszentren <strong>und</strong> 43 Geme<strong>in</strong>de-Schulungszentren im ganzen Land angeboten.<br />
Dabei handelt es sich um kle<strong>in</strong>e außerschulische Abteilungen mit Vollzeit- <strong>und</strong> Teilzeitmitarbeitern.<br />
Youthreach richtet sich an frühzeitige Schulabgänger, das heißt <strong>Jugendliche</strong> zwischen 15<br />
<strong>und</strong> 20 Jahren mit schlechter Qualifikation, die nicht mehr zur Schule gehen <strong>und</strong> noch ke<strong>in</strong>e<br />
Arbeit haben. Von den Teilnehmern s<strong>in</strong>d 15 % alle<strong>in</strong>erziehende Eltern <strong>und</strong> 10 % Pendler.<br />
Die Schulung wird <strong>in</strong> Abhängigkeit von Alter <strong>und</strong> Beteiligung bezuschusst. Das Ziel<br />
des Programms ist es, frühzeitigen Schulabgängern (16 bis 20 Jahre) das Wissen, die Fähigkeiten<br />
<strong>und</strong> das Vertrauen zu vermitteln, die erforderlich s<strong>in</strong>d, um vollständig an der Gesellschaft<br />
teilhaben <strong>und</strong> Weiterbildung <strong>und</strong> Schulungen <strong>in</strong> Anspruch nehmen <strong>und</strong> Arbeit f<strong>in</strong>den<br />
zu können.<br />
Die aktive oder passive Entscheidung junger Menschen, die Schule früh zu verlassen,<br />
wird von vielerlei Faktoren bee<strong>in</strong>flusst. Es ist leicht, frühen Schulabgang im H<strong>in</strong>blick auf<br />
Probleme <strong>und</strong> Risikofaktoren zu untersuchen. Aber Schule funktioniert für viele junge<br />
Menschen e<strong>in</strong>fach nicht. Andere mögen Schwierigkeiten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen oder allen Ökosystemen<br />
haben – der Schule, der Familie, der Alterskohorte oder der Nachbarschaft. In vielen Instanzen<br />
ist klar, dass der frühe Schulabgang e<strong>in</strong>e rationale Reaktion auf Kräfte ist, die außerhalb<br />
der Kontrolle des E<strong>in</strong>zelnen liegen. Die Erfahrungen von Youthreach zeigen, dass,<br />
wenn sich jeder junge Mensch mit se<strong>in</strong>em eigenen Päckchen an Erfahrungen <strong>und</strong> Problemen<br />
vorstellt, immer klar ist, warum er/sie die Schule früh verlassen hat. Es gibt also e<strong>in</strong>e<br />
große Bandbreite von Schwierigkeiten.<br />
In e<strong>in</strong>er vom M<strong>in</strong>isterium für Bildung <strong>und</strong> Wissenschaft im Dezember 2005 durchgeführten<br />
Umfrage unter den 90 Zentren wurde festgestellt, dass fast 40 % der Lernenden<br />
signifikante Lese- <strong>und</strong> Rechenschwierigkeiten hatten, mehr als 50 % hatten e<strong>in</strong>en problembehafteten<br />
familiären H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong>, mehr als e<strong>in</strong> Viertel Missbrauchsprobleme <strong>und</strong> 30 %<br />
benötigten nachhaltige psychologische Unterstützung. Von besonderer Bedeutung ist, dass<br />
32
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em der reichsten Länder Europas 17 % <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em „schlechten ges<strong>und</strong>heitlichen Zustand“<br />
waren, das heißt unter anhaltenden Erkrankungen oder schlechter Ernährung litten.<br />
E<strong>in</strong> ähnlich hoher Anteil wurde polizeilich verwarnt. E<strong>in</strong> Viertel hatte vielfältige Probleme.<br />
Die Mitarbeiter des Programms müssen mit e<strong>in</strong>em Paradoxon umgehen – Youthreach<br />
ist e<strong>in</strong> Bildungs- <strong>und</strong> Schulungsprogramm, ke<strong>in</strong> umfassendes Versorgungspaket. Dennoch<br />
stellen sich die <strong>Jugendliche</strong>n mit e<strong>in</strong>er Vielzahl von Problemen vor, die gelöst werden müssen,<br />
bevor sie sich dem Lernprozess h<strong>in</strong>geben können. Daher ist die wichtigste Phase der<br />
Partizipation die des Engagements. Das ist der Punkt, an dem die Programmmitarbeiter<br />
größte Unterstützung benötigen, <strong>und</strong> zwar sowohl <strong>in</strong> ihrem eigenen Handeln als auch von<br />
externen Institutionen. Diese Unterstützung ist sehr gemischt – manchmal tief greifend,<br />
manchmal nicht – <strong>und</strong> verlässt sich zu sehr auf Individuen <strong>in</strong> den Organisationen, anstatt<br />
auf e<strong>in</strong>en Zusammenhalt zwischen den Organisationen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er effektiven Infrastruktur<br />
von Jugenddiensten.<br />
Das Programm arbeitet mit Personen aus allen Bereichen e<strong>in</strong>es Spektrums. An e<strong>in</strong>em<br />
Ende gibt es Instabilität, Abhängigkeit, Loslösung, Störungen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>en Mangel an Selbstbestimmung<br />
<strong>und</strong> an dem anderen Ende Stabilität, Unabhängigkeit, Integration <strong>und</strong> Beschäftigungsfähigkeit.<br />
Die Programmteilnehmer können sich an jedem Punkt dieses Spektrums<br />
bef<strong>in</strong>den. Das Programm arbeitet mit ihnen, um ihnen zu helfen, positive Ergebnisse<br />
zu erreichen. Das tut es, <strong>in</strong>dem es die besten Verfahren aus Bildung, Schulung <strong>und</strong> <strong>in</strong>formeller<br />
Jugendarbeit komb<strong>in</strong>iert.<br />
Schulung<br />
Bildung<br />
Jugendarbeit<br />
Youthreach<br />
Bei der Jugendarbeit <strong>und</strong> der Erwachsenenbildung beg<strong>in</strong>nt man dort, wo der Lernende<br />
ist, <strong>und</strong> stellt ihn immer <strong>in</strong> den Vordergr<strong>und</strong>, <strong>und</strong> nicht das Subjekt oder die Qualifikation.<br />
So gehen die Youthreach-Mitarbeiter vor. Lernende müssen immer Entscheidungen über<br />
ihre Beteiligung fällen. Wie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Berufsausbildung werden das Lernen aus Erfahrungen<br />
<strong>und</strong> positive Mentorenbeziehungen sehr betont. Beste Verfahren br<strong>in</strong>gen Sicherheit <strong>und</strong><br />
Herausforderungen <strong>in</strong>s Gleichgewicht. Dank des kürzlich entwickelten Nationalen Qualifikationsrahmens<br />
wird es nun möglich, Qualifikationsmöglichkeiten auf e<strong>in</strong>zelne Lernende<br />
zuzuschneiden.<br />
Die Mitarbeiter müssen über besondere Fähigkeiten verfügen. Sie müssen die Rollen des<br />
Lehrers, Tra<strong>in</strong>ers, Jugendsozialarbeiters <strong>und</strong> Mentors komb<strong>in</strong>ieren. Sie müssen sich mit<br />
e<strong>in</strong>er Reihe von Experten aus e<strong>in</strong>er Vielzahl von Agenturen <strong>und</strong> Diszipl<strong>in</strong>en zusammentun.<br />
33
Sie müssen <strong>in</strong> ihrem Handeln mit den Lernenden strukturiert, klar <strong>und</strong> gerecht se<strong>in</strong>. Sie<br />
müssen reflektieren <strong>und</strong> selbstbewusst se<strong>in</strong> – häufig s<strong>in</strong>d sie die erste Person, mit denen die<br />
Lernenden e<strong>in</strong>e gleichberechtigte Beziehung unter Erwachsenen kennenlernen. Daher ist<br />
das Bewusstse<strong>in</strong> für Grenzen wichtig. Sie müssen e<strong>in</strong>en S<strong>in</strong>n für Humor haben. Sie müssen<br />
außerdem unvore<strong>in</strong>genommen se<strong>in</strong> – ihnen werden D<strong>in</strong>ge begegnen, die ihre Wertvorstellungen<br />
auf den Prüfstand stellen werden. Aber sie benötigen auch Unterstützung <strong>und</strong> Kontrolle,<br />
denn das Risiko e<strong>in</strong>es Burn-outs ist groß – <strong>und</strong> das <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Bereich, den wir gerade<br />
erst <strong>in</strong> Angriff nehmen.<br />
Als Youthreach gegründet wurde, war es zunächst als e<strong>in</strong>e kurzfristige Lösung für e<strong>in</strong><br />
kurzfristiges Problem gedacht. Heute, da wir erkennen, dass der frühe Schulabgang e<strong>in</strong><br />
strukturelles Problem ist, wird das Programm zunehmend als e<strong>in</strong> Bestandteil des Bildungs-<br />
<strong>und</strong> Ausbildungssystems betrachtet. Daher ist es hilfreich, dass das Programm sich im Laufe<br />
der Zeit weiter <strong>und</strong> selbst zu e<strong>in</strong>em Organ entwickelt hat, dass als effektiv angesehen<br />
<strong>und</strong> als solches bestätigt werden kann. Ma<strong>in</strong>stream<strong>in</strong>g-Projekte <strong>und</strong> geschützte Maßnahmen<br />
wie Youthreach s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e gr<strong>und</strong>legende Herausforderung. Dabei geht es darum, den<br />
Ma<strong>in</strong>stream zu verändern, <strong>und</strong> nicht zu verändern, was bei benachteiligten <strong>Jugendliche</strong>n funktioniert.<br />
Es geht nicht darum, wirksame Programme <strong>in</strong> die f<strong>in</strong>anziellen <strong>und</strong> adm<strong>in</strong>istrativen<br />
Schranken e<strong>in</strong>es unflexiblen Systems zu pressen, das die <strong>Jugendliche</strong>n als erstes „verloren“<br />
hat. Es sollte genau entgegengesetzt funktionieren.<br />
Das erfordert e<strong>in</strong>e langfristige Strategie, die <strong>in</strong> Phasen unterteilt ist <strong>und</strong> so weit wie möglich<br />
geht. Initiativen wir Youthreach müssen demonstrativ ebenso gut se<strong>in</strong> wie Äquivalente.<br />
<strong>Jugendliche</strong> haben e<strong>in</strong> Recht auf Qualität <strong>und</strong> Professionalität <strong>und</strong> Service auf höchstem<br />
Niveau. Wer e<strong>in</strong>e zweite Chance erhält, darf nicht als Mensch zweiter Klasse betrachtet<br />
werden. Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist die Youthreach Quality Framework-Initiative 5 von besonderer<br />
Bedeutung. Ihr Ausgangspunkt s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e Reihe von Qualitätsstandards, die alle Beteiligten,<br />
e<strong>in</strong>schließlich der Lernenden, vere<strong>in</strong>bart haben. Jedes Zentrum entwickelt e<strong>in</strong>en Zentrumsplan<br />
<strong>und</strong> führt dann jährlich e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>terne Evaluation des Zentrums durch. Schließlich<br />
führt die Abteilung für Bildung <strong>und</strong> Wissenschaft externe Evaluationen durch.<br />
Die Stadt Dubl<strong>in</strong><br />
Youthreach ist e<strong>in</strong> nationales Programm <strong>und</strong> so ist klar, dass es von lokalen Prioritäten,<br />
lokalem Wissen gelenkt werden muss, das die VECs (Berufsbildungskomitees der Countys)<br />
bereitstellen. Das Berufsbildungskomitee der Stadt Dubl<strong>in</strong> (CDVEC) ist das größte VEC <strong>in</strong><br />
Irland. Es bietet mehr als 12.000 erwachsenen Vollzeitstudenten <strong>und</strong> 17.500 Teilzeitstudenten<br />
e<strong>in</strong>e große Bandbreite an Kursen <strong>und</strong> Diensten an. Es hat mehr als 4.000 Mitarbeiter<br />
<strong>und</strong> jährliche Ausgaben <strong>in</strong> Höhe von 147 Mio. Euro.<br />
Während die Bevölkerung des Großraums Dubl<strong>in</strong> 1,5 Mio. übersteigt, leben <strong>in</strong> der Stadt<br />
Dubl<strong>in</strong>, für die das CDVEC verantwortlich ist, 500.000 Menschen. Die Altersgruppe der<br />
15- bis 24-Jährigen macht 18 % der gesamten Stadtbevölkerung aus. 54 % der Bevölkerung<br />
stehen <strong>in</strong> Arbeit, 6,3 % s<strong>in</strong>d arbeitslos <strong>und</strong> 23,4 % s<strong>in</strong>d im Ruhestand oder arbeiten von<br />
Zuhause aus. Landesweit gibt es jedoch 88 Wahlkreise, <strong>in</strong> denen die Arbeitslosenquote<br />
5 Siehe www.youthreach.ie<br />
34
20 % übersteigt. Davon bef<strong>in</strong>den sich 15 <strong>in</strong> der Stadt Dubl<strong>in</strong>. In der Stadt Dubl<strong>in</strong> haben<br />
38,9 % der Bevölkerung die höhere Sek<strong>und</strong>arschulbildung nicht abgeschlossen. Im Zusammenhang<br />
mit den voranstehend dargestellten Prioritäten <strong>in</strong> Bezug auf Qualifikationen<br />
ist das e<strong>in</strong>e besondere Herausforderung. Es gibt die Notwendigkeit, gr<strong>und</strong>legende oder f<strong>und</strong>amentale<br />
Fähigkeiten zu entwickeln, wie z. B. die Fähigkeit zu Lesen, Zahlen <strong>und</strong> Technologien<br />
zu verwenden, personenbezogene Fähigkeiten wie beispielsweise Kommunikation, die Arbeit<br />
mit anderen <strong>und</strong> im Team <strong>und</strong> Fähigkeiten aus dem Bereich K<strong>und</strong>enservice, <strong>und</strong> konzeptuelle<br />
Fähigkeiten wie z. B. das Sammeln <strong>und</strong> Organisieren von Informationen, Problemlösung,<br />
Planung <strong>und</strong> Organisation, die Fähigkeit zu lernen, wie man lernt <strong>und</strong> Kreativität<br />
sowie das Denken <strong>in</strong> Systemen. Diese werden benötigt, um überhaupt e<strong>in</strong>gestellt werden<br />
zu können, sie s<strong>in</strong>d aber auch nötig, damit e<strong>in</strong>e Person erfolgreich als Bürger <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er entwickelten<br />
Wirtschaft funktionieren kann.<br />
Das VEC der Stadt Dubl<strong>in</strong> betreibt zehn Zentren, die 546 <strong>Jugendliche</strong> betreuen. Sie<br />
s<strong>in</strong>d mit <strong>in</strong>sgesamt 10 Zentrumskoord<strong>in</strong>atoren, 35 Mitarbeitern im Bereich Ressourcen <strong>und</strong><br />
mehr als 50 Teilzeitmitarbeitern ausgestattet. Dabei ist e<strong>in</strong>e Vielzahl von Herausforderungen<br />
festzustellen – e<strong>in</strong> geeignetes Programmgleichgewicht zwischen formalen Qualifikationen<br />
<strong>und</strong> wesentlichen Lebensfähigkeiten zu f<strong>in</strong>den, den Anforderungen der Nationalen<br />
Qualifikationsstrategie gerecht zu werden, e<strong>in</strong>em Ziel des „One Step Up“, die Beständigkeit<br />
zu steigern <strong>und</strong> mit Bezug auf den Fortschritt von Youthreach Möglichkeiten des Bildungsfortschritts<br />
im eigenen System des VECs anzubieten. Bei der Vermittlung dieser nationalen<br />
Belange <strong>in</strong> die lokale Realität ist e<strong>in</strong>e weitere Herausforderung festzustellen, nämlich<br />
die, die Individualität <strong>und</strong> Kreativität e<strong>in</strong>es jeden Zentrums zu bewahren, <strong>und</strong> der Neigung<br />
zu widerstehen, weiter zu gehen, um kle<strong>in</strong>e Schulen zu werden. Das Verfahren zur<br />
Evaluation <strong>und</strong> Qualitätssicherung ist deshalb als e<strong>in</strong> Mittel zur Feststellung der Effektivität<br />
dessen, was getan wird, willkommen. Das ist auch e<strong>in</strong>e Herausforderung <strong>und</strong> bedeutet, dass<br />
alle Beteiligten <strong>in</strong> den Zentren, den VEC (lokale Verwaltung) <strong>und</strong> der Abteilung für Bildung<br />
<strong>und</strong> Wissenschaft lernen. E<strong>in</strong>e weitere Herausforderung hängt mit der effektiven<br />
Verwendung e<strong>in</strong>er gezielten F<strong>in</strong>anzierung zusammen, z. B. e<strong>in</strong>er neuen Initiative als Reaktion<br />
auf die besonderen Bedürfnisse im Bildungsbereich.<br />
E<strong>in</strong>s der CDVEC Zentren bef<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> Cruml<strong>in</strong>, e<strong>in</strong>em Stadtteil im Südwesten der<br />
Stadt. Dort ist die Benachteiligung besonders hoch. Zusätzlich zu dem, was man als „normale“<br />
Muster von Drogenmissbrauch bezeichnen könnte, gibt es hier e<strong>in</strong> signifikantes lokales<br />
Problem mit Hero<strong>in</strong> <strong>und</strong> Koka<strong>in</strong>.<br />
Der wichtigste Punkt ist natürlich die Frage, ob das alles für die Lernenden funktioniert.<br />
Aus den jährlich durchgeführten Studien geht hervor, dass Youthreach extrem effektiv ist<br />
bei der Rekrutierung se<strong>in</strong>er Zielgruppen <strong>und</strong> der Entwicklung von Soft Skills. E<strong>in</strong> beträchtlicher<br />
Anteil der <strong>Jugendliche</strong>n hält sich selbst jedoch für unfähig <strong>und</strong> gibt frühzeitig auf. Im<br />
Allgeme<strong>in</strong>en passiert das bereits <strong>in</strong> der Phase des Engagements. Positiv ist, dass 50 % dieser<br />
„frühen Aussteiger“ e<strong>in</strong>em anderen Bildungs- oder Schulungsprogramm beitreten oder<br />
e<strong>in</strong>e Arbeit aufnehmen. Die anderen haben <strong>in</strong> der Regel derart schwerwiegende Probleme,<br />
dass sie zunächst e<strong>in</strong> stärker fokussiertes <strong>in</strong>ter<strong>in</strong>stitutionelles Programm benötigen, bevor<br />
sie zu Youthreach kommen. Es ist e<strong>in</strong> ausgesprochenes Ziel herauszuf<strong>in</strong>den, wie Arrangements<br />
getroffen werden können, um diese <strong>Jugendliche</strong>n zu halten.<br />
35
Von jenen, die bei Youthreach bleiben, um entweder den Gr<strong>und</strong>- oder den Fortgeschrittenenkurs<br />
abzuschließen, werden 75 % erfolgreich platziert, 80 % nach dem Fortgeschrittenenkurs.<br />
Berichterstattung AG 2: Beschäftigung<br />
Birgit Reißig<br />
E<strong>in</strong>führung<br />
Die AG 2 befasste sich mit dem Thema Beschäftigung.<br />
Zentrale Fragestellung war: Wie können benachteiligte <strong>Jugendliche</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> aus<br />
benachteiligten Regionen durch Programme <strong>in</strong> Beschäftigung gebracht werden?<br />
Dazu stellten Vertreter aus Ungarn <strong>und</strong> Irland Maßnahmen vor. Im Zentrum der Präsentation<br />
aus Ungarn stand das Programm „START“ <strong>und</strong> das regionale Arbeitsmarktprojekt<br />
„Neue Dienste – Beschäftigung für <strong>Jugendliche</strong>“.<br />
Die Vertreter aus Irland stellten das Programm „YOUTHREACH“ vor.<br />
Geme<strong>in</strong>samkeiten<br />
Die Programme aus beiden Ländern zielen auf benachteiligte <strong>Jugendliche</strong> <strong>und</strong> junge Erwachsene,<br />
wobei das irische Programm „YOUTHREACH“ direkt auf <strong>Jugendliche</strong> mit<br />
<strong>in</strong>dividuellen Benachteiligungen ausgerichtet ist, während das ungarische Programm <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
der strukturschwächsten Regionen des Landes angesiedelt ist, also eher auf regionale<br />
Benachteiligung reagiert.<br />
Dabei geht es <strong>in</strong> beiden Programmen darum, an den Kompetenzen der <strong>Jugendliche</strong>n<br />
<strong>und</strong> jungen Erwachsenen anzusetzen <strong>und</strong> diese entsprechend den Erfordernissen des Arbeitsmarktes<br />
zu fördern <strong>und</strong> zu entwickeln. Dies zum Beispiel <strong>in</strong> der Ausbildung von so<br />
genannten Schlüsselqualifikationen.<br />
In der Arbeitsgruppe wurde als weitere Geme<strong>in</strong>samkeit herausgearbeitet, dass es <strong>in</strong> beiden<br />
Programmen <strong>und</strong> den entsprechenden nationalen Strategien darauf ankommt, aus Fehlern<br />
zu lernen <strong>und</strong> so Erfolg versprechende Modelle zur beruflichen Integration von Benachteiligten<br />
zu entwickeln.<br />
Weiterh<strong>in</strong> wurde mehrfach darauf verwiesen, dass es nicht die Benachteiligung<br />
schlechth<strong>in</strong> gibt, sondern verschiedene Modelle für die differenzierten Benachteiligungsformen<br />
entwickelt werden müssen.<br />
E<strong>in</strong>e sichtbare Geme<strong>in</strong>samkeit der Programme beider Länder war die positive Bilanz,<br />
die gezogen werden konnte. So erreichten sowohl das Programm „Neue Dienste – Beschäftigung<br />
für <strong>Jugendliche</strong>“ als auch „YOUTHREACH“ e<strong>in</strong>e zu 75 % erfolgreiche Platzierung<br />
im Bildungs- <strong>und</strong> Ausbildungssystem bzw. im Beschäftigungssektor.<br />
Neben den genannten Geme<strong>in</strong>samkeiten zeigt sich auch e<strong>in</strong>e Reihe von Unterschieden<br />
<strong>in</strong> der Arbeit der beiden Länder.<br />
36
Unterschiede<br />
Der gr<strong>und</strong>sätzliche Unterschied beider Länder besteht dar<strong>in</strong>, dass <strong>in</strong> Irland sowohl Ausbildung<br />
als auch Beschäftigung als zentrale Aufgabe des Staates gefasst werden <strong>und</strong> die kommunale<br />
Ebene <strong>in</strong> diesen Bereichen ke<strong>in</strong>e bzw. kaum E<strong>in</strong>flussmöglichkeiten hat. Damit ist<br />
e<strong>in</strong>e zentrale Steuerung dieser Bereiche durch den Staat möglich. In Ungarn h<strong>in</strong>gegen ist<br />
e<strong>in</strong> Großteil des Arbeitsmarktes durch e<strong>in</strong>e zentrale Steuerung gar nicht erfassbar. So s<strong>in</strong>d<br />
73 % der erwerbsfähigen Bevölkerung durch die Arbeitsämter gar nicht erfasst. E<strong>in</strong> großer<br />
Teil von diesen Personen agiert <strong>in</strong> der so genannten ‚black economy’. Somit stellen sich<br />
nationale Strategien als schwerer durchsetzbar dar.<br />
Dementsprechend zeichnet sich die irische Strategie durch e<strong>in</strong>en übergreifenden Ansatz<br />
mehrerer M<strong>in</strong>isterien, u. a. der Ressorts Bildung <strong>und</strong> Beschäftigung aus, währen <strong>in</strong> Ungarn<br />
die nationale Strategie hauptsächlich im Beschäftigungsressort verortet ist. Daraus ergeben<br />
sich e<strong>in</strong>e Reihe weiterer Unterschiede. So erfolgt die Steuerung der irischen Strategie auf<br />
nationaler Ebene <strong>und</strong> f<strong>in</strong>det ihre Entsprechung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er lokalen flexiblen Umsetzung, während<br />
das ungarische Programm ausschließlich regional bzw. lokal gesteuert wird. Daraus<br />
ergeben sich auch Unterschiede h<strong>in</strong>sichtlich der beteiligten Akteure. In Irland haben wir<br />
nationale <strong>und</strong> lokale Akteure aus unterschiedlichen professionellen Bezügen. In Ungarn<br />
f<strong>in</strong>den wir hauptsächlich die regionalen <strong>und</strong> lokalen Arbeitsagenturen als zentrale Akteure.<br />
E<strong>in</strong> weiterer deutlicher Unterschied offenbart sich, wenn man die jeweiligen Laufzeiten<br />
der von beiden Ländern vorgestellten Programme betrachtet. So kann das irische Programm<br />
„YOUTHREACH“ auf e<strong>in</strong>e bereits 19-jährige Tradition <strong>und</strong> Erfahrung zurückblicken<br />
<strong>und</strong> wird auch – zum<strong>in</strong>dest – bis 2016 fortgeführt. Dabei wurde das Instrumentarium<br />
<strong>und</strong> Design des Programms auf der Gr<strong>und</strong>lage <strong>in</strong>terner <strong>und</strong> externer Evaluation ständig<br />
angepasst <strong>und</strong> weiterentwickelt. Im Gegensatz dazu sehen die gesetzlichen Vorgaben <strong>in</strong><br />
Ungarn ke<strong>in</strong>e längeren Laufzeiten für Modellvorhaben als drei Jahre vor.<br />
Handlungsempfehlungen<br />
Handlungsempfehlungen ergeben sich aus der Diskussion <strong>in</strong> unserer Arbeitsgruppe auf<br />
verschiedenen Ebenen.<br />
Auf der Ebene der direkten Programmumsetzung geht es vor allem darum, sehr passgenaue<br />
Angebote zu entwickeln, die e<strong>in</strong>en ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Dabei müssen<br />
alle Lebensbereiche der <strong>Jugendliche</strong>n <strong>und</strong> jungen Erwachsenen – <strong>und</strong> nicht alle<strong>in</strong> die Arbeitswelt<br />
– <strong>in</strong> den Blick genommen werden. Dazu gehört auch, wesentlich früher als bislang<br />
Familien e<strong>in</strong>zubeziehen, ihre Potentiale zu stärken <strong>und</strong> Erziehungskompetenzen zu<br />
fördern.<br />
Als e<strong>in</strong> wesentlicher Punkt bei der Förderung von Benachteiligten wurde benannt, dass<br />
man diese Zielgruppe nicht mit e<strong>in</strong>er low-level-F<strong>in</strong>anzierung aktivieren kann. Das irische<br />
Beispiel zeigt, dass gerade für die Arbeit mit Benachteiligten e<strong>in</strong>e entsprechende Qualität<br />
des Personals <strong>und</strong> der Infrastruktur unerlässlich ist.<br />
Dieser hohe Standard kann sich besonders gut im Rahmen von langfristigen Strategien<br />
entwickeln. Aufgr<strong>und</strong> von veränderten Anforderungen im Verlauf von Programmen <strong>und</strong><br />
37
Strategien ist e<strong>in</strong>e begleitende Evaluation notwendig, die darauf reagieren <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Anpassung<br />
auf den verschiedenen Steuerungsebenen herbeiführen kann.<br />
E<strong>in</strong> wichtiger Punkt <strong>in</strong> der Diskussion der Arbeitsgruppe war die Frage der Passfähigkeit<br />
von Anforderungen an Ausbildung <strong>und</strong> Arbeit sowie deren Realisierung. Dabei erwies<br />
es sich als Problem, dass Unternehmen häufig nicht <strong>in</strong> der Lage s<strong>in</strong>d, konkrete Anforderungsprofile<br />
für zukünftige Arbeitnehmer zu formulieren. Daraus ergibt sich e<strong>in</strong>e letzte<br />
Empfehlung für den Beschäftigungsbereich: Es müssen Programme geschaffen werden, die<br />
Arbeitgeber genau dazu befähigen, mit den anderen Akteuren des Beschäftigungssystems<br />
zu kooperieren <strong>und</strong> zukunftsfähige Anforderungsprofile zu entwickeln.<br />
38
Arbeitsgruppe 3: Multikulturelles Zusammenleben<br />
Präsentation Tschechische Republik<br />
Katar<strong>in</strong>a Klamková, IQ Roma Service Brno<br />
Sona Kotibova, Schlesische Diakonie Cesky Tes<strong>in</strong><br />
Integrationsstrategien für junge Roma am<br />
Beispiel des IQ Roma Servis<br />
Tschechische Republik<br />
Die Roma-M<strong>in</strong>derheit ist e<strong>in</strong>e offiziell anerkannte (<strong>und</strong> die größte K. Klamková<br />
sichtbare, unbeliebteste) ethnische M<strong>in</strong>derheit, die sowohl <strong>in</strong><br />
wirtschaftlicher als auch sozialer H<strong>in</strong>sicht eher benachteiligt <strong>und</strong> mit e<strong>in</strong>em hohen Risiko<br />
der <strong>sozialen</strong> Ausgrenzung konfrontiert ist. In der Tschechischen Republik leben ca.<br />
250.000 bis 300.000 Roma (ca 3 % von 10 Mio. Tschechen). Dies s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e offiziellen<br />
Angaben, sondern lediglich Schätzungen (bei Volkszählungen gibt nur e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>e Anzahl<br />
von Roma ihre Roma- Herkunft an). Viele leben <strong>in</strong> den folgenden Städten: Prag, Brünn,<br />
Ostrava, Most, Chomutov, Ústí nad Labem, etc. Mit e<strong>in</strong>er hohen Geburten- <strong>und</strong> Sterblichkeitsrate<br />
gehören sie zu den so genannten „sehr jungen Geme<strong>in</strong>schaften“, obgleich der<br />
Kreislauf der <strong>sozialen</strong> Ausgrenzung sich <strong>in</strong> den Generationen wiederholt.<br />
Es besteht die Hoffnung, die praktischen Instrumente des Europäischen Sozialfonds<br />
<strong>und</strong> des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 2007 bis 2013 effizient zu nutzen,<br />
um bedeutende Änderungen zu erleichtern, <strong>in</strong>sbesondere im H<strong>in</strong>blick auf den Zugang zu<br />
effektiven Sozialdiensten, Unterstützung <strong>in</strong> den Bereichen Bildung <strong>und</strong> Arbeit, <strong>in</strong>sbesondere<br />
<strong>in</strong> den Roma-Geme<strong>in</strong>schaften, um den Kreislauf der <strong>sozialen</strong> Ausgrenzung zu durchbrechen.<br />
Verantwortliche Organe für die Frage der Roma<br />
Es gibt zwei beratende Organe der Regierung, die <strong>in</strong> die Integration von Mitgliedern der<br />
Roma-Geme<strong>in</strong>schaften <strong>in</strong>volviert s<strong>in</strong>d – Der Rat der Regierung der Tschechischen Republik für die<br />
Angelegenheiten der Roma-Geme<strong>in</strong>schaft6<strong>und</strong> der Rat der Regierung der Tschechischen Republik für nationale<br />
M<strong>in</strong>derheiten. Beides s<strong>in</strong>d motivierende <strong>und</strong> beratende Organe der Regierung <strong>und</strong> haben<br />
ke<strong>in</strong>e direkten Ausführungsbefugnisse. Schlüsseldokument ist das Gr<strong>und</strong>satzkonzept<br />
zur Integration der Roma.<br />
Mit diesen Ungleichheiten befassen sich darüber h<strong>in</strong>aus spezialisierte Abteilungen im<br />
M<strong>in</strong>isterium für Arbeit <strong>und</strong> Soziales (MoISa) <strong>und</strong> dem M<strong>in</strong>isterium für Bildung, Jugend<br />
6 Der Rat für die Angelegenheiten der Roma-Geme<strong>in</strong>schaft (CRCA) wurde durch den Erlass der Regierung der Tschechischen<br />
Republik vom 17. September 1997, Nr. 581 gegründet. Der Rat unterstützt auf systematisch die Integration<br />
der Roma-Geme<strong>in</strong>schaft <strong>in</strong> die Gesellschaft. Er unterstützt die Kooperation der M<strong>in</strong>isterien, die für die Umsetzung von<br />
Teilmaßnahmen <strong>und</strong> die Erfüllung der Aufgaben aus den Resolutionen der Regierung <strong>und</strong> <strong>in</strong>ternationalen Verträgen,<br />
denen die Tschechische Republik beigetreten ist, verantwortlich s<strong>in</strong>d. Er sammelt, begutachtet <strong>und</strong> legt der Regierung<br />
Informationen <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>legende Dokumente <strong>und</strong> Vorschläge zur Gestaltung <strong>und</strong> Anwendung der Regierungspolitik im<br />
Bereich der Integration der Roma-Geme<strong>in</strong>schaften vor. Ausführlichere Informationen über die Zusammensetzung <strong>und</strong><br />
die Aufgaben des Rates s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Satzung festgelegt. Se<strong>in</strong>e Verfahren werden durch die Verfahrensregeln bestimmt.<br />
Die Aktivitäten des Rates (e<strong>in</strong>schließlich der Aktivitäten se<strong>in</strong>er Ausschüsse <strong>und</strong> Arbeitsgruppen) werden von<br />
dem Büro unterstützt, das e<strong>in</strong>e strukturelle E<strong>in</strong>heit der Regierungsbehörde der Tschechischen Republik ist.<br />
39
<strong>und</strong> Sport. Andere M<strong>in</strong>isterien s<strong>in</strong>d ebenfalls <strong>in</strong>volviert (Kultur, Inneres, etc.). Der Rat der<br />
Regierung der Tschechischen Republik für die Angelegenheiten der Roma-Geme<strong>in</strong>schaft<br />
„koord<strong>in</strong>iert“ (solange die Befugnisse dies ermöglichen) die Maßnahmen <strong>und</strong> Strategien<br />
verschiedener M<strong>in</strong>isterien.<br />
Lokale/regionale Regierung: Institutionen, die auf lokaler Ebene agieren, schließen ebenfalls<br />
Berater aus den Reihen der Roma e<strong>in</strong> (optional auf Ebene der Geme<strong>in</strong>den) <strong>und</strong> Koord<strong>in</strong>atoren<br />
der Berater der Roma bei regionalen Behörden (obligatorisch), die i. d. R. Roma<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
Strategische Schlüsseldokumente<br />
Das Hauptgr<strong>und</strong>satzkonzept <strong>in</strong> der Tschechischen Republik mit Bezug auf die ethnische<br />
M<strong>in</strong>derheit der Roma ist das Konzept des Kampfes gegen die soziale Ausgrenzung. Unter<br />
sozialer Ausgrenzung versteht die CZR e<strong>in</strong>en „Prozess (2006, MoISA, Gabal), <strong>in</strong> dem Individuen,<br />
e<strong>in</strong>e Gruppe von Individuen oder e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>schaft am Zugang zu Ressourcen,<br />
Positionen <strong>und</strong> Möglichkeiten geh<strong>in</strong>dert werden, die e<strong>in</strong>e Partizipation an <strong>sozialen</strong>, wirtschaftlichen<br />
<strong>und</strong> politischen Aktivitäten der Mehrheitsgesellschaft ermöglichen, oder ihnen<br />
der Zugang dazu vollständig verweigert wird.“ 2006 untersuchte MoLSA die Orte <strong>und</strong><br />
Geme<strong>in</strong>den sozial ausgegrenzter Roma sowie die Aufnahmekapazität von Menschen, die<br />
auf dem Gebiet arbeiten, was e<strong>in</strong>er besseren Koord<strong>in</strong>ation von Informationen, Gr<strong>und</strong>sätzen<br />
<strong>und</strong> Programmen dienen sollte.<br />
Die wesentlichen nationalen tschechischen Strategien <strong>und</strong> Pläne, die sich mit diesem<br />
Phänomen befassen, s<strong>in</strong>d 7 :<br />
Speziell auf Roma ausgerichtet:<br />
a) Gr<strong>und</strong>satzkonzept zur Integration der Roma.<br />
b) Die Roma Decade Maßnahme – das Programm „Decade of Roma Inclusion 2005-<br />
2015“ [Jahrzehnt der E<strong>in</strong>gliederung der Roma] ist e<strong>in</strong> beispielloses politisches Engagement<br />
von Regierungen <strong>in</strong> Mittel- <strong>und</strong> Südosteuropa für die Verbesserung des<br />
sozial-wirtschaftlichen Status <strong>und</strong> der <strong>sozialen</strong> E<strong>in</strong>gliederung der Roma auf regionaler<br />
Ebene. Es handelt sich hierbei um e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>ternationale Initiative, die Regierungen,<br />
zwischenstaatliche Organisationen <strong>und</strong> Nichtregierungsorganisationen sowie<br />
Zivilgesellschaften der Roma vere<strong>in</strong>t, um den Fortschritt h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>er Verbesserung<br />
der Situation der Roma zu beschleunigen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>en solchen Fortschritt auf transparente<br />
<strong>und</strong> messbare Weise zu prüfen. Das Decade-Programm legt den Schwerpunkt<br />
auf die prioritären Bereiche Bildung, Arbeit, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Wohnen <strong>und</strong> verpflichtet<br />
Regierungen die anderen Kernbereiche Armut, Diskrim<strong>in</strong>ierung <strong>und</strong> Gender<br />
Ma<strong>in</strong>stream<strong>in</strong>g zu berücksichtigen.<br />
7 <strong>Jugendliche</strong> Roma als Gruppe werden mit besonderer Bedeutung <strong>in</strong> diese Strategien <strong>in</strong>tegriert, um den Kreislauf der<br />
<strong>sozialen</strong> Ausgrenzung zu unterbrechen, den Bildungsgrad <strong>und</strong> die E<strong>in</strong>stellbarkeit zu erhöhen <strong>und</strong> <strong>sozialen</strong> Pathologien<br />
vorzubeugen.<br />
40
Allgeme<strong>in</strong> ausgerichtet:<br />
Nationaler Aktionsplan zur <strong>sozialen</strong> E<strong>in</strong>gliederung (2006-2008) – beschäftigt sich mit<br />
Aspekten wie Arbeit, E<strong>in</strong>stellbarkeit, M<strong>in</strong>destlohn, Wohnung, Bildung, Verh<strong>in</strong>dern von<br />
sozialem Ausschluss <strong>und</strong> <strong>sozialen</strong> Pathologien (z. B. auch Roma).<br />
Die Umsetzung dieser tschechischen nationalen Strategien <strong>und</strong> Pläne sowie die Integrationsmaßnahmen<br />
<strong>in</strong> der Tschechischen Republik können <strong>in</strong> 3 Basisgruppen e<strong>in</strong>geteilt werden:<br />
(1) Politik, Programme <strong>und</strong> <strong>in</strong>stitutionelle Maßnahmen, die e<strong>in</strong>e zentrale nationale Regierung<br />
<strong>in</strong>itiiert (Sozialarbeiter der Geme<strong>in</strong>de, Lehrerassistenten, Koord<strong>in</strong>atoren der Berater<br />
der Roma bei den regionalen Behörden, Berater der Roma <strong>und</strong> Assistenten auf Geme<strong>in</strong>deebene),<br />
(2) Maßnahmen 8 von Selbstverwaltungen <strong>und</strong> Geme<strong>in</strong>den (auf der Ebene<br />
der Regionen <strong>und</strong> Städte; es gibt 14 Regionen <strong>in</strong> der CZR) <strong>und</strong> (3) Projekte, die durch geme<strong>in</strong>nützige<br />
Nichtregierungsorganisationen umgesetzt wurden, häufig mit f<strong>in</strong>anzieller Unterstützung<br />
vom Staat, der Region, Stadt, EU – ESF, ERDF. Gute Ergebnisse werden an<br />
Orten erzielt, <strong>in</strong> denen e<strong>in</strong>e NGO mit der hilfreichen Haltung e<strong>in</strong>er Selbstverwaltung existiert<br />
(unterstützt von gut gestalteten Bed<strong>in</strong>gungen auf nationaler Ebene). Der aktiven Teilnahme<br />
der Zielgruppe kommt ebenfalls e<strong>in</strong>e bedeutende Rolle zu.<br />
Projekte, die von wohltätigen Nichtregierungsorganisationen umgesetzt<br />
werden – lokale Beispiele guter Praxis<br />
Diese Projekte: e<strong>in</strong>s aus der Region Südmähren (NGO – zivile Vere<strong>in</strong>igung IQ Roma servis<br />
– CIP Equal – IQ servis – System für e<strong>in</strong>en Erfolg der Roma auf dem Arbeitsmarkt) &<br />
e<strong>in</strong>s aus der Mährisch-Schlesischen Region (NGO – Slezska diakonie) s<strong>in</strong>d offiziell anerkannt<br />
als praktische Träger der nationalen Strategie, NAPSI, Decade, das Gr<strong>und</strong>satzkonzept<br />
zur Integration der Roma:<br />
Equal-Initiative<br />
Projektname: IQ servis - System für den Erfolg der Roma auf dem Arbeitsmarkt<br />
Projektnummer CZ.04.4.09/4.1.00.4/0077<br />
Bezirk Stadt Brünn, Region Südmähren<br />
Budget Ca. 1 Mio. Euro<br />
Beg<strong>in</strong>n 16. September 2005<br />
Ende 30. Juni 2008<br />
Hauptträger des Projektes:<br />
Nichtregierungs- <strong>und</strong> wohltätige Organisation – IQ Roma servis<br />
8 In Übere<strong>in</strong>stimmung mit den nationalen allgeme<strong>in</strong>en Strategien können sie im Rahmen dieser Strategien ihre eigene<br />
konkrete Strategie, Aktionsplan (i.d.R. mit Sozialdiensten verb<strong>und</strong>en) entwickeln, z. B. Region Moravskoslezsky: Strategie<br />
zur Integration der Roma 2006-2009, Konzept der Sozialdienste <strong>in</strong> der Mährisch-Schlesischen Region (hohe Qualität,<br />
gleicher Ansatz für alle, Kooperation), Programm zur Prävention von Krim<strong>in</strong>alität, Strategie der Antidrogenpolitik<br />
2005-2009.<br />
41
Vision von IQ Roma servis: Wir möchten e<strong>in</strong>e Welt, <strong>in</strong> der aufrichtige <strong>und</strong> fre<strong>und</strong>schaftliche<br />
Beziehungen zwischen Roma <strong>und</strong> der mehrheitlichen Bevölkerung bestehen,<br />
e<strong>in</strong>e Welt, <strong>in</strong> der die Roma ganz natürlich würdige soziale Rollen mit Bezug zu ihrer Kultur<br />
<strong>und</strong> ihrer Nationalität e<strong>in</strong>nehmen.<br />
Entwicklung der Partnerschaft: Partnerschaft für den Erfolg der Roma auf dem Arbeitsmarkt<br />
– 12 nationale Partner s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>volviert: Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> weiterführende Schulen,<br />
Universitäten, Freizeitzentren, Forschungszentren, Arbeitsagentur, Stadt Brünn, Region<br />
Südmähren.<br />
Das Projekt verb<strong>in</strong>det Experten der Geme<strong>in</strong>de (Geme<strong>in</strong>dearbeiter, Mitglieder, Aktivisten,<br />
Teilnehmer) mit Experten aus Institutionen (Forscher, Lehrer, öffentliche Verwaltung,<br />
etc.), um neue Verfahren für präventive Programme, die Entwicklung effektiverer <strong>und</strong> zugänglicher<br />
Dienste <strong>und</strong> E<strong>in</strong>gliederungsstrategien zu gestalten.<br />
Das Projektverfahren deckt die gesamte Familie der Roma ab. Zielgruppen s<strong>in</strong>d sowohl<br />
<strong>K<strong>in</strong>der</strong> als auch <strong>Jugendliche</strong>, <strong>in</strong>sbesondere im Alter von 13 bis 18 Jahren sowie deren Eltern<br />
<strong>und</strong> Familienmitglieder.<br />
Die Hauptgruppe: Roma zwischen 13 <strong>und</strong> 18 Jahren<br />
Die Projektaktivitäten s<strong>in</strong>d mite<strong>in</strong>ander verb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> bauen auf 5 Säulen auf.<br />
1. Motivations- <strong>und</strong> Stimulationszentrum (Theaterausbildung, EEG Biofeedback,<br />
Fotografie, Filmklubs, etc.)<br />
2. Bildungszentrum (Förderunterricht, Schul- <strong>und</strong> Berufsberatungszentrum, Englischunterricht,<br />
IT-Unterricht, etc.)<br />
3. Zentrum für Informationen <strong>und</strong> Unterstützung auf dem Arbeitsmarkt (Berufsberatung,<br />
Bildungs- <strong>und</strong> Schulungsprogramme)<br />
4. Präventionszentrum (soziale <strong>und</strong> juristische Beratung, Antidiskrim<strong>in</strong>ierungsdienst,<br />
Sozialarbeiter)<br />
5. Bewertung, Koord<strong>in</strong>ation, PR & Medienzentrum<br />
Projektergebnisse <strong>in</strong> den Jahren 2005 bis 2007:<br />
a) 90 % der Teilnehmer besuchten die Sek<strong>und</strong>arschule.<br />
b) 140 Teilnehmer lernen Englisch oder erwerben IT-Kenntnisse.<br />
c) 100 <strong>Jugendliche</strong> s<strong>in</strong>d an motivierenden Maßnahmen beteiligt.<br />
d) 116 Teilnehmer fanden Arbeit (mit unserer Unterstützung), 60 von ihnen arbeiten<br />
mehr als 2 Monate.<br />
e) Drei Teilnehmer s<strong>in</strong>d an der Vorbereitungsphase für neue Projekte für die Geme<strong>in</strong>de<br />
beteiligt.<br />
f) Fünf Frauen schlossen den Kurs zur Projektassistent<strong>in</strong> ab, 4 Mädchen schlossen e<strong>in</strong>e<br />
Schulung zur Hostess für Messen <strong>und</strong> Ausstellungen ab.<br />
g) 54 Teilnehmer erwarben IT-Kenntnisse <strong>und</strong> 12 nehmen an Englischkursen teil.<br />
h) 190 Teilnehmer erhielten Beratung durch <strong>in</strong>terne Mitarbeiter oder Sozialarbeiter.<br />
42
37 % der Anfragen der Teilnehmer betrafen Unterkunft, 18 % Schulden, 16 % Zuschüsse,<br />
14 % Rechtsberatung.<br />
30 % der Anfragen der Teilnehmer konnten erfolgreich <strong>und</strong> <strong>in</strong> Zusammenarbeit mit<br />
dem Teilnehmer gelöst werden. Nur 3 % der Anfragen der Teilnehmer blieben erfolglos.<br />
E<strong>in</strong>ige Anfragen laufen noch.<br />
E<strong>in</strong> gutes praktisches Beispiel:<br />
Unterstützung im Bereich Fortbildung.<br />
Zu Beg<strong>in</strong>n nahm die Mutter von I.J. die soziale <strong>und</strong> juristische Beratung <strong>und</strong> Dienste von<br />
IQ Roma servis <strong>in</strong> Anspruch. Gleichzeitig erfuhr sie vom Schulberatungsdienst, den die<br />
Organisation ebenfalls anbot, <strong>und</strong> schickte ihre Tochter I.J. dort h<strong>in</strong>.<br />
I.J. war <strong>in</strong> der vierten Klasse der Sek<strong>und</strong>arschule, was bedeutete, dass sie entscheiden<br />
musste, was sie nach Abschluss der Schule tun wollte.<br />
Im Januar 2007 befragte der Schulberater von IQ Roma servis das Mädchen <strong>und</strong> formulierte<br />
die wesentlichen Probleme ihrer Situation. Zunächst war es für sie aufgr<strong>und</strong> familiärer<br />
Probleme extrem schwer, Hausaufgaben zu machen <strong>und</strong> sich auf die Schule vorzubereiten.<br />
Zweitens hatte sie ernsthafte Probleme mit Mathematik, wodurch sie möglicherweise nicht<br />
ihren Abschluss bekommen hätte. Drittens wollte I.J. versuchen, an e<strong>in</strong>er Universität aufgenommen<br />
zu werden.<br />
Angesichts dieser Situation nahm sie bei IQ Roma servis Nachhilfeunterricht <strong>in</strong> Mathematik,<br />
verbesserte <strong>in</strong> der Folge ihre Leistungen im Fach Mathematik <strong>und</strong> durfte den<br />
Schulabschluss machen. Im Februar 2007 bewarb sie sich an der Universität <strong>und</strong> bereitet<br />
sich nun bei IQ Roma servis auf die Aufnahmeprüfungen vor. Während der Vorbereitung<br />
stellte sich heraus, dass das EEG-Biofeedbacktra<strong>in</strong><strong>in</strong>g für dieses Mädchen sehr s<strong>in</strong>nvoll<br />
war.<br />
Aktivitäten, an denen sie bei IQ Roma servis teilnahm, unterstützten <strong>und</strong> motivierten sie<br />
für zukünftige Bemühungen <strong>und</strong> Ambitionen. Jetzt erklärt I.J., dass sie sich selbstsicherer<br />
fühle <strong>und</strong> ihre positiven Erfahrungen des schrittweisen Bildungserfolgs mit ihren Fre<strong>und</strong>en<br />
teilen kann. Die Unterstützung seitens der Organisation war für sie <strong>und</strong> ihre Familie sehr<br />
wichtig.<br />
Ma<strong>in</strong>stream<strong>in</strong>g, Darstellung der Fähigkeiten <strong>und</strong> Tätigkeiten der Teilnehmer:<br />
a) Fotoausstellung – auch e<strong>in</strong>sehbar unter www.jaktovidimja.cz<br />
b) Öffentliche Aufführungen im Jonglieren, Roma-Tanz<br />
c) Musiktheater (Gypsies go to heaven)<br />
d) Theatervorlesungen (Vorführungen der Theatergruppe <strong>in</strong> Schulen, im Klub, <strong>in</strong> der<br />
Öffentlichkeit)<br />
e) Europäisches Netzwerk gegen Armut – 5. Treffen der <strong>in</strong> Armut lebenden Menschen<br />
f) Beteiligung an dem Planungsverfahren der Sozialdienste der Stadt Brünn<br />
43
Empfehlung (was funktioniert):<br />
− Verfahren, das die ganze Familie e<strong>in</strong>schließt<br />
− Individuelle <strong>und</strong> langfristige Begleitung <strong>und</strong> Unterstützung für e<strong>in</strong>en erfolgreichen<br />
Übergang von der Gr<strong>und</strong>schulbildung zur Sek<strong>und</strong>arschulbildung<br />
− Verbesserung der Konzentration durch EEG Biofeedback<br />
− Selbstdarstellung <strong>und</strong> Verbesserung der persönlichen Würde durch öffentliche<br />
Aktivitäten<br />
− Direkte Intervention durch Sozialarbeiter <strong>und</strong> Beratung<br />
− ERDF-Programm<br />
Projektname: Contact II – Bohumín, – Karv<strong>in</strong>á<br />
44<br />
Projektnummer CZ.04.1.05/3.2.81.1<br />
Bezirk Stadt Bohum<strong>in</strong>, Karv<strong>in</strong>á, Region<br />
Budget 200.000 Euro<br />
Beg<strong>in</strong>n 1. März 2006<br />
Ende 31 .März 2007<br />
Hauptträger des Projektes: Nichtregierungs- <strong>und</strong> wohltätige Organisation – Schlesische<br />
Diakonie<br />
Entwicklung der Partnerschaft: Apostolische Kirche, Kofoedov Schule, Stadt Bohum<strong>in</strong>.<br />
Das Projekt versuchte, den Beratungsservice, der <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie von Roma-Teilnehmer<br />
genutzt wird, sich aber auch an sozial schwache Teilnehmer aus den Städten Bohum<strong>in</strong> <strong>und</strong><br />
Karv<strong>in</strong>a richtet, zu erweitern. Durch das methodische Vorgehen unseres Beratungsdienstes<br />
wurde das Ziel erreicht.<br />
Vision des Projektes: Hilfe zur Selbsthilfe<br />
Die Hauptgruppe: Roma-<strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> -<strong>Jugendliche</strong> zwischen 13 <strong>und</strong> 18 Jahren<br />
Die Projektaktivitäten basierten auf 4 Hauptsäulen:<br />
− Beratung<br />
− M<strong>in</strong>ikurse<br />
− Niedrigschwellige Zentren<br />
− Entwicklung e<strong>in</strong>er Methodologie<br />
Im Detail konzentriert sich das Projekt auf<br />
− Entwicklung von Beratungsmethoden<br />
− (gedruckt <strong>und</strong> im Internet, etc.)<br />
− Erstellen von Handbüchern für kle<strong>in</strong>e Klassen<br />
− Entwickeln e<strong>in</strong>e Methodologie für Kurse<br />
− E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>den von zwei niedrigschwelligen Zentren <strong>in</strong> Karv<strong>in</strong>a <strong>und</strong> Bohum<strong>in</strong> für<br />
kle<strong>in</strong>e <strong>K<strong>in</strong>der</strong> (Netzwerk von Sozialdiensten <strong>und</strong> Hilfe für die ganze Familie)<br />
− Entwicklung e<strong>in</strong>er neuen Methode für niedrigschwellige Zentren<br />
− (Förderunterricht, Schul- <strong>und</strong> Berufsberatungszentrum, Englischunterricht, IT-<br />
Unterricht, etc.)<br />
− Zentrum für Informationen <strong>und</strong> Unterstützung auf dem Arbeitsmarkt<br />
− Bewertung, Koord<strong>in</strong>ation, PR & Medienzentrum
Projektergebnisse <strong>in</strong> den Jahren 2006 bis 2007:<br />
a) 130 Teilnehmer schlossen Kurse <strong>in</strong> Bohum<strong>in</strong> ab.<br />
b) 95 Teilnehmer schlossen Kurse <strong>in</strong> Karv<strong>in</strong>a ab.<br />
c) Teilnahme von 20 <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n täglich <strong>in</strong> niedrigschwelligen Zentren (95 % - 100 %<br />
Roma-<strong>K<strong>in</strong>der</strong>) <strong>in</strong> Bohum<strong>in</strong>.<br />
d) Teilnahme von 35 bis 40 <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n täglich <strong>in</strong> niedrigschwelligen Zentren<br />
(70 % Roma-<strong>K<strong>in</strong>der</strong>)<br />
e) Angebot von mehr als 600 Maßnahmen<br />
f) Schaffung von 2 neuen Arbeitsplätzen <strong>und</strong> 10 Freiwilligen<br />
E<strong>in</strong> gutes praktisches Beispiel:<br />
Das Projekt Contact existiert heute <strong>in</strong> der dritten Auflage. Besonders bei Roma ist es sehr<br />
beliebt. Insbesondere die M<strong>in</strong>ikurse, die <strong>in</strong> E<strong>in</strong>heiten von 4 bis 6 St<strong>und</strong>en organisiert s<strong>in</strong>d,<br />
s<strong>in</strong>d sehr beliebt (Themen: Kochen, PC, Internet, Handarbeit). Die Teilnahme der Roma<br />
mit Bezug auf ihre kulturelle Mentalität wird nicht möglich se<strong>in</strong>. 2007 verdreifachte sich die<br />
Teilnahme an Kursen mit der Bezeichnung „Stärkung sozialer Kompetenzen“, was das<br />
zunehmende Interesse der Roma am <strong>sozialen</strong> Leben verdeutlicht.<br />
Ma<strong>in</strong>stream<strong>in</strong>g:<br />
a) Geme<strong>in</strong>same Aktivitäten mit anderen Jugende<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> Bohum<strong>in</strong> <strong>und</strong><br />
Karv<strong>in</strong>a<br />
b) Öffentliche Aufführungen, z. B. S<strong>in</strong>gen, Roma-Tanz<br />
c) Kurse zur Stärkung sozialer Kompetenzen (Sozialrecht, Krim<strong>in</strong>alität,<br />
soziale Vorteile)<br />
Kontakt:<br />
IQ Roma servis<br />
Hybešova 41, Brno 602 00, Tschechische Republik<br />
Tel.: +420 543 213 310, Fax: +420 543 214 809<br />
iqrs@iqrs.cz<br />
www.iqrs.cz<br />
www.jaktovidimja.cz<br />
Schlesische Diakonie, Na Nivách 7, Český Těšín, 737 01, Tschechische Republik<br />
Tel.: +420 558 764 347, Fax: +420 558 764 301<br />
www.slezskadiakonie.cz<br />
Rat der Regierung der Tschechischen Republik für Angelegenheiten der Roma Regierungsbehörde<br />
der Tschechischen Republik, Vladislavova 4,110 00 Prag 1; Postanschrift: nábřeží Edvarda Beneše<br />
4, 118 01 Prague 1;<br />
Tel.: +420 296 153 511<br />
Fax: +420 224 946 615<br />
E-Mail: krp@vlada.cz<br />
45
Präsentation Litauen<br />
Tadas Leončikas, Institut für Sozialforschung Vilnius<br />
Svetlana Novopolskaja, Roma Community Centre Vilnius<br />
Graž<strong>in</strong>a Savickaja, Abteilung für Nationale M<strong>in</strong>derheiten <strong>und</strong> im<br />
Ausland lebende Litauer unter der Regierung der Republik Litauen<br />
Vilnius<br />
„Geme<strong>in</strong>dezentren für Roma“ als Beispiel für<br />
neue Integrationsstrategien <strong>in</strong> Litauen<br />
Roma <strong>in</strong> Litauen: Ausgangssituation<br />
46<br />
G. Savickaja<br />
Laut Schätzungen leben etwa 3.000 Roma <strong>in</strong> Litauen, dessen Bevölkerung 3,4 Millionen<br />
E<strong>in</strong>wohner umfasst. In der Volkszählung von 2001 beschrieben 16,5 % der Bevölkerung<br />
ihre Volkszugehörigkeit als nicht-litauisch <strong>und</strong> 2.571 Personen registrierten sich als Roma/Zigeuner.<br />
Roma leben überall <strong>in</strong> Litauen. Ihre Zahl konzentriert sich jedoch <strong>in</strong> oder <strong>in</strong> der Nähe<br />
weniger größerer Städte. So kle<strong>in</strong> die Gesamtgeme<strong>in</strong>schaft auch se<strong>in</strong> mag, so hat sie doch<br />
ihre zentrale Sprache erhalten <strong>und</strong> be<strong>in</strong>haltet e<strong>in</strong>e Vielfalt von Traditionen. Ungeachtet der<br />
kulturellen <strong>und</strong> gesellschaftlichen Vielfalt <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>schaft leben viele Familien ohne<br />
die Sicherheit von E<strong>in</strong>kommen oder Beschäftigung, ohne Aussichten auf e<strong>in</strong>e Verbesserung<br />
der Wohnsituation; ihre <strong>K<strong>in</strong>der</strong> stehen außerhalb des Bildungssystems <strong>und</strong> s<strong>in</strong>d damit<br />
auch ohne berufliche Ausbildung.<br />
Obwohl diese Probleme für alle Roma überall im Land gelten, ist die Lage <strong>in</strong> Kirtimai,<br />
der größten Siedlungskonzentration der Roma, am kompliziertesten. Kirtimai ist e<strong>in</strong>e Ghetto-artige<br />
Siedlung <strong>in</strong> den <strong>in</strong>dustriellen Randgebieten von Vilnius, <strong>in</strong> der etwa 500 E<strong>in</strong>wohner<br />
leben. Viele der Schwierigkeiten, mit denen die Roma-Geme<strong>in</strong>schaft zu kämpfen hat,<br />
hängen mit der Armut zusammen. Darüber h<strong>in</strong>aus leidet die Kirtimai-Siedlung auch unter<br />
Problemen, die durch illegalen Drogenhandel entstehen. Dieses Image der Beziehung zur<br />
Krim<strong>in</strong>alität schädigt das Ansehen der Roma <strong>in</strong> der Gesellschaft; Umfragen <strong>in</strong> den Jahren<br />
2000 bis 2007 zeigten, dass 67 bis 77 % der Bevölkerung ke<strong>in</strong>e Roma als Nachbarn haben<br />
wollten.<br />
Fast die Hälfte der litauischen Roma ist jünger als 20 Jahre (46 % laut Volkszählung von<br />
2001), während diese Altersklasse im Landesdurchschnitt 27 % der Bevölkerung ausmacht.<br />
Diese Zahl deutet darauf h<strong>in</strong>, dass Bildung <strong>und</strong> e<strong>in</strong> erfolgreicher E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> den Arbeitsmarkt<br />
für die zukünftige Entwicklung dieser Geme<strong>in</strong>schaft maßgeblich se<strong>in</strong> werden. Für<br />
sozial benachteiligte jugendliche Roma ist es besonders wichtig, dass E<strong>in</strong>kommensquellen<br />
alternativ zur Krim<strong>in</strong>alität gef<strong>und</strong>en werden.<br />
Im Moment existiert jedoch e<strong>in</strong>e große Anzahl Roma, die nicht Litauisch sprechen. Anders<br />
als bei anderen M<strong>in</strong>derheiten, <strong>in</strong> denen die jüngere Generation besser Litauisch beherrscht<br />
als die älteren Leute, zeigen die Roma e<strong>in</strong>e „umgekehrte Verteilung“. Die immer<br />
schlechtere Beherrschung des Litauischen unter den jüngeren Roma könnte e<strong>in</strong> Indiz dafür<br />
se<strong>in</strong>, dass sich die Abgrenzung etwa während des letzten Jahrzehnts verstärkt hat.<br />
Trotz ihrer zahlenmäßig ger<strong>in</strong>gen Größe wird die Roma-M<strong>in</strong>derheit von den bisher<br />
verwirklichten staatlichen Maßnahmen nur wenig bee<strong>in</strong>flusst. E<strong>in</strong>e Studie im Jahre 2004
zeigte zwar, dass <strong>in</strong> den letzten Jahren e<strong>in</strong>ige Veränderungen h<strong>in</strong>sichtlich des Anteils der an<br />
Schulen angemeldeten Roma-<strong>K<strong>in</strong>der</strong> bemerkbar waren <strong>und</strong> dieser sich im Vergleich zu den<br />
Vorjahren erhöht hat. Es gab jedoch ke<strong>in</strong>en Durchbruch zur Lösung des Problems der<br />
massiven Arbeitslosigkeit unter den Roma.<br />
Politische Zusammenhänge auf nationaler Ebene<br />
Die zentralen E<strong>in</strong>richtungen, die an der Entstehung von Maßnahmen beteiligt s<strong>in</strong>d, welche<br />
die Roma-M<strong>in</strong>derheit betreffen, reichen von spezialisierten Regierungsstellen bis h<strong>in</strong> zur<br />
Kommunalverwaltung:<br />
− die Abteilung für Nationale M<strong>in</strong>derheiten <strong>und</strong> Im Ausland Lebende Litauer unter<br />
der Regierung<br />
− das M<strong>in</strong>isterium für Bildung <strong>und</strong> Wissenschaft<br />
− das M<strong>in</strong>isterium für gesellschaftliche Sicherheit <strong>und</strong> Arbeit (vorrangig durch allgeme<strong>in</strong>e<br />
soziale Dienste; die Abteilung für Jugendangelegenheiten ist nicht direkt<br />
beteiligt)<br />
− Kommunalbehörden (wenn auch unwillig)<br />
Die Integration nationaler M<strong>in</strong>derheiten <strong>in</strong> Litauen war e<strong>in</strong> Bereich, dem e<strong>in</strong>e große politische<br />
Bedeutung zugeschrieben wurde <strong>und</strong> der von Beg<strong>in</strong>n an, <strong>in</strong> der Zeit der wieder<br />
erlangten Unabhängigkeit des Staates <strong>in</strong> den frühen 1990ern, <strong>in</strong>stitutionalisiert wurde. Es<br />
gab nur wenige Beispiele umfassender Gesetzgebung zu M<strong>in</strong>derheiten <strong>in</strong> Europa, als Litauen<br />
im Jahre 1989 se<strong>in</strong> Gesetz zu den Nationalen M<strong>in</strong>derheiten erließ. Im Laufe der 1990er<br />
Jahre entwickelte sich die Unterstützung für M<strong>in</strong>derheiten-NGOs, Kultur, Bildung <strong>und</strong><br />
soziale Aktivitäten. Nach dem Jahr 2000 erhielten Projekte von M<strong>in</strong>derheiten-NGOs, die<br />
sich mit <strong>Jugendliche</strong>n befassten, e<strong>in</strong>ige Aufmerksamkeit, doch der Umfang <strong>und</strong> Inhalt der<br />
M<strong>in</strong>derheitenunterstützung änderte sich nicht gr<strong>und</strong>legend, während sich die Konzentration<br />
auf nie zuvor dagewesene Auswanderungsraten <strong>und</strong> auf litauische Geme<strong>in</strong>schaften im<br />
Ausland verstärkte.<br />
Massive <strong>in</strong>stitutionelle Herausforderungen, die der Entwicklung e<strong>in</strong>er Roma-<br />
Integrationspolitik gegenüberstehen, ergeben sich aus der Tatsache, dass sich die meisten<br />
Aktivitäten, die M<strong>in</strong>derheiten betreffen, auf den Bereich der Unterstützung von Organisationen<br />
sowie von kulturellen Aktivitäten <strong>und</strong> Bildung konzentrieren. Dabei stehen die<br />
meisten Probleme der heutigen Roma-Geme<strong>in</strong>schaft <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit Armut <strong>und</strong> Ausschließung<br />
<strong>und</strong> erfordern sozialpolitische Intervention. Auch fehlen fähige Organisationen<br />
unter den Roma, die von Projekten mit weitgreifenden Auswirkungen profitieren könnten.<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der <strong>sozialen</strong> Sicherheit basiert Litauens System auf e<strong>in</strong>er staatlichen Sozialversicherung,<br />
die e<strong>in</strong>en Großteil der Bevölkerung abdeckt. Soziale Programme s<strong>in</strong>d eher<br />
universell <strong>und</strong> nicht gruppenspezifisch. Sozialer Schutz <strong>und</strong> soziale Dienste werden sowohl<br />
von den Kommunalverwaltungen als auch von Regierungse<strong>in</strong>richtungen (dem Staatshaushalt)<br />
f<strong>in</strong>anziert.<br />
Ethnisch ausgerichtete soziale Abteilungen werden jedoch auf der staatlichen Ebene<br />
nicht anerkannt. Weder besitzt Litauen die <strong>in</strong>stitutionellen Möglichkeiten, diese mit Hilfe<br />
sozialpolitischer Mittel anzusprechen, noch stuft es das als Priorität e<strong>in</strong>. In ihrem Nationa-<br />
47
len Bericht zu Strategien für Sozialen Schutz <strong>und</strong> Soziale E<strong>in</strong>beziehung 2006-2008 9 an die<br />
Europäische Kommission entschied sich die Regierung nicht für die stärkere Integration<br />
ethnischer M<strong>in</strong>derheiten. Auch die Frage der „Zusicherung angemessener Behausung“<br />
wurde nicht ausgewählt, obwohl diese von größter Wichtigkeit für die Roma <strong>und</strong> für die<br />
Bed<strong>in</strong>gungen, unter denen die Roma-Jugend aufwächst, ist. Im Gegensatz dazu bezogen<br />
sich die meisten Beschwerden von Roma an den Ombudsmann für Gleichberechtigung<br />
zwischen 2005-2007 auf Wohnen <strong>und</strong> Arbeit (d.h. nicht auf, beispielsweise, Bildung).<br />
Zentrale politische Programme zu nationalen M<strong>in</strong>derheiten <strong>und</strong> der Roma-Integration<br />
Die strategische Maßnahmenplanung mit Hilfe spezifischer Programme <strong>in</strong> der öffentlichen<br />
Verwaltung erschien <strong>in</strong> der zweiten Hälfte der 1990er auf der Tagesordnung <strong>und</strong> seit dem<br />
Jahr 2000 s<strong>in</strong>d erste Programme zur Integration nationaler M<strong>in</strong>derheiten verwirklicht worden.<br />
Die Abteilung für Nationale M<strong>in</strong>derheiten <strong>und</strong> Im Ausland Lebende Litauer unter der<br />
Regierung spielt e<strong>in</strong>e zentrale Rolle bei der Gestaltung der Regierungspolitik im Bereich der<br />
Integration von M<strong>in</strong>derheiten <strong>und</strong> bei der Koord<strong>in</strong>ation der Ausführung des Programms.<br />
Die Abteilung leitet e<strong>in</strong> umfassendes Programm zur Integration von Nationalen M<strong>in</strong>derheiten <strong>in</strong><br />
die Litauische Gesellschaft 2005-2010. Die Vertreter von M<strong>in</strong>derheitsorganisationen hatten die<br />
Möglichkeit, sich am Entwicklungsprozess zu beteiligen. Die Abteilung koord<strong>in</strong>iert die<br />
Aktivitäten, die von verschiedenen M<strong>in</strong>isterien verwirklicht werden. Die Abteilung selbst<br />
unterstützte spezifische Projekte, Samstags- <strong>und</strong> Sonntagsschulen, organisierte Bewusstmachung<br />
bezüglich des Kampfes gegen Diskrim<strong>in</strong>ierung. Bei der Zuwendung für die Projekte<br />
der M<strong>in</strong>derheiten-NGOs <strong>und</strong> -Ensembles stieg die f<strong>in</strong>anzielle Unterstützung von 80.000<br />
EUR im Jahr 2004 auf 100.000 EUR im Jahr 2007.<br />
Die komplizierte Situation der Roma wurde durch die E<strong>in</strong>führung des Programms für die<br />
Integration der Roma <strong>in</strong> die Litauische Gesellschaft 2000-2004 anerkannt. Im Rahmen dieses Programms,<br />
das von der Abteilung verwaltet wurde, versuchte man <strong>in</strong>dividuelle Arbeitsplätze<br />
für Roma zu schaffen; es gab f<strong>in</strong>anzielle Unterstützung für litauische Sprachkurse <strong>und</strong> vorschulische<br />
Bildungsaktivitäten. E<strong>in</strong>e der größten Leistungen war die E<strong>in</strong>richtung des Roma<br />
Community Centre <strong>in</strong> Kirtimai, welches zu e<strong>in</strong>er zentralen Institution mit direkter Verb<strong>in</strong>dung<br />
zu Roma-Familien <strong>und</strong> E<strong>in</strong>zelnen geworden ist.<br />
9 Zu f<strong>in</strong>den unter: http://www.socm<strong>in</strong>.lt/<strong>in</strong>dex.php?-1168933446<br />
48
Die Verantwortlichkeiten für Maßnahmen, die <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> betrafen, waren<br />
verteilt wie folgt:<br />
Name Ausführende<br />
Errichtung des Roma Community Centre<br />
Entwicklung von vorschulischen Ausbildungsklassen/<br />
-gruppen <strong>und</strong> Absicherung ihrer Arbeit<br />
Organisation von zusätzlicher Bildung für <strong>K<strong>in</strong>der</strong><br />
Organisation kostenloser Nahrung für Roma-<br />
<strong>K<strong>in</strong>der</strong>, die vorschulische Ausbildungsklassen<br />
besuchen<br />
Organisation von Sommerfreizeitangeboten für<br />
Roma-<strong>K<strong>in</strong>der</strong><br />
Ausstattung der Roma-<strong>K<strong>in</strong>der</strong>, die vorschulische<br />
Ausbildungsklassen <strong>und</strong> weiterführende Schulen<br />
besuchen, mit Schulbüchern <strong>und</strong> anderen Lehrmaterialien<br />
Vorbereitung <strong>in</strong>dividueller Bildungsprogramme<br />
für Roma-<strong>K<strong>in</strong>der</strong><br />
Entwicklung e<strong>in</strong>es Schulbuchs zur Romani-<br />
Sprache<br />
Abteilung für Nationale M<strong>in</strong>derheiten <strong>und</strong><br />
Im Ausland Lebende Litauer; Kommunalverwaltung<br />
der Stadt Vilnius<br />
M<strong>in</strong>isterium für Soziale Sicherheit <strong>und</strong> Arbeit;<br />
Kommunalverwaltung der Stadt Vilnius<br />
Vorsitzende/r des Bezirks Vilnius<br />
M<strong>in</strong>isterium für Bildung <strong>und</strong> Wissenschaft<br />
Während sich das frühere Roma-Integrationsprogramm auf den abgegrenzten Fall Kirtimai<br />
konzentrierte, hat das neue Programm (2007-2010), das derzeit auf die Bestätigung<br />
von Seiten der Regierung wartet, die Ausweitung von Maßnahmen auf Roma <strong>in</strong> anderen<br />
Regionen vorausgesehen. Es bleibt jedoch e<strong>in</strong>e Herausforderung, e<strong>in</strong>e Balance der Kompetenzen<br />
<strong>und</strong> Verpflichtungen zwischen Regierung <strong>und</strong> Kommunalverwaltungen zu erreichen.<br />
Bereiche des <strong>sozialen</strong> Lebens, beispielsweise die Arbeit, bleiben für die Roma weiterh<strong>in</strong><br />
sehr wichtig. Derzeit verwirklicht die NGO Litauischer <strong>K<strong>in</strong>der</strong>fonds, das bisher größte auf<br />
Roma konzentrierte Projekt se<strong>in</strong>e Art: Entwicklung <strong>und</strong> Testlauf e<strong>in</strong>es Unterstützungsmechanismus<br />
für die E<strong>in</strong>gliederung von Roma <strong>in</strong> den Arbeitsmarkt, das von der EU-Initiative EQUAL f<strong>in</strong>anziell<br />
unterstützt wird. Die Nationale Strategie der Anti-Diskrim<strong>in</strong>ierung 2006-2008 ist ebenfalls<br />
wichtig für die Stärkung e<strong>in</strong>er generellen Rahmenstruktur für Gleichberechtigung, jedoch<br />
werden die Roma nicht e<strong>in</strong>zeln betrachtet. Aktive <strong>und</strong> direkte Arbeitsmarktmaßnahmen<br />
müssen für extrem sozial benachteiligte Gruppen, wie die Roma, weiter entwickelt werden.<br />
49
Aktivitäten auf der Geme<strong>in</strong>schaftsebene: Das Roma Community Centre (RCC ) <strong>und</strong><br />
se<strong>in</strong>e Funktion<br />
Da es schwierig ist, die Angelegenheiten e<strong>in</strong>er relativ kle<strong>in</strong>en Roma-Geme<strong>in</strong>schaft <strong>in</strong> die<br />
Agenda nationaler Institutionen <strong>und</strong> <strong>in</strong> massentaugliche politische Konzepte e<strong>in</strong>zubr<strong>in</strong>gen,<br />
hat sich die Institution, die sowohl sichtbar, e<strong>in</strong>fach erreichbar <strong>und</strong> verständnisvoll gegenüber<br />
den e<strong>in</strong>zelnen Roma ist, erfolgreich bewährt.<br />
Das RCC <strong>in</strong> Kirtimai besitzt se<strong>in</strong> eigenes Gelände <strong>und</strong> ist seit 2001 <strong>in</strong> Betrieb. Die<br />
Gründer des Zentrums s<strong>in</strong>d die Abteilung für Nationale M<strong>in</strong>derheiten, die NGO Litauischer<br />
<strong>K<strong>in</strong>der</strong>fonds <strong>und</strong> die NGO Romany Jagory. Das RCC hat fünf Angestellte, darunter<br />
Lehrer <strong>und</strong> Sozialarbeiter, <strong>und</strong> beschäftigt weiteres Personal über Projekt-Aktivitäten.<br />
Das RCC hat viele <strong>in</strong>novative Aktivitäten verwirklicht, viele davon im Bereich der Vorschulbildung<br />
für Roma-<strong>K<strong>in</strong>der</strong>. Obwohl es Zweifel von verschiedenen Seiten gab, ob separate<br />
Klassen nicht zu stärkerer Abgrenzung führen würden, deutet der Praxisbeweis auf das<br />
Gegenteil h<strong>in</strong>: die vorbereitenden Klassen gehörten zu den effektivsten Praktiken. Lehrer<br />
geben an, dass <strong>K<strong>in</strong>der</strong>, die nach Abschluss dieser Klassen <strong>in</strong> die Schule kamen, besser darauf<br />
vorbereitet waren, sowohl dem Unterricht zu folgen als auch zu ihren Altersgenossen<br />
aufzuholen.<br />
Mittlerweile ist das RCC selbst aktiv geworden, <strong>in</strong>dem es nach größeren Projekten, F<strong>in</strong>anzierungsmöglichkeiten<br />
<strong>und</strong> Partnerschaften sucht. Obwohl es noch nicht das nötige<br />
Gewicht besitzt, um e<strong>in</strong>en wesentlichen E<strong>in</strong>fluss auf die politische Agenda auszuüben, besitzt<br />
es doch das Vertrauen der Roma, die Erfahrung <strong>und</strong> das direkte Wissen darüber, welche<br />
politischen Maßnahmen funktionieren <strong>und</strong> welche nicht.<br />
Weitere Informationen:<br />
Roma: Situation Overview (2005) Forschungsbericht, Vilnius: Kontroll<strong>in</strong>stitut für Menschenrechte,<br />
April 2005. Zu f<strong>in</strong>den unter:<br />
http://www.hrmi.lt/downloads/structure//Romu_padeties_analize_20050412%20ENG121.pdf<br />
Zentrum für Ethnische Studien des Instituts für Sozialforschung (2004) Roma <strong>in</strong> Public Education.<br />
Studie durchgeführt auf Anfrage des Europäischen Kontrollzentrums für Rassismus <strong>und</strong> Fremdenfe<strong>in</strong>dlichkeit,<br />
Oktober 2004. Vilnius.<br />
Zu f<strong>in</strong>den unter: http://www.ces.lt/downloads/structure/files/Roma_Lithuania.pdf<br />
50
Präsentation Europarat<br />
Kathr<strong>in</strong> Groth, DNK-Jugendkampagne „alle anders – alle gleich“<br />
Berl<strong>in</strong><br />
„Alle anders – Alle gleich“ – Kampagne des<br />
Europarates für Vielfalt, Teilhabe <strong>und</strong><br />
Menschenrechte<br />
Fakten:<br />
− Ca. 40 nationale Kampagnenkomitees<br />
− Ca. 10 europaweite Maßnahmen 2006 <strong>und</strong> 2007<br />
− Auf europäischer Ebene vom Direktorat Jugend <strong>und</strong> Sport des Europarates<br />
koord<strong>in</strong>iert<br />
Die Geschichte der „all different – all equal“-Kampagne<br />
− Frühere Kampagne 1995/1996 „gegen Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfe<strong>in</strong>dlichkeit<br />
<strong>und</strong> Intoleranz“<br />
− Initiiert von Jugendorganisationen über den Geme<strong>in</strong>samen Jugendrat des Europarates,<br />
Direktion Jugend <strong>und</strong> Sport<br />
− Entschieden beim Gipfeltreffen der Staats- <strong>und</strong> Regierungschefs 2005 <strong>in</strong> Warschau,<br />
verabschiedet von den M<strong>in</strong>istern für Jugend, organisiert <strong>in</strong> Geme<strong>in</strong>schaft<br />
mit der Europäischen Kommission <strong>und</strong> dem Europäischen Jugendforum.<br />
Teil der Prioritäten des Europarates<br />
− Jugend fördert Menschenrechte <strong>und</strong> <strong>sozialen</strong> Zusammenhalt<br />
− Partizipation der Jugend <strong>und</strong> demokratischer Bürgers<strong>in</strong>n<br />
− Jugend gestaltet Frieden <strong>und</strong> <strong>in</strong>terkulturellen Dialog<br />
− Entwicklung <strong>und</strong> Forschung im Bereich der Jugendpolitik<br />
− Vermittlung von Menschenrechten <strong>und</strong> <strong>in</strong>terkultureller Dialog<br />
− Sozialer Zusammenhalt <strong>und</strong> die E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung junger Menschen<br />
51
Struktur der Kampagne auf europäischer Ebene<br />
52<br />
AC<br />
CDEJ<br />
Information<br />
National Campaign Committees<br />
Preparation,<br />
Implementation<br />
Evaluation<br />
Structure:<br />
European Steer<strong>in</strong>g Group<br />
Programm and Activities<br />
Decision on European<br />
activities, Participation,<br />
Evaluation<br />
CoE<br />
Preparation,<br />
Implementation<br />
Evaluation<br />
Ziele der Kampagne<br />
Was hat es mit dem Slogan „all different – all equal“ auf sich?<br />
Menschen überall auf der Welt unterscheiden sich auf vielerlei Weise, müssen aber trotz<br />
dieser Unterschiede die gleichen Rechte erhalten.<br />
Darum geht es <strong>in</strong> dieser Kampagne.<br />
Um Vielfalt zu respektieren, etwas über die Menschenrechte zu wissen <strong>und</strong> Maßnahmen<br />
zur Verteidigung der eigenen Rechte zu ergreifen, aber auch um sich gegen die Diskrim<strong>in</strong>ierung<br />
Anderer erheben zu können.<br />
Die Kampagne arbeitet im Besonderen mit jungen Menschen zwischen 12 <strong>und</strong> 30 Jahren.<br />
Maßnahmen<br />
1. Europaweite Veranstaltungen / zentralisierte Kampagne<br />
2. Nationale Kampagnenkomitees / dezentralisierte Kampagne<br />
3. PR-Sichtbarkeit / zentralisierte <strong>und</strong> dezentralisierte Medien<br />
4. Bildungsmaßnahmen<br />
5. Thematische Wochen<br />
6. Europäischer Graffiti-Wettbewerb<br />
Gesamteuropäische Symposien<br />
Bereits abgehalten:<br />
− “all different – all equal” Symposium September 2006 St. Petersburg, Russland<br />
(300 Teilnehmer – 200 aus Russland, 100 aus anderen europäischen Ländern):<br />
Workshops über Vielfalt, Partizipation <strong>und</strong> Menschenrechte; Abschließende<br />
Erklärung über die Themen der Kampagne<br />
− Symposium zum Thema Vielfalt, 25. bis 29. Oktober 2006, Budapest, Ungarn<br />
(120 <strong>in</strong>ternationale Teilnehmer; Workshops zu Themen r<strong>und</strong> um Vielfalt, abschließende<br />
Erklärung über Vielfalt)
− Interreligiöser Dialog, 27. bis 31. März 2007 <strong>in</strong> Istanbul, Türkei; 200 <strong>in</strong>ternationale<br />
Teilnehmer, Workshops über glaubensbasierte Jugendarbeit, Religion <strong>und</strong><br />
Diskrim<strong>in</strong>ierung, etc.<br />
− Symposium zum Thema Partizipation, 25. bis 29. April 2007 <strong>in</strong> Schengen, Luxemburg,<br />
<strong>in</strong> Zusammenarbeit mit den Beneluxstaaten; 100 Teilnehmer<br />
− Med Village Migration and Xenophobia 7. bis 10. Juni 2007 <strong>in</strong> Italien; Partner:<br />
M<strong>in</strong>isterien für Soziales, Inneres <strong>und</strong> Jugend 250 Teilnehmer<br />
Zukünftige Maßnahmen:<br />
− Abschließende Veranstaltung 4. bis 7. Oktober 2007, Malmö, Schweden<br />
− Bewertung <strong>und</strong> Nachverfolgung der Konferenz<br />
Bildungsmaßnahmen<br />
Alle Maßnahmen des Europäischen Jugendzentrums werden unter der Federführung dieser<br />
Kampagne durchgeführt.<br />
Die Europäische Jugendstiftung unterstützt überall <strong>in</strong> Europa Bildungsmaßnahmen <strong>und</strong><br />
Pilotprojekte zu den Themen dieser Kampagne.<br />
1. Internationale Jugendtreffen (Kategorie A): 246 Projekte<br />
2. Weitere Jugendmaßnahmen (Veröffentlichungen, Webseiten, etc.): 54 Projekte<br />
3. Pilotprojekte (e<strong>in</strong>schließlich der Vermittlung von Menschenrechten): 115 Projekte<br />
Treffen der nationalen Kampagnenkomitees<br />
Fünf Mal <strong>in</strong> den Jahren 2006 <strong>und</strong> 2007, an unterschiedlichen Orten<br />
Ziele:<br />
1. Austausch von Erfahrungen <strong>und</strong> Praxis<br />
2. Schulung <strong>in</strong> Medienstrategie, Kampagnenmanagement <strong>und</strong> Bewertung/ Nachverfolgung<br />
3. Öffentlichkeitsarbeit<br />
4. Netzwerke<br />
So weit zu den Maßnahmen der nationalen Kampagnenkomitees. Es werden folgen:<br />
− Sem<strong>in</strong>are über die Vermittlung von Menschenrechten<br />
− Lebende Bibliothek als e<strong>in</strong>e Lehrmethode<br />
− Große Mediakampagnen, Filme<br />
− Zusammenarbeit mit Schulen<br />
− Wettbewerbe<br />
− Botschafter <strong>und</strong> Musiksammlungen<br />
Thematische Wochen<br />
1. Internationale Veranstaltungen außerhalb des Geländes des Europäischen Jugendzentrums<br />
werden weiterh<strong>in</strong> mit dem nationalen Kampagnenkomitee des gastgebenden<br />
Landes entwickelt.<br />
2. Veranstaltungen, die auf „brennende Aspekte“ mit Bezug zur Kampagne abzielen;<br />
e<strong>in</strong>ige s<strong>in</strong>d allgeme<strong>in</strong>er <strong>und</strong> werden von Straßburg aus koord<strong>in</strong>iert, wobei zur Steigerung<br />
des Kommunikationseffektes <strong>in</strong> jedem Land das Netzwerk verwendet wird.<br />
53
Themen:<br />
Homophobie, Antisemitismus, Islamphobie, Rassismus gegen Migranten, Romaphobie,<br />
Diskrim<strong>in</strong>ierung Beh<strong>in</strong>derter<br />
Wenn die Wände schreien – Europäischer Graffitiwettbewerb<br />
20 Länder nehmen an e<strong>in</strong>em Wettbewerb teil:<br />
Junge Künstler wetteifern um das beste Graffiti gegen Diskrim<strong>in</strong>ierung. Der Wettbewerb<br />
f<strong>in</strong>det im Sommer 2007 <strong>in</strong> Zusammenarbeit mit den nationalen Kampagnenkomitees<br />
<strong>und</strong> der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus (UNESCO) statt. Der Europarat<br />
sammelt überall <strong>in</strong> Europa entstandene Graffitis <strong>und</strong> veröffentlicht sie <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es Buches.<br />
So können Sie sich der Kampagne anschließen:<br />
Als Mitglied e<strong>in</strong>er nationalen NGO:<br />
− Suchen Sie die Kontakte des nationalen Kampagnenkomitees heraus <strong>und</strong> setzen<br />
Sie sich mit Ihrem nationalen Kampagnenkomitee <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung.<br />
− Wenn Ihr Land nicht aufgeführt wird, wenden Sie sich bitte an das Mitglied des<br />
Lenkungsausschusses für Jugend (CDEJ) Ihres Landes.<br />
− Beachten Sie die Anzeigen für (Schulungs)maßnahmen auf der Webseite der<br />
Kampagne <strong>und</strong> auf der Seite der Direktion Jugend <strong>und</strong> Sport.<br />
Als e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>ternationale Nichtregierungsorganisation im Bereich Jugend:<br />
− Verb<strong>in</strong>den Sie Ihre Aktivitäten mit der Kampagne, <strong>in</strong>dem Sie das Logo verwenden<br />
<strong>und</strong> sie <strong>in</strong> den Kalender e<strong>in</strong>tragen.<br />
− Setzen Sie sich mit dem Europäischen Jugendforum <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung, das aus nationalen<br />
Jugendräten <strong>und</strong> IYNGOs besteht <strong>und</strong> e<strong>in</strong> Partner der Kampagne ist.<br />
Kontakt:<br />
all different – all equal<br />
Europarat<br />
Direktorat Jugend <strong>und</strong> Sport<br />
Leiter der Kampagne: Michael Raphael<br />
www.alldifferent-allequal.<strong>in</strong>fo<br />
Kontaktdaten des deutschen Kampagnenkomitees:<br />
DNK-Jugendkampagne<br />
Kathr<strong>in</strong> Groth<br />
Mühlendamm 3<br />
10178 Berl<strong>in</strong><br />
<strong>in</strong>fo@jugendkampagne.de<br />
Tel.: 030/400404-31<br />
Fax: 030/400404-22<br />
www.jugendkampagne.de<br />
54
Berichterstattung AG 3: Multikulturelles Zusammenleben<br />
Tatjana Mögl<strong>in</strong>g<br />
E<strong>in</strong>führung<br />
Die AG 3 befasste sich mit dem Thema: „Multikulturelles Zusammenleben“. Zunächst<br />
wurde die „Kampagne für Vielfalt, Teilhabe <strong>und</strong> Menschenrechte „alle anders – alle gleich“<br />
des Europarates vorgestellt. Die Umsetzung der europäischen Kampagne f<strong>in</strong>det auf der<br />
nationalen Ebene zu länderspezifischen Schwerpunkten statt. So wurde <strong>in</strong> Deutschland der<br />
Schwerpunkt auf das Thema Antidiskrim<strong>in</strong>ierung gelegt. Die diesbezügliche Koord<strong>in</strong>ierung<br />
erfolgt über Nationale Ausschüsse.<br />
In den beiden folgenden Beiträgen lag der Schwerpunkt auf der Vorstellung von Programmen<br />
zur Integration ethnischer M<strong>in</strong>derheiten <strong>in</strong> die Mehrheitsgesellschaft. Aus Litauen<br />
wurden „Geme<strong>in</strong>dezentren für Roma“ als Beispiel für e<strong>in</strong>e neue Integrationsstrategie<br />
vorgestellt, aus Tschechien „Integrationsstrategien für junge Roma am Beispiel des IQ<br />
Roma Servis“ präsentiert.<br />
Es wurde <strong>in</strong> der Diskussion deutlich, dass die Roma e<strong>in</strong>e spezielle, <strong>in</strong> sich sehr heterogene<br />
(viele Stämme) M<strong>in</strong>derheit s<strong>in</strong>d, die sich im Wesentlichen durch folgende Merkmale<br />
charakterisieren lassen: Nicht-Sesshaftigkeit, Staatenlosigkeit, Analphabetismus oder Wohnungslosigkeit.<br />
Insofern wurde auch deutlich, dass e<strong>in</strong>e gesellschaftliche Integration von<br />
Roma besondere Strategien benötigt.<br />
Trotz der unterschiedlichen Erfahrungen, die aus den Beiträgen deutlich wurden, lassen<br />
sich e<strong>in</strong>ige wesentliche Geme<strong>in</strong>samkeiten feststellen, auf die ich jetzt kurz e<strong>in</strong>gehen möchte.<br />
Geme<strong>in</strong>samkeiten<br />
In beiden Ländern wird Integration als nationale politische Querschnittsaufgabe betrachtet,<br />
wobei die Zuständigkeit <strong>in</strong> beiden Ländern bei unterschiedlichen M<strong>in</strong>isterien angesiedelt<br />
ist.<br />
Vertreter von Betroffenen <strong>und</strong> freien Trägern s<strong>in</strong>d mit e<strong>in</strong>bezogen.<br />
In beiden Ländern bestehen ähnliche Problemlagen <strong>in</strong> Bezug auf die Zielgruppe (Roma),<br />
das heißt (Selbst-)Segregation, soziale Benachteiligungen <strong>und</strong> Diskrim<strong>in</strong>ierungen.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus besteht <strong>in</strong> beiden Ländern <strong>in</strong> den Kommunen nur e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge Bereitschaft<br />
zur Mitarbeit bei der Umsetzung der Integrationsprogramme.<br />
Es existieren vergleichbare Angebote für <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> wie etwa Sonntagsschulen,<br />
Vorschulklassen <strong>und</strong> Stipendien usw.<br />
Kommen wir nun zu den wesentlichen Unterschieden, die sich im Ergebnis der Diskussion<br />
herausgestellt haben.<br />
Unterschiede<br />
Während <strong>in</strong> der Tschechischen Republik e<strong>in</strong> spezielles Programm zur Integration der Roma<br />
vorliegt, werden <strong>in</strong> Litauen alle M<strong>in</strong>derheiten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Integrationsstrategie e<strong>in</strong>bezogen,<br />
ohne Berücksichtigung der speziellen Problemlagen e<strong>in</strong>zelner M<strong>in</strong>derheitengruppen wie der<br />
Roma.<br />
55
In Litauen s<strong>in</strong>d knapp 20 % der Bevölkerung M<strong>in</strong>derheiten <strong>und</strong> die Roma stellen lediglich<br />
e<strong>in</strong>en Anteil von 0,7 % an der Gesamtbevölkerung dar. Dagegen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Tschechischen<br />
Republik 3 % der Bevölkerung Roma.<br />
In der Tschechischen Republik s<strong>in</strong>d auf den verschiedenen Handlungsebenen die Verantwortlichkeiten<br />
klar <strong>und</strong> verb<strong>in</strong>dlich geklärt.<br />
In Litauen werden die Maßnahmen <strong>und</strong> Angebote vor allem zentral festgelegt, e<strong>in</strong>iges<br />
deutet auf e<strong>in</strong> eher fürsorgendes Herangehen h<strong>in</strong>.<br />
Im Gegensatz zu Litauen, wo die Integrationsprogramme parallel zu sozial-politischen<br />
Maßnahmen existieren, ist <strong>in</strong> der Tschechischen Republik die Strategie als Rahmenprogramm<br />
gestaltet <strong>und</strong> die Umsetzung ist <strong>in</strong> die reguläre Sozialarbeit e<strong>in</strong>gebettet.<br />
Die Akteure <strong>in</strong> der Tschechischen Republik haben <strong>in</strong> der konkreten Umsetzung deutlich<br />
mehr Handlungsspielraum.<br />
In beiden Ländern ist die Partizipation der Roma bei der Umsetzung der Programme<br />
unterschiedlich stark ausgeprägt z. B. werden <strong>in</strong> der Tschechischen Republik Roma als Berater<br />
<strong>und</strong> Koord<strong>in</strong>atoren e<strong>in</strong>gesetzt.<br />
Handlungsempfehlungen<br />
Integrationsprogramme auf nationaler Ebene sollten als langfristige Rahmenprogramme<br />
gestaltet se<strong>in</strong>, die ausreichend Spielraum für e<strong>in</strong>e flexible Umsetzung auf der lokalen Ebene<br />
zu lassen.<br />
Um e<strong>in</strong>e stärkere Beteiligung der Zielgruppe zu erreichen, muss an den Bedürfnissen<br />
der M<strong>in</strong>derheit angeknüpft werden, um darauf zugeschnittene Projekte <strong>und</strong> Angebote zu<br />
entwickeln.<br />
Die Motivation der Zielgruppe wird gestärkt durch Beteiligung bei der Gestaltung der<br />
Projekte.<br />
Die Integration wird begünstigt durch ganzheitliches Herangehen d.h. durch e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung<br />
des gesamten <strong>sozialen</strong> Umfeldes (z. B. Familie, Schule usw.)<br />
Es bedarf e<strong>in</strong>er deutlich stärkeren kulturellen Sensibilisierung der Bevölkerung <strong>und</strong> der<br />
Akteure bezogen auf die Roma: bspw. Kampagnen, wie die vorgestellte EU-Kampagne<br />
„alle anders – alle gleich“, können auch begleitend zu nationalen Integrationsprogrammen<br />
durchgeführt werden. Es bietet sich gerade dort an, wo Bevölkerung <strong>und</strong> Kommunen sich<br />
sehr reserviert gegenüber Integrationsprogrammen für M<strong>in</strong>derheiten wie z. B. Roma verhalten.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus ist es s<strong>in</strong>nvoll die Geschichte der Roma (bzw. anderer M<strong>in</strong>derheiten) <strong>in</strong><br />
die schulischen Lehrpläne aufzunehmen.<br />
Wichtig ersche<strong>in</strong>t auch e<strong>in</strong>e nationale Berichterstattung <strong>und</strong> Evaluation dieser Programme,<br />
die <strong>in</strong> beiden Ländern noch nicht erfolgt.<br />
56
Arbeitsgruppe 4: Ressortübergreifende Strategien für<br />
soziale Brennpunkte<br />
Präsentation Deutschland<br />
Peter Kupferschmid, B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für<br />
Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend<br />
Dr. Susann Burchardt , <strong>Deutsches</strong> Jugend<strong>in</strong>stitut<br />
Ra<strong>in</strong>er Prölß, Stadt Nürnberg<br />
Programmplattform „Entwicklung<br />
<strong>und</strong> Chancen junger Menschen <strong>in</strong><br />
<strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong>“ (E&C)<br />
Das B<strong>und</strong>esprogramm „Entwicklung <strong>und</strong> Chancen junger Menschen <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong>“<br />
(E&C) verfolgt das Ziel, die <strong>in</strong> den Kommunen vorhandenen Ressourcen zur<br />
Förderung der <strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendhilfe zu mobilisieren, zu vernetzen <strong>und</strong> nachhaltig, im<br />
S<strong>in</strong>ne längerfristig wirksamer Angebots- <strong>und</strong> Hilfestrukturen <strong>in</strong> den benachteiligten Stadtteilen,<br />
zu gestalten. E&C stellt dabei e<strong>in</strong>e Programm- <strong>und</strong> Projektplattform dar, die verschiedene<br />
Bauste<strong>in</strong>e be<strong>in</strong>haltet, welche mit Hilfe der konzeptionellen <strong>und</strong> <strong>in</strong>haltlichen Arbeit<br />
der Regiestelle E&C so umgesetzt werden sollen, dass Synergieeffekte ermöglicht werden,<br />
um entstandene Hilfestrukturen im Bereich der <strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendhilfe im oben genannten<br />
S<strong>in</strong>ne nachhaltig zu gestalten.<br />
Durch e<strong>in</strong> <strong>in</strong>stitutionen- <strong>und</strong> ressortübergreifendes Zusammenarbeiten sollen, so<br />
die Idee des Programms E&C, die Lebensbed<strong>in</strong>gungen der Menschen vor Ort, <strong>in</strong>sbesondere<br />
die der <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n verbessert werden.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der ausdrücklichen Orientierung auf <strong>in</strong>dividuelle <strong>und</strong> strukturelle Ressourcen<br />
<strong>in</strong> den benachteiligten Stadtteilen <strong>und</strong> der damit e<strong>in</strong>hergehenden starken Aktivierungskomponente,<br />
ist das Programm E&C Ausdruck e<strong>in</strong>er neuartigen Perspektive auf die Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
der Erbr<strong>in</strong>gung sozialer Dienst- <strong>und</strong> Fürsorgeleistungen <strong>in</strong> Deutschland. Die<br />
starken fürsorgenden Momente des korporatistischen, das heißt auf die Leistungen der<br />
großen Sozialverbände orientierten, deutschen Sozialstaates f<strong>in</strong>den sich bei E&C nicht<br />
wieder.<br />
E&C stellt vielmehr e<strong>in</strong>e aktivierende Förderstrategie im Rahmen der b<strong>und</strong>esdeutschen<br />
<strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendhilfe dar, die <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie „Hilfe zur Selbsthilfe“ se<strong>in</strong> soll sowie Eigenverantwortung<br />
<strong>und</strong> Engagement der Betroffenen fördern soll.<br />
Es geht um die Ko-Produktion sozialer Dienstleistungen für <strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> <strong>in</strong><br />
<strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong>, um e<strong>in</strong>en „Welfare-Mix“ aller Angebote staatlicher, gesellschaftlicher<br />
<strong>und</strong> privater Akteure.<br />
Dies kommt auch <strong>in</strong> den strategischen Intentionen der Programmplattform – Vernetzung,<br />
Partizipation <strong>und</strong> Sozialraumorientierung <strong>und</strong> der damit zusammenhängenden besonderen<br />
Struktur von E&C als Programm- <strong>und</strong> Projektplattform zum Ausdruck.<br />
Insgesamt ist E&C als e<strong>in</strong>e Art Programmphilosophie zu verstehen, die den Rahmen für<br />
die Umsetzung verschiedener Programmbauste<strong>in</strong>e bildet. Dabei fließt auf der Ebene von<br />
E&C selbst ke<strong>in</strong> Geld <strong>in</strong> die Kommunen, sondern erst durch die Realisierung e<strong>in</strong>zelner<br />
Programmteile werden diese gefördert. Die e<strong>in</strong>zelnen Bauste<strong>in</strong>e unterliegen dabei unter-<br />
v. l.: S. Burchardt, P. Kupferschmid, R. Prölß<br />
57
schiedlichen Fördermodalitäten. Während z. B. für das B<strong>und</strong>esprogramm Freiwilliges Soziales<br />
Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsjahr (FSTJ) e<strong>in</strong>e Förderung durch das BMFSFJ, die B<strong>und</strong>esagentur für Arbeit<br />
(BA) <strong>und</strong> den Europäischen Sozialfonds erfolgte <strong>und</strong> kommunal zu 10 % mitf<strong>in</strong>anziert<br />
werden musste, kommen beim Programm „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ (LOS) nur<br />
europäische Fördermittel zum E<strong>in</strong>satz. Die Koord<strong>in</strong>ation des gesamten E&C-Programms<br />
erfordert auch vor Ort <strong>in</strong> den Kommunen erhebliche Flexibilität im Umgang mit Antragsverfahren.<br />
Die Steuerung des gesamten Programms erfolgt durch Vertreter des BMFSFJ als<br />
Auftraggeber, der B<strong>und</strong>esagentur für Arbeit (die z. B. für das Freiwillige Soziale Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsjahr<br />
ebenfalls als Geldgeber fungierte), des Deutschen Jugend<strong>in</strong>stitutes (wissenschaftliche<br />
Begleitung E&C sowie e<strong>in</strong>zelner Teilprogramme) sowie der Stiftung SPI (Sozialpädagogisches<br />
Institut Berl<strong>in</strong>) als Regiestelle. Im Rahmen dieser Steuerungsr<strong>und</strong>e werden die wesentlichen<br />
Entscheidungen über die <strong>in</strong>haltliche Ausgestaltung des Programms getroffen.<br />
Der Regiestelle obliegen im Wesentlichen die <strong>in</strong>haltliche <strong>und</strong> organisatorische Vor- <strong>und</strong><br />
Nachbereitung sowie die Durchführung der Zielgruppenkonferenzen, die sich an unterschiedliche<br />
Akteure <strong>in</strong> den Kommunen wenden sowie die gesamte Informationsgebung<br />
<strong>und</strong> Beratung über die e<strong>in</strong>zelnen Programmteile. Diese Zielgruppenkonferenzen dienen<br />
dem Erfahrungsaustausch <strong>und</strong> der Dissem<strong>in</strong>ation von guten Praxisbeispielen <strong>in</strong> Kommunen<br />
zu ausgewählten Themenbereichen, die jährlich wechseln <strong>und</strong> am Bedarf der Kommunen<br />
ausgerichtet s<strong>in</strong>d. Darüber h<strong>in</strong>aus f<strong>in</strong>den im Rahmen der e<strong>in</strong>zelnen Programmbauste<strong>in</strong>e<br />
eigene Fachforen statt, die sich thematisch mit der Umsetzung dieser befassen. Anzumerken<br />
ist dabei die Schwierigkeit, dass die Regiestelle den Gesamtprozess von E&C koord<strong>in</strong>ieren<br />
muss, wobei e<strong>in</strong>zelne Programmteile (z. B. LOS, FSTJ, Kompetenzagenturen)<br />
eigene Servicebüros zur <strong>in</strong>ternen Steuerung besitzen, während andere Teile komplett von<br />
ihr gemanagt werden müssen (z. B. Ehrenamt im ländlichen Raum). Somit war hier vor<br />
allem notwendig, die Informationen immer wieder zu bündeln <strong>und</strong> an die Akteure vor Ort<br />
zu vermitteln.<br />
Inhaltlich angeb<strong>und</strong>en ist das gesamte Programm E&C an das B<strong>und</strong>-Länder-Programm<br />
„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt“, da es sich auf die dafür<br />
ausgewählten Gebiete bezieht. Zielsetzung war, dem vorwiegend <strong>in</strong>vestiv ausgelegten<br />
Programm „Soziale Stadt“ e<strong>in</strong>e Fördermöglichkeit für nicht<strong>in</strong>vestive Maßnahmen im Bereich<br />
der <strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendpolitik zur Seite zu stellen, um Synergien zu erzielen <strong>und</strong> Ressourcen<br />
bündeln zu können. Deshalb wurde darauf Wert gelegt, dass <strong>in</strong> allen Programmteilen<br />
diese Verschränkung mit dem Programm „Soziale Stadt“ auch möglichst praktisch ausgestaltet<br />
<strong>und</strong> nicht nur <strong>in</strong> den Anträgen formalisiert wird.<br />
Beispiel e<strong>in</strong>er lokalen Umsetzung – Nürnberg<br />
In der Stadt Nürnberg (Metropole <strong>in</strong> der Region Franken <strong>in</strong> Bayern, ca. 500.000 EW) s<strong>in</strong>d<br />
die Voraussetzungen für den E<strong>in</strong>satz der Programmbauste<strong>in</strong>e der Programmplattform<br />
E&C gegeben: 15% der <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n verlassen die Schule ohne Abschluss,<br />
10% der Nürnberger/<strong>in</strong>nen leben von Leistungen des SGBII <strong>und</strong> r<strong>und</strong> e<strong>in</strong> Drittel, bei<br />
<strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n ca. 40 %, der Bewohner/<strong>in</strong>nen haben e<strong>in</strong>en Migrationsh<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong>.<br />
Wie <strong>in</strong> allen großen Städten Deutschlands konzentrieren sich soziale Problemlagen<br />
<strong>in</strong> sogenannten <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong> bzw. benachteiligten Stadtteilen.<br />
58
Die dargestellten Nürnberger Erfahrungen <strong>in</strong> den drei Soziale-Stadt-Gebieten Nordostbahnhof,<br />
Altstadt-Süd <strong>und</strong> Galgenhof/Ste<strong>in</strong>bühl beziehen sich schwerpunktmäßig auf das<br />
Programm LOS – Lokales Kapital für Soziale Zwecke (vgl. auch AG5). Andere Programmelemente<br />
konnten leider nicht die beabsichtigte Wirkung entfalten, wiewohl nachfolgende<br />
Projektbemühungen natürlich aus diesen Erfahrungen lernen können. Beim LOS<br />
Vorgängerprojekt „Kompetenz <strong>und</strong> Qualifikation – KuQ) krankte es an der kurzen Laufzeit,<br />
beim Freiwilligen Sozialen Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsjahr (FSTJ) wurden die Potenziale neuer Kooperationsformen<br />
nicht von allen Beteiligten erkannt.<br />
LOS unterstützt <strong>in</strong> Nürnberg vor allem kle<strong>in</strong>e lokale, oft unkonventionelle Projektideen<br />
<strong>und</strong> Initiativen – so genannte Mikroprojekte –, die <strong>in</strong> weiter gefassten Förderprogrammen<br />
nicht berücksichtigt werden können. Ziel ist es, durch die Mikroprojekte Strukturen <strong>und</strong><br />
Netzwerke zu schaffen, die auch nach der Förderung Bestand haben <strong>und</strong> die die Lebens-<br />
<strong>und</strong> Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen der Menschen <strong>in</strong> den jeweiligen Vierteln verbessern. Mikroprojekte<br />
können von Initiativen, Vere<strong>in</strong>en, Genossenschaften, Bildungs- <strong>und</strong> Maßnahmeträgern,<br />
Wohlfahrts- <strong>und</strong> Wirtschaftsverbänden, Kirchengeme<strong>in</strong>den oder örtlichen Unternehmen<br />
angeboten werden, von E<strong>in</strong>zelpersonen oder Existenzgründer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Existenzgründern<br />
mit guten Ideen.<br />
Kernstück der Umsetzungsstruktur ist die Koord<strong>in</strong>ierungsstelle beim Jugendamt <strong>in</strong><br />
Nürnberg. Die Zusammenarbeit mit dem Quartiermanagement der Fördergebiete ist kont<strong>in</strong>uierlich<br />
<strong>und</strong> effektiv. Über die Vergabe der Projektförderungen entscheidet der eigens<br />
e<strong>in</strong>gerichtete Begleitausschuss (BGA) <strong>in</strong> den Stadtteilen. Über die Arbeit des BGA wird<br />
gewährleistet, dass alle gesellschaftlichen Akteure (Träger, lokale Wirtschaft) <strong>in</strong>sbesondere<br />
aber <strong>Jugendliche</strong> <strong>und</strong> Bewohner der benachteiligten Stadtteile <strong>in</strong> die sie betreffenden Entscheidungen<br />
e<strong>in</strong>bezogen werden können, e<strong>in</strong>e neue Erfahrung für viele von Ihnen.<br />
Innovative Potenziale birgt auch die sozialräumliche Organisationsstruktur der Programmumsetzung<br />
<strong>in</strong>sgesamt. Den Menschen ist es seit jeher egal, welche Organisation oder<br />
Verwaltungse<strong>in</strong>heit ihnen Angebote macht. Für die betroffenen Institutionen lässt sich<br />
nicht dasselbe behaupten. Gegen Ressorteitelkeiten <strong>und</strong> -egoismen ist auch Soziale Stadt<br />
oder E&C ke<strong>in</strong> Allheilmittel, <strong>und</strong> gerade wenn <strong>in</strong> der Kommune die Verwaltungsbereiche<br />
Verantwortlichen aus unterschiedlichen politischen Richtungen zugeordnet s<strong>in</strong>d, ist die<br />
Entwicklung <strong>in</strong>tegrierter Gesamtstrategien nicht eben e<strong>in</strong>fach. Es ist aber festzustellen, dass<br />
die konkrete, auf den Stadtteil <strong>und</strong> die Menschen dort bezogene Zusammenarbeit der<br />
Dienststellen <strong>und</strong> Träger, der geme<strong>in</strong>same Wunsch, Lösungen zu f<strong>in</strong>den, <strong>und</strong> die regelmäßigen<br />
Kommunikationsgelegenheiten Versäulungen abbauen <strong>und</strong> <strong>in</strong>tegrierte Strategien<br />
befördern helfen.<br />
Verbessert hat sich <strong>in</strong> den Stadtteilen durch LOS e<strong>in</strong>deutig die arbeitsmarktbezogene<br />
zielgerichtete Kommunikation zwischen Projektträgern <strong>und</strong> anderen (<strong>sozialen</strong>) E<strong>in</strong>richtungen<br />
<strong>und</strong> Trägern. Abgestimmtes Handeln mit Zielrichtung stadtteilorientierter zielgruppen-<br />
<strong>und</strong> problemorientierter Konzepte ist immer mehr Bestandteil von LOS, aber zunehmend<br />
auch der Arbeit der Verwaltung <strong>in</strong>sgesamt.<br />
Für die eigentliche Zielsetzung der arbeitsmarktlichen Integration haben die E&C-<br />
Programme, speziell LOS, allerd<strong>in</strong>gs mit e<strong>in</strong>em großen Manko zu kämpfen. Das SGB II,<br />
das sozialstaatliche Instrument zur Wiedere<strong>in</strong>gliederung langzeitarbeitsloser Menschen <strong>in</strong><br />
59
Deutschland, versagt sich bisher weitgehend der Logik kle<strong>in</strong>räumiger Vernetzung. Viel zu<br />
stark fließen b<strong>und</strong>eszentrale Vorgaben <strong>in</strong> die Arbeitsmarktpolitik e<strong>in</strong>, anstatt dass örtliche<br />
Kompetenzen <strong>und</strong> Ressourcen mit den B<strong>und</strong>esmitteln gekoppelt <strong>und</strong> so bessere Effekte<br />
für die Zielgruppen erreicht werden. Diese Chance müssen sich kommunale Jugendhilfe-<br />
<strong>und</strong> Sozialpolitiker politisch erst noch erkämpfen.<br />
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass auf der lokalen Ebene trotz aller Fortschritte<br />
auch weiterh<strong>in</strong> Überzeugungsarbeit dafür geleistet werden muss, dass sozialräumliche<br />
Ansätze nicht als Appendix zur planerisch-baulichen Stadtentwicklung zu betrachten s<strong>in</strong>d,<br />
sondern e<strong>in</strong>e eigene Strategie darstellen, die konsequent verfolgt werden muss, wenn die<br />
sich zunehmend verstärkenden sozialräumlichen Disparitäten bei Bildung, Wohlstand <strong>und</strong><br />
Lebenschancen zum<strong>in</strong>dest abgefedert werden sollen.<br />
60
Präsentation Frankreich<br />
Philippe Choffell, wissenschaftlicher<br />
Leiter der nationalen<br />
Beobachtungsstelle kritischer<br />
Stadtteile<br />
Yves Goepfert, Leiter des Programms<br />
“Réussite éducative”<br />
Frédéric Bourthoumieu, GIP Centre<br />
Essone, Réussite Educative de<br />
Courcouronnes<br />
P. Choffell Y. Goepfert F. Bourthoumieu<br />
Programm „Réussite éducative à la DIV“ – Bildungsprogramm für<br />
<strong>Jugendliche</strong> <strong>in</strong> problematischen Stadtteilen<br />
Das Programm „Réussite éducative” im Kontext französischer Stadtpolitik<br />
Die Stadtpolitik ist e<strong>in</strong>e partnerschaftliche Politik, die <strong>in</strong> Frankreich vor etwa zwanzig Jahren<br />
<strong>in</strong>s Leben gerufen wurde. Ihr Ziel ist e<strong>in</strong>e bessere Integration von problembehafteten<br />
Quartieren <strong>in</strong> die Entwicklung der Städte. In ihrem Rahmen werden <strong>in</strong> als vorrangig e<strong>in</strong>gestuften<br />
Bereichen auf Gr<strong>und</strong>lage von Verträgen zwischen dem Staat <strong>und</strong> den Gebietskörperschaften<br />
sowohl städtische, als auch wirtschaftliche, kulturelle <strong>und</strong> soziale Maßnahmen<br />
entwickelt. Diese Verträge, die bisher als “Stadtverträge” bezeichnet wurden, s<strong>in</strong>d zum 31.<br />
Dezember 2006 ausgelaufen <strong>und</strong> wurden seit Januar 2007 durch sogenannte “Stadtverträge<br />
zur Förderung des <strong>sozialen</strong> Zusammenhalts” (CUCS) ersetzt, die bis 2012 gestaffelt s<strong>in</strong>d.<br />
Sie haben e<strong>in</strong>e Laufzeit von jeweils drei Jahren, s<strong>in</strong>d verlängerbar <strong>und</strong> werden von Staat<br />
<strong>und</strong> Bürgermeister geme<strong>in</strong>sam mit anderen Körperschaften ausgearbeitet.<br />
Die Stadtpolitik stützt sich heute auf e<strong>in</strong>en Rahmen <strong>und</strong> auf Handlungsmöglichkeiten,<br />
die durch das Stadterneuerungsgesetz vom 1. August 2003 erneuert <strong>und</strong> durch das Gesetz<br />
über die Programmgestaltung zur Förderung des <strong>sozialen</strong> Zusammenhalts vom 18. Januar<br />
2005, das Gesetz über die Chancengleichheit vom 31. März 2006 <strong>und</strong> das Gesetz über das<br />
nationale Engagement für den Wohnungsbau vom 13. Juli 2006 vervollständigt wurden.<br />
Die vorrangige Geografie der Stadtpolitik<br />
Der sogenannte “Pakt zur Wiederbelebung der Stadt”, e<strong>in</strong> Gesetz aus dem Jahr 1996, legt<br />
e<strong>in</strong>e Reihe von prioritären Quartieren fest – die sogenannten “sensiblen städtischen Regionen”<br />
(ZUS). Dabei handelt es sich um e<strong>in</strong>e Liste, die noch immer verwendet wird, obgleich<br />
<strong>in</strong> den Stadtverträgen oder den CUCS bereits weitere Quartiere benannt wurden, die diese<br />
Geografie erweitert <strong>und</strong> aktualisiert haben, <strong>und</strong> zwar durch H<strong>in</strong>zufügen von Quartieren,<br />
die <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> Präventionsmaßnahmen e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en werden müssen, um zu verh<strong>in</strong>dern,<br />
dass sich ihre Lage verschlechtert.<br />
Der Pakt zur Wiederbelebung der Stadt def<strong>in</strong>iert 751 ZUS. Die dort genannten Quartiere<br />
werden <strong>in</strong> Abhängigkeit von ihren <strong>sozialen</strong> <strong>und</strong> urbanen Schwierigkeiten drei verschiedenen<br />
Prioritätsstufen zugeordnet. 416 Zonen der städtischen Redynamisierung (ZRU)<br />
wird e<strong>in</strong>e mittlere Priorität zugewiesen. Die höchste Prioritätsstufe haben 44 sogenannte<br />
städtische Freizonen (ZFU), <strong>in</strong> denen die Ansiedlung von Unternehmen <strong>und</strong> die Beschäfti-<br />
61
gung <strong>in</strong> diesen Quartieren gefördert werden soll, <strong>in</strong>dem die Unternehmen von Steuern <strong>und</strong><br />
Sozialabgaben befreit werden. In der Folge stieg die Zahl der ZFUs 2004 <strong>und</strong> dann 2007<br />
auf 100.<br />
ZUS’, ZRUs <strong>und</strong> ZFUs s<strong>in</strong>d sowohl im französischen Mutterland als auch <strong>in</strong> den Überseedepartements<br />
(Mart<strong>in</strong>ique, Guadeloupe, Guyana, Réunion) zu f<strong>in</strong>den. Bei der letzten<br />
Volkszählung lebten <strong>in</strong>sgesamt 4,7 Millionen Menschen <strong>in</strong> diesen Quartieren, das entspricht<br />
etwa 8 % der französischen Bevölkerung.<br />
Aktionsrahmen des Stadterneuerungsgesetzes aus dem Jahr 2003<br />
Das Stadterneuerungsgesetz vom 1. August 2003 def<strong>in</strong>iert für die ZUS Aktionsprogramme,<br />
die <strong>in</strong> 6 thematische Bereiche untergliedert <strong>und</strong> auch heute noch <strong>in</strong> den aktuellen<br />
Stadtverträgen zur Förderung des <strong>sozialen</strong> Zusammenhalts zu f<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d:<br />
− Beschäftigung <strong>und</strong> wirtschaftliche Entwicklung<br />
− Wohnraum <strong>und</strong> städtisches Umfeld<br />
− Ges<strong>und</strong>heit: Prävention <strong>und</strong> Zugang zu mediz<strong>in</strong>ischer Versorgung<br />
− Bildung: Bildungserfolg<br />
− Öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
− Mobilisierung der öffentlichen Dienste<br />
Das Gesetz schreibt für jedes dieser Handlungsfelder für fünf Jahre Ziele vor, die mit<br />
Indikatoren verb<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d, anhand derer der Fortschritt der Maßnahmen gemessen werden<br />
soll.<br />
Durch dasselbe Gesetz wurde die „Nationale Beobachtungsstelle für sensible städtische<br />
Regionen“ (ONZUS) gegründet, die die Auswirkungen der Politiken messen soll, die mit<br />
Bezug auf diese, durch das Gesetz festgelegten Indikatoren umgesetzt werden. Die ON-<br />
ZUS ist dem für Stadtpolitik verantwortlichen M<strong>in</strong>isterium angegliedert, dem es jährlich<br />
Bericht erstatten muss.<br />
<strong>Jugendliche</strong> <strong>in</strong> den ZUS – e<strong>in</strong>e wichtige Herausforderung für die Stadtpolitik<br />
Die Geschichte der Stadtpolitik <strong>in</strong> Frankreich ist von Gewaltausbrüchen gekennzeichnet,<br />
deren Akteure die „<strong>Jugendliche</strong>n aus den Banlieus“ s<strong>in</strong>d: die Ereignisse <strong>und</strong> Vorfälle <strong>in</strong><br />
Vaulx-en-Vel<strong>in</strong> <strong>in</strong> den Vorstädten von Lyon 1981 bis zu denen im November 2005, von<br />
denen zahlreiche Städte <strong>in</strong> Frankreich betroffen waren (<strong>und</strong> nicht nur die „problembehafteten<br />
Quartiere“) reflektieren das schlechte Bef<strong>in</strong>den dieser <strong>Jugendliche</strong>n <strong>und</strong> verdeutlichen<br />
ihre Integrationsschwierigkeiten auf sozialer beruflicher Ebene.<br />
Die folgende Verteilung der <strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> den ZUS lässt sich durch die starke Präsenz<br />
von Großfamilien <strong>und</strong> Familien aus nicht-europäischen Ländern erklären: Fast 32 % der<br />
Bevölkerung <strong>in</strong> den ZUS s<strong>in</strong>d unter 20 Jahre, dem stehen weniger als 25 % der Bevölkerung<br />
im französischen Mutterland gegenüber.<br />
In den <strong>in</strong> den ZUS ansässigen Schulen ist der Anteil der Schüler aus benachteiligten Milieus<br />
besonders hoch, <strong>und</strong> ihre Wohnbed<strong>in</strong>gungen s<strong>in</strong>d für die Schularbeiten zu Hause<br />
nicht förderlich. Trotz der den E<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> den ZUS im Rahmen der prioritären Bildung<br />
zugeteilten zusätzlichen Mittel versagen viele <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> aus den ZUS <strong>in</strong><br />
der Schule (zu später Beg<strong>in</strong>n der höheren Schulbildung, ger<strong>in</strong>ge Erfolgsquote beim Abschluss<br />
der „Collèges“). Der Anteil der Schulabbrüche noch vor Abschluss der Gymnasial-<br />
62
ildung oder der Berufsausbildung ist <strong>in</strong> der Folge ebenfalls hoch. Insgesamt haben die<br />
<strong>Jugendliche</strong>n aus den ZUS am Ende der schulischen Gr<strong>und</strong>ausbildung e<strong>in</strong> deutlich<br />
schlechteres Niveau als andere <strong>Jugendliche</strong>. Die E<strong>in</strong>gliederung <strong>in</strong> das Berufsleben wird<br />
dadurch erschwert. Die Folge ist e<strong>in</strong>e besonders hohe Arbeitslosigkeit, die oft verspätete<br />
Aufnahme e<strong>in</strong>er längerfristigen, sicheren Arbeit sowie der häufige Verbleib <strong>in</strong> Untätigkeit.<br />
Diejenigen unter ihnen, die am besten ausgebildet s<strong>in</strong>d, s<strong>in</strong>d wiederum für die Arbeitsplätze,<br />
zu denen sie Zugang haben, häufig überqualifiziert.<br />
Diese Feststellungen verlangen nach ambitionierten Maßnahmen, damit die <strong>Jugendliche</strong>n<br />
aus diesen Quartieren schulisch erfolgreich se<strong>in</strong> <strong>und</strong> Arbeit f<strong>in</strong>den können. Das Programm<br />
„Réussite éducative“ gehört zu diesen prioritären Maßnahmen.<br />
Das Programm „Réussite éducative“<br />
Das Programm „Réussite éducative“ wurde im Rahmen des Plans für <strong>sozialen</strong> Zusammenhalt<br />
(Juni 2004) <strong>und</strong> des Gesetzes über die Programmgestaltung zur Förderung des <strong>sozialen</strong><br />
Zusammenhalts vom 18.1.2005 (Paragrafen 128 bis 132) <strong>in</strong>s Leben gerufen <strong>und</strong> richtet sich<br />
speziell an <strong>K<strong>in</strong>der</strong> im Alter von 2 bis 16 Jahren, die <strong>in</strong> ZUS leben oder e<strong>in</strong>e als vorrangig<br />
e<strong>in</strong>gestufte Schule besuchen, <strong>und</strong> deren Familien. Ziel dieses Programms ist es, die <strong>K<strong>in</strong>der</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n, die Zeichen von Benachteiligung zeigen, ab dem <strong>K<strong>in</strong>der</strong>garten bis zum<br />
Ende der schulpflichtigen Zeit zu begleiten. Verfolgen die partnerschaftlichen Maßnahmen<br />
im Bereich Bildung <strong>in</strong> der Regel e<strong>in</strong>en eher kollektiven Ansatz, so misst das Programm<br />
„Réussite éducative“ der <strong>in</strong>dividuellen Entwicklung e<strong>in</strong>e vorrangige Bedeutung bei, <strong>und</strong> zwar<br />
mit Maßnahmen, die sich langfristig auf die verschiedenen Bereiche der schulischen Entwicklung<br />
e<strong>in</strong>es K<strong>in</strong>des, wie Erziehung, Ges<strong>und</strong>heit, Schulbesuch, Kultur <strong>und</strong> Sport, beziehen.<br />
Dieser persönlichere Ansatz der Schullaufbahn 10 schließt jedoch nicht aus, dass aufgetretene<br />
Schwierigkeiten nicht auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em kollektiven Rahmen berücksichtigt werden<br />
können. Er erfordert e<strong>in</strong>fach, dass die Betreuungsmodalitäten die E<strong>in</strong>zigartigkeit e<strong>in</strong>er jeden<br />
Situation berücksichtigen, wobei das Umfeld oder der Kontext, <strong>in</strong> denen die Schwierigkeiten<br />
auftreten, betrachtet wird.<br />
Das Programm „Réussite éducative“ orientiert sich an zwei Achsen: Die Projekte zur Förderung<br />
des Bildungserfolgs <strong>und</strong> die Internate zur Förderung des Bildungserfolgs.<br />
Projekte zur Förderung des Bildungserfolgs<br />
Die Projekte zur Förderung des Bildungserfolgs s<strong>in</strong>d die faktische Umsetzung des Programms<br />
„Réussite éducative“ auf lokaler Ebene. Sie werden von e<strong>in</strong>er rechtlichen Struktur getragen,<br />
wie z. B. e<strong>in</strong>er Kasse für die Schulen, e<strong>in</strong>em <strong>sozialen</strong> Geme<strong>in</strong>dezentrum, e<strong>in</strong>er lokalen öffentlichen<br />
Bildungse<strong>in</strong>richtung oder e<strong>in</strong>er öffentlichen Interessengeme<strong>in</strong>schaft, die <strong>in</strong> ihrem<br />
Verwaltungsrat oder <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Beratungsgremium für die Kasse für die Schulen alle betroffenen<br />
Institutionen <strong>und</strong> Verbände versammelt.<br />
10 Er wurde <strong>in</strong>sbesondere durch e<strong>in</strong> <strong>in</strong> den 60er Jahren <strong>in</strong> Michigan (USA) durchgeführtes Experiment, dem PERRY<br />
SCHOOL PROGRAMM, <strong>in</strong>spiriert, das e<strong>in</strong>e massive Unterstützung von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n im Alter von 3 bis 4 Jahren anbot (die<br />
bis zum Alter von 27 Jahren nachverfolgt wurden) <strong>und</strong> sich auf deren familiäres Umfeld stützte. Das Ergebnis war, dass<br />
der Grad ihrer Integration sich signifikant verbessert hatte, obwohl ihre Ergebnisse bei e<strong>in</strong>em IQ-Test nicht besser<br />
waren.<br />
63
Gestützt auf e<strong>in</strong>e Partnerschaft, die um alle Akteure erweitert wird, die von der Umsetzung<br />
e<strong>in</strong>er Bildungspolitik auf lokaler Ebene betroffen s<strong>in</strong>d, entwickelt das Projekt zur<br />
Förderung des Bildungserfolgs auf Gr<strong>und</strong>lage e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen Analyse <strong>in</strong> der Region<br />
e<strong>in</strong>en Aktionsplan, dessen Bestandteile im Wesentlichen außerhalb der Schulzeit stattf<strong>in</strong>den<br />
<strong>und</strong> nicht dazu dienen, die Schule oder vorhandene Instrumente (lokaler Bildungsvertrag,<br />
lokale Begleitung der Schulk<strong>in</strong>der, <strong>K<strong>in</strong>der</strong>-Jugend-Vertrag, etc.) zu ersetzen.<br />
Die Programmgestaltung kann vorhandene Maßnahmen e<strong>in</strong>schließen, sofern diese den<br />
Zielen des Programms entsprechen. Zu den möglichen Maßnahmen gehören: die Begleitung<br />
von Schulk<strong>in</strong>dern durch Verbände, <strong>in</strong>sbesondere durch AFEV 11 oder APFEE 12 , die<br />
Gestaltung von Elternzimmern <strong>in</strong> den Gr<strong>und</strong>schulen (Lyon) <strong>und</strong> deren Leitung durch e<strong>in</strong><br />
Geme<strong>in</strong>demitglied, Präventionsmaßnahmen im Bereich Ges<strong>und</strong>heit, <strong>in</strong>sbesondere im<br />
Rahmen von städtischen Ges<strong>und</strong>heitsworkshops (Nanterre, Genevilliers, Courcouronnes,<br />
etc.), Unterstützung der Elternschaft <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit Netzwerken zur Unterstützung<br />
<strong>und</strong> Begleitung der Eltern ( z. B. der Bus der <strong>in</strong>term<strong>in</strong>isteriellen Kommission für Stadtentwicklung<br />
von Courcouronnes), Maßnahmen <strong>in</strong> den Bereichen Kultur <strong>und</strong> Sport mit dem<br />
Ziel, von dem Programm betroffene <strong>K<strong>in</strong>der</strong> e<strong>in</strong>zub<strong>in</strong>den, obgleich dieses häufig nicht der<br />
Fall war.<br />
Die Programmgestaltung muss darüber h<strong>in</strong>aus neue Interventionsmöglichkeiten vorschlagen,<br />
mit denen jenen <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n oder <strong>Jugendliche</strong>n, die sich <strong>in</strong> Schwierigkeiten 13 bef<strong>in</strong>den,<br />
<strong>und</strong> deren Familien e<strong>in</strong>e auf sie zugeschnittene Hilfe angeboten werden kann. Zu diesem<br />
Zweck müssen systematisch e<strong>in</strong> oder mehrere Teams zur Förderung des Bildungserfolgs<br />
zusammengestellt werden. Diese Teams versammeln <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em koord<strong>in</strong>ierten Netzwerk<br />
Profis <strong>und</strong> Akteure aus verschiedenen Ressorts 14 , die <strong>in</strong> der Lage s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong>dividuell oder kollektiv<br />
zu betreuen <strong>und</strong> langfristig e<strong>in</strong>e persönliche Weiterbegleitung umzusetzen. Wenn<br />
diese Akteure außerhalb ihrer Organisationen e<strong>in</strong>gesetzt werden, können sie entlohnt werden.<br />
Die Eltern, die die Haupterzieher bleiben, werden <strong>in</strong> das ihr K<strong>in</strong>d betreffende Projekt<br />
e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en. Sie können darüber h<strong>in</strong>aus direkt durch e<strong>in</strong>e Begleitung (guidance) oder f<strong>in</strong>anzielle<br />
Hilfe unterstützt werden, die zusätzlich an die vorrangig zu verwendenden <strong>sozialen</strong><br />
Bezüge angepasst wird.<br />
Die Vertraulichkeit der Informationen, die <strong>in</strong>nerhalb des Netzwerks ausgetauscht werden,<br />
ist zw<strong>in</strong>gend erforderlich. Die im Rahmen der schulischen Überwachung gewonnenen<br />
Erfahrungen haben die lokalen Akteure veranlasst, Vertraulichkeitsvere<strong>in</strong>barungen auszuarbeiten,<br />
<strong>in</strong> denen die Bed<strong>in</strong>gungen für den Austausch von Informationen festgehalten<br />
werden. Diese Vorschriften stehen jedoch nicht im Gegensatz zu der Tatsache, dass alle<br />
11<br />
Association de la fondation étudiante pour la ville – Studentenverband [Anm. d. Ü.]<br />
12<br />
Association pour favoriser une école éfficace – Verband zur Förderung des Bildungserfolgs [Anm. d. Ü.]<br />
13<br />
Durch die Erwachsenen der erweiterten Bildungsgeme<strong>in</strong>schaft, darunter die Lehrer, der Sozialdienst <strong>und</strong> die Abteilung<br />
zur Förderung der Ges<strong>und</strong>heit der nationalen Bildung, die Netzwerke zur Unterstützung von Schülern <strong>in</strong> Schwierigkeiten<br />
(RASED), die psychologischen Berater (COPSY), der Zwischenbereich der <strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendpsychiatrie, die<br />
Organisationen zum Schutz der Ges<strong>und</strong>heit von Mutter <strong>und</strong> K<strong>in</strong>d, die Akteure der <strong>sozialen</strong> Hilfsdienste für <strong>K<strong>in</strong>der</strong>, der<br />
Sozialdienst der Departements, Verbände.<br />
14<br />
Lehrer, Koord<strong>in</strong>atoren der ZEP-REP [Zonen/Gebiete mit prioritärer Ausbildung, Anm. d. Ü.], Erzieher, Betreuer, Sozialarbeiter,<br />
Psychologen, <strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendpsychiater, Therapeuten, Akteure aus den Bereichen Sport <strong>und</strong> Kultur,<br />
zugelassene Verbände, etc.<br />
64
nicht personalisierten Informationen <strong>und</strong> Daten zu Evaluierungszwecken des Programms<br />
verwendet werden dürfen.<br />
Internate zur Förderung des Bildungserfolgs<br />
Im Rahmen des Programms „Réussite éducative“ werden außerdem Internatsprojekte gefördert,<br />
die <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n mit vorübergehenden oder längerfristigen familiären<br />
Problemen oder Problemen im Umfeld e<strong>in</strong>en besseren schulischen Rahmen <strong>und</strong> e<strong>in</strong> besseres<br />
Arbeitsumfeld bieten.<br />
Die beigebrachte Unterstützung soll die Bed<strong>in</strong>gungen der schulischen, psychologischen<br />
<strong>und</strong> kulturellen Betreuung <strong>und</strong> Unterstützung verbessern. Sie müssen optimal se<strong>in</strong>. Gegebenenfalls<br />
kann das Programm geme<strong>in</strong>sam mit den Partnere<strong>in</strong>richtungen die Kosten übernehmen,<br />
die durch die Unterbr<strong>in</strong>gung fern der Familie entstehen <strong>und</strong> nicht von den Familien<br />
getragen werden können oder von Sozialfonds abgedeckt werden.<br />
Zwischen 2005 <strong>und</strong> 2007 wurden 25 Internatsprojekte umgesetzt. Sie betreffen ungefähr<br />
350 <strong>Jugendliche</strong>.<br />
Die DIV 15 hat zwischen Juni 2005 <strong>und</strong> Juni 2007 430 Projekte zur Förderung des Bildungserfolgs<br />
anerkannt. Diese Projekte umfassen mehr als 450 Geme<strong>in</strong>den <strong>und</strong> mobilisieren etwa 500<br />
<strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre Teams zur Förderung des Bildungserfolgs, die mehr als 80 000 sehr auffällige <strong>K<strong>in</strong>der</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> identifiziert haben <strong>und</strong> nun betreuen.<br />
Dem Programm „Réussite éducative“ wurden 230 Millionen Euro (2005: 35 Millionen<br />
Euro, 2006: 85 Millionen Euro <strong>und</strong> 2007: 110 Millionen Euro) gewährt.<br />
Das Ziel bis zum Ablauf des Programms im Jahr 2009 ist, 600 Projekte zur Förderung des Bildungserfolgs<br />
umzusetzen, die 100 000 <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> <strong>und</strong> deren Familien betreffen.<br />
Präsentation des Projektes „Réussite éducative“ <strong>in</strong> Courcouronnes<br />
Courcouronnes hat ca. 14.000 E<strong>in</strong>wohner. Die Stadt ist auf beiden Seiten der Autobahn A6<br />
gelegen <strong>und</strong> besteht aus zwei Quartieren, dem Zentrum mit Villen e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> dem Canal<br />
andererseits, <strong>in</strong> dem 60,7 % der Bevölkerung leben. Courcouronnes besteht so aus zwei<br />
Quartieren mit unterschiedlichen Funktionen <strong>und</strong> Bewohnern, auf deren Besonderheiten<br />
die Maßnahmen zugeschnitten werden müssen. Dieser besonderen urbanen Realität entsprechen<br />
Indikatoren, die leider ganz gewöhnlich s<strong>in</strong>d, stellen sie doch bis auf e<strong>in</strong>ige Abweichungen<br />
die demografische <strong>und</strong> soziale Geografie der Städte mit e<strong>in</strong>er oder mehreren<br />
sensiblen städtischen Zonen dar.<br />
In der Tat bef<strong>in</strong>den sich viele <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er benachteiligten Situation, was ihre Ausbildung<br />
betrifft. Die Risiken, den Anschluss zu verpassen, s<strong>in</strong>d tatsächlich vorhanden. Bei<br />
ihnen lassen sich zunehmend Schwierigkeiten beobachten, sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Klasse zu <strong>in</strong>tegrieren<br />
<strong>und</strong> mit den erwachsenen Bezugspersonen umzugehen.<br />
E<strong>in</strong>e Situation des Scheiterns zieht sich durch sämtliche Phasen ihrer Entwicklung: Die<br />
schulischen Leistungen, der soziale Umgang mit Ihresgleichen <strong>und</strong> manchmal sogar das<br />
Familienleben br<strong>in</strong>gen sie dazu, defensive Verhaltensweisen zu zeigen <strong>und</strong> Vermeidungs-<br />
15 Délégation <strong>in</strong>term<strong>in</strong>istérielle à la ville – <strong>in</strong> etwa: Interm<strong>in</strong>isterielle Kommission für Stadtentwicklung [Anm. d. Ü.]<br />
65
strategien zu entwickeln. Diese <strong>K<strong>in</strong>der</strong> verdecken ihre Schwächen <strong>und</strong> Schwierigkeiten<br />
häufig h<strong>in</strong>ter aggressiven <strong>und</strong> rebellischen Äußerungen <strong>und</strong> Handlungen.<br />
Um auf diese Probleme reagieren zu können, hat sich die Stadt sehr früh den zahlreichen<br />
politischen Instrumenten der Stadtpolitik angeschlossen <strong>und</strong> verfolgt im Bereich Bildung<br />
e<strong>in</strong>e aktive, auf die K<strong>in</strong>dheit <strong>und</strong> Jugend gerichtete Politik, deren Schwerpunkt auf<br />
e<strong>in</strong>er Partnerschaft liegt, die das K<strong>in</strong>d <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e Familie betrachtet <strong>und</strong> die Eltern <strong>in</strong> den<br />
Mittelpunkt der Maßnahmen setzt.<br />
In diesem Zusammenhang hat sich die Stadt dazu entschlossen, sich von Anfang an<br />
dem Programm „Réussite éducative“ anzuschließen.<br />
Die Umsetzung dieses neuen Instruments wurde durch die Existenz e<strong>in</strong>er Maßnahme<br />
zur schulischen Beobachtung (die der Staat 2001 <strong>in</strong>itiiert hat) erleichtert. Dort g<strong>in</strong>g es bereits<br />
darum, verschiedene Experten, die zuvor nicht zusammengearbeitet hatten, zu mobilisieren<br />
<strong>und</strong> koord<strong>in</strong>ieren. Durch diese Maßnahmen konnte e<strong>in</strong>e neue kollegiale Form der<br />
Arbeit erf<strong>und</strong>en werden, die auf e<strong>in</strong>er Komb<strong>in</strong>ation unterschiedlicher Logiken basiert. Sie<br />
stützt sich auf die Kompetenzen e<strong>in</strong>es jeden E<strong>in</strong>zelnen <strong>und</strong> zielt auf e<strong>in</strong>e Synergie ihrer<br />
Maßnahmen ab – e<strong>in</strong>e Synergie, die wir mit der Formel 1 + 1 = 3 übersetzen.<br />
Wir haben uns, als das Programm „Réussite éducative“ entwickelt wurde, ganz selbstverständlich<br />
dazu entschlossen, uns an dieser Stelle zu engagieren. Durch dieses neue Instrument<br />
konnten wir die Altersspanne der Betroffenen ebenso wie die zu berücksichtigenden<br />
Probleme erweitern, <strong>und</strong> wir konnten Mittel freisetzen, um geme<strong>in</strong>sam neue Maßnahmen<br />
zu <strong>in</strong>itiieren <strong>und</strong> den Ansatz des <strong>in</strong>dividuellen Werdegangs mit e<strong>in</strong>zuführen.<br />
So konnten wir e<strong>in</strong> System entwickeln, mit dem wir beim K<strong>in</strong>d, an der Seite se<strong>in</strong>er Eltern,<br />
<strong>in</strong>tervenieren können, <strong>und</strong> zwar <strong>in</strong>dem wir geme<strong>in</strong>sam die erforderlichen <strong>und</strong> unterschiedlichen<br />
Maßnahmen <strong>in</strong> den Bereichen Ges<strong>und</strong>heit, Hygiene, Freizeit, Kultur, <strong>und</strong><br />
Schule festlegen. Wir <strong>in</strong>tervenieren an e<strong>in</strong>em Punkt im Leben dieser <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> bieten<br />
ihnen für e<strong>in</strong>en begrenzten Zeitraum e<strong>in</strong>e maßgeschneiderte Begleitung an. Geme<strong>in</strong>sam<br />
gestalten wir e<strong>in</strong>zigartige <strong>und</strong> <strong>in</strong>novative Maßnahmen, mit dem geme<strong>in</strong>samen Willen, persönlich,<br />
umfassend <strong>und</strong> flexibel auf die Bedürfnisse der <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> ihrer Familien zu reagieren.<br />
Heute konnten wir durch diese partnerschaftliche Dynamik <strong>in</strong>novative Projekte entwickeln,<br />
wie z. B. e<strong>in</strong>en Elternbus, e<strong>in</strong>em Instrument, das als Maßnahme zur Unterstützung<br />
der Elternschaft dient <strong>und</strong> mit dem wir Eltern treffen können.<br />
Um die Kohärenz dieser Instrumente zu gewährleisten, wird kont<strong>in</strong>uierlich gearbeitet.<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> hat die Geme<strong>in</strong>de im Laufe des Jahres 2005 die reflektierende Arbeit an<br />
dem lokalen Schulprojekt, <strong>in</strong> dem schulische Akteure vere<strong>in</strong>t s<strong>in</strong>d, wieder aufgenommen.<br />
Referenzen:<br />
Gesetz Nr. 2003-710 vom 1. August 2003 über die Stadterneuerung:<br />
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/loiborloo01082003.pdf<br />
Bericht der nationalen Beobachtungsstelle für sensible städtische Regionen 2006:<br />
http://www.ville.gouv.fr/<strong>in</strong>fos/editions/observatoire-rapport-2006-accueil.html<br />
66
Präsentation Großbritannien<br />
Kate Morris, University of Birm<strong>in</strong>gham<br />
Prof. Marian Barnes, University of<br />
Brighton<br />
Ela<strong>in</strong>e Morrisson, Manchester Children’s<br />
F<strong>und</strong><br />
Programm „Children’s F<strong>und</strong>“ –<br />
Reduzierung sozialer<br />
Ausgrenzung von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n<br />
v.l.: K. Morris E. Morrison M.Barnes<br />
Politisch-Institutioneller Rahmen <strong>und</strong> Ziele des Programms Children's<br />
F<strong>und</strong><br />
Der Children’s F<strong>und</strong> ist e<strong>in</strong> nationales englisches Programm, welches im Rahmen der politischen<br />
Agenda „Every Child Matters (ECM)“ (Auf jedes K<strong>in</strong>d kommt es an) <strong>und</strong> auf der<br />
Gr<strong>und</strong>lage des Children Act (1989/2004) der britischen Regierung <strong>in</strong> den Kommunen umgesetzt<br />
wird.<br />
Jede Kommune (<strong>in</strong>sgesamt 149) hat so per Gesetz für die Laufzeit des Programms e<strong>in</strong>en<br />
lokalen Children’s F<strong>und</strong> e<strong>in</strong>gerichtet. Die Kommunen entscheiden selbst, welche <strong>in</strong>haltlichen<br />
Schwerpunkte im Rahmen des lokalen Children’s F<strong>und</strong>-Managements gesetzt<br />
werden. Die lokalen Children’s F<strong>und</strong> Manager haben dabei die Möglichkeit, Ressourcen<br />
verschiedener Regierungsprogramme zusammenzuführen <strong>und</strong> mit lokalen Angeboten zu<br />
komb<strong>in</strong>ieren.<br />
Nationale Programme wie Children’s F<strong>und</strong> werden <strong>in</strong> England lokal <strong>in</strong> sogenannte Local<br />
Strategic Partnerships (LSP) e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en. Diese LSP haben zum Ziel, alle Partner zur<br />
Bearbeitung lokaler Problemlagen zusammenzubr<strong>in</strong>gen. Jede dieser LSP hat e<strong>in</strong>e „Children<br />
and Young Peoples Group“ <strong>in</strong> der Vertreter der relevanten Politikbereiche zusammen arbeiten<br />
– Soziales, Ges<strong>und</strong>heit, Bildung, Polizei, lokale Beschäftigung.<br />
Mit dem Children Act von 1989 wurden erstmals Perspektiven jenseits re<strong>in</strong>er Krisen<strong>in</strong>terventionen<br />
beim <strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendschutz entwickelt. Im Jahre 2004 wurde <strong>in</strong> der Neufassung<br />
des Children Act explizit e<strong>in</strong> ganzheitlicher Ansatz für die Umsetzung der Agenda<br />
ECM formuliert. Im Zuge dessen wurden bspw. Politikfeld übergreifende „Childrens<br />
Trusts“ e<strong>in</strong>gerichtet, geme<strong>in</strong>same lokale <strong>K<strong>in</strong>der</strong>-Wohlfahrtse<strong>in</strong>richtungen, <strong>in</strong> denen Akteure<br />
aus dem Bereich Sozialarbeit, Bildung, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Polizei zusammenarbeiten.<br />
Das Programm Children’s F<strong>und</strong> ist e<strong>in</strong>gebettet <strong>in</strong> mehrere nationale Initiativen zur Umsetzung<br />
der ECM-Agenda. Das Programm Sure-Start orientiert dabei auf die <strong>K<strong>in</strong>der</strong> von 0<br />
bis 5, Children’s F<strong>und</strong> auf die Altersgruppe von 5 bis 13 <strong>und</strong> das Programm Connexions<br />
auf ältere <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>. Das Programm Connexion wird im Rahmen der Agenda<br />
„Youth Matters“ (Auf die Jugend kommt es an) umgesetzt. Koord<strong>in</strong>iert werden die verschiedenen<br />
Angebote <strong>in</strong> den Kommunen durch die Children and Young Peoples Groups<br />
<strong>in</strong> den LSP.<br />
Gr<strong>und</strong>pr<strong>in</strong>zipien der lokalen Arbeit der Children’s F<strong>und</strong>s <strong>in</strong> verschiedenen Projekten<br />
s<strong>in</strong>d Partnerschaft, Beteiligung <strong>und</strong> Prävention.<br />
67
Übergreifendes Ziel ist es, mit den bereitgestellten Mitteln des Children’s F<strong>und</strong> freiwillige,<br />
geme<strong>in</strong>schaftliche Organisationen <strong>in</strong> die Arbeit e<strong>in</strong>zub<strong>in</strong>den, um die gesamte Bandbreite<br />
von lokalen Ressourcen zu aktivieren. So soll auf lokaler Ebene alles getan werden, um<br />
Armut <strong>und</strong> Ungleichheit bei <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n zu überw<strong>in</strong>den.<br />
Inhaltlich wird die Arbeit auf folgende Ziele konzentriert:<br />
− Unterstützung bei der Erlangung von Schulabschlüssen<br />
− Verbesserung der schulischen Leistungsfähigkeit<br />
− Gewaltprävention<br />
− Reduzierung von Ungleichheiten im Ges<strong>und</strong>heitsbereich<br />
− Unterstützung präventiver Angebote<br />
− Förderung von Diensten, die sich als effektiv erwiesen haben<br />
− E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung der Familien <strong>in</strong> die geme<strong>in</strong>schaftliche Umsetzung der Programme/Projekte<br />
des Children's F<strong>und</strong><br />
Lokale Umsetzung am Beispiel des Manchester Children’s F<strong>und</strong><br />
Manchester rangiert auf Platz 3 auf dem britischen Index, der das Ausmaß an Benachteiligung<br />
<strong>in</strong> den Städten <strong>und</strong> Geme<strong>in</strong>den Großbritanniens beschreibt. 12% der Haushalte gelten<br />
als arm, die allgeme<strong>in</strong>e Arbeitslosigkeit ist überdurchschnittlich hoch, ebenso die Jugendarbeitslosigkeit.<br />
Die Stadt Manchester erhielt über den Children’s F<strong>und</strong> <strong>in</strong> den Jahren 2001 bis 2004<br />
(Phase 1) 17,5 Mio. Euro für die Umsetzung verschiedener lokaler Maßnahmen zugewiesen.<br />
Damit wurden 50 Projekte <strong>und</strong> Maßnahmen umgesetzt. Insgesamt waren 28 verschiedenen<br />
staatliche <strong>und</strong> freiwillige Organisationen <strong>und</strong> Gruppen <strong>in</strong> die Umsetzung e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en.<br />
Die sozialräumlich ausgerichteten Maßnahmen bezogen sich auf vier besonders benachteiligte<br />
Stadtgebiete <strong>in</strong> Manchester mit folgenden Themenschwerpunkten:<br />
− Flüchtl<strong>in</strong>ge <strong>und</strong> Asylbewerber<br />
− Unterstützung mentaler Ges<strong>und</strong>heit<br />
− Prävention von jugendlicher Gewalt<br />
− Prävention früher Schulschwierigkeiten<br />
In der zweiten, andauernden Phase der Umsetzung der ECM-Agenda durch die Projekt<strong>und</strong><br />
Maßnahmeförderungen des Children’s F<strong>und</strong>, setzt sich e<strong>in</strong>e stärkere strategische Orientierung<br />
durch. Es erfolgte e<strong>in</strong>e stärkere Konzentration auf präventive Angebote <strong>und</strong> die<br />
Integration der verschiedenen Projekte <strong>und</strong> Angebote auf der Basis geme<strong>in</strong>samer lokaler<br />
Vere<strong>in</strong>barungen (Local Area Agreements). <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> wurden aktiv <strong>in</strong> die<br />
jeweilige Projektumsetzung e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en. Dies geschah auch vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> der<br />
gesunkenen Zuwendungen <strong>in</strong> der 2. Phase, die <strong>in</strong> den Jahren 2005 bis 2008 <strong>in</strong>sgesamt noch<br />
10.9 Mio. Euro betragen.<br />
Kernstück der lokalen Steuerung ist das sogenannte „District Commission<strong>in</strong>g“. Dieses<br />
beschreibt die gebietsweise Auftragsvergabe für die verschiedenen, geme<strong>in</strong>sam entwickelten<br />
Maßnahmen <strong>und</strong> Projekte. Dieses ermöglicht die konkrete Messung der Folgen <strong>und</strong><br />
Ergebnisse von Projekten <strong>und</strong> somit e<strong>in</strong> effektives Leistungsmanagement. Die im Zuge des<br />
dar<strong>in</strong> <strong>in</strong>tegrierten Monitor<strong>in</strong>g ermittelten Daten dienen der weiteren Entwicklung bedarfsgerechter<br />
Angebote <strong>und</strong> der mittel- <strong>und</strong> langfristigen strategischen Planung.<br />
68
Die Ressourcen des Children’s F<strong>und</strong> werden <strong>in</strong> Manchester auf Maßnahmen gezielter,<br />
frühestmöglicher Intervention konzentriert, damit Probleme, die spezielle Dienste <strong>und</strong><br />
Maßnahmen <strong>und</strong> somit weitere Ressourcen erfordern, so ger<strong>in</strong>g wie möglich gehalten werden.<br />
Die Perspektive der Evaluatoren<br />
Aus der Perspektive der nationalen Evaluation der Arbeit der Children’s F<strong>und</strong>s <strong>in</strong> Großbritannien<br />
s<strong>in</strong>d zusammenfassend folgende Punkte zu benennen, die e<strong>in</strong>e kritische Bewertung<br />
der Folgen <strong>und</strong> Wirkungen des Programms Children’s F<strong>und</strong> erforderlich machen:<br />
Zur Datenbasis:<br />
− Das Vertrauen <strong>in</strong> die existierenden adm<strong>in</strong>istrativen <strong>und</strong> lokalen Daten ist nicht<br />
immer angemessen. Dies ist nachvollziehbar, werden doch die nationalen Zuwendungen<br />
auf der Basis der lokalen Angaben entschieden.<br />
− Es besteht die Notwendigkeit der Komb<strong>in</strong>ation verschiedenster Datenressourcen.<br />
Diese s<strong>in</strong>d bee<strong>in</strong>flusst durch die Präferenzen <strong>und</strong> Prioritäten der Nutzer,<br />
der Anbieter <strong>und</strong> der lokalen politischen Entscheidungsträger. Aber diese E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung<br />
der Anbieter ermöglicht auch die Auswahl spezifischer Risikogruppen<br />
<strong>und</strong> das Verständnis partikularer Interessen<br />
− Die verfügbare Datenübersicht aktueller Zuwendungen verdeutlicht Unterschiede<br />
<strong>und</strong> Defizite bei den Zuwendungen <strong>und</strong> ist so Gr<strong>und</strong>lage für neue f<strong>in</strong>anzielle<br />
Ansprüche.<br />
Zum Thema „Commission<strong>in</strong>g“ (Auftragsvergabe/Ausschreibungsverfahren):<br />
Mit dem Verfahren der Auftragsvergabe über öffentliche Ausschreibungen werden traditionelle<br />
Wege bei der Erbr<strong>in</strong>gung sozialer Dienstleistungen auf lokaler Ebene verlassen.<br />
Beschreiben kann man das als Prozess „From Target<strong>in</strong>g to Commission<strong>in</strong>g“. Dabei geht<br />
es um den direkten Zugang zu den Service Providern, den Anbietern der für notwendig<br />
erachteten <strong>sozialen</strong> Dienste.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich werden sehr unterschiedliche Wege <strong>in</strong> den Kommunen beschritten.<br />
In e<strong>in</strong>igen Kommunen wurden Träger <strong>und</strong> Anbieter von Leistungen im Rahmen der<br />
LSP ohne wettbewerbsförmige Verfahren direkt angesprochen <strong>und</strong> beauftragt. Andere<br />
wiederum wählten wettbewerbsförmige Auswahlverfahren. Teilweise wurden diese auch<br />
erst genutzt, um Strategien überhaupt zu entwickeln.<br />
Anhand der Bandbreite dieser Verfahren wird deutlich, wie flexibel die lokalen Entscheidungsträger<br />
im Rahmen der übergreifenden Strategie des Children’s F<strong>und</strong> agierten.<br />
Teilweise konnten hier aber auch Prozesse beobachtet werden, die den Zielen des<br />
Children's F<strong>und</strong> entgegenstehen.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich geht es beim Commission<strong>in</strong>g darum, wer (teilweise <strong>in</strong> Konkurrenz zu anderen<br />
Anbietern) die besten Konzepte vorlegt, die Probleme zu lösen, nicht darum, wer die<br />
Probleme am besten kennt. So werden z. B. Zuständigkeiten an thematisch orientierte<br />
„Commission<strong>in</strong>g Gruppen“ übertragen. So erhofft man sich die Entwicklung klarer <strong>und</strong><br />
str<strong>in</strong>genter Kriterien, die auch e<strong>in</strong>e Bewertung der Ergebnisse erleichtern <strong>und</strong> so besser<br />
Gr<strong>und</strong>lage für weitere strategische Überlegungen se<strong>in</strong> können.<br />
69
Strategisches Vorgehen auf lokaler Ebene<br />
Es wurde deutlich, dass die durch die Children’s F<strong>und</strong> angestrebten strategischen Ansprüche<br />
<strong>und</strong> Ansätze bei der Bekämpfung der Problemlagen der <strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n<br />
nicht immer durchgehalten wurden. Dies hängt offenbar mit spezifischen Zielgruppen zusammen.<br />
So wurde <strong>in</strong> Bezug auf die vielerorts vorhandenen Probleme mit sogenannten<br />
„Travellers“ beobachtet, dass es nicht möglich war, alle relevanten lokalen Authorities <strong>in</strong><br />
die Arbeit e<strong>in</strong>zub<strong>in</strong>den, dass es nur schwer möglich war, die eigentliche Zielgruppe der<br />
nicht-sesshaften <strong>K<strong>in</strong>der</strong> + Eltern zu erreichen <strong>und</strong> dass die Kooperation auf die Träger<br />
beschränkt war, die direkt die Angebote <strong>und</strong> Maßnahmen für die Zielgruppen durchführten.<br />
Es gab ke<strong>in</strong>e übergreifenden strategischen Überlegungen <strong>und</strong> Maßnahmen, die gr<strong>und</strong>sätzliche<br />
Diskrim<strong>in</strong>ierung als Problem anzugehen. In Bezug auf andere Zielgruppen, z. B.<br />
Flüchtl<strong>in</strong>ge <strong>und</strong> Asylbewerber konnten h<strong>in</strong>gegen die angestrebten Ziele besser erreicht<br />
werden.<br />
Reduzierung sozialer Exklusion?<br />
Die Arbeit der lokalen Children’s F<strong>und</strong>s ist h<strong>in</strong>sichtlich der jeweiligen Erfolge unterschiedlich<br />
zu beurteilen, da es sehr differenzierte lokale Strategien <strong>und</strong> <strong>in</strong>haltliche Schwerpunktsetzungen<br />
gab.<br />
Positiv hervorzuheben ist e<strong>in</strong>e gr<strong>und</strong>sätzliche Orientierung auf die Entwicklung übergreifender<br />
präventiver Strategien. Dabei konnte <strong>in</strong> der lokalen Umsetzung von präventiven<br />
Angeboten oft herausgearbeitet werden, welche Angebote tatsächlich funktionieren <strong>und</strong> die<br />
angestrebte Wirkung erzielen, um diese Ansätze dann <strong>in</strong> übergreifende lokale Strategien zu<br />
<strong>in</strong>tegrieren.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich s<strong>in</strong>d die Erfolge der Arbeit des Children’s F<strong>und</strong> <strong>in</strong> Bezug auf das Globalziel<br />
der Reduzierung sozialer Exclusion bei <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n kritisch zu bewerten.<br />
So ist festzustellen, dass die vielschichtigen Dimensionen sozialer Exclusion zwar identifiziert<br />
wurden, ihnen aber nicht umfassend begegnet werden konnte.<br />
Vielfach richteten sich lokale Strategien darauf, die <strong>K<strong>in</strong>der</strong> zu verändern, aber nicht die<br />
Angebote <strong>und</strong> Umstände. Zudem wurde die nationale Strategie des Children’s F<strong>und</strong> oft <strong>in</strong><br />
E<strong>in</strong>zelprojekten umgesetzt, die e<strong>in</strong>e Integration <strong>in</strong> übergreifende Strategien vermissen ließen.<br />
Dem großen Vertrauen <strong>in</strong> die Arbeit <strong>und</strong> die Ressourcen des freiwilligen <strong>und</strong> geme<strong>in</strong>schaftlichen<br />
Sektors auf lokaler Ebene stehen unzureichende formale Kompetenzen der<br />
entsprechenden Akteure gegenüber.<br />
Ob die benannten positiven Ergebnisse <strong>und</strong> Folgen Nachhaltigkeit besitzen, bleibt ebenfalls<br />
abzuwarten.<br />
70
Berichterstattung AG 4: Ressortübergreifende Strategien für<br />
soziale Brennpunkte<br />
Dr. Susann Burchardt<br />
E<strong>in</strong>führung<br />
Die Arbeitsgruppe befasste sich mit ressortübergreifenden Strategien, Programmen <strong>und</strong><br />
Projektansätzen für benachteiligte Regionen <strong>und</strong> Stadtgebiete. Im Gegensatz zu den anderen<br />
Arbeitsgruppen wurde also ke<strong>in</strong> ausgewähltes Politikfeld bearbeitet.<br />
Es wurden Programme aus Deutschland, Frankreich <strong>und</strong> Großbritannien vorgestellt<br />
<strong>und</strong> diskutiert. Die deutsche Präsentation stellte die Programmplattform „Entwicklung <strong>und</strong><br />
Chancen junger Menschen <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong>“ mit se<strong>in</strong>en verschiedenen Förderbauste<strong>in</strong>en<br />
<strong>und</strong> Modellprojekten <strong>in</strong> den Mittelpunkt. Die Kollegen aus Frankreich stellten<br />
zum e<strong>in</strong>en die „Nationale Beobachtungsstelle für sensible städtische Regionen“ vor <strong>und</strong><br />
zum anderen e<strong>in</strong> Bildungsprogramm für benachteiligte Quartiere – das „Programme le<br />
reussitee educative“. Die Entwicklung dieses Programms basiert auf Daten <strong>und</strong> Bef<strong>und</strong>en<br />
der genannten nationalen Beobachtungsstelle. Die britischen Kolleg<strong>in</strong>nen verdeutlichten<br />
die Arbeit des Children’s F<strong>und</strong>s <strong>in</strong> Großbritannien. Die E<strong>in</strong>richtung von lokalen Children’s<br />
F<strong>und</strong>s <strong>in</strong> den britischen Städten <strong>und</strong> Geme<strong>in</strong>den ist e<strong>in</strong> Programmbestandteil der nationalen<br />
Agenda „Every Child Matters“ <strong>in</strong> Großbritannien.<br />
Die Schwerpunkte der Diskussion bewegten sich auf drei Ebenen:<br />
1. Ressortübergreifende Strategien auf der nationalen Ebene – Wie wird auf den<br />
obersten politischen Entscheidungsebenen e<strong>in</strong>e ressortübergreifende Perspektive<br />
<strong>in</strong>stitutionalisiert <strong>und</strong> umgesetzt?<br />
2. Governancestrukturen auf der lokalen Ebene – Wie setzen die lokalen Gebietskörperschaften<br />
ressortübergreifende Strategien um? Welche Akteure (staatlich, gesellschaftlich,<br />
privat) kooperieren mite<strong>in</strong>ander <strong>und</strong> wie tun sie das? In welchen <strong>in</strong>stitutionellen<br />
Kontext s<strong>in</strong>d Projekte <strong>und</strong> Angebote e<strong>in</strong>gebettet? Wie werden diese entwickelt<br />
<strong>und</strong> vergeben?<br />
3. Was kommt von alledem bei den <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n an <strong>und</strong> welche Wirkungen<br />
können erzielt werden?<br />
Geme<strong>in</strong>samkeiten<br />
Die Politikfelder, auf die sich die Programme <strong>und</strong> e<strong>in</strong>zelne Programmbestandteile beziehen<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den vorgestellten Ländern weitgehend dieselben: Integration, Sicherheit, Ges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>und</strong> Beschäftigung. Hervorzuheben ist <strong>in</strong> allen drei Ländern der Schwerpunkt auf Bildungsprogrammen.<br />
Die vorgestellten Programme s<strong>in</strong>d alle zentral <strong>und</strong> auf nationaler Ebene <strong>in</strong>itiiert.<br />
Als besonderes geme<strong>in</strong>sames Kennzeichen ist hervorzuheben, dass es <strong>in</strong> allen drei Ländern<br />
bei der Entwicklung der Programme e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>term<strong>in</strong>isterielle Zusammenarbeit gegeben hat<br />
bzw. gibt.<br />
E<strong>in</strong>e ressortübergreifende Perspektive ist <strong>in</strong> den drei Ländern auch auf der lokalen Ebene<br />
verankert. Dies bedeutet, dass <strong>in</strong> den Kommunen e<strong>in</strong>e Kooperation der relevanten<br />
71
staatlichen <strong>und</strong> gesellschaftlichen Akteure angestrebt wird – Jugendämter, freie Träger,<br />
Bildungse<strong>in</strong>richtungen, Beschäftigungsförderung, Polizei, Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>richtungen.<br />
Geme<strong>in</strong>sam ist allen drei vorgestellten Programmen e<strong>in</strong>e sozialräumliche Orientierung,<br />
auch wenn deutlich wurde, dass das Pr<strong>in</strong>zip der Sozialraumorientierung für Zielgruppen,<br />
die durch Unsesshaftigkeit charakterisiert s<strong>in</strong>d (Roma <strong>und</strong> S<strong>in</strong>ti, Traveller), nicht zielführend<br />
ist.<br />
In allen drei Fällen wurde e<strong>in</strong>e ganzheitliche Perspektive auf die <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n<br />
hervorgehoben, was auch <strong>in</strong> dem bereits genannten Pr<strong>in</strong>zip der sozialräumlichen Arbeit<br />
zum Ausdruck kommt, welches das gesamte soziale Umfeld der <strong>K<strong>in</strong>der</strong> – <strong>in</strong> dem die<br />
Probleme entstehen, <strong>in</strong> die Bemühungen e<strong>in</strong>bezieht.<br />
Schließlich ist allen vorgestellten Ansätzen e<strong>in</strong>e starke Ressourcenorientierung zu besche<strong>in</strong>igen.<br />
Alle Programme heben auf e<strong>in</strong>e Förderung <strong>und</strong> Mobilisierung der vorhandenen<br />
strukturellen <strong>und</strong> <strong>in</strong>dividuellen Ressourcen <strong>in</strong> den benachteiligten Stadtteilen <strong>und</strong> Regionen<br />
ab.<br />
Unterschiede<br />
Die wesentlichen Unterschiede betreffen <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie die <strong>in</strong>stitutionellen <strong>und</strong> politischstrukturellen<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen der jeweiligen Programmstrategien.<br />
In Frankreich gibt es e<strong>in</strong>e ressortübergreifende Arbeitsgruppe, die direkt beim Stab des<br />
Premierm<strong>in</strong>isters angesiedelt ist. In dieser werden Querschnittsthemen, wie das der Jugendpolitik,<br />
programmunabhängig diskutiert. Diese fest <strong>in</strong>stitutionalisierte übergreifende<br />
Struktur f<strong>in</strong>det <strong>in</strong> Frankreich auf der kommunalen Ebene <strong>in</strong> Form der dort angesiedelten<br />
Präfekturen ihre Entsprechung. E<strong>in</strong>e ähnlich fest verankerte <strong>und</strong> hierarchisch hoch angeb<strong>und</strong>ene<br />
Arbeitsstruktur wurde für Großbritannien <strong>und</strong> Deutschland nicht berichtet.<br />
Unterschiedliche <strong>in</strong>stitutionelle Strukturen, die auch im föderalen Aufbau der Länder<br />
verankert s<strong>in</strong>d, bed<strong>in</strong>gen auf der lokalen Ebene Unterschiede bei den Möglichkeiten der<br />
E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung relevanter Akteure, wie zum Beispiel der Schulen. Schulen können im Rahmen<br />
der Programmumsetzungen <strong>in</strong> Frankreich <strong>und</strong> Großbritannien weiter reichende Aufgaben<br />
übernehmen als <strong>in</strong> Deutschland.<br />
E<strong>in</strong> weiterer Unterschied bezieht sich auf die Datenlage über die zu bearbeitenden<br />
Problemlagen. Während <strong>in</strong> Frankreich durch die Beobachtungsstelle für alle zugängliche<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>heitlich erhobene Informationen vorliegen, ist die Datenlage <strong>in</strong> Deutschland <strong>und</strong><br />
Großbritannien quantitativ <strong>und</strong> qualitativ ungleichmäßig.<br />
Unterschiedlich ist auch der Zugang zu den Programmen <strong>in</strong> den Ländern. In Deutschland<br />
„bewerben“ sich die Kommunen für e<strong>in</strong>e Programmteilnahme, <strong>in</strong> Frankreich werden<br />
Programmgebiete ausgewiesen. In Großbritannien h<strong>in</strong>gegen ist jede Kommune verpflichtet<br />
im Rahmen der Umsetzung der nationalen Agenda „Every Child Matters“ e<strong>in</strong>en lokalen<br />
Childrens F<strong>und</strong> e<strong>in</strong>zurichten.<br />
72
Handlungsempfehlungen<br />
Stärkung der lokalen Ebene: Die Kommunen brauchen eigene Handlungsspielräume, um<br />
lokale Strategien zu entwickeln, mit denen zentrale nationale strategische Vorgaben umgesetzt<br />
werden sollen.<br />
Es bedarf nationaler, e<strong>in</strong>heitlicher Berichtssysteme über die Problemlagen vor Ort.<br />
Wichtig ist hierbei aber e<strong>in</strong> gesellschaftlicher <strong>und</strong> politischer Diskurs darüber, welche Kriterien/Indikatoren<br />
als wesentlich erachtet werden <strong>und</strong> wie e<strong>in</strong>e Bewertung vorgenommen<br />
werden kann, damit es nicht zu Disfunktionalitäten solcher Instrumente kommt.<br />
Empfohlen wird e<strong>in</strong>e ganzheitliche Perspektive auf die <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n sowie<br />
e<strong>in</strong>e Orientierung auf sozialräumliche Ansätze <strong>in</strong> den Programmen <strong>und</strong> konkreten Projekten.<br />
Hierzu bedarf es e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>stitutionellen Absicherung ressortübergreifender Kooperationen<br />
auf allen politischen Entscheidungsebenen, um dies zu gewährleisten.<br />
Als <strong>in</strong>haltliche Schwerpunkte werden Bildungs- <strong>und</strong> Integrationsprogramme empfohlen.<br />
Schließlich wird dafür plädiert, die ausgrenzenden Umstände (Personen, Strukturen) <strong>in</strong><br />
entsprechende Programmbemühungen e<strong>in</strong>zubeziehen.<br />
73
Arbeitsgruppe 5: Lokale Strategien zur Aktivierung beschäftigungswirksamer<br />
<strong>und</strong> sozialer Potentiale im Rahmen<br />
des ESF-Instruments der ger<strong>in</strong>gen Zuschussbeträge<br />
(Small Grants)<br />
Auf Gr<strong>und</strong> der Bedeutung des ESF-B<strong>und</strong>esprogramms „Lokales Kapital für soziale Zwecke“<br />
(LOS) für die Arbeit <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong> <strong>in</strong> Deutschland beschäftigt sich die<br />
Arbeitsgruppe 5 mit diesem Programm <strong>und</strong> entsprechenden ESF-Programmen aus anderen<br />
Mitgliedstaaten. Geme<strong>in</strong>same Fördergr<strong>und</strong>lage dieser Programme ist Artikel 4 Abs. 2 der<br />
ESF- Verordnung 1784/1999, wonach ger<strong>in</strong>ge Zuschussbeträge (Small Grants) an Kle<strong>in</strong>stprojekte<br />
zur beruflichen <strong>und</strong> <strong>sozialen</strong> Integration benachteiligter Personen vergeben werden<br />
können. Die Vergabe erfolgt <strong>in</strong> der Regel über zwischengeschaltete Stellen, denen die<br />
entsprechenden Mittel über Globalzuschüsse (Global Grants) zur Verfügung gestellt werden.<br />
Das Förder<strong>in</strong>strument wurde zunächst <strong>in</strong> der Pilotaktion „Local Social Capital“ (1999<br />
bis 2002) erprobt <strong>und</strong> ist <strong>in</strong> der ESF-Förderperiode 2000 bis 2006 <strong>in</strong> Deutschland, Dänemark,<br />
F<strong>in</strong>nland, Frankreich, im Vere<strong>in</strong>igten Königreich, Italien, Schweden, Spanien <strong>und</strong> der<br />
Tschechische Republik <strong>in</strong> Form eigener Programme fortgeführt worden.<br />
In der Arbeitsgruppe haben Vertreter/-<strong>in</strong>nen aus Deutschland, England <strong>und</strong> Italien die<br />
Umsetzung dieses Instruments <strong>in</strong> ihren Ländern präsentiert, es wurden Geme<strong>in</strong>samkeiten<br />
bzw. Unterschiede herausgearbeitet <strong>und</strong> Handlungsempfehlungen für e<strong>in</strong>e Weiterentwicklung<br />
dieses Instrumentes aufgestellt.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus wurden auf e<strong>in</strong>er Projektmesse weitere „Small Grants“ - Programme<br />
bzw. deren lokale Projekte zur beruflichen <strong>und</strong> <strong>sozialen</strong> Integration benachteiligter Personen<br />
aus neun europäischen Ländern präsentiert (siehe Projektmesse).<br />
Präsentation Deutschland<br />
Claudia Fligge-Hoffjann, B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für<br />
Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend<br />
Christoph Schwamborn, Regiestelle LOS<br />
Petra Meier to Berndt-Seidl, Oberbürgermeister<strong>in</strong> von<br />
L<strong>in</strong>dau sowie weitere Vertreter/<strong>in</strong>nen aus dem<br />
Fördergebiet L<strong>in</strong>dau-Zech<br />
ESF-Programm „Lokales Kapital für<br />
Soziale Zwecke“ (LOS)<br />
Das Programm <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e strategische<br />
Ausrichtung<br />
Die Erfahrung zeigt, dass gerade kle<strong>in</strong>e<br />
Nichtregierungsorganisationen <strong>und</strong> lokale Initiativen<br />
mit ihren passgenauen Angeboten <strong>und</strong> ihrer flexiblen<br />
Herangehensweise besonders gut Menschen, die am<br />
Rande der Gesellschaft stehen bzw. besondere<br />
Probleme auf dem Arbeitsmarkt haben, erreichen<br />
74<br />
C. Fligge-Hoffjann C. Schwamborn<br />
P. Meier to Berndt-Seidl
können. Deshalb hat Deutschland für die ESF-Förderperiode 2000-2006 <strong>in</strong> Umsetzung des<br />
Artikel 4 Abs. 2 der ESF-Verordnung 1784/1999 <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en ESF-Planungsdokumenten<br />
e<strong>in</strong>en Schwerpunkt auf die Maßnahme 11 „Kle<strong>in</strong>projekte zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit<br />
<strong>und</strong> der lokalen-<strong>sozialen</strong> Entwicklung“ gelegt. Es sollen – Zitat aus den<br />
Programmplanungsdokumenten – „Akteure auf lokaler Ebene mit kle<strong>in</strong>eren Förderbeträgen<br />
<strong>in</strong> die Lage versetzt werden, vor Ort vorhandenes Potenzial zur Beschäftigungsentwicklung<br />
<strong>und</strong> zur E<strong>in</strong>gliederung auf den Arbeitsmarkt zu mobilisieren <strong>und</strong> so lokale Antworten<br />
auf lokale Bedürfnisse zu f<strong>in</strong>den … Ziel ist es, besonders benachteiligten Personen<br />
vor allem durch Erschließung lokaler Ressourcen die Möglichkeiten zur E<strong>in</strong>gliederung bzw.<br />
Wiedere<strong>in</strong>gliederung <strong>in</strong> das Erwerbsleben zu geben. Dabei sollen lokale Akteure als Projektträger<br />
erreicht werden, die im Rahmen der klassischen ESF-Intervention bisher wenig<br />
<strong>in</strong> Ersche<strong>in</strong>ung getreten s<strong>in</strong>d.“<br />
Bed<strong>in</strong>gt durch das föderale System <strong>in</strong> Deutschland werden ESF-Programme eigenständig<br />
<strong>in</strong> den B<strong>und</strong>esländern <strong>und</strong> durch den B<strong>und</strong> durchgeführt. 12 von 16 B<strong>und</strong>esländern –<br />
das s<strong>in</strong>d Bayern, Berl<strong>in</strong>, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-<br />
Vorpommern, Niedersachsen, Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt <strong>und</strong> Thür<strong>in</strong>gen –<br />
haben Programme nach Maßnahme 11 durchgeführt, die teilweise beendet s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> teilweise<br />
noch laufen. Die Umsetzung erfolgt dort unter verschiedenen Bezeichnungen, mit<br />
unterschiedlichen Zielgruppen, unterschiedlicher regionaler Aufteilung <strong>und</strong> differenzierten<br />
Laufzeiten.<br />
Auch der B<strong>und</strong> hat die Maßnahme 11 umgesetzt. So hat das B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für<br />
Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend (BMFSFJ) 2003 das B<strong>und</strong>esmodellprogramm „Lokales<br />
Kapital für soziale Zwecke“ (LOS) <strong>in</strong>s Leben gerufen, das noch bis Mitte 2008 läuft. Bei<br />
der Programmumsetzung maßgeblich unterstützt wird das B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium dabei von<br />
der Regiestelle LOS, als „zwischengeschaltete Stelle“. Die Regiestelle LOS ist e<strong>in</strong>e Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
(ARGE) <strong>und</strong> besteht aus der Stiftung SPI <strong>und</strong> der Gesellschaft für soziale<br />
Unternehmensberatung.<br />
LOS hat viele Geme<strong>in</strong>samkeiten, aber auch e<strong>in</strong>ige spezifische Besonderheiten gegenüber<br />
anderen Programmen im nationalen bzw. europäischen Raum. E<strong>in</strong> wesentlicher Unterscheid<br />
ist, dass LOS e<strong>in</strong>en sozialräumlichen Ansatz verfolgt, also die Förderung von Sozialräumen<br />
<strong>in</strong> den Mittelpunkt stellt. LOS unterstützt Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf,<br />
<strong>in</strong>sgesamt konnten bislang 287 Gebiete von der Förderung profitieren.<br />
Wie <strong>in</strong> vielen europäischen Städten bef<strong>in</strong>den sich auch <strong>in</strong> Deutschland Stadtteile <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Krisensituation. Das Leben der Bewohner<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Bewohner ist vielfach geprägt durch<br />
fehlende Teilhabe am Erwerbsleben <strong>und</strong> dadurch bed<strong>in</strong>gter Abhängigkeit von Transfere<strong>in</strong>kommen.<br />
Dazu kommen der Verlust unterstützender sozialer Netze <strong>und</strong> erschwerter Zugang<br />
zu <strong>sozialen</strong> <strong>und</strong> kulturellen Angeboten <strong>und</strong> vor allem zur Bildung. Durch soziale Isolation<br />
<strong>und</strong> das Leben <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em geschlossenen Milieu gehen die Brücken zur ‚normalen Gesellschaft'<br />
verloren. Diejenigen, die es sich leisten können, ziehen <strong>in</strong> attraktivere Quartiere,<br />
übrig bleiben oft die, die ohneh<strong>in</strong> auf staatliche Unterstützungsleistungen angewiesen s<strong>in</strong>d.<br />
Gerade für <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> bedeutet das von vornhere<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>ge Entwicklungschancen<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>geschränkte Teilhabe an der Gesellschaft.<br />
75
Um diese Bed<strong>in</strong>gungen aufzubrechen, hat die B<strong>und</strong>esregierung zahlreiche Programme<br />
für solche Problemgebiete aufgelegt. Dazu zählen neben LOS <strong>in</strong>sbesondere das B<strong>und</strong>-<br />
Länder-Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die Soziale Stadt“,<br />
durch das seit 1999 vor allem <strong>in</strong>vestive Maßnahmen <strong>in</strong> mehr als 400 Gebieten gefördert<br />
werden, sowie die 2001 <strong>in</strong>itiierte Programmplattform „Entwicklung <strong>und</strong> Chancen junger<br />
Menschen <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong>“ (E&C) des BMFSFJ, durch die vor allem Aktivitäten<br />
im Rahmen der Kooperationsförderung <strong>in</strong> der Arbeit mit jungen Menschen angestoßen<br />
wurden. LOS mit se<strong>in</strong>em Anliegen – die soziale <strong>und</strong> berufliche Integration von besonders<br />
benachteiligten Personen zu verbessern – ergänzt <strong>in</strong> idealer Weise die genannten Programme<br />
<strong>und</strong> trägt zur Aufwertung der Sozialräume bei.<br />
Jedes der genannten Programme hat se<strong>in</strong>e eigenen Ziele <strong>und</strong> Ausrichtung. Sie alle verb<strong>in</strong>det<br />
jedoch die sozialräumliche Sichtweise, aus der sich folgende geme<strong>in</strong>same Gr<strong>und</strong>lagen<br />
ergeben:<br />
• Sozialräume müssen örtlich festgelegt <strong>und</strong> planerisch erfasst se<strong>in</strong>.<br />
• Es bedarf e<strong>in</strong>er Kooperation der verschiedenen Ämter sowie<br />
• e<strong>in</strong>er Aktivierung <strong>und</strong> direkten Beteiligung der Bewohner<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Bewohner.<br />
• Zur Steuerung ist e<strong>in</strong> lokales Management e<strong>in</strong>zurichten.<br />
Aus diesen Gr<strong>und</strong>lagen ergaben sich für LOS folgende Programmvorgaben:<br />
• Aufstellung e<strong>in</strong>es Lokalen Aktionsplans<br />
• Funktionierendes Ämternetzwerk<br />
• E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>er Lokalen Koord<strong>in</strong>ierungsstelle durch die Kommune oder den<br />
Landkreis<br />
• Beteiligung des Lokalen Netzwerks<br />
• E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>es Begleitausschusses mit Akteuren aus dem Fördergebiet<br />
• Beteiligung der Bewohner/-<strong>in</strong>nen<br />
Das Herzstück von LOS ist dabei die Förderung von Lokalen Aktionsplänen. Die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
Konzeptwettbewerb ausgewählten Gebietskörperschaften erhalten von der Regiestelle<br />
pro Fördergebiet <strong>und</strong> Förderperiode (jeweils e<strong>in</strong> Jahr) Fördermittel <strong>in</strong> Höhe von maximal<br />
100.000 € für die Erstellung bzw. Fortschreibung <strong>und</strong> Umsetzung e<strong>in</strong>es Lokalen Aktionsplans.<br />
Zur Umsetzung des Aktionsplans können aus dieser Fördersumme dann durch die<br />
Gebietskörperschaft konkrete Mikroprojekte f<strong>in</strong>anziell unterstützt werden. Anders als bei<br />
anderen ESF-Programmen werden die Mikroprojekte bei LOS also nicht direkt durch die<br />
zwischengeschaltete Stelle gefördert, sondern durch den Fördermittelempfänger des Lokalen<br />
Aktionsplans selbst.<br />
Was s<strong>in</strong>d Lokale Aktionspläne? Der Lokale Aktionsplan ist e<strong>in</strong> Instrument der kommunalen<br />
Politik, mit dessen Hilfe die Vernetzung von Bürger/<strong>in</strong>nen, Politik, Verwaltung, lokaler<br />
Wirtschaft, freien Trägern, Bildungse<strong>in</strong>richtungen etc. vor Ort <strong>in</strong>tensiviert <strong>und</strong> verstetigt<br />
werden soll.<br />
Was ist Inhalt e<strong>in</strong>es solchen LOS-Aktionsplans? Der Lokale Aktionsplan enthält Angaben<br />
zum Fördergebiet (z. B. Strukturdaten wie Arbeitslosen-, Sozialhilfe- <strong>und</strong> Ausländerquote),<br />
e<strong>in</strong>e Situationsanalyse des Fördergebietes, die Aufstellung von Entwicklungszielen<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong> darauf abgestelltes Handlungskonzept mit Projektideen. Darüber h<strong>in</strong>aus s<strong>in</strong>d Aussagen<br />
zu den e<strong>in</strong>zelnen Kooperationsformen <strong>und</strong> Netzwerken zu formulieren.<br />
76
An der Umsetzung von LOS im Fördergebiet wirken die - bereits erwähnten - verschiedenen<br />
Akteure <strong>und</strong> Gremien mit:<br />
Wesentlich für LOS ist das Ämternetzwerk, das aus allen relevanten Ämtern bestehen<br />
sollte. Dies s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbesondere das Jugendamt, Amt für Wirtschaftsförderung bzw. für<br />
Stadtentwicklung <strong>und</strong> die Agentur für Arbeit. Je nach Problemlage können weitere Ämter<br />
dazu kommen. Die Aufgabe des Ämternetzwerkes ist es, die Bedarfe der Gebietskörperschaft<br />
zu bündeln <strong>und</strong> <strong>in</strong> den LOS-Prozess e<strong>in</strong>zubr<strong>in</strong>gen. Das Ämternetzwerk ist <strong>in</strong> die<br />
Entwicklung <strong>und</strong> Fortschreibung der Handlungsstrategie des Aktionsplans e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en<br />
<strong>und</strong> ist im Begleitausschuss mit vertreten.<br />
Bei e<strong>in</strong>em dieser Ämter des Ämternetzwerkes wird e<strong>in</strong>e Lokale Koord<strong>in</strong>ierungsstelle<br />
e<strong>in</strong>gerichtet. Die Gebietskörperschaft stellt dazu e<strong>in</strong>e Verwaltungskraft frei, wobei 20 %<br />
der LOS-Fördermittel als Sachkosten der Koord<strong>in</strong>ierungsstelle geltend gemacht werden<br />
können. Der Lokalen Koord<strong>in</strong>ierungsstelle kommt e<strong>in</strong>e zentrale Rolle zu: Sie managt <strong>und</strong><br />
steuert die Programmumsetzung vor Ort. Sie ist für den Informationstransfer im Gebiet<br />
zuständig, verantwortet die Akquise <strong>und</strong> Beratung der Mikroprojektträger sowie ferner die<br />
Abrechnung der Fördermittel <strong>und</strong> betreibt die Öffentlichkeitsarbeit zur Bekanntmachung<br />
des Lokalen Aktionsplans.<br />
Auch das Lokale Netzwerk begleitet die Umsetzung von LOS im Fördergebiet mit –<br />
<strong>in</strong>sbesondere ist das Netzwerk bei Erstellung <strong>und</strong> Fortschreibung des Aktionsplans zu<br />
beteiligen <strong>und</strong> ist mit im Begleitausschuss vertreten. Das Lokale Netzwerk ist ke<strong>in</strong> <strong>in</strong>stitutionalisiertes<br />
Gremium, sondern e<strong>in</strong> loser Zusammenschluss aus den Akteuren, die Verantwortung<br />
für das Fördergebiet übernehmen. Das können soziale E<strong>in</strong>richtungen, Schulen,<br />
Vere<strong>in</strong>e <strong>und</strong> Organisationen, E<strong>in</strong>zelpersonen, Bewohner/-<strong>in</strong>nen, Zielgruppenvertreter/<strong>in</strong>nen,<br />
Betriebe bzw. Kirchengeme<strong>in</strong>den se<strong>in</strong>.<br />
Über die Förderung der Mikroprojekte wird, wie bereits erwähnt, nicht auf B<strong>und</strong>esebene<br />
durch das B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium bzw. die Regiestelle entschieden, sondern vor Ort. Die<br />
Auswahl der Mikroprojekte trifft dabei der <strong>in</strong> jedem Fördergebiet zu bildende Begleitausschuss,<br />
dem neben Vertreter/-<strong>in</strong>nen der öffentlichen Verwaltung vor allem auch zivilgesellschaftliche<br />
Akteure, dabei <strong>in</strong>sbesondere Vertreter/-<strong>in</strong>nen der anvisierten Zielgruppen <strong>und</strong><br />
Bewohner/-<strong>in</strong>nen, angehören sollen. Diese s<strong>in</strong>d also nicht nur Adressaten der Projekte,<br />
sondern sollen auch selbst über die Projekte mitentscheiden. Darüber h<strong>in</strong>aus sollen die<br />
Bewohner/-<strong>in</strong>nen auch <strong>in</strong> die Erstellung <strong>und</strong> Fortschreibung der im Lokalen Aktionsplans<br />
verankerten Handlungsstrategie e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en werden. Die direkte Beteiligung der Zielgruppe<br />
bzw. der Bewohner/-<strong>in</strong>nen des Fördergebiets als aktive Mitgestalter ist e<strong>in</strong>e Besonderheit<br />
von LOS, die <strong>in</strong> allen Fördergebieten umgesetzt worden ist. Darüber h<strong>in</strong>aus kann<br />
e<strong>in</strong>e ausgeglichene Verteilung der Interessengruppen <strong>in</strong> den LOS-Begleitausschüssen festgestellt<br />
werden.<br />
LOS verfolgt mit se<strong>in</strong>em Konzept der lokalen Programmumsetzung damit e<strong>in</strong>erseits e<strong>in</strong>en<br />
Top-Down-Ansatz durch die kommunale Anb<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> andererseits e<strong>in</strong>en Bottom-<br />
Up-Ansatz durch die Beteiligung der zivilgesellschaftlichen Akteure.<br />
77
Die Umsetzung<br />
Für die Durchführung von LOS <strong>in</strong> den bisher vier Förderperioden standen <strong>in</strong>sgesamt ca.<br />
87 Mio. € zur Verfügung. Für die fünfte Förderperiode, die am 01.07.2007 beg<strong>in</strong>nt, s<strong>in</strong>d<br />
noch e<strong>in</strong>mal 24 Mio. € e<strong>in</strong>geplant. Ursprünglich waren drei Förderperioden mit ca.<br />
40 Mio. € vorgesehen. Daraus ist ersichtlich, dass LOS zu e<strong>in</strong>em Erfolgsfaktor <strong>in</strong> Deutschland<br />
geworden ist.<br />
Insgesamt s<strong>in</strong>d bisher 287 Lokale Aktionspläne <strong>in</strong> 200 Kommunen bzw. Landkreisen<br />
bis zu vier Jahren gefördert worden. 11.937 Mikroprojekte wurden bisher durchgeführt,<br />
durch die 332.004 Personen erreicht bzw. (vor)-beruflich qualifiziert worden s<strong>in</strong>d. Von den<br />
287 geförderten Gebieten gehören 278 dem B<strong>und</strong>-Länder-Programm „ Die Soziale Stadt“<br />
an <strong>und</strong> neun Gebiete s<strong>in</strong>d E&C-Landkreise. In der überwiegenden Mehrheit liegen die<br />
Fördergebiete <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Großstadt (133) bzw. Mittelstadt (114). Nur 31 kle<strong>in</strong>städtische bzw.<br />
e<strong>in</strong>e ländliche Geme<strong>in</strong>de werden durch LOS gefördert. Die E<strong>in</strong>wohnerzahl variiert sehr<br />
stark <strong>und</strong> reicht vom kle<strong>in</strong>sten Gebiet mit 304 bis zum größten Gebiet mit fast 100.000<br />
E<strong>in</strong>wohner/-<strong>in</strong>nen. Im Durchschnitt wohnen ca. 14.000 E<strong>in</strong>wohner/-<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em LOS-<br />
Fördergebiet. Geme<strong>in</strong>sam ist den Gebieten die im Vergleich zur jeweiligen Gesamtstadt<br />
höhere Arbeitslosenquote, wobei die Quote je nach B<strong>und</strong>esland sehr unterschiedlich se<strong>in</strong><br />
kann.<br />
Bei den Fördergebieten können zwei Arten von Gebietstypen unterschieden werden: In<br />
den westdeutschen Stadtteilen überwiegen traditionelle soziale Brennpunkte, die sich durch<br />
e<strong>in</strong>en hohen Anteil von Menschen mit Migrationsh<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong>, bildungsferner Bevölkerung<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>er generationsübergreifenden Abhängigkeit von Transferleistungen (Sozialhilfeadel)<br />
auszeichnet. In den Stadtteilen gibt es e<strong>in</strong>e Kernbevölkerung, aber auch e<strong>in</strong>e hohe Fluktuation.<br />
Die Fördergebiete s<strong>in</strong>d entweder ehemalige Arbeitersiedlungen, sanierungsbedürftige<br />
Innenstadtlagen oder Hochhaussiedlungen aus den 70er Jahren.<br />
In den ostdeutschen Stadtteilen ist h<strong>in</strong>gegen e<strong>in</strong>e neue Abhängigkeit von Transferleistungen<br />
<strong>und</strong> damit e<strong>in</strong>hergehend e<strong>in</strong>e zunehmende Desillusionierung der Bevölkerung zu<br />
verzeichnen. Der Anteil von Menschen mit Migrationsh<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> ist dort ger<strong>in</strong>g. Bed<strong>in</strong>gt<br />
durch den Rückbau bzw. Abriss der Siedlungen - meist Hochhaussiedlungen (Plattenbau) -<br />
<strong>und</strong> der Abwanderung von jungen, mobilen Personen mit e<strong>in</strong>er Ausbildung, reduziert sich<br />
die Bevölkerung <strong>in</strong> den Fördergebieten.<br />
Die Umsetzer der LOS-Mikroprojekte haben zu 80 % ke<strong>in</strong>e Erfahrung mit dem ESF.<br />
Damit konnte e<strong>in</strong>e wesentliche Zielvorgabe des Programms, vor allem ESF-unerfahrene<br />
Träger zu fördern, e<strong>in</strong>gehalten werden. Zu fast 40 % s<strong>in</strong>d lokale Vere<strong>in</strong>e aktiv, dazu kommen<br />
noch E<strong>in</strong>zelpersonen, Unternehmen, Schulen, Kirchengeme<strong>in</strong>den <strong>und</strong> die ESFerfahreneren<br />
Bildungs- <strong>und</strong> Qualifizierungsträger bzw. Wohlfahrtsverbände.<br />
Die Fördermittelhöhe der Mikroprojekte ist auf 10.000,- € begrenzt. Die Kosten pro<br />
Mikroprojekt reichen von 200,- € bis 10.000,- €, der Durchschnitt liegt bei ca. 6.500,- €.<br />
78
Gefördert werden können drei Aktionen bzw. Projekttypen16 :<br />
• Die Unterstützung „e<strong>in</strong>zelner Aktionen zur Förderung der beruflichen E<strong>in</strong>gliederung“:<br />
Dieser Projekttyp wird mit über 80 % am häufigsten gewählt.<br />
• Die „Unterstützung von Organisationen <strong>und</strong> Netzwerken, die sich für benachteiligte<br />
Menschen am Arbeitsmarkt e<strong>in</strong>setzen“: 20 % der Mikroprojekte s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><br />
diesem Bereich tätig.<br />
• Die „Unterstützung bei der Existenzgründung <strong>und</strong> bei der Gründung von <strong>sozialen</strong><br />
Betrieben“: Dieser Projekttyp wurde zu fast 10 % umgesetzt.<br />
LOS spricht damit vorwiegend natürliche Personen als Zielgruppe an. Durch die Verantwortungsdelegation<br />
auf die lokale Ebene ist es den Akteuren vor Ort überlassen, welche<br />
LOS-Zielgruppen sie im Lokalen Aktionsplan konkret beschreiben. Bei der Umsetzung<br />
von LOS hat sich dadurch e<strong>in</strong>e heterogene Verteilung der Zielgruppen <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen<br />
Fördergebieten etabliert. Zusammenfassend lassen sich aber sozial benachteiligte <strong>Jugendliche</strong>,<br />
Langzeitarbeitslose, Aussiedler/-<strong>in</strong>nen sowie Migrant/-<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> <strong>in</strong>sbesondere Frauen<br />
aus diesen Zielgruppen als Hauptzielgruppen von LOS benennen. Alle<strong>in</strong>erziehende,<br />
Berufsrückkehrer/-<strong>in</strong>nen, Wiedere<strong>in</strong>steiger/-<strong>in</strong>nen, ältere Arbeitnehmer/-<strong>in</strong>nen, beh<strong>in</strong>derte<br />
Menschen, Wohnungslose, Suchtmittelabhängige <strong>und</strong> Straffällige standen weniger im Fokus<br />
von LOS.<br />
Dem Anspruch, alle beschäftigungsfähigen Altersgruppen zu erreichen, wird LOS nicht<br />
ganz gerecht. Die Gruppe der über 55-Jährigen als spezielle Zielgruppe wurde <strong>in</strong> den ersten<br />
drei Jahren nur von 64 Mikroprojekten speziell angesprochen, was e<strong>in</strong>en Anteil von 0,78 %<br />
entspricht. Die Mehrzahl der Mikroprojekte war mit fast 60 % für Teilnehmer/-<strong>in</strong>nen aller<br />
Altersgruppen konzipiert. <strong>Jugendliche</strong> unter 25 Jahren s<strong>in</strong>d mit den verbleibenden 40% der<br />
Mikroprojekte trotzdem e<strong>in</strong>e zentrale Zielgruppe von LOS.<br />
Die Bandbreite der LOS-Projekte ist groß. Bei den Projekten für natürliche Personen wurden<br />
<strong>in</strong>sbesondere folgende Handlungsfelder bedient:<br />
• berufliche Qualifizierung durch Projekte<br />
• Integrationsprojekte für besonders Benachteiligte, z. B. Migrant/-<strong>in</strong>nen, Langzeitarbeitslose<br />
etc.<br />
• Förderung von Toleranz <strong>und</strong> Demokratie<br />
• gezielte Maßnahmen gegen Schulabbruch<br />
• Existenzgründungen<br />
• Bewerbungstra<strong>in</strong><strong>in</strong>g/Coach<strong>in</strong>g/Berufliche Beratung/Profil<strong>in</strong>g/Assessment<br />
• Berufliche Orientierung (mit Praxis) / Praktika<br />
• Sprachkurse/Sprachförderung<br />
• Qualifizierung (z. B. EDV, Medien)<br />
• sonstige Beratung<br />
• Stärkung von Schlüsselkompetenzen<br />
Bei den LOS-Projekten handelt es sich damit vorwiegend um so genannte „Vorfeldmaßnahmen“.<br />
Es geht also primär um die Heranführung der benachteiligten Personen an<br />
den Arbeitsmarkt, um die Erhöhung ihrer Beschäftigungsfähigkeit. Darüber h<strong>in</strong>aus hat<br />
LOS aber auch e<strong>in</strong>e nicht unerhebliche Beschäftigungswirkung entfaltet. Insgesamt s<strong>in</strong>d<br />
16 Mehrfachnennung möglich<br />
79
7.852 zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse entstanden. Weitere 4.239 Vermittlungen von<br />
sozial benachteiligten <strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> Ausbildung etc. konnten erreicht werden.<br />
Als e<strong>in</strong> hervorragendes Umsetzungsbeispiel von LOS ist das Fördergebiet Zech <strong>in</strong> der<br />
Stadt L<strong>in</strong>dau <strong>in</strong> Bayern zu nennen. Im Stadtteil L<strong>in</strong>dau-Zech liegt e<strong>in</strong> Schwerpunkt des<br />
Programms <strong>in</strong> der Unterstützung von <strong>Jugendliche</strong>n beim Übergang von Schule <strong>in</strong> die Berufswelt.<br />
Hier erarbeiten die Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeiter <strong>in</strong> Zech geme<strong>in</strong>sam mit den<br />
<strong>Jugendliche</strong>n deren berufliche <strong>und</strong> soziale Perspektiven. Parallel dürfen sie <strong>in</strong> sog. Juniorfirmen<br />
arbeiten, die bezahlte Dienstleistungen oder Produkte anbieten, z. B. im Bereich<br />
Holz, Metal, Gastronomie etc., jeweils abhängig von den Berufsvorstellungen der <strong>Jugendliche</strong>n.<br />
Nach Beendigung ihres Jobs erhalten sie e<strong>in</strong>e Schlussauswertung, e<strong>in</strong> Arbeitszeugnis<br />
<strong>und</strong> bei Bedarf weitere Unterstützung bei der Vermittlung auf dem „realen“ Arbeitsmarkt.<br />
Dank der umfassenden Berufsvorbereitungen s<strong>in</strong>d die <strong>Jugendliche</strong>n dann nachhaltig den<br />
Anforderungen des Arbeitsmarktes gewachsen <strong>und</strong> haben somit viel bessere Chancen im<br />
späteren Berufsleben. Weitere Information s<strong>in</strong>d zu erhalten unter:<br />
www.leben-<strong>in</strong>-zech.de/cms/fileadm<strong>in</strong>/downloads/flyer/2007_06_26_praesentation_leipzig.pdf<br />
Zusammenfassend lässt sich folgende Bilanz für die wichtigsten LOS-Kriterien ziehen:<br />
• Ämternetzwerk: E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung fast aller relevanten Ämter <strong>in</strong> das Netzwerk der<br />
Gebietskörperschaften.<br />
• Bürgerschaftliches Engagement: Ehrenamtliches Engagement von über 4.000<br />
Menschen <strong>in</strong> den LOS-Begleitausschüssen.<br />
• Aktivierung besonderer Zielgruppen: Fast alle Zielgruppen gemäß den Programmplanungsdokumenten<br />
(Förderzeitraum 2000 – 2006) konnten erreicht<br />
werden. Über 300.000 Personen haben an über 11.000 Mikroprojekten teilgenommen.<br />
• Heranführung unerfahrener Träger <strong>und</strong> kle<strong>in</strong>er Initiativen an den ESF: Durchführung<br />
der LOS-Mikroprojekte durch Träger, die zu 80% unerfahren <strong>in</strong> der<br />
Beantragung <strong>und</strong> Durchführung von ESF-Projekten waren.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der sehr positiven Umsetzung von LOS <strong>in</strong> der Vergangenheit plant das<br />
BMFSFJ für die neue ESF-Förderperiode e<strong>in</strong>e Fortsetzung von LOS <strong>in</strong> konzeptionell angepasster<br />
Form.<br />
Weitere Informationen unter www.los-onl<strong>in</strong>e.de<br />
80
Präsentation Italien<br />
Prof. Dott. Maurizio Ambros<strong>in</strong>i, Universität Mailand<br />
Dott. Luciano Ambrosio, Verantwortlicher des<br />
Projektes Union.Etica<br />
ESF-Programm „Sovvenzione Globale<br />
– Piccoli Sussidi“ <strong>und</strong> dessen<br />
Umsetzung <strong>in</strong> der Region Piemont<br />
In Italien wird das ESF-Förder<strong>in</strong>strument „Small<br />
Grants“ durch das Programm „Sovvenzione Globale – Piccoli Sussidi“ auf regionaler Ebene<br />
umgesetzt. In allen 21 regionalen Operationellen Programmen (POR – Programma<br />
Operativo Regionale) wurde für die ESF-Förderperiode 2000-2006 die Absicht erklärt,<br />
e<strong>in</strong>en „angemessenen Betrag“ von m<strong>in</strong>destens 0,5 % der ESF-Mittel für das neue Instrument<br />
„ger<strong>in</strong>ge Zuschussbeträge“ (Piccoli Sussidi) zur Verfügung zu stellen. Dieses Vorhaben<br />
ist bisher <strong>in</strong> 18 Regionen <strong>und</strong> Autonomen Prov<strong>in</strong>zen realisiert worden, wobei die Förderzeiträume<br />
sich regional unterscheiden.<br />
Zur Umsetzung des Programms <strong>in</strong> den Regionen stehen <strong>in</strong>sgesamt 82.631.346,82 € zur<br />
Verfügung. 80-90 % der Gesamtsumme werden für die „ger<strong>in</strong>gen Zuschussbeträge“ e<strong>in</strong>gesetzt,<br />
der Rest für die Kosten der zwischengeschalteten Stellen, die für die Programmumsetzung<br />
<strong>in</strong> den Regionen zuständig s<strong>in</strong>d. Zusätzlich zu diesem Mittelvolumen können noch<br />
weitere Mittel durch die Organisationen selbst oder durch Sponsoren h<strong>in</strong>zukommen.<br />
Die zwischengeschalteten Stellen (OI – Organismi Intermediari) setzen sich aus lokalen<br />
Körperschaften, regionalen Entwicklungsagenturen oder NGOs zusammen. Aufgabe der<br />
zwischengeschalteten Stellen ist die Akquise <strong>und</strong> die Begleitung von Mikroprojektträgern.<br />
Die Förderentscheidung fällt der jeweilige Verwaltungsausschuss/ Aufsichtsrat, bestehend<br />
aus Vertreter/-<strong>in</strong>nen der an der zwischengeschalteten Stelle beteiligten Organisationen.<br />
E<strong>in</strong>e Vorauswahl der Mikroprojekte erfolgt durch unabhängige Fachleute aus den Bereichen<br />
ESF / Start-up.<br />
Unterstützt werden die zwischengeschalteten Stellen durch TECNOSTRUTTURA,<br />
dem Dachverband aller italienischen Regionen <strong>und</strong> autonomen Prov<strong>in</strong>zen <strong>in</strong> Bezug auf den<br />
ESF. TECNOSTRUTTURA ist auch für e<strong>in</strong> <strong>in</strong>terregionales Projekt - „Netzwerk zur <strong>sozialen</strong><br />
E<strong>in</strong>gliederung“ (Fare rete per l’<strong>in</strong>clusione sociale) - verantwortlich, an dem sich seit<br />
dem Jahr 2003 <strong>in</strong>sgesamt 12 italienische Regionen <strong>und</strong> Autonome Prov<strong>in</strong>zen beteiligen.<br />
Dieses Projekt hat das Ziel, Erfahrungen mit dem Instrument „Sovvenzione Globale –<br />
Piccoli Sussidi“ im H<strong>in</strong>blick auf die E<strong>in</strong>gliederung von benachteiligten Personen auszutauschen<br />
<strong>und</strong> zu analysieren.<br />
Die Fördersumme der e<strong>in</strong>zelnen Mikroprojekte beträgt <strong>in</strong> der Regel zwischen 2.000 <strong>und</strong><br />
50.000 € (<strong>in</strong> manchen Regionen s<strong>in</strong>d auch höhere Beträge möglich). In e<strong>in</strong>zelnen Regionen<br />
<strong>und</strong> Autonomen Prov<strong>in</strong>zen ist auch e<strong>in</strong>e Kof<strong>in</strong>anzierung vorgeschrieben.<br />
Die Mikroprojekte werden mit dem Ziel umgesetzt, die soziale Ökonomie zu fördern,<br />
die benachteiligten Personen beruflich e<strong>in</strong>zugliedern sowie die Qualität der Unternehmen<br />
des dritten Sektors zu steigern.<br />
M. Ambros<strong>in</strong>i L. Ambrosio<br />
81
Folgende Aktionen können gefördert werden:<br />
• Entwicklung von <strong>in</strong>tegrierten Dienstleistungen.<br />
• Unterstützung zur Unternehmensgründung <strong>und</strong> zur selbständigen Tätigkeit von<br />
benachteiligten Personen. Berufliche E<strong>in</strong>gliederung von Personen <strong>in</strong> soziale Betriebe<br />
durch Gewährung e<strong>in</strong>es Zuschusses, mit Hilfe dessen die Person Mitglied<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er <strong>sozialen</strong> Genossenschaft oder <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er anderen Unternehmensform<br />
werden soll.<br />
• Begleitende Maßnahmen.<br />
• Beteiligung am Risikokapital von Organisationen des dritten Sektors.<br />
Die Adressat/-<strong>in</strong>nen der Förderung s<strong>in</strong>d NGO’s, soziale Genossenschaften, Konsortien<br />
<strong>und</strong> Organisationen des dritten Sektors.<br />
Durch die Mikroprojekte sollen folgende Zielgruppen erreicht werden: suchtmittelabhängige<br />
Personen, Strafentlassene/-gefangene, Langzeitarbeitslose, Migrant/-<strong>in</strong>nen, Menschen<br />
mit Beh<strong>in</strong>derung, Ethnische M<strong>in</strong>derheiten, benachteiligte <strong>Jugendliche</strong>, Nomad/<strong>in</strong>nen,<br />
Wohnungslose, HIV-positive Personen, Ex-Prostituierte bzw. Flüchtl<strong>in</strong>ge.<br />
Interregionales Projekt „Netzwerk zur <strong>sozialen</strong> E<strong>in</strong>gliederung“<br />
Im Rahmen des o. g. <strong>in</strong>terregionalen Projekts wurde die Studie „Soziale Ausgrenzung bekämpfen:<br />
die Ergebnisse des Globalzuschusses 17 “ durchgeführt. Sie ist federführend von<br />
den Autonomen Prov<strong>in</strong>zen Bozen <strong>und</strong> Trient <strong>in</strong> Auftrag gegeben worden. Ziel der Studie<br />
war es zu untersuchen, ob <strong>und</strong> welche Auswirkungen die Vergabe von ger<strong>in</strong>gen Zuschussbeträgen<br />
über zwischengeschaltete Stellen auf die berufliche <strong>und</strong> soziale E<strong>in</strong>gliederung von<br />
am Arbeitsmarkt besonders benachteiligten Personen hat.<br />
Gegenstand der Untersuchung waren dabei <strong>in</strong>sbesondere die Umsetzung der Strategie<br />
„Integration durch Arbeit“, die Bedeutung des dritten Sektors für die soziale <strong>und</strong> berufliche<br />
E<strong>in</strong>gliederung von benachteiligten Personen, die Def<strong>in</strong>ition der Zielgruppen (<strong>in</strong>sbesondere<br />
E<strong>in</strong>beziehung der „neuen Armut“), die Erreichung <strong>und</strong> Aktivierung der Zielgruppen, die<br />
Bewertung der Planungs- <strong>und</strong> Umsetzungsprozesse, die Rolle der zwischengeschalteten<br />
Stelle sowie die Auswirkung der Projekte <strong>und</strong> Maßnahmen für die lokale Entwicklung. Untersucht<br />
wurde die jeweilige Programmumsetzung <strong>in</strong> den Regionen.<br />
E<strong>in</strong> Schwerpunkt der Studie lag auf der Bewertung der Rolle der zwischengeschalteten<br />
Stelle <strong>und</strong> des damit zum Ausdruck kommenden Governance-Modells im Vergleich zur<br />
herkömmlichen Goverment-Praxis bei Maßnahmen gegen soziale Ausgrenzung. Dazu<br />
wurden folgende <strong>in</strong>novative Elemente <strong>in</strong> der Governance-Umsetzung durch die zwischengeschaltete<br />
Stelle identifiziert:<br />
Auftrag <strong>und</strong> Zusammensetzung der zwischengeschalteten Stelle<br />
• Die Bildung <strong>und</strong> Zusammensetzung der zwischengeschalteten Stelle selbst<br />
schafft Innovation.<br />
• Die Umsetzung durch die zwischengeschalteten Stellen erweist sich <strong>in</strong>sbesondere<br />
dann als effektiv, wenn e<strong>in</strong>e direkte Verwaltung durch öffentliche Institutionen<br />
sich als zu aufwendig erweisen würde.<br />
• Die „Non Profit“-Zusammensetzung der zwischengeschalteten Stelle schafft<br />
Vertrauen gegenüber den Adressat/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Zielgruppen.<br />
17 Herausgegeben von M. Ambros<strong>in</strong>i <strong>und</strong> P. Boccagni<br />
82
Interne Organisationsstruktur der zwischengeschalteten Stelle<br />
• Neue Akteure werden <strong>in</strong> die Strategien der <strong>sozialen</strong> E<strong>in</strong>gliederung e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en.<br />
• Relativ e<strong>in</strong>fache <strong>und</strong> flexible Struktur der zwischengeschalteten Stelle im Vergleich<br />
zu öffentlichen Institutionen / Ämtern<br />
• dezentraler Ansatz, variable Zusammensetzung der zwischengeschalteten Stelle,<br />
je nach den Fähigkeiten der lokalen Akteure (zur Vertretung, zur Bildung von<br />
Netzwerken, zur Belebung des Gebietes, zur Identifizierung von Bedürfnisse,<br />
etc.)<br />
Beziehung zwischen lokalen öffentlichen E<strong>in</strong>richtungen / Ämtern <strong>und</strong> drittem Sektor<br />
• Gute <strong>und</strong> kont<strong>in</strong>uierliche Zusammenarbeit der Organisationen des dritten Sektors<br />
mit öffentlichen E<strong>in</strong>richtungen<br />
• Umfassende Verantwortungsübernahme durch die zwischengeschaltete Stelle<br />
(horizontale Subsidiarität)<br />
• Systematische E<strong>in</strong>beziehung von zielgruppenspezifischen Dienstleistungen<br />
• Förderung e<strong>in</strong>es partizipativen Modells bei Planung <strong>und</strong> Durchführung von<br />
Maßnahmen<br />
Neues Modell der Intervention<br />
• Zwischengeschaltete Stelle als Vermittler, Fazilitator <strong>und</strong> Motivator<br />
• Es wird e<strong>in</strong> Anreiz geschaffen zum E<strong>in</strong>tritt von Personen aus der Zielgruppe <strong>in</strong><br />
die Genossenschaften bzw. Organisationen des dritten Sektors (Resultate liegen<br />
allerd<strong>in</strong>gs h<strong>in</strong>ter den Erwartungen zurück)<br />
• Begleitung <strong>und</strong> Unterstützung der Genossenschaften <strong>und</strong> Organisationen durch<br />
e<strong>in</strong>en Mitarbeiter der zwischengeschalteten Stelle<br />
Charakteristika der durchgeführten Projekte<br />
• Durchführung von mittelfristigen Projekten (mit Ziel: Personalentwicklung)<br />
• Vision des “Sozialen” als Antrieb für die lokale Entwicklung <strong>und</strong> nicht nur als<br />
Kostenfaktor<br />
• Geme<strong>in</strong>same Entwicklung von Projekten mit Hilfe der technischen Unterstützung<br />
der zwischengeschalteten Stellen<br />
• Förderung von passgenauen Projekten, die den Kompetenzen <strong>und</strong> Qualitäten<br />
der benachteiligten Person Rechnung tragen <strong>und</strong> nicht umgekehrt die Anpassung<br />
der Person an bereits vorhandene Organisations- <strong>und</strong> Arbeitstrukturen erfordern<br />
Abschließend können die positiven Aspekte <strong>und</strong> die möglichen Kritikpunkte, die sich<br />
aus der Studie ergeben haben, mit Hilfe der Swot-Analyse zusammengefasst werden. Die<br />
Swot-Analyse (siehe Tabelle) be<strong>in</strong>haltet e<strong>in</strong>e Beurteilung über Effizienz, Vertretbarkeit <strong>und</strong><br />
Übertragbarkeit des Instrumentes des Globalzuschusses.<br />
83
84<br />
S (Stärken – Strenghts)<br />
• Effektives Vorgehen der zwischengeschalteten<br />
Stellen bei Auswahl <strong>und</strong> Begleitung der<br />
Adressat/<strong>in</strong>nen<br />
• Die Organisationsstrukturen <strong>und</strong> Projektkompetenzen<br />
der Adressat(<strong>in</strong>)en werden gestärkt.<br />
• Erproben neuer Instrumente der E<strong>in</strong>gliederung<br />
(Voucher, Förderung des E<strong>in</strong>tritts <strong>in</strong><br />
soziale Genossenschaften etc.)<br />
• Die Zielgruppen <strong>und</strong> Adressat(<strong>in</strong>)en werden<br />
weiter gefasst <strong>und</strong> diversifiziert.<br />
• Flexibilität der angewandten Maßnahmen,<br />
Möglichkeit, während der Durchführung jederzeit<br />
korrigierend e<strong>in</strong>zugreifen<br />
• Sensibilisierung <strong>und</strong> Aktivierung auf lokaler<br />
Ebene<br />
T (Risiken –Threats)<br />
• Inwieweit die neuen Arbeitsplätzen (oder<br />
von neuen Unternehmen, oder von neuen<br />
Geschäftsfeldern) auch mittelfristig erhalten<br />
bleiben, bleibt noch zu evaluieren.<br />
• Risiken im H<strong>in</strong>blick auf die Zusammensetzung<br />
der zwischengeschalteten Stellen, mögliche<br />
Verfolgung von E<strong>in</strong>zel<strong>in</strong>teressen!<br />
• Der Übergang der Zielgruppe vom Nutznießer<br />
zum aktiven „Koprotagonisten“, der<br />
aktiv <strong>in</strong> die <strong>sozialen</strong> Genossenschaften /<br />
Kle<strong>in</strong>stunternehmen e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d, wird<br />
immer noch durch Widerstände organisatorischer<br />
<strong>und</strong> kognitiver Art erschwert.<br />
W (Schwächen –Weaknesses)<br />
• Integration (oder zum<strong>in</strong>dest Harmonisierung)<br />
der Programmaßnahmen <strong>in</strong> die lokalen<br />
sozial- <strong>und</strong> arbeitspolitischen Maßnahmen<br />
wäre erforderlich.<br />
• Mögliche Überschneidung mit anderen sozial-<br />
<strong>und</strong> arbeitspolitischen Maßnahmen<br />
• Mangel an anderen F<strong>in</strong>anzierungsmöglichkeiten<br />
als dem ESF<br />
• Aktivitäten zur Unterstützung der Entwicklung<br />
von Organisationen sche<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>en größeren<br />
Erfolg zu haben als die zur Schaffung<br />
von Kle<strong>in</strong>stunternehmen <strong>und</strong> neuen Arbeitsplätzen<br />
O (Vorteile – Opportunities)<br />
• Gute Übertragbarkeit des Organisationsmodells<br />
der zwischengeschalteten Stellen, auf<br />
lokale Beteiligungsprozesse zu besseren Abstimmung<br />
von Angebot <strong>und</strong> Nachfrage von<br />
Dienstleistungen zur <strong>sozialen</strong> <strong>und</strong> beruflichen<br />
E<strong>in</strong>gliederung<br />
• Bewährtes Modell der zwischengeschalteten<br />
Stellen als „lokale Antennen“, die die Bedarfe<br />
vor Ort erkennen, aufgreifen <strong>und</strong> <strong>in</strong>novative<br />
Projekte der Zivilgesellschaft fördern<br />
• Neben der beruflichen E<strong>in</strong>gliederung lernen<br />
die Adressat/<strong>in</strong>nen mit neuen Methoden<br />
<strong>und</strong> Instrumenten umzugehen, die sie für zukünftige<br />
Aktivitäten zur <strong>sozialen</strong> <strong>und</strong> beruflichen<br />
E<strong>in</strong>gliederung e<strong>in</strong>setzen können.<br />
Die gesamte Studie ist erhältlich bei TECNOSTRUTTURA, Via Volturno 58, 00185<br />
Roma, Italia, Tel. 0039-(0)6-49270501, Fax 0039-(0)6-492705108,<br />
E-Mail: stampasegreteria@tecnostruttura.it<br />
Umsetzung <strong>in</strong> der Region Piemont<br />
Die Region Piemont verfolgt mit den „ger<strong>in</strong>gen Zuschussbeträgen“ das Ziel der <strong>sozialen</strong><br />
<strong>und</strong> beruflichen E<strong>in</strong>gliederung von benachteiligten Menschen.<br />
Die zwischengeschaltete Stelle Union.Etica ist e<strong>in</strong> temporärer Zusammenschluss der<br />
zwei Organisationen Banca Popolare Etica (Volksbank) <strong>und</strong> Unionfidi S.C. Unionfidi S.C.<br />
ist e<strong>in</strong>e Genossenschaft, die geme<strong>in</strong>nützig tätig ist <strong>und</strong> kle<strong>in</strong>e <strong>und</strong> mittlere Unternehmen<br />
durch Leistungsbürgschaften <strong>und</strong> durch Beratung im Management- <strong>und</strong> F<strong>in</strong>anzbereich<br />
unterstützt. Die Aufgabe der zwischengeschalteten Stelle ist es, das Programm bekannt zu<br />
machen, das Antragsverfahren durchzuführen, (potenzielle) Projektträger zu beraten (Antragsberatungen,<br />
f<strong>in</strong>anztechnische Beratungen), <strong>und</strong> bei der Umsetzung zu begleiten sowie<br />
e<strong>in</strong> Monitor<strong>in</strong>g <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Evaluation der Projekte vorzunehmen. Die letztendliche Förder-
entscheidung über die Auswahl der Projekte wird vom Verwaltungsrat getroffen, der von<br />
Fachleuten aus dem Bereich ESF <strong>und</strong> Start-up unterstützt wird.<br />
Für den Förderzeitraum 2003-2006 standen <strong>in</strong>sgesamt 4.480.000 € zur Verfügung. Es<br />
konnten damit <strong>in</strong>sgesamt 407 soziale Betriebe (z. B. Konsortien, soziale Genossenschaften,<br />
Vere<strong>in</strong>e) <strong>und</strong> 425 E<strong>in</strong>zelpersonen gefördert werden.<br />
Die folgenden vier Aktionen werden durchgeführt:<br />
• Aktion 1: Unterstützung der Gründung <strong>und</strong> Sicherung von <strong>sozialen</strong> Konsortien<br />
zur Stärkung der <strong>sozialen</strong> Zusammenarbeit. 23,4 % der Mittel flossen <strong>in</strong> die Aktion<br />
1. Es musste e<strong>in</strong>e Kof<strong>in</strong>anzierung von 20 % durch die Antragsteller/-<strong>in</strong>nen<br />
geleistet werden. Die Projektvolumen reichten von 15.000 € bis 51.646 €. Der<br />
Durchschnittsbetrag lag bei 43.960 €.<br />
• Aktion 2: Unterstützung bei der Verbesserung der Dienstleistungen von Organisationen<br />
des dritten Sektors. 6,1 % der Mittel flossen <strong>in</strong> die Aktion 2. Es<br />
musste e<strong>in</strong>e Kof<strong>in</strong>anzierung von 20 % durch die Antragsteller/-<strong>in</strong>nen geleistet<br />
werden. Die Projektvolumen reichten von 5.165 € bis 15.494 €. Der Durchschnittsbetrag<br />
lag bei 13.744 €.<br />
• Aktion 3: Unterstützung der Beteiligung von benachteiligten Mitgliedern der<br />
<strong>sozialen</strong> Genossenschaften an der Kapitalisierung der Genossenschaft. 5,7 %<br />
der Mittel flossen <strong>in</strong> die Aktion 3. Es musste e<strong>in</strong>e Kof<strong>in</strong>anzierung von 50 %<br />
durch die Antragsteller/-<strong>in</strong>nen geleistet werden. Die Projektvolumen reichten<br />
von 250 € bis 1.549 €.<br />
• Aktion 4: Unterstützung <strong>und</strong> Kapitalisierung von <strong>sozialen</strong> Genossenschaften.<br />
64,8 % der Mittel flossen <strong>in</strong> die Aktion 4. Nur die Projekte dieser Aktion wurden<br />
zu 100 % gefördert. Die Projektvolumen reichten von 15.494 € bis 51.646<br />
€. Der Durchschnittsbetrag lag bei 38.500 €.<br />
Projekte werden <strong>in</strong> folgenden Bereichen umgesetzt:<br />
• E<strong>in</strong>gliederung von benachteiligten Personen<br />
• E<strong>in</strong>führung neuer Organisationsstrukturen<br />
• Verbesserung des Arbeitsumfeldes: Anschaffung von Geräten, E<strong>in</strong>richtungsgegenständen<br />
<strong>und</strong> Software<br />
• Weiterbildung der Zielgruppe: Beratung, Aneignung von Fachwissen, Market<strong>in</strong>g,<br />
Verwaltung, Kompetenzen im Kommunikationsbereich<br />
• Aneignung von betriebswirtschaftlicher Praxis<br />
• Entwicklung lokaler Netzwerkstrukturen<br />
85
Projektbeispiel: Consorzio Abele Lavoro<br />
Das Konsortium Abele Lavoro wurde 1998 gegründet, um die Ressourcen von acht <strong>sozialen</strong><br />
Genossenschaften zu bündeln, welche dem Verband Gruppo Abele angehören. Insbesondere<br />
sollte durch das Konsortium die Arbeitsvermittlung von benachteiligten Personen<br />
<strong>in</strong> die <strong>sozialen</strong> Genossenschaften, die dem Konsortium angegliedert s<strong>in</strong>d, unterstützt <strong>und</strong><br />
verwaltet werden.<br />
So wurde 2003 im Rahmen des Programms e<strong>in</strong> Projekt von Adele Lavoro <strong>in</strong> Höhe von<br />
51.643 € gefördert, das zum Ziel hatte, e<strong>in</strong>e zentralen Dienstleistung zur Vorauswahl des<br />
Personals, welches <strong>in</strong> die Genossenschaften e<strong>in</strong>gegliedert werden soll, zu entwickeln <strong>und</strong><br />
e<strong>in</strong> zentrales Verwaltungsbüro mit Dienstleistungen im Bereich Verwaltung, F<strong>in</strong>anzen <strong>und</strong><br />
Steuern e<strong>in</strong>zurichten.<br />
Mit der Förderung von neuen Dienstleistungen <strong>und</strong> Optimierung von bereits bestehenden<br />
Dienstleistungen, die den Genossenschaften durch das Netzwerk Sozialer Betriebe zur<br />
Verfügung gestellt werden sollten, sollte die Fähigkeit der Genossenschaften zur Bekämpfung<br />
der <strong>sozialen</strong> Ausgrenzung erhöht werden. Durch dieses Projekt konnte e<strong>in</strong> neuer Arbeitsplatz<br />
geschaffen werden.<br />
Zwei weitere Projekte von Adele Lavoro wurden <strong>in</strong> 2006 (36.553 €) <strong>und</strong> <strong>in</strong> 2007 (13.919<br />
€) <strong>in</strong> die Förderung aufgenommen. Diese Projekte hatten sich die E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>es Market<strong>in</strong>g-<br />
<strong>und</strong> Kommunikationsbüros zum Ziel gesetzt. Im Rahmen der Projekte konnten<br />
Kompetenzen im Bereich Kommunikation, Stellenvermittlung, Coach<strong>in</strong>g <strong>und</strong> Verfassen<br />
von Sozialberichten vermittelt werden. Es wurden e<strong>in</strong>e Website (www.gruppoabele.org),<br />
erstellt, die Ausstattung von Geschäftsräumen verbessert, e<strong>in</strong>e Personalschulung <strong>und</strong> Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gs<br />
durchgeführt, Hard- <strong>und</strong> Software angeschafft sowie Videos produziert.<br />
Letztendlich konnte Gruppo Abele dank dieser Maßnahmen die regionale Genehmigung<br />
als Bildungszentrum erlangen.<br />
86
Präsentation Großbritannien<br />
David Moynihan, Greater London Enterprise (GLE)<br />
Das Londoner ESF-Programm „Fast Forward<br />
Grants“<br />
Das ESF-Förder<strong>in</strong>strument „Small Grants/ Global Grants“<br />
wird <strong>in</strong> England seit dem Jahr 2001 <strong>in</strong> verschiedenen Regionen<br />
umgesetzt. Mit kle<strong>in</strong>en Zuschussbeträgen werden Nichtregierungsorganisationen<br />
(NGO) unterstützt, die bisher nicht<br />
von e<strong>in</strong>er ESF-Förderung profitieren konnten. Es geht<br />
schwerpunktmäßig darum, kle<strong>in</strong>e Organisationen <strong>und</strong> lokale<br />
Initiativen zu unterstützen, die über e<strong>in</strong>en guten Zugang zu<br />
benachteiligten Bevölkerungsgruppen verfügen. Ziel ist es, benachteiligte Menschen an den<br />
Arbeitsmarkt heranzuführen. Spezielle Zielgruppe s<strong>in</strong>d ethnische M<strong>in</strong>derheiten, Alle<strong>in</strong>erziehende,<br />
Menschen über 50 Jahre <strong>und</strong> andere Gruppen <strong>in</strong> denen e<strong>in</strong>e hohe Arbeitslosigkeit<br />
vorherrscht. Gefördert werden <strong>in</strong>sbesondere Projekte, mit denen die Schlüsselqualifikationen<br />
der Menschen erhöht werden. Dazu gehört Motivationssteigerung, Erhöhung des<br />
Selbstwertgefühls, Förderung der <strong>sozialen</strong> Kompetenzen. Des Weiteren werden Sprachkenntnisse<br />
<strong>und</strong> berufliche Fähigkeiten verbessert <strong>und</strong> lokale Netzwerke <strong>und</strong> Existenzgründungen<br />
unterstützt.<br />
Die Umsetzung von „Small Grants/Global Grants“ ist <strong>in</strong> nationale Strategien e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en.<br />
Zu nennen s<strong>in</strong>d hier der „National Action Plan for Employment“, „National Action<br />
Plan for Social Inclusion“ <strong>und</strong> die „National Strategy for Neighbourhood Renewal“.<br />
Auf nationaler Ebene (Teilstaat England) ist das Arbeitsm<strong>in</strong>isterium (Department for<br />
Work and Pensions) für die Umsetzung des ESF-Förder<strong>in</strong>struments verantwortlich. Dieses<br />
hat für Monitor<strong>in</strong>g <strong>und</strong> Evaluation von „Small Grants/Global Grants“ das „Programme<br />
Monitor<strong>in</strong>g Committee (PMC)“ e<strong>in</strong>gerichtet.<br />
Für den Teilstaat England gibt es e<strong>in</strong> eigenes operationelles Programm, <strong>in</strong> dem auch das<br />
Förder<strong>in</strong>strument der „Small Grants/Global Grants“ verankert ist. Die Umsetzung erfolgt<br />
<strong>in</strong> allen neun Regionen durch zwischengeschaltete Stellen (Intermediary Bodies). Sie werden<br />
von den jeweiligen regionalen Government Offices (Regionalverwaltung) berufen. Je<br />
nach Region gibt es e<strong>in</strong>e oder mehrere (bis zu 10) zwischengeschaltete Stellen, <strong>in</strong>sgesamt<br />
s<strong>in</strong>d es 37. Über die Hälfte s<strong>in</strong>d freiwillige Organisationen <strong>und</strong> Stiftungen. Des Weiteren<br />
nehmen auch öffentliche E<strong>in</strong>richtungen (Gebietskörperschaften oder „Learn<strong>in</strong>g and Skills<br />
Councils) sowie private Organisationen, wie etwa Wirtschaftsförderungsgesellschaften diese<br />
Funktion wahr.<br />
Die zwischengeschalteten Stellen s<strong>in</strong>d verantwortlich für die Akquise <strong>und</strong> Beratung der<br />
Projektträger, für die Durchführung des Antragsverfahrens, für die Vorbereitung der Auswahl<br />
der zu fördernden Projekte sowie die f<strong>in</strong>anzielle Abwicklung. Das be<strong>in</strong>haltet auch die<br />
Beschaffung der Kof<strong>in</strong>anzierungsmittel. Während die Projekte selbst e<strong>in</strong>e h<strong>und</strong>ertprozentige<br />
Förderung von maximal 10 000 Pf<strong>und</strong> (ca. 14.900 Euro) erhalten, müssen auf der Ebene<br />
der zwischengeschalteten Stellen Kof<strong>in</strong>anzierungsmittel <strong>in</strong> Höhe von 55 % erbracht werden.<br />
87
In allen Regionen wurden m<strong>in</strong>destens 1 % des ESF-Budgets für die Umsetzung von<br />
„Global Grants/Small Grants“ ausgegeben. In vier Regionen lag der Anteil sogar zwischen<br />
2 <strong>und</strong> 3 %. Bis e<strong>in</strong>schließlich Februar 2007 wurden <strong>in</strong> den neun Regionen 29,4 Mio. Pf<strong>und</strong><br />
(ca. 43,6 Mio. Euro) umgesetzt.<br />
Umsetzung <strong>in</strong> London<br />
In London ist das Problem der Arbeitslosigkeit größer als im Rest von Großbritannien.<br />
Insbesondere Menschen aus ethnischen M<strong>in</strong>derheiten <strong>und</strong> Schwarze s<strong>in</strong>d am Arbeitsmarkt<br />
benachteiligt. Auch Beh<strong>in</strong>derte <strong>und</strong> Eltern, hier verstärkt Alle<strong>in</strong>erziehende, haben <strong>in</strong>sbesondere<br />
<strong>in</strong> London unter Arbeitslosigkeit zu leiden. Das Londoner Global Grants Programm,<br />
genannt „Fast Forward Grants“ setzt hier an <strong>und</strong> ermöglicht die Durchführung<br />
von Kle<strong>in</strong>stprojekten für diese Menschen mit dem Ziel, sie an den Arbeitsmarkt heranzuführen.<br />
Begonnen hat das Programm <strong>in</strong> London im Jahr 2001. Seitdem wurden etwa 1.000<br />
Projekte mit e<strong>in</strong>em Gesamtvolumen von 10,14 Mio. Pf<strong>und</strong> (ca. 15,04 Mio. Euro) gefördert.<br />
„Fast Forward Grants“ läuft noch bis März 2008 <strong>und</strong> soll auch <strong>in</strong> der neuen ESF-<br />
Förderperiode fortgeführt werden.<br />
Für die Region London übernimmt die Greater London Enterprises (GLE) die Funktion<br />
der zwischengeschalteten Stelle. Die GLE ist e<strong>in</strong>e unabhängige Non-Profit Organisation,<br />
die Dienstleistungen im Bereich wirtschaftliche Entwicklung <strong>und</strong> Beratung anbietet<br />
<strong>und</strong> vor 25 Jahren gegründet wurde. Sie ist verantwortlich für die adm<strong>in</strong>istrative <strong>und</strong> f<strong>in</strong>anzielle<br />
Abwicklung des Programms <strong>in</strong> der Region. Das be<strong>in</strong>haltet zum e<strong>in</strong>en den gesamten<br />
Bereich des Antragsverfahrens: Der Kontakt zu den Zielgruppen muss hergestellt werden,<br />
e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>faches Bewerbungsverfahren entwickelt <strong>und</strong> die potentiellen Projektträger bei der<br />
Bewerbung um die Mittel beraten <strong>und</strong> unterstützt werden. Die Sichtung <strong>und</strong> Bewertung<br />
der Anträge sowie die Erstellung e<strong>in</strong>er Vorschlagsliste für das Entscheidungsgremium, die<br />
„Partnership Group“ (s.u.) gehören ebenso zu ihren Aufgaben wie das Monitor<strong>in</strong>g <strong>und</strong> die<br />
Evaluation. Zum anderen ist die GLE für die Akquise der notwendigen Kof<strong>in</strong>anzierungsmittel<br />
verantwortlich.<br />
Die Förderung von bis zu 10.000 Pf<strong>und</strong> (15.000 €) richtet sich an Nichtregierungsorganisationen<br />
(NGO’s), die e<strong>in</strong>en guten Zugang zu den benannten Zielgruppen haben. Diese<br />
Organisationen müssen bestimmte Kriterien erfüllen: Sie dürfen nicht mehr als zwei Vollzeit-Angestellte<br />
haben bzw. darf das geme<strong>in</strong>same E<strong>in</strong>kommen der Angestellten im Jahr vor<br />
der Antragstellung 60.000 Pf<strong>und</strong> nicht überschreiten, sie müssen über e<strong>in</strong> eigenes Bankkonto<br />
verfügen <strong>und</strong> müssen als NGO konstituiert se<strong>in</strong>.<br />
Über e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>faches Verfahren können sich die Organisationen um e<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzierung ihrer<br />
Projekte bewerben. Bei e<strong>in</strong>er Zustimmung erhalten sie e<strong>in</strong>e h<strong>und</strong>ertprozentige F<strong>in</strong>anzierung<br />
der Projektkosten als Vorauszahlung. Bei der Projektkonzeption <strong>und</strong> Bewerbung<br />
werden die NGO’s durch die zwischengeschaltete Stelle unterstützt. Hierzu werden<br />
Workshops <strong>und</strong> E<strong>in</strong>zelberatungen mit den (potentiellen) Antragssteller/-<strong>in</strong>nen durchgeführt.<br />
Auch während der Umsetzung werden die Projekte durch regelmäßige Besuche der<br />
GLE Mitarbeiter/-<strong>in</strong>nen begleitet. Diese Besuche dienen auch dem Monitor<strong>in</strong>g <strong>und</strong> der<br />
Evaluation. Hierfür müssen die Projekte nach Abschluss e<strong>in</strong>en Bericht vorlegen.<br />
88
Förderfähig s<strong>in</strong>d alle Projekte mit dem Ziel, Menschen aus den benannten benachteiligten<br />
Bevölkerungsgruppen an den Arbeitsmarkt heranzuführen. Hierzu werden folgende<br />
Aktionen gefördert:<br />
• Verbesserung der <strong>sozialen</strong> <strong>und</strong> beruflichen Kompetenzen<br />
• Stärkung des Selbstbewusstse<strong>in</strong>s<br />
• Erhöhung der Motivation<br />
• Bewerbungstra<strong>in</strong><strong>in</strong>g, Berufliche Beratung <strong>und</strong> Begleitung<br />
Projekte werden <strong>in</strong> folgenden Bereichen umgesetzt:<br />
• Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnologie<br />
• Vermittlung von Basisqualifikationen (Rechnen, Schreiben, Lesen)<br />
• Kunst <strong>und</strong> Handwerk<br />
• Cater<strong>in</strong>g<br />
• Multimedia<br />
• Ges<strong>und</strong>heitsfürsorge<br />
• Berufsvorbereitung<br />
Gefördert werden die laufenden Kosten, die dem Projekt direkt zuzuordnen s<strong>in</strong>d, sowie<br />
Anschaffungen, die den Wert von 1.000 Pf<strong>und</strong> (ca. 1.480 Euro) nicht überschreiten. Der<br />
Zuschuss muss die gesamten Kosten des Projektes abdecken.<br />
Die Projekte sollen das Querschnittsthema der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigen<br />
<strong>und</strong> Aktivitäten im <strong>sozialen</strong>, ökonomischen <strong>und</strong> ökologischen Bereich be<strong>in</strong>halten, die<br />
zu e<strong>in</strong>er nachhaltigen Entwicklung beitragen.<br />
Für die Auswahl der zu fördernden Projekte ist die so genannte „Partnership Group“<br />
zuständig. Sie setzt sich zusammen aus Vertreter/-<strong>in</strong>nen der ehemaligen <strong>und</strong> aktuellen Kof<strong>in</strong>anziers,<br />
z. B. der London Development Agency (Londoner Entwicklungsgesellschaft),<br />
der London Boroughs (Londoner Bezirke) <strong>und</strong> den Learn<strong>in</strong>g and Skills Councils (Nationale<br />
E<strong>in</strong>richtung für Bildung <strong>und</strong> Ausbildung von Menschen über 16 Jahren), der Organisationen,<br />
die mit den Zielgruppen arbeiten, früherer Zuschussempfänger (Projektträger) <strong>und</strong><br />
der Government Office von London (Regionalverwaltung).<br />
In den 1.000 Projekten, die <strong>in</strong> den Jahren 2002-2006 durchgeführt wurden, konnten beachtliche<br />
Erfolge erzielt werden: 2.100 Menschen nahmen e<strong>in</strong>e Beschäftigung auf, 2.214<br />
wurden <strong>in</strong> Bildungs- <strong>und</strong> Weiterbildungsmaßnahmen vermittelt <strong>und</strong> 1.056 Teilnehmer/<strong>in</strong>nen<br />
engagieren sich <strong>in</strong> der Folge im Bereich der Freiwilligenarbeit.<br />
Projektbeispiel<br />
Mugeni Association, Isl<strong>in</strong>gton<br />
Ziel des Projektes war es, jungen Schwarzen, Asiaten <strong>und</strong> Menschen aus ethnischen<br />
M<strong>in</strong>derheiten den E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong> Beschäftigung zu ermöglichen. In e<strong>in</strong>em 20-wöchigen Kurs<br />
wurden ihnen praktische Fähigkeiten im Umgang mit Computern beigebracht. Als Vorbereitung<br />
der A+ Qualifikation lernten fünf Männer <strong>und</strong> fünf Frauen die wesentlichen Fähigkeiten,<br />
die notwendig s<strong>in</strong>d, um als Systemadm<strong>in</strong>istrator zu arbeiten.<br />
Das Ergebnis des Projektes ist, dass drei der Teilnehmer/-<strong>in</strong>nen sich um e<strong>in</strong>e Arbeitsstelle<br />
bemühen, drei weitere dem Vere<strong>in</strong> Mugeni beigetreten s<strong>in</strong>d, um als ehrenamtliche<br />
89
Techniker ihre Fähigkeiten auszubauen. Andere Teilnehmer/-<strong>in</strong>nen begaben sich auf die<br />
Suche nach Weiterbildungsmöglichkeiten.<br />
Berichterstattung AG 5: Lokale Strategien zur Aktivierung beschäftigungswirksamer<br />
<strong>und</strong> sozialer Potentiale im Rahmen des ESF-<br />
Instruments der ger<strong>in</strong>gen Zuschussbeträge (Small Grants)<br />
Christoph Schwamborn<br />
E<strong>in</strong>führung<br />
Thema war die Umsetzung des Instrumentes ger<strong>in</strong>ge Zuschussbeträge“ – Förderung von<br />
Kle<strong>in</strong>projekten“ des Europäischen Sozialfond (ESF). Dazu haben Vertreter/-<strong>in</strong>nen aus England,<br />
Italien <strong>und</strong> Deutschland die Umsetzung dieses Programms <strong>in</strong> ihren Ländern präsentiert.<br />
Geme<strong>in</strong>samkeiten<br />
Die erste wesentliche Geme<strong>in</strong>samkeit ist die Förderung von Kle<strong>in</strong>projekten, um besonders<br />
benachteiligte Zielgruppen sozial <strong>und</strong> beruflich zu <strong>in</strong>tegrieren Die Umsetzung erfolgt <strong>in</strong> allen<br />
drei Ländern regional bzw. lokal. Verantwortlich für die Umsetzung s<strong>in</strong>d jeweils Organisationen,<br />
die Zugang zu den Adressaten haben: (Migrant<strong>in</strong>nen/Migranten, Schulabbrecher, LZA,<br />
jugendliche Straffällige). Geme<strong>in</strong>sam ist allen Programmen auch, dass kle<strong>in</strong>ere, ESFunerfahrene<br />
Träger erreicht werden.<br />
Wesentliche Unterschiede<br />
In Deutschland <strong>und</strong> England besteht e<strong>in</strong> Schwerpunkt auf der Förderung von beruflichen<br />
Vorfeldmaßnahmen; hier geht es um Menschen, die momentan nicht <strong>in</strong> der Lage s<strong>in</strong>d, e<strong>in</strong>er<br />
Arbeit nachzugehen, weil ihnen die Schlüsselkompetenzen dazu fehlen. (Morgens aufstehen,<br />
ganztätig arbeiten, am nächsten Morgen wieder aufstehen <strong>und</strong> arbeiten).<br />
In Italien liegt der Fokus auf der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen durch die Förderung<br />
von Genossenschaften.<br />
E<strong>in</strong> weiterer Unterschied besteht <strong>in</strong> der Ausrichtung der Programme. Während <strong>in</strong><br />
Deutschland e<strong>in</strong> sozialräumlicher Ansatz verfolgt wird, implementieren Italien <strong>und</strong> England<br />
adressatenbezogene Förderung. Die Sozialraumorientierung erlaubt es, passgenaue Projekte<br />
für die Probleme im Stadtteil zu entwickeln. Die Zielgruppen stehen zu Beg<strong>in</strong>n also noch<br />
nicht fest. Der adressatenbezogene Ansatz ist besonders gut geeignet, um Projekte zu entwickeln,<br />
die ganz spezifische Zielgruppen erreichen.<br />
In ESF-Programmen besteht normalerweise die Notwendigkeit der Kof<strong>in</strong>anzierung; das<br />
Instrument „ger<strong>in</strong>ge Zuschussbeträge“ bildet e<strong>in</strong>e Ausnahme, hier ist e<strong>in</strong>e 100 % Förderung<br />
die Regel. In Deutschland wird bisher davon Gebrauch gemacht, <strong>in</strong> England h<strong>in</strong>gegen muss<br />
der 45-prozentige ESF-Anteil auf Programmebene durch 55 % nationale Mittel kof<strong>in</strong>anziert<br />
werden (die Mikroprojekte werden aber auch dort zu 100 % unterstützt).<br />
In Deutschland erfolgt die Umsetzung <strong>in</strong> Verantwortung der Kommunen auf lokaler Ebene,<br />
<strong>in</strong> Italien <strong>und</strong> England durch NGO auf regionaler Ebene.<br />
90
Handlungsempfehlungen<br />
1. Die Diskussion hat gezeigt, dass <strong>in</strong> allen drei Ländern das Instrument „ger<strong>in</strong>ge Zuschussbeträge“<br />
bisher sehr erfolgreich war <strong>und</strong> auf jeden Fall fortgesetzt werden sollte.<br />
2. Die 100 %-Förderung wird <strong>in</strong> der jetzt neu gestarteten ESF-Förderperiode zwar von<br />
der EU-Kommission weiterh<strong>in</strong> empfohlen, die Umsetzung mit e<strong>in</strong>er 100 %-<br />
Förderung auf nationaler Ebene kann aber noch nicht als gesichert gelten. Fest steht,<br />
dass e<strong>in</strong>e Kof<strong>in</strong>anzierungspflicht auf der Ebene der Kle<strong>in</strong>projekte nicht realisierbar<br />
ist, sondern auf anderer, höherer Ebene zu erbr<strong>in</strong>gen wäre. In England beispielsweise<br />
wird diese Leistung u. a. durch die Arbeitsagentur erbracht. E<strong>in</strong> Vorteil der Kof<strong>in</strong>anzierung<br />
ist die E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung von neuen Partnern. Der Nachteil besteht hier allerd<strong>in</strong>gs<br />
<strong>in</strong> der Abhängigkeit vom jeweiligen Geldgeber. Die Beibehaltung der 100 %-<br />
Förderung ist daher wünschenswert! Wenn es e<strong>in</strong>e Kof<strong>in</strong>anzierungspflicht geben<br />
sollte, dann darf diese aber nur auf der Programmebene erbracht werden.<br />
3. Sowohl sozialräumliche als auch adressatenbezogene Förderungen haben Erfolge gezeigt,<br />
sodass beide Ansätze empfohlen werden können; vor allem die Komb<strong>in</strong>ation<br />
beider Ansätze ist besonders Erfolg versprechend.<br />
4. Der Vorteil der Koord<strong>in</strong>ierung des Programms durch NGO liegt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em besseren<br />
Zugang zu den Zielgruppen; vorausgesetzt die NGO br<strong>in</strong>gt entsprechende Erfahrungen<br />
mit (z. B. gibt es <strong>in</strong> Italien, wo ja <strong>in</strong>sbesondere Genossenschaften gefördert<br />
werden, soziale Konsortien als koord<strong>in</strong>ierende Stelle, die schon über 30 Jahre Genossenschaften<br />
beraten haben). Der Vorteil der Koord<strong>in</strong>ierung durch Kommunen besteht<br />
<strong>in</strong> der Übernahme von Verantwortung <strong>und</strong> der besseren Abstimmung ihrer<br />
verschiedenen Strategien, so dass red<strong>und</strong>ante Förderung ausgeschlossen werden<br />
kann.<br />
Bei e<strong>in</strong>er adressatenbezogenen Ausrichtung sollte die Koord<strong>in</strong>ierung eher die NGO<br />
übernehmen, aber <strong>in</strong> enger Kooperation mit den Gebietskörperschaften. Bei e<strong>in</strong>er<br />
sozial-räumlichen Ausrichtung ist es eher von Vorteil, wenn die Koord<strong>in</strong>ierung durch<br />
die Gebietskörperschaft erfolgt – hierbei ist Bed<strong>in</strong>gung, dass die Entscheidungsbefugnis<br />
bei e<strong>in</strong>em Gremium liegt, <strong>in</strong> dem zivilgesellschaftliche Akteure e<strong>in</strong>deutig vertreten<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
5. Als letztes ist darauf h<strong>in</strong>zuweisen, dass durch berufliche Vorfeldmaßnahmen bisher<br />
nicht erreichbare Zielgruppen an diesen Projekten partizipieren konnten. E<strong>in</strong> zu starker<br />
Arbeitsmarktbezug birgt die Gefahr, dass besonders benachteiligte Menschen<br />
ausgeschlossen werden. Ziel der Förderung muss es se<strong>in</strong>, besonders benachteiligte<br />
Personen zu stabilisieren <strong>und</strong> an den Arbeitsmarkt heranzuführen. In e<strong>in</strong>em 2. Schritt<br />
kann aufbauend auf diese Vorfeldmaßnahme e<strong>in</strong>e direktere Beschäftigungswirkung<br />
erzielt werden.<br />
In Deutschland gibt es e<strong>in</strong>ige Beispiele, wo e<strong>in</strong>e Qualifizierung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Existenzgründung<br />
mündete.<br />
91
Prof. Salvador Parrado, Governance International, Madrid<br />
Good Governance – Was zeichnet gute<br />
Praxis aus?<br />
92
Prof. Ra<strong>in</strong>er Kilb, Fachhochschule Mannheim, Fakultät für<br />
Sozialwesen<br />
Sozialräumliche Politikstrategien zur<br />
Verh<strong>in</strong>derung sozialer Exklusion<br />
<strong>Jugendliche</strong> tun <strong>und</strong> unternehmen eigentlich <strong>in</strong> der Regel alles<br />
Mögliche, um nicht ausgegliedert oder an den Rand gedrängt<br />
zu werden! Diese These ließe sich sicherlich gerade von der<br />
entwicklungspsychologischen Betrachtung der Adoleszenz her<br />
untermauern.<br />
Bei e<strong>in</strong>em Teil der <strong>Jugendliche</strong>n führt aber nun, wie wir wissen, gerade dieses, <strong>in</strong> der<br />
Fachsprache so genannte „Bewältigungsverhalten“ zur Exklusion – <strong>und</strong> dies ist gleichermaßen<br />
paradox wie auch dialektisch.<br />
Ich möchte dies an e<strong>in</strong>em Beispiel aufzeigen.<br />
Ich arbeitete <strong>in</strong> der Zeit, <strong>in</strong> der ich noch ke<strong>in</strong> Professor war, als Sozialarbeiter <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
Frankfurter Sozialen Brennpunkt mit – damals hieß es – „krim<strong>in</strong>ellen arbeitsscheuen Gang-<br />
<strong>Jugendliche</strong>n“ (ca. 16 Jahre). Im Rahmen dieser Arbeit führte ich immer wieder längere<br />
Gespräche mit den <strong>Jugendliche</strong>n <strong>und</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em dieser Gespräche g<strong>in</strong>g es auch um das Klauen<br />
(Diebstahlsdelikte) <strong>und</strong> um die Frage: was ist Armut <strong>und</strong> wer ist eigentlich arm?<br />
In e<strong>in</strong>em dieser Gespräche antwortete e<strong>in</strong>er der befragten <strong>Jugendliche</strong>n auf me<strong>in</strong>e damals<br />
etwas diffus formulierte Frage: „Wie müsste e<strong>in</strong>e Welt ohne Klauen aussehen?“ folgendermaßen:<br />
„Total arm, das glaube ich bestimmt, total arm wäre das gewesen, wenn ich nicht geklaut<br />
hätte, weil: ich habe ja Sachen geklaut; … also ich habe geklaut für Geld <strong>und</strong> Geld<br />
habe ich <strong>in</strong> Kleider angelegt oder eben Schuhe oder Haare schneiden oder so. Du, hätte ich<br />
nicht geklaut, wäre ich so e<strong>in</strong> asozialer Typ geworden, hätte nie Kleider gehabt, wäre ich<br />
arm rum gelaufen halt … Wenn ke<strong>in</strong>er geklaut hätte <strong>in</strong> der A(…)Straße wäre jeder arm<br />
gewesen eigentlich. Ich kenne ke<strong>in</strong>en … doch, der Hamit; der hat nie geklaut. Das war der<br />
E<strong>in</strong>zige; aber das hat man auch gesehen, dass er nicht geklaut hat, an se<strong>in</strong>en Kleidern <strong>und</strong><br />
so. Wir s<strong>in</strong>d mit neuer Mode rum gelaufen <strong>und</strong> er halt nicht so.“<br />
Wir kennen mittlerweile all die Bef<strong>und</strong>e, die das R<strong>in</strong>gen um Anerkennung, um Integration<br />
belegen. Wir kennen auch die gleichzeitigen Schwierigkeiten, aus bestimmten Lebensverhältnissen<br />
heraus dies auch wirklich zu schaffen. Die räumliche Ausgliederung wie <strong>in</strong><br />
diesem Falle bei gleichzeitig nicht vorhandenen materiellen Möglichkeiten, an konsumbezogenen<br />
gesellschaftlichen Standards teilzuhaben, lässt dann solche Muster der Bewältigung<br />
zur Normalität werden.<br />
Wir stoßen über dieses Beispiel sofort auf die zentrale Dimension der sozialräumlichen<br />
Exklusion: e<strong>in</strong> gesellschaftlich eigentlich verurteiltes Verhalten ist für die Betroffenen als<br />
solches gar nicht mehr erfahrbar. Im Gegenteil: im Ghettomilieu dient es alle<strong>in</strong> der Absicht,<br />
mithalten zu können <strong>und</strong> dabei zu se<strong>in</strong>. Es ist also zunächst e<strong>in</strong>mal e<strong>in</strong>e Integrationsleistung.<br />
Dass dadurch ganze Siedlungen oder auch ganze Stadtteile marg<strong>in</strong>alisiert werden können,<br />
ist dann die Folge. Das E<strong>in</strong>e bed<strong>in</strong>gt das Andere.<br />
96
Dies ist nur e<strong>in</strong> Beispiel, wie Exklusion sozialräumlich stattf<strong>in</strong>det; es gibt weitere Formen,<br />
die aber je nach Geme<strong>in</strong>wesenformen oder auch nach Stadtteil- oder Quartierstrukturen<br />
unterschiedlich ausfallen können.<br />
Ich möchte <strong>in</strong> vier Schritten das Thema erfassen <strong>und</strong> diskutieren:<br />
1. Mit Hilfe e<strong>in</strong>er exemplarischen Stadtstrukturanalyse der „global-city“ Frankfurt am<br />
Ma<strong>in</strong> werden marg<strong>in</strong>alisierte großstädtische Areale typisiert;<br />
2. Es folgt e<strong>in</strong>e Betrachtung dieser Segregationstypen <strong>in</strong> bestimmten städtischen Lagen<br />
<strong>in</strong> ihren jeweiligen Wirkungen auf die Bewohner/<strong>in</strong>nen h<strong>in</strong>;<br />
3. Hieraus sollen Ansatzpunkte für die Quartierarbeit abgeleitet werden;<br />
4. Im Rahmen e<strong>in</strong>es Fazits soll der Frage nach allgeme<strong>in</strong>en EU-weiten Standards<br />
nachgegangen werden.<br />
„E<strong>in</strong>e Stadt besteht aus unterschiedlichen Arten von Menschen; gleiche Menschen br<strong>in</strong>gen<br />
ke<strong>in</strong>e Stadt zuwege“ (Aristoteles). Die Stadt oder die Metropole sei durch ihre Anhäufung<br />
von Differenz e<strong>in</strong>e Integrationsmasch<strong>in</strong>e an sich; diese Feststellung ist gleichermaßen<br />
von Gelehrten der Antike, von Stadtforschern wie auch von Politikern e<strong>in</strong>schlägiger Couleur<br />
heute im Kontext von Integrationsbemühungen immer wieder zu vernehmen. Insbesondere<br />
Großstädte seien durch ihre überregionale <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Regel <strong>in</strong>ternational-globale<br />
Ausrichtung Zentren ökonomischer wie kultureller Austauschbeziehungen <strong>und</strong> deshalb zur<br />
Integration von Fremden besonders geeignet.<br />
Die Städte <strong>in</strong> ihrer Vielzahl an Lebenswelten, an Gelegenheiten <strong>und</strong> perspektivischen<br />
Optionen, an Nischen dabei ausschließlich auf ihre <strong>in</strong>tegrativen Impulse zu reduzieren wäre<br />
zu kurz gegriffen. Im Gegenteil, <strong>in</strong> quasi dialektischem Verhältnis gel<strong>in</strong>gt Integration<br />
häufig nur bei gleichzeitig stattf<strong>in</strong>dender Exklusion des- oder derjenigen, die nicht <strong>in</strong>nerhalb<br />
e<strong>in</strong>es von der Mehrheit oder auch von den mächtigeren Gruppen def<strong>in</strong>ierten „normativen<br />
Korridors“ unterzubr<strong>in</strong>gen s<strong>in</strong>d. Städte bieten also e<strong>in</strong>erseits Abspaltungs- <strong>und</strong> Trennungsmöglichkeiten<br />
räumlicher Art für lokale, ethnische, kulturelle wie soziale Milieus als<br />
auch Gelegenheiten zur Begegnung, im besseren Fall auch zu geme<strong>in</strong>samen Erfahrungen<br />
oder sogar zum Mite<strong>in</strong>ander derselben an.<br />
Typisierung segregierter Stadtareale<br />
Städtischer Raum als Vermittler sozialer Ungleichheit<br />
Shevky/ Bell als Vertreter der Chicagoer Schule befassten sich schon <strong>in</strong> den 20er Jahren<br />
mit sozialer Ungleichheit im städtischen Raum. Nach dem Modell ihres sozialökologischen<br />
Ansatzes überträgt sich soziale Ungleichheit <strong>in</strong> der Gesellschaft auf den städtischen Raum;<br />
heutige Segregationsmodelle von Häußermann (2000) oder Dangschat (2000) sehen den<br />
städtischen Raum ebenfalls <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Mittlerfunktion von sozialer Ungleichheit, die sich<br />
durch die räumlichen Strukturen verfestige. Vor allem Sampson/ Groves (1989) knüpfen <strong>in</strong><br />
den 80er Jahren wieder an diesem Modell an <strong>und</strong> differenzieren hierbei zwischen exogenen<br />
Ursachen <strong>und</strong> verschiedenen Dimensionen sozialer Desorganisation.<br />
Unter sozialer Desorganisation verstehen Shaw/ Mc Kay (1931) die „mangelnde Befähigung<br />
e<strong>in</strong>es Geme<strong>in</strong>wesens, die für die Bewohner wichtigen geme<strong>in</strong>samen Werte zu erzeugen<br />
<strong>und</strong> soziale Kontrolle über das Territorium auszuüben“. Sämtliche Modelle gehen<br />
97
von e<strong>in</strong>er bereits vollzogenen <strong>sozialen</strong>, ökonomischen, kulturellen <strong>und</strong> auch symbolischen<br />
(vgl. Bourdieu 1991) Ausdifferenzierung oder auch Spaltung des gesamtstädtischen Raumes<br />
aus <strong>und</strong> arbeiten vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> mit den zwei zentralen Kategorien „Exogener Ursachen“<br />
wie etwa e<strong>in</strong>em bereits dom<strong>in</strong>anten niedrigen wirtschaftlichen Status, <strong>sozialen</strong> Risikofaktoren<br />
wie hohen Anteilen unvollständiger Familien, ethnischer Heterogenität, residenzieller<br />
Mobilität <strong>und</strong> anomischen Entwicklungen e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> struktureller Defizite sozialer<br />
Desorganisation andererseits. Hierzu zählen etwa ger<strong>in</strong>ge Intensitäten sozialer Netzwerke,<br />
fehlende Partizipation <strong>und</strong>/oder fehlende Kontrollimpulse gegenüber Aktivitäten jugendlicher<br />
Gruppen.<br />
Eisner (1997) ergänzt die bisherigen Modelle h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>em prozessualen Muster: städtische<br />
Räume, die als unsicher von ihren Bewohnern wahrgenommen werden – <strong>und</strong> dies<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbesondere verwahrloste, gestaltlose oder unwirtliche Areale – entfalten soziale<br />
Rückzugswirkungen. Diese wiederum führen zu selektiver Entmischung <strong>und</strong> zu eher auf<br />
eigene Interessen h<strong>in</strong> orientierter Sozialkontrolle e<strong>in</strong>zelner verbliebener Gruppen. Segregation<br />
stellt sich somit sowohl als Herausbildung <strong>und</strong> als Verfestigung sozialer Ungleichheiten<br />
heraus (Dangschat 2000).<br />
Zusammenhänge zwischen städtischen Segregationstypen <strong>und</strong> Integrations-<br />
bzw. Des<strong>in</strong>tegrationsimpulsen<br />
Es sollen im Folgenden die diversen <strong>in</strong> b<strong>und</strong>esdeutschen Ballungsräumen präsenten Segregationstypen<br />
daraufh<strong>in</strong> betrachtet werden, welche Impulse von diesen für die Integrationsentwicklungen<br />
bei Migrantenfamilien <strong>und</strong> deren <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n ausgehen.<br />
In der Regel f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> den Verdichtungsräumen acht <strong>in</strong>frastrukturell spezifische,<br />
baulich speziell ausgestaltete bzw. jeweils wirtschaftshistorisch bed<strong>in</strong>gte Typen von Segregationsquartieren<br />
(vgl. Kilb 1998):<br />
a) Wohnquartiere <strong>in</strong> den City- <strong>und</strong> Cityrandbereichen mit bevorstehenden oder zu<br />
erwartenden Nutzungsänderungen (Charakteristika: hohe Lärm- <strong>und</strong> Umweltbelastungen,<br />
hohe Migrantenanteile, Übergangswohnen, Konsumanhäufungs-<br />
Armutskonfrontation);<br />
b) Subzentrale Kernbereiche mit abgeschwächt vergleichbaren Strukturen wie a);<br />
c) Quartiere im Umfeld von Verkehrsdrehscheiben <strong>und</strong> Verkehrsmagistralen (hohe<br />
Lärm-, Schmutz- <strong>und</strong> Umweltbelastungen; Migrantenkonzentrationen, Übergangswohngebiete);<br />
d) Traditionelle Industrie- <strong>und</strong> Arbeiterstadtteile/-siedlungen (die verb<strong>in</strong>denden geme<strong>in</strong>samen<br />
Arbeitsstätten fallen dort zunehmend fort);<br />
e) Großsiedlungen des <strong>sozialen</strong> Wohnungsbaus der 20er, 50er <strong>und</strong> 60er Jahre;<br />
f) Trabantenstadtteile/Großsiedlungen der 60er <strong>und</strong> 70er Jahre (residenzielle Segregation);<br />
g) Hochhaussolitäre <strong>und</strong> punktuelle Massenunterkünfte (Belegungshotels, Obdachlosenunterkünfte,<br />
Aussiedler- <strong>und</strong> Asylunterkünfte);<br />
h) Traditionelle Segregationssiedlungen (Obdachlosen-, Übergangssiedlungen, Wohnwagensiedlungen,<br />
Bauwagen- <strong>und</strong> Conta<strong>in</strong>erdörfer).<br />
98
Segregationstypen <strong>in</strong> ihren Wirkungen auf die Bewohner/<strong>in</strong>nen<br />
Diese acht Quartierstypen lassen sich von ihren jeweiligen Formen der Transferwirkungen<br />
zwischen sozialer Ungleichheit <strong>und</strong> <strong>in</strong>tegrativ/ des<strong>in</strong>tegrativen Impulsen wiederum vier<br />
verschiedenen „Wirkungstypen“ zuordnen:<br />
Sozialräume als Abspaltungsverstärker:<br />
Dies s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> sich geschlossene ghettoartige Areale, die sich durch externe Stigmatisierungen<br />
positionell eher negativ verstärken aber gleichzeitig e<strong>in</strong>e „Vorhangwirkung“ durch<br />
e<strong>in</strong>e starke Selbstisolation der Bewohner entfalten können; man bleibt im Ghetto <strong>und</strong> sieht<br />
deshalb die „äußeren Welten“ seltener (Typen g, h der residenziellen Segregationstypen). In<br />
solchen Quartieren wird gesellschaftliche Exklusion besonders deutlich. Bei heterogener<br />
<strong>in</strong>terkultureller Bevölkerungsstruktur <strong>in</strong>tensiviert sich häufig soziale Desorganisation. Leben<br />
dagegen weniger zahlreiche unterschiedliche Ethnien zusammen, können sich eher<br />
Community-Effekte entfalten. E<strong>in</strong>e Integration <strong>in</strong>nerhalb dieser Stadtteile ist dabei bei gleicher<br />
Lebenslage der Bewohner <strong>und</strong> bei ger<strong>in</strong>gerer Mobilität (vgl. Straßburger 2001) wahrsche<strong>in</strong>licher.<br />
Sozialräume als Konfrontationsverstärker:<br />
Durch unmittelbares Aufe<strong>in</strong>andertreffen von Konsumkonzentration <strong>und</strong> Benachteiligungslagen<br />
(Segregationstypen a, b, c) verstärken sich Konfrontations-, Polarisierungs- <strong>und</strong><br />
Diskrim<strong>in</strong>ierungseffekte. In diesen Arealen dom<strong>in</strong>ieren ganz deutlich z. B. die Eigentumsdelikte<br />
bei <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n, die <strong>in</strong> ihren räumlichen Lebenswelten ständig mit<br />
Konsumstandards konfrontiert werden, zu denen sie materiell gar ke<strong>in</strong>e ausreichenden<br />
legalen Zugänge besitzen.<br />
Sozialräume als Verunsicherungsverstärker:<br />
In den traditionellen kle<strong>in</strong>bürgerlichen Arbeiterstadtteilen (Typen d, e) haben sich durch<br />
die Modernisierungs- <strong>und</strong> Globalisierungsentwicklungen extrem verunsichernde Entwicklungen<br />
ergeben. Starker Arbeitsplatzabbau im produktiven Sektor führte zu e<strong>in</strong>er realen<br />
Reduktion körperorientierter Arbeitsweisen/-kulturen <strong>und</strong> zur gleichzeitigen Überhöhung<br />
körperlicher Stilisierung <strong>und</strong> Selbst<strong>in</strong>szenierung <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> der jungen männlichen<br />
Bevölkerung. In solchen Arealen s<strong>in</strong>d im <strong>sozialen</strong> Zusammenleben ebenfalls eher Des<strong>in</strong>tegrationstendenzen<br />
zu beobachten.<br />
Sozialräume als bauliche Des<strong>in</strong>tegrationsräume:<br />
Diese Quartiere besitzen kaum städtebauliche Akzente <strong>und</strong> Orientierungen. Es s<strong>in</strong>d<br />
i. d. R. Bebauungen längs der Verkehrsmagistralen ohne <strong>in</strong>tegrative Bezugskomponenten.<br />
Es treffen ungleichzeitig verlaufende Entwicklungen der BewohnerInnen mit ethnischer<br />
Heterogenität zusammen (Segregationstypen e, f, g). Gewalt- <strong>und</strong> Eigentumsdelikte s<strong>in</strong>d<br />
gleichermaßen überrepräsentiert <strong>und</strong> wirken entsolidarisierend <strong>und</strong> des<strong>in</strong>tegrierend<br />
zugleich.<br />
In e<strong>in</strong>er Expertise zum Integrationspotenzial <strong>in</strong> unterschiedlichen Frankfurter Stadtteilen<br />
arbeitete Gaby Straßburger die <strong>in</strong>tegrationsfördernden Faktoren heraus: höheres Image<br />
des Quartiers, „multikulturelles Flair“, relativ ähnliche Lebenslage, hohe Nutzungen selbst<br />
organisierter Angebote <strong>in</strong> Vere<strong>in</strong>en sowie Bewohnerkont<strong>in</strong>uität.<br />
99
In e<strong>in</strong>er von uns 2003 durchgeführten qualitativen Stadtteilanalyse im Wiesbadener Industrievorort<br />
Biebrich ließen sich ähnliche <strong>in</strong>tegrationsbegünstigende Faktoren herausarbeiten.<br />
Obwohl bei der Biebricher Wohnbevölkerung auf Gr<strong>und</strong> spezifischer soziostruktureller<br />
Faktoren <strong>in</strong>sbesondere bei <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n von im Vergleich zum<br />
Wiesbadener Durchschnitt erhöhten Risikolagen ausgegangen werden konnte, bilden sich<br />
diese weniger stark als zu erwarten gewesen wäre <strong>in</strong> aktuellen sozial-problematischen Verhaltensmustern<br />
ab: Alltagsleben, soziale, kommunikative <strong>und</strong> atmosphärische Situation<br />
erschienen nicht so bee<strong>in</strong>trächtigt, wie man dies eigentlich auf Gr<strong>und</strong> der bestehenden Risiko<strong>in</strong>dikatoren<br />
hätte vermuten können. Die traditionelle Beschäftigung vornehmlich der<br />
ersten beiden Migrantengenerationen <strong>in</strong> den ortsansässigen beiden großen Industriebetrieben<br />
sowie der begleitend stattf<strong>in</strong>dende Aufbau e<strong>in</strong>er <strong>sozialen</strong>, kulturellen <strong>und</strong> privatwirtschaftlichen<br />
Infrastruktur fungierten hierbei vermutlich als Medium.<br />
Auf diesen fortdauernden historisch-<strong>in</strong>terkulturellen Integrationsprozess wirken sich<br />
<strong>in</strong>sbesondere drei Faktoren positiv aus:<br />
1. E<strong>in</strong> urban geprägtes städtebauliches Zentrum mit lebendiger Geschäftswelt bildet<br />
e<strong>in</strong> Forum, e<strong>in</strong>e „große Bühne“ zur <strong>in</strong>formellen Begegnung der vielseitigen Bevölkerungsstruktur.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus f<strong>in</strong>den die e<strong>in</strong>zelnen ethnischen, <strong>sozialen</strong> <strong>und</strong> kulturellen<br />
Gruppierungen ihre jeweils mehr oder weniger akzeptierten spezifischen<br />
„Rückzugs<strong>in</strong>seln“ im Stadtteil. Diese Bereiche (ethnische Kulturvere<strong>in</strong>e, traditionelle<br />
Vere<strong>in</strong>e, Feuerwehr, Gaststätten, Internet-Cafes, etc.) stellen häufig das von den<br />
Betroffenen selbst gesteuerte Arrangement zwischen herkunftskulturellen <strong>und</strong> im<br />
Stadtteil dom<strong>in</strong>ierenden kulturellen Ma<strong>in</strong>stream-Aspekten dar <strong>und</strong> bieten damit<br />
sukzessive erfahrbare Integrationsstufen an.<br />
2. Zum Anderen halten die <strong>K<strong>in</strong>der</strong>gärten, Schulen <strong>und</strong> <strong>sozialen</strong> Freizeitangebote<br />
(<strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendzentrum, Nachbarschaftszentrum usw.) gezielte methodischdidaktisch<br />
aufbereitete <strong>in</strong>terkulturelle Angebote vor, die die vorher erwähnten <strong>in</strong>formellen<br />
Bezüge fördern, verstärken <strong>und</strong> teilweise „ritualisieren“.<br />
3. Weiterh<strong>in</strong> stellt sich die Netzwerkbildung über diverse Verb<strong>und</strong>systeme von Stadtteilarbeitskreis,<br />
Vere<strong>in</strong>sr<strong>in</strong>g <strong>und</strong> das „Soziale-Stadt“-Programm als <strong>in</strong>terkulturell<br />
vermittelndes <strong>und</strong> (selbst-)regulierendes Instrument dar.<br />
Als e<strong>in</strong>zige E<strong>in</strong>schränkung erweist sich e<strong>in</strong> <strong>in</strong> den demografischen Daten ersichtlicher<br />
Abgang oder „Auszug“ jüngerer „deutscher“ Familien. Hierdurch könnte mittel- <strong>und</strong> langfristig<br />
e<strong>in</strong>e „Schieflage“ <strong>in</strong> der bisher sozial-ausgeglichen wirkenden Heterogenität der Bevölkerungsstruktur<br />
entstehen, die das Image „Ausländerstadtteil“ nach <strong>in</strong>nen <strong>und</strong> nach<br />
außen zu transportieren droht (vgl. Kilb 2004).<br />
Insgesamt lassen sich über die beiden Studien die nachfolgenden günstigeren sozialräumlichen<br />
Aspekte für gel<strong>in</strong>gende Integrationsprozesse identifizieren:<br />
• nicht stigmatisierte, sondern städtebaulich aufgewertete Areale<br />
• städtebauliche Foren der Kommunikation <strong>und</strong> von geme<strong>in</strong>samen Aktivitäten<br />
• ähnlicher betrieblicher <strong>und</strong> wohnungsbezogener Erfahrungs- bzw. Aktivierungsh<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong><br />
von „Deutschen“ <strong>und</strong> „Migranten“<br />
• ähnlicher sozialer Status der (beiden) Gruppen<br />
100
• soziale <strong>und</strong> materielle Mischstrukturen <strong>in</strong> den jeweiligen „Communities“<br />
• weniger kultur-heterogene sozialräumliche Strukturen<br />
• geme<strong>in</strong>same kle<strong>in</strong>teilige sozialräumliche Geschichte<br />
• multikulturelle sozialräumliche Wirtschaftsstruktur <strong>in</strong> der unmittelbaren Versorgung<br />
Speziell für das K<strong>in</strong>des- <strong>und</strong> Jugendalter ersche<strong>in</strong>en die folgenden fünf sozialräumlichen<br />
Kriterien <strong>in</strong>tegrationsbegünstigende Wirkungen zu entfalten:<br />
1. Die Vielfalt e<strong>in</strong>es abgestuften Systems herkunfts-kultureller Orte des „Rückzugs“<br />
<strong>und</strong> multikultureller Orte/ Foren der Selbst-Darstellung <strong>und</strong> Begegnung,<br />
2. geme<strong>in</strong>same Orte der kulturellen Aneignung: Orte mit Personen <strong>und</strong> erlebbarer<br />
„Geschichten“,<br />
3. multikulturelle Mischstruktur an/<strong>in</strong> den identitätsstiftenden Orten, E<strong>in</strong>richtungen<br />
<strong>und</strong> Organisationen,<br />
4. <strong>in</strong>terkulturelle Programmatik sozialräumlicher Institutionen (<strong>K<strong>in</strong>der</strong>tagesstätten,<br />
Schulen, Vere<strong>in</strong>e, Freizeitheime),<br />
5. positiv besetzte Vermittlungsarrangements.<br />
Nach Bourdieu ist Sozialer Raum mehr e<strong>in</strong> „semantischer Assoziationsraum“ <strong>und</strong> ke<strong>in</strong>eswegs<br />
nur physischer Raum. Er prägt sich aus der Verb<strong>in</strong>dung von bestimmten <strong>sozialen</strong><br />
Lebensstilen <strong>und</strong> von <strong>sozialen</strong> Positionen, die wiederum durch e<strong>in</strong>e Hierarchie von ökonomischen,<br />
kulturellen <strong>und</strong> <strong>sozialen</strong> Ressourcen gebildet werden.<br />
Differenzierte Ansätze für die Quartierentwicklung<br />
Lassen sich Präventionsstrategien problemadäquat ausrichten?<br />
Städtische Raumentwicklungen vermitteln <strong>und</strong> verfestigen des<strong>in</strong>tegrierende Strukturen. Sie<br />
prägen deren unterschiedliche Ausformungen entscheidend mit, <strong>in</strong>dem sie als Lernfelder,<br />
als Kontrast-Erfahrungsfelder, als Etikettierungs- <strong>und</strong> Verfestigungs- sowie als Räume mit<br />
des<strong>in</strong>tegrierenden <strong>und</strong> desorientierenden Impulsen auf die Bewohner e<strong>in</strong>wirken.<br />
Ursachen <strong>und</strong> H<strong>in</strong>tergründe, Entwicklungsformen <strong>und</strong> Gelegenheiten unterscheiden<br />
sich dabei erheblich <strong>und</strong> erfordern sozialraumadäquat differenzierte Präventionsstrategien<br />
<strong>und</strong> Ansätze, die im Folgenden kurz diskutiert werden. Dabei sollten sich die verschiedenen<br />
Maßnahmen an drei übergeordneten Zielen orientieren: Integration, Regelarrangements <strong>und</strong><br />
Wohnumfeldgestaltungen. Unter diesen Zielkonturen sollten für die vier Segregationstypen<br />
folgende spezifische Schwerpunktsetzungen erfolgen:<br />
Typus Ghetto:<br />
• Aufwertung im gesamtkommunalen Kontext z. B. durch die Verlagerung subzentraler<br />
oder zentraler kommunaler Angebote <strong>und</strong> Dienstleistungen bzw. <strong>in</strong>teressanter<br />
stadtweiter kommerzieller Angebote wie z. B. Sportstätten, Freizeitangebote,<br />
Kultur- oder auch Konsumangebote. Beispiele hierfür mögen der Bau<br />
e<strong>in</strong>es überregionalen E<strong>in</strong>kaufszentrums auf e<strong>in</strong>er Industriebrache <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em <strong>sozialen</strong><br />
Brennpunkt der Stadt Köln, das von Gehry entworfene Guggenheim-<br />
Museum im Hafen Bilbaos oder das WM-Stadion <strong>in</strong> Paris se<strong>in</strong>.<br />
101
102<br />
• Verb<strong>in</strong>dungen von Arbeits- <strong>und</strong> Ausbildungsprojekten mit Wohnumfeldverbesserungen<br />
(Beispiel: Gebäude- <strong>und</strong> Grünflächensanierung <strong>in</strong> Sozialen Brennpunktsiedlungen<br />
wie z. B. Ahornstraße <strong>in</strong> Frankfurt am Ma<strong>in</strong> durch e<strong>in</strong> Beschäftigungsprojekt<br />
e<strong>in</strong>es stadtweiten Jugendhilfeträgers) mit aus Peer-Groups<br />
gebildeten Arbeitse<strong>in</strong>heiten.<br />
• Geme<strong>in</strong>wesenarbeit nach dem US-amerikanischen „Leader-Modell“: d.h. Nutzung<br />
der vor Ort vorhandenen <strong>in</strong>formellen „Hierarchie-Strukturen“ als <strong>in</strong>terner<br />
Regulations- <strong>und</strong> Vertretungsansatz nach außen. Solche vorhandenen Strukturen<br />
müssen teil formalisiert <strong>und</strong> damit aufgewertet werden <strong>und</strong> durch fachliche<br />
Begleitung häufig demokratisiert <strong>und</strong> von bisher unterdrückenden Impulsen<br />
„befreit“ werden;<br />
• Individuelle Cliquen- <strong>und</strong> Zielgruppen orientierte Talentförderung;<br />
• Individuelles Mentor<strong>in</strong>g <strong>in</strong> der Jugend-, Familiensozialarbeit <strong>und</strong> der Bildungsarbeit;<br />
Typus Armutslagen – Konsumkonzentration:<br />
• In diesen Arealen sollten im Gegensatz zum Ghettotypus städtebauliche „Nischen“<br />
<strong>und</strong> Rückzugsbereiche –durch baulich-räumliche Abtrennungen– entstehen,<br />
die zusammen mit gezielten lokalen Angeboten e<strong>in</strong>e Alternative zum<br />
„konsumorientierten Streifzug“ der <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> jugendlichen Bewohner <strong>und</strong><br />
Bewohner<strong>in</strong>nen darstellen.<br />
• Mit Hilfe von Sponsor<strong>in</strong>gaktivitäten <strong>und</strong> Patenschaften sollten <strong>Jugendliche</strong><br />
frühzeitig <strong>in</strong> arbeitsorientierter Form (Jobs, Praktika, Ausbildungsplätze) <strong>in</strong> die<br />
Betriebe im Quartier e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en werden.<br />
• Der sek<strong>und</strong>ären Prävention <strong>in</strong> Schulen <strong>und</strong> der <strong>K<strong>in</strong>der</strong>tagesbetreuung sowie der<br />
<strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendarbeit sollte große Bedeutung zukommen.<br />
• Die Bewohnerk<strong>in</strong>der <strong>und</strong> –jugendlichen sollten durch eigene Angebote tendenziell<br />
von problematischen extern wohnenden, die Citybereiche aber nutzenden<br />
<strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n wegorientiert werden. Dies kann nur gel<strong>in</strong>gen, wenn<br />
für beide Gruppierungen separate sozialpädagogisch begleitete Hilfe-, Freizeit-<br />
<strong>und</strong> Kulturarbeit existiert.<br />
Typus „Verunsicherungs“-abstiegsbedrohte Stadtareale:<br />
• In diesen Arealen existieren meist noch traditionelle soziokulturelle Selbstorganisationsformen<br />
<strong>in</strong> Nachbarschaften, Vere<strong>in</strong>en <strong>und</strong> wirtschaftlichen Zusammenhängen.<br />
Diese gilt es zu stabilisieren, zu modernisieren <strong>und</strong> langsam für<br />
neue (Migranten-) BewohnerInnen zu öffnen. Ggf. sollten Selbsthilfepotenziale<br />
durch externe Anreize reaktiviert werden.<br />
• Die bisherige soziokulturelle Infrastruktur sollte somit an die real bestehende<br />
neue Bewohnerstruktur mit Hilfe von Quartiersmanagement angepasst werden.<br />
• In Schule <strong>und</strong> Jugendhilfee<strong>in</strong>richtungen ersche<strong>in</strong>t gezielte Gewaltprävention auf<br />
der sek<strong>und</strong>ären <strong>und</strong> tertiären Präventionsebene angemessen.<br />
Typus Des<strong>in</strong>tegrationsareale:<br />
• In diesem Quartierstyp s<strong>in</strong>d zumeist abgrenzende <strong>und</strong> zentrifugal wirkende<br />
Kräfte dom<strong>in</strong>ant. Es fehlen häufig historisches Identitätsbewusstse<strong>in</strong> <strong>und</strong> bewährte<br />
Integrationsabläufe <strong>und</strong> Rituale, sodass es notwendig ersche<strong>in</strong>t, e<strong>in</strong>e<br />
neue soziokulturelle Infrastruktur aufzubauen. Regelarrangements <strong>und</strong> e<strong>in</strong> stufenförmiges<br />
Integrationskonzept (vgl. Gaitanides, Hamburger) ersche<strong>in</strong>en hier<br />
notwendig zu se<strong>in</strong>.
• Interkulturelle Mediation, konfrontierende <strong>und</strong> gleichzeitig akzeptierende Methoden<br />
ersche<strong>in</strong>en ebenfalls <strong>in</strong>diziert. Gerade an den Regelverstößen müsste die<br />
sozialpädagogische Quartiersarbeit ansetzen, um mittelfristig Regelarrangements<br />
zwischen den Bewohnergruppen entstehen zu lassen.<br />
Insgesamt sollte e<strong>in</strong>e sozialräumlich differenzierte Integrationsarbeit an den vorhandenen<br />
Potenzialen <strong>und</strong> Ressourcen <strong>und</strong> nicht primär an den bestehenden Defiziten ansetzen.<br />
Es dürfte selbstverständlich dabei se<strong>in</strong>, die Betroffenen aktiv <strong>in</strong> die Gestaltung <strong>und</strong> Konzeptionierung<br />
solcher Arbeitsansätze e<strong>in</strong>zub<strong>in</strong>den.<br />
EU-e<strong>in</strong>heitliche Standards für die Quartiersarbeit?<br />
Geht man von den augenblicklichen gesellschaftlichen <strong>und</strong> landespolitischen Entwicklungen<br />
<strong>in</strong> den Beitrittsländern aus, so ist e<strong>in</strong>erseits fest zu stellen, dass <strong>in</strong>sbesondere auf sozialpolitischer<br />
Ebene große Unterschiede existieren, die z. B. auf unterschiedlichen historischen<br />
Wurzeln <strong>und</strong> deshalb auf unterschiedlichen Paradigmen gründen: so f<strong>in</strong>det man zum<br />
Beispiel <strong>in</strong> Deutschland das „duale“ System der kirchlichen <strong>und</strong> staatlichen Armenfürsorge<br />
(Allgeme<strong>in</strong>es Preußisches Landrecht 1794) zunächst als getrenntes (Fürsorge/ Kontrolle/<br />
Verantwortung), später als korrespondierendes System („Elberfelder System“) mit der Zuständigkeit<br />
von Kommunen <strong>und</strong> Ländern. In Großbritannien/(USA) wurde die deutsche<br />
Struktur, allerd<strong>in</strong>gs ohne Ehrenamtliche übernommen; das Armenrecht (1834) ersetzt die<br />
Lohnzuschüsse der Ära Elizabeth I.; die „Würdigen Armen“ landen bei der privaten, die<br />
„unwürdigen Armen“ bei der staatlichen Wohlfahrt; die Kommunen s<strong>in</strong>d der Zentralregierung<br />
untergeordnet; es existiert e<strong>in</strong> separiertes Eigenleben kirchlicher <strong>und</strong> privater Verbände.<br />
In Schweden dagegen f<strong>in</strong>det der Übergang der feudalistischen Agrar- <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Industriegesellschaft<br />
im europäischen Vergleich erst sehr spät statt <strong>und</strong> zementiert <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Art Doppelstruktur<br />
sowohl agrarisch-landfamiliäre Versorgungspr<strong>in</strong>zipien <strong>und</strong> gewerkschaftliches<br />
Solidarpr<strong>in</strong>zip als Paradigmen sozialstaatlicher Versorgung; es existiert dort nicht die Trennung<br />
zwischen Staat <strong>und</strong> Gesellschaft/Kirche, die Verbände gehen im Staat auf. In den<br />
Niederlanden resultieren aus den „Freiheitskämpfen“ e<strong>in</strong> Vorrang des Volkes vor dem Staat<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>e ausgesprochen soziale Ausrichtung kirchlicher Organisationen <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong><br />
der Altersversorgung.<br />
Hiervon ausgehend existieren <strong>in</strong> den EU-Mitgliedsstaaten ganz verschiedene sozialpolitische<br />
Handlungssystematiken sowie verschiedene adm<strong>in</strong>istrative Handlungsebenen. Insgesamt<br />
bildet sich somit e<strong>in</strong>erseits e<strong>in</strong> ziemlich unterschiedlicher Umgang mit <strong>sozialen</strong> Phänomenen<br />
heraus. Andererseits existieren aber vergleichbare gesellschaftspolitische Phänomene.<br />
So gibt es deutlich sichtbar vergleichbare ökonomische <strong>und</strong> sozialstrukturelle Entwicklungen,<br />
vergleichbare k<strong>in</strong>des- <strong>und</strong> jugendsozialisatorische Trends <strong>und</strong> auch vergleichbare<br />
Modernisierungsphänomene.<br />
Diese gesellschaftsstrukturellen Geme<strong>in</strong>samkeiten bei gleichzeitig wirkenden sozialpolitischen<br />
Differenzen legen differenzierte Handlungsstrategien nahe. Diese sollten sich aber<br />
an geme<strong>in</strong>samen Kriterien orientieren, die wiederum Eckwertcharakter für e<strong>in</strong>e europäische<br />
Politikstrategie <strong>in</strong> diesem Feld besitzen könnten.<br />
103
Folgende Kriterien ersche<strong>in</strong>en mir Länder übergreifend relevant zu se<strong>in</strong>, wobei deren<br />
<strong>in</strong>haltliche <strong>und</strong> methodische Ausformung jeweils wieder länderspezifischen Charakter besitzen<br />
könnten:<br />
• Partizipationspr<strong>in</strong>zip: sowohl ethische Aspekte als auch Nachhaltigkeitsgebot<br />
setzen dieses Pr<strong>in</strong>zip voraus.<br />
• Sozialraumorientierung: sie setzt an den jeweiligen regionalen geografischen,<br />
materiellen, kulturellen <strong>und</strong> <strong>sozialen</strong> Bezugsdimensionen an <strong>und</strong> macht diese<br />
zum Gegenstand der Bearbeitung.<br />
• Effizienz- bzw. ökologische Orientierung: dieses Kriterium steht für e<strong>in</strong>en<br />
verträglichen Ressourcenumgang <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e ganzheitliche Erfassung des Bearbeitungsgegenstandes.<br />
• Relativitätspr<strong>in</strong>zip: die Deutungshoheit <strong>und</strong> die Gewichtungen von Problemen<br />
liegen bei den Ländern bzw. <strong>in</strong> den Regionen<br />
• Ressortübergreifendes Politikpr<strong>in</strong>zip: entsprechend der o. a. Anforderungskriterien<br />
wäre das bisher übliche ressortorientierte Politikpr<strong>in</strong>zip durch e<strong>in</strong> ressortübergreifendes<br />
zu ergänzen.<br />
• Aktuelle Raumordnungspr<strong>in</strong>zipien: Letztendlich sollten die sich immer<br />
deutlicher herausbildenden neuen Wirtschaftsraumentwicklungen auch für die<br />
Sozialpolitik handlungsrelevant werden. So bilden sich zunehmend Metropolregionen<br />
als ökonomische wie auch soziale <strong>und</strong> kulturelle Gravitationszentren <strong>in</strong><br />
Europa heraus. Ihnen kommen dabei noch e<strong>in</strong>mal unterschiedliche globale<br />
(London, Paris, Zürich, Genf, Frankfurt am Ma<strong>in</strong>), EU-weite (Brüssel, Straßburg,<br />
Hamburg, Toulouse, Rom, Milano, Randstadt/ Amsterdam/ Rotterdam/<br />
Antwerpen) oder nationale Zentralfunktionen zu. Neben diesen Metropolregionen<br />
würden die so genannten Zwischenregionen (z. B. Nordsee- <strong>und</strong> Ostseeküste)<br />
<strong>und</strong> die meist ländlich geprägten Randregionen (z. B. Südostbayern, östliches<br />
Polen) als Aktionsräume fungieren.<br />
Literatur<br />
Aristoteles (1981):Politik, Hamburg<br />
Bourdieu, P. (1991): Physischer, sozialer <strong>und</strong> angeeigneter physischer Raum. In: Wentz, M.:<br />
Städt-Raume Frankfurt a.M.<br />
Dangschat, J. (2000): Segregation. In: Häußermann, H.: Großstadt …<br />
Eisner, M. (1997): Das Ende der zivilisierten Stadt. Frankfurt am Ma<strong>in</strong>/New York.<br />
Gaitanides, S. (1994): »Interkulturelles Lernen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Multikulturellen Gesellschaft«, <strong>in</strong>:<br />
sozialmagaz<strong>in</strong> 2/1994<br />
Hamburger, F. (1991): »Erziehung <strong>in</strong> der Multikulturellen Gesellschaft«, <strong>in</strong>: IZA 4/1991<br />
Hattenhauer, H. (Hrsg.) (1970): Allgeme<strong>in</strong>es Landrecht für die preußischen Staaten von<br />
1794. Metzner, Frankfurt/Ma<strong>in</strong><br />
Häußermann, H. (2000): Großstadt. Opladen.<br />
Kilb, R. (1998): Arm dran <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er reichen Gesellschaft. In: Frankfurter R<strong>und</strong>schau.<br />
Frankfurt am Ma<strong>in</strong>.<br />
Kilb, R. (2002): Krim<strong>in</strong>alität <strong>und</strong> sozialer Raum. In: Sozialmagaz<strong>in</strong>. We<strong>in</strong>heim.<br />
Kilb, R. (2004): Interessen von Jugendgruppen <strong>in</strong> Wiesbaden-Biebrich.<br />
Frankfurt/ Wiesbaden.<br />
104
Sampson, R. /Groves, B. (1989): Community Strukture and Crime. In: American Journal<br />
of Sociology. 94. Jg.<br />
Shaw, C./McKay, H. (1931): Social Factors <strong>in</strong> Juvenile Del<strong>in</strong>quency. Wash<strong>in</strong>gton.<br />
Shevky, E./Bell, W., 1955: Social Area Analysis. Theory, Illustrative Application and Computational<br />
Procedures. Stanford: Stanford University Press.<br />
Spaich, H. (1981): Fremde <strong>in</strong> Deutschland, We<strong>in</strong>heim/Basel.<br />
Straßburger, G. (2001): Stand der Integration von Zuwanderern <strong>in</strong> Frankfurter Stadtteilen,<br />
Frankfurt a. M.<br />
105
Professor Howard Williamson, University of Glamorgan, Wales,<br />
United K<strong>in</strong>gdom<br />
Die Europäische Jugendpolitik<br />
E<strong>in</strong>leitung<br />
Praktische Programme tauschen oft Ideen darüber aus, was die<br />
gr<strong>und</strong>legenden Elemente erfolgreicher Initiativen <strong>und</strong> Maßnahmen<br />
ausmacht. Sie s<strong>in</strong>d ausnahmslos umstritten <strong>und</strong> ich denke, sie sollten<br />
als e<strong>in</strong>e eher fehlgeleitete Suche nach dem Heiligen Gral angesehen<br />
werden. Stattdessen neige ich dem Standpunkt zu, der vor langer Zeit<br />
von Marris <strong>und</strong> Re<strong>in</strong> <strong>in</strong> ihrer Studie zu <strong>sozialen</strong> Reformprogrammen<br />
vorgeschlagen wurde:<br />
106<br />
„Der gesamte Prozess – die Fehlstarts, Frustrationen, Adaptionen, die fortlaufende<br />
Neuf<strong>in</strong>dung von Intentionen, die Umwege <strong>und</strong> Konflikte – muss begriffen werden.<br />
Nur dann können wir verstehen, was erreicht wurde, <strong>und</strong> aus dieser Erfahrung lernen<br />
…<br />
Niemand kann jemals wieder genau den gleichen Weg beschreiten, doch wenn man<br />
sich die Risiken der Projekte ansieht, bietet sich e<strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>er Rahmen für die Gefahren<br />
<strong>und</strong> Entdeckungen ihres Handlungsspielraumes.“ (Marris <strong>und</strong> Re<strong>in</strong> 1972,<br />
S. 260)<br />
Dies ist natürlich besonders im Zusammenhang mit jeder europäischen politischen Agenda<br />
wichtig; sogar die allerbesten Ideen können nicht e<strong>in</strong>fach über geographische Grenzen<br />
h<strong>in</strong>weg transportiert werden, ohne sorgfältig auf kulturelle, historische <strong>und</strong> politische<br />
Traditionen sowie auf aktuelle Ansätze zur Gr<strong>und</strong>satzformulierung <strong>und</strong> ihrer Ausführung<br />
Bezug zu nehmen.<br />
Ich habe das obige Zitat <strong>in</strong> me<strong>in</strong>er wegbereitenden Bewertung dessen benutzt, was<br />
heutzutage e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>schafts<strong>in</strong>itiative für ‚<strong>sozialen</strong> Zusammenhalt’ genannt werden würde.<br />
In diesem Bericht (Williamson <strong>und</strong> Weatherspoon 1985) wurden ‚soziale Brennpunkte’<br />
als ‚Gebiete sozialer Vernachlässigung’ bezeichnet. Das Titelblatt zeigte vier e<strong>in</strong>zelne Teile<br />
e<strong>in</strong>es Puzzles – freiwillige Träger [NGOs], die zentrale Regierung, die lokale Geme<strong>in</strong>schaft<br />
<strong>und</strong> mit staatlichen Befugnissen ausgestattete Behörden – <strong>und</strong> dann e<strong>in</strong> zusammengefügtes<br />
Puzzlebild mit e<strong>in</strong>em darüber liegenden Handschlag zwischen diesen Teilen. Es war e<strong>in</strong><br />
symbolischer Versuch, die Notwendigkeit e<strong>in</strong>er Zusammenführung <strong>und</strong> Zusammenarbeit<br />
der Institutionen darzustellen, wenn e<strong>in</strong>e effektive Praxisarbeit erreicht werden soll.<br />
Es ist ebenfalls wichtig, dass geb<strong>und</strong>ene, lokale Programme mit e<strong>in</strong>em gewissen Verständnis<br />
der Ausrichtung der übergreifenden Politik h<strong>in</strong>sichtlich der <strong>Jugendliche</strong>n (<strong>und</strong><br />
natürlich der Neugestaltung des Umfelds <strong>und</strong> dem geme<strong>in</strong>schaftlichen Zusammenhalt)<br />
arbeiten, die zunehmend auch e<strong>in</strong>e wichtige europäische Komponente besitzt. Dieses<br />
Gr<strong>und</strong>gerüst zu verstehen, ermöglicht es Praktikern nicht nur, sich an der Debatte um se<strong>in</strong>e<br />
zukünftige Ausrichtung zu beteiligen, es kann auch dazu beitragen, die Richtung der<br />
eigenen Vorgehensweise zu ‚legitimieren’, wenn regionale <strong>und</strong> nationale Strukturen von<br />
unterschiedlichen Prioritäten <strong>und</strong> Kriterien durchdrungen werden.
Das Gr<strong>und</strong>gerüst der europäischen ‘Jugendpolitik’ – e<strong>in</strong>ige allgeme<strong>in</strong>e<br />
Anmerkungen<br />
Ich werde nur e<strong>in</strong>ige zentrale Entwicklungen <strong>in</strong> der Jugendpolitik auf der europäischen<br />
Ebene auswählen, sowohl aus der Europäischen Union (die 27 Länder repräsentiert) als<br />
auch vom Europarat (der 47 Länder repräsentiert). Diese Entwicklungen benötigen hier<br />
nur relativ wenig detaillierte Ausführungen: sobald man sich ihrer bewusst ist, s<strong>in</strong>d detailliertere<br />
Informationen auf den relevanten Websites zu f<strong>in</strong>den.<br />
Zunächst möchte ich jedoch e<strong>in</strong>ige allgeme<strong>in</strong>ere D<strong>in</strong>ge bezüglich des Ideengerüstes der<br />
Jugendpolitik anbr<strong>in</strong>gen. Der wichtigste Punkt ist, dass alle Länder Jugendpolitik machen –<br />
bewusst, so nebenher oder aber <strong>in</strong>dem sie diese ignorieren. Mit anderen Worten: <strong>Jugendliche</strong><br />
müssen weiterh<strong>in</strong> ihr Leben leben, egal wie der politische Kontext aussieht. Dieser<br />
Kontext kann aktiv oder passiv se<strong>in</strong>, zielstrebig oder strafend, befähigend oder beschränkend,<br />
unterstützend oder regressiv wirken. Wie auch immer er aussieht, so ist auch die Jugendpolitik.<br />
Idealerweise ist sie umfassend <strong>und</strong> positiv, ergänzend <strong>und</strong> optimistisch, geschaffen<br />
durch Dialog <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Reflektion des übergreifendes Gr<strong>und</strong>gerüsts von Regierungs-<br />
<strong>und</strong> Nichtregierungsaktivität, das auf junge Leute ausgerichtet ist – auf sie, für sie<br />
<strong>und</strong> mit ihnen. Wie das Europäische Jugendforum oft gesagt hat: ‚nichts über uns, ohne<br />
uns’.<br />
Obwohl die meisten Länder sowohl im Europa der EU als auch im erweiterten Europa<br />
des Europarats mit vielen ähnlichen Angelegenheiten konfrontiert werden, gibt es dennoch<br />
zentrale Unterschiede h<strong>in</strong>sichtlich der ‚<strong>sozialen</strong> Verfassung’ junger Menschen <strong>in</strong> verschiedenen<br />
Ländern. Daher kann es ke<strong>in</strong>en übernationalen Bauplan für ‚Jugendpolitik’ geben:<br />
sie muss immer auf die spezifischen Herausforderungen zugeschnitten werden, <strong>in</strong> die die<br />
e<strong>in</strong>zelnen Kontexte e<strong>in</strong>gebettet s<strong>in</strong>d. Der Umfang dieser Herausforderungen (wie zum Beispiel<br />
Jugendarbeitslosigkeit, Jugendkrim<strong>in</strong>alität oder Umfang der E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>Jugendliche</strong>r)<br />
wird unterschiedlich se<strong>in</strong>, ebenso wie die verfügbaren Ressourcen <strong>und</strong> der politische Wille,<br />
etwas gegen sie zu tun. Trotzdem ist, wie Lauritzen <strong>und</strong> Guidikova beobachtet haben, die<br />
Zeit vorbei, <strong>in</strong> der die europäischen Staaten ihre jungen Leute ‚geformt' haben. Jetzt ist die<br />
Zeit, <strong>in</strong> der <strong>Jugendliche</strong> überall <strong>in</strong> Europa sich <strong>und</strong> die Geme<strong>in</strong>schaften, <strong>in</strong> denen sie leben,<br />
selbst ‚formen’ müssen, <strong>und</strong> so entsteht dem Ansche<strong>in</strong> nach die Notwendigkeit, sie mit den<br />
Ressourcen auszustatten, die sie für diese Aufgabe benötigen. Was <strong>in</strong> unserem aufstrebenden<br />
<strong>und</strong> sich erweiternden Europa offenk<strong>und</strong>ig wird, ist, dass e<strong>in</strong>e massive ‚Spaltung der<br />
Jugend’ existiert, sowohl <strong>in</strong>nerhalb als auch zwischen den beteiligten Mitgliedern. E<strong>in</strong>e<br />
gr<strong>und</strong>legende Herausforderung wird es se<strong>in</strong>, e<strong>in</strong>e Balance zu f<strong>in</strong>den zwischen dem Streben<br />
nach mehr Autonomie, wie die Forderung der sche<strong>in</strong>bar besser gestellten <strong>Jugendliche</strong>n<br />
lautet, <strong>und</strong> der Ausweitung e<strong>in</strong>er weitergehenden Unterstützung, die, wie die Jugendforschung<br />
deutlich zeigt, von gefährdeten <strong>Jugendliche</strong>n aus e<strong>in</strong>em benachteiligten Umfeld<br />
benötigt wird.<br />
Die Idee e<strong>in</strong>er europäischen ‚Jugendpolitik’ bleibt zerbrechlich <strong>und</strong> fließend: sie steht<br />
noch <strong>in</strong> den Anfängen ihrer Entwicklung <strong>und</strong> zu viel Bestimmtheit <strong>und</strong> Verordnung wären<br />
nicht nur unklug, sondern auch unpassend.<br />
107
Dennoch wurde beim Treffen der Europäischen Jugendm<strong>in</strong>ister für die Jugend <strong>in</strong> Bukarest<br />
im Jahre 1998 e<strong>in</strong> Entwurf der ‚Jugendpolitik des Europarats’ offiziell formuliert, der<br />
die folgenden Punkte be<strong>in</strong>haltet:<br />
• Jungen Menschen zu helfen, die Herausforderungen zu meistern, denen sie sich<br />
gegenüber sehen, <strong>und</strong> ihre Ambitionen zu verwirklichen.<br />
• Die staatliche Geme<strong>in</strong>schaft zu stärken durch Vorbereitung auf e<strong>in</strong> demokratisches<br />
Umfeld <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em nicht formalistischen Bildungskontext.<br />
• Junge Menschen zur Mitwirkung <strong>in</strong> der Gesellschaft zu ermutigen.<br />
• Die Entwicklung von Jugendpolitik zu unterstützen.<br />
• Möglichkeiten zu suchen, um die Jugendmobilität <strong>in</strong> Europa zu fördern<br />
Das ist e<strong>in</strong> hilfreicher Ansatz. Seit damals gab es e<strong>in</strong>e Vielzahl weiterer bedeutsamer<br />
Entwicklungen.<br />
Das Gr<strong>und</strong>gerüst der Europäischen ‚Jugendpolitik’ – sechs zentrale<br />
Entwicklungen<br />
Es gibt natürlich zahlreiche ‚Wegweiser’, die ich hätte auswählen können, beispielsweise die<br />
Lehrgänge des Europarats für junge Leute zu Menschenrechten <strong>und</strong> <strong>in</strong>terkulturellem Lernen<br />
oder die Unterstützung der Europäischen Union für die Entwicklung junger Unternehmen.<br />
Die Auswahl, die ich getroffen habe, steht daher nicht für alle Initiativen, sondern<br />
ist vor allem bezeichnend für zentrale Stationen auf dem Weg zu e<strong>in</strong>em umfassenderen,<br />
verb<strong>und</strong>enen <strong>und</strong> <strong>in</strong>sbesondere verstandenen jugendpolitischen Gr<strong>und</strong>gerüst für Europa.<br />
Innerhalb der Europäischen Union gab es das ‚Weißbuch Jugend’, den europäischen<br />
‚Pakt für die Jugend’ <strong>und</strong> das Programm Europäische ‚Jugend <strong>in</strong> Aktion’. Egal welchen<br />
Kritiken sich das im Jahre 2001 aufgelegte Weißbuch ausgesetzt sah, es war absolut kritisch<br />
h<strong>in</strong>sichtlich se<strong>in</strong>er symbolischen Botschaft zur Bedeutung junger Menschen <strong>in</strong> der breiteren<br />
europäischen Agenda. E<strong>in</strong>ige se<strong>in</strong>er verme<strong>in</strong>tlichen Mängel wurden tatsächlich im<br />
Rahmen des Europäischen Jugendpakts (2005) berücksichtigt, was die Konzentration der<br />
EU auf junge Menschen <strong>in</strong> Bezug auf Fragen der Wettbewerbsfähigkeit, des Wachstums<br />
<strong>und</strong> des <strong>sozialen</strong> Zusammenhalts verstärkte. „Das ist das erste Mal, dass Jugendpolitik so<br />
deutlich auf EU-Ebene hervorgehoben wurde“, wurde auf der Website der EU erklärt.<br />
Und das Programm ‚Jugend <strong>in</strong> Aktion für 2007-2013’ baut fest auf den vorhergehenden<br />
praktischen europäischen Jugendprogrammen auf, ist aber bezeichnenderweise auch damit<br />
beschäftigt, die jugendpolitische Kooperation stärker zu unterstützen, sowohl durch den<br />
‚strukturierten Dialog’ mit jungen Menschen als auch durch e<strong>in</strong>e stabilere Liaison mit dem<br />
Europarat <strong>und</strong> den Vere<strong>in</strong>ten Nationen.<br />
Beim Europarat gibt es jetzt e<strong>in</strong>e riesige Liste von Verpflichtungserklärungen, die <strong>in</strong><br />
mehreren aufe<strong>in</strong>ander folgenden Treffen der europäischen M<strong>in</strong>ister für Jugend abgegeben<br />
wurden. Neben den oben aufgeführten geht es um e<strong>in</strong>e ganze Reihe von Problemkreisen<br />
wie Geschlechtergleichheit, gefährdete <strong>Jugendliche</strong>, Jugendmobilität, Jugendunternehmen,<br />
Berufsausbildung <strong>und</strong> so weiter. E<strong>in</strong> zweiter zentraler Aspekt der jugendpolitischen Arbeit<br />
des Rates s<strong>in</strong>d se<strong>in</strong>e <strong>in</strong>ternationalen Bewertungen nationaler Jugendpolitik. Dreizehn solcher<br />
Bewertungen s<strong>in</strong>d bisher durchgeführt worden, drei weitere s<strong>in</strong>d direkt im Anschluss<br />
geplant. Diese haben e<strong>in</strong>e wichtige Wissensgr<strong>und</strong>lage für jugendpolitische Aktivitäten <strong>in</strong><br />
108
e<strong>in</strong>er Reihe verschiedener Länder geschaffen. Sie haben außerdem e<strong>in</strong>e ‚Synthese’ des vorhandenen<br />
Materials ermöglicht, <strong>in</strong>dem nationale <strong>und</strong> <strong>in</strong>ternationale Berichte verglichen <strong>und</strong><br />
gegenübergestellt wurden, um e<strong>in</strong> Gr<strong>und</strong>gerüst für die Kartierung der Jugendpolitik <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
europäischen Kontext herzustellen (siehe Williamson 2002). Dieser Prozess hat auch<br />
e<strong>in</strong>ige ‚Bewertungen’ der Effektivität von Jugendpolitik hervorgebracht – um zu sehen, ob<br />
sich die Rhetorik, wie sie häufig von der zentralen Regierungsverwaltung kommt, vor Ort<br />
tatsächlich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e nützliche <strong>und</strong> effektive Praxis verwandelt. Diese Bewertungen erstrecken<br />
sich auf Untersuchungen zur Reichweite (sowohl <strong>in</strong> Bezug auf die Geographie als auch auf<br />
spezifische Gruppen von <strong>Jugendliche</strong>n), Kapazität (ob oder ob nicht passende Strukturen<br />
für die Umsetzung existieren), Kompetenz (die Fähigkeiten derer, die dafür verantwortlich<br />
s<strong>in</strong>d, auf junge Menschen zuzugehen), Koord<strong>in</strong>ation (horizontal über Bereiche der Politik<br />
h<strong>in</strong>weg <strong>und</strong> vertikal zwischen zentralen, regionalen <strong>und</strong> lokalen Verwaltungen) <strong>und</strong> Kosten<br />
(die personellen <strong>und</strong> f<strong>in</strong>anziellen Ressourcen, die für die Aufgabe zur Verfügung stehen).<br />
Der dritte Strang der jugendpolitischen Arbeit des Europarats ist, dass diese öffentlichen<br />
<strong>in</strong>ternationalen Bewertungen von vertraulicheren ‚Beratungsmissionen’ <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Reihe von<br />
Ländern ergänzt werden. Sie haben sehr spezifische Besorgnisse im Zusammenhang mit<br />
der Jugendpolitik angesprochen <strong>und</strong> das Verständnis der Art von jugendpolitischen Herausforderungen<br />
<strong>in</strong> verschiedenen Kontexten verstärkt.<br />
Seit der Jahrtausendwende verb<strong>in</strong>det sich die Jugendaktivität der Europäischen Union<br />
<strong>und</strong> des Europarates zusehends zu e<strong>in</strong>em formellen partnerschaftlichen Arrangement, das<br />
2005 Problemkreise wie Ausbildung, Forschung <strong>und</strong> Jugendkooperation im europäischen<br />
Mittelmeerraum <strong>in</strong> Angriff nahm. Die kritischen Fragen bewegen sich ausnahmslos um drei<br />
Punkte:<br />
• Arbeitsmarktbeteiligung <strong>und</strong> Beschäftigungsfähigkeit<br />
• Beteiligung, bürgerliche Gesellschaft <strong>und</strong> demokratische Erneuerung<br />
• Soziale Integration <strong>und</strong> E<strong>in</strong>beziehung<br />
Es gibt natürlich weiter reichende europäische Herausforderungen, bei denen die Jugendagenda<br />
offensichtlich e<strong>in</strong>en wichtigen Platz e<strong>in</strong>nimmt. Dazu gehören globale wirtschaftliche<br />
Wettbewerbsfähigkeit, Menschenrechte, der Generationenvertrag, Mobilität <strong>und</strong><br />
Migration sowie <strong>in</strong>terkulturelle Toleranz <strong>und</strong> Verständnis.<br />
Von der Politik zur Praxis<br />
Obwohl ich heute e<strong>in</strong>en Großteil me<strong>in</strong>er Zeit darauf verwende, auf der politischen Ebene<br />
zu arbeiten, ist me<strong>in</strong> persönlicher Werdegang doch sehr <strong>in</strong> der Praxis verankert. Ich habe<br />
mehr als 25 Jahre mit <strong>Jugendliche</strong>n gearbeitet. Darüber h<strong>in</strong>aus war me<strong>in</strong>e Forschungsarbeit<br />
häufig ‚handlungsorientiert’ <strong>und</strong> be<strong>in</strong>haltete Studien zu Jugendvergehen, Jugendarbeitslosigkeit,<br />
Drogenmissbrauch, Jugendunternehmen, Schulverweise, sozialer Ausgrenzung sowie<br />
die Auswertung politischer Initiativen. Ich fühle mich zutiefst verpflichtet, die Qualität<br />
unserer ‚Angebote’ an stärker benachteiligte <strong>und</strong> ausgegrenzte <strong>Jugendliche</strong> zu verbessern,<br />
diejenigen, die für mich immer die ‚Abgekoppelten’ (nicht die Entfremdeten) waren.<br />
Dies ist das Jahr der Kampagne „Alle Anders - Alle Gleich“ des Europarats, die sich mit<br />
Vielfalt, Menschenrechten <strong>und</strong> Beteiligung beschäftigt. Wir wissen, dass das Langzeitziele<br />
s<strong>in</strong>d. Wir müssen sicher se<strong>in</strong>, dass unsere Politik, die sich an weniger gleichberechtigte Ju-<br />
109
gendliche richtet, diese auch wirklich erreicht. Wenn sie von den besser gestellten weggeschnappt<br />
wird, dann haben wir versagt <strong>und</strong> tatsächlich sogar zur Verschlimmerung der<br />
Spaltung der Jugend beigetragen. Daher müssen wir Mechanismen f<strong>in</strong>den, die sicherstellen,<br />
dass die Politik die Abgekoppelten motiviert, <strong>und</strong> das kann kaum mit Hilfe von kurzen<br />
Zeitabschnitten, großen A-Priori-Behauptungen von großem Erfolg <strong>und</strong> e<strong>in</strong>em offenen<br />
Angebot erreicht werden. Daraus ergeben sich viele Fragen h<strong>in</strong>sichtlich der Gr<strong>und</strong>lage für<br />
die f<strong>in</strong>anzielle Unterstützung politischer Initiativen, ihre Zeitpläne <strong>und</strong> vielleicht auch die<br />
Notwendigkeit e<strong>in</strong>er festeren Zielsetzung für Maßnahmen. Letztendlich geht es jedoch<br />
darum, Chancen <strong>und</strong> Erfahrungen bis zu den <strong>Jugendliche</strong>n zu transportieren, denen sie<br />
derzeit verweigert werden.<br />
Das im Laufe der Zeit <strong>und</strong> über Ländergrenzen h<strong>in</strong>weg gesammelte Wissen zeigt, dass<br />
die zentralen Faktoren für soziale Integration <strong>und</strong> E<strong>in</strong>beziehung auf vier Zusammenhängen<br />
basieren: dem Individuum, der Familie, der Schule <strong>und</strong> der Geme<strong>in</strong>schaft. Das sollte e<strong>in</strong>igermaßen<br />
selbstverständlich se<strong>in</strong>. Aber wo e<strong>in</strong> genereller Mangel an Unterstützung <strong>und</strong><br />
Anleitung für das Lernen <strong>und</strong> die Entwicklung herrscht, gibt es zwangsläufig auch e<strong>in</strong>en<br />
Mangel an Ergebnissen, sowohl für das Individuum als auch für die Menschen <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er<br />
Umgebung.<br />
Was also sollte ‚Jugendpolitik’ an dieser Front unternehmen? Me<strong>in</strong>e Ansicht lautet wie<br />
folgt:<br />
1. Wir müssen den Mythos begraben, dass Bildung <strong>und</strong> Arbeit irgende<strong>in</strong>e Form von<br />
‚natürlicher’ Verb<strong>in</strong>dung haben sollten. Sie s<strong>in</strong>d zunehmend vone<strong>in</strong>ander getrennt,<br />
<strong>und</strong> zwar <strong>in</strong> der H<strong>in</strong>sicht, dass Engagement <strong>und</strong> Leistung <strong>in</strong> der formellen Bildung<br />
das Versprechen von Chancen auf dem Arbeitsmarkt mit angemessenen Qualifikationen<br />
mit sich br<strong>in</strong>gen. Wir müssen das Gleichgewicht von akademischer, beruflicher<br />
<strong>und</strong> ziviler Ausbildung überdenken. Wir müssen die Beziehungen zwischen<br />
formellen <strong>und</strong> nicht-formellen Lernmethoden <strong>und</strong> -kontexten betrachten. Wir müssen<br />
fragen, wie wichtig es ist, dass Qualifikationen Glaubwürdigkeit <strong>und</strong> Wert besitzen<br />
(wofür <strong>und</strong> für wen). Und wir müssen sicherstellen, dass es zweite (<strong>und</strong> dritte)<br />
Chancen gibt, um zum Lernen zurückzukehren. Vor allem müssen die Bildung<br />
<strong>und</strong> das Lernen für den Lernenden relevant <strong>und</strong> s<strong>in</strong>nvoll se<strong>in</strong>, auch wenn die<br />
Gründe für se<strong>in</strong> Engagement sehr unterschiedlich se<strong>in</strong> können.<br />
2. Wir müssen viel stärker über die Unterstützung für Berufsausbildung, Arbeitsmarkt<br />
<strong>und</strong> Unternehmens<strong>in</strong>itiativen seitens des öffentlichen Sektors nachdenken. Viele<br />
junge Menschen fühlen sich vom Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt des privaten<br />
Sektors ausgeschlossen. Weder sie noch die Gesellschaft möchten, dass sie ohne<br />
‚Beschäftigung’ oder von Sozialhilfe leben, auch wollen wir nicht irgende<strong>in</strong>e Form<br />
von ‚bevorm<strong>und</strong>ender Demokratie’ <strong>in</strong> Betracht ziehen (wie es von e<strong>in</strong>igen <strong>in</strong> den<br />
USA vorgeschlagen wird), <strong>in</strong> der wir e<strong>in</strong> sicheres Leben vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> des<br />
massiven Wegsperrens anderer absichern können. Auch ist es dr<strong>in</strong>gend notwendig,<br />
öffentlichen Arbeitsprogrammen für junge Arbeitslose <strong>und</strong> dem Gleichgewicht<br />
zwischen Arbeit <strong>und</strong> Leben bei Beschäftigten stärkere Aufmerksamkeit zu schenken.<br />
110
3. Wir müssen die Vorstellung von ‚zielgerichteten’ Freizeitaktivitäten für junge Menschen<br />
auf den Prüfstand stellen. Diese müssen nicht unbed<strong>in</strong>gt organisiert oder offiziell<br />
anerkannt se<strong>in</strong>! Doch sie müssen darauf ausgerichtet se<strong>in</strong>, jungen Leuten zu<br />
ermöglichen, sich nicht für e<strong>in</strong>en zerstörerischen Lebensstil als Option zu entscheiden,<br />
wie beispielsweise Drogenmissbrauch oder Krim<strong>in</strong>alität.<br />
4. Wir müssen junge Menschen während der Phase des Heranwachsens ständig begleiten<br />
<strong>und</strong> dafür Sorge tragen, dass das Austauschen geme<strong>in</strong>samer Erfahrungen mit anderen<br />
unterstützt wird: mit solchen sowohl aus privilegierten als auch benachteiligten<br />
Umfeldern, solchen mit anderen Glaubensbekenntnissen <strong>und</strong> anderem ethnischen<br />
H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong>, solchen aus städtischen <strong>und</strong> aus ländlichen Gebieten.<br />
5. Es muss rechtzeitige Angebote für junge Menschen geben, die sich <strong>in</strong> ihrem Leben<br />
‚Problemen’ gegenüber sehen.<br />
6. Es muss rechtzeitige Antworten an junge Menschen geben, die <strong>in</strong> ihrem Leben<br />
‚Probleme’ schaffen.<br />
7. Schließlich müssen wir der Frage nach Zugangsmöglichkeiten zu Chancen <strong>und</strong> Erfahrung<br />
viel stärkere Aufmerksamkeit schenken. Wir müssen mehr tun, als e<strong>in</strong>fach<br />
nur e<strong>in</strong>en ermöglichenden Kontext anzubieten („du kannst mitmachen, wenn du<br />
willst“) <strong>und</strong> Wege f<strong>in</strong>den, e<strong>in</strong>en versichernden Kontext anzubieten („das ist es, was<br />
alle jungen Menschen probieren sollten“).<br />
Die Milltown-Jungs<br />
1973 traf ich zufällig e<strong>in</strong>e Gruppe junger Teenager aus e<strong>in</strong>em ‚<strong>sozialen</strong> Brennpunkt’. Ich<br />
verbrachte fünf Jahre mit ihnen, teils als Jugendarbeiter, teils als Forscher. Ich ‚h<strong>in</strong>g’ mit<br />
ihnen den ganzen Tag über rum. Sie waren e<strong>in</strong>e frühe Gruppe der ‚Abgekoppelten’. Sie<br />
verließen die Schule mit niedrigen, meist gar ke<strong>in</strong>en Abschlüssen. Sie alle hatten Vorstrafen.<br />
Im Jahr 2000, 27 Jahre später, nahm ich e<strong>in</strong>e größere Anzahl der ‚Milltown-Jungs’ wieder<br />
<strong>in</strong>s Visier. Ich erfuhr, dass sieben (von 67) schon tot waren, bevor sie 40 wurden. Ke<strong>in</strong>er<br />
von ihnen war aufgr<strong>und</strong> von natürlichen Todesursachen gestorben. Auf der anderen<br />
Seite war es etwa e<strong>in</strong>em Drittel recht gut ergangen, deshalb merkte ich <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>leitung zu<br />
me<strong>in</strong>em Buch (Williamson 2004) an, dass ihre Geschichte genauso e<strong>in</strong>e Anlass zum Feiern<br />
des Erfolgs wie auch zur Anteilnahme am Versagen ist. Doch es ist auch e<strong>in</strong>e unglückliche<br />
Geschichte – e<strong>in</strong>e von Langzeitarbeitslosigkeit, Krim<strong>in</strong>alität, Abhängigkeiten, zerbrochenen<br />
Beziehungen, Verlust vom Kontakt mit <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> so weiter. Ich b<strong>in</strong> davon überzeugt,<br />
dass, wenn e<strong>in</strong>e stärkere Politik diese Individuen <strong>in</strong> ihren früheren Zeiten erreicht hätte,<br />
vielen von ihnen zu e<strong>in</strong>em positiveren Pfad durch ihr Leben hätte verholfen werden können.<br />
Ohne jegliche Unterstützung müssen viele der Milltown-Jungs noch immer versuchen,<br />
im Leben zurecht zu kommen. Wie Cloward <strong>und</strong> Ohl<strong>in</strong> (1960) berichteten, reagieren junge<br />
Menschen <strong>in</strong> unterschiedlicher Weise auf das, was sie als ‚Struktur der blockierten Chancen’<br />
bezeichneten. E<strong>in</strong>ige (e<strong>in</strong> beträchtlicher Anteil) entscheiden sich für die Krim<strong>in</strong>alität, um<br />
übliche Ambitionen <strong>in</strong> illegaler Form zu verwirklichen. Andere (e<strong>in</strong>e bedeutsame M<strong>in</strong>derheit)<br />
geben auf <strong>und</strong> ziehen sich <strong>in</strong> die Alkohol- <strong>und</strong> Drogenabhängigkeit zurück. Andere<br />
(wenn auch nur sehr wenige!) fordern das System durch politisches Handeln heraus. Diese<br />
111
theoretische Position klang <strong>in</strong> me<strong>in</strong>er Studie der Milltown-Jungs klar <strong>und</strong> deutlich an. Sie<br />
verweist auf die Notwendigkeit, positive Strukturen legitimer Chancen durch e<strong>in</strong>e Partnerschaft<br />
aus privater <strong>und</strong> öffentlicher Politik zu unterstützen, wo immer es möglich ist.<br />
Zusammenfassung<br />
Es gibt ke<strong>in</strong>en Zauberstab für soziale E<strong>in</strong>beziehung <strong>und</strong> Kohäsion auf der lokalen Ebene,<br />
ebenso wenig wie es e<strong>in</strong>e natürliche Vorlage für e<strong>in</strong> jugendpolitisches Gr<strong>und</strong>gerüst auf der<br />
Europa-Ebene gibt. Doch es existiert e<strong>in</strong>e wesentliche Verb<strong>in</strong>dung zwischen beiden: lokale<br />
Initiativen können die breitere politische Gr<strong>und</strong>struktur nicht ignorieren, genauso wie die<br />
europäische Agenda die Notwendigkeit e<strong>in</strong>er effektiven lokalen Umsetzung nicht verleugnen<br />
kann.<br />
Es gibt jedoch e<strong>in</strong>ige f<strong>und</strong>amentale Vorbed<strong>in</strong>gungen, wenn wir angemessene Maßnahmen<br />
sowohl <strong>in</strong> Politik als auch <strong>in</strong> der Praxis durchsetzen wollen. Zunächst ist es unbed<strong>in</strong>gt<br />
erforderlich, die Besonderheiten des Übergangszustandes der Jugend <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>enen<br />
Probleme zu verstehen. Diese funktionieren auf unterschiedliche <strong>und</strong> komplexe<br />
Art h<strong>in</strong>sichtlich ihrer E<strong>in</strong>flüsse <strong>und</strong> ihrer Ergebnisse. Wir müssen die Art <strong>und</strong> Weise der<br />
Herausforderungen, denen sich verschiedene junge Menschen gegenübersehen, <strong>und</strong> die<br />
daraus gezogenen Erfahrungen wie auch die tatsächlichen <strong>und</strong> zu erwartenden Konsequenzen<br />
dieser Prozesse erfassen, <strong>und</strong> zwar auf persönlicher <strong>und</strong> kultureller Ebene genauso wie<br />
auf sozialer <strong>und</strong> wirtschaftlicher Ebene. Kriterien, die häufig Außenstehenden verborgen<br />
bleiben, können e<strong>in</strong>e entscheidende Rolle bei der Ausprägung von Wahlmöglichkeiten <strong>und</strong><br />
bei der Motivierung zu Engagement spielen.<br />
Der damit verb<strong>und</strong>ene zweite Punkt ist der, dass großartige Strategien, die auf ‚objektiven’,<br />
von oben verordneten' Bestrebungen <strong>und</strong> Analysen basieren (wie etwa die Schaffung<br />
e<strong>in</strong>er ‚auf Wissen basierten Wirtschaft’), mit den eher ‚subjektiven’, von unten nach oben<br />
gehenden' Erwartungen <strong>und</strong> Perspektiven abgestimmt werden müssen. Kurz, das Strukturelle<br />
muss mit dem Kulturellen übere<strong>in</strong>stimmen.<br />
Wenn wir e<strong>in</strong> Europa wollen, das durch E<strong>in</strong>beziehung <strong>und</strong> Zusammenhalt charakterisiert<br />
ist, dann wird es unerlässlich se<strong>in</strong>, Zugangsmöglichkeiten <strong>und</strong> Chancen für junge<br />
Menschen zu schaffen, die sie sich nicht mit Hilfe der Unterstützung durch ihre Familie<br />
sichern können. Und wir müssen sicherstellen, dass wir die richtigen jungen Menschen an<br />
den richtigen Orten erreichen <strong>und</strong> ihnen e<strong>in</strong> vernünftiges <strong>und</strong> glaubwürdiges Angebot machen.<br />
Sonst werden wir unausweichlich zur <strong>sozialen</strong> Spaltung beitragen, <strong>in</strong>dem wir Chancen<br />
erweitern, diese dann aber unverhältnismäßig stark von jungen Leuten wahrgenommen<br />
werden, die ohneh<strong>in</strong> schon weitgehend im richtigen Umfeld leben, <strong>und</strong> diejenigen auf der<br />
anderen Seite noch immer weit h<strong>in</strong>ter sich lassen.<br />
112
Literatur<br />
Cloward, L. and Ohl<strong>in</strong>, R. (1960): Del<strong>in</strong>quency and Opportunity, London: Routledge and<br />
Kegan Paul<br />
Lauritzen, P. and Guidikova, I. (2002): ‘European Youth Development and Policy: The<br />
Role of NGOs and Public Authority <strong>in</strong> the Mak<strong>in</strong>g of the European Citizen’, <strong>in</strong><br />
R. Lerner, F. Jacobs and D. Wertlieb (eds), Handbook of Applied Developmental<br />
Science 3, London: Sage, S. 363-382<br />
Marris, P. and Re<strong>in</strong>, M. (1972): Dilemmas of Social Reform, Harmondsworth: Pengu<strong>in</strong><br />
Williamson, H. and Weatherspoon, K. (1985): Strategies for Intervention: an approach to<br />
youth and community work <strong>in</strong> an area of social deprivation, University College Cardiff:<br />
E<strong>in</strong>heit für Sozialforschung.<br />
Williamson, H. (2002): Support<strong>in</strong>g young people <strong>in</strong> Europe: pr<strong>in</strong>ciples, policy and practice,<br />
Strasbourg: Europarat<br />
Williamson, H. (2004): The Milltown Boys Revisited, Oxford: Berg<br />
113
Dr. Christian Lüders, <strong>Deutsches</strong> Jugend<strong>in</strong>stitut e.V. München<br />
Versuch e<strong>in</strong>er ersten Zwischenbilanz<br />
Im Mittelpunkt dieser Tagung standen nationale Strategien zur<br />
Verbesserung der Lebenslagen junger Menschen <strong>in</strong> benachteiligten<br />
Stadtgebieten. H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> hierzu waren unsere Erfahrungen <strong>und</strong><br />
Ergebnisse aus der wissenschaftlichen Begleitung der beiden<br />
deutschen B<strong>und</strong>esprogramme „Entwicklung <strong>und</strong> Chancen junger<br />
Menschen <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong>“ (E & C) <strong>und</strong> „Lokales<br />
Kapital für soziale Zwecke“ (LOS).<br />
Nicht m<strong>in</strong>der wichtig waren die Ergebnisse der beiden vorangegangen, auf diesem<br />
Kongress schon mehrfach erwähnten Tagungen <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> <strong>und</strong> Straßburg18 . Auf beiden Tagungen<br />
wurden <strong>in</strong>tegrierte Strategien <strong>in</strong> den Mittelpunkt gestellt. Wir g<strong>in</strong>gen dabei von der<br />
e<strong>in</strong>fachen Annahme aus, dass die Probleme <strong>in</strong> den Stadtteilen nicht von e<strong>in</strong>em Akteur alle<strong>in</strong><br />
gelöst werden können, sondern dass es der koord<strong>in</strong>ierten, zielgenauen Abstimmung<br />
zwischen alle<strong>in</strong> verantwortlichen <strong>und</strong> beteiligten Akteuren bedarf, also vor allem der Schule,<br />
der außerschulischen Jugendarbeit, der Wirtschaft <strong>und</strong> den Ausbildungs<strong>in</strong>stanzen, der<br />
Stadtplanung, der Polizei <strong>und</strong> Justiz, dem Ges<strong>und</strong>heitssystem sowie den jeweiligen privaten<br />
<strong>und</strong> halböffentlichen Initiativen vor Ort.<br />
Auf beiden Tagungen wurden unter der Überschrift „<strong>in</strong>tegrierte Strategien“ e<strong>in</strong>e ganze<br />
Reihe von <strong>in</strong>teressanten Projekten vorgestellt <strong>und</strong> wichtige Erfahrungen berichtet. Deutlich<br />
wurde dabei vor allem, dass die Beantwortung der Frage, wer mit wem jeweils zusammenarbeitet,<br />
wo es welche Schwierigkeiten gibt oder wo gar die Abstimmung <strong>und</strong> die Kooperation<br />
scheitern, offenbar etwas mit den jeweiligen nationalen Strukturen zu tun hat. Sichtbar<br />
wurde, dass nicht nur die jeweiligen lokalen Problemkonstellationen, sondern auch<br />
• die Art <strong>und</strong> Weise, wie Verantwortlichkeiten organisiert werden,<br />
• welche Akteure wie verankert s<strong>in</strong>d <strong>und</strong><br />
• welche praktischen Zuständigkeiten gegeben s<strong>in</strong>d<br />
offenbar großen E<strong>in</strong>fluss auf die Art der Problemlösung <strong>und</strong> ihre Erfolgsaussichten hat.<br />
Dies brachte uns auf die Idee, e<strong>in</strong>en Schritt weiterzugehen.<br />
Auf diesem Kongress g<strong>in</strong>g es deshalb nicht nur um die Präsentation <strong>in</strong>teressanter Projekte,<br />
sondern eben auch um die gleichsam dah<strong>in</strong>terstehenden nationalen Strategien <strong>und</strong><br />
um die Darstellung der entsprechenden Rahmenbed<strong>in</strong>gungen, <strong>in</strong> die diese Projekte unvermeidlich<br />
e<strong>in</strong>gebettet s<strong>in</strong>d. Damit verb<strong>und</strong>en war weniger e<strong>in</strong> akademisches Interesse, etwa<br />
im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es Systemvergleichs, als vielmehr e<strong>in</strong> praktisches <strong>und</strong> politisches Interesse.<br />
18 Informationen zu diesen beiden Konferenzen erhalten Sie unter: http://www.berl<strong>in</strong>process.eu/<strong>in</strong>formation.html<br />
114
Wir g<strong>in</strong>gen davon aus, dass<br />
• die Übertragbarkeit von Erfahrungen <strong>und</strong> Konzepten nur funktionieren kann,<br />
wenn man die Rahmenbed<strong>in</strong>gungen gut bis sehr gut kennt, aus denen heraus<br />
die Ergebnisse <strong>und</strong> Konzepte übertragen werden sollen.<br />
• H<strong>in</strong>zu kommt, <strong>und</strong> ich gestehe, dass ich an dieser Stelle e<strong>in</strong> besonderes Interesse<br />
habe, dass die Evaluationen von Projekten auch nur dann aussagefähige Ergebnisse<br />
präsentieren können, wenn präzise herausgearbeitet worden ist, unter<br />
welchen Voraussetzungen diese zustande gekommen s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> unter welchen<br />
Voraussetzungen Praxiskonzepte sich bewährt haben bzw. Praxiskonzepte gescheitert<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
Dieser Zuschnitt hat dazu geführt, dass wir alle Referent<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Referenten dieses<br />
Kongresses im Vorfeld mit unserer Bitte etwas quälen mussten, diese Aspekte ausführlicher,<br />
als dies sonst üblich ist, zu berücksichtigen. Ihnen allen, die trotzdem bereit waren,<br />
hier ihre Projekte zu präsentieren <strong>und</strong> zum Gel<strong>in</strong>gen des Kongresses beigetragen haben,<br />
gilt deshalb me<strong>in</strong> herzlicher Dank.<br />
Versucht man vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> <strong>in</strong> aller Vorläufigkeit <strong>und</strong> noch vor der Präsentation<br />
der Ergebnisse aus den Workshops e<strong>in</strong>e Bilanz zu ziehen, ist der erste E<strong>in</strong>druck zunächst<br />
e<strong>in</strong>mal überwältigend. Überwältigend deshalb, weil h<strong>in</strong>ter allen hier vorgestellten<br />
Projekten e<strong>in</strong> je spezifisches, sehr komplexes nationales Bed<strong>in</strong>gungsgefüge sichtbar wurde.<br />
Augenfällig wurde, dass wir es auf Seiten der jungen Menschen nicht nur mit höchst heterogenen<br />
Problemlagen <strong>und</strong> Ursachen zu tun haben, sondern auch mit nur aus dem jeweiligen<br />
nationalen Kontext heraus verständlichen Strategien – <strong>und</strong> dies <strong>in</strong> nahezu jeder H<strong>in</strong>sicht,<br />
also h<strong>in</strong>sichtlich der <strong>in</strong> den Blick genommenen Zeithorizonte, bis wann nachhaltige<br />
Lösungen greifen sollten, der Beteiligung bzw. Nicht-Beteiligung wichtiger Akteure (z. B.<br />
der Schule), der personellen <strong>und</strong> f<strong>in</strong>anziellen Ausstattung, der wirksamen politischen Rückendeckung<br />
etc.<br />
Daneben lieferten die Präsentationen e<strong>in</strong>e Fülle von Anregungen <strong>und</strong> Anlässen, die eigene<br />
Praxis zu überdenken. Beispielhaft erwähne ich nur zwei, die mir bei me<strong>in</strong>en Besuchen<br />
<strong>in</strong> den Workshops aufgefallen s<strong>in</strong>d, die aber vielleicht auch mehr über mich oder über<br />
unsere deutsche Diskussion aussagen, als über das Problem selbst. Sie selbst mögen ganz<br />
andere wichtige Lehren gezogen haben.<br />
• Die polnische Präsentation, die sehr stark auf die Probleme junger Menschen<br />
im ländlichen Raum fokussiert war, machte deutlich, dass unser eigener Ausgangspunkt,<br />
junge Menschen <strong>in</strong> benachteiligten Stadtteilen, möglicherweise jugendpolitisch<br />
betrachtet e<strong>in</strong> bisschen zu eng geschnitten ist. Wir könnten Gefahr<br />
laufen, die weniger auffälligen, vielleicht nicht so medienwirksamen Probleme<br />
junger Menschen auf dem Land, zu vernachlässigen. Und ich er<strong>in</strong>nerte<br />
mich daran, dass es zu Beg<strong>in</strong>n des Programms E & C <strong>in</strong> Deutschland e<strong>in</strong> eigenes<br />
Modul für den ländlichen Raum gab, das aber später ke<strong>in</strong>e Fortsetzung<br />
fand.<br />
• Nachdenklich gemacht hat mich die Vorstellung e<strong>in</strong>es Projektes aus der Tschechischen<br />
Republik, <strong>in</strong> dessen Mittelpunkt die Arbeit mit S<strong>in</strong>ti- <strong>und</strong> Roma-<br />
Familien <strong>und</strong> -<strong>Jugendliche</strong>n stand. Die besondere fachliche Herausforderung<br />
bestand dar<strong>in</strong>, dass die Adressatengruppe nicht sesshaft war. Auch die Projekte<br />
aus Litauen <strong>und</strong> aus England arbeiteten mit solchen <strong>Jugendliche</strong>n. Damit waren<br />
mit e<strong>in</strong>em Schlag viele sonst selbstverständliche Voraussetzungen fachlichen<br />
115
Handelns (bis h<strong>in</strong> zur Frage fester Bürozeiten) <strong>in</strong> Frage gestellt, wenn nicht so<br />
gar h<strong>in</strong>fällig. Es ist ke<strong>in</strong> weiter Weg, ausgehend von den Erfahrungen dieses<br />
Projektes die zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> Deutschland geführte Debatte zur so genannten Sozialraumorientierung,<br />
e<strong>in</strong>em fachlichen Pr<strong>in</strong>zip, das vielen <strong>in</strong>tegrierten Strategien<br />
unausgesprochen zugr<strong>und</strong>e liegt, zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> Bezug auf e<strong>in</strong>ige Zielgruppen<br />
zu problematisieren.<br />
Sie alle werden ähnliche Beispiele nennen können.<br />
Abstrakt gesprochen, waren dies Anlässe zur Komplexitätssteigerung. Erwiesen sich die<br />
<strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> <strong>und</strong> Straßburg vorgestellten Strategien schon für sich genommen als relativ voraussetzungsvoll,<br />
ergänzten die Präsentationen hier <strong>in</strong> Leipzig das Bild um e<strong>in</strong>ige weitere<br />
wichtige <strong>und</strong> <strong>in</strong> jedem Fall zu bedenkende Voraussetzungen. So wichtig <strong>und</strong> richtig diese<br />
Aufforderungen, es sich nicht zu e<strong>in</strong>fach zu machen, auch s<strong>in</strong>d, so sehr erwischte ich mich<br />
auch das e<strong>in</strong> oder andere Mal bei dem Gedanken: Oh, je, wie soll man das alles <strong>in</strong> den Griff<br />
bekommen? Und dabei dachte ich weniger an me<strong>in</strong>e Aufgabe, e<strong>in</strong>e erste Zwischenbilanz zu<br />
ziehen, obwohl das selbstredend dadurch nicht leichter wurde, sondern vor allem an unser<br />
Anliegen, der EU-Kommission umsetzbare Empfehlungen als Ergebnis des Kongresses<br />
vorlegen zu wollen.<br />
Das rettende Ufer wurde sichtbar, als gestern Abend <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Vorgespräch aus den Arbeitsgruppen<br />
berichtet wurde <strong>und</strong> ohne den Ergebnissen aus den Arbeitsgruppen vorzugreifen,<br />
die im Folgenden vorgestellt werden, möchte aus me<strong>in</strong>er Sicht drei wichtige Lehren<br />
aus dem Kongress ziehen:<br />
1. Der Kongress hat gezeigt, dass dort, wo es ressortübergreifende nationale Strategien<br />
gibt, <strong>in</strong>tegrierte Ansätze vor Ort besser funktionieren. Wichtig sche<strong>in</strong>t dabei<br />
die Beteiligung der jeweils <strong>in</strong> der Sache verantwortlichen Ressorts zu se<strong>in</strong>. Zweifelsohne<br />
werden damit hohe Ansprüche formuliert, <strong>und</strong> Howard Williamson hat<br />
gerade noch e<strong>in</strong>mal <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Beitrag deutlich gemacht, welche Probleme damit<br />
verb<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d. Immerh<strong>in</strong> hat der Kongress auch gezeigt, dass es funktionieren<br />
kann, <strong>und</strong> es wird darauf ankommen, genauer h<strong>in</strong>zusehen, welche die Gel<strong>in</strong>gensbed<strong>in</strong>gungen<br />
auf nationaler Ebene s<strong>in</strong>d.<br />
2. Die Erfahrungen e<strong>in</strong>er ganzen Reihe von hier vorgestellten Projekten legen den<br />
Schluss nahe, dass dabei nicht nur die staatlichen Akteure beteiligt werden müssen,<br />
sondern soweit als möglich auf gleicher Augenhöhe – wobei die politische Letztverantwortung<br />
auf Seiten des Staates verbleiben muss – die nicht-staatlichen Akteure,<br />
also sowohl die NGO’s <strong>und</strong> lokalen Initiativen als auch, <strong>und</strong> dies wird immer wieder<br />
vergessen, die private Wirtschaft.<br />
3. Es bedarf nationaler Verfahren, die sensibel auf lokale Bed<strong>in</strong>gungen antworten <strong>und</strong><br />
den Akteuren vor Ort genügend Spielraum für e<strong>in</strong>e eigenverantwortliche lokale<br />
Umsetzung gewährleisten. Globale Fonds <strong>und</strong> Mikroprojekte, die vor Ort gesteuert<br />
<strong>und</strong> ausgestaltet werden, sche<strong>in</strong>en dabei wichtige Elemente darzustellen. Zu der<br />
sensiblen Berücksichtigung der Bed<strong>in</strong>gungen vor Ort gehört auch das Thema Beteiligung.<br />
Wir wissen, dass Projekte, die Beteiligung der Betroffenen von Beg<strong>in</strong>n an<br />
vorsehen, erfolgreicher s<strong>in</strong>d, als re<strong>in</strong>e, wenn auch gut geme<strong>in</strong>te Top-Down-<br />
Beglückungsprojekte.<br />
116
Erlauben Sie mir zum Schluss schließlich zwei Überlegungen, die an verschiedenen Stellen<br />
auf diesem Kongress auftauchten <strong>und</strong> mich nachdenklich stimmen. Wenn wir von<br />
nationalen Strategien sprechen, provoziert dies unweigerlich die Frage, was wie erreicht<br />
werden soll. Häufig bleibt dabei die Frage, wie eigentlich die Zielgruppen def<strong>in</strong>iert werden.<br />
Denn den unterschiedlichen Ressorts liegen sehr heterogene Perspektiven zugr<strong>und</strong>e. Was<br />
aus der Sicht der Schule als Schulschwänzen ersche<strong>in</strong>en mag, betrachtet die Polizei als Sicherheitsproblem,<br />
die Sozialarbeit als ungelöste Adoleszenzproblematik <strong>und</strong> die Arbeitsverwaltung<br />
als Unfähigkeit zur Integration auf dem Arbeitsmarkt. Wenn nun aber ressortübergreifend<br />
Strategien abgestimmt <strong>und</strong> entschieden werden sollen, stellt sich die Frage,<br />
wer das Sagen hat, welche Kriterien das jeweilige Vorgehen prägen. Daraus ergibt sich e<strong>in</strong>e<br />
zweite bohrende Frage, <strong>und</strong> e<strong>in</strong> Kollege aus Schweden hat sie vorher schon kurz angerissen:<br />
Wird nicht die Idee, sich auf klar def<strong>in</strong>ierte Zielgruppen beziehen zu sollen, angesichts<br />
der Probleme, mit denen wir es <strong>in</strong> den Stadtteilen <strong>und</strong> den vernachlässigten ländlichen Regionen<br />
zu tun haben, selbst zu e<strong>in</strong>em Problem?<br />
Das jedoch ist e<strong>in</strong> neues weites Feld für das nächste Mal.<br />
117
Dr. Susann Burchardt, Dr. Heike Förster, Tatjana Mögl<strong>in</strong>g<br />
Integrationsstrategien für benachteiligte <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong><br />
– wohlfahrtsstaatlicher Kontext sowie programm-<br />
<strong>und</strong> problemspezifische E<strong>in</strong>flussfaktoren<br />
Wie e<strong>in</strong>leitend betont, werden die Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für die Entwicklung <strong>und</strong> Umsetzung<br />
von Förderprogrammen <strong>und</strong> Strategien für benachteiligte <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> <strong>in</strong><br />
den europäischen Ländern von den jeweils vorherrschenden wohlfahrtsstaatlichen Kontexten<br />
geprägt. Dieser Kontext bee<strong>in</strong>flusst die gr<strong>und</strong>sätzlichen gesellschaftlichen Ziele, Orientierungen<br />
<strong>und</strong> Bewertungen dieser Strategien im Rahmen sozial- bzw. jugendpolitischer<br />
Anstrengungen sowie das quantitative Ausmaß von Förder- <strong>und</strong> Integrationsangeboten für<br />
benachteiligte <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>. So unterscheiden sich Förderstrategien z. B. abhängig<br />
davon, ob <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Land eher fürsorgende Merkmale, im S<strong>in</strong>ne der Bereitstellung von<br />
Unterstützungsleistungen, die Sozial- bzw. Jugendpolitik dom<strong>in</strong>ieren oder aktivierende, im<br />
S<strong>in</strong>ne der Gewährleistung von Chancen <strong>und</strong> Möglichkeiten für benachteiligte <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Jugendliche</strong> <strong>und</strong> deren Familien. Je nachdem, welche gr<strong>und</strong>sätzlichen wohlfahrtsstaatlichen<br />
Orientierungen vorherrschen, werden unterschiedliche gesellschaftliche Ressourcen für die<br />
Umsetzung der Programme e<strong>in</strong>bezogen. So ist es beispielsweise wahrsche<strong>in</strong>licher, dass <strong>in</strong><br />
den südeuropäischen Staaten viel stärker auf familienbezogene Ressourcen orientiert wird,<br />
da die Fürsorge durch die Familie e<strong>in</strong> zentrales Moment <strong>in</strong> den dort vorherrschenden<br />
Wohlfahrtsorientierungen darstellt.<br />
In H<strong>in</strong>blick auf die sozialistischen Wurzeln wohlfahrtsstaatlicher Orientierungen der<br />
ost- <strong>und</strong> südosteuropäischen Länder ist ebenfalls davon auszugehen, dass diese nationale<br />
Programme, beispielsweise zur Integration ethnischer M<strong>in</strong>derheiten, bee<strong>in</strong>flussen. Stark<br />
fürsorgende, aber auch paternalistische Momente s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> diesen Ländern viel wahrsche<strong>in</strong>licher<br />
als <strong>in</strong> stark <strong>in</strong>dividualistisch orientierten, wirtschaftsliberalen Ländern wie Großbritannien.<br />
In Anlehnung an Esp<strong>in</strong>g-Andersen <strong>und</strong> Holtmann (Esp<strong>in</strong>g-Anderson 1990, Holtmann<br />
2006) mit e<strong>in</strong>er Erweiterung um die osteuropäischen Staaten lassen sich die teilnehmenden<br />
EU-Länder entsprechend ihrer gr<strong>und</strong>legenden, historisch gewachsenen wohlfahrtsstaatlichen<br />
Orientierungen folgenden Idealtypen zuordnen:<br />
118
Familistisch Statuskonservierend,<br />
berufsständig <strong>und</strong><br />
erwerbsorientiert<br />
Portugal<br />
Italien<br />
Deutschland<br />
Frankreich<br />
Zentrale wohlfahrtsstaatliche Merkmale<br />
FamilienorientierteWohlfahrtsorganisation,ausgeprägtefürsorgende<br />
Momente<br />
im bei familienbezogenerLeistungen<br />
für stark<br />
Bedürftige,<br />
Subsidiarität<br />
Erwerbsorientiertes<br />
Sozialversicherungssystem,<br />
starke Sozialverbände,<br />
ausgeprägte<br />
Fürsorgeorientierung,<br />
Subsidiarität<br />
Wirtschaftsliberal<br />
Großbritannien<br />
Irland<br />
Ausgeprägte<br />
Orientierung auf<br />
freiwillige,<br />
marktförmig<br />
organisierte Hilfeleistungen<br />
für<br />
stark Bedürftige<br />
Sozialdemokratisch<br />
Skand<strong>in</strong>avische<br />
Staaten – nicht<br />
vertreten<br />
Starker Sozialstaat<br />
zuständig<br />
für soziale<br />
Sicherheit,<br />
Staatsbürgerrecht<br />
Ehemals<br />
Sozialistische<br />
Länder<br />
Litauen, Polen<br />
Polen, Ungarn<br />
Tschechien<br />
Staatlich<br />
organisier-<br />
te Hilfe-<br />
leistungen,<br />
Entwicklung<br />
wohlfahrtsstaatlicherOrientierungen<br />
noch offen<br />
Die europäischen wohlfahrtstaatlichen Systeme – also auch die der teilnehmenden Staaten<br />
auf der hier dokumentierten Fachtagung – stehen momentan unter starkem Veränderungsdruck,<br />
da sozioökonomische <strong>und</strong> demografische Entwicklungen zur Beschleunigung<br />
von Armutsentwicklungen, starken Migrationsbewegungen sowie <strong>sozialen</strong> <strong>und</strong> räumlichen<br />
Segregationsprozessen beitragen. Die Dr<strong>in</strong>glichkeit der Probleme führt dazu, dass auf der<br />
Ebene der Programme <strong>und</strong> Strategien der teilnehmenden europäischen Staaten bei der<br />
Bekämpfung sozialer Benachteiligung von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n die jeweiligen wohlfahrtstaatlichen<br />
Orientierungen teilweise aufweichen. Dazu tragen verschiedene Entwicklungen<br />
<strong>und</strong> Veränderungen auf der europäischen Ebene bei. So auch die zunehmende Erwerbstätigkeit<br />
von Frauen, die, <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen Ländern unterschiedlich ausgeprägt, die<br />
Ausgestaltung der <strong>sozialen</strong> Sicherungssysteme bee<strong>in</strong>flusst. Der europäische Austausch über<br />
die Ländergrenzen h<strong>in</strong>weg, der durch die <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> <strong>und</strong> Straßbourg angeregten Entwicklungen<br />
e<strong>in</strong>er europäischen Jugendpolitik <strong>und</strong> Fachtagungen wie der vorliegend dokumentierten<br />
<strong>in</strong>tensiviert wurde, hat ebenfalls e<strong>in</strong>en Anteil daran, dass es zu konzeptionellen Annäherungen<br />
kommt, die teilweise zunehmend unabhängiger von den wohlfahrtstaatlichen<br />
Traditionen ihre Wirkungen entfalten. Familistisch orientierte Staaten entwickeln Strukturen<br />
die vermittelnd zwischen Staat <strong>und</strong> familialer Leistungserbr<strong>in</strong>gung stehen <strong>und</strong> so zivilgesellschaftliche<br />
Entwicklungen fördern. Länder mit starker fürsorgender Tradition, wie<br />
Deutschland, orientieren sich um <strong>und</strong> geben aktivierenden, auf die <strong>in</strong>dividuellen Ressourcen<br />
der benachteiligten <strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n orientierten Strategien, mehr Spielraum<br />
was aber auch nicht unwesentlich damit zusammenhängt, dass der deutsche Wohlfahrtsstaat<br />
<strong>in</strong> se<strong>in</strong>er traditionellen Form immer schwieriger zu f<strong>in</strong>anzieren ist. Stark liberal orientierte<br />
Länder wie Großbritannien lassen z. B. mehr staatlichen E<strong>in</strong>fluss zu. Der <strong>in</strong> Großbritannien<br />
durch Anthony Giddens geprägte Begriff des „Dritten Weges“ der programmatisch<br />
<strong>in</strong> den Konzepten der New Labour –Strategie Tony Blairs gipfelte <strong>und</strong> weite Teile der euro-<br />
119
päischen Sozialdemokratie bee<strong>in</strong>flusste, ist Ausdruck dieser Annäherung von Gr<strong>und</strong>orientierungen<br />
des Neoliberalismus <strong>und</strong> klassischer sozialdemokratischer Wohlfahrtsvorstellungen<br />
(Giddens, 1997, 1998; D<strong>in</strong>geldey 2006).<br />
Ebenso führt die <strong>in</strong> vielen westeuropäischen Ländern, weitgehend unabhängig vom<br />
wohlfahrtsstaatlichen Kontext feststellbare Konzentration sozialer Problemlagen <strong>in</strong> bestimmten<br />
Quartieren, Stadtteilen oder ländlichen Regionen zu (sozial)räumlich orientierten<br />
Programmen, die auf europäischer Ebene vergleichbar s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> Annäherungen auf der<br />
konzeptionellen <strong>und</strong> der Steuerungsebene von Strategien <strong>und</strong> Programmen bewirken.<br />
Diese konzeptionelle Annäherung vor allen D<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> den westeuropäischen Staaten<br />
wurde auf der Tagung sehr deutlich.<br />
Die vorgestellten Programme der teilnehmenden Länder lassen sich grob zwei Gruppen<br />
zuordnen:<br />
a) Programme, die <strong>in</strong>haltlich übergreifend ausgerichtet <strong>und</strong> auf längere Zeiträume angelegt<br />
s<strong>in</strong>d sowie auf der nationalen Ebene als auch der lokalen <strong>und</strong> regionalen Ebene<br />
ressortübergreifend umgesetzt werden. Dazu zählten die Programme <strong>und</strong><br />
Strategien aus Großbritannien Frankreich, Portugal, Irland <strong>und</strong> Deutschland.<br />
b) Programme, die an konkreten, <strong>in</strong>haltlich deutlich abgrenzbaren Problemen ansetzen,<br />
auf der nationalen Ebene zwar <strong>in</strong> teilweise <strong>in</strong> Querschnittszusammenhängen<br />
erarbeitet werden, aber sehr ressortbezogen umgesetzt werden. Hierzu zählen die<br />
Programme aus Ungarn, Polen, Tschechien <strong>und</strong> Litauen.<br />
Es ist leicht erkennbar, dass es sich hier e<strong>in</strong>erseits um die Gruppe westeuropäischer<br />
Länder, andererseits um die osteuropäischen, ehemals sozialistischen Länder handelt.<br />
Das den westeuropäischen Ländern geme<strong>in</strong>same Merkmal ressortübergreifender Strategien<br />
<strong>und</strong> Programme ist e<strong>in</strong> sehr deutlicher H<strong>in</strong>weis darauf, dass sich angesichts ähnlicher<br />
Problementwicklungen <strong>in</strong> H<strong>in</strong>blick auf die soziale Integration von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n,<br />
<strong>in</strong> diesen Ländern die Programmbemühungen auf der Steuerungsebene konzeptionell<br />
annähern. Dies hängt im Vergleich mit den ehemals sozialistischen Ländern natürlich auch<br />
mit der längeren, <strong>und</strong> <strong>in</strong> H<strong>in</strong>blick auf die gr<strong>und</strong>sätzlichen politischen <strong>und</strong> gesellschaftlichen<br />
Orientierungen <strong>und</strong> <strong>in</strong>stitutionellen Gefüge, geme<strong>in</strong>samen Geschichte westlicher Demokratien<br />
zusammen.<br />
Nicht nur <strong>in</strong> Bezug auf den Aspekt der demokratischen Erfahrungen sondern auch <strong>in</strong><br />
H<strong>in</strong>blick auf die Herausforderungen an die wohlfahrtstaatlichen Systeme nehmen die ehemals<br />
sozialistischen Länder e<strong>in</strong>e Sonderstellung e<strong>in</strong>, die es auch bei der Bewertung der dokumentierten<br />
Programme <strong>und</strong> Förderstrategien für benachteiligte <strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong><br />
<strong>in</strong> diesen Ländern zu bedenken gilt. So s<strong>in</strong>d diese Länder im Vergleich zu den westlich geprägten<br />
Ländern ke<strong>in</strong>e klassischen E<strong>in</strong>wanderungsländer. Migrationsentwicklungen <strong>und</strong> die<br />
damit zusammenhängenden Integrationsprobleme <strong>in</strong>nerhalb von Gesellschaften haben<br />
dort e<strong>in</strong>en anderen Stellenwert. Ebenso haben sozioökonomische Entwicklungen <strong>in</strong> diesen<br />
Ländern noch nicht zu so starken räumlichen Segregationsprozessen <strong>und</strong> der Ausprägung<br />
sozialer Brennpunkte geführt, wie das <strong>in</strong> westeuropäischen Ländern der Fall ist. Die Bearbeitung<br />
von Problemen benachteiligter <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>r ist somit auf sehr spezifische<br />
E<strong>in</strong>zelaspekte gerichtet, wie zum Beispiel die Integration von Roma-<strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>in</strong> die<br />
Mehrheitsgesellschaft.<br />
120
Sehr deutlich wird, dass offenbar die Struktur der Problemlagen auch die Form der Programmumsetzungen<br />
<strong>und</strong> die politischen Maßnahmen allgeme<strong>in</strong> bee<strong>in</strong>flusst.<br />
Der E<strong>in</strong>fluss wohlfahrtsstaatlicher Rahmenbed<strong>in</strong>gungen bildete den Ausgangspunkt unserer<br />
Überlegungen. Bezogen auf die Inhalte <strong>und</strong> die konkrete regionale <strong>und</strong> lokale Umsetzung<br />
nationaler Programme zur Bekämpfung sozialer Benachteiligungen bei <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong><br />
<strong>Jugendliche</strong>n lässt sich vermuten, dass der wohlfahrtsstaatliche Kontext auf anderen Ebenen<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> anderen Zusammenhängen wirkt als <strong>in</strong> der konkreten Programmumsetzung, die<br />
von den meisten Ländervertreter/<strong>in</strong>nen vorgestellt wurde. So ist es naheliegend anzunehmen,<br />
dass es <strong>in</strong> Ländern mit starken neoliberalen Traditionen wie Großbritannien e<strong>in</strong>facher<br />
ist, Programmstrategien zu entwickeln, die die soziale Sicherheit durch e<strong>in</strong>e stärkere staatliche<br />
Verantwortlichkeit bei der Lösung sozialer Problemlagen für benachteiligte <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Jugendliche</strong> erhöhen. Eigenleistung <strong>und</strong> Eigenverantwortung der Individuen h<strong>in</strong>gegen<br />
bleiben trotzdem selbstverständlich, da sie die gesellschaftliche Wertebasis e<strong>in</strong>es liberal<br />
orientierten Wohlfahrtsystems bilden. In Ländern mit stark fürsorgerischen Wohlfahrtstraditionen<br />
s<strong>in</strong>d diese Aspekte weniger verankert <strong>und</strong> es fällt schwer dort neoliberale Elemente<br />
der Ressourcenförderung durchzusetzen.<br />
Diesen E<strong>in</strong>fluss näher zu untersuchen muss Aufgabe vergleichender sozialwissenschaftlicher<br />
Forschungen se<strong>in</strong>. Die hier dokumentierte Tagung wirft <strong>in</strong> dieser H<strong>in</strong>sicht die angedeuteten<br />
Fragen auf <strong>und</strong> liefert nur erste Anhaltspunkte.<br />
Im Folgenden soll nun auf der Gr<strong>und</strong>lage der konkreten Programmdarstellungen die<br />
Frage vertieft werden, unter welchen konkreten Bed<strong>in</strong>gungen ressortübergreifend <strong>und</strong> strategisch<br />
gehandelt wird. Dieser Punkt ersche<strong>in</strong>t uns zentral, da dieser den deutlichsten Unterschied<br />
zwischen den beiden Ländergruppen markiert, <strong>und</strong> es überwiegend Vertreter <strong>und</strong><br />
Vertreter<strong>in</strong>nen der Länder mit ressortübergreifenden Strategien <strong>und</strong> Programmen waren,<br />
die auch von erfolgreichen Programmen <strong>und</strong> Projekten berichteten.<br />
Analyse der Länder mit ressortübergreifenden Strategien<br />
Betrachtet man die wohlfahrtsstaatlichen Voraussetzungen <strong>in</strong> den Ländern mit übergreifenden<br />
Strategien näher, so zeigt sich, dass sie sehr verschiedenen Wohlfahrtsstaatstypen<br />
zuzuordnen s<strong>in</strong>d. So können Großbritannien <strong>und</strong> Irland eher dem liberalen Wohlfahrtsstaatstyp<br />
zugeordnet werden, während Deutschland <strong>und</strong> Frankreich stärker e<strong>in</strong>e konservative<br />
Ausrichtung des Sozialstaates besitzen. Portugal wiederum ist ähnlich wie andere südeuropäische<br />
Länder (Spanien, Italien) durch e<strong>in</strong> stärker familistisches System geprägt, das<br />
e<strong>in</strong>e soziale Absicherung nur <strong>in</strong> Ansätzen verwirklicht. Wir können also nicht davon ausgehen,<br />
dass e<strong>in</strong> bestimmtes wohlfahrtsstaatliches System für strategisches, ressortübergreifendes<br />
Handeln prädest<strong>in</strong>iert ist.<br />
E<strong>in</strong>es ist jedoch allen Ländern geme<strong>in</strong>sam: In den letzten 25 Jahren haben sich die<br />
räumlichen Segregationen <strong>und</strong> die <strong>sozialen</strong> Problemlagen <strong>in</strong> diesen Gebieten so verstärkt,<br />
dass e<strong>in</strong> massiver Handlungsdruck entstanden ist, dem sich die Regierungen annehmen<br />
mussten. Dies geschieht <strong>in</strong> unterschiedlichen Kontexten <strong>und</strong> mit differenzierten Programmen.<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> soll anhand weiterer Merkmale der Programme <strong>und</strong> Strategien gezeigt<br />
werden, worauf sich die Unterschiede zwischen diesen Ländern gründen.<br />
121
Als wesentliche Merkmale ersche<strong>in</strong>en uns dabei die programmatischen Ausgangspunkte,<br />
die Steuerungsverfahren, die Dauer der Umsetzung von Programmen/Strategien, die Rolle<br />
von Berichterstattung <strong>und</strong> Evaluation sowie die räumliche Orientierung der Strategien bzw.<br />
Programme.<br />
Programmatischer Ausgangspunkt<br />
Es zeigt sich, dass <strong>in</strong> allen Ländern bestimmte Problemlagen, die spezifischen Ressorts<br />
zuzuordnen s<strong>in</strong>d, als Ausgangspunkt dienten. In Frankreich <strong>und</strong> Deutschland waren städtebauliche<br />
Probleme der Ausgangspunkt. Der Verfall bestimmter Stadtgebiete <strong>und</strong> der damit<br />
verb<strong>und</strong>ene Imageverlust von Städten führten zu Programmen, die <strong>in</strong> der Folge zu<br />
ressortübergreifenden Gremien führten, die sich der Problemlagen <strong>in</strong> diesen Gebieten annehmen<br />
sollten. Dabei ist die ressortübergreifende Zusammenarbeit <strong>in</strong> Frankreich deutlich<br />
stärker ausgeprägt als <strong>in</strong> Deutschland.<br />
In Portugal war die hohe Krim<strong>in</strong>alität <strong>in</strong> bestimmten Stadtgebieten der ausschlaggebende<br />
Punkt für die Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der Lage von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong><br />
<strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> diesen. Auch hier wurde ausgehend vor dieser spezifischen Problemlage<br />
e<strong>in</strong> ressortübergreifendes Gremium geschaffen, das e<strong>in</strong> <strong>in</strong>term<strong>in</strong>isterielles Arbeiten erlaubt.<br />
In Irland waren Bildungsdefizite (hoher Anteil von <strong>Jugendliche</strong>n ohne Schulabschluss)<br />
e<strong>in</strong> Ausgangspunkt. Es wurde e<strong>in</strong>e spezielle Arbeitsgruppe für <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> soziale Inklusion<br />
geschaffen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Reihe abgestimmter Strategien entwickelt, die quer zu verschiedenen<br />
M<strong>in</strong>isterien (Bildung, Ges<strong>und</strong>heit, Justiz) liegen <strong>und</strong> geme<strong>in</strong>sam bearbeitet werden.<br />
In Großbritannien war die zwar national <strong>in</strong>itiierte, aber lokal orientierte Armutsprävention<br />
bei <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n im Rahmen der Ressourcenstärkung der Kommunen<br />
<strong>und</strong> Regionen Ausgangspunkt für die Entwicklung von Strategien, die die Bereiche Bildung,<br />
Ges<strong>und</strong>heit, Beschäftigung <strong>und</strong> Sicherheit umfassen <strong>und</strong> somit ebenfalls ressortübergreifend<br />
umgesetzt werden müssen.<br />
Es wird deutlich, dass es <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>em Land die Jugendpolitik war, die e<strong>in</strong>e solche Entwicklung<br />
angestoßen hat, sondern eher die stärkeren Ressorts wie Sicherheit, Städtebau oder<br />
Beschäftigung, die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em hohen Maß e<strong>in</strong> Interesse daran haben, dass ihre Ausgaben <strong>in</strong><br />
den nächsten Jahren nicht immer weiter steigen, sondern präventiv auf e<strong>in</strong>e Senkung der<br />
Ausgaben abzielen. Diese Bereiche s<strong>in</strong>d viel durchsetzungsfähiger, wenn es um nationale<br />
Politik geht als z. B. die bildungs- oder jugendpolitischen Ressorts, sofern sie als eigene<br />
Ressorts <strong>in</strong> den Ländern überhaupt vorhanden s<strong>in</strong>d.<br />
Steuerungsverfahren<br />
In Bezug auf die Steuerung gibt es ebenfalls unterschiedliche Praktiken, die von den wohlfahrtsstaatlichen<br />
Kontexten mit bestimmt s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong>e ausgeprägte Orientierung auf e<strong>in</strong>e<br />
lokal selbstbestimmte Programmumsetzung oder beispielsweise f<strong>in</strong>anzielle Steuerungsmomente<br />
hängen sehr eng mit liberalen Wohlfahrtskontexten zusammen. So erfolgt <strong>in</strong> Irland<br />
<strong>und</strong> Großbritannien die Steuerung über e<strong>in</strong> nationales Rahmenprogramm, welches die wesentlichen<br />
Parameter festlegt, allerd<strong>in</strong>gs viel Spielraum für e<strong>in</strong>e flexible Ausgestaltung vor<br />
Ort lässt. In Großbritannien wird über die Höhe der f<strong>in</strong>anziellen Zuweisung e<strong>in</strong> zusätzliches<br />
Steuerungselement e<strong>in</strong>gebaut. Problematisch ist <strong>in</strong> beiden Ländern, dass es zwar e<strong>in</strong>e<br />
nationale Strategie gibt, lokal e<strong>in</strong>e solche strategische Ausrichtung häufig fehlt, d.h. die<br />
122
Programme s<strong>in</strong>d zu wenig <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e konsequente lokale Politik zur Verbesserung der Lebenslagen<br />
dieser benachteiligten <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n e<strong>in</strong>gebettet. In Irland musste aus<br />
diesem Gr<strong>und</strong> über zusätzliche nationale Parameter nachgesteuert werden, um die Unterschiede<br />
der lokalen Umsetzung zu verr<strong>in</strong>gern.<br />
In Frankreich wird mit speziellen Verträgen/Contracts zwischen Zentralstaat <strong>und</strong> den<br />
auf kommunaler Ebene übergreifend handelnden Präfekturen gearbeitet. Anhand von<br />
Rahmenparametern werden Zielvere<strong>in</strong>barungen abgeschlossen <strong>und</strong> jährlich erneuert. E<strong>in</strong>er<br />
ressortübergreifenden Orientierung auf nationaler Ebene entspricht hier e<strong>in</strong>e übergreifend<br />
angelegte Arbeitsstruktur auf kommunaler Ebene.<br />
Deutschland orientiert <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em förderalen System auf e<strong>in</strong>e kooperative Steuerungskultur<br />
(E<strong>in</strong>beziehung der B<strong>und</strong>esländer) <strong>und</strong> e<strong>in</strong>en Verb<strong>und</strong> zwischen Staat <strong>und</strong> Zivilgesellschaft.<br />
Die Rahmensetzung erfolgt national, die Umsetzung <strong>in</strong> den Teilprogrammen auf<br />
der Basis von lokalen Aktionsplänen <strong>in</strong> den Kommunen. Das Netzwerk wird als Steuerungsakteur<br />
begriffen. Hier zeigt sich vor allen D<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> H<strong>in</strong>blick auf die E<strong>in</strong>beziehung<br />
zivilgesellschaftlicher Ressourcen e<strong>in</strong> deutlicher E<strong>in</strong>fluss des wohlfahrtsstaatlichen <strong>und</strong><br />
strukturellen Kontextes auf die Ausgestaltung <strong>und</strong> Umsetzung nationaler Programme.<br />
Am schwierigsten ist die Steuerung <strong>in</strong> Portugal e<strong>in</strong>zuschätzen, da im Verlauf des Programms<br />
mehrfach umgesteuert wurde <strong>und</strong> zwar von Top-down über bottom-up zu zirkulärer<br />
Steuerung bis zur jetzigen Steuerung, die <strong>in</strong>side-out verläuft. Diese Steuerung funktioniert<br />
über e<strong>in</strong>e schnellere Informations- <strong>und</strong> Entscheidungsvermittlung durch e<strong>in</strong>e Schaltstelle<br />
zwischen M<strong>in</strong>isterium <strong>und</strong> den lokalen Projekten. Dies hängt unter anderem damit<br />
zusammen, dass auch <strong>in</strong>haltlich e<strong>in</strong>e Veränderung von eher <strong>in</strong>tervenierenden zu <strong>in</strong>teragierenden<br />
Ansätzen vorgenommen wurde. Das Beispiel Portugals macht deutlich, dass Programm<strong>in</strong>itiativen<br />
auch dazu dienen, neue Steuerungsverfahren zu entwickeln <strong>und</strong> vorhandene<br />
Verfahren anzupassen <strong>und</strong> darüberh<strong>in</strong>aus somit auch ihrerseits zu e<strong>in</strong>em Wandel<br />
wohlfahrtstaatlicher Kontexte beitragen.<br />
Dauer der Umsetzung der Strategie/des Programms<br />
Die Umsetzung von Programmen, die die nationalen Strategien zur Verbesserung der Lebenssituation<br />
von benachteiligten <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n unterstützen, hat unterschiedlich<br />
lange Tradition.<br />
Die längste Umsetzung f<strong>in</strong>det sich mit dem Programm Youthreach <strong>in</strong> Irland, wo seit<br />
1988 <strong>Jugendliche</strong> ohne Abschluss wieder <strong>in</strong> Ausbildung oder Erwerbsarbeit <strong>in</strong>tegriert werden.<br />
Dieses Programm wird auch vorerst bis 2013 weiter f<strong>in</strong>anziert <strong>und</strong> ist <strong>in</strong> die nationale<br />
Strategie zur <strong>sozialen</strong> Inklusion von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n e<strong>in</strong>gebettet.<br />
Den Children’s F<strong>und</strong> <strong>in</strong> Großbritannien gibt es seit 2000 <strong>und</strong> er wird <strong>in</strong> der bisherigen<br />
Form bis 2008 fortgeführt <strong>und</strong> soll dann <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Children’s Trust umgewandelt werden.<br />
Maßnahmen im Rahmen der Strategie ‚Children’s Act’ gibt es <strong>in</strong> Großbritannien allerd<strong>in</strong>gs<br />
schon seit 1989.<br />
In Frankreich gibt es seit 1996 Programme, die auf die <strong>sozialen</strong> Brennpunkte ausgerichtet<br />
s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> sich <strong>in</strong> unterschiedlichen Kontexten an <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> wenden. Im<br />
Jahr 2003 wurde das Gesetz zur Neuorientierung der Stadtpolitik verabschiedet, <strong>in</strong> dessen<br />
123
Rahmen die nationale Beobachtungsstelle verschiedene Indikatoren aus den Bereichen Beschäftigung,<br />
Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Bildung erhebt <strong>und</strong> auswertet.<br />
In Deutschland begannen 1998 die ersten städtebaulichen Programme auf nationaler<br />
Ebene, das Programm „Entwicklung <strong>und</strong> Chancen junger Menschen <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong>“<br />
begann 2000 <strong>und</strong> lief 2006 aus. E<strong>in</strong>zelne Bauste<strong>in</strong>e dieser Programmplattform<br />
werden jedoch weiterh<strong>in</strong> fortgeführt. So soll das Programm ‚Lokales Kapital für soziale<br />
Zwecke’ auch <strong>in</strong> der nächsten ESF-Förderperiode 2007 bis 2013 gefördert werden. Das<br />
städtebaulich orientierte Kontextprogramm „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf<br />
– Die soziale Stadt“ wird auf jeden Fall bis 2009 weiter gefördert.<br />
Portugal begann 2001 mit e<strong>in</strong>igen wenigen <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong> <strong>und</strong> baute se<strong>in</strong> Programm<br />
‚Escolhas’ auf derzeit 120 Standorte aus. Die Förderung dieses Programms ist auf<br />
jeden Fall bis 2009 geplant.<br />
An allen Beispielen wird sichtbar, dass es sich um e<strong>in</strong>e Förderung über e<strong>in</strong>en längeren<br />
Zeitraum handelt. An dieser Stelle kann auf der Gr<strong>und</strong>lage der vorliegenden Informationen<br />
nicht entschieden werden, welche Laufzeiten von Programmen sich als effektiv <strong>und</strong> wirkungsvoll<br />
erweisen, aber klar ist, dass Entwicklungen <strong>in</strong> diesen <strong>Brennpunkten</strong> mit e<strong>in</strong>er<br />
Laufzeit von weniger als fünf Jahren nicht erreicht werden können. Auszugehen ist vielmehr<br />
davon, dass es längerer Förderung bedarf, wenn man nachhaltige Effekte <strong>und</strong> nicht<br />
Strohfeuer erzielen will.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs zeigen Beispiele wie Irland auch, dass es e<strong>in</strong> Zusammenspiel mit den anderen<br />
Ressorts bedarf, denn die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss wird sich ohne e<strong>in</strong>e<br />
Veränderung des Schulsystems <strong>in</strong> Irland nicht verr<strong>in</strong>gern <strong>und</strong> es läuft am Ende auf e<strong>in</strong>e<br />
Daueraufgabe des Staates h<strong>in</strong>aus, diejenigen zu re<strong>in</strong>tegrieren, die ihren Abschluss nicht<br />
schaffen. Besser wäre präventiv umzusteuern <strong>und</strong> die Bed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> den Bildungse<strong>in</strong>richtungen<br />
selbst zu verändern.<br />
Zu bedenken s<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> H<strong>in</strong>blick auf die Laufzeiten auch verschiedene Funktionen<br />
von Programmen <strong>und</strong> Strategien. So vere<strong>in</strong>igte E&C <strong>in</strong> Deutschland vor allen D<strong>in</strong>gen<br />
Modellprojekte <strong>und</strong> -programme unter se<strong>in</strong>em Dach, die aufgr<strong>und</strong> der förderalen Struktur<br />
<strong>in</strong> Deutschland nur Anregungsfunktion haben dürfen <strong>und</strong> somit per se kürzere Laufzeiten<br />
haben. Programme wie LOS, erreichten aufgr<strong>und</strong> des feststellbaren Erfolges <strong>und</strong> der Fördermöglichkeiten<br />
über den ESF e<strong>in</strong>e gewisse Langfristigkeit. Youthreach <strong>in</strong> Irland war<br />
strukturell als langfristiges Programm gedacht, um Defiziten des nationalen Bildungssystems<br />
zu begegnen.<br />
124
Rolle der Berichterstattung <strong>und</strong> Evaluation<br />
Das Thema der Berichterstattung <strong>und</strong> Evaluation hängt sehr eng mit der realisierten Steuerungspraxis<br />
der Länder zusammen.<br />
In Großbritannien, wo die Zuweisung f<strong>in</strong>anzieller Ressourcen auf der Gr<strong>und</strong>lage bestimmter<br />
Kriterien erfolgt, müssen diese Kriterien auch messbar se<strong>in</strong>, d.h. e<strong>in</strong>e Evaluation<br />
<strong>und</strong> Berichterstattung ist dafür unerlässlich. Die Evaluation von Outcomes <strong>in</strong> verschiedenen<br />
Handlungsfeldern ist zentraler Bestandteil des gesamten Programms. Dabei beruht die<br />
Evaluation teils auf wissenschaftlich erhobene Daten, teils auf Daten <strong>und</strong> Berichterstattungen<br />
der Kommunen selbst.<br />
In Irland wird das Programm von Beg<strong>in</strong>n an wissenschaftlich evaluiert. Dabei handelt es<br />
sich um e<strong>in</strong>e formative Evaluation, d.h. die Ergebnisse werden <strong>in</strong> den Prozess e<strong>in</strong>gespeist<br />
<strong>und</strong> führen zu e<strong>in</strong>er Veränderung (Verbesserung) des Programms. Die Steuerung hatte<br />
aufgr<strong>und</strong> dieser Evaluation die Möglichkeit auf sehr unterschiedliche Entwicklungen <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>zelnen Gebieten zu reagieren <strong>und</strong> stärkere Parameter zu entwickeln, die solche Ungleichgewichte<br />
verr<strong>in</strong>gern konnten. E<strong>in</strong>e Mischung aus externer <strong>und</strong> <strong>in</strong>terner Evaluation<br />
verbesserte die Akzeptanz bei den Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> den Projekten.<br />
In Frankreich ist das Vorgehen etwas anders. Dort wird über e<strong>in</strong>e nationale Beobachtungsstelle<br />
e<strong>in</strong>e Reihe von relevanten Indikatoren erfasst <strong>und</strong> e<strong>in</strong> jährlicher Bericht erstellt,<br />
der die Problemlagen formuliert <strong>und</strong> als Gr<strong>und</strong>lage für die Entwicklung von Maßnahmen<br />
<strong>und</strong> Programmen auf nationaler Ebene dient. Die Evaluation des vorgestellten Programms<br />
ist bislang noch im Entwicklungsstadium.<br />
In Deutschland wurde das Programm „Entwicklung <strong>und</strong> Chancen junger Menschen <strong>in</strong><br />
<strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong>“ wissenschaftlich begleitet, aber aufgr<strong>und</strong> se<strong>in</strong>es Plattformcharakters<br />
nicht im strengen S<strong>in</strong>ne evaluiert. E<strong>in</strong>zelne Bauste<strong>in</strong>e aus diesem Programm wurden<br />
jedoch extern evaluiert, <strong>und</strong> deren Ergebnisse mit anderen – vergleichbaren – Maßnahmen<br />
kontrastiert.<br />
Räumliche Orientierung der Programme/Strategien<br />
In den letzten zwanzig Jahren haben sich die Problemlagen von benachteiligten <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n<br />
<strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n verschärft. Es wurde deutlich, dass nicht nur die <strong>in</strong>dividuellen <strong>und</strong> familiären<br />
Voraussetzungen e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluss auf die Entwicklungschancen dieser <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Jugendliche</strong>n haben, sondern, dass zunehmend das räumliche Niveau, <strong>in</strong> dem sie leben zu<br />
e<strong>in</strong>em zusätzlichen Benachteiligungsfaktor wird (vgl. Burgers et al. 2003 , Reutl<strong>in</strong>ger et al.<br />
2007).<br />
Dieser Situation wurde <strong>in</strong> den europäischen Ländern unterschiedlich Rechnung getragen.<br />
In den von uns hier vorgestellten Ländern Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal<br />
<strong>und</strong> Deutschland wurden Strategien entwickelt, die e<strong>in</strong>en sehr konkreten Bezug zu diesen<br />
benachteiligten Stadtgebieten besitzen.<br />
Auf der Gr<strong>und</strong>lage kommunaler Daten wurden <strong>in</strong> diesen Ländern Gebiete identifiziert,<br />
die ganz spezifische bauliche <strong>und</strong> <strong>in</strong>frastrukturelle, aber auch sozial- <strong>und</strong> bildungsstrukturelle<br />
Defizite aufweisen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er besonderen politischen Aufmerksamkeit <strong>und</strong> Förderung<br />
bedürfen. Dabei unterscheiden sich die Kriterien, nach denen diese Gebiete klassifiziert<br />
werden <strong>in</strong> den Ländern, je nach der Verfügbarkeit kle<strong>in</strong>räumig erhobener Daten. Allen<br />
125
geme<strong>in</strong>sam ist jedoch, dass die Notwendigkeit erkannt wurde, <strong>in</strong> diesen Gebieten mit sehr<br />
spezifischen Programmen wirksam zu werden.<br />
E<strong>in</strong> Blick auf die E<strong>in</strong>zelprogramme im Rahmen dieser Strategien zeigt, dass e<strong>in</strong> gewisses<br />
Maß an Flexibilität bei der Umsetzung dieser Strategien vorhanden se<strong>in</strong> muss. So wird der<br />
Childrens F<strong>und</strong> <strong>in</strong> Großbritannien auf der kommunalen Ebene aktiv <strong>und</strong> legt je nach den<br />
lokalen Bedarfen die Zielgruppen für e<strong>in</strong>e Förderung fest. Dabei müssen diese nicht unbed<strong>in</strong>gt<br />
aus e<strong>in</strong>em benachteiligten Stadtgebiet kommen, sondern die vorab festgelegten Kriterien<br />
der Bedürftigkeit erfüllen. Damit wirkt man der Problematik entgegen, außerhalb der<br />
ausgewiesenen Stadtgebiete lebende benachteiligte <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> systematisch<br />
von der Förderung auszugrenzen.<br />
Dieses Beispiel zeigt, dass e<strong>in</strong>e Orientierung auf soziale Räume, die besondere Bedarfe<br />
haben, sehr notwendig <strong>und</strong> wichtig ist, dass allerd<strong>in</strong>gs der Blick für die Benachteiligten außerhalb<br />
dieser Gebiete nicht verloren gehen darf. Sozialräumliche Strategien s<strong>in</strong>d nicht<br />
streng geografisch auszurichten sondern müssen an den <strong>sozialen</strong> Bezugspunkten der benachteiligten<br />
<strong>Jugendliche</strong>n ansetzen.<br />
Analyse der Länder mit stärker ressortbezogenen Strategien<br />
Die wohlfahrtsstaatlichen Voraussetzungen <strong>in</strong> den Ländern mit stärker ressortbezogenen<br />
Strategien s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie durch e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same sozialistische Vergangenheit geprägt<br />
<strong>und</strong> können dem so genannten ex-sozialistischen Wohlfahrtsregime (vgl. Holtmann 2006)<br />
zugeordnet werden.<br />
Die wohlfahrtsstaatlichen Arrangements haben <strong>in</strong> den osteuropäischen Ländern aufgr<strong>und</strong><br />
der sozialistischen Vergangenheit e<strong>in</strong>en stark autoritär-paternalistischen Charakter.<br />
Der Staat versprach e<strong>in</strong>e umfassende soziale Versorgung „von der Wiege bis zum Grab“<br />
<strong>und</strong> vermittelte der Bevölkerung das Gefühl, komplett abgesichert zu se<strong>in</strong>. Es gab drei<br />
gr<strong>und</strong>legende Säulen des wohlfahrtsstaatlichen Arrangements <strong>in</strong> der sozialistischen Epoche:<br />
das „Recht auf Arbeit“, umfassende staatliche Sozialleistungsprogramme <strong>und</strong> die staatliche<br />
Garantie stabiler Verbraucherpreise (vgl. Gött<strong>in</strong>g/Lessenich 1998). So fungierten die<br />
staatlichen Betriebe im staatspaternalistischen Wohlfahrtsstaat als umfassende sozialpolitische<br />
Agenturen, die für ihre Mitarbeiter die Ges<strong>und</strong>heitsversorgung gewährleisteten, <strong>K<strong>in</strong>der</strong>betreuungse<strong>in</strong>richtungen<br />
unterhielten, Wohnraum zuwiesen, Erholungsmöglichkeiten<br />
organisierten, die betriebliche Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung garantierten usw. (Ferge 1979:<br />
118ff., Offe 1994: 112f.)<br />
Mit der seit 1989 sich vollziehenden ‚Transformation’ im Osten beg<strong>in</strong>nt auch die Umorientierung<br />
auf e<strong>in</strong>e marktwirtschaftliche Steuerung. Im Zuge dessen erkennt man <strong>in</strong> diesen<br />
Ländern die Notwendigkeit e<strong>in</strong>er ausdifferenzierten Sozialpolitik. Der <strong>in</strong>stitutionelle<br />
Umbau ist eher, wie David Stark (1995) dies für den osteuropäischen Fall formuliert hat,<br />
e<strong>in</strong>e „bricolage“ aus Altem <strong>und</strong> Neuem, nicht e<strong>in</strong>e Realisierung von Konzepten, die am<br />
„grünem Tisch“ neu entworfen s<strong>in</strong>d, oder die getreue Kopie von westlichen Vorbildern.<br />
Deshalb soll die folgende wohlfahrtsstaatliche Zuordnung der momentan auf der Pfadsuche<br />
bef<strong>in</strong>denden Länder als e<strong>in</strong> Versuch betrachtet werden.<br />
So können die Tschechische Republik <strong>und</strong> Ungarn eher e<strong>in</strong>em konservativen Wohlfahrtsstaatstyp<br />
zugeordnet werden, die ihre <strong>sozialen</strong> Sicherungs<strong>in</strong>stitutionen nach deutsch-<br />
126
österreichischem Vorbild entwickeln. Polen folgt stärker e<strong>in</strong>er liberalen Ausrichtung des<br />
Sozialstaates <strong>und</strong> Litauen orientiert sich nach eigenen Aussagen an den skand<strong>in</strong>avischen<br />
Ländern <strong>und</strong> verfolgt e<strong>in</strong> sozial-demokratisches Versicherungsmodell welches eher dem<br />
deutschen Modell ähnelt, setzt aber derzeit eher e<strong>in</strong>e liberale Politik um.<br />
E<strong>in</strong>e aktuelle wohlfahrtsstaatliche Ausrichtung kann aufgr<strong>und</strong> der noch weitgehenden<br />
Unbestimmtheit noch ke<strong>in</strong>en erkennbaren E<strong>in</strong>fluss auf die konkreten Strategien <strong>und</strong> Programme<br />
für benachteiligte <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> haben. Vielmehr ist der deutliche E<strong>in</strong>fluss<br />
der staatsozialistischen Vergangenheit viel deutlicher zu spüren. Es bleibt abzuwarten,<br />
<strong>in</strong> welcher Weise sich die wohlfahrtstaatlichen Arrangements <strong>in</strong> den osteuropäischen Ländern<br />
entwickeln <strong>und</strong> wie davon abhängig sozialstaatliche Programme für benachteiligte<br />
<strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> zukünftig ausgestaltet <strong>und</strong> umgesetzt werden.<br />
E<strong>in</strong>en starken E<strong>in</strong>fluss hat offenbar die Art <strong>und</strong> Weise der Problemwahrnehmung durch<br />
die politischen Verantwortlichen.<br />
So s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den westeuropäischen Ländern die Programme für benachteiligte <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Jugendliche</strong> viel strategischer ausgerichtet. In Osteuropa h<strong>in</strong>gegen wird eher ad hoc, ohne<br />
große Strategie, auf die auftretenden „E<strong>in</strong>zel“ Probleme reagiert. Und man muss eher von<br />
e<strong>in</strong>em kurzfristigen Reagieren als von strategischem Agieren ausgehen. Zudem ist für diese<br />
Länder typisch, dass die meisten Angebote sich <strong>in</strong> der Regel an alle <strong>Jugendliche</strong>n richten<br />
<strong>und</strong> diese werden von den meisten von ihnen auch angenommen. Die Angebote unterschiedlicher<br />
Wohlfahrtse<strong>in</strong>richtungen differenzieren nicht <strong>in</strong> sozial benachteiligte <strong>und</strong> nicht<br />
benachteiligte <strong>Jugendliche</strong>. Das heißt nicht, dass man nicht auf soziale Unterschiede bei<br />
den Angeboten reagiert. So gibt es bei e<strong>in</strong>igen Angeboten, beispielsweise im Freizeitbereich,<br />
Zuschüsse für <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> aus benachteiligten Familien.<br />
Die vorgestellten nationalen Strategien <strong>und</strong> Programme dieser Länder sollen nun, entsprechend<br />
dem Vorgehen <strong>in</strong> H<strong>in</strong>blick auf die westeuropäischen Länder die eher ressortübergreifend<br />
<strong>und</strong> strategisch handeln, genauer betrachtet <strong>und</strong> mite<strong>in</strong>ander verglichen werden.<br />
Wichtig ist hierbei, osteuropäische Spezifika <strong>und</strong> Rahmenbed<strong>in</strong>gungen zu verdeutlichen,<br />
um zu e<strong>in</strong>er seriösen Bewertung der vorgestellten Programme zu kommen.<br />
Programmatischer Ausgangspunkt<br />
In den oben erwähnten osteuropäischen Ländern dienten sehr spezifische Problemlagen als<br />
Ausgangspunkt für die Entwicklung <strong>und</strong> Umsetzung der vorgestellten nationalen Programme.<br />
In Ungarn ist das Engagement <strong>in</strong> der <strong>in</strong>formellen Ökonomie wie <strong>in</strong> anderen postkommunistischen<br />
Ländern e<strong>in</strong> überaus bedeutender Faktor der Wohlfahrtsproduktion geblieben<br />
(vgl. Gött<strong>in</strong>g/Lessenich 1998: 302), was zu spezifischen <strong>sozialen</strong> Problemlagen führt.<br />
Nur e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>ger Teil der erwerbsfähigen Bevölkerung wird durch das offizielle Beschäftigungs-<br />
<strong>und</strong> Sozialsystem erfasst (grauer <strong>und</strong> schwarzer Markt). Diese Tatsache diente als<br />
Ausgangspunkt für die Umsetzung des Programms zur Verbesserung der beruflichen Integration<br />
vor allem gut ausgebildeter junger Menschen <strong>in</strong> extrem strukturschwachen Regionen.<br />
In Polen s<strong>in</strong>d besonders die ländlichen Räume unterentwickelt. Dort beobachtet man<br />
e<strong>in</strong>en starken Bevölkerungsrückgang vor allem von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n im Alter<br />
127
von sieben bis 18 Jahren. Für diese Regionen wurde deshalb e<strong>in</strong> nationales Programm zur<br />
Angleichung der Bildungschancen von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n vor allem mit Angeboten<br />
im Bereich der außerschulischen Bildung <strong>in</strong>s Leben gerufen.<br />
In der Tschechischen Republik <strong>und</strong> Litauen bef<strong>in</strong>den sich <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> aus<br />
Roma-Familien <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er besonders schwierigen Lebenslage. Der Schwerpunkt der nationalen<br />
Strategien liegt <strong>in</strong> diesen beiden Ländern auf Programmen zur Integration ethnischer<br />
M<strong>in</strong>derheiten (Roma) <strong>in</strong> die Mehrheitsgesellschaft: direkte Arbeit mit Roma-<strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong><br />
<strong>Jugendliche</strong>n sowie deren Familien.<br />
Steuerung<br />
Die sozialistische Vergangenheit wirkt <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie auf der Ebene der Steuerung der Programme<br />
<strong>und</strong> Förderstrategien nach.<br />
In Ungarn <strong>und</strong> Polen werden von der nationalen Ebene <strong>in</strong>itiierte Programme dezentral<br />
bzw. lokal gesteuert. In Polen werden z. B. 16 Regionalkoord<strong>in</strong>ator/<strong>in</strong>nen aus der staatlichen<br />
Zentralverwaltung rekrutiert. Es gibt aber ke<strong>in</strong>e den westlichen Ländern vergleichbare<br />
Struktur lokaler Netzwerke <strong>in</strong> den Regionen, die an der Programmumsetzung beteiligt s<strong>in</strong>d<br />
<strong>und</strong> mit den Regionalkoord<strong>in</strong>atoren bzw. der nationalen Ebene zusammenarbeiten.<br />
In Litauen wird das Programm durch das Departement für nationale M<strong>in</strong>derheiten zentral<br />
gesteuert. Dieses Departement <strong>in</strong>itiiert <strong>und</strong> koord<strong>in</strong>iert die Implementierung der Integrationsprogramme.<br />
In der Tschechischen Republik f<strong>in</strong>det die Programmsteuerung durch zwei zentrale, bei<br />
der Regierung ansässige Gremien statt: durch den Rat für Roma-Angelegenheiten <strong>und</strong> den<br />
Rat für nationale M<strong>in</strong>derheiten.<br />
In allen vier Ländern werden die Programme Top-down <strong>und</strong> wenig partizipativ umgesetzt.<br />
Die Ursachen für das Fehlen von button-up-Aktivitäten bzw. für e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge gesellschaftliche<br />
Partizipation liegen <strong>in</strong> der sozialistischen Vergangenheit der Länder begründet,<br />
die e<strong>in</strong> anderes, eher zentralistisches <strong>und</strong> paternalistisches Demokratieverständnis bed<strong>in</strong>gen.<br />
Da die Zivilgesellschaften <strong>in</strong> diesen Ländern noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen,<br />
fehlt dort e<strong>in</strong> entsprechender <strong>in</strong>stitutioneller Unterbau, der das vorhandene Engagement<br />
<strong>in</strong> gesellschaftlichen Bereichen fördern <strong>und</strong> kanalisieren kann. Somit stehen derzeit<br />
noch wenige zivilgesellschaftliche Akteure <strong>und</strong> freie Träger für die Umsetzung staatlich<br />
<strong>in</strong>itiierter Programme zur Verfügung. Der Aufbau sowohl der Zivilgesellschaften selbst als<br />
auch die Etablierung des zivilgesellschaftlichen Institutionengefüges ist e<strong>in</strong> langfristiger<br />
Prozess, der auch seitens der EU über europäische Programme zur Entwicklung von Demokratien<br />
<strong>und</strong> Zivilgesellschaften stärker gefördert werden muss.<br />
Dauer der Umsetzung der Strategie/des Programms<br />
Die Umsetzung von Programmen zur Verbesserung der Lebenssituation von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong><br />
<strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> den osteuropäischen Ländern hat noch ke<strong>in</strong>e lange Tradition. Die oben<br />
vorgestellten Programme wurden Mitte 2000 begonnen. So ist <strong>in</strong> Ungarn die Laufzeit des<br />
Programms von 2005 bis 2007, <strong>in</strong> Polen von 2006 bis 2008, <strong>in</strong> der Tschechischen Republik<br />
von 2006 bis 2008. In Litauen ist das Integrationsprogramm längerfristig konzipiert für<br />
2005 bis 2010. Während der Tagung war noch nicht e<strong>in</strong>deutig klar, ob diese Programme<br />
bzw. Themen weiterverfolgt werden. Für Ungarn gibt es die Aussage, dass bei positiver<br />
128
Evaluation e<strong>in</strong>e Weiterförderung angedacht ist. In der Tschechischen Republik ist dieses<br />
Programm <strong>in</strong> den Nationalen Aktionsplan (The Decade of Roma Inclusion 2005-2015)<br />
<strong>in</strong>tegriert <strong>und</strong> somit strukturell mit e<strong>in</strong>er gewissen Langfristigkeit versehen.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs ist auch hier zu sagen, dass es natürlich von der Struktur der Programme, von<br />
ihrer Rolle <strong>und</strong> Funktion abhängt, welche Dauer sich als erfolgversprechend herausstellt.<br />
Rolle der Berichterstattung <strong>und</strong> Evaluation<br />
Fast <strong>in</strong> allen diesen Ländern erfolgte ke<strong>in</strong>e eigene wissenschaftliche Programmevaluation.<br />
In Tschechien wurde zu Beg<strong>in</strong>n des Programms evaluiert <strong>und</strong> es wurden positive Effekte<br />
<strong>in</strong> Kommunen mit aktiven NGO’s festgestellt. In Ungarn s<strong>in</strong>d über die Vermittlungszahlen<br />
am Ende des Projektes Ergebnisse direkt messbar, denn es wurden 75 % der Teilnehmenden<br />
auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt.<br />
Um strategische Programmentwicklung realisieren zu können, s<strong>in</strong>d Evaluationen jedoch<br />
dr<strong>in</strong>gend notwendig, weil sie Informationen über die Ausgangslagen <strong>und</strong> die Effekte im<br />
Verlauf der Programme liefern <strong>und</strong> die Möglichkeit bieten im Verlauf Veränderungen <strong>in</strong><br />
der Programmstruktur oder -steuerung vorzunehmen. Auch Anschlussprogramme lassen<br />
sich besser entwickeln, wenn man über die Ergebnisse der vorherigen Programme valide<br />
Informationen besitzt. Daher ersche<strong>in</strong>en <strong>in</strong> diesen Ländern der Aufbau von nationalen<br />
Berichterstattungen <strong>und</strong> die Evaluation von E<strong>in</strong>zelprogrammen als wesentliches Ergebnis<br />
der Konferenz.<br />
Räumliche Orientierung der Programme/Strategien<br />
Nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Regime <strong>in</strong> Osteuropa s<strong>in</strong>d zunächst ähnliche<br />
Tendenzen <strong>in</strong> den meisten dieser Länder festzuhalten: die Umstrukturierung der sozialistischen<br />
Wirtschaft führte zu Verlusten an sozialer Sicherheit durch die steigende Arbeitslosigkeit.<br />
Im Ergebnis entstand <strong>in</strong> diesen Ländern e<strong>in</strong>e breite Schicht hilfebedürftiger Personen,<br />
die von den traditionellen betrieblichen Sozialleistungen ausgeschlossen wurden.<br />
(vgl. Kaufmann 2003: 80) Da diese Veränderungen große Teile der Gesellschaft bzw. fast<br />
alle Bevölkerungsschichten betrafen, konzentrieren sich die <strong>sozialen</strong> Problemlagen <strong>in</strong> diesen<br />
Ländern noch nicht auf bestimmte städtische Räume, die von den Entwicklungen der<br />
Gesamtstädte abgekoppelt ersche<strong>in</strong>en. Allerd<strong>in</strong>gs erfahren nach dem Umbruch vor allem<br />
die ländlichen Regionen e<strong>in</strong>en großen wirtschaftlichen Niedergang, der zu e<strong>in</strong>er großen<br />
Abwanderung vor allem der jüngeren Bevölkerung führt. Deshalb können die Erfahrungen<br />
mit sozialräumlich orientierten Programmen aus Westeuropa für die osteuropäischen Länder<br />
bezogen auf ländliche Regionen aber auch präventiv bei der Entwicklung von Segregationsvermeidungsstrategien<br />
<strong>in</strong> den städtischen Räumen wirksam werden.<br />
Fasst man die dargestellten Bef<strong>und</strong>e zusammen, wird Folgendes deutlich:<br />
Die Übertragung erfolgreicher nationaler Programme für benachteiligte <strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong><br />
<strong>in</strong> andere Länderkontexte ist hoch voraussetzungsvoll. Der <strong>in</strong>haltliche Austausch<br />
über die europäischen Ländergrenzen h<strong>in</strong>weg muss die jeweiligen sozialstaatlichen <strong>und</strong><br />
<strong>in</strong>stitutionellen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen berücksichtigen, die vor allen D<strong>in</strong>gen auf die Steuerungspraxis<br />
bei der Umsetzung der Programme <strong>und</strong> Strategien wirken. Entscheidend ist<br />
dies <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie bei der Entwicklung <strong>und</strong> Umsetzung entsprechender Integrationsprogramme<br />
<strong>in</strong> den ehemals sozialistischen EU-Ländern.<br />
129
Partizipative Verfahren werden hier nicht im gleichen Maße wie <strong>in</strong> den westeuropäischen<br />
Ländern angewandt, was mit den historisch noch kurzen Erfahrungen mit westlich<br />
geprägten demokratischen Verfahren zusammenhängt. Hier müssen sich zivilgesellschaftliche<br />
Strukturen <strong>und</strong> auch bestimmte <strong>in</strong>stitutionelle Strukturen vielfach erst entwickeln <strong>und</strong><br />
festigen. EU-Förderprogramme für die neuen Mitgliedsstaaten können hier ansetzen.<br />
Ressortübergreifende Strategien, wie sie für die vorgestellten westeuropäischen Programme<br />
charakteristisch s<strong>in</strong>d, können sich nur <strong>in</strong> historisch gefestigten <strong>in</strong>stitutionellen<br />
Strukturen entwickeln.<br />
Wichtig für e<strong>in</strong>en länderübergreifenden Lernprozess ist darüber h<strong>in</strong>aus, die <strong>in</strong>haltlichen<br />
Ausgangspunkte <strong>und</strong> die Struktur der vorgestellten <strong>und</strong> diskutierten Programme zu beachten<br />
um zu s<strong>in</strong>nvollen Schlussfolgerungen für die Arbeit im eigenen Land zu kommen.<br />
Sozialräumliche bzw. stadtteilorientierte Strategien s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Problemzusammenhängen wie<br />
beispielsweise der Integration nichtsesshafter Bevölkerungsgruppen (Roma/S<strong>in</strong>ti; Traveller)<br />
nicht angebracht <strong>und</strong> ebenso wenig, wenn räumliche Segregationsprozesse noch nicht<br />
zu beobachten s<strong>in</strong>d, wie dies hauptsächlich <strong>in</strong> den osteuropäischen EU-Ländern der Fall zu<br />
se<strong>in</strong> sche<strong>in</strong>t.<br />
Fazit<br />
Trotz der teilweise sehr unterschiedlichen wohlfahrtsstaatlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen sowie<br />
der programmatischen <strong>und</strong> <strong>in</strong>stitutionellen Unterschiede lassen sich aus der Analyse<br />
der vorgestellten Strategien <strong>und</strong> Programme, den Gr<strong>und</strong>satzreferaten sowie den Handlungsempfehlungen<br />
aus den e<strong>in</strong>zelnen Arbeitsgruppen e<strong>in</strong>ige zentrale Ergebnisse formulieren,<br />
die für die europäische <strong>und</strong> nationale Förderpolitik bei der Arbeit mit <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong><br />
<strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> benachteiligten Gebieten wesentlich ersche<strong>in</strong>en:<br />
Zentrale Ergebnisse <strong>und</strong> Schlussfolgerungen für die Entwicklung <strong>und</strong> Umsetzung<br />
nationaler Strategien <strong>und</strong> Programme für benachteiligte <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong><br />
130<br />
1. Die EU-Mitgliedstaaten können nur auf der Gr<strong>und</strong>lage der E<strong>in</strong>bettung regionaler<br />
<strong>und</strong> lokaler Maßnahmen <strong>in</strong> nationale Strategien langfristige <strong>und</strong> erfolgreiche<br />
Programme zur Verbesserung der Situation junger Menschen <strong>in</strong><br />
<strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong> entwickeln.<br />
Maßnahmen <strong>und</strong> Programme zur Verbesserung der Lebenslagen von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong><br />
<strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong> auf regionaler <strong>und</strong> lokaler Ebene bedürfen<br />
e<strong>in</strong>er nationalen Strategie als Rahmen, d.h. sie müssen Bestandteil e<strong>in</strong>er aktiven nationalen<br />
<strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendpolitik se<strong>in</strong>.<br />
Mit Hilfe der E<strong>in</strong>bettung der verschiedenen regionalen <strong>und</strong> lokalen Maßnahmen <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>e nationale Strategie erhalten sie e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>samen verb<strong>in</strong>dlichen <strong>und</strong> langfristigen<br />
Charakter. Sie dienen e<strong>in</strong>heitlichen nationalen Zielen, der Erfolg ihrer Umsetzung<br />
wird bezüglich der Zielerreichung kontrolliert. Mit e<strong>in</strong>em nationalen Rahmen<br />
können für die verschiedenen Maßnahmen <strong>und</strong> Programme vor Ort <strong>und</strong> <strong>in</strong> den<br />
Regionen e<strong>in</strong>heitliche, geme<strong>in</strong>same Qualitätsstandards e<strong>in</strong>gerichtet <strong>und</strong> umgesetzt<br />
werden. Darüber h<strong>in</strong>aus sollte e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>heitliches nationales <strong>und</strong> langfristig angelegtes<br />
Berichtssystem die Situation <strong>und</strong> Entwicklung <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong> <strong>und</strong> die
Integrationsbedarfe junger Menschen <strong>in</strong> diesen Gebieten aufzeigen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same<br />
Evaluation erfolgen.<br />
2. Nationale Handlungsstrategien <strong>und</strong> Programme müssen Spielräume <strong>und</strong><br />
Kompetenzen für die lokale Umsetzung enthalten.<br />
Nationale strategische Vorgaben <strong>und</strong> Programme werden <strong>in</strong> den Regionen <strong>und</strong><br />
Kommunen umgesetzt. Die lokalen Akteure müssen den konkreten Problemlagen<br />
<strong>und</strong> Bedürfnissen vor Ort Rechnung tragen <strong>und</strong> passgenaue Wege für die Realisierung<br />
von nationalen Strategien erproben <strong>und</strong> gehen können. Um nationale Handlungsstrategien<br />
flexibel auf die Bedürfnisse vor Ort abstimmen <strong>und</strong> umsetzen zu<br />
können, müssen sie Gestaltungsspielräume für die Umsetzung vor Ort enthalten.<br />
Nationale Aktionspläne werden außerdem nur dann wirksam, wenn auf der lokalen<br />
Ebene Potential zur Umsetzung vorhanden ist. Hierfür müssen die Kompetenzen<br />
für Projektbeantragung <strong>und</strong> lokales Projektmanagement gefördert <strong>und</strong> gestärkt<br />
werden.<br />
3. Handlungsstrategien <strong>und</strong> Maßnahmen müssen ressortübergreifend erarbeitet<br />
<strong>und</strong> umgesetzt werden.<br />
Die Erarbeitung <strong>und</strong> Umsetzung von Strategien <strong>und</strong> Maßnahmen zur Verbesserung<br />
der Lebenslagen von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong> ist wie<br />
die Politik für <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong>e Querschnittsaufgabe, die ressortübergreifend<br />
erfolgen muss. Alle beteiligten <strong>und</strong> angrenzenden Ressorts wie<br />
Bildung, Beschäftigung, Ges<strong>und</strong>heit, soziale Integration, Migration, Stadtentwicklung<br />
<strong>und</strong> Jugend selbst müssen <strong>in</strong> die Erarbeitung <strong>und</strong> Umsetzung nationaler Integrationsstrategien<br />
e<strong>in</strong>bezogen werden.<br />
4. Handlungsstrategien <strong>und</strong> Programme müssen partnerschaftlich erarbeitet<br />
<strong>und</strong> umgesetzt werden.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus ist die strategische <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre <strong>und</strong> partizipative E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung<br />
aller gesellschaftlichen Partner <strong>und</strong> Akteure unerlässlich. Hierzu zählen sowohl die<br />
Verbände der Jugendarbeit <strong>und</strong> Jugendberufshilfe, als auch die NGO’s <strong>und</strong> kle<strong>in</strong>en<br />
Initiativen vor Ort, die Wirtschaft <strong>und</strong> Arbeitnehmervertreter, aber auch die Familien<br />
der jungen Menschen <strong>und</strong> die jungen Menschen selbst.<br />
5. Maßnahmen <strong>und</strong> Programme müssen ganzheitlich den gesamten Lebensbereich<br />
<strong>und</strong> das breite Lebensumfeld von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n berücksichtigen<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>beziehen.<br />
Maßnahmen <strong>und</strong> Programme zur Integration von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n müssen<br />
den sie umgebenden gesamten Lebensraum, <strong>K<strong>in</strong>der</strong>betreuung <strong>und</strong> Schule,<br />
Ausbildung <strong>und</strong> Unternehmen, Infra- <strong>und</strong> Verkehrsstruktur, Wohnumfeld, Freizeite<strong>in</strong>richtungen<br />
<strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>e, aber auch die Familien e<strong>in</strong>b<strong>in</strong>den. Sozialraumorientierte<br />
Maßnahmen entwickeln passgenaue Projekte für die Probleme im Stadtteil,<br />
ohne dass die Zielgruppen zu Beg<strong>in</strong>n feststehen. Sie nehmen damit das ganze Lebensumfeld<br />
der <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Gebiet <strong>in</strong> den Blick <strong>und</strong> s<strong>in</strong>d für<br />
ganzheitliche Integrationsangebote besonders gut geeignet. Zielgruppenbezogene<br />
Ansätze eignen sich für die Erreichung von ganz spezifischen Zielgruppen. Auf europäischer<br />
Ebene haben sowohl sozialräumliche, als auch zielgruppenbezogene An-<br />
131
132<br />
sätze Erfolge gezeigt, sodass beide Ansätze empfohlen werden können. Die Komb<strong>in</strong>ation<br />
beider Ansätze hat sich als besonders Erfolg versprechend erwiesen.<br />
6. Benachteiligte <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong> brauchen zu ihrer Aktivierung stärkere<br />
Partizipationsmöglichkeiten.<br />
Gerade <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong> kommt es darauf an, nicht nur passgenaue Integrationsangebote<br />
für <strong>K<strong>in</strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>, sondern vor allem mit ihnen zu entwickeln<br />
<strong>und</strong> umzusetzen <strong>und</strong> sie dadurch <strong>in</strong> ihrem Sozialraum zu aktivieren. Es müssen<br />
Gestaltungsräume für sie selbst <strong>in</strong> den benachteiligten Gebieten geschaffen <strong>und</strong><br />
sie müssen zu Eigen<strong>in</strong>itiative <strong>und</strong> Aktivität befähigt werden. Dies muss durch e<strong>in</strong>e<br />
aktive <strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendpolitik sowohl auf der europäischen als auch auf der nationalstaatlichen<br />
Ebene befördert werden.<br />
7. Die Förderung von Kle<strong>in</strong>stprojekten durch den ESF trägt wesentlich zur Aktivierung<br />
von benachteiligten <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n bei.<br />
Das erfolgreiche europäische Instrument „Ger<strong>in</strong>ge Zuschussbeträge“ (Small<br />
Grants) 19 , die an Kle<strong>in</strong>stprojekte zur beruflichen <strong>und</strong> <strong>sozialen</strong> Integration benachteiligter<br />
Personen <strong>in</strong> verschiedenen europäischen Staaten 20 vergeben werden, sollte<br />
fortgesetzt werden. Die Umsetzung zeigt, dass gerade kle<strong>in</strong>e NGO’s <strong>und</strong> lokale Initiativen<br />
mit ihren passgenauen Angeboten <strong>und</strong> ihrer flexiblen Herangehensweise<br />
besonders gut Menschen erreichen können, die am Rande der Gesellschaft stehen<br />
<strong>und</strong> besondere Probleme auf dem Arbeitsmarkt haben. Sowohl sozialräumliche als<br />
auch adressatenbezogene Förderungen haben Erfolge gezeigt, so dass beide Ansätze,<br />
<strong>in</strong>sbesondere aber auch die Komb<strong>in</strong>ation beider Ansätze empfohlen werden<br />
können. Die von der Kommission <strong>in</strong> der neu gestarteten ESF-Förderperiode weiter<br />
empfohlene 100%-Förderung sollte auf nationaler Ebene gesichert werden, da auf<br />
der lokalen Ebene e<strong>in</strong>e Kof<strong>in</strong>anzierung nicht realisierbar ist.<br />
8. Benachteiligungen von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n müssen sowohl <strong>in</strong> benachteiligten<br />
großstädtischen, als auch <strong>in</strong> strukturschwachen ländlichen<br />
Gebieten abgebaut werden.<br />
Die Präsentationen vor allem aus den osteuropäischen Ländern geben e<strong>in</strong>en deutlichen<br />
H<strong>in</strong>weis darauf, dass Benachteiligungen <strong>in</strong> der Entwicklung von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong><br />
<strong>Jugendliche</strong>n nicht nur durch das Aufwachsen <strong>in</strong> benachteiligten großstädtischen<br />
Gebieten, sondern auch <strong>in</strong> strukturschwachen ländlichen Regionen entstehen. Deshalb<br />
zählen auch diese Gebiete zu den <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong> <strong>und</strong> es besteht auch<br />
hier e<strong>in</strong> großer Bedarf an speziellen Angeboten.<br />
9. Europäische <strong>und</strong> nationale Strategien müssen verstärkt auf die Integration<br />
junger Menschen <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong> zielen. Auf europäischer Ebene<br />
besteht die Notwendigkeit e<strong>in</strong>es kont<strong>in</strong>uierlichen Austauschs.<br />
Europäische Strategien <strong>in</strong> den Bereichen Beschäftigung, Bildung/Berufsbildung,<br />
soziale Integration, Migration, Jugend <strong>und</strong> Stadtentwicklung sollten künftig noch<br />
stärker auf die Verbesserung der Situation von <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n <strong>in</strong> sozia-<br />
19<br />
Fördergr<strong>und</strong>lage ist Artikel 4 Abs. 2 der ESF-Verordnung 1784/1999<br />
20<br />
Die Umsetzung erfolgte <strong>in</strong> der Förderperiode 2000-2006 <strong>in</strong> Deutschland, Dänemark, F<strong>in</strong>nland, Frankreich, im Vere<strong>in</strong>igten<br />
Königreich, Italien, Schweden, Spanien <strong>und</strong> der Tschechischen Republik.
Literatur<br />
len <strong>Brennpunkten</strong> zielen; europäische <strong>und</strong> nationale Politiken sollten hierfür noch<br />
stärker zusammengeführt werden.<br />
Die Teilnehmer <strong>und</strong> Teilnehmer<strong>in</strong>nen des Fachkongresses betonten <strong>in</strong>sbesondere<br />
die Notwendigkeit e<strong>in</strong>es kont<strong>in</strong>uierlichen Austauschs über politische Integrationsstrategien<br />
<strong>und</strong> -programme <strong>und</strong> deren Ergebnisse auf europäischer Ebene. Es sollten<br />
geme<strong>in</strong>same europäische Fachstandards für die Arbeit mit <strong>K<strong>in</strong>der</strong>n <strong>und</strong> <strong>Jugendliche</strong>n<br />
<strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong> entwickelt, deren Umsetzung geprüft <strong>und</strong> damit<br />
auf der Ebene der Mitgliedstaaten <strong>und</strong> auf der europäischen Ebene <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong>e<br />
höhere Verb<strong>in</strong>dlichkeit <strong>und</strong> Verantwortlichkeit für die Integration junger Menschen<br />
<strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong> geschaffen werden.<br />
Der europäische Fachkongress <strong>in</strong> Leipzig hat den Austausch <strong>und</strong> die Entwicklung<br />
geme<strong>in</strong>samer europäischer Standards angestoßen. Dies sollte im Interesse e<strong>in</strong>er erfolgreichen<br />
Integration junger Menschen <strong>in</strong> <strong>sozialen</strong> <strong>Brennpunkten</strong> fortgesetzt<br />
werden.<br />
Burgers, J.;Vranken, J.; Friedrichs, J.; Hommerich, C. (Hrsg.) (2003): Anleitung für e<strong>in</strong> erfolgreiches<br />
Stadtentwicklungsprogramm. Beispiele aus neun europäischen Ländern.<br />
Opladen: Leske + Budrich<br />
D<strong>in</strong>geldey, I. (2006): Aktivierender Wohlfahrtsstaat <strong>und</strong> sozialpolitische Steuerung. In: Aus<br />
Politik <strong>und</strong> Zeitgeschichte. 8-9/2006, S. 3-9<br />
Esp<strong>in</strong>g-Andersen, G. (1990): Three Worlds of Welfare Capitalism. Pr<strong>in</strong>ceton University<br />
Press<br />
Ferge, Z. (1979): A Society <strong>in</strong> the Mak<strong>in</strong>g: Hungarian Social and Societal Policy, 1945-75.<br />
Pengu<strong>in</strong> Books Ltd<br />
Giddens, A. (1997): Die Konstitution der Gesellschaft. Gr<strong>und</strong>züge e<strong>in</strong>er Theorie der Strukturierung.<br />
Campus<br />
Giddens, A. (1998): Equality and the Social Investment State. In: Hargraves, I/Christie, I.<br />
(Hrsg.): Tommorrow’s politics. The Third Way and Beyond. Demos London 1998.<br />
S. 25-40.<br />
Gött<strong>in</strong>g; Lessenich (1998): In: Lessenich, S.; Ostner, I.: Welten des Wohlfahrtskapitalismus.<br />
Der Sozialstaat <strong>in</strong> vergleichender Perspektive, Campus, S.<br />
Holtmann, D. (2006): Internationaler Vergleich der Performanz von Wohlfahrtsregiemen.<br />
In: Potsdamer Beiträge zur Sozialforschung, Nr. 26/2006<br />
Kaufmann, F. X. (2003): Varianten des Wohlfahrtsstaats. Der deutsche Sozialstaat im <strong>in</strong>ternationalen<br />
Vergleich. edition suhrkamp. Frankfurt a.M.: Suhrkamp<br />
Offe, C. (1994): Der Tunnel am Ende des Lichts. Erk<strong>und</strong>ungen der politischen Transformation<br />
im Neuen Osten. Campus Verlag<br />
Reutl<strong>in</strong>ger, C.; Mack, W.; Wächter, F.; Lang, S. (Hrsg.) (2007): Jugend <strong>und</strong> Jugendpolitik <strong>in</strong><br />
benachteiligten Stadtteilen <strong>in</strong> Europa. VS Verlag, Schriften des Deutschen Jugend<strong>in</strong>stituts<br />
Stark, D. (1995): Das Alte im Neuen: Institutionenwandel <strong>in</strong> Osteuropa. In: Transit, Heft 9,<br />
S. 65-77<br />
133
Teilnehmer/<strong>in</strong>nen<br />
Surname First name Organisation Country Email<br />
Abaci Fikret Niedersächsischer Integrationsrat Deutschland fikret.abaci@polizei.niedersachsen.de<br />
Abel Toomas Häädemeeste Municipality Estonia toomas.abel@haademeeste.ee<br />
Adamovska Andrea Bezirksamt Czech Republic andrea.adamovska@kr-moravskoslezsky.cz<br />
Albers Monika IN VIA Hamburg Deutschland Albers@INVIA-Hamburg.de<br />
Ambs-Thomsen Peter Kvisten Denmark peambs@kvisten.kk.dk<br />
Ancuta Emanoil Rumänische Stiftung für Demokratie <strong>und</strong> politische Bildung e.V. Rumänien emanoil_ancuta@yahoo.com<br />
Asberger Tatjana Stiftung SPI - Regiestelle LOS<br />
Atk<strong>in</strong> Andrea awo region osnabrück Deutschland andrea.atk<strong>in</strong>@gmx.de<br />
Bartkeviciene Jolanta M<strong>in</strong>istry of Social Security and Labour Lithuania jbartkeviciene@socm<strong>in</strong>.lt<br />
Bartl Kat<strong>in</strong>ka Maria Projektträger im DLR Deutschland kat<strong>in</strong>ka.bartl@dlr.de<br />
Bartl<strong>in</strong>g Alexander Europarat Frankreich alexander.Bartl<strong>in</strong>g@coe.<strong>in</strong>t<br />
Bazan Sergio Ial Friulia Venezia Giulia Italy sergio.bazan@ial.fvg.it<br />
Berg Berit L<strong>in</strong>köp<strong>in</strong>gs kommun Sweden berit.berg@l<strong>in</strong>kop<strong>in</strong>g.se<br />
Berkenkötter Ulrike Jugendwohnheim e.V. Deutschland berkenkoetter@gmx.de<br />
Biank Adel<strong>in</strong>de Jugendamt Ingolstadt Deutschland adel<strong>in</strong>de.biank@<strong>in</strong>golstadt.de<br />
Bischoff Gabriele ARGE Stadt Brandenburg Deutschland gabriele.bischoff@arge-sgb2.de<br />
Bog Ronny Stiftung SPI - Regiestelle LOS<br />
Bogdan Aleksandra SC ALTOTAL-CONS"SRL" Republic of Moldova bogdansanda@gmail.com<br />
Bon Christ<strong>in</strong>e École Supérieure de Travail Social - ETSUP France christ<strong>in</strong>e.bon@laposte.net<br />
Börst<strong>in</strong>ghaus Wolfgang Stadt Flensburg Deutschland boerst<strong>in</strong>ghaus.wolfgang@stadt.flensburg.de<br />
Bosse Thilo Stadt Köln, Amt für Stadtentwicklung <strong>und</strong> Statistik Deutschland thilo.bosse@stadt-koeln.de<br />
Bössenrodt Karen Thür<strong>in</strong>ger M<strong>in</strong>isterium für Wirtschaft, Technologie <strong>und</strong> Arbeit Deutschland Karen.Boessenrodt@tmwta.thuer<strong>in</strong>gen.de<br />
Brandauer Dorit Progresso Portugal d.brandauer@progresso-pt.de<br />
Bremers Klaus Magistrat Deutschland Klaus.Bremers@magistrat.bremerhaven.de<br />
Bruckdorfer Matthias Diakonisches Werk der EKD Deutschland bruckdorfer@diakonie.de<br />
Buchanan Sandra Co Donegal VEC Ireland sandrabuchanan@donegalvec.ie<br />
Bülter Heike Caritasverband Ma<strong>in</strong>-Taunus Deutschland stadtteilbuero-hattersheim@web.de<br />
Burger Petra Jugendamt Leipzig Deutschland petra.burger@leipzig.de<br />
Buttigieg Joseph M<strong>in</strong>istry of Education, Youth & Employment Malta joe.c.buttigieg@gov.mt<br />
Calo Nico Arbeitskreis zentraler Jugendverbände e.V. Deutschland calo@azj.de
Carmona Maria Instituto de Apoio à Criança - Projecto Rua Portugal iacpruanad@netcabo.pt<br />
Casapu Veronica-Iust<strong>in</strong>a A.C.C.O.R.D(Asociatia Comunitara Calarasi de Organizare rurala si Dezvoltare) Romania iust<strong>in</strong>averonica@yahoo.com<br />
Clay Sarah Warwickshire County Council United K<strong>in</strong>gdom sarahclay@warwickshire.gov.uk<br />
Cornely Jürgen Kultusm<strong>in</strong>isterium Saarland Deutschland j.cornely@bildung.saarland.de<br />
Corona Elvira xanadu youth association Italy elvira_corona@yahoo.it<br />
Craps Kris Arktos Belgium kcraps@arktos.be<br />
Dams Seppe Flemish Community Belgium seppe.dams@cjsm.vlaanderen.be<br />
Danilescu Tatiana Youth Alliance for Human Rights Republic of Moldova danilescut@yahoo.com<br />
Debus Alfred Ev. Jugend Sachsen- Landesjugendpfarramt Deutschland Alfred.Debus@evlks.de<br />
Degirmencioglu Serdar M. Beykent University Turkey s_degirmencioglu@yahoo.com<br />
Diehe Kathr<strong>in</strong> Stadt Hildesheim Deutschland k.diehe@stadt-hildesheim.de<br />
Djouadi Fahima OMJA France djouadifahima@yahoo.fr<br />
Drill<strong>in</strong>g Matthias Fachhochschule Nordwestschweiz Schweiz matthias.drill<strong>in</strong>g@fhnw.ch<br />
Eich Gottfried Diakonisches Werk Hamburg Deutschland eich@diakonie-hamburg.de<br />
Eisenstecken Veronika Autonome Prov<strong>in</strong>z Bozen Südtirol Italien veronika.eisenstecken@prov<strong>in</strong>z.bz.it<br />
Erfurth Beate Stadt Halle (Saale) Deutschland beate.erfurth@halle.de<br />
Esmail-Arndt Rubeena GTZ Bosnien rubeena.esmail-arndt@gtz.ba<br />
Fatu Al<strong>in</strong>a Civil Society Commissariat and ProVocatia Association Romania al<strong>in</strong>utza_g2003@yahoo.com<br />
Fedoriv Larysa Lviv regional council Ukra<strong>in</strong>e <strong>in</strong>fo@oblrada.lviv.ua<br />
Fietz Claudia Landeshauptstadt Dresden Jugendamt Deutschland cfietz@dresden.de<br />
Fiorucci Olimpia Tecnostruttura delle Regioni per il FSE Italy o.fiorucci@tecnostruttura.it<br />
Foster Simon Department for Education and Skills England Simon.FOSTER@dfes.gsi.gov.uk<br />
Garnier Christophe M<strong>in</strong>istère de l'Emploi France christophe.garnier@dgefp.travail.gouv.fr<br />
Gatner Dariusz OHP Polen d.gatner@ohp.pl<br />
Gatt<strong>in</strong>ger Pia Tana Bürger<strong>in</strong>itiative für Soziale Fragen e.V. Deutschland gatt<strong>in</strong>ger@bsf-richtsberg.de<br />
Gerada Joseph Fo<strong>und</strong>ation for Social Welfare Services Malta joseph.a.gerada@gov.mt<br />
Ghafour Midya Jugendmigrationsdienst AWO-Soest Deutschland m-gfr@hotmail.de<br />
Goebel Ulrike Caritasverband für Saarbrücken <strong>und</strong> Umgebung e.V. Deutschland cv-gwa-friedrichsthal@quarternet.de<br />
Groeger-Roth Frederick LAG Soziale Brennpunkte Nds. e.V. Deutschland frederick.groeger-roth@lag-nds.de<br />
Grüneklee Kai-Uwe gsub - Regiestelle LOS<br />
Grünert Sab<strong>in</strong>e gsub - Regiestelle LOS<br />
Grünke Ramona Stadtteilbüro Schwedt/Oder Deutschland stadtteilbuero.stadt@schwedt.de<br />
Habermann Tobias Quartiersmanagement Leipziger Westen Deutschland habermann@leipzigerwesten.de
Hagemann Kathr<strong>in</strong> gsub - Regiestelle LOS<br />
Hageni Monika Stadtverwaltung Freiberg Deutschland Sozialamt@Freiberg.de<br />
Hahn Mar<strong>in</strong>a BM Ges<strong>und</strong>heit, familie <strong>und</strong> Jugend Österreich mar<strong>in</strong>a.hahn@bmgfj.gv.at<br />
Hascheck Holger Stadtverwaltung Deutschland buergermeister@johanngeorgenstadt.de<br />
Hatzfeld Ulrich B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Verkehr, Bau <strong>und</strong> Stadtentwicklung Deutschland Ulrich.Hatzfeld@bmvbs.b<strong>und</strong>.de<br />
He<strong>in</strong>le<strong>in</strong> Jürgen Jugendhaus Stadt Forchheim Deutschland jugendhaus@stadt.forchheim.de<br />
Heise Mandy gsub - Regiestelle LOS Deutschland<br />
Hernández-Lería Jacobo FERE / EyG Spa<strong>in</strong> jacobo.h@ferececa.es<br />
Heuser Gisbert Gerhart-Hauptmann-Schule Unna Deutschland GisHeuser@aol.com<br />
Hlatky Christian Soziale Stadt Deutschland p.kiefl@grws-rosenheim.de<br />
Hoffstedt Gustaf Municipality of Gotland Sweden gustaf.hoffstedt@gotland.se<br />
Hrovatic Danica Center Spirala Slovenija danica.hrovatic@guest.arnes.si<br />
Hülse Margarethe Quartiersmanagement Dortm<strong>und</strong>-Borsigplatz, Stadtteil-Schule Dortm<strong>und</strong> Deutschland m.huelse@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
Iffland Sabr<strong>in</strong>a IB Internationaler B<strong>und</strong> e.V. Deutschland Sabr<strong>in</strong>a.Iffland@web.de<br />
Igoe Maire Dubl<strong>in</strong> City Council (Local Authority) Ireland maire.igoe@dubl<strong>in</strong>city.ie<br />
Jacobs Marie-Josée M<strong>in</strong>isterium für Familie <strong>und</strong> Integration Luxemburg mireille.mathieu@fm.etat.lu<br />
Jacobs Benno gsub - Regiestelle LOS Deutschland<br />
Jäger Jörg Stiftung SPI - Regiestelle LOS Deutschland<br />
Jilkova Jana CRDM - Czech Council of Children and Youth Czech Republic jam<strong>in</strong>ka@centrum.cz<br />
AVZO TSC CR - association of basic multipurpose organizations of technical<br />
Jilkova Anna Czech Republic anicka.jilkova@atlas.cz<br />
sports and activities<br />
Johansen Mette-Louise Municipal educational department Denmark mlej@bu.aarhus.dk<br />
Jung Christiane Stadt Mannheim Deutschland christiane.jung@mannheim.de<br />
Kammerer Bernd Stadt Nürnberg, Jugendamt Deutschland bernd.kammerer@stadt.nuernberg.de<br />
Kaps Petra Wissenschaftszentrum Berl<strong>in</strong> für Sozialforschung Deutschland kaps@wzb.eu<br />
Karow Marcel Stadtverwaltung Offenburg Deutschland streetwork@offenburg.de<br />
Kendl<strong>in</strong> Hilary South Dubl<strong>in</strong> County Council Ireland hkendl<strong>in</strong>@sdubl<strong>in</strong>coco.ie<br />
Khalilov Rovshan M<strong>in</strong>istry of Justice of the Republic of Azerbaijan Azerbaijan rovshan@hotmail.com<br />
Klauder He<strong>in</strong>z Sozial-Forum e.V. Deutschland he<strong>in</strong>z.klauder@sozial-forum-kappeln.de<br />
Klauder Marieke Project-Group at Roskilde University Denmark marieke85kl@aol.com<br />
Kluge Christiane Amt für Soziale Dienste Bremen Deutschland C.Kluge@afsd.bremen.de<br />
Klump Hans Stadt Mannheim Deutschland hans.klump@mannheim.de<br />
Knaak Matthias Landratsamt Bautzen Deutschland matthias.knaak@lra-bautzen.de
Knudsen John V<strong>in</strong>ter Youth Guidance Centre Copenhagen Denmark jvk@buf.kk.dk<br />
Kolouh Lidija Swedish national board for youth affairs Sweden Lidija.kolouh @ungdomsstyrelsen.se<br />
Kopischke Maike SJD-Die Falken Deutschland M.Kopischke@gmx.de<br />
Kortegaard Birgitte Sandal Municipality of Copenhagen Denmark birkor@tmf.kk.dk<br />
Kramberger Mateja Ozara Slovenija, National Life Quality Association Slovenia mateja.kramberger@ozara.org<br />
Kresse Elita Latvian Association of Local and Regional governments Latvia elita@lps.lv<br />
Kuc<strong>in</strong>skiene Rasa Parliament of the Republic of Lithuania Lithuania rakuci@lrs.lt<br />
Kühn Steffi Deutsche <strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendstiftung Deutschland steffi.kuehn@raa-mv.de<br />
Kummer Christoph LAG Soziale Brennpunkte Hessen Deutschland christoph.kummer@lagsbh.de<br />
Langmesser Thomas Stadtverwaltung Heiligenhaus Deutschland t.langmesser@onl<strong>in</strong>e.de<br />
Le Claire Anne Marie European Commission Belgium anne-marie.le-claire@ec.europa.eu<br />
Leahy Patrick University College Cork Ireland p.leahy@ucc.ie<br />
Lemos Myrto Social and Educational Action Greece socedact@otenet.gr<br />
Lettner Maria B<strong>und</strong>esjugendvertretung Österreich maria.lettner@jugendvertretung.at<br />
Liedtke Andreas Stadt Siegen Deutschland a_liedtke@siegen.de<br />
Loser-Hees Birgitt Caritasverband Rhe<strong>in</strong>-Mosel-Ahr e.V. Deutschland muenstertreff@caritas-mayen.de<br />
Lubenova Vassilka M<strong>in</strong>istry of Labour and Social Policy Bulgaria lubenova@mlsp.government.bg<br />
Lummitsch Uwe Lokales Bündnis für Familie im LK Bitterfeld c/o EWN mbH Deutschland presse@ewnonl<strong>in</strong>e.de<br />
Magariu Viorica The M<strong>in</strong>istry of Social Protection of Family and Children Republic of Moldova viorelia27@yahoo.com<br />
Majerus Mill M<strong>in</strong>isterium für Familie <strong>und</strong> Integration Luxemburg mill.majerus@fm.etat.lu<br />
Mallon Thomas Stadt Braunschweig Deutschland thomas.mallon@braunschweig.de<br />
Mangold Barbara Arbeits- <strong>und</strong> sozialpädagogisches Zentrum Deutschland barbaramangold@asz-kl.de<br />
Mans Ingrid M<strong>in</strong>isterium für Soziales <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit Deutschland Ingrid.mans@sm.mv-regierung.de<br />
Marcovici Octav Youth Research Institute Romania octav_m@yahoo.com<br />
Mart<strong>in</strong>-Huber Diana Diakonisches Werk Deutschland ksc1patrick@aol.com<br />
Mas<strong>in</strong>g Maarja-Liisa Estonian M<strong>in</strong>istry of Education and Research Estonia maarja-liisa.mas<strong>in</strong>g@hm.ee<br />
Médou-Marère Isabelle FNARS IdF France fnarsidf.europe@wanadoo.fr<br />
Meldrum Julie Nott<strong>in</strong>ghamshireCounty teach<strong>in</strong>g Primary Care Trust United K<strong>in</strong>gdom julie.meldrum@nott<strong>in</strong>ghamshirecounty-tpct.nhs.uk<br />
Miers Sor<strong>in</strong>a <strong>Deutsches</strong> Rotes Kreuz Generalsekretariat Deutschland mierss@drk.de<br />
Miersch Paloma BBHJ Deutschland miersch@bbj.de<br />
IJAB - Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Mierzowski Claudia<br />
Deutschland mierzowski@ijab.de<br />
Deutschland e.V.<br />
Mihalachi Victoria Lyceum \ Moldova victoriamihalachi@yahoo.com
Miron Mariana European Youth Parliament Initiative Moldova Republic of Moldova mariana_muse@yahoo.com<br />
Möbius Sibylle Amitié srl Iltaly smoebius@amitie.it<br />
Mohns-Welsch Birgit Landkreis Neunkirchen Deutschland b.mohns-welsch@landkreis-neunkirchen.de<br />
Molitorisz Anikó Municipal Government of Budapest Hungary molitorisza@budapest.hu<br />
Moreira Veronique council of europe France vmoreira@wanadoo.fr<br />
Moro Luciano IAL CISL Friuli Venezia Giulia Region Italy luciano.moro@ial.fvg.it<br />
Morrison Chester Liverpool City Council United K<strong>in</strong>gdom chester.morrison@liverpool.gov.uk<br />
Müller Re<strong>in</strong>er Deutscher Vere<strong>in</strong> für öffentliche <strong>und</strong> private Fürsorge Deutschland r.mueller@deutscher-vere<strong>in</strong>.de<br />
Muscat Salv<strong>in</strong>a M<strong>in</strong>istry of Education, Youth & Employment Malta salv<strong>in</strong>a.muscat@gov.mt<br />
Musiol Klaus SABW e.V. Halle / Uni MD Deutschland DR.MKF@web.de<br />
Näsman Ulla The city of S<strong>und</strong>svall Sweden ulla.nasman@s<strong>und</strong>svall.se<br />
Naumann Cornelia Kreisjugendr<strong>in</strong>g Kyffhäuserkreis e.V. Deutschland kjr.naumann@gmx.de<br />
Neumeier Harald Stadt Neuburg an der Donau Deutschland harald.neumeier@neuburg-donau.de<br />
Nowak Markus Stadt Rosenheim Deutschland markus.nowak@rosenheim.de<br />
Ole<strong>in</strong>ika Elza Children's Forum of Latvia Latvia birojs@bernuforums.lv<br />
Olk Thomas Mart<strong>in</strong>-Luther-Universität Deutschland thomas.olk@paedagogik.uni-halle.de<br />
M<strong>in</strong>istry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of<br />
Oprea Natalia Republic of Moldova youthno@gmail.com<br />
Moldova<br />
Oruc Nazmi Greater Municipality of Eskısehir Turkey nazmioruc@yahoo.com<br />
Õuemaa Anne Tartu City Government Estonia Anne.Ouemaa@raad.tartu.ee<br />
Overhage Susanne Stadt Köln Deutschland susanne.overhage@stadt-koeln.de<br />
Pal<strong>in</strong> Natalie Liverpool City Council - Liverpool Youth Service England natalie.pal<strong>in</strong>@liverpool.gov.uk<br />
Peeters George Geme<strong>in</strong>de Helmond Niederlande s.peeters@helmond.nl<br />
Pello Li<strong>in</strong>a Office of the m<strong>in</strong>ister for Population and Ethnic Affairs Estonia li<strong>in</strong>a.pello@riigikantselei.ee<br />
Plötz Barbara Stadt Ingolstadt Deutschland barbara.ploetz@<strong>in</strong>golstadt.de<br />
Pudelko Barbara Stadt Krefeld Deutschland barbara.pudelko@krefeld.de<br />
Rääk Reet Tall<strong>in</strong>n City Government Social Welfare and Health Care Board Estonia reet.raak@tall<strong>in</strong>nlv.ee<br />
Re<strong>in</strong>berg Holger Bezirksamt Harburg Deutschland Holger.Re<strong>in</strong>berg @Harburg.Hamburg.de<br />
Re<strong>in</strong>sch Friedrich Vere<strong>in</strong> Soziale Stadt Potsdam e.V. <strong>und</strong> Haus d. Generationen u. Kulturen Deutschland <strong>in</strong>fo@milanhorst-potsdam.de<br />
Rentzsch Constanze BBJ e.V. Zentrale Beratungsstelle Deutschland rentzsch@bbj.de<br />
Reutl<strong>in</strong>ger Christian FHS St. Gallen Schweiz christian.reutl<strong>in</strong>ger@fhsg.ch<br />
Riermeier Alfred Stadt Kaufbeuren Deutschland alfred.riermeier@kaufbeuren.de<br />
R<strong>in</strong>k Barbara DJI Deutschland r<strong>in</strong>k@dji.de
Rombach Jürgen Stadt Eschweiler Deutschland juergen.rombach@eschweiler.de<br />
Rossbach Günter Stadt Salzgitter Deutschland Guenter.Rossbach@Stadt.Salzgitter.de<br />
Rossel Peter Stadt Gött<strong>in</strong>gen Deutschland p.rossel@goett<strong>in</strong>gen.de<br />
Rothe Ulrike Jugendamt Deutschland ulrike.rothe@l-os.de<br />
Ruff<strong>in</strong>g Klaus G. Kreisverwaltung des Saarpfalz-Kreis Deutschland Klaus.Ruff<strong>in</strong>g@saarpfalz-kreis.de<br />
Sabelhaus Ralf Stadt Osnabrück Deutschland Sabelhaus@Osnabrueck.de<br />
Saigusa Nielsen Steffen Aarhus Municipality Denmark ssn@fa.aarhus.dk<br />
Salonen Tapio Växjö University Sweden tapio.salonen@vxu.se<br />
Salzmann Peter Sächsisches M<strong>in</strong>isterium für Soziales Deutschland peter.salzmann@sms.sachsen.de<br />
Sauter Ursula Landratsamt L<strong>in</strong>dau Deutschland<br />
Scaron Marcela Rac<strong>in</strong>e France scaron@rac<strong>in</strong>e.fr<br />
Schaub Sab<strong>in</strong>e MIT Spangenberg GmbH Deutschland sab<strong>in</strong>e.schaub@spangenberg.de<br />
Schiffer Beate Stadtverwaltung Heiligenhaus Deutschland b.schiffer@heiligenhaus.de<br />
Sch<strong>in</strong>dler Brigitte BAG KJS Deutschland brigitte.sch<strong>in</strong>dler @jugendsozialarbeit.de<br />
Schirtz Nathalie Service National de la Jeunesse Luxembourg nathalie.schirtz@snj.etat.lu<br />
Schlagowski Helmuth Stadt Lüneburg Deutschland Helmuth.Schlagowski@stadt.lueneburg.de<br />
Schmidt Verena Stadterneuerungsgesellschaft Strals<strong>und</strong> Deutschland qmgruenhufe@gmx.de<br />
Schmidt Lutz Jugendamt Leipzig Deutschland schmidt@leipzig.de<br />
Schmocker Beat Stadt Schaffhausen Schweiz beat.schmocker@stsh.ch<br />
Schneider Bastian Stiftung SPI - Regiestelle LOS Deutschland<br />
Schröder Jana Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft für <strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendhilfe - AGJ Deutschland jana.schroeder@agj.de<br />
Schuierer Bett<strong>in</strong>a Offene Jugendarbeit Forchheim Nord Deutschland <strong>in</strong>fo@oja-forchheim.de<br />
Werkgeme<strong>in</strong>schaft Die Brücke (Bramsche), Tandem-Die 2. Chance;<br />
Schweer Dirk<br />
Deutschland dirkschweer@hotmail.com<br />
Jugendgerichtshilfe Osnabrück<br />
Scutaru Mar<strong>in</strong>a Centre d' Information, Education et Analise Sociale de Moldova Republic of Moldova scutarumar<strong>in</strong>a@gmail.com<br />
Segota Patrick Croatia sasa@umki.hr<br />
Shperova Zlat<strong>in</strong>a M<strong>in</strong>istry of Labour and Social Policy Bulgaria zlat<strong>in</strong>a@mlsp.government.bg<br />
Siebenhüner Sonja Stadt Grafenwöhr Deutschland s.siebenhuener@web.de<br />
S<strong>in</strong>field Adrian University of Ed<strong>in</strong>burgh Scotland adrian.s<strong>in</strong>field@ed.ac.uk<br />
S<strong>in</strong>n Bett<strong>in</strong>a Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhe<strong>in</strong> Deutschland buergertreff-west@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
S<strong>in</strong>nwell Johannes Caritasverband für Saarbrücken <strong>und</strong> Umgebung e.V. Deutschland j.s<strong>in</strong>nwell@quarternet.de<br />
Skusevicius Darius Department of Youth Affairs <strong>und</strong>er M<strong>in</strong>istry of Social Security and Labour Lithuania d.skusevicius@jrd.lt<br />
Sobotka Gertraud ASJF, Magistrat L<strong>in</strong>z Österreich gertraud.sobotka@mag.l<strong>in</strong>z.at<br />
Sp<strong>in</strong>dler Herbert sozial.label e.v. Deutschland sp<strong>in</strong>dler@soziallabel.de
Spiteri Therese Labour Youth Forum - Malta Malta therese.spiteri@labouryouth.org<br />
Spöcker Helga M<strong>in</strong>isterium für Arbeit <strong>und</strong> Soziales Deutschland Spoecker@sm.bwl.de<br />
Sprenger Birgit Thür<strong>in</strong>ger Kultusm<strong>in</strong>isterium Deutschland Birgit.Sprenger @tkm.thuer<strong>in</strong>gen.de<br />
Stafford Bruce University of Nott<strong>in</strong>gham England Bruce.Stafford@nott<strong>in</strong>gham.ac.uk<br />
Stafseng Ola University of Oslo Norway ola.stafseng@ped.uio.no<br />
Ste<strong>in</strong> Peter Stadtverwaltung Koblenz Deutschland Peter.Ste<strong>in</strong>@stadt.koblenz.de<br />
Ste<strong>in</strong>hauer Valerias Oberlausitz-neue Heimat e.V. Deutschland neue_heimat@freenet.de<br />
Ste<strong>in</strong>mair Sab<strong>in</strong>e Stiftung SPI - Regiestelle LOS Deutschland<br />
Stell Hermann Josef Gr<strong>und</strong>schule Düsseldorfer Straße Deutschland hermann-josef.stell @schulverwaltung.bremen.de<br />
Stijohann Marion AWO Deutschland jmd-st@awo-hochsauerland-soest.de<br />
Stokes Gary Nott<strong>in</strong>ghamshireCounty teach<strong>in</strong>g Primary Care Trust England gary.stokes@nott<strong>in</strong>ghamshire county-tpct.nhs.uk<br />
Suchenek Lukasz Local Court Poland lukasz@suchenek.waw.pl<br />
Teder Pille Tall<strong>in</strong>n Family Centre Estonia pille.teder@pk.ee<br />
Potsdamer Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft zur Gr<strong>und</strong>sicherung für Arbeitssuchende<br />
Thomann Frank<br />
Deutschland Frank.Thomann2@arge-sgb2.de<br />
(PAGA)<br />
Tunc Ayd<strong>in</strong> Magistrat der Stadt Wien Österreich ayd<strong>in</strong>.tunc@m17.magwien.gv.at<br />
Uzul<strong>in</strong>a L<strong>in</strong>da YWCA/YMCA of Latvia Latvia l<strong>in</strong>da@imka.lv<br />
Veedla Aarne Estonian Parliament Estonia aarne.veedla@riigikogu.ee<br />
Verburgt Monique Don Bosco Haaglanden The Netherlands jeugdwerk@donbosco.nl<br />
Ververidou Chrisoula Social Support Center of Evosmos Greece ververidou@depoe.gr<br />
Völger Heike BMFSFJ Deutschland heike.voelger@bmfsfj.b<strong>und</strong>.de<br />
von Spee Me<strong>in</strong>olf Don Bosco International Belgien spee@don-bosco.eu<br />
Wiedermann Herbert Behörde für Soziales, Familie, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Verbraucherschutz Deutschland herbert.wiedermann @bsg.hamburg.de<br />
Wilhelm Peter Landkreis Merzig-Wadern Deutschland p.wilhelm@merzig-wadern.de<br />
W<strong>in</strong>gard Andrew Ashfield/Mansfield Local Strategic Partnership UK andrew.w<strong>in</strong>gard@nottscc.gov.uk<br />
Wirz Monika Sozialreferat der Stadt Schaffhausen Schweiz monika.wirz@stsh.ch<br />
Witzel Thomas Stiftung SPI - Regiestelle LOS Deutschland<br />
Wolf Christ<strong>in</strong> Deutschland<br />
Wrage Marc-Udo <strong>K<strong>in</strong>der</strong>- <strong>und</strong> Jugendtreff Dornestr. Deutschland marc-udo@web.de<br />
Wurster Barbara BMFSFJ Deutschland Barbara.Wurster@bmfsfj.b<strong>und</strong>.de<br />
Zammit Jennifer Children and Young Persons Advisory Board Malta Malta jennyz@maltanet.net<br />
Zentner Manfred jugendkultur.at Austria mzentner@jugendkultur.at<br />
Zezulkova Kater<strong>in</strong>a Czech council of Children and Youth Czech republic <strong>in</strong>fo@kam-pan.cz<br />
Zieske Andreas BAG örtlich regionaler Träger Deutschland zieske@bag-oert.de<br />
Zobel Gabriele Treffpunkt Zech Deutschland<br />
Zornemann Sandra Kreisjugendr<strong>in</strong>g Kyffhäuserkreis e.V. Deutschland kjr.zornemann@gmx.de
Referent/<strong>in</strong>nen<br />
Surname First name Organisation Town Country Email<br />
Ambros<strong>in</strong>i Maurizio Fondazione Luigi Clerici Italy maurizioambros<strong>in</strong>i@t<strong>in</strong>.it<br />
Ambrosio Luciano Progetto Union Etica, Region Piemonte Italy ambrosio.l@unionfidi.com<br />
Barnes Marian University of Brighton Brighton United K<strong>in</strong>gdom Marian.Barnes@brighton.ac.uk<br />
Bartak Karel European Commission, DG Education and Culture Bruxelles/Brüssel European Commission karel.bartak@ec.europa.eu<br />
Bendit Rene <strong>Deutsches</strong> Jugend<strong>in</strong>stitut e.V. Muenchen Germany Bendit@dji.de<br />
Bischoff Peter <strong>Deutsches</strong> Jugend<strong>in</strong>stitut e.V. Halle/Saale Germany P.Bischoff.Sozio-Design@web.de<br />
Bischoff Ursula <strong>Deutsches</strong> Jugend<strong>in</strong>stitut e.V. Halle/Saale Germany bischoff@dji.de<br />
Bohner Ulrich Kongress der Geme<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Regionen des Europarats Strasbourg Europarat Straßburg ulrich.bohner@coe.<strong>in</strong>t<br />
Bourthoumieu Frederic GIP Centre Essonne, Courcouronnes Courcouronnes France gip.centressonne.fb@wanadoo.fr<br />
Brocke Hartmut Stiftung SPI, Moderation AG 5 Berl<strong>in</strong> Germany <strong>in</strong>fo@stiftung-spi.de<br />
Burchardt Susann <strong>Deutsches</strong> Jugend<strong>in</strong>stitut e.V. Halle/Saale Germany burchardt@dji.de<br />
Calado Pedro Choices Programme Lissabon Portugal pedroc@programaescolhas.pt<br />
Carolan Christ<strong>in</strong>a Youthreach Local Centre Dubl<strong>in</strong> Dubl<strong>in</strong> Ireland<br />
Choffel Philippe Delegation Interm<strong>in</strong>isterielle a la Ville Sa<strong>in</strong>t-Denis la Pla<strong>in</strong>e cedex France choffel@ville.gouv.fr<br />
Cristova Nuno Cool Generation Project Monte de Caparica Portugal geracaocool.scma.pe@gmail.com<br />
Fäldt Brith Councillor, Pitea Sweden brith.faldt@swipnet.se<br />
Fligge-Hoffjann Claudia BMFSFJ - Referat 501 Germany Claudia.Fligge-Hoffjann@bmfsfj.b<strong>und</strong>.de<br />
Förster Heike <strong>Deutsches</strong> Jugend<strong>in</strong>stitut e.V. Halle/Saale Germany foerster@dji.de<br />
Fritz N<strong>in</strong>a Treffpunkt Zech Germany bett<strong>in</strong>a.schultheis@landkreis-l<strong>in</strong>dau.de<br />
Ganczer Tamás South-Transdanubian Regional Labour Centre Szekszard Hungary ganczert@lab.hu<br />
Goepfert Yves Responsable du programme réussite éducative à la DIV Sa<strong>in</strong>t-Denis la Pla<strong>in</strong>e cedex France william.legoff@ville.gouv.fr<br />
Groth Kathr<strong>in</strong> Deutscher B<strong>und</strong>esjugendr<strong>in</strong>g Berl<strong>in</strong> Germany<br />
B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong><br />
Hoofe Gerd Berl<strong>in</strong> Germany gerd.hoofe@bmfsfj.b<strong>und</strong>.de<br />
Jugend, Staatssekretär<br />
Jung Burkhard Oberbürgermeister der Stadt Leipzig Leipzig Germany <strong>in</strong>fo@leipzig.de<br />
Kelly Angelique Youthreach Local Centre Dubl<strong>in</strong> Dubl<strong>in</strong> Ireland a.kelly@yrcruml<strong>in</strong>.cdvec.ie<br />
Kilb Ra<strong>in</strong>er Fachhochschule Mannheim, Fakultät für Sozialwesen Mannheim Germany r.kilb@hs-mannheim.de<br />
Klamková Katarína IQ Roma Servis Brno Czech Katar<strong>in</strong>a.klamkova@iqrs.cz<br />
Kotibova Sona Schlesische Diakonie Cesky Tes<strong>in</strong> Czech s.kotibova@slezskadiakonie.cz<br />
Kupferschmid Peter B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend Bonn Germany peter.kupferschmid @bmfsfj.b<strong>und</strong>.de<br />
Kürüyen Enes Treffpunkt Zech Germany bett<strong>in</strong>a.schultheis@landkreis-l<strong>in</strong>dau.de
Europäische Kommision – Beschäftigung, soziale<br />
Lange Heribert European Commission Heribert.lange@ec.europa.eu<br />
Angelegenheiten <strong>und</strong> Chancengleichheit<br />
Leoncikas Tadas Centre of Ethnik Studies (CES) Vilnius Lithuania leoncikas@ktl.mii.lt<br />
Lüders Christian <strong>Deutsches</strong> Jugend<strong>in</strong>stitut e.V. München Germany lueders@dji.de<br />
Manko Grzegorz Polish Children and Youth Fo<strong>und</strong>ation Warschau Poland gmanko@tlen.pl<br />
McCarthy Stephen City of Dubl<strong>in</strong> Vocational Education Commitee Dubl<strong>in</strong> Ireland Stephen.mccarthy@cdvec.ie<br />
Meier to Berndt-Seidl Petra Oberbürgermeister<strong>in</strong> der Stadt L<strong>in</strong>dau Germany bett<strong>in</strong>a.schultheis @landkreis-l<strong>in</strong>dau.de<br />
Mögl<strong>in</strong>g Tatjana <strong>Deutsches</strong> Jugend<strong>in</strong>stitut e.V. Halle/Saale Germany moegl<strong>in</strong>g@dji.de<br />
Morris Kate University of Birm<strong>in</strong>gham Birm<strong>in</strong>gham United K<strong>in</strong>gdom k.m.morris@bham.ac.uk<br />
Morrisson Ela<strong>in</strong>e Manchester Childrens F<strong>und</strong> Manchester United K<strong>in</strong>gdom e.morrison@manchester.gov.uk<br />
Moynihan David Greater London Enterprises United K<strong>in</strong>gdom<br />
Novopolskaja Svetlana Roma community Center Vilnius Lithuania sn713@hotmail.com<br />
Obst Sven-Olaf BMFSFJ - Referat 501 Germany sven-olaf.obst@bmfsfj.b<strong>und</strong>.de<br />
Parrado Salvador Dpto. Ciencia Política y de la Adm<strong>in</strong>istración UNED Madrid Spa<strong>in</strong> salvador.parrado @gov<strong>in</strong>t.org<br />
Prölß Re<strong>in</strong>er Stadt Nürnberg, Referat Jugend, Familie <strong>und</strong> Soziales Nürnberg Germany refv@stadt.nuernberg.de<br />
B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong><br />
Reiser Kar<strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> Germany kar<strong>in</strong>.reiser@bmfsfj.b<strong>und</strong>.de<br />
Jugend, Staatssekretär<strong>in</strong><br />
Reißig Birgit <strong>Deutsches</strong> Jugend<strong>in</strong>stitut e.V. Halle/Saale Germany reissig@dji.de<br />
Savickaja Graz<strong>in</strong>a Department of National M<strong>in</strong>orities and Lithuanians Liv<strong>in</strong>g Vilnius Lithuania graz<strong>in</strong>a.savickaja@tmid.lt<br />
Ab d<br />
Schmidt Mareike <strong>Deutsches</strong> Jugend<strong>in</strong>stitut e.V. Halle/Saale Germany schmidt@dji.de<br />
Schreiber Elke <strong>Deutsches</strong> Jugend<strong>in</strong>stitut e.V. Halle/Saale Germany schreiber@dji.de<br />
Schwamborn Christoph Regiestelle LOS Germany regiestelle@los-onl<strong>in</strong>e.de<br />
Siñczuch Marc<strong>in</strong> Institute of social applied studies Warsawa University Warschau Poland m.s<strong>in</strong>czuch@uw.edu.pl<br />
Sousa Maria Virg<strong>in</strong>ia Instituto National di Habitas Lissabon Portugal MLSousa@<strong>in</strong>h.pt<br />
Stokes Dermot Youthreach Ireland, Department of Education and Science Dubl<strong>in</strong> Ireland Dermot.stokes@cdu.cdvec.ie<br />
Tapprogge Alexandra Moderator<strong>in</strong> des Politikformats giga real <strong>und</strong> Spiegel TV Germany i.vogel@SOPHiE19.de<br />
Tölgyes Gabriella M<strong>in</strong>istry of Social Affairs and Labour Budapest Hungary tolgyes.gabriella @szmm.gov.hu<br />
Varela Bruno Cool Generation Project Monte de Caparica Portugal geracaocool.scma.pe @gmail.com<br />
Europäische Kommission, GD Beschäftigung, Soziales <strong>und</strong><br />
Vignon Jérôme Bruxelles/Brüssel European Commission jerome.vignon@ec.europa.eu<br />
Chancengleichheit<br />
Walczak Dom<strong>in</strong>ika Institute of social Studies studies Warsawa University Warschau Poland dom<strong>in</strong>ika.walczak @poczta.uw.edu.pl<br />
Williamson Howard University of Glamorgan, Wales Pontypridd United K<strong>in</strong>gdom howardw@glam.ac.uk
Aussteller/<strong>in</strong>nen, Projektmesse<br />
Ausstellergruppe Surname First Name Organisation Town Country Email<br />
Hattersheim Brandt Marianne Raum für Entwicklung Ma<strong>in</strong>z-Kostheim Deutschland marianne.brandt@raum-f-entwicklung.de<br />
Hattersheim Krietsch Gerhard Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft Hattersheim am Ma<strong>in</strong> Deutschland gkrietsch@hawobau.de<br />
Hattersheim Schaffhauser Gitta Stadt Hattersheim Hattersheim am Ma<strong>in</strong> Deutschland gitta.schaffhauser@hattersheim.de<br />
Landkreis Plön Gemsjäger Ruth Awo KV Plön Klausdorf Deutschland ruth.gemsjaeger@onl<strong>in</strong>ehome.de<br />
Landkreis Plön L<strong>in</strong>dner Holger Awo KV Plön Klausdorf Deutschland holger.l<strong>in</strong>dner@onl<strong>in</strong>ehome.de<br />
Landkreis Plön Krüger Axel Kreis Plön Plön Deutschland axel.krueger@kreis-ploen.de<br />
Berl<strong>in</strong>-Neuköln Hans<strong>in</strong>g Tom RÜTLI-WEAR Berl<strong>in</strong> Deutschland tom@ruetli-wear.de<br />
Berl<strong>in</strong>-Neuköln Stevanovic Ivan Streetdance-Connection Berl<strong>in</strong> Deutschland batoivan@hotmail.com<br />
Berl<strong>in</strong>-Neuköln Süllke Franziska Bezirksamt Neukölln von Berl<strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> Deutschland franziska.suellke@ba-nkn.verwalt-berl<strong>in</strong>.de<br />
Saarbrücken Herger Fred Sozialer Betrieb Sulzbach eG Sulzbach Deutschland f.herger@stadt-sulzbach.de<br />
Saarbrücken Schmidt Karsten Stadtverband Saarbrücken Saarbrücken Deutschland katja.kruse@svsbr.de<br />
Landkreis Eichsfeld Hupkau Rosa Koord<strong>in</strong>ierungsstelle LOS Heilbad Heiligenstadt Deutschland kunstsicherungsamt@kreis-eic.de<br />
Landkreis Eichsfeld Wehner Dechand Katholisches Pfarramt St. Maria-Magdalena Le<strong>in</strong>efelde Le<strong>in</strong>efelde-Worbis Deutschland bauamt@le<strong>in</strong>efelde-worbis.de<br />
Landkreis Eichsfeld Schröter<br />
B<br />
Jutta<br />
h d<br />
Katholisches Pfarramt St. Maria-Magdalena Le<strong>in</strong>efelde Le<strong>in</strong>efelde-Worbis Deutschland bauamt@le<strong>in</strong>efelde-worbis.de<br />
Landkreis Eichsfeld Br<strong>in</strong>kmann Astrid Katholisches Pfarramt St. Maria-Magdalena Le<strong>in</strong>efelde Le<strong>in</strong>felde-Worbis Deutschland bauamt@le<strong>in</strong>efelde-worbis.de<br />
Rosenheim Langste<strong>in</strong> Franz Startklar Schätzel Rosenheim Deutschland fhro@startklar-schaetzel.de<br />
Rosenheim Diwischek Maria Soziale Stadt Rosenheim Rosenheim Deutschland mite<strong>in</strong>ander@cablenet.de<br />
Rosenheim Zuber Michael Soziale Stadt Rosenheim Deutschland p.kiefl@grws-rosenheim.de<br />
Landkreis Bitterfeld-Wolfen Laukat Bianca Landkreis Bitterfeld Bitterfeld Deutschland bianca.laukat@landkreis-bitterfeld.de<br />
Landkreis Bitterfeld-Wolfen Elster Sab<strong>in</strong>e Aktiv-Zentrum-Wolfen e.V. Wolfen Deutschland aktiv-zentrum-wolfen@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
Landkreis Bitterfeld-Wolfen Kortmann Sandra Fördervere<strong>in</strong> LandLebenKunstWerk e.V. Zörbig Deutschland <strong>in</strong>fo-pusteblume@arcor.de<br />
Ludwigshafen Eberle Hans Michael Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhe<strong>in</strong> Ludwigshafen am Rhe<strong>in</strong> Deutschland Hans-Michael.Eberle@ludwigshafen.de<br />
Ludwigshafen Mayer Katja Fördervere<strong>in</strong> Offener Kanal Ludwigshafen e. V. Ludwigshafen am Rhe<strong>in</strong> Deutschland katja.mayer@ok-lu.de<br />
Ludwigshafen Neumann Frank Fördervere<strong>in</strong> Offener Kanal Ludwigshafen e. V. Ludwigshafen am Rhe<strong>in</strong> Deutschland frankneumann@oggersheim.<strong>in</strong>fo<br />
Hamburg Geng Christiane Bezirksamt Altona Hamburg Deutschland christiane.geng@altona.hamburg.de<br />
Hamburg Oehler Wolfgang Convent GmbH Hamburg Deutschland oehler@convent-hamburg.de<br />
Hamburg Wiese He<strong>in</strong>er Bezirksamt Altona Hamburg Deutschland he<strong>in</strong>er.wiese@altona.hamburg.de<br />
Köln Kossack Lothar Stadt Köln Köln Deutschland lothar.kossack@stadt-koeln.de<br />
Köln Reis<strong>in</strong>ger Monika Bürgerschaftshaus Köln Deutschland monika.reis<strong>in</strong>ger@buergerschaftshaus.de<br />
Köln Werwach-Bayer Eva Veedel e.V. Deutschland<br />
Potsdam Moser Peter Manne e.V. Potsdam Deutschland <strong>in</strong>fo@mannepotsdam.de
Potsdam Röder Gabriele Stadtverwaltung Potsdam Potsdam Deutschland gabriel.roeder@rathaus.potsdam.de<br />
Potsdam Dör<strong>in</strong>g Heiko Manne e.V. - Potsdam Potsdam Deutschland <strong>in</strong>fo@mannepotsdam.de<br />
Mannheim Hasselbach Klaus Diakonisches Werk Mannheim Mannheim Deutschland ra<strong>in</strong>weidenstrasse@diakonie-mannheim.de<br />
Mannheim Römmich Margot ProFimannheim Mannheim Deutschland roemmich@profimannheim.de<br />
Mannheim Schenck Ursula Stadt Mannheim Mannheim Deutschland ursula.schenck@mannheim.de<br />
Johanngeorgenstadt Neubert Christiane Stadtverwaltung Johanngeorgenstadt Deutschland ch.neubert@johanngeorgenstadt.de<br />
Johanngeorgenstadt Scholz Michael Outdoor Team Westerzgebirge e.V. <strong>und</strong> KJR Johanngeorgenstadt Deutschland outdoorteam@gmx.de<br />
Johanngeorgenstadt Gruber Jana Outdoor Team e.V. Johanngeorgenstadt Deutschland outdoorteam@gmx.de<br />
Senator für Arbeit, Frauen, Ges<strong>und</strong>heit, Jugend <strong>und</strong><br />
Bremen Siegel Renate Bremen Deutschland Renate.Siegel@soziales.bremen.de<br />
Soziales<br />
Bremen Bernhard Claudia Bremerarbeit gmbh Bremen Deutschland claudia.bernhard@bremerarbeit.de<br />
Bremen Stöver Dirk Amt für Soziale Dienste Bremen Deutschland dirk.stoever@afsd.bremen.de<br />
Wilhelmshaven Päsler Ra<strong>in</strong>er Stadt Wilhelmshaven Wilhelmshaven Deutschland ra<strong>in</strong>er.paesler@stadt.wilhelmshaven.de<br />
Wilhelmshaven Stahlhut Thorsten Job Center Wilhelmshaven Wilhelmshaven Deutschland Thorsten.Stahlhut@arge-sgb2.de<br />
Wilhelmshaven Wichards Claudia hs bremer str. Wilhelmshaven Deutschland wichards-schule@gmx.de<br />
Rostock Bäumler Claudia Charisma e.V. Rostock Deutschland Claudia.baeumler@charismarostock.de<br />
Rostock Witt Petra Amt für Jugend <strong>und</strong> Soziales Rostock Deutschland Petra.Witt@Rostock.de<br />
Rostock Zenkert Christiane nordost -art Rostock Deutschland zenkert@nordost-art.de<br />
B<strong>und</strong>esland Bayern Schmiedt da Silva Angelika Landesarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft Jugendsozialarbeit Bayern München Deutschland schmiedtdasilva@web.de<br />
LAG Jugendsozialarbeit Bayern c/o Evang.<br />
B<strong>und</strong>esland Bayern Götz Elisabeth<br />
München Deutschland kontakt@ejsa-bayern.de<br />
Jugendsozialarbeit Bayern e.V.<br />
B<strong>und</strong>esland Berl<strong>in</strong> Grosch Kerst<strong>in</strong> Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH Berl<strong>in</strong> Deutschland kerst<strong>in</strong>.grosch@gsub.de<br />
B<strong>und</strong>esland Berl<strong>in</strong> Kiefer Jörg Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH Berl<strong>in</strong> Deutschland joerg.kiefer@gsub.de<br />
B<strong>und</strong>esland Sachsen Zenk Burkhard Unit Consult<strong>in</strong>g Group Chemnitz Deutschland zenk@unitconsult<strong>in</strong>g.de<br />
Gesellschaft für Arbeits- <strong>und</strong> Wirtschaftsförderung des<br />
B<strong>und</strong>esland Thür<strong>in</strong>gen Kresse Kirst<strong>in</strong> Erfurt Deutschland esf@gfaw-thuer<strong>in</strong>gen.de<br />
Freistaats Thür<strong>in</strong>gen mbH<br />
EVU - Bus<strong>in</strong>ess Centre for Start up, Growth and<br />
Denmark_valby Bjerregaard Troels Valby Denmark tbj@evu.dk<br />
Development<br />
Denmark_valby Degn Dorthe Marie EVU Bus<strong>in</strong>ess Centre Valby Denmark dd@evu.dk<br />
F<strong>in</strong>nland Turkia Riikka-Maria M<strong>in</strong>istry of Labour Governement F<strong>in</strong>land riikka-maria.turkia@mol.fi<br />
F<strong>in</strong>nland-jyväskylä Tervaniemi Matti Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry Jyväskylä F<strong>in</strong>land matti.tervaniemi@kyt.fi<br />
F<strong>in</strong>nland-ilmolahti Pekkar<strong>in</strong>en Sirpa Keski-Suomen Kylät ry Ilmolahti F<strong>in</strong>land sirpa.pekkar<strong>in</strong>en@pp.<strong>in</strong>et.fi<br />
F<strong>in</strong>nland-suomusjärvi Peltomäki Pirja The Village Action Association of F<strong>in</strong>land Suomusjärvi F<strong>in</strong>land pirja.peltomaki@kylatoim<strong>in</strong>ta.fi<br />
F<strong>in</strong>nland-suomusjärvi Tikkanen Outi<br />
F<strong>in</strong>nland-hankasalmi Seppälä Ti<strong>in</strong>a Maaseutukehitys ry Hankasalmi F<strong>in</strong>land ti<strong>in</strong>a.seppala@pp3.<strong>in</strong>et.fi<br />
Potsdam Röder Gabriele Stadtverwaltung Potsdam Potsdam Deutschland gabriel.roeder@rathaus.potsdam.de<br />
Frankreich-rhone alpes Garnatz Christ<strong>in</strong>e Association PONTIAS Les Pilles France pontias@club-<strong>in</strong>ternet.fr<br />
Frankreich-rhone alpes Gaus Kathr<strong>in</strong> Association PONTIAS Les Vans France GAUS.Kathr<strong>in</strong> [gaus.kathr<strong>in</strong>@wanadoo.fr]
Frankreich Douat Rémi L'atelier Journaliste remi.douat@regards.fr<br />
Frankreich Didier Myriam CRES POITOU-CHARENTES France pch.cres.md@wanadoo.fr<br />
Frankreich Beaulieu David Echomer La Rochelle France echomer@wanadoo.fr<br />
Frankreich Mac Gregor Kar<strong>in</strong> Granulana Chalandray France mcgregoran@gmail.com<br />
Frankreich Mordant Gilles Fairplaylist paris France gilles@fairplaylist.org<br />
Frankreich Vipard Laëtitia ARDEVA Paris France laetitia.vipard@ardeva.org<br />
Italien-Florenz Rosa Sergio Region Toskana Pistoia Italy s.rosa@regione.toscana.it<br />
Italien-Florenz Goldbach Christ<strong>in</strong>e ESPRIT soc. cons. a r.l. Prato Italy a.goldbach@esprit.toscana.it<br />
Italien-Florenz Rizzo<br />
Al<br />
Filippo<br />
d<br />
ESPRIT soc. cons. a r.l. Florence Italy f.rizzo@esprit.toscana.it<br />
Italien-Napoli Barbarella Carla CIDIS Onlus Perugia Italy perugia@cidisonlus.org<br />
Italien-Napoli Terreri Maria Teresa CIDIS Onlus Napoli Italy mterreri@cidisonlus.org<br />
Italien-Napoli Pierri Paola CIDIS Onlus Napoli Italy ppierri@cidisonlus.org<br />
Italien-Tur<strong>in</strong> Accornero Mauro UNIONFIDI S.C. Tur<strong>in</strong> Italy <strong>in</strong>fo@studioaccornero.eu<br />
Italien-Tur<strong>in</strong> Toscano Crist<strong>in</strong>a<br />
Italien-Ttur<strong>in</strong> Lambiase Nadia UNION.ETICA Tur<strong>in</strong> Italy nadialambi@tor<strong>in</strong>ofacile.it<br />
Italien-Bozen Stenico Alberto SOLIDARIS Bozen Italy alberto.stenico@legacoopb<strong>und</strong>.coop<br />
Italien-Bozen Struggl Birgit Italy Birgit.Struggl@legacoopb<strong>und</strong>.coop<br />
Italien Panasiti Anton<strong>in</strong>o D.T.M srl Tur<strong>in</strong> Italy segreteria@d-t-m.it<br />
Prag Gajdos Marek NROS Prague Czech Republic marek.gajdos@nros.cz<br />
Prag Ochranova Karol<strong>in</strong>a NROS Prague Czech Republic karol<strong>in</strong>a.ochranova@nros.cz<br />
Prag Abdalla Lamis Civil Society Development Fo<strong>und</strong>ation (NROS) Prague 8 Czech Republic lamis.abdalla@nros.cz<br />
Spanien-Madrid Cenjor del Rey Vanesa F<strong>und</strong>ación Luís Vives Madrid Spa<strong>in</strong> v.cenjor@f<strong>und</strong>acionluisvives.org<br />
Sweden Hallberg Ronny Bryggeriet Klagstorp Sweden ronny@bryggeriet.org<br />
Sweden Lukkerz Christoph Sweden<br />
Sweden Olofsson Stefan Växtkraft Mål 3, Lokal -Utveckl<strong>in</strong>g Barsebäck Sweden mail.to.olofsson@telia.com<br />
Sweden Svensson Peter Sweden<br />
Sweden Nilsson Peter Sweden<br />
Sweden_Skane Stigzelius Håkan Coompanion Gotenburg Sweden hakan@stz.se<br />
Uk-Coventry Costello T<strong>in</strong>a Heart of England Community Fo<strong>und</strong>ation Coventry United K<strong>in</strong>gdom t<strong>in</strong>a@heartofenglandcf.co.uk<br />
Uk-Coventry Moody Philip Motovate UK Ltd Coventry United K<strong>in</strong>gdom phil@motorvateUK.co.uk<br />
Uk-Coventry Sa<strong>und</strong> Harjit The Sahil Project Coventry United K<strong>in</strong>gdom sahil.project@btopenworld.com<br />
Frankreich Douat Rémi L'atelier Journaliste remi.douat@regards.fr<br />
Frankreich Didier Myriam CRES POITOU-CHARENTES France pch.cres.md@wanadoo.fr<br />
Frankreich Beaulieu David Echomer La Rochelle France echomer@wanadoo.fr
Kulturacts<br />
Sternchen (Stadt Itzehoe)<br />
Jessica Lier<br />
André Lier<br />
Veronika Geer<br />
Angelika Geer<br />
Michael Berschauer<br />
Nikita P<strong>in</strong>ig<strong>in</strong><br />
Anne-Krist<strong>in</strong> Scheftner<br />
Viktoria Feist<br />
Viktoria Kovalias<br />
Patricia Koch<br />
Maria Makuschk<strong>in</strong>a<br />
Nikole Trippel<br />
Maria Ehler<br />
Tatjana Koch (Betreuer<strong>in</strong>)<br />
Elena Neumann Betreuer<strong>in</strong>)<br />
Olga Feist (Betreuer<strong>in</strong>)<br />
Margarita Berschauer (Betreuer<strong>in</strong>)<br />
Natali Geer (Betreuer<strong>in</strong>)<br />
Modenschau mit historischen Kostümen<br />
(LK Eichsfeld)<br />
Rolf Eberhardt<br />
Gerl<strong>in</strong>de Vogler<br />
Monika Leukefeld<br />
Angelika Wittgen<br />
Jutta Dramburg<br />
Bernhard Wehner (Betreuer)<br />
Dr. Gert Leukefeld<br />
Birgitt Thume<br />
Cilli Br<strong>in</strong>kmann<br />
Jutta Meys<strong>in</strong>g<br />
Egon Kuchenbuch<br />
Elisabeth Hunold<br />
Jutta Werkmeister<br />
Mar<strong>in</strong>a Blacha<br />
Simone Keil<br />
Ute Fritzsche<br />
Rosi Sander<br />
Margot Lange<br />
Vocalk<strong>in</strong>gs (Ma<strong>in</strong>tal-Dörnigheim)<br />
Klaus Carl<br />
Faruk Tepe<br />
Michael Senaczek<br />
Daniel Weber<br />
Kev<strong>in</strong> Wash<strong>in</strong>gton<br />
Orhan Dadashov<br />
Tony Micelli<br />
Joshua Lorse<br />
Streichorchester Arkadi Spektor<br />
Quartett (Koblenz)<br />
Gennadiy Nudelmann (Manager)<br />
Arkadi Spektor<br />
Mar<strong>in</strong>a Spektor<br />
Michael Spektor<br />
Miron Borodul<strong>in</strong><br />
Tanzgruppe Danc<strong>in</strong>g Queens (Merzig)<br />
Jessica Morbe<br />
Jessica Rose<br />
Loredana Marotta<br />
Annika Altmeier<br />
Svenja Croon<br />
Monika Megharbi (Betreuer<strong>in</strong>)<br />
Lena Gorges<br />
Sarah Fandel<br />
Pol<strong>in</strong>e Martel<br />
Michelle Schweitzer<br />
Kalet Megharbi (Betreuer)<br />
Filmteam (Ludwigshafen)<br />
Hans-Uwe Daumann (Betreuer)<br />
Alfred Schmitt<br />
David Stevenson<br />
David Zabanowski<br />
Torsten Kleb (Betreuer)<br />
Dennis Ewert<br />
Esra Görür<br />
Than Ha Pham<br />
Breakdance (Ingolstadt)<br />
Robert Rudi (Betreuer)<br />
Anton Sosna<br />
Sergej Hafner<br />
Nikolai Bulik<br />
Alex Strelnikov<br />
Streetdance-Connection (Berl<strong>in</strong>-<br />
Neukölln)<br />
Ivan Stevanovic (Betreuer)<br />
Inga Maggi Aldunes<br />
Esra Demirci<br />
Kübra Demirci<br />
Beatrix Viergott<br />
Pr<strong>in</strong>ce Ofori<br />
Hassan Akkouch<br />
Saber Hussa<strong>in</strong>