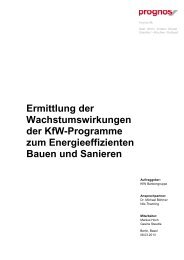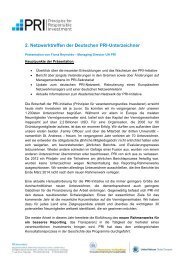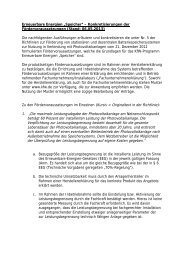"KfW-Gründungsmonitor 2010" (Langfassung, pdf)
"KfW-Gründungsmonitor 2010" (Langfassung, pdf)
"KfW-Gründungsmonitor 2010" (Langfassung, pdf)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
KFW RESEARCH<br />
<strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
LEbHAFtE GRündunGSAKtivität in dER KRiSE<br />
Jährliche Analyse von Struktur und dynamik des<br />
Gründungsgeschehens in deutschland
untERSuCHunG ZuR EntWiCKLunG vOn GRündunGEn iM vOLL- und nEbEnERWERb.<br />
Herausgeber<br />
<strong>KfW</strong> Bankengruppe<br />
Abteilung Volkswirtschaft<br />
Palmengartenstraße 5-9<br />
60325 Frankfurt am Main<br />
Telefon 069 7431-0, Telefax 069 7431-2944<br />
www.kfw.de<br />
Autoren<br />
Dr. Karsten Kohn, <strong>KfW</strong> Bankengruppe<br />
Dr. Katrin Ullrich, <strong>KfW</strong> Bankengruppe<br />
Prof. Dr. Hannes Spengler, Fachhochschule Mainz<br />
ISSN 1867-1489<br />
Frankfurt am Main, Juni 2010
Auf einen Blick<br />
• Im Jahr 2009 haben 872.000 Personen eine selbstständige Tätigkeit begonnen. Erstmals<br />
seit sechs Jahren sind damit wieder steigende Gründerzahlen zu verzeichnen.<br />
1.500<br />
1.000<br />
500<br />
1.290<br />
695<br />
596<br />
1.548<br />
932<br />
616<br />
1.461<br />
791<br />
1.496<br />
841<br />
1.357<br />
706<br />
669 655 651<br />
1.286<br />
678<br />
1.088<br />
0<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
608<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb<br />
Grafik: Anzahl der Unternehmensgründer 2000–2009 (in Tsd.)<br />
• Die Wirtschaftskrise zeigt sich in einer Polarisierung der Gründungsaktivität: Zum einen<br />
hat sich für jeden fünften Gründer der Druck für den Schritt in die Selbstständigkeit erhöht.<br />
Zum anderen eröffnete die Krise nahezu ebenso vielen Gründern eine explizite Gründungschance.<br />
• Gut ein Fünftel der Gründer war vor Beginn der Selbstständigkeit arbeitslos. Dieser Anteil<br />
ist nur marginal höher als im Vorjahr. Unter den vormals arbeitslosen Gründern sind Langzeitarbeitslose<br />
im Rezessionsjahr besonders häufig vertreten.<br />
• Der direkte Bruttobeschäftigungseffekt des Neugründungsgeschehens im Jahr 2009 beträgt<br />
rund 517.000 Vollzeitstellen. In der Krise wurden nicht nur mehr Gründungen mit Mitarbeitern,<br />
sondern auch im Durchschnitt größere Gründungen als in den Vorjahren realisiert.<br />
• Die Gründungsfinanzierung ist weiterhin durch kleine Losgrößen gekennzeichnet. Rund<br />
drei Viertel der Gründer mit Mittelbedarf bleiben innerhalb des Mikrofinanzierungsbereichs<br />
von bis zu 25.000 EUR. Bei der Deckung des externen Finanzierungsbedarfs dominieren<br />
Darlehen (längerfristige Bankdarlehen, Kontokorrentfinanzierungen und Förderkredite), die<br />
im Vergleich zum Vorjahr nochmals an Bedeutung gewonnen haben.<br />
• Jeder vierte Gründer mit externem Finanzierungsbedarf klagt über Schwierigkeiten bei der<br />
Gründungsfinanzierung. Gründer, die im schwierigen Umfeld der Krise ihr Projekt verwirklicht<br />
haben, waren jedoch vergleichsweise gut vorbereitet und besaßen so bessere Chancen,<br />
potenzielle Kapitalgeber zu überzeugen. Dies zeigt sich in einem signifikanten Rückgang<br />
der Finanzierungsschwierigkeiten im Vergleich zum Vorjahr.<br />
• Die Anfangssterblichkeit von Gründungen ist nach wie vor hoch. Rund ein Viertel aller<br />
Gründungen ist nach spätestens drei Jahren wieder aus dem Markt ausgeschieden.<br />
643<br />
446<br />
859<br />
544<br />
315<br />
795<br />
465<br />
330<br />
872<br />
475<br />
397
Executive Summary<br />
10 Jahre <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong><br />
[1] Seit dem Jahr 2000 erhebt die <strong>KfW</strong> Bankengruppe jährlich die repräsentative Bevölkerungsbefragung<br />
zum <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>. In diesen zehn Jahren hat sich der <strong>KfW</strong>-<br />
<strong>Gründungsmonitor</strong> zur umfassendsten Informationsquelle über das Gründungsgeschehen<br />
in Deutschland entwickelt. Für die vorliegende Jubiläumsausgabe des <strong>Gründungsmonitor</strong>-Berichts<br />
wurden 50.000 Personen zu ihrem Gründungsverhalten im<br />
Jahr 2009 befragt. Die große Fallzahl ermöglicht detaillierte Analysen zur Struktur des<br />
aktuellen Gründungsgeschehens. Darüber hinaus liefert eine Verknüpfung der vorliegenden<br />
zehn Befragungswellen wertvolle Erkenntnisse zur Dynamik der Gründungsaktivität.<br />
Belebung des Gründungsgeschehens in der Wirtschaftskrise<br />
[2] Im Jahr 2009 haben 872.000 Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren eine selbstständige<br />
Tätigkeit im Voll- oder Nebenerwerb begonnen. 397.000 Personen (46 %) haben<br />
sich im Vollerwerb und 475.000 Personen (54 %) im Nebenerwerb selbstständig gemacht.<br />
Bezogen auf die Gesamtbevölkerung im Alter von 18 bis 64 Jahren entspricht<br />
dies einer Gesamtgründerquote von 1,7 % (Vollerwerb: 0,8 %, Nebenerwerb: 0,9 %).<br />
[3] Im Vergleich zum Jahr 2008, in dem rund 795.000 Personen eine selbstständige Tätigkeit<br />
begonnen haben (Gesamtgründerquote 1,5 %), hat sich das Gründungsgeschehen<br />
insgesamt mit einer Zunahme der Gründerzahl um 10 % merklich belebt. Damit ist<br />
nach dem Abwärtstrend in den Jahren 2004 bis 2008 erstmals wieder ein Anstieg der<br />
Gründungsaktivität zu verzeichnen. Besonders stark ist die Zahl der Vollerwerbsgründer<br />
um 67.000 (+20 %) gestiegen. Aber auch im Nebenerwerb geht die Gründerzahl<br />
erstmals seit sechs Jahren nicht weiter zurück (+2 % bzw. 10.000 Gründer).<br />
[4] Der Anstieg der Gründerzahl resultiert aus dem Zusammenspiel von Konjunktureinbruch<br />
und verschlechterter Arbeitsmarktsituation. Auf der einen Seite haben die höhere<br />
Arbeitslosenquote und die geschmälerten Perspektiven in abhängiger Beschäftigung<br />
vor allem Gründer im Vollerwerb hervorgebracht. Auf der anderen Seite generiert der<br />
dramatische Konjunktureinbruch insofern einen gegenläufigen Effekt zur Push-Wirkung<br />
der Arbeitslosigkeit, als die Risiken für Gründungen steigen und Gründungswillige besonders<br />
Hinzuverdienstprojekte als weniger aussichtsreich einstufen. Dieser negativ<br />
wirkende Pull-Effekt beeinflusst insbesondere Nebenerwerbsgründer, deren Zahl nach<br />
Aufrechnung beider Effekte nahezu konstant geblieben ist.
IV <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
[5] Im Jahr der Wirtschaftskrise zeigt sich eine Polarisierung der Gründungsaktivität. Einerseits<br />
hat sich durch die Rezession für ein Fünftel aller Gründer nach eigener Aussage<br />
der Druck für den Schritt zur Selbstständigkeit erhöht, andererseits eröffnete die<br />
Krise auch besondere Gründungschancen (für 17 % aller Gründer). Entsprechend ist<br />
bei gleich gebliebenem Anteil von Notgründern (34 %) ein höherer Anteil von Chancengründern<br />
(39 %) als im Jahr zuvor zu verzeichnen, der zu Lasten eines geringeren<br />
Anteils von Gründern mit sonstigem Hauptmotiv (27 %, hierunter z. B. Hinzuverdienstoder<br />
Selbstverwirklichungsziele) geht. Die Krise wirkte demnach als Impulsgeber,<br />
Gründungsprojekte umzusetzen. Knapp die Hälfte aller Gründer (44 %) gibt jedoch an,<br />
dass die Wirtschaftskrise bis zum Befragungszeitraum im zweiten Halbjahr 2009 keine<br />
Auswirkungen auf die eigene Gründung hatte.<br />
Gründungsgeschehen in den Regionen<br />
[6] In Westdeutschland lag die Gesamtgründerquote mit 1,8 % im Jahr 2009 wie im Vorjahr<br />
höher als in Ostdeutschland (1,3 %) und auch die Zunahme der Gründungsaktivität<br />
fiel im Osten insgesamt schwächer als im Westen aus. So stieg die Zahl der Gründer in<br />
Westdeutschland um 11 % auf 752.000 und in Ostdeutschland um 7 % auf 122.000 an.<br />
[7] Die Betrachtung nach Bundesländern untermauert die Einschätzung, dass einer höhere<br />
ökonomische Aktivität einer Region positiv auf die Gründungsintensität wirkt (Pull-<br />
Effekt). So weisen neben den Stadtstaaten Berlin und Hamburg auch Flächenländer<br />
wie Hessen und Bayern mit einem hohen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf eine überdurchschnittliche<br />
Gründerquote auf. Darüber hinaus zeigt sich auch in der Analyse auf<br />
Bundesländerebene der Push-Effekt der Arbeitslosigkeit.<br />
Strukturmerkmale der Gründungen<br />
[8] Eine Betrachtung nach Gründungsform, d. h. nach Neugründungen, Übernahmen und<br />
Beteiligungen zeigt, dass Neugründungen mit einem Anteil von gut 69 % an allen Gründungsprojekten<br />
die bedeutendste Gründungsform darstellen. Knapp 13 % des gesamten<br />
Gründungsgeschehens sind Übernahmen und 18 % Beteiligungen.<br />
[9] Im Vergleich zum Vorjahr sind die Anteile von Neugründern im Vollerwerb um fast<br />
12 Prozentpunkte (von 79 % auf 67 %) zurückgegangen. Dem stehen fast ebenso hohe<br />
Zunahmen bei den Gründern mit Übernahmen gegenüber (von 8 % auf 19 %). Dieses<br />
Muster zeigt sich auch im Vergleich der Jahre 2002 und 2001. „In die Krise hinein“<br />
gründen offenbar viele Personen ein neues Unternehmen, die dies unabhängig von der<br />
wirtschaftlichen Lage vorhaben; gleichzeitig erscheint die Übernahme eines etablierten<br />
Unternehmens in solchen Zeiten einfacher als ein kompletter Neuanfang. Erst wenn die
Executive Summary V<br />
Krise auch den Arbeitsmarkt erreicht, erhöht sich durch die Push-Wirkung auf das<br />
Gründungsgeschehen neben den Gründerzahlen per se auch wieder der Anteil der<br />
Neugründer.<br />
[10] Nur ein kleiner Teil der Gründer (im Vollerwerb) startet sein Projekt außerhalb des<br />
Dienstleistungsbereiches [Verarbeitendes Gewerbe 3 % (5 %), Baugewerbe 7 %<br />
(11 %) sonstige Nicht-Dienstleistungsbranchen 7 % (2 %)]. Entsprechend beträgt der<br />
Anteil der Gründer (Vollerwerbsgründer) im Dienstleistungssektor 83 % (82 %) und<br />
liegt über dem Anteil der Dienstleister an den kleinen und mittleren Bestandsunternehmen<br />
(ca. 76 %). Dies deutet auf eine voranschreitende Tertiarisierung der deutschen<br />
Wirtschaft hin.<br />
[11] Der Innovationsgehalt des Gründungsgeschehens wird im <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong><br />
durch die Frage: „Stellen die Produkte oder Dienstleistungen, die Sie anbieten, eine regionale,<br />
nationale oder weltweite Marktneuheit dar?“ eruiert. Knapp 9 % der Gründer<br />
geben an, eine regionale Marktneuheit anzubieten, jeweils 2 % geben an, eine<br />
deutschlandweite oder eine weltweite Marktneuheit anzubieten. Demnach waren im<br />
Jahr 2009 knapp 13 % der Gründungsprojekte innovativ. Im Vollerwerb liegt der Anteil<br />
bei 15 %. Diese Anteile unterscheiden sich kaum von früheren Jahren.<br />
[12] Eine Sichtung der Projektbeschreibungen lässt Zweifel daran aufkommen, dass es sich<br />
bei den als neu bezeichneten Geschäftsideen tatsächlich um Innovationen im Schumpeter’schen<br />
Sinn handelt. Die kritische Beurteilung der Innovationsangaben führt vielmehr<br />
zu dem Schluss, dass der Anteil tatsächlich innovativer Gründungen noch geringer<br />
als die beobachteten 13 % ist.<br />
Gestiegener Bruttobeschäftigungseffekt der Gründungen<br />
[13] In Neugründungen des Jahres 2009 sind rund 517.000 vollzeitäquivalente Stellen entstanden<br />
(direkter Bruttobeschäftigungseffekt des Gründungsgeschehens). Davon entfallen<br />
ca. 267.000 Stellen auf die (Vollerwerbs-) Neugründer selbst und gut 250.000<br />
Stellen auf angestellte Mitarbeiter.<br />
[14] Das Frageprogramm des <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>s erlaubt eine Berechnung des Bruttobeschäftigungseffekts<br />
ab dem Erhebungsjahr 2005. Der Bruttobeschäftigungseffekt<br />
des Jahres 2009 übertrifft die Werte aller Vorjahre mit Ausnahme des Jahres 2005, in<br />
dem jedoch auch die Gründerquote (2,47 %) wegen der damals sehr hohen Arbeitslosigkeit<br />
wesentlich höher lag. Zwischen 2005 und 2008 war der Bruttobeschäftigungseffekt<br />
von 799.000 auf 447.000 vollzeitäquivalente Stellen gesunken.
VI <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
[15] Der mittlere Bruttobeschäftigungseffekt einer Neugründung beträgt im Jahr 2009 1,69<br />
vollzeitäquivalente Stellen im Voll- und 0,37 vollzeitäquivalente Stellen im Nebenerwerb.<br />
Die Vorjahreswerte lagen mit 1,56 bzw. 0,25 Stellen etwas niedriger.<br />
Wer gründet? Individuelle Bestimmungsgründe der Gründungsentscheidung<br />
[16] Nach Kontrolle jeweils aller anderen Merkmale besitzen Männer, Nicht-EU-Ausländer,<br />
Universitätsabsolventen, Absolventen von Fach- und Meisterschulen, angestellte Unternehmens-<br />
oder Geschäftsführer, leitende oder hoch qualifizierte Angestellte und Arbeitslose<br />
signifikant höhere Gründungswahrscheinlichkeiten. Andererseits sind Frauen,<br />
ältere Menschen (55–64 Jahre) und Beamte signifikant seltener unter den Gründern im<br />
Vollerwerb anzutreffen. Demnach gründen sowohl Personen mit besseren formalen<br />
Qualifikationen und damit höherem Humankapital, als auch Personen, für die eine<br />
selbstständige Erwerbstätigkeit häufig die einzige Erwerbsalternative darstellt, überdurchschnittlich<br />
häufig.<br />
[17] Jeder fünfte Gründer insgesamt (20 %) und knapp jeder dritte Vollerwerbsgründer<br />
(30 %) war vor bzw. bei Gründung arbeitslos. Diese Anteile liegen weit über der Erwerbslosenquote.<br />
Bei Gründern aus der Arbeitslosigkeit überwiegt das Notmotiv<br />
(53 %); andererseits geben auch 38 % die Ausnutzung einer Geschäftsidee als vorrangiges<br />
Gründungsmotiv an; weniger als 10 % berichten einen anderen Hauptgrund. Die<br />
Polarisierung zwischen „Not“ und „Chance“ ist bei Gründern aus der Arbeitslosigkeit<br />
stärker ausgeprägt als bei anderen Gründern.<br />
Gründung: ein häufig beschrittener Weg aus der Langzeitarbeitslosigkeit<br />
[18] Vollerwerbsgründungen aus der Arbeitslosigkeit wurden im Jahr 2009 in fast der Hälfte<br />
der Fälle (47 %) von Langzeitarbeitslosen unternommen. Der Langzeitarbeitslosenanteil<br />
an allen Vollerwerbsgründern aus der Arbeitslosigkeit liegt deutlich über dem Anteil<br />
von Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen eines Jahres. Eine Existenzgründung<br />
stellt deshalb gerade für langzeitarbeitslose Menschen eine relativ häufig gewählte Option<br />
zum Wiedereintritt in die Arbeitswelt dar.<br />
[19] Die Entwicklung des Langzeitarbeitslosenanteils an allen Vollerwerbsgründern im Zeitraum<br />
2005–2009 zeigt hohe Werte bei schlechter Konjunktur und umgekehrt. Demnach<br />
könnten Rezessionen in Bezug auf Langzeitarbeitslose einen „doppelten“ Push-Effekt<br />
bewirken: Neben dem Push-Effekt der Arbeitslosigkeit per se entsteht in der Rezession<br />
ein zusätzlicher Gründungsdruck, weil die im Grunde bevorzugten abhängigen Beschäftigungsverhältnisse<br />
gerade für Langzeitarbeitslose noch schwerer zugänglich sind<br />
als in konjunkturell besseren Zeiten.
Executive Summary VII<br />
Nachhaltigkeit von Gründungsprojekten: Hohe Anfangssterblichkeit<br />
[20] Zur Untersuchung der kurzfristigen Mortalität von Gründungsprojekten werden im <strong>KfW</strong>-<br />
<strong>Gründungsmonitor</strong> neben Gründern mit jüngst vollzogener Gründung (Gründung innerhalb<br />
der letzten 12 Monate) auch Gründer erfasst, die ihr Gründungsprojekt mindestens<br />
12, aber höchstens 36 Monate vor dem Befragungszeitpunkt begonnen haben.<br />
Diese erweiterte Perspektive erlaubt Einblicke in die Nachhaltigkeit von Gründungen in<br />
der kurzen Frist. Es zeigt sich, dass zwischen einem Fünftel und einem Viertel der<br />
Gründer spätestens nach drei Jahren aus dem Markt ausgeschieden sind.<br />
[21] Eine multivariate Analyse der Ursachen des Abbruchs von Gründungsprojekten kommt<br />
zu dem Ergebnis, dass Gründer mit Wohnsitz in Ostdeutschland, in den Freien Berufen<br />
und im Handwerk sowie mit einem Finanzmitteleinsatz von über 10.000 EUR signifikant<br />
länger am Markt verbleiben. Gründer, die vor Gründung als Facharbeiter oder sonstige<br />
Arbeiter tätig waren, ihre Gründung als Beteiligung an einem bereits bestehenden Unternehmen<br />
vollziehen, ein Handelsunternehmen gründen, deren Produkt oder Dienstleistung<br />
eine „nur“ regionale Marktneuheit darstellt oder die Teamgründer ohne Mitarbeiter<br />
sind, haben dagegen eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit, mit ihrem Projekt<br />
frühzeitig zu scheitern.<br />
Gründungsfinanzierung: Mitteleinsatz größtenteils kleinvolumig<br />
[22] Gut zwei Drittel aller Gründer (70 %) haben finanziellen Mittelbedarf zur Finanzierung<br />
von Investitionen und Betriebsmitteln. Dabei ist im Vergleich zu den Vorjahren der Anteil<br />
der Gründer mit Finanzierungsbedarf nochmals gestiegen (2008: 67 %, 2007:<br />
57 %). Jeder zehnte Gründer kommt ganz ohne Mittelbedarf aus und ein Fünftel nutzt<br />
ausschließlich bereits vorhandene Sachmittel, wie beispielsweise eingebrachte Büroräume,<br />
Computer oder Autos. Gründer ohne finanziellen Mittelbedarf treten erwartungsgemäß<br />
häufiger im Neben- als im Vollerwerb auf (Vollerwerb 24 %, Nebenerwerb<br />
35 %).<br />
[23] Ein Großteil der Gründer mit Sach- bzw. Finanzmittelbedarf (46 %) gibt einen Gesamtmittelbedarf<br />
von unter 5.000 EUR an, während nur rund 10 % einen Gesamtmittelbedarf<br />
von über 50.000 EUR aufweisen. Drei von vier Gründern mit Mittelbedarf<br />
(76 %) bleiben innerhalb des Mikrobedarfs von 25.000 EUR. Das Gros der Gründungen<br />
fällt somit in die Kategorie der Klein- und Kleinstgründungen mit keinem oder nur<br />
geringem Mittelbedarf. Bei mittleren und größeren Gründungsprojekten kommt finanziellen<br />
Mitteln im Vergleich zu Sachmitteln erwartungsgemäß eine wichtigere Rolle zu.
VIII <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
[24] Einerseits sind mehr Gründungen den Kleinstgründungen mit einem Gesamtmitteleinsatz<br />
von bis zu 10.000 EUR zuzurechnen (2009: 65 %, 2008: 62 %, 2007: 57 %); andererseits<br />
ist auch der Anteil der größeren Gesamtmittelbedarfe in Höhe von über<br />
25.000 EUR von 19 % in 2007 über 20 % in 2008 auf 24 % in 2009 angewachsen. Im<br />
Sinne einer Polarisierung haben in der Wirtschaftskrise zum einen mehr Gründer kleine,<br />
wenig kapitalintensive Selbstständigkeiten begonnen, zum anderen schlagen mehr<br />
größere Gründungen zu Buche.<br />
Nutzung von Finanzierungsquellen: Bankdarlehen und Förderkredite dominieren<br />
[25] Ein erheblicher Anteil der Gründungsprojekte wird mit eigenen Mitteln der Gründer finanziert.<br />
63 % der Gründer mit finanziellem Mittelbedarf setzen ausschließlich eigene<br />
Mittel ein, während weitere 30 % sowohl eigene als auch externe Mittel, wie beispielsweise<br />
Bankkredite, Förderdarlehen oder Förderzuschüsse der Bundesagentur für Arbeit<br />
nutzen. Mit 37 % ist der Anteil der Gründer, die für ihren Finanzierungsbedarf auf<br />
Mittel externer Kapitalgeber zurückgegriffen haben, im Vergleich zum Vorjahr nahezu<br />
unverändert geblieben.<br />
[26] Zur Deckung des externen Finanzierungsbedarfs setzt ein Großteil der Gründer mit<br />
Nutzung externer Mittel längerfristige Bankdarlehen (51 %), Kontokorrentfinanzierungen<br />
(34 %) und/oder Förderkredite (29 %) ein. Darlehen und Schenkungen von Verwandten<br />
und Bekannten, Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit und sonstige Finanzierungsquellen<br />
wie Mezzanine- oder Beteiligungskapital kamen seltener zum Einsatz.<br />
Im Krisenjahr 2009 ist die Häufigkeit der Kreditfinanzierungsvarianten deutlich angestiegen<br />
(längerfristige Bankdarlehen im Vergleich zum 2008 um 16 Prozentpunkte,<br />
Kontokorrentfinanzierungen um 19 Prozentpunkte, Förderkredite um 11 Prozentpunkte).<br />
[27] Auch in der Volumenbetrachtung dominieren Kreditfinanzierungen in Form von längerfristigen<br />
Bankdarlehen (46 % des externen Finanzierungsvolumens), Förderkrediten<br />
(14 %) und Kontokorrentkrediten (10 %), wobei analog zur Nutzungshäufigkeit dieser<br />
Quellen auch die Volumenanteile im Jahr 2009 zugenommen haben. Fördermittel der<br />
Bundesagentur für Arbeit (Volumenanteil 5 %) und Mittel von Verwandten und Bekannten<br />
(18 %) werden nach Möglichkeit in Anspruch genommen, reichen zur Finanzierung<br />
größerer Investitionen jedoch bei Weitem nicht aus.<br />
Finanzierungsschwierigkeiten: Gründer von Krise weniger betroffen<br />
[28] Während der weit überwiegende Anteil der Befragten keine Schwierigkeiten mit der<br />
Finanzierung der Gründung hatte, klagen 10 % aller Gründer im Jahr 2009 über Finan-
Executive Summary IX<br />
zierungsprobleme im Gründungszusammenhang. Die häufigste Schwierigkeit stellen<br />
unzureichende Eigenmittel dar (54 % der Gründer mit Finanzierungsschwierigkeiten)<br />
und jeder dritte (29 % der Gründer mit Finanzierungsschwierigkeiten) hat einen beantragten<br />
Bankkredit nicht erhalten.<br />
[29] Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil der Gründer mit Finanzierungsschwierigkeiten<br />
um 6 Prozentpunkte signifikant zurückgegangen. Hierfür verantwortlich ist zum einen<br />
die Tatsache, dass unter den Gründern, die im schwierigen Umfeld der Wirtschaftskrise<br />
den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben, vergleichsweise viele gut vorbereitet<br />
waren und so bessere Chancen besaßen potenzielle Kapitalgeber zu überzeugen, als<br />
Gründer mit weniger überlegten Projekten zu besseren Zeiten. Zum anderen mögen<br />
Banken angesichts der eingebrochenen Investitionskreditnachfrage etablierter Unternehmen<br />
verstärkt auf die Finanzierung von Gründern und jungen Unternehmen gesetzt<br />
haben.<br />
[30] Nur selten haben Gründer Finanzierungsschwierigkeiten erfahren und daraufhin auf<br />
eine Finanzierung ganz verzichtet oder sich auf eigene Mittel beschränkt. Allerdings<br />
haben Gründer mit externem Finanzmitteleinsatz überdurchschnittlich häufig mit<br />
Schwierigkeiten zu kämpfen (23 %). Auch dieser Wert liegt unter dem Niveau des Vorjahres<br />
(32 %). In den vorliegenden (wie auch den vorangegangenen) Auswertungen<br />
der Befragungsdaten werden allerdings potenzielle Gründer nicht erfasst, die durch<br />
(Finanzierungs-)Schwierigkeiten gänzlich an einer Realisierung ihrer Gründungsidee<br />
gehindert worden sind. Insofern wird das Ausmaß von Finanzierungsschwierigkeiten<br />
insgesamt tendenziell unterschätzt.<br />
[31] Eine im diesjährigen <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> erstmals mögliche multivariate Untersuchung<br />
zu den Determinanten des Auftretens von Finanzierungsschwierigkeiten unterstreicht<br />
die Einschätzung, dass Gründer mit umfangreicheren Projekten stärker von Finanzierungsschwierigkeiten<br />
betroffen sind: Schwierigkeiten treten signifikant häufiger<br />
bei Gründern im Vollerwerb sowie bei höherem Finanzmitteleinsatz (> 10.000 EUR)<br />
auf. Darüber hinaus berichten jüngere Gründer, Gründer aus der Arbeitslosigkeit, jene<br />
ohne Berufsabschluss und Nicht-EU-Ausländer häufiger von Finanzierungsschwierigkeiten,<br />
während leitende oder hoch qualifizierte Angestellte bei der Finanzierung ihrer<br />
Selbstständigkeit signifikant seltener auf Schwierigkeiten stoßen.
Inhaltsverzeichnis<br />
Auf einen Blick ........................................................................................................................I<br />
Executive Summary ..............................................................................................................III<br />
Inhaltsverzeichnis ................................................................................................................ XI<br />
Abbildungsverzeichnis ....................................................................................................... XII<br />
Tabellenverzeichnis ........................................................................................................... XIV<br />
1 Einleitung ....................................................................................................................1<br />
2 Der <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>......................................................................................3<br />
2.1 Methodik und Struktur...................................................................................................3<br />
2.2 Abgrenzung zu anderen Datensätzen mit Gründungsbezug........................................6<br />
2.3 Zentrale Definitionen und Konventionen.....................................................................10<br />
3 Entwicklung und Struktur des Gründungsgeschehens........................................13<br />
3.1 Aktuelle Entwicklungen von Gründerquote und Gründerzahl .....................................14<br />
3.2 Strukturmerkmale der Gründungen ............................................................................29<br />
3.3 Bruttobeschäftigungseffekt des Gründungsgeschehens ............................................37<br />
4 Analysen zu Beginn und Abbruch von Gründungsprojekten ..............................43<br />
4.1 Wer gründet? Bestimmungsgründe der individuellen Gründungsentscheidung.........43<br />
4.2 Abbruch von Gründungsprojekten ..............................................................................57<br />
5 Gründungsfinanzierung ...........................................................................................63<br />
5.1 Mittelbedarf der Gründer.............................................................................................64<br />
5.2 Finanzierungsschwierigkeiten.....................................................................................74<br />
6 Fazit............................................................................................................................87<br />
Literatur.................................................................................................................................91<br />
Anhang ................................................................................................................................101
Abbildungsverzeichnis<br />
Grafik 1: Gründerquoten in Deutschland 2000–2009 ....................................................15<br />
Grafik 2: Gründungsaktivität im Konjunkturablauf .........................................................17<br />
Grafik 3: Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf Gründer.............................................22<br />
Grafik 4: Gründerquoten in West- und Ostdeutschland 2000–2009..............................24<br />
Grafik 5: Gründerquoten nach Bundesländern (Durchschnitt 2005–2009) ...................27<br />
Grafik 6: Gründer nach Branche (Durchschnitt 2007–2009) .........................................33<br />
Grafik 7: Gründerquote und direkter Bruttobeschäftigungseffekt ..................................41<br />
Grafik 8: Gründungsmotiv nach Erwerbsstatus vor Gründung, 2009 ............................51<br />
Grafik 9: Vollerwerbsgründer aus der Arbeitslosigkeit nach Arbeitslosigkeitsdauer......53<br />
Grafik 10: Beendete Selbstständigkeitsprojekte nach Gründungszeitpunkt....................58<br />
Grafik 11: Mittelbedarf nach Sachmitteln und finanziellen Mitteln, 2009 .........................65<br />
Grafik 12: Höhe des Mittelbedarfs nach Sachmitteln und finanziellen Mitteln, 2009.......67<br />
Grafik 13: Einsatz eigener und externer Mittel durch Gründer mit finanziellem<br />
Mittelbedarf 2009 ............................................................................................68<br />
Grafik 14: Höhe des Finanzmittelbedarfs bei Nutzung eigener bzw. externer<br />
Finanzmittel durch Gründer mit Finanzmittelbedarf 2009 ...............................69<br />
Grafik 15: Externe Finanzierungsquellen nach Häufigkeit und Volumen der<br />
Inanspruchnahme, 2009 .................................................................................71<br />
Grafik 16: Finanzierungsschwierigkeiten von Gründern..................................................76<br />
Grafik 17: Finanzierungsschwierigkeiten nach Finanzierungseinsatz,<br />
Anteile in Prozent............................................................................................78<br />
Grafik 18: Art der Schwierigkeiten von Gründern mit Finanzierungs<br />
schwierigkeiten, 2009 .....................................................................................80<br />
Grafik 19: Gründerquoten nach Gemeindegrößenklassen............................................101<br />
Grafik 20: Form der Gründung (Neugründung, Übernahme oder Beteiligung) .............102<br />
Grafik 21: Gründer nach Branche..................................................................................103<br />
Grafik 22: Gründer nach Berufsgruppe .........................................................................104<br />
Grafik 23: Neuheitsgrad der angebotenen Produkte und Dienstleistungen ..................105
Grafik 24: Größe der Gründung.....................................................................................106<br />
Grafik 25: Größe der Neugründung...............................................................................107<br />
Grafik 26: Gründer nach Staatsangehörigkeit ...............................................................108<br />
Grafik 27: Gründer nach Berufsabschluss.....................................................................109<br />
Grafik 28: Gründer nach Erwerbsstatus ........................................................................110<br />
Grafik 29: Gründer nach hauptsächlichem Gründungsmotiv.........................................111<br />
Grafik 30: Verteilung sonstiger Gründungsmotive.........................................................112
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 1: Ausgewählte Strukturmerkmale der Gründung 2009 (Anteile in Prozent) ......31<br />
Tabelle 2: Bruttobeschäftigungseffekt von Neugründungen 2009...................................40<br />
Tabelle 3: Ausgewählte Merkmale der Gründer 2009 (Anteile in Prozent)......................46<br />
Tabelle 4: Bestimmungsfaktoren der persönlichen Gründungsneigung<br />
(Probitschätzung)............................................................................................55<br />
Tabelle 5: Bestimmungsfaktoren des Abbruchs der Gründungsprojekte<br />
(Probitschätzung)............................................................................................60<br />
Tabelle 6: Bestimmungsfaktoren von Finanzierungsschwierigkeiten<br />
(Probit-Regressionen).....................................................................................82<br />
Tabelle 7: Gründerquoten nach Region, 2000–2009.....................................................113<br />
Tabelle 8: Gründerzahlen (hochgerechnet in Tausend) nach Region, 2000–2009 .......113<br />
Tabelle 9: Push- und Pull-Faktoren des Gründungsgeschehens ..................................114<br />
Tabelle 10: Förderung von Existenzgründungen durch die Bundesagentur<br />
für Arbeit: Instrumentarium ...........................................................................115<br />
Tabelle 11: Form der Gründung ......................................................................................116<br />
Tabelle 12: Gründeranteile nach Geschlecht und Region ...............................................117<br />
Tabelle 13: Gründeranteile nach Alter .............................................................................118<br />
Tabelle 14: Finanzierungsstruktur von Gründungen 2007 bis 2009,<br />
Anteile (bedingte Häufigkeiten) in Prozent....................................................119<br />
Tabelle 15: Finanzierungsstruktur von Gründungen 2007 bis 2009,<br />
Anteile (unbedingte Häufigkeiten) in Prozent................................................120
1 Einleitung<br />
Unternehmensgründungen beziehen ihre Bedeutung aus ihrem positiven Einfluss auf die<br />
Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum von Volkswirtschaften. Neugründungen fördern die<br />
Technologiediffusion in bestehenden Märkten und führen, wenn sie hinreichend innovativ<br />
sind, auch zur Erschließung neuer Märkte. Die Möglichkeit von Eintritten in bestehende Märkte<br />
und Branchen fördert den Wettbewerb und hält existierende Unternehmen zu einer Verbesserung<br />
ihrer Produkte und Dienstleistungen an. Dies führt zu Effizienzsteigerungen und<br />
ersetzt solche Unternehmen auf dem Markt, die notwendige Anpassungen an ein sich veränderndes<br />
Umfeld nicht leisten können. In Zeiten der Wirtschaftskrise verstärkt sich dieser<br />
Strukturwandel und der „Prozess schöpferischer Zerstörung“ intensiviert sich. Somit begünstigen<br />
Gründungen den Erneuerungsprozess der Wirtschaft. Zudem schaffen Gründungen<br />
neue Arbeitsplätze für zuvor arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Gründer sowie<br />
– insbesondere bei größeren, wachstumsorientierten Gründungen – für die eingestellten Mitarbeiter.<br />
Sie tragen auch zur Entlastung der sozialen Sicherungssysteme bei.<br />
Für den Beginn einer selbstständigen Erwerbstätigkeit muss eine Gründerperson jedoch bereit<br />
sein, neben der Wahrnehmung der Chancen die teilweise auch erheblichen Risiken einer<br />
Gründung zu tragen. Die Unsicherheit, ob sich das Gründungsprojekt als tatsächlich tragfähig<br />
erweist, ist zum Start der Selbstständigkeit nicht vollständig auszuräumen. Zudem muss ein<br />
Gründer willig und fähig sein, verschiedene Hürden zu überwinden. Letztere reichen von administrativen<br />
und organisatorischen Schwierigkeiten bei der Gründungsvorbereitung bis zu<br />
Finanzierungshemmnissen bei der Umsetzung der Gründungsidee.<br />
Um vermeidbaren, häufig aus Gründungshemmnissen resultierenden Fehlentwicklungen bis<br />
hin zum Scheitern in der Gründungsphase entgegenzuwirken und das Wachstums- und Innovationspotenzial<br />
von Gründungen bestmöglich auszunutzen, betreiben viele Volkswirtschaften<br />
insbesondere in Westeuropa eine aktive Politik der Gründungs- und Mittelstandsförderung.<br />
Zum optimalen Einsatz öffentlicher Steuerungsmaßnahmen bedarf es aussagekräftiger<br />
Informationsinstrumente, die eine detaillierte Analyse von Gründungen, Gründungsentscheidungen<br />
und den dabei auftretenden Schwierigkeiten ermöglichen. Denn nur auf der Grundlage<br />
einer soliden repräsentativen Datenbasis können belastbare Aussagen über das Gründungsgeschehen<br />
getroffen und wirtschaftspolitische Implikationen abgeleitet werden. Mit dem<br />
seit dem Jahr 2000 jährlich erhobenen <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> und den gleichnamigen Publikationen<br />
stellt die <strong>KfW</strong> Bankengruppe eine solche Informationsquelle zur Verfügung, die sich<br />
an politische Entscheidungsträger, einschlägig interessierte Personen aus Medien und Forschung,<br />
sowie an die breite Öffentlichkeit richtet.
2 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Die in diesem Jahr vorliegende Jubiläumsausgabe des <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>s enthält umfassende<br />
Auswertungen der Daten aus der Befragung des Jahres 2009 und setzt darüber<br />
hinaus das aktuelle Gründungsgeschehen an vielen Stellen in Beziehung zum Gründungsgeschehen<br />
früherer Jahre. Der Bericht ist wie folgt gegliedert. Das sich anschließende Kapitel 2<br />
stellt das Konzept des <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>s als repräsentativer Bevölkerungserhebung<br />
vor. In Kapitel 3 erfolgt zunächst die jährliche Fortschreibung der Zeitreihen zum Gründungsgeschehen<br />
in Deutschland. Es werden makroökonomische Ursachen für die zeitliche<br />
Entwicklung am aktuellen Rand und regionale Differenzen im Gründungsgeschehen diskutiert.<br />
Hieran schließt sich eine Charakterisierung der Gründungsprojekte an, wobei Gründungen<br />
u. a. nach Branche, Innovationsgehalt und Größe unterschieden werden. Überdies erfolgt<br />
eine Abschätzung des Bruttobeschäftigungseffektes des Gründungsgeschehens. In Kapitel<br />
4 werden Unterschiede zwischen Gründern und Nicht-Gründern bezüglich ausgewählter<br />
persönlicher Merkmale wie bspw. Geschlecht, Alter, Berufsabschluss oder Erwerbsstatus<br />
herausgearbeitet. Dies erlaubt eine Analyse der Gründungsentscheidung in Abhängigkeit von<br />
verschiedenen sozioökonomischen Personenmerkmalen. Anschließend wird die Mortalität<br />
von Gründungsprojekten behandelt, wobei personenbezogene und projektbezogene Determinanten<br />
des Gründungsabbruchs in den ersten 36 Monaten nach Aufnahme der selbstständigen<br />
Tätigkeit analysiert werden. Das Schwerpunktkapitel 5 ist der Gründungsfinanzierung<br />
gewidmet. Neben einer ausführlichen Darstellung der Finanzierungsstruktur, im Zuge derer<br />
u. a. Fragen zur Nutzung verschiedener Finanzierungsquellen beantwortet werden, erfolgen<br />
auch Auswertungen zu Ausmaß, Art und Bestimmungsgrößen von Finanzierungsschwierigkeiten<br />
der Gründer. Kapitel 6 schließt den Bericht mit einem Fazit ab.
2 Der <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong><br />
Seit nunmehr 10 Jahren analysiert die <strong>KfW</strong> Bankengruppe das Gründungsgeschehen in<br />
Deutschland mit einer jährlichen repräsentativen Bevölkerungsbefragung: dem <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>.<br />
In dieser Zeit haben sich die erhobenen Daten und die hieraus resultierenden<br />
Publikationen zu einer festen Größe in der deutschen Gründungsforschung entwickelt. Darüber<br />
hinaus liefert der jährliche Bericht zum <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> politischen Entscheidungsträgern,<br />
Medien und der breiten Öffentlichkeit verständlich aufbereitete, ausführliche<br />
und aktuelle Analysen der Gründungsaktivität in Deutschland. Im Laufe der Jahre wurde das<br />
Befragungsprogramm stets weiterentwickelt und an aktuelle Fragestellungen angepasst. Mittlerweile<br />
existieren insgesamt zehn Querschnittsdatensätze, die nicht nur für sich genommen<br />
wichtige Strukturinformationen zum Gründungsgeschehen eines jeweiligen Jahres bereitstellen,<br />
sondern in ihrer Kombination wertvolle Einblicke in die kurz- bis mittelfristige Gründungsdynamik<br />
zulassen. So stellt der <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> nun die umfassendste Informationsquelle<br />
zum Gründungsgeschehen in Deutschland dar.<br />
Die folgenden Abschnitte stellen das Erhebungsdesign des <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>s vor,<br />
nehmen eine Abgrenzung zu anderen Datensätzen mit Gründungsbezug vor und halten zentrale<br />
Definitionen und Konventionen für den vorliegenden Bericht fest.<br />
2.1 Methodik und Struktur<br />
Der <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> ist eine computerunterstützte telefonische (CATI) Bevölkerungsbefragung<br />
zum Gründungsgeschehen in Deutschland. In der aktuellen Erhebungswelle für<br />
das Jahr 2009 wurden 50.000 zufällig ausgewählte in Deutschland ansässige Personen<br />
interviewt. Durch spezielle, dem aktuellen Standard der Marktforschung entsprechende Verfahren<br />
bei Stichprobengenerierung und Befragung wird eine weit gehende Repräsentativität<br />
des Datensatzes für die deutsche Wohnbevölkerung gewährleistet.<br />
Zielgruppe / Grundgesamtheit<br />
Die angestrebte Grundgesamtheit, über die die Nettostichprobe (d. h. die Gesamtheit der<br />
Personen mit vollendetem Interview) des <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>s repräsentativ Auskunft<br />
geben soll, sind alle 51,6 Mio. in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Personen im<br />
„gründungsrelevanten“ Alter von 18 bis 64 Jahren.<br />
Erhebungsmethode / Feldphase<br />
Der <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> wird mittels computerunterstützter telefonischer Interviews erhoben.<br />
Die Interviewsprache ist deutsch. Zur telefonischen Erhebungsform besteht keine Alter-
4 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
native, da der Fragebogen eine sehr komplexe Filterstruktur besitzt und es deshalb einer automatisierten<br />
(computerunterstützten) Führung durch seine Inhalte bedarf. Zudem verlangt<br />
der enge zeitliche Rahmen, in dem die benötigten 50.000 Interviews durchzuführen sind,<br />
nach einer telefonischen Erhebung. Für die Feldphase steht seit dem Jahr 2003 jeweils der<br />
Zeitraum von Anfang August bis Mitte Dezember zur Verfügung. 1 Die täglichen Telefonzeiten<br />
sind Montag bis Freitag von 19.00 bis 21.00 Uhr und Samstag von 10.00 bis 19.00 Uhr. 2<br />
Fragebogeninhalte<br />
Existenzgründer werden mit einer Eingangsfrage identifiziert, die darauf abzielt, ob der Proband<br />
innerhalb der letzten 12 Monate eine gewerbliche oder freiberufliche Selbstständigkeit<br />
im Voll- oder Nebenerwerb begonnen hat. Im weiteren Verlauf wird Gründern ein ausführliches<br />
Frageprogramm mit derzeit über 40 Fragen zu ihrer Person und ihrem Gründungsprojekt<br />
vorgelegt. Dabei handelt es sich z. B. um Fragen zu Ablauf und Art der Gründung, zu<br />
Mitarbeitern und Finanzierung, zum Fortbestand der Gründung sowie zur persönlichen Erwerbshistorie,<br />
beruflicher Qualifikation und weiteren soziodemografischen Merkmalen. Entsprechende<br />
Informationen werden – soweit sinnvoll (d. h. soweit die Beantwortung einzelner<br />
Fragen nicht eine vollzogene Gründung voraussetzt) – auch für eine Unterstichprobe von<br />
rund 7.500 Nicht-Gründern erhoben. Dies ermöglicht umfassende Vergleiche von Gründern<br />
mit Nicht-Gründern in der Bevölkerung und Analysen zur Gründungsentscheidung.<br />
Stichprobenstruktur<br />
Die Stichprobenziehung erfolgt gemäß dem in der Marktforschung für CATI Studien allgemein<br />
anerkannten und vom Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute (ADM)<br />
empfohlenen Verfahren der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (MA). Bei dem Verfahren<br />
werden zunächst auf Basis der eingetragenen Telefonnummern Blöcke gebildet, indem von<br />
allen vorhandenen eingetragenen Rufnummern die letzten zwei Stellen gelöscht und mit den<br />
Ziffern „00“ bis „99“ aufgefüllt werden. So werden neben den eingetragenen auch die nicht<br />
eingetragenen sowie ein gewisser Anteil nicht existierender Nummern generiert. Man spricht<br />
in diesem Zusammenhang vom Universum aller in Deutschland möglichen Festnetztelefonnummern.<br />
Aus dieser Auswahlgesamtheit erfolgt die Ziehung einer regional geschichteten<br />
1<br />
Die bisherigen Befragungen zum <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> haben in den folgenden Zeiträumen stattgefunden:<br />
02.08.–26.10.2000, 14.05.–06.07.2001, 15.04.–19.07.2002, 18.08.–22.11.2003,<br />
16.08.–16.11.2004, 22.08.–23.11.2005, 21.08.–28.11.2006, 27.08.–04.12.2007, 20.08.–23.12.2008,<br />
27.07.–23.12.2009.<br />
2<br />
Terminvereinbarungen für Interviews werden auch für Zeiten außerhalb der genannten Rahmenzeiten<br />
vorgenommen.
Der <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> 5<br />
Bruttostichprobe (der Menge aller potenziell anzurufenden Nummern). In der Feldphase des<br />
Projektes werden die Telefonnummern der Bruttostichprobe sukzessive „abtelefoniert“, bis<br />
eine Zahl von 50.000 vollständigen Interviews mit Privathaushalten erreicht ist. 3 Diese<br />
50.000 Merkmalsträger bilden die Nettostichprobe des <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>s.<br />
Stichprobengewichtung und Hochrechnung der Befragungsergebnisse<br />
Um von der Nettostichprobe auf die Grundgesamtheit schließen zu können, werden die Befragungsergebnisse<br />
mittels Gewichtungsfaktoren hochgerechnet. Diese Faktoren werden so<br />
gewählt, dass die Verteilung der gewichteten Stichprobe zumindest hinsichtlich der Merkmale<br />
Bundesland, Gemeindegrößenklasse, Geschlecht, Alter, Berufsausbildungsabschluss,<br />
Staatsangehörigkeit und Haushaltsgröße der Verteilung dieser Merkmale in der Grundgesamtheit<br />
der 18- bis 64-Jährigen in Deutschland ansässigen Bevölkerung entspricht. Die Gewichtung<br />
anhand der vorgenannten Merkmale verfolgt insbesondere das Ziel, Repräsentativität<br />
in Bezug auf das erfasste Gründungsgeschehen zu erreichen. Der <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong><br />
enthält zwei Gewichtungsfaktoren, einen zur Gewichtung und Hochrechnung der Gesamtstichprobe<br />
der 50.000 Personen und einen zur Gewichtung und Hochrechnung der Unterstichprobe<br />
der gut 7.500 Personen, in der detaillierte soziodemografische Merkmale auch<br />
für die Nicht-Gründer vorliegen.<br />
Mögliche Beeinträchtigungen der Repräsentativität<br />
Die Begrenzung der Auswahlgesamtheit auf Festnetznummern, die Nichtberücksichtigung<br />
von Interviewpartnern ohne hinreichende Deutschkenntnisse und die Durchführung von Interviews<br />
zu den vorgenannten Zeiten können grundsätzlich zu Beeinträchtigungen der Repräsentativität<br />
des <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>s für das Gründungsgeschehen in Deutschland führen.<br />
• Stichprobenauswahl ausschließlich auf Basis von Festnetznummern: Während<br />
die Beschränkung der Stichprobenauswahl auf Festnetztelefonnummern bis zuletzt<br />
unumstritten und unproblematisch war, zeichnet sich jüngst eine Zunahme von Haushalten<br />
ab, die nur noch über das Mobilfunknetz telefonisch zu erreichen sind. Der Anteil<br />
dieser Haushalte wird derzeit mit rund 10 % veranschlagt, liegt jedoch in bestimm-<br />
3 Geschäftsanschlüsse werden, soweit im Vorfeld eindeutig identifizierbar, aus der Auswahlgesamtheit<br />
ausgeschlossen. Kommen dennoch Verbindungen mit Geschäftsanschlüssen zustande, wird das Interview<br />
abgebrochen.
6 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
ten Gruppen, wie z. B. junge Single-Haushalte, schon deutlich darüber. 4 Sofern sich<br />
die Personen, die ausschließlich über das Mobilfunknetz zu erreichen sind, hinsichtlich<br />
ihrer Gründungshäufigkeit oder der Merkmale ihrer Gründungsprojekte systematisch<br />
von Personen mit Festnetzanschluss unterscheiden, kann dies zu verzerrten<br />
Gründerquoten oder -strukturen führen.<br />
• Interviews ausschließlich in deutscher Sprache: Sofern sich in Deutschland ansässige<br />
Personen ohne hinreichend gute Deutschkenntnisse in ihrer Gründungsneigung<br />
systematisch von anderen Personen unterscheiden, ist die Repräsentativität einer<br />
nur mit deutschsprachigen Interviews operierenden Gründungsbefragung für die<br />
Gesamtbevölkerung ebenfalls eingeschränkt. Diesem Problem wirkt die für das Jahr<br />
2008 erstmalig vorgenommene Stichprobengewichtung anhand der Staatsbürgerschaft<br />
entgegen, da der Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft mit hinreichenden<br />
Kenntnissen der deutschen Sprache stark korreliert ist.<br />
• Interviewbeginn montags bis freitags ab 19.00 Uhr: Es kann nicht ausgeschlossen<br />
werden, dass die private Erreichbarkeit von Gründern geringer ist als die Erreichbarkeit<br />
von Nicht-Gründern (insbesondere von Nicht-Erwerbstätigen). Somit könnten sich<br />
aus einem zu frühen Interviewbeginn Beeinträchtigungen der Repräsentativität ergeben.<br />
Mögliche Verzerrungen werden durch den langen sonnabendlichen Interviewzeitraum<br />
sowie durch die freie Vereinbarkeit von Interviewterminen gemildert.<br />
• Allgemeine Teilnahmebereitschaft von Gründern: Beeinträchtigungen der Repräsentativität<br />
könnten schließlich darin bestehen, dass Gründer im Allgemeinen oder<br />
spezielle Gruppen von Gründern generell eine geringere oder aber eine auch höhere<br />
Bereitschaft zur Teilnahme an (telefonischen) Befragungen aufweisen als Nicht-<br />
Gründer. Eine höhere Abbruchwahrscheinlichkeit der längeren Interviews mit Gründern<br />
wird bei der Hochrechnung der Gründerquote berücksichtigt.<br />
2.2 Abgrenzung zu anderen Datensätzen mit Gründungsbezug<br />
Die zentralen Anforderungen an eine Datenbasis zum Gründungsgeschehen bestehen in<br />
einer möglichst vollständigen Erfassung desselben und in der Bereitstellung möglichst umfassender<br />
Informationen zu den Gründern und ihren Gründungsprojekten. Der <strong>KfW</strong>-<br />
4 Unter Haushalten mit Haupteinkommensbezieher unter 25 Jahren besitzen rund 35 % keinen Festnetzanschluss<br />
(Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008 des Statistischen Bundesamtes;<br />
Behrends und Kott, 2009). Vgl. Schneid und Stiegler (2006) für eine Diskussion der Zukunftsfähigkeit<br />
von (computerunterstützten) Telefonumfragen.
Der <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> 7<br />
<strong>Gründungsmonitor</strong> erfüllt beide Kriterien: Er zeichnet sich sowohl durch einen breiten Gründungsbegriff<br />
– es werden gewerbliche und freiberufliche Gründungen (Neugründungen, Übernahmen<br />
und Beteiligungen) sowie Gründungen im Voll- und im Nebenerwerb erfasst – als<br />
auch durch einen außerordentlich großen Informationsumfang zur Person des Gründers und<br />
zu seinem Gründungsvorhaben aus. Die nachfolgenden Absätze stellen heraus, inwiefern<br />
sich andere Datensätze mit Gründungsbezug für Deutschland vom <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong><br />
unterscheiden.<br />
Der Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes und der Statistischen Landesämter stellt<br />
Informationen zu Selbstständigen im Vollerwerb bzw. in der ersten Erwerbstätigkeit bereit;<br />
Informationen zum gegründeten Unternehmen sind dort gar nicht enthalten. 5 Auch im Sozioökonomischen<br />
Panel (SOEP) 6 des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung lassen sich<br />
Existenzgründer identifizieren. Da das SOEP jedoch ebenso wie der Mikrozensus nicht spezifisch<br />
zur Untersuchung des Gründungsgeschehens erhoben wird, fehlen auch in diesem Datensatz<br />
jegliche Informationen zum gegründeten Unternehmen. Wichtige Unterschiede zwischen<br />
SOEP und Mikrozensus bestehen darin, dass das SOEP als echter Längsschnittdatensatz<br />
Aussagen über den Fortbestand einer selbstständigen Erwerbstätigkeit prinzipiell<br />
zulässt, 7 während dies anhand des Mikrozensus nur bedingt möglich ist. 8 Andererseits verfügt<br />
der Mikrozensus als Ein-Prozent-Stichprobe der in Deutschland lebenden Haushalte<br />
bzw. Personen über eine um ein Vielfaches höhere Beobachtungszahl (und damit über bedeutend<br />
mehr Gründer) als das SOEP.<br />
Der Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ist eine internationale Umfrage zum Gründungsgeschehen,<br />
an der auch Deutschland beteiligt ist. Der GEM weist in seiner Konzeption<br />
große Ähnlichkeit zum <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> auf, befragt hier zu Lande jedoch vergleichsweise<br />
wenige Personen (ca. 7.500), enthält bedeutend weniger Informationen zu Gründern<br />
5 Vgl. Statistisches Bundesamt (2009) und Piorkowsky et al. (2009).<br />
6 Vgl. Wagner et al. (2007).<br />
7<br />
Mit personen- bzw. haushaltsbezogenen Datensätzen wie dem SOEP (oder dem Mikrozensus) können<br />
allenfalls Aussagen darüber getroffen werden, ob bestimmte Personen weiterhin als Selbstständige<br />
tätig sind. Die Beendigung einer Selbstständigkeit durch eine Person kann jedoch nicht mit der<br />
Schließung des von ihr gegründeten Unternehmens gleichgesetzt werden.<br />
8<br />
Beim Mikrozensus handelt es sich um ein sogenanntes Rotationspanel, in dem Haushalte in bis zu<br />
vier aufeinander folgenden Befragungsjahren erfasst werden. Während die Scientific-Use-Files des<br />
Mikrozensus der Wissenschaft bislang nur als Querschnittsdatensätze angeboten wurden, ist seit<br />
kurzem auch ein Mikrozensuspanel des von 1996 bis 1999 befragten Rotationsviertels verfügbar.<br />
Demnach kann das Mikrozensuspanel – zumindest in begrenztem Umfang – ebenso wie das SOEP<br />
für Analysen des Fortbestandes von Selbstständigkeitsprojekten genutzt werden. Vgl. Schmidt (2000)<br />
und Konold (2006).
8 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
und Gründungen und verwendet einen anderen Gründerbegriff. 9 Ein anderer internationaler<br />
Befragungsdatensatz mit deutscher Beteiligung ist das Eurobarometer der Europäischen<br />
Kommission. In Ergänzung zu der Hauptbefragung werden auch kleinere sogenannte Flash<br />
Eurobarometer durchgeführt, die Spezialthemen gewidmet sind. 10 Seit dem Jahr 2000 ist<br />
Entrepreneurship eines dieser Spezialthemen und seit dem Jahr 2002 werden den Barometer-Teilnehmern<br />
auch explizite Fragen zu ihrem Gründungsverhalten gestellt. Ein bedeutender<br />
Nachteil der Flash Eurobarometer besteht jedoch darin, dass die Teilstichprobe für<br />
Deutschland nur 1.000 Personen umfasst und keine Informationen zum gegründeten Unternehmen<br />
erhoben werden.<br />
Die Gewerbeanzeigenstatistik der Statistischen Ämter, auf der auch die Gründungsstatistik<br />
des IfM Bonn 11 beruht, bietet nur rudimentäre Angaben zu Gründern und Gründungen und ist<br />
zudem auf gewerbliche Unternehmen begrenzt – enthält also z. B. keine Informationen zu<br />
Gründungen im Bereich der Freien Berufe. 12 Die Umsatzsteuerstatistik ist eine weitere amtliche<br />
Datenquelle mit Gründungsbezug. In ihr sind jedoch keinerlei Informationen zum Gründer<br />
und – abgesehen von umsatzsteuerspezifischen Angaben – lediglich Angaben zu dem<br />
Ort, dem Wirtschaftszweig und der Rechtsform des Unternehmens bzw. der Gründung enthalten.<br />
Außerdem ist der Datenbestand auf umsatzsteuerpflichtige Unternehmen begrenzt<br />
und schließt damit keine Kleinunternehmer und keine Selbstständigen im Bereich der freien<br />
Heilberufe ein. 13 Informationen über Gründungen lassen sich auch aus der Betriebsdatei zur<br />
Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit gewinnen. Da die Betriebsinformationen<br />
jedoch nur ein Nebenprodukt des auf Arbeitnehmer abzielenden Meldeverfahrens zur<br />
Sozialversicherung sind, werden nur Betriebe mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig<br />
Beschäftigten erfasst. Zudem enthält diese Datenquelle nur wenige Informationen<br />
zum Betrieb und keine Informationen zum Gründer. 14 Die Erhebungen der Statistischen<br />
Ämter für bestimmte Wirtschaftsbereiche decken den Bereich der kleinen Betriebe eben-<br />
9<br />
Der zentrale Gründerbegriff des GEM ist der des „Nascent Entrepreneurs“. Dieser umfasst Personen<br />
im Alter von 18 bis 64 Jahren, die a) zum Zeitpunkt der Befragung versuchen, allein oder mit Partnern<br />
ein neues Unternehmen zu gründen, b) in den letzten 12 Monaten etwas zur Ingangsetzung dieser<br />
Neugründung unternommen haben, c) Inhaber- oder Teilhaberschaft im Unternehmen anstreben und<br />
d) während der letzten drei Monate keine Vollzeitlöhne oder -gehälter bezahlt haben (Brixy et al.,<br />
2010).<br />
10<br />
Vgl. Eurobarometer (2007).<br />
11 Vgl. Günterberg (2008).<br />
12 Vgl. Leiner (2002).<br />
13<br />
Kleinunternehmer im Sinn der Umsatzsteuerstatistik sind Unternehmer, deren Umsatz zuzüglich der<br />
darauf entfallenden Umsatzsteuer im vorangegangenen Kalenderjahr nicht höher als 17.500 EUR war<br />
und deren Umsatz im laufenden Kalenderjahr 50.000 EUR voraussichtlich nicht übersteigen wird.<br />
14<br />
Vgl. Brixy und Fritsch (2002).
Der <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> 9<br />
falls nur teilweise ab. Zudem wird bei den dort ausgewiesenen Gründungen der Gründungszeitpunkt<br />
im Zweifel zu spät angesetzt, weil neue Betriebe erst dann in der Statistik erscheinen,<br />
wenn sie eine bestimmte Größe erreicht haben. Schließlich umfassen die Erhebungen<br />
bislang nur Betriebe in ausgewählten Sektoren. 15<br />
Das statistische Unternehmensregister führt einige der amtlichen Statistiken mit Unternehmensbezug<br />
(insbesondere die Umsatzsteuerstatistik und die Beschäftigtenstatistik) zusammen<br />
und enthält somit Unternehmen/Gründungen mit steuerbarem Umsatz aus Lieferungen<br />
und Leistungen und/oder sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. 16 Damit bleiben Kleinund<br />
Kleinstunternehmen und freiberuflich Selbstständige aus dem Bereich der Heilberufe<br />
ohne sozialversicherungspflichtig Beschäftigte unerfasst und es stehen auch keine Gründerinformationen<br />
zur Verfügung.<br />
Das auf Daten der Kreditauskunftei CREDITREFORM beruhende Mannheimer Unternehmenspanel<br />
des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) schließlich ist auf<br />
sogenannte „wirtschaftsaktive“ Unternehmen (i. d. R. Unternehmen mit Eintrag ins Handelsregister<br />
und/oder Nachfrage nach Fremdkapital) beschränkt und schließt Klein- und Kleinstgründungen<br />
deshalb weit gehend aus. Überdies beinhaltet das Mannheimer Unternehmenspanel<br />
nur wenige Informationen zur Gründerperson. 17 Die im Mannheimer Unternehmenspanel<br />
erfassten Gründungen bilden gleichzeitig die Zielgruppe des <strong>KfW</strong>/ZEW-<br />
Gründungspanels, das seit dem Jahr 2008 als eine weitere informative Datenquelle zum<br />
Gründungsgeschehen in Deutschland zur Verfügung steht. Als Längsschnittbefragung zielt<br />
diese darauf ab, neu gegründete Unternehmen über mehrere Jahre hinweg zu verfolgen und<br />
längerfristige Erfolgsanalysen auf Unternehmensebene zu ermöglichen. 18 Im Gegensatz zur<br />
Bevölkerungsbefragung des <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>s zeichnet die Unternehmensbefragung<br />
des <strong>KfW</strong>/ZEW-Gründungspanels kein repräsentatives Bild des gesamten Gründungsgeschehens<br />
und das Unternehmen – nicht die Gründerperson – steht im Vordergrund. So enthält<br />
das <strong>KfW</strong>/ZEW-Gründungspanel auch keine Nicht-Gründer als Vergleichsgruppe.<br />
15 Vgl. Fritsch et al. (2002) und Niese (2002).<br />
16 Vgl. Statistisches Bundesamt (2010e) und Gräb und Zwick (2002).<br />
17 Bis zum Jahr 2008 firmierte das Mannheimer Unternehmenspanel unter der Bezeichnung ZEW-<br />
Gründungspanel. Die Panel-Bezeichnung hier kommt dadurch zu Stande, dass CREDITREFORM in<br />
regelmäßigen Abständen (zweimal jährlich jeweils im Januar und Juni) seinen gesamten Unternehmensdatenbestand<br />
zu Forschungszwecken an das ZEW liefert. Da die Unternehmensinformationen<br />
jedoch nicht regelmäßig, sondern häufig nur bei Kundenanfragen aktualisiert werden, ist die Bezeichnung<br />
der Daten als Panel streng genommen unzutreffend. Vgl. Almus, Engel und Prantl (2000, 2002).<br />
18 Vgl. Fryges et al. (2010), Gottschalk et al. (2008).
10 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Die vorgenannten Datenquellen lassen sich anhand ihrer Erhebungsform, ihres Erhebungsumfangs<br />
und ihrer Merkmalsträger (Gründungen/Gründer) in zwei Gruppen einteilen. Gewerbeanzeigenstatistik,<br />
Umsatzsteuerstatistik, die Betriebsdatei zur Beschäftigtenstatistik, die<br />
Erhebungen der Statistischen Ämter für bestimmte Wirtschaftsbereiche, das Unternehmensregister<br />
und das Mannheimer Unternehmenspanel sind prozessproduzierte Datensätze, die<br />
auf gesetzlich vorgeschriebenen Meldeprozessen oder im Fall des Mannheimer Unternehmenspanels<br />
auf kommerziell motivierten Rechercheprozessen aufbauen. Diese Datensätze<br />
stellen innerhalb des vorgegebenen Erfassungsbereichs Vollerhebungen dar und ihr Merkmalsträger<br />
ist das Unternehmen bzw. die Gründung. <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>, Mikrozensus,<br />
SOEP, GEM, Flash Eurobarometer und das <strong>KfW</strong>/ZEW-Gründungspanel, sind dagegen stichprobenbasierte<br />
Befragungsdatensätze, deren Merkmalsträger i. d. R. Personen bzw.<br />
Gründer sind. 19 Während der Vorteil von Befragungsdatensätzen in ihrem hohen, von Forschungsinteressen<br />
bestimmten Informationsumfang besteht, andererseits aber aus Kostengründen<br />
häufig nur relativ wenige Gründungen/Gründer in den Stichproben vorhanden sind,<br />
stellt sich der Sachverhalt im Fall von prozessproduzierten Datensätzen umgekehrt dar. Ihre<br />
Stärke liegt im Bereich der Beobachtungszahlen. Da es sich aber nicht um originär für die<br />
Forschung bestimmte Datensätze handelt, liegen ihre Schwächen in der Anzahl und/oder im<br />
Informationsgehalt der zur Verfügung stehenden Merkmale.<br />
2.3 Zentrale Definitionen und Konventionen<br />
Aus den dargestellten Besonderheiten der Gründungsdatensätze für Deutschland, aber auch<br />
aufgrund von Unterschieden im Erkenntnisinteresse, ergeben sich Abweichungen hinsichtlich<br />
grundlegender Begriffsabgrenzungen zum Gründungsgeschehen. Die wichtigsten Definitionen<br />
des <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>s sind die Folgenden:<br />
• Selbstständigkeit: selbstständige gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit im Volloder<br />
Nebenerwerb.<br />
• Voll-/Nebenerwerb: Die Einordnung in die Kategorien Voll- oder Nebenerwerb wird<br />
allein dem Gründer ohne nähere Spezifikation der Begriffsinhalte (von Voll- und Nebenerwerb)<br />
überlassen. 20<br />
19<br />
Lediglich das <strong>KfW</strong>/ZEW-Gründungspanel verknüpft ein Befragungsdesign mit einer Unternehmensstichprobe.<br />
20<br />
Denkbar wären auch Einordnungen gemäß der für die neue Selbstständigkeit eingesetzten Arbeitszeit<br />
(relativ zu einer anderen Erwerbstätigkeit) und/oder des Beitrages der Gründung zum Haushaltseinkommen.<br />
Hierdurch würde das häufig nicht triviale Abgrenzungsproblem zwischen Voll- und<br />
Nebenerwerb jedoch nur vom Befragten auf den mit der Datenauswertung befassten Forscher verlagert.
Der <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> 11<br />
• Gründer: Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit innerhalb der 12 Monate, die der<br />
Befragung vorangegangen sind, wobei unter die neue selbstständige Tätigkeit neben<br />
Neugründungen auch Übernahmen von und Beteiligungen an bereits bestehenden<br />
Unternehmen subsumiert sind. 21<br />
• Gründerquote: Anteil der Gründer im Alter von 18 bis 64 Jahren an der Bevölkerung<br />
im Alter von 18 bis 64 Jahren. Das Konzept findet auch für Untergruppen Anwendung<br />
(z. B. Anteil der ostdeutschen Gründer im Alter von 18 bis 64 Jahren an der<br />
ostdeutschen Bevölkerung im Alter von 18 bis 64 Jahren).<br />
Zur Gewährleistung der besseren Lesbarkeit des Textes werden die folgenden Vereinfachungen<br />
vorgenommen:<br />
• Ohne dass dies an jeder Stelle explizit erwähnt wird, ziehen die nachfolgenden Analysen<br />
ausschließlich Personen (sowohl Gründer als auch Nicht-Gründer) im Alter von<br />
18 bis 64 Jahren in Betracht. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass sich<br />
nur ein kleiner Teil der Gesamtheit aller Gründer (10,3 %) und ein noch deutlich geringerer<br />
Teil der Vollerwerbsgründer (3,8 %) aus Jugendlichen oder Personen im (gegenwärtigen)<br />
Rentenalter rekrutieren. 22 Mit diesem Alterskonzept passt sich der <strong>KfW</strong>-<br />
<strong>Gründungsmonitor</strong> an andere Gründerstudien, wie z. B. den Global Entrepreneurship<br />
Monitor (GEM), an.<br />
• Die Befragungsergebnisse des Jahres 2009 werden ebenso wie die Befragungsergebnisse<br />
früherer Jahre mit dem Gründungsgeschehen des betreffenden Jahres<br />
gleichgesetzt. Tatsächlich ist es jedoch aufgrund des Befragungsdesigns des <strong>KfW</strong>-<br />
<strong>Gründungsmonitor</strong>s (Erfassung einer Gründung innerhalb der letzten 12 Monate, bezogen<br />
auf den i. d. R. immer im Spätsommer oder Herbst liegenden Tag der Befragung)<br />
nicht möglich, das Gründungsgeschehen kalenderjahrgenau zu erfassen. So<br />
21<br />
Im Rahmen der Analysen zum Fortbestand von Selbstständigkeit in Abschnitt 4.2 werden zusätzlich<br />
zu diesem Gründerkonzept auch solche Gründer in den Blick genommen, die ihr Selbstständigkeitsprojekt<br />
bis zu 36 Monate vor dem Befragungszeitpunkt aufgenommen haben.<br />
22<br />
Diese Angaben beruhen auf Auswertungen des <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>s für das Befragungsjahr<br />
2005, in dem zum letzten Mal auch Personen im Alter von unter 18 oder über 67 Jahren befragt wurden.<br />
Im Rahmen der Erhebung 2008 wurden zwar auch Personen im Alter von 65 bis 67 Jahren befragt,<br />
diese fließen aber nicht in die Analysen ein.
12 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
haben z. B. rund 25 % der im Befragungsjahr 2009 identifizierten Gründer ihre Gründung<br />
bereits im Jahr 2008 vollzogen. 23<br />
• Zwecks besseren Leseflusses wird davon Abstand genommen, Substantive in einer<br />
Schreibweise wiederzugeben, die gleichzeitig auch eine explizite weibliche Form aufnimmt<br />
(z. B. ‚Gründer/innen’ oder ‚GründerInnen’). Die verwendete Schreibform (z. B.<br />
‚Gründer’) umfasst selbstverständlich sowohl weibliche als auch männliche Personen.<br />
In methodischer Hinsicht wird in dieser Studie der Tatsache Rechnung getragen, dass Aussagen<br />
über Grundgesamtheiten, die auf Stichproben beruhen, mit einer statistischen Unsicherheit<br />
behaftet sind. Diese Unsicherheit fällt unter sonst gleichen Bedingungen umso größer<br />
aus, je kleiner die Stichprobe ist, auf der eine Auswertung beruht. Die nachfolgenden<br />
deskriptiven Analysen in grafischer Form werden deshalb i. d. R. mit Schwankungsbreiten<br />
(95 %-Konfidenzintervallen) ausgewiesen. Je größer beispielsweise in einem Balkendiagramm<br />
das Konfidenzintervall relativ zu dem zugehörigen Balken (bzw. Anteils- oder Mittelwert)<br />
ist, desto eher kann der wahre Wert relativ weit von dem auf Basis der Stichprobe errechneten<br />
Wert entfernt liegen. Konfidenzintervalle dienen ferner dem Vergleich verschiedener<br />
Balken. Nur wenn sich die Konfidenzintervalle von zu vergleichenden Werten nicht überschneiden,<br />
ist davon auszugehen, dass diese Werte tatsächlich (d. h. in der Grundgesamtheit)<br />
voneinander verschieden sind.<br />
23 Für die Befragungsjahre 2006–2008 liegen die entsprechenden Anteile zwischen 16 und 25 %. Für<br />
die Befragungsjahre 2000–2005 wurde das genaue Gründungsdatum nicht erhoben. Unter Berücksichtung<br />
der in Fußnote 1 dargestellten Zeiträume der Feldphase kann für die Befragungsjahre 2000,<br />
2003, 2004 und 2005 ebenfalls von rund einem Viertel Gründer aus dem jeweiligen Vorjahr ausgegangen<br />
werden. In den Jahren 2001 und 2002 dürften diese Anteile aufgrund der früher liegenden<br />
Feldphasen bei ca. 50 % liegen.
3 Entwicklung und Struktur des Gründungsgeschehens<br />
Das Jahr 2009 war gekennzeichnet durch die schwerste Wirtschaftskrise seit Gründung der<br />
Bundesrepublik. Im Vergleich zu 2008 nahm das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) saison- und<br />
kalenderbereinigt um 4,9 % ab (Statistisches Bundesamt, 2010c). Eine Betrachtung nach<br />
Wirtschaftsbereichen zeigt, dass der Konjunktureinbruch zum größten Teil zu Lasten des<br />
Verarbeitenden Gewerbes ging (Statistisches Bundesamt, 2010b). Der Rückgang der Wirtschaftsleistung<br />
zeigte sich vor allem im ersten Halbjahr, zumal im Vergleich zum ersten Halbjahr<br />
2008, welches noch durch eine gute konjunkturelle Situation gekennzeichnet war. So<br />
betrugen die realen Wachstumsraten des BIP im 1. und im 2. Quartal 2009 im Vergleich zum<br />
jeweiligen Vorjahresquartal -6,4 % bzw. -7,0 % (Statistisches Bundesamt, 2010c). In der<br />
zweiten Jahreshälfte waren dann erste Anzeichen für eine konjunkturelle Erholung zu verzeichnen,<br />
die vor allem von einer anziehenden Exporttätigkeit getrieben war. Im<br />
1. Quartal 2010 setzt sich der leichte Erholungstrend aus dem zweiten Halbjahr 2009 fort und<br />
für das Gesamtjahr 2010 ergibt die Prognose auf Basis des <strong>KfW</strong>-Konjunkturindikators eine<br />
reale Wachstumsrate des BIP von moderaten 1,8 % (Borger und Schoenwald, 2010).<br />
Der Arbeitsmarkt zeigte sich im Krisenjahr 2009 erstaunlich robust. Die Unternehmen haben<br />
die Anpassung an den Wirtschaftseinbruch vor allem über die Arbeitszeit und nicht über die<br />
Beschäftigtenzahl vorgenommen. Dadurch stieg die Erwerbslosigkeit vergleichsweise moderat:<br />
Die Erwerbslosenquote betrug im Jahresdurchschnitt 2008 7,2 % und stieg in 2009 auf<br />
lediglich 7,6 % (Statistisches Bundesamt, 2010b). Der überwiegende Teil des Anstiegs vollzog<br />
sich dabei in den ersten vier Monaten des Jahres 2009 (Statistisches Bundesamt,<br />
2010a). Für das laufende Jahr rechnen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Frühjahrsprognose<br />
im Gegensatz zu ihrer Einschätzung vom Herbst 2009 nicht mehr mit einer weiteren<br />
Verschlechterung der Arbeitsmarktlage (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose, 2009,<br />
2010). Die erwartete Seitwärtsbewegung setzt jedoch voraus, dass sich die wirtschaftliche<br />
Erholung wie erwartet fortsetzt.<br />
Neben der Wirtschaftskrise war das Jahr 2009 auch noch von Auswirkungen der Finanzmarktkrise<br />
gekennzeichnet. Seit der deutlichen Entspannung auf den Finanzmärkten im<br />
Sommer 2009 – nicht zuletzt wegen massiver geldpolitischer Maßnahmen und staatlicher<br />
Unterstützung des Bankensektors – setzte sich die Erholung tendenziell weiter fort (Deutsche<br />
Bundesbank, 2010b). Während sich der Bankensektor stabilisierte, zeichneten sich jedoch<br />
gegen Ende des Jahres 2009 zunehmend Sorgen um Staatspapiere in verschiedenen europäischen<br />
Ländern, insbesondere Griechenland, ab. Eine flächendeckende Kreditklemme ist<br />
daraus für Deutschland bisher nicht erwachsen.
14 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
In diesem Kapitel werden die Auswirkungen dieser gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen auf<br />
das Gründungsgeschehen beleuchtet. Der aktuelle Stand und die zeitliche Entwicklung der<br />
Gründerquote und der hochgerechneten Gründerzahlen auf nationaler Ebene werden in Abschnitt<br />
3.1 beschrieben und in den gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang gestellt. Für die<br />
Entwicklung des Gründungsgeschehens ist insbesondere der Einfluss der Wirtschaftskrise<br />
von Interesse, die das Zusammenspiel der Push- und Pull-Faktoren der Gründungsaktivität<br />
beeinflusst hat. Es schließen sich regionale Betrachtungen des Gründungsgeschehens für<br />
West- und Ostdeutschland und auf Bundesländerebene an. Abschnitt 3.2 wendet sich der<br />
Struktur des Gründungsgeschehens zu und untersucht Merkmale der gegründeten Unternehmen.<br />
Dabei werden u. a. die Form der Gründung (Neugründung, Beteiligung oder Übernahme),<br />
Branche, Innovationsgehalt und Größe (nach Anzahl der Teampartner und Anzahl<br />
der Mitarbeiter) betrachtet. Insbesondere ermöglicht die Kombination von Form und Größe<br />
der Gründung eine Abschätzung der in Neugründungen entstandenen vollzeitäquivalenten<br />
Arbeitsplätze (direkter Bruttobeschäftigungseffekt) in Abschnitt 3.3.<br />
3.1 Aktuelle Entwicklungen von Gründerquote und Gründerzahl<br />
Die jährlichen Gründerquoten der Jahre 2000 bis 2009 sind in Grafik 1 abgebildet. Für das<br />
Jahr 2009 beläuft sich die geschätzte Gründerquote auf 1,69 % bezogen auf die Gesamtbevölkerung.<br />
Dies entspricht einer Gesamtzahl von rund 872.000 Gründern. 24 Diese verteilen<br />
sich auf 397.000 (= 46 %) Vollerwerbs- und 475.000 (= 54 %) Nebenerwerbsgründer (siehe<br />
auch Tabelle 7 und Tabelle 8 im Anhang). Im Jahr 2008 belief sich die Gründerquote noch<br />
auf 1,54 %, entsprechend einer Gründeranzahl von rund 795.000, wobei 330.000 (= 41 %)<br />
Personen im Vollerwerb und 465.000 (= 59 %) im Nebenerwerb gegründet hatten. Im Vorjahresvergleich<br />
ist damit ein deutlicher Anstieg der Gründerzahl (+10 %) zu verzeichnen, wofür<br />
fast ausschließlich die Zunahme der Vollerwerbsgründer (+20 %) verantwortlich ist. Die Zahl<br />
der Nebenerwerbsgründer veränderte sich dagegen kaum (+2 %).<br />
24 Die absoluten Gründerzahlen ergeben sich durch Multiplikation der jeweiligen Gründerquote (Anteil<br />
der Gründer in der Stichprobe im Alter von 18 bis 64 Jahren; vgl. Abschnitt 2.4) mit der in Deutschland<br />
lebenden Bevölkerung im Alter von 18 bis 64 Jahren. Die Berechnung führt zur Gesamtgründerzahl<br />
als z. B. 1,69 / 100 x 51,590 Mio. = 872.000.
Analysen zur Aufnahme und zur Beendigung der Selbstständigkeit 15<br />
3,5%<br />
3,0%<br />
2,5%<br />
2,0%<br />
1,5%<br />
1,0%<br />
0,5%<br />
2,43<br />
1,31<br />
2,92<br />
1,76<br />
1,12 1,16<br />
2,76<br />
1,49<br />
2,84<br />
1,60<br />
2,59<br />
1,26 1,24 1,24<br />
2,47<br />
1,34 1,30<br />
1,17<br />
2,10<br />
1,24<br />
0,86<br />
1,66<br />
1,05<br />
1,54<br />
0,61 0,64<br />
1,69<br />
0,90 0,92<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb 95%-Konfidenzintervall<br />
Die Gründerquoten (Anteile der Gründer in der Bevölkerung) beruhen auf den folgenden Stichprobenumfängen: n=23.504<br />
(2000), n=15.017 (2001), n=29.776 (2002), n=30.659 (2003), n=30.463 (2004), n=29.964 (2005), n=37.231 (2006), n=37.620<br />
(2007), n=25.015 (2008), 48.437 (2009). Für die Jahre 2000 und 2001 beruhen die Gründerquoten auf Fragestellungen, die<br />
sowohl voneinander als auch von den Gründerfragen in den nachfolgenden Jahren abweichen. Die Quoten dieser Jahre sind<br />
deshalb nur eingeschränkt miteinander und mit den Gründerquoten der nachfolgenden Jahre vergleichbar.<br />
Grafik 1: Gründerquoten in Deutschland 2000–2009<br />
Die Abwärtsdynamik in der Gründungsaktivität, die im Jahr 2004 einsetzte, hatte sich schon<br />
2008 verlangsamt und ist nun gebrochen. 25 Während für die Gründerzahl im Vollerwerb wie<br />
schon von 2007 auf 2008 ein leichter Anstieg zu verzeichnen war, ist die Zahl der Nebenerwerbsgründer<br />
nun zum ersten Mal seit 2003 wieder leicht gestiegen.<br />
Makroökonomische Einflussfaktoren auf das Gründungsgeschehen<br />
Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die in der ökonomischen Literatur nach<br />
ihrem Einfluss auf das Gründungsgeschehen in Push- und Pull-Faktoren unterschieden werden,<br />
bilden den Hintergrund für die individuelle Gründungsentscheidung. 26 Als bedeutender<br />
25<br />
Statistisch sind die die Veränderungen zwischen 2008 und 2009 nicht signifikant. Die 95 %-<br />
Konfidenzintervalle für die Gründerquoten im Jahr 2009 lauten [1,58; 1,80] für Gründer insgesamt,<br />
[0,69; 0,85] für Gründer im Vollerwerb und [0,83; 1,01] für Gründer im Nebenerwerb. Für die hochgerechneten<br />
Absolutzahlen ergeben sich die entsprechenden Schwankungsbreiten als 813.000–931.000<br />
für Gründer insgesamt; 431.000–519.000 für Vollerwerbsgründer und 405.000–527.000 für Nebenerwerbsgründer.<br />
26<br />
Vgl. Meager (1992).<br />
0,77
16 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Push-Faktor wird die Erwerbs- bzw. Arbeitslosigkeit angesehen, durch die die betroffenen<br />
Personen in Ermangelung von Erwerbsalternativen quasi in die Selbstständigkeit „gestoßen“<br />
werden. Die konjunkturelle Entwicklung wird dagegen als Pull-Faktor verstanden, da eine<br />
positive wirtschaftliche Dynamik – soweit sie nicht sogar durch das Entstehen neuer Unternehmen<br />
(mit)verursacht ist – Gründungen „nach sich zieht“, indem sich für potenzielle Gründer<br />
z. B. wachsende oder gar neue Absatzmärkte erschließen.<br />
Über die Jahre hinweg sind deutliche Anzeichen für die Relevanz von Erwerbslosigkeit als<br />
Push-Faktor zu finden. Wird der Zeitraum 2000–2008 betrachtet, dann ist der Korrelationskoeffizient<br />
zwischen der Veränderungsrate der ILO-Erwerbslosenquote 27 und der Gründerquote<br />
(im Vollerwerb / im Nebenerwerb) mit r = 0,83 (0,87 / 0,71) signifikant positiv. 28 Von 2008 zu<br />
2009 fällt der Anstieg der Erwerbslosenquote mit 0,4 Prozentpunkten auf 7,6 % nur relativ<br />
gering aus. Gleichzeitig hat die Gründerquote um 0,2 Prozentpunkte zugenommen, was jedoch<br />
bei der geringeren Varianz dieser Zeitreihe einen stärkeren relativen Anstieg bedeutet.<br />
Dies senkt den Zusammenhang zwischen der Gründerquote und der relativen Veränderung<br />
der Erwerbslosenquote auf r = 0,66 (0,75 / 0,52) 29 , wenn der Zeitraum 2000 bis 2009 betrachtet<br />
wird. Um den Gleichlauf zwischen Gründerquote und relativer Veränderung der Erwerbslosenquote<br />
zu veranschaulichen, sind in Grafik 2 die standardisierten Werte 30 für beide Zeitreihen<br />
abgebildet. Der deutliche Gleichlauf zwischen Veränderung der Erwerbslosenquote<br />
und Gründerzahlen im Vollerwerb verdeutlicht nochmals die Bedeutung der Arbeitsmarktsituation<br />
als Push-Faktor: höhere Arbeitslosigkeit und mangelnde Erwerbsalternativen in abhän-<br />
27 Die Erwerbslosenquote nach dem Standard der International Labour Organization (ILO) stellt den<br />
Vergleichsmaßstab zur Beurteilung der Arbeitsmarktsituation verschiedener Staaten dar. Sie ist unabhängig<br />
von nationalen Arbeitslosigkeitsdefinitionen und deren Veränderungen. In Bezug auf Deutschland<br />
erweist sich dies insbesondere im Hinblick auf das im Zug der Zusammenlegung von Arbeitslosen-<br />
und Sozialhilfe im Jahr 2005 erweiterte Arbeitslosigkeitskonzept als nützlich. Die ILO-Erwerbslosenquote<br />
ist als Anteil der Erwerbslosen an allen Erwerbspersonen (bestehend aus Erwerbstätigen<br />
und Erwerbslosen) definiert. Als erwerbslos im Sinn der ILO-Statistik gilt, wer weniger als eine Stunde<br />
pro Woche arbeitet, aber mehr arbeiten will und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht.<br />
28<br />
r ist der Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson. Er ist ein dimensionsloses Maß für den Grad<br />
des linearen Zusammenhangs zwischen zwei metrisch skalierten Merkmalen. Er kann Werte zwischen<br />
-1 und 1 annehmen. Bei einem Wert von +1 (-1) besteht ein vollständig positiver (negativer) linearer<br />
Zusammenhang zwischen den betrachteten Merkmalen. Wenn der Korrelationskoeffizient den Wert 0<br />
aufweist, hängen die beiden Merkmale überhaupt nicht linear zusammen.<br />
29<br />
Die p-Werte zur Ermittlung der Signifikanz lauten 0,04 (0,01 / 0,12).<br />
30 Für die Standardisierung werden die beobachteten Werte so transformiert, dass die Zeitreihe einen<br />
Mittelwert von Null und eine Varianz von Eins aufweist. Die zugehörigen p-Werte zur Ermittlung der<br />
Signifikanz lauten 0,01 (0,00 / 0,03).
Analysen zur Aufnahme und zur Beendigung der Selbstständigkeit 17<br />
giger Beschäftigung führen dazu, dass Personen verstärkt eine Selbstständigkeit als Haupteinkommensquelle<br />
in Betracht ziehen. 31<br />
1,5<br />
1,0<br />
0,5<br />
0<br />
-0,5<br />
-1,0<br />
-1,5<br />
-2,0<br />
-2,5<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Standardisierte Gründerquote<br />
Stand. Veränderungsrate ILO-Erwerbslosenquote<br />
Standardisierte BIP-Wachstumsrate<br />
Quelle: <strong>KfW</strong> <strong>Gründungsmonitor</strong>, Statistisches Bundesamt (2010a,b), eigene Berechnungen.<br />
Grafik 2: Gründungsaktivität im Konjunkturablauf<br />
Ein Zusammenhang zwischen Konjunkturzyklus und Gründungsaktivität lässt sich dagegen<br />
zunächst nicht identifizieren. Der Korrelationskoeffizient zwischen realer Wachstumsrate des<br />
BIP und Gründerquote (im Vollerwerb / im Nebenerwerb) für den gesamten Zeitraum von<br />
2000–2009 ist mit r = 0,13 (0,02 / 0,22) 32 insignifikant. Insbesondere am aktuellen Rand geht<br />
der Konjunkturabschwung mit einem Anstieg der Gründerzahlen einher, während noch 2008<br />
ein schwächeres Wirtschaftswachstum von einem – wenn auch gebremsten – Rückgang im<br />
Gründungsgeschehen begleitet war. Dies vermittelt eher den Eindruck eines negativen Zusammenhangs<br />
zwischen Konjunktur und Gründungsaktivität, der sich auch im Verlauf der<br />
standardisierten Zeitreihen in Grafik 2 widerspiegelt.<br />
Die Bewertung der Push- und Pull-Faktoren muss jedoch auch den Zusammenhang zwischen<br />
Arbeitsmarkt und Konjunktur in Betracht ziehen. So könnte die vermeintliche Unabhängigkeit<br />
der Gründungsaktivität von der konjunkturellen Entwicklung daraus resultieren,<br />
31<br />
Die Arbeitsmarktsituation lässt sich zum einen anhand der Erwerbslosenquote beschreiben. Ein<br />
zweiter Indikator ist die Zahl der bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten offenen Stellen, die die<br />
Alternativen in abhängiger Beschäftigung widerspiegelt (siehe Tabelle 9). Die Korrelation zwischen<br />
der ILO-Erwerbslosenquote und der Zahl der offenen Stellen beträgt -0,50 (p-Wert 0,12), die eine<br />
spiegelbildliche Entwicklung dieser beiden Größen nahelegt.<br />
32<br />
Die p-Werte zu Ermittlung der Signifikanz lauten 0,72 (0,94 / 0,54).
18 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
dass die stärker wirkende positive Korrelation zwischen der Veränderungsrate der Erwerbslosenquote<br />
und der Gründerquote den Zusammenhang zwischen realer Wachstumsrate und<br />
Gründerquote überlagert. Denn im Regelfall entwickeln sich Konjunktur und die Lage auf dem<br />
Arbeitsmarkt – wenn auch mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung – parallel: Einem Konjunkturabschwung<br />
folgt eine Verschlechterung der Arbeitsmarktlage. Der Zusammenhang<br />
zwischen konjunktureller Entwicklung und Arbeitsmarktlage spiegelt sich dann auch in einem<br />
negativen Korrelationskoeffizienten von r = -0,57 (p-Wert 0,09) zwischen der Veränderung<br />
der Erwerbslosenquote und der realen Wachstumsrate für den Zeitraum 2000 bis 2009 wider.<br />
Die Rezession 2009 weist ebenfalls diesen Zusammenhang auf, ist jedoch im Hinblick auf die<br />
quantitativen Auswirkungen des Konjunkturabschwungs auf den Arbeitsmarkt als Sonderfall<br />
einzuschätzen. Zwar ist die Wirtschaftsleistung so stark eingebrochen wie noch nie seit<br />
Gründung der Bundesrepublik, gleichzeitig haben Anpassungen der Arbeitszeit (und weniger<br />
Anpassungen der Beschäftigtenzahl), flankiert von konjunkturpolitischen Maßnahmen wie<br />
staatlich geförderter Kurzarbeit, dazu geführt, dass die Arbeitslosigkeit deutlich weniger als<br />
erwartet gestiegen ist. Dies wirkt sich auch auf das Zusammenspiel der Push- und Pull-<br />
Faktoren im Gründungsgeschehen aus. Die moderate Verschlechterung der Arbeitsmarktlage<br />
lässt zunächst einen relativ geringen Push-Effekt der Arbeitslosigkeit und damit Anstieg der<br />
Gründungsaktivität erwarten, der dramatische Wirtschaftseinbruch eine starke Verminderung<br />
der Pull-Wirkung der gesamtwirtschaftlichen Situation. Durch den stärkeren Zusammenhang<br />
der Gründungsaktivität mit der Arbeitsmarktlage zeigen die Daten im Saldo höhere Gründerzahlen<br />
an.<br />
Die im bivariaten Vergleich ermittelte weit gehende Unabhängigkeit von konjunktureller Entwicklung<br />
und Gründungen gibt demnach nicht den tatsächlichen Zusammenhang zwischen<br />
Gründungen und Konjunktur per se wieder. Vielmehr bewegen die mit einem wirtschaftlichen<br />
Aufschwung einhergehenden verbesserten Job- und Einkommenschancen in abhängiger<br />
Erwerbstätigkeit potenzielle Gründer eher zur Beibehaltung oder Aufnahme eines vergleichsweise<br />
sicheren abhängigen Beschäftigungsverhältnisses und lässt sie von der Aufnahme<br />
einer risikobehafteten selbstständigen Erwerbstätigkeit Abstand nehmen. Dementsprechend<br />
sollte die Pull-Hypothese nicht a priori verworfen werden, sondern ist in einem multivariaten<br />
Kontext zu überprüfen.
Analysen zur Aufnahme und zur Beendigung der Selbstständigkeit 19<br />
Exkurs 1: Der multivariate Zusammenhang zwischen Gründerquote, Erwerbslosenquote und<br />
realem Wirtschaftswachstum<br />
Um den Zusammenhang zwischen Gründungsaktivität, Konjunktur und Arbeitsmarkt zu überprüfen,<br />
bietet sich eine Regressionsanalyse für den Gesamtzeitraum 2000–2009 an. 33 Als abhängige Variable<br />
wird die Gründerquote q gewählt, als erklärende Größen die reale Jahreswachstumsrate des<br />
BIP, g, sowie die relative Veränderung der Erwerbslosenquote, Δu. Die Schätzung resultiert in folgender<br />
Gleichung (t-Werte in Klammern):<br />
q = 2,<br />
18 + 0,<br />
06 Δu<br />
+ 0,<br />
16 g;<br />
( 25,<br />
08)<br />
( 5,<br />
50)<br />
( 3,<br />
80)<br />
R = 0,<br />
7628,<br />
prob<br />
prob<br />
Breusch-Godfrey<br />
Test auf Autokorrelation<br />
Breusch-Pagan<br />
Test auf Heteroskedastie<br />
Die Schätzergebnisse unterstützen zum einen die Beobachtung, dass die Erwerbslosigkeit als<br />
Push-Faktor wirkt. Der Einfluss der relativen Veränderung der Erwerbslosenquote auf die Gründerquote<br />
ist signifikant positiv, wobei eine um einen Prozentpunkt höhere relative Veränderung der<br />
Erwerbslosenquote zu einem Anstieg der Gründerquote um 0,06 Prozentpunkte führen würde.<br />
Zum anderen entfaltet auch das Wirtschaftswachstum über die Pull-Wirkung einen signifikant positiven<br />
Einfluss auf die Gründerquote. Eine um einen Prozentpunkt höhere reale Wachstumsrate<br />
würde danach zu einem Anstieg der Gründerquote um 0,16 Prozentpunkte führen. Hätte sich die<br />
Wirtschaftskrise in einem noch im Frühjahr 2009 vermuteten Anstieg der Erwerbslosenquote auf<br />
8,1 % und in einem noch stärkeren Rückgang der Wirtschaftsleistung um insgesamt 6 % niedergeschlagen<br />
(Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose, 2009), hätte dies die Gründerquote nochmals<br />
um 0,25 Prozentpunkte nach oben getrieben.<br />
Eine Unterteilung nach Bundesländern ermöglicht eine weitergehende Untersuchung mithilfe einer<br />
Panelregression. Wird die Gründerquote der Jahre 2000–2009 unter Berücksichtigung fixer Effekte<br />
für die Bundesländer auf die relative Änderung der Arbeitslosenquote 34 und die reale Wachstumsrate<br />
des BIP regressiert, so bestätigen sich die Push-Wirkung der Arbeitslosenquote und die Pull-<br />
Wirkung der konjunkturellen Entwicklung auch in dieser Analyse. Dies betrifft sowohl die Größe der<br />
Effekte als auch ihre Signifikanz. 35<br />
Auch wenn Regressionsergebnisse aufgrund der geringen Anzahl von Beobachtungen nicht<br />
allein zur Interpretation herangezogen werden können, unterstützen sie doch die Beobachtung,<br />
dass sowohl eine steigende Erwerbslosigkeit als Push-Faktor als auch eine positive<br />
33<br />
Multivariate Analysen erlauben die simultane Berücksichtung des Einflusses der beiden vorgenannten<br />
(und etwaiger weiterer potenzieller) Einflussfaktoren auf die zu erklärende Größe bzw. die Gründerquote.<br />
Indem die Korrelationsbeziehungen der erklärenden Variablen in multivariaten Analysen<br />
berücksichtigt werden, ist es möglich, die partiellen Effekte bzw. ceteris paribus Effekte der erklärenden<br />
Variablen zu bestimmen. Diese geben den Einfluss der jeweiligen erklärenden Variable auf die zu<br />
erklärende Variable bei unterstellter Konstanz aller anderen erklärenden Variablen wieder.<br />
Ob die zehn Beobachtungen der Jahre 2000–2009 für die Zeitreihenanalyse ausreichend sind, ist von<br />
verschiedenen Faktoren abhängig. Für belastbare Ergebnisse sind im Allgemeinen umso mehr Beobachtungen<br />
heranzuziehen, je mehr zufällige Variation in den Variablen enthalten ist. Für die vorliegenden<br />
Jahresdaten dürften zufällige Schwankungen hinreichend gering sein, was als Ergänzung der<br />
bivariaten Analyse eine Regression mit zwei erklärenden Variablen ermöglicht. Bei der Einordnung<br />
der Ergebnisse ist angesichts der geringen Anzahl von Freiheitsgraden selbstverständlich Vorsicht<br />
angebracht.<br />
34<br />
Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen.<br />
35 Schätzergebnisse auf Anfrage bei den Autoren.<br />
=<br />
=<br />
0,<br />
12<br />
0,<br />
27
20 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
konjunkturelle Entwicklung als Pull-Faktor das Gründungsgeschehen positiv beeinflussen. In<br />
der Situation des Jahres 2009 bedeutet dies eine Erhöhung der Gründungsaktivität durch die<br />
verschlechterte Arbeitsmarktsituation und einen gegenläufigen Effekt durch die Rezession.<br />
Da der erste Effekt stärker ausfällt, ist für die Gründerzahl im Jahr 2009 netto ein Anstieg zu<br />
verzeichnen.<br />
Durch den substanziellen Anteil von Gründern aus der Arbeitslosigkeit am Gründungsgeschehen<br />
in Deutschland haben Änderungen der Förderung der Selbstständigkeit durch die<br />
Bundesagentur für Arbeit (BA) einen entsprechend starken Einfluss auf die Gründerzahlen.<br />
Da das Förderinstrumentarium jedoch seit 2005 im Wesentlichen unverändert geblieben ist,<br />
dürfte am aktuellen Rand kein institutioneller Effekt mehr den Einfluss makroökonomischer<br />
Push- und Pull-Faktoren auf das aggregierte Gründungsgeschehen überlagern, wie dies im<br />
vorangegangenen Konjunkturzyklus der Fall war (siehe Exkurs 2). Insofern ist eher davon<br />
auszugehen, dass die Förderzahlen den Einfluss der Push-Faktoren auf die Gründungsaktivität<br />
widerspiegeln. Im Krisenjahr 2009 haben auch die Zugänge in die BA-Förderprogramme<br />
für Gründer wieder zugenommen (Tabelle 9 im Anhang). So wurden rund 158.000 Arbeitslose<br />
bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit von der BA unterstützt. Dies sind 9 % unterstützte<br />
Arbeitslose mehr als im Jahr 2008, in dem 144.000 Gründer von der BA gefördert wurden.<br />
Der Anstieg der Förderung geht einher mit einem Anstieg der Erwerbslosenquote um 3 %<br />
und einem Rückgang der gemeldeten Stellen um 15 %, beides Indikatoren für die Verschlechterung<br />
der Arbeitsmarktsituation in der Krise.<br />
Exkurs 2: Der Einfluss der aktiven Gründungsförderung durch die Bundesagentur für Arbeit<br />
Da die Dynamik des Gründungsgeschehens in den letzten Jahren maßgeblich durch Gründungen<br />
aus der Arbeitslosigkeit beeinflusst wurde, ist die Förderung der Selbstständigkeit durch die Bundesagentur<br />
für Arbeit (BA) als Einflussfaktor zu berücksichtigen. Eine Übersicht über die Gründerförderung<br />
der BA seit 1999 findet sich in Tabelle 10 im Anhang.<br />
Institutionelle Änderungen der BA-Förderung schlagen sich recht deutlich in den Gründerzahlen<br />
nieder. Die Ausweitung der Gründungsförderung der BA in den Jahren 2003–2004 und die danach<br />
einsetzende restriktivere Ausgestaltung der Förderkonditionen hat offensichtlich jenseits des reinen<br />
Push-Effekts der Arbeitslosigkeit einen spürbaren institutionellen Einfluss auf die Entwicklungen<br />
des Gründungsgeschehens (insbesondere im Vollerwerb) gehabt. Starke Belege für diese Vermutung<br />
sind die Verdopplung der Zugänge (+129.000 Fälle) zur BA-Gründungsförderung bei Einführung<br />
des Existenzgründungszuschusses im Jahr 2003 und der starke Abfall der Zugangszahlen (-<br />
86.000 Fälle) im Jahr 2005 bei Ausschluss der früheren Arbeitslosenhilfeempfänger vom Förderanspruch.<br />
Diese Ausschläge in BA-geförderten Gründungen, die sich auch in den Gründerquoten<br />
in Grafik 1 widerspiegeln (Anstieg der Gründerquote im Jahr 2003 und deutlicher Rückgang seit<br />
dem Jahr 2005), können nicht allein durch die Entwicklung der Erwerbslosigkeit erklärt werden. Die<br />
Erwerbslosenquote stieg bspw. im Jahr 2005 um 0,9 Prozentpunkte an, was für sich genommen<br />
eine steigende Gründerzahl induziert haben sollte.
Analysen zur Aufnahme und zur Beendigung der Selbstständigkeit 21<br />
Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf das Gründungsgeschehen<br />
Die verstärkte Gründungsaktivität in der Rezession wird zwar vornehmlich von der Push-<br />
Wirkung einer schlechten Arbeitsmarktsituation gespeist, muss jedoch nicht nur Gründungen<br />
aus der Not heraus hervorbringen. Auch Personen, die eine Gründungsidee „in der Schublade“<br />
liegen hatten, können durch einen äußeren Anlass, wie ein unsicherer werdendes Beschäftigungsverhältnis,<br />
dazu bewogen werden, ihr Projekt umzusetzen. Zudem können Personen<br />
gerade in der Krise als Zeit des Wandels Chancen für eine Gründung entdecken. Mit<br />
dieser Einschätzung in Einklang steht die Erfahrung, dass Gründungsprojekte in Krisen insofern<br />
größer ausfallen, als der Schritt in die Selbstständigkeit dann ‚nur’ mit einer substanziellen<br />
und als tragfähig eingestuften Gründungsidee gegangen wird (OECD, 2009). Gründungen<br />
mit weniger ausgereiftem Konzept ‚zum Ausprobieren’ finden dagegen weniger häufig statt.<br />
Im Gegensatz dazu könnte die Gründungsgröße in Krisenzeiten aber auch kleiner ausfallen.<br />
Zum einen wäre dies der Fall, wenn für die Gründer, die auf externe Ressourcen zur Finanzierung<br />
ihres Projekts zurückgreifen müssen, der Finanzierungszugang eingeschränkt wäre. 36<br />
Zum anderen könnten Gründer in der Krise dezidiert klein starten und erst nach entsprechenden<br />
Anfangserfolgen eine Ausweitung des Geschäftsbetriebs auf den ursprünglich geplanten<br />
Umfang vornehmen. Ein infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise vorsichtiges Agieren sowohl<br />
der Gründer als auch der Kapitalgeber würde sich dann in einem kleineren Umfang der<br />
Gründungen widerspiegeln.<br />
In Grafik 3 werden die möglichen Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Gründungsaktivität<br />
differenziert betrachtet. Für rund 44 % der Gründer blieb die Wirtschaftskrise bis zum Befragungszeitraum<br />
in der zweiten Jahreshälfte 2009 folgenlos. Die häufigste Auswirkung der<br />
Krise ist ein erhöhter Druck zur Selbstständigkeit, der am zweithäufigsten verbreitete Effekt<br />
ist die Eröffnung von Gründungschancen. Allerdings werden deutliche Unterschiede in Abhängigkeit<br />
vom Gründungsumfang sichtbar. Vollerwerbsgründer spüren seltener keine Krisenauswirkungen<br />
(33 %) als Nebenerwerbsgründer, von denen sich über die Hälfte als nicht<br />
betroffen bezeichnet. Die Differenz in der Wahrnehmung von Krisenauswirkungen zwischen<br />
Voll- und Nebenerwerbsgründern speist sich zum einen aus dem unterschiedlichen Druck,<br />
den die Krise auf die Gründer ausgeübt hat, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen.<br />
Zum anderen eröffnete die Krise aber auch Chancen, die Gründer häufiger für eine Vollerwerbsgründung<br />
genutzt haben.<br />
36<br />
Zur Gründungsfinanzierung und insbesondere zur Entwicklung von Finanzierungsschwierigkeiten<br />
siehe Abschnitt 5.
22 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Ein Mangel an Erwerbsalternativen, der sich aus der unsicheren Arbeitsmarktlage angesichts<br />
(drohender) Arbeitslosigkeit und weniger offenen Stellen ergibt, ist vor allem für Vollerwerbsgründer<br />
spürbar. Für rund 25 % der Vollerwerbsgründer hat die Krise den Druck zur Selbstständigkeit<br />
erhöht. Im Gegensatz dazu sind Nebenerwerbsgründer, die per Definition auf eine<br />
alternative Haupterwerbsquelle zurückgreifen können, dem Druck weniger stark ausgesetzt<br />
(14 % derart betroffen). Verkürzte Arbeitszeiten aufgrund von weniger Überstunden oder<br />
Kurzarbeit, sowie möglicherweise auch geringere Arbeitsentgelte mögen aber auch die Notwendigkeit<br />
eines Hinzuverdienstes verstärkt haben.<br />
In Wirtschaftskrisen verstärkt sich der Strukturwandel in der Wirtschaft und der „Prozess der<br />
schöpferischen Zerstörung“ intensiviert sich. Die Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur<br />
eröffnen Gründungschancen, die von Gründern im Vollerwerb stärker genutzt werden. Rund<br />
20 % der Vollerwerbsgründer und 15 % der Nebenerwerbsgründer geben an, dass sich die<br />
Wirtschaftskrise in Form einer eröffneten Gründungschance direkt positiv ausgewirkt hat.<br />
Gründungszeitpunkt verzögert<br />
Gründungsumfang kleiner als geplant<br />
Gründungschance eröffnet<br />
Druck für Schritt in Selbstständigkeit erhöht<br />
Bislang keine Auswirkungen<br />
7,1<br />
7,8<br />
6,6<br />
13,5<br />
14,7<br />
12,6<br />
17,2<br />
19,9<br />
14,8<br />
19,5<br />
25,3<br />
14,1<br />
44,4<br />
32,6<br />
54,6<br />
0% 20% 40% 60%<br />
Alle Gründer<br />
Vollerwerb<br />
Nebenerwerb<br />
95%-Konfidenzintervall<br />
Die Zahlen neben den Balken geben die Anteile der Gründer der jeweiligen Gründergruppen an allen mind. n=668 Gründern, an<br />
allen mind. n=295 Gründern im Vollerwerb bzw. an allen mind. n=366 Gründern im Nebenerwerb wieder, die sich zu den Auswirkungen<br />
der Finanz- und Wirtschaftskrise auf ihr Gründungsprojekt geäußert haben (Mehrfachnennungen möglich). Lesehilfe:<br />
19,5 % aller Gründer haben durch die Finanz- und Wirtschaftskrise einen verstärkten Druck für den Schritt in die Selbstständigkeit<br />
verspürt.<br />
Grafik 3: Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf Gründer<br />
Ein verzögerter Gründungszeitpunkt und ein kleinerer als geplanter Gründungsumfang sind<br />
zwei weitere Kanäle, durch die die Wirtschaftskrise negativ auf die Gründungsaktivität wirkt.<br />
Beide Effekte sind unter Voll- und Nebenerwerbsgründern nahezu gleichermaßen verbreitet.
Analysen zur Aufnahme und zur Beendigung der Selbstständigkeit 23<br />
Ein geringerer Gründungsumfang als geplant war für 15 % der Vollerwerbsgründer und 13 %<br />
der Nebenerwerbsgründer relevant; rund 8 % der Vollerwerbsgründer und 7 % der Nebenerwerbsgründer<br />
haben wegen der Wirtschaftskrise den Gründungszeitpunkt verschoben. Nicht<br />
ermitteln lassen sich hingegen die Gründer, die ihr Projekt aufgrund der Wirtschaftskrise ganz<br />
aufgegeben oder auf einen Zeitpunkt nach der Befragung verschoben haben. Insofern sind<br />
die Zahlen eher als Untergrenzen für die negativen Auswirkungen der Rezession auf die<br />
Gründungsaktivität in 2009 zu interpretieren.<br />
Gründungsgeschehen in den Regionen<br />
Unterschiede im Gründungsgeschehen zwischen West- und Ostdeutschland sind Grafik 4<br />
sowie Tabelle 7 und Tabelle 8 im Anhang zu entnehmen. Im Westen lag die Gesamtgründerquote<br />
im Jahr 2009 mit 1,78 % wie in den Vorjahren höher als im Osten (1,30 %). Die auf die<br />
jeweiligen Bevölkerungen hochgerechneten Gründerzahlen belaufen sich entsprechend auf<br />
752.000 (+11 %) Personen in Westdeutschland und 122.000 (+6 %) Personen in Ostdeutschland<br />
(Veränderungen zum Vorjahr in Klammern). Damit fiel, nachdem die Gründerzahlen bereits<br />
im Jahr 2008 im Westen weniger stark zurückgegangen waren als im Osten, der Anstieg<br />
in der Gründungsaktivität insgesamt in Westdeutschland stärker aus als in Ostdeutschland.<br />
Hierdurch hat sich die Lücke in der Gründungsaktivität zwischen Ost- und Westdeutschland<br />
weiter vergrößert. Die geringere Gründungsneigung in Ostdeutschland zeigt sich auch in den<br />
empirischen Analysen zur Struktur des Gründungsgeschehens und der Gründungsentscheidung<br />
(siehe Abschnitt 3.2 und Abschnitt 4.1).
24 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
3,5%<br />
3,0%<br />
2,5%<br />
2,0%<br />
1,5%<br />
1,0%<br />
0,5%<br />
0%<br />
2,45<br />
2,91 2,86 2,99<br />
West Ost<br />
2,64 2,55<br />
2,07<br />
1,72<br />
1,78<br />
1,61<br />
2,32<br />
2,94<br />
2,36 2,38<br />
2,25<br />
2,15 2,20<br />
1,43<br />
1,22 1,30<br />
2000 2003 2006 2009 2000 2003 2006 2009<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb 95%-Konfidenzintervall<br />
Die Gründerquoten beruhen auf den folgenden Stichprobenumfängen (1. Angabe jeweils für West-, 2. Angabe jeweils für Ostdeutschland):<br />
n=18.712, 4.792 (2000), n=12.020, 2.997 (2001), n=23.665, 6.111 (2002), n=24.468, 6.191 (2003), n=24.290,<br />
6.173 (2004), n=23.898, 6.066 (2005), n=30.029, 7.202 (2006), n=30.493, 7.127 (2007), n=20.080, 4.919 (2008) , n=32.785,<br />
15.635 (2009). Zur eingeschränkten Vergleichbarkeit der Gründerquoten der Jahre 2000 und 2001 vgl. die Anmerkungen in der<br />
Fußnote zu Grafik 1.<br />
Grafik 4: Gründerquoten in West- und Ostdeutschland 2000–2009<br />
Die Quoten der Gründer im Vollerwerb (Nebenerwerb) betragen am aktuellen Rand 0,78 %<br />
(1,00 %) in Westdeutschland und 0,74 % (0,56 %) in Ostdeutschland. Dementsprechend sind<br />
für 2009 in Westdeutschland 329.000 (+29 %) Vollerwerbsgründer und 422.000 (+/-0 %) Nebenerwerbsgründer,<br />
in Ostdeutschland 69.000 (-5 %) Vollerwerbs- und 52.000 (+27 %) Nebenerwerbsgründer<br />
zu verzeichnen (Veränderungen zum Vorjahr in Klammern). 37<br />
Der für Deutschland insgesamt im Jahr 2009 zu beobachtende Anstieg der Vollerwerbsgründungen<br />
resultiert dementsprechend ausschließlich aus einem deutlichen Anstieg in Westdeutschland<br />
um rund 73.000 Personen, während für die Zahl der Vollerwerbsgründer in Ostdeutschland<br />
ein – wenngleich geringer – Rückgang um 4.000 Personen zu verzeichnen ist.<br />
Der leichte Anstieg der Nebenerwerbsgründer auf Bundesebene ist dagegen ausschließlich<br />
auf eine Zunahme in Ostdeutschland (+11.000 Personen) zurückzuführen, da sich die Zahl<br />
der Nebenerwerbsgründer in Westdeutschland im Vergleich zu 2008 im Prinzip nicht verändert<br />
hat (-2.000 Personen). Die Verteilung der gestiegenen Gründungsaktivität auf mehr Vollerwerbsgründer<br />
in Westdeutschland und mehr Nebenerwerbsgründer in Ostdeutschland zeigt<br />
37 Statistisch signifikant ist keine der Veränderungen von 2008 auf 2009.
Analysen zur Aufnahme und zur Beendigung der Selbstständigkeit 25<br />
einmal mehr, dass in den Regionen vermutlich unterschiedliche Mechanismen das Gründungsgeschehen<br />
treiben. Während sich für Westdeutschland die Zahlen für Voll- und Nebenerwerbsgründer<br />
relativ parallel entwickeln, jedoch durchgängig mehr Nebenerwerbsgründer<br />
zu verzeichnen sind, verläuft die Entwicklung der Gründerzahlen in Ostdeutschland deutlich<br />
volatiler. Dies könnte einerseits daran liegen, dass das Gründungsgeschehen in Ostdeutschland<br />
stärker auf die Push- und Pull-Faktoren – konjunkturelle Entwicklung und Änderung der<br />
Arbeitsmarktsituation – reagiert. Andererseits ist nicht auszuschließen, dass die stärkeren<br />
Ausschläge in Ostdeutschland lediglich das Ergebnis der aufgrund der geringeren Beobachtungszahlen<br />
für die neuen Bundesländer deutlich größeren Schwankungsbreiten (Konfidenzintervalle)<br />
der Zeitreihen sind.<br />
Die unterschiedliche Entwicklung der Vollerwerbsgründerzahl in Ost- und Westdeutschland<br />
im Jahr 2009 spiegelt mutmaßlich verschieden starke Push-Wirkungen der Arbeitslosigkeit<br />
wider. Während in Westdeutschland die Arbeitslosenquote gestiegen ist, ist sie in Ostdeutschland<br />
sogar etwas zurückgegangen, 38 was die gestiegene Zahl der Vollerwerbsgründer<br />
in Westdeutschland und die leicht gesunkene Zahl in Ostdeutschland erklären könnte.<br />
Für Nebenerwerbsgründer sind die sonstigen Gründe, vor allem Selbstverwirklichung und<br />
pekuniäre Gründe, ein weiter verbreitetes Gründungsmotiv als für Vollerwerbsgründer, während<br />
das Notmotiv eine geringere Rolle spielt (siehe Abschnitt 4.1, Tabelle 3). Zum einen ist<br />
daher der Push-Effekt der Arbeitslosigkeit weniger stark ausgeprägt. Zum anderen ist der<br />
zum Push-Effekt der Arbeitslosigkeit gegenläufige Effekt fehlender Gelegenheiten für Gründungen<br />
und Hinzuverdienstmöglichkeiten, die sich in der negativen Wachstumsrate des BIP<br />
widerspiegelt, bei den Nebenerwerbsgründern ausgeprägter. Dies zeigt sich insbesondere in<br />
Westdeutschland, wo die Zahl der Nebenerwerbsgründer in 2009 nur geringfügig zugenommen<br />
hat.<br />
In Ostdeutschland ist dagegen die Zahl der Nebenerwerbsgründer 2009 deutlich gestiegen.<br />
In den neuen Bundesländern hat sich zwar die Arbeitsmarktsituation angesichts eines hier<br />
weniger dramatischen Konjunkturabschwungs nicht so stark verschlechtert wie in den alten<br />
Bundesländern, aber die Unsicherheit über die Prognosen über den Arbeitsmarkt und Zweifel<br />
an der Belastbarkeit der sich abzeichnenden Erholung in der ersten Jahreshälfte 2009 dürften<br />
schon als Anstoß für eine erhöhte Gründungsaktivität gereicht haben. Da das Zeitbudget je-<br />
38 Arbeitslosenquote als Anteil an allen zivilen Erwerbspersonen: Westdeutschland 2008 6,4 %, 2009<br />
6,9 %; Ostdeutschland inkl. Berlin 2008 13,1 %, 2009 13,0 % (Quelle: Sachverständigenrat, 2010).<br />
Ein sehr ähnliches Bild ergibt sich, wenn die Unterbeschäftigung mit Kurzarbeit betrachtet wird. Während<br />
in Westdeutschland ein Anstieg um 18 % zu verzeichnen ist, ergibt sich für Ostdeutschland nur<br />
eine Zunahme um 1 % (eigene Berechnungen auf Basis Bundesagentur für Arbeit, 2010a).
26 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
doch nicht für eine Vollerwerbsgründung ausreicht, wenn eine Person weiter in abhängiger<br />
Beschäftigung arbeitet, können Gründungswillige in den Nebenerwerb „umgeleitet“ worden<br />
sein. Dass hinreichend viele Gelegenheiten für Gründer im Nebenerwerb vorhanden waren,<br />
könnte auch auf den Rückgang der Gründerquote im Nebenerwerb von 1,28 % in 2006 auf<br />
0,44 % in 2008 zurückzuführen sein. War das Gründungspotenzial während der guten konjunkturellen<br />
Entwicklung bis Mitte 2008 nicht ausgeschöpft, so mag dies zu einem Nachholbedarf<br />
bei Nebenerwerbsgründungen in Ostdeutschland geführt haben.<br />
Gründungsgeschehen in den Bundesländern<br />
Mit der Betrachtung des Gründungsgeschehens auf Bundesländerebene erfolgt in Grafik 5<br />
eine weiter gehende regionale Differenzierung der Gründungsaktivität. Um eine höhere statistische<br />
Belastbarkeit der Analyse zu gewährleisten, werden die Daten der <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>befragungen<br />
für die Jahre 2006 bis 2009 gemeinsam betrachtet. Die Länder sind in<br />
absteigender Reihenfolge der Gesamtgründerquote angeordnet.<br />
Die höchsten Gründerquoten sind in den beiden Stadtstaaten Berlin (3,20 %) und Hamburg<br />
(2,51 %), gefolgt von den drei wirtschaftsstarken Flächenstaaten Hessen (2,12 %), Bayern<br />
(1,97 %) und Schleswig-Holstein (1,91 %) auf den Plätzen 3 bis 5 zu verzeichnen. Die niedrigste<br />
Gründerquote besitzt Bremen (1,16 %). Auf den Plätzen 12 bis 15 finden sich die Flächenstaaten<br />
Saarland, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, und Thüringen wieder. Generell<br />
sind die (in Termini des BIP pro Kopf) wohlhabenden Länder eher in der oberen und die ärmeren<br />
Länder eher in der unteren Hälfte der Liste angesiedelt. Eine höhere Kaufkraft in den<br />
wohlhabenden Bundesländern führt zu günstigen Nachfragebedingungen, die sich in einer<br />
höheren Gründungsaktivität insbesondere im Nebenerwerb niederschlagen.<br />
Zwei Ausnahmen fallen ins Auge. Zum ersten findet sich das Land Brandenburg mit einer<br />
Gründerquote von 1,79 % im Mittelfeld auf Rang 8 wieder, obwohl es das zweitniedrigste BIP<br />
pro Kopf aufweist. Die vergleichsweise hohe Gründungsaktivität ist mutmaßlich auf das brandenburgische<br />
Umland von Berlin zurückzuführen. Die zweite Ausnahme bildet Bremen, welches<br />
vom Pro-Kopf-Einkommen her auf dem zweiten Platz steht, jedoch für die geringste<br />
Gründerquote verantwortlich zeichnet. Auch für den Bereich der technologie- und wissensintensiven<br />
Gründungen ist die Region Bremen-Oldenburg am unteren Ende der Metropolregionen<br />
Deutschlands zu finden (Metzger et al., 2008). Für die Schwäche Bremens im technologieorientierten<br />
Gründungsgeschehen dürften eine eher ungünstige Branchenstruktur sowie<br />
die Qualifikationsstruktur der Beschäftigten verantwortlich zeichnen (Meurer und Stenke,<br />
2007).
Analysen zur Aufnahme und zur Beendigung der Selbstständigkeit 27<br />
Berlin<br />
Hamburg<br />
Hessen<br />
Bayern<br />
Schleswig-Holstein<br />
Baden-Württemberg<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
Brandenburg<br />
Niedersachsen<br />
Rheinland-Pfalz<br />
Sachsen-Anhalt<br />
Saarland<br />
Mecklenburg-Vorpommern<br />
Sachsen<br />
Thüringen<br />
Bremen<br />
0,57<br />
0,76<br />
0,81<br />
0,79<br />
0,80<br />
1,06<br />
1,22<br />
0,93<br />
0,98<br />
1,11<br />
1,08<br />
0,90<br />
0,89<br />
0,74 1,01<br />
0,68<br />
0,94<br />
0,69 0,82<br />
0,71 0,80<br />
0,78<br />
0,65<br />
0,81<br />
0,58<br />
0,57<br />
0,59<br />
1,10<br />
1,32<br />
1,32<br />
1,44<br />
1,39<br />
1,16<br />
1,45<br />
1,88<br />
1,97<br />
1,91<br />
1,87<br />
1,75<br />
1,67<br />
1,62<br />
1,51<br />
1,79<br />
1,51<br />
1,91<br />
2,12<br />
0% 1% 2% 3%<br />
2,51<br />
3,20<br />
Alle Gründer<br />
Vollerwerb<br />
Nebenerwerb<br />
95%-Konfidenzintervall<br />
Die regionalen Gründerquoten wurden aus den kumulierten Gründerzahlen der Jahre 2005 bis 2009 berechnet, um statistisch<br />
belastbarere Ergebnisse zu erhalten. Den Berechnungen liegen die folgenden Stichprobenumfänge zu Grunde: n=7.729 (Berlin),<br />
n=3.596 (Hamburg), n=12.012 (Hessen), n=26.447 (Bayern), n=5.452 (Schleswig-Holstein), n=20.115 (Baden-Württemberg),<br />
n=36.333 (Nordrhein-Westfalen), n=6.910 (Brandenburg), n=16.474 (Niedersachsen), n=8.557 (Rheinland-Pfalz),<br />
n=6.942 (Sachsen-Anhalt), n=2.139 (Saarland), n=4.615 (Mecklenburg-Vorpommern), n=12.141 (Sachsen), n=6.834 (Thüringen),<br />
n=1.310 (Bremen).<br />
Grafik 5: Gründerquoten nach Bundesländern (Durchschnitt 2005–2009)<br />
Weiterhin auffällig ist, dass die Rangfolge der Gründerquoten in Grafik 5 durch zwei dicht<br />
besiedelte Stadtstaaten angeführt wird. In diesen Ballungsräumen existiert eine vergleichsweise<br />
hohe Gründungsdynamik. Dieses Bild untermauert auch Grafik 19 im Anhang, die die<br />
Gründerquoten nach Gemeindegrößenklassen ausweist: Im Vergleich zu kleinen Gemeinden<br />
liegt in Großstädten und insbesondere in Gemeinden mit über 100.000 Einwohnern die Gründerquote<br />
tendenziell höher und die Gründungsneigung ist in Großstädten ab 500.000 Einwohner<br />
höher als in kleineren Gemeinden (siehe Tabelle 4). Dies gilt vor allem für Gründer im<br />
Vollerwerb. Großstädte weisen höhere Arbeitslosenquoten auf, was als Pushfaktor Gründer<br />
aus der Arbeitslosigkeit antreibt. Gleichzeitig ist durch das Vorhandensein von Clustern und<br />
die Möglichkeit, sich in Netzwerke einzubinden, die Attraktivität einer Gründung erhöht.<br />
Fazit und Ausblick zum aktuellen Gründungsgeschehen<br />
Im Jahr 2009 hat die Wirtschaftskrise zu einer Polarisierung des Gründungsgeschehens geführt.<br />
Auf der einen Seite hat sich der Druck zur Selbstständigkeit aufgrund der verschlechterten<br />
Arbeitsmarktsituation erhöht, auf der anderen Seite eröffnete die Wirtschaftskrise<br />
durch den verstärkten Strukturwandel auch Gründungschancen. Entsprechend sind in 2009
28 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
sowohl ein höherer Anteil von Chancengründern im Voll- und Nebenerwerb als auch ein höherer<br />
Anteil von Notgründern im Vollerwerb zu Lasten der Gründung aus sonstigen Motiven<br />
zu verzeichnen (siehe Grafik 29).<br />
Insgesamt ist die Gründungsaktivität deutlich angestiegen. Dieser Gesamteffekt nährt sich<br />
aus den entgegengesetzt wirkenden Faktoren Arbeitsmarktsituation und konjunktureller Entwicklung.<br />
Auf der einen Seite steht die Push-Wirkung einer (drohenden) Arbeitslosigkeit und<br />
den weniger zahlreichen Möglichkeiten in abhängiger Beschäftigung, die für sich genommen<br />
zu steigenden Gründerzahlen führt. Wenn sich die Aussichten für abhängige Beschäftigungsverhältnisse<br />
verschlechtern, kann dies der äußere Auslöser sein, Gründungspläne<br />
umzusetzen oder den Schritt in die Selbstständigkeit in Ermangelung anderer Möglichkeiten<br />
der Erwerbstätigkeit zu gehen. Auf der anderen Seite steht die Pull-Wirkung der konjunkturellen<br />
Entwicklung, die in der Rezession einen entsprechend negativen Einfluss auf die<br />
Gründungsaktivität entfaltet. Die Schwere der Rezession hat allerdings nicht nur zu einem<br />
Nachfrageausfall geführt, sondern gleichzeitig den „Prozess schöpferischer Zerstörung“ verstärkt,<br />
der direkt Gründungschancen eröffnet. Im Jahr 2009 haben der positive Push-Effekt<br />
der schlechten Arbeitsmarktsituation und die durch die Krise hervorgerufenen Gründungschancen<br />
den negativen Pull-Effekt des Konjunkturabschwungs deutlich überkompensiert.<br />
Die Unterscheidung nach Vollerwerbs- und Nebenerwerbsgründern lässt zudem vermuten,<br />
dass die Push- und Pullfaktoren im Jahr 2009 unterschiedlich auf potenzielle Gründer gewirkt<br />
haben. So ist die Zahl der Vollerwerbsgründer deutlich gestiegen, während sich das<br />
Gründungsgeschehen im Nebenerwerb auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2008 bewegt.<br />
Die starke Push-Wirkung der Arbeitslosigkeit und die Wahrnehmung von länger geplanten<br />
und langfristig ausgelegten Projekten, die die höheren Markteintrittsschranken in der Rezession<br />
überwinden können, dürften die Entscheidung für Gründungen im Vollerwerb begünstigt<br />
haben. Für Gründungen im Nebenerwerb hat sich in dieser Rezession die Arbeitsmarktsituation<br />
insofern günstig ausgewirkt, als die starke Zunahme der Kurzarbeit und die Reduktion<br />
des Arbeitsvolumens das Zeitbudget von Gründungswilligen zu Gunsten von Selbstständigkeitsprojekten<br />
verschoben hat. Allerdings dürfte die fehlende Nachfrage die Hinzuverdienstchancen<br />
für selbstständige Zusatztätigkeiten deutlich reduziert haben, sodass die Zahl der<br />
Nebenerwerbsgründer in der Summe letztendlich kaum zugenommen hat.<br />
Für das Jahr 2010 deuten Konjunkturprognosen auf eine weitere wirtschaftliche Erholung<br />
hin, allerdings in gemäßigtem Tempo. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass die<br />
wirtschaftliche Erholung von Rezessionen, die mit Finanzkrisen gekoppelt waren, langsamer<br />
verläuft als Aufschwünge im normalen Konjunkturzyklus (Reinhart und Rogoff, 2008). Der<br />
Arbeitsmarkt hat sich in der Rezession als robuster als erwartet erwiesen. Da er der Konjunktur<br />
nachläuft, kann eine weitere Verschlechterung zwar nicht vollständig ausgeschlossen
Analysen zur Aufnahme und zur Beendigung der Selbstständigkeit 29<br />
werden, nach Einschätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute dürfte sich jedoch kein erhöhter<br />
Entlassungsdruck aufbauen (Projekt Gemeinschaftsdiagnose, 2010).<br />
Vor diesem Hintergrund ist für die Gründungsaktivität im laufenden Jahr und der nahen Zukunft<br />
eine Seitwärtsbewegung der Gründungszahlen zu erwarten. Die moderate konjunkturelle<br />
Erholung führt zwar zu einem positiven Pull-Effekt für das Gründungsgeschehen, der<br />
aber weiterhin schwach ausfallen dürfte, denn erstens ist die Wachstumsrate noch niedrig<br />
und zweitens hat sich das Gründungsgeschehen in Deutschland in der Vergangenheit wenig<br />
konjunkturreagibel gezeigt. Einen stärkeren Effekt übt die Arbeitsmarktlage aus. Da sich diese<br />
erwartungsgemäß leicht entspannt, baut sich kein zusätzlicher Druck zur Selbstständigkeit<br />
auf. Gleichzeitig deutet sich aber auch keine wesentliche Verbesserung der Situation für<br />
die schon Arbeitslosen an, sodass insbesondere Langzeitarbeitslose in Ermangelung von<br />
Erwerbsalternativen eine Selbstständigkeit in Betracht ziehen können. Selbstständigkeit<br />
– evtl. auch nur auf Zeit – kann helfen, dass sich die konjunkturell bedingte höhere Arbeitslosigkeit<br />
nicht wieder in eine strukturelle Arbeitslosigkeit verfestigt. Weiterhin sind keine Aufstockungen<br />
oder Erleichterungen der BA-Förderprogramme für Gründungen aus der Arbeitslosigkeit<br />
absehbar, sodass auch kein institutioneller Effekt die konjunkturellen Einflussgrößen<br />
überlagern dürfte.<br />
3.2 Strukturmerkmale der Gründungen<br />
Im vorangegangenen Abschnitt wurde das Gründungsgeschehen in Deutschland als ganzes<br />
und somit in seiner Quantität beleuchtet. Die nachfolgenden Betrachtungen wenden sich nun<br />
den Strukturmerkmalen der Gründungen zu und rücken damit Qualitätsaspekte in den Fokus.<br />
Analysiert werden die Strukturmerkmale „Gründungsform“ (Neugründung, Beteiligung oder<br />
Übernahme), „Branche“, „Innovationsgehalt“ sowie „Gründungsgröße“ (Anzahl der Mitgründer<br />
und Mitarbeiter). Tabelle 1 enthält eine Übersicht über die Verteilungen dieser Merkmale unter<br />
den Gründungsprojekten. Grafik 20 bis Grafik 25 und Tabelle 11 im Anhang können weiter<br />
gehende Informationen entnommen werden.<br />
Gründungsform<br />
Der <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> ist eine Bevölkerungsbefragung und erfasst das Gründungsgeschehen<br />
folglich auf der Personenebene. Aus diesem Grund ist es naheliegend, dem Gründungsgeschehen<br />
sowohl Neugründungen von Unternehmen als auch Übernahmen von und<br />
Beteiligungen an bestehenden Unternehmen zuzurechnen, da jede dieser drei Gründungsformen<br />
aus der Sicht des Existenzgründers den Schritt in die Selbstständigkeit definiert.<br />
Wesentliche Unterschiede zwischen den Gründungsformen bestehen in der Anzahl der<br />
Teampartner des Gründers und hinsichtlich der Anzahl von Mitarbeitern, die der Gründer be-
30 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
schäftigt. Während Neugründer (im Vollerwerb) mit durchschnittlich 0,35 (0,26) Teampartnern<br />
und 0,58 (0,69) vollzeitäquivalenten Mitarbeitern die kleinsten Gründungsprojekte starten,<br />
sind die Projekte von Übernahmegründern (im Vollerwerb) mit 0,64 (0,60) Teampartnern und<br />
1,8 (2,2) Mitarbeitern und die Projekte von Beteiligungsgründern (im Vollerwerb) mit<br />
1,0 (0,65) Teampartnern und 0,71 (0,68) Mitarbeitern merklich größer. 39 Die Unterscheidung<br />
der drei Gründungsformen bietet sich auch deshalb an, weil sie eine mitunter sehr unterschiedliche<br />
Qualität mit entsprechenden Konsequenzen für das Wachstum und die Beschäftigung<br />
in einer Volkswirtschaft besitzen. Man denke dabei z. B. an die Neugründung eines<br />
Technologieunternehmens, die Beteiligung an einem bestehenden Direktvertriebsunternehmen<br />
im Konsumgüterbereich oder an die familieninterne Übernahme eines Handwerksbetriebs.<br />
Während von Neugründungen insbesondere in technologieorientierten Branchen wichtige<br />
Impulse für Innovation und Beschäftigung erwartet werden können, sichern Übernahmen<br />
und Beteiligungen in erster Linie das Fortbestehen von und die Arbeitsplätze in bestehenden<br />
Unternehmen und weisen eine relativ geringe Innovationsaktivität auf (vgl. Spengler und Tilleßen<br />
2006).<br />
Tabelle 1 sowie Tabelle 11 im Anhang zeigen, dass Neugründungen sowohl am aktuellen<br />
Rand als auch über den Zeitraum 2001–2009 hinweg die bedeutendste Gründungsform darstellen.<br />
Im Jahr 2009 waren 69 % aller Gründer, 67 % der Voll- und 71 % der Nebenerwerbsgründer<br />
Neugründer. Diese Anteile entsprechen hochgerechneten Zahlen von<br />
ca. 603.000 Neugründern insgesamt, 267.000 Neugründern im Vollerwerb und 336.000 Neugründern<br />
im Nebenerwerb. Im Vergleich zum Vorjahr (79 %) ist der Anteil der Neugründungen<br />
an allen Vollerwerbsgründungen allerdings um mehr als 10 Prozentpunkte (!) zurückgegangen;<br />
gleichzeitig ist der Anteil der Übernahmegründungen ebenso stark angestiegen. In<br />
der Rezession gewinnt so die wirtschaftspolitische Diskussion um Unternehmensnachfolgen<br />
und ihre Erfolgsfaktoren nochmals an Gewicht.<br />
39 Um den Einfluss von Ausreißern und potenziellen Falschangaben bei Teampartnerzahl und Mitarbeiterzahl<br />
zu reduzieren, wurden nur solche positiven Angaben zur Teampartner- bzw. Mitarbeiterzahl<br />
in die Mittelwertberechnungen einbezogen, die höchstens so groß wie das 95 %-Perzentil der positiven<br />
Wertangaben sind. Angaben von „Null“ Teampartnern bzw. Mitarbeitern sind in die Mittelwertberechnungen<br />
einbezogen.
Analysen zur Aufnahme und zur Beendigung der Selbstständigkeit 31<br />
Tabelle 1: Ausgewählte Strukturmerkmale der Gründung 2009 (Anteile in Prozent)<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb<br />
Gründungsform<br />
Neugründung 69,2 67,3 70,8<br />
Übernahme 12,6 19,3 6,6<br />
Beteiligung<br />
Branche<br />
18,2 13,4 22,6<br />
Verarbeitendes Gewerbe 3,2 5,1 1,7<br />
Baugewerbe 6,7 10,8 3,3<br />
Handel 20,3 19,7 20,8<br />
Gastgewerbe 2,8 2,2 3,2<br />
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 2,9 4,4 1,6<br />
Versicherungs-, Finanzdienstleistungen 5,0 8,4 2,2<br />
wirtschaftliche Dienstleistungen 28,6 26,5 30,0<br />
persönliche Dienstleistungen 23,7 20,6 26,2<br />
sonstige Branchen (keine Dienstleistungen)<br />
Berufsgruppe<br />
6,9 2,2 11,1<br />
Freie Berufe 27,6 25,0 29,8<br />
Handwerk 16,7 24,0 10,8<br />
andere Berufsgruppe<br />
Neuheit der Produkte / Dienstleistungen<br />
55,7 51,1 59,4<br />
keine Marktneuheit 87,5 85,0 89,5<br />
regionale Marktneuheit 8,6 9,8 7,8<br />
deutschlandweite Marktneuheit 1,8 2,4 1,4<br />
weltweite Marktneuheit<br />
Gründungsgröße<br />
2,0 2,8 1,3<br />
Sologründer ohne Mitarbeiter 55,2 50,2 59,2<br />
Sologründer mit Mitarbeitern 23,4 30,4 17,6<br />
Teamgründer ohne Mitarbeiter 6,7 3,0 9,8<br />
Teamgründer mit Mitarbeitern<br />
Nachrichtl.: Gründungsgröße von Neugründungen<br />
14,6 16,4 13,4<br />
Sologründer ohne Mitarbeiter 58,9 53,9 63,2<br />
Sologründer mit Mitarbeitern 25,4 29,8 21,4<br />
Teamgründer ohne Mitarbeiter 5,7 3,3 7,8<br />
Teamgründer mit Mitarbeitern 10,0 13,0 7,6<br />
Grafische Darstellungen der Gründungsmerkmale inklusive Konfidenzintervallen finden sich im Anhang (Grafik 20 bis Grafik<br />
25). Den Fußnoten der Grafiken ist zu entnehmen, auf welchen Stichprobengrößen die dargestellten Verteilungen der Gründungsmerkmale<br />
beruhen.<br />
Die Zeitreihen zur Gründungsform in Tabelle 11 erlauben einen Vergleich der Verteilung der<br />
Gründungsform am aktuellen Rand mit den Jahren 2001/2002. Wie das Jahr 2009 war auch<br />
das Jahr 2002 das erste (reine) Rezessionsjahr nach einer Hochkonjunktur und auch damals<br />
gab es im gleichen Ausmaß eine Verschiebung innerhalb der Gründungsformen im Vollerwerb<br />
hin zu Übernahmen und zu Lasten der Neugründungen. Wie ist dieses Muster zu interpretieren?<br />
Setzt eine Wirtschaftskrise in Deutschland ein, so gibt es aufgrund der verzögerten<br />
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt (z. B. aufgrund automatischer Stabilisatoren wie dem<br />
vergleichsweise generösen Arbeitslosengeld oder Kündigungsschutzregeln, aber auch aufgrund<br />
des Kurzarbeitergeldes) zunächst noch keine starken Neugründungsimpulse aus der<br />
Arbeitslosigkeit. „In die Krise hinein“ gründen offenbar hauptsächlich diejenigen Personen ein<br />
neues Unternehmen, die dies unabhängig von der wirtschaftlichen Lage vorhaben; familieninterne<br />
Nachfolgen beispielsweise sind i. d. R. längerfristig geplant. Zudem erscheint die Übernahme<br />
eines etablierten Unternehmens in solchen Zeiten einfacher als ein kompletter Neuanfang.<br />
Erst wenn die Krise auch den Arbeitsmarkt erreicht, setzt die oben diskutierte Push-
32 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Wirkung auf das Gründungsgeschehen ein und erhöht neben den Gründungszahlen insgesamt<br />
auch wieder den Anteil der Neugründungen, 40 da Gründungen aus der Arbeitslosigkeit<br />
zumeist Neugründungen sind.<br />
Branchenstruktur des Gründungsgeschehens<br />
Tabelle 1 zeigt, wie sich das Gründungsgeschehen auf neun ausgewählte Wirtschaftszweige<br />
verteilt. Auffällig ist, dass nur 17 % aller Gründer und 18 % der Vollerwerbsgründer außerhalb<br />
des Dienstleistungssektors gründen. Die Gründer (Vollerwerbsgründer) außerhalb des<br />
Dienstleistungsbereichs verteilen sich auf das Verarbeitende Gewerbe (3 % aller Gründer,<br />
5 % aller Vollerwerbsgründer), das Baugewerbe (7 % bzw. 11 %) und die sonstigen Nicht-<br />
Dienstleistungsbranchen „Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht“ und „Erneuerbare Energien“<br />
(7 % bzw. 2 %). Damit liegt der Anteil der Gründer (im Vollerwerb) im Dienstleistungsgewerbe<br />
mit 83 % (82 %) im Jahr 2009 deutlich über dem entsprechenden Anteil im Bestand<br />
der kleinen und mittleren Unternehmen, der laut <strong>KfW</strong>-Mittelstandspanel im aktuellsten verfügbaren<br />
Jahr (2006) ca. 76 % betrug. 41 Die Konsequenz dieser Differenz von Bestand und<br />
Zugang, die u. a. von der häufigeren Zugehörigkeit von Bestandsunternehmen zum Verarbeitenden<br />
Gewerbe (7 % versus 3 % der Gründungen) und der selteneren Zugehörigkeit zu<br />
den persönlichen Dienstleistungen (16 % versus 24 % der Gründungen) verursacht wird, ist<br />
ein weiteres Voranschreiten der Tertiarisierung des Mittelstandes und damit der deutschen<br />
Volkswirtschaft.<br />
Eine stärkere Aufgliederung der Branchenstruktur (nach 20 Branchen) bietet Grafik 6. Insbesondere<br />
dient diese Darstellung dem besseren Einblick in die stark besetzten Branchen<br />
„Handel“ sowie „wirtschaftliche Dienstleistungen“ und „persönliche Dienstleistungen“. Um<br />
belastbare Aussagen zu erhalten, werden die Daten der Befragungsjahre 2007 bis 2009 gemeinsam<br />
ausgewertet. Die Dienstleistungsbranchen mit den höchsten Gründeranteilen bzw.<br />
der höchsten Gründungsaktivität (im Vollerwerb) sind der Einzelhandel mit 9 % (9 %), Direktvertrieb<br />
und Networkmarketing mit 7 % (3 %), das Versicherungs- und Finanzdienstleistungsgewerbe<br />
mit 5 % (7 %), das Gesundheits-, Veterinär- & Sozialwesen 8 % (8 %) und die<br />
heterogene Restgruppe der sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 12 % (11 %). In letzterer<br />
sind z. B. viele Existenzgründer aus den Bereichen Werbung sowie Büro- und Gebäudeservices<br />
vertreten. Zusammen mit dem ebenfalls gründungsaktiven Baugewerbe (7 %<br />
40<br />
Im Jahr 2003 stieg der Neugründungsanteil im Vollerwerb von 62 % auf 76 % (Tabelle 11 im Anhang).<br />
41<br />
Vgl. Reize und Zimmermann (2009).
Analysen zur Aufnahme und zur Beendigung der Selbstständigkeit 33<br />
aller und 11 % der Gründungen im Vollerwerb) repräsentieren die vorgenannten Branchen<br />
knapp die Hälfte des Gründungsgeschehens (im Vollerwerb).<br />
Land- & Forstwirtschaft, Fischerei & Fischzucht<br />
Verarbeitendes Gewerbe<br />
Erneuerbare Energien<br />
Baugewerbe<br />
Handel mit KfZ, Instandhaltung & Reparatur von KfZ, Tankstellen<br />
Großhandel & Handelsvermittlung<br />
Einzelhandel<br />
Direktvertrieb & Networkmarketing<br />
Gastgewerbe<br />
Verkehr & Nachrichtenübermittlung<br />
Versicherungs- & Finanzdienstleistungen<br />
Grundstücks- & Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen<br />
Datenverarbeitung & Datenbanken, Forschung & Entwicklung<br />
Rechts-, Steuer-, Unternehmens- & sonst. Wirtschaftsberatung<br />
Architektur- & Ingenieurbüros u.ä.<br />
Erbringung von sonst. wirtschaftlichen Dienstleistungen<br />
Erziehung & Unterricht<br />
Gesundheits-, Veterinär- & Sozialwesen<br />
Kultur, Sport & Unterhaltung<br />
Sonstige persönliche Dienstleistungen<br />
1,8 2,7<br />
1,2<br />
3,6<br />
3,4<br />
3,8<br />
3,5<br />
0,2<br />
4,5<br />
2,4<br />
1,6<br />
3,5<br />
2,6<br />
1,4<br />
4,3<br />
3,3<br />
6,0<br />
7,4<br />
6,7<br />
2,6<br />
2,4<br />
2,7<br />
2,9<br />
4,4<br />
1,9<br />
5,3<br />
6,8<br />
4,3<br />
3,5<br />
4,8<br />
2,6<br />
5,3<br />
5,1<br />
5,3<br />
4,3<br />
4,7<br />
4,0<br />
3,1<br />
4,0<br />
2,5<br />
4,2<br />
6,4<br />
8,1<br />
7,5<br />
7,6<br />
7,5<br />
3,1<br />
5,4<br />
4,7<br />
5,0<br />
4,3<br />
7,1<br />
9,1<br />
8,8<br />
9,2<br />
9,2<br />
11,4<br />
11,8<br />
10,5<br />
12,8<br />
0% 5% 10% 15%<br />
Alle Gründer<br />
Vollerwerb<br />
Nebenerwerb<br />
95%-Konfidenzintervall<br />
Um statistisch belastbarere Ergebnisse zu erhalten, wurden neben der aktuellen auch die Erhebungswellen für die Jahre 2007<br />
und 2008 in die Analyse einbezogen. Die Zahlen neben den Balken geben die Anteile der Gründer der jeweiligen Gründergruppe<br />
an allen (n=1.984) Gründern, an allen (n=836) Gründern im Vollerwerb bzw. allen (n=1.139) Gründern im Nebenerwerb<br />
wieder, für die Angaben zum Wirtschaftszweig ihres Unternehmens verfügbar sind. Lesehilfe: Im Durchschnitt der Jahre 2007<br />
bis 2009 haben sich 11,4 % der Vollerwerbsgründer im Baugewerbe selbstständig gemacht.<br />
Grafik 6: Gründer nach Branche (Durchschnitt 2007–2009)<br />
In Grafik 6 lassen sich einige Branchen identifizieren, die deutliche Unterschiede hinsichtlich<br />
der Gründungshäufigkeiten in Voll- und Nebenerwerb aufweisen. Gründungen im Baugewer-<br />
be (11 % versus 5 %), in Großhandel und Handelsvermittlung (4 % versus 1 %) sowie im<br />
Bereich Verkehrs- und Nachrichtenübermittlung (4 % versus 2 %) erfolgen signifikant häufiger<br />
im Vollerwerb. Weitere deutliche Übergewichte des Vollerwerbs sind in der Land- und Forstwirtschaft<br />
(3 % versus 1 %), der Kfz-Branche (4 % versus 2 %), im Versicherungs- und Finanzdienstleistungsgewerbe<br />
(7 % versus 4 %), im Grundstücks- und Wohnungswesen (5 %<br />
versus 3 %) sowie in den Architektur- und Ingenieurdienstleistungen (4 % versus 3 %) zu<br />
finden.
34 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Exkurs 3: Gründungsgeschehen nach Berufsgruppen<br />
Im Jahr 2009 waren 28 % (22 %) aller Gründer (im Vollerwerb) einer der von Freiberuflern dominierten<br />
Branchen Rechts-, Steuer- Unternehmens- und sonstige Wirtschaftsberatung, Architektur-,<br />
Ingenieur- und ähnliche Büros, Erziehung und Unterricht, Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen<br />
oder Kultur, Sport und Unterhaltung zuzurechnen. Ohne genau deckungsgleich zu sein (nicht<br />
alle Gründer in den vorgenannten Branchen üben tatsächlich einen freien Beruf aus und nicht alle<br />
Freiberufler sind einer der vorgenannten Branche zuzurechnen), bewegt sich der aggregierte Gründeranteil<br />
dieser Branchen in der Größenordnung des auf der Grundlage einer Detailanalyse der Vorhabensbeschreibung<br />
ermittelten Anteils von Freiberuflern an allen Gründern (im Vollerwerb) in Höhe von<br />
28 % (25 %, siehe Tabelle 1).<br />
Auch hier lohnt sich – wie schon bei der Branchenstruktur – der Vergleich von Strom- und Bestandsgrößen.<br />
Zieht man die Zahlen der Selbstständigen in den Freien Berufen des Instituts für<br />
Freie Berufe (IFB) heran und kombiniert diese mit der Zahl von Selbstständigen des Statistischen<br />
Bundesamtes, ergibt sich für das Jahr 2009 eine Freiberuflerquote als Anteil an allen Selbstständigen<br />
von (1.053.000 / 4.412.000 x 100 =) 24 %. 42 Da es relativ mehr Freiberufler unter den Gründern<br />
als unter den Bestandsselbstständigen gibt, kann mit einer weiteren Zunahme des Anteils der<br />
Freiberufler am Bestand der Selbstständigen gerechnet werden. Diese Prognose liegt in dem seit<br />
Gründung der Bundesrepublik Deutschland anhaltenden Trend zu mehr Freiberuflern (210 Tsd. in<br />
1950, 415 Tsd. in 1989, 668 Tsd. in 1999, 1.053 Tsd. in 2009), der sich insbesondere innerhalb der<br />
letzten 10 Jahre nochmals deutlich verstärkte und neben der zunehmenden Ausgliederung freiberuflicher<br />
Tätigkeiten von Unternehmen (z. B. im Ingenieur- und Wirtschaftlichkeitsbereich) durch die<br />
(alterungsbedingte) Expansion des Gesundheits- und Sozialwesens getrieben wird.<br />
Die zweite Berufsgruppe, die im Rahmen der Detailanalyse der Vorhabensbeschreibung erfasst<br />
wurde, ist das Handwerk. Für das Jahr 2009 ergaben sich „Handwerkeranteile“ an allen Gründern<br />
in Höhe von 17 %, an allen Vollerwerbsgründern von 24 % und an allen Nebenerwerbsgründern<br />
von 11 %. Im Baugewerbe handelt es sich bei praktisch jeder Gründung um eine Handwerksgründung<br />
(Hoch- und Tiefbauer, Elektriker, Trockenbauer, Haustechniker etc.). Andere Branchen mit<br />
hohen Anteilen von Handwerksgründern sind das Verarbeitende Gewerbe (z. B. Bäcker, Fleischer,<br />
Metallbauer, (Kunst-) Schmiede, Schneider), die Kfz-Branche (Kfz-Mechaniker, Lackierer), die wirtschaftlichen<br />
Dienstleistungen (z. B. Fotografen, Gebäudereiniger), die persönlichen Dienstleistungen<br />
(Kosmetiker, Friseure) und der Handel (z. B. Änderungsschneider, Reparaturbetriebe).<br />
Branchen mit einer signifikanten Überrepräsentation von Gründern im Nebenerwerb sind die<br />
Erneuerbaren Energien (fast ausschließlich Personen mit privaten Energieerzeugungsanlagen,<br />
die einen Teil ihres erzeugten Stroms an die Netzanbieter verkaufen) mit 6 % versus<br />
0,2 % im Vollerwerb, der Direktvertrieb (9 % versus 3 %), Erziehung und Unterricht (8 % versus<br />
4 %) und Kultur, Sport und Unterhaltung (7 % versus 3 %).<br />
Exkurs 4: Technologieorientierung<br />
Aus der Branchenverteilung des Gründungsgeschehens lassen sich auch Rückschlüsse auf seine<br />
Technologieorientierung ziehen. Technologiegründungen i. e. S. sind im Verarbeitenden Gewerbe<br />
42 Vgl. IFB (2009) und Statistisches Bundesamt (2010d).
Analysen zur Aufnahme und zur Beendigung der Selbstständigkeit 35<br />
angesiedelt und relativ selten, sodass ihr wahrer Umfang nur durch Totalerhebungen oder allenfalls<br />
sehr große Stichproben adäquat erfasst werden kann. 43 Technologiegründungen i. w. S.<br />
schließen jedoch auch technologieorientierte Dienstleister mit ein, deren Anzahl deutlich höher ist.<br />
Hierzu zählen etwa Gründungen in folgenden Branchen: Fernmeldedienste, Datenverarbeitung und<br />
Datenbanken, Forschung & Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und<br />
Medizin, Architektur- und Ingenieurbüros sowie technische, physikalische und chemische Untersuchungen.<br />
44 Diese Abgrenzung korrespondiert mit den Branchen Datenverarbeitung u. ä. sowie Architektur<br />
und Ingenieurbüros des <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>s in Grafik 6. 45 Demnach haben im Mittel<br />
der Jahre 2007 bis 2009 7 % (9 %) der Gründer (im Vollerwerb) ein Unternehmen im Bereich der<br />
technologieorientierten Dienstleistungen gegründet. Technologieorientierte Gründungen sind besonders<br />
erwünscht, weil von ihnen ein wichtiger Beitrag zur Innovationskraft und damit zur Stärkung<br />
der Leistungsfähigkeit und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft erwartet<br />
wird. Die Erfassung des Innovationsgehalts der Gründungsprojekte erfolgt im <strong>KfW</strong>-<br />
<strong>Gründungsmonitor</strong> – wie der folgende Abschnitt zeigt – aber auch unmittelbar.<br />
Die unterschiedliche Verteilung von Voll- und Nebenerwerbsgründungen auf die einzelnen<br />
Wirtschaftszweige lässt sich durch die zu den genannten Branchen gehörigen Berufsfelder<br />
und deren Vereinbarkeit mit einer (anderen) Haupterwerbstätigkeit erklären. So erscheint es<br />
plausibel, dass sich gerade Tätigkeiten im Baugewerbe und in den angrenzenden technischen<br />
Dienstleistungen (Architekten und Ingenieure) aufgrund des erforderlichen Zeiteinsatzes<br />
häufig nur schwer im Nebenerwerb realisieren lassen. Direktvertrieb, Unterricht und unterhaltende<br />
Dienstleistungen sollten dagegen eine gute Vereinbarkeit mit einer weiteren Erwerbstätigkeit<br />
bzw. einer Haupterwerbstätigkeit besitzen.<br />
Neuheit der Produkte / Innovationsgehalt<br />
Im Rahmen der Erhebung des <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>s werden Gründer auch gefragt, ob<br />
die von ihnen angebotenen Produkte oder Dienstleistungen eine regionale, nationale oder<br />
weltweite Marktneuheit darstellen. Wie Tabelle 1 zeigt, gaben im Jahr 2009 15 % der Vollerwerbsgründer<br />
und 11 % der Nebenerwerbsgründer an, dass sie mit einer Marktneuheit starten.<br />
Grafik 23 im Anhang zeigt ferner, dass die Angaben zum Innovationsgehalt über die<br />
Jahre hinweg kaum variieren.<br />
43<br />
Nach Schätzungen des ZEW Mannheim auf Grundlage der Unternehmensdaten von CREDITRE-<br />
FORM fanden im Jahr 2008 in Deutschland nur ca. 2.300 Gründungen im Bereich der Spitzen- und<br />
hochwertigen Technologie statt (Heger et al., 2009). Mit einem Umfrageinstrument wie dem <strong>KfW</strong>-<br />
<strong>Gründungsmonitor</strong>, in dem im Durchschnitt der letzten Befragungsjahre jeweils insgesamt rund<br />
700 Gründer enthalten sind, lassen sich allenfalls vereinzelte dieser Technologiegründungen bzw.<br />
-gründer „auffinden“. Dies kann keine valide Basis für eine Abschätzung des wahren Umfangs dieses<br />
Gründungssegmentes darstellen.<br />
44<br />
Vgl. Gottschalk et al. (2008).<br />
45<br />
Gründungen im Bereich Fernmeldedienste waren in den Jahren 2007 bis 2009 nicht im <strong>KfW</strong>-<br />
<strong>Gründungsmonitor</strong> enthalten.
36 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Eine genaue Auseinandersetzung mit den Vorhabensbeschreibungen (im Rahmen einer<br />
Frage des <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>s sind die Gründer dazu aufgefordert, ihr Gründungsprojekt<br />
aussagekräftig zu beschreiben) lässt jedoch Zweifel daran aufkommen, dass es sich bei<br />
diesen von den Gründern selbst als neu bezeichneten Geschäftsideen tatsächlich um Innovationen<br />
im Schumpeter’schen Sinn handelt. Selbst die große Mehrheit der ohnehin sehr<br />
seltenen (angeblichen) weltweiten Marktneuheiten (nur 2 % der Gründer berichten, ein solches<br />
Produkt bzw. eine solche Dienstleistung anzubieten) scheint nicht dazu geeignet, einer<br />
„schöpferischen Zerstörung“ oder gar einer Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit<br />
der deutschen Volkswirtschaft Vorschub zu leisten.<br />
Dieses Ergebnis impliziert jedoch nicht, dass es unter den Gründungsprojekten in Deutschland<br />
keine ernst zu nehmenden Innovationen gibt. Es zeigt vielmehr die Beschränktheit einer<br />
Bevölkerungsbefragung auf, seltene Ereignisse zu erfassen, wenn diese Ereignisse kein<br />
Schichtungskriterium bei der Stichprobengenerierung darstellen. Angenommen 0,5 % der<br />
Gründungen eines Jahres seien im Schumpeter’schen Sinn innovativ. Dann erfasst man mit<br />
dem <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> bei gegebenem Stichprobenumfang und aktueller Gründerquote<br />
(siehe Kapitel 2 und 3.1) jährlich im Durchschnitt nur vier bis fünf solcher Projekte.<br />
Wären die tatsächlich innovativen Gründungsprojekte andererseits zahlreicher, dann müssten<br />
sie auch in höherer Anzahl im <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> zu beobachten sein, insbesondere<br />
vor dem Hintergrund der jährlichen Wiederholung der Befragung. Deshalb kann trotz der<br />
Einschränkungen des <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>s als Instrument zur Analyse der Innovationsaktivität<br />
darauf geschlossen werden, dass das innovative Segment im deutschen Gründungsgeschehen<br />
sehr klein ist. Vor diesem Hintergrund sollten hierzulande noch weiter gehende<br />
Anstrengungen zur Ermutigung zu und Förderung von innovativen Gründungsprojekten<br />
unternommen werden. Mehr als im Bereich anderer Gründungen kann das Versäumnis,<br />
eine viel versprechende innovative Gründung nicht angemessen gefördert zu haben, einen<br />
immensen Verlust an zukünftiger Wertschöpfung und Wohlfahrt bedeuten.<br />
Gründungsgröße<br />
Das Merkmal Gründungsgröße setzt sich hier aus den Kombinationen des Vorhandenseins<br />
von Teampartnern und Mitarbeitern zusammen. Tabelle 1 ist zu entnehmen, dass eine Mehrheit<br />
von 55 % der Gründer (Vollerwerb: 50 %) ihr Projekt ohne Teampartner – als Sologründer<br />
– und ohne Mitarbeiter aufnimmt. Demnach handelt es sich bei dem Gros des Gründungsgeschehens<br />
in Deutschland um Kleinstgründungen, die nur aus dem Gründer selbst<br />
bestehen. Dieser Gründungstyp ist dann noch häufiger, wenn es sich um Gründungen aus<br />
der Arbeitslosigkeit heraus handelt: zwei von drei Vollerwerbsgründern aus der Arbeitslosigkeit<br />
sind Sologründer ohne Mitarbeiter.
Analysen zur Aufnahme und zur Beendigung der Selbstständigkeit 37<br />
Weitere 7 % der Gründer (Vollerwerb: 3 %) beschäftigen ebenfalls keine Mitarbeiter, haben<br />
ihre Gründung aber mit mindestens einem Teampartner realisiert (Teamgründer ohne Mitarbeitern).<br />
Insgesamt ergibt sich somit ein Anteil von 62 % (53 %) aller Gründer (im Vollerwerb),<br />
die ihre Geschäfte zum Befragungszeitpunkt ohne die Unterstützung durch Mitarbeiter<br />
– als Sologründer – tätigten. Auf den ersten Blick erscheinen diese Anteile an Kleinstgründungen<br />
hoch, sie deuten aber im Vergleich mit den Vorjahren auf eine Qualitätsverbesserung<br />
des Gründungsgeschehens hin. So lagen in den Jahren 2008 und 2007 die Anteile der<br />
Gründer (Vollerwerbsgründer) ohne Mitarbeiter mit 72 % (66 %) und 74 % (67 %) noch bedeutend<br />
höher als im Jahr 2009 (siehe Grafik 24).<br />
Gut 19 % der Vollerwerbsgründer und gut 23 % der Nebenerwerbsgründer sind Teamgründer.<br />
Von diesem Gründungstyp wird gemeinhin erwartet, dass er gegenüber Sologründungen<br />
den Vorteil besitzt, die komparativen Stärken der Teampartner in das Unternehmen einzubringen<br />
und eine Verteilung der Last des i. d. R. sehr arbeitsintensiven Gründungsprozesses<br />
auf mehrere Schultern zu erlauben – letzteres dürfte auch der Grund für die größere<br />
Häufigkeit von Teamgründungen im Nebenerwerb sein. Potenzielle Nachteile von Gründerteams<br />
können darin bestehen, dass Entscheidungsprozesse aufgrund des Mitspracherechts<br />
mehrerer Personen nur verzögert ablaufen und es zu Streitigkeiten im Gründerteam kommen<br />
kann, die, wenn sie nicht beizulegen sind, in einer Trennung des Teams und einer Unternehmensaufgabe<br />
resultieren. Bislang existieren unseres Wissens nach noch keine eindeutigen<br />
wissenschaftlichen Ergebnisse, die belastbar belegen könnten, dass sich Gründerteams<br />
in Ihrem Erfolg von Sologründern unterscheiden. 46 Abschnitt 4.2 liefert Evidenz zu dieser<br />
offenen Forschungsfrage.<br />
Die Strukturierung des Gründungsgeschehens anhand der vier Ausprägungen des Merkmals<br />
Gründungsgröße erweist sich auch im Zuge der folgenden Abschätzung des Bruttobeschäftigungseffekts<br />
des Gründungsgeschehens als nützlich.<br />
3.3 Bruttobeschäftigungseffekt des Gründungsgeschehens<br />
Neben der positiven Wirkung auf die Innovationskraft und internationale Wettbewerbsfähigkeit<br />
von Volkswirtschaften ist an Gründungen auch die Erwartung eines positiven Beschäftigungseffekts<br />
geknüpft. Die Ermittlung der Beschäftigungswirkung des Gründungsgeschehens<br />
ist jedoch sehr komplex, weil Gründungen einerseits nicht nur neue Arbeitsplätze kreieren,<br />
sondern auch bestehende Arbeitsplätze obsolet machen (direkter versus indirekter Ef-<br />
46<br />
Vgl. bspw. Lechler und Gemünden (2003) und die Ausführungen hierzu in Spengler und Tilleßen<br />
(2006).
38 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
fekt) und es sich andererseits erst nach etlichen Jahren herausstellt, ob sich eine Gründung<br />
am Markt etabliert und die in ihr geschaffenen Arbeitsplätze auch als dauerhaft bezeichnet<br />
werden können (Brutto- versus Nettoeffekt). Mit Querschnittsbefragungen wie dem <strong>KfW</strong>-<br />
<strong>Gründungsmonitor</strong> kann weder die Problematik des „Verdrängungseffekts“ noch die Frage<br />
der „Nachhaltigkeit“ angemessen berücksichtigt und untersucht werden. Mittels der enthaltenen<br />
Angaben zur Anzahl der Teampartner und der Mitarbeiter zum Gründungszeitpunkt,<br />
kann jedoch zumindest der direkte Bruttobeschäftigungseffekt des Gründungsgeschehens<br />
eines Jahres berechnet werden.<br />
Exkurs 5: Beschäftigungseffekte von Unternehmensgründungen<br />
Direkter Bruttobeschäftigungseffekt: Gesamtzahl der in allen Unternehmensgründungen eines<br />
bestimmten Jahres zum Gründungszeitpunkt entstandenen Arbeitsplätze.<br />
Direkter Nettobeschäftigungseffekt: Zahl der in einer Gründungskohorte noch verbliebenen Arbeitsplätze<br />
nach einer bestimmten Anzahl von Jahren (z. B. nach zehn Jahren).<br />
Diese Größe wird dadurch beeinflusst, dass eine Reihe von Gründungen (etwa 60 %, vgl. Boeri<br />
und Cramer, 1992) die ersten 8–10 Jahre nicht überlebt und wieder schließt. Andere bauen einen<br />
Teil ihrer ursprünglichen Beschäftigung wieder ab, weitere bleiben bei ihrer ursprünglichen Größe<br />
und wieder andere wachsen, einige sogar stark. Wird diese Dynamik berücksichtigt und die Beschäftigung<br />
berechnet, die in einer Gründungskohorte nach mehreren Jahren verbleibt, erhält man<br />
den direkten Nettobeschäftigungseffekt. Internationale Studien zum direkten Nettobeschäftigungseffekt<br />
konnten zeigen, dass die Beschäftigung einer Gründungskohorte im ersten Jahr stark ansteigt,<br />
um dann in den Folgejahren wieder abzunehmen. Langfristig stabilisiert sich die Beschäftigung<br />
einer Gründungskohorte zumeist auf dem Ausgangsniveau oder geringfügig darunter, sodass<br />
die direkten Nettobeschäftigungseffekte ungefähr so groß wie die direkten Bruttobeschäftigungseffekte<br />
sind (vgl. Boeri und Cramer, 1992; Engel et al., 2004). Da es sich bei dem <strong>KfW</strong>-<br />
<strong>Gründungsmonitor</strong> um eine Querschnittsbefragung handelt und eine Betrachtung der Entwicklung<br />
von Gründungen über die Zeit damit nur sehr eingeschränkt möglich ist, muss eine fundierte Analyse<br />
von Nettobeschäftigungseffekten Paneldatensätzen (wie z. B. dem <strong>KfW</strong>/ZEW-Gründungspanel)<br />
vorbehalten bleiben.<br />
Berücksichtigung indirekter Effekte: Nicht berücksichtigt sind in den angegebenen Zahlen indirekte<br />
positive oder negative Effekte. Positive indirekte Effekte äußern sich z. B. in einer gesteigerten gesamtwirtschaftlichen<br />
Effizienz durch zunehmenden Wettbewerb, in beschleunigtem Strukturwandel,<br />
aber auch in Spillover-Effekten durch positive Impulse von Unternehmensgründungen für Zulieferer,<br />
Abnehmer und das Innovationsgeschehen. Negative indirekte Effekte werden z. B. durch die<br />
Verdrängung etablierter Unternehmen vom Markt hervorgerufen (vgl. Wagner, 2006). Von den indirekten<br />
Effekten wird insbesondere angenommen, dass sie für einen bedeutenden Anteil des Einflusses<br />
von Gründungen auf Wachstum und Beschäftigung verantwortlich sind (vgl. Fritsch, 2008).<br />
Obwohl indirekte Effekte nur schwer quantifiziert werden können, lassen Ergebnisse von Fritsch<br />
und Müller (2004) vermuten, dass der Beschäftigungseffekt von Neugründungen unter Berücksichtigung<br />
sämtlicher indirekter Effekte zumindest in der langen Frist positiv ist.<br />
Es erscheint sinnvoll, den Beschäftigungseffekt auf Neugründungen zu begrenzen (siehe<br />
hierzu die Ausführungen in Abschnitt 3.1 zur Gründungsform), da diese anders als Übernahmen<br />
oder Beteiligungen unmittelbar in Beziehung zur Schaffung von Arbeitsplätzen stehen.<br />
Aus berechnungstechnischen Gründen bietet es sich weiterhin an, die Ermittlung des<br />
Gesamteffekts in vier Schritten gemäß der Ausprägungen des zuvor diskutierten Merkmals<br />
„Gründungsgröße“ durchzuführen.
Analysen zur Aufnahme und zur Beendigung der Selbstständigkeit 39<br />
Neugründer ohne Teampartner und ohne angestellte Mitarbeiter repräsentieren 54 % der<br />
Neugründer im Vollerwerb und 63 % der Neugründer im Nebenerwerb (siehe Tabelle 1). Der<br />
Bruttobeschäftigungseffekt dieser Neugründungen besteht allein in der Schaffung eines Arbeitsplatzes<br />
für den Gründer selbst. Im Zuge einer konservativen Abschätzung des Beschäftigungseffektes<br />
werden nur die Stellen der Vollerwerbsgründer in die Berechnung einbezogen,<br />
da Nebenerwerbsgründer i. d. R. mit ihrer Haupterwerbstätigkeit bereits eine Stelle besitzen.<br />
Damit beläuft sich der Beschäftigungseffekt aus Neugründungen durch Alleingründer<br />
auf (0,539 x 267.000 =) ca. 144.000 Stellen.<br />
Sologründer mit Mitarbeitern beginnen ihr Selbstständigkeitsprojekt ebenfalls ohne Teampartner,<br />
beschäftigen aber mindestens einen Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit. Erwartungsgemäß<br />
findet sich dieser Gründertyp häufiger im Bereich des Vollerwerbs (30 %) als im Nebenerwerb<br />
(21 %), da Vollerwerbsgründungen im Durchschnitt aufwendigere und damit auch<br />
personalintensivere Projekte darstellen. Im Vollerwerb beschäftigt dieser Gründertyp im<br />
Durchschnitt 1,43 vollzeitäquivalente Mitarbeiter. Im Nebenerwerb sind es 1,28 vollzeitäquivalente<br />
Mitarbeiter. 47 Der Bruttobeschäftigungseffekt dieser Gruppe von ca.<br />
285.400 Stellen ergibt sich als Summe der (0,298 x 267.000 =) ca. 79.600 Gründer im Vollerwerb,<br />
deren (79.600 x 1,43 =) ca. 113.800 Mitarbeiter und der (0,214 x 336.000 x 1,28 =)<br />
ca. 92.000 Mitarbeiter der Nebenerwerbsgründer.<br />
Gründerteams ohne Mitarbeiter treten im Vollerwerb (3 %) seltener auf als im Nebenerwerb<br />
(8 %), wobei sich die durchschnittliche Teamgröße im Vollerwerb auf 2,83 Teampartner im<br />
Voll- und 2,44 Teampartner im Nebenerwerb beläuft. Der durch Gründerteams ohne Mitarbeiter<br />
induzierte Beschäftigungseffekt beläuft sich analog zu den Sologründern ohne Mitarbeiter<br />
lediglich auf die für Vollerwerbsgründer geschaffenen (0,033 x 267.000 =) ca.<br />
8.700 Stellen.<br />
Teamgründungen mit Mitarbeitern unternahmen im Jahr 2009 13 % der Gründer im Vollerwerb<br />
und 8 % der Gründer im Nebenerwerb. Diese Gründungen erfolgten im Vollerwerb<br />
(Nebenerwerb) mit einer durchschnittlichen Teamgröße von 2,55 (4,19) Partnern und<br />
1,91 (3,05) vollzeitäquivalenten Mitarbeitern. Der Bruttobeschäftigungseffekt dieser Gruppen<br />
ergibt sich aus der Summe der für die Teampartner im Vollerwerb selbst geschaffenen<br />
(0,13 x 267.000 =) ca. 34.700 Stellen zuzüglich der (34.700 x 1,91 / 2,55 =) ca. 26.000 von<br />
Teamgründern im Vollerwerb geschaffenen Stellen für Mitarbeiter und der (0,076 x 336.000 x<br />
47 Zur Berechnung der Durchschnittswerte beachte Fußnote 39.
40 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
3,05 / 4,19 =) ca. 16.600 von Teamgründern im Nebenerwerb geschaffenen Stellen für Mitarbeiter<br />
zu ca. 79.200 Stellen. 48<br />
Der gesamte in Tabelle 2 dargestellte direkte Bruttobeschäftigungseffekt von Neugründungen<br />
im Jahr 2009 ergibt sich als Summe der Beschäftigungseffekte der vier Gründungsgrößentypen<br />
in Höhe von 517.400 Stellen (Vorjahr: 448.800 Stellen). Davon entfallen ca.<br />
267.000 (Vorjahr: 261.000) Stellen auf die (Vollerwerbs-) Neugründer selbst und ca. 250.400<br />
(Vorjahr: 187.800) Stellen auf angestellte Mitarbeiter. Die positive Differenz des Bruttobeschäftigungseffekts<br />
zum Vorjahr von ca. 69.000 Stellen resultiert somit zum überwiegenden<br />
Teil aus der im Jahr 2009 wesentlich höheren Zahl der für Mitarbeiter geschaffenen Stellen.<br />
Tabelle 2: Bruttobeschäftigungseffekt von Neugründungen 2009<br />
Stellen von ...<br />
Stellen für ...<br />
Vollerwerb Nebenerwerb<br />
Gründer Mitarbeiter Gründer Mitarbeiter<br />
Summe<br />
Sologründern ohne Mitarbeiter 144.000 --- --- --- 144.000<br />
Sologründern mit Mitarbeitern 79.600 113.800 --- 92.000 285.400<br />
Teamgründern ohne Mitarbeiter 8.700 --- --- --- 8.700<br />
Teamgründern mit Mitarbeitern 34.700 26.000 --- 18.600 79.200<br />
Summe<br />
267.000<br />
406.800<br />
139.800 ---<br />
110.600<br />
110.600<br />
517.400<br />
Das Frageprogramm des <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>s erlaubt eine Berechnung des Bruttobeschäftigungseffekts<br />
ab dem Erhebungsjahr 2005. In Grafik 7 ist die Zeitreihe des Bruttobeschäftigungseffekts<br />
(blaue Line, rechte Ordinate) gemeinsam mit der Zeitreihe der Gründerquote<br />
(orangenfarbene Line, linke Ordinate) dargestellt. Der Bruttobeschäftigungseffekt des<br />
Jahres 2009 übertrifft die Werte aller Vorjahre mit Ausnahme des Jahres 2005. Im Jahr 2005<br />
lag die Gründerquote mit 2,47 % jedoch auch – nicht zuletzt wegen der damals sehr hohen<br />
Arbeitslosigkeit und der Existenzgründungszuschuss-Förderung von Seiten der Bundesagentur<br />
für Arbeit – wesentlich höher als im Jahr 2009 mit 1,69 %. Insgesamt ist eine deutliche<br />
Korrelation zwischen Bruttobeschäftigungseffekt und Gründerquote erkennbar. Dies ist<br />
intuitiv plausibel, da sich der Bruttobeschäftigungseffekt wie oben diskutiert aus dem Zusammenwirken<br />
von Gründerzahl und Mitarbeiterzahl ergibt. 49<br />
48<br />
Zur Vermeidung von Doppelzählungen müssen die Stellen für Mitarbeiter um die jeweiligen durchschnittlichen<br />
Teamgrößen korrigiert werden.<br />
49<br />
Die Gründerzahlen werden dabei mit erheblich höherer statistischer Präzision als die Mitarbeiterzahlen<br />
(nach Gründungsgröße im obigen Sinn) gemessen, da die Schätzung letzterer häufig nur auf<br />
wenigen Beobachtungen basiert. Durch solche Messungenauigkeiten könnte auch ein Teil des vergleichsweise<br />
sehr hohen Beschäftigungseffektes des Jahres 2005 zu erklären sein, da sich für dieses
Analysen zur Aufnahme und zur Beendigung der Selbstständigkeit 41<br />
3,0%<br />
2,5%<br />
2,0%<br />
1,5%<br />
1,0%<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Gründerquote (linke Skala)<br />
Bruttobeschäftigungseffekt (rechte Skala)<br />
800.000<br />
700.000<br />
600.000<br />
500.000<br />
400.000<br />
Für die Gründerquoten sind die in der Erläuterung zu Grafik 1 angegebenen Stichprobenumfänge relevant. Für die Bruttobeschäftigungseffekte<br />
sind darüber hinaus auch die Unterstichproben zur Gründungsgröße und zur Mitarbeiter- als auch Teampartnerzahl<br />
relevant. Im Fall der beiden letztgenannten Merkmale bewegen sich die Beobachtungszahlen teilweise im einstelligen<br />
Bereich (z. B. basiert die Schätzung der mittleren Teamgröße von Teamgründern ohne Mitarbeiter im Jahr 2010 auf sechs<br />
Beobachtungen). Vergleiche über die Jahre zeigen aber trotzdem weit gehend robuste Werte.<br />
Grafik 7: Gründerquote und direkter Bruttobeschäftigungseffekt<br />
Eine weitere Möglichkeit der Kombination von Gründer- und Mitarbeiterzahl besteht in der<br />
Berechnung des durchschnittlichen Bruttobeschäftigungseffekts einer Neugründung. Geht<br />
man unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Teamgröße davon aus, dass die Zahl von<br />
267.000 Neugründern im Vollerwerb ungefähr (144.000 + 79.600 + 8.700 / 2,83 + 34.700 /<br />
2,55 =) 240.300 Neugründungen im Vollerwerb entspricht und diese zusammen ca. 406.800<br />
vollzeitäquivalente Stellen schaffen, dann ergibt sich der mittlere Bruttobeschäftigungseffekt<br />
einer Neugründung im Vollerwerb mit (406.800 / 240.300 =) 1,69 vollzeitäquivalenten Stellen<br />
(Vorjahr: 1,56 Stellen). Der mittlere Bruttobeschäftigungseffekt einer Nebenerwerbsgründung<br />
kann analog bestimmt werden: 336.000 Neugründer im Nebenerwerb entsprechen (212.300<br />
+ 71.900 + 26.300 / 2,44 + 25.500 / 4,19 =) ca. 301.100 Neugründungen im Nebenerwerb.<br />
Durch diese wurden 110.600 vollzeitäquivalente Stellen geschaffen, was dem mittleren Brut-<br />
Jahr (trotz Anwendung der Beschränkung auf Angaben unterhalb des 95%-Perzentils) hohe durchschnittliche<br />
vollzeitäquivalente Mitarbeiterzahlen für Sologründer mit Mitarbeitern von 2,6 (2009: 1,4)<br />
und Teamgründer mit Mitarbeitern von 4,2 (2009: 1,9) ergaben.
42 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
tobeschäftigungseffekt einer Neugründung im Nebenerwerb von (110.600 / 301.100 =)<br />
0,37 vollzeitäquivalenten Stellen (Vorjahr: 0,25 Stellen) entspricht. 50<br />
Damit ist im Jahr 2009 nicht nur die Zahl der Gründungen, sondern auch die durchschnittliche<br />
Gründungsgröße gemessen an der Mitarbeiterzahl sowohl im Vollerwerb als auch im<br />
Nebenerwerb deutlich gestiegen. Offenbar haben sich in der Krise gerade vergleichsweise<br />
substanzhaltige Gründungen durchgesetzt.<br />
50 Im Fall der Nebenerwerbsgründungen ist es angebracht, die Gründerperson(en) von der Berechnung<br />
des Bruttobeschäftigungseffekts auszuschließen. Ihre Berücksichtigung bei der Bestimmung der<br />
durchschnittlichen Unternehmensgröße einer Neugründung ist jedoch naheliegend. Unterstellt man,<br />
dass die Stelle des Nebenerwerbsgründers selbst im Durchschnitt einer halben vollzeitäquivalenten<br />
Stelle entspricht, ergibt sich eine durchschnittliche Größe einer Nebenerwerbsneugründung von<br />
([(336.000 x 0,5) + 110.600] / 301.100 =) 0,93 (Vorjahr: 0,80) vollzeitäquivalenten Beschäftigten. Für<br />
Vollerwerbsgründungen ist die mittlere Unternehmensgröße mit dem mittleren Bruttobeschäftigungseffekt<br />
identisch.
4 Analysen zu Beginn und Abbruch von Gründungsprojekten<br />
Wer gründet und welche Gründer sind mit welchen Projekten erfolgreich? Diese Fragen sind<br />
nicht nur aus wissenschaftlicher Perspektive interessant, sondern auch aus der Sicht der<br />
Gründungsfinanzierer im Allgemeinen und aus förderpolitischer Sicht im Besonderen hoch<br />
relevant. Beide Fragen werden deshalb in diesem Kapitel ausführlich behandelt. Abschnitt<br />
4.1 richtet den Fokus auf die individuelle Gründungsentscheidung, indem Unterschiede<br />
zwischen Gründern und Nicht-Gründern bezüglich ausgewählter persönlicher Merkmale<br />
(Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit, Berufsabschluss, Erwerbsstatus) deskriptiv herausgearbeitet<br />
und anschließend einer Überprüfung mittels multivariater Analyseverfahren unterzogen<br />
werden. In Abschnitt 4.2 erfolgen Ausführungen zur Bestandsfestigkeit bzw. zum Abbruch<br />
von Gründungsprojekten in der ersten besonders kritischen Zeit nach dem Beginn der<br />
Selbstständigkeit. Hier werden Abbrecherquoten innerhalb der ersten drei Jahre deskriptiv<br />
dargestellt und mögliche Bestimmungsgrößen mittels multivariater Verfahren analysiert.<br />
4.1 Wer gründet? Bestimmungsgründe der individuellen Gründungsentscheidung<br />
Die Betrachtung persönlicher Merkmale von Gründern dient dem Ziel, das aktuelle Gründungsgeschehen<br />
besser einordnen und Veränderungen im zukünftigen Gründungsgeschehen<br />
besser prognostizieren zu können. Ein über die vergangenen Jahre hinweg robuster Befund<br />
besteht beispielsweise darin, dass Gründungen zum größten Teil von jüngeren Menschen<br />
realisiert werden. Die Tatsache, dass der Altersdurchschnitt der deutschen Bevölkerung<br />
zunehmend steigt, wird folglich auch Auswirkungen auf das Gründungsgeschehen haben.<br />
51 Ebenso zeigte sich zuletzt ein konstant hoher Anteil von zuvor arbeitslosen Personen<br />
an den Gründern. Dies lässt Schlüsse auf die Entwicklung der Gründungsintensität in Abhängigkeit<br />
von der Konjunkturlage bzw. der Situation am Arbeitsmarkt zu. Den Ursachen für die<br />
höhere Gründungsneigung von Personen, die bestimmte (Kombinationen) von soziodemografischen<br />
und sozioökonomischen Merkmalen aufweisen, wird ebenfalls in diesem Abschnitt<br />
nachgegangen.<br />
Exkurs 6: Die individuelle Gründungsentscheidung<br />
Analog zu anderen (ökonomischen und nicht-ökonomischen) Entscheidungsprozessen kann die<br />
Gründungsentscheidung als (rationales) persönliches Erwartungsnutzenkalkül verstanden werden,<br />
bei dem der potenzielle Gründer den erwarteten Nutzen aus einer selbstständigen Beschäftigung<br />
51 Mit den Auswirkungen des demografischen Wandels auf das Gründungsgeschehen in Deutschland<br />
befassen sich z. B. die Studien von Engel et al. (2008) und Gottschalk und Theuer (2008).
44 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
dem erwarteten Nutzen aus einem alternativen Erwerbszustand gegenüberstellt. 52 Nur wenn der<br />
erwartete Nutzen aus einer Gründung höher ist als der Nutzen aus dem alternativen Erwerbszustand,<br />
entscheidet sich die Person zu einer Gründung. Die zu erwarteten vergleichenden Nutzen<br />
umfassen dabei nicht nur die Einkommenschancen in den Erwerbsalternativen. Die Individuen ziehen<br />
ebenso nicht pekuniäre Faktoren, wie z. B. soziale Anerkennung und die Möglichkeit zur<br />
Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung zum Vergleich heran. Wie sich die Einkommenschancen<br />
als Gründer oder abhängiger Beschäftigter darstellen und welches Gewicht die für Unternehmer<br />
i. d. R. besseren Möglichkeiten zur Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung bei der Gründungsentscheidung<br />
erhalten, hängt entscheidend von den persönlichen Merkmalen, Einstellungen<br />
und Präferenzen des potenziellen Gründers ab. 53<br />
Die drei folgenden Beispiele mögen dies verdeutlichen: Geht man von Gründungen als sehr zeitintensiven<br />
und sowohl körperlich als auch psychisch anstrengenden Ereignissen aus und sind jüngere<br />
Menschen ceteris paribus besser geeignet, diese Herausforderungen zu meistern, so kann das<br />
Alter bezüglich der Einkommenschancen als Unternehmer als gründungsrelevanter Faktor angesehen<br />
werden. Bedenkt man, dass die Einkommenschancen als Unternehmer im Vergleich zum<br />
Einkommen aus einem Angestelltenverhältnis mit einer größeren Unsicherheit behaftet sind, ist es<br />
plausibel anzunehmen, dass sich risikofreudige Menschen unter ansonsten gleichen Bedingungen<br />
eher für eine Gründung entscheiden als Menschen mit einer niedrigen Risikotoleranz. Insofern ist<br />
vom Geschlecht, das nachweislich in engem Zusammenhang mit der Risikoaversion steht, ein Einfluss<br />
auf die Gründungsneigung zu erwarten. Unterstellt man schließlich, dass Personen mit mangelnder<br />
Sprachkenntnis oder Personen in unfreiwilliger Arbeitslosigkeit (bestimmte) abhängige Beschäftigungsverhältnisse<br />
temporär oder dauerhaft nicht zugänglich und die diesbezüglichen Einkommenserzielungschancen<br />
für diese Personen niedrig sind, sollten auch die nationale Herkunft<br />
und der Arbeitsmarktstatus Bestimmungsfaktoren der Gründungsentscheidung darstellen.<br />
In Tabelle 3 werden zentrale Personenmerkmale wie Geschlecht, Alter, nationale Herkunft,<br />
Berufsabschluss und Erwerbsstaus im Hinblick auf ihre Gründungsrelevanz untersucht und<br />
interpretiert. Dies geschieht anhand einer Gegenüberstellung der jeweiligen Merkmalsverteilungen<br />
zwischen Gründern und der gesamten Bevölkerung. Die beobachtbaren Unterschiede<br />
können zumeist in den Kontext des beschriebenen Erwartungsnutzenkalküls eingebettet werden.<br />
Weiter gehende Informationen zu den dargestellten Merkmalen sind Grafik 26 bis Grafik<br />
30 sowie Tabelle 12 und Tabelle 13 im Anhang zu entnehmen.<br />
Geschlecht<br />
Frauen sind im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil und auch zu ihrem Anteil an den Erwerbstätigen<br />
im Gründungsgeschehen stark unterrepräsentiert. Während Frauen ca. die Hälfte<br />
der Bevölkerung und ca. 45 % der Erwerbstätigen (Statistisches Bundesamt, 2010f) repräsentieren,<br />
liegt ihr Gründeranteil nur bei 38 % (Tabelle 3). Dieser Unterschied wird noch deutlicher,<br />
wenn man die Betrachtung auf Vollerwerbsgründer konzentriert. Weniger als jeder<br />
dritte Vollerwerbsgründer ist eine Frau. Mögliche Einflüsse, die vom Geschlecht auf die<br />
Gründungsneigung ausgehen, könnten in den körperlichen Voraussetzungen (insbesondere<br />
52<br />
Zur Anwendung des ökonomischen Erwartungsnutzenkalküls auf verschiedenste Lebensbereiche<br />
siehe Becker (1976).<br />
53<br />
Vgl. Blanchflower und Oswald (1998) und Arenius und Minniti (2005).
Analysen zu Aufnahme und Beendigung der Selbstständigkeit 45<br />
der Körperkraft) zu sehen sein, die Gründungen von Frauen in bestimmten Branchen wie<br />
z. B. Landwirtschaft und Baugewerbe, in denen die Selbstständigenquote relativ hoch ist,<br />
deutlich unwahrscheinlicher machen. Bedeutender ist aber vermutlich eine im Vergleich zu<br />
Männern höhere durchschnittliche Risikoaversion, die in vielen Studien nachgewiesen wird<br />
und sich negativ auf die Partizipation in Unterfangen mit unsicherem Ausgang, wie es Gründungen<br />
sind, auswirken sollte. 54<br />
Alter<br />
Jüngere Altersgruppen sind im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil im Gründungsgeschehen<br />
deutlich über-, ältere Altersgruppen dagegen deutlich unterrepräsentiert. 25- bis 34-Jährige<br />
stellen z. B. 24 % der Gründer, aber nur 16 % der Bevölkerung im Alter von 18 bis<br />
64 Jahren. Umgekehrt verhält es sich mit den 55- bis 64-Jährigen, die 19 % der Bevölkerung<br />
im gründungsrelevanten Alter, aber nur knapp 12 % der Gründer repräsentieren. Jüngere<br />
Menschen dürften deshalb stärker zu einer Gründung tendieren, weil diese für sie i. d. R. mit<br />
geringeren Opportunitätskosten verbunden ist. Im Gegensatz zu älteren Erwerbspersonen<br />
gehen sie mit geringerer Wahrscheinlichkeit bereits einer gut entlohnten abhängigen Beschäftigung<br />
nach. Ein weiterer Grund dürfte – wie in Exkurs 6 erläutert – darin bestehen, dass<br />
jüngere Menschen der hohen Arbeitsbelastung und nicht selten auch psychischen Belastung,<br />
die eine Gründung mit sich bringt, besser gewachsen sind und deshalb ceteris paribus im<br />
Vergleich zu älteren Personen höhere Erfolgs- bzw. Einkommenschancen durch eine Gründung<br />
besitzen. Andererseits besitzt ein höheres Alter auch einen Aspekt, der sich positiv auf<br />
die Gründungswahrscheinlichkeit auswirken sollte, denn mit zunehmendem Alter nimmt (bei<br />
Erwerbstätigkeit) auch die Arbeitserfahrung und damit die berufsspezifische Qualifikation zu.<br />
Fehlende Gründungskompetenz aufgrund mangelnder beruflicher Erfahrung dürfte der Grund<br />
für die in Relation zu ihrem Bevölkerungsanteil nur durchschnittliche Gründungsneigung von<br />
Personen im Alter von 18 bis 24 Jahren sein. 55 Die Altersgruppe mit der höchsten Gründungsaktivität<br />
insbesondere im Vollerwerb, in dem sie für jede dritte Gründung steht, ist die<br />
der 35- bis 44 Jährigen. Hier kommen vermutlich beide Gründungen begünstigende Faktoren<br />
zusammen: „Jugend“ und Berufserfahrung.<br />
54<br />
Vgl. beispielsweise die internationalen Übersichtsartikel von Brush (1992, 2006) und Carter und<br />
Shaw (2006) sowie für Deutschland Wagner (2007), Furdas und Kohn (2010) und die Sammelwerke<br />
Leicht und Welter (2004) und <strong>KfW</strong> Bankengruppe (2004).<br />
55<br />
Vgl. die Arbeiten zu Altersaspekten des Gründungsgeschehens von Bönte et al. (2009), van Praag<br />
und Booij (2003) und Lévesque und Minniti (2006) und Kohn und Spengler (2008c).
46 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Tabelle 3: Ausgewählte Merkmale der Gründer 2009 (Anteile in Prozent)<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb Bevölkerung<br />
Geschlecht<br />
männlich 61,7 68,7 56,1 50,2<br />
weiblich<br />
Alter<br />
38,3 31,3 43,9 49,8<br />
18 bis 24 Jahre 14,0 8,5 18,8 14,1<br />
25 bis 34 Jahre 23,6 22,0 24,9 15,6<br />
35 bis 44 Jahre 29,0 32,6 26,2 24,9<br />
45 bis 54 Jahre 21,3 26,0 17,2 26,0<br />
55 bis 64 Jahre<br />
Staatsbürgerschaft<br />
12,0 10,9 12,9 19,3<br />
schon immer deutsche Staatsbürgerschaft 80,1 77,1 82,4 82,4<br />
eingebürgert oder Spätaussiedler 6,8 9,6 4,5 6,3<br />
EU27-Ausländer 6,5 4,2 8,5 5,1<br />
sonstiger Ausländer<br />
Berufsabschluss<br />
6,6 9,1 4,7 6,3<br />
Universität 13,8 13,8 13,6 8,8<br />
Fachhochschule, Berufsakademie u. ä. 8,6 9,1 8,4 8,4<br />
Fachschule, Meisterschule 8,4 13,0 4,7 4,1<br />
Lehre, Berufsfachschule 40,8 42,8 39,4 51,6<br />
kein Berufsabschluss<br />
Erwerbsstatus<br />
28,3 21,3 34,0 27,1<br />
Angestellter Unternehmensleiter 6,4 6,8 6,0 1,7<br />
leitender / hoch qualifizierter Angestellter 12,6 12,9 12,4 9,8<br />
sonstiger Angestellter 24,9 26,0 23,9 33,9<br />
Beamter 1,9 0,5 3,2 4,1<br />
Facharbeiter 3,4 1,6 5,1 7,2<br />
sonstiger Arbeiter 1,7 1,9 1,5 4,4<br />
selbstständig 10,7 11,3 10,1 8,1<br />
arbeitslos 21,4 28,0 15,0 7,5<br />
Nichterwerbsperson<br />
Hauptgrund Gründung (Gründungsmotiv)<br />
17,0 11,0 22,9 23,4<br />
Ausnutzung Geschäftsidee 39,2 39,0 39,8 --fehlende<br />
Erwerbsalternativen 33,9 41,5 27,3 --sonstiger<br />
Hauptgrund<br />
Region<br />
26,9 19,5 32,9 ---<br />
Westdeutschland 86,5 83,1 89,3 82,4<br />
Ostdeutschland<br />
Gemeindegröße<br />
13,5 16,9 10,7 17,6<br />
unter 5.000 Einwohner 15,3 15,6 15,1 15,4<br />
5.000 bis unter 20.000 Einwohner 23,5 22,2 24,3 25,1<br />
20.000 bis unter 100.000 Einwohner 23,2 19,7 25,9 27,5<br />
100.000 bis unter 500.000 Einwohner 18,9 20,7 17,5 15,5<br />
ab 500.000 Einwohner 19,2 21,7 17,3 16,6<br />
Grafische Darstellungen ausgewählter Gründermerkmale inklusive Konfidenzintervallen finden sich im Anhang (Grafik 26 bis<br />
Grafik 30). Die Verteilungen der Merkmale Geschlecht, Alter, Staatsbürgerschaft, Berufsabschluss, Region und Gemeindegröße<br />
beruhen für Gründer jeweils auf einer Stichprobengröße von n=678, 301, 373 (alle Gründer, Vollerwerb, Nebenerwerb). Die<br />
Stichprobengrößen für die Verteilungen der übrigen Merkmale sind die folgenden: n=628, 296, 332 für Erwerbsstatus, n=667,<br />
298, 365 für Gründungsmotiv. Die letzte Tabellenspalte enthält zu Vergleichszwecken (außer für das Merkmal „Gründungsmotiv“,<br />
das nur für Gründer beobachtbar ist) die Verteilungen der Merkmale für alle antwortenden Personen (Gründer und Nicht-<br />
Gründer) des <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>s. Diese Berechnungen beruhen für alle Merkmale mit Ausnahme des Erwerbsstatus<br />
(n=9.343) auf n=48.025 Beobachtungen.<br />
Tabelle 13 im Anhang zeigt einen interessanten Aspekt den Gründeranteil der 45- bis 54 Jährigen<br />
betreffend. Dieser liegt im Jahr 2009 im Vollerwerb mit 26 % deutlich höher als im Vorjahr<br />
(20 %) und höher als in allen früheren Jahren seit Durchführung des <strong>KfW</strong>-<br />
<strong>Gründungsmonitor</strong>s. Der Grund hierfür mag in der sehr schwierigen konjunkturellen Lage des<br />
Jahres 2009 zu sehen sein, der verstärkt etablierte abhängige Beschäftigte dazu bewogen
Analysen zu Aufnahme und Beendigung der Selbstständigkeit 47<br />
haben könnte, ihre trotz arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen immer unsicherer werdenden<br />
abhängigen Beschäftigungsverhältnisse zu Gunsten einer Selbstständigkeit aufzugeben.<br />
Zugleich ist der Vollerwerbsgründeranteil der 25- bis 34 Jährigen von 28 % auf 22 % zurückgegangen.<br />
Auch hier mag die konjunkturelle Entwicklung ursächlich sein, da in Rezessionszeiten<br />
die Markteintrittsbarrieren höher liegen und damit größere Gründungsprojekte für eine<br />
erfolgsreiche Umsetzung der Gründungsidee verlangen. Die größere Gründungsgröße erfordert<br />
gegebenenfalls einen höheren Ressourceneinsatz der Gründer, den diese im Alter zwischen<br />
25 und 34 Jahren noch nicht aufbringen können.<br />
Migrationshintergrund<br />
Die vier erfassten Ausprägungen dieses an den Mikrozensus angelehnten Merkmals sind<br />
„Deutsche Staatsbürgerschaft von Geburt an“, „Deutsche Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung<br />
oder als Spätaussiedler“, „Ausländer aus einem EU27-Staat“ und „Nicht-EU-Ausländer“.<br />
Die stärksten relativen Abweichungen zwischen Bevölkerungsanteil und Gründeranteil sind<br />
im Vollerwerb für Eingebürgerte / Spätaussiedler und sonstige Ausländer zu beobachten.<br />
Während Eingebürgerte / Spätaussiedler und sonstige Ausländer jeweils 6 % der in Deutschland<br />
lebenden Bevölkerung repräsentieren, ist Ihr Anteil an allen Vollerwerbsgründern mit<br />
10 % bzw. 9 % deutlich höher. Dies kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass der erwartete<br />
Nutzen aus einer Selbstständigkeit für diese Bevölkerungsgruppen im Vergleich zu<br />
den anderen beiden Gruppen (Deutsche von Geburt an und EU-Ausländer) deutlich höher ist.<br />
Die Gründe liegen vermutlich in den geringeren Opportunitätskosten einer Selbstständigkeit<br />
für Eingebürgerte / Spätaussiedler und sonstige Ausländer, z. B. aufgrund eines erschwerten<br />
Zugangs zu abhängigen Beschäftigungsverhältnissen. Hierfür können Sprachhemmnisse,<br />
das Fehlen spezifischer in Deutschland geforderter formaler Qualifikationen, aber auch Benachteiligungen<br />
bei Einstellungsprozessen verantwortlich sein. 56 Für diese These spricht insbesondere<br />
der Blick auf den Nebenerwerb. Dort sind Eingebürgerte / Spätaussiedler und<br />
sonstige Ausländer mit Anteilen von jeweils knapp 5 % nicht über-, sondern unterrepräsentiert.<br />
Dies wiederum spricht dafür, dass für den Fall des Zugangs zu abhängigen Beschäftigungsverhältnissen<br />
– Nebenerwerbsgründer besitzen in der Regel ein solches – keine erhöhte<br />
Gründungsneigung mehr vorliegt. EU-Ausländer heben sich von den anderen beiden<br />
Migrantengruppen deutlich ab, indem sie relativ zu ihrem Bevölkerungsanteil von 5 % im<br />
Vollerwerb unterrepräsentiert (4 %) und im Nebenerwerb (9 %) überrepräsentiert sind. Dies<br />
56<br />
Eine ausführliche Darstellung der Gründungsaktivitäten von Personen mit Migrationshintergrund<br />
erfolgt in Kohn und Spengler (2007b).
48 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
könnte seine Ursache im höheren Qualifikationsniveau dieser Gruppe und dem dadurch erleichterten<br />
Zugang zu abhängigen Beschäftigungsverhältnissen haben.<br />
Humankapital (Berufsabschluss und Erwerbsstatus)<br />
Die beiden Merkmale Berufsabschluss und Erwerbsstatus vor Gründung spiegeln das Humankapital<br />
der Befragten unmittelbar wider. 57 Im Kontext des persönlichen Erwartungsnutzenkalküls<br />
der Gründungsentscheidung ist jedoch nicht offensichtlich, ob eine höhere Humankapitalausstattung<br />
die Gründungsneigung eher fördert oder behindert. Einerseits wirkt<br />
sich höheres Humankapital positiv auf die Wahrscheinlichkeit unternehmerischen Erfolgs aus<br />
und sollte sich deshalb in einer höheren Gründungsneigung niederschlagen. Andererseits<br />
beeinflusst es auch die Opportunitätskosten der Gründung, weil gerade gut ausgebildeten<br />
und qualifizierten Personen auch attraktivere abhängige Beschäftigungsverhältnisse offen<br />
stehen. Insgesamt dürften die Chancen von hoch qualifizierten Personen, mit unternehmerischer<br />
Tätigkeit höhere Einkommen als in abhängiger Beschäftigung zu erzielen, größer sein<br />
als für Personen mit niedrigerer Humankapitalausstattung. 58 Diese Hypothese kann damit<br />
begründet werden, dass es Personen mit hohem Humankapital besser gelingen sollte, mit<br />
ihren Angeboten auf bestehende oder sogar neue Märkte mit überdurchschnittlichen Renditechancen<br />
vorzudringen (z. B. in wirtschaftsberatenden oder ingenieurwissenschaftlichen und<br />
anderen technologiegeprägten Bereichen). Ferner gewährleistet höheres Humankapital auch<br />
den Zugang zu einer breiteren Palette von potenziellen Gründungsprojekten, was vor allem<br />
auch unter anderen Nutzenaspekten, wie z. B. Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung,<br />
attraktiv sein mag. Insgesamt ist zu erwarten, dass überdurchschnittlich gut ausgebildete<br />
Personen überdurchschnittlich häufig gründen.<br />
Diese Überlegungen bestätigen sich sowohl im Merkmal Berufsabschluss als auch in der<br />
Variable Erwerbsstatus in Tabelle 3. Sowohl im Voll- als auch im Nebenerwerb sind Universitätsabsolventen<br />
im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil unter den Gründern deutlich überrepräsentiert<br />
(Vollerwerbsgründeranteil: 14 %; Nebenerwerbsgründeranteil: 14 %, Bevölkerungsanteil:<br />
9 %). Personen, die nur einen Lehr- oder Berufsfachschulabschluss besitzen,<br />
sind dagegen in Voll- und Nebenerwerb stark unterrepräsentiert (43 % bzw. 39 % versus<br />
52 %). Personen ohne Berufsabschluss sind unter den Vollerwerbsgründer ebenfalls erwartungsgemäß<br />
unterrepräsentiert (21 % versus 27 %); ihre Überrepräsentation im Nebener-<br />
57 Das Merkmal Alter (s. o.) kann ebenfalls als ein Humankapitalindikator angesehen werden. Der<br />
Zusammenhang zwischen Alter und Humankapital gilt jedoch als indirekt, da er sich über die im<br />
Durchschnitt mit dem Alter ansteigende Berufserfahrung entfaltet.<br />
58 Vgl. van der Sluis, van Praag und van Witteloostuijn (2007).
Analysen zu Aufnahme und Beendigung der Selbstständigkeit 49<br />
werb (34 %) ist jedoch überraschend. Ein Erklärungsansatz dafür ist, dass Angehörige dieser<br />
niedrigsten und vergleichsweise häufig in Arbeitslosigkeit oder Nichterwerbstätigkeit befindlichen<br />
Bildungsgruppe neben dem Bezug von Sozialleistungen Nebeneinkünfte durch selbstständige<br />
Arbeit erzielen.<br />
Der auffälligste Wert zum Berufsabschluss ist für die Absolventen von Fach- und Meisterschulen<br />
(Meister und Techniker) zu beobachten. Obwohl ihr Bevölkerungsanteil nur 4 % beträgt,<br />
stellen sie 13 % der Vollerwerbsgründer. Grafik 27 im Anhang ist zu entnehmen, dass<br />
dieser Anteil signifikant höher als im Vorjahr (6 %) liegt. Die unsichere Arbeitsmarktlage aufgrund<br />
der Wirtschaftskrise mag gerade qualifiziertes technisches Personal in Produktionsbetrieben<br />
(z. B. in der Automobilindustrie oder ihren Zulieferbetrieben) dazu bewogen haben,<br />
einer möglichen späteren Entlassung (z. B. nach Auslaufen von Kurzarbeitsregelungen) zuvorzukommen<br />
und sich trotz Krise in der Selbstständigkeit zu versuchen. Hinzu kommt, dass<br />
gerade von Personen mit einer technischen Qualifikation substanzhaltige Gründungsideen zu<br />
erwarten sind.<br />
Der Erwerbsstatus spiegelt neben dem formalen Berufsabschluss auch die Berufserfahrung<br />
und die Einbindung in geschäftsbezogene Netzwerke wider. Hier greifen entsprechend ähnliche<br />
Mechanismen wie beim Berufsabschluss. Im Vollerwerb geht innerhalb der Gruppen, die<br />
vor Gründung abhängig beschäftigt waren, eine höhere Qualifikation bzw. ein höheres Humankapital<br />
ebenfalls mit einer höheren Gründungsaffinität einher. Angestellte Unternehmensleiter<br />
und Geschäftsführer (7 % versus 2 %) sind vor leitenden oder hoch qualifizierten Angestellten<br />
(13 % versus 10 %) im Gründungsgeschehen am stärksten überrepräsentiert; sonstige<br />
Angestellte (26 % versus 34 %), Facharbeiter (2 % versus 7 %) und sonstige Arbeiter (2 %<br />
versus 4 %) sind deutlich unterrepräsentiert. Im Nebenerwerb ist über die Erwerbsgruppen<br />
hinweg annähernd das gleiche Muster zu beobachten.<br />
Beamte – zumeist gut ausgebildet – nehmen eine Sonderposition ein. Für sie sind die Opportunitätskosten<br />
einer Gründung im Vollerwerb besonders hoch, weil die Aufnahme einer<br />
selbstständigen Vollzeittätigkeit den Übergang von einem i. d. R. unkündbaren Beschäftigungsverhältnis<br />
mit sicherem Einkommen in eine Betätigung mit unsicheren Zukunftsaussichten<br />
bedeutet. Deshalb liegt der Anteil der Vollerwerbsgründer unter den Beamten mit 1 %<br />
deutlich unter ihrem Bevölkerungsanteil (4 %).<br />
Wendet man sich mit den Gründern aus Selbstständigkeit, Arbeitslosigkeit und Nichterwerbsbeteiligung<br />
den drei Erwerbsgruppen zu, die vor Gründung nicht abhängig beschäftigt waren,<br />
findet sich ebenfalls eine Bestätigung für das Humankapitalargument. Nichterwerbspersonen<br />
besitzen i. d. R. weniger Humankapital und sind entsprechend am Gründungsgeschehen<br />
(zumindest) im Vollerwerb stark unterrepräsentiert (11 % versus 23 %). Auf den ersten Blick
50 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
sollten Selbstständige, also Personen, die bereits ein Unternehmen führen, beispielsweise<br />
aufgrund zeitlicher Beschränkungen für eine (weitere) Gründung weniger infrage kommen.<br />
Dennoch setzt sich auch hier das gründungsbezogene Humankapital durch, sodass Selbstständige<br />
am Gründungsgeschehen sowohl im Voll- als auch Nebenerwerb sogar überrepräsentiert<br />
sind (11 % bzw. 10 % versus 8 %). Dieser Effekt wird jedoch nicht nur von „Bestandsselbstständigen“<br />
bzw. Serienunternehmern, die ein weiteres Projekt gründen, sondern<br />
auch und womöglich sogar in stärkerem Ausmaß von Selbstständigen mit einem zuvor abgebrochenen<br />
Selbstständigkeitsprojekt (Restarter) getrieben.<br />
Gründer aus der Arbeitslosigkeit<br />
Arbeitslosigkeit stellt zum ersten eine enorme Kostenbelastung für das Sozialsystem dar und<br />
ist zum zweiten auch mit erheblichen finanziellen und häufig auch psychischen Belastungen<br />
für die Betroffenen verbunden. Neben der (erfolgreichen) Suche eines abhängigen Beschäftigungsverhältnisses<br />
stellt die Selbstständigkeit den zweiten Ausweg aus der Arbeitslosigkeit.<br />
Gründungen aus der Arbeitslosigkeit heraus sind deshalb ein wichtiger Aspekt des Gründungsgeschehens<br />
und ständiger Gegenstand der Gründungsforschung (siehe hierzu die aktuelle<br />
Studie von Kohn et al. (2010) und die dort zitierte Literatur).<br />
Bei gut 20 % aller Gründer und knapp 30 % aller Vollerwerbsgründer handelt es sich im<br />
Jahr 2009 um Personen, die zum Zeitpunkt der Gründung arbeitslos waren. Diese Anteile<br />
unterscheiden sich nicht stark von den Vorjahren (siehe Grafik 28 im Anhang). Dass der Anteil<br />
der Vollerwerbsgründer aus der Arbeitslosigkeit im Krisenjahr 2009 nicht höher (sondern<br />
sogar etwas niedriger) als im Vorjahr ausfällt (28 % versus 32 %), dürfte seine Ursache einerseits<br />
darin haben, dass die Krise sich bislang nur schwach auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt<br />
hat (Anstieg der ILO-Erwerbslosenquote von 2008 auf 2009 um nur 0,4 Prozentpunkte,<br />
s. Tabelle 9). Anderseits hat die Krise eine verstärkte Gründungsaktivität aufseiten der Erwerbstätigen,<br />
deren Jobs häufig unsicher geworden sind, ausgelöst und somit deren Gründeranteil<br />
erhöht (Grafik 28 zeigt einen signifikanten Anstieg des Vollerwerbsgründeranteils<br />
der sonstigen Angestellten von 16 % im Jahr 2008 auf 26 % im Jahr 2009).<br />
Im Jahr 2009 – wie auch in allen früheren Jahren – überschreiten die Anteile der zuvor Arbeitslosen<br />
an den Gründern den Anteil der arbeitslosen Personen an allen Teilnehmern des<br />
<strong>Gründungsmonitor</strong>s bei Weitem (siehe Tabelle 3). Die Relevanz von Arbeitslosigkeit als treibender<br />
Faktor für Unternehmensgründungen widerspricht zwar dem Humankapitalargument,
Analysen zu Aufnahme und Beendigung der Selbstständigkeit 51<br />
da Arbeitslose im Durchschnitt weniger hoch qualifiziert sind als andere Erwerbstätige. 59<br />
Dennoch ist die hohe Gründungsneigung Arbeitsloser gut mit dem Erwartungsnutzenkalkül<br />
vereinbar. Arbeits- bzw. Erwerbslosigkeit ist mit geringem Einkommen, niedrigem sozialen<br />
Status und geringer beruflicher Selbstbestimmung verbunden. Zudem finden Arbeitslose<br />
– insbesondere so genannte schwer vermittelbare Arbeitslose – häufig trotz intensiver Suche<br />
kein passendes abhängiges Beschäftigungsverhältnis (siehe auch Exkurs 7 zur Dauer der<br />
Arbeitslosigkeit vor Gründung). Aus diesen Gründen stellt eine Existenzgründung häufig die<br />
einzige Erwerbsalternative zur Arbeitslosigkeit dar. Das Erwartungsnutzenkalkül kann somit<br />
als theoretische Fundierung der in Abschnitt 3.1 motivierten Sichtweise der Arbeitslosigkeit<br />
als Pull-Faktor des Gründungsgeschehens herangezogen werden.<br />
Ausnutzung Geschäftsidee<br />
Fehlende Erwerbsalternativen<br />
Sonstiger Hauptgrund<br />
Ausnutzung Geschäftsidee<br />
Fehlende Erwerbsalternativen<br />
Sonstiger Hauptgrund<br />
Erwerbstätige Arbeitslose<br />
5,4<br />
14,7<br />
24,4<br />
45,0<br />
38,9<br />
51,0<br />
34,3<br />
30,6<br />
26,8<br />
34,3<br />
28,8<br />
32,3<br />
27,1<br />
28,0<br />
34,1<br />
43,2<br />
38,8<br />
62,3<br />
9,1<br />
7,8<br />
11,5<br />
38,0<br />
42,7<br />
29,3<br />
52,9<br />
49,5<br />
0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80%<br />
Nichterwerbspersonen<br />
0% 20% 40% 60% 80%<br />
59,1<br />
Alle Gründer<br />
Vollerwerb<br />
Nebenerwerb<br />
95%-Konfidenzintervall<br />
Die Zahlen neben den Balken geben die Anteile der jeweiligen Gründergruppen an allen Gründern (Vollerwerbsgründern) [Nebenerwerbsgründern]<br />
an, die vor ihrer Gründung erwerbstätig, arbeitslos bzw. Nichterwerbspersonen waren und Angaben zu<br />
ihrem Gründungsmotiv gemacht haben. Die Stichprobenumfänge sind die Folgenden: n=412, (n=186) [n=226] für Erwerbstätige,<br />
n=113, (n=79) [n=34] für Arbeitslose und n=96, (n=29) [n=67] für Nichterwerbspersonen. Lesehilfe: Bei 49,5 % der Vollerwerbsgründer,<br />
die vor Beginn ihrer Selbstständigkeit arbeitslos waren, waren fehlende Erwerbsalternativen (Notmotiv) das<br />
dominante Gründungsmotiv.<br />
Grafik 8: Gründungsmotiv nach Erwerbsstatus vor Gründung, 2009<br />
Grafik 8 zeigt, dass der Großteil (53 %) der Existenzgründungen von Arbeitslosen in der Tat<br />
in Ermangelung von Erwerbsalternativen (als sog. „Notgründung“) erfolgte (Vollerwerb:<br />
59 Vgl. Reinberg, A. und M. Hummel (2005). Niefert (2010) zeigt indes, dass Gründer aus der Arbeitslosigkeit<br />
innerhalb der Gruppe aller Arbeitslosen signifikant besser qualifiziert sind.
52 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
50 %). Dennoch geben beachtliche 38 % der Gründer aus der Arbeitslosigkeit an, die Gründung<br />
vorrangig zur Realisierung einer Geschäftsidee (als „Chancengründung“) realisiert zu<br />
haben. Richtet man den Blick auf den Vollerwerb, findet sich unter den Gründern aus der<br />
Arbeitslosigkeit sogar ein höherer Anteil (43 %) von Chancengründern als unter den Gründern<br />
aus der Erwerbstätigkeit (39 %). Dieser Vergleich fiel im Vorjahr auf niedrigerem Niveau<br />
noch genau umgekehrt aus. Hier handelte es sich bei 22 % (29 %) der vor Gründung arbeitslosen<br />
(erwerbstätigen) Vollerwerbgründer um Chancengründer. 60 Arbeitslosigkeit per se dürfte<br />
bei vielen Betroffenen ein intensives Nachdenken über potenzielle Gründungsprojekte auslösen<br />
und führt offenbar auch häufig zu einer konkreten Geschäftsidee. Dies wird dann nicht<br />
mehr nur als Ausweg aus einer Notsituation, sondern in höherem Maß als Ausnutzung einer<br />
Chance empfundenen. Dass sich in 2009 im Gegensatz zum Vorjahr ein höherer Anteil von<br />
Gründern aus der Arbeitslosigkeit als von Gründern aus einer abhängigen Beschäftigung als<br />
chancenmotiviert bezeichnet, mag daran liegen, dass in der Rezession aufgrund der unsicheren<br />
Arbeitsmarktentwicklung die Suche nach Alternativen zu Arbeitslosigkeit und die Wahrnehmung<br />
der Selbstständigkeit als Chance besonders ausgeprägt gewesen ist.<br />
Exkurs 7: Dauer der Arbeitslosigkeit vor Gründung<br />
Grafik 9 beschreibt die Vollerwerbsgründer aus der Arbeitslosigkeit nach der Arbeitslosigkeitsdauer<br />
vor Gründung. Für das Jahr 2009 zeigt sich mit 47 % der im Beobachtungszeitraum höchste Anteil<br />
von Langzeitarbeitslosen. Dieser Anteil muss zu seiner richtigen Einordnung nicht zum Anteil der<br />
Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen zu einem Stichtag oder im Durchschnitt eines Jahres<br />
(Jahresdurchschnitt 2009: ca. 30 %), sondern zum Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen<br />
eines Jahres in Beziehung gesetzt werden. Da im Lauf des Jahres 2009 rund 12,35 Mio. Arbeitslosigkeitsmeldungen<br />
(= 3,10 Mio. Arbeitslose Ende 2008 + 9,25 Mio. zugehende Arbeitslose<br />
2009) registriert wurden, stammen zwischen 10 % und 25 % der Meldungen des Jahres 2009 von<br />
Langzeitarbeitslosen. 61 Geht man von der realistischen Annahme aus, dass sich der wahre Anteil<br />
eher unter als über 20 % bewegt, dann liegt der Langzeitarbeitslosenanteil an allen Vollerwerbsgründern<br />
aus Arbeitslosigkeit mehr als doppelt so hoch, wie der Anteil (der Meldungen) von Langzeitarbeitslosen<br />
an allen (Meldungen von) Arbeitslosen des Jahres 2009. Diese Überrepräsentation<br />
von Langzeitarbeitslosen unter den Gründern aus der Arbeitslosigkeit zeigt, dass die Existenzgründung<br />
gerade für langzeitarbeitslose Menschen eine häufig wahrgenommene Option zum Wiedereintritt<br />
in die Erwerbstätigkeit darstellt. [Die in diesem Abschnitt verwendeten Arbeitslosigkeitszahlen<br />
stammen aus Bundesagentur für Arbeit 2010b und 2010c.]<br />
Die Entwicklung des Langzeitarbeitslosenanteils im Zeitraum 2005–2009 verläuft entgegengesetzt<br />
zur Konjunktur (vgl. Tabelle 1). Im Jahr 2005 waren bei einem Wirtschaftswachstum von 0,9 %<br />
rund 36 % aller Vollerwerbsgründer aus der Arbeitslosigkeit vormals langzeitarbeitslos, im Jahr<br />
2006 betrugen das Wachstum 3,4 % und der Langzeitarbeitslosenanteil 26 %, im Jahr 2007 waren<br />
2,6 % Wachstum und ein Anteil von 30 %, 2008 1 % Wachstum und ein Anteil von 38 % – also fast<br />
60 Vgl. Kohn und Spengler (2009).<br />
61 Untergrenze: ca. 1,13 Mio. Langzeitarbeitslose Ende 2008 / 12,35 Mio. Arbeitslosigkeitsmeldungen<br />
2009 = 9% (Annahme: im Jahr 2009 kommen zu den ca. 1,13 Mio. Langzeitarbeitslosen zum Jahresende<br />
2008 keine weiteren dazu). Obergrenze: 25 % (Annahme: jeder der 1,97 Mio. Ende 2008 nicht<br />
langzeitarbeitslosen Arbeitslosen wird 2009 zum Langzeitarbeitslosen).
Analysen zu Aufnahme und Beendigung der Selbstständigkeit 53<br />
die gleiche Konstellation wie 2005 – und 2009 schließlich ein Wachstum von -4,9 % und ein Anteil<br />
von 47 % zu beobachten. Diese Zahlen zeigen, dass Langzeitarbeitslose die Selbstständigkeitsoption<br />
dann verstärkt wählen, wenn die Konjunktur schwach und der Weg in abhängige Beschäftigungsverhältnisse<br />
aufgrund geringer Arbeitsnachfrage (stärker als sonst) versperrt ist. Möglicherweise<br />
tragen Rezessionen über die induzierten Gründungen sogar dazu bei, dass viele Langzeitarbeitslose<br />
schneller wieder am Erwerbsleben teilnehmen als dies bei normaler Wirtschaftslage der<br />
Fall gewesen wäre. Es könnte hier von einem „doppelten“ Push-Effekt gesprochen werden. Neben<br />
dem normalen Push-Effekt der Arbeitslosigkeit per se, entsteht in der Rezession ein zusätzlicher<br />
Druck auf Langzeitarbeitslose eine Gründung zu vollziehen, weil die im Grunde bevorzugten abhängigen<br />
Beschäftigungsverhältnisse noch schwerer zugänglich sind.<br />
Bis zu 13 Wochen<br />
Über 13 bis 52 Wochen<br />
Über 52 Wochen<br />
13,8<br />
12,4<br />
13,7<br />
19,7<br />
25,8<br />
35,8<br />
25,8<br />
30,1<br />
37,5<br />
50,4<br />
54,5<br />
44,1<br />
50,1<br />
39,3<br />
47,0<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
95%-Konfidenzintervall<br />
Die Zahlen neben den Balken geben die Anteile der jeweiligen Gründergruppen an allen Vollerwerbsgründern aus der Arbeitslosigkeit<br />
in den Jahren 2005, 2006, 2007, 2008 und 2009 an, für die Angaben zur Arbeitslosigkeitsdauer vor Gründung<br />
vorhanden sind. Die Stichprobenumfänge sind die Folgenden: n=134 für das Jahr 2005, n=100 für das Jahr 2006, n=79 für<br />
das Jahr 2007, n=80 für das Jahr 2008 und n=77 für das Jahr 2009. Lesehilfe: Im Jahr 2009 waren 47 % der Vollerwerbsgründer<br />
aus der Arbeitslosigkeit zum Gründungszeitpunkt über 52 Wochen arbeitslos, d. h. langzeitarbeitslos.<br />
Grafik 9: Vollerwerbsgründer aus der Arbeitslosigkeit nach Arbeitslosigkeitsdauer<br />
Multivariate Analyse: Determinanten der Gründungsentscheidung<br />
Die bisherige Betrachtung der Merkmale der Gründerpersonen diente deren Strukturierung<br />
und der Identifikation potenzieller Einflussfaktoren für die Gründungsentscheidung. Ob es<br />
sich bei den diskutierten Variablen jedoch tatsächlich um Bestimmungsfaktoren der persönlichen<br />
Gründungsentscheidung handelt, kann nur im Rahmen einer weiter gehenden multivariaten<br />
Analyse geklärt werden. Nur indem die potenziellen Bestimmungsfaktoren (Geschlecht,<br />
Alter, nationale Herkunft, Berufsabschluss und Erwerbsstatus) gemeinsam in Beziehung zur<br />
persönlichen Gründungsentscheidung gesetzt und damit gegenseitige Abhängigkeiten der<br />
Bestimmungsfaktoren berücksichtigt werden, kann eine Annäherung an ihre eigenständigen<br />
(bzw. partiellen) Effekte auf die Gründungsentscheidung erreicht werden.
54 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Die multivariaten Analysen erfolgen mittels Probitschätzungen, bei denen die abhängige Variable<br />
den Wert 1 (0) annimmt, wenn es sich bei der Person um einen Gründer (Nicht-<br />
Gründer) handelt. Es wurden eine Schätzung zur Erklärung der allgemeinen Gründungsentscheidung<br />
sowie getrennte Schätzungen nach Vollerwerb und Nebenerwerb durchgeführt. In<br />
der Schätzung zur Erklärung einer Gründung im Vollerwerb (Nebenerwerb) rechnen die Nebenerwerbsgründer<br />
(Vollerwerbsgründer) zu den Nicht-Gründern. Die Ergebnisse der multivariaten<br />
Analyse sind in Tabelle 4 dargestellt.<br />
Die Werte in den Spalten 1, 3 und 5 geben die partiellen Änderungen der Gründungswahrscheinlichkeit<br />
bei Veränderungen der jeweiligen Merkmalsausprägungen relativ zu einer Referenzperson<br />
wieder. Bei dieser Referenzperson handelt es sich um einen Mann deutscher<br />
Herkunft im Alter von 35–44 Jahren, der einen Lehrabschluss besitzt, als sonstiger Angestellter<br />
beschäftigt ist, in einem westdeutschen Ort mit über 500.000 Einwohnern lebt und dessen<br />
Daten im Rahmen der Befragung im Jahr 2008 erhoben wurden (zur Reduktion der Schätzfehler<br />
werden die Daten der Befragungen 2009 und 2008 verwendet). 62 Die ausgewiesenen<br />
Effekte sind deshalb z. B. wie folgt zu interpretieren (siehe Tabelle 4, Spalte 1): Würde die<br />
Person nicht aus West-, sondern aus Ostdeutschland stammen, dann wäre ihre Wahrscheinlichkeit,<br />
eine Gründung zu unternehmen, um 1,7 Prozentpunkte bzw. um 27 % niedriger als<br />
die für die Referenzperson geschätzte Gründungswahrscheinlichkeit (zweite Tabellenzeile<br />
von unten) i. H. v. von 6,3 %. 63 Interpretationen dieser Art sind jedoch nur für statistisch signifikante<br />
Effekte zulässig.<br />
62<br />
Die Auswahl der Referenzperson richtet sich (außer bei dem Geschlecht) nach den (ungewichtet)<br />
am häufigsten im Datensatz auftretenden Merkmalsausprägungen. Ferner soll die Referenzperson<br />
insofern realistisch sein, als tatsächlich Personen mit der beschriebenen Merkmalskombination existieren.<br />
63<br />
Im Vergleich zur Gründungswahrscheinlichkeit auf der Grundlage aller Teilnehmer des <strong>KfW</strong>-<br />
<strong>Gründungsmonitor</strong>s im Alter von 18 bis 64 Jahren von 1,69 % liegen die mittlere Gründungswahrscheinlichkeit<br />
im Schätzdatensatz und die Gründungswahrscheinlichkeit der Referenzperson mit<br />
5,7 % bzw. 6,3 % erheblich höher. Gründer sind dezidiert überrepräsentiert, weil im <strong>KfW</strong>-<br />
<strong>Gründungsmonitor</strong> manche Merkmale (z. B. Erwerbsstatus) zwar für alle Gründer, jedoch aus Kostengründen<br />
nur für eine Unterstichprobe von ca. 7.500 Nicht-Gründern erhoben werden. Eine Beschränkung<br />
der in die Schätzung einfließenden Gründer auf jene, die zu den ersten ca. 7.500 Befragten gehören,<br />
erschient indes nicht sinnvoll, weil die Güte von Probitschätzungen negativ von zu geringen<br />
Anteilen von Einsen bzw. Erfolgen in der abhängigen Variable beeinflusst wird. Indem die geschätzten<br />
absoluten Wahrscheinlichkeitseffekte wie hier in Beziehung zur Gründungswahrscheinlichkeit der<br />
Referenzperson im Schätzdatensatz gesetzt werden, können jedoch Rückschlüsse auf die Effektstärken<br />
in der Grundgesamtheit gezogen werden.
Analysen zu Aufnahme und Beendigung der Selbstständigkeit 55<br />
Tabelle 4: Bestimmungsfaktoren der persönlichen Gründungsneigung (Probitschätzungen)<br />
Abhängige Variable: Gründungsentscheidung (Gründer: y=1, kein Gründer: y=0)<br />
Gründer gesamt Vollerwerbsgründer Nebenerwerbsgründer<br />
dF/dx<br />
(1)<br />
t-Wert<br />
(2)<br />
dF/dx<br />
(3)<br />
t-Wert<br />
(4)<br />
dF/dx<br />
(5)<br />
t-Wert<br />
(6)<br />
Geschlecht (= weiblich) -0,0131 *** -3,87 -0,0130 *** -5,92 0,0008 0,31<br />
Alter (Ref.: 35–44 Jahre)<br />
18 bis 24 Jahre 0,0185 ** 2,1 0,0076 1,13 0,0115 * 1,91<br />
25 bis 34 Jahre 0,0159 *** 2,93 0,0022 0,58 0,0129 *** 3,37<br />
45 bis 54 Jahre -0,0126 *** -3,03 -0,0056 * -1,82 -0,0064 ** -2,3<br />
55 bis 64 Jahre -0,0353 *** -8,01 -0,0182 *** -5,73 -0,0162 *** -5,37<br />
Staatsangehörigkeit (Ref.: D)<br />
D erst durch Einbürgerung -0,0129 -1,63 0,0048 0,77 -0,0142 *** -2,84<br />
EU27-Ausländer 0,0043 0,35 0,0026 0,28 0,0025 0,31<br />
sonstige Ausländer 0,0151 1,22 0,0221 ** 2,21 -0,0024 -0,31<br />
Bildung (Ref.: Lehre)<br />
Universität 0,0384 *** 6,27 0,0213 *** 4,59 0,0180 *** 4,28<br />
Fachhochschule, BA u. ä. 0,0117 ** 1,98 0,0057 1,28 0,0065 1,61<br />
Fachschule, Meisterschule 0,0190 * 1,87 0,0202 *** 2,65 -0,0003 -0,04<br />
kein Berufsabschluss -0,0127 ** -2,18 -0,0072 -1,63 -0,0050 -1,27<br />
Status (Ref.: Sonst. Angest.)<br />
Unt.leiter / Geschäftsführer 0,0965 *** 6,89 0,0676 *** 6,18 0,0321 *** 3,46<br />
leitender / hochq. Angest. 0,0189 *** 2,94 0,0171 *** 3,4 0,0033 0,79<br />
Beamter -0,0235 *** -2,7 -0,0228 *** -3,35 -0,0035 -0,6<br />
Facharbeiter -0,0231 *** -2,88 -0,0173 *** -3,02 -0,0055 -0,98<br />
sonstiger Arbeiter -0,0280 *** -2,57 -0,0152 * -1,89 -0,0131 * -1,79<br />
selbstständig 0,0242 *** 3,33 0,0081 1,52 0,0154 *** 3,04<br />
arbeitslos 0,1204 *** 13,26 0,1083 *** 13,62 0,0202 *** 3,68<br />
Nichterwerbsperson 0,0230 *** 3,69 0,0025 0,54 0,0171 *** 4<br />
Region (= Ostdeutschland) -0,0170 *** -4,31 -0,0004 -0,12 -0,0138 *** -5,55<br />
Ort (Ref.: ab 500.000 Einw.)<br />
bis 5.000 Einw. -0,0064 -1,13 -0,0063 -1,59 0,0003 0,07<br />
5.000 bis unter 20.000 Einw. -0,0059 -1,15 -0,0041 -1,12 -0,0016 -0,45<br />
20.000 bis unter 100.000 E. -0,0163 *** -3,37 -0,0119 *** -3,59 -0,0041 -1,17<br />
100.000 bis unter 500.000 E. -0,0108 * -1,94 -0,0074 * -1,9 -0,0031 -0,78<br />
Jahr (= 2009) 0,0019 0,53 0,0017 0,63 0,0003 0,11<br />
Anzahl der Beobachtungen 22.139 22.139 22.139<br />
Beobachtete Wahrscheinlichkeit 0,0568 0,0261 0,0307<br />
Geschätzte Wahrscheinlichkeit 0,0625 0,0304 0,0303<br />
Pseudo-R² 0,052 0,087 0,031<br />
***, **, * signifikant auf dem 1 %, 5 %, 10 %-Niveau, heteroskedastiekonsistente t-Werte in Klammern.<br />
Für die Schätzungen sind die Gründungen aus den Befragungswellen 2008 und 2009 zusammengefasst. Die Schätzkoeffizienten<br />
geben die Veränderung der Wahrscheinlichkeit einer Gründung relativ zur Referenzperson für die diskrete Veränderung der<br />
Dummyvariablen von 0 nach 1 an. Die Referenzperson ist ein Mann im Alter von 35–44 Jahren mit deutscher Staatsangehörigkeit<br />
von Geburt an, der einen Lehrabschluss besitzt, als sonstiger Angestellter beschäftigt ist und in einem westdeutschen Ort<br />
mit über 500.000 Einwohnern wohnt und der im Jahr 2008 befragt wurde.<br />
Ein qualitativer Vergleich der Signifikanzen und Wirkungsrichtungen der Effekte der multivariaten<br />
Analyse ergibt eine umfassende Übereinstimmung mit den Ergebnissen der deskriptiven<br />
Analyse. Die meisten der persönlichen Merkmalsausprägungen, die in den jeweiligen Gründergruppen<br />
(im Vergleich zur Gesamtbevölkerung) deutlich häufiger auftreten, erweisen sich<br />
in den Schätzungen als signifikante Einflussfaktoren mit den erwarteten Wirkungsrichtungen.
56 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
So korrespondiert z. B. die deutliche Unterrepräsentation von Frauen und Beamten (im Gründungsgeschehen)<br />
im Vollerwerb mit signifikant negativen Effekten dieser Merkmale auf die<br />
Gründungswahrscheinlichkeit (Spalten 1 und 3). Gleiches gilt für die durchweg signifikant<br />
negativen Effekte der Altersgruppe 55–64 und des Arbeitsmarktstatus „sonstiger Arbeiter“,<br />
die signifikant positiven Effekte einer ausländischen Nicht-EU-Staatsbürgerschaft und eines<br />
Fach- / Meisterschulabschlusses für den Vollerwerb, sowie für die durchweg signifikant positiven<br />
Effekte eines Universitätsabschlusses, der (früheren) Tätigkeit als angestellter Unternehmens-<br />
oder Geschäftsführer und der Arbeitslosigkeit vor Gründung.<br />
Ein Beispiel für ein Ergebnis der multivariaten Analyse, das nicht aus der deskriptiven Untersuchung<br />
ableitbar ist (und damit auch die Notwendigkeit einer multivariaten Überprüfung deskriptiver<br />
Evidenz unterstreicht), besteht in dem insignifikanten Einfluss des Arbeitsmarktstatus<br />
„Nichterwerbsperson“ auf die Gründungswahrscheinlichkeit im Vollerwerb, der resultiert,<br />
obwohl diese Gruppe im Vergleich zu Ihrem Bevölkerungsanteil deutlich stärker unterrepräsentiert<br />
ist als die Referenzkategorie. Eine wahrscheinliche Erklärung besteht darin, dass<br />
Nichterwerbstätige häufiger als in anderen Altersgruppen in der Gruppe der 55–64-Jährigen<br />
zu finden sind. Wird diese Altersgruppe kontrolliert, die für sich genommen einen starken negativen<br />
Einflüsse auf die Gründungswahrscheinlichkeit im Vollerwerb besitzt, zeigt sich, dass<br />
von der Nichterwerbstätigkeit per se kein signifikanter negativer Einfluss auf die Gründungswahrscheinlichkeit<br />
ausgeht.<br />
Zwischenfazit zur persönlichen Gründungsentscheidung<br />
In einem deskriptiven Vergleich zentraler persönlicher Merkmale wie Geschlecht, Alter,<br />
Staatsangehörigkeit, Berufsabschluss und Erwerbsstatus vor Gründung kann gezeigt werden,<br />
dass es systematische Unterschiede zwischen Gründern und Nicht-Gründern gibt. Diese Unterschiede<br />
können weit gehend im Rahmen des individuellen Erwartungsnutzenkalküls erklärt<br />
werden und halten auch einer Überprüfung mittels multivariater Analyseverfahren stand. Ceteris<br />
paribus besitzen Männer, Nicht-EU-Ausländer, Universitätsabsolventen, Absolventen<br />
von Fach- und Meisterschulen, angestellte Unternehmens- oder Geschäftsführer, leitende<br />
oder hoch qualifizierte Angestellte und Arbeitslose zumindest im Vollerwerb signifikant höhere<br />
Gründungswahrscheinlichkeiten. Andererseits sind Frauen, ältere Menschen (55–64 Jahre)<br />
und Beamte signifikant seltener unter den Gründern im Vollerwerb anzutreffen. Demnach<br />
neigen einerseits Personen mit besseren formalen Qualifikationen und damit höherem Humankapital,<br />
andererseits aber auch Personen, für die eine selbstständige Erwerbstätigkeit<br />
häufig die einzige Erwerbsalternative darstellt, überdurchschnittlich stark zu einer Gründung.
Analysen zu Aufnahme und Beendigung der Selbstständigkeit 57<br />
4.2 Abbruch von Gründungsprojekten<br />
Der Abbruch bzw. das Überleben von Gründungsprojekten ist – wie in Exkurs 5 ausgeführt –<br />
der Keil zwischen dem Brutto- und dem Nettobeschäftigungseffekt des Gründungsgeschehens.<br />
Querschnittserhebungen wie der <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> eignen sich nur bedingt zur<br />
Analyse der Entwicklung von Gründungen über die Zeit. Dennoch ermöglicht ein innovatives<br />
Befragungsdesign Einblicke zumindest in die kurzfristige Entwicklungsdynamik. Um Informationen<br />
zur Bestandsfestigkeit von Gründungen gewinnen zu können, wurden die Teilnehmer<br />
im <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> auch nach dem Fortbestand ihres Selbstständigkeitsprojekts befragt.<br />
Insbesondere wurde diese Frage nicht nur Gründern mit jüngst (innerhalb der letzten<br />
12 Monate) vollzogenen Gründungen gestellt, sondern auch an zuvor identifizierte Personen<br />
gerichtet, die im Zeitraum zwischen 12 und 36 Monaten vor dem Befragungszeitpunkt den<br />
Schritt in die Selbstständigkeit unternommen haben. Die Ergebnisse dieser Zusatzbefragung<br />
sind in Grafik 10 dargestellt.<br />
Innerhalb des ersten Jahres nach der Gründung haben gemäß der Befragung des Jahres<br />
2009 (2008) mindestens 7 % (11 %) der Gründer ihr Selbstständigkeitsprojekt wieder aufgegeben.<br />
64 Diese Betrachtung ist jedoch zu kurzfristig, um eine belastbare Evidenz zur Bestandsfestigkeit<br />
von Gründungen abzuleiten, da ein Zeitraum von einem Jahr oftmals zu<br />
kurz für die Offenlegung des Misserfolgs eines Gründungsprojekts ist. Dies gilt insbesondere<br />
dann, wenn in der Startphase in ausreichendem Umfang Kapital (z. B. in Form eines Kredits<br />
aus einem Gründerprogramm) zur Verfügung steht. In dieser frühen Phase sind Gründungen<br />
dann „zu jung zum Scheitern“. Bei den dennoch eingestellten Projekten dürfte es sich<br />
unter anderem um solche handeln, die von vornherein auf eine bestimmte Dauer befristet<br />
angelegt waren und für die die Überlebensdauer daher kein Erfolgskriterium darstellt.<br />
Bereits aussagekräftiger ist die Abbruchrate von 21 % (17 %) derjenigen Gründer, die ihr<br />
Projekt mindestens 12, aber höchstens 24 Monate vor dem Befragungszeitpunkt begonnen<br />
haben. Im Fall dieser Gründer existiert mindestens eine Zeitspanne von 12 Monaten, die<br />
fortbestehende Unternehmen am Markt überdauert haben müssen. Aber auch bei diesen<br />
Projekten spielt das „Polster“ der Startphasenfinanzierung wahrscheinlich noch eine bedeutende<br />
Rolle. Die belastbarsten Aussagen über die Nachhaltigkeit des Gründungsgesche-<br />
64 Bei den Anteilen von 7 % bzw. 11% handelt es sich um Untergrenzen für den Anteil der innerhalb<br />
eines Jahres beendeten Projekte, da die meisten Projekte weniger als 12 Monate vor dem Befragungszeitpunkt<br />
begonnen wurden und somit kein ganzes Jahr beobachtet werden konnten. Die Abbruchraten<br />
sind somit zensiert. Entsprechend geben die Abbruchraten für die beiden anderen Gründergruppen<br />
(Gründung vor 12 bis 24 Monaten und Gründung vor 24 bis 36 Monaten) die Untergrenzen<br />
für die ersten zwei bzw. drei Jahre nach der Gründung an.
58 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
hens sollten die Angaben zu den Projekten liefern, die mindestens 24, aber höchstens<br />
36 Monate vor dem Befragungszeitpunkt begonnenen wurden. Um gemäß dieser Abgrenzung<br />
als erfolgreich gelten zu können, muss ein Gründungsprojekt mindestens zwei Jahre<br />
am Markt überdauert haben. Die in diesem Segment beobachteten Abbruchraten liegen bei<br />
rund einem Fünftel (2009) bzw. einem Viertel (2008). 65<br />
Gründung liegt höchstens 12 Monate zurück<br />
Gründung liegt über 12 Monate aber<br />
höchstens 24 Monate zurück<br />
Gründung liegt über 24 Monate aber<br />
höchstens 36 Monate zurück<br />
2008 2009<br />
10,9<br />
8,9<br />
11,9<br />
17,3<br />
15,0<br />
20,0<br />
19,6<br />
24,2<br />
28,7<br />
0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40%<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb 95%-Konfidenzintervall<br />
Die Zahlen neben den Balken geben die Anteile der Gründer der jeweiligen Gründergruppen an allen Gründern, Vollerwerbsgründern<br />
bzw. Nebenerwerbsgründern wieder, deren Selbstständigkeitsprojekt zum Befragungszeitpunkt bereits beendet war<br />
und für die Angaben zum Gründungszeitpunkt vorliegen. Die Auswertungen beruhen auf den folgenden Fallzahlen (erster Wert<br />
jeweils für alle Gründer, zweiter Wert für Voll-, dritter Wert für Nebenerwerbsgründer): n=655, 285, 367 im Jahr 2008 und<br />
n=675, 300, 371 im Jahr 2009 für Gründer, deren Gründung höchstens 12 Monate zurückliegt; n=374, 182, 192 im Jahr 2008<br />
und n=310, 144, 165 im Jahr 2009 für Gründer, deren Gründung über 12, aber höchstens 24 Monate zurückliegt; n=401, 200,<br />
199 im Jahr 2008 und n=316, 165, 151 im Jahr 2009 für Gründer, deren Gründung über 24, aber höchstens 36 Monate zurückliegt.<br />
Lesehilfe: 18,8 % der Vollerwerbsgründer aus der Befragung des Jahres 2009, die ihre Selbstständigkeit über 12, aber<br />
höchstens 24 Monate vor dem Befragungszeitpunkt begonnen hatten, hatten dieses zum Befragungszeitpunkt bereits wieder<br />
beendet.<br />
Grafik 10: Beendete Selbstständigkeitsprojekte nach Gründungszeitpunkt<br />
65 Das unerwartete Ergebnis, dass die Abbrecherquoten der Projekte, die vor über 12, aber höchstens<br />
24 Monaten begonnen wurden, teils höher sind als die Mortalitätsraten der Projekte mit Beginn vor<br />
über 24, aber höchstens 36 Monaten, ist eine Folge des Querschnittscharakters des <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>s.<br />
Daraus resultiert das Problem, dass Informationen über die Vergangenheit nicht (wie<br />
im Panel) automatisch durch wiederkehrende Befragungen derselben Personen / Gründer generiert<br />
werden, sondern durch die Befragung unterschiedlicher Personen / Gründer zu einem einzigen Befragungszeitpunkt<br />
über unterschiedlich lange zurückliegende Ereignisse der Vergangenheit. Hierdurch<br />
entstehen häufig – wie auch hier – Beeinträchtigungen der Datenqualität durch Einschränkungen des<br />
Erinnerungsvermögens und potenzielle Umdeutungen von vergangenen Ereignissen.<br />
2,8<br />
6,8<br />
10,3<br />
21,4<br />
18,8<br />
20,2<br />
20,0<br />
20,3<br />
24,0
Analysen zu Aufnahme und Beendigung der Selbstständigkeit 59<br />
Eine sich aufdrängende Frage ist die nach den Ursachen für das beobachtete Gründungssterben.<br />
Hierzu bietet der <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> aufgrund seiner umfassenden Erfassung<br />
von Gründungs- und Gründermerkmalen (siehe Abschnitte 3.2, 3.3 und 4.1) eine reichhaltige<br />
Informations- und Analysebasis. Nachfolgend werden die Ergebnisse einer multivariaten<br />
Analyse des Abbruchs von Gründungsprojekten präsentiert. 66<br />
Multivariate Analyse: Determinanten des Gründungsüberlebens<br />
Wie bereits in Abschnitt 4.1, erfolgt die Analyse mittels Probit-Regression. Hier nimmt die<br />
abhängige Variable nun den Wert 1 (0) an, wenn es sich bei der Person um einen Gründer<br />
mit beendetem (fortbestehendem) Projekt handelt. Der Schätzdatensatz speist sich aus<br />
Gründern der Befragungsjahre 2009 und 2008. 67 Die Analyse basiert nur auf Gründern, die<br />
ihr Projekt mehr als 6 Monate, aber höchstens 36 Monate vor dem Befragungszeitpunkt begonnen<br />
haben. Gründer innerhalb des letzten halben Jahres werden von der Analyse ausgeschlossen,<br />
weil sie, wie oben dargelegt, in vielen Fällen noch „zu jung zum Scheitern“ sind.<br />
Durch ihre Berücksichtigung würden (zu) viele eigentlich zum Scheitern verurteilte Projekte<br />
als überlebend in die Analyse eingehen. Diese fehlerhafte Messung der abhängigen Variable<br />
würde sich in unpräzisen Schätzungen des Einflusses der erklärenden Variablen niederschlagen<br />
und (wie Schätzversuche unter Einbeziehung auch der jüngsten Gründer gezeigt<br />
haben) die Identifikation der Determinanten des Gründungsüberlebens erschweren. Die<br />
Schätzergebnisse sind in Tabelle 5 zusammengestellt.<br />
Analog zu den Schätzungen der Gründungswahrscheinlichkeit in Tabelle 4 geben die Werte<br />
in den Spalten 1 und 3 die partiellen Änderungen der Wahrscheinlichkeit des Abbruchs des<br />
Gründungsprojekts relativ zu einem Referenzgründer an. Der Referenzgründer besitzt die<br />
gleichen persönlichen Merkmale wie die Referenzperson in Tabelle 4. Darüber hinaus handelt<br />
es sich um einen Gründer, der eine Neugründung im Vollerwerb im Bereich der wirtschaftlichen<br />
Dienstleistungen und der sonstigen Berufe ohne Teampartner, ohne Mitarbeiter<br />
und als Realisation einer Gründungschance begonnen hat. Die Gründung wurde 7–9 Monate<br />
vor dem Befragungszeitpunkt mit einem Finanzmitteleinsatz zwischen einem und<br />
10.000 EUR begonnen. Das angebotene Produkt ist keine Marktneuheit.<br />
66<br />
Einen Überblick über verwandte nationale und internationale Studien (in Verbindung mit originären<br />
Ergebnissen auf Basis des <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>s) zu den Bestimmungsgründen des Gründungsüberlebens<br />
geben Kohn und Spengler (2008d). Vgl. auch van Praag (2003).<br />
67<br />
Die Daten des Jahres 2008 werden mitberücksichtigt, um eine der Vielzahl der erklärenden Variablen<br />
angemessene Beobachtungszahl (Zahl von Freiheitsgraden) zu erreichen. Aus dem gleichen<br />
Grund werden keine getrennten Schätzungen für Voll- und Nebenerwerb durchgeführt.
60 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Tabelle 5: Bestimmungsfaktoren des Abbruchs der Gründungsprojekte (Probitschätzung)<br />
Abhängige Variable: Fortbestand des Gründungsprojekts (Projekt beendet: y=1, Projekt besteht fort: y=0)<br />
Gründermerkmale + Kontrollvariablen Strukturmerkmale Gründung + Kontrollvariablen<br />
dF/dx<br />
(1)<br />
t-Wert<br />
(2)<br />
dF/dx<br />
(3)<br />
t-Wert<br />
(4)<br />
Geschlecht (= weiblich) 0,0161 1,29 Umfang (= Nebenerwerb) -0,0107 -1,02<br />
Alter (Ref.: 35–44 Jahre) Form (Ref.: Neugründung)<br />
18 bis 24 Jahre 0,0063 0,22 Übernahme -0,0062 -0,30<br />
25 bis 34 Jahre 0,0085 0,62 Beteiligung 0,0570 *** 3,23<br />
45 bis 54 Jahre -0,0091 -0,72 Branche (Ref.: wirtsch. Dienstleist.)<br />
55 bis 64 Jahre -0,0093 -0,57 Verarbeitendes Gewerbe -0,0052 -0,18<br />
Staatsangehörigkeit (Ref.: D) Baugewerbe -0,0165 -0,64<br />
deutsch durch Einbürgerung 0,0156 0,63 Handel 0,0361 ** 2,11<br />
EU27-Ausländer 0,0149 0,47 persönliche Dienstleistungen 0,0076 0,51<br />
sonstige Ausländer -0,0255 -0,86 sonstige Branchen -0,0341 -1,46<br />
Bildung (Ref.: Lehre) Berufsgruppe (Ref.: Sonstige Berufe)<br />
Universität 0,0035 0,24 Freie Berufe -0,0262 ** -2,18<br />
Fachhochschule, BA u. ä. -0,0179 -1,24 Handwerk -0,0272 * -1,72<br />
Fachschule, Meisterschule 0,0024 0,08 Marktneuheit (Ref.: keine Neuheit)<br />
kein Berufsabschluss 0,0022 0,12 regionale Neuheit 0,0708 *** 3,26<br />
Status (Ref.: Sonstige Angestellte) deutschlandweite Neuheit -0,0168 -0,58<br />
Unt.leiter / Geschäftsführer -0,0073 -0,27 weltweite Neuheit 0,0567 1,25<br />
leitender / hochq. Angestellte -0,0181 -1,20 Größe (Ref.: Sologründer o. Mitarbeit.)<br />
Beamte -0,0191 -0,50 Sologründer mit Mitarbeitern 0,0032 0,22<br />
Facharbeiter 0,0593 * 1,80 Teamgründer ohne Mitarbeiter 0,0716 *** 2,97<br />
sonstiger Arbeiter 0,2208 *** 3,63 Teamgründer mit Mitarbeitern -0,0118 -0,61<br />
selbstständig -0,0235 -1,33 Finanzmitteleinsatz (Ref.: 1–10 TEUR)<br />
arbeitslos 0,0268 1,52 keine finanziellen Mittel 0,0309 ** 2,28<br />
Nichterwerbsperson 0,0126 0,74 > 10.000 bis 25.000 EUR -0,0304 ** -2,06<br />
Gründungsmotiv (Ref.: Chance) > 25.000 EUR -0,0414 *** -3,13<br />
Notmotiv im Vordergrund 0,0144 1,06 Gründung vor … (Ref.: 7–9 Monate)<br />
sonstiges Motiv im Vordergrund -0,0106 -0,85 10–12 Monaten 0,0677 ** 2,35<br />
Region (= Ostdeutschland) -0,0260 ** -2,35 13–15 Monaten 0,0841 ** 2,48<br />
Ort (Ref.: ab 500.000 Einw.) 16–18 Monaten 0,0757 ** 2,34<br />
bis 5.000 Einwohner -0,0136 -0,88 19–21 Monaten 0,1535 *** 3,98<br />
5.000 bis unter 20.000 Einw. 0,0025 0,15 22–24 Monaten 0,0908 ** 2,52<br />
20.000 bis unter 100.000 Einw. 0,0030 0,18 25–27 Monaten 0,1258 *** 3,22<br />
100.000 bis unter 500.000 Einw. 0,0133 0,72 28–30 Monaten 0,1543 *** 4,14<br />
Jahr (= 2009) -0,0103 -1,06 31–33 Monaten 0,1240 ** 3,52<br />
34–36 Monaten 0,1947 *** 4,79<br />
Anzahl Beobachtungen 1.617<br />
Beobachtete Wahrscheinlichkeit 0,173<br />
Geschätzte Wahrscheinlichkeit 0,065<br />
Pseudo-R 2 0,130<br />
***, **, * signifikant auf dem 1 %, 5 %, 10 %-Niveau, heteroskedastiekonsistente t-Werte in Klammern.<br />
Für die Schätzungen sind die Gründungen aus den Befragungswellen 2008 und 2009 zusammengefasst. Die Schätzkoeffizienten<br />
geben die Veränderung der Wahrscheinlichkeit eines Abbruchs des Selbstständigkeitsprojekts für Projekte, die über ein<br />
halbes Jahr vor dem Befragungszeitpunkt begonnen wurden, relativ zu einem Referenzgründer für die diskrete Veränderung<br />
der Dummyvariablen von 0 nach 1 an. Der Referenzgründer besitzt die gleichen persönlichen Merkmale wie die Referenzperson<br />
in der Schätzung der Gründungswahrscheinlichkeit (siehe Fußnote zu Tabelle 4). Darüber hinaus handelt es sich um einen<br />
„Chancengründer“ aus der Befragung des Jahres 2008, der eine Neugründung im Vollerwerb im Bereich der wirtschaftlichen<br />
Dienstleistungen und sonstigen Berufe ohne Teampartner und Mitarbeiter realisiert hat. Die Gründung wurde 7–9 Monate vor<br />
dem Befragungszeitpunkt mit einem Finanzmitteleinsatz von einem bis 10.000 Euro vollzogen. Beim angebotenen Produkt<br />
handelt es sich nicht um eine Marktneuheit.
Analysen zu Aufnahme und Beendigung der Selbstständigkeit 61<br />
Die Ergebnisse in Tabelle 5 bestätigen teils die Erwartungen, sind in manchen Punkten aber<br />
überraschend. So ist für den Bildungsabschluss kein signifikanter Einfluss auf die Beendigung<br />
von Gründungsprojekten zu beobachten. Auch für Gründungen aus der Arbeitslosigkeit<br />
kann kein signifikanter Effekt auf die Mortalität nachgewiesen werden. Jedoch besitzt der<br />
Effekt das erwartete positive Vorzeichen und verfehlt die schwache Signifikanz nicht weit.<br />
Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass nicht aussichtsreiche Projekte von vornherein nicht<br />
realisiert werden, wenn ihnen wegen einer negativ ausgefallenen Tragfähigkeitsprüfung seitens<br />
der Bundesagentur für Arbeit keine Zuschüsse gewährt. In der Gruppe der Erwerbsstatusvariablen<br />
besitzen die Merkmale „Facharbeiter“ schwach und „sonstige Arbeiter“ stark signifikant<br />
positive Effekte auf die Abbruchwahrscheinlichkeit. Relativ geringes Humankapital,<br />
das für diese beiden Erwerbsgruppen typisch ist, schlägt sich somit in niedrigeren Lebenserwartungen<br />
der Gründungsprojekte nieder. Insbesondere die Gründungen von sonstigen Arbeitern<br />
bieten mit einer um 22 Prozentpunkte erhöhten Sterbewahrscheinlichkeit im Durchschnitt<br />
keine guten Aussichten.<br />
Eine bislang für Deutschland noch nicht geklärte Frage besteht in den Erfolgsaussichten von<br />
Team- versus Sologründungen. Hier zeigt sich, dass die Risiken einer Teamgründung<br />
– zumindest für den Fall, dass sie ohne Mitarbeiter erfolgt – die Chancen offenbar überwiegen.<br />
Teamgründer ohne Mitarbeiter besitzen im Vergleich zu Sologründern ohne Mitarbeiter<br />
eine um 7 Prozentpunkte erhöhte Wahrscheinlichkeit, spätestens innerhalb der ersten drei<br />
Jahre nach Gründung zu scheitern. Eine mögliche Erklärung könnte in der Gefahr von Meinungsverschiedenheiten<br />
der Gründer gerade in der aufreibenden frühen Phase des Gründungsprojekts<br />
bestehen, die schließlich zum Ausscheiden von Partnern oder der gänzlichen<br />
Aufgabe des Projekts führen.<br />
Gründungen im Bereich der Freien Berufe erhöhen die Überlebenswahrscheinlichkeit im<br />
3-Jahreszeitraum signifikant um knapp 3 Prozentpunkte. Dies ist mit den vergleichsweise<br />
komplexen Gütern und Dienstleistungen zu erklären, die diese Gründergruppe anbietet. Je<br />
komplexer oder ausbildungsintensiver das Produkt ist, desto weniger Personen sind potenziell<br />
dazu in der Lage, dieses nachzuahmen. Für das Handwerk wird ein ebenfalls (wenngleich<br />
nur schwach) signifikanter Effekt in gleicher Größe gefunden. Im Gegensatz hierzu<br />
sind Gründungen im Handel, der sich durch eine hohe Wettbewerbsintensität auszeichnet,<br />
mit einer um 4 Prozentpunkte höheren Abbruchrate verbunden als Gründungen in der Referenzkategorie<br />
der wirtschaftlichen Dienstleistungen.<br />
Marktneuheiten, die lediglich eine regionale Neuheit darstellen, erweisen sich bzgl. der Überlebensfähigkeit<br />
schwächer als imitative Gründungen: Im Vergleich zu Gründungsprojekten,<br />
die keine Neuheit darstellen, scheitern sie mit einer um 7 Prozentpunkte erhöhten Wahrscheinlichkeit<br />
innerhalb der ersten maximal 3 Jahre. Bei diesen Gründern, die in der Regel
62 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
ein einfaches Produkt (häufig im Bereich Einzelhandel) anbieten, mag der Gründungsidee<br />
häufig eine Fehleinschätzung bzgl. des lokalen bzw. regionalen Marktpotenzials zu Grunde<br />
liegen. Für deutschlandweite oder weltweite Neuheiten kann kein signifikanter Effekt im Vergleich<br />
zu nicht innovativen Projekten festgestellt werden. Dies ist ein Hinweis darauf, dass<br />
diese Projekte tatsächlich ein höheres Potenzial als nur regionale Marktneuheiten besitzen.<br />
Im Rahmen der Analyse der Gründungswahrscheinlichkeit wurde herausgearbeitet, dass<br />
Nicht-EU-Ausländer (und auch eingebürgerte Migranten / Spätaussiedler) aufgrund mutmaßlich<br />
schlechterer Voraussetzungen, eine geeignete abhängige Beschäftigung zu erhalten,<br />
signifikant häufiger den Weg in die Selbstständigkeit wählen (müssen). Insofern wäre es nicht<br />
überraschend, wenn ihre Projekte auch mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit scheitern würden.<br />
Dies ist jedoch nicht der Fall. Ein Grund für die gute Performance von Nicht-EU-<br />
Ausländern könnte darin bestehen, dass sie aufgrund der geringeren Erwerbsalternativen<br />
und des häufigen Fehlens von Ansprüchen auf Sozialleistungen aus der Arbeitslosenversicherung<br />
auf die Aufrechterhaltung und den Erfolg ihres Gründungsprojekts angewiesen sind<br />
und einen entsprechend hohen persönlichen Einsatz bringen.<br />
Der Finanzmitteleinsatz hängt signifikant mit dem Fortbestand des Projekts zusammen. Je<br />
mehr finanzielle Mittel bei der Gründung eingesetzt werden bzw. je größer das Projekt ist,<br />
desto wahrscheinlicher ist sein Fortbestand. Gründungen, die ohne den Einsatz finanzieller<br />
Mittel einhergehen, werden im untersuchten 3-Jahresfenster mit einer um 3 Prozentpunkte<br />
erhöhten Wahrscheinlichkeit beendet, Gründungen mit einem anfänglichen Finanzmitteleinsatz<br />
von 10 TEUR bis 25 TEUR und über 25 TEUR bestehen mit einer um 3 bzw. 4 Prozentpunkte<br />
höheren Wahrscheinlichkeit fort als Projekte mit einem Mitteleinsatz von einem<br />
bis 10 TEUR (Referenz). In diesem nicht unerwarteten Ergebnis könnte allerdings eine Endogenitätsbeziehung<br />
zum Ausdruck kommen. So ist denkbar, dass genau jene Projekte mit höheren<br />
Finanzmitteln operieren, denen diese von Seiten der Kapitalgeber gerade wegen ihrer<br />
vergleichsweise hohen Erfolgsaussichten zugestanden wurden. Dennoch liefern die Schätzergebnisse<br />
Hinweise darauf, dass eine Unterausstattung von Gründungen mit finanziellen<br />
Mitteln mit negativen Folgen für den Unternehmenserfolg verbunden sein kann. Wie sich die<br />
aktuelle Finanzierungssituation von Gründungen in Deutschland darstellt, ist Gegenstand des<br />
folgenden Kapitels.
5 Gründungsfinanzierung<br />
Ausgehend von den hohen Volumina des Jahres 2008 ist das Kreditneugeschäft der deutschen<br />
Kreditinstitute an Unternehmen und Selbstständige seit Anfang des vergangenen Jahres<br />
rückläufig. Insbesondere für die zweite Hälfte 2009 verzeichnet der <strong>KfW</strong>-<br />
Kreditmarktausblick hohe Schrumpfungsraten am Kreditmarkt; inzwischen hat sich die Abwärtsdynamik<br />
jedoch wieder verlangsamt. 68 Angesichts von Wirtschaftskrise und Finanzmarktunsicherheiten<br />
haben Banken ihre Standards für Kredite an Unternehmen, die bereits<br />
seit dem 3. Quartal 2007 stetig angehoben worden waren, in 2009 vor allem in der ersten<br />
Jahreshälfte nochmals verschärft. Am aktuellen Rand sind jedoch kaum noch Verschärfungstendenzen<br />
bei den Kreditrichtlinien zu verzeichnen. 69<br />
Gemäß „Unternehmensbefragung 2010“ (Bauer und Zimmermann, 2010) hat sich die Finanzierungssituation<br />
von etablierten Unternehmen im Lauf des Jahres 2009 deutlich verschlechtert.<br />
Die extrem negative Beurteilung des Kreditzugangs während der letzen Rezession in<br />
den Jahren 2002 und 2003 wurde jedoch bisher nicht erreicht. Auch im ifo Konjunkturtest liegt<br />
die sog. „Kredithürde“ als Anteil der teilnehmenden Unternehmen, die angeben, die Kreditvergabe<br />
der Banken sei restriktiv, zwar aktuell deutlich höher als noch zur Mitte des Jahres<br />
2007. Nach einem massiven Anstieg im Jahr 2008 hat jedoch im Verlauf des Jahres 2009<br />
eine Plateaubildung stattgefunden, und seit Anfang dieses Jahres befindet sich die Hürde<br />
wieder im Sinken. Traditionell lag die Kredithürde für kleine und mittlere Unternehmen höher<br />
als für große Unternehmen. Seit Herbst 2008 stellt sich die Situation jedoch umgekehrt dar.<br />
Im Branchenvergleich sind zudem Handelsunternehmen weniger von Kreditrestriktionen betroffen<br />
als Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, und auch von der Entspannung am<br />
aktuellen Rand profitierte der weniger kapitalintensive Handel stärker. 70<br />
Der Analyse von Schoenwald (2010) zufolge liegt das Schrumpfen des Kreditneugeschäfts<br />
der Banken im Jahr 2009 angesichts des tiefen konjunkturellen Einschnitts im Rahmen der<br />
Erwartungen. Auf Basis des <strong>KfW</strong>-Mittelstandspanels zeigt Reize (2010) weiterhin, dass der<br />
Anstieg der Kreditablehnungsquote in 2009 durch das schlechte konjunkturelle Umfeld nachfrageseitig<br />
und nicht angebotsseitig durch ein übermäßig restriktives Verhalten der Banken<br />
bedingt war. Finanzielle Engpässe im Unternehmenssektor sind aber für den Fall nicht aus-<br />
68<br />
Vgl. Denzer-Speck und Schoenwald (2010).<br />
69<br />
Vgl. die Ergebnisse des Bank Lending Survey für April 2010 (EZB, 2010; Deutsche Bundesbank,<br />
2010a).<br />
70<br />
Vgl. ifo (2010).
64 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
zuschließen, wenn bei wieder anziehender Konjunktur die Investitionskreditnachfrage der<br />
Unternehmen steigt und dann auf ein restriktives Kreditangebot von Seiten der Banken trifft.<br />
Aufgrund der Belastung der Eigenkapitalbasis durch krisenbedingte Kreditausfälle und steigender<br />
regulatorischer Anforderungen stehen die Banken derzeit geschwächt dar. Alles in<br />
allem lässt sich jedoch trotz der Risiken im Finanzmarktsektor bisher nicht von einem flächendeckenden<br />
Kreditklemmenszenario in der Unternehmensfinanzierung sprechen.<br />
Für Gründer stellt der Zugang zu bedarfsgerechten Finanzierungsinstrumenten eine zentrale<br />
Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung ihres Vorhabens dar. 71 Der <strong>KfW</strong>-<br />
<strong>Gründungsmonitor</strong> widmet deshalb regelmäßig ein Kapitel der Gründungsfinanzierung. Dabei<br />
unterscheidet das Fragedesign explizit zwischen Sachmitteln und Finanzmitteln und erlaubt<br />
damit eine trennscharfe Erfassung des Mittelbedarfs. 72 Unter Sachmitteleinsatz fallen bereits<br />
vor der Gründung vorhandene und vom Gründer genutzte Objekte, wie beispielsweise eigene<br />
Autos oder Computer. Finanzmittel dienen der Finanzierung sowohl von Investitionen als<br />
auch von Betriebsmitteln, wobei der Einsatz eigener Mittel der Gründer – beispielsweise das<br />
Einbringen von Ersparnissen – und die Nutzung verschiedener externer Finanzierungsquellen<br />
zu unterscheiden sind.<br />
Die nachfolgenden Abschnitte analysieren zunächst den Mittelbedarf von Voll- und Nebenerwerbsgründern<br />
und die Finanzierungsstruktur der Gründungen (Abschnitt 5.1). Sodann<br />
schließen sich Untersuchungen zu Existenz, Art und Bestimmungsgrößen von Finanzierungsschwierigkeiten<br />
im Gründungszusammenhang an (Abschnitt 5.2).<br />
5.1 Mittelbedarf der Gründer<br />
Der Sach- und Finanzmittelbedarf von Gründern des Jahres 2009 zur Bereitstellung und Finanzierung<br />
von Investitionen und Betriebsmitteln ist Grafik 11 (ergänzt durch Tabelle 14 im<br />
Anhang) zu entnehmen. Jeder zehnte Gründer (10,3 %) kam ganz ohne Mittelbedarf aus und<br />
ein Fünftel (19,8 %) nutzte ausschließlich Sachmittel, wie etwa eingebrachte Büroräume,<br />
Computer oder Autos. Gut zwei Drittel aller Gründer (69,9 %) hatten jedoch finanziellen Mittelbedarf,<br />
wobei das Gros (54,8 %) sowohl Finanz- als auch Sachmittel in Anspruch genommen<br />
hat.<br />
71<br />
Die Auffassung, dass Liquiditätsbeschränkungen bei einer Gründungsentscheidung tatsächlich bindend<br />
sind, wird durch eine Vielzahl internationaler empirischer Studien gestützt. Vgl. z. B. Evans und<br />
Jovanovic (1989) und die Übersichten in Parker (2004) und Kohn (2009).<br />
72<br />
Vgl. Kohn und Spengler (2007a).
Gründungsfinanzierung 65<br />
Mehr Gründer mit Finanzierungsbedarf<br />
Im Vergleich zu den Vorjahren 2007 und 2008 (Tabelle 14 im Anhang) ist damit der Anteil der<br />
Gründer, die einen Finanzierungsbedarf aufweisen, merklich angestiegen (2008: 67,3 %,<br />
2007: 56,6 %). Dies kann als Hinweis auf einen größeren Umfang und verbesserte Erfolgsaussichten<br />
zahlreicher in Zeiten der Wirtschaftskrise realisierter Gründungsprojekte dienen,<br />
zumal die Entwicklung im Voll- wie auch im Nebenerwerb zu beobachten ist und ein Finanzmitteleinsatz<br />
– wie im Abschnitt 4.2 diskutiert – mit einer höheren Überlebenswahrscheinlichkeit<br />
der Gründung einhergeht.<br />
60,9%<br />
54,8%<br />
Vollerwerb Nebenerwerb<br />
7,3%<br />
Alle Gründer<br />
10,3%<br />
16,2%<br />
15,1%<br />
15,5%<br />
19,8%<br />
50,2%<br />
12,7%<br />
14,8%<br />
22,3%<br />
Weder Sachmittel noch finanzielle Mittel<br />
Nur Sachmittel<br />
Nur finanzielle Mittel<br />
Sachmittel und finanzielle Mittel<br />
Die Zahlen geben die Anteile der jeweiligen Gründergruppen an allen n=623 Gründern, an allen n=265 Gründern im Vollerwerb<br />
bzw. allen n=355 Gründern im Nebenerwerb wieder, für die Angaben zum Sach- und Finanzmittelbedarf verfügbar sind. Lesehilfe:<br />
60,9 % der Vollerwerbsgründer im Jahr 2009 haben sowohl Sachmittel als auch finanzielle Mittel eingesetzt.<br />
Grafik 11: Mittelbedarf nach Sachmitteln und finanziellen Mitteln, 2009<br />
Gründer, die den Schritt in die Selbstständigkeit ohne jedweden Mitteleinsatz unternehmen,<br />
stellen eine kleine Minderheit dar. Zudem treten Gründer ohne finanziellen Mittelbedarf erwartungsgemäß<br />
deutlich häufiger im Neben- als im Vollerwerb auf (Vollerwerb: 23,5 %, Nebenerwerb:<br />
35 %), 73 denn die Projekte von Nebenerwerbsgründern sind hinsichtlich Mitarbeiterzahl,<br />
Investitionsvolumina, Betriebsmittelbedarf usw. in der Regel kleiner als die von Voller-<br />
73 Weiter gehende Analysen zeigen, dass Nebenerwerbsgründer signifikant häufiger nur Sachmittel<br />
nutzen und Vollerwerbsgründer signifikant häufiger sowohl Sach- als auch Finanzmittel einsetzen.
66 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
werbsgründern. Zudem dürfte die Bereitschaft, finanzielle Risiken einzugehen, bei den Gründern<br />
geringer sein, die ihr Projekt primär als Hinzuverdienstmöglichkeit ansehen.<br />
Sach- und Finanzmittel: kleine Bedarfe dominieren<br />
Informationen zur Höhe des Mittelbedarfs im Jahr 2009 liefert Grafik 12, die zwischen Gründern<br />
mit Sachmitteleinsatz und/oder finanziellem Mittelbedarf (rechte Spalte, „gesamte Mittel“)<br />
und den Teilgruppen Gründer mit Sachmittelbedarf (linke Spalte) und Gründer mit finanziellem<br />
Mittelbedarf (Mitte) unterscheidet. 74<br />
Der Anteil der Gründer mit einem sehr kleinen Gesamtmittelbedarf von unter 5.000 EUR betrug<br />
45,8 % (aller Gründer mit Mittelbedarf), und drei von vier Gründern (76,5 %) blieben innerhalb<br />
der Mikrobedarfsgrenze von 25.000 EUR, während nur knapp 10 % einen Gesamtmittelbedarf<br />
von über 50.000 EUR angaben. In den Klassen der mittleren und größeren Gründungsprojekte<br />
kommt finanziellen Mitteln (7,8 % der Gründer mit finanziellem Mittelbedarf<br />
nutzten Finanzmittel von über 50.000 EUR) im Vergleich zu Sachmitteln (nur 2,1 % der Gründer<br />
mit Sachmittelbedarf setzten solche von über 50.000 EUR ein) eine wichtigere Rolle zu.<br />
Diese Ergebnisse untermauern zum einen die Tatsache, dass mit den Klein- und Kleinstgründungen<br />
ein erhebliches Segment im Gründungsgeschehen mit einer geringen Grundausstattung<br />
auskommt. Zum anderen unterstreichen sie die Bedeutung des Finanzmitteleinsatzes<br />
bei größeren Gründungen.<br />
Im Vergleich zu den Vorjahren sind 2009 einerseits mehr Gründungen den Kleingründungen<br />
mit einem Gesamtmitteleinsatz bis 10.000 EUR zuzurechnen (2009: 64,6 % der Gründungen<br />
mit Mittelbedarf, 2008: 62,1 %, 2007: 57,2 %); andererseits ist auch der Anteil der größeren<br />
Gesamtbedarfe i. H. v. über 25.000 EUR von 18,9 % in 2007 über 19,9 % in 2008 auf 23,5 %<br />
in 2009 angewachsen. Im Sinn einer Polarisierung des Gründungsgeschehens in der Wirtschaftskrise<br />
haben mehr Gründer kleine, wenig kapitalintensive und vermutlich häufig aus<br />
einem Notmotiv heraus gestartete Selbstständigkeiten begonnen. Auf der anderen Seite<br />
schlagen mehr größere, auch beschäftigungsintensive Gründungen zu Buche, die die Krise<br />
explizit als Chance genutzt haben (vgl. auch Abschnitte 3.2 und 3.3). In Bezug auf den Finanzmitteleinsatz<br />
allein haben sich die Finanzierungsklassen allerdings kaum verschoben.<br />
74 Die Spalte „Gesamte Mittel“ enthält somit Angaben für die Vereinigungsmenge von Gründern mit<br />
Sachmitteleinsatz und jenen mit finanziellem Mittelbedarf.
Gründungsfinanzierung 67<br />
1 EUR bis 5 TEUR<br />
Über 5 TEUR bis 10 TEUR<br />
Über 10 TEUR bis 25 TEUR<br />
Über 25 TEUR bis 50 TEUR<br />
Über 50 TEUR<br />
2,1<br />
3,5<br />
0,9<br />
2,1<br />
2,5<br />
1,7<br />
Sachmittel Finanzielle Mittel Gesamte Mittel<br />
17,9<br />
22,3<br />
14,1<br />
9,3<br />
10,7<br />
8,1<br />
68,6<br />
61,0<br />
75,2<br />
7,6<br />
8,8<br />
6,6<br />
15,5<br />
20,6<br />
10,6<br />
10,7<br />
10,4<br />
10,9<br />
7,8<br />
11,8<br />
4,0<br />
58,5<br />
48,4<br />
67,9<br />
18,7<br />
22,1<br />
15,7<br />
12,0<br />
16,3<br />
8,3<br />
13,7<br />
17,0<br />
11,0<br />
9,8<br />
13,6<br />
6,5<br />
45,8<br />
31,0<br />
58,5<br />
0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80%<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb 95%-Konfidenzintervall<br />
Die Zahlen neben den Balken geben die Anteile der Gründer der jeweiligen Gründergruppen an allen (n=389, 391, 488) Gründern,<br />
an allen (n=166, 188, 218) Gründern im Vollerwerb bzw. an allen (n=222, 203, 269) Gründern im Nebenerwerb wieder, die<br />
Bedarf an Sachmitteln (jeweils erste Angabe), finanziellen Mitteln (zweite Angabe) bzw. Bedarf an Sachmitteln oder finanziellen<br />
Mitteln (dritte Angabe) hatten und für die vollständige Angaben zum Mittelbedarf vorliegen. Lesehilfe: 31 % der Vollerwerbsgründer,<br />
die Sachmittel oder finanzielle Mittel eingesetzt haben, hatten einen Gesamtmittelbedarf (Summe von Sachmitteln und<br />
finanziellen Mitteln) zwischen einem und 5.000 EUR.<br />
Grafik 12: Höhe des Mittelbedarfs nach Sachmitteln und finanziellen Mitteln, 2009<br />
Unabhängig von der Art der Bedarfsdeckung tritt ein sehr kleiner Mittelbedarf von unter<br />
5.000 EUR bei Vollerwerbsgründern (z. B. 31,0 % im Fall des Gesamtmittelbedarfs) weit seltener<br />
auf als bei Nebenerwerbsgründern (58,5 %), was sich wiederum mit der geringeren<br />
Größe von Nebenerwerbsgründungen erklären lässt. Dementsprechend sind die größeren<br />
Bedarfsklassen unter Vollerwerbsgründern deutlich stärker besetzt als unter Nebenerwerbsgründern.<br />
Für die Gesamtbedarfsklasse oberhalb von 50.000 EUR beispielsweise betragen<br />
die Anteile 13,6 % im Vollerwerb und 6,5 % im Nebenerwerb.<br />
Deckung des finanziellen Mittelbedarfs: eigene Mittel besonders häufig<br />
Der geringe (Finanz-) Mittelbedarf des Großteils der Gründer geht damit einher, dass ein erheblicher<br />
Anteil der Projekte aus eigenen finanziellen Mitteln der Gründer, wie Ersparnissen<br />
und Rücklagen, finanziert wird. Grafik 13 (ergänzt durch Tabelle 14 im Anhang) ist zu entnehmen,<br />
dass im Jahr 2009 rund zwei Drittel (63,2 %) der Gründer mit finanziellem Mittelbedarf<br />
ausschließlich eigene Mittel eingesetzt haben (2008: 65,2 %, 2007: 59,3 %), während<br />
weitere 29,5 % sowohl eigene als auch externe Finanzmittel, wie beispielsweise Bankkredite,<br />
Förderzuschüsse der Bundesagentur für Arbeit (BA) oder Beteiligungskapital, nutzten (2008:
68 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
27,5 %, 2007: 34,1 %). Mit rund 7 % auf geringem Niveau konstant geblieben ist der Anteil<br />
derjenigen, die ihren Finanzierungsbedarf ausschließlich durch den Einsatz externer Mittel<br />
gedeckt haben. Insgesamt hat sich die relative Bedeutung eigener und externer Mittel im vergangenen<br />
Jahr nicht signifikant verändert. Der geringfügige Anstieg der Nutzungshäufigkeit<br />
externer Mittel um 2 Prozentpunkte – bezogen auf alle Gründer setzte im Jahr 2009 jeder<br />
vierte (25,7 %, s. Tabelle 15 im Anhang) externe Finanzierungen ein – mag indes als ein weiteres<br />
Indiz für einen gestiegenen Umfang vieler realisierter Gründungen dienen.<br />
34,3%<br />
7,3%<br />
7,8%<br />
29,5%<br />
Vollerwerb Nebenerwerb<br />
Alle Gründer<br />
57,9%<br />
63,2%<br />
6,8%<br />
25,1%<br />
68,1%<br />
Nur eigene Finanzmittel<br />
Nur externe Finanzmittel<br />
Eigene und externe Finanzmittel<br />
Die Zahlen geben die Anteile der jeweiligen Gründergruppen an allen n=426 Gründern, an allen n=201 Gründern im Vollerwerb<br />
bzw. allen n=224 Gründern im Nebenerwerb mit finanziellem Mittelbedarf wieder, für die vollständige Angaben zur Aufteilung<br />
des finanziellen Mittelbedarfs auf eigene und fremde Mittel verfügbar sind. Lesehilfe: 34,3 % der Vollerwerbsgründer mit finanziellem<br />
Mittelbedarf im Jahr 2009 haben sowohl eigene als auch externe Mittel eingesetzt.<br />
Grafik 13: Einsatz eigener und externer Mittel durch Gründer mit finanziellem Mittelbedarf<br />
2009<br />
Unter Nebenerwerbsgründern war der Anteil der Gründer mit ausschließlicher Nutzung von<br />
eigenen Mitteln (68,1 %) im Jahr 2009 wie in den Vorjahren merklich höher als unter den Vollerwerbsgründern<br />
(57,9 %). 75 Vollerwerbsgründer setzen mithin in wesentlich stärkerem Maß<br />
externe Mittel zur Finanzierung ein. Neben der allgemein geringeren Gründungsgröße im<br />
Nebenerwerb dürfte dieser Unterschied auch darauf zurückzuführen sein, dass Nebener-<br />
75 Statistisch ist dieser Unterschied schwach signifikant.
Gründungsfinanzierung 69<br />
werbsgründer häufig ein weiteres Einkommen erzielen, das zur Finanzierung des Gründungsprojektes<br />
herangezogen werden kann.<br />
Externe Mittel auch zur Finanzierung größerer Losgrößen<br />
Grafik 14 beschreibt die Höhe des Finanzierungsbedarfs von Gründern im Jahr 2009, die<br />
eigene bzw. externe finanzielle Mittel eingesetzt haben. Im Einklang mit den Ergebnissen<br />
aus Grafik 12 zum Mittelbedarf allgemein nimmt der Großteil der Gründer nur geringe Finanzierungsmittel<br />
bis 5.000 EUR in Anspruch. Besonders stark besetzt ist die so definierte<br />
Gruppe der Kleinstfinanzierungen beim Einsatz eigener Mittel (63,4 %), während beim Einsatz<br />
externer Mittel der entsprechende Anteil unterhalb der Hälfte (44,8 %) liegt. In größeren<br />
Finanzierungsklassen dreht sich dieses Verhältnis um (eigene Mittel: 3 %; externe Mittel:<br />
9,9 % in der Klasse oberhalb von 50.000 EUR), sodass erwartungsgemäß eine relativ große<br />
Bedeutung der externen Finanzierung bei umfangreicheren Gründungsprojekten zu konstatieren<br />
ist.<br />
1 EUR bis 5 TEUR<br />
Über 5 TEUR bis 10 TEUR<br />
Über 10 TEUR bis 25 TEUR<br />
Über 25 TEUR bis 50 TEUR<br />
Über 50 TEUR<br />
4,4<br />
6,7<br />
2,4<br />
3,0<br />
5,5<br />
0,7<br />
12,8<br />
12,4<br />
13,2<br />
Eigene Mittel Externe Mittel<br />
16,4<br />
20,8<br />
12,3<br />
63,4<br />
54,7<br />
71,5<br />
11,4<br />
13,8<br />
8,5<br />
15,0<br />
9,2<br />
9,9<br />
12,5<br />
6,7<br />
18,9<br />
17,6<br />
20,5<br />
22,2<br />
44,8<br />
47,0<br />
42,0<br />
0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80%<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb 95%-Konfidenzintervall<br />
Die Zahlen neben den Balken geben die Anteile der Gründer der jeweiligen Gründergruppen an allen (n=394, 136) Gründern,<br />
an allen (n=186, 83) Gründern im Vollerwerb bzw. an allen (n=207, 53) Gründern im Nebenerwerb wieder, die Bedarf an eigenen<br />
(jeweils erste Angaben) bzw. an externen finanziellen Mitteln (zweite Angaben) hatten und für die vollständige Angaben zur<br />
Höhe des Finanzmittelbedarfs vorliegen. Lesehilfe: 9,2 % aller Vollerwerbsgründer mit externem Mittelbedarf hatten einen Bedarf<br />
von über 25.000 bis 50.000 EUR.<br />
Grafik 14: Höhe des Finanzmittelbedarfs bei Nutzung eigener bzw. externer Finanzmittel<br />
durch Gründer mit Finanzmittelbedarf 2009<br />
Insgesamt lag im Jahr 2009 ein Viertel (24,9 %) aller externen Gründungsfinanzierungen oberhalb<br />
der Mikrofinanzierungsgrenze von 25.000 EUR. Bezogen auf alle Gründer entspricht
70 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
dies einem Anteil von 6,5 %, während – ebenfalls bezogen auf alle Gründer – 19,3 % in den<br />
externen Mikrofinanzierungsbereich fallen. 76 Über die Jahre hinweg sind leichte Verschiebungen<br />
zwischen den Größenklassen zu verzeichnen. So ist insbesondere im Vergleich zu 2007,<br />
dem Jahr vor Beginn der Wirtschaftskrise, sowohl der Anteil der Kleinstfinanzierungen bis<br />
5.000 EUR gestiegen (bei eigenen Mitteln um 4,5 Prozentpunkte, bei externen Mitteln um<br />
1,3 Prozentpunkte), als auch der Anteil der größeren externen Finanzierungen oberhalb von<br />
25.000 EUR (um 4,1 Prozentpunkte). 77 Auch dieses Resultat deutet, wenngleich sich die Verschiebungen<br />
i. d. R. als statistisch nicht signifikant erweisen, auf die Polarisierung des Gründungsgeschehens<br />
in der Wirtschaftskrise hin: Auf der einen Seite vermehrt kleinere Projekte,<br />
die vergleichsweise häufig angesichts verschlechterter Jobaussichten, Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit<br />
gestartet wurden; auf der anderen Seite vermehrt chancenmotivierte, größer<br />
dimensionierte Gründungen. So sind nicht zuletzt für die größere Zahl von Übernahmegründungen<br />
(vgl. Abschnitt 3.2) vergleichsweise hohe Finanzierungssummen notwendig.<br />
Im Vergleich von Vollerwerbs- und Nebenerwerbsgründern zeigt sich in Grafik 14 wiederum<br />
analog zu Grafik 12, dass Nebenerwerbsgründer sowohl bei den eigenen als auch bei den<br />
externen Mitteln eher Kleinstprojekte bis 5.000 EUR und entsprechend seltener größere Projekte<br />
finanzieren. In den einzelnen Größenklassen erweisen sich die beobachteten Unterschiede<br />
auch angesichts der geringen Fallzahlen jedoch häufig als insignifikant.<br />
Externe Finanzierungsquellen: herausragende Rolle von Bankdarlehen und Förderkrediten<br />
Dem Einsatz bedarfsgerechter Finanzierungsinstrumente kommt eine zentrale Bedeutung für<br />
die erfolgreiche Umsetzung einer Gründungsidee zu. 78 Dementsprechend unterscheidet<br />
Grafik 15 verschiedene Finanzierungsquellen zur Deckung des externen Finanzierungsbe-<br />
76 Anteil aller Gründer mit Finanzierungsbedarf (15,1 % + 54,8 %) x bedingter Anteil Gründer mit externem<br />
Finanzmitteleinsatz (7,3 % + 29,5 %) x bedingter Anteil externe Finanzierungen oberhalb von<br />
25.000 EUR (15,0 % + 9,9 %) = 6,5 %. Analog berechnet sich der Anteil der Gründer mit externen<br />
Finanzierungen im Mikrofinanzierungsbereich: Anteil aller Gründer mit Finanzierungsbedarf (15,1 % +<br />
54,8 %) x bedingter Anteil Gründer mit externem Finanzmitteleinsatz (7,3 % + 29,5 %) x bedingter<br />
Anteil externe Finanzierungen bis 25.000 EUR (44,8 % + 11,4 % + 18,9 %) = 19,3 %.<br />
77<br />
Bei den eigenen Mitteln liegt der Anteil der Finanzierungen oberhalb von 25.000 EUR hingegen<br />
sowohl im Jahr 2007 als auch im Jahr 2009 bei 7,4 %.<br />
78<br />
Vgl. die Übersichtsartikel von Berger und Udell (2003) und Gompers und Lerner (2003) sowie<br />
Nathusius (2001) und Kohn und Spengler (2008a).
Gründungsfinanzierung 71<br />
darfs von Gründern nach der Häufigkeit ihrer Inanspruchnahme (linke Spalte) und ihrem Volumenanteil<br />
(rechte Spalte). 79<br />
Bankdarlehen (ohne Kontokorrent)<br />
Kontokorrentkredit<br />
Förderkredit von <strong>KfW</strong> oder<br />
Förderinstituten der Länder<br />
Darlehen und geschenktes Geld<br />
von Verwandten, Freunden etc.<br />
Zuschuss der Bundesagentur für Arbeit<br />
Sonstiges (z. B. Beteiligungskapital)<br />
Häufigkeitsanteil Volumenanteil<br />
21,1<br />
29,2<br />
21,0<br />
20,8<br />
21,1<br />
20,5<br />
21,6<br />
18,8<br />
25,2<br />
19,3<br />
14,2<br />
25,8<br />
34,3<br />
39,7<br />
50,8<br />
53,8<br />
46,9<br />
51,1<br />
10,2<br />
7,1<br />
13,3<br />
4,6<br />
6,2<br />
3,0<br />
7,9<br />
8,3<br />
7,5<br />
13,7<br />
13,5<br />
14,0<br />
18,0<br />
11,6<br />
0% 30% 60% 0% 30% 60%<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb 95%-Konfidenzintervall<br />
Die Kategorie ‚Kontokorrentkredit’ umfasst die Inanspruchnahme von Dispositions- oder Überziehungskrediten auf Girokonten<br />
sowie die Ausnutzung des Kreditrahmens von Kreditkarten. Die Zahlen neben den Balken der linken Teilgrafik geben die Anteile<br />
der Gründer der jeweiligen Gründergruppen an allen n=129 Gründern, an allen n=81 Gründern im Vollerwerb bzw. an allen<br />
n=48 Gründern im Nebenerwerb wieder, die Bedarf an externen finanziellen Mitteln hatten und für die vollständige Angaben zur<br />
Mittelaufteilung vorliegen (Mehrfachnennungen möglich). Lesehilfe: 50,8 % aller Gründer mit Nutzung externer finanzieller Mittel<br />
haben Bankdarlehen (ohne Kontokorrentkredite) in Anspruch genommen. Die Zahlen neben den Balken der rechten Teilgrafik<br />
geben auf der Basis der vorgenannten Gründerzahlen die Anteile der Finanzierungsvolumina der jeweiligen Finanzierungsquellen<br />
am Volumen der gesamten externen Finanzierung an. Zur Vermeidung des Einflusses von Ausreißern erfolgt die Auswertung<br />
auf Basis der 95 % der Gründer mit den niedrigsten externen Finanzierungsbedarfen (95%-Perzentil). Lesehilfe: Der Anteil<br />
von Bankdarlehen (ohne Kontokorrentkredite) am gesamten externen Finanzierungsvolumen aller Gründer, die externe finanzielle<br />
Mittel genutzt haben, betrug 45,6 %.<br />
Grafik 15: Externe Finanzierungsquellen nach Häufigkeit und Volumen der Inanspruchnahme,<br />
2009<br />
Im Jahr 2009 nahm jeder zweite Gründer mit externem Finanzierungsbedarf längerfristige<br />
Bankdarlehen (50,8 %) in Anspruch. 80 Am zweithäufigsten kamen Kontokorrentfinanzierungen<br />
(34,3 %) und Förderkredite von Seiten der <strong>KfW</strong> und der Förderinstitute der Länder<br />
(29,2 %) zum Einsatz. Damit griff ein Großteil der Gründer für den Schritt in die Selbstständigkeit<br />
auf Varianten der Kreditfinanzierung zurück, wobei die Verbreitung der Kontokorrentfinanzierung<br />
deren leichte Verfügbarkeit widerspiegeln dürfte, zumal diese Finanzierungs-<br />
79<br />
Bei der Beantwortung der Frage nach Nutzung der unterschiedlichen Finanzierungsformen waren<br />
Mehrfachnennungen möglich, sodass sich die Häufigkeitsangaben – im Gegensatz zu den Volumenanteilen<br />
– über die Alternativen nicht zu 100 % addieren.<br />
80<br />
Bezogen auf alle Gründer entspricht dies einem Anteil von 13,1 % (vgl. Tabelle 15 im Anhang).<br />
24,4<br />
45,6<br />
37,9<br />
53,4
72 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
form im Vergleich zu Alternativen wie Förderkrediten in der Regel teurer ist. Informelles Kapital<br />
von Freunden und Verwandten (20,8 %) und Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit<br />
(21,6 %) wurden jeweils von rund einem Fünftel der Gründer mit externem Finanzierungsbedarf<br />
genutzt. Die Kategorie „sonstige Finanzierungsquellen“ schließlich u. a. Beteiligungskapital<br />
(inkl. Kapital von Business Angels), Mezzanine-Finanzierungen oder Gesellschafterdarlehen.<br />
Sie schlägt mit einem entsprechenden Häufigkeitsanteil von insgesamt 19,3 % zu<br />
Buche.<br />
Verglichen mit Vollerwerbsgründern haben Nebenerwerbsgründer tendenziell häufiger auf<br />
Kontokorrentfinanzierungen (Häufigkeitsanteile 51,1 % versus 21,1 %), Förderkredite<br />
(39,7 % versus 21 %) und die sonstigen Finanzierungsformen (25,8 % versus 14,2 %) zurückgegriffen,<br />
jedoch seltener längerfristige Bankdarlehen (46,9 % versus 53,8 %) genutzt.<br />
Gründer im Nebenerwerb profitieren jedoch in ähnlichem Maße wie Gründer im Vollerwerb<br />
von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit (BA). Dieses Ergebnis ist insofern bemerkenswert,<br />
als die Programme der BA zur Existenzgründungsförderung dezidiert auf Gründungen<br />
im „Hauptberuf“ ausgerichtet sind. 81 Der Begriff des Hauptberufs in der Nomenklatur<br />
der BA ist jedoch nicht unbedingt deckungsgleich mit der Vollerwerbs-Einschätzung seitens<br />
der Gründer im <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>. 82<br />
Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Anteile der Gründer, die zur Deckung ihres externen<br />
Finanzierungsbedarfs Kreditfinanzierungen eingesetzt haben, im Krisenjahr 2009 deutlich<br />
angestiegen (längerfristige Bankdarlehen im Vergleich zu 2008 um 16 Prozentpunkte, Kontokorrentfinanzierungen<br />
um 19 Prozentpunkte, Förderkredite um 11 Prozentpunkte; vgl. Tabelle<br />
14 im Anhang). 83 Dieses Ergebnis erstaunt nur auf den ersten Blick. Offenbar konnten neben<br />
der Mehrheit der Gründer, deren Geschäftsidee überhaupt nicht von der Krise beeinträchtigt<br />
wurde (vgl. Abschnitt 3.1), insbesondere diejenigen Gründer, die die Krise ausdrücklich zur<br />
Gründung genutzt haben, Banken von ihrem Geschäftsmodell überzeugen, die daraufhin<br />
Kredite beispielsweise für Übernahmen von gesunden Unternehmen, für Ausrüstungsinvestitionen<br />
oder zur Vorfinanzierung von Löhnen und Gehältern angesichts der gestiegenen Be-<br />
81<br />
Dies gilt sowohl für das Einstiegsgeld, welches Empfänger von Arbeitslosengeld II beim Schritt in<br />
die Selbstständigkeit unterstützt, als auch für den Gründungszuschuss, der Arbeitslose mit Anspruch<br />
auf Arbeitslosengeld I bei Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit fördert (Bundesagentur für Arbeit,<br />
2007).<br />
82<br />
Vgl. die Diskussion in Kohn et al. (2010).<br />
83 Bei den Anteilswertvergleichen ist die erhebliche statistische Unsicherheit bei der Erfassung der<br />
Finanzierungsquellen zu berücksichtigen, die daraus resultiert, dass für die einzelnen Finanzierungsquellen<br />
nur vergleichsweise geringe Beobachtungszahlen vorliegen. Umso bemerkenswerter ist das<br />
Ergebnis, dass die drei genannten Anstiege statistisch zumindest schwach signifikant sind.
Gründungsfinanzierung 73<br />
schäftigungsintensität der Gründungen ausgereicht haben. Zur intensiveren Nutzung von<br />
Förderkrediten dürfte neben der gestiegenen Attraktivität von Förderprogrammen mit Haftungsfreistellung<br />
für die durchleitenden Hausbanken auch die Tatsache beigetragen haben,<br />
dass der Bekanntheitsgrad der Förderbanken im Zuge der Kampagnen zur Bekämpfung der<br />
Finanz- und Wirtschaftskrise angestiegen ist, sodass mehr Gründer überhaupt auf die Förderangebote<br />
aufmerksam wurden.<br />
Bankdarlehen und Förderkredite mit gestiegenen Volumenanteilen<br />
Während die betrachteten Häufigkeiten Aufschluss über die Verbreitung der Inanspruchnahme<br />
der Quellen geben, lässt ein Vergleich der entsprechenden Volumenanteile in der<br />
rechten Spalte von Grafik 15 weiter gehende Rückschlüsse hinsichtlich der Bedeutung der<br />
unterschiedlichen Quellen externer Gründungsfinanzierungen zu. In Gegenüberstellung von<br />
Volumen- und Häufigkeitsanteilen erschließen sich Informationen zu durchschnittlichen Finanzierungsgrößen.<br />
Es zeigt sich, dass im Jahr 2009 mit einem Volumenanteil von nahezu<br />
der Hälfte (45,6 %) Bankdarlehen eine dominierende Rolle einnehmen. Über längerfristige<br />
Bankdarlehen werden somit überproportional große Gründungsprojekte finanziert. Dies äußert<br />
sich auch darin, dass Vollerwerbsgründer (53,4 %) einen deutlich höheren Anteil ihres<br />
externen Finanzierungsvolumens als Nebenerwerbsgründer (37,9 %) durch längerfristige<br />
Bankdarlehen decken. Weitere substanzielle Anteile im Finanzierungsmix kommen Darlehen<br />
und Geschenken von Freunden und Verwandten (18 %), Förderkrediten von der <strong>KfW</strong> und<br />
Landesförderinstituten (13,7 %) und Kontokorrentfinanzierungen (10,2 %) zu. In der Volumenbetrachtung<br />
insgesamt nur einen kleineren Finanzierungsbeitrag leisten die BA-<br />
Zuschüsse (4,6 % der gesamten externen Finanzierung). Hier manifestiert sich in dem mit<br />
6,2 % höheren Anteil für Vollerwerbsgründer (Nebenerwerb: 3 %) die Tatsache, dass Personen<br />
mit einem höheren Anspruch auf Zuschuss (Gründungszuschuss im Gegensatz zum<br />
Einstiegsgeld) ihre Selbstständigkeit eher als haupterwerbliche Vollzeitbeschäftigung ausüben<br />
und diese Mittel für das Gründungsprojekt verwenden können. 84<br />
Auch in Bezug auf das externe Finanzierungsvolumen zeigt sich das bereits bei den Nutzungshäufigkeiten<br />
beobachtete Bild, dass die Bedeutung der Kreditfinanzierung im Vergleich<br />
zu den Vorjahren am aktuellen Rand zugenommen hat. So liegen die Volumenanteile der<br />
84 Auch bei der Einordnung dieses Ergebnisses ist die erhebliche statistische Unsicherheit bei der<br />
Erfassung der selten genutzten Finanzierungsformen zu berücksichtigen. So erweisen sich die Unterschiede<br />
zwischen Vollerwerbs- und Nebenerwerbsgründern auch als statistisch nicht signifikant. Im<br />
Großen und Ganzen stehen die Ergebnisse zur Bedeutung der unterschiedlichen Finanzierungsquellen<br />
jedoch im Einklang mit verwandten Resultaten in der Literatur (vgl. z. B. Brüderl et al., 1993, oder<br />
Gottschalk et al., 2008).
74 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
längerfristigen Bankdarlehen, der Kontokorrentfinanzierungen und der Förderkredite im Jahr<br />
2009 um 4,9, 7,8 bzw. 0,8 Prozentpunkte oberhalb der Werte von 2008. 85 Gesunken ist hingegen<br />
vor allem die relative Bedeutung informellen Kapitals von Freunden und Verwandten<br />
(um 7,1 Prozentpunkte).<br />
Zwischenfazit zur Finanzierungsstruktur von Gründungen<br />
Zusammengefasst ist die Finanzierung des breiten Gründungsgeschehens in Deutschland<br />
strukturell charakterisiert durch eine erhebliche Zahl von Gründungen ohne nennenswerten<br />
Mittelbedarf oder mit intensiver Nutzung von Sachmitteln sowie einem Gesamtmittelbedarf,<br />
der häufig im Mikrobereich liegt. Gründer greifen vielfach auf eigene finanzielle Ressourcen<br />
zurück und bestreiten damit einen großen Teil ihres finanziellen Mittelbedarfs. Im Zuge externer<br />
Finanzierung, die vor allem für größere Gründungen sehr wichtig ist, werden nach<br />
Möglichkeit informelles Kapital und Zuschüsse in Anspruch genommen, es überwiegen jedoch<br />
bei Weitem Bankdarlehen und Förderkredite.<br />
Im Vergleich zu den Vorjahren wiesen im Jahr 2009 mehr Gründer überhaupt finanziellen<br />
Mittelbedarf auf. In Bezug auf den Gesamtmittelbedarf sowie die Höhe des externen Finanzierungsbedarfs<br />
ist eine Polarisierung der Gründungslandschaft zu konstatieren: Wurden auf<br />
der einen Seite vermehrt Kleingründungen realisiert, so ist auf der anderen Seite der Anteil<br />
größerer Finanzierungen jenseits des Mikrofinanzbereichs angewachsen. Zusammen mit<br />
dem Resultat, dass sowohl die Häufigkeit des Einsatzes als auch die volumenmäßige Bedeutung<br />
von Bankdarlehen und Förderkrediten gestiegen ist, untermauert dies die Einschätzung,<br />
dass die Wirtschaftskrise nicht nur Personen mit Kleinstgründungen in die Selbstständigkeit<br />
gedrängt hat, sondern auch explizit Chancen für umfangreichere Geschäftsideen eröffnet hat.<br />
5.2 Finanzierungsschwierigkeiten<br />
Aus finanzierungstheoretischer Sicht sind Gründungen und junge Unternehmen eher von<br />
Finanzierungsengpässen betroffen als bestehende ältere und größere Unternehmen. 86 Dies<br />
ist zum einen auf die kleineren Losgrößen in der Gründungsfinanzierung zurückzuführen, die<br />
in Anbetracht von Fixkosten bei der Finanzierung (bspw. für eine Kreditprüfung) ein schlechteres<br />
Kosten-Ertragverhältnis für mögliche Kapitalgeber und in der Folge höhere Finanzierungskosten<br />
nach sich ziehen. Zum anderen ist bei Gründungen das Problem asymmetrischer<br />
Informationsverteilung zwischen Kapitalgeber und -nehmer ausgeprägter als bei Be-<br />
85 Statistisch signifikant ist nur der Anstieg der Kontokorrentfinanzierungen.<br />
86 Vgl. Kohn und Mark (2009) und die dort zitierte Literatur.
Gründungsfinanzierung 75<br />
standsunternehmen. So fällt es Gründern angesichts des inhärenten Neuigkeitsgehalts ihres<br />
Projekts (insbesondere bei innovativen Gründungen) und einer fehlenden Unternehmenshistorie<br />
schwerer, potenzielle Kapitalgeber von der Profitabilität eines Finanzierungsengagements<br />
zu überzeugen und Sicherheiten bereitzustellen.<br />
In der aktuellen Befragungswelle wurden wie im Vorjahr alle Gründer dazu befragt, ob sie im<br />
Zusammenhang mit ihrer Gründung auf Schwierigkeiten bei der Finanzierung gestoßen sind<br />
und – sofern zutreffend – welcher Art diese Schwierigkeiten waren. 87<br />
Ausmaß und Entwicklung von Finanzierungsschwierigkeiten<br />
Grafik 16 ist zu entnehmen, dass mit 89,8 % der überwiegende Anteil der Befragten keine<br />
Schwierigkeiten mit der Finanzierung der Gründung hatte. In diese Gruppe fallen sowohl diejenigen<br />
Gründer, deren Projekt von vornherein keiner Finanzierung bedurfte, als auch der<br />
größere Teil derjenigen, die problemlos mit eigenen Ersparnissen operieren konnten oder<br />
deren Zusammentreffen mit externen Kapitalgebern erfolgreich und problemlos war. Jeder<br />
zehnte Gründer (10,2 %) hatte jedoch mit Finanzierungsschwierigkeiten zu kämpfen. Dabei<br />
sind Vollerwerbsgründer (13,9 % mit Schwierigkeiten) angesichts ihrer i. d. R. größeren Projekte<br />
signifikant stärker betroffen als Nebenerwerbsgründer (7,1 %).<br />
Auf den ersten Blick bemerkenswert ist der mit gut 6 Prozentpunkten erhebliche, auch statistisch<br />
signifikante Rückgang der Finanzierungsschwierigkeiten im Vergleich zum Vorjahr 2008,<br />
von dem sowohl Vollerwerbs- als Nebenerwerbsgründer profitierten. Zur Erklärung dieses<br />
Befundes lassen sich verschiedene Argumente ins Feld führen. Erstens gibt rund die Hälfte<br />
aller Gründer (44,4 %, vgl. Grafik 3 in Abschnitt 3.1) an, von der Krise gar nicht betroffen zu<br />
sein, und jedem sechsten (17,2 %) hat die Krise sogar explizit eine Chance zur Gründung<br />
eröffnet. Bei diesen Gründungen, deren Konzept „in die Zeit passt“, sollten tendenziell weniger<br />
Schwierigkeiten zu erwarten sein. Mutmaßlich waren unter den Gründern, die sich im<br />
schwierigen Umfeld der Wirtschaftskrise zum Schritt in die Selbstständigkeit durchgerungen<br />
und ihr Projekt verwirklicht haben, vergleichsweise viele gut vorbereitet und hatten daher<br />
bessere Chancen, potenzielle Kapitalgeber zu überzeugen, als Gründer mit weniger überlegten<br />
Projekten in besseren Zeiten. Für diese Einschätzung sprechen auch weiter gehende<br />
Auswertungen des <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>s, nach denen der Anteil derjenigen Gründer, die<br />
87 Frühere Befragungswellen des <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>s bis einschließlich 2007 beschränkten sich<br />
auf Schwierigkeiten bei der externen Finanzierung und es wurden nur diejenigen Gründer nach ihren<br />
Schwierigkeiten befragt, die überhaupt Finanzmittel eingesetzt hatten (vgl. Spengler und Tilleßen,<br />
2006, und Kohn und Spengler, 2008b).
76 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
angeben keine Informationsquellen vor dem Schritt in die Selbstständigkeit genutzt zu haben,<br />
von 12,6 % im Jahr 2008 auf 9,5 % im Jahr 2009 gesunken ist.<br />
25%<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
16,6<br />
10,2<br />
20,2<br />
13,9<br />
13,1<br />
7,1<br />
2008 2009 2008 2009 2008 2009<br />
Alle Gründer<br />
Vollerwerb<br />
Nebenerwerb<br />
95%-Konfidenzintervall<br />
Die Zahlen über den Balken geben die Anteile der Gründer mit Finanzierungsschwierigkeiten innerhalb der jeweiligen Gründergruppen<br />
wieder. Den Gründergruppen liegen die folgenden Stichprobengrößen zu Grunde (alle Gründer, Vollerwerb, Nebenerwerb):<br />
n=653, 284, 366 (2008), 672, 298, 370 (2009). Lesehilfe: Der Anteil der Vollerwerbsgründer im Jahr 2009 mit Finanzierungsschwierigkeiten<br />
beträgt 13,9 %.<br />
Grafik 16: Finanzierungsschwierigkeiten von Gründern<br />
Zweitens dürften Gründer angesichts der anhaltenden öffentlichen Diskussion um die Wirtschafts-<br />
und Finanzmarktkrise von vornherein skeptischer in Bezug auf die Finanzierbarkeit<br />
ihres Vorhabens gewesen sein. Gab es in der tatsächlichen Umsetzung dann weniger Probleme<br />
als erwartet, beantworteten die Gründer die Frage nach den Schwierigkeiten häufiger<br />
verneinend. Drittens war im Krisenjahr 2009 ein massiver Rückgang der Investitionskreditnachfrage<br />
zu verzeichnen (Schoenwald 2010). 88 Angesichts der eingebrochenen Nachfrage<br />
von Seiten etablierter Unternehmen mögen Banken im Vergleich zum Vorjahr verstärkt auf<br />
die Finanzierung von Gründern und jungen Unternehmen gesetzt haben.<br />
Schließlich fragen die allermeisten Gründer insgesamt vergleichsweise kleine Finanzierungsvolumina<br />
nach (Abschnitt 5.1). Sofern mit einem kleineren Finanzierungsvolumen im Durchschnitt<br />
ein geringeres Risiko der Projekte einhergeht oder die Finanzierung mehrerer kleiner<br />
88<br />
Gemäß Statistischem Bundesamt (2010g) gingen die Ausrüstungsinvestitionen 2009 im Vergleich<br />
zum Vorjahr um 20,5 % zurück.
Gründungsfinanzierung 77<br />
Projekte zu Diversifizierungsvorteilen bei den Kapitalgebern führt, ist das Gros der Gründer<br />
von angespannten Eigenkapitaldecken der Banken in der Krise vermutlich nicht so stark betroffen<br />
wie beispielsweise Bestandsunternehmen mit größeren Finanzierungsbedarfen. 89<br />
Gründer mit innovativen und technologieorientierten Projekten, die aufgrund einer erforderlichen<br />
Mindestgröße ihres Gründungsprojekts auf größere Finanzierungslosgrößen angewiesen<br />
sind und deren Erfolgschancen naturgemäß besonders schwer einzuschätzen sind, dürften<br />
sich hingegen in höherem Maße Finanzierungsschwierigkeiten gegenübersehen.<br />
Finanzierungsschwierigkeiten nach Nutzung der Finanzierungsformen<br />
Grafik 17 vergleicht das Ausmaß von Finanzierungsschwierigkeiten in ausgewählten Gründergruppen,<br />
die unterschiedliche Finanzierungsformen genutzt haben. Im Jahr 2009 haben<br />
nur wenige Gründer Finanzierungsschwierigkeiten erfahren und daraufhin auf eine Finanzierung<br />
ganz verzichtet: 4 % der Gründer, die letztlich keine Finanzmittel eingesetzt haben, berichten<br />
von Schwierigkeiten. Die allermeisten dieser Gründer haben also erst gar keine Finanzierung<br />
nachgefragt. Ähnliches gilt für diejenigen Gründer, die ausschließlich eigene Mittel<br />
eingesetzt haben (6,5 % mit Schwierigkeiten). Gründer mit externem Finanzierungseinsatz<br />
hatten dementsprechend überdurchschnittlich häufig mit Schwierigkeiten zu kämpfen (23 %).<br />
Nebenerwerbsgründer berichten im Vergleich zu den Vollerwerbsgründern in allen aufgeführten<br />
Finanzierungsklassen tendenziell seltener von Finanzierungsschwierigkeiten; und auch<br />
vom Rückgang der Schwierigkeiten vom Jahr 2008 auf 2009 profitierten alle Klassen in gleichem<br />
Ausmaß.<br />
89 Neben den aufgeführten Erklärungsansätzen sind zwei weitere Punkte denkbar. Erstens könnten<br />
die Beobachtungen für das Jahr 2008 einen Datenausreißer mit extrem häufigen Finanzierungsschwierigkeiten<br />
darstellen. Während dies vor dem Hintergrund der Unsicherheiten der sich im Lauf<br />
des Jahres 2008 abzeichnenden Krise prinzipiell vorstellbar wäre, lassen – wenngleich eingeschränkte<br />
– Vergleiche zu den Jahren vor 2008 diesen Schluss nicht zu. So lag der Anteil derer mit Finanzierungsschwierigkeiten<br />
unter denjenigen Gründern, die externe Mittel eingesetzt haben, mit 30,4 % im Jahr<br />
2008 genauso hoch wie der Anteil der Gründer mit externem Finanzmitteleinsatz, die im Jahr 2005 angaben,<br />
Schwierigkeiten bei der Akquisition externer Mittel gehabt zu haben (30,6 %), und unterschritt den<br />
entsprechenden Anteil von 37,9 % für das Jahr 2007 (s. Spengler und Tilleßen, 2006, und Kohn und<br />
Spengler, 2008b, 2009).<br />
Zweitens könnten die geringeren Finanzierungsschwierigkeiten allein auf systematische Verschiebungen<br />
in der Zusammensetzung des Gründungsgeschehens zurückzuführen sein. Dieser Möglichkeit<br />
gehen wir im Rahmen einer multivariaten Analyse zu den Bestimmungsfaktoren der Finanzierungsschwierigkeiten<br />
weiter unten nach; eine entsprechende Hypothese bestätigt sich dort nicht.
78 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Schwierigkeiten bei der Finanzierung<br />
hatten unter den Gründern …<br />
insgesamt<br />
ohne Einsatz finanzieller Mittel<br />
die nur eigene finanzielle Mittel einsetzen<br />
die externe finanzielle Mittel einsetzen<br />
die Bankfinanzierung<br />
o.ä.* finanzielle Mittel einsetzen<br />
mit externem Finanzmitteleinsatz<br />
bis 25 TEUR<br />
mit externem Finanzmitteleinsatz<br />
> 25 TEUR<br />
16,6<br />
20,2<br />
13,1<br />
10,0<br />
11,9<br />
7,7<br />
13,6<br />
17,4<br />
10,5<br />
3,5<br />
2008 2009<br />
32,2<br />
35,2<br />
27,7<br />
36,2<br />
43,1<br />
30,5<br />
33,4<br />
30,1<br />
37,0<br />
28,9<br />
49,9<br />
10,2<br />
13,9<br />
7,1<br />
4,0<br />
8,1<br />
1,8<br />
6,5<br />
8,4<br />
5,0<br />
6,7<br />
23,0<br />
26,5<br />
18,7<br />
22,3<br />
25,1<br />
19,1<br />
24,6<br />
25,4<br />
23,6<br />
18,1<br />
30,5<br />
0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80%<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb 95%-Konfidenzintervall<br />
Die Zahlen neben den Balken geben die Anteile der Gründer mit Finanzierungsschwierigkeiten innerhalb der jeweiligen Gründergruppen<br />
wieder. Den Gründergruppen liegen die folgenden Stichprobengrößen zu Grunde (alle Gründer, Vollerwerb, Nebenerwerb<br />
2008 / 2009): n=653, 284, 366 / 672, 298, 370 (Gründer insgesamt), n=203, 66, 136 / 183, 59, 122 (Gründer ohne<br />
Einsatz finanzieller Mittel), n=282, 125, 156 / 287, 116, 170 (Gründer, die nur eigene finanzielle Mittel eingesetzt haben), n=130,<br />
74, 55 / 136, 83, 53 (Gründer, die (auch) externe finanzielle Mittel eingesetzt haben), n=83, 42, 41 / 105, 61, 44 (Gründer, die<br />
(auch) Bankfinanzierung o. ä. externe finanzielle Mittel eingesetzt haben; * hierunter fallen Bankdarlehen, Kontokorrentfinanzierungen,<br />
Förderkredite und die Kategorie „sonstige Quellen“, die bspw. Beteiligungskapital umfasst; vgl. Grafik 15), n=96, 55,<br />
40 / 101, 64, 37 (Gründer mit externem Finanzmitteleinsatz von maximal 25.000 EUR), n=34, 19, 15 / 35, 19, 16 (Gründer mit<br />
externem Finanzmitteleinsatz von über 25.000 EUR). Lesehilfe: Der Anteil der Vollerwerbsgründer im Jahr 2009 mit externem<br />
Finanzmittelbedarf bis zu 25.000 EUR, der Finanzierungsschwierigkeiten angab, beträgt 25,4 %.<br />
Grafik 17: Finanzierungsschwierigkeiten nach Finanzierungseinsatz, Anteile in Prozent<br />
Innerhalb der Gruppe von Gründern mit externem Finanzierungsbedarf zeigen sich keine<br />
Unterschiede nach Art des Finanzierungseinsatzes (formelles Kapital wie Bankdarlehen, Förderkredite<br />
oder Beteiligungskapital versus ausschließlich informelles Kapital oder BA-<br />
Zuschüsse). Vor dem Hintergrund der ungünstigen Kosten-Ertragsrelation kleiner Finanzierungslosgrößen<br />
sehen sich Gründer mit externen Mikrofinanzierungen bis 25.000 EUR tendenziell<br />
häufiger Finanzierungsschwierigkeiten gegenüber als Gründer mit Finanzierungsvolumina<br />
jenseits des Mikrobereichs (in 2009: 24,6 % versus 18,1 %). 90 Vollerwerbsgründer mit<br />
hohem externem Finanzierungsbedarf sind Schwierigkeiten am stärksten ausgesetzt<br />
(30,5 %). Bei der Einordnung dieses Resultats ist aufgrund des geringen Anteils der Gründer<br />
mit großem Finanzierungsbedarf und der daraus resultierenden statistischen Unsicherheit<br />
90 Aufgrund des hohen Detaillierungsgrades der Auswertung sind die Gruppenvergleiche in Grafik 17<br />
mit einer erheblichen statistischen Unsicherheit belastet. So erweist sich zwar der Unterschied zwischen<br />
Gründern mit Nutzung externer Mittel und denjenigen ohne als statistisch signifikant. Die Differenzen<br />
innerhalb der Nutzer externer Finanzierungen liegen jedoch alle im Unsicherheitsbereich.
Gründungsfinanzierung 79<br />
Vorsicht geboten. Als solches ist das Ergebnis jedoch als bedenklich zu beurteilen, da gerade<br />
von größeren, häufig technologieorientierten Gründungen – die einen größeren Finanzierungsbedarf<br />
aufweisen – positive Effekte im Hinblick auf Innovationskraft, Wachstum und<br />
Beschäftigung zu erwarten sind.<br />
Welcher Art sind die Finanzierungsschwierigkeiten?<br />
Grafik 18 unterscheidet verschiedene Arten von Finanzierungsschwierigkeiten und weist die<br />
bedingten Anteile derjenigen Gründer mit Schwierigkeiten aus, die sich den jeweiligen Problemen<br />
gegenübersahen. 91 Mit 54,3 % am häufigsten genannt wurden nicht hinreichende Eigenmittel.<br />
Bezogen auf alle Gründer war dies für jeden zwanzigsten (5,4 %) ein Problem. 92<br />
Unzureichende Eigenmittel schränken im Gründungszusammenhang nicht nur selbstfinanzierte<br />
Investitionen ein, sondern können dadurch, dass weniger Sicherheiten gestellt werden<br />
können, auch als Hemmnis bei der Kreditfinanzierung wirken.<br />
In der Häufigkeit des Auftretens folgen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Akquisition<br />
von Bankkrediten. So waren angefragte Bankkredite teils gar nicht (29 %), teils nicht im<br />
gewünschten Umfang (17,2 %) oder nur zu schlechteren Konditionen, also beispielsweise nur<br />
mit Risikoaufschlägen auf den Kreditzinssatz (18,6 %) zu erhalten. Damit haben bezogen auf<br />
alle Gründer geschätzte 3 % einen gewünschten Bankkredit nicht bekommen. 93 Die Antwortkategorie<br />
schließt grundsätzlich nicht aus, dass betroffene Gründer für einen anderen angefragten<br />
Bankkredit eine Zusage bekommen haben. In Anbetracht der Tatsache, dass überhaupt<br />
nur 13,1 % aller Gründer Bankdarlehen (ohne Kontokorrentfinanzierungen) genutzt<br />
haben (vgl. Tabelle 15 im Anhang), erscheint das Ausmaß der erfahrenen Schwierigkeiten<br />
bei der Akquisition von Bankkrediten dennoch beachtlich: Auf 100 Gründer mit einer längerfristigen<br />
Bankfinanzierung kommen 23 Gründer, die zumindest einen angefragten Kredit nicht<br />
erhalten haben.<br />
Grundsätzlich steht die Häufigkeit des Auftretens von Schwierigkeiten mit einzelnen Finanzierungsquellen<br />
in einem engen Zusammenhang zur Nutzungshäufigkeit bei den jeweiligen<br />
Quellen (vgl. Grafik 15 in Abschnitt 5.1). Dementsprechend seltener wurden Probleme im<br />
Zusammenhang mit der Beantragung eines öffentlichen Förderkredits (17,3 %) oder eines<br />
91 Hier waren Mehrfachnennungen möglich.<br />
92<br />
Anteil mit Schwierigkeiten (10,2 %) x bedingter Anteil der Kategorie „Eigene Finanzmittel reichten<br />
nicht aus“ (54,3 %) = 5,5 %.<br />
93<br />
10,2 % x 29,0 % = 3,0 %.
80 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
BA-Förderzuschusses (15,9 %), sowie insbesondere mit der Akquisition von Beteiligungsoder<br />
Mezzanine-Kapital (1,6 %) genannt.<br />
Bankkredite gar nicht erhalten<br />
Bankkredite nicht in<br />
gewünschtem Umfang erhalten<br />
Bankkredite nur zu<br />
schlechteren Konditionen erhalten<br />
BA-Fördermittel<br />
beantragt aber nicht erhalten<br />
Öffentliche Förderkredite<br />
beantragt aber nicht erhalten<br />
Schwierigkeiten mit<br />
Beteiligungs- oder Mezzanine-Kapital<br />
Eigene Finanzmittel reichten nicht aus<br />
Sonstige Schwierigkeiten<br />
1,6<br />
0,0<br />
3,0<br />
4,5<br />
17,2<br />
9,5<br />
29,0<br />
23,5<br />
18,6<br />
24,8<br />
7,8<br />
15,9<br />
23,3<br />
17,3<br />
10,2<br />
25,9<br />
20,7<br />
30,7<br />
29,6<br />
38,6<br />
54,3<br />
62,8<br />
39,4<br />
35,0<br />
0% 30% 60% 90%<br />
Alle Gründer<br />
Vollerwerb<br />
Nebenerwerb<br />
95%-Konfidenzintervall<br />
Die Zahlen neben den Balken geben die Anteile der Gründer, die die genannten Arten von Finanzierungsschwierigkeiten erfahren<br />
haben, an allen n=66 Gründern, allen n=44 Vollerwerbsgründern bzw. allen n=22 Nebenerwerbsgründern, die Finanzierungsschwierigkeiten<br />
angegeben haben, wieder. Mehrfachnennungen möglich. Lesehilfe: 23,5 % der Vollerwerbsgründer mit<br />
Schwierigkeiten bei der Finanzierung haben, obwohl dies gewünscht war, keine Bankkredite erhalten.<br />
Grafik 18: Art der Schwierigkeiten von Gründern mit Finanzierungsschwierigkeiten, 2009<br />
Im Vergleich zwischen Gründern im Voll- und im Nebenerwerb haben Vollerwerbsgründer<br />
tendenziell weniger Schwierigkeiten, Bankkredite überhaupt (23,5 % derjenigen mit Schwierigkeiten;<br />
im Nebenerwerb: 38,6 %) oder in gewünschtem Umfang zu erhalten (9,5 % versus<br />
30,7 %). 94 Auch haben Gründer im Vollerwerb (10,2 %) seltener als Gründer im Nebenerwerb<br />
(29,6 % derjenigen mit Schwierigkeiten) einen beantragten Förderkredit nicht erhalten. Hierin<br />
dürfte sich die Tatsache widerspiegeln, dass viele Förderprogramme dezidiert auf Gründungen<br />
ausgerichtet sind, die zumindest mittelfristig als Vollerwerbsunternehmen vorgesehen<br />
sind. Vergleichsweise häufig sahen sich Vollerwerbsgründer schließlich mit schlechteren<br />
Konditionen (24,8 % versus 7,8 %) oder dem Problem unzureichender Eigenmittel (62,8 %<br />
94 Auch hier zeigen die breiten Konfidenzbänder eine erhebliche statistische Unsicherheit an, die aus<br />
den geringen Fallzahlen in den einzelnen betrachteten Gruppen resultiert.
Gründungsfinanzierung 81<br />
bzw. 39,4 % derjenigen mit Schwierigkeiten) konfrontiert. Auch in diesem Resultat manifestiert<br />
sich die i. d. R. größere Dimensionierung der Vollerwerbsprojekte.<br />
Multivariate Analyse: Wer hat Finanzierungsschwierigkeiten?<br />
Um möglichen Beeinträchtigungen des Gründungsgeschehens durch Finanzierungsengpässe<br />
zielgerecht entgegenwirken zu können, sind Erkenntnisse darüber, welche Gründer mit welchen<br />
Projekten von Finanzierungsschwierigkeiten betroffen sind, essenziell. In diesem Zusammenhang<br />
lässt sich die Informationsfülle des <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>s zur Schätzung<br />
partieller Effekte von Projekt- und Personenmerkmalen auf das Auftreten von Finanzierungsschwierigkeiten<br />
nutzen. Die multivariate Analyse erfolgt mittels einer Probit-Regression. Hier<br />
nimmt die abhängige Variable den Wert 1 (0) an, wenn der Gründer (keine) Schwierigkeiten<br />
bei der Gründungsfinanzierung erfahren hat. Für die Schätzung sind die Gründungen der<br />
Befragungsjahre 2008 und 2009 heranzuziehen (Tabelle 6).<br />
Die deutlichen Unterschiede im Auftreten von Finanzierungsschwierigkeiten nach dem Ausmaß<br />
des Finanzmitteleinsatzes, die sich bereits im bivariaten Vergleich in Grafik 17 abgezeichnet<br />
haben, bleiben auch in der partiellen Betrachtung erhalten. Im Vergleich zur Referenzgruppe<br />
der Gründer mit einem positiven Finanzierungseinsatz von bis zu 10.000 EUR<br />
haben diejenigen Gründer, die gar keine Finanzierungsmittel eingesetzt haben, eine um<br />
6 Prozentpunkte geringere Wahrscheinlichkeit, von Schwierigkeiten betroffen zu sein. Auf der<br />
anderen Seite liegt die Wahrscheinlichkeit für Gründer mit Finanzierungen von über<br />
10.000 EUR um 18 Prozentpunkte nochmals signifikant höher. 95 Dieses Resultat untermauert<br />
zum einen den Umstand, dass für viele kleinere Gründungen – man denke etwa an Strukturvertrieb<br />
von Kosmetik oder Studentenprojekte zur Netzwerkadministration – Finanzierung<br />
schlichtweg gar kein Thema ist. Zum anderen belegt es, dass sich eher die größeren Gründungen,<br />
von denen auch stärkere Wachstums- und Beschäftigungswirkungen zu erwarten<br />
sind, Finanzierungsschwierigkeiten gegenübersehen. Offenbar greift das Losgrößenargument<br />
eines aus Sicht potenzieller Kapitalgeber schlechteren Aufwands-Ertragsver-hältnisses kleinerer<br />
Finanzierungen in der besonders kleinteiligen Gründungsfinanzierung nicht.<br />
95 Keine signifikanten Unterschiede zeigen sich hingegen zwischen den Effekten einer Finanzierung<br />
von über 10.000 bis 25.000 EUR und einer Finanzierungsgröße jenseits von 25.000 EUR. Zu dem<br />
Ergebnis, dass Finanzierungsschwierigkeiten im Gründungszusammenhang umso eher auftreten, je<br />
größer das Finanzierungsvolumen ist, kommt beispielsweise auch Metzger (2007).
82 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Tabelle 6: Bestimmungsfaktoren von Finanzierungsschwierigkeiten (Probitschätzung)<br />
Abhängige Variable: Finanzierungsschwierigkeiten vorhanden (ja: y=1, nein: y=0)<br />
Gründermerkmale Strukturmerkmale Gründung + Kontrollvariablen<br />
dF/dx<br />
(1)<br />
t-Wert<br />
(2)<br />
dF/dx<br />
(3)<br />
t-Wert<br />
(4)<br />
Geschlecht (= weiblich) 0,038 1,40 Umfang (= Nebenerwerb) -0,039 * -1,72<br />
Alter (Ref.: 35–44 Jahre) Form (Ref.: Neugründung)<br />
18 bis 24 Jahre 0,067 1,27 Übernahme 0,008 0,17<br />
25 bis 34 Jahre 0,091 ** 2,36 Beteiligung 0,008 0,23<br />
45 bis 54 Jahre -0,012 -0,42 Branche (Ref.: wirtsch. Dienstleist.)<br />
55 bis 64 Jahre -0,022 -0,56 Verarbeitendes Gewerbe -0,068 -1,06<br />
Staatsangehörigkeit (Ref.: D) Baugewerbe -0,037 -0,66<br />
deutsch durch Einbürgerung 0,045 0,82 Handel 0,025 0,71<br />
EU27-Ausländer 0,028 0,41 persönliche Dienstleistungen 0,019 0,54<br />
sonstige Ausländer 0,140 * 1,79 sonstige Branchen -0,089 * -1,92<br />
Bildung (Ref.: Lehre) Berufsgruppe (Ref.: sonstige Berufe)<br />
Universität -0,020 -0,63 Freie Berufe -0,021 -0,67<br />
Fachhochschule, BA u. ä. 0,037 0,93 Handwerk -0,009 -0,23<br />
Fachschule, Meisterschule 0,144 ** 2,23 Marktneuheit (Ref.: keine Neuheit)<br />
kein Berufsabschluss 0,095 ** 2,16 regionale Neuheit 0,071 1,53<br />
Status (Ref.: sonstige Angestellte) deutschlandweite Neuheit 0,002 0,03<br />
Unt.leiter / Geschäftsführer -0,041 -0,68 weltweite Neuheit -0,086 -1,47<br />
leitender / hochq. Angestellte -0,079 ** -2,48 Größe (Ref.: Sologründer o. Mitarbeit.)<br />
Beamte 0,019 0,23 Sologründer mit Mitarbeitern -0,022 -0,78<br />
Facharbeiter 0,090 1,33 Teamgründer ohne Mitarbeiter -0,001 -0,01<br />
sonstiger Arbeiter -0,066 -0,76 Teamgründer mit Mitarbeitern 0,054 1,24<br />
Selbstständig 0,003 0,07 Finanzmitteleinsatz (Ref.: 1–10TEUR)<br />
arbeitslos 0,077 * 1,90 keine finanziellen Mittel -0,058 ** -2,35<br />
Nichterwerbsperson -0,039 -1,20 > 10.000 bis 25.000 EUR 0,186 *** 3,46<br />
Gründungsmotiv (Ref.: Chance) > 25.000 EUR 0,187 *** 3,71<br />
Notmotiv im Vordergrund 0,012 0,41 Jahr (= 2009) -0,036 * -1,71<br />
sonstiges Motiv im Vordergrund -0,035 -1,25<br />
Region (= Ostdeutschland) 0,007 0,21<br />
Ort (Ref.: ab 500.000 Einw.)<br />
bis 5.000 Einwohner -0,047 -1,51<br />
5.000 bis unter 20.000 Einw. -0,028 -0,94<br />
20.000 bis unter 100.000 Einw. -0,063 ** -2,25<br />
100.000 bis unter 500.000 Einw. -0,014 -0,38<br />
Anzahl Beobachtungen 1.031<br />
Beobachtete Wahrscheinlichkeit 0,124<br />
Geschätzte Wahrscheinlichkeit 0,126<br />
Pseudo-R 2 0,172<br />
***, **, * signifikant auf dem 1 %, 5 %, 10 %-Niveau, heteroskedastiekonsistente t-Werte in Klammern.<br />
Für die Schätzungen werden die Gründungen aus den Befragungswellen 2008 und 2009 zusammengefasst, um statistisch<br />
belastbare Ergebnisse zu erhalten. Die Schätzkoeffizienten geben die Veränderung der Wahrscheinlichkeit, Schwierigkeiten bei<br />
der Finanzierung der Gründung zu haben, relativ zu einem Referenzgründer für die diskrete Veränderung der Dummyvariablen<br />
von 0 nach 1 an. Mit Ausnahme der hier nicht aufgenommenen Dauer der Selbstständigkeit besitzt der Referenzgründer die<br />
selben persönlichen und Projektmerkmale wie die Referenzperson in der Schätzung zum Abbruch des Selbstständigkeitsprojekts<br />
(siehe Fußnote zu Tabelle 5).<br />
Die größeren Finanzierungsschwierigkeiten umfangreicherer Gründungen resultieren auch in<br />
einem signifikant negativen Effekt in Höhe von 4 Prozentpunkten für Nebenerwerbsgründungen.<br />
Die Unterschiede in Bezug auf die durch Teampartner und Mitarbeiter gemessene Grün-
Gründungsfinanzierung 83<br />
dungsgröße sind hingegen nicht signifikant. Lediglich Teamgründer mit Mitarbeitern erfahren<br />
tendenziell häufiger Schwierigkeiten. Ceteris paribus sind auch Branchenunterschiede betragsmäßig<br />
klein und i. d. R. insignifikant. 96 Weiterhin keine systematischen Unterschiede<br />
zeigen sich hinsichtlich der Dimensionen Gründungsform, Berufsgruppe und Innovativität.<br />
Mögliche Effekte dieser Attribute – verwandte Studien in der Literatur kommen bspw. häufig<br />
zu dem Ergebnis, dass Finanzierungsengpässe bei innovativen Jungunternehmen 97 besonders<br />
gravierend sind – wirken dementsprechend indirekt u. a. über die Finanzierungshöhe.<br />
Exkurs 8: Zur Einordnung der erhobenen Finanzierungsschwierigkeiten<br />
Wie ist das Ausmaß der erhobenen Finanzierungsschwierigkeiten im Hinblick auf seine Bedeutung<br />
für das Gründungsgeschehen in Deutschland insgesamt zu beurteilen? Auf der einen Seite steht<br />
das Ausmaß der von Seiten der Gründer angegebenen Finanzierungsschwierigkeiten im Einklang<br />
mit den Resultaten verwandter Studien. 98 Zudem ist zu berücksichtigen, dass der Großteil der<br />
Gründer mit Schwierigkeiten letztendlich doch Finanzmittel einsetzen konnte. In den Experteneinschätzungen<br />
des Global Entrepreneurship Monitor (GEM; Brixy et al. 2010) zu den Rahmenbedingungen<br />
für Existenzgründungen nimmt Deutschland im internationalen Vergleich in Bezug auf Finanzierungsbedingungen<br />
einen Mittelplatz (Rang 8 in der Vergleichsgruppe von 18 innovationsbasierten<br />
Volkswirtschaften) ein. Die öffentliche Förderinfrastruktur in Deutschland belegt hingegen<br />
regelmäßig den Spitzenplatz (Rang 1 aus 18).<br />
Grundsätzlich spiegeln selbst berichtete Schwierigkeiten nicht notwendigerweise ein Marktversagen<br />
wider. 99 Alternativ können lediglich die subjektive Wahrnehmung des Gründers zur Qualität<br />
seines Projektes und die entsprechende Einschätzung von Seiten des Marktes mit dem Resultat<br />
auseinanderfallen, dass kein Finanzierungsmatch zwischen Gründer und potenziellem Kapitalgeber<br />
zu Stande kommt. Aus diesem Betrachtungswinkel überzeichnen die berichteten Schwierigkeiten<br />
möglicherweise die Finanzierungsengpässe.<br />
Auf der anderen Seite bezieht sich die Analyse nur auf Gründer, die ihr Projekt tatsächlich realisiert<br />
haben. Diese haben damit alle Gründungsbarrieren, wie beispielsweise einen erschwerten Mittelzugang,<br />
letztlich überwunden. Nicht erfasst werden hingegen potenzielle Unternehmensgründer,<br />
die durch Finanzierungs- oder andere im Zusammenhang mit dem Gründungsprozess stehende<br />
Schwierigkeiten gänzlich an einer Realisierung ihres Gründungsprojektes gehindert wurden. Brixy<br />
et al. (2010) zufolge hat nicht einmal die Hälfte aller Personen mit konkreten Gründungsabsichten<br />
im GEM (‚nascent entrepreneurs’) ihren Plan innerhalb eines Jahres auch in die Tat umgesetzt.<br />
Rund ein Drittel hat hingegen in diesem Zeitraum die Gründungsabsicht endgültig wieder verworfen.<br />
Vor diesem Hintergrund wird das gesamte Ausmaß von Finanzierungsschwierigkeiten in der<br />
Gründungsfinanzierung insgesamt tendenziell unterschätzt.<br />
96<br />
Die im Vergleich zur Referenzbranche ‚wirtschaftliche Dienstleistungen’ um 9 Prozentpunkte signifikant<br />
geringere Wahrscheinlichkeit von Finanzierungsschwierigkeiten im Bereich der sonstigen Branchen<br />
dürfte maßgeblich durch die hier erfassten privaten Energieerzeugungsanlagen, für die klare<br />
Förderregeln existieren, bestimmt sein.<br />
97<br />
Vgl. die Übersicht in Kohn (2009).<br />
98<br />
Beispielsweise geben in der Umfrage von Kulicke (2000) unter jungen Dienstleistungsunternehmen<br />
diese in der Mehrheit (70 %) an, keine Finanzierungsschwierigkeiten bei der Betriebserrichtung gehabt<br />
zu haben.<br />
99<br />
Vgl. Kohn (2009).
84 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Neben den Projektmerkmalen üben verschiedene Persönlichkeitsmerkmale der Gründerperson<br />
deutliche Einflüsse auf die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Finanzierungsschwierigkeiten<br />
aus. So berichten jüngere Gründer ceteris paribus häufiger von Schwierigkeiten,<br />
was darauf zurückzuführen sein könnte, dass jüngere im Vergleich zu älteren weniger Gelegenheit<br />
hatten, eigene Ressourcen für den Start in die Selbstständigkeit aufzubauen. Ähnliches<br />
mag für Gründer ohne Berufsabschluss gelten, die um 10 Prozentpunkte häufiger als<br />
die Referenzgruppe derer mit Abschluss von Finanzierungsschwierigkeiten betroffen sind.<br />
Darüber hinaus wirken positive Bildungssignale auch in Richtung einer Reduzierung von In-<br />
formationsasymmetrien. 100<br />
Eine im Vergleich zu deutschen Staatsbürgern um 14 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit<br />
von Finanzierungsschwierigkeiten weisen Nicht-EU-Ausländer auf. Für diese Gruppe<br />
mögen neben Sprachbarrieren auch kulturelle Unterschiede eine substanzielle Hürde im Kontakt<br />
mit potenziellen Kapitalgebern darstellen. Ausländer aus EU-Staaten berichten hingegen<br />
nicht häufiger von Finanzierungsschwierigkeiten. Zwar sind auch für diese Gruppe Sprachbarrieren<br />
zu erwarten, es überwiegen aber offensichtlich eine kulturelle Nähe und Erfahrungen<br />
der Gründer mit ähnlichen Finanzinstitutionen im gemeinsamen europäischen Markt.<br />
Mangelnde eigene Ressourcen oder Stigmatisierungseffekte der Arbeitslosigkeit könnten für<br />
die signifikant häufigeren Schwierigkeiten von Gründern, die aus der Arbeitslosigkeit heraus<br />
gestartet sind (Unterschied zu vormals angestellten Gründern: 8 Prozentpunkte), verantwortlich<br />
zeichnen. Vormals in leitender Tätigkeit angestellte Gründer können indes eher auf eigene<br />
Ressourcen für die Selbstständigkeit zurückgreifen, sodass sie signifikant seltener Finanzierungsschwierigkeiten<br />
begegnen (Wahrscheinlichkeit um 8 Prozentpunkte geringer als für<br />
die Referenzgruppe).<br />
Der signifikant negative Jahreseffekt für 2009 belegt schließlich, dass die Wahrscheinlichkeit<br />
von Schwierigkeiten bei der Gründungsfinanzierung auch nach Kontrolle der Gründer- und<br />
Gründungsmerkmale von 2008 auf 2009 um 4 Prozentpunkte gesunken ist. Der Rückgang<br />
der Finanzierungsschwierigkeiten ist also nicht nur auf messbare Verschiebungen in der Zusammensetzung<br />
des Gründungsgeschehens zurückzuführen, sondern spiegelt, wie oben<br />
diskutiert, auch einen Qualitätsaspekt der im Krisenjahr realisierten Gründungsprojekte sowie<br />
möglicherweise ein für Gründungen im Vergleich zu Bestandsunternehmen relativ positives<br />
Finanzierungsumfeld wider.<br />
100 Vgl. Werner (2007).
Gründungsfinanzierung 85<br />
Zwischenfazit zu Finanzierungsschwierigkeiten<br />
Im Zuge der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise hat sich zwar im Lauf des Jahres 2009 die<br />
Finanzierungssituation von Unternehmen allgemein verschlechtert, insgesamt ist jedoch keine<br />
flächendeckende Kreditklemme festzustellen; dies gilt besonders für die Finanzierung<br />
kleiner und mittlerer Unternehmen. 101 Unter den Gründern des Jahres 2009 hatte der überwiegende<br />
Teil keine Schwierigkeiten mit der Finanzierung des Gründungsprojekts. Aufgrund<br />
des häufig geringen Finanzierungsbedarfs waren mögliche Probleme für viele Gründer gar<br />
nicht relevant. Auch sind kleinvolumige Finanzierungen im Mikrofinanzierungsbereich weniger<br />
stark von Schwierigkeiten betroffen als Gründer mit größerem Finanzierungsengagement.<br />
Gründer, die zur Finanzierung ihres Investitionsvorhabens auf externes Kapital angewiesen<br />
sind, klagen überdurchschnittlich häufig über Finanzierungsschwierigkeiten. Darüber hinaus<br />
wird das Auftreten von Finanzierungsschwierigkeiten maßgeblich von der Fähigkeit des<br />
Gründers, auf eigene Ressourcen zurückgreifen zu können, beeinflusst. Unter den aufgetretenen<br />
Schwierigkeiten werden ‚unzureichende Eigenmittel’ am häufigsten genannt, es folgen<br />
Probleme bei der Akquisition von Bankkrediten.<br />
Im Vergleich zum Vorjahr ist im Jahr 2009 anhand der Selbstauskünfte der Gründer eine<br />
Verbesserung der Finanzierungssituation von Gründern festzustellen, die auf eine gestiegene<br />
Qualität der in der Krise realisierten Gründungen hindeutet. Dabei ist zu beachten, dass –<br />
wie auch in den Vorjahren – nur der Blickwinkel derjenigen Gründer eingenommen werden<br />
kann, die ihr Projekt tatsächlich unternommen und nicht ihre Gründungsabsichten angesichts<br />
von Finanzierungsschwierigkeiten oder anderen Gründungshürden zurückgestellt oder ganz<br />
aufgegeben haben.<br />
Mit Blick auf die nähere Zukunft muss es darum gehen, auch angesichts der aktuellen Risiken<br />
im Bankensektor und auf den Finanzmärkten sicherzustellen, dass potenzielle Gründer<br />
viel versprechende Gründungsideen auch in die Tat umsetzen können und Gründungen ihre<br />
gesamtwirtschaftlich wünschenswerten positiven Wachstums- und Beschäftigungswirkungen<br />
entfalten können. Insbesondere bedarf es flexibler und bedarfsgerechter Finanzierungsangebote,<br />
damit sich auch Gründer mit innovativen und technologieorientierten Projekten, die<br />
aufgrund einer erforderlichen Mindestgröße ihres Gründungsprojekts auf formelle externe<br />
Mittel angewiesen sind, in ausreichendem Maß mit geeignetem Startkapital versorgen können.<br />
101 Vgl. EZB (2010), ifo (2010), Denzer-Speck und Schoenwald (2010), Reize (2010), Schoenwald<br />
(2010) sowie und Bauer und Zimmermann (2010).
86 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010
6 Fazit<br />
Nach dem Rückgang der Gründerzahlen in den Jahren 2004 bis 2008 ist für das Jahr 2009<br />
eine deutliche Zunahme der Gründungsaktivität zu verzeichnen. Rund 872.000 Personen<br />
haben im Rezessionsjahr eine selbstständige Tätigkeit begonnen, 10 % mehr als im Jahr<br />
2008. Bezogen auf die Bevölkerung entspricht dies einer Gründerquote von 1,7 %. Besonders<br />
stark ist die Zahl der Vollerwerbsgründer gestiegen, und zwar um 20 % auf 397.000<br />
Personen. Die Zahl der Nebenerwerbsgründer ist hingegen im Vorjahresvergleich nahezu<br />
konstant geblieben (+2 % auf 475.000 Personen). Die Zunahme der Gründungsaktivität fiel<br />
in Westdeutschland stärker aus als in Ostdeutschland, sodass sich die Gründerquoten in den<br />
beiden Regionen weiter auseinander entwickeln (Gründerquoten 2009: Westdeutschland<br />
1,8 %; Ostdeutschland 1,3 %).<br />
Gesamtwirtschaftlich war das Jahr 2009 gekennzeichnet durch einen dramatischen Rückgang<br />
des Bruttoinlandsprodukts im ersten Halbjahr und erste konjunkturelle Erholungstendenzen<br />
im zweiten Halbjahr. Allerdings war diese Entwicklung noch bis in den Herbst hinein<br />
mit großer Unsicherheit behaftet. Auf dem Arbeitsmarkt stieg zwar die Erwerbslosenquote<br />
moderat an, angesichts der Schwere der Rezession zeigte sich der Arbeitsmarkt jedoch insgesamt<br />
erfreulich robust, da Unternehmen notwendige Beschäftigungsanpassungen häufig<br />
nicht über die Beschäftigtenzahl, sondern über die Arbeitszeit vorgenommen haben. Dabei<br />
haben nicht zuletzt die wirtschaftspolitischen Maßnahmen zum Kurzarbeitergeld unterstützend<br />
gewirkt.<br />
Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung der Gründerzahlen einzuordnen. Auf der einen<br />
Seite haben die höhere Erwerbslosenquote und die geschmälerten Perspektiven in abhängiger<br />
Beschäftigung vor allem Gründer im Vollerwerb hervorgebracht (Push-Wirkung eingetretener<br />
oder drohender Arbeitslosigkeit). Auf der anderen Seite generiert der dramatische Konjunktureinbruch<br />
dadurch einen gegenläufigen Effekt, dass die Risiken für Gründungen angesichts<br />
verringerter Nachfrage steigen und Gründungswillige besonders Hinzuverdienstprojekte<br />
als weniger aussichtsreich einstufen. Dieser negativ wirkende Pull-Effekt der Konjunktur<br />
beeinflusst insbesondere Nebenerwerbsgründer, deren Zahl nach Aufrechnung beider Effekte<br />
nahezu konstant geblieben ist.<br />
Für das Jahr 2010 deuten Konjunkturprognosen auf eine Fortsetzung der wirtschaftlichen<br />
Erholung hin, allerdings in gemäßigtem Tempo. Auch der Arbeitsmarkt dürfte sich geringfügig<br />
erholen, eine grundlegende Verbesserung der Beschäftigungsaussichten ist angesichts<br />
weiterhin verbleibender Risiken jedoch nicht in Sicht. Vor diesem Hintergrund ist für die<br />
Gründungsaktivität im laufenden Jahr eine Seitwärtsbewegung der Gründungszahlen zu er-
88 <strong>Gründungsmonitor</strong> 20092010<br />
warten. Für sich genommen führt die moderate konjunkturelle Erholung zu einem positiven<br />
Pull-Effekt auf das Gründungsgeschehen. Dieser dürfte jedoch wiederum schwach ausfallen,<br />
denn in der Vergangenheit hat sich das Gründungsgeschehen in Deutschland wenig konjunkturreagibel<br />
gezeigt. Auf dem Arbeitsmarkt baut sich kein zusätzlicher Druck zur Selbstständigkeit<br />
auf. Da sich aber gleichzeitig keine wesentliche Verbesserung der Situation für<br />
bereits arbeitslose Personen ankündigt, könnten weiterhin insbesondere Langzeitarbeitslose<br />
in Ermangelung von Erwerbsalternativen eine Selbstständigkeit in Betracht ziehen.<br />
In einer Wirtschaftskrise verstärkt sich der Strukturwandel und der „Prozess schöpferischer<br />
Zerstörung“ intensiviert sich (Günterberg et al., 2010). Dies manifestiert sich nicht zuletzt<br />
darin, dass Unternehmen aus dem Markt ausscheiden. Um den Unternehmensbestand wieder<br />
aufzufüllen und den Erneuerungsprozess der Wirtschaft voranzutreiben, sind Gründungen<br />
von essenzieller Bedeutung. Zum einen beleben Markteintritte neuer Unternehmen den<br />
Wettbewerb auf den Gütermärkten und Bestandsunternehmen werden zu Effizienzsteigerungen<br />
angehalten. Zum anderen generieren Gründer mit innovativen Ideen neue Wachstumschancen.<br />
Darüber hinaus kann eine – eventuell auch nur auf Zeit angelegte – Selbstständigkeit<br />
als Alternative für Arbeitslose helfen, dass sich die konjunkturell bedingte höhere<br />
Arbeitslosigkeit nicht strukturell verfestigt.<br />
Insgesamt hat sich die Wirtschaftskrise positiv auf die Gründungsaktivitäten in Deutschland<br />
ausgewirkt, es sind mehr und im Durchschnitt größere Gründungen zu verzeichnen. Hinter<br />
diesem Gesamtbild verbirgt sich jedoch eine Polarisierung des Gründungsgeschehens. Diese<br />
zeigt sich, wenn die Gründer zu den Auswirkungen der Wirtschaftskrise befragt werden:<br />
Auf der einen Seite hat sich für 20 % der Gründer der Druck zur Selbstständigkeit erhöht, auf<br />
der anderen Seite geben 17 % aller Gründer an, dass die Wirtschaftskrise ihnen eine explizite<br />
Gründungschance eröffnet hat. Ferner manifestiert sich die Polarisierung in den Strukturmerkmalen<br />
der Gründungsprojekte. Im Vergleich zu 2008 sind einerseits größere Anteile von<br />
Gründern mit Unternehmensübernahmen und von Gründungen mit höherem Gesamtmittelbedarf<br />
(von mehr als 50.000 EUR) zu verzeichnen. Andererseits ist der Anteil der vormals<br />
Langzeitarbeitslosen unter den Gründern gestiegen und ein höherer Anteil von Gründern<br />
setzt nur geringe Sach- und Finanzmittel (weniger als 10.000 EUR) ein.<br />
Nicht verändert hat sich der Anteil innovativer Projekte. 13 % aller Gründer gaben an, mit<br />
einer zumindest regionalen Marktneuheit gestartet zu sein, und wie im Vorjahr brachten lediglich<br />
2 % eine Weltmarktneuheit an den Start. Da diese Angaben die Selbsteinschätzung<br />
der Gründer wiedergeben und deshalb eher als eine optimistische Obergrenze für den Anteil<br />
tatsächlich innovativer Gründungsprojekte zu verstehen sind, lässt die Innovationsaktivität<br />
des Gründungsgeschehens demnach weiterhin zu wünschen übrig.
Fazit 89<br />
Die Beschäftigungswirkungen des Gründungsgeschehens setzen sich aus den geschaffenen<br />
Arbeitsplätzen für Gründer selbst und gegebenenfalls eingestellten Mitarbeitern zusammen.<br />
Neben der höheren Anzahl von Vollerwerbsgründern sind auch ein höherer Anteil von Gründungen<br />
mit Mitarbeitern (2009: 38 %, 2008: 28 %) und durchschnittlich höhere Mitarbeiterzahlen<br />
zu verzeichnen. So hatte eine Vollerwerbsneugründung im Jahr 2009 durchschnittlich<br />
1,69 vollzeitäquivalente Stellen (2008: 1,56). Insgesamt ergibt sich ein Anstieg des direkten<br />
Bruttobeschäftigungseffekts des Neugründungsgeschehens von 447.000 auf 517.000 vollzeitäquivalente<br />
Stellen.<br />
Der direkte Bruttobeschäftigungseffekt berücksichtigt naturgemäß keine (indirekten) Verdrängungseffekte<br />
in Bestandsunternehmen und keine späteren Marktaustritte. Einen ersten<br />
Hinweis auf die Nachhaltigkeit des Gründungsgeschehens gibt die Abbruchquote der Selbstständigkeitsprojekte<br />
in der ersten Zeit nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit. Die Ergebnisse<br />
des <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>s zeigen, dass zwischen einem Fünftel und einem Viertel aller<br />
Gründer bereits spätestens nach drei Jahren wieder aus dem Markt ausgeschieden sind.<br />
Damit ist eine hohe Sterblichkeit der Projekte in den ersten Monaten und Jahren nach Gründung<br />
zu konstatieren. Da ein Scheitern von Gründungen sowohl individuelle als auch gesellschaftliche<br />
Kosten mit sich bringt, muss es ein wirtschaftspolitisches Ziel sein, die Überlebenschancen<br />
Erfolg versprechender Gründungsprojekte zu erhöhen.<br />
Für das Bestehen am Markt ist in der Regel eine Mindestprojektgröße notwendig, für deren<br />
Erreichen der Einsatz entsprechender Ressourcen erforderlich ist. Die Analyse des Abbruchs<br />
von Gründungsprojekten kommt u. a. zu dem Ergebnis, dass der Einsatz finanzieller<br />
Mittel (oberhalb von 10.000 EUR) mit einer signifikant höheren Wahrscheinlichkeit des Fortbestandes<br />
des Gründungsprojekts einhergeht. Gründer, die den Schritt in die Selbstständigkeit<br />
zwar mit Teampartnern, aber ohne Mitarbeiter unternehmen oder die ohne jeglichen Einsatz<br />
finanzieller Mittel starten, haben dagegen eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit, mit<br />
ihrem Projekt frühzeitig zu scheitern.<br />
Die erfreuliche Entwicklung, dass im Jahr 2009 nur rund 10 % der Gründer und damit<br />
6 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr über Finanzierungsschwierigkeiten berichten, stützt<br />
die Aussage, dass in Deutschland aus der Wirtschafts- und Finanzkrise bisher keine flächendeckende<br />
Kreditklemme erwachsen ist. Allerdings klagen Gründer, die zur Finanzierung<br />
ihres Investitionsvorhabens auf externes Kapital angewiesen sind, nach wie vor überdurchschnittlich<br />
häufig (2009: 23 %, 2008: 32 %) über Finanzierungsschwierigkeiten. Für die weitere<br />
Entwicklung der jungen Unternehmen und die in 2010 erfolgenden Gründungen ist von<br />
zentraler Bedeutung, dass es auch im Aufschwung trotz Eigenkapitalproblemen der Kapitalgeber<br />
nicht zu Finanzierungsengpässen kommt.
90 <strong>Gründungsmonitor</strong> 20092010<br />
Für die <strong>KfW</strong> Bankengruppe bilden Gründer eine wichtige Zielgruppe, die mit spezifischen<br />
Förderprogrammen unterstützt wird. Diese Programme werden der großen Bandbreite des<br />
Gründungsgeschehens gerecht und bieten sowohl Kreditfinanzierungen als auch Eigenkapitalfinanzierungen<br />
sowie Mischformen in Mezzanine-Programmen an. Beispielsweise konzentriert<br />
sich das „<strong>KfW</strong>-Startgeld“ auf Gründer mit kleinerem Mittelbedarf (Kredite bis<br />
50.000 EUR). Mit der Einbeziehung auch von Nebenerwerbsgründern (sofern sie mittelfristig<br />
auf einen Vollerwerb ausgerichtet sind) und gründerfreundlichen Konditionen (u. a. lange<br />
Laufzeiten, tilgungsfreie Anlaufjahre, kostenfreie außerplanmäßige Tilgung, Mehrfachgewährung<br />
an Gründerteams) ist dieses Förderprogramm sehr gut auf das breite, kleinteilige Gründungsgeschehen<br />
in Deutschland angepasst. Für Gründer mit höherem und mezzaninem Mittelbedarf<br />
steht das Programm „ERP-Kapital für Gründung“ zur Verfügung; und speziell auf die<br />
Bedürfnisse von innovativen Technologie-Gründungen ist das Private-Equity-Programm<br />
„ERP-Startfonds“ zugeschnitten.<br />
Ergänzt werden die Finanzierungsangebote durch die Unterstützung der Gründungsberatung.<br />
Hier sind insbesondere die „startothek“ (Internet-Plattform mit aktuellen Rechtsinformationen<br />
für Gründer und Berater mit der Möglichkeit für Gründer, online Kontakt mit Beratern aufzunehmen)<br />
und das „Gründercoaching Deutschland“ (Zuschüsse zu den Kosten für Gründer,<br />
die Beratung von Experten in Anspruch nehmen möchten) zu nennen. Im Hinblick auf einen<br />
erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit ist die Verbindung von geeigneter Finanzierung<br />
und qualifizierter Beratung im Rahmen einer gründlichen Vorbereitung der Gründer wesentlich.
Literatur<br />
Almus, M., D. Engel und S. Prantl (2000): The ZEW Foundation Panels and the Mannheim<br />
Enterprise Panel (MUP) of the Centre for European Economic Research (ZEW),<br />
Schmollers Jahrbuch 120, 301−308.<br />
Almus, M., D. Engel und S. Prantl (2002): Die Mannheimer Gründungspanels des Zentrums<br />
für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW), in: M. Fritsch und R. Grotz<br />
(Hrsg.), Das Gründungsgeschehen in Deutschland – Darstellung und Vergleich der<br />
Datenquellen, Physica, Heidelberg, S. 79−102.<br />
Arenius, P. und M. Minniti (2005): Perceptual Variables and Nascent Entrepreneurship,<br />
Small Business Economics 24, 233−247.<br />
Bauer, A. und V. Zimmermann (2010): Unternehmensbefragung 2010. Unternehmensfinanzierung:<br />
Anhaltende Schwierigkeiten für die wirtschaftliche Erholung, <strong>KfW</strong> Bankengruppe,<br />
Frankfurt am Main.<br />
Becker, G. S. (1976): The Economic Approach to Human Behavior, The University of Chicago<br />
Press, Chicago.<br />
Behrends, S. und K. Kott (2009): Zuhause in Deutschland – Ausstattung und Wohnsituation<br />
privater Haushalte – Ausgabe 2009, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.<br />
Berger, A. N. und G. F. Udell (2003): Small Business and Debt Finance, in: Z. J. Acs und D.<br />
B. Audretsch (Hrsg.), Handbook of Entrepreneurship Research, S. 299−328, Kluwer,<br />
New York.<br />
Blanchflower, D. G. und A. J. Oswald (1998): What Makes an Entrepreneur?, Journal of Labor<br />
Economics 16, 26−60.<br />
Bönte, W., O. Falck und S. Heblich (2009): The Impact of Regional Age Structure on Entrepreneurship,<br />
Economic Geography 85, 269–287.<br />
Boeri, T. und U. Cramer (1992): Employment Growth, Incumbents and Entrants, International<br />
Journal of Industrial Organization 10, 545−565.<br />
Borger, K. und S. Schoenwald (2010): <strong>KfW</strong>-Investbarometer: Juni 2010. <strong>KfW</strong> Bankengruppe,<br />
Frankfurt Main.
92 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Brixy, U. und M. Fritsch (2002): Die Betriebsdatei der Beschäftigtenstatistik der Bundesanstalt<br />
für Arbeit, in: M. Fritsch und R. Grotz (Hrsg.), Das Gründungsgeschehen in<br />
Deutschland – Darstellung und Vergleich der Datenquellen, Physica, Heidel<br />
berg, 55−77.<br />
Brixy, U., C. Hundt und R. Sternberg (2010): Global Entrepreneurship Monitor –Unternehmensgründungen<br />
im weltweiten Vergleich – Länderbericht Deutschland 2009,<br />
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Nürnberg und Leibniz Universität<br />
Hannover.<br />
Brüderl, J., P. Preisendörfer und R. Ziegler (1993): Staatliche Gründungsfinanzierung und<br />
der Erfolg neugegründeter Betriebe, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik<br />
212, 13−32.<br />
Brush, C. G. (1992): Research on Women Business Owners: Past Trends, a New Perspective<br />
and Future Directions, Entrepreneurship Theory and Practice 6(4), 5–30.<br />
Brush, C. G. (2006): Women Entrepreneurs: A Research Overview, in: M. Casson, B. Yeung,<br />
A. Basu und N. Wadeson (Hrsg.), The Oxford Handbook of Entrepreneurship, Oxford<br />
University Press, Oxford, 611−628.<br />
Bundesagentur für Arbeit (2007): Existenzgründung – Wege in die Selbstständigkeit, BBZ<br />
Heft 9, Ausgabe 2007/2008.<br />
Bundesagentur für Arbeit (2010a): Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in<br />
Zahlen, Aktuelle Zahlen, April 2010, Nürnberg, www.pub.arbeitsagentur.de/<br />
hst/services/statistik/detail/a.html (Auswahl: „Aktuelle Daten - Arbeitsmarkt in<br />
Deutschland“, Datei: multi_201004.xls), Zugriff 10.05.2010.<br />
Bundesagentur für Arbeit (2010b): Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in<br />
Zahlen, Aktuelle Zahlen, Januar 2009, Nürnberg, www.pub.arbeitsagentur.de/<br />
hst/services/statistik/detail/a.html (Auswahl: „Aktuelle Daten - Arbeitsmarkt in<br />
Deutschland“, Datei: multi_200901.xls), Zugriff 04.06.2010.<br />
Bundesagentur für Arbeit (2010c): Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in<br />
Zahlen, Arbeitslose nach Rechtskreisen, 2009, www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/<br />
statistik/200812/iiia4/akt_dat_jzd.<strong>pdf</strong>, Zugriff 04.06.2010.<br />
Bundesagentur für Arbeit (2010d): Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktpolitische<br />
Instrumente – mit Daten der zkT, Jahreszahlen 2009, Nürnberg,<br />
www.pub.arbeitsagentur.de/hst/services/statistik/detail/f.html (Auswahl: „Ausgewähl-
Literatur 93<br />
te arbeitsmarktpolitische Instrumente nach Rechtskreisen - Jahreszahlen“, Datei:<br />
AMP_SGBI_zkT_JZ_RD_LD.xls), Zugriff 26.04.2010.<br />
Caliendo, M. und A. S. Kritikos (2009): Die reformierte Gründungsförderung für Arbeitslose:<br />
Chancen und Risiken, Perspektiven der Wirtschaftspolitik 10(2), 189–213.<br />
Caliendo, M., S. Künn und F. Wießner (2009): Ich-AG und Überbrückungsgeld. Erfolgsgeschichte<br />
mit zu frühem Ende, IAB-Kurzbericht 3/2009, Institut für Arbeitsmarkt- und<br />
Berufsforschung, Nürnberg.<br />
Carter, S., und E. Shaw (2006): Women’s Business Ownership: Recent Research and Policy<br />
Development, Small Business Service Research Report, November, London.<br />
Denzer-Speck, D. und S. Schoenwald (2010): Trendwende am Kreditmarkt erreicht?, <strong>KfW</strong>-<br />
Kreditmarktausblick Juni 2010, <strong>KfW</strong> Bankengruppe, Frankfurt am Main.<br />
Deutsche Bundesbank (2010a): Bank Lending Survey des Eurosystems – Ergebnisse für<br />
Deutschland, Deutsche Bundesbank, Frankfurt,<br />
http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/publikationen/vo_bank_lending<br />
_survey_nettosaldo.<strong>pdf</strong>, Zugriff 06.05.2010.<br />
Deutsche Bundesbank (2010b): Die Wirtschaftslage in Deutschland um die Jahreswende<br />
2009/2010: Finanzmärkte. Monatsbericht 62 (2), Frankfurt.<br />
Engel, D., K. Kohn, A. Sahm und H. Spengler, unter Mitarbeit von B. Günterberg und<br />
G. Metzger (2008): Unternehmensfluktuation: Aktuelle Entwicklungen und Effekte<br />
einer alternden Bevölkerung, in: <strong>KfW</strong>, Creditreform, IfM, RWI, ZEW (Hrsg.), Mittelstandsmonitor<br />
2008 – Mittelstand trotz nachlassender Konjunkturdynamik in robuster<br />
Verfassung – jährlicher Bericht zu Konjunktur- und Strukturfragen kleiner und<br />
mittlerer Unternehmen, Frankfurt am Main, 37−101.<br />
Engel, D., G. Metzger, M. Niefert und D. Skambracks (2004): Der Beschäftigungsbeitrag<br />
kleiner und mittlerer Unternehmen. RWI Materialien 11, RWI Essen.<br />
Eurobarometer (2007): Entrepreneurship Survey of the EU (25 Member States), United<br />
States, Iceland and Norway, European Commission (Hrsg.), Analytical Report, Flash<br />
EB Series No. 192.<br />
EZB (2010): The Euro Area Bank Lending Survey – April 2010, Europäische Zentralbank,<br />
Frankfurt,
94 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
http://www.ecb.int/stats/<strong>pdf</strong>/blssurvey_201004.<strong>pdf</strong>?e8db6f19fe2a1c0b3de4ed9c3be<br />
658c6, Zugriff 06.05.2010.<br />
Evans, D. S. und B. Jovanovic (1989): An Estimated Model of Entrepreneurial Choice under<br />
Liquidity Constraints, Journal of Political Economy 97, 808−827.<br />
Fritsch, M. (2008): Die Arbeitsplatzeffekte von Gründungen – Ein Überblick über den Stand<br />
der Forschung, Zeitschrift für Arbeitsmarktforschung 41, 55−69.<br />
Fritsch, M., R. Grotz, U. Brixy, M. Niese und A. Otto (2002): Die statistische Erfassung von<br />
Gründungen – Ein Vergleich von Beschäftigtenstatistik, Gewerbeanzeigenstatistik<br />
und den Mannheimer Gründungspanels, Allgemeines Statistisches Archiv 86, 87–<br />
96.<br />
Fritsch, M. and P. Müller (2004): Der Einfluss von Gründungsprozessen auf die Regionalentwicklung<br />
im Zeitablauf, Regional Studies 38, 961−975.<br />
Furdas, M. und K. Kohn (2010): What’s the Difference?! Gender, Personality, and the Propensity<br />
to Start a Business, IZA Discussion Paper 4478, Bonn.<br />
Fryges, H., K. Kohn und S. Gottschalk (2010): The <strong>KfW</strong>/ZEW Start-up Panel: Design and<br />
Research Potential, Schmollers Jahrbuch 130, 117−131.<br />
Gompers, P. und J. Lerner (2003): Equity Financing, in: Z. J. Acs und D. B. Audretsch<br />
(Hrsg.), Handbook of Entrepreneurship Research, 267−298, Kluwer, New York.<br />
Gottschalk, S., H. Gude, S. Kanzen, K. Kohn, G. Licht, K. Müller, M. Niefert und H. Spengler<br />
(2008): <strong>KfW</strong>/ZEW-Gründungspanel für Deutschland – Beschäftigung, Finanzierung<br />
und Markteintrittsstrategien junger Unternehmen, Creditreform, <strong>KfW</strong> Bankengruppe<br />
und ZEW, Mannheim.<br />
Gottschalk, S. und S. Theuer (2008): Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf<br />
das Gründungsgeschehen in Deutschland, ZEW Discussion Paper 08-032, Mannheim.<br />
Gräb, C. und M. Zwick (2002): Die Umsatzsteuerstatistik, in: M. Fritsch und R. Grotz (Hrsg.),<br />
Das Gründungsgeschehen in Deutschland – Darstellung und Vergleich der Datenquellen,<br />
Physica, Heidelberg, 129−140.<br />
Günterberg, B. (2008): Berechnungsmethode der Gründungs- und Liquidationsstatistik des<br />
IfM Bonn, Arbeitspapier, Institut für Mittelstandsforschung Bonn.
Literatur 95<br />
Günterberg, B., K. Kohn und M. Niefert (2010): “Unternehmensfluktuation: Aktuelle Entwicklungen<br />
im Gründungs- und Liquidationsgeschehen”, in: <strong>KfW</strong>, Creditreform, IfM, RWI,<br />
ZEW (Hrsg.), Mittelstandsmonitor 2010 – konjunkturelle Stabilisierung im Mittelstand<br />
– aber viele Belastungsfaktoren bleiben, Frankfurt am Main, 39−69.<br />
Heger, D., D. Höwer, G. Licht, G. Metzger und W. Sofka (2009): Hightech-Gründungen in<br />
Deutschland – Optimismus trotz Krise, ZEW Mannheim in Zusammenarbeit mit<br />
Microsoft Deutschland, Mannheim.<br />
IFB (2009): Entwicklung der Zahl der Selbstständigen in den Freien Berufen in Deutschland<br />
(1950-2009), Institut für Freie Berufe an der Universität Nürnberg, http://www.freieberufe.de/fileadmin/freie-berufe.de/<strong>pdf</strong>/Statistik/1__Selbst_FB_BRD_50-09.<strong>pdf</strong>,<br />
Zugriff 30.05.2010.<br />
ifo (2010): Die Kredithürde – Ergebnisse des ifo-Konjunkturtests im April 2010, ifo Institut für<br />
Wirtschaftsforschung an der Universität München, http://www.cesifogroup.de/portal/page/portal/ifoContent/N/data/Indices/KredKl/Kredit2_Container/Kre<br />
dit2-PDFs/Kredit_201004_EN.<strong>pdf</strong>, Zugriff 06.05.2010.<br />
<strong>KfW</strong> Bankengruppe (Hrsg.) (2004): Chefinnensache – Frauen in der unternehmerischen Praxis,<br />
Physica, Heidelberg.<br />
Kohn, K. (2009): Marktversagen und Gründungshemmnisse – Was können wir aus der empirischen<br />
Literatur lernen?, FINANZ BETRIEB 11, 678−684.<br />
Kohn, K. und K. Mark (2009): Mikrofinanzierung von Gründungen, in: <strong>KfW</strong>, Creditreform, IfM,<br />
RWI, ZEW (Hrsg.), Mittelstandsmonitor 2009 – Deutsche Wirtschaft in der Rezession<br />
– Talfahrt auch im Mittelstand, Frankfurt, 73−106.<br />
Kohn, K., M. Niefert und K. Ullrich (2010): “Gründer aus der Arbeitslosigkeit: Motive, Projekte<br />
und Beitrag zum Gründungsgeschehen”, in: <strong>KfW</strong>, Creditreform, IfM, RWI, ZEW<br />
(Hrsg.), Mittelstandsmonitor 2010 – konjunkturelle Stabilisierung im Mittelstand –<br />
aber viele Belastungsfaktoren bleiben, Frankfurt, 71−107.<br />
Kohn, K. und H. Spengler (2007a): <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> 2007. Gründungen im Vollerwerb<br />
stark rückläufig – Aussicht auf Trendwende in 2007, <strong>KfW</strong> Bankengruppe, Frankfurt.<br />
Kohn, K. und H. Spengler (2007b): Unternehmensgründungen von Personen mit Migrationshintergrund,<br />
FINANZ BETRIEB 9, 706−710.
96 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Kohn, K. und H. Spengler (2008a): Finanzierungsstruktur von Existenzgründungen in<br />
Deutschland, FINANZ BETRIEB 10, 72−76.<br />
Kohn, K. und H. Spengler (2008b): <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> 2008. Gründungen in Deutschland:<br />
weniger aber besser – Chancenmotiv rückt in den Vordergrund. <strong>KfW</strong> Bankengruppe,<br />
Frankfurt.<br />
Kohn, K. und H. Spengler (2008c): Gründungsintensität, Gründungsqualität und alternde<br />
Bevölkerung, Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship 56, 253−271.<br />
Kohn, K. und H. Spengler (2008d): Subjective Perceptions and the Survival of Business<br />
Start-Ups – An Instrumental Variable Approach, Manuskript, <strong>KfW</strong> Bankengruppe,<br />
Frankfurt.<br />
Kohn, K. und H. Spengler (2009): <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> 2009. Abwärtsdynamik im Gründungsgeschehen<br />
gebremst – weiterhin wenige innovative Projekte, <strong>KfW</strong> Bankengruppe,<br />
Frankfurt.<br />
Konold, M. (2006): Möglichkeiten der Analyse von Arbeitsmarktübergängen mit Daten des<br />
Mikrozensus-Panels, in: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Landesämter<br />
(Hrsg.), Amtliche Mikrodaten für die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften – Beiträge<br />
zu den Nutzerkonferenzen des FDZ der Statistischen Landesämter 2005, 55−67.<br />
Kulicke, M. (2000): Finanzierungsbedarf (Höhe, Art) und Finanzierungsprobleme bei Existenzgründungen<br />
im Dienstleistungsbereich, Fraunhofer IRB, Stuttgart.<br />
Lechler, T. und H. Gemünden (2003): Gründerteams. Chancen und Risiken für den Unternehmenserfolg,<br />
DtA-Publikationen zu Gründung und Mittelstand, Heidelberg, Physica.<br />
Leicht, R. und F. Welter (Hrsg.) (2004): Gründerinnen und selbständige Frauen – Potenziale,<br />
Strukturen und Entwicklungen in Deutschland, von Loeper, Karlsruhe.<br />
Leiner, R. (2002): Die Gewerbeanzeigenstatistik, in: M. Fritsch und R. Grotz (Hrsg.), Das<br />
Gründungsgeschehen in Deutschland – Darstellung und Vergleich der Datenquellen,<br />
Physica, Heidelberg, 103−127.<br />
Lévesque, M. und M. Minniti (2006), The Effect of Aging on Entrepreneurial Behavior, Journal<br />
of Business Venturing 21, 177−194.<br />
Meager, N. (1992): Does Unemployment Lead to Self-employment? Journal of Small Business<br />
Economics 4, 87−104.
Literatur 97<br />
Metzger, G. (2007): On the Role of Entrepreneurial Experience for Start-up Financing – An<br />
Empirical Investigation for Germany, Discussion Paper 07-047, ZEW Mannheim.<br />
Metzger, G., M. Niefert und G. Licht (2008): High-Tech-Gruendungen in Deutschland –<br />
Trends, Strukturen, Potenziale, Studie in Zusammenarbeit mit Microsoft, ZEW<br />
Mannheim.<br />
Meurer, P. und G. Stenke (2007): Innovationsleistung und Innovationspotenzial der Metropolregion<br />
Bremen-Oldenburg im Nordwesten. BAW.kompakt Nr. 16, Bremen.<br />
Nathusius, K. (2001): Grundlagen der Gründungsfinanzierung. Instrumente – Prozesse –<br />
Beispiele, Gabler, Wiesbaden.<br />
Niefert, M. (2010): Characteristics and Determinants of Start-ups from Unemployment: Evidence<br />
from German Micro Data, Journal of Small Business and Entrepreneurship,<br />
im Erscheinen.<br />
Niese, M. (2002): Die Erhebungen der Statistischen Ämter, in: M. Fritsch und R. Grotz<br />
(Hrsg.), Das Gründungsgeschehen in Deutschland – Darstellung und Vergleich der<br />
Datenquellen, Physica, Heidelberg, 21−53.<br />
Noll, S., A. Nivorozhkin und J. Wolff (2006): Förderung mit dem Einstiegsgeld nach § 29<br />
SGB II. Erste Befunde zur Implementation und Deskription, IAB Forschungsbericht<br />
23/2006, Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.<br />
OECD (Hrsg.) (2009): Policy Responses to the Economic Crisis: Investing in Innovation for<br />
Long-Term Growth. OECD, Paris.<br />
Parker, S. C. (2004): The Economics of Self-Employment and Entrepreneurship, Cambridge<br />
University Press, New York.<br />
Piorkowsky, M.-B., S. Fleißig und A. Junghanns (2009): Selbständigkeit in Deutschland<br />
1997– 2007. Der erste Selbständigen-Monitor für Deutschland, mit dem vollständigen<br />
Datensatz der Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes, Universität Bonn,<br />
Bonn.<br />
Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (Hrsg.) (2009): Im Sog der Weltrezession – Gemeinschaftsdiagnose<br />
Frühjahr 2009, Dienstleistungsauftrag des Bundesministeriums für<br />
Wirtschaft und Technologie, München et al.
98 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (Hrsg.) (2010): Erholung setzt sich fort – Risiken<br />
bleiben groß. Gemeinschaftsdiagnose Frühjahr 2010. Dienstleistungsauftrag des<br />
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, Essen.<br />
Reinberg, A. und M. Hummel (2005): Vertrauter Befund – Höhere Bildung schützt auch in der<br />
Krise vor Arbeitslosigkeit, IAB-Kurzbericht 9/2005, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung,<br />
Nürnberg.<br />
Reinhart, C. M. und K. S. Rogoff (2008): This Time is Different: A Panoramic View of Eight<br />
Centuries of Financial Crises, NBER Working Paper No. 13882.<br />
Reize, F. (2010): Gibt es eine Kreditklemme im Mittelstand?, <strong>KfW</strong>-Research Standpunkt<br />
Nr. 2, <strong>KfW</strong> Bankengruppe, Frankfurt.<br />
Reize, F. und V. Zimmermann (2009): <strong>KfW</strong>-Mittelstandspanel 2009. 2008 – Wirtschaftskrise<br />
erfasst auch Mittelstand: Investitionen steigen noch, aber Innovationen lassen nach.<br />
<strong>KfW</strong> Bankengruppe, Frankfurt.<br />
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2010): Eckdaten<br />
der Arbeitslosigkeit, Tabelle 090, Stand 13.04.2010<br />
www.sachverstaendigenrat.org: Startseite > Zeitreihen > Lange Reihen > Nationale<br />
Tabellen > Arbeitsmarkt, Zugriff 11.05.2010.<br />
Schmidt, S. (2000): Erwerbstätigkeit im Mikrozensus. Konzept, Definition, Umsetzung.<br />
Arbeitsbericht 2000/01, ZUMA Mannheim.<br />
Schneid, M. und A. Stiegler (2006): CATI – Wohin geht der Weg? planung & analyse<br />
3/2006, 16−27.<br />
Schoenwald, S. (2010): Die Kreditversorgung der Unternehmen in der Krise, <strong>KfW</strong>-Research<br />
Standpunkt Nr. 3, <strong>KfW</strong> Bankengruppe, Frankfurt.<br />
Spengler, H. und P. Tilleßen (2006): <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong> 2006. Gründungen aus der Arbeitslosigkeit<br />
rückläufig – Trends zu Dienstleistungs- und Mikrogründungen halten<br />
an, <strong>KfW</strong> Bankengruppe, Frankfurt.<br />
Statistisches Bundesamt (2009): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit – Mikrozensus 2008.<br />
Stand und Entwicklung der Erwerbstätigkeit, Band 1, Fachserie 1, Reihe 4.1.1.,<br />
Stand 29.07.2009, Wiesbaden.<br />
Statistisches Bundesamt (2010a): Erwerbslosenstatistik nach dem ILO-Konzept, Genesis<br />
online, Tabelle 13231-0001, Wiesbaden, Zugriff 19.04.2010.
Literatur 99<br />
Statistisches Bundesamt (2010b): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen – Inlandsproduktberechnung,<br />
detaillierte Jahresberichte, Fachserie 18, Reihe 1.4,<br />
Stand 24.03.2010, Wiesbaden.<br />
Statistisches Bundesamt (2010c): Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal 2010 leicht gewachsen.<br />
Pressemitteilung Nr. 170 vom 12.05.2010.<br />
Statistisches Bundesamt (2010d): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen – Einwohner und<br />
Erwerbsbeteiligung, http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/<br />
Internet/DE/Content/Statistiken/Arbeitsmarkt/ILOArbeitsmarktstatistik/Tabellen/<br />
Content50/EinwohnerErwerbsbeteiligung,templateId=renderPrint.psml,<br />
Zugriff 30.05.2010.<br />
Statistisches Bundesamt (2010e): Unternehmen und Betriebe im Unternehmensregister,<br />
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statisti<br />
ken/UnternehmenGewerbeInsolvenzen/Unternehmensregister/Aktuell.psml,<br />
Zugriff 27.05.2010.<br />
Statistisches Bundesamt (2010f): Bevölkerung, Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbspersonen,<br />
Nichterwerbspersonen [jeweils im Alter von 15 bis unter 65 Jahren]: Deutschland,<br />
Jahre, Geschlecht, Genesis Online, Tabelle 12211-0001, Zugriff 04.06.2010.<br />
Statistisches Bundesamt (2010g): Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im<br />
4. Quartal 2009. Pressemitteilung Nr. 061 vom 24.02.2010.<br />
van der Sluis, J., M. van Praag und A. van Witteloostuijn (2007): Why Are the Returns to<br />
Education Higher for Entrepreneurs than for Employees?, IZA Discussion Paper<br />
3058, Bonn.<br />
van Praag, M. (2003), Business Survival and Success of Young Small Business Owners,<br />
Small Business Economics 21, 1–17.<br />
van Praag, B. M. S. und A. S. Booij (2003), Risk Aversion and the Subjective Time Discount<br />
Rate: A Joint Approach, CESifo Working Paper 923, München.<br />
Wagner, G. G., J. R. Frick und J. Schupp (2007): The German Socio-Economic Panel Study<br />
(SOEP) – Scope, Evolution and Enhancements, Schmollers Jahrbuch 127,<br />
139−169.
100 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Wagner, J. (2006): Politikrelevante Folgerungen aus Analysen mit Wirtschaftsstatistischen<br />
Einzeldaten der Amtlichen Statistik, Working Papers Series in Economics, Nr. 16,<br />
Universität Lüneburg, Lüneburg.<br />
Wagner, J. (2007): What a difference a Y makes – Female and Male Nascent Entrepreneurs<br />
in Germany, Small Business Economics 28, 1−21.<br />
Werner, A. (2007): Entrepreneurial Signalling – Eine theoretische und empirische Analyse<br />
des Einflusses von höheren Bildungssignalen und Patenten auf innovative Unternehmensgründungen,<br />
Rainer Hampp, München und Mering.
Anhang<br />
Bis unter 5.000<br />
5.000 bis unter 20.000<br />
20.000 bis unter 100.000<br />
100.000 bis unter 500.000<br />
500.000 und mehr<br />
1,43<br />
0,43<br />
0,99<br />
1,62<br />
0,67<br />
0,95<br />
1,40<br />
0,58<br />
0,82<br />
0,46<br />
2007 2008 2009<br />
1,43<br />
0,98<br />
1,35<br />
1,89<br />
2,34<br />
1,23<br />
0,53<br />
0,70<br />
0,78<br />
1,01<br />
1,25<br />
0,51<br />
0,74<br />
1,79<br />
1,50<br />
0,58<br />
0,92<br />
0,78<br />
1,14<br />
1,92<br />
0,78<br />
0,90<br />
1,68<br />
1,58<br />
0,69<br />
0,90<br />
1,43<br />
0,56<br />
0,87<br />
1,03<br />
1,04<br />
1,01<br />
0,95<br />
0% 1% 2% 3% 0% 1% 2% 3% 0% 1% 2% 3%<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb 95%-Konfidenzintervall<br />
Die Gründerquoten wurden auf Grundlage der folgenden Stichprobenumfänge bestimmt (2007, 2008, 2009). n=6.481, 4.277,<br />
10.123 für Orte unter 5.000 Einwohner, n=9.671, 6.473, 12.689 für Orte von 5.000 bis unter 20.000 Einwohner, n=9.916, 6.307,<br />
11.937 für Orte von 20.000 bis unter 100.000 Einwohner, n=6.423, 3.726, 6.373 für Orte von 100.000 bis unter 500.000 Einwohner,<br />
n=5.129, 3.978, 6.908 für Orte ab 500.000 Einwohner.<br />
Grafik 19: Gründerquoten nach Gemeindegrößenklassen<br />
2,07<br />
1,96
102 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Neugründung<br />
Übernahme<br />
Beteiligung<br />
8,0<br />
4,6<br />
13,6<br />
13,9<br />
2007 2008 2009<br />
24,7<br />
31,3<br />
67,3<br />
64,1<br />
72,4<br />
6,6<br />
8,4<br />
5,2<br />
20,0<br />
12,9<br />
26,0<br />
0% 20% 40% 60% 80%100% 0% 20% 40% 60% 80%100% 0% 20% 40% 60% 80%100%<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb 95%-Konfidenzintervall<br />
Die Zahlen neben den Balken geben die Anteile der Gründer der jeweiligen Gründergruppen an allen (n=758, 630, 650) Gründern,<br />
an allen (n=292, 279, 295) Vollerwerbsgründern bzw. allen (n=463, 348, 351) Nebenerwerbsgründern wieder, die Angaben<br />
zur Form ihres Gründungsprojektes gemacht haben (erste Angabe für 2007, zweite Angabe für 2008, dritte Angabe für<br />
2009). Lesehilfe: 67,3 % der Vollerwerbsgründer im Jahr 2009 haben eine Neugründung unternommen.<br />
Grafik 20: Form der Gründung (Neugründung, Übernahme oder Beteiligung)<br />
73,4<br />
68,8<br />
78,7<br />
12,6<br />
6,6<br />
19,3<br />
18,2<br />
13,4<br />
22,6<br />
69,2<br />
67,3<br />
70,8
Anhang 103<br />
Verarbeitendes Gewerbe<br />
Baugewerbe<br />
Handel<br />
Versicherungs-/Finanzdienstleistungen<br />
Wirtschaftliche Dienstleistungen<br />
Persönliche Dienstleistungen<br />
Sonstige Wirtschaftszweige<br />
3,8<br />
2,8<br />
4,5<br />
8,4<br />
13,2<br />
5,6<br />
5,4<br />
7,7<br />
4,0<br />
2007 2008 2009<br />
10,3<br />
11,5<br />
9,6<br />
23,0<br />
19,6<br />
25,1<br />
27,5<br />
27,0<br />
27,5<br />
21,6<br />
18,2<br />
23,7<br />
3,7<br />
2,0<br />
5,1<br />
7,0<br />
10,4<br />
4,3<br />
5,6<br />
4,4<br />
6,6<br />
9,8<br />
9,0<br />
10,4<br />
19,2<br />
20,5<br />
18,1<br />
27,9<br />
33,4<br />
23,8<br />
26,8<br />
20,2<br />
31,6<br />
3,2<br />
5,1<br />
1,7<br />
6,7<br />
10,8<br />
3,3<br />
5,0<br />
8,4<br />
2,2<br />
12,6<br />
8,8<br />
15,9<br />
20,3<br />
19,7<br />
20,8<br />
28,6<br />
26,5<br />
30,0<br />
23,7<br />
20,6<br />
26,2<br />
0% 10% 20%30% 40% 0% 10% 20%30% 40% 0% 10% 20% 30%40%<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb 95%-Konfidenzintervall<br />
Die Zahlen neben den Balken geben die Anteile der Gründer der jeweiligen Gründergruppen an allen (n=743, 630, 611) Gründern,<br />
an allen (n=289, 276, 271) Vollerwerbs- bzw. allen (n=451, 352, 336) Nebenerwerbsgründern wieder, für deren Projekte<br />
Branchenangaben zur Verfügung stehen (erste Angabe für 2007, zweite Angabe für 2008, dritte Angabe für 2009). Lesehilfe:<br />
10,8 % der Vollerwerbsgründer im Jahr 2009 haben eine Gründung im Baugewerbe vollzogen.<br />
Grafik 21: Gründer nach Branche
104 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Freie Berufe<br />
Handwerk<br />
Andere Berufsgruppe<br />
2007 2008 2009<br />
21,9<br />
22,6<br />
21,0<br />
18,4<br />
15,7<br />
23,2<br />
59,7<br />
54,1<br />
63,3<br />
17,8<br />
19,2<br />
16,1<br />
29,2<br />
27,6<br />
30,6<br />
0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80%<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb 95%-Konfidenzintervall<br />
Die Zahlen neben den Balken geben die Anteile der Gründer der jeweiligen Gründergruppen an allen (n=743, 630, 611) Gründern,<br />
an allen (n=289, 276, 271) Vollerwerbs- bzw. allen (n=451, 352, 336) Nebenerwerbsgründern wieder, für die Angaben zur<br />
Berufsgruppe verfügbar sind (erste Angabe für 2007, zweite Angabe für 2008, dritte Angabe für 2009). Lesehilfe: 24 % der<br />
Vollerwerbsgründer im Jahr 2009 haben sich im Handwerk selbstständig gemacht.<br />
Grafik 22: Gründer nach Berufsgruppe<br />
53,0<br />
53,3<br />
53,3<br />
16,7<br />
10,8<br />
27,6<br />
25,0<br />
29,8<br />
24,0<br />
55,7<br />
51,1<br />
59,4
Anhang 105<br />
Keine Marktneuheit<br />
Regionale Marktneuheit<br />
Deutschlandweite Marktneuheit<br />
Weltweite Marktneuheit<br />
8,2<br />
11,7<br />
6,2<br />
3,6<br />
2,2<br />
4,3<br />
3,9<br />
5,1<br />
2,8<br />
2007 2008 2009<br />
84,4<br />
81,0<br />
86,7<br />
8,8<br />
9,1<br />
8,6<br />
4,2<br />
3,6<br />
4,6<br />
2,0<br />
2,1<br />
2,0<br />
85,0<br />
85,3<br />
84,8<br />
8,6<br />
9,8<br />
7,8<br />
1,8<br />
2,4<br />
1,4<br />
2,0<br />
2,8<br />
1,3<br />
0% 30% 60% 90% 0% 30% 60% 90% 0% 30% 60% 90%<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb 95%-Konfidenzintervall<br />
Die Zahlen neben den Balken geben die Anteile der Gründer der jeweiligen Gründergruppen an allen (n=791, 649, 664) Gründern,<br />
an allen (n=300, 283, 293) Vollerwerbsgründern bzw. allen (n=486, 363, 367) Nebenerwerbsgründern wieder, die Angaben<br />
zur Form ihres Gründungsprojektes gemacht haben (erste Angabe für 2007, zweite Angabe für 2008, dritte Angabe für<br />
2009). Lesehilfe: 9,8 % der Vollerwerbsgründer im Jahr 2009 bieten ein Produkt an, das eine regionale Marktneuheit darstellt.<br />
Grafik 23: Neuheitsgrad der angebotenen Produkte und Dienstleistungen<br />
87,5<br />
85,0<br />
89,5
106 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Sologründer ohne Mitarbeiter<br />
Sologründer mit Mitarbeitern<br />
Teamgründer ohne Mitarbeiter<br />
Teamgründer mit Mitarbeitern<br />
12,4<br />
19,8<br />
8,0<br />
11,2<br />
6,3<br />
14,4<br />
14,0<br />
13,6<br />
14,3<br />
2007 2008 2009<br />
62,4<br />
60,2<br />
63,4<br />
17,0<br />
25,1<br />
10,7<br />
9,6<br />
6,5<br />
12,0<br />
10,7<br />
8,9<br />
12,2<br />
62,8<br />
59,5<br />
65,0<br />
23,4<br />
30,4<br />
17,6<br />
6,7<br />
3,0<br />
9,8<br />
14,6<br />
16,4<br />
13,4<br />
55,2<br />
50,2<br />
59,2<br />
0% 30% 60% 90% 0% 30% 60% 90% 0% 30% 60% 90%<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb 95%-Konfidenzintervall<br />
Die Zahlen neben den Balken geben die Anteile der Gründer der jeweiligen Gründergruppen an allen (n=733, 646, 657) Gründern,<br />
an allen (n=286, 283, 292) Vollerwerbsgründern bzw. allen (n=442, 360, 362) Nebenerwerbsgründern wieder, für die<br />
Angaben zur Anzahl der Mitarbeiter und zur Anzahl der Teampartner verfügbar sind (erste Angabe jeweils für 2007, zweite<br />
Angabe für 2008, dritte Angabe für 2009). Lesehilfe: 30,4 % der Gründer im Vollerwerb im Jahr 2009 haben ohne Teampartner<br />
(als Sologründer), aber mit Mitarbeitern gegründet.<br />
Grafik 24: Größe der Gründung
Anhang 107<br />
Sologründer ohne Mitarbeiter<br />
Sologründer mit Mitarbeitern<br />
Teamgründer ohne Mitarbeiter<br />
Teamgründer mit Mitarbeitern<br />
11,4<br />
16,7<br />
7,9<br />
8,5<br />
6,9<br />
9,8<br />
9,0<br />
10,3<br />
8,2<br />
2007 2008 2009<br />
71,1<br />
66,2<br />
74,1<br />
17,4<br />
24,5<br />
10,9<br />
6,5<br />
6,6<br />
6,4<br />
6,4<br />
4,7<br />
8,0<br />
69,8<br />
64,2<br />
74,6<br />
5,7<br />
3,3<br />
7,8<br />
25,4<br />
29,8<br />
21,4<br />
10,0<br />
13,0<br />
7,6<br />
58,9<br />
53,9<br />
63,2<br />
0% 30% 60% 90% 0% 30% 60% 90% 0% 30% 60% 90%<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb 95%-Konfidenzintervall<br />
Die Zahlen neben den Balken geben die Anteile der Neugründer der jeweiligen Gründergruppen an allen (n=478, 472, 479)<br />
Neugründern, an allen (n=201, 222, 221) Neugründern im Vollerwerb bzw. allen (n=275, 247, 256) Gründern im Nebenerwerb<br />
wieder, für die Angaben zur Anzahl der Mitarbeiter und zur Anzahl der Teampartner verfügbar sind (erste Angabe jeweils für<br />
2007, zweite Angabe für 2008, dritte Angabe für 2009). Lesehilfe: 29,8 % der Neugründer im Vollerwerb im Jahr 2009 haben<br />
ohne Teampartner (als Sologründer), aber mit Mitarbeitern gegründet.<br />
Grafik 25: Größe der Neugründung
108 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Deutsche Staatsbürgerschaft<br />
schon immer vorhanden<br />
Deutsche Staatsbürgerschaft durch<br />
Einbürgerung oder als Spätaussiedler<br />
EU27-Ausländer<br />
Sonstige Ausländer<br />
7,6<br />
8,0<br />
7,4<br />
4,9<br />
5,2<br />
4,8<br />
9,0<br />
12,5<br />
5,8<br />
2008 2009<br />
78,4<br />
74,4<br />
82,0<br />
6,8<br />
9,6<br />
4,5<br />
6,5<br />
4,2<br />
8,5<br />
6,6<br />
9,1<br />
4,7<br />
80,1<br />
77,1<br />
82,4<br />
0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb 95%-Konfidenzintervall<br />
Die Zahlen neben den Balken geben die Anteile der Gründer der jeweiligen Gründergruppen an allen (n=602) Gründern, an<br />
allen (n=264) Vollerwerbs- bzw. allen (n=335) Nebenerwerbsgründern wieder, für die Angaben zur Staatsangehörigkeit verfügbar<br />
sind (erste Angabe jeweils für 2008, zweite Angabe für 2009). Lesehilfe: 9,1 % der Vollerwerbsgründer im Jahr 2009 waren<br />
nicht aus der EU stammende Ausländer.<br />
Grafik 26: Gründer nach Staatsangehörigkeit
Anhang 109<br />
Universität<br />
Fachhochschule, Berufsakademie u.ä.<br />
Fachschule, Meisterschule<br />
Lehre, Berufsfachschule<br />
Kein Berufsabschluss<br />
5,4<br />
6,0<br />
4,9<br />
15,2<br />
16,9<br />
14,0<br />
10,3<br />
11,2<br />
9,6<br />
2008 2009<br />
23,5<br />
17,9<br />
27,4<br />
45,6<br />
48,0<br />
44,1<br />
8,6<br />
9,1<br />
8,4<br />
13,8<br />
13,8<br />
13,6<br />
8,4<br />
13,0<br />
4,7<br />
28,3<br />
21,3<br />
34,0<br />
40,8<br />
42,8<br />
39,4<br />
0% 20% 40% 60% 0% 20% 40% 60%<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb 95%-Konfidenzintervall<br />
Die Zahlen neben den Balken geben die Anteile der Gründer der jeweiligen Gründergruppen an allen (n=584) Gründern, an<br />
allen (n=256) Vollerwerbs- bzw. allen (n=326) Nebenerwerbsgründern wieder, für die Angaben zum Berufsabschluss verfügbar<br />
sind (erste Angabe jeweils für 2008, zweite Angabe für 2009). Lesehilfe: 13,8 % aller Gründer besitzen einen Universitätsabschluss.<br />
Grafik 27: Gründer nach Berufsabschluss
110 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Angestellte Unternehmensleiter<br />
Leitende/hochqualifizierte Angestellte<br />
Sonstige Angestellte<br />
Beamte<br />
Facharbeiter<br />
Sonstige Arbeiter<br />
Selbstständige<br />
Arbeitslose<br />
Nicht-Erwerbspersonen<br />
2007 2008 2009<br />
1,1<br />
1,9<br />
0,6<br />
15,6<br />
15,8<br />
15,5<br />
22,4<br />
21,6<br />
22,8<br />
3,3<br />
0,6<br />
4,9<br />
5,7<br />
5,2<br />
6,0<br />
2,8<br />
0,5<br />
4,3<br />
6,2<br />
6,9<br />
5,7<br />
17,5<br />
30,7<br />
9,2<br />
25,5<br />
16,8<br />
30,9<br />
4,0<br />
6,1<br />
2,1<br />
13,6<br />
17,6<br />
10,2<br />
21,7<br />
15,8<br />
26,6<br />
2,5<br />
1,0<br />
3,9<br />
4,6<br />
4,2<br />
5,0<br />
1,6<br />
1,4<br />
1,7<br />
10,6<br />
7,9<br />
12,9<br />
20,7<br />
32,4<br />
10,8<br />
20,7<br />
13,5<br />
26,8<br />
6,4<br />
6,8<br />
6,0<br />
12,6<br />
12,9<br />
12,4<br />
24,9<br />
26,0<br />
23,9<br />
1,9<br />
0,5<br />
3,2<br />
3,4<br />
1,6<br />
5,1<br />
1,7<br />
1,9<br />
1,5<br />
10,7<br />
11,3<br />
10,1<br />
21,4<br />
28,0<br />
15,0<br />
17,0<br />
11,0<br />
22,9<br />
0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40%<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb 95%-Konfidenzintervall<br />
Die Zahlen neben den Balken geben die Anteile der Gründer der jeweiligen Gründergruppen an allen (n=755, 572, 571) Gründern,<br />
an allen (n=312, 217, 259) Vollerwerbs- bzw. allen (n=443, 354, 312) Nebenerwerbsgründern wieder, für die Angaben<br />
zum Erwerbsstatus vor Gründung verfügbar sind (erste Angabe jeweils für 2007, zweite Angabe für 2008, dritte Angabe für<br />
2009). Lesehilfe: 17,6 % der Vollerwerbsgründer im Jahr 2009 waren vor ihrer Gründung als leitende oder hoch qualifizierte<br />
Angestellte beschäftigt.<br />
Grafik 28: Gründer nach Erwerbsstatus
Anhang 111<br />
Ausnutzung Geschäftsidee<br />
Fehlende Erwerbsalternativen<br />
Sonstiger Hauptgrund<br />
2008 2009<br />
30,6<br />
29,6<br />
31,5<br />
35,0<br />
31,1<br />
34,3<br />
30,8<br />
39,6<br />
37,3<br />
19,5<br />
27,3<br />
26,9<br />
33,9<br />
32,9<br />
39,2<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50%<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb 95%-Konfidenzintervall<br />
Die Zahlen neben den Balken geben die Anteile der Gründer der jeweiligen Gründergruppen an allen (n=592) Gründern, an<br />
allen (n=256) Vollerwerbs- bzw. allen (n=332) Nebenerwerbsgründern wieder, für die Angaben zum Gründungsmotiv verfügbar<br />
sind (erste Angabe jeweils für 2008, zweite Angabe für 2009). Lesehilfe: Bei 35,3 % der Vollerwerbsgründer im Jahr 2009 stellte<br />
die Ausnutzung einer Geschäftsidee das vorrangige Gründungsmotiv dar.<br />
Grafik 29: Gründer nach hauptsächlichem Gründungsmotiv<br />
39,0<br />
39,8<br />
41,5
112 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Selbstverwirklichung<br />
Pekuniäre Gründe<br />
Familiäre / private Gründe<br />
Geschäftsübergabe<br />
Andere Gründe<br />
3,6<br />
5,2<br />
2,6<br />
4,6<br />
8,3<br />
13,4<br />
14,2<br />
13,0<br />
17,8<br />
10,0<br />
2008 2009<br />
30,3<br />
37,7<br />
37,4<br />
49,5<br />
52,5<br />
0,9<br />
4,5<br />
4,9<br />
10,1<br />
10,3<br />
12,6<br />
22,5<br />
20,2<br />
20,3<br />
28,0<br />
32,4<br />
29,9<br />
29,1<br />
30,7<br />
43,7<br />
0% 20% 40% 60% 0% 20% 40% 60%<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb 95%-Konfidenzintervall<br />
Die Zahlen neben den Balken geben die Anteile der Gründer der jeweiligen Gründergruppen an allen (n=199) Gründern, an<br />
allen (n=77) Vollerwerbs- bzw. allen (n=122) Nebenerwerbsgründern wieder, für die Angaben zu sonstigen hauptsächlichen<br />
Gründungsmotiven (Motive außer „Ausnutzung einer Geschäftsidee“ oder „Ermangelung von Erwerbsalternativen“) verfügbar<br />
sind (erste Angabe jeweils für 2008, zweite Angabe für 2009). Lesehilfe: 52,5 % der Nebenerwerbsgründer im Jahr 2009, die<br />
ein sonstiges hauptsächliches Gründungsmotiv angaben, gründeten hauptsächlich aus pekuniären Gründen.<br />
Grafik 30: Verteilung sonstiger Gründungsmotive
Anhang 113<br />
Tabelle 7: Gründerquoten nach Region, 2000–2009<br />
Deutschland West Ost<br />
Gesamt Vollerwerb Nebenerwerb<br />
Gesamt Vollerwerb Nebenerwerb<br />
Gesamt Vollerwerb Nebenerwerb<br />
2000 2,43 1,12 1,31 2,45 1,09 1,36 2,32 1,23 1,09<br />
2001 2,92 1,16 1,76 2,91 1,09 1,82 2,94 1,42 1,52<br />
2002 2,76 1,26 1,50 2,86 1,24 1,62 2,36 1,37 0,99<br />
2003 2,84 1,24 1,60 2,99 1,27 1,72 2,25 1,12 1,13<br />
2004 2,59 1,24 1,35 2,64 1,15 1,49 2,38 1,58 0,80<br />
2005 2,47 1,17 1,30 2,55 1,12 1,43 2,15 1,36 0,79<br />
2006 2,10 0,86 1,24 2,07 0,84 1,23 2,20 0,92 1,28<br />
2007 1,66 0,61 1,05 1,72 0,62 1,10 1,43 0,57 0,86<br />
2008 1,54 0,64 0,90 1,61 0,61 1,00 1,22 0,78 0,44<br />
2009 1,69 0,77 0,92 1,78 0,78 1,00 1,30 0,74 0,56<br />
Zur eingeschränkten Vergleichbarkeit der Gründerquoten der Jahre 2000 und 2001 vgl. die Anmerkungen in der Fußnote zu<br />
Grafik 1.<br />
Tabelle 8: Gründerzahlen (hochgerechnet in Tausend) nach Region, 2000–2009<br />
Deutschland West Ost<br />
Gesamt Vollerwerb Nebenerwerb<br />
Gesamt Vollerwerb Nebenerwerb<br />
Gesamt Vollerwerb Nebenerwerb<br />
2000 1.290 596 695 1.054 469 586 233 124 109<br />
2001 1.548 616 932 1.252 470 782 295 143 152<br />
2002 1.461 669 791 1.230 532 698 234 136 99<br />
2003 1.496 655 841 1.280 546 735 222 111 111<br />
2004 1.357 651 706 1.125 491 633 233 155 78<br />
2005 1.286 608 678 1.081 474 607 208 131 77<br />
2006 1.088 446 643 874 357 518 211 88 123<br />
2007 859 315 544 726 262 465 136 54 82<br />
2008 795 330 465 680 256 424 114 73 41<br />
2009 872 397 475 752 329 422 122 69 52<br />
Zur eingeschränkten Vergleichbarkeit der Gründerzahlen der Jahre 2000 und 2001 vgl. die Anmerkungen in der Fußnote zu<br />
Grafik 1.
114 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Tabelle 9: Push- und Pull-Faktoren des Gründungsgeschehens<br />
Veränderung des realen saison- und kalenderbereinigten<br />
BIP in Prozent<br />
Erwerbslosenquote nach ILO-Standard<br />
in Prozent<br />
Veränderung der ILO-Erwerbslosenquote<br />
in Prozent<br />
Bestand an gemeldeten freien Stellen<br />
(Jahresdurchschnitt)<br />
Zugänge zur BA-Förderung der Selbstständigkeit<br />
Veränderung der Zugänge zur BA-Förderung<br />
der Selbstständigkeit in Prozent<br />
nachrichtlich: Gründerquote in Prozent<br />
(<strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>)<br />
nachrichtlich: Anteil Gründer aus der Arbeitslosigkeit<br />
in Prozent (<strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>)<br />
nachrichtlich: Gründungen aus der Arbeitslosigkeit<br />
(<strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>)<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
1,9 3,5 1,4 0 -0,2 0,7 0,9 3,4 2,6 1,0 -4,9<br />
8,2 7,4 7,5 8,3 9,2 9,7 10,6 9,8 8,3 7,2 7,6<br />
-9,0 1,2 9,7 11,4 5,0 8,6 -7,4 -14,7 -12,8 2,5<br />
456.379 515.474 507.241 451.972 354.762 285.607 413.078 564.210 621.391 568.513 485.528<br />
98.114 92.596 95.926 124.885 253.894 351.355 265.134 218.285 158.096 144.119 157.571<br />
--- -5,6 3,6 30,2 103,3 38,4 -24,5 -17,7 -27,6 -8,8 9,3<br />
--- 2,43 2,92 2,76 2,84 2,59 2,47 2,10 1,66 1,54 1,69<br />
--- --- --- --- --- --- 22,3 17,7 17,3 20,5 21,4<br />
--- --- --- --- --- --- 287.000 192.000 148.000 163.000 186.000<br />
Zur eingeschränkten Vergleichbarkeit der Gründerquoten der Jahre 2000 und 2001 vgl. die Anmerkungen in der Fußnote zu Grafik 1.<br />
Quellen: Statistisches Bundesamt (2010a, 2010b,2010d), Bundesagentur für Arbeit (2010d), <strong>KfW</strong>-<strong>Gründungsmonitor</strong>.
Anhang 115<br />
Tabelle 10: Förderung von Existenzgründungen durch die Bundesagentur für Arbeit: Instrumentarium<br />
Zugangsvoraussetzungen<br />
Überbrückungsgeld 1)<br />
(bis 31.7.2006)<br />
• Anspruch auf Alg I oder Teilnahme<br />
an Arbeitsbeschaffungsmaßnahme<br />
nach SGB III<br />
(ab 1.2.2005)<br />
• Tragfähigkeitsbescheinigung<br />
einer fachkundigen Stelle<br />
Leistungen • Überbrückungsgeld für 6 Monate<br />
in Höhe des zuletzt bezogenen<br />
Alg I<br />
• Zzgl. darauf entfallende pauschalierteSozialversicherungsbeiträge<br />
• Soziale Absicherung in eigener<br />
Verantwortung<br />
Sonstiges • Rechtsanspruch auf Förderung<br />
• Restansprüche auf Arbeitslosengeld<br />
können 4 Jahre ab<br />
ihrer Entstehung geltend gemacht<br />
werden<br />
1) existent seit 1986 2) existent seit 2003<br />
Existenzgründungszuschuss 2)<br />
(bis 30.6.2006)<br />
• Anspruch auf Alg I oder Teilnahme<br />
an Arbeitsbeschaffungsmaßnahme<br />
nach SGB III<br />
(ab 1.2.2005)<br />
• Tragfähigkeitsbescheinigung<br />
einer fachkundigen Stelle (ab<br />
1.11.2004)<br />
• Das Einkommen aus Selbstständigkeit<br />
darf 25 TEUR im<br />
Jahr nicht überschreiten.<br />
• Zuschuss für bis zu drei Jahre;<br />
Bewilligung für jeweils ein Jahr<br />
• 600 EUR pro Monat im ersten,<br />
360 EUR pro Monat im zweiten<br />
und 240 EUR pro Monat<br />
im dritten Förderjahr<br />
• Obligatorische Mitgliedschaft<br />
in der gesetzlichen Rentenversicherung<br />
• Nach Ablauf der Förderung<br />
soziale Absicherung in eigener<br />
Verantwortung<br />
• Rechtsanspruch auf Förderung<br />
• Restansprüche auf Arbeitslosengeld<br />
können 4 Jahre ab<br />
ihrer Entstehung geltend gemacht<br />
werden<br />
Gründungszuschuss<br />
(seit 1.8.2006)<br />
• Anspruch auf Alg I von mindestens<br />
90 Tagen oder Teilnahme<br />
an Arbeitsbeschaffungsmaßnahme<br />
nach SGB III<br />
• Tragfähigkeitsbescheinigung<br />
einer fachkundigen Stelle<br />
• Nachweis der persönlichen und<br />
fachlichen Eignung<br />
• Gründungszuschuss für<br />
9 Monate in Höhe des zuletzt bezogenen<br />
Alg I, zzgl. Pauschale<br />
von 300 EUR pro Monat zur sozialen<br />
Absicherung (Pflichtleistung)<br />
• 300 EUR pro Monat für weitere<br />
6 Monate, wenn die geförderte<br />
Person intensive Geschäftstätigkeit<br />
und hauptberufliche unternehmerische<br />
Aktivitäten nachweisen<br />
kann (Ermessensleistung)<br />
• Soziale Absicherung in eigener<br />
Verantwortung<br />
• Rechtsanspruch auf Förderung<br />
• Förderung wird auf Restansprüche<br />
auf Alg I angerechnet<br />
• Freiwillige Weiterversicherung in<br />
der Arbeitslosenversicherung<br />
möglich<br />
Einstiegsgeld (Selbstständigkeit)<br />
(seit 1.1.2005)<br />
• Anspruch auf Alg II • Erwerbsfähigkeit<br />
(mind. 3 Std. Arbeit pro<br />
Tag)<br />
• Langfristig müssen von der<br />
Selbstständigkeit Einkünfte in<br />
solcher Höhe zu erwarten sein,<br />
dass der Anspruch auf Alg II erlischt.<br />
• Zuschuss zum Alg II, dessen<br />
Höhe sich nach der bisherigen<br />
Dauer der Arbeitslosigkeit und<br />
der Größe der Bedarfsgemeinschaft<br />
richtet<br />
• Monatl. Förderbetrag für Alleinstehende:<br />
50 % der Alg II-Regelleistung,<br />
d.h. aktuell ca.<br />
180 EUR; bei gravierenden Vermittlungshemmnissen<br />
oder längerer<br />
Arbeitslosigkeitsdauer max.<br />
100 % der Alg II-Regelleistung<br />
• Dauer der Förderung:<br />
12 Monate, verlängerbar auf maximal<br />
24 Monate<br />
• Bewilligung liegt im Ermessen<br />
des Fallmanagers, kein Rechtsanspruch<br />
auf Förderung<br />
Quelle: Kohn et al., 2010, basierend auf Caliendo und Kritikos, 2009, Caliendo et al., 2009, Noll et al., 2006.
116 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Tabelle 11: Form der Gründung<br />
Neugründung<br />
Deutschland West Ost<br />
Übernahme <br />
Beteiligung <br />
Neugründung <br />
Übernahme<br />
Beteiligung <br />
Neugründung <br />
Übernahme <br />
Beteiligung<br />
Gesamt<br />
2001 61,8 9,6 28,6 58,7 11,5 29,8 73,2 2,4 24,4<br />
2002 60,4 13,9 25,7 60,1 14,2 25,7 61,8 12,4 25,8<br />
2003 70,1 10,2 19,7 68,5 10,7 20,8 78,7 7,4 13,9<br />
2004 71,7 10,5 17,8 71,2 11,3 17,5 74,3 6,9 18,9<br />
2005 69,8 6,5 23,7 68,7 7,2 24,1 75,2 3,1 21,7<br />
2006 62,7 7,1 30,3 64,1 7,8 28,1 57,1 4,6 38,3<br />
2007 67,3 8,0 24,7 67,0 8,7 24,3 69,0 4,2 26,8<br />
2008 73,4 6,6 20,0 73,2 6,3 20,5 74,5 8,1 17,4<br />
2009<br />
Vollerwerb<br />
69,2 12,6 18,2 68,5 13,5 18,1 73,7 7,4 18,9<br />
2001 72,0 13,4 14,6 68,5 16,4 15,1 81,9 4,8 13,3<br />
2002 61,7 20,8 17,5 61,7 21,3 17,0 61,8 18,9 19,3<br />
2003 76,4 14,2 9,4 74,0 16,1 9,9 87,8 5,4 6,9<br />
2004 72,5 16,5 11,0 70,8 19,5 9,9 77,1 8,8 14,1<br />
2005 79,7 7,5 12,8 79,0 9,2 11,8 82,0 2,2 15,8<br />
2006 72,4 10,1 17,4 69,5 11,5 19,0 83,5 5,1 11,4<br />
2007 72,5 13,6 13,9 68,4 15,5 16,1 91,2 4,9 4,0<br />
2008 78,8 8,4 12,9 78,3 7,8 13,9 80,0 10,2 9,8<br />
2009<br />
Nebenerwerb<br />
67,3 19,3 13,4 66,6 21,6 11,8 71,0 8,1 21,0<br />
2001 54,4 6,8 38,9 52,2 8,3 39,6 64,2 0 35,8<br />
2002 59,0 7,5 33,5 58,7 8,3 33,1 60,9 2,7 36,4<br />
2003 65,4 7,1 27,5 64,7 6,7 28,7 69,6 9,5 20,9<br />
2004 71,6 4,5 23,9 72,0 4,7 23,2 68,5 2,9 28,7<br />
2005 60,5 5,5 34,1 60,2 5,6 34,2 62,4 4,7 33,0<br />
2006 55,3 5,0 39,7 60,3 5,2 34,5 35,7 4,4 59,8<br />
2007 64,1 4,6 31,3 65,9 4,8 29,3 55,2 3,8 41,0<br />
2008 68,8 5,2 26,0 69,3 5,4 25,3 64,1 4,1 31,8<br />
2009 70,8 6,6 22,6 70,0 6,6 23,4 77,5 6,4 16,1
Anhang 117<br />
Tabelle 12: Gründeranteile nach Geschlecht und Region<br />
Gesamt<br />
Deutschland West Ost<br />
Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen<br />
2000 59,9 40,1 58,8 41,2 64,3 35,7<br />
2001 62,7 37,3 61,5 38,5 67,4 32,6<br />
2002 66,0 34,0 65,7 34,3 67,6 32,4<br />
2003 61,7 38,3 61,6 38,4 62,4 37,6<br />
2004 64,2 35,8 63,4 36,6 67,6 32,4<br />
2005 63,6 36,4 62,5 37,5 68,7 31,3<br />
2006 59,8 40,2 59,3 40,7 61,7 38,3<br />
2007 60,4 39,6 58,8 41,2 68,0 32,0<br />
2008 58,6 41,4 58,0 42,0 61,1 38,9<br />
2009<br />
Vollerwerb<br />
61,7 38,3 61,2 38,8 65,2 34,8<br />
2000 62,6 37,4 60,4 39,6 70,3 29,7<br />
2001 68,5 31,5 63,7 36,3 83,0 17,0<br />
2002 68,6 31,4 68,2 31,8 70,0 30,0<br />
2003 71,8 28,2 72,2 27,8 70,3 29,7<br />
2004 70,2 29,8 68,6 31,4 74,8 25,2<br />
2005 69,5 30,5 67,6 32,4 75,7 24,3<br />
2006 66,7 33,3 67,5 32,5 63,7 36,3<br />
2007 63,9 36,1 62,9 37,1 68,3 31,7<br />
2008 66,7 33,3 69,5 30,5 58,3 41,7<br />
2009<br />
Nebenerwerb<br />
68,7 31,3 68,6 31,4 69,0 31,0<br />
2000 57,5 42,5 57,5 42,5 57,4 42,6<br />
2001 58,8 41,2 60,1 39,9 52,7 47,3<br />
2002 63,8 36,2 64,1 35,9 62,4 37,6<br />
2003 53,7 46,3 53,6 46,4 54,2 45,8<br />
2004 58,8 41,2 59,6 40,4 53,2 46,8<br />
2005 58,3 41,7 58,5 41,5 56,6 43,4<br />
2006 55,2 44,8 53,9 46,1 60,1 39,9<br />
2007 58,2 41,8 56,3 43,7 68,0 32,0<br />
2008 52,5 47,5 50,8 49,2 65,9 34,1<br />
2009 56,1 43,9 55,7 44,3 60,1 39,9
118 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Tabelle 13: Gründeranteile nach Alter<br />
Gesamt<br />
Altersgruppe<br />
18–24 25–34 35–44 45–54 55–64<br />
2000 34,1 28,0 24,4 8,8 4,7<br />
2001 16,8 28,2 28,0 18,8 8,2<br />
2002 16,4 25,1 29,4 18,4 10,7<br />
2003 12,6 26,6 29,8 22,1 9,0<br />
2004 11,9 26,8 33,0 18,9 9,5<br />
2005 13,3 25,7 35,5 17,6 8,0<br />
2006 16,6 26,0 33,0 16,0 8,6<br />
2007 17,8 29,2 29,7 15,2 8,1<br />
2008 15,0 29,9 29,2 17,3 8,6<br />
2009<br />
Vollerwerb<br />
14,0 23,6 29,0 21,3 12,0<br />
2000 32,4 40,0 24,7 8,7 3,3<br />
2001 11,3 26,3 33,7 19,8 9,0<br />
2002 14,3 24,2 33,5 17,4 10,7<br />
2003 6,8 26,5 33,9 25,2 7,6<br />
2004 10,4 26,1 35,3 18,9 9,3<br />
2005 8,9 25,0 39,3 18,2 8,6<br />
2006 11,8 26,4 37,6 15,9 8,3<br />
2007 12,8 29,0 30,8 18,3 9,1<br />
2008 10,4 27,7 33,1 19,6 9,2<br />
2009<br />
Nebenerwerb<br />
8,5 22,0 32,6 26,0 10,9<br />
2000 35,5 25,5 24,1 8,9 6,0<br />
2001 20,4 29,4 24,3 18,1 7,8<br />
2002 18,3 26,0 26,2 19,1 10,4<br />
2003 17,2 26,3 26,7 19,7 10,0<br />
2004 12,9 27,9 30,7 19,1 9,5<br />
2005 17,3 26,1 32,2 17,1 7,3<br />
2006 20,2 25,4 29,9 16,0 8,5<br />
2007 20,9 29,0 29,1 13,5 7,6<br />
2008 18,6 31,3 26,3 15,7 8,1<br />
2009 18,8 24,9 26,2 17,2 12,9
Anhang 119<br />
Tabelle 14: Finanzierungsstruktur von Gründungen 2007 bis 2009, Anteile (bedingte Häufigkeiten) in Prozent<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb<br />
2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007<br />
Mittelnutzung nach Sach- und finanziellen Mitteln<br />
Weder Sach- noch finanzielle Mittel 10,3 8,4 9,2 7,3 2,9 8,2 12,7 12,0 9,9<br />
Nur Sachmittel 19,8 24,2 34,1 16,2 20,2 28,7 22,3 27,4 37,5<br />
Nur finanzielle Mittel 15,1 12,4 9,2 15,5 19,1 10,0 14,8 7,5 8,8<br />
Sach- und finanzielle Mittel<br />
Finanzmittelnutzung nach eigenen und externen Mitteln<br />
54,8 54,9 47,4 60,9 57,7 53,1 50,2 53,1 43,9<br />
Nur eigene Mittel 63,2 65,2 59,3 57,9 59,7 48,3 68,1 70,6 67,6<br />
Nur externe Mittel 7,3 7,3 6,5 7,8 7,3 5,4 6,8 6,9 7,3<br />
Eigene und externe Mittel<br />
Nutzung externer Finanzierungsquellen<br />
29,5 27,5 34,1 34,3 32,9 46,2 25,1 22,5 25,1<br />
Bankdarlehen (ohne Kontokorrent) 50,8 34,9 44,9 53,8 34,2 22,0 46,9 35,8 70,3<br />
Kontokorrentkredit 34,3 15,0 21,6 21,1 11,0 17,8 51,1 20,0 25,8<br />
Förderkredite 29,2 18,7 16,7 21,0 11,4 15,6 39,7 27,5 17,9<br />
Darlehen, Geschenke von Verwandten, Freunden etc. 20,8 33,6 38,6 21,1 34,1 36,6 20,5 33,0 40,7<br />
Zuschuss der Bundesagentur für Arbeit 21,6 23,4 31,6 18,8 37,4 50,6 25,2 6,2 10,4<br />
Sonstiges (z. B. Beteiligungskapital)<br />
Nachrichtlich: Volumenanteile<br />
19,3 22,0 18,0 14,2 16,3 10,5 25,8 29,0 26,4<br />
Bankdarlehen (ohne Kontokorrent) 45,6 40,7 41,3 53,4 39,7 15,5 37,9 42,9 80,4<br />
Kontokorrentkredit 10,2 2,4 4,3 7,1 2,5 4,6 13,3 2,4 3,7<br />
Förderkredite 13,7 12,9 3,2 13,5 10,8 5,1 14,0 17,5 0,3<br />
Darlehen, Geschenke von Verwandten, Freunden etc. 18,0 25,1 33,8 11,6 24,7 52,3 24,4 26,0 5,8<br />
Zuschuss der Bundesagentur für Arbeit 4,6 8,7 11,5 6,2 11,5 18,4 3,0 2,4 1,1<br />
Sonstiges (z. B. Beteiligungskapital) 7,9 10,3 6,0 8,3 10,9 4,1 7,5 8,9 8,7<br />
Anteilswerte in Prozent. Die Angaben zur Mittelnutzung nach Sach- und finanziellen Mitteln beziehen sich auf alle (n=623, 620, 745) Gründer, alle (n=265, 268, 281) Vollerwerbsgründer bzw. alle (n=355,<br />
349, 461) Nebenerwerbsgründer; die Angaben zur Finanzmittelnutzung nach eigenen und externen Mitteln beziehen sich auf alle (n=426, 413, 2262) Gründer, alle (n=201, 199, 118) Vollerwerbsgründer<br />
bzw. alle (n=224, 212, 143) Nebenerwerbsgründer mit Finanzmittelbedarf; die Angaben zur Nutzung externer Finanzierungsquellen beziehen sich auf alle (n=129, 126, 81) Gründer, alle (n=81, 71, 48)<br />
Vollerwerbsgründer bzw. alle (n=48, 55, 33) Nebenerwerbsgründer mit Bedarf an externen finanziellen Mitten (bedingte Häufigkeiten, erste Angaben zum Stichprobenumfang jeweils für 2009, zweite<br />
Angaben für 2008, dritte Angaben für 2007). Zur Vermeidung des Einflusses von Ausreißern erfolgt die Berechnung der Volumenanteile jahresspezifisch auf Basis der 95 % der Gründer mit den niedrigsten<br />
externen Finanzierungsbedarfen (95%-Perzentil). Die Kategorie ‚Kontokorrentkredit’ umfasst die Inanspruchnahme von Dispositions- oder Überziehungskrediten auf Girokonten sowie die Ausnutzung<br />
des Kreditrahmens von Kreditkarten. Lesehilfe: 50,8 % aller Gründer des Jahres 2009, die externe Mittel genutzt haben, haben Bankdarlehen in Anspruch genommen.
120 <strong>Gründungsmonitor</strong> 2010<br />
Tabelle 15: Finanzierungsstruktur von Gründungen 2007 bis 2009, Anteile (unbedingte Häufigkeiten) in Prozent<br />
Alle Gründer Vollerwerb Nebenerwerb<br />
2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007<br />
Mittelnutzung nach Sach- und finanziellen Mitteln<br />
Weder Sach- noch finanzielle Mittel 10,3 8,4 9,2 7,3 2,9 8,2 12,7 12,0 9,9<br />
Nur Sachmittel 19,8 24,2 34,1 16,2 20,2 28,7 22,3 27,4 37,5<br />
Nur finanzielle Mittel 15,1 12,4 9,2 15,5 19,1 10,0 14,8 7,5 8,8<br />
Sach- und finanzielle Mittel<br />
Finanzmittelnutzung nach eigenen und externen Mitteln<br />
54,8 54,9 47,4 60,9 57,7 53,1 50,2 53,1 43,9<br />
Nur eigene Mittel 44,2 43,9 33,6 44,2 45,9 30,5 44,3 42,8 35,6<br />
Nur externe Mittel 5,1 4,9 3,7 6,0 5,6 3,4 4,4 4,2 3,8<br />
Eigene und externe Mittel<br />
Nutzung externer Finanzierungsquellen<br />
20,6 18,5 19,3 26,2 25,3 29,2 16,3 13,6 13,2<br />
Bankdarlehen (ohne Kontokorrent) 13,1 8,2 10,3 17,3 10,6 7,2 9,7 6,4 12,0<br />
Kontokorrentkredit 8,8 3,5 5,0 6,8 3,4 5,8 10,6 3,6 4,4<br />
Förderkredite 7,5 4,4 3,8 6,8 3,5 5,1 8,2 4,9 3,1<br />
Darlehen, Geschenke von Verwandten, Freunden etc. 5,3 7,9 8,9 6,8 10,5 11,9 4,3 5,9 6,9<br />
Zuschuss der Bundesagentur für Arbeit 5,6 5,5 7,3 6,0 11,5 16,5 5,2 1,1 1,8<br />
Sonstiges (z. B. Beteiligungskapital) 5,0 5,2 4,1 4,6 5,0 3,4 5,4 5,2 4,5<br />
Anteilswerte in Prozent, jeweils bezogen auf alle Gründer bzw. auf alle Voll- oder Nebenerwerbsgründer (unbedingte Häufigkeiten). Die Auswertungen beruhen auf folgenden Beobachtungszahlen (erste<br />
Angabe jeweils für 2009, zweite Angabe für 2008, dritte Angabe für 2007): Mittelnutzung nach Sach- und finanziellen Mitteln (alle Gründer n=623, 620, 745, Vollerwerb: n=265, 268, 281, Nebenerwerb:<br />
n=355, 349, 461), Finanzmittelnutzung nach eigenen und externen Mitteln (n=426, 413, 2262, Vollerwerb: n=201, 199, 118, Nebenerwerb: n=224, 212, 143), Nutzung externer Finanzierungsquellen (alle<br />
Gründer: n=129, 126, 81, Vollerwerb: n=81, 71, 48, Nebenerwerb: n=48, 55, 33). Die Kategorie ‚Kontokorrentkredit’ umfasst die Inanspruchnahme von Dispositions- oder Überziehungskrediten auf Girokonten<br />
sowie die Ausnutzung des Kreditrahmens von Kreditkarten. Lesehilfe: 17,3 % aller Vollerwerbsgründer des Jahres 2009 haben Bankdarlehen (ohne Kontokorrentkredite) in Anspruch genommen.