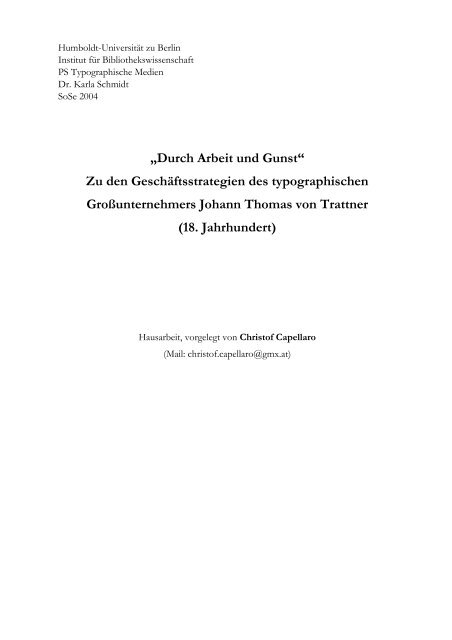Durch Arbeit und Gunst - Institut für Bibliothekswissenschaft ...
Durch Arbeit und Gunst - Institut für Bibliothekswissenschaft ...
Durch Arbeit und Gunst - Institut für Bibliothekswissenschaft ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Humboldt-Universität zu Berlin<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Bibliothekswissenschaft</strong><br />
PS Typographische Medien<br />
Dr. Karla Schmidt<br />
SoSe 2004<br />
„<strong>Durch</strong> <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Gunst</strong>“<br />
Zu den Geschäftsstrategien des typographischen<br />
Großunternehmers Johann Thomas von Trattner<br />
(18. Jahrh<strong>und</strong>ert)<br />
Hausarbeit, vorgelegt von Christof Capellaro<br />
(Mail: christof.capellaro@gmx.at)
Abstract<br />
Die <strong>Arbeit</strong> befasst sich – vorwiegend unter medien- <strong>und</strong> wirtschaftshistorischen Aspekten – mit dem<br />
österreichischen Drucker Johann Thomas von Trattner (1717-1798) <strong>und</strong> dessen Erfolg als<br />
„typographischer Großunternehmer“. Ausgehend von einem biographisch-unternehmensgeschichtlichen<br />
Abriss <strong>und</strong> der Feststellung, dass dem Unternehmen Trattners ein beeinruckender<br />
Aufstieg beschieden war, wird nach den zentralen Erfolgsfaktoren in Trattners<br />
unternehmenspolitischem Handeln gefragt. Trattners Beziehungen ins jesuitische <strong>und</strong> höfische Milieu,<br />
insbesondere seine guten Beziehungen zu Maria Theresia werden beleuchtet, Auftreten <strong>und</strong><br />
Argumentationslinien Trattners gegenüber der Kaiserin analysiert <strong>und</strong> deren Privilegierungspolitik<br />
zugunsten Trattners besprochen. In einem zweiten Abschnitt wird Trattners Agieren innerhalb des<br />
Unternehmens auf besondere Erfolgsfaktoren hin untersucht. Hier werden Trattners Marktkenntnis,<br />
seine buchgestalterischen Fähigkeiten, unternehmerische Innovations- <strong>und</strong> Adaptionsbereitschaft,<br />
Strategien der Unternehmensexpansion- <strong>und</strong> Diversifizierung sowie die Vernetzung unterschiedlicher<br />
Geschäftszweige als Erfolgsstrategien von zentraler Bedeutung benannt. Zusammenfassend werden alle<br />
als wichtig eingeschätzten Erfolgsfaktoren aufgezählt <strong>und</strong> vor dem Hintergr<strong>und</strong> der von Michael<br />
Giesecke in der Mediengeschichte populär gemachten Metapher des typographischen Netzwerks<br />
interpretiert. (Autor)
Christof Capellaro<br />
„<strong>Durch</strong> <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Gunst</strong>“<br />
Zu den Geschäftsstrategien des typographischen Großunternehmers<br />
Johann Thomas von Trattner (18. Jahrh<strong>und</strong>ert)<br />
Gliederung<br />
1.0 Einleitung<br />
1.1 Gegenstand <strong>und</strong> Ziel 3<br />
1.2 Quellenlage 3<br />
1.3 Forschungsstand, Methodische Zugriffe der Forschung 4<br />
2.0 Biographischer <strong>und</strong> unternehmensgeschichtlicher Abriss 5<br />
3.0 Unternehmensstrategien 7<br />
3.1 Eine ‚Imagekampagne’ am Anfang 7<br />
3.2 Beziehungsnetzwerke 8<br />
3.3 Beziehungen zum Kaiserhof 9<br />
3.4 Privilegierungen 11<br />
3.5 Private Verbindungen zum Hof <strong>und</strong> deren „symbolischer Nutzen“ 11<br />
3.6 Marktkenntnis <strong>und</strong> Werbung<br />
3.7 Buchgestaltung, Reihen <strong>und</strong> Preise am Beispiel des „Planes zur<br />
allgemeinenVerbreitung der Kultur in den k.k. Staaten durch wohlfeile<br />
12<br />
Lieferung der Bücher aller Wissenschaften“ (1785)<br />
3.8 Beispiele <strong>für</strong> Innovations- <strong>und</strong> Adaptionsfähigkeit in verschiedenen<br />
13<br />
Unternehmensbereichen 14<br />
3.9 Ausbau des Unternehmens <strong>und</strong> Nutzung von Synergieeffekten 15<br />
4.0 Zusammenfassung <strong>und</strong> Bewertung 17<br />
5.0 Ausblick 18<br />
Abkürzungen 19<br />
Abbildungsverzeichnis 19<br />
Literatur- <strong>und</strong> Quellenverzeichnis<br />
Gedruckte Quellen 20<br />
Literatur <strong>und</strong> Internetquellen 20
1.0 Einleitung<br />
- 3 -<br />
1.1 Gegenstand <strong>und</strong> Ziel<br />
1735 trat bei dem wienerneustädter Drucker Samuel Müller ein junger Mann in die Lehre, dem<br />
zu diesem Zeitpunkt wegen seiner ungünstigen familiären Voraussetzungen (mittellos,<br />
Vollwaise, Kind protestantischer Eltern in einem an sich streng katholischen Territorium)<br />
sicher niemand eine großartige ‚Karriere’ vorausgesagt hätte.<br />
Wenige Jahrzehnte später war derselbe – Johann Thomas Trattner – nicht nur in den<br />
Adelsstand aufgestiegen, sondern auch Inhaber eines umsatzstarken <strong>und</strong> weitverzweigten<br />
Druck- <strong>und</strong> Verlagsimperiums, das nicht nur alle alteingesessenen Betriebe in den<br />
habsburgisch-österreichischen Erblanden überflügelt hatte, sondern durch eine ungehemmte –<br />
<strong>und</strong> von staatlicher Seite geförderte – Nachdrucktätigkeit auch den fortschrittlichsten<br />
norddeutschen Verlagsunternehmen ernstliche Konkurrenz machte.<br />
Den Gründen dieses Aufstiegs Trattners <strong>und</strong> seines Unternehmens nachzugehen, wird<br />
Gegenstand der vorliegenden <strong>Arbeit</strong> sein. Zu diesem Zweck werden die wichtigsten von<br />
Trattner als „typographischen Großunternehmer“ 1 angewandten Geschäftsstrategien dargestellt.<br />
Zugleich wird nach (wirtschafts-)politischen Rahmenbedingungen <strong>und</strong> sonstigen<br />
äußeren Einflussfaktoren gefragt, welche den Einsatz dieser Strategien sinnvoll erscheinen<br />
ließen <strong>und</strong> den Aufstieg des Unternehmens Trattner begünstigten.<br />
Am Ende soll eine zumindest annäherungsweise Erklärung der trattnerschen Erfolgsgeschichte,<br />
sowie die Benennung <strong>und</strong> Deutung der zentralen Erfolgsfaktoren <strong>und</strong> Unternehmensstrategien<br />
stehen.<br />
1.2 Quellenlage<br />
Archivalien zur Firmengeschichte Trattners befinden sich im Archiv der Firma Überreuter in<br />
Wien (als Nachfolgefirma) sowie im Österreichischen Staatsarchiv, ebenfalls Wien. Von<br />
besonderem Interesse ist hierbei die (im Rahmen älterer Untersuchungen teils auch gedruckt 2<br />
vorliegende) Korrespondenz Trattners mit verschiedenen Verwaltungsbehörden, sowie dem<br />
kaiserlichen Hof, weil aus ihr jene Argumentationsstrategien, derer sich Trattner gegenüber<br />
diesen Obrigkeiten bediente um seine geschäftlichen Ziele durchzusetzen, erschlossen werden<br />
können.<br />
Dasselbe, wenngleich auch unter dem Vorzeichen krisenhafter Auseinandersetzung, gilt<br />
<strong>für</strong> die Korrespondenz Trattners mit seinem kongenialen Gegenspieler Philipp Erasmus Reich<br />
<strong>und</strong> anderen norddeutschen Buchhändlern im Streit darüber, ob Trattner die Berechtigung<br />
habe, deren Verlagswerke nachzudrucken bzw. die Nachdrucke dann auch außerhalb der<br />
österreichischen Erblande 3 zu verbreiten. Diese Schriftstücke befinden sich im Sächsischen<br />
1 Zur Begrifflichkeit vgl. auch Abschnitt 3.9 dieser <strong>Arbeit</strong>.<br />
2 Auszugsweise abgedruckt bei Giese, Trattner.<br />
3 Unter Erblanden versteht man jene Länder, welche die Machtgr<strong>und</strong>lage einer Dynastie bilden. Im Falle<br />
Österreich-Habsburgs sind dies die habsburgischen Gebiete westlich der Leitha (nicht die ungarischen <strong>und</strong><br />
italienischen Besitzungen). – Vgl. Jaklin, Schulbuch, S. 16
- 4 -<br />
Hauptstaatsarchiv Dresden. Sie sind von Mark Lehmstedt ausgewertet <strong>und</strong> im Anhang seines<br />
Artikels abgedruckt worden. 4<br />
Private Briefe oder sonstige Selbstzeugnisse, die Rückschlüsse auf Trattners Persönlichkeit<br />
über seine Geschäftstätigkeit hinaus zulassen, sind nicht bekannt. 5 Jedoch existiert eine im<br />
Unternehmen selbst entstandene Schrift, die Trattners Leben darstellt <strong>und</strong> kurz nach seinem<br />
Tod – wohl mit der Absicht diese in Druck zu geben – der österreichischen Zensurbehörde<br />
vorgelegt wurde. Diese Schrift wurde von einen gewissen Conrad Leger verfasst, den man mit<br />
Recht in der Führungsetage des trattnerschen Großunternehmens vermutet. 6<br />
Hinzuweisen ist außerdem auf ein ausführliches Huldigungsgedicht, welches Trattner von<br />
seinen Angestellten anlässlich seines 50jährigen Geschäftsjubiläums im Jahre 1798 dargebracht<br />
wurde. Dass in diesem freilich nur die positiven Seiten des Prinzipals dargestellt werden <strong>und</strong><br />
sein Quellenwert daher als niedrig zu veranschlagen ist, liegt auf der Hand.<br />
1.3 Forschungsstand, Methodische Zugriffe der Forschung<br />
Das Leben <strong>und</strong> Wirken Trattners hat in Gesamtdarstellungen zur Druck- <strong>und</strong><br />
Buchhandlesgeschichte 7 ebenso seinen Niederschlag gef<strong>und</strong>en, wie in thematisch engeren<br />
Einzeluntersuchungen, wobei letztere jedoch entweder stark biographisch-kulturgeschichtlich<br />
orientiert sind, 8 oder sich unter (urherber)rechtsgeschichtlichen Aspekten fast ausschließlich mit<br />
Trattners Tätigkeit als Nachdrucker <strong>und</strong> den Gegenmaßnahmen der norddeutschen<br />
Originalverleger befassen. 9<br />
Divergierende Forschungspositionen ergaben sich dabei vor allem hinsichtlich der Frage,<br />
ob die norddeutschen Originalverleger den Nachdruck ihrer Titel durch ungerechte<br />
Geschäftsbedingungen provoziert hatten oder völlig unverschuldet Opfer der süddeutschen<br />
<strong>und</strong> österreichischen Nachdrucker, deren prominentester Vertreter zweifellos Trattner ist,<br />
geworden waren; eine Frage, die, wie Goldfriedrich treffend bemerkt, im Nachhinein wohl nie<br />
abschließend geklärt werden kann. 10<br />
Es ist die Beantwortung dieser Frage jedoch auch nicht Ziel der vorliegenden <strong>Arbeit</strong>, die<br />
nicht ein weiteres Mal rechtsgeschichtliche Probleme erörtern, sondern, einen<br />
mediengeschichtlichen, methodisch durch Elemente der Unternehmensgeschichte 11 erweiterten<br />
Zugriff auf das Thema versuchen will. Zwar ist es auch hier<strong>für</strong> notwendig, im Hinterkopf zu<br />
behalten, dass Trattners Geschäftserfolg auch durch seine Nachdruckertätigkeit bedingt war,<br />
aber eben nicht nur.<br />
4 Siehe Lehmstedt, Strohm.<br />
5 Vgl. Cloeter, Großunternehmer, S. 67<br />
6 Vgl. ebd., S. 13f.<br />
7 Z.B. in älterer Zeit: Goldfriedrich Geschichte, Bd. 3, S. 3-7 u. 74-77, Mayer, Buchdruckergeschichte, Bd. 2, S. 31-<br />
43, in jüngerer Zeit z.B. Durstmüller, Druck, Bd. 1, S. 204-212.<br />
8 Z.B. Cloeter, Großunternehmer.<br />
9 Z.B. Lehmstedt, Strom.<br />
10 Vgl. Goldfriedrich, Geschichte, Bd. 3, S. 101.<br />
11 Vgl. zu Begriff, Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Methoden der Unternehmensgeschichte Pierenkemper,<br />
Unternehmensgeschichte, S. 13-82.
- 5 -<br />
In jüngster Zeit wird das Wirken Trattners auch im Zusammenhang mit dem FWF-<br />
Forschungsprojekt der Österreichischen Gesellschaft <strong>für</strong> Buchforschung „Der Buchmarkt der<br />
Habsburgermonarchie“(Untersuchungszeitraum 1750-1850) gewürdigt. Einen ersten Überblick<br />
über die dort entwickelten, meiner Einschätzung nach äußerst fruchtbaren Forschungsansätze,<br />
gibt Johannes Frimmel. 12<br />
2.0 Biographischer <strong>und</strong> unternehmensgeschichtlicher Abriss13 Johann Thomas Trattner wurde am 20. Dezember 1717 14 in Johrmannsdorf in der Nähe von<br />
Güns (damals Ungarn, heute Teil des österreichischen B<strong>und</strong>esgebiets) als Kind unbegüterter<br />
evangelischer Bauern geboren <strong>und</strong> nach dem frühen Tod der Eltern von einer Tante in<br />
Wienerneustadt groß– <strong>und</strong> im Sinne des Katholizismus umerzogen.<br />
1735 trat Trattner bei dem wienerneustädter Drucker Samuel Müller in die Lehre, ab 1739<br />
arbeitete er in Wien <strong>für</strong> den Hofdrucker <strong>und</strong> späteren Stadtrichter Peter van Gehlen. Dort<br />
erhielt er nicht nur die Möglichkeit, sich anhand einer umfassenden Bibliothek fachlich<br />
weiterzubilden, sondern wurde auch mit der Herstellung einer Zeitung vertraut, da Van Gehlen<br />
das „Wiener Diarium“ verlegte. 15 Dieser Umstand ist besonders im Hinblick darauf wichtig,<br />
dass sich Trattner später, nach Gründung des eigenen Unternehmens, ebenfalls intensiv mit der<br />
Herausgabe von Zeitungen <strong>und</strong> Zeitschriften befassen <strong>und</strong> damit auf ein Medium setzten<br />
sollte, 16 das im Verlauf des achtzehnten Jahrh<strong>und</strong>erts noch immer mehr an Bedeutung <strong>für</strong> den<br />
Markt gewann.<br />
Am 12. Mai 1748 machte Trattner den bereits angedeuteten Schritt in die Selbstständigkeit<br />
<strong>und</strong> kaufte die heruntergekommene Druckerei der Eva Maria Schilgin in Wien, wozu er sich<br />
von dem befre<strong>und</strong>eten Gewürzhändler Anton Bilzotti 4000 Gulden geborgt hatte.<br />
In diese Phase fällt der Aufbau wichtiger Beziehungen zu verschiedenen Personen aus dem<br />
jesuitischen <strong>und</strong> universitären, sodann auch aus dem höfischen Milieu, sowie die erste, überaus<br />
erfolgreiche Audienz Trattners bei Kaiserin Maria Theresia (1751), welche die bis zu ihrem<br />
Tode währende <strong>Gunst</strong> der Monarchin <strong>für</strong> Trattner begründete.<br />
Trattners Beziehungen zahlten sich <strong>für</strong> diesen bald aus, vor allem, da ihm schließlich in<br />
rascher Folge verschiedenste Privilegien gewährt wurden, die ihm das exklusive Recht zum<br />
(Nach)druck bestimmter Werke <strong>und</strong> Schrifttumsklassen <strong>für</strong> die Erblande sicherten <strong>und</strong> so die<br />
weitere Expansion des Unternehmens ermöglichten. 17<br />
12 Frimmel, Netzwerk.<br />
13 Im folgenden – so nicht anders angegeben – dargestellt nach Cloeter, Großunternehmer.<br />
14 In der Sek<strong>und</strong>ärliteratur finden sich, was Tag <strong>und</strong> Monat der Geburt betrifft, divergierende Angaben. Ich<br />
möchte in diesem Punkt der jüngsten vorgelegten Untersuchung von Jaklin, Schulbuch, S. 21 folgen, da Jaklin<br />
nicht nur eine ausgezeichnete Kennerin der Biographie Trattners ist, sondern sich bei der Frage des<br />
Geburtsdatums auch auf eingehende genealogische <strong>und</strong> aktenmäßige Studien von Gert Polster im Rahmen der<br />
Staatsprüfungsarbeit „Die Familien der heutigen Großgemeinde Bad Tatzmannsdorf in genealogischer, sozial- <strong>und</strong><br />
wirtschaftsgeschichtlicher Sicht“ Wien, März 2001, S. 151 stützen kann.<br />
15 Vgl. Giese, Trattner, Sp. 1024.<br />
16 Vgl. ebd.<br />
17 Auf den Privilegienbegriff sowie die trattnerschen Privilegien im Speziellen wird an geeigneter Stelle (Abschnitt<br />
3.4) noch einzugehen sein.
- 6 -<br />
1751 wurde Trattner privilegierter Hofbuchhändler, ein Jahr später eröffnete er tatsächlich<br />
eine Buchhandlung, 1752 eine eigene Schriftgießerei. 1759 kaufte er ein Gr<strong>und</strong>stück in der<br />
Wiener Vorstadt Josefstadt (Alt-Lerchenfeld), um dort Druckerei, Schriftschneiderei, Gießerei,<br />
Kupferstecherei, sowie eine Buchbinderei <strong>und</strong> Buchhandlung unter einem gemeinsamen Dach<br />
(zum sogenannten „Typographischen Palast“) zu vereinigen. 1764 unternahm Trattner eine<br />
ausgedehnte Auslandsreise, die ihn nach Italien, Frankreich, Holland <strong>und</strong> England führte <strong>und</strong><br />
den Zweck hatte, sich mit neuen Technologien <strong>und</strong> Unternehmensideen bekannt zu machen.<br />
Aufgr<strong>und</strong> des vorherrschenden Papiermangels errichtete er 1767 eine erste <strong>und</strong> 1786 eine<br />
zweite eigene Papierfabrik in der Herrschaft Ebergassing, nördlich von Wien, einige Jahre<br />
später kaufte er die gesamte Herrschaft auf. Er dehnte sein Unternehmen kontinuierlich über<br />
die Erblande <strong>und</strong> auch darüber hinaus aus, indem er insgesamt fünf Druckereien sowie<br />
zahlreiche Buchhandlungen <strong>und</strong> Buchniederlagen außerhalb Wiens eröffnete, viele davon in der<br />
bisher buchhändlerisch nur schlecht erschlossenen Provinz.<br />
1773 kaufte Trattner das Gr<strong>und</strong>stück des ehemaligen Freisingerhofes in zentraler Lage<br />
Wiens, um dort ein Stadtpalais von beeindruckenden Ausmaßen – den sogenannten<br />
Trattnerhof – zu errichten. Diesen wiederum nutzte er nicht nur um satte Mieterträge zu<br />
kassieren, sondern auch zur Einrichtung eines Lesekabinetts, dem er aus absatzstrategischen<br />
Gründen bald eine Buchhandlung anschloss.<br />
Dem geschäftlichen Erfolg folgte die Nobilitierung: 1764 wurde Trattner in den<br />
Reichsritterstand erhoben, 1790 in den ungarischen Adel. Im selben Jahr wurde er auch in die<br />
Versammlung der niederösterreichischen 18 Landstände aufgenommen. 19<br />
Trattner war zweimal verheiratet, erst mit der Tochter eines Reichshofratsagenten, 20<br />
nämlich Maria Anna von Retzenheim. Nach deren Tod heiratete er die Tochter eines seiner<br />
bedeutendsten Protektoren, nämlich des Hofmathematikers Josef Anton von Nagel, Theresia<br />
Nagel. 21<br />
Trattner starb am 31.07.1798 in Wien. Im Zuge amtlicher Erhebungen im Zusammenhang<br />
mit der Regelung der Erbschaftsangelegenheiten wurde festgestellt, dass sich kurz nach<br />
Trattners Tod die Aktiva des gesamten Unternehmens auf 589.085 Gulden beliefen, denen<br />
482.974 Gulden an Passiva gegenüberstanden. 22<br />
18 Zeitgenössisch wurde Niederösterreich auch als ‚Österreich unter der Enns’ bezeichnet. Die Haupt- <strong>und</strong><br />
Residenzstadt Wien war zu Trattners Zeiten, was die Verwaltung betraf, Teils Niederösterreichs.<br />
19 Zu Begriff <strong>und</strong> Bedeutung der Landstände vgl. Haberkern/Wallach, Art. Landstände, S. 379 u. Art. Landtag, S.<br />
380f, sowie die überaus instruktiven Erläuterungen bei Brauneder, Verfassungsgeschichte, insbesonders S. 33, 35,<br />
79, 81, 83, 96-98.<br />
20 Vgl. Durstmüller, Druck, Bd. 1, S.204f.<br />
21 Vgl. Mayer, Buchdruckergeschichte, Bd. 2, S. 42.<br />
22 Eine umfassende Aufstellung <strong>und</strong> Interpretation der Zahlen bei Cloeter, Großunternehmer, S. 109. Meiner<br />
Ansicht nach darf man den hohen Anteil der Passiva nicht dahingehend deuten, dass Trattner doch kein so<br />
erfolgreicher Geschäftsmann gewesen sei, wie angenommen. Der hohe Passivaanteil zeigt lediglich, dass Trattners<br />
geschäftlicher Expansionsdrang so groß war, dass er teils mit geliehenem Geld finanziert werden musste.
3.0 Unternehmensstrategien<br />
- 7 -<br />
Der vorangegangene Abriss hat sich bewusst auf ein Faktengerüst beschränkt, das einen groben<br />
Überblick über Art <strong>und</strong> Dimensionen des Wachstums von Trattners Unternehmen geben<br />
sollte. Vor dem Hintergr<strong>und</strong> dieser Fakten wird nun gezielt danach zu fragen sein, mit Hilfe<br />
welcher Strategien Trattner diesen Aufstieg ins Werk setzen konnte.<br />
3.1 Eine ‚Imagekampagne’ am Anfang<br />
Das geschickte strategische Agieren Trattners wird schon bei der Gründung des eigenen<br />
Unternehmens offenbar. Als Trattner im Jahr 1748 die Offizin der Eva Maria Schilgin erwarb,<br />
befand sich diese nicht nur in einem drucktechnisch äußerst schlechtem Zustand, 23 sondern<br />
hatte außerdem ein akutes „Imageproblem“, das auf den liederlichen Lebenswandel ihres<br />
letzten Betreibers Johann Jakob Jahn, des Schwiegersohnes der Eva-Maria Schilgin,<br />
zurückzuführen war <strong>und</strong> das zur massiven Abwanderung von K<strong>und</strong>schaft geführt hatte. 24<br />
Trattners (erfolgreicher) Versuch dieses Image zu korrigieren bestand darin, als erstes<br />
Werk ein Gebet in Druck zu nehmen, das Ulrich Hauer, der spätere Abt des Stiftes Melk,<br />
verfasst hatte <strong>und</strong> die Erträge aus dem Verkauf dieses Druckes unter den Armen zu verteilen.<br />
Wie wirkungsmächtig diese Geste gewesen sein muss, ist daran abzulesen, dass noch die ältere<br />
Forschung diese Episode gerne <strong>und</strong> nicht ohne den Unterton der Rührung erzählt. 25 Für<br />
Trattner hatte sich die Sache jedenfalls ausgezahlt, zumal er so nicht nur die <strong>Gunst</strong> des<br />
Publikums zurück, sondern auch jene der Jesuiten neu gewonnen hatte. 26<br />
Zu diesen sollte er in der Folgezeit weiter gute persönliche Beziehungen pflegen, was vom<br />
unternehmerischen Standpunkt her überaus klug war, hielten die Jesuiten doch das Schul- <strong>und</strong><br />
Universitätswesen der Erblande unter ihrer Kontrolle <strong>und</strong> hatten daher eine ganze Reihe von<br />
Druckaufträgen zu vergeben, wovon in der Folge nachweislich auch etliche an Trattner<br />
gingen. 27 Isabelle Heitjan bringt diesen Umstand auf den Punkt, wenn sie sagt, Trattner hätte<br />
„sein Unternehmen anfangs mit Hilfe der Geistlichkeit, insbesondere der Jesuiten,<br />
augbebaut“. 28<br />
Zudem hatte sich Trattner durch diesen ersten Druck die <strong>Gunst</strong> Hauers gesichert, der sich<br />
später wiederum da<strong>für</strong> einsetzte, dass Trattner niederösterreichischer Landschaftsbuchdrucker<br />
wurde 29 , also das exklusive Recht erhielt, die <strong>für</strong> die Verwaltung notwendigen Amtsdrucksachen<br />
<strong>für</strong> Niederösterreich herzustellen.<br />
23 Versetzung der Lettern, die Trattner erst wieder zurückkaufen musste durch den Vorbesitzer etc. Vgl. dazu<br />
Cloeter, Großunternehmer, S. 19.<br />
24 Vgl. ebd., S. 19.<br />
25 Z.B. Cloeter, Trattner, S. 83.<br />
26 Vgl. Wurzbach, Art. Trattner, Bd. 46, S. 286.<br />
27 Vgl. ebd.<br />
28 Heitjan, Briefe, Sp. 1070.<br />
29 Vgl. Wurzbach, Biographisches Lexikon, Bd. 46, S. 286.
- 8 -<br />
3.2 Beziehungsnetzwerke<br />
Der vorhergehende Abschnitt hat gezeigt, wie es Trattner durch geschicktes öffentlichkeitswirksames<br />
Handeln gelungen war, das angeschlagene Image der von ihm gekauften Druckerei<br />
aufzupolieren. Zugleich deutete sich in diesem Abschnitt mit der Beschreibung der Kontakte<br />
ins jesuitisch-universitäre Milieu auch schon der gezielte Aufbau von Beziehungsnetzwerken<br />
<strong>und</strong> damit eine weitere trattnersche Erfolgsstrategie von großer Bedeutung an, die im folgenden<br />
näher zu beleuchten ist.<br />
Unter „Aufbau von Beziehungsnetzwerken“ verstehe ich dabei Trattners erfolgreiches<br />
Bemühen, mit einflussreichen Personen in Kontakt zu kommen, diese Kontakte gezielt zu<br />
pflegen <strong>und</strong> gegebenenfalls später <strong>für</strong> Interventionen, Begünstigungen bzw. das Knüpfen<br />
weiterer Kontakte zu nützen.<br />
Hierbei folgte dem Aufbau von Kontakten in jesuitische <strong>und</strong> universitäre Kreise der<br />
Zugang zu Personen aus dem Umfeld des Kaiserhofs <strong>und</strong> über diese wiederum zum Kaiserhof<br />
selbst <strong>und</strong> damit zu den obersten Entscheidungsträgern im Reich. 30<br />
Als wichtigste Kontaktleute <strong>und</strong> Protektoren Trattners sind hier neben dem bereits<br />
erwähnten Ulrich Hauer Robert Stadler, der Abt des Schottenstiftes, 31 Rudolf Graf Chotek,<br />
Statthalter in Böhmen <strong>und</strong> späterer Präsident der Hofkammer bzw. oberster Kanzler der<br />
vereinigten Hofkanzlei, 32 Anton Nagel, Hofmathematiker <strong>und</strong> späterer Schwiegervater<br />
Trattners, 33 sowie Maria Theresias Hofpyhsikus Abbate Marci 34 zu nennen.<br />
Marci ermöglichte Trattner nicht nur die erste Audienz bei Maria Theresia, sondern ließ<br />
ihn auch Einsicht in das 1751 in Auftrag gegeben verwaltungsinterne Gutachten der<br />
„Niederösterreichischen Repräsentanz <strong>und</strong> Cammer“ 35 über die Lage des Buchdrucks in<br />
Österreich nehmen, aus dem Trattner dann eine Vielzahl von Ideen übernahm, um sie im<br />
eigenen Betrieb umzusetzen. 36 Nachdem Trattner im Jahr 1752 ein Privileg <strong>für</strong> den Schriftguss<br />
in den Erblanden erhalten hatte <strong>und</strong> von Seiten anderer Drucker der Vorwurf laut geworden<br />
war, Trattner fertigte jene Lettern, die er ihnen verkaufe in weniger guter Qualität aus, als jene,<br />
die er <strong>für</strong> die eigene Druckerei behalte <strong>und</strong> Trattner von den Behörden daraufhin zweimal zur<br />
Vorlage von Druckproben verpflichtet worden war, setzte sich Marci jedesmal durch überaus<br />
positive Gutachten da<strong>für</strong> ein, dass Trattner sein Privileg behalten durfte. 37<br />
30 Um den Umfang einer Proseminararbeit nicht allzusehr zu überschreiten kann hier nur Trattners Beziehung zu<br />
Maria Theresia, nicht aber jene zu deren Sohn Joseph II. etwas näher beleuchtet werden.<br />
31 Vgl. Giese, Trattner, Sp. 1028.<br />
32 Vgl. ebd. Sp. 1042-44 sowie Wurzbach, Constantin: Art. Chotek von Chotkowa <strong>und</strong> Wognin, J. Rudolph Graf.<br />
Bd. 2, S. 359f.<br />
33 Vgl. Mayer, Buchdruckergeschichte, Bd. 2, S. 42 sowie zur Rolle Nagels als Protektor Trattners Cloeter,<br />
Großunternehmer, S. 76.<br />
34 Vgl. Cloeter, Großunternehmer, S. 22.<br />
35 Unter Repräsentanz- <strong>und</strong> Cammer ist eine – im Zuge der von Maria Theresia 1749 durchgeführten<br />
Verwaltungsreform – neu geschaffene Behörde zu verstehen, die „in der allgemeinen Verwaltung den Willen des<br />
Monarchen [d.h. Maria Theresias, CC] präsent machen <strong>und</strong> insbesondere die Finanzverwaltung zu führen“ hatte.<br />
Brauneder, Verfassungsgeschichte, S. 83.<br />
36 Vgl. Giese, Trattner, Sp. 1023f. Das Gutachten (HKA Wien NÖ Kommerz, Fasc 110/1) ist bei Giese, Trattner,<br />
Sp. 1014-23 auch auszugsweise wiedergegeben.<br />
37 Vgl. Cloeter, Großunternehmer, S. 23.
- 9 -<br />
Graf Chotek wiederum erwirkte im Jahr 1751 bei Maria Theresia die Gewährung eines<br />
Kredits von immerhin 15.000 Gulden an Trattner. 38<br />
Es mögen dies Einzelepisoden sein, jedoch ließe sich ihre Reihe mühelos fortsetzen. Vor<br />
allem aber wird an diesen Beispielen deutlich, wie sich der Aufbau der Beziehungsnetzwerke <strong>für</strong><br />
Trattner schließlich ganz konkret auszuzahlen begann, nämlich dadurch dass sich seine<br />
Protektoren durch Gutachten <strong>und</strong> Empfehlungen bei der Staatsverwaltung bzw. am Hof <strong>für</strong> ihn<br />
einsetzten bzw. ihm sodann den direkten Zugang zum Hof ermöglichten.<br />
3.3 Beziehungen zum Kaiserhof<br />
Dieser zweite Punkt, besonders der erfolgreiche persönliche Kontakt Trattners zu Maria<br />
Theresia, ist ein weiterer Hauptgr<strong>und</strong> <strong>für</strong> den Erfolg des trattnerschen Unternehmens. Dabei<br />
war es nicht nur von zentraler Bedeutung, dass Trattner überhaupt eine Audienz bei der<br />
Kaiserin gewährt bekommen hatte, sondern dass er es durch geschickte <strong>und</strong> überzeugende<br />
Argumente auch schaffte, die Kaiserin <strong>für</strong> seine Pläne einzunehmen.<br />
Soweit sich Trattners Argumentation aus schriftlichen Quellen erschließen lässt, hat dieser<br />
gegenüber Maria Theresia vor allem unter drei Gesichtspunkten argumentiert, nämlich unter<br />
einem wirtschaftlichen, einem patriotischen <strong>und</strong> einem religiösen.<br />
Vorauszuschicken ist hierbei, dass die Druckproduktion in den Erblanden zum Zeitpunkt<br />
der ersten Audienz insgesamt verhältnismäßig gering war. Das österreichische Buchgewerbe litt<br />
noch an den Folgen des Dreißigjährigen Krieges <strong>und</strong> der Gegenreformation sowie unter einer<br />
strengen katholischen Zensur 39 <strong>und</strong> die große Masse der Bücher wurde – legal oder illegal – aus<br />
dem Ausland, vornehmlich Norddeutschland, importiert, was zu massivem Geldabfluss führte.<br />
Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten – darunter sind zu dieser Zeit die Gr<strong>und</strong>sätze des<br />
Merkantilismus 40 zu verstehen – konnte Trattner der Monarchin gegenüber daher<br />
argumentieren, dass es <strong>für</strong> die erbländische Wirtschaft besser sei, wenn im Land selbst mehr<br />
gedruckt <strong>und</strong> weniger als bisher importiert würde. Genau das, mehr zu drucken, ggf. auch<br />
nachzudrucken, sei sein, Trattners Ziel. Unter den Vorzeichen merkantilistischer<br />
Wirtschaftspolitik bestand außerdem auch durchaus eine Interessensgleichheit zwischen<br />
Trattner <strong>und</strong> der Monarchin, eben weil es Maria Theresia darum zu tun war, den durch<br />
Buchimport verursachten Geldabfluss zu stoppen <strong>und</strong> die erbländische Produktion zu fördern.<br />
Aber nicht nur unter wirtschaftspolitischen, sondern auch unter kultur- <strong>und</strong> machtpolitischen<br />
Gesichtspunkten war es im Interesse Maria Theresias, wenn die erbländische Buchproduktion<br />
durch die Tatkraft Trattners wieder in Schwung kam. Kulturpolitisch bedeutete dies nämlich<br />
langfristig auch eine Belebung des aus den bereits genannten Gründen verödeten erbländischen<br />
Geisteslebens <strong>und</strong> unter machtpolitischen Gesichtspunkten versprach es <strong>für</strong> die Monarchin die<br />
38 Vgl. Giese, Trattner, Sp. 1042-44.<br />
39 Vgl. Jaklin, Schulbuch, S. 37.<br />
40 Zu den Gr<strong>und</strong>ideen merkantilistischer (bzw. später kameralistischer) Wirtschaftspolitik vgl. Kisel/Münch,<br />
Gesellschaft, S. 31-33.
- 10 -<br />
Möglichkeit, „ihr weitläufiges <strong>und</strong> heterogenes Einflussgebiet mit gedruckten Informationen zu<br />
versorgen“ was wiederum Voraussetzung <strong>für</strong> ihre „geplanten staatlichen Reformen“ war. 41<br />
Was die patriotische Argumentationslinie Trattners betrifft, so ist diese häufig mit der<br />
wirtschaftlich-merkantilistischen verknüpft: Geschickt versuchte Trattner die Dinge so<br />
darzustellen, als sei er ein vollkommen selbstloser Patriot, dessen Unternehmungen ihm<br />
persönlich kaum Gewinn einbrächten <strong>und</strong> von ihm einzig zu dem Zweck getätigt würden, das<br />
Wachstum der erbländischen Wirtschaft zu befördern <strong>und</strong> den Ruhm des Vaterlandes zu<br />
mehren. 42<br />
Ein Beispiel <strong>für</strong> die religiösen Argumentation, die als bewusster Appell an den strengen<br />
Katholizismus der Kaiserin gedacht war, lässt sich anführen, dass Trattner in Eingaben <strong>und</strong><br />
Bitten immer wieder daran erinnerte, dass er inländische Lehrlinge zu Druckern ausbilde <strong>und</strong><br />
dadurch den religionspolitisch unerwünschten Zuzug lutherischer Gesellen verhindern helfe. 43<br />
Dass diese Argumentationslinie weniger einer echten katholischen Überzeugung Trattners, als<br />
viel mehr dem Wunsch nach wirksamer <strong>Durch</strong>setzung eigener Marktinteressen entsprang, kann<br />
schon daran ablesen werden, dass es Trattner nach Erteilung des Toleranzpatentes durch Maria<br />
Theresias in Religionsfragen weit liberaleren Sohn, Mitregenten <strong>und</strong> Nachfolger Joseph II.<br />
sogleich darum zu tun war, sich eine maßgebliche Position auf dem nunmehr legalen Markt <strong>für</strong><br />
protestantisches Schriftgut zu sichern. 44<br />
Vergleicht man die drei Hauptargumentationsstränge Trattners, so fällt auf, dass sich unter<br />
wirtschaftspolitischen Aspekten eine echte Interessensgleichheit zwischen ihm <strong>und</strong> der Kaiserin<br />
ergab, welche Maria Theresia die Begünstigung Trattners zur Beförderung des erbländischen<br />
Buchdrucks nahe legte. Was dagegen die patriotischen <strong>und</strong> religiösen Argumente Trattners<br />
betrifft, so lassen sich diese in historischer Perspektive leicht als Scheinargumente entlarven,<br />
wenngleich auch als überaus wirkungsvolle.<br />
Diesen Punkt zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Förderung Trattners<br />
durch Maria Theresia einerseits durch eine zumindest partielle Interessengleichheit zwischen<br />
ihren (bzw. den „Staatsinteressen“) <strong>und</strong> den Interessen Trattners bedingt war. Darüber hinaus<br />
gelang es Trattner aber auch dort eine Interessengleichheit herbeizureden, wo diese nicht von<br />
vornherein gegeben, bzw. die „Überfütterung“ 45 Trattners durch immer neue Vorrechte <strong>und</strong><br />
Privilegien selbst (oder besonders) unter den Vorzeichen merkantilistischer Wirtschaftspolitik<br />
nicht mehr sinnvoll war, sondern den objektiven Interessen der Monarchin zuwiderlief, weil<br />
durch eine unverhältnismässige Bevorzugung Trattners die Entwicklung der anderen Drucker<br />
<strong>und</strong> somit das Wachstum insgesamt behindert wurde. 46 Der Gr<strong>und</strong> da<strong>für</strong>, dass Trattner dies<br />
gelang, mag einerseits das charmante Auftreten <strong>und</strong> das Gefühl <strong>für</strong> den Umgang mit Menschen,<br />
41 Frimmel, Netzwerk.<br />
42 Vgl. Giese, Trattner. Sp. 1113.<br />
43 Vgl. ebd., Sp. 1043<br />
44 Vgl. Durstmüller, Druck, Bd. 1, S. 208.<br />
45 Goldfriedrich, Geschichte, Bd. 3, S. 7.<br />
46 Fragwürdig ist daher Frimmels Bezeichnung Trattners als „Mitarbeiter“ Maria Theresias. Viel eher als<br />
Mitarbeiter der Kaiserin muss Trattner wohl gewitzter Petent in eigener Sache bezeichnet werden.
- 11 -<br />
das Trattner entwickeln konnte, wenn es darum ging, Höhergestellte <strong>für</strong> sich zu gewinnen,<br />
sowie sein großes Geschick im Formulieren von Eingaben <strong>und</strong> Bitten, 47 das es ihm erlaubte<br />
auch Scheinargumente als echte Argumente „verkaufen“ zu können, sein.<br />
3.4 Privilegierungen<br />
Was aber waren nun die konkreten Auswirkungen all dieser Bemühungen um die <strong>Gunst</strong> der<br />
Obrigkeit? Vor allem Privilegien. 48<br />
Unter einem Privileg ist im gegebenen Zusammenhang das Recht zu verstehen, ein<br />
bestimmtes Werk oder eine ganze Schrifttumsklasse <strong>für</strong> ein Territorium (in unserem Falle das<br />
habsburgisch-österreichische) alleinig herstellen zu dürfen, d.h. vor der Konkurrenz anderer<br />
Drucker <strong>und</strong> Verleger hinsichtlich eines Werkes oder einer ganzen Schrifttumsklasse geschützt<br />
zu sein. 49<br />
Hermine Cloeter gibt in ihrer Untersuchung an, Trattner seien allein in den vier Jahren<br />
von 1752 bis 1756 – die erste Audienz Trattners bei Maria Theresia hatte im Jahr 1751 statt<br />
gef<strong>und</strong>en – „nicht weniger als neun verschiedene Privilegien, darunter solche bis zur Dauer von<br />
20 Jahren verliehen“ worden. 50 So erhielt Trattner beispielsweise im Jahr 1755 <strong>für</strong> 15 Jahre das<br />
alleinige Recht, die Missale (Meßbücher) <strong>und</strong> Breviare (Gebetbücher) <strong>für</strong> die Erblande zu<br />
drucken. 51 1756 erhielt er ein ähnliches Privileg <strong>für</strong> Militärkalender sowie verschiedene<br />
Schulbücher 52 <strong>und</strong> ab 1762 lieferte er sämtliches Papier, das <strong>für</strong> die staatlichen Kanzleiarbeiten<br />
benötigt wurde. 53<br />
Schon an diesen Beispielen wird klar, dass die Privilegierung auf die Herstellung<br />
verschiedener Arten von Massen, Ge- <strong>und</strong> Verbrauchsschrifttum sowie die exklusive Tätigkeit<br />
als Lieferant <strong>für</strong> den Staat <strong>für</strong> Trattner einen unschätzbaren Marktvorteil darstellte <strong>und</strong> somit<br />
die starke Expansion seines Unternehmens, von der noch zu sprechen sein wird, nicht bloß<br />
ermöglichte, sondern geradezu herausforderte. Gleiches gilt <strong>für</strong> den Umstand, dass Trattner <strong>für</strong><br />
die Errichtung von Unternehmensgebäuden staatseigene Liegenschaften nachweislich zu weit<br />
unter dem tatsächlichen Wert liegenden Preisen verkauft wurden. 54<br />
3.5 Private Verbindungen zum Hof <strong>und</strong> deren „symbolischer Nutzen“<br />
Freilich lässt sich die enge Verbindung Trattners mit dem Hof nicht nur auf dieser, das<br />
Geschäft im engeren Sinn betreffenden Ebene, fassen, sondern auch auf einer persönlicheren.<br />
So fungierte z.B. die Monarchin bei zwei Töchtern Trattners als Taufpatin 55 <strong>und</strong> Angehörige<br />
47 Vgl. Giese, Trattner, Sp. 1116.<br />
48 Eine exemplarische Privilegienliste bei Jaklin, Schulbuch, S. 56-58.<br />
49 Vgl. zum Privilegienbegriff im gegebenen Zusammenhang auch Jaklin, Schulbuch, S. 17 sowie die überaus<br />
fruchtbare Definition bei Frimmel, Netzwerk.<br />
50 Vgl. Cloeter, Großunternehmer, S. 24f.<br />
51 Vgl. ebd.<br />
52 Dazu ausführlich eine neue monographische Untersuchung von Jaklin, Schulbuch, besonders S. 137-243.<br />
53 Cloeter, Großunternehmer, S. 24f.<br />
54 Z.B. Ankauf des Gr<strong>und</strong>stücks in der Vorstadt Josephstadt zur Errichtung des bereits erwähnten<br />
„Typographischen Palastes“. – Vgl. dazu Cloeter, Großunternehmer, S. 55.<br />
55 Vgl. ebd., S. 57.
- 12 -<br />
des Kaiserhauses besuchten mehrmals Trattners Unternehmen. 56 Diese Akte der<br />
<strong>Gunst</strong>bezeugung hatten keinen direkten materiellen Wert, bedeuteten aber einen Prestige- <strong>und</strong><br />
Imagegewinn <strong>für</strong> Trattner. Vor dem selben Hintergr<strong>und</strong> ist schließlich auch Trattners<br />
Erhebung in den Adelsstand zu sehen.<br />
3.6 Marktkenntnis <strong>und</strong> Werbung<br />
Freilich würde es das Bild verzerren, wollte man Trattners Erfolg einzig durch seine Stellung als<br />
Günstling einflussreicher Fre<strong>und</strong>e <strong>und</strong> des Hofes erklären. Ganz abgesehen davon, dass man<br />
auch den Aufbau der angesprochenen Beziehungsnetzwerke als mühevolle <strong>Arbeit</strong> (Lobbyarbeit<br />
wie man heute sagen würde) bezeichnen könnte, hat Trattner seinen Betrieb nämlich nicht nur<br />
äusserst geschickt in der Öffentlichkeit vertreten, sondern ihn auch straff nach innen organisiert<br />
<strong>und</strong> bei Auswahl, Gestaltung <strong>und</strong> Verkauf seiner Druckwerke eine Reihe zukunftsfähiger<br />
Strategien angewandt.<br />
Hinsichtlich der Gestaltung seines Verlagsprogramms ist festzuhalten, dass Trattners<br />
Kenntnis des Buchmarktes weit darüber hinaus ging, sich anzusehen mit welchen Druckwerken<br />
seine norddeutschen Kollegen besondern Erfolg hatten <strong>und</strong> diese Werke sogleich<br />
nachzudrucken. Es gelang ihm nicht nur erfolgreiches Handeln im Nachhinein zu kopieren,<br />
sondern auch die zukünftigen Bedürfnisse des Buchmarktes vorauszusehen <strong>und</strong> gerade deshalb<br />
rechtzeitig um Privilegien <strong>für</strong> die künftig auf dem erbländischen Buchmarkt<br />
vielversprechendsten Schrifttumsklassen nachzusuchen. 57<br />
Dabei setzte er gezielt auf die Herstellung von Massenware, die einen dauerhaft<br />
gesicherten Absatz versprach <strong>und</strong> seine Pressen langfristig unter <strong>Arbeit</strong> hielt. (Dies waren<br />
Bücher zum alltäglichen geistlichen oder weltlichen Gebrauch wie die bereits erwähnten<br />
liturgischen bzw. Gebetsbücher, Schulbücher <strong>und</strong> Kalender.)<br />
Daneben beschäftigte sich Trattner intensiv mit der Herstellung von Zeitungen <strong>und</strong><br />
Zeitschriften, welche zwar eine Erfindung des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts sind, deren Marktbedeutung<br />
aber im 18. Jahrh<strong>und</strong>ert immer noch zunehmen sollte. Auch hier setzte er also auf eine<br />
Medienart mit langfristigem Zukunftspotential.<br />
Dasselbe gilt <strong>für</strong> den Bereich der Werbung. Zu diesem Zeitpunkt noch verhältnismäßig<br />
junge <strong>und</strong> innovative Werbeformen derer sich Trattner gezielt bediente, waren die (bezahlte)<br />
Buchrezension <strong>und</strong> das Zeitungs- bzw. Zeitschrifteninserat. 58 Daneben warb er <strong>für</strong> seine<br />
Verlagsprodukte auch durch regelmäßige Verlagskataloge <strong>und</strong> gedruckte Vorankündigungen<br />
größerer Reihen („Zirkulare“).<br />
Nicht zuletzt förderte er den Absatz durch den Aufbau eines eigenen Netzwerkes von<br />
Buchhandlungen.<br />
56 Dazu ausführlicher Cloeter, Großunternehmer, S. 54-57.<br />
57 Vgl. Giese, Trattner, Sp. 1030.<br />
58 Vgl. ebd., Sp. 1191.
- 13 -<br />
3.7 Buchgestaltung, Reihen <strong>und</strong> Preise am Beispiel des „Planes zur allgemeinen Verbreitung<br />
der Kultur in den k.k. Staaten durch wohlfeile Lieferung der Bücher aller<br />
Fächer der Wissenschaften“ (1785)<br />
So wie Trattner die Kunst beherrschte, die Bedürfnisse des Marktes frühzeitig zu erkennen,<br />
verstand er es auch, seinen Drucken ein gefälliges (<strong>und</strong> wiederum deren Absatz förderndes)<br />
Aussehen zu geben, beispielsweise durch die Wahl ästhetisch ansprechender Schrifttypen die in<br />
seiner eigenen Schriftgiesserei hergestellt wurden. 59<br />
Abb. 1: Musterblatt aus Trattners Offizin enthaltend auch Trattners Wahlspruch. 60<br />
Dazu kam die gezielte Herstellung von Reihen, deren Teile in ihrer äußeren Gestaltung<br />
<strong>und</strong> in den Preisen einheitlich waren. Das prominenteste Beispiel einer solchen bei Trattner<br />
59 Vgl. als Beispiel Abb. 1.<br />
60 Quelle: Mayer, Buchdruckergeschichte, Bd. 2, S. 79.
- 14 -<br />
erschienen Reihe ist sicher sein „Plan zur allgemeinen Verbreitung der Kultur in den k.k.<br />
Staaten durch wohlfeile Lieferung der Bücher <strong>für</strong> alle Fächer der Wissenschaften“ 61<br />
Ziel dieses 1785 62 ins Werk gesetzten Projektes war es, die nützlichsten wissenschaftliche<br />
Werke der Zeit systematisch nachzudrucken <strong>und</strong> in einer typographisch ansprechenden Reihe<br />
zu einheitlichen <strong>und</strong> verhältnismäßig günstigen Preisen anzubieten.<br />
Dazu hatte Trattner die wissenschaftliche Literatur in zwölf Klassen eingeteilt, ein eigener<br />
Katalog der Reihentitel sowie verschiedenes Werbematerial war hergestellt worden <strong>und</strong> um den<br />
Absatz zu fördern sollten außerdem die Namen der Subskribenten den Bänden vorne<br />
eingedruckt werden. 63<br />
K<strong>und</strong>enfre<strong>und</strong>lich waren bei diesem Projekt übrigens nicht nur die Preise, sondern auch<br />
die Überlegung, dass es möglich sein sollte, nicht die ganze Reihe zu beziehen, sondern aus den<br />
Gebieten auszuwählen. 64 Die Lieferung erfolgte, auch in entlegene Landesteile, <strong>für</strong> den K<strong>und</strong>en<br />
frachtkostenfrei. 65<br />
3.8 Beispiele <strong>für</strong> Innovations- <strong>und</strong> Adaptionsfähigkeit in verschiedenen<br />
Unternehmensbereichen<br />
Trattner Fähigkeit die Bedürfnisse des Buchmarktes seiner Zeit rasch zu erkennen <strong>und</strong> auch<br />
künftige Bedürfnisse des Marktes abzuschätzen, ist ebenso wie der Einsatz innovativer Werbe<strong>und</strong><br />
Absatzstrategien bereits besprochen worden.<br />
Jedoch war Trattners Innovations- <strong>und</strong> Adaptionsfähigkeit in geschäftlichen Belangen<br />
nicht allein auf diese Gebiete beschränkt. Darum erscheint es zielführend, hier noch weitere<br />
exemplarische Beispiele <strong>für</strong> die Innovations- <strong>und</strong> Adaptionsfähigkeit Trattners aus anderen<br />
Unternehmensbereichen darzustellen, nämlich die Anstellung von Korrekteuren in Trattners<br />
Druckereien <strong>und</strong> die Einführung des Stücklohns in seinen beiden Papierfabriken.<br />
Das erste Beispiel hängt mit dem bereits erwähnte Gutachten der „Niederösterreichischen<br />
Repräsentanz <strong>und</strong> Cammer“ über die Lage des Buchdrucks in Österreich zusammen. 66 In<br />
diesem Gutachten war unter anderem vorgeschlagen worden, den erbländischen Druckern<br />
staatlich besoldete Korrekteure zur Seite zu stellen, um die Qualität <strong>und</strong> Zuverlässigkeit des in<br />
den Erblanden Gedruckten zu erhöhen. Die staatliche Seite wies den Vorschlag zwar mit der<br />
Begründung, dieses wäre zu teuer <strong>und</strong> außerdem unnotwendig zurück, Trattner aber, der –<br />
bezeichnenderweise durch persönliche Beziehungen – Einblick in das Gutachten erhalten hatte,<br />
nahm die Anregung (wie übrigens noch verschiedene weitere Vorschläge aus dem Gutachten)<br />
auf <strong>und</strong> stellte wenig später in seiner eigenen Druckerei <strong>und</strong> auf eigene Kosten mehrere<br />
Korrekteure zur „Qualitätssicherung“ ein. 67<br />
61 Vgl. dazu Giese, Trattner, Sp. 1149-1158 <strong>und</strong> Cloeter, Großunternehmer, S. 35-37.<br />
62 Jaklin, Schulbuch, S. 51<br />
63 Vgl. Giese, Trattner, Sp. 1155 <strong>und</strong> Sp. 1167.<br />
64 Vgl. Trattner, ‚Skizzirter Plan...’, abgebildet bei Cloeter, Großunternehmer, S. 129-132.<br />
65 Vgl. Giese, Trattner, S. 1157.<br />
66 Vgl. HKA Wien NÖ Kommerz, Fasc 110/1, auszugsweise abgedruckt bei Giese, Trattner, Sp. 1014-1023.<br />
67 Vgl. Giese, Trattner, Sp. 1023f.
- 15 -<br />
Ein zweites Beispiel bildet Trattners Einführung des Stücklohns <strong>für</strong> die in seinen beiden<br />
Papierfabriken arbeitenden Gesellen. Der Stücklohn stellte ein absolutes Novum dar 68 <strong>und</strong> war<br />
<strong>für</strong> die Papiergesellen ein großer Anreiz zur Steigerung der Produktion, was besonders<br />
interessant ist, wenn man bedenkt, dass Trattner sich noch wenige Jahre zuvor einer akuten<br />
allgemeinen Papierknappheit in den Erblanden ausgesetzt sah <strong>und</strong> seine eigenen Papierfabriken<br />
ja gegründet hatte, um dieser Papierknappheit entgegenzuwirken.<br />
Abschließend wäre im Zusammenhang mit Trattners Innovationen auch noch darausf<br />
hinzuweisen, dass er nicht nur Anregungen umsetzte, auf die er – wie etwa im Zusammenhang<br />
mit dem Gutachten der „Niederösterreichischen Repräsentanz <strong>und</strong> Cammer“ – mehr oder<br />
weniger zufällig – stieß bzw. gestoßen worden war, sondern sich auch gezielt über weitere<br />
Innovationsmöglichkeiten zu informieren suchte. Die erste seiner beiden ausgedehnten<br />
Europareisen (1764) diente nachweislich diesem Zweck, 69 <strong>für</strong> die zweite (1783) kann man es<br />
zumindest vermuten.<br />
3.9 Ausbau des Unternehmens <strong>und</strong> Nutzung von Synergieeffekten<br />
Obwohl Trattner zunächst als „reiner“ Drucker begonnen hatte, dehnte er sein Unternehmen<br />
rasch <strong>und</strong> systematisch aus <strong>und</strong> zwar nicht nur rein quantitativ (also beispielweise durch<br />
Erhöhung der Zahl der Pressen <strong>und</strong> Mitarbeiter...) sondern auch qualitativ durch die Eröffnung<br />
ganzer neuer Geschäftszweige. Trattner drang so in geschäftliche Bereiche vor, die mit dem<br />
Druckerhandwerk im engeren Sinn nur mittelbar zu tun hatte, deren Integration in sein<br />
Unternehmen vom geschäftstrategischen Standpunkt aber gleichwohl sinnvoll, zukunftsträchtig<br />
<strong>und</strong> gewinnversprechend war, so etwa in das Gebiet des Buchhandels 70 <strong>und</strong> der<br />
Papierproduktion.<br />
Deshalb kann man Trattner auch schlecht einfach als „Drucker“ oder „Nachdrucker“<br />
bezeichnen, vielmehr scheint der Begriff „typographischer Großunternehmer“ angemessener.<br />
Auch hatte Trattners Unternehmensexpansion eine starke räumliche Komponente,<br />
nämlich einerseits in dem Sinn, dass er bestrebt war, verschiedenartige, jedoch aufeinander<br />
bezogene Geschäftszweige unter einem Dach zu vereinen um dadurch logistische Vorteile<br />
ausnützen zu können (Musterbeispiel ist hier<strong>für</strong> die Errichtung des „Typographischen<br />
Palastes“) <strong>und</strong> zum anderen in dem Sinne, dass Trattner ausgehend vom Hauptstandort Wien<br />
ein dichtes Netz von Filialbetrieben (Buchhandlungen <strong>und</strong> Druckereien) inner- <strong>und</strong> außerhalb<br />
der Erblande errichtete. 71<br />
68 Vgl. Giese, Trattner, Sp. 1076.<br />
69 Vgl. Jaklin, Schulbuch, S. 29.<br />
70 Der sich im Allgemeinen bezeichnenderweise sonst gerade im 18. Jahrh<strong>und</strong>ert noch mehr vom<br />
Druckerhandwerk ablöste.<br />
71 Vgl. zum Phänomen der Unternehmensexpansion Cloeter, Großunternehmer, S. 9 sowie Giese, Filiale, S. 145-<br />
168, wo der Aufbau der Linzer Niederlassung exemplarisch dargestellt wird.
- 16 -<br />
Abb. 2: Trattners Filialnetz. 72 (Die Sternchen bezeichnen Standorte des österr. Schulbuchverlages <strong>und</strong><br />
sind im gegebenen Zusammenhang nicht relevant.)<br />
Was waren nun die Ziele dieser Formen der Unternehmensexpansion <strong>und</strong><br />
Diversifizierung? Meiner Ansicht nach verfolgte Trattner damit vor allem zwei Ziele, nämlich<br />
die Nutzung von Synergieeffekten, sowie die Gewinnung von Unabhängigkeit gegenüber<br />
unzuverlässigen Dritten, auf die er sonst angewiesen gewesen wäre.<br />
Besonders gut belegbar ist diese These <strong>für</strong> die Errichtung der beiden Papierfabriken in<br />
Ebergassing, läßt sich doch nachwiesen, dass die Versorgung mit Papier zuvor in den<br />
Erblanden über Jahre hinweg nur äußerst schlecht funktioniert hatte, 73 was <strong>für</strong> Trattner mit<br />
seinem unaufhaltsam expandierenden Unternehmen, vor allem dem papierintensiven Druck<br />
von Massenware, schnell zum Problem geworden sein mag.<br />
Der Aufbau eines eigenen Netzwerkes von Buchhandlungen dagegen erlaubte Trattner<br />
seine Produkte einfacher, schneller <strong>und</strong> vor allem zu günstigeren Konditionen, zumal an das<br />
Publikum in der bisher buchhändlerisch kaum erschlossenen Provinz, abzusetzen.<br />
Wesentlich befördert wurden Trattners Strategien der Unternehmensexpansion nicht nur<br />
durch sein forsches Wesen, dass ihn nicht davor zurück schrecken ließ, zur Finanzierung dieser<br />
Unternehmensexpansion sehr hohe Kredite aufzunehmen, sondern wiederum durch den Hof,<br />
der zum einen durch seine großzügige Privilegeinvergabe die Gr<strong>und</strong>lage der Expansion erst<br />
72 Aus: Jaklin, Schulbuch, S. 109.<br />
73 Vgl. Durstmüller, Druck, S. 206.
- 17 -<br />
gelegt hatte <strong>und</strong> zum anderen Trattner immer wieder dabei behilflich war, günstig an<br />
Betriebsobjekte zu kommen. 74<br />
4.0 Zusammenfassung <strong>und</strong> Bewertung<br />
Ausgehend von den bloßen Rahmendaten der Erfolgsgeschichte des typographischen<br />
Großunternehmers Johann Thomas von Trattner habe ich nach den Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Ursachen<br />
<strong>für</strong> Trattners geschäftlichen Erfolg gefragt <strong>und</strong> dabei vor allem die unternehmerischen<br />
Strategien Trattners beleuchtet.<br />
Versucht man ein abschließendes Resümee, so sind als zentrale Erfolgsstrategien Trattners<br />
kluge Imagepolitik (nicht nur) am Beginn seiner unternehmerischen Laufbahn, der gezielte<br />
Aufbau von Beziehungsnetzwerken ins jesuitische, akademische <strong>und</strong> höfische Milieu bzw. zur<br />
Kaiserin selbst, die gute Kenntnis des Buchmarktes <strong>und</strong> der Marktbedürfnisse, der gezielte<br />
Einsatz von Strategien der Werbung <strong>und</strong> Absatzförderung, speziell auch bestimmter Formen<br />
der Buchgestaltung <strong>und</strong> Preisgestaltung, Innovationsfähigkeit <strong>und</strong> Innovationsfreudigkeit zu<br />
nennen. Dazu kommen Strategien gezielter Unternehmensdiversifizierung <strong>und</strong><br />
Unternehmensexpansion.<br />
Wie modern die meisten der von Trattner angewandten Unternehmensstrategien wirken, wird<br />
jeder Leser eingestehen müssen <strong>und</strong> zwar auch ohne dass man diese Strategien mit<br />
zugegebenermaßen anachronistischen Begriffen wie Imagekampagne, Marketing oder Lobbying<br />
belegt.<br />
Ohne die persönliche Leistung Trattners schmälern zu wollen, ist dabei auch festzuhalten,<br />
dass die meisten seiner Erfolgsstrategien gerade deshalb so gut funktionierten, weil ihr Einsatz<br />
von äußeren Umständen der Zeit begünstigt wurde. Als Beispiel da<strong>für</strong> lässt sich die zumindest<br />
partielle Interessensgleichheit zwischen Trattner <strong>und</strong> Maria Theresia unter den Vorzeichen<br />
merkantilistischer Wirtschaftspolitik anführen. Maria Theresia hätte Trattners Aktivitäten wohl<br />
kaum in dem dokumentierten Ausmaß begünstigt, wenn sie (bzw. ‚der Staat’) nicht selbst ein<br />
vitales Interesse am Ausbau der erbländischen Druckwirtschaft gehabt hätte.<br />
Auffällig ist außerdem, dass sich die beiden, meiner Einschätzung nach wichtigsten<br />
Erfolgsstrategien Trattners (Aufbau von Beziehungsnetzwerken <strong>und</strong> Ausbau des Unternehmens<br />
zu einem weitverzweigten typographischen Imperium mit verschiedensten, zur Erzielung von<br />
Synergieeffekten miteinander vernetzten Geschäftszweigen <strong>und</strong> Filialnetzen) zum einen schon in<br />
seinem eigenen Wahlspruch andeuten („Labore et favore“ – durch <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Gunst</strong>) <strong>und</strong> sich<br />
andererseits beide mit der Metapher des Netzes beschreiben lassen, einer Metapher also, derer<br />
sich die medienhistorische Forschung in ähnlichen Zusammenhängen bereits mit Gewinn<br />
bedient hat. 75<br />
74 Vgl. Cloeter, Großunternehmer, S. 55.<br />
75 Z.B. Giesecke, Medien, S. 75-98. Auf die Nützlichkeit der von Giesecke entwickelten Netzmetapher <strong>für</strong> den<br />
gegebenen Untersuchungsgegenstand weist auch Frimmel, Netzwerk, hin.
5.0 Ausblick<br />
- 18 -<br />
Was die angewandte Methodik betrifft, so hat es sich meiner Einschätzung nach als sinnvoll<br />
erwiesen, die Geschichte Trattners einmal nicht unter rechtshistorischen Gesichtspunkten<br />
(„Trattner als Nachdrucker“) betrachtet, sondern bewusst einen stärker unternehmens- bzw.<br />
wirkungsgeschichtlichen Zugriff versucht zu haben.<br />
Sowohl eine weitergehende Untersuchung der Bedeutung verschiedenster Arten von<br />
Netzwerken (z.B. Beziehungsnetzwerke <strong>und</strong> Filialnetzwerke) <strong>für</strong> Trattners Erfolgsstrategien als<br />
auch eine weitergehende Untersuchung anderer unternehmensgeschichtlicher Aspekte wären<br />
<strong>für</strong> künftige <strong>Arbeit</strong>en 76 überaus wünschenswert. Der unternehmensgeschichtliche Ansatz<br />
könnte sich dabei auch rein methodisch als überaus fruchtbar erwiesen, zumal wenn es im Zuge<br />
einschlägiger Untersuchungen zu einem engeren Zusammenwirken von Medien- <strong>und</strong><br />
Unternehmensgeschichte kommt, als dies bisher der Fall gewesen ist.<br />
76 Solche wird man sich in näherer Zukunft wohl vor allem im Zusammenhang mit dem aktuellen, von der<br />
Österreichischen Gesellschaft <strong>für</strong> Buchforschung initiierten <strong>und</strong> im Bereich des Vernetzungsportals "Kakanien<br />
revisited" angesiedelten Forschungsprojektes „Der Buchmarkt der Habsburgermonarchie / The Book Market of<br />
the Habsburg Monarchy (FWF-Projekt Nr. P16079)“ mit dem Untersuchungszeitraum 1750-1850 erwarten<br />
dürfen. Vgl. dazu Universität Wien/bm:bwk: Kakanien revisited, Gesellschaft <strong>für</strong> Buchforschung in Österreich,<br />
Homepage u. Frimmel, Netzwerk.
Abkürzungen<br />
- 19 -<br />
AGB Archiv <strong>für</strong> Geschichte des Buchwesens<br />
bm:bwk B<strong>und</strong>esministerium <strong>für</strong> Bildung, Wissenschaft <strong>und</strong> Kunst<br />
Fasc. fasciculum, Faszikel<br />
FWF Österreichischer Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung<br />
HKA Hofkammerarchiv (heute Teil des Österreichischen Staatsarchivs, Wien)<br />
k.k kaiserlich-königlich, d.h. die österreichische <strong>und</strong> die ungarische Reichshälfte<br />
betreffend<br />
nö. niederösterreichisch<br />
ÖSTA Österr. Staatsarchiv, Wien<br />
österr. österreichische(s)<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abb. 1 Schriftmusterblatt Trattners S. 13<br />
Abb. 2 Trattners Filialnetz S. 16
- 20 -<br />
Literatur- <strong>und</strong> Quellenverzeichnis<br />
Gedruckte Quellen<br />
Abdruck von denjenigen Röslein <strong>und</strong> Zierrathen, welche sich in der k.k. Hoffschriftgiesserey bey<br />
Johann Thomas Trattnern dermalen befinden. In: Mayer, Anton : Wiens Buchdrucker-Geschichte : Bd.<br />
2. 1482 - 1882 / hrsg. von den Buchdruckern Wiens. Verf. von Anton Mayer . - Wien : Verl. des<br />
Comités zur Feier der 400j. Einf. der Buchdruckerkunst in Wien.<br />
Bd. 2: 1682-1882. Wien : Frick, 1887. S. 79.<br />
Hofbericht der „Niederösterreichischen Repräsentanz <strong>und</strong> Cammer“ von 1751 über die Lage der<br />
Buchproduktion in Österreich. HKA (=ÖSTA) Wien NÖ Kommerz, Fasc 110/1. Auszugsweise<br />
gedruckt bei: Giese, Ursula: Johann Thomas Edler von Trattner. – Seine Bedeutung als Buchdrucker,<br />
Buchhändler <strong>und</strong> Herausgeber. In: AGB 3(1961), Sp. 1014-1023.<br />
Trattner, Johann Thomas von: Plan zur allgemeinen Verbreitung der Kultur in den k.k. Staaten durch<br />
wohlfeile Lieferung der Bücher <strong>für</strong> alle Fächer der Wissenschaften. (1785). In: Cloeter, Hermine :<br />
Johann Thomas Trattner. Ein Großunternehmer im theresianischen Wien / Hermine Cloeter . - Graz<br />
[u.a.] : Boehlau , 1952 . S. 129-132.<br />
Literatur <strong>und</strong> Internetquellen<br />
Brauneder, Wilhelm : Österreichische Verfassungsgeschichte / von Wilhelm Brauneder. Graph. Darst.:<br />
Friedrich Lachmayer . - 6., durchges. u. erg. Aufl. . - Wien : Manz , 1992 . - 288 S.<br />
Cloeter, Hermine: Johann Thomas von Trattner. Ein Großunternehmer aus dem Theresianischen Wien.<br />
In: Jahrbuch des Vereins <strong>für</strong> Geschichte der Stadt Wien. 1(1939) S. 82-102.<br />
Cloeter, Hermine : Johann Thomas Trattner. Ein Großunternehmer im theresianischen Wien /<br />
Hermine Cloeter . - Graz [u.a.] : Boehlau , 1952 . - 138 S.<br />
Durstmüller, Anton : 500 Jahre Druck in Österreich : die Entwicklungsgeschichte der graphischen<br />
Gewerbe von den Anfängen bis zur Gegenwart / von Anton Durstmüller . - Wien : Hauptverband der<br />
Graphischen Unternehmungen Österreichs<br />
Bd. 1: Anton Durstmüller ; Norbert Frank. -[1]. [1482 - 1848] , [1982] . - 392 S. + Beil.: 6 Falttaf.<br />
Frimmel, Johannes: Das Netzwerk des Gedruckten. – Überlegungen anlässlich eines<br />
Forschungsprojektes. [Internetressource.] http://www.kakanien.ac.at/beitr/ncs/Jfrimmel1.pdf. [Letzter<br />
Zugriff: 17.07.2004.]<br />
Gesellschaft <strong>für</strong> Buchforschung in Österreich: Homepage. [Internetressource.]<br />
http://www.buchforschung.at. [Letzter Zugriff: 19.07.2004.]<br />
Giese, Ursula: Die Filiale des Edlen von Trattner in Linz. – Ein Beitrag zur Geschichte des<br />
Buchgewerbes in Oberösterreich. Oberösterreichische Heimatblätter 14(1960) S. 145-168.<br />
Giese, Ursula: Johann Thomas Edler von Trattner. – Seine Bedeutung als Buchdrucker, Buchhändler<br />
<strong>und</strong> Herausgeber. In: AGB 3(1961), Sp. 1013-1454.<br />
Giesecke, Michael: Als die alten Medien neu waren : Medienrevolutionen in der Geschichte. In:<br />
Information ohne Kommunikation? : die Loslösung der Sprache vom Sprecher / hrsg. von Rüdiger<br />
Weingarten . - Orig.-Ausg. . - Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl. , 1990 . - S. 75-98.<br />
Goldfriedrich, Johann : Geschichte des Deutschen Buchhandels / im Auftr. des Börsenvereins der<br />
Deutschen Buchhändler hrsg. von der Historischen Kommission desselben . - Leipzig : Verl. des<br />
Börsenvereins der Dt. Buchhändler
- 21 -<br />
Bd. 3 (1909). Geschichte des Deutschen Buchhandels vom Beginn der klassischen Litteraturperiode bis<br />
zum Beginn der Fremdherrschaft (1740-1804) / von Johann Goldfriedrich , 1909 . - IX, 673 S.<br />
Haberkern, Eugen ; Wallach, Joseph F.: Art. Landstände in: Haberkern, Eugen : Hilfswörterbuch <strong>für</strong><br />
Historiker : Mittelalter <strong>und</strong> Neuzeit / von Eugen Haberkern u. Joseph Friedrich Wallach . - 2.,<br />
neubearb. u. erw. Aufl. . - Bern [u.a.] : Francke , 1964 . - S. 379.<br />
Haberkern, Eugen ; Wallach, Joseph F.: Art. Landtag in: Haberkern, Eugen : Hilfswörterbuch <strong>für</strong><br />
Historiker : Mittelalter <strong>und</strong> Neuzeit / von Eugen Haberkern u. Joseph Friedrich Wallach . - 2.,<br />
neubearb. u. erw. Aufl. . - Bern [u.a.] : Francke , 1964 . - S. 380f.<br />
Heitjan, Isabel: Trattners Briefe an das Unternehmen Moretus. In: AGB 18(1977), Sp. 1067-1076.<br />
Jaklin, Ingeborg : Das österreichische Schulbuch im 18. Jahrh<strong>und</strong>ert : aus dem Wiener Verlag Trattner<br />
<strong>und</strong> dem Schulbuchverlag / Ingeborg Jaklin . - [Wien] : Ed. Praesens , 2003 . - 299 S. . - (Buchforschung<br />
; 3 )<br />
Kiesel, Helmuth : Gesellschaft <strong>und</strong> Literatur im 18. Jahrh<strong>und</strong>ert : Voraussetzungen <strong>und</strong> Entstehung des<br />
literarischen Markts in Deutschland / Helmuth Kiesel ; Paul Münch . - München : Beck , 1977 . - 245 S.<br />
. - (Beck'sche Elementarbücher )<br />
Lehmstedt Mark: „Ein Strohm der alles überschwemmet“. – Dokumente zum Verhältnis von Philipp<br />
Erasmus Reich <strong>und</strong> Johann Thomas von Trattner. Ein Beitrag zur Geschichte des Nachdrucks in<br />
Deutschland im 18. Jahrh<strong>und</strong>ert. In: Bibliothek <strong>und</strong> Wissenschaft 25(1991) [erschienen 1992] S. 176-<br />
267.<br />
Mayer, Anton : Wiens Buchdrucker-Geschichte : Bd. 2. 1482 - 1882 / hrsg. von den Buchdruckern<br />
Wiens. Verf. von Anton Mayer . - Wien : Verl. des Comités zur Feier der 400j. Einf. der<br />
Buchdruckerkunst in Wien.<br />
Bd. 2: 1682-1882. Wien : Frick, 1887. VIII 423 S., zahlr. Ill.<br />
Pierenkemper, Toni : Unternehmensgeschichte : eine Einführung in ihre Methoden <strong>und</strong> Ergebnisse /<br />
Toni Pierenkemper . - Stuttgart : Steiner , 2000 . - 328 S. . - (Gr<strong>und</strong>züge der modernen<br />
Wirtschaftsgeschichte ; 1 )<br />
Universität Wien / [Österreichisches] B<strong>und</strong>esministerium <strong>für</strong> Bildung, Wissenschaft <strong>und</strong> Kunst:<br />
Kakanien revisited. [Internetressource.] http://www.kakanien.ac.at/home. Letzter Zugriff: 19.07.2004.<br />
Wittmann, Reinhard: Der gerechtfertigte Nachdrucker? In: Buch <strong>und</strong> Buchhandel in Europa im<br />
achtzehnten Jahrh<strong>und</strong>ert : fünftes Wolfenbütteler Symposium vom 1. bis 3. November 1977 ; Vorträge<br />
= The book and the book trade in Eighteenth-century Europe / hrsg. von Giles Barber u. Bernhard<br />
Fabian . - Hamburg : Hauswedell , 1981 . - 360 S. . - (Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des<br />
Buchwesens ; 4 ) S. 293-320.<br />
Wittmann, Reinhard : Geschichte des deutschen Buchhandels : ein Überblick / Reinhard Wittmann . -<br />
München : Beck , 1991 . - 438 S.<br />
Wurzbach, Constantin von : Art. Chotek von Chotkowa <strong>und</strong> Wognin, J. Rudolph Graf. In: Wurzbach,<br />
Constantin von : Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich : enthaltend die Lebensskizzen<br />
der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate <strong>und</strong> in seinen Kronländern gelebt<br />
haben / von Constant v. Wurzbach . - Wien : Verl. d. typograf.-literarisch-artist. Anstalt. Bd. 2.(Bninski -<br />
Cordova). 1857 S. 362f.<br />
Wurzbach, Constantin von : Art. Trattner, Johann Thomas Edler von. In: Wurzbach, Constantin von :<br />
Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich : enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen<br />
Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate <strong>und</strong> in seinen Kronländern gelebt haben / von<br />
Constant v. Wurzbach . - Wien : Verl. d. typograf.-literarisch-artist. Anstalt. Bd. 46.Toffoli -<br />
Traubenburg.1882. S.285-291.