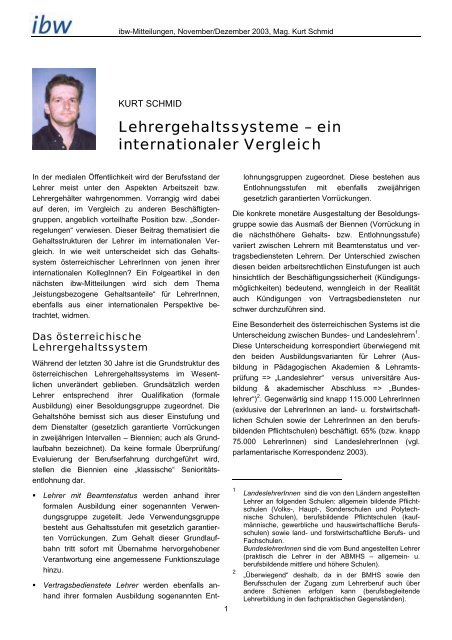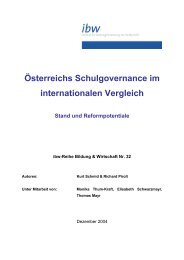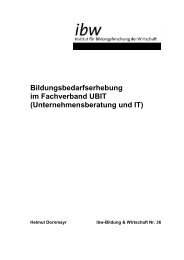Lehrergehaltssysteme – ein internationaler Vergleich - ibw
Lehrergehaltssysteme – ein internationaler Vergleich - ibw
Lehrergehaltssysteme – ein internationaler Vergleich - ibw
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>ibw</strong>-Mitteilungen, November/Dezember 2003, Mag. Kurt Schmid<br />
KURT SCHMID<br />
<strong>Lehrergehaltssysteme</strong> <strong>–</strong> <strong>ein</strong><br />
<strong>internationaler</strong> <strong>Vergleich</strong><br />
In der medialen Öffentlichkeit wird der Berufsstand der<br />
Lehrer meist unter den Aspekten Arbeitszeit bzw.<br />
Lehrergehälter wahrgenommen. Vorrangig wird dabei<br />
auf deren, im <strong>Vergleich</strong> zu anderen Beschäftigtengruppen,<br />
angeblich vorteilhafte Position bzw. „Sonderregelungen“<br />
verwiesen. Dieser Beitrag thematisiert die<br />
Gehaltsstrukturen der Lehrer im internationalen <strong>Vergleich</strong>.<br />
In wie weit unterscheidet sich das Gehaltssystem<br />
österreichischer LehrerInnen von jenen ihrer<br />
internationalen KollegInnen? Ein Folgeartikel in den<br />
nächsten <strong>ibw</strong>-Mitteilungen wird sich dem Thema<br />
„leistungsbezogene Gehaltsanteile“ für LehrerInnen,<br />
ebenfalls aus <strong>ein</strong>er internationalen Perspektive betrachtet,<br />
widmen.<br />
Das österreichische<br />
Lehrergehaltssystem<br />
Während der letzten 30 Jahre ist die Grundstruktur des<br />
österreichischen Lehrergehaltssystems im Wesentlichen<br />
unverändert geblieben. Grundsätzlich werden<br />
Lehrer entsprechend ihrer Qualifikation (formale<br />
Ausbildung) <strong>ein</strong>er Besoldungsgruppe zugeordnet. Die<br />
Gehaltshöhe bemisst sich aus dieser Einstufung und<br />
dem Dienstalter (gesetzlich garantierte Vorrückungen<br />
in zweijährigen Intervallen <strong>–</strong> Biennien; auch als Grundlaufbahn<br />
bezeichnet). Da k<strong>ein</strong>e formale Überprüfung/<br />
Evaluierung der Berufserfahrung durchgeführt wird,<br />
stellen die Biennien <strong>ein</strong>e „klassische“ Senioritätsentlohnung<br />
dar.<br />
� Lehrer mit Beamtenstatus werden anhand ihrer<br />
formalen Ausbildung <strong>ein</strong>er sogenannten Verwendungsgruppe<br />
zugeteilt. Jede Verwendungsgruppe<br />
besteht aus Gehaltsstufen mit gesetzlich garantierten<br />
Vorrückungen. Zum Gehalt dieser Grundlaufbahn<br />
tritt sofort mit Übernahme hervorgehobener<br />
Verantwortung <strong>ein</strong>e angemessene Funktionszulage<br />
hinzu.<br />
� Vertragsbedienstete Lehrer werden ebenfalls anhand<br />
ihrer formalen Ausbildung sogenannten Ent-<br />
1<br />
lohnungsgruppen zugeordnet. Diese bestehen aus<br />
Entlohnungsstufen mit ebenfalls zweijährigen<br />
gesetzlich garantierten Vorrückungen.<br />
Die konkrete monetäre Ausgestaltung der Besoldungsgruppe<br />
sowie das Ausmaß der Biennen (Vorrückung in<br />
die nächsthöhere Gehalts- bzw. Entlohnungsstufe)<br />
variiert zwischen Lehrern mit Beamtenstatus und vertragsbediensteten<br />
Lehrern. Der Unterschied zwischen<br />
diesen beiden arbeitsrechtlichen Einstufungen ist auch<br />
hinsichtlich der Beschäftigungssicherheit (Kündigungsmöglichkeiten)<br />
bedeutend, wenngleich in der Realität<br />
auch Kündigungen von Vertragsbediensteten nur<br />
schwer durchzuführen sind.<br />
Eine Besonderheit des österreichischen Systems ist die<br />
Unterscheidung zwischen Bundes- und Landeslehrern 1 .<br />
Diese Unterscheidung korrespondiert überwiegend mit<br />
den beiden Ausbildungsvarianten für Lehrer (Ausbildung<br />
in Pädagogischen Akademien & Lehramtsprüfung<br />
=> „Landeslehrer“ versus universitäre Ausbildung<br />
& akademischer Abschluss => „Bundeslehrer“)<br />
2 . Gegenwärtig sind knapp 115.000 LehrerInnen<br />
(exklusive der LehrerInnen an land- u. forstwirtschaftlichen<br />
Schulen sowie der LehrerInnen an den berufsbildenden<br />
Pflichtschulen) beschäftigt. 65% (bzw. knapp<br />
75.000 LehrerInnen) sind LandeslehrerInnen (vgl.<br />
parlamentarische Korrespondenz 2003).<br />
1 LandeslehrerInnen sind die von den Ländern angestellten<br />
Lehrer an folgenden Schulen: allgem<strong>ein</strong> bildende Pflichtschulen<br />
(Volks-, Haupt-, Sonderschulen und Polytechnische<br />
Schulen), berufsbildende Pflichtschulen (kaufmännische,<br />
gewerbliche und hauswirtschaftliche Berufsschulen)<br />
sowie land- und forstwirtschaftliche Berufs- und<br />
Fachschulen.<br />
BundeslehrerInnen sind die vom Bund angestellten Lehrer<br />
(praktisch die Lehrer in der ABMHS <strong>–</strong> allgem<strong>ein</strong>- u.<br />
berufsbildende mittlere und höhere Schulen).<br />
2 „Überwiegend“ deshalb, da in der BMHS sowie den<br />
Berufsschulen der Zugang zum Lehrerberuf auch über<br />
andere Schienen erfolgen kann (berufsbegleitende<br />
Lehrerbildung in den fachpraktischen Gegenständen).
<strong>ibw</strong>-Mitteilungen, November/Dezember 2003, Mag. Kurt Schmid<br />
Der aktuelle Monatsbezug der Lehrer besteht aus dem<br />
Gehalt und allfälligen Zulagen (Vorrückungssystem<br />
mit Funktionszulagen). Zum Gehalt der Grundlaufbahn<br />
tritt sofort mit Übernahme hervorgehobener<br />
Verantwortung <strong>ein</strong>e Funktionszulage hinzu. Funktionen<br />
in diesem Zusammenhang sind nicht nur Managementfunktionen,<br />
sondern auch andere hoch bewertete<br />
Arbeitsplätze, die Spezialistenwissen erfordern. Die<br />
Höhe der Funktionszulage wird durch die Zuordnung<br />
des Arbeitsplatzes zu <strong>ein</strong>er der Funktionsgruppen<br />
(Arbeitsplatzwertigkeit) und durch die Funktionsstufe<br />
(an das Dienstalter anknüpfende Erfahrungskomponente)<br />
bestimmt. Nach wie vor besteht zu jeder Verwendungs-<br />
bzw. Entlohnungsgruppe <strong>ein</strong>e Zuordnung<br />
nach dem Vorbildungsprinzip.<br />
Das Besoldungsrecht der Beamten und Vertragsbediensteten<br />
kennt <strong>ein</strong>e Reihe von Nebengebühren.<br />
Dabei handelt es sich um Bezüge, die zeitliche<br />
Mehrleistungen (etwa in Form von Überstunden oder<br />
Journaldiensten) oder besondere Umstände des Dienstes<br />
(Gefahren, Erschwernisse) abgelten, weiters um<br />
Aufwandersätze (etwa für den Mehraufwand im<br />
Rahmen von Dienstreisen) oder um Leistungen mit<br />
Belohnungscharakter. Zur letzten Kategorie gehört die<br />
Belohnung 3 selbst, die nach Maßgabe vorhandener<br />
Mittel für besondere Leistungen oder aus sonstigen<br />
besonderen Anlässen gezahlt werden kann und die<br />
Jubiläumszuwendung, <strong>ein</strong>e Treueprämie für 25- bzw.<br />
40-jährige Dienste.<br />
Internationaler <strong>Vergleich</strong><br />
der Grundstrukturen<br />
der Lehrergehälter<br />
In den meisten OECD-Ländern werden Lehrer <strong>–</strong><br />
ähnlich dem österreichischen System <strong>–</strong> nach <strong>ein</strong>heitlichen<br />
Besoldungsgruppen bezahlt, wobei das<br />
Gehalt von der Qualifikation (formaler Bildungsabschluss)<br />
und von der Berufserfahrung des Lehrers<br />
(gemessen an der Beschäftigungsdauer) abhängt.<br />
Diese Besoldungsgruppen werden meist auf zentraler<br />
oder regionaler Ebene festgelegt. Ausnahmen bilden<br />
Finnland, Schweden, die USA und das Ver<strong>ein</strong>igte<br />
Königreich, wo die Lehrergehälter auf lokaler Ebene<br />
3 Folgende Belohnungen sind möglich:<br />
� Belohnung aus Belohnungsaktionen (max. € 436/Jahr);<br />
� Belohnung für Mitglieder des Schulgem<strong>ein</strong>schaftsausschusses;<br />
� Belohnung für verpflichtende Klassenelternabende,<br />
2<br />
oder innerhalb <strong>ein</strong>es von höherer Stelle vorgegebenen<br />
Rahmens auf Schulebene ver<strong>ein</strong>bart werden (Klös und<br />
Weiß 2003).<br />
In fast allen Ländern wird über <strong>ein</strong> Gehaltsstufensystem<br />
die grundsätzliche Steigerung der Lehrergehälter<br />
während des Berufslebens festgelegt. Überwiegend<br />
werden lineare Steigerungsstufensysteme<br />
verwendet, lediglich in <strong>ein</strong>igen osteuropäischen Ländern<br />
gibt es auch sogenannte Matrixsysteme (in derartigen<br />
Systemen ergibt sich die Gehaltsstruktur <strong>ein</strong>es<br />
Lehrers aus der Kombination mehrerer, jedoch nicht<br />
mit<strong>ein</strong>ander korrelierter/zusammenhängender Komponenten).<br />
Darüber hinaus können Lehrer in nahezu allen<br />
OECD-Ländern diverse Zulagen und „sonstige finanzielle<br />
Zuschüsse“ (Reisekostenzuschüsse, Wohnzuschüsse,<br />
Zuschüsse für Studienmaterial etc.) erhalten.<br />
Leistungsbezogene Gehaltsbestandteile („Leistungsprämien“)<br />
sind nicht sehr verbreitet. In den Ländern, die<br />
derartige variable Gehaltsbestandteile vorsehen, machen<br />
diese in der Regel nur <strong>ein</strong>en sehr geringen Anteil<br />
des gesamten Lehrerentgelts aus.<br />
Einstiegsgehälter und<br />
Einkommensentwicklung<br />
in Abhängigkeit<br />
der Beschäftigungsdauer<br />
Einstiegsgehalt<br />
In den meisten Ländern liegen die Einstiegsgehälter<br />
der Lehrer unter dem durchschnittlichen Einkommen<br />
der Gesamtbevölkerung (Indikator BIP pro Kopf) <strong>–</strong><br />
Grafik 1. Nur in Australien, Belgien (nur der Sekundarbereich<br />
II), Dänemark, Deutschland (!), Griechenland,<br />
Korea, Mexiko, Portugal, Spanien, der Schweiz und der<br />
Türkei liegen sie darüber. Dies ist deshalb auch<br />
bemerkenswert, da die Lehrerpopulation doch höhere<br />
Qualifikationen (formale Bildungsabschlüsse) als der<br />
Durchschnitt der Gesamtbevölkerung aufweisen dürfte.<br />
In 11 Ländern gibt es (praktisch) k<strong>ein</strong>e Unterschiede<br />
bei den Einstiegsgehältern differenziert nach den<br />
Bildungsbereichen. Relativ geringe Unterschiede gibt<br />
es in 10 Ländern (inkl. Österreich), relativ große<br />
Unterschiede in 8 Ländern.
GRAFIK 1:<br />
Anfangsgehalt / BIP pro Kopf<br />
1,8<br />
1,6<br />
1,4<br />
1,2<br />
1,0<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
0,0<br />
Australien<br />
Quelle: OECD (2003); <strong>ibw</strong>-Berechnungen<br />
Gehaltsentwicklung<br />
während des Berufslebens<br />
<strong>ibw</strong>-Mitteilungen, November/Dezember 2003, Mag. Kurt Schmid<br />
Primarbereich<br />
Sekundarbereich I<br />
Sekundarbereich II<br />
Belgien<br />
Tschechische Rep.<br />
Deutliche Unterschiede gibt es zwischen den Ländern<br />
hinsichtlich der Steigerungsdynamik der Lehrergehälter<br />
während des Berufslebens (Indikator: Verhältnis des<br />
Höchstgehaltes bezogen auf das Anfangsgehalt). In<br />
der Tabelle 1 haben die Schulbereiche der Länder, die<br />
rot <strong>ein</strong>gefärbt sind, <strong>ein</strong> um mindestens zwei Drittel<br />
höheres Maximalgehalt <strong>–</strong> verglichen mit dem jeweiligen<br />
Anfangsgehalt. Die gelbe Formatierung zeigt die<br />
Schulbereiche der Länder, deren Höchstgehalt maximal<br />
um <strong>ein</strong> Drittel höher als das jeweilige Anfangs-<br />
Lehreranfangsgehalt / BIP pro Kopf<br />
3<br />
Finnland<br />
Frankreich<br />
Deutschland<br />
Griechenland<br />
Ungarn<br />
Island<br />
Irland<br />
Italien<br />
Japan<br />
Korea<br />
Mexiko<br />
Niederlande<br />
Neuseeland<br />
Norwegen<br />
Portugal<br />
Slowakische Rep.<br />
Spanien<br />
Schweden<br />
Schweiz<br />
gehalt ist. Die orange Formatierung ist der Zwischenbereich,<br />
in dem das Höchstgehalt der Lehrer zwischen<br />
<strong>ein</strong>em und zwei Drittel höher als das Anfangsgehalt ist.<br />
Österreich gehört in die Kategorie jener Länder, deren<br />
Gehaltsschemata die stärkste implizite Einkommensdynamik<br />
zugrunde liegt (in etwa <strong>ein</strong>e Verdoppelung).<br />
Zusätzlich ist in der Tabelle auch noch die Anzahl der<br />
Berufsjahre ausgewiesen, bis man das Höchstgehalt<br />
erreicht. Hier gehört Österreich zur Kategorie der<br />
Länder, in denen erst sehr spät im Berufsleben das<br />
maximale Einkommen erzielt wird (erst nach 34<br />
Jahren).<br />
USA
TABELLE 1:<br />
<strong>ibw</strong>-Mitteilungen, November/Dezember 2003, Mag. Kurt Schmid<br />
Verhältnis des Höchstgehaltes zum Anfangsgehalt der Lehrer<br />
Jahre bis zum<br />
Primarbereich Sekundarbereich I Sekundarbereich II Höchstgehalt<br />
Australien 1,42 1,42 1,42 10<br />
Österreich 2,00 2,08 2,13 34<br />
Belgien (fläm.) 1,59 1,71 1,73 27<br />
Belgien (frz.) 1,64 1,73 1,76 27<br />
Tschechische Rep. 1,72 1,72 1,73 32<br />
Dänemark 1,13 1,13 1,42 8<br />
England 1,58 1,58 1,58 8<br />
Finnland 1,42 1,45 1,49 20<br />
Frankreich 1,98 1,89 1,89 34<br />
Deutschland 1,30 1,28 1,28 28<br />
Griechenland 1,46 1,46 1,46 33<br />
Ungarn 1,92 1,92 1,92 40<br />
Island 1,15 1,15 1,39 18<br />
Irland 1,83 1,76 1,76 22<br />
Italien 1,46 1,49 1,56 35<br />
Japan 2,41 2,41 2,48 31<br />
Korea 2,72 2,73 2,73 37<br />
Mexiko 2,18 2,15 14<br />
Niederlande 1,44 1,53 2,01 22<br />
Neuseeland 1,93 1,93 1,93 7<br />
Norwegen 1,23 1,23 1,23 28<br />
Portugal 2,67 2,67 2,67 26<br />
Schottland 1,60 1,60 1,60 11<br />
Slowakische Rep. 1,43 1,57 1,74 27<br />
Spanien 1,46 1,45 1,45 39<br />
Schweden 1,33 1,33 1,29 a<br />
Schweiz 1,57 1,56 1,51 24<br />
Türkei 1,73 1,80 27<br />
Ver<strong>ein</strong>igte Staaten 1,77 1,73 1,73 m<br />
Ländermittel 1,66 1,67 1,70 25<br />
Quelle: OECD (2003); <strong>ibw</strong>-Berechnungen<br />
Aus der Kombination Einkommenssteigerung (Höchstgehalt<br />
in Bezug zum Anfangsgehalt) und dem Zeitpunkt<br />
des Berufslebens, zu dem man das höchste Einkommen<br />
erzielt, lassen sich „hypothetische“ Einkommensprofile<br />
generieren. Diese Profile zeigen nicht<br />
die wirkliche Einkommensentwicklung auf (da ja die<br />
Gehälter infolge der Inflationsanpassungen sich verändern),<br />
sondern zeigen „nur“ die den Besoldungs-<br />
4<br />
schemata zugrundeliegende Einkommensdynamik (und<br />
die dadurch implizierte monetäre Anreizwirkung). Anhand<br />
der Grafiken 2a und b ist deutlich zu erkennen,<br />
dass die Gehaltsschemata der Ländern sehr unterschiedlich<br />
strukturiert sind. Innerhalb <strong>ein</strong>es Landes gibt<br />
es aber praktisch k<strong>ein</strong>e wesentlichen strukturellen<br />
Unterschiede der Gehaltsschemata zwischen den<br />
Schulbereichen.
GRAFIK 2a:<br />
Jahresgehalt in US-$<br />
70.000<br />
65.000<br />
60.000<br />
55.000<br />
50.000<br />
45.000<br />
40.000<br />
35.000<br />
30.000<br />
25.000<br />
20.000<br />
Quelle: OECD (2003); <strong>ibw</strong>-Berechnungen<br />
<strong>ibw</strong>-Mitteilungen, November/Dezember 2003, Mag. Kurt Schmid<br />
Hypothetische Einkommensprofile<br />
im Primarbereich<br />
15.000<br />
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39<br />
Berufsjahre<br />
5<br />
Australien<br />
Österreich<br />
Belgien (fläm.)<br />
Belgien (frz.)<br />
Dänemark<br />
England<br />
Finnland<br />
Frankreich<br />
Deutschland<br />
Griechenland<br />
Irland<br />
Italien<br />
Japan<br />
Korea<br />
Niederlande<br />
Neuseeland<br />
Norwegen<br />
Portugal<br />
Schottland<br />
Spanien<br />
Schweden<br />
Schweiz<br />
Ver<strong>ein</strong>igte Staaten
GRAFIK 2b:<br />
Jahresgehalt in US-$<br />
70.000<br />
65.000<br />
60.000<br />
55.000<br />
50.000<br />
45.000<br />
40.000<br />
35.000<br />
30.000<br />
25.000<br />
20.000<br />
Quelle: OECD (2003); <strong>ibw</strong>-Berechnungen<br />
<strong>ibw</strong>-Mitteilungen, November/Dezember 2003, Mag. Kurt Schmid<br />
Tabelle 2 stellt anhand <strong>ein</strong>es groben Rasters <strong>ein</strong>e<br />
Länderzuordnung zu idealtypischen „Kategorien“ entlang<br />
der Dimensionen Einstiegsgehalt, Zeitpunkt zudem<br />
das höchste Gehalt erzielt wird, und Gehalt am<br />
Ende der Berufslaufbahn dar.<br />
Man erkennt, dass die Höhe des Anfangsgehaltes<br />
praktisch nicht korreliert ist, mit dem Zeitpunkt zudem<br />
das höchste Gehalt erzielt wird. Auch in Bezug auf die<br />
Höhe des Endgehaltes lässt sich k<strong>ein</strong> <strong>ein</strong>deutiger<br />
Zusammenhang mit dem Anfangsgehalt bzw. mit dem<br />
Zeitpunkt, zudem das höchste Gehalt erzielt wird,<br />
erkennen.<br />
Hypothetische Einkommensprofile<br />
in der Sekundarstufe I<br />
15.000<br />
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39<br />
Berufsjahre<br />
6<br />
Australien<br />
Österreich<br />
Belgien (fläm.)<br />
Belgien (frz.)<br />
Dänemark<br />
England<br />
Finnland<br />
Frankreich<br />
Deutschland<br />
Griechenland<br />
Irland<br />
Italien<br />
Japan<br />
Korea<br />
Niederlande<br />
Neuseeland<br />
Norwegen<br />
Portugal<br />
Schottland<br />
Spanien<br />
Schweden<br />
Schweiz<br />
Ver<strong>ein</strong>igte Staaten<br />
Ländermittel<br />
Österreich hat relativ niedrige Einstiegsgehälter, liegt<br />
aber im oberen Bereich bei den Maximalgehältern<br />
(praktisch identisch mit Deutschland bei den Maximalbezügen;<br />
deutsche Lehrer haben aber deutlich höhere<br />
Einstiegsgehälter). Österreich weist damit <strong>ein</strong>e der<br />
höchsten Einkommensdynamiken auf. Nur in Japan<br />
und Korea steigen die Jahresgehälter im Zeitablauf<br />
noch stärker an. In der Schweiz ist <strong>ein</strong>e ähnlich ausgeprägte<br />
Einkommensdynamik zu beobachten, wenngleich<br />
dort die Lehrer durchgängig höher entlohnt sind.
TABELLE 2:<br />
<strong>ibw</strong>-Mitteilungen, November/Dezember 2003, Mag. Kurt Schmid<br />
Idealtypische Lehrergehaltsschemata (für die Sekundarstufe I) international<br />
Zeitpunkt des<br />
Land Anfangsgehalt Höchstgehalts Endgehalt<br />
Schweiz mittel hoch<br />
hoch<br />
Deutschland spät hoch<br />
Australien<br />
Ver<strong>ein</strong>igte Staaten<br />
früh<br />
mittel<br />
Dänemark niedrig<br />
Niederlande<br />
Korea<br />
Spanien<br />
Italien<br />
mittel<br />
mittel<br />
spät<br />
mittel<br />
hoch<br />
mittel<br />
Norwegen niedrig<br />
England mittel<br />
Neuseeland<br />
Schottland<br />
Schweden<br />
Portugal hoch<br />
Belgien (fläm.)<br />
Belgien (frz.)<br />
Irland<br />
Ländermittel<br />
Finnland<br />
Island<br />
Österreich<br />
Frankreich<br />
Japan<br />
Tschechische Rep.<br />
Griechenland<br />
Ungarn<br />
Slowakische Rep.<br />
Quelle: OECD (2003); <strong>ibw</strong>-Berechnungen<br />
niedrig<br />
Aus der vorhergehenden Darstellung der gesetzlichen<br />
(bzw. vertraglichen) Grundstrukturen der Lehrergehaltsschemata<br />
lässt sich aber <strong>ein</strong>e wichtige Schlussfolgerung<br />
ziehen. In vielen Ländern dürfte die hohe Bedeutung<br />
der Senioritätskomponente am gesamten<br />
Lehrergehalt eng in Zusammenhang mit der spezifischen<br />
Bewertungsproblematik (wie misst man die<br />
Leistung <strong>ein</strong>es Lehrers?) und den flachen schulischen<br />
Hierarchien stehen. Unter diesen Bedingungen ist es<br />
aus effizienzlohntheoretischer Sicht durchaus sinnvoll,<br />
Motivation durch Lohnsteigerungen in Abhängigkeit der<br />
Betriebszugehörigkeit zu „schaffen“. Der Effekt wird<br />
durch den sogenannten Teilausgleich erzielt, bei dem<br />
die Entlohnung zu Beginn des Arbeitsverhältnisses<br />
geringer <strong>–</strong> nach langer Betriebszugehörigkeit aber hö-<br />
7<br />
früh<br />
mittel<br />
spät<br />
niedrig<br />
mittel<br />
niedrig<br />
hoch<br />
niedrig<br />
her als das Produktivitätsniveau des Arbeitnehmers ist.<br />
Dass dies in zumindest <strong>ein</strong>igen Ländern der Fall s<strong>ein</strong><br />
dürfte, zeigt auch, das in vielen Fällen relativ (verglichen<br />
mit der Gesamtbevölkerung <strong>–</strong> vgl. Grafik 1)<br />
niedrige Einstiegsgehaltsniveau der Lehrer. Österreich<br />
kann hierfür als „Paradebeispiel“ herangezogen werden.<br />
Eine andere Sichtweise würde die in mehreren Ländern<br />
feststellbare hohe Einkommenssteigerungsdynamik der<br />
Lehrergehälter eher durch politische Argumente (starke<br />
Lehrer-Gewerkschaften) im Sinne partikulärer Interessensvertretung<br />
erklären. Auch hierfür kann Österreich,<br />
zumindest nach M<strong>ein</strong>ung etlicher Kommentatoren, als<br />
„Paradebeispiel“ dienen.
Zusätzliche Komponenten<br />
des Lehrergehaltes<br />
<strong>ibw</strong>-Mitteilungen, November/Dezember 2003, Mag. Kurt Schmid<br />
Die bisherigen Aussagen bezogen sich auf die<br />
gesetzlich bzw. vertraglich festgelegten Gehaltsstrukturen.<br />
In allen OECD-Ländern wird das Lehrergehalt<br />
aber noch durch zusätzliche Komponenten be<strong>ein</strong>flusst,<br />
die unabhängig von der Beschäftigungsdauer<br />
der Lehrer sind.<br />
� Zulagen zum Grundgehalt:<br />
In nahezu allen OECD-Ländern können Lehrer diverse<br />
Zulagen erhalten (vgl. Tabelle 1 im Anhang). Am<br />
häufigsten sind Zulagen für die Übernahme von Verwaltungsfunktionen<br />
zusätzlich zur Lehrverpflichtung.<br />
Eine finanzielle Belohnung für herausragende Unterrichtsleistungen<br />
gibt es in <strong>ein</strong>em Drittel der Länder. Nur<br />
in der tschechischen Republik und im UK sind sie<br />
etwas Alltägliches. In <strong>ein</strong>igen Fällen basieren Gehaltszulagen<br />
auf von höherer Stelle festgelegten fixen<br />
Kriterien, in anderen hat die Schule selbst <strong>ein</strong>en<br />
Ermessungsspielraum. Darüber hinaus sagt die r<strong>ein</strong>e<br />
Anzahl an möglichen Zulagen nichts über die monetäre<br />
Bedeutung der Zulagen (ihren Anteil am Gesamtgehalt<br />
<strong>ein</strong>es Lehrers) aus. Leider gibt es diesbezüglich nur<br />
sehr spärliche Informationen. In Finnland, Japan,<br />
Spanien, der Tschechischen Republik und den USA<br />
liegen die Zulagen zwischen 15 und 30% für Primarlehrer<br />
und 25 bis 80% für Lehrer der Sekundarstufe II<br />
(allgem<strong>ein</strong>bildende Schulen) 4 .<br />
� Lehrerfortbildung als Einflussfaktor des Lehrergehalts<br />
In den meisten Staaten werden die Fortbildungsaktivitäten<br />
von Lehrern nur bei der Beförderung als <strong>ein</strong><br />
mögliches Bewertungskriterium herangezogen (d.h. sie<br />
sind oftmals <strong>ein</strong> notwendiges, jedoch k<strong>ein</strong> hinreichendes<br />
Kriterium der Beförderung). Lediglich formale<br />
Höherqualifizierung weist meistens <strong>ein</strong>en engeren Be-<br />
4 OECD 2000. Länder mit <strong>ein</strong>em ausgebauten Zulagensystem<br />
(welches auch monetär <strong>ein</strong>en nennenswerten<br />
Anteil der Lehrergehälter umfasst) sollten dann aber <strong>ein</strong>e<br />
eher geringere Senioritätskomponente aufweisen. Setzt<br />
man die Indikatoren der Gehaltsschemata in Beziehung<br />
zur Anzahl der möglichen Zulagen, dann zeigt sich<br />
jedoch, dass k<strong>ein</strong> <strong>ein</strong>deutiger Zusammenhang festgestellt<br />
werden kann. So hat beispielsweise Finnland zwar nur<br />
relativ moderate Lehrergehälter bei gleichzeitig relativ<br />
vielen Zulagen. Im Gegensatz dazu hat aber die Schweiz<br />
mit ihren sehr hohen Lehrergehältern (und der sehr ausgeprägten<br />
Einkommenssteigerungsdynamik) ebenfalls relativ<br />
viele Zulagen. Ohne präzisere Daten zur monetären<br />
Bedeutung der Zulagen lassen sich jedoch hinsichtlich der<br />
hier aufgeworfenen Fragestellung k<strong>ein</strong>e relevanten<br />
Aussagen treffen.<br />
8<br />
zug zu Beförderungsmöglichkeiten (Gehalt und berufliche<br />
Stellung) auf. Die wenigen Länder, in denen Fortbildung<br />
<strong>ein</strong>en direkten Bezug zum Lehrergehalt hat,<br />
sind Spanien, Portugal, Luxemburg, Schottland, die<br />
Niederlande sowie die USA.<br />
Zusammengefasst kann also festgehalten werden,<br />
dass das österreichische Lehrergehaltsschema in s<strong>ein</strong>er<br />
grundsätzlichen Ausgestaltung denjenigen der<br />
meisten anderen Länder entspricht: Zuordnung zu<br />
<strong>ein</strong>er Besoldungsgruppe aufgrund der Vorbildung des<br />
Lehrers in Kombination mit Senioritätsentlohnung sowie<br />
praktisch k<strong>ein</strong>e outputorientierten Gehaltsbestandteile.<br />
Als variable Gehaltsbestandteile im weiteren Sinne<br />
können eigentlich nur die Funktionszulagen und die<br />
Leistungen mit Belohnungscharakter angesehen werden.<br />
Variable Gehaltsbestandteile als expliziter Leistungsanreiz<br />
im Sinne <strong>ein</strong>er outputorientierten Bewertung<br />
stellt nur die Belohnung aus Belohnungsaktionen<br />
dar. Wie schon der Name nahe legt, hat diese jedoch<br />
sowohl aufgrund des Gesamtumfanges und der Vergabemodalitäten<br />
5 als auch infolge der maximalen Höhe<br />
für den individuellen Lehrer (vgl. Fußnote 3) weder <strong>ein</strong>e<br />
nennenswerte Bedeutung für die Gehaltsstruktur per se<br />
noch stellt sie <strong>ein</strong>en wirklich monetären Anreiz für den<br />
Einzellehrer dar. Ein Folgeartikel in den nächsten <strong>ibw</strong>-<br />
Mitteilungen wird sich dem Thema „leistungsbezogene<br />
Gehaltsanteile“ für Lehrer, ebenfalls aus <strong>ein</strong>er internationalen<br />
Perspektive betrachtet, widmen.<br />
Ein zusätzlicher wichtiger Aspekt in Bezug auf die Anreizwirkung<br />
<strong>ein</strong>es Gehaltsschemas ist dessen Widerspiegelung<br />
bzw. Verquickung mit der Aufbauorganisation,<br />
d.h. der schulischen Hierarchie. Diese ist in Österreich<br />
sehr flach gestaltet. Neben der Schulleitung gibt<br />
es nur <strong>ein</strong>e administrative Zwischenebene: die Abteilungs-<br />
bzw. Fachvorstände 6 . Schulexterne Karrieremöglichkeiten<br />
stellen die Beschäftigung als Schulinspektor<br />
(bei den Landes-/ Stadtschulräten) sowie in<br />
Institutionen der Lehrererstausbildung und -fortbildung<br />
(meistens ist dies jedoch nur auf Teilzeitbasis möglich<br />
und daher eher als zusätzliche Arbeitsbelastung denn<br />
als Karriere anzusehen) dar.<br />
5 Vergabemodalität für <strong>ein</strong>e Belohnung aus der Belohnungsaktion:<br />
Bestätigung <strong>ein</strong>er exzeptionellen Arbeitsqualität<br />
seitens <strong>ein</strong>es Schulinspektor, des Klassenvorstandes,<br />
des Abteilungs-/Fachvorstandes oder <strong>ein</strong>er speziellen<br />
Kommission.<br />
6 Klassenvorstände können eigentlich nicht als <strong>ein</strong>e eigene<br />
Hierarchieebene angesehen werden, das sie gegenüber<br />
ihren LehrerkollegInnen k<strong>ein</strong>e Instruktionsbefugnisse<br />
haben.
TABELLE 1:<br />
Quelle: OECD (2003)<br />
<strong>ibw</strong>-Mitteilungen, November/Dezember 2003, Mag. Kurt Schmid<br />
Zulagekategorien<br />
Weitere Infos zu Regelungen <strong>ein</strong>zelner Zulagenkategorien (insbesondere „Ortszulage“ sowie dem Unterricht von SchülerInnen mit besonderem Bildungsbedarf) und zu „sonstigen<br />
finanziellen Zuschüssen“ (Reisekostenzuschüsse, Wohnzuschüssen, Zuschüsse für Studienmaterial etc.) sind in Eurydice 2003 enthalten.<br />
9
Literaturverzeichnis<br />
<strong>ibw</strong>-Mitteilungen, November/Dezember 2003, Mag. Kurt Schmid<br />
Ballou Dale:<br />
„Pay for performance in public and private schools”<br />
in: Economics of Education Review 20, 2001<br />
Buerkli Christoph:<br />
„Beurteilung und Entlöhnung von Lehrpersonen”<br />
Universität Bern, mimeo April 2001<br />
Eurydice (2003):<br />
„The Teaching Profession in Europe: Profile, Trends<br />
and Concerns. Report III Working Conditions and Pay <strong>–</strong><br />
General Lower Secondary Education”<br />
Hackl Dagmar:<br />
„Attracting, Developing and Retaining Effective<br />
Teachers. Country Background Report for Austria”<br />
OECD July 2003<br />
Klös Hans-Peter, Weiß R<strong>ein</strong>hold (Hrsg.):<br />
„Bildungs-Benchmarking Deutschland. Was macht <strong>ein</strong><br />
effizientes Bildungssystem aus?“<br />
DIV Verlag, Köln 2003<br />
OECD (2003):<br />
„Education at a Glance”<br />
Parlamentarische Korrespondenz (2003):<br />
Beantwortung (684/AB XXII.GP) zur parlamentarischen<br />
Anfrage (Nr. 668/J-NR/2003) betreffend Schul- und<br />
LehrerInnendaten 2002/03.<br />
10<br />
Rechnungshof:<br />
„Besoldung der Landeslehrer“<br />
in: „Wahrnehmungsbericht des Rechnungshofes. Teilgebiete<br />
der Gebarung des Bundes“ Reihe Bund<br />
2003/2.<br />
Santiago Paul:<br />
„Teacher Demand and Supply: Improving Teaching<br />
Quality and Addressing Teacher Shortages”<br />
OECD Education Working Paper No.1, Dec. 2002<br />
Schratz Michael:<br />
„Study on Teachers: Attractiveness, Profile and Occupational<br />
Content of the Teaching Profession. Contextual<br />
Analysis: Austria”<br />
BMBWK October 2001<br />
Waterreus Ib:<br />
„Teacher Pay and Productivity: An International<br />
Comparison”<br />
Paper presented at the ESPE 2002 Conference in<br />
Bilbao, Spain<br />
Waterreus Ib:<br />
„Incentives in secondary education: an international<br />
comparison“<br />
Max Goote Kenniscentrum, Nov. 2001<br />
Downloadable:<br />
http://www.maxgoote.nl/files/360/Incentives.pdf