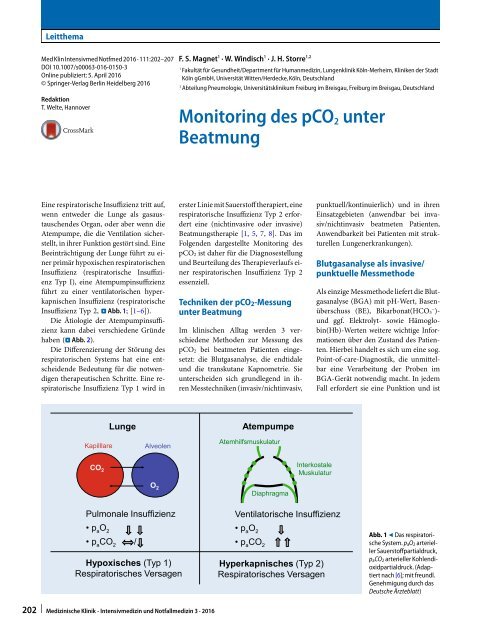Monitoring PCO2 Magnet
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Leitthema<br />
MedKlinIntensivmedNotfmed2016 ·111:202–207<br />
DOI 10.1007/s00063-016-0150-3<br />
Online publiziert: 5. April 2016<br />
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016<br />
Redaktion<br />
T. Welte, Hannover<br />
F. S. <strong>Magnet</strong> 1 · W. Windisch 1 ·J.H.Storre 1,2<br />
1<br />
Fakultät für Gesundheit/Department für Humanmedizin, Lungenklinik Köln-Merheim, Kliniken der Stadt<br />
Köln gGmbH, Universität Witten/Herdecke, Köln, Deutschland<br />
2<br />
Abteilung Pneumologie, Universitätsklinikum Freiburg im Breisgau, Freiburg im Breisgau, Deutschland<br />
<strong>Monitoring</strong> des pCO 2 unter<br />
Beatmung<br />
Eine respiratorische Insuffizienz tritt auf,<br />
wenn entweder die Lunge als gasaustauschendes<br />
Organ, oder aber wenn die<br />
Atempumpe, die die Ventilation sicherstellt,<br />
in ihrer Funktion gestört sind. Eine<br />
Beeinträchtigung der Lunge führt zu einer<br />
primär hypoxischen respiratorischen<br />
Insuffizienz (respiratorische Insuffizienz<br />
Typ I), eine Atempumpinsuffizienz<br />
führt zu einer ventilatorischen hyperkapnischen<br />
Insuffizienz (respiratorische<br />
Insuffizienz Typ 2, . Abb. 1; [1–6]).<br />
Die Ätiologie der Atempumpinsuffizienz<br />
kann dabei verschiedene Gründe<br />
haben (. Abb. 2).<br />
Die Differenzierung der Störung des<br />
respiratorischen Systems hat eine entscheidende<br />
Bedeutung für die notwendigen<br />
therapeutischen Schritte. Eine respiratorische<br />
Insuffizienz Typ 1 wird in<br />
ersterLinie mitSauerstofftherapiert,eine<br />
respiratorische Insuffizienz Typ 2 erfordert<br />
eine (nichtinvasive oder invasive)<br />
Beatmungstherapie [1, 5, 7, 8]. Das im<br />
Folgenden dargestellte <strong>Monitoring</strong> des<br />
pCO 2 ist daher für die Diagnosestellung<br />
und Beurteilung des Therapieverlaufs einer<br />
respiratorischen Insuffizienz Typ 2<br />
essenziell.<br />
Techniken der pCO 2 -Messung<br />
unter Beatmung<br />
Im klinischen Alltag werden 3 verschiedene<br />
Methoden zur Messung des<br />
pCO 2 bei beatmeten Patienten eingesetzt:<br />
die Blutgasanalyse, die endtidale<br />
und die transkutane Kapnometrie. Sie<br />
unterscheiden sich grundlegend in ihren<br />
Messtechniken (invasiv/nichtinvasiv,<br />
punktuell/kontinuierlich) und in ihren<br />
Einsatzgebieten (anwendbar bei invasiv/nichtinvasiv<br />
beatmeten Patienten,<br />
Anwendbarkeit bei Patienten mit strukturellen<br />
Lungenerkrankungen).<br />
Blutgasanalyse als invasive/<br />
punktuelle Messmethode<br />
Als einzige Messmethode liefert die Blutgasanalyse<br />
(BGA) mit pH-Wert, Basenüberschuss<br />
(BE), Bikarbonat(HCO 3– )-<br />
und ggf. Elektrolyt- sowie Hämoglobin(Hb)-Werten<br />
weitere wichtige Informationen<br />
über den Zustand des Patienten.<br />
Hierbei handelt es sich um eine sog.<br />
Point-of-care-Diagnostik, die unmittelbar<br />
eine Verarbeitung der Proben im<br />
BGA-Gerät notwendig macht. In jedem<br />
Fall erfordert sie eine Punktion und ist<br />
Lunge<br />
Atempumpe<br />
Kapilllare<br />
Alveolen<br />
Atemhilfsmuskulatur<br />
CO 2<br />
O 2<br />
Interkostale<br />
Muskulatur<br />
Diaphragma<br />
Pulmonale Insuffizienz<br />
•p a<br />
O 2<br />
•p a<br />
CO 2<br />
/<br />
Hypoxisches (Typ 1)<br />
Respiratorisches Versagen<br />
Ventilatorische Insuffizienz<br />
•p a<br />
O 2<br />
•p a<br />
CO 2<br />
Hyperkapnisches (Typ 2)<br />
Respiratorisches Versagen<br />
Abb. 1 9 Das respiratorische<br />
System. p aO 2 arterieller<br />
Sauerstoffpartialdruck,<br />
p aCO 2 arterieller Kohlendioxidpartialdruck.<br />
(Adaptiert<br />
nach [6]; mit freundl.<br />
Genehmigung durch das<br />
Deutsche Ärzteblatt)<br />
202 Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin 3 · 2016
somit eine invasive Abnahmetechnik,<br />
die naturgemäß das Risiko einer Infektion<br />
für die betroffene Person darstellt<br />
[9]. Das Risiko einer Gewebeverletzung<br />
ist von der Art der BGA abhängig,<br />
wobei die arterielle BGA das höchste<br />
Risiko beinhaltet. Ein weiterer Nachteil<br />
der BGA besteht darin, dass sie als<br />
punktuelle Messmethode immer nur<br />
eine Momentaufnahme der Ventilation<br />
aufzeigen kann.<br />
Arterielle Blutgasanalyse<br />
Die arterielle BGA stellt den Goldstandard<br />
in der Bestimmung der Blutgase<br />
dar [10–12]. Insbesondere für die genaue<br />
Bestimmung des arteriellen Sauerstoffpartialdrucks<br />
(p aO 2) ist sie unerlässlich<br />
[12–14]. Sie erfolgt entweder durch<br />
einmalige Punktion einer Arterie oder<br />
über Einlegen eines arteriellen Katheters<br />
(meistA.radialis,A.brachialisoderA.femoralis)<br />
mit der Möglichkeit einer mehrmaligen<br />
Abnahme ohne erneute Punktion<br />
und der häufig verwendeten zusätzlich<br />
Option einer invasiven kontinuierlichen<br />
Blutdruckmessung. Die häufigste<br />
Komplikation ist eine Verletzung der Arterie,<br />
die zu Aneurysmen und Blutungen/Hämatomen<br />
führen kann. Zudem<br />
kann es zu einer Thrombose mit konsekutiver<br />
distaler Ischämie kommen. Die<br />
Schmerzhaftigkeit der arteriellen Punktion<br />
scheint maßgeblich von der Größe<br />
Abb. 2 9 Die Atempumpe<br />
mit unterschiedlichen<br />
Lokalisationen<br />
möglicher<br />
Funktionsstörungen.<br />
PNS peripheres<br />
Nervensystem,<br />
ZNS zentrales<br />
Nervensystem.<br />
(Adaptiert nach [3];<br />
mit freundl. Genehmigung<br />
der Georg<br />
Thieme Verlag KG)<br />
der Kanüle abzuhängen. In einer kürzlich<br />
veröffentlichten Studie stellte sich heraus,<br />
dasseine arterielle Punktionmiteiner26-<br />
Gauge-Kanüle als weniger schmerzhaft<br />
als eine kapillare BGA mit einer Lanzette<br />
empfunden wird [13]. Dies war bei<br />
anderen Studien, in denen größere Kanülen<br />
(22 bzw. 23 Gauge) benutzt wurden,<br />
gegenteilig der Fall [14, 15].<br />
Kapillare Blutgasanalyse<br />
Die kapillare BGA ist seit den 1960er-<br />
Jahren bekannt [16]. Sie wird meist am<br />
hyperämisierten Ohrläppchen (alternativ<br />
an der Fingerbeere) entnommen. In<br />
einer Metaanalyse wurde gezeigt, dass sie<br />
im Vergleich zu einer arteriellen BGA<br />
den pH- und v. a. den pCO 2-Wert adäquat<br />
reflektiert, was auch durch neuere<br />
Studien belegt wird [12, 13]. Sie ist<br />
weniger invasiv als die arterielle BGA,<br />
kann auch von nichtärztlichem Personal<br />
durchgeführt werden und ist in der<br />
Summe kostengünstiger als die arterielle<br />
BGA [17]. Ein Nachteil besteht in der<br />
NotwendigkeitderHyperämisierung,die<br />
eine Zeitverzögerung von etwa 10 min<br />
bedingt. Dies ist insbesondere in der Notfall-<br />
und Intensivmedizin ein entscheidender<br />
Nachteil.<br />
Venöse Blutgasanalyse<br />
DievenöseBGAistdieeinfachsteder<br />
3 Methoden einer Blutgasanalyse und<br />
erfordert dann am wenigsten Aufwand,<br />
wenn sie mit einer gewöhnlichen venösen<br />
Blutentnahme verbunden werden<br />
kann. Sie wird deshalb häufig in der<br />
Notaufnahme für ein erstes Screening<br />
des Säure-Basen-Haushalts des Patienten<br />
eingesetzt [11, 18]. Verschiedene Studien<br />
untersuchten den Stellenwert der<br />
venösen BGA in der Notaufnahme [19,<br />
20]. Im Methodenvergleich zeigten sich<br />
klinisch akzeptable Übereinstimmungen<br />
hinsichtlich der pH- und HCO 3– -Werte<br />
im Vergleich zu einer arteriellen BGA.<br />
» Die venöse Blutgasanalyse ist<br />
zur genauen Messung des pCO 2<br />
ungeeignet<br />
Hinsichtlich der pCO 2-Werte lagen die<br />
Ergebnisse jedoch außerhalb eines klinisch<br />
akzeptablen Bereichs. Somit kann<br />
diese Technik als ein primäres Screeninginstrument<br />
hinsichtlich einer Ab-<br />
weichungimSäure-Basen-Haushalt(pH-<br />
Wert, HCO3 – ) eingesetzt werden. Zur genauen<br />
Bestimmung des pCO 2 eines Patienten<br />
bei Verdacht auf respiratorische<br />
Insuffizienz oder zur Verlaufskontrolle<br />
eines beatmeten Patienten ist die venösen<br />
BGA jedoch nicht geeignet und es<br />
wird eine arterielle oder kapillare BGA<br />
empfohlen [21].<br />
Nichtinvasive/kontinuierliche<br />
Messmethoden<br />
Die(arterielle/kapillare)BGAliefertzwar<br />
die genauesten Absolutwerte des pCO 2,<br />
eignet sich jedoch nicht für eine kontinuierliche<br />
Überwachung der Beatmungssituation<br />
und würde zu erheblichen Blutverlusten<br />
bzw. rezidivierenden invasiven<br />
Eingriffen führen. In den 1970er-Jahren<br />
wurdeeineMethodezurinvasivenkontinuierlichen<br />
intraarteriellen Messung des<br />
pCO 2 entwickelt, die sich jedoch aufgrund<br />
technischer Limitation und hoher<br />
Kosten nicht im klinischen Alltag durchsetzen<br />
konnte [22].<br />
Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin 3 · 2016 203
Zusammenfassung · Abstract<br />
Endtidale pCO2-Messung<br />
Der endtidale p (et)CO 2<br />
wird bei beatmeten<br />
Patienten am Ende der Exspiration<br />
gemessen. Er reflektiert die<br />
alveoläre Konzentration des CO 2, die<br />
aufgrund der hohen CO 2-Diffusionskapazität<br />
Rückschlüsse auf den arteriellen<br />
p (a)CO 2 zulässt [23, 24]. Aufgrund des<br />
alveolären Totraumvolumens besteht<br />
jedoch eine Differenz zwischen p aCO 2<br />
und p etCO 2 von etwa 2–5 mmHg, die<br />
unter Allgemeinanästhesie, mit zunehmendem<br />
Alter, bei pulmonalen Erkrankungen<br />
(Lungenembolie, Emphysem),<br />
reduziertem Herzzeitvolumen oder Hypervolämie<br />
weiter zunimmt. Anders<br />
verhält es sich unter Beatmung mit<br />
niedrigen Atemfrequenzen und hohen<br />
Tidalvolumen: Hier nimmt die Differenz<br />
zwischen p aCO 2 und p etCO 2 ab [25]. Bei<br />
strukturellen Lungenerkrankungen mit<br />
Ventilations-Perfusions-Missverhältnis<br />
treten bedeutende Abweichungen zwischen<br />
dem p aCO 2 und dem p etCO 2 auf,<br />
wodurch diese Messmethode in diesem<br />
Patientenkollektiv ungeeignet ist<br />
(. Abb. 3a; [26, 27]).<br />
Aus diesem Grund wird nach aktueller<br />
Leitlinienempfehlung die p etCO 2-<br />
Messung zum <strong>Monitoring</strong> bei respiratorischer<br />
Insuffizienz nicht empfohlen [5].<br />
Bei Lungengesunden kann die Methode<br />
jedoch mit guten Ergebnissen eingesetzt<br />
werden (. Abb. 3b; [27]).<br />
» Bei Lungengesunden kann<br />
die endtidale pCO 2 -Messung<br />
eingesetzt werden<br />
Die Messung geschieht meist spekrometrisch<br />
im Haupt- oder Nebenstromverfahren.<br />
Das Hauptstomverfahren birgt<br />
das Risiko einer akzidentiellen Extubation<br />
aufgrund des zusätzlichen Gewichts<br />
des Messgeräts, das Nebenstromverfahren<br />
hingegen kann zu Autotriggerungen<br />
führen, wenn ein Flowtrigger<br />
eingesetzt wird [11]. Haupteinsatzgebiet<br />
dieser Messmethode ist das <strong>Monitoring</strong><br />
beatmeter Patienten während einer<br />
Allgemeinanästhesie oder zur Lagekontrolle<br />
nach Intubation [22, 27, 28]. Bei<br />
der nichtinvasiven Beatmung kommt es<br />
Med Klin Intensivmed Notfmed 2016 · 111:202–207<br />
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016<br />
F. S. <strong>Magnet</strong> · W. Windisch · J. H. Storre<br />
<strong>Monitoring</strong> des pCO 2 unter Beatmung<br />
Zusammenfassung<br />
Eine respiratorische Insuffizienz Typ 2<br />
(ventilatorische Insuffizienz) ist durch eine<br />
Hyperkapnie, bedingt durch eine alveoläre<br />
Hypoventilation, gekennzeichnet. Daher ist<br />
das <strong>Monitoring</strong> des Kohlendioxidpartialdrucks<br />
(pCO 2) zur Diagnostik und Therapieüberwachung<br />
in der modernen Beatmungsmedizin<br />
essenziell. Hierzu stehen verschiedene<br />
Techniken zur Verfügung, die sich in ihren<br />
Messmethoden (z. B. invasiv/nichtinvasiv,<br />
kontinuierlich/nichtkontinuierlich) und<br />
möglichen Einsatzgebieten unterscheiden.<br />
Daraus ergeben sich verschiedene<br />
Indikationen für ihren jeweiligen Einsatz.<br />
Den Goldstandard stellt nach wie vor die<br />
(arterielle) Blutgasanalyse (BGA) dar. Als<br />
invasive nichtkontinuierliche Messmethode<br />
wird sie insbesondere in der Akutmedizin<br />
eingesetzt. Zur Beurteilung des pCO 2 hat sich<br />
außerhalb der Akut- und Intensivmedizin<br />
auch die Durchführung einer kapillaren BGA<br />
etabliert.<br />
Der pCO 2 kann durch die Messung des<br />
endtidalen p (et)CO 2und transkutanen p (tc)CO 2<br />
kontinuierlich und nichtinvasiv überwacht<br />
<strong>Monitoring</strong> of pCO 2 during ventilation<br />
Abstract<br />
Respiratory insufficiency type 2 (ventilatory<br />
failure) is characterized by hypercapnia<br />
due to alveolar hypoventilation. Therefore,<br />
the monitoring of pCO 2 is essential for<br />
diagnostic and surveillance purposes.<br />
Various techniques which differ in the way<br />
of measurement (e.g., invasive/noninvasive,<br />
continuous/noncontinuous) and their<br />
indication are available. Arterial blood gas<br />
analysis (ABG) as an invasive procedure is<br />
the gold standard procedure and is mostly<br />
used in emergency medicine or intensive care<br />
units (ICUs). Another method to evaluate<br />
pCO 2is capillary blood gas analysis (CBG).<br />
Furthermore, endtidal pCO 2-(PetCO 2)and<br />
transcutaneous CO 2-measurement (PtcCO 2)<br />
are able to continuously and noninvasively<br />
monitor pCO 2.PetCO 2 is mostly used in<br />
the field of anesthesiology during general<br />
DOI 10.1007/s00063-016-0150-3<br />
werden. Das <strong>Monitoring</strong> des p etCO 2 erfolgt<br />
v. a. in der Narkoseführung im Fachbereich<br />
der Anästhesiologie und ist in vielen<br />
Intensivrespiratoren als Funktion integriert.<br />
Eine Limitation des p etCO 2 besteht jedoch in<br />
der Ungenauigkeit bei Lungenerkrankungen,<br />
ebenso ist er nur bei invasiv beatmeten<br />
Patienten sinnvoll einsetzbar. Alternativ<br />
steht die p tcCO 2-Messung zur Verfügung, die<br />
insbesondere bei chronisch ventilatorischer<br />
Insuffizienz und im Rahmen der Diagnostik<br />
bei schlafbezogenen Atemstörungen sehr<br />
gut geeignet ist eine Hypoventilation zu<br />
erkennen. Sie biete hierbei sogar wesentliche<br />
Vorteile zu punktuellen Messungen, die im<br />
Rahmen einer BGA durchgeführt werden.<br />
In der klinischen Routine werden die<br />
verschiedenen Verfahren meist kombiniert<br />
angewandt.<br />
Schlüsselwörter<br />
Lungenerkrankungen · Respiratorische Insuffizienz<br />
· Säure-Basen-Haushalt · Blutgasanalyse ·<br />
Transkutanes Blutgasmonitoring<br />
anesthesia and is integrated in many<br />
ventilators, also in ICUs. However, PetCO 2 is<br />
limited in monitoring pCO 2in patients with<br />
lung disease and it is only reasonably usable in<br />
invasively ventilated patients. Transcutaneous<br />
pCO 2 (PtcCO 2) is available as an alternative,<br />
especially in chronic respiratory failure and<br />
to diagnose hypoventilation in sleep-related<br />
breathing disorders, and it has substantial<br />
advantages in these indications compared<br />
to discontinuous measurements, e.g., blood<br />
gas analysis. The various methods to monitor<br />
pCO 2are generally used synergistically in<br />
clinical practice.<br />
Keywords<br />
Lung diseases · Respiratory insufficiency ·<br />
Acid–base balance · Blood gas analysis · Blood<br />
gas monitoring, transcutaneous<br />
204 Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin 3 · 2016
durch Leckagen ebenfalls zu deutlichen<br />
Messungenauigkeiten [27].<br />
Transkutane pCO 2 -Messung<br />
Bei dieser Messmethode wird transkutan<br />
der pCO 2 über eine modifizierte Severinghaus-Elektrode<br />
gemessen, die auf<br />
der Haut aufliegt. Das CO 2 diffundiert<br />
über die durch die Elektrode erwärmte<br />
Haut in die Messkammer und bewirkt<br />
dort eine pH-Änderung, wodurch der<br />
transkutane p (tc)CO 2 bestimmt werden<br />
kann [11]. Ein Vorteil der Methode besteht<br />
in dem breiten Anwendungsspektrum:<br />
Sie kann bei spontanatmenden Patienten,<br />
nichtinvasiv beatmeten und invasiv<br />
beatmeten Patienten oder auch im<br />
Weaning eingesetzt werden. Bei einer Beatmungsindikation<br />
aufgrund einer akuten<br />
respiratorischen Insuffizienz eignet<br />
sie sich zur Darstellung des pCO 2-Verlaufs,<br />
kann jedoch eine BGA aufgrund<br />
der Abweichungen der Absolutwerte in<br />
dieser Indikation nicht ersetzen. Im Bereich<br />
der chronischen Beatmungsmedizin<br />
kann sie die BGA teilweise ersetzen<br />
bzw. ihren Einsatz auf ein Minimum reduzieren<br />
[27–31].<br />
» Die transkutane pCO 2 -<br />
Messung kann teilweise die<br />
Blutgasanalyse ersetzen<br />
Abb. 3 8 EndtidalerundtranskutanerpCO 2-VerlaufunterinvasiverBeatmungübereinTracheostoma<br />
während des Weanings. a Endtidaler und transkutaner pCO 2-Verlauf unter invasiver Beatmung über<br />
einTracheostoma währenddes Weanings beieinem57-jährigenPatientenmitchronisch-obstruktiver<br />
Lungenerkrankung (COPD). b Ein 47-jähriger Patient mit thorakal-restrikiver Erkrankung. p aCO 2 arterieller<br />
Kohlendioxidpartialdruck, p etCO 2 endtidaler Kohlendioxidpartialdruck, p tcCO 2 transkutaner<br />
Kohlendioxidpartialdruck. (Adaptiert nach [27]; mit freundl. Genehmigung der Georg Thieme Verlag<br />
KG)<br />
Weitere Nachteile der Messmethode bestehen<br />
im Vergleich zur kapillaren BGA<br />
in der Latenzzeit von etwa 10 min, die<br />
zu Beginn benötigt wird, um das Kapillarbett<br />
zu erwärmen und stabile Werte<br />
zu erhalten. Ebenso besteht die Notwendigkeit<br />
einer regelmäßigen Kalibration<br />
und eines regelmäßigen Membranwechsels.<br />
In der Akutmedizin sind weniger<br />
genaue Messergebnisse zu erwarten,<br />
wenn beispielsweise eine Hypothermie<br />
vorliegt oder durch Vasokonstriktion/Schock<br />
oder Anasarka die adäquate<br />
Reflexion des pCO 2 im Kapillarbett<br />
eingeschränkt ist [28, 32]. Bei älteren<br />
Geräten trat über eine lange Messdauer<br />
ein relevanter technischer Drift auf,<br />
der zwar retrospektiv korrigiert werden<br />
kann, bei der Online-Ablesung jedoch<br />
Berücksichtigung finden muss [32]. Bei<br />
Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin 3 · 2016 205
Leitthema<br />
Tab. 1 Vor- und Nachteile der verschiedenen Messmethoden zur Bestimmung des Kohlendioxidpartialdrucks.<br />
(Adaptiert nach [27])<br />
Vorteile<br />
Nachteile<br />
Arterielle BGA<br />
Goldstandard der<br />
pCO 2-Bestimmung<br />
Weitere Messwerte: pH, BE,<br />
HCO – 3 , Elektrolyte/Laktat<br />
Invasiv, schmerzhaft<br />
Nicht kontinuierlich<br />
Momentaufnahme<br />
Hoher technischer Aufwand<br />
Kostenintensiv<br />
Kapillare BGA<br />
Venöse BGA<br />
Endtidale pCO 2-Messung<br />
Transkutane pCO 2-Messung<br />
Weitere Messwerte: pH, BE,<br />
HCO 3<br />
–<br />
Abnahme durch Assistenzpersonal<br />
möglich<br />
Weitere Messwerte: pH, BE,<br />
HCO 3<br />
–<br />
Gewohnte/routinierte Abnahmetechnik<br />
Kontinuierlich<br />
Nichtinvasiv<br />
Keine Kalibration notwendig<br />
Keine Störung der Schlafqualität<br />
Kontinuierlich<br />
Nichtinvasiv<br />
Unabhängig vom Atemfluss<br />
Invasiv, schmerzhaft<br />
Nicht kontinuierlich<br />
Momentaufnahme<br />
Hoher technischer Aufwand<br />
Messfehler bei ungenügender<br />
Hyperämisierung<br />
Zeitliche Verzögerung von<br />
etwa 10 min<br />
Invasiv, schmerzhaft<br />
Nicht kontinuierlich<br />
Momentaufnahme<br />
p aCO 2 klinisch nicht ausreichend<br />
ersetzbar<br />
Ungenau bei Leckagen<br />
Abhängig vom Ventilations-<br />
Perfusions-Verhältnis und<br />
Atemfluss<br />
Nicht validiert bei nichtinvasiver<br />
Ventilation (NIV) und<br />
Lungenerkrankungen<br />
Technischer Drift/Abweichung<br />
Zeitliche Verzögerung von<br />
etwa 10 min<br />
Ungenauigkeiten z. B. bei<br />
Vasokonstriktion, Hautödem<br />
Nicht ausreichend validiert im<br />
akuten Setting<br />
BGA Blutgasanalyse, BE Basenüberschuss, HCO 3 – Bikarbonat, p aCO 2 arterieller Kohlendioxidpartialdruck,<br />
pCO 2 Kohlendioxidpartialdruck<br />
Tab. 2 Einsatzgebiete und Indikationen der unterschiedlichen Messmethoden<br />
Methode<br />
Einsatzgebiete/Indikation<br />
Arterielle BGA<br />
Intensiv-/Akutmedizin<br />
Akute respiratorische Insuffizienz<br />
Genaueste pCO 2-Bestimmung<br />
Kapillare BGA<br />
Chronische ventilatorische Insuffizienz<br />
Venöse BGA<br />
Screening des Säure-Basen-Haushalts<br />
Endtidale pCO 2-Messung<br />
Invasiv beatmete Patienten<br />
Allgemeinanästhesie<br />
Patienten ohne strukturelle Lungenerkrankung<br />
Lagekontrolle des Tubus nach Intubation<br />
Transkutane pCO 2-Messung Verlaufsbeobachtungen („Trend“) des pCO 2,z.B.im<br />
Weaning oder bei Einleitung einer außerklinischen<br />
Beatmung<br />
Chronische ventilatorische Insuffizienz<br />
Screening bei nächtlicher Hyperkapnie (z. B. im Schlaflabor)<br />
BGA Blutgasanalyse, pCO 2 Kohlendioxidpartialdruck<br />
den modernen Geräten ist er allerdings<br />
klinisch nicht mehr relevant [31].<br />
Die verschiedenen Vor- und Nachteile<br />
der einzelnen Messmethoden sind<br />
in . Tab. 1 dargestellt, . Tab. 2 zeigt ihre<br />
Indikationen und Einsatzgebiete.<br />
Fazit für die Praxis<br />
4 Im klinischen Alltag werden meist<br />
mehrere Messverfahren zum pCO 2-<br />
<strong>Monitoring</strong> gemeinsam eingesetzt,<br />
um ihre verschiedenen Vor- und<br />
Nachteile optimal zu nutzen. So<br />
kann beispielsweise eine (arterielle/<br />
kapillare) BGA durchgeführt und<br />
mit dem transkutanen pCO 2 für<br />
die weitere Verlaufsbeobachtung<br />
abgeglichen werden.<br />
4 Die Messung des transkutanen pCO 2<br />
dient der kurz- bis mittelfristige<br />
Verlaufskontrolle, da der transkutane<br />
pCO 2 kurzfristige Änderungen der<br />
Ventilation (z. B. Maskenleckage,<br />
Anstieg des pCO 2 während einer<br />
Spontanatmungsphase) anzeigen<br />
kann. Bei Lungengesunden kann die<br />
endtidale pCO 2-Messung eingesetzt<br />
werden.<br />
Korrespondenzadresse<br />
Dr.F.S.<strong>Magnet</strong><br />
Fakultät für Gesundheit/<br />
Department für Humanmedizin,<br />
Lungenklinik Köln-<br />
Merheim, Kliniken der Stadt<br />
Köln gGmbH, Universität<br />
Witten/Herdecke<br />
Ostmerheimer Str. 200,<br />
51109 Köln, Deutschland<br />
magnetf@kliniken-koeln.de<br />
Einhaltung ethischer Richtlinien<br />
Interessenkonflikt. Die Autoren geben an, dass die<br />
Arbeitsgruppe Forschungsgelder und Verbrauchmaterialen<br />
für die Klinik und wissenschaftliche Studien<br />
von Breas Medical Deutschland bzw. GE Homecare,<br />
Heinen & Löwenstein, Vivisol Deutschland, SenTec AG<br />
und Radiometer Deutschland erhalten haben. F.S. <strong>Magnet</strong>erhieltKongressunterstützungenvondenFirmen<br />
Breas Medical Deutschlandbzw. GEHomecare, Heinen<br />
& Löwenstein und Vivisol Deutschland. W. Windisch<br />
und J. H. Storre erhielten Honorare für Vortrags- und<br />
Beratertätigkeiten sowie Kongressunterstützungen<br />
von den Firmen Breas Medical Deutschland bzw. GE<br />
Homecare, SenTec AG, Heinen & Löwenstein, Vivisol<br />
Deutschland und Radiometer Deutschland.<br />
206 Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin 3 · 2016
Lesetipp<br />
Dieser Beitrag beinhaltet keine von den Autoren<br />
durchgeführten Studien an Menschen oder Tieren.<br />
Literatur<br />
1. Roussos C (1982) The failing ventilatory pump.<br />
Lung160:59–84<br />
2. Windisch W (2012) Home mechanical ventilation.<br />
In: Tobin MJ (Hrsg) Principles & practice of<br />
mechanical ventilation, 3. Aufl. Mc Graw Hill, New<br />
York,S683–697<br />
3. KabitzHJ,WindischW(2007)DiagnostikderAtemmuskelfunktion:<br />
state of the art. Pneumologie<br />
61:582–587<br />
4. Windisch W (2008) Pathophysiologie der Atemmuskelschwäche.Pneumologie62:18–22<br />
5. Windisch W, Brambring J, Budweiser S et al<br />
(2010) Nichtinvasive und invasive Beatmung<br />
als Therapie der chronischen respiratorischen<br />
Insuffizienz. S2-Leitlinie herausgegeben von der<br />
Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und<br />
Beatmungsmedizine. V.Pneumologie64:207–240<br />
6. Windisch W (2015) Respiratorische Insuffizienz-<br />
O2-Gabe oder Beatmung. Perspektiven der<br />
Pneumologie und Allergologie. Dtsch Arztebl<br />
112:28–31<br />
7. Anonymous (1999) Clinical indications for noninvasive<br />
positive pressure ventilation in chronic<br />
respiratory failure due to restrictive lung disease,<br />
COPD, andnocturnal hypoventilation-a consensus<br />
conferencereport.Chest116:521–534<br />
8. Stoller JK, Panos RJ, Krachman S, Doherty DE,<br />
Make B (2010) Long-term Oxygen Treatment Trial<br />
Research Group. Oxygen therapy for patients with<br />
COPD: currentevidence andthe long-termoxygen<br />
treatmenttrial.Chest138:179–187<br />
9. Kelly AM, McAlpine R, Kyle E (2001) Venous pH can<br />
safely replace arterial pH in the initial evaluation<br />
of patients in the emergency department. Emerg<br />
MedJ18:340–342<br />
10. HonarmandA,SafaviM(2008)Predictionofarterial<br />
blood gas values from arterialized earlobe blood<br />
gas values in patients treated with mechanical<br />
ventilation.IndianJCritCareMed12:96–101<br />
11. Huttmann SE, Windisch W, Storre JH (2014)<br />
Techniques for the Measurement and <strong>Monitoring</strong><br />
ofCarbonDioxideintheBlood.AnnAmThoracSoc<br />
1:645–652<br />
12. Zavorsky GS, Cao J, Mayo NE, Gabbay R, Murias JM<br />
(2007)Arterialversuscapillarybloodgases:ametaanalysis.RespirPhysiolNeurobiol155:268–279<br />
13. Ekkernkamp E, Welte L, Schmoor C, Huttmann<br />
SE, Dreher M, Windisch W, Storre JH (2015) Spot<br />
check analysis of gas exchange: invasive versus<br />
noninvasivemethods.Respiration89:294–303<br />
14. Dar K, Williams T, Aitken R, Woods KL, Fletcher<br />
S (1995) Arterial versus capillary sampling for<br />
analysingbloodgaspressures.BMJ310:24–25<br />
15. Eaton T, Rudkin S, Garrett JE (2001) The clinical<br />
utility of arterialized earlobe capillary blood in<br />
the assessment of patients for long-term oxygen<br />
therapy.RespirMed95:655–660<br />
16. Langlands JH, Wallace WF (1965) Small bloodsamples<br />
from ear-lobe puncture: a substitute for<br />
arterialpuncture.Lancet2:315–317<br />
17. Pitkin AD, Roberts CM, Wedzicha JA (1994)<br />
Arterialised earlobe blood gas analysis: an<br />
underusedtechnique.Thorax49:364–366<br />
18. Malatesha G, Singh NK, Bharija A, Rehani B, Goel<br />
A (2007) Comparison of arterial and venous pH,<br />
bicarbonate, <strong>PCO2</strong> and PO2 in initial emergency<br />
departmentassessment.EmergMedJ24:569–571<br />
19. Lim BL, Kelly AM (2010) A meta-analysis on the<br />
utility of peripheral venous blood gas analyses in<br />
exacerbations of chronic obstructive pulmonary<br />
diseaseintheemergencydepartment.EurJEmerg<br />
Med17:246–248<br />
20. Kelly AM (2010) Review article: Can venous blood<br />
gas analysis replace arterial in emergency medical<br />
care.EmergMedAustralas22(493):498<br />
21.KellyAM,KyleE,McAlpineR(2002)VenouspCO2<br />
and pH can be used to screen for significant<br />
hypercarbia in emergency patients with acute<br />
respiratorydisease.JEmergMed22:15–19<br />
22. Eberhard P (2007) The design, use, and results of<br />
transcutaneous carbon dioxide analysis: current<br />
andfuturedirections.AnesthAnalg105:48–52<br />
23. Weinger MB, Brimm JE (1987) End-tidal carbon<br />
dioxide as a measure of arterial carbon dioxide<br />
during intermittent mandatory ventilation. J Clin<br />
Monit3:73–79<br />
24. Casati A, Gallioli G, Scandroglio M, Passaretta R,<br />
Borghi B, Torri G (2000) Accuracy of end-tidal<br />
carbon dioxide monitoring using the NBP-75<br />
microstream capnometer: a study in intubated<br />
ventilated and spontaneously breathing nonintubatedpatients.EurJAnaesthesiol17:622–626<br />
25. Bhavani-Shankar K, Moseley H, Kumar AY, Delph<br />
Y (1992) Capnometry and anaesthesia. Can J<br />
Anaesth39:617–632<br />
26. Yamanaka MK, Sue DY (1987) Comparison of<br />
arterial-end-tidal<strong>PCO2</strong>differenceanddeadspace/<br />
tidal volume ratio in respiratory failure. Chest<br />
92:832–835<br />
27. Storre JH, Dellweg D (2014) <strong>Monitoring</strong> of Patients<br />
Receiving Mechanical Ventilation. Pneumologie<br />
68:532–541<br />
28. Chhajed PN, Heuss LT, Tamm M (2004) Cutaneous<br />
carbon dioxide monitoring in adults. Curr Opin<br />
Anaesthesiol17:521–525<br />
29. Belpomme V, Ricard-Hibon A, Devoir C et al<br />
(2005) Correlation of arterial <strong>PCO2</strong> and PetCO2 in<br />
prehospital controlled ventilation. Am J Emerg<br />
Med23:852–859<br />
30. JanssensJP,Howarth-FreyC,ChevroletJC,AbajoB,<br />
Rochat T (1998) Transcutaneous <strong>PCO2</strong> to monitor<br />
noninvasive mechanical ventilation in adults:<br />
assessment of a new transcutaneous <strong>PCO2</strong>device.<br />
Chest113:768–773<br />
31. Storre JH, <strong>Magnet</strong>FS, Dreher M, Windisch W(2011)<br />
Transcutaneous monitoring as a replacement for<br />
arterial <strong>PCO2</strong> monitoring during nocturnal noninvasiveventilation.RespirMed105:143–150<br />
32. Rodriguez P, Lellouche F, Aboab J, Buisson CB,<br />
Brochard L (2006) Transcutaneous arterial carbon<br />
dioxide pressure monitoring in critically ill adult<br />
patients.IntensiveCareMed32:309–312<br />
Palliativmedizin in der<br />
Pneumologie<br />
Zur Verbesserung der Lebensqualität von<br />
Patienten und ihren Angehörigen, umfasst<br />
die Palliativmedizin im wesentlichen<br />
Symptomkontrolle, psychosoziale Unterstützung<br />
und Versorgungsplanung. Bei<br />
Atemnot bestehen zwar neurophysiologisch<br />
Ähnlichkeiten mit der Schmerzempfindung,abersie<br />
isterheblichkomplexerals<br />
Schmerz und in vielen Bereichen schwieriger<br />
zu verstehen.<br />
In Der Pneumologe 02/2016 finden Sie Vorschläge<br />
für eine bessere palliativmedizinische<br />
Versorgung von Patienten mit chronischen,<br />
nicht heilbaren pulmonalen Erkrankungen,<br />
sowie auch für die Integration der<br />
PalliativmedizinineinLungentransplantationsprogramm,<br />
auch wenn Transplantations-<br />
und Palliativmedizin ähnlich wie die<br />
IntensivmedizinaufdenerstenBlickgegensätzliche<br />
Ansätze haben.<br />
4 Palliativmedizin in der thorakalen Onkologie<br />
4 Palliativmedizin bei nicht malignen<br />
chronisch pulmonalen Erkrankungen<br />
4 Ethik und Palliativmedizin in der Intensiv-<br />
und Beatmungsmedizin<br />
4 Palliative Care in der Lungentransplantation<br />
Bestellen Sie diese Ausgabe zum Preis von<br />
39,- EUR zzgl. Versandkosten bei<br />
Springer Customer Service Center<br />
Tel.: +49 6221-345-4303<br />
E-Mail: leserservice@springer.com<br />
Suchen Sie noch mehr zum Thema? Mit<br />
e.Med, dem Kombi-Abo von Springer Medizin,<br />
können Sie schnell und komfortabel in<br />
über 600 medizinischen Fachzeitschriften<br />
recherchieren.<br />
Weitere Infos unter<br />
www.springermedizin.de/eMed<br />
Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin 3 · 2016 207