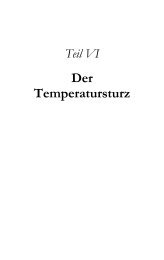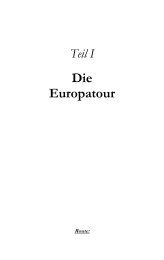Teil III - Die Dreiländersafari
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Teil</strong> <strong>III</strong><br />
<strong>Die</strong><br />
<strong>Dreiländersafari</strong>
Route:<br />
Nairobi – Kampala – Dar es Salaam<br />
Mombasa<br />
84
Äquatortreffen<br />
Kenia<br />
V<br />
om Piloten erfahren wir, dass wir uns in einer Höhe<br />
von 3000 Fuß über den Sudan hinweg bewegen. Beim<br />
Blick durch die Luke läuft es mir eiskalt über den Rücken,<br />
erst jetzt wird mir klar was unter Sudan zu verstehen ist.<br />
Der flächenmäßig größte Staat Afrikas, auf dessen Gebiet<br />
ein Großteil Westeuropas unterzubringen wäre, gilt als<br />
einer der unzugänglichsten und schwierigsten Länder des<br />
Kontinents. Nachdem was ich davon zu sehen bekomme,<br />
ist er alles andere als einladend.<br />
Der Norden wird von einer gewaltigen Wüste und einer<br />
anschließenden Steppen- und Savannenlandschaft eingenommen.<br />
Von Armut und Hunger geplagt sind diese<br />
Gebiete zwar mit denen im Süden politisch vereint, in den<br />
Sumpflandschaften des Sudd entflammt jedoch immer<br />
wieder der Bürgerkrieg, weil sich die dort lebenden schwarz<br />
afrikanischen Völker gegen die Beherrschung durch den<br />
arabischen Norden auflehnen.<br />
Mit abnehmender Flughöhe steigt die Stimmung an Bord.<br />
Neben dem kunterbunten Treiben in den Sitzen, sorgen die<br />
Gesänge auf Swahili, einer Sprache die aus arabischen und<br />
afrikanischen Dialekten entstanden ist, für exotische Unterhaltung<br />
bis es schließlich heißt:<br />
„Stop smoking and fasten your seat belts! “<br />
„Unatoka wapi?“ - Das braune Fräulein neben mir möchte<br />
noch rasch wissen woher ich komme.<br />
„Mimi ninatoka Ujerumani!“ – rufe ich ihr zurück.<br />
Während des Landeanfluges erfahren wir aus den Lautsprechern<br />
von der Schönheit des Landes. Wie es heißt,<br />
fasziniere Kenia besonders durch seinen landschaftlichen<br />
Reichtum.<br />
85
Palmenstrände am Indischen Ozean, endlose Savannen,<br />
grünes Hochland und die schneebedeckten Gipfel des<br />
Mount Kenia bilden vielfältige Naturkontraste, die es zu<br />
entdecken gilt.<br />
Bis wir den Flughafen verlassen, bin ich nass geschwitzt.<br />
Der Zöllner will uns nur einreisen lassen, wenn wir ihm ein<br />
Rückflugticket vorweisen können. Da wir nicht vorhaben,<br />
in absehbarer Zeit den Rückzug anzutreten, können wir<br />
natürlich kein entsprechendes Papier vorlegen. Es kostet<br />
unendlich viel Zeit, ihn zu bewegen, uns die geliebte<br />
Freiheit einfach so zu schenken.<br />
Draußen erteilen wir den Angeboten der Taxifahrer eine<br />
Absage, weil wir nun wieder auf eigenen Füssen stehen<br />
wollen. Nachdem die Pedale anmontiert sind und der<br />
Druck der Reifen auf Vordermann gebracht ist, stehen wir<br />
bereit. Ich brenne darauf meinen Erlebnishunger zu stillen,<br />
auch wenn mir der Schlafentzug der letzten Nacht noch<br />
immer in den Knochen steckt.<br />
Vom Kenyatta-Airport starten wir in den ungewohnten<br />
Linksverkehr, schon bald stellt sich die Routine wieder ein.<br />
Wir spurten durch sattes Grün, bis wir durch einige<br />
herumliegende Nagelbretter ausgebremst werden.<br />
Ich versuche dem Stachelwerk und einer Gewehrmündung<br />
auszuweichen, lande aber unsanft im Straßengraben.<br />
<strong>Die</strong> Polizisten haben ihren Spaß daran, sie stellen mich aber<br />
gleich wieder auf die Beine. Wie sich danach herausstellt,<br />
befinden wir uns auf dem Weg hinunter nach Mombasa.<br />
Wir schlagen umgehend wieder die Gegenrichtung ein und<br />
erreichen so über den Uhuru-Highway das Zentrum von<br />
Nairobi.<br />
<strong>Die</strong> Stadt präsentiert sich mit seiner Hochhausarchitektur<br />
modern. Erst Ende des vorigen Jahrhunderts wurde<br />
Nairobi als Eisenbahncamp im Hochland angelegt, es<br />
beherbergt heute bereits über eine Million Einwohner.<br />
86
So befindet sich neben den Hotels, Bankpalästen und<br />
noblen Geschäften auch die andere Seite der Realität,<br />
nämlich die Slums am Rande des Wohlstandes. Nairobi ist<br />
nicht unbedingt schön, aber auch nicht besonders hässlich.<br />
Andererseits ist die Stadt für afrikanische Verhältnisse recht<br />
ordentlich und sauber.<br />
Trotzdem haben wir bereits nach wenigen Tagen genug<br />
von diesem Ort, in dem der Krawall in den Strassen<br />
besonders in der Nacht nicht zu überhören ist.<br />
Indem die neuesten Nachrichten vom Golf schon um fünf<br />
Uhr morgens aus den Radios plärren, machen wir uns auf<br />
die Socken.<br />
Beim Verlassen des Hotels brummt einer hinter uns her:<br />
„Don´t worry, Kenya is a peacefull country! “<br />
Hinter der Stadt erwartet uns eine sanfte Hügellandschaft,<br />
ein frischer Wind weht uns um die Ohren. <strong>Die</strong> alte Limuru-<br />
Road führt an den gut bewachten Landsitzen der Herrschaften<br />
vorbei. Nur ein Stück des Weges weiter finden<br />
sich Teefelder und Stroh gedeckte Hüttendörfer.<br />
In Kaufladen von Limuru gibt es ein karges Angebot<br />
genießbarer Produkte. Mehr als Weißbrot, Marmelade und<br />
Erdnussbutter darf man hier nicht erwarten.<br />
In den Regalen befinden sind in erster Linie nur giftige<br />
Produkte. Das Angebot erstreckt sich über Mückenspray<br />
und Seife bis hin zum Unkrautvertilgungsmittel, sogar das<br />
Trinkwasser welches wir gereicht bekommen schmeckt<br />
nach Petroleum.<br />
<strong>Die</strong> Strasse nach Longonot hat sich in eine lange Baustelle<br />
verwandelt.<br />
Mit Hängen und Würgen müssen wir uns gelegentlich in<br />
die Büsche zurückziehen, weil uns der üble Gestank<br />
aufgeblähter Zebrakadavers den Magen umdreht.<br />
Am Ende des Tages schlagen wir unser Zelt im Camp der<br />
Straßenbauarbeiter neben einer alten Dampfwalze auf.<br />
87
Auch hier ist das Gesprächsthema der Krieg im Irak. Ein<br />
Alter hofft darauf, dass Präsident Bush möglichst viele<br />
Schwarze in den Krieg schicken möge, damit diese den<br />
Arabern einmal gründlich einheizen.<br />
<strong>Die</strong> anderen Männer klagen über die steigenden Preise und<br />
den chronischen Wassermangel der Gegend. Wir<br />
schlendern zusammen zur nahen Bierbar, aber die<br />
Stimmung liegt auch dort am Boden, der Barkeeper ist in<br />
seinem Drahtkäfig gefangen. Als ich die kleine Luke an der<br />
Getränkeausgabe anpeile, werde ich eifrig von einigen<br />
gelangweilten Damen begrüßt. Da ich mich dem<br />
herrschenden Treiben und ihrem Freibierdurst nicht<br />
gewachsen fühle, kehre ich auf der Stelle um.<br />
Das ostafrikanische Rift-Valley ist <strong>Teil</strong> eines der größten<br />
geologischen Wunder der Erde. Es durchzieht das Hochland<br />
Kenias und ist Hauptteil des Ostafrikanischen<br />
Grabensystems, das einst durch einen Riss in der Erdkruste<br />
entstand. <strong>Die</strong> Erde ist hier in langen schmalen Abschnitten<br />
eingesunken und hat auf diese Weise Täler mit den<br />
angrenzenden Vulkanen und ganze Seenketten zurück<br />
gelassen. Mit einer Länge von über 5000 Kilometern<br />
erstreckt sich das Rift-Valley über das Rote Meer bis nach<br />
Vorderasien.<br />
Im Schatten des malerischen Berges Mount-Longonot liegt<br />
der Naivasha See. Auf einer Höhe von über 1800 Metern<br />
gelegen, gilt er als der höchste und sauberste See des Rift-<br />
Valleys. Während wir uns dem See nähern trabt ein hoch<br />
gewachsener Mann fleißig neben mir her. Ich staune,<br />
welche Ausdauer er dabei an den Tag legt, zumal er sich<br />
andauernd mit mir unterhält. Wie die Farmen im<br />
Kolonialstil entlang der Straße bezeugen, begann der Ort<br />
einst als eine Siedlergemeinschaft, heute ist er Versorgungspunkt<br />
für die Besucher des Sees.<br />
88
Ganz in der Nähe Hell´s-Gate-Nationalparks übernachten<br />
wir auf einem Campingplatz.<br />
Früh stehen wir wieder auf den Beinen.<br />
Am Seeufer trotten die Flusspferde recht verschlafenen<br />
durch den Schlamm, sie nutzen die angrenzende Wiese als<br />
Weidegrund.<br />
Der Hells-Gate National Park ist mit den Rädern rasch<br />
erreicht. Am Eingang erfahren wir von den Rangern<br />
Interessantes über dieses Gebiet. Der Park wurde 1984<br />
eröffnet und hat sich schnell zu einem einzigartigen Biotop<br />
entwickelt, indem eine große Artenvielfalt wilder Tiere, eine<br />
außergewöhnliche Flora und eine bunte Vogelwelt anzutreffen<br />
ist. <strong>Die</strong> Landschaft ist der vulkanischen Tätigkeit<br />
früherer Zeiten entsprungen, heiße Quellen und hoch<br />
aufsteigende Dampfwolken unterhalb des Mount-Longonot<br />
erinnern daran, dass der letzte Vulkanausbruch gerade<br />
einmal hundert Jahre zurückliegt. Vom Olkaria, einem<br />
inzwischen erloschenen Vulkan im Westen, floss damals die<br />
heiße Lava herunter. Sie ließ eine raue und zackige<br />
Landschaft entstehen.<br />
Zum Schluss unserer Unterhaltung werden wir eindringlich<br />
darauf hingewiesen, dem Wild nicht zu nahe zu kommen,<br />
besonders mit den Büffeln sei nicht zu spaßen.<br />
Mit einer Landkarte bewaffnet und mit einem mulmigen<br />
Gefühl im Bauch strampeln wir über staubige Wege in ein<br />
enges Tal. Von steilen Felsen flankiert, lassen wir uns von<br />
einem spitzen Kegel der hoch aus der Erde ragt anlocken.<br />
Der spitze Turm aus Basaltsäulen ist das Markenzeichen<br />
des Nationalparks. Er wurde nach dem deutschen Naturforscher<br />
G.A. Fischer benannt, der im Jahre 1885 als erster<br />
Europäer seine Augen auf ihn richtete. Wir folgen dem<br />
Wegweiser und begegnen grasenden Zebraherden und<br />
hüpfenden Antilopen.<br />
An einem hervorragenden Aussichtspunkt verschlägt es uns<br />
beim Blick über die Steppe den Atem.<br />
89
Ich erkenne in der Ferne einige Giraffen, die kaum dass sie<br />
uns gewittert haben, ihre langen Beine schwingen.<br />
Es ist einfach toll wie diese grazilen Tiere fast schwerelos<br />
und mit hohem Tempo über den Steppenboden traben.<br />
An den ausgedörrten Skeletten gerissener Antilopen vorbei<br />
holpern wir einen Berghang hinunter. An den Wasserlöchern<br />
dieser trockenen Region treffen wir auf Zebras,<br />
Büffel und Thomson Gazellen. <strong>Die</strong> Spuren im Sand sind<br />
eindeutig, es gibt im Park Raubkatzen. Zum unserem Glück<br />
jagen die Leoparden und Löwen überwiegend in der Nacht.<br />
Wir geraten in einen Canyon mit zerklüfteten Felswänden,<br />
es riecht nach faulen Eiern weil dort giftige Schwefeldämpfe<br />
den heißen Quellen entweichen.<br />
Eine Straußendame keift uns überaus böse hinterher.<br />
„Mensch, fahr doch schneller!<br />
Siehst du nicht den Löwen?!<br />
Das kräftige Biest weiß genau was es will.<br />
Ich kann ihm einfach nicht entkommen – meine Beine<br />
lassen mich im Stich. Ich schaue in die mörderischen<br />
Augen und kann den faulen Atem der Katze riechen …<br />
Dann ist es vorbei - Straßenlärm dringt an meine Ohren.<br />
Blutrünstige Moskitos kreisen über mir und ich frage mich<br />
wo ich gelandet bin.<br />
In einem düsteren Loch finde ich mich wieder und ich<br />
besinne mich.<br />
Nachdem wir am Naivasha-Lake unser Zelt zusammen<br />
packten, erreichten wir nach einer heißen Etappe Nakuru.<br />
Nicht der miserable Zustand der Straße machte uns an<br />
diesem Tag so fertig, sondern die diabolische Fahrweise<br />
unserer lieben Mitmenschen gab uns den Rest.<br />
Mehrmals sind wir dem Tod von der Schippe gesprungen,<br />
indem wir uns in die Gräben zu den toten Zebras stürzten.<br />
<strong>Die</strong> Ufer des Sees bei Nakuru wurden einst von bis zu<br />
zwei Millionen Flamingos bevölkert. Mitte der siebziger<br />
Jahre, begannen die Vögel einfach fortzuziehen.<br />
90
Über mehrere Jahre lang blieben nur wenige übrig - nicht<br />
genügend um das Touristenspektakel des rosa gesäumten<br />
Sees aufrechtzuerhalten. Niemand weiß mit Sicherheit,<br />
warum die Vögel den Ort verließen oder warum sie<br />
allmählich wieder zurückkehren.<br />
Schon seit Tagen verfolgten uns die Msungu-Rufe der<br />
Kinder am Straßenrand, die Hüttenbewohner brechen in<br />
schallendes Gelächter aus, sobald sie uns zu Gesicht<br />
bekommen.<br />
Wir erhalten weite Ausblicke in die uns umgebenden<br />
Landschaften und tiefe Einblicke in stachelige Kakteenfelder.<br />
Am größten Breitenkreis der Erde, wo unser Planet<br />
in die nördliche und südliche Halbkugel aufgeteilt wird,<br />
machen wir an einer Gedenktafel Pause.<br />
Neben dem Fußvolk gesellt sich auch ein Radprofi aus<br />
Nairobi zu unserer Äquatortaufe, dazu braust eine Wolke<br />
aus Staub heran und ein Mann in Leder gesteht vom<br />
Motorrad herunter: „<strong>Die</strong>se See-Piste ist eine der<br />
schlechtesten Straßen die ich je gefahren bin!“<br />
Der Norddeutsche, der mit seinem qualmenden Vehikel<br />
zuletzt durch Zaire und Uganda fuhr, ist auf dem Weg zum<br />
Kap der guten Hoffnung. Ich würde um keinen Preis der<br />
Welt mit ihm tauschen mögen. Wenn ich es mir recht<br />
überlege, ist es doch öde mit einer Maschine die Kilometer<br />
nur so zu fressen. Viele Details nimmt man bei dieser Art<br />
der Fortbewegung einfach nicht mehr wahr, zudem bin ich<br />
überzeugt davon, dass nur langsames Reisen der Seele<br />
ermöglicht, Schritt zu halten.<br />
<strong>Die</strong> Sonnenstrahlen sind mittags fast unerträglich, zwischen<br />
den Anpflanzungen einer Sisal-Fabrik staut sich die Hitze<br />
über der rot getönten Erde. Erleichtert nehmen wir den<br />
Abzweig zum Bogoria See, der zunächst steil über Felsabsätze<br />
auf losem Gestein abwärts führt.<br />
Trotz aller Widrigkeiten wuchten wir die Packesel bis zum<br />
Emsos-Gate, wo der Wildhüter große Augen macht.<br />
91
Der Bogoria-See liegt in einer versengten, felsigen Landschaft<br />
mit heißen Quellen und explodierenden Geysiren<br />
entlang des westlichen Ufers und einer steilen dunklen<br />
Wand des hoch thronenden Laikipafelsens in östlicher<br />
Richtung. Der erste Eindruck aus der Ferne war der einer<br />
schroffen, leblosen Umwelt, nun aber sehen wir die<br />
Flamingoscharen die den ganzen Salzsee rosa färben. Der<br />
Park beherbergt neben Gazellen- und Antilopenherden<br />
auch wilde Affenhorden.<br />
Am Seeufer schlagen wir unter riesigen Feigenbäumen<br />
unser Lager auf, an diesem herrlichen Flecken bleiben wir<br />
gerne für einige Zeit.<br />
In den Bäumen haben sich die Baboons versammelt, diese<br />
kräftigen Affen mit ihren langen Schnauzen und dem<br />
raubtierartigen Gebiss halten aber einen respektvollen<br />
Abstand ein. <strong>Die</strong> Schlange, die aus den Blättern eines<br />
Busches heraus züngelt, verzieht sich auch gleich wieder.<br />
<strong>Die</strong> Mückenvölker schwärmen in den Abend, der Himmel<br />
verdüstert sich und ein Gewitter zieht auf.<br />
Wir verkriechen uns schnell im Zelt.<br />
Im Wald ist es bald stockfinster geworden, vom See weht<br />
Flamingogeschnatter herüber. <strong>Die</strong> anderen Laute die durch<br />
die Zeltplane dringen, lassen mich erschaudern.<br />
Für einen kurzen Augenblick zuckt ein Blitz, der Donner<br />
grollt und endlich setzt der Regen ein. Mit einem<br />
stürmischen Guss peitscht er über uns hinweg.<br />
Im Wald beginnt ein riesiges Affenspektakel. Als die Ruhe<br />
wieder einkehrt, versinke ich in einen flüchtigen Schlaf, der<br />
jedoch mit einem kurzen Stoß in die Rippen beendet wird.<br />
„Hey, da schleicht doch jemand ums Zelt!“ - Blitzschnell<br />
ergreife ich die Initiative und fasse die Taschenlampe.<br />
Es sind die kleinen Hände der Affen, die sich an unserer<br />
Behausung zu schaffen machen. Ich leuchte in eine wilde<br />
Mähne und blicke in abscheuliche Zähne.<br />
92
Aus vollem Herzen brülle ich in das betagte Gesicht, dabei<br />
gerät alles außer Rand und Band. Wie vom Hafer gestochen<br />
rast die haarige Bande durch den Wald.<br />
Am nächsten Morgen lacht mir die Sonne ins Gesicht.<br />
Ich traue meinen Augen kaum, als ich den Baboon<br />
bemerke, der die frühen Stunden in unserer Nachbarschaft<br />
genießt. Ich frage mich ob er bei der nächtlichen Aktion<br />
dabei war, obwohl er irgendwie gebrechlich auf mich wirkt .<br />
Als ich mich aufrichte, humpelt er schwerfällig davon.<br />
Mit einem Keks versuche ich ihn zu besänftigen, doch das<br />
ist ein Fehler.<br />
Der Affe beginnt mit einem Mal frech zu werden.<br />
Zunächst gelingt es mir, ihn mit einem Stock auf Distanz<br />
zu halten, doch dann ist der Alte nicht mehr zu bremsen.<br />
<strong>Die</strong> Hiebe mit dem Knüppel beantwortet er mit einem<br />
weit aufgerissenen Maul. Das Affengebiss ist dabei so<br />
beeindruckend, dass ich vorsichtshalber weitere Prügel<br />
erteile.<br />
Nachdem sich der zottige <strong>Die</strong>b mit unseren Brotvorräten<br />
in den Wald verkrümelt hat, betrachte ich die Beziehung<br />
unter den Primaten als gestört. Mit der Idylle am See ist es<br />
nun endgültig vorbei.<br />
Ich gehe viele große Steine sammeln.<br />
Dass es bei uns was zu holen gibt, hat sich schnell herum<br />
gesprochen. Mit gezielten Steinwürfen und knurrendem<br />
Magen gelingt es aber, die Affenbande auf Distanz zu<br />
halten.<br />
Gegen Abend bekommen wir erneuten Besuch, dieses Mal<br />
in Form einer Arztfamilie mit Jeep. Das kluge Paar ist<br />
gleich bei der Begrüßung der festen Überzeugung, dass uns<br />
bald die Malaria holen wird. In dieser Hinsicht um einiges<br />
optimistischer, verweisen wir auf die aktuelle Bedrohungslage<br />
direkt aus dem Dschungel.<br />
93
Das Affentheater geht mit dem Sonnenaufgang weiter.<br />
Herr Doktor beginnt nach einer turbulenten Nacht im<br />
nassen Schlafsack mit dem Abriss des undichten Zeltes.<br />
Frau Doktor hat sich bereits in die Sicherheit ihres Wagens<br />
begeben. Durch einen Fensterschlitz berichtet sie mir, dass<br />
sich ihre Lebensmittel in fremden Händen auf dem<br />
Feigenbaum befinden.<br />
Schon hüpfen die Affen wieder von den Ästen und<br />
formieren sich zu einem neuen Angriff.<br />
Nun wird auch der Doktor böse und verflucht die Bande.<br />
So wie dieser Zweibeiner herumtobt und seiner Zeltplane<br />
hinterher jagt, ist leicht zu erkennen, dass zwischen Affen<br />
und Menschen kein all zu großer Unterschied besteht.<br />
Am Westufer setzen wir die Reise fort.<br />
Es folgt ein ewiges auf und ab, mit kümmerlichem Schatten<br />
und herrlichen Ausblicken über den See.<br />
Es wimmelt nur so von Flamingos.<br />
Mit ihren langen Beinen, dem rosa Gefieder, den beilförmigen<br />
Schnäbeln und den gebogenen Hälsen bieten sie<br />
uns einen wunderschönen Anblick.<br />
Zu Hunderten stehen sie am Rande des Sees und filtern mit<br />
abwärts gekehrtem Schnabel die Nahrung aus dem Wasser.<br />
In dichten Schwärmen fliegen sie an uns vorbei.<br />
<strong>Die</strong> Start und Landetechnik der Vögel fasziniert mich ganz<br />
besonders, ihr rasanter Spurt auf der Wasseroberfläche ist<br />
einzigartig.<br />
<strong>Die</strong> Seeadler lauern geduldig im Hintergrund.<br />
So mancher Flamingo wurde schon von ihnen vernascht,<br />
wie zum Beweis türmen sich bei den heißen Quellen die<br />
Gerippe auf.<br />
Der Grund des Rift-Valleys besteht aus der typischen<br />
ostafrikanischen Savanne, in der es die meiste Zeit des<br />
Jahres über trocken und heiß ist.<br />
94
Trotz der Kultivierung einiger Flächen wurde die Tierwelt<br />
noch nicht ganz verdrängt, es gibt Giraffen, Zebras,<br />
Gazellen, Paviane, Geparde und Leoparden, sogar einige<br />
Löwen haben sich hier gehalten. Zu den heimischen<br />
Pflanzenarten gehört die farbenprächtige Feuerlilie, die<br />
Aloe, die Dornakazie mit ihren runden, ameisengefüllten<br />
Auswüchsen an den Zweigen sowie der kaktusartige<br />
Euphorbiabaum.<br />
Wie befürchtet, wird der Anstieg überaus anstrengend, an<br />
jeder Straßenkehre holen wir tief Luft, aber mit jedem<br />
Höhenmeter gewinnen wir einen besseren Überblick über<br />
das weite Tal um den Baringo-See.<br />
Von Karbanet geht es in kurvenreicher Abfahrt hinunter,<br />
unsere mühevoll erklommene Höhe geht dabei wie im Flug<br />
verloren. Auf einer pfeilgeraden Strecke durchqueren wir<br />
eine trockene Landschaft, bis die mächtige Felswand des<br />
zweiten Anstieges vor uns protzt.<br />
In Biretwo, einem Straßendorf mit ein paar Ziegen sowie<br />
einer Bar mit Sonnenschirm tanken wir Flüssigkeit auf.<br />
In flimmernder Hitze nehmen wir den nächsten Anstieg,<br />
der sich in weiten Kurven hinauf windet.<br />
Wir schieben von Schatten zu Schatten, die Sonne über<br />
dem Rift-Valley brennt gnadenlos auf uns herab. Um nicht<br />
zu verschmoren verpflastern wir die Gesichter.<br />
Eine bewachsene Bergkante ragt in leuchtendem Grün<br />
hoch über uns auf, nur ein kümmerlicher Wasserstrahl rinnt<br />
aus den heißen Felsen.<br />
Eldoret ist ein blühendes Städtchen mit einem Geschäftszentrum,<br />
es liegt etwa 300 Kilometer nordwestlich von<br />
Nairobi entfernt. Wie die meisten Besucher dieses Landstriches<br />
ziehen wir auf dem Weg nach Uganda hier vorbei.<br />
<strong>Die</strong> Stadt bietet eine gute Gelegenheit, sich mit dem Allernötigsten<br />
einzudecken.<br />
95
Schon mittags ist die Bar gerammelt voll. Wir gesellen uns<br />
zu heiteren Afrikanern, die sich hier aber etwas derber<br />
geben als die Leute im Südosten.<br />
Mit dem Schreiben des Tagebuches erregen wir bald<br />
allgemeines Misstrauen, man ist sich ziemlich sicher, dass<br />
Madam nur schlechtes von hier zu berichten weiß.<br />
In aller Frühe suchen wir unseren Weg aus Eldoret.<br />
Runde 60 Kilometer weiter erscheint in unserem Blickfeld<br />
die Papierfabrik von Webuye.<br />
Zunächst überwinden wir eine lang gestreckte Anhöhe,<br />
dann erreichen wir die Fabrik an einem schmutzigen Fluss.<br />
Der Ort ist einfach strukturiert, er besteht aus zwei<br />
Gebäudereihen mit einfachen Geschäften sowie mehreren<br />
Bars. Wir mieten uns im Western-Hotel ein, in dem es<br />
erbärmlich aus den Toiletten stinkt, weil es derzeit im<br />
ganzen Ort kein Wasser gibt.<br />
Passend zum Thema finde ich in der Zeitung die Zeilen<br />
eines gewissen Herrn van Hout:<br />
Haben sie schon gewusst, dass die Panafrican-Paper-Mills<br />
in Webuye etwa sieben Millionen Gallonen Wasser an<br />
einem Tag verbrauchen, während vielen Menschen in dieser<br />
Stadt nicht eine Gallone für den ganzen Monat zur<br />
Verfügung steht?<br />
96
Uganda<br />
W<br />
ir schieben nach Uganda rüber, wo uns der<br />
Grenzposten schon im Morgengrauen mit seinen<br />
blöden Fragen die Laune verdirbt.<br />
Warum wir auf Fahrrädern einreisen wollen, wie groß<br />
unsere mitgeführte Geldmenge ist, beziehungsweise wann<br />
und wo wir gedenken wieder auszureisen.<br />
Der Gipfel aber ist die völlig ernst gemeinte Frage:<br />
„Sir, weshalb tragen sie diese komischen Hosen?“<br />
Es wird an unserer Kleidung herum gemäkelt, bis ich die<br />
Herren über den Sinn und den Zweck von Radlerhosen<br />
aufkläre. Wie sich später herausstellt, steht die hier<br />
dargestellte Prüderie in keinerlei Verhältnis zur tatsächlichen<br />
Kleiderordnung des Landes. Wir fühlen uns vor den<br />
Kopf gestoßen und als unser Monatsvisum auch noch<br />
ohne Angabe von Gründen einfach um eine Woche<br />
gekürzt wird, empfinden wir uns in Uganda nicht<br />
willkommen.<br />
Das Grenzgebiet zwischen Kenia und Uganda wird von<br />
einem großen erloschenen Vulkan, dem Mount-Elgon<br />
besetzt. Vor Millionen Jahren ist er entstanden und noch<br />
heute befinden sich in seinem Krater heiße Quellen.<br />
Seine gut 100 km breite Grundfläche gibt Anlass zur<br />
Vermutung, dass dieser Vulkan in Urzeiten alle anderen<br />
Berge Afrikas, wenn nicht sogar der ganzen Erde, überragt<br />
hat. Inzwischen rangiert er, hinter dem Kilimandscharo,<br />
dem Mt. Kenia und der Ruwenzori-Kette an vierter Stelle<br />
innerhalb des afrikanischen Kontinents.<br />
Aufgrund seiner Höhenlage hat das Äquatorland Uganda<br />
ein tropisch mildes Klima mit Temperaturen um die 22<br />
Grad Celsius, schon deshalb ist das Land reich von<br />
Grünpflanzen bedeckt.<br />
97
Dem Dickicht entspringt eine gut getarnte Mannschaft<br />
und stellt sich uns in den Weg. <strong>Die</strong> Panzerfaust welche aus<br />
der Flora ragt unterstreicht den Ernst der Lage.<br />
Da Uganda immer noch ein Land ist, in dem Gesetz und<br />
Ordnung nicht vollkommen wieder hergestellt sind, soll mit<br />
derartigen Militärkontrollen dem inneren Frieden nachgeholfen<br />
werden.<br />
Winston Churchill hat Uganda einst die Perle Afrikas<br />
genannt. Das Land, war die wohlhabendste Nation der Ostafrikanischen<br />
Gemeinschaft. Unter der Militärdiktatur von<br />
Idi Amin machte dieses Land nur noch durch Skandale von<br />
sich reden. Mehr als zwanzig Jahre Diktatur, Korruption<br />
und Bürgerkrieg haben Uganda in einen Sumpf der Rückständigkeit<br />
getrieben. Der jetzige Regierungschef Yoweri<br />
Museveni, versucht dem Land neue Hoffnung zu geben.<br />
<strong>Die</strong> Trümmer, die der Krieg hinterlassen hat, verschwinden<br />
aber nur langsam.<br />
Mit der Dämmerung meistern wir eine letzte Anhöhe, die<br />
Lichter von Buguri sind schon zu erkennen.<br />
<strong>Die</strong> Nacht bleibt drückend schwül, erst der nächste Tag<br />
bringt eine umfassende Erfrischung.<br />
Bevor wir die schützenden Dächer von Iganga erreichen,<br />
schüttet es aus vollen Kübeln. Sofort steht die Straße unter<br />
Wasser, die Sintflut sorgt für ein Chaos aus Schlamm.<br />
Der Victoriasee ist mit fast 70.000 Quadratkilometern etwa<br />
so groß wie Bayern, damit ist er das größte Binnengewässer<br />
Afrikas. Fast die Hälfte des Sees gehört zu Uganda, er<br />
bildet dank seines enormen Fischreichtums eine wichtige<br />
Nahrungsquelle für das Land. Auch wenn die Straße dicht<br />
am Ufer entlang führt, bekommen wir den Viktoriasee<br />
kaum zu sehen. Das Ufer ist stellenweise so versumpft,<br />
dass sich die Wasserfläche in weitem Abstand zur Straße<br />
befindet.<br />
98
<strong>Die</strong> vorbei rasenden Fahrzeuge, lassen auf ein größeres<br />
Gewässer schließen, weil an ihnen besonders dicke Fische<br />
baumeln. <strong>Die</strong> tropische Luft liegt schwer über dem Viktoria<br />
Nil, der Wald dampft und trieft vor sich hin.<br />
Ein hartnäckiger Regen verfolgt uns bis in die Hauptstadt,<br />
wo wir gleich im ersten Kreisverkehr von der Bahn<br />
gedrängt werden.<br />
Getreu dem Motto „Lieber nachgeben als sterben“ hetzen<br />
wir weiter. Während am Schlachthof der letzte Wagen eines<br />
Transporters entladen wird, schieben Menschen ihre voll<br />
beladenen Fahrräder vom Hof. Auf der geteerten Hauptstraße<br />
strampeln sie in blutigen Kitteln durch den dichten<br />
Verkehr. Mit einem Sack voll Innereien über dem Rahmen,<br />
einigen Rinderbeinen auf dem Gepäckträger und einem<br />
Rinderkopf an der Lenkerstange ziehen sie zum Markt. An<br />
den festen Buden, auf kleinen Tischen oder aus einem<br />
einzigen Korb am Boden gibt es dort fast alles zu kaufen.<br />
Auf der Zufahrtsstraße vor dem Hindutempel und der<br />
Moschee liefern die Fischer ihren Fang an. Von einem<br />
Lastwagen werden Matokestämme, die beliebten grünen<br />
Kochbananen abgeladen.<br />
Gleich daneben bieten die Metzger ihre Ware in der prallen<br />
Sonne an, während die Marabus auf den Dächern nach<br />
einer fetten Beute Ausschau halten.<br />
Im Zentrum Kampalas herrscht während der Geschäftsstunden<br />
emsiges Treiben. Auf der Kampala Road und im<br />
anschließenden Regierungsviertel mit Rathaus, Ministerien<br />
und Banken drängen sich die Geschäftsleute, Bankangestellten<br />
und die Beamten. Bis hinauf zum Nakasero<br />
Hill herrschen gepflegte Anzüge und adrette Kleider vor.<br />
Auch indischen Händler sieht man wieder, nachdem sie<br />
Anfang der siebziger Jahre aus dem Land verjagt wurden.<br />
Damals hatte man ihren Besitz enteignet und damit der<br />
ugandischen Wirtschaft einen Riesendienst erwiesen.<br />
99
<strong>Die</strong> Quartiersuche gestaltet sich schwierig. Ratlos sehen<br />
wir uns um, bis uns ein Schlitzohr anspricht und zum<br />
christlichen Verein junger Männer begleitet. In dieser Stadt<br />
ist es überaus schwierig die Spreu vom Weizen zu trennen,<br />
die Art und Weise in der hier versucht wird, an Geld zu<br />
kommen, ist nicht immer die Feinste. Erst als wir im Backsteinbau<br />
der Schule verschwinden, haben wir Ruhe.<br />
Heute ist fast die Hälfte der Bevölkerung Ugandas jünger<br />
als 15 Jahre alt, die Kinder auf den Straßen versprühen die<br />
reinste Lebensfreude. <strong>Die</strong> uniformierten Schüler versammeln<br />
sich zahlreich auf dem Sportplatz. Durch ihre<br />
einheitliche Kleidung, dem roten Hemd und der khakifarbenen<br />
Hose ist der soziale Unterschied aus ihrem<br />
Schulalltag verbannt. Sie dürfen sich glücklich schätzen,<br />
denn nur etwa die Hälfte der Kinder Ugandas durchläuft<br />
die siebenjährige Grundschulausbildung.<br />
<strong>Die</strong> Analphabetenquote der über 15jährigen liegt immer<br />
noch bei 50 Prozent. <strong>Die</strong> Hälfte der Afrikaner wird dem<br />
Christentum zugerechnet, aber die traditionellen Glaubensvorstellungen<br />
dürften noch immer überwiegen.<br />
Sonntags wird für alle gepredigt. Im nahen Baptisten-Zelt<br />
lässt sich die versammelte Gemeinde von einem weißen<br />
Prediger die Leviten lesen.<br />
<strong>Die</strong> armen Sünder werden unüberhörbar missioniert.<br />
Wir singen „Kwa heri Kampala“ und kehren der Stadt<br />
gerne den Rücken. Mit Ananas und Bananen im Gepäck<br />
bewegen wir uns durch eine dicht bewaldete Hügellandschaft<br />
in Richtung Masaka.<br />
Ein weiteres Mal überqueren wir bei Nabusanke den<br />
Äquator. Barfüßige Kinder rennen uns solange hinterher,<br />
bis ihnen die Puste ausgeht. Der letzte Posten Ugandas liegt<br />
bei Mutukula, er hat uns außer lethargischen Beamten<br />
nichts zu bieten.<br />
100
Dornen der Savanne<br />
Tansania<br />
W<br />
ieder einmal wird mir schmerzlich bewusst, das in<br />
Afrika das Geld nicht auf der Straße liegt. Wir hatten<br />
damit gerechnet, gleich bei unserer Ankunft in die<br />
Tansanische Währung wechseln zu können, was sich aber<br />
als Illusion herausstellt.<br />
Wir beugen uns dem Schicksal und radeln in den neuen Tag<br />
hinein. Bis Bukoba liegen runde 100 Kilometer vor uns.<br />
Ohne einen müden Pfennig in der Tasche bekommt das<br />
Reisen den Hauch von Abenteuer, auf den ich in diesen<br />
Breiten gerne verzichtet hätte. Wir holpern auf einer<br />
miserablen Piste weiter, die Zunge klebt mir im Hals.<br />
Im Schatten einer Banane treffen wir auf nette Leute. <strong>Die</strong><br />
Einen füttern uns mit Ananas, die Anderen helfen uns die<br />
Räder über einen steilen Buckel zu schieben. Der Verkehr<br />
hält sich zwar in Grenzen, die Strecke wird nach dem Überqueren<br />
eines Flusses aber nicht einfacher. <strong>Die</strong> wenigen<br />
Dörfer entlang des Weges wirken wie ausgestorben, die<br />
herrschende Armut bleibt uns nicht verborgen. Ich fühle<br />
mich nicht wohl in meiner Haut, nur widerwillig lasse ich<br />
mich zu neuen Leistungen anspornen. Auf der mit Sand<br />
gepuderten Piste bedeutet das Vorankommen harte<br />
Muskelarbeit.<br />
Bis zum späten Nachmittag dämmert mir, dass wir Bukoba<br />
nicht bei Tageslicht erreichen werden, zu viele Kilometer<br />
trennen uns von der Stadt. Was uns bevorsteht, wenn es<br />
erst einmal finster geworden ist, wage ich mir nicht<br />
auszumalen.<br />
Das Glück im Unglück poltert plötzlich in Form eines<br />
Geländewagens heran. Wir können es kaum fassen, in<br />
dieser Gegend auf eine deutsche Familie treffen.<br />
101
Für Peter, Renate und die Kinder sind wir ebenfalls keine<br />
alltägliche Erscheinung, sie nehmen uns daher einfach mit.<br />
Wir atmen auf, denn nun brauchen wir die kommende<br />
Nacht nicht im Busch verbringen, somit werden wir den<br />
Löwen heute nicht zur Verfügung stehen.<br />
Wir erreichen eine Stadt mit einer eingezäunten Bungalowsiedlung.<br />
Da es hier komfortabler zugeht als in den Dörfern<br />
im Busch, werden wir bei den irischen Bekannten zum<br />
Duschen abgeliefert, unsere Lebensgeister kehren beim<br />
anschließenden Dinner schnell wieder zurück.<br />
Gegen Mitternacht brechen wir zu Peters Hospital auf.<br />
Wir rasen hinter dem Scheinwerferkegel her, bis wir<br />
zerrüttet unser Ziel erreichen. Das Haus steht abseits im<br />
Dunkeln.<br />
Peter beleuchtet mit seiner Taschenlampe den Weg und<br />
flucht: „Verdammt noch mal - diese Biester.<br />
Rührt euch bloß nicht vom Fleck!“<br />
<strong>Die</strong> Kinder kennen dass schon, ihr Daddy deutet mit dem<br />
Spaten zur Erde, wo die Puffotter liegt.<br />
Sie ist fast einen Meter lang, extrem giftig und vor allem<br />
deshalb gefährlich, weil sie nicht wie ihre Artgenossen den<br />
Rückzug antritt, wenn sie sich bedroht fühlt. Kommt man<br />
ihr zu nahe, gibt sie ein tiefes Zischen von sich und<br />
schnappt zu. Bevor sie den leisesten Puff ausstößt, ist sie<br />
fachgerecht in Stücke gehackt und aus dem Weg geräumt<br />
worden.<br />
Das Hospital in Kemondo existiert seit 70 Jahren, es wird<br />
von der Diözese in Würzburg finanziell unterstützt. Eine<br />
ärztliche Behandlung ist hier im Gegensatz zu den staatlichen<br />
Einrichtungen zwar kostenpflichtig, aber die Leute<br />
bevorzugen die bessere Behandlung in solchen Missions-<br />
Krankenhäusern.<br />
Im Hospital ist die Atmosphäre familiär.<br />
102
<strong>Die</strong> Kranken werden von ihren Verwandten mit dem<br />
Nötigsten versorgt, das Essen wird auf einem Holzfeuer in<br />
der Gemeinschaftsküche zubereitet. Für die Angehörigen<br />
der Patienten sind einige Wohnplätze vorhanden, so dass<br />
hier mit wenig Personal viel erreicht werden kann. Es gibt<br />
eine Leprastation mit zwei akuten Fällen, eine Tuberkuloseabteilung,<br />
einen Röntgenapparat sowie einen kleinen, aber<br />
gut ausgestatteten Operationsraum.<br />
Und es gibt die HIV-Abteilung, weil der Aids Virus zum<br />
Hauptkiller in Ostafrika geworden ist. In manchen Orten<br />
sind bis zu 40% der Bevölkerung infiziert.<br />
Ausländische Ärzte sind schon deshalb kaum hierher zu<br />
bewegen. Peter ist zwar der Chef, aber im Hospital ist er<br />
gleichzeitig Mädchen für alles. Als Chirurg muss er sich<br />
zudem um viele andere Belange kümmern. Seit einigen<br />
Wochen betreibt er eine neue Solaranlage für die<br />
Haustechnik.<br />
In letzter Zeit ist er sehr nachdenklich geworden. Tag für<br />
Tag hält er beim Operieren das Skalpell in der Hand, dabei<br />
fließt natürlich auch infiziertes Blut. Der kleinste Kratzer<br />
kann für ihn bedeuten, dass er sich zu den „Verlorenen“<br />
zählen muss. Bisher konnte er mit dem Risiko umgehen,<br />
aber wegen der sich rasant abzeichnenden Entwicklung<br />
möchte er bald wie möglichst Tansania verlassen.<br />
Der Besuch der Aidsstation führt uns das entsetzliche<br />
Elend vor Augen. <strong>Die</strong> Kranken liegen auf einfachen Metallbetten<br />
in einem schlichten Raum. In einem Land, wo<br />
Medikamente für die meisten Menschen unerschwinglich<br />
sind, ist das Kreuz an der fahlen Wand oft der einzige<br />
Trost.<br />
Im Hof begegnen wir einem Rollstuhlfahrer, auch er ist<br />
ein bedauerlicher Fall. Während der Arbeit im Zuckerrohrfeld<br />
ist er unter die Messer einer Erntemaschine<br />
geraten. Dabei wurde ihm ein Arm abgetrennt und das<br />
linke Bein zerquetscht.<br />
103
Inzwischen ist der Arm wieder mit Erfolg angenäht<br />
worden, doch das Bein verursacht immer noch Sorgenfalten<br />
auf Peters Stirn.<br />
„Hallo Doktor, sieh mal, meine Finger lassen sich<br />
bewegen!“ - Der Verletzte ringt sich ein schmerzvolles<br />
Lächeln ab.<br />
„Mein Bein macht auch Fortschritte, stimmt´s Doktor?“<br />
<strong>Die</strong> Stimme des Jungen klingt unsicher.<br />
Peter tätschelt seine Schulter, die bittere Wahrheit gesteht<br />
er jedoch nur uns: „Das Bein ist von einer Entzündung des<br />
Knochenmarks sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Um<br />
das Leben des Jungen zu retten, werde ich das Bein in den<br />
nächsten Tagen amputieren müssen.“<br />
Was es für einen Menschen in Afrika bedeutet, mit nur<br />
einem Bein im Leben zu stehen, steht auf einem ganz<br />
anderen Blatt geschrieben.<br />
Und dann ist da auch noch das Schicksal des vier Monate<br />
alten Babys, dessen Mutter bei der Geburt gestorben ist.<br />
Der Vater ist nicht in der Lage, alleine für das Kind zu<br />
sorgen, geschweige denn fünfzig Mark für die dringend<br />
erforderliche Fußbehandlung aufzubringen. Gäbe es nicht<br />
Peter und Renate, wäre das Kind schon als Baby zum<br />
Krüppel verurteilt worden. Im Moment wird die<br />
Deformation der Knochen mit Gipsverbänden behandelt.<br />
Für das Kind ist vorerst bestens gesorgt, aber wie die<br />
Zukunft aussieht steht in den Sternen. <strong>Die</strong> Waisenhäuser<br />
entlassen die Kinder meist schon mit drei Jahren in die<br />
Familien der Dörfer, ohne sich weiter um deren Schicksal<br />
zu kümmern. <strong>Die</strong> Waisenbabys sind anfangs vollkommen<br />
auf die Hilfe solcher Häuser angewiesen, da die Menschen<br />
im Dorf die Babys unter den herrschenden Bedingungen<br />
nicht groß ziehen können.<br />
Es mangelt hier an fast allem und Milch für die Kinder ist<br />
viel zu teuer.<br />
104
<strong>Die</strong> Unkenntnis um die einfachsten Dinge bei der Hygiene<br />
und der Ernährung führt für die Kleinsten schnell in die<br />
Katastrophe.<br />
Uns Europäern fällt es schwer diese Situation zu begreifen.<br />
Es ist kaum zu glauben, dass in den mehr oder weniger<br />
regendichten Lehmhütten bis zu zehn Leute hausen sollen.<br />
Auch wenn sie mit Gras ausgelegt wurden, sind Sandflöhe<br />
und Ratten allgegenwärtige Plagegeister.<br />
Gekocht wird im Freien an einer überdachten Feuerstelle<br />
neben dem Garten. Das kleinste Kind auf den Rücken<br />
gebunden, versorgen die armen Frauen ihre Familien. Sie<br />
bestellen das Feld und schleppen Wasser aus den Tümpeln<br />
der Umgebung heran. Unter Umständen gibt es noch ältere<br />
Angehörige zu pflegen, während die Männer sich oft anderweitig<br />
betätigen. So Mancher verdient ein wenig Geld, dass<br />
er gleich wieder für Alkohol ausgibt. Andere lassen sich<br />
gleich tagelang nicht zu Hause blicken und wenn sie nach<br />
Hause kommen besteht für die Frauen die Gefahr erneut<br />
Schwanger zu werden oder Aids zu bekommen.<br />
So in etwa ergeht es Jenny, die wir abends in ihrer Hütte<br />
besuchen. Gemeinsam mit ihrer Schwester hat sie einige<br />
Mäuler zu stopfen. <strong>Die</strong> bemerkenswerte Frau gesteht uns,<br />
darüber froh zu sein, dass sich ihr Mann wieder einmal in<br />
Luft aufgelöst hat. Jenny hilft sich so gut es geht aus der<br />
Misere, indem sie sich mit der Nähmaschine ein wenig<br />
Geld dazu verdient.<br />
Unsere Stunden in Kemondo sind gezählt, Peter hat mir<br />
für die Weiterreise etwas Geld geborgt, so dass wir die<br />
Nachtfähre von Bukoba über den Victoriasee nach Mwanza<br />
nehmen können. Wir sind für die Hilfe sehr dankbar und<br />
wünschen Ihm und seiner Familie alles Gute.<br />
Im Hafen herrscht Gedränge, vor der Ticketausgabe balgen<br />
sich die Leute. Wieder einmal haben wir Glück, ein hilfsbereiter<br />
Mann besorgt uns über seine guten Beziehungen<br />
die nötigen Fahrscheine.<br />
105
Der alte Kahn ist wirkt stark mitgekommen, mit Sicherheit<br />
war er schon in Schuss. In den letzten Jahren sind einige<br />
Exemplare dieser Flotte samt Mann und Maus in den<br />
Tiefen des Victoriasees versunken.<br />
Um uns tobt ein Chaos, die Kletterei über unseren Köpfen<br />
geht mir auf die Nerven. Wir sitzen auf dem Deck und<br />
hoffen, dass wir keinen Schiffbruch erleiden.<br />
Nach kurzer Zeit ist der Getränkevorrat an Bord erschöpft,<br />
sogar das Wasser ist ausverkauft. Unter Deck treiben einige<br />
Damen in den Kabinen ihr Unwesen. Nicht zu überhören<br />
ist, dass sie dabei viel geschäftstüchtiger sind, als der<br />
Barkeeper der auf dem Trockenen sitzt.<br />
Der Wind bläst lau durch eine stockfinstere Nacht.<br />
Nach Mitternacht wird es still an Bord, nur die Anopheles<br />
Mücken sind noch aktiv, sie stechen überwiegend in der<br />
Nacht. <strong>Die</strong> weibliche Mücke ist Trägerin der Malaria<br />
Parasiten, die sie in den menschlichen Körper überträgt,<br />
während sie sich von dessen Blut ernährt, das sie zur<br />
Entwicklung ihrer Eier braucht. An der Art, wie sie den<br />
Hinterleib in die Höhe reckt, ist sie leicht zu erkennen. <strong>Die</strong><br />
gefährlichsten Wesen des Kontinentes verursachen in<br />
Afrika mehr Todesfälle als jedes andere Tier. Ich erschlage<br />
einige dieser Biester und versuche zu einzuschlafen. Erst als<br />
es kühler wird, öffne ich die Augen und erblicke am<br />
Südufer des Victoria-Sees die Lichter von Mwanza.<br />
Mit einer Fläche von fast einer Million Quadratkilometern,<br />
ist Tansania das größte Land Ostafrikas. <strong>Die</strong> Landschaft<br />
beeindruckt zunächst mit Felsformationen, die aussehen<br />
als hätte sie jemand aufeinander gestapelt. Dahinter breitet<br />
sich die Hochebene der Dornensavanne aus. <strong>Die</strong><br />
Lehmpiste verlangt uns einiges ab, die unzähligen Schlaglöcher<br />
sind nur im Dauerslalom zu bewältigen. Zeitweise<br />
bevorzugen wir die kleinen Parallelwege neben der Piste,<br />
weil diese besser für Zweiräder befahrbar sind.<br />
106
Vor Rundere gilt es ein Sumpfgelände zu durchqueren, zur<br />
Schlammschlacht zwitschert eine bunte Vogelwelt.<br />
Wir haben alle Hände voll zu tun, einem festgefahrenen<br />
Laster können wir beim besten Willen nicht helfen.<br />
Zu allem Übel zieht eine Gewitterwolke über uns hinweg.<br />
In Lehm gebadet bewegen wir uns später zwischen<br />
Shinyanga und Igunga durch die brutale Hitze. <strong>Die</strong> spitzen<br />
Dornen am Boden treiben mich an den Rand des Wahnsinns.<br />
Laufend stehen wir auf platten Reifen in der Savanne<br />
und reparieren die zerstochenen Schläuche.<br />
Das Angebot auf dem Markt in Nzega ist äußerst mager.<br />
<strong>Die</strong> Marmelade ist unerschwinglich und der Trockenfisch<br />
riecht nach Hundefutter. Schließlich können wir bei einem<br />
Händler eine Milchpackung zum gerechten Preis erstehen.<br />
Der freundliche Mann lebte in den siebziger Jahren in der<br />
BRD. Es ist erstaunlich, dass er noch immer einige<br />
Brocken unserer Sprache auf Lager hat.<br />
Von ihm lassen wir uns die Geschichte Deutsch-Ostafrikas<br />
erzählen: <strong>Die</strong> Engländer und Franzosen hatten Afrika<br />
weitgehend unter sich aufgeteilt, nur ein paar Flecken<br />
waren noch übrig geblieben. Bis vor Hundert Jahren gab es<br />
in Tansania noch herrenloses Land. Da die deutsche<br />
Nation bei der Verteilung der Erde mehr oder weniger leer<br />
ausgegangen war, wollte man es sich hier holen. So zog ein<br />
gewisser Peters von Dorf zu Dorf und handelte sich gegen<br />
Schnaps und anderen Waren die Hoheitsrechte ein.<br />
Nachdem Sansibar im Austausch gegen Helgoland an die<br />
Engländer abgetreten worden war, übernahm das Deutsche<br />
Reich im Jahre 1891 die Herrschaft über dieses Deutsch-<br />
Ostafrika. Doch ganz ohne Widerstand und Kämpfe ging<br />
es dabei natürlich nicht ab. Der Stamm der Hehe erhob<br />
sich gegen Peters. Danach hatten die Deutschen jahrelang<br />
gegen die von Häuptling Mkwawa angeführten Afrikaner<br />
zu kämpfen und sie taten es mit großer Brutalität.<br />
107
Als Mkwawa 1898 endgültig erlag, schickte man seinen<br />
abgeschlagenen Kopf als Zeichen des Triumphes nach<br />
Deutschland.<br />
Bei Ausbruch des ersten Weltkrieges lebten in Deutsch-<br />
Ostafrika neben den knapp acht Millionen Afrikanern<br />
weniger als 6000 Europäer. Mit dem Ende des Krieges<br />
musste dann Deutschland sämtliche Kolonien abtreten.<br />
Der letzte Februartag ist angebrochen. Auf beiden Seiten<br />
der Piste gedeihen prächtige Sträucher, die sich mit ihren<br />
langen Stacheln Respekt verschaffen. Wie gewohnt zischt<br />
es aus meinem Reifen während Suzi Schmerz gepeinigt<br />
stöhnt, da ihr ein Insekt in den Rücken gestochen hat. Ich<br />
ziehe den triefenden Stachel aus der Haut und verarzte die<br />
angeschwollene Stelle. Irgendwann fragen wir uns im<br />
Schutze eines Baobab-Baumes, wie wir mit dem<br />
Wolkenbruch und den Windböen klar kommen sollen. Im<br />
Nu hat sich die Straße in reinen Schlamm verwandelt. Auf<br />
der nächsten Anhöhe blubbert wieder Luft aus meinem<br />
Reifen. Frustriert halte ich auf einige Lehmhütten zu,<br />
Kinder lotsen uns zu ihrer Behausung. Besudelt wie wir<br />
daher kommen, bleiben wir aber besser draußen stehen.<br />
Sobald die Sonne untergegangen ist, verschwinden die<br />
Eingeborenen in ihren Hütten. <strong>Die</strong> Angst vor der Dunkelheit<br />
ist hierzulande nicht ganz unbegründet, denn es ist die<br />
Zeit der Jäger und Räuber. <strong>Die</strong> Spuren sind mir nicht<br />
entgangen, auch wenn ich bisher noch keine Raubkatze zu<br />
Gesicht bekommen habe. Bis Singida liegen noch einige<br />
Kilometer vor uns, am Himmel steht der volle Mond. Seine<br />
Leuchtkraft kommt uns mehr als gelegen. Wenigstens<br />
tappen wir so nicht völlig im Dunkeln. Zu Fuß erscheint<br />
mir die Einsamkeit bedrohlich, ich konzentriere mich auf<br />
den Weg und balanciere um die Tümpel, in denen sich der<br />
Mondschein spiegelt. Ich gebe mir dabei große Mühe, nicht<br />
auf eine Schlange zu treten.<br />
108
<strong>Die</strong> unsicheren Schritte verhallen in der Stille, ein ungutes<br />
Gefühl beschleicht mich. Mein Herz pocht in der Brust als<br />
wolle es fliehen. <strong>Die</strong> Beklemmung schnürt mir die Kehle<br />
zu, ich weiß dass uns jetzt mit Panik am Wenigsten<br />
geholfen ist.<br />
Es ist gegen Mitternacht, als uns ein Lichtstrahl streift.<br />
Durch das Gelände klappert ein Fahrzeug. Wir sind nicht<br />
sicher, was zu tun ist und überlegen, ob es nicht besser ist<br />
in Deckung zu gehen. Dann entscheiden wir uns zur<br />
Kontaktaufnahme mittels Taschenlampe. Ein Lastwagen<br />
mit Anhänger wackelt langsam heran und bleibt stehen.<br />
Weiße Augäpfel blicken überrascht auf uns herunter bis die<br />
Türen geöffnet werden. <strong>Die</strong> beiden Fahrer aus Somalia<br />
sprechen nur ein gebrochenes Englisch, erkennen aber<br />
sofort den Ernst der Lage. Sie kennen die Gefahren der<br />
Wildnis, manch einer der nur mal eben zum Pinkeln in den<br />
Büschen verschwand, wurde nie wieder gesehen. Im<br />
Fahrzeug fühlen wir uns sicher. Ich richte mich auf dem<br />
offenen Anhänger ein, Suzanne kommt vorne bei Rashid<br />
und Farah unter. Wir bewegen uns nur im Schritttempo<br />
voran. <strong>Die</strong> Fahrspur ist mit Vorsicht zu genießen, zu leicht<br />
kann man in Abgründe versinken.<br />
Der Untergrund macht sich mit der Zeit unangenehm<br />
bemerkbar. Den Stößen der Gesteinsbrocken folgt eine<br />
zermürbende Rüttelei im Minutentakt, wobei wir mal in der<br />
einen, mal in der anderen Lage durch eine gespenstische<br />
Landschaft poltern.<br />
<strong>Die</strong> Bruchbuden eines verlassenen Dorfes schweigen sich<br />
hartnäckig aus, es herrscht Geisterstunde. <strong>Die</strong>ses Nest wäre<br />
eine herbe Enttäuschung geworden, hätten wir den Weg<br />
bis hierher überstanden. Müde rumpeln wir über eine Piste,<br />
die weiterhin bescheiden bleibt. Ich erkenne einen umgestürzten<br />
Lastwagen, dessen Frontscheibe in unzählige<br />
Splitter zertrümmert ist. <strong>Die</strong> verschreckte Besatzung sitzt<br />
am Lagerfeuer daneben.<br />
109
Sie berichten uns von einem Überfall, bei dem durch Steinattacken<br />
das Fenster zerstört wurde. Von der Landung im<br />
Graben bis zur Ausplünderung soll die gesamte Aktion nur<br />
wenige Minuten gedauert haben. Derartige Zwischenfälle<br />
nehmen oft ein böses Ende, die Männer raten uns daher<br />
zur größten Vorsicht.<br />
Wieder mache ich es mir wieder auf den staubigen Säcken<br />
bequem, später verliere mich ganz und gar in einem<br />
phantastischen Sternenhimmel.<br />
Ein harter Schlag holt mich auf den Boden der Tatsachen<br />
zurück – um Haaresbreite verfehlt mich ein grober Stein<br />
und kracht gegen das Fahrzeugblech. Wie ein Blitz klettert<br />
Farah zu mir herüber um Licht ins Dunkel zu bringen.<br />
„Hast du was abbekommen, bist du in Ordnung?“<br />
Im Gebüsch bleibt es still, weit und breit rührt sich absolut<br />
nichts. Doch das ist jetzt völlig egal, Rashid beginnt Kopf<br />
und Kragen zu riskieren um nicht in die Hände von<br />
Ganoven zu fallen. Er verlangt seinem Motor das Letzte<br />
ab. Räder drehen durch, Erde spritzt durch die Luft.<br />
Damit ich nicht verloren gehe, kralle ich mich so fest wie<br />
möglich an den Jutesäcken fest.<br />
Der Höllentrip ist am Ortseingang von Singida beendet.<br />
<strong>Die</strong> Stadt ist für unliebsame Überraschungen in der Nacht<br />
bekannt, daher ziehen wir es vor bis zum Tagesanbruch vor<br />
ihren Toren abzuwarten.<br />
Am folgenden Tag unternehmen wir einen weiteren<br />
Schritt in die Richtung der Zivilisation. <strong>Die</strong> folgende gut<br />
200 Kilometer lange Piste bis Dodoma ist als Straße der<br />
Gesetzlosen bei den Truckern berüchtigt. <strong>Die</strong> Mitfahrgelegenheit<br />
auf einem Futtertransporter kommt uns gerade<br />
recht, nur zu gerne quetschen wir uns in den Schaumstoff<br />
zwischen Fahrer und Kompagnon. Auch wenn uns die<br />
marode Technik immer wieder zum Aufenthalt zwingt,<br />
lassen wir uns bis Manyoni von der schönen Landschaft<br />
aus Felsformationen und Buschland beeindrucken.<br />
110
Unablässig glimmen zwischen den wulstigen Lippen der<br />
Fahrer die Zigaretten Marke Sportsmann. Ständig rutscht<br />
die Kupplung und aus dem lecken Tank tropft der Sprit.<br />
An einigen Stellen droht der Anhänger beinahe umzukippen.<br />
Das Sitzpolster zeigt keine Wirkung mehr, ich<br />
spüre alle Knochen.<br />
In Manyoni werden wir zu Pilaw mit Bohnen einladen -<br />
wegen einer Reifenpanne müssen wir bei Kilimatinde<br />
anhalten. Es folgt harte Arbeit unter den schlechtesten<br />
Bedingungen. Mit dem Wagenheber und einem Vorschlaghammer<br />
gehen wir gewaltsam ans Werk.<br />
Stunden später rollen wir auf dem frischen Asphalt von<br />
Dodoma ein. In der zukünftigen Hauptstadt Tansanias ist<br />
es bereits Dunkel geworden, als wir das Rasthaus ansteuern.<br />
<strong>Die</strong> Anlage ist gut bewacht, schon beim Näherkommen<br />
werden wir von einem betagten Krieger mit Pfeil und<br />
Bogen aufgehalten. Erst als sich sicher ist, dass wir keine<br />
Bedrohung für seine Umwelt darstellen, lässt er uns ziehen.<br />
Bereits 1973 wurde beschlossen, die Hauptstadt Daressalam<br />
aufzugeben. Im Landesinneren sollte in zentraler<br />
und vor allem klimatisch günstiger Lage eine neue<br />
Hauptstadt errichten werden.<br />
<strong>Die</strong> Verlegung sollte innerhalb von zehn Jahren erfolgen.<br />
So hat der Premierminister seine Residenz inzwischen hier<br />
eingerichtet, aber nach wie vor amtiert er die meiste Zeit in<br />
Daressalam. Wie es im Augenblick aussieht, wird wohl erst<br />
im nächsten Jahrhundert umgezogen werden.<br />
In Afrika ist eben einiges anders, man hat viel Zeit.<br />
Mit einem guten Fahrgefühl schweben wir durch ein<br />
schönes Hochland aus Savanne und Buschland hinunter<br />
zur Küste.<br />
An den Südosthängen der Berge gedeiht der Nebelwald.<br />
Wir vollenden diese Etappe bei Gairo, einem Ort der nach<br />
Ansicht der Einheimischen in einer Kältezone liegt.<br />
111
Das bedeutet, dass die Thermometer Nachts schon mal auf<br />
unter 20 Grad Celsius abfallen können. Bei den heißblütigen<br />
Afrikanern führen solche Temperaturen schnell zu<br />
Zähnegeklapper.<br />
<strong>Die</strong> Route über Morogoro in Richtung Daressalam führt<br />
durch abwechslungsreiche Gebiete. <strong>Die</strong> Gesichter der<br />
Berge variieren zwischen schroffen Granitkuppen und<br />
dunklen Flanken die von mattem Grün durchsetzt werden.<br />
Wir begegnen hier zum ersten Mal den Massais.<br />
<strong>Die</strong> Viehzucht liegt hauptsächlich in den Händen dieses<br />
außergewöhnlichen Stammes. Sie sind eine kleine aufsässige<br />
Minderheit, die die Gesetze des Staates nicht anerkennen<br />
wollen, da sie ihre eigenen haben. Sie gelten nach wie vor<br />
als nicht integrierbar. Der junge Murani zieht mit seinen<br />
Leuten und den Kühen als Nomaden durch das Land.<br />
Stolz und unbeugsam halten sie, wie die meisten Massai an<br />
ihrer traditionellen Lebensweise fest. Sie haben gelernt mit<br />
den Touristen und deren Jagdgeräten um zu gehen. Weil sie<br />
inzwischen wissen wie man einen Photoapparat bedient,<br />
lichten wir uns gegenseitig ab.<br />
Es ist schade dass wir ihre Sprache nicht verstehen, so<br />
bleiben viele Fragen offen. <strong>Die</strong> Massai sind nicht nur als<br />
Hirten, sondern auch als Krieger berüchtigt. <strong>Die</strong> alte<br />
Mannbarkeitssitte, einen Löwen im Zweikampf zu erlegen,<br />
wird heutzutage weit weniger praktiziert. Einerseits leben<br />
die wilden Tiere in den Parks relativ gut geschützt,<br />
andererseits gibt es weit ungefährlichere Erwerbsquellen<br />
für die Massai. Ihre Tradition können sie gerade wegen der<br />
Touristen bewahren, denn die Reisenden sind immer auf<br />
der Fotojagd nach urtümlichen Kriegern in bunten<br />
Tüchern.<br />
Vier Tage später holt uns die Zivilisation endgültig ein.<br />
Von einer Anhöhe ist der Indischen Ozean zu sehen, der<br />
wunderbare Blick auf Daressalaam ist nur von kurzer<br />
Dauer.<br />
112
<strong>Die</strong> verrückten Busfahrer versuchen uns von der Strasse zu<br />
drängen. Unsere Annäherung an die Stadt erfolgt im<br />
Tiefsandstreifen neben der Piste, weil wir im Fluss aus<br />
mobilem Schrott keinen Platz mehr finden. In den<br />
endlosen Wellblechsiedlungen am Stadtrand haust die<br />
Armut, im Innern beherbergt Daressalaam verschiedene<br />
Bauepochen und Stile.<br />
Am folgenden Tag ist die Kanalisation durch Wolkenbrüche<br />
schnell überfordert, so dass die Straßen bald im<br />
Dreck versinken. Wir waten durch die lauwarme Brühe<br />
hinunter zum Ozean. Am Hafentor erläutern wir einem<br />
Offizier, dass wir das Land gerne verlassen würden und<br />
deshalb ein geeignetes Schiff suchen. Er verweist uns auf<br />
ein großes Gebäude, wo uns geraten wird den schnellen<br />
Luftweg zu nehmen.<br />
Wir erkundigen uns nach Flügen in Richtung Indien, für<br />
360 Dollar ist Bombay zu haben. <strong>Die</strong> Sache hat einen<br />
Haken, denn keine Agentur ist bereit unsere Eurocard zu<br />
akzeptieren. Unsere letzten Dollars helfen nicht weiter und<br />
weil ohne Moos auch hier nicht viel los ist, müssen wir den<br />
Kauf vorerst vergessen. Fast mittellos und mit einem<br />
abgelaufenen Visum in der Tasche kommen wir nicht von<br />
der Stelle.<br />
Wenn sich nicht bald eine Bank unser erbarmt, sehe ich<br />
schwarz. Erst im Immigration-Office hellt sich meine<br />
Stimmung auf, weil wir dort wenigstens eine Aufenthaltsverlängerung<br />
bekommen. Dennoch führt kein Weg an<br />
Kenia vorbei, weil es nur dort frisches Bargeld für uns gibt.<br />
Mombasa oder Nairobi, das ist jetzt die Frage.<br />
Am Bahnhof hilft der Fahrplan weiter - die Züge bis Tanga<br />
fahren nach Mitternacht los.<br />
Bis Moshi am Kilimandscharo braucht die Bahn nur 16<br />
Stunden, das gefällt uns gut.<br />
113
Am Fahrkartenschalter herrscht eine unvorstellbare Hektik.<br />
Einer bucht lautstark einen Sitzplatz, ein anderer lamentiert<br />
in vorderster Front wegen seines Wechselgeldes herum. Als<br />
ich an der Reihe bin, schaut der Kartenverkäufer ratlos. Da<br />
die zweite Klasse so gut wie ausgebucht ist, preist er mir<br />
seine erste Klasse an. Beim Hinblättern der Scheine wird<br />
der doppelte Fahrpreis fällig, dafür nehmen sich die hilfsbereiten<br />
Eisenbahner aber sofort unserer Räder an.<br />
Ich hege meine Bedenken, zumal der Gepäckwagen nur<br />
versiegelt und nicht verschlossen wird. <strong>Die</strong> zertrümmerten<br />
Fensterscheiben und die Einschusslöcher an den Wagen,<br />
lassen kein Vertrauen in das Unternehmen wachsen.<br />
Für 16 Uhr ist die Abfahrt geplant. Eine Stunde lang rührt<br />
sich fast nichts, nur das Gerücht einer Verspätung dreht die<br />
Bahnsteigrunde. Gegen 18 Uhr trifft der Zug aus Mwanza<br />
ein und um 19 Uhr erscheint endlich der Zug nach Moshi.<br />
Bis dieser weiterfährt, dürfen wir uns weitere sechzig<br />
Minuten gedulden, dann erfolgt der Sturm auf den spärlich<br />
beleuchteten Zug. Wir tasten uns in ein antikes Abteil vor,<br />
wo uns die Pritschenfüllung aus den Ledernähten entgegen<br />
springt.<br />
Edle Hölzer an der Decke und den Wänden sorgen für<br />
gediegene Atmosphäre im Stile der Kolonialzeit. Es gibt<br />
einen Schrank und ein aufklappbares Waschbecken, dessen<br />
Deckel beim Waschen festzuhalten ist.<br />
Ja, das ist die erste Klasse, so sieht der reine Luxus aus.<br />
Abgesehen davon, dass dem Wasserhahn kein einziger<br />
Tropfen mehr zu entlocken ist und der Ventilator für<br />
immer streikt.<br />
Über der Savanne geht die Sonne auf, ein winziger<br />
Bahnhof stellt den Abzweig zur Küste nach Tanga dar.<br />
<strong>Die</strong> Landschaft wird jetzt zunehmend staubiger.<br />
<strong>Die</strong> Straße die durch diesen verdörrten Landstrich führt,<br />
ist nur ein unscheinbarer Pfad.<br />
114
<strong>Die</strong> Dörfer leben gut von der Eisenbahnstrecke, unsere<br />
Ankunft in den Bahnhöfen sorgt jedes Mal für Aufregung.<br />
Kleine wie große Leute eilen mit ihren Lebensmitteln zu<br />
den Gleisen, um mit den Reisenden ins Geschäft zu<br />
kommen.<br />
Das Usambara Gebirge zieht an uns vorbei, seine höchsten<br />
Gipfel sind mit Wolken behangen, unmittelbar dahinter<br />
erstreckt sich eine weite Ebene. Zu Füßen des<br />
Kilimandscharo packen wir unseren Krempel und springen<br />
aus dem Zug.<br />
Der Berg ist mit fast 6000 Metern nicht nur der höchste<br />
Afrikas, sondern zugleich der einzige mit dieser Höhe, der<br />
von normalen Touristen ohne besondere Erfahrung und<br />
Ausrüstung bestiegen werden kann.<br />
Das Moshi ein Zentrum für die Bergsteiger ist, wird mir<br />
auf dem Bahnsteig bewusst, wo wir die ersten hartnäckigen<br />
Kletterangebote bekommen.<br />
Für 200 Dollar will man uns hinauf zum Gipfel führen.<br />
Nein, nein und nochmals nein - mir genügt der Anblick des<br />
Riesen, auch wenn sein schneegekröntes Haupt derzeit in<br />
den Wolken steckt.<br />
Für die Massai ist der Kilimandscharo der leuchtende Berg,<br />
für die Karawanenleute von der Küste war er der Berg des<br />
bösen Geistes.<br />
Nur die Tschagga, die an seinen Hängen leben und ihm<br />
dabei so nahe sind, dass sie nie das ganze Bergmassiv<br />
sehen, haben keinen Namen für ihn.<br />
<strong>Die</strong> Bergmasse, die sich erst am Abend vollständig aus der<br />
umgebenden Ebene erhebt, bietet ein phantastisches Bild<br />
und die vereiste Spitze des Kili wirkt im Licht der Abendsonne<br />
gewaltig.<br />
Ein Einheimischer wendet sich mit leuchtenden Augen an<br />
uns: „Mountains never meet, but people do! “<br />
115
Nach seiner Überzeugung sind die Berge einsame Gesellen,<br />
weil sie zur Bewegungslosigkeit verdammt sind.<br />
Irgendwie hat er Recht.<br />
Zu genüge haben wir mittlerweile selbst erfahren was es<br />
heißt, ständig Unterwegs zu sein.<br />
Seit Monaten treiben wir uns in der Weltgeschichte herum.<br />
Vielen Menschen sind wir dabei begegnet, wie oft haben<br />
wir beim Plaudern mit ihnen die Zeit vergessen?<br />
Unzählige Gesichter sind mir in Erinnerung geblieben,<br />
besonders solche die es gut mit uns meinten.<br />
Ich muss an die zahnlose Bäuerin in der Puszta denken, auf<br />
deren Hof wir vorzüglich bewirtet wurden oder an die<br />
Kamelkarawane der Libyer, denen wir im Süden Ungarns<br />
begegneten.<br />
Unvergessen bleibt auch die Gastfreundschaft der<br />
Jugoslawen, die gerne mit ihrem Slibowitz auf uns angestoßen<br />
haben.<br />
Der würzige Duft griechischer Pinienwälder, das ruhige<br />
Leben auf den Inseln im Mittelmeer, die stille Weite der<br />
Wüste Nordafrikas sowie der Trubel am ägyptischen Nil.<br />
Alle diese Bilder trage ich in mir - und das ist gut so.<br />
116
Flamingos am Bogoria See<br />
Äquatortaufe in Uganda<br />
117
Auf Tansanias Pisten<br />
118