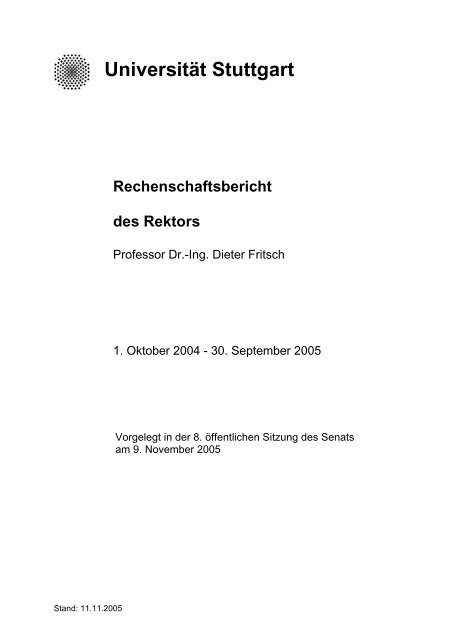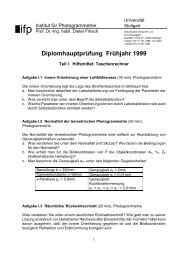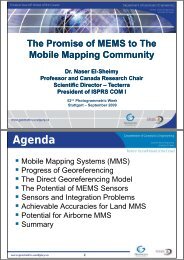Institut für Photogrammetrie - Universität Stuttgart
Institut für Photogrammetrie - Universität Stuttgart
Institut für Photogrammetrie - Universität Stuttgart
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Stand: 11.11.2005<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
Rechenschaftsbericht<br />
des Rektors<br />
Professor Dr.-Ing. Dieter Fritsch<br />
1. Oktober 2004 - 30. September 2005<br />
Vorgelegt in der 8. öffentlichen Sitzung des Senats<br />
am 9. November 2005
1 BERICHT DES REKTORS<br />
Die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> ist weiterhin auf gutem Kurs. Entgegen allen politischen Diskussionen<br />
um Rückbau der staatlichen Verantwortung in vielen Bereichen finanziert<br />
sie sich schon seit vielen Jahren mit mehr als 40 % durch eigene Aktivitäten im Bereich<br />
Forschung und Entwicklung. Nach wie vor ist die <strong>Universität</strong> durch den Solidarpakt<br />
geschützt und kann daher noch bis Ende 2006 von stabilen finanziellen<br />
Rahmenbedingungen ausgehen. Dies konnte im Berichtszeitraum genutzt werden,<br />
um die Konsolidierung des Haushalts erfolgreich zum Abschluss zu bringen.<br />
Ein Hauptaugenmerk der Arbeit des Rektors ist nach wie vor die Mitwirkung bei der<br />
Ausarbeitung von hochschulpolitischen Rahmenvorgaben des Landes. Darüber hinaus<br />
wirkt er in verschiedenen Arbeitsgruppen der Hochschulrektorenkonferenz sowie<br />
der Gruppe der neun großen Technischen <strong>Universität</strong>en (TU 9) mit.<br />
1.1 Hochschulpolitische Entwicklungen<br />
Das neue Landeshochschulgesetz ist zum 01.01.2005 in Kraft getreten. Die in diesem<br />
Gesetz enthaltenen Änderungen in den Leitungsstrukturen zeigen, dass die Gesetzgebung<br />
die Hochschulen und tertiären Ausbildungsstätten wie „Wirtschaftsunternehmen“<br />
sehen möchte. Die <strong>Universität</strong>sleitung (Rektorat) ist gemäß Gesetz repräsentiert<br />
durch einen Vorstand mit Vorstandsvorsitzendem (Rektor) und weiteren<br />
hauptamtlichen und nebenamtlichen Mitgliedern (Prorektoren). Der Kanzler oder die<br />
Kanzlerin stellt an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> das zweite hauptamtliche Mitglied. Ein<br />
weiteres hauptamtliches Mitglied sollte die Fakultät <strong>für</strong> Medizin vertreten, was <strong>für</strong><br />
<strong>Stuttgart</strong> entfällt. Dem Vorstand wird ein Aufsichtsrat zur Seite gestellt, den wir als<br />
<strong>Universität</strong>srat bezeichnen. Dieser steuert alle strategischen Angelegenheiten und<br />
kontrolliert die Amtsführung des Vorstands. Der Senat bleibt als Gremium erhalten,<br />
dieser wurde jedoch in seinen wesentlichen Entscheidungensbereichen stark eingeschränkt.<br />
Die Landesrektorenkonferenz Baden-Württemberg (LRK) mit dem Rektor der niversität<br />
<strong>Stuttgart</strong> als stellvertretendem Vorsitzenden war immer bestrebt, auch den Senat<br />
und die Fakultäten zentral in die Entscheidungsprozesse der <strong>Universität</strong> einzubinden.<br />
Nach Auffassung der baden-württembergischen Rektoren stellt eine <strong>Universität</strong> kein<br />
Unternehmen mit einfachen top-down Strukturen dar, sondern wird von den Fächern,<br />
den Wissenschaftskulturen und ihren Experten gelebt. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen,<br />
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Studierenden sollten<br />
daher in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden, um gemeinsam zur Weiterentwicklung<br />
der <strong>Universität</strong> beizutragen und letztlich die Weichen <strong>für</strong> die Zukunft<br />
der <strong>Universität</strong> zu stellen.<br />
In der Gesamtwertung des neuen Landeshochschulgesetzes ist zu sehen, dass der<br />
Aufsichtsrat bzw. der <strong>Universität</strong>srat und das Rektorat in vielen Dingen gestärkt worden<br />
sind und der Senat und die Fakultäten in den Entscheidungskompetenzen geschwächt<br />
wurden. Die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> hat diese vom Gesetz vorgegebene<br />
Schwächung maßgeblich durch eine neue Grundordnung <strong>für</strong> die <strong>Universität</strong> ausgeglichen.<br />
Nach Meinung des Rektorats sollen und müssen der erweiterte Fakultätsrat<br />
und der Senat stärker in die Entscheidungsprozesse der <strong>Universität</strong> eingebunden<br />
werden. Es bleibt zu hoffen, dass auch das Spannungsfeld zwischen <strong>Universität</strong>srat<br />
2
und Senat durch ein kooperatives Miteinander ausgefüllt wird, zum Wohle der <strong>Universität</strong><br />
<strong>Stuttgart</strong>.<br />
Bezüglich der Habilitation hat das Bundesverfassungsgericht <strong>für</strong> die <strong>Universität</strong>en<br />
bzw. die Länder ein positives Urteil ausgesprochen, so dass nunmehr drei gleichberechtigte<br />
Qualifikationswege zur Professur zur Verfügung stehen: Neben der Juniorprofessur<br />
ist weiterhin die Habilitation ein wichtiger Meilenstein im Karriereweg eines<br />
Wissenschaftlers/in, die beide durch die Berufung aus der Praxis komplementär ergänzt<br />
werden. An der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> sind durch die Umwandlung der C1- und<br />
C2-Stellen insgesamt 64 Juniorprofessuren ausgewiesen. Diese Stellen müssen<br />
jedoch nicht sofort mit Juniorprofessorinnen oder -professoren besetzt werden, sondern<br />
können auch „unterbesetzt“ werden, um auf diese Weise Personalentscheidungen<br />
so zu treffen, die <strong>für</strong> die <strong>Universität</strong> am günstigsten sind.<br />
1.2 Hochschulpolitische Rahmenbedingungen <strong>für</strong> die Weiterentwicklung<br />
der Lehre<br />
Das neue Landeshochschulgesetz setzt ebenfalls. die Rahmenvorgaben des Bolognaprozesses<br />
in Landesrecht um. Hierbei werden die Hochschulen aufgefordert, <strong>für</strong><br />
einen so genannten europäischen Bildungsraum zu sorgen und damit <strong>für</strong> eine Harmonisierung<br />
und <strong>für</strong> eine größere Mobilität der Studierenden sowie der Wissenschaftlerinnen<br />
und Wissenschaftler einzutreten. Um die Hochschulen zu verpflichten,<br />
ihre Studiengänge auf die neuen Bachelor- und Masterabschlüsse umzustellen,<br />
können Zulassungen zu den bestehenden Diplom- und Magisterstudiengängen<br />
längstens bis zum Beginn des Wintersemesters 2009/10 ausgesprochen werden.<br />
Bereits mit Inkrafttreten des LHG ist die Einrichtung neuer Diplom- und Magisterstudiengänge<br />
nicht mehr zulässig.<br />
Die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> begleitet diesen Prozess mit viel Augenmaß. Wir sind der<br />
Meinung, dass der Master das Ziel sein und bleiben muss und dass der Bachelor<br />
sich diesem Ziel unterzuordnen hat. Die Gruppe TU 9, das Konsortium der neun<br />
großen Technischen <strong>Universität</strong>en in Deutschland, hat daher festgehalten,<br />
dass der Bachelor einen Türöffner darstellt, aber der Master das Ziel ist. Während<br />
anderenorts die Kapazitäten der Ausbildung <strong>für</strong> den Bachelor erhöht, <strong>für</strong> den<br />
Master aber deutlich gesenkt werden, hält die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> an dem o. g. Ziel<br />
der TU 9 fest. Denn sollten bald nur noch 30 bis 40 % der Bachelorabsolventen in<br />
den Masterbereich gelangen, werden am Ende nur noch 25 % der heutigen Diplom-<br />
Ingenieure ausgebildet.<br />
Eine solche dramatische Unterversorgung mit Akademikern wäre fatal <strong>für</strong> die deutsche<br />
Wirtschaft, die unverändert mindestens genauso viele Ingenieure wie heute benötigt.<br />
Wir müssen Innovationen stärken, entwickeln und fördern und dies bedingt<br />
hervorragend ausgebildete Ingenieure. Daher dürfen wir uns nicht damit zufrieden<br />
geben, dass die meiste Kapazität irgendwo zu Beginn der tertiären Ausbildung eingesetzt<br />
wird und anschließend <strong>für</strong> den Master nichts mehr übrig bleibt.<br />
3
1.3 Professorenbesoldungsreformgesetz<br />
Seit 01.01.2005 liegt ein neues Gesetz zur Professorenbesoldung vor („W-Besoldung“,<br />
das W kommt von Wissenschaft). Grundgedanke dieses Gesetzes war eine<br />
leistungsbezogene Besoldung <strong>für</strong> Professoren. Dort gibt es drei Stufen:<br />
- W1 <strong>für</strong> die Juniorprofessur,<br />
- W2 vorwiegend <strong>für</strong> die Professuren an Fachhochschulen (außerhalb Baden-<br />
Württembergs aber vermehrt auch an <strong>Universität</strong>en anzutreffen) und<br />
- W3 überwiegend <strong>für</strong> die <strong>Universität</strong>sprofessuren; in Baden-Württemberg werden<br />
in Zukunft alle <strong>Universität</strong>sprofessoren hiernach eingestuft.<br />
Auch hier haben die <strong>Universität</strong>en versucht, über die Hochschulrektorenkonferenz<br />
Einfluss auf dieses Gesetz zu nehmen, jedoch mit wenig Erfolg. Die Besoldungsreform<br />
ist letztlich gegen die Wünsche der Hochschulen in Kraft getreten. Letztlich<br />
erweist sich die neue Besoldung als ein Gesetz, um Geld einzusparen, so dass<br />
man dieses auch als „Gehaltsabsenkungsgesetz“ bezeichnen könnte. Es bereitet<br />
den <strong>Universität</strong>en nun große Schwierigkeiten, gute Kolleginnen und Kollegen aus<br />
der Praxis heraus zu gewinnen. Mittels Gewährung von Zulagen wird versucht, finanzielle<br />
Nachteile auszugleichen, jedoch ist der Rahmen hier<strong>für</strong> sehr knapp. Früher war<br />
es leichter möglich, über Zulagenarten durch das Wissenschaftsministerium attraktive<br />
Angebote zu machen. Der Erhöhung des Vergaberahmes von 10 % zum besseren<br />
Einstieg in die W-Besoldung wurde aufgrund der schlechten finanziellen Rahmenbedingungen<br />
des Landes leider nicht entsprochen.<br />
Heute führt der Rektor gemeinsam mit dem Kanzler die Verhandlungen zur Ausstattung<br />
und zu den Bezügen. Aufgrund der harten finanziellen Rahmenbedingungen<br />
und der befristeten Anstellung bei der Erstberufung stoßen wir jedoch vermehrt an<br />
unsere Grenzen. Zum Beispiel können Zulagen zum W3-Grundgehalt in Höhe von<br />
4.723,61 Euro zwar bis zur gleichen Höhe gewährt werden, diese Zulage ist aber i. d.<br />
R. nur zu 40 % ruhegehaltsfähig. Von daher fällt es uns außerordentlich schwer,<br />
hoch qualifizierte C4-Kollegen nach <strong>Stuttgart</strong> zu berufen. Wir müssen ihnen nun W3<br />
anbieten, womit sie sich von vornherein bereits verschlechtern. Folglich liegt bisher<br />
noch kein Antrag aus der <strong>Universität</strong> vor, dass jemand von C3 oder C4 nach W3 übergeleitet<br />
werden möchte.<br />
1.4 Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder<br />
Die Diskussion um die Förderung von Eliteuniversitäten in Deutschland hatte sich zu<br />
einer Hängepartie entwickelt. Hier hatten sich lange Zeit der Bund und die Länder<br />
infolge der Föderalismusdebatte gegenseitig blockiert. Was keiner mehr <strong>für</strong> möglich<br />
gehalten hätte, wurde jedoch im Juni 2005 durch eine gemeinsame Bund-Länder-<br />
Kommission beschlossen – auch die Finanzierung ist mittlerweile sichergestellt.<br />
Die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder sieht vor, Forschungs-Cluster,<br />
Graduiertenschulen sowie Zukunftsprojekte an den <strong>Universität</strong>en ab Sommer 2006<br />
zu fördern. 1,9 Milliarden Euro sollen, verteilt auf fünf Jahre, zur Verfügung gestellt<br />
werden. Es ist zu vermuten, dass auch eine zweite Förderperiode zur Fortführung<br />
des Programms ausgearbeitet wird.<br />
4
Die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> hat der DFG im Juli 2005 gemeldet, dass fünf Voranträge <strong>für</strong><br />
Exzellenzcluster und zwei Anträge auf Einrichtung von Graduate Schools geplant<br />
sind (s. hierzu auch Kapitel 4.3). Entsprechende Voranträge wurden fristgerecht ausgearbeitet<br />
und der DFG gegen Ende September 2005 übergeben. Ebenso hat sich<br />
die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> entschlossen, einen Antrag in der dritten Säule „Zukunftsprojekte“<br />
zu stellen. Hier geht das Projekt „MOBILIUS“ <strong>für</strong> die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> ins<br />
Rennen. Dieses wurde am 10. Oktober 2005 der DFG als Antragsskizze übergeben.<br />
1.5 Strukturelle Entwicklungen<br />
Die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> konnte im Berichtszeitraum Zielvereinbarungen mit dem<br />
Wissenschaftsministerium abschließen. Zum einen konnte das Zentrum <strong>für</strong> Kultur<br />
und Technikforschung durch einen Zuschuss des MWK ausgebaut werden. Zum anderen<br />
hat der Rektor mit einer universitären Arbeitsgruppe Zielvereinbarungen über<br />
einen Schwerpunkt Systembiologie in Abstimmung mit dem Wissenschaftsministerium<br />
ausgearbeitet., die im September 2005 von Herrn Minister Prof. Frankenberg und<br />
dem Rektor gegengezeichnet wurden. Das Land Baden-Württemberg stellt hier<strong>für</strong><br />
der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> ca. 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Dies ist eine hervorragende<br />
Ausgangsposition, um die Zusammenarbeit der Natur- und Ingenieurwissenschaften<br />
auf dem Gebiet der Systembiologie zu stärken.<br />
Mit der Umsetzung der im Rahmen der „Zukunftsoffensive <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong>“<br />
(ZUS) erarbeiteten Maßnahmen konnte im Berichtszeitraum begonnen werden. Im<br />
letzten Jahr wurden die Studiengänge der Geowissenschaften pünktlich zum 1. Oktober<br />
2004 eingestellt, d. h. in der Geographie, der Geologie, den Technischen Geowissenschaften<br />
und der Geophysik wurden keine neuen Studierenden mehr aufgenommen.<br />
Die Evaluierung der Geisteswissenschaften zur Identifikation der zu streichenden<br />
Professuren war Ende 2004 abgeschlossen (s. hierzu auch Kapitel 2.5).<br />
Hier haben Senat und <strong>Universität</strong>srat mittlerweile abschließende Entscheidungen<br />
gefällt. Die Gesamteinsparungen im Rahmen der Zukunftsoffensive betragen<br />
66,5 Stellen bis zum Jahre 2010 und weit mehr als 100 Stellen bis zum Jahre<br />
2015.<br />
Künftige Strukturentscheidungen hängen verstärkt von gutachterlichen Untersuchungen,<br />
den Evaluationen ab. Die Evaluierungsagentur des Landes Baden-Württemberg<br />
(evalag) beabsichtigt, jeden Studiengang im Lande alle sechs bis acht Jahre zu<br />
evaluieren und damit Hinweise <strong>für</strong> die Rektorate zu geben. Mit ihren Empfehlungen<br />
sollen auch die Mittelflüsse gesteuert werden. Bisher befinden wir uns in der Anfangsphase.<br />
Wir lernen langsam die Evaluations-Prozesse zu verstehen und sind<br />
sehr gespannt darauf, wie das Ganze weiter instrumentalisiert wird. In diesem Jahr<br />
wurden an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> bereits die Studiengänge Betriebswirtschaftslehre,<br />
Verfahrenstechnik, Elektro- und Informationstechnik, INFOTECH, COMMAS, die<br />
Erziehungswissenschaften sowie die Philosophisch-Historische Fakultät mit positiven<br />
Ergebnissen evaluiert.<br />
1.6 <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> 2020<br />
Die Erfahrungen mit der Arbeitsgruppe „Zukunftsoffensive der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
(ZUS)“ haben gezeigt, dass die <strong>Universität</strong> gut beraten ist, ihre eigene Entwicklung in<br />
Autonomie selbst zu steuern, um strukturelle Veränderungen intern zu diskutieren<br />
5
und letztlich auch in Eigenverantwortung zu tragen. Aus diesem Grund hat das Rektorat<br />
dem Senat in seiner Sitzung am 15.12.2004 die Einrichtung einer Arbeitsgruppe<br />
empfohlen, die sich mit der zukünftigen Entwicklung unserer <strong>Universität</strong> auseinandersetzt.<br />
Dabei sollen verschiedene Szenarien entworfen werden, aus denen sich<br />
Missionen und Leitlinien <strong>für</strong> die künftige <strong>Universität</strong>sentwicklung ableiten lassen, die<br />
ab 2010 ff umgesetzt werden könnten.<br />
Folgende Fragen sollten durch die AG beantwortet werden:<br />
– „Mainstream“-Forschungsfelder bzw. Unverzichtbare Kernkompetenzen und<br />
Schwerpunkte in Forschung und Lehre an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong>:<br />
• Forschungsschwerpunkte am Hochtechnologiestandort der Region <strong>Stuttgart</strong><br />
• Integration außeruniversitärer Forschungseinrichtungen<br />
– <strong>Universität</strong> und Gesellschaft:<br />
• Hochschulregion mittlerer Neckarraum als integriertes Modell; Fragestellung:<br />
Inwieweit tragen Stadt, Region und Land zur Entwicklung der <strong>Universität</strong><br />
<strong>Stuttgart</strong> bei? Welche Defizite gibt es? Aufgabe des Campus Stadtmitte?<br />
- Kriterien <strong>für</strong> den internationalen Wettbewerb der weltweit besten <strong>Universität</strong>en (in<br />
ternationalen Rankings, Studentenwohnheime etc.)<br />
• Volluniversität mit internationaler Ausrichtung<br />
• Positionierung der <strong>Universität</strong> gegenüber anderen Hochschuleinrichtungen<br />
durch Wissenschaftsorientierung, qualitative Lehre und breites Bildungsangebot<br />
• Einbeziehung der Bildungspolitik (Bologna-Prozess, Pisa-Studie etc.)<br />
– Ressourcen und Strukturen:<br />
• Festlegung von Kapazitäten (Anzahl der Studierenden, differenziert nach Fächern)<br />
• Finanzierungsmodelle<br />
• Langfristige Visionen und Perspektiven ohne Randbedingungen<br />
Der Senat der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> ist in seiner Sitzung am 23.02.2005 dem Vorschlag<br />
des Rektors gefolgt und hat 10 Vertreter der Mitgliedergruppe Professorinnen<br />
und Professoren und jeweils 1 Vertreter der übrigen Mitgliedergruppen in die Arbeitsgruppe<br />
entsandt. Erste Ergebnisse der Arbeitsgruppe sollen im Wintersemester<br />
2005/06 vorgelegt werden.<br />
Beraterkreis „Hochschulentwicklung 2020“ der baden-württembergischen Landesregierung<br />
Auch die Regierung des Landes Baden-Württemberg hat beschlossen, ein Expertengremium,<br />
bestehend aus Persönlichkeiten der Wirtschaft und der Wissenschaft zur<br />
„Hochschulentwicklung 2020“ einzusetzen, das sich mit folgenden Fragestellungen<br />
zur Hochschullandschaft Baden-Württemberg befassen soll:<br />
1. Qualitativ hochwertige Ausbildung bei wachsender studentischer Nachfrage<br />
2. Umstellung auf das zweistufige Studiensystem Bachelor/Master im Zuge des Bologna-Prozesses<br />
6
3. Vermeidung einer Fachkräftelücke auf dem Arbeitsmarkt bei akademischen Berufen<br />
4. Nachhaltige Rekrutierung hoch qualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchses<br />
5. Gewährleistung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen<br />
6. Sicherstellung einer aufgabengerechten Finanzierung der Hochschulen<br />
1.7 SIMT und GUC<br />
Das <strong>Stuttgart</strong> <strong>Institut</strong>e of Management and Technology (SIMT) ist mittlerweile durch<br />
die Unterstützung der heimischen Wirtschaft auf einem guten Weg. Es konnte im<br />
September 2004 beachtliche 38 MBA-Vollzeitstudierende aus 174 Bewerbungen<br />
auswählen und im September 2005 insgesamt 43 Studierende aus xxx Bewerbungen.<br />
Das SIMT hat die Management Education Programme, die <strong>für</strong> die heimische<br />
Wirtschaft angeboten werden, weiter ausgebaut. Es konnten mehr als 20 Firmen gefunden<br />
werden, die nicht nur Manager-Nachwuchs als Studierende ins SIMT hinein<br />
geben, sondern das SIMT in den nächsten drei Jahren mit einer jährlichen Spende<br />
kräftig fördern werden.<br />
Der akademische Status des SIMT als unabhängige Hochschule war mit dem<br />
31.08.2005 beendet. Die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> ist seither die federführende <strong>Universität</strong><br />
und trägt die alleinige akademische Verantwortung <strong>für</strong> das SIMT, die durch eine Kooperationsvereinbarung<br />
sowie Externen-Prüfungsordnung im Detail zu regeln ist.<br />
Die deutsche <strong>Universität</strong> in Kairo (German University of Cairo, GUC) entwickelt sich<br />
sehr gut. Sie hatte im letzten Jahr neben den mehr als 1.000 ersteingeschriebenen<br />
Studierenden weitere 1.062 Zulassungen aus mehr als 5.000 Bewerbungen.<br />
Im akademischen Jahr 2004/2005 wurden 1.062 Zulassungen aus 5.000 Bewerbungen<br />
ausgesprochen, davon 440 im Bereich Pharmazie, 397 in den Ingenieurwissenschaften<br />
und 225 im Management. Der Durchschnitt der Schulabgänger liegt bei 94<br />
Prozent. Ferner wurden 210 Stipendien vergeben.<br />
An der GUC sind zurzeit 44 % Lehrende aus Deutschland tätig. In der ersten Oktoberwoche<br />
2004 wurden die German Open Days mit großem Erfolg durchgeführt.<br />
Mit dem neuen Jahrgang 2005 sind mittlerweile an der GUC insgesamt 3335<br />
Studierende eingeschrieben – ein beachtlicher Erfolg <strong>für</strong> diese erst zwei jahre<br />
alte Hochschule.<br />
1.8 Rankings<br />
Weiterhin erfreulich sind die Ergebnisse der <strong>Universität</strong> bei den Rankings (oder Ratings)<br />
im Berichtszeitraum. Vor allem die ingenieurwissenschaftlichen Fächer sind<br />
durchgehend in der Spitzengruppe (CHE, Focus), oft sogar an erster Stelle (Spiegel),<br />
platziert. Und dies sowohl bei Rankings, die auf die Leistungen der Lehre abheben,<br />
als auch bei den Ratings zur Forschung.<br />
Über das methodische Vorgehen kann und muss im Einzelfall gestritten werden,<br />
doch ohne Zweifel werden Rankings in der Öffentlichkeit und auch bei den Studierenden<br />
zunehmend wahr genommen.<br />
7
Die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> ist daher weiterhin gut beraten, konstruktiv und aufgeschlossen<br />
auf Rating-Anfragen zu reagieren, auch wenn damit oft ein gewisser<br />
Mehraufwand verbunden ist."<br />
1.9 eLearning – Medida Prix 2005<br />
Die Virtualisierung der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> konnte mit großem Erfolg weiter vorangetrieben<br />
werden. Mittlerweile werden wir vielfach als Musterunversität zitiert. Diese<br />
Entwicklung wird <strong>für</strong> zukünftige Konzepte des Bereiches Lehre und Weiterbildung<br />
eine maßgebliche Rolle spielen. Es werden die <strong>Universität</strong>en in Zukunft erfolgreich<br />
sein können, die sowohl im Bereich des blended learning, d.h. im Zusammenspiel<br />
von Präsenzehre und virtueller Lehre sowie entsprechenden online Weiterbildungsangeboten<br />
die Nase vorn haben.<br />
Der Bereich des eLearning wird daher an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> konsequent ausgebaut.<br />
Die Lehrenden werden bei der Realisierung ihrer eLearning-Projekte im<br />
Lehralltag durch den weiteren Ausbau der technischen Infrastruktur unterstützt. Ferner<br />
wurden in einem universitätsweiten Ausschreibungsverfahren ca. 40 weitere Projekte<br />
zur Erstellung von Selbstlernmaterialien aufgesetzt. Darüber hinaus wird den<br />
Lehrenden mit dem Upload Portal die Möglichkeit gegeben, ihre Vorlesungsaufzeichnungen<br />
mit Lecturnity den Studierenden ohne eigenen technischen Aufwand<br />
zur Verfügung zu stellen. Die Lehrenden werden dabei mit Beratung und Schulungen<br />
begleitet. Nachdem die multimedialen Angebote im Lehralltag zu einer Selbstverständlichkeit<br />
geworden sind, wird an einem Konzept zur Systematisierung des e-<br />
Learning-Angebots in den Studiengängen gearbeitet und die Einführung eines eLabels<br />
geplant.<br />
Besonders ist zu bemerken, dass die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> das universitäre Medienkonzept<br />
bei der Finalrunde des Medida Prix 2005 vertreten hat und da<strong>für</strong><br />
den ersten Preis zuerkannt bekam. (s. hierzu auch Kapitel 6.2)<br />
1.10 Verleihung von Ehrenbürgerwürden<br />
Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> – die höchste Auszeichnung,<br />
die von der <strong>Universität</strong> vergeben werden kann – war zweifelsfrei einer der<br />
Höhepunkte des Berichtszeitraums. Am 26.11.2004 wurde diese Ehrung Frau Suzanne<br />
Mubarak, First Lady der Arabischen Republik Ägypten, zuteil. Am 18.05.2005<br />
wurde Herrn Manfred Rommel, Altoberbürgermeister der Landeshauptstadt <strong>Stuttgart</strong>,<br />
ebenfalls die Ehrenbürgerwürde unserer <strong>Universität</strong> verliehen. Beide wurden in einem<br />
Festakt im Haus der Wirtschaft feierlich begangen.<br />
1.11 Studentisches Wohnen<br />
Die Vermehrung von studentischen Wohnheimplätzen ist auf gutem Weg. Der Rektor<br />
hat gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Studentenwerks weitere Projekte durch<br />
den Verwaltungsrat des Studentenwerks beschließen lassen, so das die seinerzeit im<br />
Oktober 2003 von den Hochschulrektoren des Großraums <strong>Stuttgart</strong> eingeforderten<br />
10.000 Wohnheimplätze bis zum Jahr 2010 durch konkrete Meilensteine belegt wer-<br />
8
den können. Auch der Oberbürgermeister der Stadt <strong>Stuttgart</strong>, Herr Dr. Schuster, ist<br />
hier ein verlässlicher Partner.<br />
Die derzeitige Wohnheimkapazität von 4.800 Plätzen wird auf nahezu 7000 Plätze<br />
gegen Ende 2006 ansteigen.<br />
1.12 Gleichstellung<br />
Die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> kann und will auf das geistige Potenzial junger Frauen in<br />
Forschung und Lehre nicht verzichten. Neben dem schon seit vielen Jahren erfolgreich<br />
durchgeführten Projekt „Probiert die Uni aus – Naturwissenschaften und Technik<br />
<strong>für</strong> Mädchen der Oberstufe“ konnte im Berichtszeitraum endlich das Mentoring-<br />
Programm begonnen werden, welches speziell auf die Steigerung des Frauenanteils<br />
in Forscherkarrieren abzielt. Das Rektorat unterstützt die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten<br />
in vollem Umfang – erste Erfolge wie z.B. der dritte Preis bei D21 zur<br />
Förderung von Frauen in der Wissenschaft sind weithin sichtbar.<br />
1.13 Zusammenarbeit mit der Stadt <strong>Stuttgart</strong><br />
Die Zusammenarbeit mit der Stadt hat sich im Berichtszeitraum weiterhin sehr positiv<br />
entwickelt. Der Oberbürgermeister ist gern gesehener Redner bei unserer „Avete<br />
Academici“, die am 19. Oktober 2004 wiederum mehr als 1.000 Studierende zu uns<br />
in den Hegelsaal führte. Rektor, Oberbürgermeister und Bürgermeister der Stadt<br />
<strong>Stuttgart</strong> treffen sich regelmäßig, um gemeinsam <strong>für</strong> die Stadt und <strong>Universität</strong> wichtige<br />
Vorhaben auf den weg zu bringen. Derzeit wird das Projekt „Kinderland“ diskutiert,<br />
um Kleinst-, Kindergarten- und Schulkindern von Studierenden sowie Wissenschaftlerinnen<br />
eine Ganztagsbetreuung anzubieten.<br />
1.14 Kooperationen mit den <strong>Universität</strong>en Hohenheim und Tübingen<br />
Nicht nur ZUS hat gezeigt, wie wichtig eine Absprache mit den benachbarten <strong>Universität</strong>en<br />
in Zeiten politischer und finanzieller Unsicherheiten sein kann, sondern es<br />
zeichnet die Politik einer guten <strong>Universität</strong> aus, die Zusammenarbeit zu suchen und<br />
offensiv und gemeinsam eine Profilschärfung <strong>für</strong> jeden Standort voranzutreiben.<br />
In mehreren Gesprächen haben sich die drei Rektoren der <strong>Universität</strong>en <strong>Stuttgart</strong>,<br />
Hohenheim und Tübingen darauf verständigt, die Wirtschaftswissenschaften als Pilotprojekt<br />
im Sinne einer Profilschärfung einzusetzen.<br />
Im Berichtszeitraum wurden die Kooperationsvereinbarungen mit der <strong>Universität</strong> Hohenheim<br />
über das Zusammenwirken bei der Durchführung des Diplomstudiengangs<br />
Kommunikationswissenschaft sowie das Zusammenwirken bei der Durchführung des<br />
Masterstudienganges Wirtschaftsinformatik unterzeichnet.<br />
9
2 Entwicklungen im Bereich Struktur<br />
2.1. Neue Professuren<br />
Im Berichtszeitraum wurden die folgenden neuen Professuren besetzt:<br />
1 W 3-Professur „Biomedical Engineering“, Stiftungsprofessur, Fakultät 4,<br />
2 W 3-Professur „Mikroelektronik“, Leerstelle, Fakultät 5 oder 7,<br />
3 W 3-Professur „Embedded Systems Engineering“, Fakultät 5,<br />
4 W 3-Professur „Bauweisen und Strukturen in der Luft und Raumfahrt“, Leerstelle,<br />
Fakultät 6.<br />
Im Berichtszeitraum hat der Senat keinen Berufungsvorschlag zur Besetzung neuer<br />
Professuren beschlossen. Das Verfahren zur Besetzung der W 3-Professur „Chemische<br />
Raumfahrtantriebe“ (Leerstelle, Fakultät 6) wurde aufgrund der Bewerberlage<br />
unterbrochen.<br />
2.2 Struktur- und Entwicklungsplan der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
Im Berichtszeitraum wurde mit der Vorbereitung des Struktur- und Entwicklungsplans<br />
2007 – 2010 begonnen. Im Nachgang zum Struktur- und Entwicklungsplan 2002 –<br />
2006 berichtete die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> dem Ministerium über die in den einzelnen<br />
Fachbereichen angestrebte Ausbildungskapazität.<br />
2.3 Zukunftsoffensive der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> (ZUS)<br />
Im Berichtszeitraum wurde unter der Leitung des Prorektors Struktur eine Evaluierung<br />
der Philosophisch-Historischen Fakultät durchgeführt. Auf der Grundlage der<br />
Empfehlungen der Evaluierungskommission hat der <strong>Universität</strong>srat in seiner Sitzung<br />
am 17.03.2005 folgende Beschlüsse gefasst:<br />
1. Die Lehramtsstudiengänge sollen zunächst fortgeführt werden. Angesichts der<br />
derzeitigen Diskussionen um die zukünftige Lehramtsausbildung sowie dem Bedarf<br />
möge die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> spätestens 2010 erneut zur Weiterführung des<br />
Lehramts entscheiden.<br />
5 Als Ersatz <strong>für</strong> die seinerzeit von ZUS eingeforderten Streichungen der Professuren<br />
„Landesgeschichte“ und „Germanistische Mediävistik“ wird eine der beiden<br />
Professuren „Mittelalterliche Geschichte“ oder „Geschichte der Frühen Neuzeit<br />
unter Berücksichtigung der altostdeutschen Geschichte“ entfallen. Die Landesgeschichte<br />
sollte künftig ggf. die Geschichte des Mittelalters mitvertreten.<br />
6 Die Professuren <strong>für</strong> „Romanischen Literaturen“ und „Italianistik“ werden zu einer<br />
Professur zusammengefasst.<br />
7 Die Professur „Geschichte der Naturwissenschaften und Technik“ wird künftig am<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Philosophie angesiedelt.<br />
8 Hinsichtlich der Fakultätszugehörigkeit des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> Maschinelle Sprachverarbeitung<br />
(IMS) legt der <strong>Universität</strong>srat dringend nahe, das <strong>Institut</strong> in der Fakultät 5<br />
10
zu verorten. Das IMS und die Fakultät 5 werden aufgefordert, ein Integrationskonzept<br />
<strong>für</strong> Lehre und Forschung zu erarbeiten.<br />
Durch die Umsetzung der Empfehlungen der Zukunftsoffensive der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
wurden bislang 10 Stellen in der Zentralen Verwaltung und den Zentralen Einrichtungen<br />
und 1,5 Stellen in den Fakultäten eingespart.<br />
2.4 Evaluationen<br />
Folgende Fächer bzw. Studiengänge der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> wurden im Berichtszeitraum<br />
einer Evaluation durch die Evaluationsagentur Baden-Württemberg (evalag)<br />
unterzogen. Dies führte zu folgenden Ergebnissen:<br />
1. Fakultät 5: der Master-Studiengang INFOTECH<br />
Dieser Studiengang wurde mit geringen Auflagen zur unbefristeten Weiterführung<br />
empfohlen.<br />
2. Fakultät 5: das Fach Elektrotechnik<br />
Hier liegt noch kein Evaluierungsbericht vor.<br />
3. Fakultät 7: das Fach Verfahrenstechnik<br />
Der Verfahrenstechnik wird bescheinigt, dass sie aufgrund ihrer weltweit anerkannten<br />
Forschungsleistungen im In- und Ausland einen hervorragenden Ruf genießt<br />
und dass die Studierenden und Doktoranden mit ihrer Ausbildung außerordentlich<br />
zufrieden sind.<br />
4. Fakultät 8: der Master-Studiengang PHYSICS<br />
Für Physics wurde zunächst nur eine Verlängerung der Befristung empfohlen bis<br />
zur Anpassung der Studienordnung an die veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen.<br />
5. Fakultät 9: das Fach Geschichte<br />
Hier liegt noch kein Evaluierungsbericht vor.<br />
6. Fakultät 10: das Fach Betriebswirtschaftslehre<br />
Bei der Betriebswirtschaftslehre wurde von den Gutachtern eine Reihe von Mängeln<br />
in Forschung, Lehre und Organisation festgestellt.<br />
Eine Evaluierung des Fachs Erziehungswissenschaft an den <strong>Universität</strong>en und Pädagogischen<br />
Hochschulen des Landes wurde durch das Ministerium <strong>für</strong> Wissenschaft,<br />
Forschung und Kunst angeregt und ebenfalls von der evalag durchgeführt mit<br />
dem Ergebnis, dass der Bereich Berufspädagogik als bundesweit gut anerkannt und<br />
wettbewerbsfähig bewertet wurde. Für den Bereich Pädagogik wurde festgestellt,<br />
dass dieser aufgrund des zu geringen Ausbaus der Disziplin eine Hauptfachausbildung<br />
nicht ausreichend abdecken kann.<br />
Evaluierungen der Fächer Bauingenieurwesen, Mathematik und Germanistik durch<br />
die evalag laufen im Herbst 2005 an. Des weiteren ist eine bundesweite Evaluierung<br />
der Chemie durch den Wissenschaftsrat geplant.<br />
11
2.5 Zentren<br />
Im Berichtszeitraum wurden das Zentrum <strong>für</strong> Infrastrukturplanung und das Zentrum<br />
<strong>für</strong> Simulationstechnik geschlossen. An die Stelle des Zentrums <strong>für</strong> Simulationstechnik<br />
trat der Forschungsschwerpunkt „Scientific Computing“.<br />
2.6 Zusammenarbeit der <strong>Universität</strong>en <strong>Stuttgart</strong> und Hohenheim<br />
Im Berichtszeitraum wurden die Kooperationsvereinbarungen mit der <strong>Universität</strong> Hohenheim<br />
über das Zusammenwirken bei der Durchführung des Diplomstudiengangs<br />
Kommunikationswissenschaft sowie das Zusammenwirken bei der Durchführung des<br />
Masterstudienganges Wirtschaftsinformatik unterzeichnet.<br />
12
3 Bericht aus dem Bereich der Lehre<br />
3.1 Evaluationen, Akkreditierungen und Rankings<br />
Die hohe Qualität der Lehre an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> wurde durch ein sehr gutes<br />
Abschneiden bei zahlreichen Evaluationen und Akkreditierungsverfahren im Berichtszeitraum<br />
bestätigt.<br />
Im vergangenen Jahr hat die Evaluationsagentur Baden-Württemberg (evalag) den<br />
Masterstudiengang Information Technology (INFOTECH) durchweg positiv evaluiert.<br />
Hervorgehoben wurde insbesondere die fachliche Ausgewogenheit, die gute Entwicklung<br />
und die Interdisziplinarität. Dementsprechend empfahl die evalag die Entfristung<br />
des Studiengangs.<br />
Des weiteren wurde der Masterstudiengang Physics im vergangenen Jahr durch die<br />
evalag begutachtet. Die Bewertung war auch hier überwiegend positiv. Besonders<br />
gelobt wurde das Engagement der Beteiligten, das maßgeblich zum Erfolg des Studienprogramms<br />
beiträgt. Defizite wurden demgegenüber bei der Modularisierung und<br />
der Vergabe von ECTS-Punkten festgestellt. Aufgrund der veränderten rechtlichen<br />
Rahmenbedingungen sind in diesen Bereichen umfangreichere Anpassungen erforderlich.<br />
Die evalag hat daher zunächst nur eine Verlängerung der befristeten Genehmigung<br />
des Studiengangs empfohlen.<br />
Vergleichend bewertete die evalag im Berichtszeitraum die Betriebswirtschaftslehre<br />
an den Fachhochschulen und <strong>Universität</strong>en in Baden-Württemberg. Die Besonderheit<br />
einer Kombination von Technik und Wirtschaft an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> wurde von<br />
den Gutachtern als zukunftsweisend gewürdigt. Gleichwohl empfahlen die Gutachter<br />
den Technikanteil noch stärker in das Studium zu integrieren und die wirtschaftlichen<br />
und technischen Anteile im Studium durch die Einführung integrativer Lehrveranstaltungen<br />
stärker miteinander zu verzahnen. Positiv hervorgehoben wurde im übrigen<br />
der hohe Anteil an Online-Veranstaltungen.<br />
Die hochschulübergreifende Evaluation in den Fächern Elektrotechnik und Geschichte<br />
an den Hochschulstandorten in Baden-Württemberg durch die evalag wurde im<br />
Berichtszeitraum noch nicht abgeschlossen.<br />
Im CHE-Ranking 2005/06, das vom Centrum <strong>für</strong> Hochschulentwicklung durchgeführt<br />
und durch Die Zeit veröffentlicht wurde und das Kriterien wie die Reputation der<br />
Hochschule bei Studierenden und Professoren, den Praxisbezug, die Forschungsaktivitäten<br />
und Attraktivität der Lehre zu erfassen versucht, wurden zahlreiche Fächer<br />
bewertet, die auch zum Angebotsspektrum der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> gehören. In den<br />
Ingenieurwissenschaften (Architektur, Bauingenieurwesen, Elektro- und Informationstechnik,<br />
Maschinenbau) lag die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> nahezu in allen Kriterien in der<br />
Spitzengruppe. In den Naturwissenschaften (Chemie, Mathematik, Physik und Informatik)<br />
sowie in den Geistes- und Sozialwissenschaften (Anglistik, Germanistik, Politik,<br />
Soziologie und Geschichte) bewegten sich die Bewertungen überwiegend im Mittelfeld,<br />
mit Ausnahme der Erziehungswissenschaften und der Betriebswirtschaftslehre,<br />
die unterdurchschnittlich abschnitten.<br />
13
Das Nachrichtenmagazin Focus bewertete im September 2005 die Studiengänge<br />
Bauingenieurwesen, Maschinenbau und Elektrotechnik. In allen drei Disziplinen<br />
schnitt die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> hervorragend ab. Sie erreichte im Bauingenieurwesen<br />
Platz 1, im Maschinenbau Platz 2 und in der Elektrotechnik Platz 3. In das Ranking<br />
gingen neun Faktoren ein, darunter die Promotionsquote, das Betreuungsverhältnis,<br />
Patentanmeldungen und die Reputation der Hochschule bei Wissenschaftlern und<br />
Unternehmen. In die Bewertung von BWL flossen u. a. die Reputation, der ISI-<br />
Zitationsindex, die Studiendauer, sowie die Promotions- und Drittmittelquote ein. Hier<br />
landete die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> in der Mittelgruppe.<br />
•<br />
3.2 Hochschulpolitische Rahmenbedingungen <strong>für</strong> die Weiterentwicklung<br />
der Lehre<br />
Zum 01.01.2005 ist das neue Landeshochschulgesetz (LHG) <strong>für</strong> Baden-Württemberg<br />
in Kraft getreten.<br />
Positiv hervorzuheben ist, dass die Regelungsdichte im Bereich Studium und Lehre<br />
deutlich zurückgegangen ist und den Hochschulen in diesem Bereich mehr Autonomie<br />
eingeräumt wurde. Begrenzt wird diese Autonomie allerdings durch die verbindlich<br />
vorgeschriebenen regelmäßigen Akkreditierungen der Studiengänge, durch die<br />
die Studienprogramme inhaltlich überprüft und bewertet werden sollen.<br />
Negativ anzumerken ist, dass in der Praxis zahlreiche Regelungslücken und Auslegungsfragen<br />
auftreten, die zeitaufwändig im Rahmen von hochschulübergreifenden<br />
Absprachen auf Landesebene oder in Abstimmung mit dem MWK zu klären sind.<br />
In den Geistes- und Sozialwissenschaften ist die Umstellung auf die neuen Studiengänge<br />
an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> bereits sehr weit fortgeschritten. Zum Wintersemester<br />
2004/05 wurden letztmalig Erstsemester zu den Magisterstudiengängen zugelassen.<br />
Ab dem Wintersemester 2005/06 werden im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften<br />
neben den Lehramtsstudiengängen nur noch Bachelor- und Masterstudiengänge<br />
- mit Ausnahme der beiden Diplomstudiengänge Technisch orientierte<br />
Betriebswirtschaftslehre und Linguistik - <strong>für</strong> Studienanfänger/innen angeboten.<br />
Im Bereich der Ingenieur- und Naturwissenschaften erfolgt die Umstellung aufgrund<br />
der damit verbundenen Probleme und Bedenken wesentlich zögerlicher. Eine Vorreiterrolle<br />
kommt hierbei der Verfahrentechnik zu, die ab dem Wintersemester 2005/06<br />
erstmals den herkömmlichen Diplomstudiengang zugunsten eines Bachelor-<br />
/Mastermodells aufgibt. Bei den anderen bereits existierenden ingenieurwissenschaftlichen<br />
Bachelor-Studiengängen (Umweltschutztechnik, Elektrotechnik und Informationstechnik)<br />
wird der gleichnamige Diplomstudiengang bislang parallel angeboten.<br />
Im Falle einer positiven Resonanz auf diesen Umstieg planen weitere Ingenieurwissenschaften<br />
die Umstellung auf die neuen Studienabschlüsse. Die Mehrzahl<br />
der Studiengänge strebt als Termin hier<strong>für</strong> das Wintersemester 2007/08 an.<br />
3.3 Studienangebot<br />
Der Senat der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> und der <strong>Universität</strong>srat haben im Frühjahr 2005<br />
die Ergebnisse einer externen Evaluation der Philosophisch-Historischen Fakultät<br />
14
e<strong>für</strong>wortet und beschlossen, die Lehramtsstudiengänge bis zum Jahr 2010 unverändert<br />
fortzuführen. Spätestens Ende des Jahrzehnts soll die Lehrerausbildung –<br />
abhängig vom Bedarf und im Blick auf die Nachbaruniversitäten – erneut auf den<br />
Prüfstand gestellt werden. Eine Profilbildung in Richtung Kulturwissenschaften sowie<br />
eine disziplinenübergreifende Vernetzung wurden angeregt.<br />
Die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> erweitert erneut ihr Angebot an internationalen Studiengängen<br />
durch die Einrichtung des viersemestrigen deutsch-französischen Masterstudiengangs<br />
„Praxisorientierte Kulturphilosophie“ zum Wintersemester 2005/06. Im Mittelpunkt<br />
des viersemestrigen Studienprogramms, das die angehenden Kulturphilosophen<br />
in der Regel zu gleichen Teilen in Paris (Vincennes - St. Denis) und <strong>Stuttgart</strong><br />
absolvieren, stehen neben historischen, systematischen und methodischen Grundlagen<br />
der Kulturphilosophie und -kritik vertiefende Module zu den Themen „Technologische<br />
Kultur“ und „Interkulturalität“.<br />
Auf Antrag der zuständigen Fakultäten wurden die Studiengänge „Technisch orientierte<br />
Volkswirtschaftslehre“ (Diplom) und „Deutsch als Fremdsprache“ (Bachelor)<br />
eingestellt, da beide angesichts der eingeschränkten Ressourcen nicht mehr verantwortlich<br />
durchgeführt werden können.<br />
3.4 Eignungsfeststellungs- und Hochschulauswahlverfahren<br />
• An der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> waren <strong>für</strong> die Zulassung zum Wintersemester 2005/06<br />
in 16 Studienfächern Eignungsfeststellungs- und in 44 Studienfächern Hochschulauswahlverfahren<br />
vorgesehen. Im Vergleich zu allen anderen Landesuniversitäten<br />
ist <strong>Stuttgart</strong> bei weitem die <strong>Universität</strong> mit den meisten Studiengängen, in<br />
denen Bewerber/innen diese Hürde nehmen müssen.<br />
•<br />
Die Durchführung der Eignungsfeststellungs- und Hochschulauswahlverfahren setzt<br />
eine Bewertung schulischer und außerschulischer Kriterien voraus, die arbeitsteilig<br />
vom Studiensekretariat und von Fakultätskommissionen vorgenommen wird. Während<br />
die Eignungsfeststellung unabhängig von der Bewerberzahl zwingend durchzuführen<br />
ist, findet ein Hochschulauswahlverfahren nur dann statt, wenn die Nachfrage<br />
die festgesetzte Zulassungszahl deutlich übersteigt. Da die Bewerberzahl in einigen<br />
der zulassungsbeschränkten Studiengänge in vertretbarem Maß über der Zahl der zu<br />
vergebenden Plätze lag, wurde in 9 Fächern im Einvernehmen mit der jeweiligen Fakultät<br />
auf die Durchführung eines Auswahlverfahrens verzichtet und alle Bewerber,<br />
die dieses Fach als Hauptantrag hatten, zugelassen.<br />
• Bei einigen Eignungsfeststellungsverfahren, vor allem in den Geistes- und Sozialwissenschaften,<br />
zeigte sich, dass die Messlatte <strong>für</strong> viele Studienbewerber/innen<br />
zu hoch lag. Teilweise betrug die Quote der als geeignet eingestuften<br />
Studieninteressierten nur 5-10%. In Bachelorfächern, <strong>für</strong> die eine gemeinsame<br />
Zulassungszahl mit dem gleichnamigen Lehramtsstudiengang festgesetzt wurde,<br />
führte dies im Ergebnis zu einer massiven Verschiebung zugunsten der Lehramtsaspiranten,<br />
da nach der Hochschulvergabeverordnung freie Studienplätze<br />
innerhalb derselben Lehreinheit gegenseitig angerechnet werden müssen.<br />
15
Dass die Eignungsfeststellungsverfahren, die zum Teil das persönliche Erscheinen<br />
des Bewerbers erfordern, insbesondere <strong>für</strong> ausländische Bewerber problematisch<br />
sind, da diese aus Visums- oder Kostengründen von wenigen Ausnahmen abgesehen<br />
nicht an den Tests teilnehmen können, bestätigte sich in diesem Jahr erneut.<br />
Um den mit dem Transfer der Bewerbungen an die Fakultäten und die Erfassung der<br />
zurückgemeldeten Ergebnisse erheblichen manuellen Aufwand zu reduzieren, bereitet<br />
die Zentrale Verwaltung in Abstimmung mit der Zentralen Datenschutzstelle der<br />
baden-württembergischen <strong>Universität</strong>en (ZENDAS) und dem Rechenzentrum derzeit<br />
die Umstellung auf ein Verfahren zur elektronischen Erfassung und Verteilung der<br />
Bewerbungsunterlagen vor. Die hier<strong>für</strong> eingesetzte Projektgruppe hat mehrfach getagt<br />
und detaillierte Leistungsanforderungen erarbeitet. Der Start des Pilotverfahrens<br />
hat sich aufgrund der schleppenden Vertragsverhandlungen mit der beauftragten<br />
Firma lum zwei Semester verschoben. Neben der deutlichen Reduzierung des Kopier-<br />
und Sortieraufwandes bringt die die elektronische Übermittlung der Bewerbungsunterlagen<br />
an die Fakultäten erbringt eine Verkürzung der Verfahrensdauer, da<br />
die Erfassung der schulischen Noten parallel zur Bewertung der außerschulischen<br />
Kriterien durch die Kommission erfolgen kann und die Ergebnisse mit Hilfe einer<br />
Transfer-Datenbank automatisiert in HIS-ZUL übernommen werden.<br />
3.5 Entwicklung der Bewerber- und Studierendenzahlen<br />
Zum Wintersemester 2005/06 haben sich 15.232 Studieninteressierte (davon 4.981<br />
Ausländer) an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> beworben. Damit lag die Zahl insgesamt auch<br />
in diesem Jahr wieder über der des Vorjahres (14.516), wenngleich die Zahl der Bewerbungen<br />
aus dem Ausland etwas zurückging (Vorjahr: 5.594).<br />
Der Großteil der ausländischen Bewerber außerhalb der EU kommt aus China<br />
(1.320), gefolgt von der Türkei (385), Bulgarien (269), Russland (172), Marokko<br />
(167) und Korea (166). Ein Vergleich der Bewerberzahlen mit denen des Vorjahres<br />
ergibt, dass der Beschluss des Senats der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong>, ausländische Studienbewerber<br />
(mit Ausnahme der EU-Bürger, Bürger aus Konventionsländern und<br />
Bildungsinländer) nur dann zum Studium an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> zuzulassen,<br />
wenn diese ein abgeschlossenes Hochschulstudium von mindestens drei- bzw. vierjähriger<br />
Dauer haben, deutliche Auswirkungen auf das Zulassungsverfahren bei Ausländern<br />
hatte. Die Bewerberzahl aus bestimmten Ländern, insbesondere aus China<br />
(-289), Bulgarien (-389) und Marokko (-88) ist deutlich rückläufig, während die Zahl<br />
der Bewerbungen aus EU-Mitgliedsstaaten teils konstant blieb, teils anstieg. Erneut<br />
wurden mehr als 50 % der Ablehnungen (1.774 von 3.324) damit begründet, dass die<br />
geforderte akademische Vorbildung nicht nachgewiesen werden konnte.<br />
Der von den Bewerbern am stärksten nachgefragte Studiengang im Zulassungsverfahren<br />
zum Wintersemester 2005/06 ist mit weitem Abstand die Technisch orientierte<br />
Betriebswirtschaftslehre, <strong>für</strong> den sich 1.022 (Vorjahr: 743) interessierten. Damit wurde<br />
bei einem Studiengang der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> erstmals die Tausendergrenze<br />
überschritten.<br />
In den ingenieurwissenschaftlichen Fächern gleicht sich die Zu- und Abnahme der<br />
Bewerberzahl in etwa aus. Am beliebtesten sind hier die Studiengänge Architektur<br />
(541), Luft- und Raumfahrt (508) und Maschinenwesen (454). Der Studiengang Ver-<br />
16
fahrenstechnik, der als erster ingenieurwissenschaftlicher Studiengang den kompletten<br />
Umstieg von Diplom auf Bachelor/ Master gewagt hat, zählte mit 92 sogar etwas<br />
mehr Bewerber als im Vorjahr (87). Dies spricht <strong>für</strong> die Akzeptanz der neuen Abschlussarten<br />
in den Ingenieurwissenschaften.<br />
In den Naturwissenschaften ist ein größeres Interesse <strong>für</strong> das Lehramt zu verzeichnen.<br />
Hier liegen die Bewerberzahlen durchweg über denen des Vorjahres.<br />
Die Aufgabe der Magisterstudiengänge in den Geistes- und Sozialwissenschaften<br />
scheint die Nachfrage nicht wesentlich beeinflusst zu haben. Besonders nachgefragt<br />
wurden der Bachelor in Sozialwissenschaft (279), in Politikwissenschaft (127) und in<br />
Berufspädagogik (170). In den Lehramtsfächern erhielten Deutsch (237) und Englisch<br />
(196) die meisten Bewerbungen.<br />
Zum Wintersemester 2005/06 konnte die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> 3.094 Ersteinschreiber<br />
(ohne Hochschulvergangenheit) und 434 Neueinschreiber (mit Hochschulvergangenheit)<br />
verzeichnen, 15.942 Studierende haben sich zurückgemeldet 746 sind derzeit<br />
beurlaubt. Die Zahl der Immatrikulierten beträgt insgesamt 19.470 (Stand<br />
12.10.2005).<br />
• Das Annahmeverhalten der Bewerber/innen hat sich auch in diesem Jahr erneut<br />
verschlechtert, was auf die Zunahme von Mehrfachbewerbungen (an mehreren<br />
Hochschulen) in Fächern mit Hochschulauswahl- und/oder Eignungsfeststellungsverfahren<br />
zurückzuführen sein dürfte. Deshalb musste in einigen zulassungsbeschränkten<br />
Fächern mehrmals nachgerückt werden.<br />
•<br />
•<br />
• 3.6 Service<br />
3.6.1 Studiensekretariat<br />
Der seit März 2004 eingerichtete Telefonservice im Studiensekretariat war auch<br />
in diesem Jahr unverzichtbar, um die Erreichbarkeit <strong>für</strong> Bewerber und Studierende<br />
insbesondere während des Zulassungsverfahrens zu gewährleisten. Der<br />
Telefonservice, der in den Sommermonaten wieder über zwei Anschlüsse verfügte,<br />
hat sich außerordentlich bewährt und zu einer deutlichen Entlastung der<br />
Sachbearbeiterinnen geführt. In Spitzenzeiten wurden durchschnittlich mehr<br />
als 300 Anrufe pro Tag entgegengenommen.<br />
Das Rektorat der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> hat dem Dezernat Studentische Angelegenheiten<br />
<strong>für</strong> die Einführung der HIS-QIS-Funktionalitäten eine zeitlich befristete Projektstelle<br />
zur Verfügung gestellt, die sich ausschließlich dieser Aufgabe widmen wird. In<br />
der Priorisierung stehen neben der Prüferfunktion in HIS-QIS-POS die Online-<br />
Bewerbung ganz oben. Ein Testbetrieb der Online-Bewerbung ist zum Sommersemester<br />
2006 vorgesehen, nachdem nunmehr die datenschutzrechtliche Seite zur Zufriedenheit<br />
von ZENDAS geklärt ist.<br />
•<br />
17
• Trotz der sehr hohen Arbeitsbelastung hat das Studiensekretariat <strong>für</strong> Ausländer<br />
auf Wunsch der Stabsstelle Internationale Angelegenheiten in den Monaten September<br />
und Oktober 2005 zwei Mal pro Woche eine zusätzliche Sprechstunde im<br />
Internationalen Zentrum in Vaihingen angeboten, um den ausländischen Studienanfängern<br />
lange Wege im Rahmen der Einschreibung zu ersparen.<br />
3.6.2 Zentrale Studienberatung<br />
Die Umstellung der Studienabschlüsse auf Bachelor und Master, die zahlreichen und<br />
sehr unterschiedlichen Auswahlverfahren sowie die Einführung von Studiengebühren<br />
waren im Berichtszeitraum die dominanten Themen, die nahezu jedes Informations-<br />
und Beratungsgespräch mit Studieninteressierten durchzogen. Die Entscheidung <strong>für</strong><br />
oder wider einen Studiengang mit einem der neuen Studienabschlüsse ist immer eng<br />
verknüpft mit Unsicherheiten bezüglich der beruflichen Zukunft. Ebenso werfen die<br />
komplizierten und schwer zu erläuternden Zulassungsverfahren (Eignungsfeststellungs-<br />
und Hochschulauswahlverfahren) weitere Fragen auf; neben dem Entscheidungsprozess<br />
zur Wahl des Studiengangs und der Abschlussart müssen individuelle<br />
Bewerbungsstrategien entworfen werden, falls sich der Erstwunsch nicht realisieren<br />
lässt. Hinzu kommt die angekündigte Einführung der Studiengebühren – die Frage,<br />
ob sich jemand ein Studium leisten kann sowie die Angst vor Schulden verknüpft mit<br />
unsicheren Chancen auf dem Arbeitsmarkt ist in der Beratung an der <strong>Universität</strong>, auf<br />
den Messen und an Schulen stets gegenwärtig.<br />
Schwerpunkte in der Arbeit der Zentralen Studienberatung waren auch in diesem<br />
Jahr die Orientierungs- und Studienwahlberatung von Studieninteressierten (Schülerinnen<br />
und Schülern der Oberstufe, Dienstleistende, ausländische Studieninteressierte),<br />
die Beratung der Studienanfänger/innen und die Beratung von Studierenden bei<br />
Prüfungsanspruchverlust und beabsichtigtem Studiengangwechsel bzw. Studienabbruch.<br />
Die Zahl der Einzelberatungen betrug im Berichtszeitraum rund 2.500<br />
(2004/05: 3.300), die Zahl der Erstgespräche in der Clearingstelle der ZSB entsprach<br />
mit rund 3.550 der des Vorjahres. Bei den Mailanfragen (ca. 30.500) und telefonischen<br />
Anfragen (6.300) gab es gegenüber dem Vorjahr einen leichten Rückgang.<br />
Die schriftlichen Anfragen bzw. Anforderungen von Informationsmaterial lagen mit ca.<br />
3.550 etwa 20% unter der Zahl des letzten Berichtszeitraums.<br />
Um einerseits die große Nachfrage nach Beratung bewältigen zu können und andererseits<br />
den Gruppeneffekt zu nutzen, wurden im Frühjahr 2005 insgesamt 30 (2004:<br />
26) fachspezifische Gruppenberatungen und Workshops zur Studienorientierung,<br />
teilweise in Kooperation mit den Fakultäten, angeboten. Im Berichtszeitraum besuchten<br />
Mitarbeiter/innen der ZSB 12 Gymnasien und waren auf den AZUBI- und Studientagen<br />
auf der Messe Killesberg in <strong>Stuttgart</strong> sowie auf der EINSTIEG-Abi-Messe<br />
in Karlsruhe vertreten. Gemeinsam mit der Berufsberatung der Arbeitsagentur und<br />
der ZSB der <strong>Universität</strong> Hohenheim wurde im akademischen Jahr 2004/05 das „Forum<br />
Studium und Beruf“ konzipiert und durchgeführt. Das Forum bestand aus unterschiedlichen<br />
Bausteinen zu allen Themen der Studienwahl (Orientierung, Studienwahl,<br />
fächerspezifische Veranstaltungen, Veranstaltungen zu Bachelor und Master<br />
sowie zu den Zulassungsverfahren).<br />
Im Wintersemester 2004/05 und im Sommersemester 2005 führte die ZSB <strong>für</strong> Studienanfänger/innen<br />
der Geisteswissenschaften 7 Gruppenberatungen zur Studienorganisation<br />
durch und besetzte einen mehrtägigen Informationstisch zu Semesterbe-<br />
18
ginn im Gebäude Keplerstr.17. Für Lehramtsstudierende wurde zum zweiten Mal in<br />
Kooperation mit dem <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Pädagogik, dem Oberschulamt und dem Staatlichen<br />
Seminar <strong>für</strong> Didaktik und Lehrerbildung eine Informationsveranstaltung mit etwa 300<br />
Teilnehmern organisiert. Diese Veranstaltung wird künftig fest etabliert, da sie ein<br />
notwendiges und gut angenommenes Angebot ist.<br />
Im Bereich der Multiplikatoren führte die ZSB eine Veranstaltung zum Thema „Die<br />
neue Gymnasiale Oberstufe“ <strong>für</strong> Studiendekane, Fachstudienberater/innen, Mitarbeiter/innen<br />
des Dezernat III und sonstige Interessierte durch. Referent war der Stellvertretende<br />
Schulleiter des Solitude-Gymnasiums.<br />
Im Berichtszeitraum wurde zudem eine neue Broschüre zur Einführung der Bachelor<br />
und Masterstudiengänge an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> erstellt, die einen grundlegenden<br />
Überblick zu den Neuerungen im Rahmen des Bologna-Prozesses und dem<br />
Stand der Einführung an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> gibt und die vorrangig <strong>für</strong> Studieninteressierte<br />
gedacht ist..<br />
3.6.3 Prüfungsamt<br />
Das Prüfungsamt verwaltet nach seiner flächenmäßigen Erweiterung und personellen<br />
Aufstockung nunmehr seit Februar 2005 die neu eingerichteten geistes- und sozialwissenschaftlichen<br />
Bachelor-Studiengänge. Im Vorfeld der Übernahme der<br />
Betreuung durch die Zentrale Verwaltung fand ein Treffen mit den entsprechenden<br />
Prüfungsausschussvorsitzenden statt, um offene Fragen zu klären. Insgesamt verlief<br />
die Aufgabenübertragung nahezu reibungslos.<br />
• Auf Einzelanfrage der Studierenden wurden bislang Zeugnisse und Urkunden ins<br />
Englische übersetzt, was mit einem sehr hohen Zeitaufwand verbunden war. Die<br />
Übersetzungen sollen zukünftig direkt mit Hilfe der Datenbank des Prüfungsamtes<br />
erstellt werden. Voraussetzung da<strong>für</strong> ist eine zweisprachige Erfassung der gesamten<br />
Prüfungsfachbezeichnungen, die in Arbeit ist, und die kontinuierliche<br />
Pflege der Daten.<br />
Durch die im Dezernat Studentische Angelegenheiten neu geschaffene EDV-<br />
Projektstelle wird auch die Einrichtung der Online-Funktionalitäten <strong>für</strong> Prüfende und<br />
Studierende voran getrieben, wobei der Schwerpunkt der Aktivitäten zunächst auf<br />
der Einführung der Prüferfunktionen liegen soll.<br />
3.7 Allgemeine Studienangelegenheiten<br />
3.7.1 Landeslehrpreis<br />
•<br />
• Frau Dr. Susanne Lin-Klitzing erhielt im Rahmen des „Tages der Lehre“ des baden-württembergischen<br />
Wissenschaftsministeriums am 29.10.2004 den mit<br />
25.000 Euro dotierten Landeslehrpreis. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin der<br />
Abteilung Pädagogik am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Erziehungswissenschaft und Psychologie<br />
wurde <strong>für</strong> die didaktische Konzeption, anregende Vielfalt und die klaren Strukturen<br />
ihrer Lehrveranstaltungen ausgezeichnet. Sie verbindet Formen offener und<br />
traditioneller Lehre ziel- und ergebnisorientiert miteinander und kombiniert Prä-<br />
19
senz- mit Selbstlernphasen. Unter Anleitung der Dozentin entwickelten die Studierenden<br />
eine online verfügbare Lernsoftware, die ein bundesweites Novum darstellt.<br />
3.7.2 Avete Academici 2004<br />
Am 19. Oktober wurde wie in den Vorjahren zum Erstsemesterabend in die Liederhalle<br />
eingeladen. Die neu immatrikulierten Studierenden und ihre Angehörigen wurden wie in<br />
jedem Jahr durch den Rektor, den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt <strong>Stuttgart</strong>,<br />
Herrn Dr. Wolfgang Schuster, und den Studierendenvertreter Franz Boszak begrüßt. Umrahmt<br />
wurde die festliche Veranstaltung, bei der als Ansporn an den künftigen studentischen<br />
Nachwuchs auch Preise an Studierende verliehen wurden, durch musikalische<br />
und Theatereinlagen. Bei einem „Markt der Möglichkeiten“ im Foyer hatten studentische<br />
Arbeitsgruppen, Einrichtungen der <strong>Universität</strong> und die Stadt <strong>Stuttgart</strong> die Gelegenheit, ihr<br />
Angebot <strong>für</strong> Studierende vorzustellen.<br />
3.7.3 Landesgraduiertenförderung<br />
Das Ministerium <strong>für</strong> Wissenschaft, Forschung und Kunst be<strong>für</strong>wortet nachhaltig die<br />
Einrichtung von Graduiertenschulen, was sich künftig bei der Verwendung der Mittel<br />
aus der Landesgraduiertenförderung, insbesondere bei der Bereitstellung von Stipendien<br />
niederschlagen wird. Nachdem nun endlich die Einigung zwischen Bund und<br />
Ländern zur Nachwuchsförderung im Rahmen der „Exzellenzinitiative“ erfolgte, liegt<br />
die Priorität des Mitteleinsatzes darin, die erfolgreiche Einwerbung von Mitteln aus<br />
der „Exzellenzinitiative“ zu unterstützen. Die <strong>Universität</strong> wird sich da<strong>für</strong> einsetzen,<br />
dass auch weiterhin Individualstipendien in Fächern vergeben werden können, die<br />
nicht in Graduiertenschulen integriert sind.<br />
Die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> hat neben den Anträgen <strong>für</strong> Exzellenzcluster zwei Antragsskizzen<br />
<strong>für</strong> Graduiertenschulen zu den Themen „Systems Biology“ (Koordination<br />
Prof. Scheurich und Prof. Allgöwer) und „Advanced Manufacturing Engineering“ (Koordination<br />
Prof. Westkämper) beim MWK zur Weiterleitung an die DFG eingereicht.<br />
Unabhängig von einer Beteiligung an der „Exzellenzinitiative“ erhielten die <strong>Universität</strong>en<br />
in 2004 und 2005 weiterhin Mittel <strong>für</strong> Individualstipendien nach dem Landesgraduiertenförderungsgesetz.<br />
Im Rahmen der Landesgraduiertenförderung konnten im<br />
Berichtszeitraum insgesamt 20 Stipendien (davon 12 an Frauen) vergeben werden.<br />
Damit liegt die Zahl der Geförderten über der des Vorjahres.<br />
3.7.4 Lehrevaluation<br />
Die Evaluation der Lehrveranstaltungen an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> durch die Studierenden,<br />
die bereits im vorigen Berichtszeitraum zum festen Bestandteil des Studienbetriebs<br />
geworden ist, hat sich als Instrument zur Qualitätssicherung in der Lehre<br />
sehr bewährt. Die Fakultäten und <strong>Institut</strong>e haben zusätzliche fachspezifische Fragebögen<br />
entwickelt. Die weitergehende Verwendung der Ergebnisse durch Organisationsstrukturen<br />
der <strong>Universität</strong> (Studiendekan, Fakultätsvorstand) ist noch zu klären<br />
und daher in den kommenden Monaten abzustimmen.<br />
•<br />
Offensichtlich ist die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> mit der vollautomatischen Auswertung der<br />
Fragebögen im technologischen Sinn mittlerweile zum Vorbild geworden – die von ihr<br />
20
verwendete Software evaSys wird auch an anderen Hochschulen des Landes verwendet.<br />
3.7.5 Konzept zur multimedialen Wissensvermittlung<br />
• Im Rahmen der Programme „100-online“ und „self-study-online“ entwickelten die<br />
<strong>Institut</strong>e der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> eine Vielzahl von e-Learning-Projekten, in denen<br />
die Vorlesungsinhalte weiter bearbeitet und in Foren diskutiert werden können.<br />
Das Programm „self-study-online“, das drei Jahre lang durch das Ministerium <strong>für</strong><br />
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gefördert wurde, lief im<br />
Sommer 2005 aus. Insgesamt entstanden 195 Projekte, in denen engagierte Lehrende<br />
aller Fakultäten ihren Studierenden interaktive Selbstlernmaterialien zur<br />
Verfügung stellten. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung prämierte der Rektor<br />
Prof. Dieter Fritsch die sechs besten Projekte und kündigte eine Initiative an, um<br />
die Studiengänge der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> über e-Learning-Angebote an den<br />
Schulen bekannt zu machen. Mit dieser e-Learning-Initiative wird der Wettbewerb<br />
um die besten Schüler fortgesetzt.<br />
•<br />
• Die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> hat mit ihrem e-Learning-Konzept „Campus-online education:<br />
Neue Medien und Medienkompetenz <strong>für</strong> die gesamte <strong>Universität</strong>“ den mit<br />
25.000 Euro dotierten MedidaPrix 2005 in der Kategorie „Hochschulentwicklung<br />
mit digitalen Medien“ gewonnen. In der gleichen Kategorie wurde auch die <strong>Universität</strong><br />
Salzburg <strong>für</strong> ihre Initiative „Flexibles Lernen“ ausgezeichnet. Die Jury lobte<br />
das didaktisch angelegte <strong>Stuttgart</strong>er Konzept und die aufgebauten technischen<br />
Infrastrukturen, die als Katalysator <strong>für</strong> Vernetzung, Zentralisierung und IT-Einsatz<br />
an der gesamten <strong>Universität</strong> wirkten. Insgesamt hatten sich 121 Projekte aus dem<br />
e-Learning-Bereich an Hochschulen in Deutschland, Österreich und in der<br />
Schweiz um den diesjährigen MedidaPrix der Gesellschaft <strong>für</strong> Medien in der Wissenschaft<br />
e.V. beworben.<br />
3.8 Internationale Beziehungen<br />
Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten des Internationalen Zentrums hat sich im<br />
Hinblick auf die Zusammenarbeit innerhalb der drei Abteilungen der Stabsstelle Internationale<br />
Angelegenheiten bewährt und ermöglicht jetzt eine insgesamt effizientere<br />
Gestaltung der Arbeitsabläufe.<br />
Auch hinsichtlich der Betreuung der internationalen Studierenden erweist sich der<br />
Standort Vaihingen als sehr positiv. Da ein Großteil dieser Klientel auf dem Campus<br />
in Vaihingen untergebracht ist und dadurch die Wege kurz sind, werden die Sprechstunden<br />
sehr gut angenommen. Für die Studentenvereine sind die Begegnungsräume,<br />
in denen sie sich regelmäßig treffen können, ein großer Gewinn.<br />
Die Anzahl von Programmstudierenden (ERASMUS-Programm und Partneruniversitäten<br />
in Übersee), die zu Studienzwecken aus dem Ausland nach <strong>Stuttgart</strong> kamen,<br />
hat sich deutlich um 34 % auf insgesamt 316 erhöht (Vorjahr 235). Innerhalb des<br />
ERASMUS-Programms waren die stärksten Zuwächse bei den Studierenden aus<br />
Frankreich (mehr als 40 %) und Spanien (38 %) zu verzeichnen. Bei den Partneruni-<br />
21
versitäten in Übersee erfuhren insbesondere die Programme mit den USA, die stark<br />
rückläufige Zahlen in den beiden vorhergehenden Jahren hatten, eine erfreuliche<br />
Steigerung von 18 Studierenden im Vorjahr auf 32. Sehr gut angenommen wurden<br />
auch unsere neueren Austauschprogramme mit Südamerika (Argentinien, Chile, Mexiko).<br />
Von dort kamen insgesamt 19 Studierende (Vorjahr 6) an die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong>.<br />
Das beliebte Patenprogramm der Abteilung Betreuung, das vom Studentenwerk<br />
<strong>Stuttgart</strong> finanziert wird, wurde auch im aktuellen Berichtsjahr rege in Anspruch genommen.<br />
Im Hochschuljahr 2004/05 nahmen insgesamt 291 (Vorjahr 260) „Patenkinder“<br />
diesen „Welcoming Service“ in Anspruch. Insgesamt 92 (Vorjahr 103) studentische<br />
Paten und Patinnen stellten sich zur Verfügung, um neu ankommende internationale<br />
Studierende am Flughafen abzuholen oder sie bei der Erledigung von Formalitäten<br />
zu unterstützen.<br />
Ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem Studentenwerk wird weiterhin das vor drei<br />
Jahren eingeführte Wohnheimtutorenprogramm angeboten. Insgesamt vier Wohnheimtutoren<br />
in den Wohnheimen Allmandring, Pfaffenhof und Straußäcker übernehmen<br />
die Einführung von neuen Wohnheimbewohner(inne)n, bieten kulturelle Abende<br />
mit Länderschwerpunkten an und sind Ansprechpartner(innen) in Konfliktfällen. Besonders<br />
hervorzuheben ist, dass im Berichtsjahr eine polnische Stipendiatin der Robert<br />
Bosch Stiftung als Wohnheimtutorin eingesetzt war, die sich besonders <strong>für</strong> die<br />
Vermittlung der polnischen Kultur einsetzte. Sie organisierte neben kleineren Kulturprogrammen<br />
in den Wohnheimen in Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung<br />
das umfangreiche Kulturprogramm „Polnischer StuttgART Mai“, das mit 12 Kulturveranstaltungen<br />
im Mai 2005 mehr als 1.500 Besucher(innen) anzog.<br />
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 236 Studierende in Kursen zur Vorbereitung auf<br />
die Deutsche Sprachprüfung <strong>für</strong> den Hochschulzugang (DSH) aufgenommen. Darunter<br />
zählten 25 Programmstudierende der <strong>Universität</strong> Wuhan (China), die innerhalb<br />
eines Jahres den Grund- und Mittelstufenkurs absolvierten. Wie bereits in den Jahren<br />
zuvor kamen mit ca. 60 Prozent die meisten Studierenden aus dem asiatischen<br />
Raum, insbesondere aus China. Ca. 25 Prozent waren türkische Teilnehmer. Beim<br />
Prüfungstermin im März 2005 bestanden 70 Prozent der Teilnehmenden die DSH-<br />
Prüfung. Studierende, die im SS 2005 den Kurs besuchen, legen die Prüfung Ende<br />
September 2005 ab. Den 3-wöchigen Intensivkurs zur Prüfungsvorbereitung besuchen<br />
derzeit 19 Kandidaten. Die Einnahmen aus Gebühren <strong>für</strong> die Sprachkurse betrugen<br />
im WS 2004/2005 und im SS 2005 insgesamt 310.894 EUR.<br />
Die im Januar/Februar 2005 zum ersten Mal stattfindende Winter University wurde<br />
von insgesamt 18 Studierenden besucht, davon 17 aus Australien und ein Teilnehmer<br />
aus Kanada. Da das sprachliche Niveau sehr unterschiedlich war, wurden drei<br />
Deutschkurse angeboten. Unter den Fachkursen wurden die Fächer „European Art &<br />
Architecture“ und „Cross-Cultural Competence“ belegt. Die Teilnehmer waren äußerst<br />
motiviert und interessiert.<br />
An der Summer University in den Monaten Mai und Juni 2005 nahmen 46 Studierende<br />
teil, darunter 34 aus den USA, 3 aus Kanada und 9 aus Singapur. In diesem Jahr<br />
war das sprachliche Leistungsniveau der Teilnehmenden besonders hoch, sodass<br />
erstmalig ein Mittelstufenkurs DaF angeboten werden konnte. Zu den bereits einge-<br />
22
führten Fachkursen wurden zwei weitere – „Urban Planning and Transportation“ und<br />
„Deutschland nach der Wende“ - aufgelegt.<br />
55 Studierende aus aller Welt besuchten den 52. Internationalen Sommersprachkurs<br />
mit dem Themenschwerpunkt „Die moderne Informationsgesellschaft aus technischer<br />
sowie soziologischer Sicht“. Neben vier Sprachkursen (DaF) stieß das dazugehörige<br />
Rahmenprogramm mit Besichtigung des Höchstleistungsrechners auf dem Campus<br />
auf ganz besonderes Interesse.<br />
Im Sommersemester 2005 nahmen 110 Teilnehmer aus 28 Ländern am Deutschkurs<br />
teil. Die meisten Studierenden kamen aus Spanien (34); es folgten mit Abstand jene<br />
aus der Türkei (18). Der Kurs umfasste 180 Stunden.<br />
Der Intensivkurs im Wintersemester 2005 zählt 245 Teilnehmer, darunter 165 aus<br />
dem ERASMUS-/Overseas-Programm und 66 aus Masterstudiengängen. 13 Teilnehmer<br />
kommen über den DAAD aus Argentinien und Indien. Besonders stark vertreten<br />
sind in diesem Semester Teilnehmer aus Spanien, Frankreich und den USA.<br />
Die Abteilung organisierte insgesamt 12 Sprachkurse – von der Grundstufe bis zur<br />
Oberstufe.<br />
Das Ziel, jedem zweiten Studierenden der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> einen Studienaufenthalt<br />
im Ausland zu ermöglichen, ist und bleibt eine Herausforderung. Eine Steigerung<br />
der Anzahl von Plätzen <strong>für</strong> unsere Studierenden an Partnerhochschulen ist nur im<br />
Reziprokverfahren denkbar. Unsere Aktivitäten mit der Summer und auch Winter University<br />
zielen darauf ab. Als weitere Maßnahmen in dieser Richtung sind zu nennen<br />
ein ‚Enhanced Summer Semester’, das vor allem nordamerikanischen Studierenden<br />
ermöglichen soll, nach dem intensiven Sprachprogramm im Winter das anschließende<br />
Sommersemester zu belegen. Auf diese Weise stehen <strong>Stuttgart</strong>er Studierenden<br />
rechnerisch weitere sog. Tuition Waiver <strong>für</strong> ein Studienjahr in Amerika zur Verfügung.<br />
Speziell <strong>für</strong> die National University of Singapore (NUS) wird ein zusätzliches Sprachprogramm<br />
konzipiert. Zudem sollten mittelfristig Maßnahmen zur Verbesserung des<br />
englischsprachigen Angebots an Vorlesungen und Übungen folgen.<br />
In 2005 ist das Interesse an Auslandsaufenthalten in Australien weiterhin angestiegen.<br />
Durch die Teilnahme australischer Studierender an der Winter University konnten<br />
weitere Austauschplätze an unseren Partnerinstitutionen gewonnen und Kooperationsabkommen<br />
mit zwei neuen <strong>Universität</strong>en in Australien vereinbart werden. Es<br />
wird dadurch ein erheblicher Anstieg von outgoings im Jahr 2006 erwartet. 2005 gilt<br />
als Übergangsjahr. 6 Studierende gingen an unsere Partnerhochschulen in South<br />
Australia, 2 an die University of Melbourne und 2 an die DEAKIN University.<br />
Die zur Verfügung stehenden Plätze im Rahmen der Austauschprogramme mit unseren<br />
asiatischen Partnerhochschulen konnten 2004 nahezu ausgeschöpft werden. 6<br />
Studierende nahmen an den Programmen mit Japan und 7 Studierende an den Programmen<br />
mit Singapur teil. Durch Umstrukturierungen hat eine Partnerhochschule in<br />
Südafrika die Austauschplätze stark reduziert, so dass lediglich 5 Studierende die<br />
Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes an den Partnerinstitutionen in Südafrika<br />
wahrnehmen konnten.<br />
Die Anzahl der Studierenden, die nach Nordamerika vermittelt wurden, ist in den vergangenen<br />
Jahren in etwa konstant geblieben (was der Anzahl der vorhanden Austauschplätze<br />
entspricht): ca. 45 bis 50 Studierende halten sich jährlich im Rahmen<br />
23
einer Direkt- oder Landespartnerschaft in Nordamerika auf. Weitere 25 Studierende<br />
können im Rahmen eines DAAD geförderten ISAP-Programms ihr Studium in den<br />
USA oder Kanada fortsetzen. Für das akademische Jahr 2005/06 ist ein starker Anstieg<br />
von Bewerbungen in den neuen Studiengängen Technologiemanagement und<br />
Fahrzeug- und Motorentechnik festzustellen.<br />
Nachdem im akademischen Jahr 2001/02 erstmals 2 Studierende nach Lateinamerika<br />
(Brasilien) vermittelt werden konnten, konnten diese Zahlen in den Folgejahren<br />
kontinuierlich gesteigert werden. In den akademischen Jahren 2002/03 und 2003/04<br />
waren es jeweils 6 und im Jahr 2004/05 waren es bereits 9 Studierende, die an den<br />
neuen Partnerhochschulen in Argentinien, Chile und Mexiko studiert haben. Für das<br />
akademische Jahr 2005/06 ist das Bewerbungsverfahren noch nicht abgeschlossen.<br />
Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Zahlen kräftig ansteigen werden: Schon<br />
jetzt steht fest, dass 11 Studierende aus allen Fachbereichen im WS 05/06 in Lateinamerika<br />
studieren werden und <strong>für</strong> das SS 2006 ist mit einigen weiteren Bewerbungen<br />
zu rechnen. Die Studienangebote in Lateinamerika werden von den Studierenden<br />
der ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge sehr gut nachgefragt. Es ist davon<br />
auszugehen, dass dieser Trend sich fortsetzt, da die Rückmeldungen bzgl. der Qualität<br />
der Ausbildung an den Partnerhochschulen durchweg positiv sind und verschiedene<br />
neue Studienangebote existieren.<br />
Innerhalb Europas haben ca. 210 Studierende der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> an den Programmen<br />
Sokrates/Erasmus (186), <strong>für</strong> ein bzw. zwei Auslandssemester, sowie Leonardo<br />
da Vinci, im Rahmen eines Praktikums der EU, teilgenommen. Die Anzahl der<br />
angebotenen Doppeldiplom-Programme mit Frankreich (insgesamt 6) und Spanien<br />
(2) wird in nächster Zeit um vier weitere Grands Ecoles erweitert werden.<br />
Im Berichtszeitraum besuchten 40 ausländische Delegationen unsere <strong>Universität</strong> und<br />
neue universitätsweite Partnerschaftsverträge wurden mit der University of British<br />
Columbia (Kanada), der Universidad de Chile sowie der Universidad Catòlica de Chile,<br />
beide Santiago, mit dem Harbin <strong>Institut</strong> of Technology (China), der TU Dalian<br />
(China), der Purdue University, der University of Tennessee und der University of<br />
Oklahoma (alle USA) abgeschlossen.<br />
24
4 Bericht aus dem Bereich Forschung und Technologie<br />
4.1 Spezielle Aufgaben des Prorektors Forschung und Technologie<br />
Das Prorektorat Forschung und Technologie wurde im Berichtszeitraum wesentlich<br />
durch die Vorbereitung der Anträge im Rahmen der Exzellenzinitiative bestimmt. Dabei<br />
wurde sowohl intern mit den Koordinatoren der Graduiertenschulen und Exzellenzcluster<br />
als auch mit den maßgeblichen Stellen bei DFG und Wissenschaftsrat<br />
enger Kontakt gesucht, um <strong>für</strong> die <strong>Universität</strong> ein kohärentes und aussichtsreiches<br />
Konzept zu entwickeln. Siehe auch<br />
Darüber hinaus wurde die Evaluation der Stiftungsprofessur Heiz- und Raumlufttechnik<br />
vorbereitet und begleitet.<br />
4.2 Senatsausschuss Forschung und Technologie<br />
Der Senatsausschuss Forschung und Technologie trat im Wintersemester 2004/05<br />
einmal und im Sommersemester 2005 zweimal zusammen.<br />
Die Sitzung im Oktober 2004 war der Sichtung und Bewertung der Anträge im Rahmen<br />
der Exzellenzinitiative gewidmet. Es lagen Anträge <strong>für</strong> 9 Exzellenzcluster und 3<br />
Graduiertenschulen vor. Siehe hierzu im Einzelnen Ziffer 4.3.<br />
Die Sitzung im April 2005 diente der Information des Senatsauschusses in seiner<br />
neuen Zusammensetzung über die allgemeine forschungspolitische Situation - insbesondere<br />
die ‚Zukunftsoffensive des Landes’ und das Forschungsschwerpunktprogramm<br />
- und über den Sach- und Entscheidungsstand in Sachen Exzellenzinitiative.<br />
Auf der Tagesordnung der Sitzung im Juli 2005 stand die Vorauswahl der Anträge<br />
zum Forschungsschwerpunktprogramm des Landes, die an das Ministerium weitergeleitet<br />
werden sollten. Dem Senatsausschuss lagen insgesamt 19 Anträge vor, von<br />
denen 8 Anträge aus den Bereichen Modellierung und Simulation, Seiltechnik, Softwaretechnik,<br />
Lasertechnik, Geologie und Geschichte <strong>für</strong> eine Weiterleitung an das<br />
Ministerium ausgewählt wurden.<br />
4.3 Exzellenzinitiative<br />
Der Senatsausschuss Forschung und Technologie hatte bereits in seiner Sitzung im<br />
Oktober 2004 neun Anträge <strong>für</strong> Exzellenzcluster und drei Anträge auf Einrichtung<br />
von Graduate Schools behandelt. Der Senatsausschuss empfahl,<br />
• die beiden materialwissenschaftliche Projekte ‚Organisierte Materialsysteme’<br />
und ‚ Werkstoffe und Fertigungstechnologien <strong>für</strong> die Produkte der Zukunft’ zu<br />
einem Exzellenzcluster zusammenzufassen<br />
• zu prüfen, ob die Anträge ‚Mobilität und Kommunikation’ und ‚Energie und<br />
Mobilität’ zu einem gemeinsamen Exzellenzcluster mit ‚Mobilität’ als Leitthema<br />
zusammengefügt werden können.<br />
25
• im Exzellenzcluster ‚Simulation Technology: From Models to Interaction’ den<br />
Aspekt der Modellierung noch stärker herauszuarbeiten durch Kombination mit<br />
dem Antrag ‚Verlässliche komplexe Systeme’.<br />
• den Antrag ‚Licht und Materie’ um eine vertiefte Prüfung der Konkurrenzsituation<br />
zu ergänzen.<br />
Die drei vorgelegten Anträge auf Einrichtung von Graduate Schools wurden zur Ausarbeitung<br />
empfohlen.<br />
Zwei weitere Anträge wurden nicht zur Ausarbeitung im Rahmen der Exzellenzinitiative<br />
empfohlen.<br />
Nach Überarbeitung der Anträge im Sinne der durch den Senatsausschuss ausgesprochenen<br />
Empfehlungen wurde der DFG im Juli 2005 gemeldet, dass die <strong>Universität</strong><br />
<strong>Stuttgart</strong> die folgenden sieben Voranträge plant:<br />
• Exzellenzcluster Licht und Materie<br />
• Exzellenzcluster SimTech<br />
• Exzellenzcluster Verlässliche komplexe Systeme<br />
• Exzellenzcluster Information und Kommunikation <strong>für</strong> Mensch und Fahrzeug<br />
• Exzellenzcluster Energie und Mobilität<br />
• Graduiertenschule Systems Biology<br />
• Graduiertenschule Advanced Manufacturing.<br />
4.4 Sonderforschungsbereiche, Transferbereiche, Transregio-Projekte<br />
Derzeit sind sechs Sonderforschungsbereiche, drei Transferbereiche, ein Transregio-<br />
Projekt und eine SFB-Nachwuchsgruppe zum SFB 495 an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
angesiedelt; an einem weiteren Sonderforschungsbereich, deren Sprecher an der<br />
<strong>Universität</strong> Tübingen sitzt, sind <strong>Institut</strong>e der <strong>Universität</strong> beteiligt. (vgl. Anhang A, Tabelle<br />
A1)<br />
Der SFB 382 „Verfahren und Algorithmen zur Simulation physikalischer Prozesse auf<br />
Höchstleistungsrechnern“ (Sprecherhochschule <strong>Universität</strong> Tübingen) wurde bis Ende<br />
2006 verlängert.<br />
Zum SFB 467 „Wandlungsfähige Unternehmensstrukturen <strong>für</strong> die variantenreiche<br />
Serienproduktion“, der 2005 ausläuft, wurde ein Transferbereich und <strong>für</strong> den SFB<br />
495 „Topologie und Dynamik von Signalprozessen“ eine Verlängerung bis 2008 beantragt.<br />
Drei weitere Sonderforschungsbereiche befinden sich im Antragsstadium: ein SFB<br />
‚Katalytische Selektivoxidationen von C-H-Bindungen mit molekularem Sauerstoff’<br />
(<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Organische Chemie), der im August 2005 begutachtet wurde, ein SFB<br />
‚Incremental Specification in Context’, der zunächst mit dem Title ‚Diversity and Dynamics<br />
of Linguistic Representations‘ geplant war (<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Linguistik/Anglistik) und<br />
ein SFB ‚Interplanetare Rückkehrmissionen’ (<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Raumfahrtsysteme), <strong>für</strong> den<br />
in Kürze ein Konzeptpapier bei der DFG eingereicht wird.<br />
Der 2003 beantragte Transferbereich TFB 41 „Entwicklung und Erprobung innovativer<br />
Produkte“, dessen Grundlage die Ergebnisse des SFB 374 bilden, läuft Ende<br />
26
2005 aus. Zwei weitere Transferbereiche, der TFB 51 „Simulation und aktive Beeinflussung<br />
der Hydroakustik in flexiblen Leitungen“ und der TFB 56 „Entwicklung eines<br />
regenerativen Reaktorsystems“ sind zum Jahresbeginn angelaufen.<br />
Des Weiteren sind ein Transregio „Quantenkontrolle in maßgeschneiderter Materie“<br />
(gemeinsam mit den <strong>Universität</strong>en Tübingen und Ulm) und eine SFB-Nachwuchsgruppe<br />
zum SFB 495 „Topologie und Dynamik von Signalprozessen“ zum 1.7.2005<br />
angelaufen.<br />
4.5 Forschungszentren der DFG<br />
Die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> hatte im Juli 2004 im Rahmen des Programms ‚DFG-<br />
Forschungszentren’ jeweils ein Bewerbungskonzept zu den Bereichen ‚Kognitive<br />
Technische Systeme’ und ‚Regenerative Therapien’ (letzteres gemeinsam mit der<br />
<strong>Universität</strong> Tübingen) eingereicht. Der Senat der DFG hat jedoch im Januar 2005<br />
beschlossen, das Thema ‚Kognitive Technische Systeme’ nicht in Form von Forschungszentren,<br />
sondern durch andere geeignete Fördermaßnahmen zu entwickeln.<br />
4.6 EU-Forschungsförderung<br />
Die Drittmitteleinnahmen, die der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> im Rahmen der F&E-Förderung<br />
durch die Europäische Union im Jahre 2004 zuflossen, beliefen sich auf 13,8<br />
Mio. € (Vorjahr: 11,2 Mio. €).<br />
Im Dezember 2002 lief das 6. Forschungsrahmenprogramm (2002-2006) der EU-<br />
Kommission an. Bis Mitte September 2005 konnten insgesamt 95 Verträge mit der<br />
EU-Kommission abgeschlossen werden sowie weitere 20 Konsortialverträge, die der<br />
Vertragsschließung mit der EU-Kommission vorausgehen.<br />
Das Land hat die Antragstellung im Frühjahr 2005 erneut mit Mitteln zur Anschubfinanzierung<br />
gefördert. Hier erhielt die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> 60.000 €, durch die die Antragstellung<br />
<strong>für</strong> insgesamt 20 durch die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> koordinierte Projekte unterstützt<br />
wurde. Ferner wurden aus diesen Mitteln die Vorbereitungen <strong>für</strong> 4 Technologieplattformen<br />
gefördert, die bereits im Hinblick auf das im Jahr 2007 anlaufende 7.<br />
Rahmenprogramm geplant werden.<br />
4.7 Förderung durch die Landesstiftung Baden-Württemberg<br />
Von den bereits im April 2004 zum Eliteförderprogramm <strong>für</strong> Postdoktoranden eingereichten<br />
sieben Anträgen, wurde ein Antrag im November 2004 bewilligt. Eine Entscheidung<br />
über die im Juli 2005 eingereichten fünf Anträge liegt noch nicht vor.<br />
Ende 2004 und im Jahr 2005 konnten ferner bislang Verträge mit der Landesstiftung<br />
über insgesamt 4 Projekte abgeschlossen werden, davon 3 Verträge im Rahmen des<br />
Programms ‚Atomoptik’ und zwei Verträge im Programm ‚Sport – Bewegung - Prävention’.<br />
27
4.8 Existenzgründungen<br />
4.8.1 Aktivitäten innerhalb der <strong>Universität</strong><br />
Unter der Schirmherrschaft des Prorektors <strong>für</strong> Forschung und Technologie wurde<br />
erstmalig eine fakultätsübergreifenden Ringvorlesung „Existenzgründung <strong>für</strong> Akademiker“<br />
mit 2 Semesterwochenstunden und schriftlicher Klausur durchgeführt, die am<br />
28. Oktober 2004 startete und auch <strong>für</strong> Gasthörer geöffnet war. Die erfolgreiche Teilnahme<br />
an der Ringvorlesung wird in den Studiengängen: Elektrotechnik und Informationstechnik,<br />
Informatik, Luft- und Raumfahrttechnik, Maschinenwesen und Softwaretechnik<br />
als Studienleistung anerkannt.<br />
In die inhaltliche Ausgestaltung der Ringvorlesung gingen die Beratungsergebnisse<br />
eines uni-internen Arbeitkreises, die Erfahrungen von Herrn Professor Wehking<br />
mit einer ähnlichen Veranstaltung in der Fakultät 7, die Beratungserfahrungen der<br />
PUSH!-Campus-Agentur TTI GmbH und die Erfahrungen von JungunternehmerInnen<br />
aus der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> ein. Als Referenten wirkten sechs Professoren aus unterschiedlichen<br />
Fakultäten der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> sowie der Inhaber des Stiftungslehrstuhls<br />
Entrepreneurship der <strong>Universität</strong> Hohenheim, vier als Gründungsexperten<br />
ausgewiesene Lehrbeauftragte der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong>, die profundes Praxiswissen<br />
aus Wirtschaft und Industrie einbringen, das Technologie-Lizenz-Büro Baden-<br />
Württemberg GmbH und die TTI GmbH, ergänzt durch Jungunternehmer aus der<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong>. Für die Weiterführung der Ringvorlesung konnten unter dem<br />
Projekttitel "Inkubator an der <strong>Universität</strong>", Fördermitteln des Wirtschaftsministeriums<br />
Baden-Württemberg und aus dem Europäischen Sozialfonds eingeworben werden.<br />
Von Januar bis März 2005G fand der gemeinsam von Professor Zahn (Lehrstuhl <strong>für</strong><br />
Planung, <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong>) und von Professor Müller (SE Hohenheim) durchgeführte<br />
Ideenwettbewerb „Test your ideas“ statt, an dem sich aus der <strong>Universität</strong><br />
<strong>Stuttgart</strong> neun Antragsteller beteiligt haben.<br />
Das Förderprojekt PUSH! wurde in 2006 erfolgreich abgeschlossen. Für Einzelheiten<br />
wird auf den Abschlußbericht verwiesen.<br />
Für das Jahr 2004 wurden neun Existenzgründungen aus den zehn Fakultäten der<br />
<strong>Universität</strong> bekannt (vgl. Anhang A, Tabelle A5).<br />
4.8.2 Technologie-Transfer-Initiative GmbH an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
Die TTI GmbH hat bislang 385 Gründer und Gründerinnen in 326 Gründungsvorhaben<br />
betreut. Es sind bereits über 120 Firmen mit ca. 500 Arbeitsplätzen entstanden.<br />
Im Berichtszeitraum wurden 15 GründerInnen von der TTI im Rahmen des Bundesförderprogramms<br />
„EXIST-SEED“ und zwei Gründer im Rahmen des Landesförderprogramms<br />
„Junge Innovatoren“ gecoacht. Insgesamt gibt es über 80 Patenschaftsverträge<br />
und 26 Transfer- und Gründerzentren (TGZ) von ProfessorInnen sowie<br />
sechs Transfer- und Gründungsunternehmungen (TGU) von ExistenzgründerInnen.<br />
Am 3. Existenzgründertag der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> am 24.06.2005 waren die Gründungsbeauftragten<br />
wieder aktiv als Moderatoren beteiligt. Die TTI war bei der Organisation<br />
und Durchführung der Veranstaltung beteiligt und hat sie als Sponsor unterstützt.<br />
28
Von April 2005 bis Mitte 2007 wird die TTI zusammen mit der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
vom Wirtschaftsministerium im Rahmen des Landesprogramms „Förderung von Existenzgründer/innen<br />
und Inkubatoren an den baden-württembergischen Hochschulen“<br />
gefördert.<br />
Die TTI GmbH wurde weiterhin mit der Projektträgerschaft <strong>für</strong> das Landesprogramm<br />
„Junge Innovatoren“ beauftragt.<br />
Das Gründungsunternehmen [FOLDCORE], eine Ausgründung aus dem <strong>Institut</strong> <strong>für</strong><br />
Flugzeugbau der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong>, hat im Mai 2005 den 1. Platz beim Businessplan-Wettbewerb<br />
Cyberone des bwcon-Netzwerkes erreicht.<br />
4.9 Patent- und Lizenzangelegenheiten<br />
Vom 01.10.2004 bis 31.08.2005 wurden der Zentralen Verwaltung insgesamt 56<br />
neue Erfindungen gemeldet. Hiervon wurden 40 (=71 %) in Anspruch genommen,<br />
was rechtliche Voraussetzung <strong>für</strong> eine nationale und internationale Schutzrechtsanmeldung<br />
ist.<br />
Mehr als die Hälfte der Erfindungsmeldungen wurden an das Technologie-Lizenz-<br />
Büro der Baden-Württembergischen Hochschulen (TLB) zur Prüfung einer wirtschaftlichen<br />
Verwertung weitergeleitet. Soweit das TLB eine Empfehlung zur Patentanmeldung<br />
ausgesprochen hat, wurden die betreffenden Erfindungen in Anspruch genommen<br />
und beim Deutschen bzw. Europäischen Patentamt als Schutzrecht angemeldet.<br />
Im Dezember 2003 endete die 1. Phase des BMBF-Verbundprojekts „Weiterentwicklung<br />
des Patent- und Verwertungswesens von Hochschulen in Baden-Württemberg<br />
im Rahmen der BMBF-Verwertungsoffensive.“ Partner des Verbundprojekts sind<br />
Hochschulen Baden-Württembergs und das Technologie-Lizenz-Büro in Karlsruhe<br />
(TLB). In dieser 1. Projektphase wurden von der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> insgesamt 57<br />
Erfindungsmeldungen an das TLB zur Prüfung einer wirtschaftlichen Verwertung weitergeleitet,<br />
bei 16 Meldungen wurde bislang eine Schutzrechtsanmeldung eingereicht.<br />
Einem Antrag der Projektpartner auf Verlängerung und Weiterförderung hat das<br />
BMBF entsprochen und weiter Mittel <strong>für</strong> die Verwertungsaktivitäten und Schutzrechtsanmeldungen<br />
in Höhe von insgesamt über 1 Mio. Euro <strong>für</strong> die Jahre 2004 bis<br />
2006 bewilligt. Im ersten Jahr dieser Phase II des Projekts (2004) wurden <strong>für</strong> neun<br />
Erfindungen der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> Schutzrechtsanmeldungen eingereicht.<br />
29
5 Stabsstellen des Rektors<br />
5.1 Alumni-Netzwerk „alumnius“<br />
Im Berichtszeitraum Wintersemester 2004/2005 und Sommersemester 2005 wurde<br />
das zentrale Alumni-Netzwerk der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong>, „alumnius“, weiter deutlich<br />
ausgebaut.<br />
5.1.1 Funktion und Profil<br />
Alumni-Netzwerke sind seit einigen Jahren ein fester Bestandteil im Zielkanon von<br />
<strong>Universität</strong>en. Bei allen Unterschieden in ihren Organisations- und Rechtsformen,<br />
macht sich ihre zentrale Bedeutung und Funktion an den folgenden gemeinsamen<br />
Aspekten fest: a) Imagebildung der <strong>Universität</strong> durch die Multiplikatoren Alumni in<br />
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, b) Praxiskontakte <strong>für</strong> Studierende und AbsolventInnen<br />
über die Alumni-Kontakte, c) Nachfrage nach Weiterbildungsangeboten durch<br />
Alumni, d) Fundraising und Vernetzung der Alumni.<br />
Die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> verfügt seit 2001 über eine Alumni-Stabsstelle, das zentrale<br />
Alumni-Netzwerk „alumnius“.<br />
alumnius versteht sich als das weltweite Kommunikations- und Servicenetzwerk der<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong>, das auf der Grundlage des Leitbilds der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> zur<br />
Zukunftsfähigkeit der <strong>Universität</strong> beiträgt. In diesem Sinne fördert alumnius sowohl<br />
den interkulturellen Austausch und die weltweite Vernetzung der Alumnae und Alumni<br />
als auch den Informations- und Wissenstransfer zwischen der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
und Unternehmen, Organisationen und <strong>Institut</strong>ionen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.<br />
Das Alumni-Netzwerk wendet sich mit einem breiten klientelspezifischen<br />
Angebot an Ehemalige, Freunde und Förderer der <strong>Universität</strong>. In gezielter Erweiterung<br />
dieser Zielgruppen wird auch Studierenden und <strong>Universität</strong>sangehörigen die<br />
Möglichkeit zur Mitgliedschaft geboten. Sie können über das Netzwerk den Austausch<br />
mit Ehemaligen der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> herstellen und am Service- und<br />
Kommunikationsangebot partizipieren.<br />
Die Angebote von alumnius umfassen eine Vielzahl von Aktivitäten, die den wechselseitigen<br />
Kontakt und Erfahrungsaustausch der Alumnae und Alumni fördern, und auf<br />
diese Weise die lebenslange Verbindung zueinander und zur gemeinsamen Alma<br />
Mater erhalten. Mit alumnius eröffnet die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> einerseits allen Ehemaligen<br />
die Möglichkeit, aktiv den Kontakt mit ihrer Alma Mater zu pflegen. Auf der anderen<br />
Seite bietet alumnius allen Studierenden einen besonderen institutionellen<br />
Rahmen, um wertvolle Kontakte zu Ehemaligen, Freunden und Förderern zu knüpfen.<br />
Für Freunde und Förderer stellt alumnius zudem eine universitätsweite Plattform<br />
bereit, um Projekte in Forschung und Lehre zu unterstützen und persönliches Engagement<br />
gezielt einzubringen.<br />
5.1.2 Kooperation und Koordination<br />
Das Alumni-Netzwerk kooperiert mit universitätsinternen und externen Partnern. Ziel<br />
ist die Vernetzung und Bündelung themenrelevanter Services <strong>für</strong> Alumnae und Alumni<br />
der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> sowie die Förderung des wechselseitigen Informations-<br />
und Wissenstransfers.<br />
30
5.1.2.1 Interne Kooperationen<br />
Im Berichtszeitraum wurde die Kooperation und Zusammenarbeit mit allen Bereichen<br />
und Einrichtungen der <strong>Universität</strong> fortgeführt. Im Einzelnen ging es um die folgenden<br />
Themenbereiche: Transfer von fachlichen und allgemeinen Informationen; Anfragen<br />
Ehemaliger zu Weiterbildungsangeboten; Anfragen zu Informationen rund um das<br />
Thema Existenzgründung; Anfragen zu Forschungskooperationen; Anfragen zu Stellen-,<br />
Praktikums- und Diplomarbeitsangeboten; Informationen zu Veranstaltungen;<br />
Versand von Publikationen; Betreuung von Besucherinnen und Besuchern; persönliche<br />
Beratung von Alumnae und Alumni.<br />
Die Kooperation mit den zehn Fakultäten der <strong>Universität</strong> wurde weitergeführt und die<br />
Kommunikation der Alumni-Themen in die Fakultäten und <strong>Institut</strong>e weiter gefördert.<br />
Bei Absolventenfeiern wurden jeweils Informationen zum Alumni-Netzwerk bereit gestellt<br />
und die Erläuterung des Alumni-Programms in die Referentenbeiträge integriert.<br />
Der Versand des alumnius-Informationsflyers an Absolventen/innen durch das Prüfungsamt<br />
und durch <strong>Institut</strong>e, jeweils zusammen mit den Abschlusszeugnissen, wurde<br />
fortgesetzt.<br />
Die Unterstützung des Alumni-Netzwerks bei themenrelevanten Initiativen in den <strong>Institut</strong>en<br />
wurde wiederum intensiv angefragt. Im Berichtszeitraum fand u. a. im Studiengang<br />
Politikwissenschaft an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> eine Online-Absolventenbefragung<br />
statt, die von alumnius unterstützt wurde. Von den Ergebnissen solcher<br />
Studien können sowohl die aktuell Studierenden profitieren als auch Anregungen <strong>für</strong><br />
künftige Planungen und Entwicklungen im jeweiligen Studiengang abgeleitet werden.<br />
Die <strong>Institut</strong>e nutzten wiederum die Kommunikationsplattform des Alumni-Netzwerks,<br />
um bei besonderen wissenschaftlichen Projekte und Veranstaltungen die Mitglieder<br />
des Alumni-Netzwerks gezielt anzusprechen.<br />
5.1.2.2 Externe Kooperationen<br />
Im Berichtszeitraum wurde die Kooperation mit der Vereinigung von Freunden der<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> e.V. (VFUS) weiter fortgeführt.<br />
alumnius und die VFUS verfolgen als Kooperationspartner das gemeinsame Ziel einer<br />
nachhaltigen Förderung der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong>. In dem traditionsreichen Förderverein<br />
der <strong>Universität</strong> hat alumnius in den letzten Jahren einen wichtigen Partner<br />
gefunden. Durch die Kooperation wurde ein leistungsstarkes Paket geschnürt, mit<br />
dem zum einen die Informations- und Service-Plattformen von alumnius effektiv genutzt<br />
und zum anderen das Förderprogramm der VFUS gezielt aufgebaut werden<br />
kann.<br />
Im Bereich der Mitgliedergewinnung werben beide Kooperationspartner wechselseitig<br />
<strong>für</strong> die Partner-Organisation, u.a. über die Homepage. Im Berichtszeitraum wurde der<br />
gemeinsame Info-Flyer von alumnius und der Vereinigung von Freunden an alle Mitglieder<br />
der VFUS versandt. Im Jahresheft 2005 der VFUS ist alumnius mit einem Beitrag<br />
über das Alumni-Netzwerk präsent. Ebenso wurde in die Ausgabe 2005 des Alumni-Magazins<br />
ein Beitrag über die Vereinigung von Freunden aufgenommen. Der<br />
Druck der Ausgabe 2005 wurde von der VFUS gefördert.<br />
Neben der Kooperation mit der VFUS bestehen weitere strategische Kooperationen<br />
mit externen Partnern im Alumni-Sektor.<br />
Regional ist alumnius u.a. Gründungsmitglied im Arbeitskreis der Career-Services<br />
baden-württembergischer Hochschulen. Im Rahmen dieses Arbeitskreises werden<br />
Maßnahmen zur wechselseitigen Unterstützung zwischen den Hochschulen und Uni-<br />
31
versitäten in Baden-Württemberg im Themenbereich „Career-Service“ entwickelt und<br />
implementiert. Im Berichtszeitraum wurde das Projekt eines gemeinsamen Internet-<br />
Portals aller baden-württembergischen Hochschulen zum Thema Career-Services<br />
weiter entwickelt, alumnius war Organisator eines Arbeitskreistreffens.<br />
Überregional ist alumnius aktives Mitglied im Dachverband der Alumni-Organisationen<br />
alumni-clubs.net e.V., mit Teilnahme an der jährlichen Konferenz der Alumni-<br />
Manager aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Berichtszeitraum lag zudem<br />
die Teilnahme an der Jahreskonferenz von CASE, der europäischen Dachorganisation<br />
<strong>für</strong> den Bildungssektor, mit Schwerpunkt auf Alumni-Relations, Fundraising<br />
und Bildungsmarketing.<br />
Weitere themenspezifische Kooperationen werden in den folgenden Unterpunkten<br />
aufgeführt.<br />
5.1.3 Kommunikation und Information<br />
Im Berichtszeitraum wurden vielfältige Kontakt-, Informations-, Beratungs- und Weiterbildungsservices<br />
bereitgestellt und weiter entwickelt: Online-Kontaktplattformen<br />
auf der alumnius-Homepage (Suchen&Finden-Website etc.), Informationen zu ausgewählten<br />
Veranstaltungen (Online-Veranstaltungskalender etc.), Einladungen zu<br />
Veranstaltungen (Tag der Wissenschaft, Vorträge, Veranstaltungen der Fakultäten<br />
und deren Alumni-Clubs etc.), Vermittlung von Beratungsangeboten <strong>für</strong> ExistenzgründerInnen<br />
(in Kooperation mit der TTI-GmbH), Vermittlung von wissenschaftlichen<br />
Weiterbildungsangeboten (in Kooperation mit der KWW) und aktuelle Informationen<br />
über Aktivitäten und Entwicklungen an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> (Versand von Publikationen<br />
etc.).<br />
5.1.3.1 Info-Service, Datenbank<br />
Die Internetplattform des Alumni-Netzwerks wurde im Berichtszeitraum in allen Themenbereichen<br />
(News&Events, Info-Service, Career-Service, Alumni-Clubs, Mitgliederschnittstelle)<br />
aktualisiert und erweitert. Ihr kommt als wichtiges Informationsmedium<br />
sowie als Kundengewinnungs- und Kundenbindungsinstrument besondere Bedeutung<br />
zu.<br />
Im Berichtszeitraum wurde die Alumni-Datenbank aktualisiert und erweitert. Die Online-Mitgliederschnittstelle<br />
der Datenbank auf der Alumni-Homepage (Web-Interface)<br />
wurde von den Mitgliedern sehr gut angenommen und genutzt, um Datenaktualisierungen<br />
vorzunehmen und Informationen abzufragen.<br />
In einem umfangreichen Aktualisierungsprojekt mit der Deutschen Post AG wurden<br />
Datenbestände überprüft und aktualisiert. Im Berichtszeitraum wurde <strong>für</strong> die Internetplattform<br />
und die Datenbank des Alumni-Netzwerks ein eigener Alumni-Server eingerichtet,<br />
der vom Rechenzentrum der <strong>Universität</strong> betrieben wird.<br />
Das Alumni-Netzwerk beteiligt sich an einem Projekt der HIS Hochschul-Informations-System<br />
GmbH und ist Mitglied der Lenkungsgruppe zur Entwicklung eines spezifischen<br />
Datenbankmoduls <strong>für</strong> die Alumni-Arbeit an Hochschulen.<br />
Der Online-Newsletter des Alumni-Netzwerks hat sich im Berichtszeitraum als<br />
schnelles und aktuelles Informationsmedium etabliert. Die Ausgaben erscheinen vierteljährlich<br />
und bieten jeweils in einem Rück- und Vorblick Neuigkeiten aus dem Alumni-Programm,<br />
aktuelle Informationen aus Forschung und Lehre, ausgewählte<br />
Personalia, ausgewählte Veranstaltungshinweise und Highlights rund um die Univer-<br />
32
sität. Die Ausgaben des Newsletters stehen nach dem Versand an die Abonnenten<br />
auch auf der Alumni-Homepage zur Verfügung.<br />
Im Berichtszeitraum wurde das Alumni-Magazin 2004 publiziert. Die Sonderausgabe<br />
berichtete unter dem Titel „Retrospektive: Alumni-Tag und<br />
<strong>Universität</strong>sjubiläum“ über den ersten Alumni-Tag der<br />
<strong>Universität</strong> im Jubiläumsjahr 2004. Themenschwerpunkt<br />
war die Dokumentation der Podiumsdiskussion mit<br />
prominenten Gästen zum Thema „Wege in die Zukunft:<br />
Visionen und Modelle <strong>für</strong> die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong>“ beim<br />
Alumni-Tag. Weitere Beiträge boten eine Rückblick auf<br />
ausgewählte Veranstaltungen und Projekte des <strong>Universität</strong>sjubiläums<br />
(Abbildung 1: Alumni-Magazin 2004). Neben<br />
der Printausgabe ist das Alumni-Magazin zusätzlich in<br />
einer Online-Version und als PDF-Datei auf der<br />
Homepage des Alumni-Netzwerks verfügbar und kann<br />
von Interessenten in aller Welt abgerufen werden.<br />
5.1.3.2 Veranstaltungen<br />
Beim Tag der Wissenschaft der <strong>Universität</strong> in 2005 hatte das Alumni-Netzwerk zum<br />
jährlichen Netzwerk-Treffen auf dem Campus eingeladen. Die Mitglieder des Alumni-<br />
Netzwerks nutzten die Gelegenheit, beim alumnius-Treffpunkt auf der Festwiese in<br />
Vaihingen Kontakte zu knüpfen und neueste Informationen zum Alumni-Programm<br />
der <strong>Universität</strong> zu erhalten. Alumnae und Alumni hatten zugleich die Möglichkeit, ihre<br />
früheren <strong>Institut</strong>e und Fakultäten zu besuchen. Neue Interessenten erhielten am Infostand<br />
des Alumni-Netzwerks Informationen und konnten sich vor Ort als Mitglied<br />
online anmelden.<br />
Im Berichtszeitraum wurde zudem ein Alumni-Treffen in der Fakultät Maschinenbau<br />
organisatorisch unterstützt und vorbereitet.<br />
Als neues Angebot <strong>für</strong> Studierende und Absolventen bot das Alumni-Netzwerk im<br />
Wintersemester 2004/2005 erstmals ein professionelles Bewerbungstraining mit renommierten<br />
Referenten an. Erfahrene Personalberater gaben Informationen und<br />
Tipps rund um den Bewerbungsprozess. Die Teilnehmer erhielten umfangreiches<br />
Informationsmaterial und hatten Gelegenheit zu persönlicher Beratung. Nach dem<br />
großen Erfolg und Interesse an dieser Veranstaltung wurde das kostenfreie Abendseminar<br />
auch im Sommersemester 2005 veranstaltet. Kooperationspartner war die<br />
Süddeutsche Zeitung. Die Veranstaltungsreihe soll fortgesetzt werden.<br />
Das Alumni-Netzwerk präsentierte sich im Berichtszeitraum wiederum bei verschiedenen<br />
Veranstaltungen mit Informationsmaterial und Beratungsangeboten, u. a. bei<br />
der Erstsemesterbegrüßung „Avete Academici“ und bei der Jahresfeier der <strong>Universität</strong>.<br />
5.1.3.3 Career-Service<br />
Im Berichtszeitraum wurden der Online-Stellenmarkt wie auch die Praktika- und Diplomarbeitsbörse<br />
auf der Homepage des Alumni-Netzwerks weiter ausgebaut. Der<br />
stets aktuelle Online-Stellenmarkt wurde zunehmend nachgefragt. Zugleich wurde<br />
diese Plattform als Marketinginstrument eingesetzt, um externe Anbieter nach Alumni-Kontakten<br />
in ihrem Unternehmen zu befragen und Mitglieder <strong>für</strong> das Alumni-<br />
Netzwerk zu werben.<br />
33
Als neuer Service wurde ein professionelles Bewerbungstraining <strong>für</strong> Studierende und<br />
Absolventen mit großem Erfolg durchgeführt (s. Erläuterung unter 5.1.3.2).<br />
In Kooperation mit dem Career Service der <strong>Universität</strong> Hohenheim bietet das Alumni-<br />
Netzwerk Studierenden der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> als zusätzlichen Service die Möglichkeit,<br />
an speziellen Career Service-Angeboten der <strong>Universität</strong> Hohenheim teilzunehmen.<br />
In Kooperation mit der TTI-GmbH bietet die Alumni-Homepage ständig erweiterte Informationsseiten<br />
zu erfolgreichen Alumni-Unternehmen und Alumni-Existenzgründern/innen<br />
an und informiert über die vielfältigen Angebote der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
<strong>für</strong> Gründerinnen und Gründer.<br />
In Kooperation mit der Kontaktstelle <strong>für</strong> Wissenschaftliche Weiterbildung (KWW) versendet<br />
das Alumni-Netzwerk Informationen der KWW an bestimmte Zielgruppen. Auf<br />
der Alumni-Homepage werden zudem die Weiterbildungsangebote der <strong>Universität</strong><br />
auf einer eigenen Plattform beworben, u. a. das Mentoringprogramm.<br />
5.1.3.4 Alumni-Clubs<br />
Im Berichtszeitraum wurden weitere Organisationen und Initiativen in die Liste der<br />
beim zentralen Alumni-Netzwerk registrierten Alumni-Organisationen der <strong>Institut</strong>e<br />
und Einrichtungen der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> aufgenommen.<br />
Das Alumni-Netzwerk leistet Unterstützung und Beratung bei der Gründung neuer<br />
Alumni-Clubs und bei Alumni-Initiativen. Im Berichtszeitraum hat die Fakultät Luft-<br />
und Raumfahrttechnik und Geodäsie mit dem "Verein der Freunde der Luft- und<br />
Raumfahrttechnik der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> e.V." einen neuen fakultätsweiten Alumni-<br />
Verein gegründet. Im <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen ist ein<br />
Förderverein in Gründung.<br />
Im Berichtszeitraum wurde auf der Alumni-Homepage eine weitere Plattform mit<br />
Links zu den vielfältigen Alumni-Initiativen der Fakultäten und <strong>Institut</strong>e eingerichtet.<br />
Sie ergänzt die Plattform der Alumni-Clubs und Fördervereine.<br />
5.1.4 Fazit<br />
Die im Berichtszeitraum durchgeführten Maßnahmen haben sich als sehr gut geeignet<br />
erwiesen, sowohl den interkulturellen Austausch und die weltweite Vernetzung<br />
der Alumnae und Alumni der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> herzustellen und zu vertiefen als<br />
auch den Informations- und Wissenstransfer zwischen der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> und<br />
Unternehmen, Organisationen und <strong>Institut</strong>ionen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft<br />
zu fördern.<br />
34
5.2 Koordinierungsstelle <strong>für</strong> Wissenschaftliche Weiterbildung<br />
5.2.1 Allgemeines<br />
Im Berichtzeitraum Wintersemester 2004/2005 bis zum Sommersemester 2005 werden<br />
je Semester zwischen 110 bis 130 Weiterbildungsveranstaltungen durchgeführt.<br />
Der Studienführer Wissenschaftliche Weiterbildung erscheint in einer Auflage von<br />
2500 Exemplaren. Zusätzlich können die Veranstaltungen im Netz abgefragt werden.<br />
Das Veranstaltungsprogramm <strong>für</strong> Wissenschaftler und Existenzgründer wird seit<br />
2003 im Studienführer Wissenschaftliche Weiterbildung und im Trainingsprogramm<br />
beworben.<br />
5.2.2. Programmentwicklung Seminare <strong>für</strong> Fach- und Führungskräfte<br />
aus Wirtschaft und Industrie<br />
Seit Beginn des Jahres 2004 kooperiert die KWW eng mit dem SIMT (<strong>Stuttgart</strong> <strong>Institut</strong><br />
of Management and Technology). Der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> und der KWW steht<br />
somit eine attraktive Plattform zur Vermarktung, Durchführung und der marktgerechten<br />
Abrechnung von kostenpflichtigen Angeboten, wie Seminaren, Workshops und<br />
Fachtagungen zur Verfügung.<br />
Mit dem gemeinsamen Programm wird folgende Zielsetzung verfolgt:<br />
� Reagieren auf aktuelle gesellschaftliche Bedürfnisse durch Expertenwissen<br />
� Reagieren auf aktuelle Kundenbedürfnisse in den Industrieunternehmen<br />
� professionelle Vermarktung von bereits existierenden Weiterbildungsveranstaltungen<br />
aus der <strong>Universität</strong><br />
5.2.2.1 Zielgruppen der Veranstaltungen<br />
Zielgruppen sind Fach- und Führungskräfte aus den Branchen:<br />
Baufirmen, Ingenieurbüros im Umweltbereich, Rohstoff erzeugende und verarbeitende<br />
chemische Industrie, Fertigungsunternehmen, Kraftwerksindustrie, chemisch/petrochemische<br />
Industrie, Dichtungen herstellende Industrie, Energiewirtschaft, Maschinenbaufirmen,<br />
Medizintechnikunternehmen, Software-Entwicklungsfirmen.<br />
5.2.3. Programmentwicklung <strong>für</strong> den wissenschaftlichen Mittelbau und<br />
<strong>für</strong> Gründungsinteressierte<br />
Für Wissenschaftler und Existenzgründer existiert seit Beginn des Jahres 2003 ein<br />
dreistufiges zielgruppenorientiertes Trainingsprogramm. Es richtet sich an die Zielgruppen:<br />
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Projektverantwortliche,<br />
Führungskräfte und Gründungsinteressierte. Je Zielgruppe bietet das Programm ein<br />
Einstiegs-Modul, verschiedene Werkstatt-Module und Kolleg-Module. Insgesamt<br />
werden ca. 30 Seminarthemen angeboten, die je nach Bedarf ein oder zweimal pro<br />
Jahr durchgeführt werden. Neu in der Planung ist eine Projektmanagementreihe im<br />
Kolleg-Modul-Bereich, Internationales Projektmanagement, Distance Leadership,<br />
Verteiltes Projektmanagement usw.<br />
35
5.2.4 Ausweitung des Kundenstammes<br />
Die positive Resonanz aus den Seminaren hat dazu geführt, dass einzelne <strong>Institut</strong>e<br />
institutsinterne Weiterbildungsmaßnahmen bei der KWW buchen. Die Inhalte werden<br />
dann ganz speziell auf die Bedarfe des <strong>Institut</strong>es zugeschnitten. Zudem kommen<br />
vermehrt Aufträge von Sonderforschungsbereichen und Graduierten Kollegs. Dies<br />
führt mittelfristig dazu, dass auch andere <strong>Universität</strong>en auf das KWW Programm<br />
aufmerksam werden. Auch hier war der Bedarf an individuell auf die Gruppe abgestimmten<br />
Themen und Konzepten sehr hoch.<br />
5.2.5. <strong>Universität</strong>sinterne Kooperationen<br />
Die KWW engagiert sich stark in der Arbeitsgruppe „Existenzgründung“, die vom Prorektor<br />
<strong>für</strong> Forschung und Technologie geleitet wird. Die KWW hat seit 2003 zusammen<br />
mit dem Dekan <strong>für</strong> Luft- und Raumfahrttechnik die Projektleitung <strong>für</strong> den Existenzgründertag<br />
inne. Ungefähr 200 Studentinnen und Studenten haben im Jahr<br />
2003, 2004 und 2005 am Gründertag teilgenommen. 10 hochkarätige Professoren<br />
konnten zur intensiven Zusammenarbeit mit der KWW bewegt werden. Dies ist ein<br />
riesiger Erfolg <strong>für</strong> das Konzept. Der Existenzgründertag wird sich als fester Termin im<br />
Uni-Kalender etablieren.<br />
5.2.5.1 Interne Kooperationen zur Stärkung des wissenschaftlichen Angebotes<br />
und des Trainingsprogramms<br />
Bereich E-Learning: Im Zuge der <strong>Universität</strong>sprojekte 100-online und self study online<br />
sind eine Vielzahl von online-Lehrgängen in Arbeit. Diesbezüglich bestehen zwischen<br />
der KWW und dem Rechenzentrum der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> enge Kontakte.<br />
Bereich Lehrerweiterbildung: Die Lehrerweiterbildung ist momentan in der konzeptionellen<br />
Ausarbeitung durch den Prorektor <strong>für</strong> Lehre und Weiterbildung. Er wird sich an<br />
die KWW wenden, wenn Inhalte vorliegen.<br />
Beide Bereiche würden der KWW den Eintritt in neue Marktsegmente ermöglichen.<br />
Die KWW würde eine geeignete Plattform zur Vermarktung und Abrechnung der<br />
Lerneinheiten bieten.<br />
5.2.5.2 Kooperation mit dem Dezernat Personal<br />
Die Themen der Seminare <strong>für</strong> wissenschaftliche Bedienstete der <strong>Universität</strong> werden<br />
mit der im Dezernat Personal angesiedelten Stelle <strong>für</strong> Fort- und Weiterbildung (<strong>für</strong><br />
nicht wissenschaftliche Mitarbeiter) abgestimmt. Seit Herbst 2003 plant die KWW<br />
zusammen mit dem Dezernat Personal die Einführungsveranstaltung <strong>für</strong> neue Mitarbeiter.<br />
Ziel dieser Veranstaltung ist es, die neuen Mitarbeiter aus Verwaltung und<br />
Forschung in die inneruniversitären Strukturen ein zu weisen und ihnen somit den<br />
Einstieg in den neuen Arbeitsplatz zu erleichtern. Die Veranstaltung ist sehr gut besucht<br />
und wird jährlich abgehalten.<br />
5.2.5. Externe Kooperationen<br />
5.2.5.1 Zusammenarbeit mit der <strong>Universität</strong> Hohenheim<br />
Die bereits seit 2000 bestehende Kooperation mit der <strong>Universität</strong> Hohenheim wird im<br />
Berichtszeitraum 2002 bis 2004 vertieft und weiter ausgebaut. Um sich den Kunden-<br />
36
wünschen verstärkt an zu passen, werden nun ergänzend zum Kompaktkurs 3-4 Vertiefungsbausteine<br />
zu unterschiedlichsten Themen angeboten. Seit WS 2004/05 kooperieren<br />
die KWW der Uni <strong>Stuttgart</strong> und Hohenheim auch im Bereich des Trainingsprogramms.<br />
Dies hat zu einer erhöhten Teilnehmerzahl im Bereich des Trainings<br />
<strong>für</strong> Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geführt. Diese Kooperation wird<br />
künftig auf die TU Karlsruhe ausgeweitet.<br />
5.2.5.2 Kooperationen mit PUSH!<br />
Im Bereich der Betreuung und Unterstützung der Existenzgründerinnen und -gründer<br />
aus der <strong>Universität</strong> verstärkt die KWW die Kooperation mit PUSH! durch neue Seminarkonzepte<br />
und den Existenzgründertag und gemeinsamen Außenauftritt. Intensiviert<br />
wird die Anzahl der Kursstarts und die Module zur intensiven Betreuung und<br />
Unterstützung der Gründer.<br />
5.3 Marketing<br />
5.3.1. Zentrale Maßnahmen<br />
5.3.1.1 Jubiläum<br />
Im Berichtszeitraum gehörte neben den regulären Aufgabenfeldern die Planung und<br />
Durchführung des 175-jährigen Jubiläums zu den wesentlichen Aufgaben der Stabsstelle<br />
Marketing. In der zentralen AG Koordination übernahm sie Koordinierungsaufgaben<br />
und Strategieentwicklung und war hinsichtlich organisatorischer Fragestellungen<br />
Ansprechpartner <strong>für</strong> alle weiteren Jubiläums-Arbeitsgruppen. Zudem lag die Abstimmung<br />
und die Abwicklung von Vereinbarungen mit den Sponsoren und Spendern<br />
in ihrem Aufgabenbereich.<br />
Auch <strong>für</strong> die Auswahl geeigneter Kommunikationsmaßnahmen sowie deren komplette<br />
Betreuung im Produktions- und Verteilungsprozess war die Stabsstelle Marketing<br />
verantwortlich. Beim grafischen Gesamtauftritt des Jubiläums wurde Wert auf ein<br />
einheitliches visuelles Erscheinungsbild gelegt, so waren Jubiläumslogo und Zeitleiste<br />
wiederkehrende Gestaltungselemente. Auch wurde durch innovative Formate und<br />
Verarbeitung der Werbematerialien das Jubiläums-Motto „Innovation ist Tradition“<br />
sowie die Betonung des „jungen“ Jubiläums anschaulich umgesetzt.<br />
Visualisiert wurde das Jubiläums in Stadt und Region durch folgende Kommunikationsmaßnahmen:<br />
- Jubiläumsplakat: Thema „feiert175“<br />
- Plakate zu Jubiläumsveranstaltungen bzw. -projekten: Uni Inside, Jubiläumsball<br />
- Einladungskarten zu Jubiläumsveranstaltungen: Uni Inside, Jubiläumsball<br />
- Webauftritt zum Jubiläum<br />
- Jubiläumsfahnen, eingesetzt auf dem Campus und während des Jubiläumsballes<br />
vor dem Kultur- Kongreßzentrum Liederhalle<br />
- Sponsorenflyer sowie -display<br />
- Streuartikel: Ballons, Aufkleber, s`Württembärle<br />
Die Stabsstelle Marketing war bei der Vorbereitung und Durchführung der Jubiläumsveranstaltungen<br />
„Jubiläumsball“ und „Uni Inside“ beratend, konzipierend, und<br />
37
koordinierend involviert und evaluierte beide Veranstaltungen. Die Mitarbeiterveranstaltung<br />
„Uni Inside“ fand großen Anklang. Nach bereits rückläufigen Besucherzahlen<br />
in den letzten Jahren lag die Zahl der Gäste beim diesjährigen Ball mit rund 900<br />
erstmalig unter der 1.000er-Marke. Der Uniball wird aus diesem Grund bis auf weiteres<br />
nicht mehr durchgeführt.<br />
5.3.1.2 Corporate Design<br />
Die Aktivitäten <strong>für</strong> eine stärkere Harmonisierung des visuellen Erscheinungsbildes<br />
der <strong>Universität</strong> wurden im Berichtszeitraum durch den vermehrten Einsatz des Corporate<br />
Design Handbuchs intensiviert. Für den nationalen und internationalen Bildungsmarkt<br />
wurden verschiedene Werbematerialien wie Poster, Informationsbroschüren<br />
etc. auf der Basis des Corporate Designs <strong>für</strong> eine öffentlichkeitswirksame<br />
sowie einheitliche Außendarstellung entwickelt.<br />
5.3.1.3 Printmaterialien / Außenauftritt von Abteilungen, <strong>Institut</strong>ionen und Einrichtungen<br />
Für den nationalen Bildungsmarkt produzierte die Stabsstelle Marketing in enger Zusammenarbeit<br />
mit der Zentralen Studienberatung Informationsmaterialien wie die<br />
Broschüre „Studieren an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong>“, den Flyer „Unitag“ sowie die Programme<br />
zum „Schnupperstudium - Vorlesungen <strong>für</strong> Schüler-/ innen“ oder „Info - Veranstaltungen<br />
<strong>für</strong> Studieninteressierte“ und die Informationsbroschüre „Bachelor und<br />
Master an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong>“.<br />
Für Studieninteressierten und Erstsemester hat die Stabsstelle Marketing gemeinsam<br />
mit dem Rechenzentrum, der <strong>Universität</strong>sbibliothek und der Zentralen Studienberatung<br />
eine informative und unterhaltsame CD rund um den Studienanfang konzipiert.<br />
Für den internationalen Bildungsmarkt wurde die auf der Broschüre „Studieren an der<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong>“ basierende Broschüre „Study Programs“ neu überarbeitet. Der<br />
Relevanz englischsprachiger Studiengänge sowie der Umstrukturierung der Studienabschlüsse<br />
wurde insbesondere durch die Integration einer Übersichtstabelle über<br />
die möglichen Studienabschlüsse pro Studienfach Rechnung getragen. Die Broschüre<br />
wurde durch die Stabsstelle Marketing an Multiplikatoren in aller Welt versandt.<br />
Auf gleiche Weise, aber auch auf Messen wurde der englischsprachige Flyer „International<br />
Master´s Programs“ interessierten ausländischen Studierenden zugänglich<br />
gemacht.<br />
Erstmalig nahm die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> auch an dem von Gate Germany (DAAD)<br />
initiierten Projekt „qualifying in Germany“ teil, das ausländische Studieninteressierte<br />
bzw. Postgraduierte über das Studienangebot an deutschen Hochschulen informieren<br />
soll: Die Stabsstelle Marketing koordinierte hierbei die Bereitstellung sämtlicher<br />
Informationen über die internationalen Masterstudiengänge sowie über das PhD-<br />
Programm der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong>. Dieses im Detail geschilderte englischsprachige<br />
Studienangebot wird zusätzlich zu den herkömmlichen Informationen auf der DAADhomepage<br />
verfügbar gemacht, ist auch über den link www.qualifying-ingermany.de<br />
erreichbar und wird auf eine CD-Rom geschrieben und ab Dez. 2005 in<br />
einer Auflage von 90.000 Stk. über den DAAD weltweit verteilt.<br />
38
5.3.1.4 Anzeigenschaltung<br />
Bei der Schaltung von Anzeigen in zielgruppenrelevanten Printmedien wurde primär<br />
das Ziel verfolgt, das Profil der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> der Zielgruppe Studieninteressierte<br />
zu vermitteln, dabei wurde meist neben einer Anzeige auch ein redaktioneller<br />
Beitrag gebucht. Ein weiteres Ziel war, die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppen auf<br />
die Messepräsenz der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> zu lenken.<br />
Publikation<br />
Regionalsausgabe ZukunftBeruf (Rhein-<br />
Neckar-Raum)<br />
ADAC-Stadtplan <strong>Stuttgart</strong> spezialgefaltet,<br />
5. Auflage<br />
Messezeitung der azubi- & studientage,<br />
<strong>Stuttgart</strong> 2005<br />
Job – Berufe mit Zukunft (Esslingen/Göppingen)<br />
Ausg.03/05<br />
Messeplaner zur EINSTIEG ABI, Karlsruhe<br />
2005<br />
Scientific American Sonderbeilage: Baden<br />
Württemberg: At The Technology Heart of<br />
Europe<br />
Countdown-Starthilfe zur Berufswahl<br />
(Sachsen)<br />
Job – Berufe mit Zukunft<br />
(Stuttg./Ludwigsburg) Ausgabe 08/05<br />
Falk-Stadtplan <strong>Stuttgart</strong>/Mittl. Neckar 12.<br />
Auflage<br />
Berufswahlheft <strong>Stuttgart</strong> (Großraum <strong>Stuttgart</strong>)<br />
Ziel<br />
Reichweite Auflage<br />
Neukunden-<br />
Akquisition<br />
National 40.000<br />
Neukunden-<br />
Akquisition<br />
National 10.000<br />
Neukunden-<br />
Akquisition<br />
Regional 45.000<br />
Neukunden-<br />
Akquisition<br />
Regional 16.000<br />
Neukunden-<br />
Akquisition<br />
National 20.000<br />
Imagewerbung International 700.000<br />
Neukunden-<br />
Akquisition<br />
Regional 50.000<br />
Neukunden-<br />
Akquisition<br />
Regional 16.000<br />
Imagewerbung National<br />
25.000<br />
Neukunden-<br />
Akquisition<br />
Tabelle 1: Anzeigenschaltung in Printmedien im Berichtszeitraum<br />
5.3.2 Veranstaltungen<br />
Regional 30.000<br />
Im Berichtszeitraum war die Stabsstelle Marketing in diverse Projekte und Veranstaltungen<br />
der <strong>Universität</strong> und ihrer Einrichtungen involviert. Dabei umfasste das Aufgabenspektrum<br />
Beratung, Konzeption, Durchführung und Evaluation von Marketing-<br />
Maßnahmen. So wurden unter anderem Vermarktungskonzepte <strong>für</strong> die „Avete Academici“<br />
und den „Dies Academicus“ maßgeblich von ihr vorbereitet und umgesetzt.<br />
Als Kommunikationsinstrumente wurden unter anderem Plakate, Informationsbroschüren<br />
und Internetpräsenzen eingesetzt.<br />
Für den Dies Academicus, ab 2005 ‚Jahresfeier’, entwickelte die Stabsstelle Marketing<br />
im Berichtszeitraum ein neues Konzept. Da auch das Veranstaltungsmanagement<br />
<strong>für</strong> die Jahresfeier 2005 bei ihr liegen wird, fiel in den Berichtszeitraum bereits<br />
ein erheblicher Teil der Organisationsaufgaben.<br />
Im Hinblick auf die Großveranstaltung „Tag der offenen Tür“ wurde im Berichtszeitraum<br />
eine Modifizierung des Veranstaltungskonzepts notwendig – dies ergab die Evaluation<br />
der Veranstaltung. Die Stabsstelle Marketing nahm in Absprache mit dem<br />
Hauptkoordinator vor allem Änderungen beim Titel der Veranstaltung sowie beim<br />
Veranstaltungszeitraum und -ablauf vor. Der „Tag der Wissenschaft - Wissenschaft<br />
39
entdecken“ fand am 18. Juni 2005 statt und lockte ca. 10.000 Besucher an. Erstmals<br />
fand im Anschluss an die Informations- und Beratungsveranstaltung die „Science<br />
Party“ statt, die als fester Bestandteil zukünftig in den „Tag der Wissenschaft“ integriert<br />
werden soll. Im Berichtszeitraum begann auch die Planung <strong>für</strong> die „Lange Nacht<br />
der Wissenschaft“ 2006, bei der das Thema „Fußball und WM“ aus wissenschaftlicher<br />
Perspektive betrachtet wird. Im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft soll diese<br />
Nacht am 7. Juli 2006, dem Vortag des Viertelfinalspiels, stattfinden. Sollte die „Lange<br />
Nacht“ erfolgreich sein, ist <strong>für</strong> die nächsten Jahre geplant, den „Tag der Wissenschaft“<br />
und die „Lange Nacht“ in jährlichem Wechsel stattfinden zu lassen.<br />
Im Berichtszeitraum wurde die Ehrenbürgerwürde der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> an zwei<br />
Persönlichkeiten verliehen: Suzanne Mubarak (Nov. 2004) und Manfred Rommel<br />
(Mai 2005). Hier war die Stabsstelle Marketing einerseits <strong>für</strong> die Konzeption und Abwicklung<br />
von Einladungskarten und Programmheft zuständig und wesentlich in die<br />
Koordination der von der <strong>Universität</strong>sbibliothek veröffentlichen Redebeiträge im Band<br />
„Reden und Aufsätze“ involviert. Andererseits lag aber auch das Veranstaltungsmanagement<br />
in ihrer Zuständigkeit, das sie als Organisator und Koordinator <strong>für</strong> beide<br />
Festveranstaltungen - in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit der persönlichen<br />
Referentin des Rektors - wahrnahm.<br />
5.5.3 Science Truck<br />
Der Science Truck „<strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> mobil“ wurde im Rahmen des Jubiläums<br />
2004 <strong>für</strong> eine direkte Zielgruppenansprache und <strong>für</strong> öffentlichkeitswirksame Präsentationen<br />
angeschafft. Insbesondere im Hinblick auf Neueinschreibungen ist der<br />
Science Truck, mit der Möglichkeit zu Vor-Ort-Einsätzen an den Gymnasien Baden-<br />
Württembergs, ein sehr gutes Mittel, um die Zielgruppe der Oberstufenschüler zu<br />
erreichen. Hierbei können einzelne <strong>Institut</strong>e, wie beispielsweise das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Mechanische<br />
Verfahrenstechnik es bereits praktiziert, direkt auf dem Schulgelände über<br />
das Studium und die Studiengänge an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> mit Exponaten und<br />
Broschüren aufklären. Da Einsätze des Science Trucks stark wetterabhängig sind,<br />
finden diese vor allem in den warmen Monaten des Jahres statt. Im Berichtszeitraum<br />
waren dies insgesamt vier Einsätze bei:<br />
- dem Wissenschaftssommer 2004 in <strong>Stuttgart</strong> (Ausführende: IFF),<br />
- der Woche der Technik in Göppingen (Ausführende: IBVT / IMVT),<br />
- Gymnasien in Waiblingen und Aalen (Ausführende: IMVT),<br />
- dem Stadtfest in Göppingen (Ausführende: IRS).<br />
- Mittel- und langfristiges Ziel ist es, die Nutzungshäufigkeit weiter zu erhöhen.<br />
5.3.4 Bildungsmessen<br />
National war die <strong>Universität</strong> im April 2005 auf den „Azubi- & Studientagen“ in <strong>Stuttgart</strong><br />
sowie auf der „Einstieg Abi“ in Karlsruhe vertreten.<br />
Die rund 38.000 Besucher der zweitägigen “Azubi- und Studientage“ setzten sich<br />
zusammen aus Schülerinnen und Schülern der letzten beiden Jahrgangsstufen aller<br />
Schularten aus der Region <strong>Stuttgart</strong> sowie Eltern und LehrerInnen. Entsprechend der<br />
heterogenen Zielgruppe präsentierte sich die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong>: Neben dem Studienangebot<br />
der <strong>Universität</strong>, vertreten durch die Mitarbeiter der Zentralen Studienberatung,<br />
an einem der Tage aber auch durch Dozenten des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> Sportwissenschaften<br />
und des Betriebswirtschaftlichen <strong>Institut</strong>s, wurden auch die Ausbildungsbe-<br />
40
ufe an der <strong>Universität</strong> durch den Ausbilderkreis vorgestellt. Beide Bereiche zogen<br />
großes Besucherinteresse auf sich.<br />
Auf der Abiturientenmesse „Einstieg Abi“ in Karlsruhe war die <strong>Universität</strong> mit der<br />
Zentralen Studienberatung sowie durch einen Vertreter des <strong>Institut</strong>s A <strong>für</strong> Mechanik<br />
vertreten. Ca. 19.000 Schülerinnen und Schüler aus Süddeutschland besuchten diese<br />
Messe. Das Interesse an den Angeboten der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> war sehr gezielt.<br />
Die Teilnahme an den internationalen Bildungsmessen verfolgte die Zielsetzung, die<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> auf dem internationalen Bildungsmarkt zu positionieren und Studierende<br />
mit guter Vorbildung auf das Angebot an internationalen Master-<br />
Studiengängen der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> aufmerksam zu machen.<br />
Die von der Stabsstelle Marketing vorbereitete und geplante Messebeteiligung auf<br />
der „Career 2005“ in Singapur im März 2005 musste aufgrund plötzlichen Erkrankens<br />
des Leiters der Internationalen Angelegenheiten leider abgesagt werden. Bewirkt<br />
werden konnte aber, dass die bereits versandten Materialen auf dem Messestand<br />
des DAAD verfügbar gemacht wurden.<br />
Im April 2005 präsentierte sich die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> auf den vom DAAD als übergeordneten<br />
Koordinator besuchten und unter dem Titel „Posgrado Europeo“ zusammengefassten<br />
Bildungsmessen und Multiplikatorentreffen in den beiden mexikanischen<br />
Städten Monterrey und Mexiko und dem venezolanischen Caracas. Insbesondere<br />
die Veranstaltungen in Mexiko schienen dabei als besonders lohnend, da<br />
Deutschland hier neben Frankreich das begehrteste europäische Zielland <strong>für</strong> ein<br />
Auslandsstudium ist und seitens der Messebesucher, d.h. der mexikanischen Studierenden,<br />
ein ausgeprägtes Interesse an Masterstudiengängen bestand. Die Messebesucher<br />
der in Venezuelas Hauptstadt fortgesetzten ‚DAAD-Messe’ zeigten eher ein<br />
allgemeines Interesse an Deutschland als Studienland.<br />
Bewährt hat sich bei den Messeauftritten in Mexiko und Venezuela die Einbindung<br />
eines Verantwortlichen der internationalen Masterstudiengänge als aktiven Messebesucher:<br />
So reiste der Course Director von WASTE gemeinsam mit einem gebürtigen<br />
Kolumbianer, der MIP-Absolvent und derzeitiger <strong>Stuttgart</strong>er Doktorand ist.<br />
Fachwissen, Auskünfte über das bei den Masterstudiengängen übliche Bewerbungsprozedere<br />
sowie die ‚testimonials’ des Doktoranden boten überzeugende Anknüpfungspunkte<br />
<strong>für</strong> die Messegespräche.<br />
An der internationalen Multiplikatorenkonferenz NAFSA in Seattle (Washington) mit<br />
über 5000 Besuchern nahm die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> Ende Mai bis Anfang Juni 2005<br />
teil. Die Stabsstelle Marketing unterstütze, wie auch bei den vorgenannten Messen,<br />
durch die Bereitstellung geeigneter Werbe- und Informationsmaterialien.<br />
5.3.5 Kooperationen mit externen Partnern<br />
Ebenfalls in den Berichtszeitraum fällt die Kooperation mit der Baden-Württemberg<br />
International GmbH, kurz: bw-i. So initiierte die Stabsstelle Markteing im Vorfeld der<br />
Hannover Industriemesse 2005 ein Rundschreiben an sämtliche <strong>Institut</strong>e zur Möglichkeit<br />
einer Beteiligung am Gemeinschaftsstand der bw-i . Die Resonanz war erfreulich,<br />
es beteiligten sich das IKP, das IMS Chips, sowie die TTI/TGU Smart Mode.<br />
Umgekehrt nutzte die Stabsstelle Marketing das Angebot der bw-i, Informationsmaterialien<br />
<strong>für</strong> die Zielgruppe ausländische Studierende auf den zahlreichen Auslandsveranstaltungen<br />
der bw-i auszulegen und versorgte sie regelmäßig mit den entsprechenden,<br />
oben bereits genannten Materialien.<br />
41
Für das <strong>Stuttgart</strong> <strong>Institut</strong>e of Management and Technology ließ die Stabsstelle Marketing<br />
im Berichtszeitraum internationale Messedisplays anfertigen, die längerfristig<br />
als Image-Werbeträger der <strong>Universität</strong> beim SIMT aufgestellt bleiben sollen.<br />
Auch <strong>für</strong> die GUC koordinierte die Stabsstelle Marketing die Anfertigung und Bereitstellung<br />
internationaler Messedisplays, die Anfang Oktober 2005 bei den German<br />
Open Days in Kairo, aber auch langfristig als Hingucker und Image-Werbeträger das<br />
Interesse dortiger Studierender auf die Uni <strong>Stuttgart</strong> lenken soll.<br />
Seit vier Jahren bietet die Aktion „Notebooks for Students“ in Kooperation mit den<br />
Herstellern HP, IBM, Apple und Fujitsu-Siemens Studierenden und Mitarbeitern der<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong>, aber auch umliegender Hochschulen, Qualitätsnotebooks zu<br />
attraktiven Preisen an. Ziel der Aktion ist es, Studierenden den Zugang zu virtuellen<br />
Lehrveranstaltungen zu ermöglichen. Die Stabsstelle Marketing konzipiert dieses<br />
Projekt und ist <strong>für</strong> die Koordination desselben zuständig. Sie ist verantwortlich <strong>für</strong> die<br />
Aktionswochen zu jedem Semesterbeginn und sorgt <strong>für</strong> alle relevanten Kommunikationsmaßnahmen<br />
wie Rundschreiben, Internetpräsenz, Handzettel, seit Oktober 2004<br />
erstmalig auch Plakate. Ebenfalls neu ist die der Evaluation dienende Studierendenbefragung,<br />
die im SS05 online durchgeführt wurde.<br />
Gemeinsam mit der Landeshauptstadt <strong>Stuttgart</strong> und den Hochschulen <strong>Stuttgart</strong>s war<br />
die Stabsstelle Marketing auch im Berichtszeitraum wieder in die Planung der Veranstaltung<br />
<strong>für</strong> Studierende des ersten Semesters, der "Welcome Week" im Oktober<br />
2004 involviert. Die Veranstaltung erstreckt sich über fünf Tage, richtet sich sowohl<br />
an inländische als auch ausländische Studierende aller Hochschulen der Region<br />
<strong>Stuttgart</strong> und präsentiert den Studienstandort <strong>Stuttgart</strong> mit all seinen Facetten, um<br />
insbesondere den so genannten weichen Standortfaktoren Rechnung zu tragen.<br />
42
6 Zentrale Einrichtungen<br />
6.1 <strong>Universität</strong>sbibliothek<br />
6.1.1 Universitäres Bibliothekssystem<br />
Die <strong>Universität</strong>sbibliothek bildet zusammen mit 124 <strong>Institut</strong>sbibliotheken das Bibliothekssystem<br />
der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong>. Weitere Teilbibliotheken konnten in die Zentralbibliothek<br />
in der Stadtmitte und Vaihingen integriert und so die Rolle der UB als<br />
Informations- und Servicezentrum zur Literatur- und Dokumentenversorgung der <strong>Universität</strong><br />
ausgebaut und gestärkt werden. Um diese Entwicklung erfolgreich weiterführen<br />
zu können, benötigt die UB dringend einen Erweiterungsbau in der Stadtmitte.<br />
Sie hat deshalb, in Absprache mit dem <strong>Universität</strong>sbauamt, einen entsprechenden<br />
Antrag an das Rektorat gestellt. Dessen Realisierung wird insbesondere wegen der<br />
Raumsituation im KII immer dringlicher. Die UB hat im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen<br />
des KII die Koordination <strong>für</strong> alle dort untergebrachten bibliothekarischen Einrichtungen<br />
übernommen und leistet dem Dezernat Technik und Bauten sowohl bei<br />
der Neugestaltung als auch zur Organisation der Interimszeit Zuarbeit. Die UB übernimmt<br />
im Vorfeld der Sanierung des KII wesentliche Bestände von den <strong>Institut</strong>sbibliotheken,<br />
um die Umzugskosten und die durch die <strong>Universität</strong> während der Sanierungszeit<br />
anzumietenden Flächen möglichst gering zu halten.<br />
Die Zusammenarbeit zwischen der UB und dem Rechenzentrum der <strong>Universität</strong> wurde<br />
im vergangenen Jahr weiter intensiviert. Die in den regelmäßig stattfindenden<br />
“Quartalstreffen” entwickelten strategischen Konzepte haben eine noch engere Integration<br />
der Dienstleistungen beider Einrichtungen zum Ziel.<br />
6.1.2 Etat<br />
Die Etatsituation hat sich gegenüber 2004 leicht verbessert. Es hat sich jedoch gezeigt,<br />
dass die aufgrund der geringen Mittel deutlich eingeschränkten Erwerbungen<br />
der letzten Jahre die Informationsversorgung insgesamt beeinträchtigen. Das macht<br />
sich vor allem in einem deutlich erhöhten Fernleihaufkommen bemerkbar.<br />
Aussagen zum Etat der <strong>Institut</strong>sbibliotheken beruhen auf den Meldungen der <strong>Institut</strong>e<br />
zur Deutschen Bibliotheksstatistik (DBS) an die UB. Danach sind auch die Erwerbungsmittel<br />
der <strong>Institut</strong>e in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Auch dies<br />
hat zu einer Verschlechterung der Literaturversorgung der <strong>Universität</strong> beigetragen.<br />
Die Erwerbung im Bibliothekssystem der <strong>Universität</strong> muss deshalb noch stärker koordiniert<br />
und sollte konsequenterweise in der UB konzentriert werden. Vorbereitend<br />
wird die UB ihr bisheriges Etatmodell verändern und in Zukunft zu Fachetats übergehen.<br />
Damit wird die Möglichkeit geschaffen, <strong>für</strong> die einzelnen Fächer – und damit die<br />
Lehreinheiten – gemeinsam mit den <strong>Institut</strong>en Gesamtetats aufzubauen und zu verwalten.<br />
43
6.1.3 Bestand<br />
Der Bestand der UB umfasst gegenwärtig ca. 1,5 Mio. Medieneinheiten an den beiden<br />
zentralen Standorten. Die Retrokonversion, d.h. die rückwärtige Formalerschließung<br />
im OPAC der UB konnte abgeschlossen werden. Damit ist der gesamte Bestand<br />
elektronisch nachgewiesen und recherchierbar. Es wird jetzt damit begonnen<br />
die Bestände der 124 <strong>Institut</strong>sbibliotheken mit insgesamt ca. 900.000 Bänden retrospektiv<br />
zu katalogisieren, sodass zukünftig alle rund 2,4 Millionen Medieneinheiten<br />
im Bibliothekssystem der <strong>Universität</strong> elektronisch erschlossen sind. Laufend werden<br />
von der UB 2.625 Zeitschriften in nicht elektronischer Form bezogen, davon werden<br />
1.362 gekauft, den Rest erhält die UB im Tausch oder als Geschenk. Weitere 3.215<br />
Print-Zeitschriften werden an den <strong>Institut</strong>sbibliotheken geführt mit einem hohen Anteil<br />
Geschenk und Tausch. Die Beteiligung an der “Elektronischen Zeitschriftenbibliothek<br />
(EZB)” in Regensburg wurde weiter ausgebaut, sodass jetzt über dieses komfortable<br />
Zugangssystem 13.856 wissenschaftliche Zeitschriften in elektronischer Form als<br />
Volltext <strong>für</strong> Angehörige der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> zugänglich sind. Viele dieser Titel<br />
sind en bloc im Rahmen sog. Aggregatordatenbanken erworben worden. Seit Januar<br />
2005 sind auch die DIN-Normen in elektronischer Form im Volltext verfügbar.<br />
6.1.4 Nutzung und Dienstleistungen<br />
Im Jahr 2004 waren 24.027 aktive Benutzer an der UB eingeschrieben (+10,9%). Sie<br />
tätigten rund 699.000 Entleihungen (+4,9%). Da die Nutzung elektronischer Angebote<br />
nicht an ein Benutzungsverhältnis mit der UB gekoppelt ist, liegt die tatsächliche<br />
Zahl der Nutzer von Bibliotheksdienstleistungen wesentlich höher. Die Nutzung elektronischer<br />
Angebote ist im Berichtsjahr um 5% auf rund 100.000 Sessions gestiegen.<br />
Der Ausbau der Dienstleistungen wird immer stärker auf elektronische Dienste fokussiert,<br />
was gerade von dem im “öffentlichen” Bereich tätigen Personal hohe Einsatz-<br />
und Innovationsbereitschaft verlangt.<br />
Das Erwerbungssystem LIBERO hat sich im Monographienbereich bewährt und<br />
konnte in vielfacher Weise die Planung und Durchführung der Erwerbung transparenter<br />
gestalten. Durch den Einsatz der neueren Version 5 kann nun auch das LIBERO-<br />
Zeitschriftenmodul genutzt werden. Mit der Erfassung der Zeitschriften-Basisdaten<br />
wurde begonnen.<br />
Die Dienstleistung “InfoMail”, die über vorgemerkte und fällige Medien informiert und<br />
bei der rd. 19.000 Nutzer angemeldet sind (Steigerung gegenüber 6/2004 um 36%),<br />
wird weiterhin mit ca. 1.500 E-Mails pro Tag stark genutzt.<br />
Die Rechercheoberfläche des Online-Katalogs BISSCAT wurde weiter entwickelt.<br />
Schwerpunkte waren der E-Mail-Versand von Trefferlisten, die verbesserte Darstellung<br />
von <strong>Institut</strong>skatalogen (auch Neuerwerbungslisten) sowie der komfortable Zugang<br />
zu Fernleihbestellungen. Da der Südwestdeutsche Bibliotheksverbund (SWB)<br />
zum Jahresende 2005 auf das neue PICA-System wechselt, wurde mit ersten Überlegungen<br />
zu einem Ablösesystem <strong>für</strong> BISSCAT begonnen. In Frage kommt eine lokale<br />
bzw. regionale Sicht auf den PICA-Verbund-OPAC oder das Nachfolgesystem<br />
des derzeit in Betrieb befindlichen Systems HORZON.<br />
44
Die Nutzung der Online-Fernleihe der UB stieg auch im Berichtszeitraum weiterhin<br />
stark an. Sämtliche Fernleihbestellungen (Monographien und Aufsätze) werden mittlerweile<br />
mit dem beschleunigten Bestellverfahren über den zentralen Fernleihserver<br />
beim SWB-Verbund abgewickelt und Bestellungen auf Monographien ggf. automatisiert<br />
an andere Verbünde weitergeleitet. Interne Arbeitsabläufe wurden weiter automatisiert.<br />
Das uniinterne Dokumentliefersystem LEA hat sich bewährt und wurde weiter ausgebaut.<br />
Es ist nun möglich, Aufsätze direkt aus online-Datenbanken (der Anbieter Ovid/Silverplatter<br />
und Ebsco) zu bestellen, sofern der Zeitschriftentitel an der UB<br />
gehalten wird.<br />
Der landesweite ReDI-Dienst (Regionale Datenbank-Informationen), dessen Standort<br />
<strong>Stuttgart</strong> gemeinsam von der UB und dem Rechenzentrum der <strong>Universität</strong> betrieben<br />
wird, läuft wie in den vergangenen Jahren stabil. Angehörige der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
können damit 301 bibliographische Fakten- und Volltextdatenbanken nutzen. Der<br />
Zugang zu diesen und weiteren Datenbanken wurde durch das neu eingeführte Datenbank-Informationssystem<br />
(DBIS) wesentlich verbessert und erleichtert.<br />
Das elektronische Volltextinformationssystem OPUS wird mittlerweile an 48 weiteren<br />
Hochschulen und von drei Bibliotheksverbünden (BSZ, KOBV und HBZ) eingesetzt.<br />
Aufgrund des breiten Anwenderkreises und der damit verbundenen differenzierteren<br />
Anforderungen wird im November 2005 eine neue Version (3.0) des Systems ausgeliefert.<br />
Diese wird auch in Zukunft kontinuierlich an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst<br />
werden. Für elektronische Dissertationen ist OPUS an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
gut etabliert. In Zukunft sollen auch verstärkt weitere wissenschaftliche Publikationen<br />
(Preprints, Postprints von Zeitschriftenaufsätzen, Konferenzbeiträgen u.ä.) dort erfasst<br />
und im Volltext zugänglich gemacht werden. Das Rektorat hat hierzu im Januar<br />
2005 die Einrichtung einer Arbeitsgruppe elektronisches Publizieren an der <strong>Universität</strong><br />
beschlossen.<br />
6.1.5 Planungen und Projekte<br />
Unmittelbar vor der Realisierung steht die Umgestaltung der Kataloghallen in der<br />
Stadtmitte und in Vaihingen, um die Selbstabholung durch Benutzer einführen zu<br />
können und mehr Buchstellfläche <strong>für</strong> die Freihandbibliotheken zu schaffen. Gleichzeitig<br />
kann durch diese Maßnahme das Angebot an Computerarbeitsplätzen ausgebaut<br />
werden. Im Bereich Stadtmitte werden Leihstelle und Auskunft in einem integrierten<br />
Informationsbereich zusammengefasst. Hier wird im Oktober 2005 mit den Bauarbeiten<br />
begonnen, im Bereich Vaihingen im November. Dort werden zusätzlich ein Videokonferenzraum<br />
und ein Schulungsbereich eingerichtet, die auch von anderen <strong>Universität</strong>seinrichtungen<br />
genutzt werden können.<br />
Im Rahmen des universitären Projekts „elektronischer Studierendenausweis“ strebt<br />
die UB an, mit der Immatrikulation ein Nutzungsverhältnis <strong>für</strong> die Studierenden (aktiv<br />
nutzbares Konto) zu begründen. Der Vorteil <strong>für</strong> die Studierenden ist, dass sie alle<br />
webbasierten Dienste (z.B. Vormerkungen, Bestellungen, Fernleihe) der UB nutzen<br />
können, ohne sich vorher persönlich in der UB anmelden zu müssen. Hierzu wird<br />
gegenwärtig mit der ZV und dem RUS ein Verfahren <strong>für</strong> den notwendigen Datenaustausch<br />
erarbeitet.<br />
45
Die Portalsoftware SISIS/Elektra, mit der eine übergreifenden Recherche in Beständen<br />
des BISSCAT (wissenschaftliche Bibliotheken) und öffentlicher Bibliotheken aus<br />
der Region <strong>Stuttgart</strong> möglich ist, soll zum WS 2005/06 mit der “Regionalsicht <strong>Stuttgart</strong>”<br />
in Routinebetrieb übergehen.<br />
Das EU-Projekt GRACE wurde im Frühjahr 2005 abgeschlossen. Ein erster Prototyp<br />
der Grid-basierten Suchmaschine ist verfügbar. Das Projekt zeigte, dass gegenwärtige<br />
Grid-Middleware wie LCG oder Globus interaktive Anwendungen wie Suchmaschinen<br />
noch nicht ausreichend unterstützen.<br />
Das 2004 begonnene Verbundprojekt ARCHE (“Entwicklung eines Farbmikrofilm-<br />
Laserbelichters zur Langzeitarchivierung digitaler bzw. digitalisierter Dokumente in<br />
Verbindung mit einem Workflow <strong>für</strong> die Erstellung und Digitalisierung von Farbmikrofilmen”),<br />
an dem die UB beteiligt ist, macht Fortschritte. Ein “Warenkorb” der zu digitalisierenden<br />
Bestände aus verschiedenen Archiven Baden-Württembergs, der UB<br />
und des <strong>Universität</strong>sarchivs wurde zusammengestellt und teilweise bereits mit verschiedenartigen<br />
Scannern digitalisiert. Erste Tests mit einer neu entwickelten Software<br />
<strong>für</strong> den Workflow wurden durchgeführt.<br />
Das externe WWW-Angebot der UB wurde kontinuierlich überarbeitet und soll zur<br />
einfacheren Handhabung und Pflege auf das Content-Management-System TYPO3<br />
umgestellt werden. Die Intranet-Seiten der UB sind weitgehend auf ein WiKi-System<br />
umgestellt worden.<br />
Mit Beginn des Wintersemesters 2005/06 wird die UB ihren Benutzerinnen und Benutzern<br />
ein neues Konzept zur Stärkung der Informationskompetenz anbieten. Neben<br />
den bisher bereits angebotenen allgemeinen Einführungen in die Bibliotheksbenutzung<br />
treten fachspezifische Bibliotheksführungen ebenso wie themenorientierte<br />
Veranstaltungen zu bestimmten Angeboten der UB und relevanten Entwicklungen im<br />
Bereich des wissenschaftlichen Publikationswesens.<br />
6.1.5 <strong>Universität</strong>sarchiv<br />
Im Dezember 2004 wurde das zweite Buch zum <strong>Universität</strong>sjubiläum „Die <strong>Universität</strong><br />
<strong>Stuttgart</strong> nach 1945. Geschichte, Entwicklungen, Persönlichkeiten (hg. v. N. Becker<br />
u. F. Quarthal) fertig gestellt und der Öffentlichkeit präsentiert. Im Berichtszeitraum<br />
fanden 147 Benutzungen statt (Anfragen und Besucher) und 32 Aktenbestände wurden<br />
in das Archiv übernommen, darunter 7 Nachlässe. Anfang 2005 überschritt die<br />
Menge der im <strong>Universität</strong>sarchiv verwahrten Archivalien die Grenze von 1.000 lfd.<br />
Regalmetern. Die im letzten Rechenschaftsbericht erwähnten Rückstände in der Bearbeitung<br />
der Dokumentation konnten inzwischen durch eine Kraft aus der Zentralbibliothek<br />
(10 Std. wöchentlich) aufgearbeitet werden. Im August 2005 erhielt das<br />
Archiv eine Stelle des mittleren Verwaltungsdienstes, wodurch sich die personelle<br />
Situation erheblich verbessert. Seit Juli 2005 stellt das <strong>Universität</strong>sarchiv Online-<br />
Findbücher zur Verfügung, die den Archivbenutzern über die Recherchemöglichkeit<br />
in der Online-Bestandsübersicht hinaus gehende, komfortable Recherchemöglichkeiten<br />
in einzelnen Archivbeständen vom heimischen Arbeitsplatz aus ermöglichen.<br />
46
6.2 Rechenzentrum <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> (RUS)<br />
Wie im <strong>Universität</strong>sgesetz formuliert, fördert, betreibt und betreut das Rechenzentrum<br />
der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> im Rahmen eines kooperativen Versorgungskonzeptes<br />
die digitale Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik an der <strong>Universität</strong><br />
<strong>Stuttgart</strong>. Es plant, berät und koordiniert die grundlegenden Konzepte <strong>für</strong> die Informationsversorgung<br />
sowohl <strong>für</strong> Soft- als auch Hardwareausstattung, organisiert die<br />
Mediendienste der <strong>Universität</strong> und führt darüber hinaus Aufsicht in diesem Bereich.<br />
In den letzen 12 Monaten wurde das Datennetz sukzessive erneuert und ca. 400<br />
neue Aktive Komponenten im Gesamtwert von ca. 1,6 Mio. € in ca. 150 Datenverteilern<br />
auf dem <strong>Universität</strong>scampus eingebaut. Diese Maßnahme trägt wesentlich zur<br />
Verbesserung der Netzqualität hinsichtlich Redundanz und Bandbreitenversorgung<br />
bei, so dass 95 % der Gebäude mit 1 GBit/s an das Campusnetz angebunden sind.<br />
In den restlichen 5 % der Gebäude werden diese Umbaumaßnahmen im kommenden<br />
Jahr nach Mittelfreigabe durch die <strong>Universität</strong>sleitung nachgeholt.<br />
Sicherheitslücken und Malware stellen ein ständiges Problem <strong>für</strong> die Systeme in den<br />
Netzen der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> dar. Die Stabsstelle DV-Sicherheit (RUS-CERT) überwacht<br />
daher den Netzverkehr auf Anomalien, um kompromittierte Systeme zu<br />
identifizieren und ggf. Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Gleichzeitig mit der<br />
Veröffentlichung von Meldungen zu akuten Sicherheitslücken überprüft sie die Netze<br />
der <strong>Universität</strong> auf gegen diese Lücken verwundbare oder bereits kompromittierte<br />
Systeme soweit möglich, und benachrichtigt die entsprechenden <strong>Institut</strong>sansprechpartner.<br />
Im Bereich des BelWü wurden aus Kostengründen knapp 30 ISDN-Einwahlstandorte<br />
eingestellt. Parallel dazu wurden Zugänge per DSL ausgebaut und in zwei Fällen die<br />
Anbindung von Fachhochschul- bzw. Berufsakademiestandorten von 2 auf 1000<br />
MBit/s erhöht. Neben der ständigen Verbesserung der Spamerkennung wurde ein<br />
leistungsfähiger Mailserver (mit Mailzugriff per Web, POP3 und IMAP) sowie ein<br />
stärkerer Webserver in Betrieb genommen. Schließlich wurde als neuer Dienst die<br />
Anbindung von ca. 100 Schulverwaltungen realisiert.<br />
Nach dem prozessorientierten Qualitätsmanagement-Handbuch <strong>für</strong> die RUS-Abteilungen<br />
wird nun ein kundenorientiertes QM-Handbuch erarbeitet, das <strong>für</strong> die Kunden<br />
des RUS online auf dem <strong>Universität</strong>snetz zur Verfügung steht. Darin finden die<br />
RUS-Kunden Informationen über wichtige Dienste und Anwendungen. Die zugrunde<br />
liegenden Arbeitsprozesse werden aus Kundensicht dargestellt. Unterstützung erhalten<br />
die RUS-Kunden außerdem im neuen QM-Webportal, das zu Beginn des WS<br />
2005/06 über die RUS Homepage zugänglich ist.<br />
Das Rechenzentrum baut die Online-Informationsdienste <strong>für</strong> die Studierenden und<br />
Mitarbeiter auf. So befinden sich ein Portal <strong>für</strong> Studierende im Aufbau, an dem sie<br />
ihre Stammdaten und Noten einsehen können, sowie ein Portal zur Abfrage von Kontaktinformationen<br />
(Telefon, E-Mail) <strong>für</strong> die Mitarbeiter.<br />
Neben den Daueraufgaben und Diensten wie z.B. Betreuung des Netzes, Archivierung<br />
und Backup und Dienste <strong>für</strong> Studierende sind im Berichtszeitraum zahlreiche<br />
externe Projekte durchgeführt worden. Hier sind vor allem drei EU-Vorhaben hervorzuheben.<br />
Daidalos, www.ist-daidalos.org: Ausgehend von den Szenarien „Mobile<br />
<strong>Universität</strong>“ und „Automobil“ wird die Integration „aller Kommunikationstechnologien“<br />
auf der Basis von Mobile IPv6 zu einer ubiquitären Service-Infrastruktur realisiert.<br />
Das gemeinsam mit dem HLRS konzipierte IP Akogrimo, www.ist-akogrimo.org, erweitert<br />
das herkömmliche Grid-Konzept um die Dimensionen Mobilität und „Wissen“<br />
47
(semantic Web). Auch hier wird diese neue integrierte Architektur in einem e-<br />
Learning Szenario demonstriert werden. Innerhalb der Forschungskooperation der<br />
<strong>Universität</strong> mit der Firma Alcatel entwarf und realisierte das Vorhaben ROSE <strong>für</strong> den<br />
mobilen Benutzer erweiterte Kommunikationsdienste im Telefonumfeld, die in Perspektive<br />
organisatorische Prozesse der <strong>Universität</strong> durch intelligente Einbindung innovativer<br />
Kommunikationstechnologie effizienter beschreiben.<br />
Im Berichtszeitraum sind folgende Projekte bzw. Dienste besonders hervorzuheben:<br />
PC Betreuung<br />
Das RUS hat <strong>für</strong> die Unterstützung von Arbeitsplatzsystemen unter Microsoft Windows<br />
ein Betriebskonzept entworfen, mit dessen Hilfe eine effiziente Nutzung der<br />
IuK-Technologien angestrebt wird. Insbesondere soll mit möglichst geringem Aufwand<br />
eine möglichst hohe Funktionalität an den PC-Arbeitsplätzen der Mitarbeiter<br />
der <strong>Universität</strong> erzielt werden. Eingesetzt wird hier<strong>für</strong> eine auf MS Windows basierende<br />
Informations- und Kommunikations-Infrastruktur. Das Angebot umfasst die<br />
Dienste Bereitstellung einer MS Windows Domänen-Struktur, Betrieb von MS Windows<br />
Datei- und Print-Servern und Softwaretechnische Betreuung von PC-<br />
Arbeitsplätzen unter MS Windows. Aufgrund des modularen Aufbaus sind verschiedene<br />
Kooperationsszenarien zwischen dem RUS und den nutzenden Einrichtungen<br />
hinsichtlich der Delegation von Aufgaben sowie eine abgestufte, phasenweise Umsetzung<br />
möglich. Grundlegend <strong>für</strong> den Erfolg eines derartigen Vorhabens sind eine<br />
strikte Standardisierung und eine möglichst weitgehende Automatisierung. Inzwischen<br />
werden diese Dienste an ersten Einrichtungen der <strong>Universität</strong> genutzt.<br />
eLearning - Medida<br />
Das RUS unterstützt die Lehrenden der <strong>Universität</strong> bei der Realisierung ihrer eLearning<br />
Projekte im Lehralltag durch den weiteren Ausbau der technischen Infrastruktur<br />
und organisiert die eLearning Programme der <strong>Universität</strong>. In einem universitätsweiten<br />
Ausschreibungsverfahren wurden ca. 40 weitere Projekte zur Erstellung von Selbstlernmaterialien<br />
aufgesetzt. Ziel in dieser dritten und damit letzten Stufe von self-study<br />
online war, das mit Metadaten versehende Selbstlernangebot auf der vom RUS betreuten<br />
und ständig ausgebauten Lernplattform Ilias anzubieten. Darüber hinaus wird<br />
den Lehrenden mit dem Upload Portal die Möglichkeit gegeben, ihre Vorlesungsaufzeichnungen<br />
mit Lecturnity den Studierenden ohne eigenen technischen Aufwand<br />
zur Verfügung zu stellen. Die Lehrenden werden vom RUS mit Beratung und Schulungen<br />
begleitet, auch ist das RUS Ansprechpartner bei der Erstellung von Anträgen<br />
im eLearning-Bereich geworden. Nachdem die multimedialen Angebote im Lehralltag<br />
zu einer Selbstverständlichkeit geworden sind, wird an einem Konzept zur Systematisierung<br />
des eLearning Angebots in den Studiengängen gearbeitet und die Einführung<br />
eines eLabels geplant.<br />
Besonders ist zu bemerken, dass das RUS das universitäre Medienkonzept bei der<br />
Finalrunde des MedidaPrix vertreten hat und den ersten Preis <strong>für</strong> die <strong>Universität</strong> erringen<br />
konnte.<br />
Einführung eines Helpdesks<br />
Zur Erhöhung der Erreichbarkeit und der Beratungseffizienz hat das RUS einheitliche<br />
Funktionsmailadressen definiert und führt als weiteren Schritt ein Trouble Ticket System<br />
(TTS) ein. Durch die Möglichkeit Anfragen effizient in einem Team zu bearbeiten<br />
48
wird gewährleistet, dass Nutzeranfragen zeitnah und effizient bearbeitet werden. Die<br />
Bearbeitungsschritte sind im Team nachvollziehbar und führen dazu, dass die Informationen<br />
zu einem Problem transparent gemacht werden können und die Zusammenarbeit<br />
erleichtert wird.<br />
Mit der Einführung eines Trouble Ticket Systems können sowohl die die IP-Telefonie<br />
an der <strong>Universität</strong> als auch die allgemeinen RUS-Dienste durch eine moderne, kompetente<br />
und kundenorientierte Benutzerberatung unterstützt werden.<br />
SPAM<br />
Um die Flut der SPAM Mails einzudämmen, setzt das RUS einen SPAM Filter auf<br />
den Mailrelays ein, der SPAM Mails markiert und dem Benutzer ermöglicht, über einfache<br />
Filterregeln im Mail-Client SPAM Mails effektiv zu löschen. Hier werden ca. 90<br />
% der SPAM Mails erkannt. Als weitere Maßnahme gegen SPAM hat das RUS Greylisting<br />
in einem Pilotversuch positiv evaluiert. Greylisting ist ein Konzept, welches<br />
aktuell das SPAM-Aufkommen um ca. 95 % reduziert. Nach Klärung der formalen<br />
Randbedingungen wird Greylisting als Dienst des RUS den <strong>Institut</strong>en angeboten.<br />
Einführung der IP-Telefonie an der gesamten <strong>Universität</strong><br />
Unter Federführung des RUS wird intensiv an der Realisierung einer zeitgemäßen<br />
und zukunftsfähigen Kommunikationsinfrastruktur gearbeitet. Die Übernahme der<br />
Systemverantwortung <strong>für</strong> die neue Kommunikations-Infrastruktur und deren Betriebseinführung<br />
stellt <strong>für</strong> das Rechenzentrum - unter den gegebenen Personalengpässen<br />
– eine außerordentliche Herausforderung dar. Gleichzeitig sieht das RUS<br />
darin aber auch eine besondere Gelegenheit, als Service- und Kompetenzzentrum<br />
<strong>für</strong> alle informations- und kommunikationstechnischen Aspekte, die Zukunft der <strong>Universität</strong><br />
nachhaltig mitzugestalten.<br />
Zum 1. Juni 2005 wurde an einem Referenzaufbau die grundsätzliche Realisierbarkeit<br />
nachgewiesen. Durch das parallel durchgeführte Programm zur Erneuerung der<br />
Datennetz-Infrastruktur der <strong>Universität</strong> ist es möglich geworden, den Anteil der IP-<br />
Telefone erheblich zu erhöhen, sodass es nun möglich wird, <strong>für</strong> nahezu alle Mitarbeiter<br />
hochwertige Endgeräte und die davon abhängigen modernen Mehrwertdienste<br />
zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus werden in diesem Zusammenhang, durch<br />
Integration zusätzlicher Komponenten, die Sicherheit im Datennetz, sowie durch redundante<br />
Auslegung des Kernnetzes, die Betriebssicherheit insgesamt deutlich verbessert.<br />
Aufgrund eines angekündigten Modellwechsels seitens des Herstellers der Anlage<br />
wurde die Installation der Telefone und damit die Inbetriebnahme der Gesamtanlage<br />
auf das 1. Quartal 2006 verschoben. Dies gibt auch Gelegenheit, die Einführung der<br />
geplanten Mehrwertdienste schon jetzt vorzubereiten und die Betriebskonzepte umzusetzen,<br />
um dann bei Inbetriebnahme der Anlage den Nutzern von Anfang an den<br />
vollen Funktionsumfang anbieten zu können.<br />
ECUS: Einführung eines elektronischen Ausweises <strong>für</strong> Studierende<br />
Die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> beabsichtigt <strong>für</strong> ihre Mitglieder und Gäste eine multifunktionale<br />
elektronische Karte („ecus“ – electronic card <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong>) einzuführen.<br />
Die Funktionen des ecus sollen über optische Merkmale, einen RFID-Chip und eine<br />
optionale Wertmarke realisiert werden.<br />
49
Zusätzlich soll die Möglichkeit bestehen, einzelne (RFID-)Anwendungen mit den<br />
Gastkarten der <strong>Universität</strong> und Ausweisen anderer Hochschulen aus dem Großraum<br />
<strong>Stuttgart</strong> zu nutzen. Neben der Nutzung des studentischen ecus (geplanter Einführungstermin<br />
2006) als Bibliotheksausweis soll die Möglichkeit bestehen, zu einem<br />
späteren Zeitpunkt den bisher papiergebundenen Bibliotheksausweis der Mitarbeiter<br />
und öffentlichen Nutzer in das ecus-Konzept zu integrieren.<br />
Ein wesentlicher Aspekt <strong>für</strong> die Akzeptanz des ecus besteht dabei im Schutz der personenbezogenen<br />
Daten aller Karteninhaber durch Projekt-Konzeption und –<br />
Umsetzung. Daneben stehen im Mittelpunkt der Betrachtung technische Umsetzungsmöglichkeiten,<br />
effiziente Gestaltung der Geschäftsprozesse und die Zukunftssicherheit<br />
und Nachhaltigkeit der Investition.<br />
Das RUS koordiniert im Auftrag des Rektors dieses Projekt und realisiert zusammen<br />
mit den beteiligten Partnern eine Karte, die den Anforderungen einer modernen <strong>Universität</strong><br />
auch in Zukunft gerecht wird.<br />
6.3 Höchstleistungsrechenzentrum <strong>Stuttgart</strong> (HLRS)<br />
Das Höchstleistungsrechenzentrum <strong>Stuttgart</strong> (HLRS) hat im Jahr 2004 den nächsten<br />
großen Schritt seines Wandlungsprozesses umgesetzt und die wissenschaftliche,<br />
technische und bauliche Grundlage <strong>für</strong> die nächsten 5-10 Jahre geschaffen. Damit<br />
kann das HLRS nicht nur seiner Rolle als <strong>Universität</strong>seinrichtung und Bundeshöchstleistungsrechenzentrum<br />
besser gerecht werden, sondern stellt auch die Weichen <strong>für</strong><br />
eine Bewerbung als europäisches Zentrum <strong>für</strong> Supercomputing.<br />
Mit der Errichtung des neuen Rechnergebäudes mit angeschlossenem Büroteil in der<br />
Nobelstraße 19 verfügt das HLRS derzeit über eines der modernsten Zentren weltweit<br />
und ist technisch <strong>für</strong> die Zukunft gerüstet. Die Inbetriebnahme des Gebäudes<br />
verlief Dank der exzellenten Abwicklung durch das <strong>Universität</strong>sbauamt reibungslos.<br />
Ebenso erfolgreich gestaltete sich die Inbetriebnahme des neuen Höchstleistungsrechners.<br />
Nach Beginn der Installation im Dezember 2004 ging der weitere Aufbau<br />
zügig voran und wurde von der Lieferfirma NEC pünktlich und problemlos abgeschlossen.<br />
Gemeinsam mit dem Gebäude konnte der Supercomputer im Juli 2005 im<br />
Beisein von Ministerpräsident Oettinger, Bundesministerin Bulmahn sowie zahlreicher<br />
Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Industrie eingeweiht werden.<br />
Das neue Vektorrechnersystem ist derzeit Europas leistungsstärkster Rechner und<br />
liefert eine Spitzenleistung von rund 12.7 TFLOP/s bzw. eine reale Leistung von rund<br />
5-6 TFLOP/s <strong>für</strong> die ingenieurwissenschaftlichen Anwendungen <strong>Stuttgart</strong>er und deutscher<br />
Wissenschafter. Durch eine Kooperation mit NEC konnten weitere Rechnerressourcen<br />
verfügbar gemacht werden. Insgesamt kann das HLRS seinen Benutzern<br />
nun Systeme aller Architekturklassen (Vektor, SMP, PC-Cluster) mit einer Gesamtleistung<br />
von rund 16 TFLOP/S anbieten.<br />
Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Industrie wurde gleichzeitig mit der<br />
Rechnerbeschaffung und dem Bau des Gebäudes weiter vorangetrieben. Die bestehenden<br />
Kooperationen wurden ausgebaut – so ist zum ersten Mal in der Geschichte<br />
des HLRS die Firma Porsche netztechnisch direkt an das Zentrum angebunden.<br />
Gemeinsam mit der Region <strong>Stuttgart</strong> wurde aber auch die Partnerschaft mit kleinen<br />
und mittleren Betrieben in der Region vorangetrieben. Gemeinsame Workshops zur<br />
Simulation auf Höchstleistungsrechnern trugen erste Früchte. Alle diese Aktivitäten<br />
tragen dazu bei die industriellen Beteiligung am Höchstleistungsrechnen zu stärken<br />
und auszubauen. Gleichzeitig soll dadurch ein qualitativer und wissenschaftlicher<br />
50
Beitrag zur Stärkung des Standortes geleistet werden und er Auslagerung von Arbeitsplätzen<br />
in Billiglohnländer – insbesondere im Bereich der Entwicklung – entgegengearbeitet<br />
werden.<br />
Unterstützt wird dies durch die bestehende Kooperation des HLRS mit der <strong>Universität</strong><br />
Karlsruhe im Höchstleistungsrechner-Kompetenzzentrum Baden-Württemberg (hkzbw)<br />
dem im Frühjahr 2005 auch die <strong>Universität</strong> Heidelberg beigetreten ist. Das HLRS<br />
vertritt die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> in der hkz-bw und wird im Rahmen dieser Kooperation<br />
seine Service-Aktivitäten in den Bereichen Lebenswissenschaften, Energiewissenschaften<br />
und innovative Anwendungen ausweiten.<br />
Im Bereich der Forschung hat das HLRS seine Schwerpunkte ausgebaut und erweitert<br />
Herauszuheben ist hier insbesondere die Visualisierung mit den Themen „Augmented<br />
Reality“ und „Virtual Reality“. Insbesondere die Forschungsinvestitionen auf<br />
dem noch sehr jungen Gebiet der Augmented Reality finden in der Industrie und zunehmend<br />
auch in der Forschung großen Anklang. Forschungsschwerpunkte liegen<br />
auf der Integration der Simulationsprozesskette, z.B. in exemplarischer Zusammenarbeit<br />
mit dem <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> hydraulische Strömungsmaschinen bei der Entwicklung<br />
eines virtuellen Prüfstandes, aber auch in der zunehmenden Nutzung von Parallelrechnern<br />
in der Visualisierungsprozesskette. Zeichen der internationalen Anerkennung<br />
<strong>für</strong> die Visualisierung ist die Kooperation mit der Firma Microsoft zu der das<br />
HLRS als eines von 6 Zentren weltweit ausgewählt wurde. Im Rahmen dieser Gruppe<br />
von „Centers of Innovation“ vertritt das HLRS die Bereiche Visualisierung und ingenieurwissenschaftliche<br />
Anwendungen“. Gemeinsam mit seiner ausgegründeten<br />
Firma VISENSO vertreibt das HLRS darüber hinaus seine Visualisierungssoftware<br />
COVISE und bringt das Thema Visualisierung immer stärker in die Bereiche der Fertigung<br />
und Produktion.<br />
Im GRID Computing hat das HLRS seine Führungsstellung in Europa weiter ausgebaut.<br />
In insgesamt 10 europäischen Projekten sowie weiteren nationalen Projekten<br />
entwickelt das HLRS gemeinsam mit seinen Partnern Konzepte und Software <strong>für</strong> den<br />
Zugang und die Nutzung verteilter Ressourcen. Diese Aktivitäten fokussieren auf die<br />
Anwendungsprofile der Nutzer des HLRS und kommen damit direkt seinen Kunden<br />
zu Gute. In diesem Zusammenhang hat das HLRS auch seine Einbindung in die industrielle<br />
Forschung und Produktion intensiviert. Im Rahmen des deutschen Verbundprojekts<br />
d-grid leitet das HLRS das Ingenieur-Gridprojekt In-Grid in dem Wissenschafter<br />
aus x <strong>Universität</strong>en zusammenarbeiten.<br />
Auch im Jahr 2004/2005 hat das HLRS seine Kooperationen mit internationalen<br />
Partnern vorangetrieben. Die bestehenden Projekte im asiatischen Raum wurden<br />
2004 durch weitere Kontakte mit Partnern in Russland und Kasachstan ergänzt. Das<br />
HLRS strebt an, in diesem wichtiger werdenden Raum die starke Vertretung auch<br />
gegen amerikanische Konkurrenz zu behaupten. Bei der Definition des siebten Forschungsrahmenprogramms<br />
der EU bringt das HLRS seine Erfahrung in den Bereichen<br />
Simulation, Visualisierung, Höchstleistungsrechnen und Grid-Computing ein,<br />
sodass auch in Zukunft eine starke Forschungskomponente in diesem Bereich aufrechterhalten<br />
werden kann. Die Kooperation mit den USA wurde durch Einladungen<br />
von Gastwissenschaftern an das HLRS intensiviert. Gleichzeitig werden die Kontakte<br />
durch ehemalige Mitarbeiter, die in die USA abgeworben wurden, ausgebaut.<br />
51
6.4 Internationales Zentrum <strong>für</strong> Kultur- und Technikforschung<br />
6.4.1 Fellowship-Programm<br />
Im Rahmen des Fellowship-Programms lädt das IZKT Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen<br />
aus dem In- und Ausland zur Arbeit an einem ausgewählten Rahmenthema<br />
nach <strong>Stuttgart</strong> ein. Das Programm wurde fortgesetzt mit Friedemann Mattern<br />
(ETH Zürich), der als Fellow der Alcatel SEL-Stiftung <strong>für</strong> Kommunikationsforschung<br />
seine Forschungsergebnisse zu Technologien, Perspektiven und Auswirkungen des<br />
Ubiquitous Computing in einer viel beachteten Vorlesungsreihe „Die Informatisierung<br />
des Alltags“ vorstellte. Diese wurde nicht nur von Studierenden der Geistes- und Sozialwissenschaften,<br />
sondern auch in großer Zahl von Studierenden der Informatik<br />
und Elektrotechnik besucht. Die Brückenfunktion zwischen den Disziplinen, die zu<br />
befördern das IZKT als seine Aufgabe versteht, konnte so in besonderer Weise <strong>für</strong><br />
die Lehre an der <strong>Universität</strong> fruchtbar gemacht werden. Einem breiteren Publikum<br />
präsentierte Mattern seine Thesen in einem Vortrag „Visionen und Szenarien des<br />
allgegenwärtigen Computers – Wunderbare Zukunft oder märchenhafte Illusion?“ in<br />
der Stadtbücherei. Gastprofessor der DVA-Stiftung war der französische Philosoph<br />
Joseph Cohen (Strasbourg). Er setzte mit seinen Lehrveranstaltungen zur französischen<br />
Philosophie der Gegenwart einen besonderen Akzent und stieß mit seinem<br />
Vortrag in der Stadtbücherei über „Die Erfahrung des Opfers in der Philosophie“ auf<br />
große Resonanz.<br />
6.4.2 Frankreich-Schwerpunkt<br />
Das Programm „Deutsch-Französische Wechselwirkungen“, das von der DVA-<br />
Stiftung an der <strong>Universität</strong> eingerichtet wurde, ist als Frankreich-Schwerpunkt am<br />
IZKT angesiedelt. Im Rahmen dieses Schwerpunktes werden Gastprofessuren und<br />
Promotions- bzw. Habilitationsstipendien vergeben, Vorträge französischer Wissenschaftler<br />
organisiert und neue Instrumente der deutsch-französischen Wissenschaftskooperation<br />
erprobt. Neben der Gastprofessur von Joseph Cohen sind die<br />
Vorträge von Frédéric Hartweg („Das Elsass: eine Sprachlandschaft im Wandel“),<br />
Michel Frizot („Analyse et synthèse du mouvement: les méthodes d’Etienne Jules<br />
Marey“), Dominique Bourel („Die Mendelssohn-Legende in Europa“) und Patrick Berger<br />
(„Formes cachées, la ville“) hervorzuheben. Im Rahmen der Werner-Krauss-<br />
Vorlesung fand der Vortrag von Jörn Garber („Die Ursprungsgeschichte der Menschheits-Zivilisation:<br />
Werner Krauss und die moderne Anthropologie-<br />
Geschichtsschreibung“) statt. Höhepunkt der Vorträge war die Präsentation des international<br />
sehr renommierten Philosophen und Sinologen François Jullien, dessen<br />
<strong>Stuttgart</strong>er Vortrag „Von Griechenland nach China oder: Wie wir uns in der abendländischen<br />
Vernunft wieder einrichten können“ auch von der Deutschen Zeitschrift <strong>für</strong><br />
Philosophie veröffentlicht worden ist (Deutsche Zeitschrift <strong>für</strong> Philosophie, Zweimonatsschrift<br />
der internationalen philosophischen Forschung, Berlin 53 (2005), S. 523-<br />
539). Ein IZKT-Gespräch mit François Jullien wurde in der Zeitschrift Information Philosophie<br />
(Heft 3, August 2005, S. 34-41) publiziert.<br />
6.4.3 Italien-Schwerpunkt<br />
Der in Kooperation mit dem Italienischen Kulturinstitut <strong>Stuttgart</strong> und mit Unterstützung<br />
der Stiftung Würth eingerichtete Italien-Schwerpunkt hat die Aufgabe, den<br />
52
deutsch-italienischen Kulturaustausch und Wissenschaftsdialog auf interdisziplinärer<br />
Ebene zu befördern. Im Rahmen dieses Schwerpunktes trug Michela Nacci (Università<br />
dell’Aquila) vor („Equivocare la tecnica. Cultura e modernità nell’Italia del<br />
’900/Sich in der Technik täuschen. Kultur und Moderne in Italien des 20. Jahrhunderts“),<br />
diskutierten Roland Benedikter (Innsbruck), Umberto Galimberti (Venedig)<br />
und Christoph Hubig (<strong>Stuttgart</strong>) zum Thema „Die Technik bewohnen. Für ein Wissen<br />
auf der Höhe unseres Könnens. / Abitare la tecnica. Per un sapere all’altezza del<br />
nostro saper fare“, sprach Elena Esposito (Modena) mit Hannlore Schlaffer über<br />
„Paradoxien der Mode“ und stellt Giulio Busi (z. Z. Berlin) den Humanisten Pico della<br />
Mirandola vor.<br />
Höhepunkt der Aktivitäten des Italien-Schwerpunktes war das deutsch-italienische<br />
Symposium „Die italienische Mediendemokratie. Zur Geschichte politischer Inszenierungen<br />
und inszenierter Politik im Medienzeitalter“, das mit Unterstützung der Stiftung<br />
Würth und der Landeshauptstadt <strong>Stuttgart</strong> durchgeführt wurde. Den Abendvortrag<br />
in der Stadtbücherei hielt der Politologe und Herausgeber von „La Stampa“ Gian<br />
Enrico Rusconi (Turin): „Quale Berlusconismo dopo Berlusconi?“<br />
6.4.4 Neue Schwerpunkte eingerichtet<br />
Unter dem Dach des IZKT wurden im Berichtszeitraum drei neue Schwerpunkte eingerichtet:<br />
• China-Schwerpunkt. Dieser Schwerpunkt ist in Kooperation mit der Arbeitsstelle<br />
<strong>für</strong> deutschsprachige Technikphilosophie der Technischen <strong>Universität</strong> Dalian/VR<br />
China begründet worden und wird von Prof. Hubig und Prof. Thomé koordiniert.<br />
Eine Veranstaltungsreihe und ein Forschungsprojekt zum Thema „Europäische<br />
und chinesische Technikkonzepte im Vergleich“ sind in Planung.<br />
• ZIRN- Interdisziplinärer Forschungsschwerpunkt Risiko und nachhaltige Technikentwicklung<br />
verfolgt das Ziel, die Bedingungen, Voraussetzungen und Folgen<br />
nachhaltiger Technikentwicklung sowie die Risiken und Chancen dieser Entwicklungen<br />
in Wechselwirkung von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft (Governance)<br />
systematisch zu erforschen. ZIRN wird von Prof. Renn geleitet.<br />
• EIP – Europäisches <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Stadtplanung. Dieser Schwerpunkt ist als selbständige<br />
Organisationseinheit dem IZKT angeschlossen. Er dient der Förderung<br />
der internationalen Kooperation von <strong>Universität</strong>en, <strong>Institut</strong>ionen und Firmen, die<br />
im Bereich der Stadtplanung und Stadtgestaltung forschend oder praktisch tätig<br />
sind. EIP wird von Prof. Bott geleitet.<br />
6.4.5 Interdisziplinäre Gesprächsinitiative „SYSTEME“<br />
Um den Dialog zwischen den Wissenschaftskulturen zu befördern und Potentiale<br />
<strong>für</strong> fächerübergreifende Forschungsarbeiten an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
zu sondieren, hat das IZKT eine interdisziplinäre Gesprächsrunde zum Thema<br />
„Systeme“ initiiert, an der sich Wissenschaftler aus unterschiedlichen Bereichen,<br />
von der Architektur, Bioverfahrenstechnik, Regelungstechnik, dem Verkehrswesen,<br />
der Informatik, Physik bis zur Soziologie und Philosophie beteiligen.<br />
Im Berichtszeitraum trug Prof. Allgöwer zur Systemtheorie aus Sicht eines<br />
Regelungstechnikers vor.<br />
53
6.4.6 Arbeitsgruppe „Kulturalität – Interkulturalität“<br />
Am IZKT hat sich diese regelmäßig zusammentreffende, aus Mitgliedern der Fakultät<br />
9 der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> bestehende Arbeitsgruppe gebildet. Sie widmet sich Fragen<br />
des Kulturverständnisses und des interkulturellen Dialogs an den Schnittstellen<br />
von Literaturwissenschaften, Philosophie und Kulturtheorie.<br />
6.4.7 Schwerpunktprojekt „Kultur und Technik I. Die Transformation des<br />
Raums“<br />
Das zentrale Projekt im Forschungsprogramm des IZKT mit der Aufgabe, Struktur<br />
und Wandel des Räumlichen in Abhängigkeit von technischen, ökonomischen und<br />
kulturellen Bedingungen zu untersuchen, ist im Berichtszeitraum abgeschlossen<br />
worden. Die hier erarbeiteten Forschungsergebnisse wurden publiziert:<br />
• Perspektiven des urbanen Raums, hrsg. von Helmut Bott und Elke Uhl, Reihe<br />
MATERIALIEN, Schriftenreihe des IZKT, Bd.1, <strong>Stuttgart</strong> 2004<br />
• Niemandsland - topographische Ausflüge zwischen Wissenschaft und Kunst,<br />
hrsg. von Jens Badura und Sarah Schmidt, Reihe MATERIALIEN, Schriftenreihe<br />
des IZKT, Bd. 2, <strong>Stuttgart</strong> 2004<br />
• Denken des Raums in Zeiten der Globalisierung, hrsg. von Michaela Ott und Elke<br />
Uhl, Münster/Hamburg/Berlin/London: LIT Verlag 2005 (im Druck)<br />
6.4.8 Schwerpunktprojekt „Kultur und Technik II. Neue Materialien – Neue<br />
Formen und Verfahren – neue Funktionen“<br />
Das zweite zentrale Projekt wurde eröffnet mit der internationalen Tagung „Apparaturen<br />
bewegter Bilder. Vor- und Frühgeschichte der Bildtechnologien zur Bewegungsdarstellung“,<br />
die das IZKT in Kooperation mit dem <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Kunst und Kulturwissenschaften<br />
der Technischen <strong>Universität</strong> Graz, dem Kommunalen Kino <strong>Stuttgart</strong>,<br />
dem Theaterhaus und der Stadtbücherei <strong>Stuttgart</strong> sowie mit Unterstützung der DVA-<br />
Stiftung vom 20.-22.1.2005 organisierte. Im Rahmen dieser Tagung fand eine Filmpräsentation<br />
von Christian Lebrat im Kommunalen Kino statt („Du flip-book au flicker.<br />
Petit inventaire provisoire du feuilletage ou battement cinématographique / Vom<br />
Daumenkino zum Flickerfilm. Ein kleines Inventar vom Blättern oder dem kinematographischen<br />
Rhythmus“). Michel Frizot sprach in der Stadtbücherei über das Werk<br />
des Physiologen und Technikers Etienne Jules Marey.<br />
6.4.9 Projektreihe „ Modernisierung, Technologie und kulturelle Transformation“<br />
Die Projektreihe stellt sich die Aufgabe, die kulturellen Auswirkungen und Bedingungen<br />
der Transport- und Kommunikationsrevolution zu erforschen. Sie will zudem die<br />
technisch und ökonomisch-politisch motivierte Globalisierung und die damit verbundene<br />
kulturelle Herausforderung in den Blick bekommen. In Zusammenarbeit mit<br />
dem <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Literaturwissenschaft/Neuere Englische Literatur veranstaltete das<br />
IZKT das Symposium „Magie, Wissenschaft, Technik und Literatur“ (28.-29.1.2005),<br />
in Zusammenarbeit mit der Abt. Amerikanistik die Tagung „Postcolonial (Dis-) Affections“<br />
(19.-21.5.2005). Die jeweiligen Eröffnungsvorträge in der Stadtbücherei hielten<br />
Andreas Höfele (München): „Raising Tempests: Magic, Art and Science, c. 1600“ und<br />
54
Bill Ashcroft (Sydney, Australien): „The emperor’s new clothes. Post-coloniality and<br />
globalization“.<br />
6.4.10 Projektreihe „Medialität und Modell/Modellierung und Computersimulation“<br />
Das Projekt widmet sich den Zusammenhängen von technischen und performativen<br />
Simulationen und sucht eine theoretische Basis <strong>für</strong> die Neubewertung<br />
der Simulation in der Architektur. Im Rahmen dieses Projekts fanden ein<br />
Workshop mit Susanne Haubold (Berlin) sowie ein Vortrag von Claus Pias (Essen)<br />
über Computerspiele der Wissenschaften am IGMA statt.<br />
6.4.11 Projekt „Der Krimkrieg als erster europäischer Medienkrieg“<br />
Vom 16.-18.6.2005 fand das unter Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters der<br />
Landeshauptstadt <strong>Stuttgart</strong> stehende internationale Symposium „Der Krimkrieg als<br />
erster europäischer Medienkrieg“ statt, veranstaltet in Kooperation mit der Université<br />
de Nancy, dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg, dem Französischen Kulturinstitut<br />
<strong>Stuttgart</strong> und der DVA-Stiftung. Eine Begleitausstellung im Französischen<br />
Kulturinstitut wurde am 17.6.2005 eröffnet. Den Abendvortrag „Schlachtenbilder- Bilderschlachten<br />
– zur ästhetischen Inszenierung des Krimkrieges“ hielt der Kunsthistoriker<br />
Ulrich Keller (Santa Barbara).<br />
6.4.12 Das IZKT als Kooperationspartner des Festivals „Theater der Welt<br />
2005“<br />
Das IZKT war Kooperationspartner des Festivals „Theater der Welt 2005“ in <strong>Stuttgart</strong>.<br />
Aus dieser Zusammenarbeit konnten zwei zusätzliche Lehrangebote in besonderer<br />
Form an der <strong>Universität</strong> angeboten werden: Das Seminar „Medienpraxis“ mit Praktikumsmöglichkeit,<br />
das mit verschiedenen Sektoren der Medienpraxis und des Kulturmanagements<br />
in der Festivalplanung und -durchführung vertraut machte, sowie das<br />
Seminar „Szene Stadtraum“, dessen erarbeitete Entwurfsprojekte im Rahmen des<br />
Festivals präsentiert wurden. Zudem war das IZKT Mitorganisator des internationalen<br />
Symposiums „Last Call for Sheherazade“, veranstaltet von Theater der Welt mit Unterstützung<br />
des Auswärtigen Amtes, der Robert-Bosch-Stiftung, des Ministeriums <strong>für</strong><br />
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und Zonta <strong>Stuttgart</strong>.<br />
6.4.13 Vorträge<br />
Im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft Kairo/<strong>Stuttgart</strong> veranstaltete<br />
das IZKT einen Vortrag von Aleya Khattab über die Bibliotheca Alexandrina.<br />
In der Reihe „Kulturtheorien“, die mit Unterstützung der Breuninger-Stiftung stattfindet,<br />
war der amerikanische Literaturwissenschaftler Hillis Miller zu Gast. In Kooperation<br />
mit dem Künstlerhaus <strong>Stuttgart</strong> organisierte das IZKT eine Podiumsdiskussion<br />
zum Thema „KulturAusTausch: Aneignung, Ausstoßung, Auflösung und Erstarrung“<br />
im Rahmen des dortigen Projekts „Entre Pindorama“.<br />
55
6.5 Materialprüfungsanstalt <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
Der Materialprüfungsanstalt <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> führt Forschungs- und Entwicklungsarbeiten<br />
im Bereich der Werkstoff- und Bauteilprüfung, Werkstoffoptimierung<br />
und -entwicklung sowie der Bauteilsicherheit und -auslegung durch. Der Kompetenzbereich<br />
der Zentralen Einrichtung MPA <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> umfasst seit der Zusammenführung<br />
nahezu alle ingenieurwissenschaftlich relevanten Werkstoffe des Bauwesens<br />
und Maschinenbaus. Die MPA <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> ist nach der Bundesanstalt<br />
<strong>für</strong> Materialprüfung (BAM) Berlin die größte Materialprüfungsanstalt der Bundesrepublik<br />
Deutschland.<br />
Ein großer Teil der Tätigkeiten betrifft die direkte Kooperation mit der Industrie, speziell<br />
im Bereich KMU. Es wird ein hoher Technologietransfer in Arbeitsfeldern wie z.<br />
B. Schadensverhütung, moderne Berechnungsmethoden, beanspruchungsgerechte<br />
Werkstoffauswahl, werkstoffgerechte Fertigungsmethode, Werkstoff- und Bauteilqualifizierung<br />
erreicht.<br />
Die Materialprüfungsanstalt <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> ist neben einem kompetenten Forschungsinstitut,<br />
das auf allen Bereichen der Werkstoffanwendung wissenschaftlich<br />
tätig ist, ein technisch-wissenschaftliches Dienstleistungsunternehmen und ist daher<br />
ein kompetenter Partner der Wirtschaft, der in der Lage ist, individuell zugeschnittene<br />
Problemlösungen mit innovativem wissenschaftlichen Charakter aus einer Hand anzubieten.<br />
Die Tätigkeiten der MPA <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> als Prüf-, Überwachungs- und<br />
Zertifizierungsstelle beruhen auf dem Nachweis der besonderen Kompetenz und ermöglichen<br />
z. B. die bauaufsichtliche Zulassung neuer Werkstoffe und Bauarten sowie<br />
Prüfungen im Rahmen der Qualitätssicherung. Neben den experimentellen Untersuchungen<br />
stellt die numerische Simulation ein an Bedeutung zunehmender Arbeitsschwerpunkt<br />
dar. Aufwändige und teuere Experimente an komplexen Bauteilen können<br />
dadurch zielgenauer und erfolgreicher durchgeführt und ausgewertet werden.<br />
Die MPA <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> verfügt über zahlreiche, z.T. modernste Einrichtungen<br />
zur Prüfung von Werkstoffen und Bauteilen. In diesem Zusammenhang führt sie experimentelle<br />
Arbeiten <strong>für</strong> <strong>Universität</strong>sinstitute durch und stellt der Fakultät <strong>für</strong> „Maschinenbau“<br />
und "Bau- und Umweltingenieurwissenschaften" ihre technischen Einrichtungen<br />
<strong>für</strong> die Ausbildung von Studenten zur Verfügung. Über diese Zusammenarbeit<br />
in der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> ist die MPA in die naturwissenschaftlich-technische<br />
Grundlagenforschung der <strong>Universität</strong> integriert.<br />
Im Berichtszeitraum sind folgende Bereiche/Aktivitäten hervorzuheben:<br />
6.5.1 Verwaltung<br />
Das zum 01.01.2004 eingeführte kaufmännisches Buchhaltungssystem hat sich bewährt<br />
und wurde weiter auf der Grundlage der elektronischen Kommunikation ausgebaut.<br />
Die Nachteile der räumlichen Trennung der verschiedenen Einheiten der<br />
MPA <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> wurden überwunden.<br />
56
Das System erlaubt eine genaue Ermittlung der Kostensituation in den einzelnen Bereichen<br />
und daher die Erstellung einer sich an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen<br />
ausgerichteten Gewinn-Verlust-Rechnung.<br />
In der im Frühjahr 2005 durch das Regierungspräsidium <strong>Stuttgart</strong> durchgeführten<br />
Grundsatzprüfung wurde die Angemessenheit der bei öffentlichen Aufträgen zum<br />
Ansatz kommenden Stundensätze festgestellt.<br />
6.5.2 Personal- und Organisationsstruktur<br />
Zum 1.01.2005 wurde die Personalstruktur neu festgelegt. Bis zu diesem Zeitpunkt<br />
mussten die Einnahmen des ehemaligen FMPA Teils zur Deckung der Personalkosten<br />
der dort angesiedelten Haushaltsstellen abgeführt werden. Die jetzt eingeführte<br />
Struktur sieht eine deutliche Absenkung der Anzahl der Haushaltsstellen um rd. 50%<br />
vor. Der Eigenfinanzierungsanteil der Personalkosten der von der MPA <strong>Universität</strong><br />
<strong>Stuttgart</strong> in Zukunft aufzubringen sein wird, liegt im Bereich > 80 %.<br />
Die Organisationsstruktur wurde zum 01.01.2005 gestrafft (siehe Abschnitt Technische<br />
Ausstattung).<br />
6.5.3 Technische Ausstattung<br />
Wie bereits oben erwähnt, stellt die Ausstattung der MPA <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> mit<br />
Prüfgeräten eine wesentliche Grundlage <strong>für</strong> ihre Wettbewerbsfähigkeit dar. In einem<br />
Projekt MPA 2005 wurde eine Analyse der Zukunftsfähigkeit durchgeführt. Als Ergebnis<br />
ergab sich ein relativ großer Bedarf an Erneuerung und Modernisierung von<br />
Prüfeinrichtungen als auch der Infrastruktur. Auf der Grundlage dieser Untersuchungen<br />
werden Umstrukturierungen durchgeführt und Prioritäten bei möglichen Investitionen<br />
festgelegt.<br />
6.5.4 Drittmittelsituation<br />
Die Mehrzahl der Aufträge werden von der Industrie erteilt. Der Anteil der mehrwertsteuerfreien<br />
Forschungsvorhaben liegt bei rd. 20 %. Die Einnahmen aus Forschungs-<br />
und Industrieaufträgen waren im Berichtsraum (ca. 5%) leicht rückläufig.<br />
Dies ist eine Folge der schlechteren wirtschaftlichen Situation der Industrie, speziell<br />
der Bauindustrie, aber auch der öffentlichen Hand bei der Bereitstellung von Forschungsmitteln.<br />
Die Zahl der Mitarbeiter blieb nahezu konstant bei ca. 400 Mitarbeitern.<br />
6.5.5 Businesspläne und Vorplanung<br />
Die Möglichkeiten einer Budget- und Kostenvorplanung werden auf der Grundlage<br />
des erwähnten betriebswirtschaftlichen Buchhaltungssystems wahrgenommen, die<br />
Umsetzung bzw. Einhaltung muss sich aber daran orientieren, dass die MPA <strong>Universität</strong><br />
<strong>Stuttgart</strong> i. d. R. wissenschaftliche Dienstleistungen verkauft, die über längere<br />
57
Zeiträume schlecht vorplanbar sind. Aus diesem Grund wurden abteilungsbezogene<br />
Vorplanungen der wissenschaftlich-technischen Aktivitäten eingeführt, die langfristig<br />
einen besseren Zugang zum Markt ermöglichen sollen und in Verbindung mit der<br />
Priorisierung der Investitionen stehen.<br />
7 Zentrale Verwaltung<br />
7.1 Personal<br />
7.1.1 Bereich studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte<br />
Im Wintersemester 2004/2005 und im Sommersemester 2005 waren bei der <strong>Universität</strong><br />
<strong>Stuttgart</strong> insgesamt 3273 studentische und 474 wissenschaftliche Hilfskräfte mit<br />
8018 Arbeitsverträgen beschäftigt.<br />
7.2.2 Bereich Auszubildende<br />
Im Berichtszeitraum hat die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> insgesamt 84 jungen Menschen einen<br />
Ausbildungsplatz angeboten. Derzeit werden an 22 <strong>Institut</strong>en und Einrichtungen<br />
folgende Ausbildungsberufe angeboten: Industriemechaniker/in, Baustoffprüfer/in,<br />
Chemielaborant/in, Energieelektroniker/in, Feinwerkmechaniker/in, Technischer<br />
Zeichner/in, Tischler/in, Werkstoffprüfer/in, Fachinformatiker/in, Buchbinder/in und<br />
Glasapparatebauer/in. Außerdem erfolgt am Rechenzentrum der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
der praktische Ausbildungsteil <strong>für</strong> das Studium zum Dipl.-Ingenieur/in Informationstechnik,<br />
Vertiefungsrichtung Netz- und Softwaretechnik der Berufsakademie.<br />
7.2.3 Bereich Lehraufträge<br />
Vom 1.10.2004 bis zum 30.09.2005 wurden zur Ergänzung des Lehrangebots 531<br />
Lehraufträge erteilt. Davon waren 241 vergütet und 290 unvergütet. Die Anzahl der<br />
weiblichen Lehrbeauftragten betrug 118, die Anzahl der männlichen Lehrbeauftragten<br />
413.<br />
7.2.4 Bereich Gastvorträge<br />
Zur Ergänzung und Vertiefung der Studieninhalte und des Lehrangebots werden jedes<br />
Jahr 500 Gastvorträge an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> gehalten.<br />
7.2.5 Fort- und Weiterbildung der Zentralen Verwaltung<br />
Das Fort- und Weiterbildungsprogramm der Zentralen Verwaltung <strong>für</strong> die nicht wissenschaftlichen<br />
Beschäftigten umfasst jährlich über 100 Veranstaltungen unterschiedlicher<br />
Themenbereiche. Darüber hinaus organisiert die Fortbildungsbeauftragte<br />
der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> als Mitglied des Arbeitskreises Weiterbildung <strong>für</strong> die Uni-<br />
58
versitäten des Landes Baden-Württemberg jährlich 10 Veranstaltungen <strong>für</strong> alle <strong>Universität</strong>en<br />
des Landes. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Verwaltung und<br />
Technik wird dadurch ermöglicht, neue Kenntnisse zu erwerben und sich bedarfsorientiert<br />
weiter zu qualifizieren. Außer den Seminaren zur fachlichen und zur Weiterbildung<br />
im EDV-Bereich sowie in den Bereichen Arbeits- und Umweltschutz werden<br />
auch Fähigkeiten auf dem Gebiet der methodischen, persönlichen und sozialen<br />
Kompetenz vermittelt.<br />
Die Zentrale Verwaltung ermöglicht außerdem den Beschäftigten sich an Hand dieses<br />
Programms über alle weiteren an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> und den in Verbindung<br />
mit der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> vorhandenen Fort- und Weiterbildungsangebote zu informieren:<br />
- Fortbildungsprogramm <strong>für</strong> die <strong>Universität</strong>en des Landes Baden-Württemberg<br />
- Fortbildungsprogramm der <strong>Universität</strong>sbibliothek<br />
- Fortbildungsprogramm des Rechenzentrums der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
- Fortbildungsprogramm des Sprachenzentrums<br />
- Angebote des Allgemeinen Hochschulsports <strong>für</strong> <strong>Universität</strong>sbeschäftigte<br />
- Angebote des Studium Generale<br />
- Angebote des Arbeitsbereichs Hochschuldidaktik<br />
- Fortbildungsveranstaltungen der Technischen Akademie (TA) Esslingen<br />
- Fortbildungsveranstaltungen der Handwerkskammer Region <strong>Stuttgart</strong><br />
- Fortbildungsprogramm der <strong>Universität</strong>sklinika<br />
- Fortbildungsangebote der Koordinierungsstelle <strong>für</strong> wissenschaftliche Weiterbildung.<br />
Die Gesamtorganisation liegt beim Dezernat IV –Personal. Das Programm erscheint<br />
einmal jährlich und ist im Intranet abrufbar unter<br />
http://www.verwaltung.uni-stuttgart.de/weiterbildung<br />
außerdem wird mittels Rundschreiben auf das gesamte Angebot und die einzelnen<br />
Veranstaltungen regelmäßig hingewiesen.<br />
7.2.5.1 Themen und Zielgruppe<br />
Grundlagen- und Aufbaukurse im EDV-Bereich<br />
- Word <strong>für</strong> Windows<br />
- Excel 2000<br />
- Outlook 2000<br />
- PowerPoint 2000<br />
- Access 2000<br />
- Adobe<br />
Seminare der Zentralen Verwaltung<br />
- Informationsveranstaltung Arbeitsplatz <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
- Einstellungsverfahren bei wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Mitarbeitern<br />
sowie Arbeitern<br />
- Rund um das Arbeitsverhältnis<br />
59
- Aufgaben und Beteiligungsrechte des Personalrats<br />
- Beschäftigung studentischer und wissenschaftlicher Hilfskräfte, Praktikanten,<br />
Lehrbeauftragte, Gastvortragende<br />
- Veranstaltung zum Thema Drittmittelrecht<br />
- Veranstaltung zum Thema Reisekostenrecht<br />
- Veranstaltung zum Thema Beschaffungswesen<br />
Informationsveranstaltungen der Bundesanstalt <strong>für</strong> Angestellte (BfA), der Landesversicherungsanstalt<br />
<strong>für</strong> Arbeiter (LVA), der Versorgungsanstalt des Bundes und der<br />
Länder (VBL)<br />
Seminare über Kommunikation und Sprache<br />
- Fremdsprachenkurse Business English, Technical English, Grund- und Aufbaukurse<br />
- Wege zur Chefentlastung – die Sekretärin als Organisations-, Informations- und<br />
Aufgabenmanagerin<br />
- Schreiben im Beruf – sicher, prägnant und überzeugend formulieren<br />
- Mehr Zeit <strong>für</strong> das Wesentliche – Zeitmanagement und rationelle Arbeitstechniken<br />
- Arbeitsplatz und Büroorganisation<br />
- Moderation<br />
- Konfliktherd Arbeitsplatz – Kommunikation in Konfliktbereichen<br />
- Professionelle Präsentationen, Vorträge und Schulungen<br />
- Angewandte Rhetorik<br />
Kurse zum Arbeits- und Umweltschutz<br />
Die Kurse richten sich an die Beschäftigten im nicht wissenschaftlichen Bereich (die<br />
Kurse zum Arbeits- und Umweltschutz der Abteilung Sicherheitswesen stehen allen<br />
Beschäftigten offen).<br />
7.2.5.2. Anmeldung<br />
Im Interesse einer intensiven Mitarbeit kann nur eine begrenzte Teilnehmerzahl je<br />
Veranstaltung zugelassen werden. Die Anmeldung <strong>für</strong> eine Veranstaltung erfolgt<br />
über die Vorgesetzte oder den Vorgesetzten zweifach bei der Zentralen Verwaltung,<br />
Dezernat Personal, IV/3.<br />
7.2.5.3. Teilnahme<br />
Der Besuch der Veranstaltungen liegt im dienstlichen Interesse. Die Teilnahme ist<br />
kostenlos und wird bei den meisten Kursen als Dienstzeit auf die Arbeitszeit angerechnet,<br />
bei Teilzeitbeschäftigten im Umfang ihrer festgelegten Arbeitszeit.<br />
Nach Kursabschluss wird den Teilnehmern <strong>für</strong> die meisten Kurse ein Fortbildungsnachweis<br />
ausgestellt, der an die <strong>Universität</strong>seinrichtung gesandt wird. Eine Mehrfertigung<br />
wird in die Personalakte bei der Zentralen Verwaltung aufgenommen.<br />
Jede der Veranstaltungen wird evaluiert. Die Veranstaltungen erhielten bezüglich der<br />
fachlichen und methodisch/didaktischen Vermittlung der Inhalte, der Kursdauer, der<br />
60
Organisation der Veranstaltung und der Umsetzbarkeit des Erlernten <strong>für</strong> die tägliche<br />
Arbeit hervorragende Bewertungen.<br />
An den von der Zentralen Verwaltung, Dezernat Personal und der Abteilung Sicherheitswesen<br />
<strong>für</strong> die Beschäftigten der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> im Zeitraum vom 1.10.2004<br />
bis zum 30.09.2005 angebotenen Veranstaltungen haben insgesamt 1.219 Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter teilgenommen.<br />
7.2 Technik und Bauten<br />
7.2.1 Realisierte Baumaßnahmen<br />
Im Berichtszeitraum wurde durch das <strong>Universität</strong>sbauamt <strong>Stuttgart</strong> und Hohenheim<br />
im Auftrag der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> ca. 28,7 Mio. Euro in Form von Bauunterhalt,<br />
kleinen wertsteigernden Baumaßnahmen, Sammeltitel-, Einzeltitel- und Sonderbaumaßnahmen<br />
in die <strong>Universität</strong>sgebäude investiert. Der Bauetat schlüsselt sich wie<br />
folgt auf:<br />
- Bauunterhalt 10,1 Mio. Euro<br />
- kleine Wert steigernde Baumaßnahmen 1,9 Mio. Euro<br />
- zweckgebundene Sammeltitelmaßnahmen 4,5 Mio. Euro<br />
- Einzeltitel/Sonderbauprogramme (Mittelabfluss<br />
entsprechend des Bauablaufs der Neubauten) 12,1 Mio. Euro<br />
- Planungskosten 0,1 Mio. Euro<br />
Gesamt: 28,7 Mio. Euro<br />
Mit der feierlichen Übergabe des neuen Höchstleistungsrechner NEC SX-8 und des<br />
Neubaus eines Höchstleistungsrechenzentrums an die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> im Juli<br />
'05 konnte ergänzend auch der räumliche Betrieb des Rechenzentrums (RUS) neugeordnet<br />
werden. Zur Abdeckung der erhöhten technischen Betriebsvoraussetzung<br />
musste die Kältezentrale Süd erweitert werden.<br />
Der Neubau eines Internationalen Zentrums konnte im Frühjahr '05 bezogen werden.<br />
Mit einer feierlichen Übergabe im Juli '05 wurde der neue internationale und kommunikative<br />
Treffpunkt an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> in Betrieb genommen.<br />
Der erste Bauabschnitt (Bürogebäude) der Gebäudesanierung Holzgartenstr. 17<br />
wurde termingerecht im Herbst '04 abgeschlossen.<br />
7.2.2 In Bau befindliche- und geplante Baumaßnahmen:<br />
Der Neubau <strong>für</strong> das Ersatzgebäude des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> Zeitmesstechnik, Fein- und Mikrotechnik<br />
– Baukosten ca. 5,4 Mio. Euro – ist im Gange. Das Richtfest soll im November<br />
'05 und der Einzug Ende '06 erfolgen.<br />
Für das geplante Forschungs- und Beratungszentrum des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> Sportwissenschaft<br />
sind die Planungen <strong>für</strong> einen Ergänzungsbau im Gange. Eine erste Schätzung<br />
geht von Baukosten von ca. 1,3 Mio. Euro aus. Der Baubeginn ist <strong>für</strong> Anfang '06 geplant.<br />
61
Nach über 40jähriger Nutzung ist eine Techniksanierung des Gebäudes Keplerstr.<br />
17, K II in Vorbereitung. Die Sanierungssumme wird mit 16,5 Mio. Euro begrenzt. Der<br />
Baubeginn soll im September '06 sein.<br />
Das Finanzministerium des Landes Baden-Württemberg trat mit der Bitte an die <strong>Universität</strong><br />
<strong>Stuttgart</strong> heran, die Villengebäude Richard-Wagner-Str. 44 und Dillmannstr.<br />
15 verkaufen zu wollen. Ein entsprechendes Ersatzgebäude <strong>für</strong> das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Geophysik<br />
und <strong>für</strong> die Abteilungen <strong>für</strong> Pädagogik und Psychologie einschließlich der<br />
Hochschuldidaktik konnte mit dem Gebäude Azenbergstr. 16 gefunden werden. Der<br />
Umzug ist <strong>für</strong> den Herbst '05 vorgesehen.<br />
7.2.2.1 Projekte<br />
Die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> hat sich im Rahmen einer freihändigen Vergabe mit öffentlichem<br />
Teilnahmewettbewerb in einem 3stufigen Auswahlverfahren <strong>für</strong> das System<br />
FAMOS der Firma Keßler Real Estate Solutions GmbH entschieden. In den vergangenen<br />
anderthalb Jahren wurde das CAFM-System in den laufenden Gebäudebetrieb<br />
des Dezernats VI - Technik und Bauten mit den Modulen Flächen- und Störungsmanagement<br />
implementiert. Die Anlagendokumentation über sämtliche Gebäude<br />
befindet sich in der Aufbauphase. Unterstützend zu der Einführung der Kosten-<br />
und Leistungsrechnung wird damit eine kostenoptimale Raum- und Gebäudebewirtschaftung<br />
möglich sein und der Weg <strong>für</strong> ein modernes Gebäudemanagement geebnet.<br />
7.3 Öffentlichkeitsarbeit<br />
7.3.1 Medienarbeit<br />
„Ein Jubiläumsjahr geht zu Ende, ein großes Jahr <strong>für</strong> <strong>Stuttgart</strong> und seine <strong>Universität</strong>...die<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> (hat) viel in ihr 175-Jahr-Jubiläum investiert – und gewonnen“,<br />
schrieb die <strong>Stuttgart</strong>er Zeitung am 23. Dezember 2004 in einem Kommentar<br />
zum sich neigenden Jubiläumsjahr. <strong>Universität</strong>sangehörige von Studierenden bis<br />
zum <strong>Institut</strong>sdirektor hätten mit „Geduld, mit Spaß an der Sache und pfiffigen Ideen“<br />
auch einer nicht wissenschaftlich gebildeten Öffentlichkeit Einblick in ihre Arbeit gegeben.<br />
Zweifellos hat das Jubiläumsjahr in der Region <strong>Stuttgart</strong> dazu beigetragen, den Blick<br />
auf die <strong>Universität</strong>, die dort tätigen Menschen und die Arbeit in Lehre und Forschung<br />
zu erweitern. Und diese Erfahrungen haben sicher auch viele Uni-Angehörigen darin<br />
bestärkt, <strong>für</strong> ihre Arbeit offensiv zu werben. Neben den Veranstaltungen und Projekten<br />
im auslaufenden Jubiläumsjahr wie dem Wissenschaftsmarkt im Oktober 2004,<br />
der den Focus auf die Forscherinnen richtete, oder der Medienpräsentation des Buches<br />
„Die <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> nach 1945“ prägten eine Reihe weiterer öffentlichkeitswirksamer<br />
Veranstaltungen die Arbeit der Pressestelle: Dies reicht von der Verleihung<br />
der Ehrenbürgerwürde an die ägyptische First Lady Suzanne Mubarak und<br />
den ehemaligen <strong>Stuttgart</strong>er Oberbürgermeister Manfred Rommel, die Ausstellung der<br />
Fakultät Architektur und Stadtplanung im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt,<br />
die Entscheidung <strong>für</strong> den Standort <strong>Stuttgart</strong> als Standort des deutschen Betriebszentrums<br />
<strong>für</strong> das Stratosphären Observatorium <strong>für</strong> Infrarot Astronomie (SOFIA) und die<br />
62
Gründung des SOFIA-<strong>Institut</strong>s bis zum Tag der Wissenschaft, der Einweihung des<br />
Höchstleistungsrechenzentrums und des Internationalen Zentrums.<br />
7.3.2 Produkte der Pressestelle<br />
Diese und zahlreiche weitere Ereignisse und Entwicklungen finden sowohl in den<br />
Mediendiensten ihren Niederschlag (www.uni-stuttgart.de/aktuelles/presse/ und<br />
www.uni-stuttgart.de/aktuelles/uni-infos/), bei zahlreichen Pressekonferenzen als<br />
auch in Produkten der Pressestelle wie dem unikurier oder den newslettern science<br />
und news. Das Jahrbuch Wechselwirkungen bietet den Wissenschaftlern ein Forum,<br />
ihre Forschungsarbeit ausführlicher darzustellen – von Baumaterialien der Zukunft,<br />
über Texiltechnik und Flugzeugbau bis zu moderner Bildgebung in der Nanotechnologie.<br />
Das neu entwickelte Themenheft Forschung gibt Einblick in das junge<br />
und zukunftsträchtige Forschungsgebiet der Systembiologie, in dem fakultätsübergreifend<br />
Ingenieure, Biologen und Systemwissenschaftler an einem neuen Verständnis<br />
organischen Lebens arbeiten. In diesem Themenheft finden neue Forschungsinitiativen<br />
eine Plattform zur Information der Öffentlichkeit und gleichzeitig zur inneruniversitären<br />
Verständigung. Das nächste Themenheft wird sich dem Bereich der Photonik<br />
widmen. Außerordentlich begehrt sind immer die jährlich in deutscher Sprache<br />
neu aufgelegte Technologietransferbroschüre „Forschung – Entwicklung – Beratung“<br />
und der Wandkalender. Mit dem Wegweiser <strong>für</strong> Studienanfänger/innen gibt<br />
die Pressestelle zudem eine Hilfestellung <strong>für</strong> den studentischen Nachwuchs.<br />
7.3.3. Beratung und Vermittlung<br />
Das Know-how der Pressestelle als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit<br />
wird von <strong>Universität</strong>smitarbeitern beim Transfer in die Medien zunehmend<br />
nachgefragt, ob es um wissenschaftliche Tagungen, Ergebnisse von Forschungsarbeiten<br />
oder studentische Projekte geht. Gleiches gilt <strong>für</strong> Journalisten, die Informationen<br />
über Entwicklungen an der <strong>Universität</strong> von strukturellen Fragen bis zu neuen<br />
Studienabschlüssen, neue Technologien aus den unterschiedlichsten Bereichen oder<br />
bestimmte Projekte wünschen. Diese Beratungs- und Vermittlungsarbeit nimmt inzwischen<br />
einen sehr hohen Arbeitsanteil ein. Gleichzeitig erleichtert dies auch die<br />
Platzierung von Uni-Themen in bestimmten Medien. Ferner trägt die Pressestelle<br />
auch eigene Texte zu externen Publikationen bei.<br />
7.3.4 Merchandising<br />
Von Seidentüchern und Krawatten bis zu Schlüsselbändern, Jubiläumsartikeln oder<br />
hochwertigen Analog- oder Digitaluhren reicht die Produktpalette des Uni-Shops.<br />
Produkte und Preise können unter www.uni-stuttgart.de/presse/unishop/.<br />
63
ANHANG<br />
VI
ANHANG A: FORSCHUNG<br />
VII
Tabelle A1: Sonderforschungsbereiche<br />
(Stand 01.09.2005)<br />
SFB-Nr. Titel Laufzeit<br />
374 Entwicklung und Erprobung innovativer Produkte – Rapid<br />
Prototyping<br />
381 Charakterisierung des Schädigungsverlaufs in<br />
Faserverbundwerkstoffen mittels zerstörungsfreier<br />
Prüfung<br />
382 Verfahren und Algorithmen zur Simulation physikalischer<br />
Prozesse auf Höchstleistungsrechnern<br />
(Sprecherhochschule: Tübingen)<br />
1994 bis 2006<br />
1994 bis 2006<br />
1994 bis 2006<br />
404 Mehrfeldprobleme in der Kontinuumsmechanik 1995 bis 2006<br />
467 Wandlungsfähige Unternehmensstrukturen <strong>für</strong> die<br />
variantenreiche Serienproduktion<br />
1997 bis 2005<br />
495 Topologie und Dynamik von Signalprozessen 2000 bis 2005<br />
627 Umgebungsmodelle <strong>für</strong> mobile kontextbezogene<br />
Systeme<br />
Tabelle A2: Transferbereiche<br />
2003 bis 2006<br />
TFB Nr. Titel Laufzeit<br />
41 Entwicklung und Erprobung innovativer Produkte 1.1.2004-2005<br />
51 Simulation und aktive Beeinflussung der Hydroakustik in<br />
flexiblen Leitungen<br />
56<br />
01.01.2005-<br />
31.12.2007<br />
Entwicklung einer regenerativen Reaktorsystems 1.1.05-30.6.08<br />
Tabelle A3: Transregio<br />
Titel Laufzeit<br />
21 Quantenkontrolle in maßgeschneiderter Materie<br />
<strong>Stuttgart</strong>/Tübingen/Ulm<br />
1.7.05-30.6.08<br />
VIII
Tabelle A4: Nachwuchsgruppe SFB 495<br />
Titel Laufzeit<br />
Topologie und Dynamik von Signalprozessen<br />
1.7.05-30.4.09<br />
Tabelle A5: DFG-Forschergruppen<br />
FOR Nr. Titel Laufzeit<br />
384<br />
2001-2006<br />
Zerstörungsfreie Strukturbestimmung von Betonbauteilen<br />
mit akustischen und elektromagnetischen Echo-<br />
Verfahren<br />
460<br />
508<br />
509<br />
Entwicklung von Konzepten und Methoden zur Ermittlung<br />
der Zuverlässigkeit mechatronischer Systeme in frühen<br />
Entwicklungsphasen<br />
Noise Generation in Turbulent Flow<br />
Multiscale Methods in Computational Mechanics<br />
2002-2005<br />
2003-2006<br />
2003-2005<br />
Tabelle A5: Existenzgründungen aus der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
(im Jahr 2004)<br />
Stand: 30.9.2005<br />
Fakultät<br />
Anzahl der<br />
Existenzgründungen<br />
1 2<br />
2 1<br />
3 -<br />
4 -<br />
5 1<br />
6 1<br />
7 3<br />
8 -<br />
9 1<br />
10 -<br />
IX
Tabelle A6: Erfindungsmeldungen und Inanspruchnahmen<br />
Stand 31.08.2005<br />
Zeitraum Erfindungsmeldungen<br />
davon Inanspruchnahmen<br />
01.10.1996-30.09.1997 26 1<br />
01.10.1997-30.09.1998 33 17<br />
01.10.1998-30.09.1999 27 19<br />
01.10.1999-30.09.2000 58 36<br />
01.10.2000-30.09.2001 46 29<br />
01.10.2001-30.09.2002 59 47<br />
01.10.2002-30.10.2003 68 50<br />
01.10.2003-31.08.2004 42 36<br />
01.10.2004-31.08.2005<br />
davon Fakultät im Jahre<br />
2004/2005<br />
56 40<br />
1 Architektur und Stadtplanung<br />
2 Bau- u. Umweltingenierwissen-<br />
2 1<br />
schaften 0 0<br />
3 Chemie 7 6<br />
4 Geo- und Biowissenschaften<br />
5 Informatik, Elektrotechnik u.<br />
2 2<br />
Informat.<br />
6 Luft- und Raumfahrttechnik u.<br />
8 6<br />
Geodäsie 5 2<br />
7 Maschinenbau 30 22<br />
8 Mathematik und Physik<br />
9 Philosophisch-Historische Fa-<br />
2 1<br />
kultät<br />
10 Wirtschafts- uns Sozialwis-<br />
0 0<br />
senschaften 0 0<br />
Zentrale Einrichtungen 0 0<br />
X
ANHANG B: LEHRE<br />
XI
Tabelle B1: Entwicklung der Studierendenzahlen bis WS 2005/2006<br />
(jeweils einschl. der Beurlaubten und eingeschriebenen Doktorand/inn/en),<br />
Stand: 11.10.2005<br />
WS WS WS WS WS<br />
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06*<br />
Gesamtzahl 17.282 18.560 20.148 20.671 19.470<br />
davon<br />
Einschreibungen 4.413 4.484 4.920 4.163 3.528<br />
davon<br />
Ausländer/innen 1.394 1.309 1.213 1.068 730<br />
Ersteinschreibungen<br />
3.823 3.762 4.174 3.547 3.094<br />
Neueinschreibungen<br />
590 722 746 616 434<br />
Ausländer/innen 4.189 4.905 5.442 5.553 4.894<br />
davon Bildungsinländer/innen<br />
1.007 1.026 1.077 1.047 885<br />
Frauen 5.453 6.029 6.562 6.884 6.483<br />
davon Ausländerinnen<br />
1.721 1.985 2.238 2.340 2.109<br />
Beurlaubte 851 702 718 860 746<br />
* vorläufige Zahlen<br />
Ausländer/innen Studierende mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit<br />
Bildungausländer/innenStudierende mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit jedoch<br />
deutschem Abitur<br />
XII
Figur B1: Studierendenentwicklung nach Geschlecht (Wintersemester)<br />
22.000<br />
20.000<br />
18.000<br />
16.000<br />
14.000<br />
12.000<br />
10.000<br />
8.000<br />
6.000<br />
4.000<br />
2.000<br />
0<br />
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06<br />
Einschreibungen Frauen Männer Gesamtzahl<br />
VIII
Figur B2: Studierendenentwicklung nach Herkunft und Geschlecht<br />
Ausländerinnen<br />
Ausländer, M<br />
Deutsche,<br />
F<br />
Deutsche, M<br />
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000<br />
WS 01/02 WS 02/03 WS 03/04 WS 04/05 WS 05/06<br />
Figur B3: Entwicklung nach Herkunft und Geschlecht bis Wintersemester<br />
2005/06<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
0<br />
WS 90/91<br />
WS 91/92<br />
WS 92/93<br />
WS 93/94<br />
WS 94/95<br />
WS 95/96<br />
WS 96/97<br />
21.024<br />
21.402<br />
21.454<br />
21.505<br />
21.091<br />
19.964<br />
4.512<br />
19.091<br />
2.034<br />
4.663<br />
4.829<br />
2.289 4.967<br />
17.807<br />
2.562<br />
5.049<br />
2.736<br />
16.245<br />
5.034<br />
2.882<br />
15.914<br />
5.085<br />
2.880<br />
16.015<br />
17.281<br />
4.919<br />
2.853<br />
18.560<br />
20.148<br />
2.812 4.610<br />
20.617<br />
4.663<br />
2.893<br />
3.224 4.792<br />
5.453<br />
19.470<br />
3.451<br />
4.288 6.029<br />
4.905 6.562<br />
5.442 6.884<br />
5.553 6.483<br />
4.894<br />
WS 97/98<br />
WS 98/99<br />
WS 99/00<br />
WS 00/01<br />
WS 01/02<br />
WS 02/03<br />
WS 03/04<br />
WS 04/05<br />
WS 05/06<br />
gesamt<br />
Frauen<br />
Ausländer<br />
IX
Figur B4: Ausländische Studierende (Wintersemester)<br />
6.000<br />
5.000<br />
4.000<br />
3.000<br />
2.000<br />
1.000<br />
0<br />
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06<br />
Einschreibungen Frauen Männer Gesamtzahl<br />
X
Tabelle B 2: Entwicklung der Anfänger/innen/zahlen bis WS 2005/06<br />
Deutsche und Ausländer/innen (Fallzahlen)<br />
Erste Fachsemester, ohne Doktorand/inn/en und ohne<br />
ausländische Gaststudierende .<br />
Stand: 12.10.2005<br />
Studienfach / Abschluss WS 02/03 WS 03/04 WS 04/05 WS 05/06*<br />
Allg. u.Vergl. Literaturwissenschaften<br />
MA HF 42 82 22<br />
Allg. u.Vergl. Literaturwissenschaften<br />
MA NF 8 9 5<br />
Anglistik BA HF 12 13 9<br />
Anglistik BA NF 9 4 9<br />
Anglistik MA HF 187 95 54<br />
Anglistik MA NF 21 11 17<br />
Architektur und Stadtplanung Diplom 183 259 240 246<br />
Automatisierung in der Produktion Diplom 31 37 43 44<br />
Bauingenieurwesen BA NF 0 1 1<br />
Bauingenieurwesen Diplom 88 94 118 97<br />
Bauingenieurwesen MA 2. HF 2 1 3<br />
Berufspädagogik MA HF 40 75 27<br />
Berufspädagogik MA NF 5 17 6<br />
BWL BA NF 11 5 2<br />
BWL MA NF 64 35 7<br />
BWL t.o. Diplom 217 232 151 96<br />
Chemie Diplom 113 120 121 139<br />
Chemie LA Gym. BF 3 4 0 1<br />
Chemie LA Gym. HF 10 21 25 30<br />
Chemie MA 2. HF 1 5 6<br />
Chemie MA NF 0 2 3<br />
COMMAS MSc 29 22 24 28<br />
Computational Physics BSc 5 11 6 3<br />
Deutsch LA Gym. BF 13 21 24 16<br />
Deutsch LA Gym. HF 129 87 63 116<br />
Deutsch als Fremdsprache BA HF 40<br />
Dt.-Franz. Studiengang Sozialwis- Diplom<br />
senschaften<br />
10 14 9 18<br />
Elektrotechnik u. Informationstechnik<br />
BA NF 0 0 1<br />
Elektrotechnik u. Informationstechnik<br />
BSc 0 1 4 3<br />
Elektrotechnik u. Informationstechnik<br />
Diplom 219 219 206 188<br />
Elektrotechnik u. Informationstechnik<br />
MA 2. HF 6 0 1<br />
Englisch LA Gym. BF 17 18 5 6<br />
Englisch LA Gym. HF 130 80 83 91<br />
Fahrzeug- und Motorentechnik Diplom 210 356 176 274<br />
Französisch LA Gym. BF 6 9 6 4<br />
Französisch LA Gym. HF 43 37 43 62<br />
Romanistik: Französisch BA HF 1 0 5<br />
Romanistik: Französisch BA NF 1 9 5<br />
XI
Galloromanistik MA HF 25 17 31<br />
Galloromanistik MA NF 10 11 10<br />
Geodäsie u. Geoinformatik Diplom 19 36 68 33<br />
Geographie Diplom 81 85<br />
Geographie LA Gym. BF 10 12<br />
Geographie LA Gym. HF 50 22<br />
Geographie MA HF 24 6<br />
Geographie MA NF 3 4<br />
Geologie/Paläontologie Diplom 7<br />
Germanistik BA HF 6 3 5<br />
Germanistik BA NF 2 3 9<br />
Germanistik MA HF 231 94 86<br />
Germanistik MA NF 18 13 22<br />
Geschichte BA HF 3 3 12<br />
Geschichte BA NF 1 12 9<br />
Geschichte LA Gym. BF 13 12 5 9<br />
Geschichte LA Gym. HF 63 57 72 60<br />
Geschichte MA HF 121 135 181<br />
Geschichte MA NF 19 21 31<br />
Geschichte der Naturwissenschaf- BA NF<br />
ten und Technik<br />
0 3 2<br />
Geschichte der Naturwissenschaf- MA HF<br />
ten und Technik<br />
14 18 29<br />
Geschichte der Naturwissenschaf- MA NF<br />
ten und Technik<br />
0 2 6<br />
Immobilientechnik u. Immobilien- Diplom 38 46 59 32<br />
wirtschaft<br />
Informatik BA NF 1 1 1<br />
Informatik Diplom 121 179 171 150<br />
Informatik LA Gym. BF 3 5 1 1<br />
Informatik LA Gym. HF 1 1 5 2<br />
Informatik MA NF 10 3 11<br />
INFOTECH MSc 37 11 21 18<br />
Infrastrukturplanung MIP 33 19<br />
Romanistik: Italienisch BA HF 4 3 11<br />
Romanistik: Italienisch BA NF 6 2 3<br />
Italianistik MA HF 53 63 25<br />
Italianistik MA NF 18 11 10<br />
Italienisch LA Gym. BF 14 7 4 1<br />
Italienisch LA Gym. HF 7 24 2 11<br />
Kunstgeschichte BA HF 10 9 19<br />
Kunstgeschichte BA NF 2 6 6<br />
Kunstgeschichte MA HF 133 59 202<br />
Kunstgeschichte MA NF 20 46 25<br />
Lebensmittelchemie Staatsex. 31 29 30 24<br />
Linguistik BA HF 2 2 4<br />
Linguistik BA NF 9 2 5<br />
(Computer-)Linguistik Diplom 42 53 50 43<br />
Linguistik MA HF 126 126 39<br />
Linguistik MA NF 14 21 11<br />
Luft- u. Raumfahrttechnik Diplom 338 319 275 253<br />
Maschinenwesen Diplom 255 345 250 258<br />
Maschinenwesen MA 2. HF 0 3 5<br />
XII
Mathematik BA NF 0 1 2<br />
Mathematik Diplom 92 78 97 71<br />
Mathematik LA Gym. BF 7 9 11 7<br />
Mathematik LA Gym. HF 64 65 84 95<br />
Mathematik MA NF 10 7 3<br />
Mineralogie Diplom 2<br />
Pädagogik LA Gym. HF 8 4 5 2<br />
Pädagogik MA HF 119 58 37<br />
Pädagogik MA NF 18 19 8<br />
Pädagogik / Berufspädagogik BA HF 7 9 3<br />
Pädagogik / Berufspädagogik BA NF 4 2 8<br />
Philosophie BA HF 1 0 5<br />
Philosophie BA NF 2 18 9<br />
Philosophie LA Gym. HF 0 0 3 1<br />
Philosophie MA HF 95 117 148<br />
Philosophie MA NF 25 41 32<br />
Philosophie/Ethik LA Gym. BF 0 2 0 2<br />
Philosophie/Ethik LA Gym. HF 17 38 48 70<br />
Physics MSc 22 28 18 10<br />
Physik Diplom 113 127 134 136<br />
Physik LA Gym. BF 2 0 2 1<br />
Physik LA Gym. HF 15 12 28 33<br />
Physik MA 2. HF 3 2 2<br />
Physik MA NF 1 2 0<br />
Politikwissenschaft BA NF 7 3 10<br />
Politikwissenschaft LA Gym. BF 11 8 12 9<br />
Politikwissenschaft LA Gym. HF 17 25 22 19<br />
Politikwissenschaft MA HF 73 95 51<br />
Politikwissenschaft MA NF 20 11 16<br />
Softwaretechnik Diplom 68 138 122 107<br />
Sozialwissenschaften BA HF 2 22 18<br />
Soziologie BA NF 3 1 4<br />
Soziologie MA HF 48 26 25<br />
Soziologie MA NF 22 12 18<br />
Sportwissenschaft BA HF 0 13 2<br />
Sportwissenschaft Diplom 29 27 15 16<br />
Sportwissenschaft LA Gym. BF 3 4 1 2<br />
Sportwissenschaft LA Gym. HF 27 31 40 15<br />
Sportwissenschaft MA HF 11 5 5<br />
Sportwissenschaft MA NF 1 0 0<br />
Techn. Geowissenschaft Diplom 13 15<br />
Technikpäd./Bautechnik Dipl.-Gew.L. 4 6 10 1<br />
Technikpäd./Elektrotechnik Dipl.-Gew.L. 2 2 4 3<br />
Technikpäd./Informatik Dipl.-Gew.L. 4 2 3 2<br />
Technikpäd./Maschinenbau Dipl.-Gew.L. 6 9 16 12<br />
Technikpädagogik Aufbaustu- Dipl.-Gew.L. 13 15<br />
diengang<br />
Technische Biologie Diplom 60 69 75 58<br />
Technische Kybernetik Diplom 71 86 76 79<br />
Technologiemanagement Diplom 184 228 130 129<br />
Umweltschutztechnik BSc 0 1 9 22<br />
Umweltschutztechnik Diplom 112 137 165 191<br />
Verfahrenstechnik BSc 63<br />
XIII
Verfahrenstechnik Diplom 39 61 56<br />
VWL BA NF 1 3 5<br />
VWL t.o. Diplom 43 18<br />
WAREM MSc 53 31 21 18<br />
Werkstoffwissenschaft Diplom 30 43 74 61<br />
Wirtschaftsinformatik BSc 40 45 25 34<br />
* vorläufig<br />
XIV
Tabelle B3: Studienanfänger/innen zum WS (12.10.2005)<br />
– ausgewählte Studiengänge –<br />
Geistes- und Sozialwissenschaften<br />
BWL t.o. Diplom 226 151 96<br />
Germanistik/Deutsch HF 184 152 121<br />
Politikwiss./Sozialwiss. HF 117 95 37<br />
Naturwissenschaften<br />
Chemie Diplom 119 121 139<br />
Physik Diplom 126 134 136<br />
Informatik Diplom 175 171 150<br />
Ingenieurwissenschaften<br />
Architektur Diplom 258 240 246<br />
Bauingenieurwesen Diplom 90 118 97<br />
Elektrotechnik und IT Diplom 213 206 188<br />
Luft-und Raumfahrtt. Diplom 318 275 253<br />
Maschinenwesen Diplom 342 250 258<br />
XIV
Tabelle B4: Studienanfänger/innen zu WS (12.10.2005)<br />
– neue Studiengänge –<br />
Studienfach 2003/04 2004/05 2005/06 D<br />
Diplom<br />
Immobilientechnik und -wirtschaft Diplom 45 59 32<br />
Bachelor Studiengänge<br />
Computational Physics BSc 11 6 3<br />
Elektro- & Informationstechnik BSc 1 4 3<br />
Umweltschutztechnik BSc 1 9 22<br />
Verfahrenstechnik BSc 63<br />
Wirtschaftsinformatik BSc 50 25 34<br />
Anglistik BA / HF 11 13 9<br />
Germanistik BA / HF 7 3 5<br />
Geschichte BA / HF 3 3 12<br />
Kunstgeschichte BA / HF 10 9 19<br />
Pädagogik / Berufspäd. BA / HF 7 9 3<br />
Sozialwissenschaft BA / HF 2 22 18<br />
XV
Tabelle B 5: Entwicklung der Absolvent/innen/zahl Magister- und Lehramtsstudiengänge (nur HF)<br />
Stand 12.10.2005<br />
Absolvent(inn)en Diplom / MSc /<br />
BSc<br />
WS 03/04 SS 2004 WS 04/05 SS 2005*<br />
dt. F dt. M ausl. ausl. dt. F dt. M ausl. ausl. dt. F dt. M ausl. ausl. dt. F dt. M ausl. ausl.<br />
F M<br />
F M<br />
F M<br />
F M<br />
Architektur und Stadtplanung 48 47 17 13 40 79 12 10 36 50 17 18 28 47 20 12<br />
Automatisierung in der Produktion 0 3 0 0 0 7 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0<br />
Bauingenieurwesen 9 22 1 5 10 26 1 7 5 25 1 7 8 14 2 6<br />
BWL t.o. 10 29 2 4 8 37 5 6 7 50 3 11 3 17 1 7<br />
Chemie<br />
2 9 1 2 4 4 1 0 2 4 1 0 6 1 1 0<br />
COMMAS<br />
0 0 0 2 0 0 1 7 0 0 0 2 1 2 0 11<br />
Dt.-Franz. Studiengang Sozialwiss. 1 0 2 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 1 2 1<br />
Elektrotechnik u. Informationst. 1 28 0 7 1 43 2 13 1 35 0 6 2 36 2 9<br />
Energie- und Anlagentechnik 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0<br />
Fahrzeug- und Motorentechnik 0 6 1 0 1 3 0 0 0 9 0 2 0 7 1 1<br />
Geodäsie u. Geoinformatik 0 5 0 0 2 3 0 0 1 1 0 1 1 4 0 0<br />
Geographie 4 6 0 1 4 9 0 0 3 6 0 0 1 3 0 0<br />
Geologie/Paläontologie<br />
0 4 0 0 2 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0<br />
Informatik 0 25 1 3 0 22 2 6 3 23 0 5 2 19 2 8<br />
INFOTECH<br />
0 3 5 18 2 6 3 8 0 1 3 6 0 1 0 0<br />
Linguistik 1 1 0 0 0 3 2 0 2 2 3 0 2 0 1 0<br />
Luft- u. Raumfahrttechnik<br />
3 51 0 10 5 54 1 8 10 50 0 5 3 38 0 8<br />
Maschinenwesen 2 64 2 6 6 55 1 4 4 60 3 14 4 53 2 12<br />
Mathematik 1 4 0 0 5 6 0 0 3 6 0 3 3 3 0 1<br />
Mineralogie<br />
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Physics 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Physik<br />
0 17 0 0 1 15 0 1 1 15 0 3 2 10 2 1<br />
Softwaretechnik<br />
1 19 0 0 1 11 1 3 0 13 0 1 1 6 0 1<br />
Sportwissenschaft<br />
3 8 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Technikpäd./Bautechnik<br />
0 2 0 0 1 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0<br />
XVI
Technikpäd./Elektrotechnik<br />
0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Technikpäd./Maschinenbau<br />
0 5 0 0 0 5 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0<br />
Technische Biologie 12 11 0 0 7 7 0 1 16 10 1 1 7 10 0 0<br />
Technische Kybernetik<br />
0 23 0 1 1 20 0 1 2 11 0 0 1 9 0 0<br />
Technologiemanagement<br />
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Umweltschutztechnik 4 8 0 1 8 18 1 2 4 7 0 1 1 6 1 0<br />
Verfahrenstechnik 1 11 1 1 3 10 0 3 5 10 0 3 1 9 0 1<br />
WAREM 0 3 11 16 2 2 6 6 2 2 4 15 0 0 2 3<br />
WASTE<br />
0 0 3 11 0 0 0 7 0 0 2 3 0 1 0 0<br />
Werkstoffwissenschaft<br />
0 1 0 0 2 5 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0<br />
Wirtschaftsinformatik<br />
0 0 0 0 1 9 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0<br />
zusammen<br />
670 725 671 507<br />
* vorläufig<br />
XVII
Absolvent(inn)en Magister / Lehramt<br />
WS 03/04 SS 2004 WS 04/05 SS 2005*<br />
dt. F dt. M ausl. ausl. dt. F dt. M ausl. ausl. dt. F dt. M ausl. ausl. dt. F dt. M ausl. ausl.<br />
F M<br />
F M<br />
F M<br />
F M<br />
Allg. u.Vergl. Literaturwissenschaften<br />
2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0<br />
Anglistik / Englisch<br />
24 6 4 1 23 13 5 1 17 18 4 0 7 2 3 1<br />
Berufspädagogik 3 3 1 0 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0<br />
Biologie 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Chemie<br />
0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0<br />
Galloromanistik / Französisch 4 1 1 1 10 2 1 0 5 0 3 0 6 0 0 0<br />
Geographie 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Geographie<br />
1 0 0 0 3 5 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0<br />
Germanistik / Deutsch<br />
26 3 5 1 20 12 5 1 22 17 6 1 5 2 5 3<br />
Geschichte 11 8 2 0 4 13 0 0 6 4 0 0 5 5 0 0<br />
Geschichte der Naturwiss. und<br />
Technik<br />
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0<br />
Italianistik / Italienisch<br />
1 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0<br />
Kunstgeschichte 3 1 2 0 4 0 0 0 9 2 1 1 2 0 0 0<br />
Linguistik 3 1 5 0 4 1 4 0 3 2 5 0 3 1 5 1<br />
Maschinenwesen<br />
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Mathematik 1 0 0 0 6 4 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0<br />
Pädagogik<br />
11 1 2 4 3 1 5 1 9 6 4 1 1 0 1 1<br />
Philosophie<br />
2 1 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0<br />
Physik 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Physik<br />
1 2 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0<br />
Politikwissenschaft<br />
6 12 4 1 5 15 1 1 6 11 2 0 4 8 0 0<br />
Soziologie 8 5 1 0 4 5 1 0 10 2 1 0 0 3 0 0<br />
Sportwissenschaft<br />
1 4 0 0 5 11 1 0 4 3 1 0 1 0 0 0<br />
zusammen<br />
199 226 212 83<br />
* vorläufig<br />
XVIII
Tabelle B 6: Anzahl der Promotionen 2003/04 und 2004/05<br />
Fakultät<br />
2003/04 2004/05<br />
M W Alle M W Alle<br />
1 6 2 8 4 3 7<br />
2 27 5 32 33 7 40<br />
3 44 9 53 38 13 51<br />
4 11 10 21 14 8 22<br />
5 26 3 29 24 1 25<br />
6 23 1 24 26 3 29<br />
7 119 7 126 102 4 106<br />
8 37 4 41 40 6 46<br />
9 12 16 28 9 7 16<br />
10 12 4 16 14 4 18<br />
Gesamt 317 61 378 304 56 360<br />
Figur B5: Promotionen<br />
2004/05<br />
2003/04<br />
2002/03<br />
2001/02<br />
2000/01<br />
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450<br />
360<br />
378<br />
380<br />
393<br />
415<br />
XXI
Tabelle B 7: Anzahl der Habilitationen<br />
Fakultät 2003/2004 2004/2005<br />
M W Alle M W Alle<br />
1<br />
2 1 1 2 2<br />
3 3 1 4 4 4<br />
4 1 1 4 1 5<br />
5 3 1 4<br />
6 1 1 1 1<br />
7 2 2 2 2<br />
8 1 1 4 4<br />
9 1 3 1 2 4 6<br />
10 1 1<br />
Gesamt 10 5 15 22 6 28<br />
Figur B6: Habilitationen<br />
2004/05<br />
2003/04<br />
2002/03<br />
2001/02<br />
2000/01<br />
13<br />
15<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40<br />
20<br />
28<br />
36<br />
XXII
ANHANG C: PERSONAL<br />
XXIII
1. IN MEMORIAM<br />
2. Ehrungen und wissenschaftliche Anerkennungen <strong>für</strong> Angehörige<br />
der <strong>Universität</strong> - soweit bekannt geworden<br />
3. Nachwuchs- und Studienpreise<br />
4. Verleihung der Würde einer Ehrendoktorin/eines Ehrendoktors<br />
5. Verleihung der Würde einer Ehrensenatorin/eines Ehrensenators<br />
6. Verleihung der Ehrenmedaille der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
7. Rufe an andere Hochschulen - soweit bekannt geworden<br />
8. Emeritierung und Ruhestand von <strong>Universität</strong>sprofessorinnen/<strong>Universität</strong>sprofessoren<br />
9. Zur <strong>Universität</strong>sprofessorin/zum <strong>Universität</strong>sprofessor ernannt<br />
10. Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßige Professorin/außerplanmäßiger<br />
Professor“:<br />
11. Zur Honorarprofessorin/zum Honorarprofessor wurden bestellt:<br />
12. 40-jähriges Dienstjubiläum:<br />
25-jähriges Dienstjubiläum:<br />
13. Statistiken<br />
XXIV
1. IN MEMORIAM<br />
Kochendörfer, Richard, Apl. Prof.<br />
verstorben am 20.04.2005<br />
Roediger, Hanns, Honorarprofessor Dr.-Ing.<br />
verstorben am 24.12.2004<br />
Späth, Franz, Prof. a. D. Dr. Dr.<br />
verstorben am 03.12.2004<br />
Ströhle, Wolfgang<br />
verstorben am 17.01.2005<br />
Beutelspacher, Petra, Studentin<br />
verstorben am 13.06.2005<br />
Adamczuk, Michael, Student<br />
verstorben am 05.08.2005<br />
XXV
2. Ehrungen und wissenschaftliche Anerkennungen <strong>für</strong> Angehörige<br />
der <strong>Universität</strong> - soweit bekannt geworden<br />
Prof. Dr. phil. Eduard Arzt<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Metallkunde<br />
Wissenschaftspreis des Stifterverbandes <strong>für</strong> die Deutsche Wissenschaft<br />
Prof. Dr.-Ing. Monika Auweter-Kurtz<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>für</strong> Raumfahrtsysteme<br />
Frauenpreis „DODO“<br />
und<br />
Wahl in das Gutachtergremium <strong>für</strong> die Auswahl der Experim. <strong>für</strong> die ISS der<br />
Europäische Raumfahrtagentur ESA<br />
Prof. Dr. techn. Herwig Brunner<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Grenzflächenverfahrenstechnik<br />
und Fraunhofer-<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik<br />
Wahl zum Mitglied der Leibniz-Sozietät<br />
Prof. a. D. Dr. phil. Norbert Conrads<br />
Historisches <strong>Institut</strong><br />
Goldene Medaille der <strong>Universität</strong> versität Wroclaw (Breslau)<br />
Prof. Dr.-Ing. Gerhart Eigenberger<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Chemische Verfahrenstechnik<br />
Ernest-Solvay-Preis der Ernest-Solvay-Stiftung<br />
Prof. Dr.-Ing. Rolf Eligehausen<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Werkstoffe im Bauwesen<br />
Ernennung zum Fellow des American Concrete <strong>Institut</strong>e (ACI)<br />
Medal of Merit der Fédération International du Béton (fib)<br />
Prof. Dr.-Ing. Peter Eyerer<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Kunststoffprüfung und Kunststoffkunde<br />
Berufung in das Nationalkomitee <strong>für</strong> die Weltdekade "Bildung <strong>für</strong> nachhaltige<br />
Entwicklung" der UNESCO-Kommission<br />
Prof. Artur Fischer<br />
Ehrensenator der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
Gründerpreis Baden-Württemberg<br />
XXVI
Prof. Dr.-Ing. Dieter Fritsch<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Photogrammetrie</strong><br />
Wahl zum Vorsitzenden des Beirats "Wissenschaft, Forschung und Kunst" von Baden-Württemberg<br />
International - Gesellschaft <strong>für</strong> internationale wirtschaftliche und<br />
wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
Prof. Dr. Oscar W. Gabriel<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>für</strong> Sozialwissenschaften<br />
Wahl zum Vorsitzenden des Kuratoriums der Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher<br />
Infrastrukureinrichtungen (GESIS)<br />
Prof. Grafarend<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie<br />
Ernennung zum korrespondierenden Mitglied der Österreichischen Geodätischen<br />
Kommission (ÖGK)<br />
Franziska Harms<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Raumfahrtsysteme<br />
Amelia Earhart Award 2005<br />
Prof. Emeritus Dr.-Ing. Dr.-Ing. Gerhard Heimerl<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Eisenbahn- und Verkehrwesen<br />
Public Award der European Platform of Transport Sciences des Europäischen<br />
Verkehrskongresses 2004 in Opatija<br />
und<br />
Ehrenmedaille der <strong>Universität</strong> Stettin<br />
und<br />
Ernennung zum Ehrenmitglied der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen<br />
Gesellschaft<br />
Prof. Dr.-Ing. Klaus Hein<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>für</strong> Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen<br />
Percy W. Nicholls Award der American Society fo Mechanical Engineering<br />
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. mult. Uwe Heisel<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Werkzeugmaschinen<br />
Ernennung zum Ehrendoktor der Universitatea „Politehnica“ in Timisoara (Rumänien)<br />
Prof. Dr. rer. nat. Hans Herrmann<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>für</strong> Computerphysik<br />
Gentner-Kastler-Preis 2005 der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und der<br />
Société Francaise de Physique<br />
XXVII
Prof. Dr. Christoph Hubig<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Philosophie<br />
Ernennung zum Honorarprofessor an der Dalian University of Technology/Dalian,<br />
China<br />
Prof. a. D. Dr.-Ing. Helmut Hügel<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>für</strong> Strahlwerkzeuge<br />
23. Arthur L. Schawolow Award des Laser <strong>Institut</strong>e of America (LIA)<br />
und<br />
Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg<br />
Prof. Dr. rer. nat. Martin Jansen<br />
Honararprofessor der Fakultät Chemie<br />
Ernennung zum Ehrendoktor der Ludwig-Maximilian-<strong>Universität</strong> München<br />
und<br />
Wissenschaftspreis des Stifterverbandes <strong>für</strong> die Deutsche Wissenschaft<br />
Prof. Emeritus Dr. Eberhard Jäckel<br />
Historisches <strong>Institut</strong><br />
ordentliches Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften (seit 1995)<br />
ausländisches Mitglied der Polnischen Akademie der Wissenschaften (seit 1997)<br />
Josef-Hlávka-Gedenkmedaille der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften<br />
(1992)<br />
Prof. Wolfgang Kaim<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>für</strong> Anorganische Chemie<br />
Ernennung zum Gastprofessor der Northern Illinois University (USA) und der Sun<br />
yat-sen <strong>Universität</strong> in Guanghzhou (China)<br />
Dipl.-Phys. Bernd Kaltenhäuser<br />
5. Physikalisches <strong>Institut</strong><br />
Dr.-Heinrich-Düker-Preis der Stiftung <strong>für</strong> Bildung und Behindertenförderung<br />
Prof. a. D. Dr.-Ing. Karlheinz Krauth<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>für</strong> Siedlungswasserbau, Wassergüte und Abfallwirtschaft<br />
Max-Prüß-Medaille der Deutschen Vereinigung <strong>für</strong> Wasserwirtschaft, Abwasser und<br />
Abfall<br />
Prof. Dr.-Ing. Paul J. Kühn<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>für</strong> Kommunikationsnetze und Rechnersysteme<br />
Wahl in den Beirat des neu gegründeten Forschungszentrums <strong>für</strong><br />
Informationstechnik-Gestaltung der <strong>Universität</strong> Kassel<br />
XXVIII
Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Konstruktion und Entwurf<br />
IVBH Preis 1997 und<br />
Bundesverdienstkreuz am Bande<br />
Dr. Susanne Lin-Klitzing<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>für</strong> Erziehungswissenschaft und Psychologie<br />
Landeslehrpreis 2004<br />
Diana Lauffer<br />
Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie<br />
Amelia Earhart Award 2005<br />
Prof. Dr. phil. Georg Maag<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>für</strong> Literaturwissenschaft<br />
Sonderpreis in Verbindung mit der Verleihung des "Premio Ozieri" (Sardinien)<br />
Prof. Dr.-Ing. Ullrich Martin<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>für</strong> Eisenbahn- und Verkehrswesen<br />
Wahl zum korrespondierenden Mitglied der Technikwissenschaftlichen Klasse der<br />
Sächsische Akademie der Wissenschaften<br />
und<br />
Wahl zum Mitglied im UITP Academic Network<br />
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Massonne<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>für</strong> Mineralogie und Kristallchemie<br />
Wahl zum Fellow der Mineralogical Society of America<br />
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Messerschmid<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Raumfahrtsysteme, Abteilung Astronautik und Raumstationen<br />
Ernennung zum Mitglied der Deutschen Akademie <strong>für</strong> Naturforscher Leopoldina<br />
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Nagel<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Biomedizinische Technik<br />
Wahl zum Fellow des American <strong>Institut</strong>e for Medical and Biological Engineering<br />
(AIMBE) und zum Fellow der Biomedical Engineering Society (USA)<br />
Prof. Dr.-Eng. Hideo Nakamura<br />
Ehrendoktor der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
Wahl zum Präsidenten der Technischen <strong>Universität</strong> Musashi (Musashi <strong>Institut</strong>e of<br />
Technology)<br />
XXIX
Anuscheh Nawaz<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Raumfahrtsysteme<br />
Amelia Earhart Award 2005<br />
Prof. Emeritus Dr.-Ing. Frei Otto<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren<br />
Royal Gold Medal 2005 des Royal <strong>Institut</strong>e of British Architects (RIBA)<br />
Prof. Dr.-Ing. Günter Pritschow<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen<br />
Ernennung zum Ehrendoktor der Technischen <strong>Universität</strong> Chemnitz<br />
und<br />
Wahl zum Vorsitzenden des Kuratoriums der Technischen <strong>Universität</strong> Chemnitz<br />
Prof. Dr.-Ing. Ekkehard Ramm<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>für</strong> Baustatik<br />
Ernennung zum Ehrendoktor der Technische <strong>Universität</strong> München<br />
und<br />
Ernennung zum Ehrendoktor der University of Calgary<br />
und<br />
Wahl zum korrespondierenden Mitglied der Österreichischen Akademie der<br />
Wissenschaften und der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft<br />
Prof. Dr.-Ing. Hans-Wolf Reinhardt<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>für</strong> Werkstoffe im Bauwesen<br />
Ernennung zum „Fellow“ des American Concrete <strong>Institut</strong>e der amerikanischen<br />
Organisation <strong>für</strong> Betonbau<br />
und<br />
Ernennung zum Ehrendoktor der Technischen <strong>Universität</strong> Braunschweig<br />
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Hans-Eckardt Schaefer<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>für</strong> Theoretische und Angewandte Physik<br />
Hsun-Lee Joint Research Award des <strong>Institut</strong>e of Metal Research der chin. Akademie<br />
der Wissenschaft, Shenyang<br />
und<br />
Ernennung zum Gastprofessor der Yanshan University in Quinhuangdao<br />
Prof. Dr. rer. pol. Henry Schäfer<br />
Dipl-Volkswirt Philipp Lindenmayer<br />
Betriebswirtschaftliches <strong>Institut</strong><br />
Olaf-Triebenstein-Preis 2004 der Stiftung Warentest<br />
Prof. a. D. Dr.-Ing. Werner Schiehlen<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Mechanik (B)<br />
Ernennung zum Ehrenmitglied der European Mechanics Society (EUROMECH)<br />
XXX
Prof. Emeritus Dr.-Ing. Jörg Schlaich<br />
Ernennung zum Ehrenprofessor der Huazhong University of Science and Technology<br />
in Wuhan<br />
Prof. Dr.-Ing. Michael Schmidt<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>für</strong> Heiz- u. Raumlufttechnik<br />
Hermann-Rietschel-Ehrenmedaille<br />
und<br />
Wahl zum Vizepräsidenten der Federation of European Heating and Air-Conditioning<br />
Associations (REHVA)<br />
Prof. Dr.-Ing. Werner Sobek<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>für</strong> Leichtbau, Entwerfen und Konstuieren<br />
Auguste-Perret-Preis 2005 des Weltverbandes der Architekten (Union Internationale<br />
des Architectes)<br />
Prof. Dr.-Ing. Pieter A. Vermeer<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>für</strong> Geotechnik<br />
Forschungspreis des Königlichen <strong>Institut</strong>es der Ingenieure (Niederlande)<br />
Prof. Rudolf Voit-Nitschmann<br />
Dr.-Ing. Michael Rehmet<br />
Werner Schulz<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>für</strong> Flugzeugbau<br />
Prince Alvaro de Orleon-Borbon Fund Preis der Fédération Aéronautique<br />
Internationale (FAI)<br />
Dr. rer. nat. Jürgen Weis<br />
Privatdozet der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
Rudolf-Kaiser-Preis des Stifterverbandes <strong>für</strong> die Deutsche Wissenschaft<br />
Fakultät Architektur und Stadtplanung<br />
Otto-Mühlschlegel-Preis "Zukunft Alter" der Erich-und-Liselotte-Gradmann-Stiftung<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
3. Preis im bundesweiten Hochschulwettbewerb der Initiative D 21<br />
XXXI
3. Nachwuchs- und Studienpreise<br />
Rüdiger Barth<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung<br />
Preis der Baden-Württembergischen Elektrizitätswirtschaft <strong>für</strong> seine Diplomarbeit<br />
Dipl.-Ing. Hannah Böhrk<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Raumfahrtsysteme<br />
Amelia-Earhart-Preis<br />
Dipl.-Ing. Thomas Bürgstein<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Systemtheorie und Bildschirmtechnik<br />
Edison-Preis in Bronze der General Electrics Stiftung (Sitz in Budapest)<br />
Dr.-Ing. Tobias Erhart<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Baustatik<br />
Preis der Freunde der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> <strong>für</strong> seine Dissertation<br />
Dr. Uwe Gomolinsky<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>für</strong> Sportwissenschaft<br />
Kurt-Hegele-Preis<br />
Dipl.-Ing. Silke Kersen<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Grenzflächenverfahrenstechnik<br />
Hugo-Geiger-Preis<br />
Dr.-Ing. Wolfgang Klos<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>für</strong> Maschinenkonstruktion<br />
Südwestmetall-Preis zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses<br />
Dr.-Ing. Stefan Pfletschinger<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>für</strong> Nachrichtenübertragung<br />
Rudolf-Urtel-Preis der Fernseh- und Kinotechnischen Gesellschaft in Zürich<br />
M. Sc. Ayelet Walter<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Kernenergetik und Energiesysteme<br />
EnBW-Preis der Helmholtz-Gemeinschaft zur nuklearen Sicherheitsforschung<br />
Dipl.-Biol. (t.o.) Xin Xiong<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Grenzflächenverfahrenstechnik<br />
Hugo-Geiger-Preis<br />
XXXII
Nils Krohn<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Kunststoffprüfung und Kunststoffkunde<br />
Berthold-Preis 2004 der Deutschen Gesellschaft <strong>für</strong> zerstörungsfreie Prüfung<br />
Dr.-Ing. Anna Krolo<br />
Dr.-Ing. Joachim Ryborz<br />
Dipl.-Ing. Claus Gerald Pflüger<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Maschinenelemente<br />
Gisbert-Lechner-Preis<br />
Fakultät Architektur und Stadtplanung<br />
Jo Schwarz<br />
Christoph Herrmann<br />
Uwe Lehmkühler<br />
Volker Mayntz<br />
Karl-Steinbuch-Stipendien der MFG-Stiftung Baden-Württemberg<br />
Studiengang Architektur<br />
Patrick Herzer<br />
Prämie der Stiftung der deutschen Städte, Gemeinden und Kreise zur Förderung der<br />
Kommunalwissenschaften<br />
Studiengang Bauingenieurwesen<br />
Tobias Gebler<br />
Jörg Franke<br />
Annette Lächler<br />
Christian Seng<br />
Anerkennungspreis beim Schinkel-Wettbewerb<br />
Studiengang Immobilientechnik und Immobilienwirtschaft<br />
Stephan Klamert<br />
<strong>Stuttgart</strong>er Immobilienpreis<br />
Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften<br />
Benjamin Schneider<br />
Emil - Mörsch – Studienpreis des Freundeskreises Württembergischer Ingenieure<br />
des Konstruktiven Ingenieurbaus<br />
Fakultät Chemie<br />
Anja Rieche<br />
Sascha Schäfer<br />
Procter & Gamble-Förderpreis <strong>für</strong> ausgezeichnete Studienleistungen<br />
Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik<br />
Sheung Ying Yueng<br />
Kabbab Mounir<br />
XXXIII
Marc Barisch<br />
Thorsten Freckmann<br />
Heiko Mangold<br />
Preis der Richard-Hirschmann-Stiftung 2004<br />
Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik<br />
Stefan Ulrich<br />
Frank Feller<br />
Michael Schoor<br />
Manuel Gärtner<br />
Jirapat Methaseth<br />
Preis der Richard-Hirschmann-Stiftung 2005<br />
Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik<br />
Jirapat Methaseth<br />
Frank Feller<br />
Michael Schoor<br />
Stefan Uhlich<br />
Sven Lill<br />
Bastian Diehm<br />
Thomas Kirchartz<br />
Studienpreis der Anton-und-Klara-Röser-Stiftung<br />
Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik<br />
Tobias Schafhitzel<br />
Marko Vrhovnik<br />
Preis des Informatik Verbunds <strong>Stuttgart</strong><br />
Fakultät Maschinenbau<br />
Frank Blum<br />
Procter & Gamble-Förderpreis <strong>für</strong> ausgezeichnete Studienleistungen<br />
Fakultät Maschinenbau, IMK – Technisches Design<br />
Sandra Nowak: Preis <strong>für</strong> Technisches Design 2005 <strong>für</strong> ihre Diplomarbeit<br />
Christoph Leute: Anerkennung <strong>für</strong> Technisches Design 2005 <strong>für</strong> seine Studienarbeit<br />
Gestiftet von der Eugen und Irmgard Hahn Stiftung<br />
Fakultät Maschinenbau<br />
Sandra Nowak<br />
Prämie <strong>für</strong> Diplomarbeit<br />
Fakultät Maschinenbau<br />
Alexandra Fritsch<br />
Mathias Lehmann<br />
LEWA-Preis <strong>für</strong> ausgezeichnete Studienleistungen<br />
XXXIV
Fakultät Maschinenbau<br />
Trong Nghia Nguyen<br />
Martin Schilling<br />
Preise der Ensinger Stiftung<br />
Fakultät Maschinenbau<br />
Axel Heß<br />
Studienpreis der Anton-und-Klara-Röser-Stiftung<br />
Studiengang Verfahrenstechnik<br />
Stefanie Geier<br />
Martina Heitzig<br />
Holger Werhan<br />
Buchpreise im Vordiplom<br />
Alexandra Fritsch<br />
Ralf Jörg Notz<br />
Martin Tenzer<br />
Buchpreise im Hauptdiplom<br />
Studiengang Technische Kybernetik<br />
Angela Schöllig<br />
Martin Kaszynski<br />
Markus Reble<br />
Markus Schleyer<br />
Peter-Sagirow-Preis <strong>für</strong> das Vordiplom<br />
Frank Blum<br />
Tobias Mauk<br />
Frank Schmid<br />
Philipp Wolfrum<br />
Peter-Sagirow-Preis <strong>für</strong> das Hauptdiplom<br />
Studiengang Technische Kybernetik<br />
Marc Oliver Wagner<br />
Studienpreis 2003 der SEW-EURODRIVE-Stiftung<br />
Studiengang Technisch orientierte Betriebswirtschaftslehre<br />
Elmar Armin Dworski<br />
Österreichischer Controllerpreis<br />
Fakultät Mathematik und Physik<br />
Studiengang Physik<br />
Jochen Hub<br />
Ralf Kaminke<br />
Artur-Fischer-Preis 2005<br />
XXXV
Unternehmen FOLDCORE (Ausgründung aus der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong>)<br />
1. Platz im Innovationswettbewerb CyberOne 2005<br />
und<br />
3. Platz im StartUP-Gründungswettbewerb<br />
Rolf Gehre<br />
5. Preis im Wettbewerb ‚Jugend forscht’<br />
Dr. Thomas Stark<br />
Dr. Stefan Nonnenmacher<br />
Förderpreis der Friedrich-und-Elisabeth-Boysen-Stiftung<br />
Daniel Krätschmer<br />
Thomas Laun<br />
Thomas Reeß<br />
Holger Bastuck<br />
Christoph Schlegel<br />
Preis der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> <strong>für</strong> studentisches Engagement<br />
Kerstin Renz<br />
Martin Kraus<br />
Piet O. Schmidt<br />
Roland Haehnel<br />
Jennifer Niessneer<br />
Stefan Rüdenauer<br />
Andreas Gutscher<br />
Diane Lauffer<br />
Karsten Weiß<br />
Helmut Linde<br />
Sandra Kostner<br />
Seda Tunc<br />
Marc Scheffler<br />
Thomas Speck<br />
Preis der Vereinigung von Freunden der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
XXXVI
4. Verleihung der Würde einer Ehrendoktorin/eines Ehrendoktors<br />
an:<br />
13.07.2005: Herrn Prof. Dr.-Ing. Walter H. Dilger<br />
in Anerkennung seiner herausragenden technisch-wissenschaftlichen Leistungen auf<br />
dem Gebiet des konstruktiven Ingenieurbaus, insbesondere der Erforschung des<br />
Tragverhaltens des Stahlbetons und Spannbetons und deren Anwendung im Brückenbau.<br />
Ebenso wird damit sein breites internationales politisches Engagement sowie<br />
das von ihm mit initiierte und als Programmdirektor mitbetreute 25-jährige Austauschprogramm<br />
<strong>für</strong> Studenten der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> und der University of Calgary<br />
gewürdigt.<br />
8.06.2005: Herrn Prof. Dr. Denis Jérome<br />
in Anerkennung seiner Bahn brechenden Arbeiten auf dem Gebiet der organischen<br />
Leiter und Supraleiter. Er wird ebenso als eine der herausragenden Persönlichkeiten<br />
in der Festkörperphysik gewürdigt.<br />
13.07.2005: Herrn Prof. Dr. phil. Kurt Ludwig Komarek<br />
in Anerkennung seiner außergewöhnlichen fachübergreifenden wissenschaftlichen<br />
Leistungen und Verdienste <strong>für</strong> die Chemie sowie seinen Einsatz in der Hochschul-<br />
und Gesellschaftspolitik.<br />
4.05.2005: Herrn Prof. Dr. Egon Krause Ph.D.<br />
in Würdigung seiner Verdienste um die Strömungsmechanik, insbesondere auf dem<br />
Gebiet der numerischen Methoden und der Wirbeldynamik.<br />
XXXVII
5. Verleihung der Würde einer Ehrensenatorin/eines Ehrensenators<br />
an:<br />
26.01.2005: Herrn Prof. Dr. h. c. Reinhold Würth<br />
in Würdigung seiner hervorragenden Leistungen als weitsichtiger Unternehmer auf<br />
dem Gebiet der Befestigungstechnik sowie seines persönlichen Engagements und<br />
großzügiger Förderung der Forschung und des Ingenieurnachwuchses an der <strong>Universität</strong><br />
<strong>Stuttgart</strong>.<br />
6. Verleihung der Ehrenmedaille der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> an:<br />
13.07.2005: Herrn Prof. Dr.-Ing. Jan Koch<br />
in Würdigung seiner Verdienste um die Kooperation und den wissenschaftlichen Austausch<br />
zwischen der Technischen <strong>Universität</strong> Breslau und der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
und seine tatkräftige, Jahrzehnte währende Förderung von Lehre und Forschung an<br />
der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong>.<br />
XXXVIII
7. Rufe an andere Hochschulen - soweit bekannt geworden -<br />
PD Dr. Achim Bräuning<br />
<strong>Universität</strong> Erlangen-Nürnberg<br />
PD Dr. Raimund Bürger<br />
Departamento de Ingeniería Matemática der Universidad<br />
de Concepción in Concepción (Chile)<br />
Dr.-Ing. Stefan Hurlebaus<br />
A & M University, Texas<br />
PD Dr. Axel Klein<br />
<strong>Universität</strong> zu Köln<br />
PD Dr. Michael Kohler<br />
<strong>Universität</strong> des Saarlandes<br />
PD Dr. Jörg Pietruszka<br />
Heinrich-Heine-<strong>Universität</strong> Düsseldorf<br />
PD Dr. Andreas Rödder<br />
Johannes-Gutenberg-<strong>Universität</strong> Mainz<br />
Dr. Christophe Weber<br />
<strong>Universität</strong> Duisburg-Essen<br />
Dr. Daniel Weiskopf<br />
Simon-Fraser-University in Vancouver, Kanada<br />
PD Dr. Rainer Winter<br />
<strong>Universität</strong> Regensburg<br />
XXXIX
8. Emeritierung und Ruhestand von <strong>Universität</strong>sprofessorinnen/Uni-versitätsprofessoren<br />
Prof. Dr. Günther Bien<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Philosophie<br />
Prof. Dr. Gerd Blind<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Geometrie und Topologie<br />
Prof. Dr.-Ing. Gerhart Eigenberger<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Chemische Verfahrenstechnik<br />
Prof. Dr.-Ing. Erik Grafarend<br />
Geodätisches <strong>Institut</strong><br />
Prof. Dr.-Ing. Klaus Hein<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Verfahrenstechnik<br />
und Dampfkesselwesen<br />
Prof. Dr. Péter Horváth<br />
Betriebswirtschaftliches <strong>Institut</strong><br />
Prof. Dr.-Ing. Friedrich Landstorfer<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Hochfrequenztechnik<br />
Prof. Dr. Helge Majer<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Volkswirtschaftslehre<br />
und Recht<br />
Prof. Dipl.-Ing. Boris Podreka<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Innenraumgestaltung<br />
und Entwerfen<br />
Prof. Dr.-Ing. Horst Roos<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Fördertechnik und Logistik<br />
Prof. Dr. Heinz Schlaffer<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Literaturwissenschaft<br />
Abt. Neuere Deutsche Literatur I<br />
Prof. Dr. Gustav Schoder<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Sportwissenschaft<br />
Prof. Dr. Uwe Schumacher<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Plasmaforschung<br />
Prof. Dr. Hans-Ulrich Seeber<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Literaturwissenschaft<br />
XL
Prof. Dr.-Ing. Klaus Siegert<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Umformtechnik<br />
Prof. Dr. Peter Treuner<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Raumordnung<br />
und Entwicklungsplanung<br />
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Wendland<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Angewandte Analysis<br />
und Numerische Simulation<br />
Prof. Dr. Erhard Wielandt<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Geophysik<br />
XLI
9. Zur <strong>Universität</strong>sprofessorin/zum <strong>Universität</strong>sprofessor der Bes. Gr.<br />
C 4 ernannt<br />
<strong>Universität</strong>sprofessor Harald Gießen, Ph. D.<br />
4. Physikalisches <strong>Institut</strong><br />
<strong>Universität</strong>sprofessor Dr.-Ing. Ewald Krämer<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Aerodynamik und Gasdynamik<br />
<strong>Universität</strong>sprofessor Dr.-Ing. Ulrich Nieken<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Chemische Verfahrenstechnik<br />
<strong>Universität</strong>sprofessor Dr. Günter Scheffknecht<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen<br />
<strong>Universität</strong>sprofessor Dr. Ulrich Stroth<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Plasmaforschung<br />
<strong>Universität</strong>sprofessorin Dr. Annette Werner<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Algebra und Zahlentheorie,<br />
Lehrstuhl <strong>für</strong> Algebraische Geometrie und Algebra<br />
10. Zur <strong>Universität</strong>sprofessorin/zum <strong>Universität</strong>sprofessor der Bes. Gr.<br />
C 3 ernannt<br />
<strong>Universität</strong>sprofessor Dr. Andreas Friedrich<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Thermodynamik und Wärmetechnik<br />
<strong>Universität</strong>sprofessor Dr. Roland Kontermann<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Zellbiologie und Immunologie<br />
<strong>Universität</strong>sprofessor Dipl.-Ing. Jürgen Schreiber<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Baustofflehre, Bauphysik, Technischer Ausbau und<br />
Entwerfen<br />
XLII
Zur <strong>Universität</strong>sprofessorin/zum <strong>Universität</strong>sprofessor der Bes. Gr. W 3<br />
ernannt<br />
<strong>Universität</strong>sprofessor Dr.-Ing. Joachim Burghartz<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Zeitmesstechnik, Fein- und Mikrotechnik bzw.<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Mikroelektronik <strong>Stuttgart</strong> (Wirtschaftsministerium)<br />
<strong>Universität</strong>sprofessor Dr. Marcel Griesemer<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Analysis, Dynamik und Modellierung<br />
<strong>Universität</strong>sprofessor Dr.-Ing. Mathias Liewald<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Umformtechnik<br />
<strong>Universität</strong>sprofessor Dr.-Ing. Martin Radetzki<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Technische Informatik/Fachrichtung „Embedded Systems Engineering“<br />
<strong>Universität</strong>sprofessor Dr.-Ing. Alexander Verl<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und<br />
Fertigungseinrichtungen<br />
<strong>Universität</strong>sprofessor Dr.-Ing. Heinz Voggenreiter<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Flugzeugbau, Arbeitsbereich Bauweisen und Strukturen<br />
10. Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßige Professorin/außerplanmäßiger<br />
Professor“<br />
Privatdozent Dr. Christoph König<br />
Privatdozent Dr.-Ing. Karl Maile<br />
Privatdozent Dr.-Ing. Joško Ožbolt<br />
Privatdozent Dr.-Ing. Ulrich Rist<br />
Privatdozent Dr.-Ing. Hermann Schad<br />
Privatdozent Dr.-Ing. Uwe Schnell<br />
Privatdozent Dr. Andreas Stolz<br />
XLIII
11. Zur Honorarprofessorin/zum Honorarprofessor wurden bestellt:<br />
Dr.-Ing. Gerd Baldauf<br />
Dr.-Ing. Hardo Braun<br />
Dipl.-Ing. Ulrich Bruhnke<br />
Dr. Ulrich Fellmeth<br />
Dr. Michael Goer<br />
Dr. Wolfgang Henn<br />
Dr. Joachim Niemeier<br />
Dr.-Ing. Rainer Ott<br />
Dr. Jörg Senn-Bilfinger<br />
Dr. Theo Simon<br />
Dr. Christian Steger<br />
XLIV
12. 40-jähriges Dienstjubiläum<br />
Arnold, Ulli, Dr. <strong>Universität</strong>sprofessor<br />
Bark, Dr. Joachim <strong>Universität</strong>sprofessor<br />
Bertagnolli, Dr. Helmut <strong>Universität</strong>sprofessor<br />
Docter, Winfried Kraftwerker<br />
Eligehausen, Dr.-Ing. Rudolf <strong>Universität</strong>sprofessor<br />
Gaebe, Dr. rer. pol. Wolf <strong>Universität</strong>sprofessor<br />
Härer, Erich Technischer Angestellter<br />
Karl, Dr.-Ing. Hans Akademischer Direktor<br />
Koch, Jörgen Werkstoffprüfer<br />
Kuhn, Apl. Prof. Dr. Axel <strong>Universität</strong>sdozent<br />
Kühn, Dr.-Ing. Paul <strong>Universität</strong>sprofessor<br />
Nürnberger, Apl. Prof. Dr.-Ing. Ulf Ltd. Regierungsbaudirektor<br />
Port, Dr. Helmut Akademischer Oberrat<br />
Reineck, Dr.-Ing. Karl-Heinz Akademischer Direktor<br />
Rott, Dr.-Ing. Ulrich <strong>Universität</strong>sprofessor<br />
Schwörer, Dr. Karl Wissenschaftlicher Angestellter<br />
Seyfried, Ellen Verwaltungsangestellte<br />
Steinwand, Dr.-Ing. Jörg Ulrich Akademischer Oberrat<br />
Thöne, Dr. Karin Akademische Direktorin<br />
Wielandt, Dr. Erhard <strong>Universität</strong>sprofessor<br />
Zeitz, Dr.-Ing. Michael <strong>Universität</strong>sprofessor<br />
XLV
25-jähriges Dienstjubiläum:<br />
Bäcker, Frank Mechaniker<br />
Braun, Michael Chemotechniker<br />
Crienitz, Stefan Akademischer Oberrat<br />
Czepan, Anna-Maria Verwaltungsangestellte<br />
Dominikovic, Anna Arbeiterin<br />
Dominikovic, Stefan Platzwart<br />
Ehling, Walter wissenschaftlicher Angestellter<br />
Eyb, Dr.-Ing. Gerhard wissenschaftlicher Angestellter<br />
Frommert, Irene Chemotechnikerin<br />
Göc, Ünal Angestellte im Schreibdienst<br />
Haller, Peter Techniker<br />
Hartling, Manfred technischer Angestellter<br />
Höllering, Ingeborg Verwaltungsangestellte<br />
Küster, Uwe wissenschaftlicher Angestellter<br />
Leisner, Monika Fremdsprachensekretärin<br />
Lesky, Dr. Peter Akademischer Oberrat<br />
Maag, Dr. phil. Georg <strong>Universität</strong>sprofessor<br />
Metzger, Marianne Verwaltungsangestellte<br />
Meyers, Lothar Techniker<br />
Plotz, Thomas Mechaniker<br />
Poljak, Ildiko Verwaltungsangestellte<br />
Räuchle, Werner Elektrotechniker<br />
Schlebbe, Heribert Programmierer<br />
Schünemann, Angelika Verwaltungsangestellte<br />
Siebke, Gisela chemisch-technische Assistentin<br />
Speidel, Herbert technischer Angestellter<br />
Stephan, Werner Ltd. Bibliotheksdirektor<br />
Turowski, Volker Mechaniker<br />
Untereiner, Gabriele chemisch-technische Assistentin<br />
Wagner, Ewald Meister<br />
Watzlawick, Dr. Hildegard Akademische Rätin<br />
Weik, Wilfried technischer Angestellter<br />
Zeller, Dr.-Ing. Christoph Akademischer Oberrat<br />
Zitzler, Ursula Pressereferentin<br />
Zöltzer, Dr. Dieter Akademischer Oberrat<br />
XLVI
13. Statistik<br />
Tabelle 1: Beschäftigte an der <strong>Universität</strong> <strong>Stuttgart</strong> nach Fakultäten<br />
Stand 01.10.2005<br />
Fakultät Professoren<br />
Wissenschaftliche<br />
Beamte<br />
Wissenschaftliche<br />
Beamte<br />
Wissenschaftliche<br />
Angestellte<br />
Wissenschaftliche<br />
Angestellte aus<br />
Drittmitteln<br />
Technisches<br />
Personal<br />
Verwaltungs-<br />
/Bibliotheks-<br />
Personal<br />
C4/C3 C2/C1 A13-16 BAT IIa - I BAT IIa - I<br />
Zentrale<br />
Einrichtungen 1<br />
- 29 219 131 442 385<br />
1 21 2 8 82 16 11 28<br />
2<br />
24 6 24 215 147 100 40<br />
3 20 9 17 133 70 80 20<br />
4<br />
17 14 10 78 50 43 16<br />
5 28 21 13 220 134 83 41<br />
6<br />
19 5 8 192 131 119 28<br />
7 52 10 35 566 421 220 96<br />
8<br />
33 7 18 171 95 89 34<br />
9 23 19 8 62 18 1 27<br />
10<br />
19 8 16 87 37 6 30<br />
Summe: 257 101 186 2.025 1.250 1.194 745