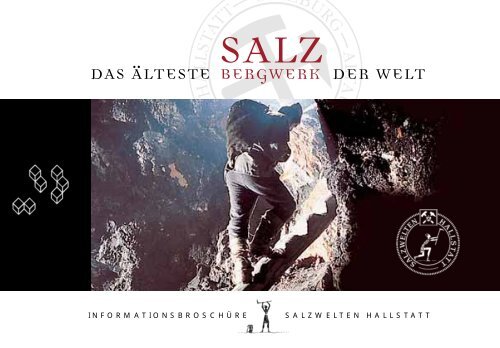DAS ÄLTESTE BERGWERK DER WELT - Welterbe-Aktiv
DAS ÄLTESTE BERGWERK DER WELT - Welterbe-Aktiv
DAS ÄLTESTE BERGWERK DER WELT - Welterbe-Aktiv
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
SALZ<br />
<strong>DAS</strong> <strong>ÄLTESTE</strong> <strong>BERGWERK</strong> <strong>DER</strong> <strong>WELT</strong><br />
INFORMATIONSBROSCHÜRE SALZ<strong>WELT</strong>EN HALLSTATT
HALLSTATT SCHREIBT <strong>WELT</strong>GESCHICHTE<br />
Das Hallstätter Hochtal · Das Hallstätter Gräberfeld · Die Jungsteinzeit<br />
Die Bronzezeit · Die Hallstattzeit · Das Ende einer Epoche · Die römische Zeit<br />
Vom Mittelalter in die Neuzeit · Die technische Revolution im Mittelalter · Eine Zeit des Niedergangs<br />
Vom Kaiser Franz Joseph zur Gegenwart · Die Geschichte vom Mann im Salz<br />
WIE KOMMT <strong>DAS</strong> SALZ AUF DEN TISCH?<br />
Wie alles begann<br />
Wie kommt das Salz ins Meer?<br />
Wie kommt das Salz vom Meer in den Berg?<br />
Wie kommt das Salz vom Berg auf den Tisch?<br />
SALZ<strong>WELT</strong>EN HALLSTATT<br />
Die Anlagen der Salzwelten<br />
Eine faszinierende Reise durch die Zeit<br />
Archäologische Forschungen heute<br />
UNESCO-Weltkulturerbeort Hallstatt
EINE REISE DURCH DIE ZEIT
Im Hallstätter Hochtal liegt jenes weltberühmte<br />
Gräberfeld, das der Hallstattzeit ihren Namen<br />
gegeben hat.<br />
Das Hallstätter Hochtal<br />
7000 JAHRE MENSCHHEITSGESCHICHTE<br />
Das Hallstätter Hochtal ist Zeuge für 7000 Jahre Menschheitsgeschichte. Hier<br />
lebten die Menschen der Vorzeit, arbeiteten in den Stollen des Salzbergwerkes<br />
und wurden hier begraben. Seit der Jungsteinzeit verfolgen die Menschen in<br />
diesem Tal ein Ziel: Sie wollen dem Berg das Salz, das „weiße Gold“ abgewinnen.
Das Hallstätter Gräberfeld<br />
ENTDECKT VON JOHANN GEORG RAMSAUER<br />
Der Salinenbeamte Isidor Engl skizzierte die Gräber in aufwendiger Aquarelltechnik.<br />
Die Fülle und die Qualität der Funde sind einzigartig und begeisterten bereits im 19. Jh.<br />
die Fachwelt. Ramsauers „Troja der Alpen“ lockte bald internationale Prominenz an<br />
und es gehörte damals zum guten Ton, dass noble Kurgäste aus dem nicht weit entfernten<br />
Bad Ischl die Graböffnungen als abenteuerlichen Freizeitspaß empfanden.<br />
1846 wurde zur Schottergewinnung im Hallstätter Hochtal eine Grube geöffnet. Dabei stießen die Arbeiter auf<br />
menschliche Skelette und auf sonderbar anmutende Metallgegenstände. Aufgeregt verständigten sie den damaligen<br />
Betriebsleiter des Hallstätter Salzbergwerks Johann Georg Ramsauer, der nach weiteren Grabungen erkannte,<br />
dass es sich um einen Friedhof handeln musste. Mit Unterstützung der Hofkammer in Wien begann er mit systematischen<br />
Ausgrabungen. Sorgsam ließ er fast 1000 Gräber öffnen und stieß dabei auf unzählige Grabbeigaben<br />
wie Fibeln, kostbare Ringe, reich verzierte Waffen und Bronzegefäße. Diese einmaligen Funde sind Indiz für die hohe<br />
soziale Stellung der Verstorbenen und zeugen von Luxus und erlesenem Kunstverstand. Die Funde beweisen auch<br />
die weiten Handelsbeziehungen, die sich vom Mittelmeer bis zur Ostsee erstreckten. Bezahlt wurde mit Salz, das<br />
aus dem Hallstätter Bergwerk kam. Bedenkt man, dass Ramsauer Laie war, arbeitete er mit erstaunlichem Können.
Die Jungsteinzeit<br />
UM 5000 VOR CHRISTUS<br />
Die Anfänge des Hallstätter Salzbergbaus verlieren sich im Grau der Steinzeit. Nach dem Rückgang<br />
der eiszeitlichen Gletscher wurde das Klima warm und mild, und ausgedehnte Wälder breiteten sich<br />
in den alpinen Regionen aus. Die Menschen wurden sesshaft und betrieben Ackerbau und Viehzucht.<br />
Und sie hinterließen Spuren wie diese Hirschgeweih-Haue, mit der wahrscheinlich schon vor<br />
7000 Jahren am Hallstätter Salzberg nach Salz gegraben wurde.<br />
Das Salz der Erde<br />
Das Salz ist kulturhistorisch von höchster Bedeutung<br />
und hat der Menschheit den größten Dienst als Konservierungsmittel<br />
für Nahrung erwiesen. Die Möglichkeit,<br />
Fleisch oder Fisch haltbar zu machen, befreite<br />
den Menschen vom Zwang, alles sofort zu verzehren<br />
und er konnte sesshaft werden. Über Jahrtausende<br />
hinweg war Salz ein Gut, das man mit Gold aufwog<br />
und das Salz wurde zu einer der wichtigsten Triebkräfte<br />
für die wirtschaftliche Entwicklung Europas.
Die Bronzezeit<br />
UM 1200 VOR CHRISTUS<br />
In Ägypten regierte Pharao Echnaton mit seiner<br />
berühmten Gattin Nofretete, in Jerusalem herrschte<br />
König David, Rom gab es noch nicht und<br />
in der Gegend von Wien hausten Bären und<br />
Wölfe in den Urwäldern. Im Salzberg von Hallstatt<br />
wurde bereits Salz gewonnen. Werkzeuge<br />
aus dem Metall Bronze erleichterten den Bergleuten<br />
die schwere Arbeit, in den Berg vorzudringen.<br />
Nach etwa 300 Meter erreichten die<br />
Bergmänner das Salzgebirge. Das Salz wurde<br />
zu faustgroßen Stücken zerkleinert und in Fellsäcken<br />
ans Tageslicht gebracht. Stein für Stein<br />
und unter der spärlichen Beleuchtung von<br />
Kienspänen. Die Kleidung war einfach: Stoffe<br />
aus Wolle und Leinen, kegelförmige Mützen<br />
als Kopfbedeckung und Schuhe aus Fell und<br />
Leder.
Die HallstattZeit<br />
8. – 4. JAHRHUN<strong>DER</strong>T VOR CHRISTUS<br />
Aufgrund der hervorragenden Bodenfunde durch Archäologen wird seit 1874 die ältere Eisenzeit (8. – 4. Jh. v. Chr.)<br />
auch als Hallstattzeit bezeichnet. Weltberühmtheit erlangten die sogenannten „Hallstätter Herzen“, eine für diese<br />
Zeit typische bergmännische Abbaumethode von Salzstücken in Herzform. Die in das Salzgebirge gehauenen<br />
Herzen sind bis heute erhalten und können im Hallstätter Salzbergwerk bei der prähistorischen Tour besichtigt<br />
werden.
Das Ende einer Epoche<br />
IM 4. JAHRHUN<strong>DER</strong>T VOR CHRISTUS<br />
Um die Mitte des 4. Jh. v. Chr. beendete eine Hangrutschung das blühende Gemeinwesen im Hallstätter<br />
Hochtal. Muren rissen Teile der Oberfläche mit sich und versperrten die Zugänge zum Bergwerk. In<br />
die Stollen und Schächte des Bergwerks brach immer wieder Wasser ein und füllte die Hohlräume.<br />
So war mit den damaligen technischen Mitteln an ein Weiterführen des Bergbaus nicht mehr zu<br />
denken. An fast allen Fundorten gibt es Anzeichen, dass dieser Tagwassereinbruch der prähistorischen<br />
Zeit das ganze Hochtal vernichtete und das Ende des prähistorischen Bergbaus einleitete.
Die römische Zeit<br />
UM CHRISTI GEBURT<br />
Die Überlebenden der Naturkatastrophe versuchten, den<br />
Bergbaubetrieb wieder aufzunehmen. Doch sie waren<br />
zum Scheitern verurteilt. Die Stollen waren eingebrochen<br />
und die Eingänge verschüttet. Im ersten Jh. v. Chr.<br />
drangen keltische Bergleute oberhalb des Hallstätter<br />
Hochtals erneut in das Salzgebirge ein, um das Salz aus<br />
dem Berg zu holen.<br />
Wahrscheinlich überdauerte eine dort gelegene Bergmannssiedlung<br />
sogar die römische Zeit. Die Römer<br />
kamen nach Hallstatt um Christi Geburt und lebten auch<br />
hier sehr aufwendig. Sie bauten ihre prächtigen Villen auf<br />
der schmalen Landzunge zwischen Seeufer und Berg,<br />
betrieben gewinnbringenden Handel und blieben einige<br />
hundert Jahre.<br />
Spätestens mit dem Zerfall des weströmischen Reiches<br />
erreichten die Wirren und Unruhen der Völkerwanderung<br />
auch das Gebiet des heutigen Salzkammergutes.<br />
Doch der Bergbau im Hallstätter Hochtal dürfte auch in<br />
den kommenden Jahrhunderten im kleinen Rahmen<br />
weitergeführt worden sein.
Vom Mittelalter<br />
in die Neuzeit<br />
AB DEM 13. JAHRHUN<strong>DER</strong>T<br />
Schriftliche Aufzeichnungen über einen historischen Salzbergbau in Hallstatt<br />
gibt es erst seit dem 13. Jahrhundert, als die Herrschaft der Habsburger begann.<br />
1273 wurde Rudolf I. zum deutschen König gewählt. Österreich wurde Besitz von<br />
Rudolfs Sohn Albrecht I., der einige Jahre später seiner Gemahlin Elisabeth das<br />
Salzkammergut schenkte. Elisabeth kümmerte sich sehr um die Entwicklung im<br />
Bergbau und sie war es auch, die 1311 den Bürgern von Hallstatt das Marktrecht<br />
verlieh.<br />
In den Salzbergwerken wurde das Salz bereits „nass abgebaut“ und in den<br />
Sudhäusern zu Salz weiterverarbeitet. Viele Berufe entstanden rund ums Salz, der<br />
Handel war rege und auch gewinnbringend. Auf Schiffen wurde das Salz die<br />
Traun flussabwärts nach Gmunden befördert und von dort nach Wien, Böhmen<br />
und Mähren transportiert. Der Streit um Absatzmärkte führte zu einer steigenden<br />
Rivalität zwischen den bayrischen Herzögen, dem Erzstift Salzburg und den<br />
österreichischen Landesfürsten. Zum Schutze seiner Salzproduktion und zur<br />
Verteidigung gegen die Salzburger Bischöfe ließ Albrecht I. 1284 im Hallstätter<br />
Hochtal den Rudolfsturm errichten. Die Zwistigkeiten um das Salz mit dem Erzstift<br />
Salzburg waren bald bereinigt und Salzkriege sollte es danach nicht mehr geben.<br />
Ab dem 15. Jh. waren die landesfürstlichen Salzbeamten in Gmunden für das<br />
Salzwesen verantwortlich und sie achteten peinlich genau darauf, dass alles<br />
seine Ordnung hatte und Dienstwege eingehalten wurden. Als um 1800 die<br />
Verkehrsverbindungen zwischen Wien und dem Salzkammergut besser wurden,<br />
verlor das Gmundner Salzamt seine Sonderstellung und wurde 1850 aufgelöst.
Die technische revolution<br />
im Mittelalter<br />
12. JAHRHUN<strong>DER</strong>T<br />
Im 12. Jh. kam es zu einem der größten technologischen Fortschritte in der Salzgewinnung.<br />
Salz wurde „nass abgebaut“: Künstliche Hohlräume im Berg wurden<br />
mit Wasser aufgefüllt um das Salz aus dem salzhältigen Gestein zu lösen. Dabei<br />
entstand eine wässrige Salzlösung, die Sole genannt wird. Die Sole floss in<br />
kilometerlangen hölzernen Rohrleitungen aus den Stollen heraus und wurde in die<br />
Sudhäuser im Tal weitergeleitet.<br />
Dort wurde die Sole in ca. 10 m x 10 m großen Sudpfannen so lange erhitzt, bis<br />
das Wasser verdampft war und Kochsalz übrig blieb. Das Holz für die Befeuerung<br />
der Pfannen kam aus den Wäldern des Umlands und wurde auf dem Hallstätter<br />
See angedriftet. 1595 wurde eine weitere technologische Großtat vollbracht: der<br />
Bau der Soleleitung vom Hallstätter Bergwerk zur neuen Saline nach Ebensee, für<br />
die 13.000 durchbohrte Baumstämme benötigt wurden. Mit über 40 Kilometer<br />
Länge ist die Soleleitung die älteste Pipeline der Welt, der heute ein idyllischer<br />
Wanderweg folgt.
Eine Zeit des Niedergangs<br />
17. JAHRHUN<strong>DER</strong>T<br />
Ab dem 17. Jh. begann in der Region eine Zeit der Unruhe. Die Reformation rüttelte an den<br />
Autoritäten von Staat und Kirche. Es wüteten Hungersnöte, Erdbeben, Feuer, die Ruhr und<br />
die Pest. Durch die Türkenkriege und durch die Kriege mit Frankreich wurde die Finanzlage<br />
Österreichs immer kritischer. Auch das Salzamt war von den schweren Zeiten beeinträchtigt<br />
und konnte teilweise nicht einmal mehr die Löhne an die Arbeiter auszahlen.<br />
Viele Protestanten wurden aus Glaubensgründen<br />
des Landes verwiesen und fanden fern ihrer<br />
Heimat ein neues Zuhause.<br />
Der Bergbau überstand jedoch alle politische Wirren unbeschadet. Hin und wieder stießen Knappen<br />
auf uralte Spuren vergangener Zeiten, ohne diesen Funden große Bedeutung zuzumessen. So wurde<br />
1734 im Bergwerk eine durch das Salz konservierte Leiche entdeckt. Auch im Werksprotokoll ist<br />
dieser ungewöhnliche Vorfall festgehalten, doch ließ man den Zeugen der Vorgeschichte schnell<br />
und ohne viel Aufhebens begraben. Der wahrscheinlich bei einer prähistorischen Bergkatastrophe<br />
verunglückte Bergmann ging später als „Mann im Salz“ in die Hallstätter Geschichte ein.
Mit dem Bau der Eisenbahn 1877 kam es zu einer tiefgreifenden Veränderung im<br />
Salzkammergut und das Zeitalter der Industrialisierung brach an. Die in den<br />
Sudhäusern gewonnene Sole spielte auch zunehmend in der Kuranwendung eine<br />
Rolle und die Basis für den Tourismus im Salzkammergut war gelegt. Jeden Sommer<br />
kam der Kaiser nach Bad Ischl, die Gäste wurden immer zahlreicher und<br />
vornehmer und bald war es schick, im Salzkammergut auf Sommerfrische gewesen<br />
zu sein. Die Gründerzeit bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges, die Bad Ischl<br />
so tiefgreifend veränderte, ließ Hallstatt unversehrt, und sogar der Massentourismus<br />
Vom Kaiser zur Gegenwart<br />
KAISER FRANZ JOSEPH I.<br />
konnte Hallstatt nicht allzu negativ beeinflussen. Im Salzbergbau brachte die<br />
Industrialisierung auch Verbesserungen der Abbaumethoden mit sich und<br />
Maschinen erleichterten nun die Arbeit im Berg. Das in der Hallstätter Sudhütte<br />
erzeugte Salz wurde auf Salzschiffe verladen, über den See nach Obertraun<br />
gebracht und an der dortigen Bahnstation zum weiteren Transport in Eisenbahnwaggons<br />
verladen. Die Hallstätter Sudhütte bestand bis 1965. Heute wird Sole aus<br />
Hallstatt nur noch in Ebensee zu Salz verarbeitet.
DIE GESCHICHTE…
…vom Mann im Salz<br />
Es ist ein stürmischer Apriltag im Jahr 1734.<br />
Drei Bergleute sind mit Sicherungsarbeiten in der<br />
Grube beschäftigt. Denn in einer Kaverne ist die<br />
Decke eingestürzt. Und bei ihrer Arbeit finden sie,<br />
eingequetscht im Gebirge, die Leiche eines<br />
Mannes.<br />
Unerschrocken prüfen die drei Knappen den<br />
makaberen Fund. Gesicht und Körper des Toten<br />
sind plattgedrückt wie ein Brett. Kleider und<br />
Schuhe sind erhalten, schauen aber für die<br />
damalige Zeit irgendwie eigenartig aus.<br />
Um den Toten zu bergen, holen die Bergleute eine<br />
Bahre. Hinaus aus dem Stollen und ins Tal nach<br />
Hallstatt wollen sie ihn bringen, wo er bestattet<br />
werden soll.
In Hallstatt spricht sich der Fund vom „Mann im<br />
Salz“ schnell herum und die Einwohner des Ortes<br />
laufen zusammen, um die schauerliche Leiche zu<br />
sehen. Ein paar hundert Jahre alt wird der Tote<br />
wohl sein, so vermutet man.<br />
Unauffällig soll die Leiche verscharrt werden,<br />
irgendwo im Bereich des Hallstätter Friedhofs.<br />
Denn der „Mann im Salz“ ist kein Christ, sondern<br />
er ist ein Heide, heißt es. Und niemand kennt<br />
seinen Namen, sein Alter und sein Schicksal.<br />
Der Kapuzinerpater Matthias liest eine kurze<br />
Einsegnung und schnell ist die Leiche unter der<br />
Erde. Heute vermuten Wissenschaftler, dass<br />
der Tote bei einem Bergwerksunglück in der<br />
prähistorischen Zeit ums Leben gekommen ist<br />
und Tausende Jahre alt gewesen sein dürfte.
www.salinen.com
WIE KOMMT <strong>DAS</strong> SALZ AUF DEN TISCH?
Bevor das Salz auf den Tisch kommt, hat es einen langen Weg durch<br />
Himmel und Hölle hinter sich. Begonnen hat alles mit dem Urknall vor<br />
vielleicht 15 Milliarden Jahren. Das Universum war bereits 10 Milliarden<br />
Jahre alt, als ein Urnebel, bestehend aus<br />
Wasserstoff, Helium und Staubpartikel in sich<br />
zusammenfiel. Aus diesem Chaos entstanden<br />
Sterne wie die Sonne und Planeten wie die<br />
Erde. Nicht nur auf der Sonne war es heiß,<br />
auch im Inneren der Erde glühte es. Vulkane<br />
transportierten flüssiges Magma an die<br />
Erdoberfläche, das entweder noch in der<br />
Erdkruste als Tiefengestein stecken blieb oder an der Erdoberfläche<br />
zu Ergussgesteinen erstarrte. Zusammen mit den Lavamassen wurde<br />
auch Wasserdampf aus dem Erdinneren ausgespuckt. Dann kühlte<br />
WIE ALLES BEGANN<br />
das Klima der Erde irgendwann ab, der aufsteigende Wasserdampf<br />
wandelte sich in Wasser um und es entstanden die Ozeane. Das<br />
Wasser löste aus den Gesteinen Minerale und eines von diesen<br />
Mineralen war Salz. Im Laufe von Millionen<br />
Jahren lagerten sich die Salze in den Urmeeren<br />
ab und bildeten darin einen durchschnittlichen<br />
Salzgehalt von ca. 3,5%. Dieser Salzgehalt<br />
liegt weit unter dem möglichen Anteil von Salz<br />
im Wasser und die Ozeane haben noch genug<br />
freie Kapazität für die weitere Aufnahme von<br />
Salz. Für die nächsten paar Milliarden Jahre ist<br />
somit die natürliche Bildung von Salz gesichert und das sind wahrhaft<br />
gute Zukunftsaussichten für jeden Salzproduzenten.
WIE KOMMT <strong>DAS</strong> SALZ INS MEER?<br />
Vor 250 Millionen Jahren hatte die Erde bereits ihre heutige Größe und war auch für<br />
Lebewesen bewohnbar. Es gab ein Urmeer, die Tethys und den Riesenkontinent<br />
Pangea, an dessen Rändern die Meeresbecken breit und seicht waren. Das Klima war<br />
damals über mehrere Millionen Jahre hindurch überall trocken und heiß. So heiß wie<br />
heute in der Wüste. Eine ideale Voraussetzung für die Bildung von Salz.<br />
0° ÄQUATOR<br />
30°<br />
30°<br />
60°<br />
P a n g e a<br />
T e t h y s
= Salz<br />
Regnete es, dann löste das Regenwasser<br />
aus den Gesteinen Minerale<br />
wie das Salz, das durch Flüsse weiter<br />
bis ins Meer transportiert wurde. Der<br />
Meeresspiegel stieg ständig an und<br />
schwappte irgendwann über Landbrücken,<br />
sogenannte Barren, in ein<br />
flaches Becken.<br />
H2O<br />
Die damals herrschende Hitze ließ das<br />
Wasser verdunsten und Salze wurden<br />
abgelagert. Ein Vorgang, der auch<br />
beim Toten Meer zu beobachten ist,<br />
wo mehr Wasser verdunstet als durch<br />
den Jordan zufließen kann. Mit etwa<br />
25% ist der Salzgehalt des Toten<br />
Meeres um vieles höher als der Salzgehalt<br />
des Mittelmeeres mit nur 3,5%.<br />
Im Laufe von weiteren Millionen<br />
Jahren hoben sich Landmassen<br />
und der Meeresboden senkte sich.<br />
Der Kreislauf wiederholte sich immer<br />
wieder. Wasser wurde zugeführt,<br />
verdunstete und Salze blieben übrig.<br />
Zusätzlich vermischte sich das Salz<br />
mit Sedimenten vom Festland.<br />
Das Klima wurde feuchter, aber es<br />
blieb sehr warm. Es herrschten<br />
Klimaverhältnisse wie in den Tropen.<br />
Der Meeresspiegel begann zu<br />
steigen und es wuchsen mächtige<br />
Korallenriffe, ähnlich wie heute in<br />
der Karibik.
WIE KOMMT <strong>DAS</strong> SALZ VOM MEER IN DEN BERG?<br />
Kräfte im Erdinneren ließen den Urkontinent Pangea innerhalb von einigen Millionen Jahren auseinanderbrechen. Landmassen<br />
drifteten voneinander weg und verteilten sich rund um die Erdkugel zu den 5 großen Kontinentalmassen. Die<br />
Kontinentalverschiebung hatte auch Auswirkungen auf die Gebirgsbildung in unserer Region: Die Anfänge der Alpen lagen<br />
als Riffkalk oder Dolomit irgendwo am Äquator, sie überlagerten die Salze und wurden durch die Plattentektonik nach<br />
Norden verschoben. Einige Gebirge hoben sich, andere Teile sanken wieder, solange bis die Alpen in ihrer heutigen<br />
landschaftlichen Schönheit dastanden.
= Salzgebirge<br />
Das unter der sengenden Sonne entstandene Salz war nun in den Kalken eingequetscht und wurde bei der Gebirgsbildung<br />
genauso hin und her geschoben wie die Alpen. Unter dem enormen Druck und Gewicht des schweren Kalkgebirges wurden<br />
die weicheren, plastischen Salzstöcke in Bruchlinien und Kalkklüfte gedrückt und stiegen zwischen den großen Kalkmassiven<br />
nach oben. Dieser Vorgang wird Salztektonik genannt. Die mächtigen Kalkberge der Umgebung ruhen heute zum Teil auf<br />
dem Salzgebirge, das die Geologen auch Haselgebirge nennen.
WIE KOMMT <strong>DAS</strong> SALZ VOM BERG AUF DEN TISCH?<br />
In prähistorischer Zeit wurde Steinsalz in fester Form abgebaut. Mühevoll schleppten die Knappen schwere Salzbrocken<br />
aus dem Berg, um sie draußen in handelsübliche Formen zu zerkleinern. Seit dem 12. Jh. wird aus dem Berg Sole gefördert<br />
und bei der Erzeugung von Salz hat man sich die Natur zum Vorbild gemacht: Ähnlich, wie im Meer das Wasser durch<br />
die Sonneneinwirkung verdunstet und zur Ablagerung von Meersalz führt, erhitzte man Sole solange, bis das reine<br />
Salz übrig blieb. Das Grundprinzip der Salzgewinnung ist bis heute gleich geblieben, aber Methoden und Technik<br />
haben sich laufend verändert.
Das etwa 100 - 200 Meter tiefe, senkrechte<br />
Bohrloch hat einen Durchmesser<br />
von 30 Zentimeter. In diesem Bohrloch<br />
sind 2 ineinander geschobene Rohre eingebracht,<br />
wobei das Innenrohr tiefer nach<br />
unten reicht.<br />
VOM STEINSALZ ZUR SOLE<br />
Das heute meist genutzte Verfahren zur Solegewinnung ist die Bohrlochsondentechnik.<br />
Durch das Außenrohr wird Wasser in die<br />
Tiefe geleitet, das aus dem Salzgebirge<br />
die Salze löst. Die Salzlösung wird Sole<br />
genannt, ist schwerer als das reine<br />
Wasser und sinkt zu Boden.<br />
Über das tiefer reichende Innenrohr steigt die Sole nach<br />
oben und wird mit einer Konzentration von 316 kg / m 3<br />
in einer Pipeline zur Saline Ebensee geleitet. Durch das<br />
Auflösen des Steinsalzes aus der Decke und durch das<br />
Absinken des unlöslichen Materials zu Boden wandert<br />
der Hohlraum im Laufe der Zeit entlang dem Bohrloch<br />
nach oben. Im Salzbergwerk Hallstatt werden pro Jahr<br />
mehr als 1.000.000 Kubikmeter Sole gefördert.
VON <strong>DER</strong> SOLE ZUM SPEISESALZ<br />
Heute erzeugt man Salz aus Sole in der Saline Ebensee. Hier wird das energiesparende Thermokompressionsverfahren<br />
eingesetzt, das nach dem Prinzip der Wärmepumpe arbeitet. In einem großen Metallbehälter wird die gereinigte<br />
und vorgewärmte Sole erhitzt, das Wasser verdampft und das nasse Speisesalz kristallisiert aus. Der Salzbrei wird in<br />
Zentrifugen ausgeschleudert, getrocknet und anschließend in einer großen Halle für den Versand gelagert. Nur ein<br />
kleiner Teil wird für die Produktion von Speisesalz verwendet, der Großteil geht an Industrie und Gewerbe.
Einfahrtsgebäude Knappenhaus<br />
Hochtal mit Gräberfeld<br />
Bad Aussee<br />
Talstation Hallstätter Salzbergbahn<br />
Schiffsanlegestelle Lahn<br />
Bergstation Hallstätter Salzbergbahn mit Shop<br />
Gräberfeld<br />
Rudolfsturm / Restaurant<br />
Fußweg zu den Salzwelten ca. 1 Stunde<br />
Museum<br />
Soleleitungsweg nach Bad Ischl<br />
i<br />
Schiffsanlegestelle Markt<br />
Bad Ischl
S A L Z W E L T E N H A L L S T A T T<br />
BLICK VOM RUDOLFSTURM<br />
VOM HALLSTÄTTER HOCHTAL ...<br />
FREILICHTSCHAU HALLSTATTDORF KNAPPENHAUS<br />
MIT <strong>DER</strong> SALZBERGBAHN erreicht man schnell das 300 Meter über Hallstatt gelegene Hochtal mit seiner atemberaubenden Aussicht vom<br />
Rudolfsturm. Der asphaltierte Gehweg von der Bergstation zum Einfahrtsgebäude „Knappenhaus“ ist sanft und gemütlich und viele Hinweisschilder<br />
informieren über die weltberühmte Geschichte des Gräberfeldes. Ein eigens angelegter Weg erinnert an die Ausgrabungen von Johann Georg Ramsauer.<br />
WIE WOHNTEN die Menschen in der prähistorischen Zeit? Wie waren sie gekleidet? Welche Sitten und Bräuche hatten sie? Fragen, die eine<br />
Freilichtschau nach neuesten Erkenntnissen der Archäologie klären kann.<br />
<strong>DAS</strong> KNAPPENHAUS wurde 1896 als Wohnstätte für Bergknappen errichtet. Damals strebten viele Arbeiter den Salinendienst an. Die Arbeit war<br />
zwar hart, aber die Saline bot ein sicheres Einkommen und eine Altersversorgung. Heute erwartet die Besucher im Knappenhaus ein Bergwerksführer,<br />
der von diesen längst vergangenen Zeiten des Hallstätter Bergbaus zu erzählen weiß. Neben der 11 ⁄2-stündigen Führung gibt es auch eine<br />
prähistorische Tour, die etwa 4 Stunden dauert.
CHRISTINASTOLLEN <strong>DAS</strong> ZWERGWERK FÜR KIN<strong>DER</strong> VIELE ERLEBNISSTATIONEN IM BERG<br />
... IN DIE STOLLEN DES SCHAU<strong>BERGWERK</strong>S<br />
STOLLEN, SCHÄCHTE, LAUGWERKE und was es sonst noch alles im Berg gibt, sind nach adeligen Herrschaften oder verdienstvollen Persönlichkeiten<br />
benannt. Namensgeberin des Eingangesstollens war die Mutter von Kaiserin Maria Theresia, Elisabeth Christina von Braunschweig-Wolfenbüttel.<br />
1719 begannen die Knappen mit dem Bau des Christinastollens, der 420 m über dem Hallstätter See in 928 m Seehöhe liegt.<br />
DIE WEGSTRECKE durch das Schaubergwerk beträgt 1200 Meter. Zwei Bergwerkshorizonte mit einem Höhenunterschied von etwa 35 Metern<br />
werden auf Bergmannsrutschen überwunden. Eine elektrische Grubenbahn bringt die Besucher wieder an das Tageslicht.<br />
IM <strong>BERGWERK</strong> herrscht das ganze Jahr hindurch eine permanente Lufttemperatur von etwa 8°. Ein gut durchdachtes Belüftungssystem, oder besser<br />
gesagt ein „Bewetterungssystem“, wie es in der Fachsprache der Bergleute heißt, sorgt für ausreichende Frischluftzufuhr. Für einen Bergwerksbesuch<br />
sind gutes Schuhwerk und warme Kleidung erforderlich. Kinder unter 4 Jahren, gebrechliche oder klaustrophobische Personen sind aus<br />
Sicherheitsgründen von einem Besuch im Bergwerk ausgeschlossen.
S A L Z W E L T E N H A L L S T A T T<br />
BERGMANNSRUTSCHEN TIEF HINUNTER<br />
7000 JAHRE <strong>WELT</strong>GESCHICHTE ...<br />
LICHTSCHAU IM „HÖRNERWERK“ ZEITSPIRALE IM „EDELS<strong>BERGWERK</strong>“<br />
DIE ERSTE RUTSCHE führt in die unterirdische Wunderwelt des Salzes. Die zweite Rutsche ist mit 60 Meter Länge wohl eine der spektakulärsten<br />
Bergmannsrutschen. Was für Bergleute schon immer die bequemste Art war, Höhenunterschiede zu überwinden, ist heute ein besonderes<br />
Vergnügen für Kinder, Erwachsene und Junggebliebene.<br />
<strong>DAS</strong> „HÖRNERWERK“ ist ein altes Laugwerk, das mit einer Fläche von 4.200m2 fast so groß ist wie ein Fußballfeld. 1911 wurde das Werk<br />
gewässert und war rund 90 Jahre in Betrieb. Die gewonnene Sole leitete man zur Weiterverarbeitung nach Ebensee. Nun dient das Werk als<br />
unterirdisches Kino, das die Mystik der großen Kaverne einfängt. Felszeichnungen und archaische Musik lassen diese Station zu einem besonderen<br />
Raum-Klangerlebnis werden, das tief unter die Haut geht.<br />
<strong>DAS</strong> <strong>ÄLTESTE</strong> SALZ<strong>BERGWERK</strong> der Welt verrät den Besuchern viel an seinen Geheimnissen. Raumgroße Modelle zeigen die Anfänge des<br />
Bergbaus und Filme berichten von den Menschen, die das „weiße Gold“ mühsam zu Tage brachten.
DIE GESCHICHTE VOM MANN IM SALZ SZENE <strong>DER</strong> BRONZEZEIT GRUBENBAHN BEI <strong>DER</strong> AUSFAHRT<br />
... IN EINER FASZINIERENDEN REISE DURCH DIE ZEIT<br />
BERGMANN SEPP hält einen Fetzen in seiner linken Hand. Es ist ein Stoff aus der prähistorischen Zeit, den er soeben bei seiner Arbeit im<br />
„Heidengebirge“ gefunden hat. Sepp kennt die alten, verfallenen Stollen, und er kennt auch die Geschichte vom „Mann im Salz“, die er zu erzählen<br />
beginnt.<br />
MÜHSAM WAR <strong>DER</strong> ABBAU VON STEINSALZ in der Bronzezeit. Kniend räumt der rechte Bergknappe das aus dem gerade angeschlagenen<br />
Stollen herausgebrochene Gestein beiseite. An der Stollenwand ist sein bronzener Pickel angelehnt, der ihm einen Vortrieb von ein paar Zentimeter<br />
pro Tag ermöglicht. Der zweite Knappe lädt das gewonnene Steinsalz in einen Fellsack, der durch einen schmalen Schacht von der Grube ans<br />
Tageslicht befördert wird.<br />
400 METER LANG ist die Strecke der elektrischen Grubenbahn, die uns aus der Tiefe des Berges wieder an das Tageslicht bringt. Die Reise in<br />
den Salzberg ist nun zu Ende.
S A L Z W E L T E N H A L L S T A T T<br />
SKIZZEN VON J. G. RAMSAUER<br />
Das Hallstätter Gräberfeld gehört aufgrund der zahlreichen<br />
archäologischen Funde zu den wichtigsten Fundstellen<br />
der ganzen Welt. Heute wird das Gräberfeld systematisch<br />
von Wissenschaftlern des Naturhistorischen Museums in<br />
Wien erforscht.<br />
ARCHÄOLOGISCHE FORSCHUNGEN HEUTE<br />
AUSGRABUNGEN IM GRÄBERFELD<br />
UNTER <strong>DER</strong> WISSENSCHAFTLICHEN LEITUNG der prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien finden alljährlich Grabungsarbeiten<br />
statt, die von den Österreichischen Salinen unterstützt werden. Die jüngsten archäologischen Untersuchungen auf dem Hallstätter Salzberg<br />
bestätigen die Besonderheit des Fundplatzes immer wieder aufs Neue. Vieles was von Ramsauer und seinen Nachfolgern überliefert wurde,<br />
konnte bestätigt und ergänzt werden. Aus den Grabungen im 19. Jh. sind 1300 Gräber bekannt. Aufgrund der aktuellen Grabungen wird heute<br />
die Gesamtzahl der im Hallstätter Gräberfeld Bestatteten auf etwa 4000 geschätzt. Doch auch jüngst freigelegte Gräber enthalten immer wieder<br />
für Hallstatt einmalige Fundobjekte. Das gilt vor allem für keramische Waren, wie kleine, zierliche Tassen und größere Töpfe, Tongefäße, Kopfschmuck,<br />
Fibeln, Schwerter oder Messer. Durch die Forschungsergebnisse der Archäologen wissen wir heute, dass das Hallstätter Hochtal schon seit dem<br />
Beginn der Jungsteinzeit vor 7000 Jahren besiedelt war, ein hochtechnisiertes Wirtschaftszentrum mit internationalen Kontakten war, und dass<br />
in den prähistorischen Stollen des Hallstätter Salzbergwerks regelmäßig Salz abgebaut wurde.
ALTE HÄUSER DICHT AM BERG GEBAUT AM SPIEGELGLATTEN SEE<br />
HALLSTATT – <strong>DER</strong> MALERISCHE ORT<br />
ENG AN DEN BERG geschmiegt, drängen sich die hübschen Häuser dicht aneinander, verwinkelt und verschachtelt. Wohin das Auge sieht, kleine<br />
Gässchen, malerische Stiegen und leuchtender Blumenschmuck. Hallstatt, ein Kleinod an architektonischer Schönheit und menschlicher<br />
Besiedlungskunst und Herz des UNESCO-Weltkulturerbes Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut.<br />
DIE FINSTERE JAHRESZEIT ist in Hallstatt lang, und der Schnee und die Kälte sind hartnäckiger als sonst wo. Doch seit 7000 Jahren leben in dieser<br />
Gegend Menschen, angezogen von der wichtigsten Lebensader menschlicher Existenz: dem Salz, das dieser Region den Namen gegeben hat.<br />
UMZINGELT von fast lotrechten Felsen liegt der meist spiegelglatte Hallstätter See, der sich mystisch durchs ganze Tal ergießt. Tief und beinahe<br />
schwarz an trüben Tagen, strahlend blau und funkelnd im Sonnenschein.
Für den Inhalt verantwortlich: Salinen Tourismus Ges.m.b.H. ; Dr. Johannes Coelsch · Konzeption und Grafik: www.szenario.tv<br />
Text: Dr. Johannes Coelsch · Fotos: Dr. Andreas Scheucher; Naturhistorisches Museum Wien; Österreichische Salinen; Hans Wiesenhofer<br />
Wissenschaftliche Beratung: Dr. Anton Kern; Johann Unterberger<br />
2002 Salinen Tourismus Ges.m.b.H. Bad Ischl