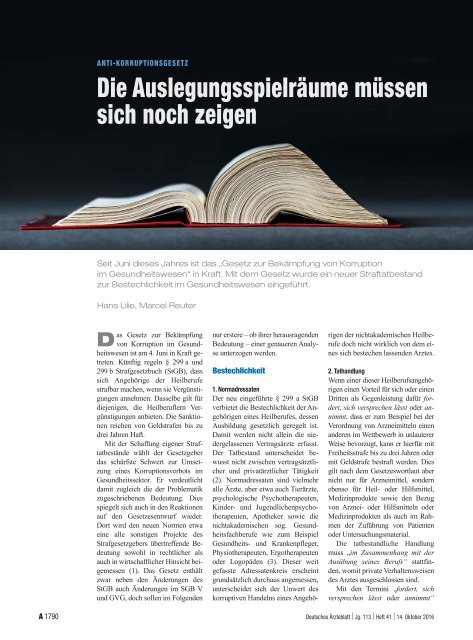Antikorruptionsgesetz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ANTI-KORRUPTIONSGESETZ<br />
Die Auslegungsspielräume müssen<br />
sich noch zeigen<br />
Seit Juni dieses Jahres ist das „Gesetz zur Bekämpfung von Korruption<br />
im Gesundheitswesen“ in Kraft. Mit dem Gesetz wurde ein neuer Straftatbestand<br />
zur Bestechlichkeit im Gesundheitswesen eingeführt.<br />
Hans Lilie, Marcel Reuter<br />
Das Gesetz zur Bekämpfung<br />
von Korruption im Gesundheitswesen<br />
ist am 4. Juni in Kraft getreten.<br />
Künftig regeln § 299 a und<br />
299 b Strafgesetzbuch (StGB), dass<br />
sich Angehörige der Heilberufe<br />
strafbar machen, wenn sie Vergünstigungen<br />
annehmen. Dasselbe gilt für<br />
diejenigen, die Heilberuflern Vergünstigungen<br />
anbieten. Die Sanktionen<br />
reichen von Geldstrafen bis zu<br />
drei Jahren Haft.<br />
Mit der Schaffung eigener Straftatbestände<br />
wählt der Gesetzgeber<br />
das schärfste Schwert zur Umsetzung<br />
eines Korruptionsverbots im<br />
Gesundheitssektor. Er verdeutlicht<br />
damit zugleich die der Problematik<br />
zugeschriebenen Bedeutung. Dies<br />
spiegelt sich auch in den Reaktionen<br />
auf den Gesetzesentwurf wieder.<br />
Dort wird den neuen Normen etwa<br />
eine alle sonstigen Projekte des<br />
Strafgesetzgebers übertreffende Bedeutung<br />
sowohl in rechtlicher als<br />
auch in wirtschaftlicher Hinsicht beigemessen<br />
(1). Das Gesetz enthält<br />
zwar neben den Änderungen des<br />
StGB auch Änderungen im SGB V<br />
und GVG, doch sollen im Folgenden<br />
nur erstere – ob ihrer herausragenden<br />
Bedeutung – einer genaueren Analyse<br />
unterzogen werden.<br />
Bestechlichkeit<br />
1. Normadressaten<br />
Der neu eingeführte § 299 a StGB<br />
verbietet die Bestechlichkeit der Angehörigen<br />
eines Heilberufes, dessen<br />
Ausbildung gesetzlich geregelt ist.<br />
Damit werden nicht allein die niedergelassenen<br />
Vertragsärzte erfasst.<br />
Der Tatbestand unterscheidet bewusst<br />
nicht zwischen vertragsärztlicher<br />
und privatärztlicher Tätigkeit<br />
(2). Normadressaten sind vielmehr<br />
alle Ärzte, aber etwa auch Tierärzte,<br />
psychologische Psychotherapeuten,<br />
Kinder- und Jugendlichenpsycho -<br />
the rapeuten, Apotheker sowie die<br />
nichtakademischen sog. Gesundheitsfachberufe<br />
wie zum Beispiel<br />
Gesundheits- und Krankenpfleger,<br />
Physiotherapeuten, Ergotherapeuten<br />
oder Logopäden (3). Dieser weit<br />
gefasste Adressatenkreis erscheint<br />
grundsätzlich durchaus angemessen,<br />
unterscheidet sich der Unwert des<br />
korruptiven Handelns eines Angehö -<br />
rigen der nichtakademischen Heilberufe<br />
doch nicht wirklich von dem eines<br />
sich bestechen lassenden Arztes.<br />
2. Tathandlung<br />
Wenn einer dieser Heilberufsangehörigen<br />
einen Vorteil für sich oder einen<br />
Dritten als Gegenleistung dafür fordert,<br />
sich versprechen lässt oder annimmt,<br />
dass er zum Beispiel bei der<br />
Verordnung von Arzneimitteln einen<br />
anderen im Wettbewerb in unlauterer<br />
Weise bevorzugt, kann er hierfür mit<br />
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder<br />
mit Geldstrafe bestraft werden. Dies<br />
gilt nach dem Gesetzeswortlaut aber<br />
nicht nur für Arzneimittel, sondern<br />
ebenso für Heil- oder Hilfsmittel,<br />
Medizinprodukte sowie den Bezug<br />
von Arznei- oder Hilfsmitteln oder<br />
Medizinprodukten als auch im Rahmen<br />
der Zuführung von Patienten<br />
oder Untersuchungsmaterial.<br />
Die tatbestandliche Handlung<br />
muss „im Zusammenhang mit der<br />
Ausübung seines Berufs“ stattfinden,<br />
womit private Verhaltensweisen<br />
des Arztes ausgeschlossen sind.<br />
Mit den Termini „fordert, sich<br />
versprechen lässt oder annimmt“<br />
A 1790 Deutsches Ärzteblatt | Jg. 113 | Heft 41 | 14. Oktober 2016
POLITIK<br />
wurden aus der Formulierung der<br />
§ 299 Abs. 1, § 331 Abs. 1, 2 StGB<br />
bekannte Begriffe verwendet. Zum<br />
Verständnis erscheint es zweckmäßig<br />
– und darauf weisen auch die<br />
Entwurfsverfasser hin (4) –, die dazu<br />
bereits ergangene Rechtsprechung<br />
und Literatur heranzuziehen. Danach<br />
liegt dann ein Fordern eines<br />
Arztes vor, wenn dieser erklärt, einen<br />
Vorteil für eine unlautere Bevorzugung<br />
zu begehren (5). Der Erklärungsempfänger<br />
muss von der Erklärung<br />
lediglich Kenntnis erlangen. Ob<br />
er ihren Bedeutungsgehalt erfasst, ist<br />
dementgegen genauso unerheblich<br />
wie die Form der Erklärung oder das<br />
Zustandekommen einer Einigung<br />
(6). Damit ist diese Alternative auch<br />
dann zu bejahen, wenn der andere<br />
Teil auf die Offerte nicht eingeht.<br />
Die Alternative des Sich-versprechen-Lassens<br />
betrifft die „nächste<br />
Stufe“ und setzt eine tatsächliche<br />
Übereinkunft im Sinne zweier korrespondierender<br />
Willenserklärungen<br />
zwischen den Parteien voraus (7).<br />
Annehmen schließlich beschreibt<br />
„die tatsächliche Entgegennahme<br />
des Vorteils mit dem nach außen bekundeten<br />
Willen, über den Vorteil zu<br />
eigenen Zwecken oder zugunsten eines<br />
Dritten zu verfügen“ (8).<br />
3. Vorteilsbegriff<br />
Jede dieser Handlungsvarianten<br />
muss auf einen Vorteil gerichtet sein.<br />
Nach der Rechtsprechung des BGH<br />
ist unter einem Vorteil im Sinne des<br />
§ 299 BGB jede Leistung zu verstehen,<br />
auf die der Empfänger keinen<br />
Rechtsanspruch hat und die seine<br />
wirtschaftliche, rechtliche oder auch<br />
nur persönliche Lage objektiv verbessert<br />
(9). Diesen Vorteilsbegriff<br />
wird man ebenfalls auf die neuen<br />
Normen übertragen können. Neben<br />
materiellen Besserstellungen – etwa<br />
Geldleistungen, Gutscheinen, Rabatten<br />
(10), Darlehen, Einladungen zu<br />
Urlaubsreisen oder Kongressen (11)<br />
– sind auch immaterielle Positionen<br />
Foto: Fotolia/Ingo Bartussek<br />
wie die Verschaffung einer Auszeichnung<br />
(12), einer Gelegenheit<br />
zur wissenschaftlichen Veröffentlichung<br />
oder die Förderung des beruflichen<br />
Fortkommens (13) des Arztes<br />
erfasst (14).<br />
Der Vorteil kann sowohl für den<br />
bestechlichen Arzt als auch einen<br />
Dritten bestimmt sein; etwa in Form<br />
einer Spende an den örtlichen<br />
Sportverein (15). Unerheblich ist, in<br />
welcher Verbindung der Vorteilsnehmer<br />
zum Dritten steht und ob<br />
die finanzielle Gabe gegebenfalls<br />
auch begrüßenswerten Zwecken zugutekommt,<br />
zum Beispiel ein karitatives<br />
Projekt oder wissenschaftliches<br />
Forschungsvorhaben fördert<br />
(16). Bei universitären Drittmitteln<br />
steht zu vermuten, dass die bislang<br />
für §§ 331 ff. StGB anerkannte<br />
Die bloße Annahme<br />
eines Vorteils begründet<br />
jedoch noch keine<br />
Strafbarkeit des Arztes.<br />
Rechtsprechung, die einen Vorteil<br />
bei Beachtung des einschlägigen<br />
Drittmittelrechts verneint, auch hier<br />
zum Tragen kommen wird (17).<br />
Bereits der Abschluss eines Vertrages,<br />
aus dem Leistungen an den<br />
Arzt folgen (zum Beispiel Behandlungsvertrag),<br />
kann einen Vorteil bilden<br />
(Verdienstmöglichkeit). Hierbei<br />
ist es für die Klassifizierung als Vorteil<br />
irrelevant, ob diesen Leistungen<br />
eine angemessene vertragliche Gegenleistung<br />
des Arztes gegenübersteht<br />
(18). Ansonsten bestünde die<br />
Möglichkeit, die Korruptionstatbestände<br />
durch die Vereinbarung eines<br />
Vertrages zwischen Arzt und Leistungsgeber<br />
zu umgehen (19). Dadurch<br />
soll insbesondere verhindert<br />
werden, dass der Arzt unter dem<br />
Deckmantel einer etwa von einem<br />
Pharmaunternehmen vermittelten Nebentätigkeit<br />
zur Bevorzugung desselben<br />
motiviert wird (20).<br />
Auch wenn der Gesetzgeber bewusst<br />
keine explizite Bagatellgrenze<br />
in die Tatbestände integriert hat (21),<br />
sollen – wie schon bislang bei §§ 299,<br />
331 StGB (22) – in gewissem Umfang<br />
übliche und daher sozialadäquate<br />
Vorteile von der Strafbarkeit<br />
auszunehmen sein. Denn dadurch<br />
werde die medizinische Entscheidung<br />
des Arztes und damit auch der<br />
Wettbewerb im Gesundheitswesen<br />
aus objektiver Perspektive nicht beeinflusst<br />
(23). Der Arzt muss also<br />
nicht schon besorgt sein, wenn ein<br />
Patient ihm aus gegebenem Anlass<br />
eine gewohnheitsmäßig anerkannte,<br />
relativ geringwertige Aufmerksamkeit<br />
zukommen lässt. Auch die Einladung<br />
zu einem Geschäftsessen<br />
oder das Abholen mit einem Firmenwagen<br />
wird regelmäßig zulässig sein<br />
(24). Gleiches gilt für Werbeartikel –<br />
wie Kugelschreiber, USB-Sticks et<br />
cetera – sowie branchenübliche<br />
Preisnachlässe oder Skonti, die gegenüber<br />
jedermann gewährt werden<br />
(25). Gleichwohl betont Kubiciel zu<br />
Recht, dass behutsam vorgegangen<br />
werden sollte, können doch auch geringwertige<br />
Zuwendungen im Einzelfall<br />
zu einer Bevorzugung motivieren<br />
(26). Soweit eine betragsmäßige<br />
Geringwertigkeitsgrenze angegeben<br />
wird, liest man Zahlen von 25<br />
bis 50 € (27). Letztlich kommt es<br />
aber nicht auf einen bestimmten<br />
Wert an, sondern darauf, ob der Vorteil<br />
aus objektiver Sicht zur Willensbeeinflussung<br />
ungeeignet war (28).<br />
Eine exakte Abgrenzung ist damit<br />
kaum möglich (29).<br />
4. Als Gegenleistung für eine unlautere<br />
Bevorzugung im Wettbewerb<br />
Die bloße Annahme eines Vorteils<br />
begründet jedoch noch keine Strafbarkeit<br />
des Arztes. Für eine Verwirklichung<br />
des Tatbestandes muss der<br />
Vorteil zusätzlich die Gegenleistung<br />
für eine unlautere Bevorzugung im<br />
Wettbewerb darstellen (sogenannte<br />
Unrechtsvereinbarung). Wenigstens<br />
aus der subjektiven Perspektive des<br />
Täters muss insoweit ein synallagmatisches<br />
Verhältnis vorliegen. Bevorzugung<br />
im Sinne des § 299 StGB bedeutet<br />
nach ständiger höchstrichterlicher<br />
Rechtsprechung die sachfremde<br />
Entscheidung zwischen zumindest<br />
zwei Bewerbern, setzt also Wett -<br />
bewerb und Benachteiligung eines<br />
Konkurrenten voraus (30). Dabei ist<br />
das Merkmal jedoch subjektiviert.<br />
Die unternommenen Handlungen<br />
müssen daher lediglich nach der Vorstellung<br />
des Täters zur Herbeifüh-<br />
A 1792 Deutsches Ärzteblatt | Jg. 113 | Heft 41 | 14. Oktober 2016
POLITIK<br />
rung der Bevorzugung beziehungsweise<br />
unlauteren Beeinflussung des<br />
Wettbewerbs geeignet sein, eine solche<br />
muss aber nicht tatsächlich eintreten<br />
(kein Erfolg nötig!) (31).<br />
Schon vor der abstrakten Gefahr<br />
sachwidriger Entscheidungen soll geschützt<br />
werden (32). Eine Unrechtsvereinbarung<br />
liegt damit etwa dann<br />
vor, wenn der Arzt den Gutschein für<br />
eine Kongressreise von einem Pharmaunternehmen<br />
annimmt und diesen<br />
als Gegenleistung dafür ansieht, dass<br />
er ein bestimmtes Medikament künftig<br />
bevorzugt verschreibt.<br />
Die Annahme einer bloß nachträglichen<br />
Belohnung für schon zurückliegende<br />
Bevorzugungen beziehungsweise<br />
erbrachte Leistungen ist<br />
mangels Unrechtsvereinbarung hingegen<br />
nicht erfasst (33). Dies gilt<br />
freilich nur, wenn die nachträgliche<br />
Zuwendung nicht bereits zuvor als<br />
Vorteil für die Bevorzugung vereinbart<br />
war (34).<br />
Eine Bevorzugung geschieht nach<br />
den zu § 299 StGB entwickelten<br />
Auslegungsgrundsätzen in unlauterer<br />
Weise, wenn sie nicht auf rein<br />
sachlichen Gesichtspunkten beruht,<br />
sondern sachwidrig durch den Vorteil<br />
motiviert ist (35). Im Rahmen<br />
des vorstehend geschilderten Beispiels<br />
bestünde die Unlauterkeit also<br />
darin, dass die Verschreibung des<br />
Medikaments nicht allein auf medizinischen<br />
Erwägungen beruht, sondern<br />
durch den Reisegutschein beeinflusst<br />
wäre. Eine berufsrechtlich<br />
zulässige Bevorzugung soll regelmäßig<br />
als sachgerecht und damit lauter<br />
einzuordnen sein (36).<br />
5. Entscheidungsgruppen<br />
Die Bevorzugung muss im Zusammenhang<br />
mit einer der im Gesetz genannten<br />
Entscheidungsgruppen stehen:<br />
1. Verordnung von Arznei-, Heiloder<br />
Hilfsmitteln oder von Medizinprodukten<br />
(Verordnungsentscheidungen)<br />
2. Bezug von Arznei- oder Hilfsmitteln<br />
oder von Medizinprodukten,<br />
die jeweils zur unmittelbaren Anwendung<br />
durch den Heilberufsangehörigen<br />
oder einen seiner Berufshelfer<br />
bestimmt sind (Bezugsentscheidungen)<br />
3. Zuführung von Patienten oder<br />
Untersuchungsmaterial (Zuführungsentscheidungen)<br />
Der Begriff des Verordnens umfasst<br />
jede Verschreibung der genannten<br />
Mittel unabhängig von einer Verschreibungspflicht<br />
sowie eng damit<br />
verbundene Verhaltensweisen (37).<br />
Bezug ist jede Form des Sich-Verschaffens,<br />
wobei die Kostentragung<br />
unerheblich ist (38). Hinsichtlich der<br />
Bezugsentscheidungen sind in der finalen<br />
Gesetzesform nur noch die<br />
Fälle erfasst, in denen die jeweiligen<br />
Für besonders schwere<br />
Fälle der Bestechlichkeit<br />
beziehungsweise<br />
der Bestechung ist<br />
sogar eine Freiheitsstrafe<br />
bis zu fünf<br />
Jahren möglich.<br />
Mittel oder Produkte zur unmittelbaren<br />
Anwendung durch den Heilberufsangehörigen<br />
oder dessen Berufshelfer<br />
bestimmt sind. Darunter können<br />
etwa Prothesen oder Implantate<br />
fallen.<br />
Der Gesetzgeber wählt für die<br />
dritte Variante bewusst den Begriff<br />
der Zuführung, um klarzustellen,<br />
dass formale Aspekte unerheblich<br />
sind. Vielmehr sollen neben Überweisungen<br />
und Verweisungen auch<br />
unverbindliche Empfehlungen, Hinweise<br />
und sonstige Einwirkungsmaßnahmen<br />
auf die Entscheidungsfindung<br />
hinsichtlich der Arztwahl<br />
des Patienten eine Zuführung darstellen<br />
können (39). So kann etwa<br />
die bloße Aushändigung einer Beratungskarte<br />
eines Hörgeräteakustikers<br />
eine Verweisung im Sinne des § 31<br />
Abs. 2 MBO-Ä (40) und damit wohl<br />
auch eine Zuführung im hier relevanten<br />
Sinne sein. Allerdings setzt<br />
eine Strafbarkeit außerdem voraus,<br />
dass die Empfehlung Gegenstand einer<br />
Unrechtsvereinbarung und damit<br />
die unlautere Gegenleistung für einen<br />
Vorteil ist. Ein Arzt muss deshalb<br />
zumindest aus strafrechtlicher<br />
Perspektive nicht schon besorgt sein,<br />
wenn er auf Nachfrage des Patienten<br />
einen anderen Leistungserbringer<br />
empfiehlt, sondern erst dann, wenn<br />
er hierfür „Schmiergeld“ oder andere<br />
Vorteile fordert, sich versprechen<br />
lässt oder annimmt (41). Eine Zuführung<br />
ist ferner nicht bereits deshalb<br />
ausgeschlossen, weil sie innerhalb<br />
einer beruflichen Kooperation erfolgt<br />
(42). Desgleichen kann eine<br />
Zuführung von Patienten an Unternehmen<br />
strafbar sein, an denen der<br />
Arzt selbst beteiligt ist; insbesondere<br />
wenn die Zuführung für ihn unmittelbar<br />
wirtschaftliche Vorteile hervorbringt<br />
(43). Hier wird man auf<br />
das Berufsrecht zurückgreifen können,<br />
wo es ebenfalls „angreifbar“ ist,<br />
wenn der Arzt durch Zuweisungen<br />
direkt den Wert seines Kapitalanteils<br />
steuert und damit sein Kapitalertrag<br />
letztlich eine getarnte Provision für<br />
die Zuweisung darstellt (44). Dies<br />
bedeutet aber nicht, dass eine Unternehmensbeteiligung<br />
schlechthin unzulässig<br />
oder gar strafbar ist (45).<br />
Bestechung<br />
Während § 299 a StGB die (passive)<br />
Bestechlichkeit unter Strafe stellt, regelt<br />
§ 299 b StGB umgekehrt die<br />
(aktive) Bestechung. So wird das<br />
Anbieten (In-Aussicht-Stellen), das<br />
Versprechen (Zusage) oder Gewähren<br />
(tatsächliche Übergabe) (46) eines<br />
Vorteils für die unlautere Bevorzugung<br />
im Zusammenhang mit Verordnungs-,<br />
Bezugs- und Zuführungsentscheidungen<br />
bestraft.<br />
Strafandrohung<br />
Für besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit<br />
beziehungsweise Bestechung<br />
enthält § 300 StGB eine<br />
Strafrahmenverschiebung, so dass<br />
sogar eine Freiheitsstrafe bis zu fünf<br />
Jahren möglich ist. Auch insoweit<br />
werden die Auslegungsgrundsätze<br />
zu den §§ 299, 300 StGB eine Orientierungshilfe<br />
bieten.<br />
§ 300 Satz 2 StGB listet zwei Regelbeispiele<br />
auf. So liegt danach ein<br />
besonders schwerer Fall insbesondere<br />
bei einem Vorteil (nicht Bevorzugung!)<br />
(47) großen Ausmaßes vor.<br />
A 1794 Deutsches Ärzteblatt | Jg. 113 | Heft 41 | 14. Oktober 2016
POLITIK<br />
Schon für den bisherigen § 300<br />
StGB existierte keine exakte betragsmäßige<br />
Grenze, ab der von einem<br />
großen Ausmaß gesprochen<br />
werden konnte (48). Vielmehr wird<br />
diese Wertung auch künftig anhand<br />
der konkreten Umstände des Einzelfalles<br />
zu treffen sein. Gemessen<br />
am Zweck der Vorschrift wird man<br />
sich davon leiten lassen müssen, ob<br />
der Vorteil in besonderem Maße geeignet<br />
ist, den Vorteilsnehmer zu<br />
korrumpieren, weshalb nicht zuletzt<br />
dessen persönliche und wirtschaftliche<br />
Verhältnisse ausschlaggebend<br />
sind (49).<br />
Besonders schwere Fälle liegen<br />
überdies regelmäßig bei gewerbsmäßigem<br />
oder Handeln als Bandenmitglied<br />
vor. Für Letzteres ist ein<br />
bandenmäßiges Zusammenwirken<br />
von mindestens drei Personen notwendig<br />
(50). Gewerbsmäßig ist das<br />
Vorgehen, wenn es von der Absicht<br />
getragen wird, sich durch wiederholte<br />
Taten eine nicht nur vor -<br />
rübergehende Einnahmequelle zu<br />
sichern (51). Neben diesen sind<br />
auch unbenannte besonders schwere<br />
Fälle denkbar. Im medizinischen<br />
Bereich liegt insoweit vor allem eine<br />
korruptionsbedingt fehlerhafte<br />
Behandlung nahe, die zu einer Gesundheitsschädigung<br />
oder der Gefahr<br />
einer solchen geführt hat (52).<br />
Der Bundesrat wollte dies sogar als<br />
benannten besonders schweren Fall<br />
im Gesetz aufnehmen (53).<br />
Problembereiche<br />
1. Abgrenzung zwischen zulässiger und<br />
verbotener Zusammenarbeit<br />
So begrüßenswert das Gesetzesvorhaben<br />
zur effektiven Bekämpfung<br />
von Korruption im Gesundheitssektor<br />
auch ist, so birgt es doch das<br />
Problem der Abgrenzung verbotener<br />
korruptiver Kooperationen von<br />
zulässiger beruflicher Zusammenarbeit,<br />
insbesondere der im SGB V im<br />
Interesse verbesserter Wirtschaftlichkeit<br />
und Qualität angelegten,<br />
medizinisch-ökonomisch sinnvollen<br />
Kooperationsformen. Auch im<br />
Rahmen der Beratungen und Stellungnahmen<br />
im Gesetzgebungsverfahren<br />
sowie in der Literatur wurde<br />
die Sorge vor der Kriminalisierung<br />
eigentlich gewollter und geförderter<br />
Zusammenarbeit artikuliert (54).<br />
Dies nicht ohne Grund. Denn in einem<br />
gesetzübergreifend harmonisch<br />
ausgestalteten Normensystem muss<br />
die Strafbarkeit grundsätzlich dort<br />
enden, wo das in Rede stehende<br />
Verhalten im Einklang mit den sozialrechtlichen<br />
Vorgaben steht (55),<br />
jedenfalls solange dies nicht zur<br />
Korruption ausgenutzt wird. Die<br />
Gesetzesbegründung ist sichtlich<br />
bemüht klarzustellen, dass die Formen<br />
der Zusammenarbeit, die im<br />
Sozialgesetzbuch angelegt sind, den<br />
Straftatbeständen – abgesehen von<br />
Missbrauchsfällen – nicht unterfallen<br />
(56).<br />
Im Zuge der letzten Gesundheitsreformen<br />
wurden zahlreiche<br />
Das Gesetz birgt das<br />
Problem der Abgrenzung<br />
verbotener korruptiver<br />
Kooperationen<br />
von zulässiger beruf -<br />
licher Zusammenarbeit.<br />
Kooperationsmöglichkeiten gesetzlich<br />
verankert (57). Der Entwurfsverfasser<br />
nennt für die Formen erwünschter<br />
Zusammenarbeit exemplarisch<br />
Kooperationsvereinbarungen<br />
über die Durchführung vorund<br />
nachstationärer Behandlungen<br />
gemäß § 115 a SGB V, ambulanter<br />
Behandlungen gemäß § 115 b SGB<br />
V, ambulanter spezialfachärztlicher<br />
Versorgung gemäß § 116 b SGB V<br />
sowie integrierter Versorgung gemäß<br />
§ 140 a SGB V. Es sei etwa zulässig,<br />
wenn einem niedergelassenen<br />
Vertragsarzt eine Verdienstmöglichkeit<br />
in Gestalt eines angemessenen<br />
Entgelts für eine ambulante<br />
Operation nach § 115 b Abs. 1<br />
Satz 4 SGB V verschafft wird, der<br />
den Patienten dem Krankenhaus zuvor<br />
zugewiesen hat (58). Soweit<br />
keine weiteren Umstände hinzutreten,<br />
könne aus der Vergütung heilberuflicher<br />
Leistungen im Rahmen<br />
zulässiger beruflicher Kooperationsformen<br />
nicht auf eine Unrechtsvereinbarung<br />
geschlossen werden,<br />
also dass die Verdienstmöglichkeit<br />
als Gegenleistung für die Zuweisung<br />
verschafft wird (59). Ebenso<br />
sei die Gewährung im Sozialrecht<br />
gründender Boni an Ärzte nicht<br />
strafbar (zum Beispiel gemäß § 84<br />
Abs. 4 SGB V für die Erfüllung<br />
von Zielvereinbarungen), weil diese<br />
grundsätzlich nicht als Gegenleistung<br />
für eine Bevorzugung, sondern<br />
für eine wirtschaftliche Verordnungsweise<br />
und damit im Interesse<br />
des Patienten und der Krankenversicherung<br />
gewährt werden (60).<br />
Überdies bietet das offene Tatbestandsmerkmal<br />
„unlauter“ die Gelegenheit,<br />
die sozialrechtlich gestatteten<br />
Kooperationen als lauteres<br />
und damit strafloses Verhalten einzuordnen<br />
(61). Dies ausdrücklich<br />
in den Gesetzestext aufzunehmen<br />
(62), erscheint allerdings nicht erforderlich,<br />
birgt eine Aufnahme<br />
doch eher die Gefahr, dass der<br />
Straftatbestand sodann die überladene<br />
und damit unübersichtliche<br />
Struktur einiger sozialrechtlicher<br />
Normen erhält.<br />
Abgrenzungsschwierigkeiten (63)<br />
etwa zwischen zulässiger Vergütung<br />
und unzulässiger „getarnter<br />
Kopfprämie“ (64) werden sicherlich<br />
zu Recht befürchtet (65). Wann<br />
die Vergütung eines zuweisenden<br />
Honorarkooperationsarztes die für<br />
eine Straflosigkeit erforderliche Angemessenheit<br />
besitzt, bleibt ebenfalls<br />
unklar (66). Der Verweis auf<br />
die Straflosigkeit sozialrechtlich<br />
zulässiger Kooperationen hilft letztlich<br />
ohnehin nur bedingt weiter,<br />
wenn bereits die Reichweite des sozialrechtlich<br />
Zulässigen nicht deutlich<br />
umrissen ist (67). So sei es für<br />
die Akteure im Zeitpunkt des Abschlusses<br />
von Kooperationsvereinbarung<br />
oftmals nicht ersichtlich,<br />
ob diese sozialrechtlich zulässig<br />
sind (68). Ob die immerhin für<br />
§ 17 StGB (Verbotsirrtum) relevante<br />
Option, den Ärztekammern die Kooperationsmodelle<br />
zur Prüfung vorzulegen,<br />
insoweit Abhilfe schaffen<br />
kann, muss die Praxis zeigen (69).<br />
A 1796 Deutsches Ärzteblatt | Jg. 113 | Heft 41 | 14. Oktober 2016
POLITIK<br />
2. Anwendungsbeobachtungen<br />
Einen weiteren vieldiskutierten Themenkomplex<br />
bilden die sog. Anwendungsbeobachtungen<br />
(AWB).<br />
AWB sind eine Untergruppe der<br />
nichtinterventionellen Prüfungen<br />
im Sinne von § 4 Abs. 23 Satz 3<br />
AMG (70). Es handelt sich um Untersuchungen,<br />
die dazu bestimmt<br />
sind, Erkenntnisse bei der Anwendung<br />
zugelassener oder registrierter<br />
Arzneimittel zu sammeln (§ 67<br />
Abs. 6 S. 1 AMG). Schon das AMG<br />
sieht vor, dass AWB-durchführende<br />
Ärzte sich für ihren zusätzlichen<br />
Aufwand entschädigen lassen dürfen<br />
(§ 67 Abs. 6 S. 3 AMG). Dementsprechend<br />
wäre es inkonsequent,<br />
jeglichen Geldfluss an Ärzte im<br />
Rahmen von AWB als tatbestandmäßig<br />
im Sinne der §§ 299 a f.<br />
StGB zu werten. Sobald jedoch eine<br />
Vergütung für die bevorzugte<br />
Verschreibung der Arzneimittel, die<br />
Gegenstand der AWB sind, erfolgt,<br />
wird regelmäßig ein strafbares Verhalten<br />
vorliegen. Dies dürfte insbesondere<br />
dann naheliegen, wenn die<br />
Gegenleistung den Aufwand deutlich<br />
übersteigt (71). Hier mag die<br />
schwierige Grenzziehung in der<br />
Praxis ebenfalls zu Unsicherheiten<br />
führen.<br />
Abgrenzung zum Berufsrecht<br />
Auch künftig muss zwischen Verstößen<br />
gegen berufsrechtliche Normen,<br />
die der Wahrung der ärztlichen<br />
Unabhängigkeit dienen (§§ 30<br />
ff. MBO-Ä), und strafrechtlich re -<br />
levantem Verhalten unterschieden<br />
werden. So mag es etwa nicht mit<br />
§ 32 Abs. 2 MBO-Ä vereinbar sein,<br />
wenn ein Arzt für die Teilnahme an<br />
einer wissenschaftlichen Fortbildungsveranstaltung<br />
einen unangemessenen,<br />
das heißt, über die notwendigen<br />
Reisekosten und Tagungsgebühren<br />
hinausgehenden,<br />
Vorteil erhält. Erfolgt diese Zuwendung<br />
jedoch aus der Sicht des Arztes<br />
nicht als Gegenleistung für eine<br />
unlautere Bevorzugung, scheidet<br />
eine Strafbarkeit nach § 299 a<br />
Abs. 1 StGB aus. Ebenso verbietet<br />
es § 31 Abs. 2 MBO-Ä dem Arzt<br />
berufsrechtlich, Patienten ohne hinreichenden<br />
Grund bestimmte andere<br />
Ärzte, Apotheken et cetera zu<br />
empfehlen. Legt man hingegen den<br />
Maßstab des § 299 a Abs. 1 Nr. 3<br />
StGB zugrunde, so wäre die Empfehlung<br />
zwar auch eine Form der<br />
Zuführung (siehe oben), doch<br />
könnte hier eine Straftat allenfalls<br />
dann in Betracht kommen, wenn<br />
der Arzt auch einen Vorteil fordern,<br />
sich versprechen lassen oder annehmen<br />
würde. An anderer Stelle ist<br />
wiederum das Berufsrecht enger.<br />
So werden von § 31 MBO-Ä – anders<br />
als im Rahmen der §§ 299 a f.<br />
Auch die Staatsanwaltschaften<br />
und Gerichte<br />
werden sich an die<br />
Neuerungen mit<br />
Feingefühl herantasten<br />
müssen.<br />
StGB (siehe oben) – immaterielle<br />
Vorteile nach zugegeben umstrittener<br />
Auffassung nicht erfasst (72).<br />
Es kann deshalb per se weder von<br />
einem berufsrechtlich missbilligten<br />
Fehlverhalten auf eine Straftat geschlossen<br />
werden noch umgekehrt.<br />
Fazit<br />
Zwar sind korruptive Praktiken im<br />
gesundheitlichen Sektor auch in der<br />
Vergangenheit stets Gegenstand sozialgerichtlicher,<br />
wettbewerbs- und<br />
berufsgerichtlicher sowie strafgerichtlicher<br />
Rechtsprechung gewesen.<br />
Doch heben die gesetzlichen<br />
Neuerungen die künftige Verfolgung<br />
derartiger Vorgehensweisen<br />
auf eine neue Ebene. Auf die dadurch<br />
veränderten Rahmenbedingungen<br />
müssen sich nicht nur Pharmaunternehmen<br />
und Medizinproduktehersteller<br />
einstellen, sondern<br />
auch alle übrigen am Gesundheitswesen<br />
beteiligten Akteure, die der<br />
Tatbestand erfasst. Die voranstehenden<br />
Erörterungen haben gezeigt,<br />
dass das neue Gesetz zahlreiche<br />
Fallstricke bereithält. So sind<br />
nicht nur die eindeutig korruptiven<br />
Praktiken, wie etwa die Bestechung<br />
eines Arztes zur wunschgemäßen<br />
Zuweisung an das zahlende Krankenhaus<br />
oder zur Verordnung bestimmter<br />
Medikamente des bestechenden<br />
Pharmaunternehmens erfasst.<br />
Vielmehr können auch komplexe<br />
Sachverhalte Bedeutung erlangen,<br />
bei denen ein korruptives<br />
Vorgehen erst auf den zweiten<br />
Blick erkennbar wird (73).<br />
Bilden die neuen Normen auch<br />
einen bedeutenden Schritt in der<br />
<strong>Antikorruptionsgesetz</strong>gebung, wurden<br />
doch nicht alle Forderungen der<br />
maßgeblichen Akteure erfüllt. So<br />
verlangten etwa die Krankenkassen,<br />
Whistleblower besser zu schützen<br />
(74). Denn die Enthüllung zahlreicher<br />
Korruptionsfälle hinge entscheidend<br />
von Hinweisgebern ab<br />
(75). Deren Schutz dürfte damit tatsächlich<br />
einen maßgeblichen Baustein<br />
in der Korruptionsbekämpfung<br />
bilden.<br />
Auch die Staatsanwaltschaften<br />
und Gerichte werden sich an die<br />
Neuerungen mit Feingefühl herantasten<br />
müssen. Hier wird erst die Zukunft<br />
zeigen, wie die Auslegungsspielräume<br />
genutzt werden. Die Literatur<br />
befürchtet ob des geringen<br />
Erfahrungsschatzes der Ermittlungsbehörden<br />
mit den neuen Tatbeständen<br />
und der verhältnismäßig niedrigen<br />
Anforderungen an einen Anfangsverdacht<br />
gemäß § 152 Abs. 2<br />
StGB die Einleitung zahlreicher Ermittlungsverfahren<br />
(76). Dies wird<br />
durch die im Gesetzgebungsverfahren<br />
vorgenommene Änderung vom<br />
bedingten Antragsdelikt zum Offizialdelikt<br />
– das heißt, die Staatsanwaltschaft<br />
wird von sich aus tätig –<br />
nochmals verstärkt. Damit sich die<br />
Akteure im Gesundheitswesen nicht<br />
in unnötiger Weise einer strafrechtlichen<br />
Verfolgung und sei es nur beginnender<br />
Ermittlungen wegen eines<br />
Anfangsverdachts ausgesetzt sehen,<br />
ist es wichtig, bereits im Vorfeld<br />
rechtssichere Gestaltungsmöglichkeiten<br />
der Berufsausübung zu finden.<br />
Um das Verhalten im medizinischen<br />
Alltag den veränderten gesetzlichen<br />
Rahmenbedingungen anpassen zu<br />
können, erscheint eine tiefgreifende<br />
Auseinandersetzung mit dieser Thematik<br />
unerlässlich.<br />
Anschrift für die Verfasser<br />
Prof. Dr. jur. Hans Lilie ist of Counsel bei KMR<br />
Kiesgen-Millgramm Rechtsanwälte, Lampestraße 2,<br />
04107 Leipzig<br />
@<br />
Literatur im Internet:<br />
www.aerzteblatt.de/lit4116<br />
oder über QR-Code.<br />
Deutsches Ärzteblatt | Jg. 113 | Heft 41 | 14. Oktober 2016 A 1797
POLITIK<br />
LITERATURVERZEICHNIS HEFT 41/2016, ZU:<br />
ANTI-KORRUPTIONSGESETZ<br />
Die Auslegungsspielräume<br />
müssen sich noch zeigen<br />
Seit Juni diesen Jahres ist das „Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen“ in<br />
Kraft. Mit dem Gesetz wurde ein neuer Straftatbestand zur Bestechlichkeit im Gesundheitswesen<br />
eingeführt.<br />
Hans Lilie, Marcel Reuter<br />
LITERATUR<br />
1. Kubiciell, MedR 2016, 1, 4.<br />
2. BT-Drucks. 18/6446, S. 16, zustimmend:<br />
Wigge, NZS 2015, 447, 449.<br />
3. BT-Drucks. 18/6446, S. 13.<br />
4. BT-Drucks. 18/6446, S. 17.<br />
5. Dannecker, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen,<br />
StGB, 4. Aufl. 2013, § 299 Rn. 32.<br />
6. Dannecker, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen,<br />
StGB, 4. Aufl. 2013, § 299 Rn. 32.<br />
7. Schur, in: Spickhoff, Medizinrecht, 2. Aufl.<br />
2014, § 302 Rn. 31; Heine/Eisele, in:<br />
Schönke/Schröder, StGB, 29. Aufl. 2014,<br />
§ 299 Rn.14.<br />
8. Dannecker, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen,<br />
StGB, 4. Aufl. 2013, § 299 Rn. 34.<br />
9. BGH NJW 2003, 2996, 2997 f. m.w.N.<br />
10. BGH, Urt. vom 03.07.1991, – 2 StR<br />
132/91; BGH, Urt. v. 11.04., 3 StR<br />
503/00.<br />
11. BGH 1 StR 541/01 – Urt. v. 23.10.2002.<br />
12. Heine/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB,<br />
29. Aufl. 2014, § 299 Rn. 12.<br />
13. Krick, in: MüKoStGB, 2. Aufl. 2014, § 299<br />
Rn. 18.<br />
14. BT-Drucks. 18/6446, S. 17.<br />
15. OLG Karlsruhe Beschl. v. 27.04.2010, Az.:<br />
2 (7) Ss 173/09-AK, JurionRS 2010,<br />
23712.<br />
16. Vgl. Krick, in: MüKoStGB, 2. Aufl. 2014, §<br />
299 Rn. 19.<br />
17. Schneider, Rechtsgutachten zu dem „Entwurf<br />
eines Gesetzes zur Bekämpfung von<br />
Korruption im Gesundheitswesen“ des<br />
Bundesministeriums der Justiz und für<br />
Verbraucherschutz, S. 12.<br />
18. BT-Drucks. 18/6446, S. 18.<br />
19. BGH, Urt. v. 10.03.1983, Az.: 4 StR<br />
375/82, JurionRS 1983, 11079.<br />
20. Kubiciel MedR 2016, 1, 3.<br />
21. BT-Drucks. 18/6446 S. 17; in der Rechtsprechung<br />
wurde auch schon eine Zuwendung<br />
i.H.v. 5 DM für eine Auskunft als<br />
hinreichender Vorteil anerkannt, vgl. BGH<br />
Urt. v. 22.06.2000, Az.: 5 StR 268/99, JurionRS<br />
2000, 16278.<br />
22. Etwa BGH JurionRS 2005, 10292.<br />
23. BT-Drucks. 18/6446, S. 17 f.; Krick, in:<br />
MüKoStGB, 2. Aufl. 2014, § 299 Rn. 29.<br />
24. Krick, in: MüKoStGB, 2. Aufl. 2014, § 299<br />
Rn. 29.<br />
25. BT-Drucks. 18/6446, S. 23.<br />
26. Kubiciell, MedR 2016, 1, 4.<br />
27. Vgl. Schneider, Rechtsgutachten zu dem<br />
„Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung<br />
von Korruption im Gesundheitswesen“ des<br />
Bundesministeriums der Justiz und für<br />
Verbraucherschutz, S. 13.<br />
28. Dannecker, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen,<br />
StGB, 4. Aufl. 2013, § 299 Rn. 39.<br />
29. Frank/Vogel, AnwBl 2016, 94, 97<br />
30. BGH, Beschl. v. 29.04.2015, Az.: 1 StR<br />
235/14, JurionRS 2015, 20328.<br />
31. BGH, Urt. v. 09.08.2006, Az.:<br />
1 StR 50/06, JurionRS 2006, 21091; BGH<br />
Beschl. v. 29.04.2015, Az.: 1 StR 235/14,<br />
JurionRS 2015, 20328.<br />
32. BGH, Urt. v. 09.08.2006, Az.:<br />
1 StR 50/06, JurionRS 2006, 21091.<br />
33. BT-Drucks. 18/6446 S. 18.<br />
34. Dannecker, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen,<br />
StGB, 4. Aufl. 2013, § 299 Rn. 47<br />
35. Heine/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB,<br />
29. Aufl. 2014, § 299 Rn. 19; BGH Urt. v.<br />
13.05.1952, Az.: 1 StR 670/51, JurionRS<br />
1952, 10499.<br />
36. BT-Drucks. 18/6446, S. 21.<br />
37. BT-Drucks. 18/6446, S. 18.<br />
38. BT-Drucks. 18/6446, S. 22.<br />
39. BT-Drucks. 18/6446, S. 20.<br />
40. Scholz, in: Spickhoff, Medizinrecht, 2. Aufl.<br />
2014, § 31 Rn. 14.<br />
41. Jary, PharmR 2015, 99, 102.<br />
42. BT-Drucks. 18/6446, S. 20.<br />
43. BT-Drucks. 18/6446, S. 19.<br />
44. Ratzel, in: Ratzel/Lippert, Kommentar<br />
MBO, 6. Aufl. 2015, § 31 Rn. 31.<br />
45. Zur nur mittelbaren Beteiligung vgl. BGH,<br />
Urteil vom 13. Januar 2011, Az. I ZR<br />
111/08 Rn. 70.<br />
46. Zu den Definitionen vgl. etwa Momsen, in:<br />
BeckOK.StGB, § 299 Rn. 29.<br />
47. BGH, JurionRS 2015, 20328.<br />
48. In der Lit. werden hier sehr unterschiedliche<br />
Wertgrenzen benannt, vgl. Fischer,<br />
StGB, 62. Aufl., 2015, § 300 Rn. 4: 5.000<br />
€, 10.000 €, 20.000 €.<br />
49. BGH, JurionRS 2015, 20328.<br />
50. Fischer, StGB, 62. Aufl., 2015, § 300 Rn.<br />
5.<br />
51. Fischer, StGB, 62. Aufl., 2015, § 300 Rn.<br />
6.<br />
52. BT-Drucks. 18/6446, S. 23.<br />
53. BR-Drucks. 360/15, S. 1<br />
54. Etwa DEGEMED, Stellungnahme,<br />
04.11.2015, S. 1 f.; Kubiciell, MedR<br />
2016, 1, 4; Schneider, Rechtsgutachten<br />
zu dem „Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung<br />
von Korruption im Gesundheitswesen“<br />
des Bundesministeriums der Justiz<br />
und für Verbraucherschutz, S. 23 f.<br />
55. Schneider, HRRS 2009, 484, 485.<br />
56. BT-Drucks. 18/6446, S. 18<br />
57. Überblick bei: Halbe, MedR 2015, 168,<br />
170 ff.<br />
58. BT-Drucks. 18/6446, S. 18.<br />
59. BT-Drucks. 18/6446, S. 18.<br />
60. Jary, PharmR 2015, 99, 103; BT-Drucks.<br />
18/6446, S. 20.<br />
61. Kubiciell, MedR 2016, 1, 4.<br />
62. So etwa Wigge, NZS 2015, 447, 452;<br />
KBV, Stellungnahme v. 12.10.2015, S. 8<br />
63. Frank/Vogel, AnwBl 2016, 94, 100<br />
64. Zur Betrugsstrafbarkeit vgl. Schneider,<br />
HRRS 2009, 484 ff.<br />
65. Wigge, NZS 2015, 447, 451.<br />
66. Ein Vorschlag findet sich bei: Schneider,<br />
Rechtsgutachten zu dem „Entwurf eines<br />
Gesetzes zur Bekämpfung von Korruption<br />
A 6 Deutsches Ärzteblatt | Jg. 113 | Heft 41 | 14. Oktober 2016
POLITIK<br />
im Gesundheitswesen“ des Bundesministeriums<br />
der Justiz und für Verbraucherschutz,<br />
S. 24 f.<br />
67. Vgl. Wigge, NZS 2015, 447, 451 f.<br />
68. Vgl. Wigge, NZS 2015, 447, 452.<br />
69. Frank/Vogel, AnwB l 2016, 94, 100.<br />
70. Vgl. dazu: Gemeinsame Bekanntmachung<br />
des Bundesinstituts für Arzneimittel und<br />
Medizinprodukte und des Paul-Ehrlich-Instituts<br />
zur Anzeige von Anwendungsbeobachtungen<br />
nach § 67 Abs. 6 AMG und zur<br />
Anzeige von nichtinterventionellen Unbedenklichkeitsprüfungen<br />
nach § 63 f und g<br />
AMG, Entwurf, 20.10.2014, S. 1.<br />
71. BT-Drucks. 18/6446, S. 19.<br />
72. Scholz, in: Spickhoff, Medizinrecht, 2. Aufl.<br />
2014, § 31 MBO-Ä Rn. 5; Scholz GesR<br />
2013, 12, 14; a. A. Rehborn, in: Prütting,<br />
Fachanwaltskommentar Medizinrecht, 3.<br />
Aufl. 2014, § 31 MBO-Ä Rn. 5.<br />
73. Vgl. etwa auch den Fall bei: Schneider,<br />
Rechtsgutachten zu dem „Entwurf eines<br />
Gesetzes zur Bekämpfung von Korruption<br />
im Gesundheitswesen“ des Bundesministeriums<br />
der Justiz und für Verbraucherschutz,<br />
S. 29: Die bedingte kostenlose<br />
Überlassung eines Hauptgerätes durch ein<br />
Unternehmen an einen Arzt könne den<br />
Straftatbestand erfüllen, wenn die kostenlose<br />
Überlassung von der Abnahme bestimmter<br />
Mengen der entsprechenden<br />
Verbrauchsmaterialien abhängig gemacht<br />
und dadurch die Verordnungsentscheidung<br />
des Arztes beeinflusst werde.<br />
74. GKV Spitzenverband, Geschäftsbericht<br />
2015, S. 73, 75. vgl. auch BT-Drucks.<br />
18/5452, S. 1 f.; 18/8106, S. 14.<br />
75. GKV Spitzenverband, Geschäftsbericht<br />
2015, S. 73, 75.<br />
76. Paßmann, Der Gastroenterologe 2016,<br />
47, 50 m.w.N.<br />
Deutsches Ärzteblatt | Jg. 113 | Heft 41 | 14. Oktober 2016 A 7