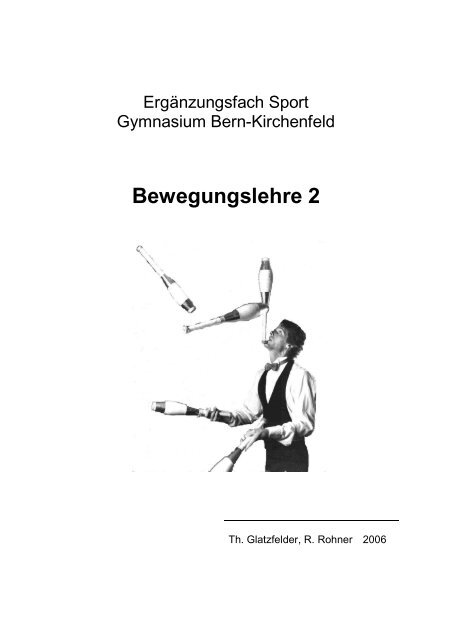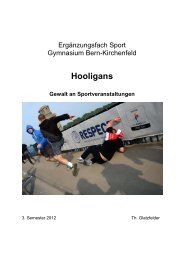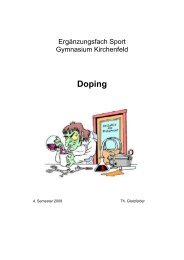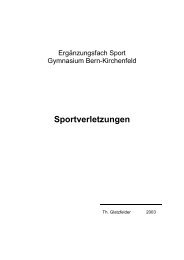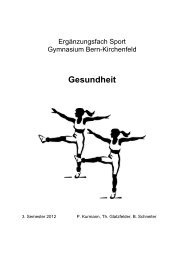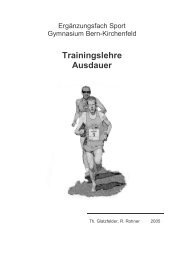Bewegungslehre 2 - Efsport.ch
Bewegungslehre 2 - Efsport.ch
Bewegungslehre 2 - Efsport.ch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ergänzungsfa<strong>ch</strong> Sport<br />
Gymnasium Bern-Kir<strong>ch</strong>enfeld<br />
<strong>Bewegungslehre</strong> 2<br />
Th. Glatzfelder, R. Rohner 2006
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
Inhaltsverzei<strong>ch</strong>nis<br />
1 Der Koordinationsbegriff ................................................................................... 2<br />
2 Faktoren des Bewegungslernens...................................................................... 3<br />
3 Die 5 Analysatoren ............................................................................................. 4<br />
4 Steuerung und Regelung ................................................................................... 8<br />
5 Bewegungserfahrung......................................................................................... 9<br />
6 Bewegungsvorstellung .................................................................................... 10<br />
6.1 Definition.............................................................................................................................10<br />
6.2 Methoden zur Verbesserung der Bewegungsvorstellung .....................................................11<br />
7 Modell der Bewegungskoordination............................................................... 12<br />
8 Phasen des motoris<strong>ch</strong>en Lernens .................................................................. 14<br />
8.1 Grobkoordination ................................................................................................................14<br />
8.2 Feinkoordination .................................................................................................................16<br />
8.3 Situativ-variable Verfügbarkeit.............................................................................................19<br />
9 Literatur ............................................................................................................. 23<br />
10 Bildna<strong>ch</strong>weis.................................................................................................. 23<br />
Glatzfelder/Rohner 2006 1
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
1 Der Koordinationsbegriff<br />
Die Koordinationsfähigkeit, oft mit Gewandtheit oder sportli<strong>ch</strong>er Begabung glei<strong>ch</strong>gesetzt,<br />
ist eine grundlegende Voraussetzung für das Lernen und die Ausführung gekonnter<br />
Bewegungen. Aus der grossen Anzahl von Definitionen seien zwei ausgewählt:<br />
„ Bewegungskoordination ist das Zusammenwirken von Zentralnervensystem und<br />
Skelettmuskulatur innerhalb eines gezielten Bewegungsablaufs.“ (Hollmann/Hettinger<br />
in: Röthig/Grössing 1996, 83)<br />
„Bewegungskoordination ist die Ordnung und Organisation motoris<strong>ch</strong>er Aktionen in<br />
Ausri<strong>ch</strong>tung auf ein ganz bestimmtes Ziel“ (Meinel/S<strong>ch</strong>nabel 1998, 38)<br />
Viele sportli<strong>ch</strong>e Bewegungen verlangen eine Zusammenordnung von Teilbewegungen.<br />
Erlernte Te<strong>ch</strong>niken müssen an si<strong>ch</strong> verändernde Situationen angepasst werden,<br />
und oft werden s<strong>ch</strong>wierige Bewegungsabläufe no<strong>ch</strong> miteinander kombiniert. Daraus<br />
kann abgelesen werden, wie kompliziert die mens<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>e Bewegungsmas<strong>ch</strong>inerie ist.<br />
Die Te<strong>ch</strong>nik ist ni<strong>ch</strong>t in allen Sportarten von glei<strong>ch</strong>er Bedeutung. Je na<strong>ch</strong> Sportart ist<br />
der te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>en Vervollkommnung eine unters<strong>ch</strong>iedli<strong>ch</strong>e Gewi<strong>ch</strong>tung zuzumessen.<br />
Aufgabe:<br />
1. Füge in die folgende Skala zum Thema „koordinative/te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>e Anforderungen“<br />
ein paar typis<strong>ch</strong>e Sportarten ein:<br />
.................................................................<br />
.................................................................<br />
.................................................................<br />
.................................................................<br />
.................................................................<br />
.................................................................<br />
.................................................................<br />
.................................................................<br />
Die Te<strong>ch</strong>nik einer sportli<strong>ch</strong>en Disziplin wird oft in Form eines so genannten motoris<strong>ch</strong>en<br />
Idealtyps vermittelt. Betra<strong>ch</strong>tet man jedo<strong>ch</strong> die Te<strong>ch</strong>nik von Spitzensportlern,<br />
so stellt man fest, dass gewisse <strong>ch</strong>arakteristis<strong>ch</strong>e Bewegungsmerkmale zwar glei<strong>ch</strong><br />
sind, si<strong>ch</strong> aber z.T. erhebli<strong>ch</strong>e individuelle Eigenheiten feststellen lassen, wel<strong>ch</strong>e die<br />
Leistung des Sportlers in keiner Weise beeinflussen. Diese Eigenheiten ma<strong>ch</strong>en<br />
dann den „persönli<strong>ch</strong>en Stil“ eines Athleten aus.<br />
(Weineck 1997, 563)<br />
Aufgabe:<br />
Hohe te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>e Anforderungen<br />
Mittlere te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>e Anforderungen<br />
keine te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>en Anforderungen<br />
2. Kennst Du Sportlerinnen/Sportler, die dur<strong>ch</strong> einen ganz persönli<strong>ch</strong>en Stil in ihrer<br />
Te<strong>ch</strong>nik auffallen?<br />
Glatzfelder/Rohner 2006 2
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
2 Faktoren des Bewegungslernens<br />
Wie Abb. 1 zeigt, ist das Te<strong>ch</strong>niklernen von einer Vielzahl externer und interner Bedingungen<br />
abhängig.<br />
Der wi<strong>ch</strong>tigste Faktor für den motoris<strong>ch</strong>en Lernprozess wie für die sportli<strong>ch</strong>e Leistung<br />
ist die Motivation. Eine positive Motivationslage erweist si<strong>ch</strong> im Sport als eine generelle<br />
Voraussetzung für eine sportmotoris<strong>ch</strong>e Leistung – unabhängig vom Leistungsniveau.<br />
(Weineck 1997, 567)<br />
Lernfähigkeit<br />
Seitigkeits-<br />
typologie<br />
Lerntyp<br />
(visuell,<br />
kognitiv, kin-<br />
ästhetis<strong>ch</strong>)<br />
Auffassungs-<br />
fähigkeit,<br />
Intelligenz<br />
Vorstellungs-<br />
vermögen<br />
Motivation<br />
Lernen<br />
von<br />
Te<strong>ch</strong>niken<br />
Momentane<br />
psy<strong>ch</strong>is<strong>ch</strong>e<br />
Verfassung<br />
Aufmerksamkeit<br />
und<br />
Konzentra-<br />
tionsfähigkeit<br />
Bewegungs-<br />
s<strong>ch</strong>atz<br />
Bewegungs-<br />
erfahrung<br />
Äussere Bedingungen<br />
der Lernsituation:<br />
-Lehrperson<br />
-Lernumgebung<br />
-Witterungsbedingungen<br />
- ......................................<br />
Abb. 1 Faktoren, die das Erlernen von Te<strong>ch</strong>niken beeinflussen (Weineck 1997, 566)<br />
Aufgaben:<br />
3. Gruppenarbeit zu Abb. 1: Formuliert zu jedem Käst<strong>ch</strong>en in einem Satz, was Ihr<br />
darunter versteht.<br />
4. Worin unters<strong>ch</strong>eidet si<strong>ch</strong> das Lernen von Te<strong>ch</strong>niken im Geräteturnen gegenüber<br />
dem Fussballspiel?<br />
Glatzfelder/Rohner 2006 3
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
3 Die 5 Analysatoren<br />
Je mehr ein Sportler in der Lage ist, seine eigene Bewegung sowie die Umweltsituation<br />
analysatoris<strong>ch</strong> zu erfassen, desto besser wird er si<strong>ch</strong> auf veränderte Gegebenheiten<br />
einstellen und die Bewegungsaufgaben im Rahmen seiner individuellen Mögli<strong>ch</strong>keiten<br />
motoris<strong>ch</strong> lösen können.<br />
Die Informationsaufnahme und- aufbereitung wird dur<strong>ch</strong> Analysatoren gewährleistet.<br />
Zu einem Analysator gehören<br />
• spezifis<strong>ch</strong>e Rezeptoren (Sinnesorgane, die Informationen aufnehmen)<br />
• afferente (= zum Zentralnervensystem hinführende) Nervenbahnen<br />
• sensoris<strong>ch</strong>e Zentren in vers<strong>ch</strong>iedenen Hirngebieten<br />
Zentralnervensystem<br />
(Hirn, Rückenmark)<br />
Rezeptor<br />
(z.B. Sehzellen<br />
des Auges)<br />
Afferente<br />
Nervenbahnen<br />
Abb. 2 Funktionsweise des Analysators<br />
Für die motoris<strong>ch</strong>e Koordination sind im Wesentli<strong>ch</strong>en 5 Analysatoren wi<strong>ch</strong>tig. Sie<br />
beeinflussen ganz wesentli<strong>ch</strong> die Güte eines Bewegungsablaufs und wirken meist<br />
eng zusammen, bzw. ergänzen si<strong>ch</strong>. Die Bedeutung der einzelnen Analysatoren<br />
kann dabei von Sportart zu Sportart stark differieren.<br />
(Meinel/S<strong>ch</strong>nabel 1998, 48, und Weineck 1997, 547ff)<br />
Der optis<strong>ch</strong>e Analysator<br />
Mit Hilfe dieses Analysators erhalte i<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t nur Informationen über meine eigenen<br />
Bewegungen, sondern au<strong>ch</strong> über die Bewegungen anderer Mens<strong>ch</strong>en. Beim Erlernen<br />
von Bewegungen spielt er eine wi<strong>ch</strong>tige Rolle, weil erst auf seiner Grundlage ein<br />
Vorbild, ein Vorma<strong>ch</strong>en als Bewegungsinformation mögli<strong>ch</strong> ist.<br />
Glatzfelder/Rohner 2006 4
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
Abb. 3 Der optis<strong>ch</strong>e Rezeptor. Horizontals<strong>ch</strong>nitt des re<strong>ch</strong>ten<br />
Auges (Silbernagl/Despopoulos 1992, 300)<br />
Bei vielen sportli<strong>ch</strong>en Handlungen geben die optis<strong>ch</strong>en Signale au<strong>ch</strong> indirekte Informationen<br />
über den Bewegungsablauf:<br />
Der Slalomläufer erhält Informationen über den Verlauf seiner Bewegungen in Bezug auf Torstangen<br />
und Piste, der Ho<strong>ch</strong>springer in bezug auf die Latte oder die Absprungstelle. Die eigene Bewegung ist<br />
dabei visuell nur fragmentaris<strong>ch</strong> und am Rande des Gesi<strong>ch</strong>tsfeldes erfassbar.<br />
Der kinästhetis<strong>ch</strong>e Analysator<br />
Kinästhetis<strong>ch</strong> heisst „bewegungsempfindend“. Allein mit dieser Bezei<strong>ch</strong>nung wird die<br />
wi<strong>ch</strong>tige Funktion dieses Analysators beim Ausführen von Bewegungen deutli<strong>ch</strong> gema<strong>ch</strong>t.<br />
Seine Rezeptoren finden si<strong>ch</strong> in allen Muskeln und Gelenken. In den Muskeln<br />
nehmen sie Spannungs- und Längenveränderungen wahr, in den Gelenken geben<br />
sie Informationen über Gelenkwinkeländerungen. Dur<strong>ch</strong> ihre unmittelbare Lage in<br />
den Bewegungsorganen können sie au<strong>ch</strong> jeden Bewegungsvorgang unmittelbar signalisieren.<br />
Muskelspindel:<br />
• Regelung der Muskellänge<br />
Sehnenspindel<br />
• S<strong>ch</strong>utz vor zu hoher Spannung<br />
(In der Graphik ni<strong>ch</strong>t enthalten)<br />
Gelenkrezeptoren in der Gelenkkapsel<br />
• Messung von Gelenkwinkeländerungen<br />
Abb. 4 Der kinästhetis<strong>ch</strong>e Rezeptor. Muskelspindel und Sehnenrezeptor (Silbernagl/Despopoulos<br />
1988, 278)<br />
Bei vielen sportli<strong>ch</strong>en Handlungen ist eine optis<strong>ch</strong>e Kontrolle der Bewegung ni<strong>ch</strong>t mögli<strong>ch</strong>. Deshalb ist<br />
die kinästhetis<strong>ch</strong>e „Innenansi<strong>ch</strong>t“ zum Beispiel für die Kontrolle der Beinhaltung beim Geräteturnen<br />
oder die Armführung beim Speerwurf unbedingt erforderli<strong>ch</strong>.<br />
Der kinästhetis<strong>ch</strong>e Analysator liefert von allen Analysatoren die differenziertesten<br />
Informationen über unsere Bewegungen. Er ist verantwortli<strong>ch</strong> für das so genannte<br />
„Bewegungsgefühl“ beim Ausführen einer sportli<strong>ch</strong>en Te<strong>ch</strong>nik. Da si<strong>ch</strong> aber ein Bewegungsgefühl<br />
kaum vermitteln lässt, kann insbesondere der Anfänger diesen Analysator<br />
no<strong>ch</strong> sehr s<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t nutzen. Er muss si<strong>ch</strong> dieses Gefühl im Verlauf des Übungsprozesses<br />
erst aneignen.<br />
Glatzfelder/Rohner 2006 5
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
Der taktile Analysator<br />
Die Rezeptoren dieses Analysators sind in der Haut lokalisiert und nehmen me<strong>ch</strong>anis<strong>ch</strong>e<br />
Reize auf. Auf taktilem Weg gewinnen wir unter anderem Informationen über<br />
Form und Oberflä<strong>ch</strong>e berührter Gegenstände.<br />
Abb. 5 Der taktile Rezeptor (Silbernagl/Despopoulos 1988, 277)<br />
Unters<strong>ch</strong>iedli<strong>ch</strong>e Zellen messen vers<strong>ch</strong>iedene taktile<br />
Reize:<br />
1 = Berührung<br />
2 = Druck<br />
3 = Vibration<br />
Das ist z.B. für die Grifffestigkeit bedeutsam. Beim Ballspiel, im Ringen oder im Geräteturnen spielt<br />
der ständig kontrollierte ri<strong>ch</strong>tige Griff eine wi<strong>ch</strong>tige Rolle. Ebenso empfindet eine S<strong>ch</strong>wimmerin den<br />
„Abdruck“ am Wasser vor allem dur<strong>ch</strong> den taktilen Analysator, und au<strong>ch</strong> das Gefühl für das Gleiten im<br />
Wasser wird auf diesem Weg übermittelt.<br />
Der akustis<strong>ch</strong>e Analysator<br />
Vom Sportler werden im Bewegungsvollzug au<strong>ch</strong> akustis<strong>ch</strong>e Signale aufgenommen.<br />
Im Allgemeinen spielt aber dieser Analysator eine untergeordnete Rolle, weil der Informationsgehalt<br />
der bei einer Bewegung aufgenommenen akustis<strong>ch</strong>en Signale relativ<br />
begrenzt ist.<br />
Abb. 6 Der akustis<strong>ch</strong>e Rezeptor<br />
(Silbernagl/Despopoulos 1988, 319)<br />
Bedeutsam ist bei einer Reihe von Ballspielen das akustis<strong>ch</strong>e Signal des aufs<strong>ch</strong>lagenden<br />
Balles. So ist es für einen Tis<strong>ch</strong>tennisspieler sehr verwirrend, wenn er statt<br />
auf einem Lei<strong>ch</strong>tmetalltis<strong>ch</strong> auf einer betonierten Steinplatte im Freien spielen muss,<br />
wo der Ball ein gänzli<strong>ch</strong> anderes Geräus<strong>ch</strong> abgibt. Offensi<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong> sind hier mit den<br />
akustis<strong>ch</strong>en Signalen au<strong>ch</strong> Informationen über die Dynamik des Balls verbunden.<br />
Glatzfelder/Rohner 2006 6
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
Der statico-dynamis<strong>ch</strong>e Analysator<br />
Der statico-dynamis<strong>ch</strong>e Rezeptor ist im Innenohr lokalisiert und informiert über Ri<strong>ch</strong>tungs-<br />
und Bes<strong>ch</strong>leunigungsänderungen des Kopfes.<br />
Das mens<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>e Gehör besitzt drei Bogengänge<br />
und kann damit Drehbewegungen in<br />
allen drei Rauma<strong>ch</strong>sen registrieren.<br />
Die Bogengänge sind mit Flüssigkeit gefüllt.<br />
Bei Bewegungen des Kopfes bleibt die Flüssigkeit<br />
aufgrund der Trägheit hinter der Bewegung<br />
zurück. Diese relative Vers<strong>ch</strong>iebung<br />
der Flüssigkeit wird von Nerven wahrgenommen<br />
und ans Zentralnervensystem weitergeleitet.<br />
Abb. 7 Der statico-dynamis<strong>ch</strong>e Rezeptor (Lippert 1983, 395). Zur Lage des Glei<strong>ch</strong>gewi<strong>ch</strong>tsorgans im<br />
Ohr vgl. Abb. 6<br />
Für die Orientierung im Raum und die Erhaltung des Glei<strong>ch</strong>gewi<strong>ch</strong>ts spielen aber<br />
au<strong>ch</strong> visuelle, kinästhetis<strong>ch</strong>e und taktile Informationen eine grosse Rolle.<br />
Zentrale Bedeutung kommt diesem Analysator vor allem in den Sportarten zu, in denen Körperrotationen<br />
auszuführen sind. Wasserspringen und Geräteturnen z.B. erfordern jederzeit differenzierte Informationen<br />
über die Lage des Körpers im Raum.<br />
Zusammenwirken der Analysatoren<br />
Der kinästhetis<strong>ch</strong>e Analysator ist in seiner Funktion enger mit allen andern Analysatoren<br />
verbunden als diese untereinander. Das erklärt si<strong>ch</strong> daraus, dass jeder motoris<strong>ch</strong>e<br />
Vorgang kinästhetis<strong>ch</strong>e Signale auslöst. Die Aufnahme und ri<strong>ch</strong>tige Verarbeitung<br />
dieser Signale ist deshalb zentral für die Beherrs<strong>ch</strong>ung ho<strong>ch</strong>komplexer Bewegungen.<br />
Eine besonders enge Beziehung besteht zwis<strong>ch</strong>en dem kinästhetis<strong>ch</strong>en und dem<br />
optis<strong>ch</strong>en Analysator. Die Bedeutung der visuellen Information ist für viele sportli<strong>ch</strong>e<br />
Bewegungsabläufe deshalb so gross, weil damit verbundene gespei<strong>ch</strong>erte kinästhetis<strong>ch</strong>e<br />
Informationen – und in gewissem Masse au<strong>ch</strong> taktile und statico-dynamis<strong>ch</strong>e<br />
Informationen - aktiviert werden. Der optis<strong>ch</strong>e Analysator hat glei<strong>ch</strong>sam die Bewegungserfahrung<br />
von diesen Analysatoren mit übernommen.<br />
(na<strong>ch</strong> Meinel/S<strong>ch</strong>nabel 1998 48-52)<br />
Glatzfelder/Rohner 2006 7
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
Aufgabe:<br />
5. Beurteile Deine Sportart in bezug auf die 5 Analysatoren. S<strong>ch</strong>reibe sti<strong>ch</strong>wortartig<br />
auf, wel<strong>ch</strong>e Informationen aufgenommen werden und überlege Dir, wel<strong>ch</strong>e Analysatoren<br />
in Deiner Sportart zentral sind.<br />
4 Steuerung und Regelung<br />
Im Zentralnervensystem liegen sogenannte motoris<strong>ch</strong>e Programme vor, z.B. eine<br />
Wurfbewegung, der Ablauf eines Sprungs, etc., wel<strong>ch</strong>e im Verlaufe des Lebens erworben<br />
werden. Je na<strong>ch</strong> zu bewältigender Aufgabe kann nun die Sportlerin auf ein<br />
sol<strong>ch</strong>es Programm zugreifen. Da die Programme nur sehr generalisiert gespei<strong>ch</strong>ert<br />
sind und nur die grobe <strong>ch</strong>arakteristis<strong>ch</strong>e Struktur einer Bewegung enthalten, kann die<br />
Sportlerin dieses Programm no<strong>ch</strong> situativ anpassen. Sie kann z.B. im Programm<br />
„Torwurf im Handball“ wählen, ob sie den Wurf links oben oder als Aufsetzer re<strong>ch</strong>ts<br />
unten platzieren will. Das ablaufende Programm steuert dann die gewüns<strong>ch</strong>te Bewegung.<br />
(S<strong>ch</strong>eid/Prohl 2001, 34)<br />
Abb. 8 Der Sportler als Disc-Jockey (aus Röthig/Grössing 1996, 15)<br />
Der Sportler kann im Umgang mit seinen Programmen<br />
wie ein Disc-Jockey mit seinen S<strong>ch</strong>allplatten<br />
vergli<strong>ch</strong>en werden:<br />
Im Zentralnervensystem sind, wie in einer Musikbox,<br />
so etwas wie S<strong>ch</strong>allplatten gelagert. Sie können<br />
bei Bedarf jederzeit aufgelegt und abgespielt<br />
werden. Ergebnis dieses Abspielens sind motoris<strong>ch</strong>e<br />
Kommandos. Über sie steuert die S<strong>ch</strong>allplatte<br />
die Skelettmuskulatur, so dass eine in Raum<br />
und Zeit geordnete Bewegung entsteht.<br />
(S<strong>ch</strong>eid/Prohl 2001, 38)<br />
In fast allen Sportarten muss der Sportler aber seine Bewegungen an we<strong>ch</strong>selnde<br />
Bedingungen anpassen oder auftretende Fehler korrigieren können. Diese Mögli<strong>ch</strong>keit<br />
der Einflussnahme auf eine Bewegung nennt man Regelung. Kraft- und Ges<strong>ch</strong>windigkeitseinsatz,<br />
aber au<strong>ch</strong> räumli<strong>ch</strong>e Aspekte einer Bewegung werden den<br />
Erfordernissen der jeweiligen Situation angepasst.<br />
Um Bewegungen regeln, anpassen zu können, brau<strong>ch</strong>t der Sportler eine Rückmeldung,<br />
ein Feedback über seine Bewegung. Dies wird dur<strong>ch</strong> die 5 Analysatoren ermögli<strong>ch</strong>t.<br />
Ihre Informationen über die tatsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>e Bewegung (Istwert) verglei<strong>ch</strong>t der<br />
Sportler mit seiner gewüns<strong>ch</strong>ten Bewegung (Sollwert) und kann entspre<strong>ch</strong>ende Anpassungen<br />
einleiten. Der Vorgang der Regelung einer Bewegung lässt si<strong>ch</strong> anhand<br />
eines Regelkreises verans<strong>ch</strong>auli<strong>ch</strong>en:<br />
Glatzfelder/Rohner 2006 8
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
Efferente (motoris<strong>ch</strong>e) Nervenbahn<br />
Abb. 9 Die Regelung der Bewegung, dargestellt als Regelkreis (Abb. der Muskelinnervation aus<br />
Weineck 1998, 49)<br />
5 Bewegungserfahrung<br />
Zentralnervensystem<br />
Soll-Istwert-<br />
Verglei<strong>ch</strong><br />
Bewegungsausführung<br />
Afferente (sensoris<strong>ch</strong>e) Nervenbahn<br />
Zentralnervensystem<br />
(Hirn, Rückenmark)<br />
Rezeptor<br />
(z.B. Sehzellen<br />
des Auges)<br />
Beim Erlernen neuer Bewegungen im Verlaufe des individuellen Lebens wird immer<br />
auf bereits vorhandenen Grundlagen aufgebaut. So verfügen wir, wenn wir mit dem<br />
Erlernen eines sportli<strong>ch</strong>en Bewegungsablaufs oder einer sportli<strong>ch</strong>en Te<strong>ch</strong>nik beginnen,<br />
bereits über ein motoris<strong>ch</strong>es Leistungsniveau. Dieses motoris<strong>ch</strong>e Ausgangsniveau<br />
bestimmt in hohem Masse, wie s<strong>ch</strong>nell si<strong>ch</strong> der Lernprozess vollziehen wird. Je<br />
grösser der S<strong>ch</strong>atz an Bewegungserfahrungen, desto lei<strong>ch</strong>ter und s<strong>ch</strong>neller geht das<br />
Neulernen vor si<strong>ch</strong>. Geringe Bewegungserfahrungen können einen Lernprozess<br />
stark verlängern und komplizieren.<br />
(Meinel/S<strong>ch</strong>nabel 1998, 157)<br />
Glatzfelder/Rohner 2006 9
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
Bewegungserfahrungen sind im motoris<strong>ch</strong>en Gedä<strong>ch</strong>tnis des Lernenden gespei<strong>ch</strong>ert<br />
und haben unter anderem eine Orientierungsfunktion in der ersten Phase der aktiven<br />
Auseinandersetzung mit einer neuen Bewegung. Der Sportler nimmt eine Standortbestimmung<br />
vor, indem er einen Verglei<strong>ch</strong> zwis<strong>ch</strong>en dem geforderten und dem aktualisierbaren<br />
Können ma<strong>ch</strong>t. Das Resultat dieses Verglei<strong>ch</strong>s ist meistens eine Differenz,<br />
die es dann in einem Lernprozess zu bereinigen gilt.<br />
(Hotz 1986, 74)<br />
Lernfähigkeit ist sehr stark abhängig von früheren Lernerfahrungen. Sie bedeutet,<br />
dass in derselben Zeit mehr und s<strong>ch</strong>wierigere Bewegungsformen gelernt werden<br />
können. Beim Lernen werden so Wirkungen früherer Lernerfahrungen in die neue<br />
Situation übertragen. Wirkt si<strong>ch</strong> eine frühere Erfahrung positiv auf eine neu zu erlernende<br />
Bewegung aus, spri<strong>ch</strong>t man von Transferenz. Gelegentli<strong>ch</strong> ist aber au<strong>ch</strong> zu<br />
beoba<strong>ch</strong>ten, dass si<strong>ch</strong> alte Koordinationsmuster störend auf das Erlernen neuer Bewegungen<br />
auswirken. Diese Ers<strong>ch</strong>einung wird als Interferenz bezei<strong>ch</strong>net (vgl. <strong>Bewegungslehre</strong><br />
1, Kap. 6 „Bewegungsverwandts<strong>ch</strong>aften“).<br />
Aufgabe:<br />
6. Wel<strong>ch</strong>e Faktoren haben einen Einfluss auf den Erwerb von Bewegungserfahrung?<br />
6 Bewegungsvorstellung<br />
6.1 Definition<br />
Eine wi<strong>ch</strong>tige Rolle beim motoris<strong>ch</strong>en Lernen spielt die Bewegungsvorstellung.<br />
Unter Bewegungsvorstellung versteht man einen aus dem Gedä<strong>ch</strong>tnis aufgebauten<br />
Ablauf einer geplanten oder ausgeführten Bewegung.<br />
(na<strong>ch</strong> Röthig/Grössing 1996, 89)<br />
Die Bewegungsvorstellung ist einerseits immer eine ganzheitli<strong>ch</strong>e Vorstellung einer<br />
Bewegung und beinhaltet also au<strong>ch</strong> z.B. ihren dynamis<strong>ch</strong>en Verlauf. Das reine Vorstellen<br />
einer oder mehrerer Körperstellungen, wie sie z.B. auf Reihenbildern zu sehen<br />
sind, ist no<strong>ch</strong> keine Bewegungsvorstellung.<br />
Anderseits sind in einer umfassenden Bewegungsvorstellung die gespei<strong>ch</strong>erten<br />
Wahrnehmungen aller 5 Analysatoren enthalten. Alles, was i<strong>ch</strong> während einer Bewegung<br />
sehe, höre und fühle, fliesst in die Bewegungsvorstellung ein.<br />
Wenn si<strong>ch</strong> ein Sportler eine Bewegung vorstellt, so stellt er sie ni<strong>ch</strong>t als etwas ausser<br />
ihm Existierendes „vor si<strong>ch</strong> hin“, sondern er stellt sie „in si<strong>ch</strong> hinein“. Eine e<strong>ch</strong>te Bewegungsvorstellung<br />
ist deshalb immer eine „Innensi<strong>ch</strong>t“.<br />
(Meinel/S<strong>ch</strong>nabel 1998, 54-55)<br />
Glatzfelder/Rohner 2006 10
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
6.2 Methoden zur Verbesserung der Bewegungsvorstellung<br />
Einen s<strong>ch</strong>wierigen Bewegungsablauf zu erlernen, hängt unter anderem ab von der<br />
Bildung einer klaren und ri<strong>ch</strong>tigen Bewegungsvorstellung. Diese Vorstellung kann<br />
si<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong> Beoba<strong>ch</strong>ten s<strong>ch</strong>lagartig bilden. Den 9 –12-Jährigen spri<strong>ch</strong>t man ein Lernen<br />
(dur<strong>ch</strong> Na<strong>ch</strong>ahmung) auf Anhieb zu. In späterem Alter, aber au<strong>ch</strong> bei höheren<br />
und komplexeren Lernanforderungen kommt man mit einer sol<strong>ch</strong>en „naiven Te<strong>ch</strong>nik“<br />
ni<strong>ch</strong>t aus. Im Folgenden werden ein paar Methoden zum gezielten Aufbau einer Bewegungsvorstellung<br />
bes<strong>ch</strong>rieben. Dabei werden auf vers<strong>ch</strong>iedenen Wegen bewusst<br />
Informationen aufgenommen.<br />
1. Über das Auge: Die intensive Beoba<strong>ch</strong>tung und ihre Spei<strong>ch</strong>erung im Gedä<strong>ch</strong>tnis.<br />
Das heisst bewusstes Beoba<strong>ch</strong>ten, Auswahl der Te<strong>ch</strong>nikelemente, des Gesamtablaufs,<br />
der ins eigene Repertoire übernommen werden könnte.<br />
2. Über das Wort: Bewusste Aufnahme von Bewegungserklärungen des Trainers,<br />
aber au<strong>ch</strong> eigene Bes<strong>ch</strong>reibung des Bewegungsablaufs. Auf diese Weise vergegenwärtigt<br />
man si<strong>ch</strong>, was passiert oder passiert ist.<br />
3. Über das Gefühl: Bewusstma<strong>ch</strong>en kinästhetis<strong>ch</strong>er Informationen. Wahrgenommen<br />
werden Spannungs- und Entspannungszustände der Muskulatur, die Abstufung<br />
des Krafteinsatzes, der Rhythmus einer Bewegung, etc.<br />
(Röthig/Grössing 1996, 89-90)<br />
Aufgabe<br />
Abb. 10 Die Bewegungsphasen eines Vollrists<strong>ch</strong>usses (Bauer 1998, 82)<br />
7. Versu<strong>ch</strong>e, die oben bes<strong>ch</strong>riebenen Methoden<br />
bei der Ausführung eines Vollrists<strong>ch</strong>usses<br />
(vgl. Abb. 10) anzuwenden:<br />
1. Informationsaufnahme über das Auge:<br />
Was beoba<strong>ch</strong>test Du? Auf wel<strong>ch</strong>e Aspekte der<br />
Bewegung a<strong>ch</strong>test Du?<br />
2. Informationsaufnahme über das Wort:<br />
Formuliere den Bewegungsablauf in eigenen<br />
Worten.<br />
3. Informationsaufnahme über das Gefühl:<br />
Bes<strong>ch</strong>reibe, was Du während des Bewegungsablaufs<br />
spürst.<br />
Glatzfelder/Rohner 2006 11
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
7 Modell der Bewegungskoordination<br />
Das folgende Modell der Bewegungskoordination geht davon aus, dass si<strong>ch</strong> Lernen<br />
grundsätzli<strong>ch</strong> in einem Regelkreis vollzieht, der si<strong>ch</strong> selbst optimiert. Zur Lösung der<br />
in vielen Sportarten gestellten komplizierten Koordinationsaufgaben sind mehrere<br />
Teilaufgaben zu realisieren:<br />
1. Die afferente und reafferente Informationsaufnahme. Dadur<strong>ch</strong> werden vor, während<br />
und na<strong>ch</strong> einer Bewegung Informationen gewonnen und weitervermittelt.<br />
2. Die Erstellung eines Bewegungsplans<br />
3. Das Abfragen des motoris<strong>ch</strong>en Gedä<strong>ch</strong>tnisses mit Bewegungsmustern<br />
4. Die Steuerung und Regelung der Bewegung dur<strong>ch</strong> die Erteilung efferenter Steuer-<br />
und Korrekturimpulse an die Muskeln<br />
5. Die Bewegungsausführung<br />
6. Der Verglei<strong>ch</strong> der eingehenden Informationen (Istwerte) mit dem erstellten Bewegungsplan<br />
(Sollwerte)<br />
Efferente Informationen<br />
an die Muskeln<br />
Störgrösse<br />
Handlungsziel<br />
Bewegungsplan<br />
Istwert-Sollwert-<br />
Verglei<strong>ch</strong><br />
Motoris<strong>ch</strong>es<br />
Gedä<strong>ch</strong>tnis<br />
mit<br />
Auswahl-<br />
programmen<br />
Bewegungsausführung<br />
(Muskeln)<br />
Innerer<br />
Regelkreis<br />
Äusserer<br />
Regelkreis<br />
Abb. 11 Modell der Bewegungskoordination (na<strong>ch</strong> Meinel/S<strong>ch</strong>nabel 1998, 42)<br />
(Re-)afferente<br />
Informationen an das<br />
Zentralnervensystem<br />
(Afferenzsynthese)<br />
Umwelt<br />
(Boden, Geräte,<br />
Wasser, S<strong>ch</strong>nee)<br />
Glatzfelder/Rohner 2006 12
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
Erläuterungen zum Modell der Bewegungskoordination<br />
Afferente Informationen,<br />
Afferenzen<br />
Reafferente Informationen,<br />
Reafferenzen<br />
Informationen, die vor einer Bewegung dur<strong>ch</strong> die Sinnesorgane (z.B.<br />
Augen und Ohren) aufgenommen und an das zentrale Nervensystem<br />
weitergeleitet werden.<br />
Informationen (Rückmeldungen, Feedback), die während oder na<strong>ch</strong><br />
einer Bewegung auf afferentem Weg übermittelt werden. Sie orientieren<br />
über den Verlauf oder das Ergebnis einer Bewegung.<br />
Afferenzsynthese Der Sportler erhält beim Lernen von Bewegungen eine Reihe von<br />
Informationen. Der Lehrende erklärt sie (verbal), die Bewegung wird<br />
vorgema<strong>ch</strong>t (visuell), das Bewegungsgefühl bringt erste Empfindungen<br />
über den mögli<strong>ch</strong>en Ablauf einer Bewegung (kinästhetis<strong>ch</strong>). Diese<br />
ankommenden (afferenten) Impulse werden nun zu einer Einheit<br />
vers<strong>ch</strong>molzen. Erst diese Gesamtinformation (Synthese) ermögli<strong>ch</strong>t<br />
es, einen Bewegungsplan zu entwickeln, ehe eine Bewegung ausgeführt<br />
wird.<br />
Da die Afferenzsynthese alle auf afferentem Weg übermittelten Informationen<br />
enthält, sind darin au<strong>ch</strong> die Reafferenzen einges<strong>ch</strong>lossen.<br />
Efferente Informationen,<br />
Efferenzen<br />
Innerer und äusserer Regelkreis<br />
Informationen (motoris<strong>ch</strong>e Kommandos), die vom zentralen Nervensystem<br />
zur Peripherie (Muskulatur) gesendet werden.<br />
(Röthig/Grössing 1996, 166f)<br />
Zum inneren Regelkreis gehören der kinästhetis<strong>ch</strong>e und der staticodynamis<strong>ch</strong>e<br />
Analysator, zum äusseren Regelkreis der optis<strong>ch</strong>e, taktile<br />
und akustis<strong>ch</strong>e Analysator. Der äussere Regelkreis verarbeitet<br />
Informationen aus der Umwelt, im innern Regelkreis verläuft der Informationsfluss<br />
auss<strong>ch</strong>liessli<strong>ch</strong> innerhalb des Organismus.<br />
(Meinel/S<strong>ch</strong>nabel 1998, 48)<br />
Aufgabe:<br />
8. Trage in das Modell der Bewegungskoordination Abb. 11 die Korrektur des Trainers<br />
ein.<br />
Abb. 12 Glei<strong>ch</strong>gewi<strong>ch</strong>t – eine der<br />
zentralen koordinativen Fähigkeiten<br />
im Sport<br />
Glatzfelder/Rohner 2006 13
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
8 Phasen des motoris<strong>ch</strong>en Lernens<br />
Aufgabe:<br />
9. Nenne einige Bewegungsfehler, die für Anfänger in bestimmten Sportarten typis<strong>ch</strong><br />
sind. Orientiere Di<strong>ch</strong> dabei an den bekannten Bewegungsmerkmalen.<br />
Das Lernen neuer Bewegungen vollzieht si<strong>ch</strong> in <strong>ch</strong>arakteristis<strong>ch</strong>en Phasen. Man unters<strong>ch</strong>eidet<br />
folgende drei Lernphasen:<br />
Erste Lernphase: Entwicklung der Grobkoordination<br />
Zweite Lernphase: Entwicklung der Feinkoordination<br />
Dritte Lernhase: Entwicklung der situativ-variablen Verfügbarkeit<br />
Diese Phasen stellen kein starres S<strong>ch</strong>ema dar. Es gibt keine s<strong>ch</strong>arfen Trennungslinien,<br />
sondern fliessende Übergänge von der einen in die nä<strong>ch</strong>st höhere Phase. Ebenso<br />
stellen die drei Phasen die Grundstruktur allen motoris<strong>ch</strong>en Lernens dar, unabhängig<br />
von der Sportart, dem Alter und der vorhandenen Bewegungserfahrung<br />
eines Mens<strong>ch</strong>en.<br />
8.1 Grobkoordination<br />
8.1.1 Allgemeine Charakteristik<br />
Die erste Lernphase umfasst den Lernverlauf vom ersten näheren Bekanntwerden<br />
mit dem neu zu erlernenden Bewegungsablauf bis zu einem Stadium, in dem der<br />
Lernende die Bewegung bei günstigen Bedingungen ausführen kann. Das Können in<br />
dieser ersten Lernphase ist jedo<strong>ch</strong> no<strong>ch</strong> unvollkommen in vers<strong>ch</strong>iedener Beziehung:<br />
Der Erfolg ist eng an günstige Bedingungen der Übungsstätte oder des Geländes<br />
gebunden. Die Bewegungsausführung weist no<strong>ch</strong> wesentli<strong>ch</strong>e Mängel auf, die in fast<br />
allen Bewegungsmerkmalen (Skript <strong>Bewegungslehre</strong> 1,11-13) zu Tage treten.<br />
8.1.2 Zur Bewegungskoordination<br />
Die oben bes<strong>ch</strong>riebenen Mängel in der Bewegungsausführung lassen si<strong>ch</strong> weitgehend<br />
erklären, wenn wir verstehen, wie die Bewegung in dieser ersten Lernphase<br />
gesteuert und geregelt wird.<br />
Analysatoren<br />
Charakteristis<strong>ch</strong> für die Informationsaufnahme und -verarbeitung ist die unzurei<strong>ch</strong>ende<br />
Verwertung der afferenten und reafferenten Signale. Einem Anfänger ist es ni<strong>ch</strong>t<br />
mögli<strong>ch</strong>, die Fülle der vor und während der Bewegungsausführung einlaufenden Informationen<br />
ri<strong>ch</strong>tig zu deuten, die wesentli<strong>ch</strong>en herauszufiltern und zweckentspre<strong>ch</strong>end<br />
zusammenzusetzen.<br />
Der Lernende erfasst häufig s<strong>ch</strong>on das ihm dargebotene Vorbild ni<strong>ch</strong>t hinrei<strong>ch</strong>end,<br />
so dass keine brau<strong>ch</strong>bare erste Vorstellung, kein sinnvoller Bewegungsplan entste-<br />
Glatzfelder/Rohner 2006 14
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
hen kann. Die Wahrnehmung der vollzogenen Bewegung ist sehr vers<strong>ch</strong>wommen,<br />
d.h. der Anfänger weiss oft ni<strong>ch</strong>t genau, was er eigentli<strong>ch</strong> gema<strong>ch</strong>t hat.<br />
Dominierend ist zunä<strong>ch</strong>st der optis<strong>ch</strong>e Analysator, die andern Analysatoren sind<br />
wohl beteiligt, aber no<strong>ch</strong> unzurei<strong>ch</strong>end. Das betrifft insbesondere den kinästhetis<strong>ch</strong>en<br />
Analysator, dessen Informationen die Bewegung massgebli<strong>ch</strong> steuern und<br />
regeln müssen.<br />
Bewegungsvorstellung<br />
Eine ents<strong>ch</strong>eidende Rolle spielt die Bewegungserfahrung. Ein erfahrener Sportler,<br />
der eine neue Bewegung lernt, befindet si<strong>ch</strong> in einer andern Ausgangssituation als<br />
der sportli<strong>ch</strong>e Anfänger. Die erste Lernphase verläuft für ihn anders. Die sensoris<strong>ch</strong>en<br />
und verbalen Informationen bei der Aufgabenstellung werden besser aufgenommen<br />
und verarbeitet. Es bildet si<strong>ch</strong> sehr s<strong>ch</strong>nell eine klarere, au<strong>ch</strong> bereits kinästhetis<strong>ch</strong>e<br />
Bewegungsvorstellung.<br />
Beim sportli<strong>ch</strong>en Anfänger hingegen ist die Vorstellung vom Bewegungsablauf im<br />
Wesentli<strong>ch</strong>en ein optis<strong>ch</strong>es Abbild und enthält nur in geringem Mass die für eine Bewegungsvorstellung<br />
so wi<strong>ch</strong>tigen kinästhetis<strong>ch</strong>en Anteile.<br />
Abb. 13 Te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>es und<br />
taktis<strong>ch</strong>es Können im Kampf<br />
um den Ball<br />
Soll-Istwert-Verglei<strong>ch</strong><br />
Mens<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>e Bewegungstätigkeit ist nur mögli<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong> Regelung, d.h., bei der Ausführung<br />
einer Bewegung findet ein ständiger Soll-Istwert- Verglei<strong>ch</strong> statt. Das gilt<br />
au<strong>ch</strong> bereits für die Grobkoordination. Da hingegen die Informationsaufnahme und<br />
Informationsverarbeitung über die auszuführende Bewegung no<strong>ch</strong> sehr ungenau ist,<br />
kann im Bewegungsplan au<strong>ch</strong> kein korrekter Sollwert eingestellt werden. Deshalb ist<br />
eine Regelung des Bewegungsablaufs nur bes<strong>ch</strong>ränkt mögli<strong>ch</strong>. Charakteristis<strong>ch</strong> für<br />
die Regelung in der ersten Lernphase ist, dass Sollwertabwei<strong>ch</strong>ungen erst von einer<br />
bestimmten Grösse an überhaupt erfasst werden. Das zeigt si<strong>ch</strong> am deutli<strong>ch</strong>sten<br />
beim Erlernen von Bewegungen, die hohe Anforderungen an das Glei<strong>ch</strong>gewi<strong>ch</strong>t stellen.<br />
Hierin ist au<strong>ch</strong> die Tatsa<strong>ch</strong>e begründet, dass im Stadium der Grobkoordination die<br />
Bewegung nur unter günstigen Bedingungen gelingt. Auf Störungen reagiert der An-<br />
Glatzfelder/Rohner 2006 15
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
fänger nur ungenügend oder ni<strong>ch</strong>t s<strong>ch</strong>nell genug. Fast überhaupt unmögli<strong>ch</strong> ist für<br />
ihn eine vorauss<strong>ch</strong>auende, antizipierende Regelung. Er kann Störungen ni<strong>ch</strong>t voraussehen<br />
und si<strong>ch</strong> darauf einstellen. Das wird erst in einem späteren Lernstadium<br />
errei<strong>ch</strong>t. Darum ist eine wettkampfmässige Anwendung der erlernten Te<strong>ch</strong>nik im<br />
Stadium der Grobkoordination ni<strong>ch</strong>t zweckmässig. Denn in jedem Wettkampf treten<br />
Störeinflüsse auf, sei es dur<strong>ch</strong> die Bedingungen des Geländes, des Wettkampfortes<br />
oder dur<strong>ch</strong> den Gegner.<br />
Die Mängel in der Bewegungskoordination in dieser ersten Lernphase lassen si<strong>ch</strong><br />
folgendermassen erklären: Die Bewegungsausführung wird hauptsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> über den<br />
äusseren Regelkreis kontrolliert. Mögli<strong>ch</strong>e Korrekturen ges<strong>ch</strong>ehen fast nur auf der<br />
Basis visueller Informationen, sind sehr grob und kommen oft zu spät.<br />
8.2 Feinkoordination<br />
(na<strong>ch</strong> Meinel/S<strong>ch</strong>nabel 1998, 160-168)<br />
8.2.1 Allgemeine Charakteristik<br />
Die zweite Lernphase umfasst den Lernverlauf vom Errei<strong>ch</strong>en des Stadiums der<br />
Grobkoordination bis zu einem Stadium, in dem der Lernende die Bewegung annähernd<br />
fehlerfrei ausführen kann. Dabei wird die Aufgabe unter den gewohnten, günstigen<br />
Bedingungen ohne störende Einflüsse voll und mit Lei<strong>ch</strong>tigkeit erfüllt. Treten<br />
jedo<strong>ch</strong> ungewohnte, ungünstige Bedingungen und Störeinflüsse auf, ist die Erfüllung<br />
der Aufgabe ni<strong>ch</strong>t glei<strong>ch</strong>ermassen vollkommen. Es stellen si<strong>ch</strong> wieder gröbere te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>e<br />
Fehler und Rückfälle in eben erst überwundene Mängel ein. Ansonsten wirkt<br />
der Bewegungsablauf harmonis<strong>ch</strong>er und einheitli<strong>ch</strong>er, überflüssige Mitbewegungen<br />
vers<strong>ch</strong>winden.<br />
Die Entwicklung von der Grob- zur Feinkoordination geht im Allgemeinen kontinuierli<strong>ch</strong><br />
vor si<strong>ch</strong>. Bisweilen kann jedo<strong>ch</strong> au<strong>ch</strong> eine zeitweilige Stagnation auftreten, so<br />
dass trotz fortgesetzten Übens kein si<strong>ch</strong>tbarer Erfolg verzei<strong>ch</strong>net wird. Denno<strong>ch</strong> stellt<br />
si<strong>ch</strong> häufig ein grösserer Forts<strong>ch</strong>ritt na<strong>ch</strong> einer zeitweiligen Stagnation ein, und das<br />
ni<strong>ch</strong>t selten na<strong>ch</strong> einer Unterbre<strong>ch</strong>ung des Übens über mehrere Trainingseinheiten<br />
hinweg. Wird der Lernverlauf in Form einer Kurve dargestellt, so lassen si<strong>ch</strong> sowohl<br />
Perioden des Lernforts<strong>ch</strong>ritts als au<strong>ch</strong> Perioden gewisser Stagnation (Plateaubildung)<br />
erkennen.<br />
Das Problem der Plateaubildung<br />
Es ist anzunehmen, dass der Lernprozess der Bewegungskoordination in den entspre<strong>ch</strong>enden Hirnzentren<br />
forts<strong>ch</strong>reitet, au<strong>ch</strong> wenn in der Bewegungsführung keine Veränderungen erkennbar werden.<br />
Das heisst, dass die Plateaubildung nur eine s<strong>ch</strong>einbare Stagnation des Lernprozesses ausdrückt.<br />
Offenbar muss in den Prozessen des Zentralnervensystems erst eine bestimmte Qualität errei<strong>ch</strong>t<br />
werden, bevor si<strong>ch</strong> diese Forts<strong>ch</strong>ritte au<strong>ch</strong> in der Bewegung zeigen. Das gilt besonders für s<strong>ch</strong>wierigere<br />
sportli<strong>ch</strong>e Bewegungen.<br />
In den Bewegungsmerkmalen ist überall das Ers<strong>ch</strong>einungsbild anzutreffen, das für<br />
eine rationelle und ökonomis<strong>ch</strong>e Bewegungsausführung gefordert wird.<br />
Glatzfelder/Rohner 2006 16
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
8.2.2 Zur Bewegungskoordination<br />
Analysatoren<br />
In der zweiten Lernphase ist die Informationsaufnahme und –verarbeitung von zentraler<br />
Bedeutung. Im Gegensatz zur ersten Lernphase werden nun in zunehmendem<br />
Masse au<strong>ch</strong> Informationen über die Bewegungsausführung aufgenommen und verarbeitet.<br />
Ein Grossteil dieser erweiterten Information ist auf eine Vers<strong>ch</strong>iebung im<br />
Anteil der Analysatoren zurückzuführen. Mit zunehmender Übung können vor allem<br />
die Informationen des kinästhetis<strong>ch</strong>en Analysators besser verarbeitet werden. Im<br />
Verlauf dieser zweiten Lernphase gewinnt der kinästhetis<strong>ch</strong>e Analysator - und mit<br />
ihm der innere Regelkreis - an Bedeutung und wird zur führenden Instanz.<br />
Abb. 14 Judo – Taktile Fähigkeiten im „sanften<br />
Weg“<br />
Bewegungsvorstellung<br />
Die Bewegungsvorstellung, die beim Anfänger no<strong>ch</strong> unvollkommen ist, wird zunehmend<br />
erweitert und verfeinert. Au<strong>ch</strong> dies wird nur mögli<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong> eine stärkere Einbeziehung<br />
aller sensoris<strong>ch</strong>en Informationen.<br />
Die Verbesserung der Bewegungsvorstellung ist dabei eng verbunden mit der Verbalisierung<br />
des Bewegungsvorgangs. Verbalisierung heisst zum einen, dass der Lehrer<br />
die Bewegung und allfällige Korrekturen in allen Einzelheiten zu bes<strong>ch</strong>reiben weiss.<br />
Zum andern ist au<strong>ch</strong> der Lernende aufgefordert, die eigene Bewegung spra<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong><br />
wiederzugeben. Auf diese Weise können Fehler in der Bewegungsvorstellung entdeckt<br />
werden und Teile – wie bei einem Puzzle – na<strong>ch</strong> und na<strong>ch</strong> zu einer ganzheitli<strong>ch</strong>en<br />
Bewegungsvorstellung zusammengesetzt werden. Diese kognitive Arbeit an<br />
einer Bewegung verlangt eine hohe Motivation seitens des Sportlers, weil oft über<br />
längere Zeit trotz harter Arbeit keine si<strong>ch</strong>tbaren Erfolge eintreten. Ein Sportler, dem<br />
dieses innere Engagement, diese dauernde Auseinandersetzung mit den Feinheiten<br />
eines Bewegungsablaufs fehlt, wird jedo<strong>ch</strong> bei komplizierteren te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>en Abläufen<br />
nie das Stadium der Feinkoordination errei<strong>ch</strong>en.<br />
Glatzfelder/Rohner 2006 17
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
Soll-Istwert-Verglei<strong>ch</strong><br />
Wurden in der ersten Lernphase Sollwertabwei<strong>ch</strong>ungen im Verglei<strong>ch</strong> mit dem antizipierten<br />
Programm erst von einer sol<strong>ch</strong>en Grösse an erfasst, dass die einsetzende<br />
Korrektur den gesamten Bewegungsablauf beeinträ<strong>ch</strong>tigte, so ändert si<strong>ch</strong> das jetzt<br />
S<strong>ch</strong>ritt für S<strong>ch</strong>ritt. Sollwertabwei<strong>ch</strong>ungen werden bereits im Anfangsstadium erfasst.<br />
Die entspre<strong>ch</strong>ende Korrektur setzt so zeitig ein, dass ein fliessender, glatter Bewegungsablauf<br />
gewährleistet ist. Dieses Niveau der Bewegungsregulation wird jedo<strong>ch</strong><br />
erst unter gewohnten Übungsbedingungen errei<strong>ch</strong>t. Plötzli<strong>ch</strong> auftretende grössere<br />
Störungen werden no<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t s<strong>ch</strong>nell genug erfasst und verarbeitet.<br />
Mit der Entwicklung der Feinkoordination bildet si<strong>ch</strong> eine komplexe Wahrnehmung<br />
heraus, die man oft mit Begriffen wie „Skigefühl“, „Ballgefühl“, usw. ums<strong>ch</strong>reibt. Beim<br />
Skigefühl werden die Skier glei<strong>ch</strong>sam als verlängerter Fuss empfunden, beim Ballgefühl<br />
wird der Ball beinahe als Teil des eigenen Körpers angesehen. Dieser Einheit<br />
zwis<strong>ch</strong>en Gerät und Person wird man si<strong>ch</strong> oft erst dann bewusst, wenn man na<strong>ch</strong><br />
längerer Übungspause das vertraute Gefühl vermisst.<br />
(Meinel/S<strong>ch</strong>nabel 1998, 170-183)<br />
Aufgaben:<br />
10. Nenne einige Sportarten und Situationen, wo plötzli<strong>ch</strong> auftretende grössere Störungen<br />
eine im allgemeinen gut beherrs<strong>ch</strong>te Bewegung misslingen lassen.<br />
11. Worin besteht die Gefahr, wenn eine Sportlerin an Wettkämpfen teilnimmt, bevor<br />
sie das Stadium der Feinkoordination errei<strong>ch</strong>t hat? Ist diese Gefahr in allen<br />
Sportarten glei<strong>ch</strong> gross?<br />
12. Das Üben in der zweiten Lernphase wird von Sportwissens<strong>ch</strong>aftlern bes<strong>ch</strong>rieben<br />
als „Wiederholen ohne Wiederholung“. Was ist damit gemeint?<br />
Glatzfelder/Rohner 2006 18
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
8.3 Situativ-variable Verfügbarkeit<br />
Abb. 15 Präzision mit hoher Konstanz, die Merkmale<br />
eines Könners.<br />
8.3.1 Allgemeine Charakteristik<br />
Die dritte Lernphase umfasst den Lernverlauf vom Errei<strong>ch</strong>en des Stadiums der Feinkoordination<br />
bis zu einem Stadium, in dem der Lernende die Bewegung au<strong>ch</strong> unter<br />
s<strong>ch</strong>wierigen und ungewohnten Bedingungen si<strong>ch</strong>er ausführen und jederzeit erfolgrei<strong>ch</strong><br />
anwenden kann. Die Aufgabe muss im Wettkampf unter s<strong>ch</strong>wierigsten Bedingungen<br />
erfüllt werden, wobei die Bewegungsstruktur und die Gütekriterien der Te<strong>ch</strong>nik<br />
dem Bewegungszweck au<strong>ch</strong> bei stärkeren Störeinflüssen entspre<strong>ch</strong>en müssen.<br />
Erst damit sind die Voraussetzungen für hö<strong>ch</strong>ste sportli<strong>ch</strong>e Leistungen gegeben.<br />
Leistungsstabilität beruht jedo<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t nur auf dem Niveau motoris<strong>ch</strong>en Könnens. Die<br />
Persönli<strong>ch</strong>keit einer Sportlerin mit ihren psy<strong>ch</strong>is<strong>ch</strong>en Eigens<strong>ch</strong>aften ist sehr mitents<strong>ch</strong>eidend.<br />
Zwis<strong>ch</strong>en psy<strong>ch</strong>is<strong>ch</strong>er Stabilität und der Stabilität einer motoris<strong>ch</strong>en Fertigkeit<br />
bestehen We<strong>ch</strong>selbeziehungen.<br />
Im Stadium der situativ-variablen Verfügbarkeit besitzt der Sportler aber meist die<br />
nötige Selbstsi<strong>ch</strong>erheit, um au<strong>ch</strong> kritis<strong>ch</strong>e Situationen wie Doppelfehler beim Tennisaufs<strong>ch</strong>lag,<br />
Fehlversu<strong>ch</strong>e beim Ho<strong>ch</strong>sprung, usw. wieder in den Griff zu bekommen.<br />
Die dritte Lernphase ist niemals restlos abges<strong>ch</strong>lossen; ein ni<strong>ch</strong>t mehr zu überbietendes<br />
Optimum wird nie errei<strong>ch</strong>t, sondern nur eine Annäherung an dieses Optimum.<br />
Die stabilisierte Feinkoordination ist so „labil“, dass das erarbeitete Niveau nur bei<br />
weiterer bewusster S<strong>ch</strong>ulung gehalten werden kann.<br />
Glatzfelder/Rohner 2006 19
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
8.3.2 Zur Bewegungskoordination<br />
Abb. 16 Mit te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>er Perfektion<br />
an die Grenzen des Mögli<strong>ch</strong>en<br />
Analysatoren<br />
Die Prozesse der Informationsaufnahme und –verarbeitung haben bereits im Stadium<br />
der Feinkoordination ein hohes Niveau errei<strong>ch</strong>t. Mit zunehmender Stabilisierung<br />
ist es nun ni<strong>ch</strong>t mehr erforderli<strong>ch</strong>, dass der Lernende seine volle Aufmerksamkeit auf<br />
Details der Bewegungsausführung ri<strong>ch</strong>tet. Abgesehen von einzelnen zentralen Stellen<br />
in einem Bewegungsablauf, so genannten Knotenpunkten, kann si<strong>ch</strong> der Sportler<br />
ganz dem Errei<strong>ch</strong>en einer maximalen Leistungsfähigkeit widmen.<br />
In Zweikampfsportarten wird die Aufmerksamkeit frei für die taktis<strong>ch</strong>e Seite eines Kampfes. Au<strong>ch</strong> bei<br />
Spielsportarten wird der Sportler frei für eine ständige Beoba<strong>ch</strong>tung des Gegners und seiner Mitspieler.<br />
Dieses Freiwerden der Aufmerksamkeit ist darauf zurückzuführen, dass in der Bewegungsführung<br />
eine weitere Verlagerung des optis<strong>ch</strong>en Analysators auf den kinästhetis<strong>ch</strong>en<br />
Analysator ges<strong>ch</strong>ieht. Insgesamt werden jedo<strong>ch</strong> alle Analysatoren, die<br />
in einer bestimmten Sportart ents<strong>ch</strong>eidend sind, besser genutzt. Die Informationsaufnahme<br />
ges<strong>ch</strong>ieht immer feinsinniger, wodur<strong>ch</strong> au<strong>ch</strong> kleinste Störeinflüsse und<br />
Bedingungsvarianten sofort erkannt und zweckgemäss beantwortet werden können.<br />
Bewegungsvorstellung<br />
Dur<strong>ch</strong> die präzise Informationsaufnahme und –verarbeitung errei<strong>ch</strong>t au<strong>ch</strong> die Bewegungsvorstellung<br />
in der dritten Lernphase ihren Höhepunkt. Es entwickelt si<strong>ch</strong> eine<br />
Allgemeinvorstellung, die jedo<strong>ch</strong> alle Details einer Bewegung mit den dazugehörigen<br />
Anpassungsvarianten im Falle von Störungen enthält.<br />
Ein ausgezei<strong>ch</strong>netes Beispiel liefert der alpine Skilauf, wo jeder Wettkampf unter<br />
ganz unters<strong>ch</strong>iedli<strong>ch</strong>en Bedingungen stattfindet. Der Skiläufer muss während eines<br />
ganzen Laufes Störungen dur<strong>ch</strong> das Gelände, we<strong>ch</strong>selnde S<strong>ch</strong>neebes<strong>ch</strong>affenheit<br />
und s<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>te Si<strong>ch</strong>tverhältnisse verarbeiten. Diese Si<strong>ch</strong>erheit in der Anpassung er-<br />
Glatzfelder/Rohner 2006 20
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
höht er dadur<strong>ch</strong>, dass die Strecke vorher besi<strong>ch</strong>tigt und gedä<strong>ch</strong>tnismässig eingeprägt<br />
wird.<br />
Soll-Istwert-Verglei<strong>ch</strong><br />
Der Soll-Istwert-Verglei<strong>ch</strong> errei<strong>ch</strong>t in diesem Stadium eine weitere Vervollkommnung.<br />
Sollwertabwei<strong>ch</strong>ungen werden so s<strong>ch</strong>nell erfasst und mit Korrekturen beantwortet,<br />
dass au<strong>ch</strong> bei stärkeren, massiven Störungen von aussen ein Errei<strong>ch</strong>en des Bewegungsziels<br />
no<strong>ch</strong> mögli<strong>ch</strong> ist.<br />
(Meinel/S<strong>ch</strong>nabel 1998, 183 –190)<br />
Abb. 17 Grobkoordination (links) und Stufe der situativ-variablen Verfügbarkeit (re<strong>ch</strong>ts)<br />
Aufgaben:<br />
13. Verglei<strong>ch</strong>e in der Abb. 17 die Bewegungsstruktur von Anfängern mit derjenigen<br />
eines Könners.<br />
14. Bei s<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>ten Si<strong>ch</strong>tverhältnissen (Nebel, S<strong>ch</strong>neefall) fahren s<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>te Skifahrer<br />
unverhältnismässig unsi<strong>ch</strong>erer als sehr gute Fahrer, die kaum auf diese s<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>ten<br />
Bedingungen zu reagieren s<strong>ch</strong>einen. Worauf ist das zurückzuführen?<br />
15. Erläutere die folgende These anhand Deiner Kenntnisse im Bewegungslernen:<br />
„Sinnvolles Na<strong>ch</strong>denken ist nützli<strong>ch</strong>er als blindwütiges Üben“ (Hotz 1986, 156)<br />
16. In wel<strong>ch</strong>en Sportarten sind kritis<strong>ch</strong>e Situationen zu sehen, die von Sportlerinnen<br />
oft aussergewöhnli<strong>ch</strong> gut gemeistert werden?<br />
17. Den grossen Meistern der Kampfkünste wird na<strong>ch</strong>gesagt, dass sie jederzeit im<br />
Voraus wissen, was der Gegner beabsi<strong>ch</strong>tigt. Worauf ist diese „Zauberei“ zurückzuführen?<br />
Glatzfelder/Rohner 2006 21
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
Aufgabe:<br />
18. Erstelle zu den drei Lernphasen eine kurze Zusammenfassung mit 1-2 zentralen<br />
Aussagen zu jedem aufgeführten Aspekt des motoris<strong>ch</strong>en Lernens.<br />
Situativ-variable Verfügbarkeit<br />
Feinkoordination<br />
Grobkoordination<br />
Allgemeine Charakteristik<br />
Analysatoren<br />
Bewegungsvorstellung<br />
Soll-Istwert-<br />
Verglei<strong>ch</strong><br />
Glatzfelder/Rohner 2006 22
<strong>Bewegungslehre</strong> 2 EF Sport<br />
9 Literatur<br />
- Bauer, G.: Fussballte<strong>ch</strong>nik heute. BLV Züri<strong>ch</strong> 1998<br />
- Hotz, A.: Qualitatives Bewegungslernen. SVSS-Verlag Zumikon 1986<br />
- Lippert, H.: Anatomie. Text und Atlas. Urban & S<strong>ch</strong>warzenberg Verlag Mün<strong>ch</strong>en<br />
1983<br />
- Meinel, K./S<strong>ch</strong>nabel,G.: <strong>Bewegungslehre</strong> – Sportmotorik. Sportverlag Berlin 1998<br />
- Röthig P.: Sportwissens<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>es Lexikon. S<strong>ch</strong>orndorf 1992, 6. Auflage<br />
- Röthig P./Grössing St.: <strong>Bewegungslehre</strong>. Kursbu<strong>ch</strong> 3. Limpert Verlag Wiesbaden<br />
1996 5. Auflage<br />
- S<strong>ch</strong>eid, V./Prohl, R..: <strong>Bewegungslehre</strong>. Kursbu<strong>ch</strong> Sport 3. Limpert Verlag Wiebelsheim<br />
2001 6. Auflage<br />
- Silbernagl S./Despopoulos A.: Tas<strong>ch</strong>enatlas der Physiologie. Thieme Verlag<br />
Stuttgart 1988<br />
- Weineck, J.: Optimales Training. Spitta Verlag Balingen 1997<br />
- Weineck, J.: Sportbiologie. Spitta Verlag Balingen 1998<br />
10 Bildna<strong>ch</strong>weis<br />
Titelseite Bryan Wendling http://jugglerboy.home.att.net<br />
Abb. 12 Bob Martin www.bobmartin.com<br />
Abb. 13 Bauer, G.: Fussballte<strong>ch</strong>nik heute. BLV Züri<strong>ch</strong> 1998, S. 37<br />
Abb. 14 Prisma Dia-Agentur Züri<strong>ch</strong>. Sports Photo Catalog, S. 104<br />
Abb. 15 S<strong>ch</strong>oll P.: Ri<strong>ch</strong>tig Tennisspielen, BLV Sportpraxis, Mün<strong>ch</strong>en 1995, S. 112<br />
Abb. 16 Prisma Dia-Agentur Züri<strong>ch</strong>. Sports Photo Catalog, S. 16<br />
Abb. 17 links: Egger K.: Turnen und Sport in der S<strong>ch</strong>ule, Bd. 1. Bern 1978, S. 128<br />
re<strong>ch</strong>ts: Wolfermann K./Rieder H.: Speerwerfen. Mün<strong>ch</strong>en 1973, S.64<br />
Glatzfelder/Rohner 2006 23