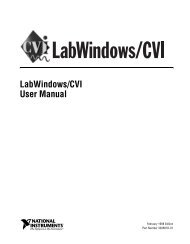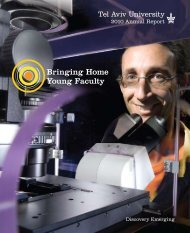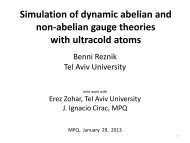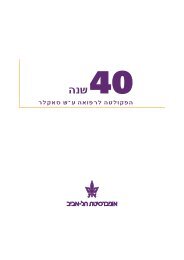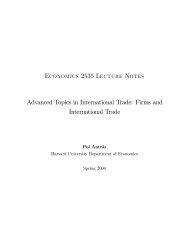Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Karl Leich-Gal<strong>la</strong>nd > La <strong>juive</strong> <strong>–</strong> <strong>die</strong> <strong>jüdin</strong><br />
sich 1836 im gleichen B<strong>la</strong>tt anlässlich der uraufführung der Huguenots wiederholen mit<br />
dem bedeutsamen zusatz, bereits im vorjahr habe man auf der pariser opernbühne eine<br />
„apothéose judaique“ vorgenommen allein „um den eingebungen eines komponisten<br />
jüdischer religion entgegenzukommen“. (l. de Bonald) Weder der name des Werkes noch<br />
der des komponisten werden genannt, aber dennoch verstand im paris des jahres 1836 jeder,<br />
dass hier nur von fromental halévy und der <strong>juive</strong> <strong>die</strong> rede sein konnte. auch <strong>die</strong> radikalrepublikanische<br />
opposition vermochte sich mit der neuen oper nicht anzufreunden, schon<br />
allein weil sie mit dem tun und treiben der Direktion der großen oper schlechthin nicht<br />
einverstanden war. hohes und höchstes lob wurde dem Werk dagegen von Seiten der<br />
regierungstragenden, liberal-bourgeoisen kräfte zuteil (Le journal des débats, Le Constiutionnel).<br />
nicht nur <strong>die</strong> inszenierung und <strong>die</strong> komposition fanden anerkennung sondern ausdrücklich<br />
auch <strong>die</strong> „so interessante“ handlung (Le Figaro).<br />
in händen der liberalen Bourgeoisie war <strong>die</strong> <strong>juive</strong> sicherlich zuerst ein instrument im kampf<br />
der politischen meinungen. Sie kann verstanden werden als ein Bemühen der regierung, den<br />
ideologischen Bestrebungen der fortschrittlichen eine gelegenheit des ausdrucks zu<br />
gewähren, in dem eindrucksvoll zur Darstellung gebracht wird, auf welch abstoßend unduldsame<br />
Weise das ancien régime mit andersgläubigen minderheiten umsprang. Diese mitteilung<br />
wurde von den zeitgenossen <strong>–</strong> zustimmend oder ablehnend <strong>–</strong> durchaus verstanden.<br />
unter <strong>die</strong>sem gesichtspunkt steht <strong>die</strong> <strong>juive</strong>, den Huguenots durchaus vergleichbar, in der<br />
<strong>la</strong>ngen, bis ins 17. jahrhundert zurückreichenden tradition von opern, <strong>die</strong> untaten der<br />
mächtigen zur Belehrung und als abschreckende Beispiele vor augen stellen.<br />
Doch der text der <strong>juive</strong> enthält noch andere Bedeutungsschichten. zuerst der Christenhass<br />
eléazars, der an den „vollkommenen hass“ des psalmisten denken lässt, und sein bis zum<br />
ende des vierten akts andauernder Wille zur rache. Diese einstellung eléazars wird be-<br />
gründet durch den von Christen verursachten gewaltsamen tod seiner Söhne, der in <strong>die</strong> vor-<br />
geschichte der oper verlegt ist. hier finden wir uns im gefolge elektras und Donna annas<br />
(don Giovanni), <strong>die</strong> beide auf das ziel ausgerichtet sind, den tod des vaters zu rächen. Doch<br />
während elektras Bruder orest <strong>die</strong> schicksalhafte rache vollzieht und Don giovanni, aller-<br />
dings durch göttlichen eingriff der höllenstrafe zugeführt wird, schwört eléazar in der großen<br />
monolog-arie nr. 22 seiner rache zweimal, das heißt vollständig und endgültig ab. Dies be-<br />
deutet jedoch keineswegs, dass eléazar bereit ist, den Christen zu verzeihen.<br />
unter dem eindruck der todesrufe der volksmenge gewinnt in ihm dann ein bis dahin<br />
nicht ausgesprochener gesichtspunkt <strong>die</strong> oberhand. er sieht rachel vor <strong>die</strong> Wahl gestellt,<br />
durch den märtyrertod in <strong>die</strong> ewige gemeinschaft mit dem „gott jakobs“, wie er sagt, ein-<br />
zugehen oder <strong>die</strong>ses höchste gut durch den übertritt zum christlichen g<strong>la</strong>uben zu verlieren.<br />
Wie eléazar selbst im vierten lehnt rachel im fünften akt <strong>die</strong> konversion ab und wählt in<br />
heroischer Selbstüberschreitung den f<strong>la</strong>mmentod, nicht ohne zuvor im „generositätswettbewerb“<br />
(h. <strong>la</strong>usberg) mit eudoxie das leben des reichsprinzen léopold gerettet zu<br />
haben. in <strong>die</strong>sem letzten akt wandelt sich <strong>die</strong> rache-oper zum märtyrer-oratorium wie<br />
es dem musikfreund zum Beispiel durch händels Theodora bekannt ist; allerdings gesehen<br />
aus einem ganz ungewohnten Blickwinkel. Statt der Christen sind es hier <strong>die</strong> beiden juden,<br />
<strong>die</strong> den Bekennertod wählen. auch <strong>die</strong>se Bedeutungsschicht der <strong>juive</strong> wurde von den<br />
zeitgenossen k<strong>la</strong>r erfasst. ablehnend, etwa durch h. de Bonald, oder zustimmend, so durch<br />
ph. Chasles, der <strong>die</strong> oper im jahre 1845 als „das jüdische Symbol des19. jahrhunderts“<br />
bezeichnet, durch welches <strong>die</strong> „tragischen ungerechtigkeiten“ von Shakespeares Shylock<br />
wiedergutgemacht seien. natürlich ist <strong>die</strong> im mosaischen g<strong>la</strong>uben aufgewachsene rachel<br />
auch als leibliche tochter Brognis eine <strong>jüdin</strong>. Der zeit halévys war der seit dem ausgehenden<br />
19. jahrhundert vorherrschende biologische Determinismus, der den menschen jeder<br />
Wahlfreiheit beraubt, noch fremd.<br />
gewiss hatte <strong>die</strong> musik fromental halévys auf <strong>die</strong> Dauer den entscheidenden anteil am<br />
Welterfolg der <strong>juive</strong>. Sie fand bei der pariser kritik, <strong>die</strong> der handlung der oper nicht<br />
ablehnend gegenüberstand, volle zustimmung. hierbei wurden wiederholt der „ernst“ und<br />
<strong>die</strong> satztechnische meisterschaft des komponisten hervorgehoben. rossini war von der<br />
partitur sehr angetan, und den jungen franz liszt inspirierte sie zu seinen Réminiscences de<br />
<strong>la</strong> <strong>juive</strong>, einer „bril<strong>la</strong>nten“ k<strong>la</strong>vierfantasie, in der er vor allem das Thema des Bolero verarbeitet,<br />
der in paris sogleich nach der uraufführung gestrichen wurde. gegen ende des<br />
19. jahrhunderts wurde deutlich erkennbar, dass aubers La Muette de Portici und halévys<br />
La <strong>juive</strong> <strong>die</strong> bedeutendsten Schöpfungen der französischen opernschule während der ersten<br />
jahrhunderthälfte darstellen.<br />
in den deutschen <strong>la</strong>nden gehörte richard Wagner zeitlebens zu den Bewunderern der<br />
<strong>juive</strong>. er hat sie selbst wiederholt aufgeführt und nicht gezögert, halévy unter Bezugnahme<br />
auf dessen Reine de Chypre als „unverrücktes vorbild“ für <strong>die</strong> jungen deutschen opernkomponisten<br />
hinzustellen. noch im hohen alter „rühmte“ Wagner <strong>die</strong> <strong>juive</strong> „sehr“ (Cosima<br />
Wagner). auch gustav mahler dirigierte <strong>die</strong> oper häufig und sprach mit größter hochachtung<br />
von ihr. noch hans pfitzner schätzte <strong>die</strong> <strong>juive</strong> und bezeichnete sie als „eines der<br />
wenigen wirklich dramatischen Werke der zeit.“ in Deutsch<strong>la</strong>nd stellte sich auch <strong>die</strong> frage<br />
nach einem jüdischen Charakter von halévys musik. nach a. z. idelsohn hat halévy allein<br />
in der <strong>la</strong>ngsamen einleitung der arie nr. 22 der <strong>juive</strong> eine jüdische melo<strong>die</strong> verwendet.<br />
Der österreichische Dichter franz grillparzer wohnte einer aufführung der <strong>juive</strong> in<br />
london bei. gewisse ähnlichkeiten der handlung im vergleich zu seinem Drama <strong>die</strong><br />
<strong>jüdin</strong> von Toledo würden eine besondere untersuchung rechtfertigen.<br />
Die <strong>juive</strong> wurde bis zum zweiten Weltkrieg in folgende fremdsprachen übersetzt und zur<br />
jeweiligen erstaufführung gebracht:<br />
1. Deutsch, leipzig 1835; 2. russisch, St. petersburg 1837; 3. Dänisch, kopenhagen 1838;<br />
4. tschechisch, prag 1838; 5. ungarisch, Budapest 1842; 6. englisch, london 1854;<br />
> 30 > 31