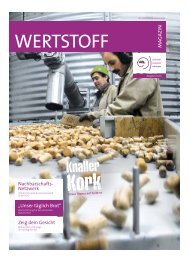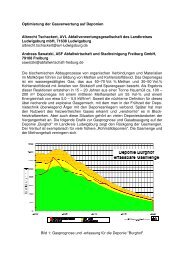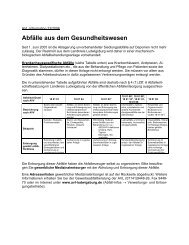Deponiegas: Vergangenheit, Bestand, weitere Entwicklung - AVL
Deponiegas: Vergangenheit, Bestand, weitere Entwicklung - AVL
Deponiegas: Vergangenheit, Bestand, weitere Entwicklung - AVL
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Deponiegas</strong>: <strong>Vergangenheit</strong>, <strong>Bestand</strong>, <strong>weitere</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
Dipl.-Ing. Albrecht Tschackert<br />
Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH<br />
Hindenburgstraße 40<br />
71638 Ludwigsburg<br />
1 Einleitung<br />
Mit Beginn des Betriebes geordneter Deponien wurde schnell erkannt, dass das im Inneren<br />
der Ablagerung entstehende Gas einige Umweltrelevanz hat. Bei angrenzenden Wäldern<br />
starben häufig die ersten Baumreihen ab; Bewohner angrenzender Ortschaften beklagten<br />
üble Fäulnisgerüche; erste einfache aber unablässig brennende Fackeln ließen auf den hohen<br />
Energieinhalt des Gases schließen. Weitergehende Untersuchungen führten zu den Explosionsschutzmaßnahmen,<br />
die heute im gesamten <strong>Deponiegas</strong>bereich selbstverständlich<br />
sind. Die Erkenntnis, dass <strong>Deponiegas</strong> eine erhebliche Klimarelevanz aufweist, ist dagegen<br />
noch relativ jung.<br />
Methan wirkt in der Atmosphäre auf verschiedene Weise, durch die<br />
� Bildung von Wasserdampf in der Stratosphäre<br />
� Förderung des Treibhauseffektes durch Absorption von Wärmestrahlung<br />
� Bildung von oberflächennahem Ozon<br />
Methan ist ein hochwirksames globales Klimagas. Es besitzt ein um den Faktor 21 höheres<br />
Global Warming Potential als die Reverenzsubstanz Kohlendioxid. Betrug die Konzentration<br />
in der Atmosphäre im 18. Jahrhundert noch etwa 800 ppb, liegt sie heute mit 1.750 ppb mehr<br />
als doppelt so hoch. Neben den natürlichen Methanquellen wie Mooren und Regenwäldern<br />
sind Folgewirkungen der Bevölkerungsexplosion, wie die Verbrennung von Erdgas, der<br />
Reisanbau, die Massentierhaltung und die Müllablagerung zu den Hauptquellen der Methanbelastung<br />
geworden (1).
Bild 1: Methanquellen (Grafik: Universität Erlangen (1))<br />
Es wird deutlich, dass eine möglichst effiziente Deponieentgasung ein wesentlicher Beitrag<br />
zum Umweltschutz ist, der standortnah zur Verringerung von Geruchsemissionen und Waldschäden<br />
und global zur Verringerung des Treibhauseffektes führt. Die in Deutschland entwickelte<br />
moderne Entgasungstechnik findet inzwischen auch international Anwendung, so dass<br />
inzwischen nicht nur in unserem Land gegen diese Form der Umweltbelastung vorgegangen<br />
wird.<br />
Die Technische Anleitung Siedlungsabfall (TASi, (2)) enthält Vorschriften, die zur Zwangsentgasung<br />
und Gasverwertung beim Betrieb von Mülldeponien anleiten.<br />
Ziffer 10.6.5.2 TASi: „Gas“<br />
„Sofern ... signifikante Gaskonzentrationen gemessen werden oder ... mit der Entstehung<br />
von <strong>Deponiegas</strong> zu rechnen ist, sind geeignete Einrichtungen zur Fassung und Verwertung<br />
des anfallenden Gases einzusetzen. ... Ist mit <strong>Deponiegas</strong> zu rechnen, sind Einrichtungen<br />
für <strong>Deponiegas</strong>messungen und Gaspegel zur Emissionsüberwachung vorzusehen.“<br />
Das <strong>Deponiegas</strong> – ein Gemisch aus Methan, Kohlendioxid, Stickstoff und Spurengasen: Ist<br />
es eine lästige Begleiterscheinung des Deponiebetriebes? Oder eine Beeinträchtigung des<br />
Wohls der Allgemeinheit? Auf jedenfall eine umweltrelevante Emission, die zu entsprechenden<br />
Regelungen in der TASi und der Deponieverordnung (DepV, (3)) geführt hat.<br />
2 <strong>Vergangenheit</strong><br />
Im Landkreis Ludwigsburg wurde bereits Ende der 70iger Jahre intensive Überlegungen angestellt,<br />
dass aus der Deponie „Am Lemberg“, bei Ludwigsburg-Poppenweiler, austretende<br />
<strong>Deponiegas</strong> zunächst zu fassen, es zu verbrennen und anschließend auch einer energetischen<br />
Nutzung zuzuführen (4). Vorausgegangen war ein Antrag der Universität Stuttgart an<br />
den Bundesminister des Innern auf eine „Forschungszuwendung bezüglich Untersuchungen<br />
zu den Themenbereichen Entstehung, Ausbreitung und Erfassung von Zersetzungsgasen
aus Abfallablagerungen, <strong>Deponiegas</strong>verwertung und Müllfaulung im Labormaßstab (4).“ Allerdings<br />
fanden zunächst die beiden letzten Punkte noch keine Zustimmung, sie wurden erst<br />
später aktuell. Die Forschungsarbeiten, die im Jahre 1977 auf der Deponie "Am Lemberg"<br />
begannen und vom Umweltbundesamt begleitet wurden, zeigten aber sehr rasch unter anderem<br />
folgende zwei wichtigen Dinge:<br />
� dass die Deponie wegen der Gasemissionen und den dadurch verursachten Schäden<br />
am Wald und der Bepflanzung sowie den auftretenden Gerüchen entgast werden<br />
muss<br />
� und dass sie der Menge und Qualität nach so gutes Gas liefert, dass eine Verwertung<br />
ins Auge gefasst werden könnte.<br />
Der Landkreis Ludwigsburg, der die bisherigen Arbeiten der Universität Stuttgart bereits tatkräftig<br />
unterstützte, bat die Universität 1979, Vorschläge für eine Entgasung zu unterbreiten<br />
und die ersten Schritte zu einer möglichen Verwertung des <strong>Deponiegas</strong>es in die Wege zu<br />
leiten.<br />
Die ersten technischen Entgasungsanlagen auf der Deponie „Am Lemberg“ wurden bereits<br />
ab 1979 bautechnisch realisiert, das noch heute betriebene Maschinenhaus der Entgasungsanlage<br />
wurde 1982 fertig gestellt. Seinerzeit fanden sich nur zwei Firmen, die sich diesen<br />
Aufgaben stellten – die Firmen Roediger und die Büro für Kies + Abfall AG. Auf der Deponie<br />
„Burghof“ wurde im gleichen Jahr, 1982, eine Projektstudie zur zukünftigen Deponieentgasung<br />
durchgeführt.<br />
Beschäftigt man sich mit einem Rückblick über die Deponieentgasung, muss man auf die<br />
diesbezüglichen wesentlichen Grundlagenarbeiten von Gerhard Rettenberger hinweisen, der<br />
hierüber ab 1977 am Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft der<br />
Universität Stuttgart Forschungsarbeiten aufgenommen und dabei wesentliche Grundlagenarbeiten<br />
erstellt hat (6, 7). Über die Ergebnisse wurde u.a. im Juli 1986 im Auftrag des Bundesministers<br />
für Forschung und Technologie im FuE-Bericht „Gasabsauge- und Gasverwertungsanlagen<br />
an Mülldeponien - Anleitung zur <strong>Entwicklung</strong> sicherheitstechnischen Konzepte“<br />
(6) ausführlich berichtet. Diesem Basiswerk von Rettenberger folgten zahllose <strong>weitere</strong> Berichte<br />
sowie ganze Kolloquien, die der <strong>Deponiegas</strong>nutzung, der Emissionsminimierung und<br />
der <strong>Entwicklung</strong> neuer Technologien gewidmet waren.
Sicherlich ist es ein besonderer Verdienst von Rettenberger und Stegmann, an diesem Thema<br />
kontinuierlich weitergearbeitet zu haben. Dabei wurde die Fachwelt und hier insbesondere<br />
die Deponiebetreiber und der Anlagenbau auch über neue Erkenntnisse informiert und auf<br />
diese Weise zu dem heute gegebenen hohen Standard von <strong>Deponiegas</strong>anlagen für große<br />
und kleine Gasvolumenströme beigetragen.<br />
Bild 2: Erste Gasfackel auf der Deponie „Am Lemberg“,<br />
Typ Eigenbau.<br />
Der weite Bogen des Themas ergibt sich aus den<br />
folgenden wenigen Daten der Entgasung der Deponie<br />
„Am Lemberg“:<br />
Erste Entgasungsversuche und Oberflächenemissionsmessungen<br />
wurden von Rettenberger in den<br />
Jahren ab 1977 vorgenommen. Etwa ab 1983<br />
wurden aus der Deponie rund 1.500 m³ Gas pro<br />
Stunde abgesogen und damit 3 Motoren sowie die<br />
Heizanlage einer benachbarten Großgärtnerei beliefert.<br />
Die Gasabnahme durch die Gärtnerei konnte<br />
15 Jahre lang betrieben werden, bis sie auf Grund<br />
des Rückganges der Gasmenge der 1989 stillgelegten<br />
Deponie dann aus wirtschaftlichen Erwägungen<br />
eingestellt werden musste. Inzwischen liegt die Gasmenge der Deponie „Am Lemberg“<br />
bei rund 200 m³/h. Es ist absehbar, dass die Gasmengen mittelfristig weiter zurückgehen<br />
werden und bei unterschreiten der Mindestgasmenge für den kontrollierten Betrieb des letzten<br />
Gasmotors und später einer Hochtemperaturgasfackel dann<br />
� die Umstellung auf einen „Schwachgasbetrieb“ zur kontrollierten Deponieentgasung<br />
� oder die Umstellung auf die Belüftung der Deponie<br />
vorgenommen werden muss. Obwohl heute der Betrieb der Deponie stillgelegt ist, entstehen<br />
damit auf Dauer <strong>weitere</strong> Kosten, die in der Nachsorgekostenberechnung abgebildet sind und<br />
damit das Budget darstellen, das für die zukünftige kontrollierte Deponieentgasung zur Verfügung<br />
steht.<br />
Aus der Chronologie der Deponieentgasungsanlage (Anlage 1) der Deponie „Burghof“, bei<br />
Vaihingen/Enz-Horrheim, wird deutlich, dass die installierte Technik einer Entgasungsanlage<br />
einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen ist. Dies ist angesichts der Dynamik des<br />
Gasentstehungsprozesses, mit seinen verschiedenen Einflussfaktoren und seinem mathematisch<br />
beschreibbaren Anschwellen und Abschwellen der Gasmengen in den verschiedenen<br />
Betriebsphasen nicht verwunderlich.
• November 1982 Erstellung einer Projektstudie zur Deponieentgasung<br />
• Dezember 1985 Errichtung des <strong>Deponiegas</strong>kraftwerkes mit 2 Motoren<br />
• September 1990 Ergänzung des Kraftwerkes um einen 3. Motor<br />
• Mai 1999 Austausch der alten Gasfackel gegen eine moderne<br />
Hochtemperaturfackel<br />
• Oktober 2004 Ergänzung des Kraftwerkes um einen 4. Motor<br />
Der Landkreis Ludwigsburg und später die <strong>AVL</strong> haben seit Inbetriebnahme der Deponie<br />
„Burghof“ rund 2,94 Mio. Euro in die Entgasungstechnik investiert. Hierin sind die erforderlichen<br />
hohen Investitionskosten in das Gaskraftwerk und die dort betriebenen Motoren nicht<br />
enthalten. Der Landkreis Ludwigsburg hat sich bereits 1983 für ein reines Betreibermodell für<br />
die Gasverstromung entschieden, so dass die Leistungsverpflichtungen des Landkreises mit<br />
der Übergabe des <strong>Deponiegas</strong>es am Gaskraftwerk enden. Betreiber war ursprünglich die<br />
Neckarwerke AG, heute in deren Nachfolge die EnBW AG.<br />
3 <strong>Bestand</strong><br />
3.1 Der <strong>Bestand</strong> auf der Deponie „Burghof“<br />
Entgasungsanlagen sind heute komplexe Einrichtungen, die aus einer Vielzahl von einzelnen<br />
Elementen bestehen. Die nachfolgende Kurzbeschreibung der Entgasungseinrichtung der<br />
Deponie „Burghof“ macht dies deutlich:<br />
Entgasungssystem aktive Entgasung,<br />
Absaugung des gefassten Gases mittels Gebläse.<br />
Gasfassungssysteme Gasbrunnen, Gasdrainagen<br />
Anzahl 81 (gesamt)<br />
Davon angeschlossene Gasbrunnen derzeit 63<br />
Davon angeschlossene Gasdrainagen 6 Gasdrainagen, 12 Sickerwasserdrainagen<br />
Gassammelsystem zum Teil Einzelanschluss der Gasbrunnen,<br />
System mit derzeit 5 Unterstationen<br />
(dezentrale Gassammelstellen).<br />
Verdichterstation 2 Drehkolbengebläse mit einer max. Förderleistung<br />
von je ca. 1.000 m³/h für die motorische Verwertung<br />
und die Fackelanlage.<br />
Gasbehandlung Hochtemperaturverbrennung,<br />
Fackelanlage mit max. Durchsatz von 1.000 m³/h.<br />
Gasverwertung Mit 4 Gasmotoren, insgesamt ca. 2,0 MW;<br />
Gasabnahme max. ca. 1.400 m³/h;<br />
Anlage im Besitz der EnBW AG<br />
Die Entgasungs- und Verstromungsanlage wird in der Zwischenzeit 20 Jahre betrieben. Im<br />
Frühjahr 2005 wurde die Grenze von 100 Mio. kWh erzeugter elektrischer Leistung überschritten.<br />
Während des 20jährigen Betriebes wurde eine durchschnittliche elektrische Leistung<br />
zur Versorgung von 1.300 Haushalten erzeugt. Die aktuell installierte Leistung liefert die
elektrische Energie für 3.000 Haushalte. Es wird dabei deutlich, dass die <strong>Deponiegas</strong>verwertung<br />
einen sinnvollen, wenn auch bescheidenen ökologischen Nutzen hat.<br />
Vor diesem Hintergrund ist auch ein Hinweis auf die Vergütungsregelungen nach dem Gesetz<br />
der Neuregelung des Rechts der erneuerbaren Energien im Strombereich (EEG, (8))<br />
erforderlich. In dem im April 2004 in Kraft getretenen Gesetz wird in § 7 u. a. die Vergütung<br />
für Strom aus <strong>Deponiegas</strong> geregelt. Die Vergütung beträgt bei einer Leistung bis zu 500 kW<br />
mindestens 7,67 Cent/ kWh und bis einschließlich 5 MW mindestens 6,65 Cent/kWh. Der<br />
Mindestvergütungssatz erhöht sich um 2 Cent/kWh, wenn das eingespeiste Gas auf Erdgasqualität<br />
aufbereitet worden ist oder der Strom mittels Brennstoffzellen, Gasturbinen oder anderen<br />
speziellen Verstromungsanlagen mit höheren Wirkungsgraden gewonnen wird.<br />
Mit dieser Regelung ist auch dauerhaft eine interessante Rückvergütung für die Erzeugung<br />
von elektrischer Energie auf Deponien möglich, die nach unseren Erfahrungen jedoch nicht<br />
die Gesamtkosten des gesetzlich vorgeschriebenen Betriebes der Zwangsentgasungsanlagen<br />
der Deponien decken kann. Immerhin stellt dies jedoch einen wesentlichen Beitrag zur<br />
Kostendämpfung in diesem Betriebsbereich dar.<br />
Bild 3: Ausschnitt aus einem Bericht der Kornwestheimer Zeitung vom 12.03.2005
3.2 Kosten der Deponieentgasung<br />
In der <strong>AVL</strong>-Buchhaltung werden die Kosten der Deponieentgasung der Deponie „Burghof“<br />
separat und differenziert geführt. Während des 5-Jahreszeitraumes 2000-04 ergaben sich<br />
folgende durchschnittliche Jahreskosten:<br />
Kostenstelle<br />
Durchschnittliche Jahreskosten<br />
Zeitraum 2000 – 2004 ohne Mwst.<br />
mittlere Gesamtkosten pro Jahr 155.700 €/a<br />
Abschreibungen 69.300 €/a<br />
Personalaufwand 33.000 €/a<br />
Baukosten an der Entgasungsanlage 27.400 €/a<br />
Instandhaltung und Wartung 16.100 €/a<br />
Versicherungen 7.500 €/a<br />
Sonstiger Aufwand 2.400 €/a<br />
Um vergleichbare Kenngrößen angeben zu können, werden die Betriebskosten auf das Deponievolumen<br />
und auf die Gasmengen bezogen.<br />
Im Zeitraum 2000-04 waren auf der Deponie „Burghof“ im Mittel ca. 4,45 Mio m³ Abfälle abgelagert.<br />
Daraus ergeben sich spezifische Betriebskosten in Höhe von 3,5 ct/m³ Deponievolumen<br />
für den Betrieb der Entgasungsanlage. Im gleichen Zeitraum wurden im Mittel jährlich<br />
7,39 Mio. m³ <strong>Deponiegas</strong> abgesaugt. Die spezifischen Betriebskosten ergeben sich damit zu<br />
2,1 ct/m³ abgesaugtes Gas.<br />
7.500 €/a<br />
69.300 €/a<br />
16.100 €/a<br />
27.400 €/a<br />
2.400 €/a<br />
33.000 €/a<br />
Deponiebaukosten<br />
sonstiger Aufwand<br />
Personalaufwand<br />
Abschreibungen<br />
Versicherungen<br />
Instandhaltung, Wartung<br />
Bild 4: Durchschnittlicher jährlicher Betriebsaufwand der Entgasungsanlage Burghof.<br />
Daten 2000 – 2004, ohne Mwst.
Der Betreibervertrag für die Gasverwertungsanlage Burghof wurde im November 1984 für<br />
die Dauer von 25 Jahren abgeschlossen. Sicher war der Landkreis Ludwigsburg seinerzeit<br />
einer der ersten Kreise, der ein solches Projekt realisiert hat. Aus dieser Historie erklärt es<br />
sich, dass die Erlöse für die Gasübergabe nicht auf dem heutigen Niveau des EEG liegen.<br />
Allerdings muss dabei auch berücksichtigt werden, dass dem Landkreis für die Verwertungsanlage<br />
keine Investitionskosten und keinerlei Kosten für Wartung und Instandhaltung entstehen.<br />
Im o.g. Zeitraum wurden Erlöse von durchschnittlich 82.200 € pro Jahr oder 1,6 ct/m³<br />
verwertetes Gas erzielt. Zudem beteiligte sich die EnBW an den Stromkosten der Verdichter,<br />
so dass sich das Ergebnis noch um etwa 10 % verbessert.<br />
Die Betriebskosten von etwa 155.700 €/a sind etwa 90 % höher als unsere derzeitigen mittleren<br />
Erlöse. Die Kostendifferenz hat unter anderem die Ursache, dass ein Teil des erfassten<br />
Gases dann abgefackelt wird, wenn nicht die volle Motorenleistung zur Verfügung steht. Der<br />
„alte“ Verwertungsvertrag sieht hierfür keine Ausgleichszahlungen des Betreibers vor.<br />
Im Herbst 2004 wurde auf der Deponie inzwischen der vierte Motor in Betrieb genommen.<br />
Mit diesem Motor wird eine wesentliche Leistungssteigerung möglich sein. Deponieseitig hat<br />
der Motor keine finanziellen Auswirkungen auf das Betriebsgeschehen, so dass für das laufende<br />
Betriebsjahr eine Angleichung von Betriebsausgaben und Erlösen aus der Entgasung<br />
erfolgen wird.<br />
3.3 Laufende betriebliche Maßnahmen<br />
Die ständige betriebliche Unterhaltung der umfangreichen Entgasungsanlage der Deponie<br />
„Burghof“ macht es erforderlich, dass ein Mitarbeiter hierfür speziell geschult wird und ihm<br />
die für die Betreuung der Anlage notwendige Zeit zur Verfügung steht. Zur Effizienzsteigerung<br />
seiner Tätigkeit ist inzwischen das Datenverarbeitungssystem der Deponie auf den<br />
Stand gebracht worden, dass der Mitarbeiter auch einen Einblick über einen Laptop hat,<br />
wenn er sich nicht am Arbeitsplatz aufhält.<br />
Neben den ständigen Arbeiten im Zusammenhang mit den routinemäßigen Gasmessungen<br />
und Einregulierungen der Gaserfassungsstellen werden folgende regelmäßige Überprüfungen<br />
durchgeführt:<br />
� Überprüfung der Wirksamkeit der Entgasung nach TASi<br />
� Wartungsarbeiten an den Entgasungsanlage gemäß GUV R 127<br />
o Verdichterstation<br />
o Fackelanlage<br />
o Kondensatschächte<br />
� Ortsfeste elektrische Einrichtungen der Entgasungsanlage<br />
� Ortsveränderliche Elektrogeräte der Entgasungsanlage<br />
� Hochtemperatur-Abfackelungsanlage<br />
� Stationäre und mobile Gaswarngeräte und Gasmessgeräte<br />
Die Wirksamkeit der Entgasung wird in Anlehnung an die Empfehlungen des Leitfadens zur<br />
Überwachung des Betriebes von Siedlungsabfalldeponien des Ministeriums für Umwelt und<br />
Verkehr Baden-Württemberg (9) durchgeführt.
Im Rahmen des laufenden Betriebes wurde der bestehende Ex-Zonen-Plan der Deponie im<br />
Oktober 2004 als zeitgemäßes Explosionsschutzdokument (10) gemäß § 6.2 Betriebssicherheitsverordnung<br />
ausgearbeitet. Aus dem Explosionsschutzdokument geht hervor,<br />
� dass die Explosionsgefährdungen des gesamten Betriebes ermittelt und einer Bewertung<br />
unterzogen wurden;<br />
� dass angemessene Vorkehrungen getroffen wurden, um die Ziele des Explosionsschutzes<br />
zu erreichen;<br />
� welche Bereiche in Ex-Zonen eingeteilt wurden<br />
� und für welche Bereiche Mindestvorschriften gelten.<br />
Die Struktur unseres Explosionsschutzdokumentes orientiert sich am Beispiel-Verzeichnis<br />
gemäß Explosionsschutz-Regeln BGR 104, Kap. E 6. Die Ex-Schutz-relevanten Bereiche<br />
sind im beigefügten Übersichtsplan „Deponie Burghof – explosionsgefährdete Bereiche“ (Anlage<br />
2) dargestellt. Es handelt sich dabei um<br />
� Entgasungseinrichtungen wie Gaskollektoren und -leitungssysteme, Gasunterstationen<br />
und Kondensatschächte;<br />
� Sickerwassererfassungs- und -speichereinrichtungen;<br />
� Flüssiggastank für die Reserve-Heizung des Betriebsgebäudes.<br />
Nachdem das Explosionsschutzdokument erstmals in 2004 grundlegend aufgebaut wurde,<br />
planen wir hier eine jährliche Fortschreibung, um die aktuellen Veränderungen der Entgasungsanlage<br />
im Dokument abzubilden. Nach durchgeführter <strong>Bestand</strong>saufnahme für die Basisversion<br />
stellt die regelmäßige Fortschreibung nur noch einen geringen Aufwand dar.<br />
3.4 Temporäre Abdeckungen<br />
Zum <strong>Bestand</strong> der Deponieausrüstungen gehören heute meist auch temporäre Oberflächenabdeckungen<br />
oder bereits TASi-gleichwertige Abdichtungen, zumindest auf Teilflächen. Die<br />
Vorgaben der DepV zwingen alle Deponiebetreiber zum Aufbringen von Abdichtungen. Nach<br />
dem Wortlaut von § 14.7 DepV ist die Oberflächenabdichtung unmittelbar nach dem Abklingen<br />
der Hauptsetzungen herzustellen.<br />
Die Abdeckungen und Abdichtungen haben zum Hauptziel, den Wassereintrag in den Deponiekörper<br />
zu verringern oder zu unterbinden, um damit die Entstehung des behandlungsbedürftigen<br />
Sickerwassers zu reduzieren und den klimarelevanten Austritt von <strong>Deponiegas</strong> einzudämmen.<br />
Aus eigenen Erfahrungen kann berichtet werden, dass mit dem Aufbringen einer<br />
großflächigen temporären Abdeckung auf der Deponie "Burghof" die Oberflächenemissionen<br />
zurück gegangen sind. Dies wird deutlich, wenn man die Ergebnisse der FID-Messungen an<br />
der Deponieoberfläche vor und nach dem Aufbringen der Folie auswertet. Dies zeigt sich<br />
aber auch sehr deutlich an der Verringerung des Einflusses der Deponie auf den benachbarten<br />
Wald und konkret an der Verringerung der dort erkennbaren Pflanzenschäden.<br />
Die Abdeckung, und noch viel mehr die Abdichtung, stellt aber einen massiven Eingriff in den<br />
Wasserhaushalt der Deponie dar. Die für den biologischen Abbau verantwortlichen Mikroorganismen<br />
benötigen für ihre Stoffwechselprozesse ein hinreichend großes Wasserangebot<br />
und stellen bei Unterschreitung von Mindestmengen ihren Stoffwechsel ein.
Collins (in 11) gibt einen Verbrauch von etwa 50 – 125 l/Mg TM an. Dies entspricht unter der<br />
Annahme, dass je Mg Abfall ca. 75 m³ Gas entstehen, einem Verbrauch von 0,12 l Wasser/m³<br />
Gas. Auch Bräcker (in 11) führt einen spezifischen Bedarf von etwa 0,15 l/m³ Gas an.<br />
Ein ausreichender Wassergehalt im Deponiekörper ist für die biochemischen Prozesse der<br />
Gasproduktion erforderlich, da nur gelöste Stoffe bioverfügbar, d.h. den Mikroorganismen<br />
direkt zugänglich sind. Daneben kommt der Transportfunktion des Wassers in Deponien eine<br />
wesentliche Bedeutung zu, da der Deponiekörper als biochemischer Festbettreaktor betrachtet<br />
werden muss. Die gleichmäßige Verteilung der Nährstoffe für die Mikroorganismen kann<br />
also nicht durch eine aktive Durchmischung des Reaktorinhalts sichergestellt werden. Nur<br />
durch die hinreichende Durchspülung des „Reaktors“ Deponie werden die Nährstoffe zu den<br />
Mikroorganismen geleitet. Daneben ist das Wasser am Metabolismus auch unmittelbar beteiligt.<br />
Die praktischen Auswirkungen von weitgehend dichten Deponieabdeckungen haben verschiedene<br />
Betreiber bereits am Rückgang der <strong>Deponiegas</strong>mengen festgestellt. Der Umgang<br />
mit diesem vorhersehbaren Effekt ist eine Sache der jeweiligen Betriebsphilosophie. Es ist<br />
jedoch eine Tendenz dazu erkennbar, dass Deponiebetreiber eine Fortsetzung des Entgasungsbetriebes<br />
anstreben, um<br />
� die Investitionen in die Entgasungstechnik und Gasverwertung weiter nutzen zu können,<br />
� die Deponieentgasung in einem überschaubaren Zeitraum kontrolliert bis in die Phase<br />
der Abschaltung der Aktiventgasung (siehe Ziffer 4.1 und DepV) zu führen,<br />
� zum Schutz der späteren Oberflächenabdichtung die Setzungen durch den biologischen<br />
Abbau zeitnah herbeizuführen.<br />
An zwei Beispielen werden nachfolgend die Auswirkungen von Abdichtungen und Abdeckungen<br />
dargestellt:<br />
3.4.1 Deponie Dreieich-Buchschlag, Frankfurt am Main<br />
Die Deponie wurde 1968 von der Stadt Frankfurt/M. übernommen und bis 1991 als Hausmülldeponie<br />
betrieben. Abgelagert wurden etwa 15 Mio. m³ Siedlungsabfälle. Die Entgasungseinrichtungen<br />
wurden ab 1989 eingebaut, die Gasaufbereitung und -verwertung in einem<br />
Heizkraftwerk wurde ab 1990 realisiert. Parallel dazu wurden Maßnahmen zur Oberflächenabdichtung<br />
von 1988 bis 1995 ausgeführt. Von März 1992 bis Juni 2002 wurde das aufbereitete<br />
<strong>Deponiegas</strong> über eine Fernleitung zum Heizkraftwerk Niederrad gefördert. In diesem<br />
Zeitraum konnten mehr als 160 Millionen m³ <strong>Deponiegas</strong> verwertet werden. Seit Juli<br />
2002 wird das erfasste <strong>Deponiegas</strong> mit drei Gasmotoren/Generator-Modulen (3 x 250 kWel)<br />
auf der Deponie verwertet.<br />
Aus dem folgenden Diagramm (Bild 5) wird die Abnahme der zum HKW Niederrad geförderten<br />
Gasmenge ersichtlich, die insbesondere im Zusammenhang mit der seit 1989 begonnenen<br />
und 1995 beendeten Oberflächenabdichtung zu beurteilen ist.<br />
Aus dem Vergleich der Prognosemengen mit den Ist-Gasmengen wird deutlich, dass in den<br />
Jahren ab 1993 die geförderte <strong>Deponiegas</strong>menge zum HKW-Niederrad nahezu halbiert ist.<br />
Heinz (12) führt diesen Sachverhalt im Wesentlichen auf die Unterbrechung des Feuchtigkeitstransportes<br />
aufgrund der Oberflächenabdichtung zurück. Aufgrund der Ist-Gasmengenabnahmen<br />
von bis zu 20% zur Vorjahresmenge, wurde sehr schnell deutlich, dass durch die
Abdichtung in die Deponie immer weniger Feuchtigkeit eintritt und damit die Gasproduktion<br />
massiv behindert wird.<br />
<strong>Deponiegas</strong>menge zum HKW - Niederrad in m3 pro Jahr<br />
60.000.000<br />
50.000.000<br />
40.000.000<br />
30.000.000<br />
20.000.000<br />
10.000.000<br />
0<br />
Gasmengenentwicklung seit 1992 bis 2004 und Prognosemengen bis Ende 2007<br />
1992<br />
1993<br />
Gasprognosemenge zum HKW - Niederrad<br />
IST - Gasmenge zum HKW - Niederrad<br />
1995<br />
Beendigung der<br />
Oberflächenabdichtungsarbeiten<br />
1994<br />
1995<br />
1997/98<br />
Beginn der<br />
Rückbefeuchtungsversuche<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
Umbauphase auf<br />
Verstromungsbetrieb<br />
2002<br />
Beendigung des<br />
Lieferbetriebs zum<br />
HKW - Niederrad<br />
Bild 5: Gasmengenentwicklung der Deponie Dreieich-Buchschlag, Frankfurt/M., (12).<br />
2002<br />
2003<br />
2002<br />
Beginn der <strong>Deponiegas</strong>verstromung<br />
mit 3 Gasmotor/Generator - Modulen<br />
Ab dem Zeitpunkt 1997/98 wurde bereits mit einem Rückbefeuchtungsversuch (über eine<br />
Horizontalrigole der Gaserfassung) begonnen. Dieser Versuch wurde 1998 abgeschlossen,<br />
da festgestellt wurde, dass über die Gasrigole nur sehr geringe Wassermengen in den Deponiekörper<br />
versickert werden können. 1999 wurde der Rückbefeuchtungsversuch um ein<br />
Lanzenfeld mit Versickerungslanzen erweitert. Ab 2001 wurde der Versuch nochmals um<br />
einige, speziell ausgerüstete Gasbrunnen sowie mit der Erweiterung des Lanzenfeldes, ergänzt.<br />
Heinz erläutert in seinem Bericht, dass die Rückbefeuchtung mit Sickerwasser zu einer<br />
Stabilisierung der <strong>Deponiegas</strong>produktion geführt hat.<br />
3.4.2 Deponien im Landkreis Ravensburg<br />
Im Landkreis Ravensburg werden die Deponien Gutenfurt und Obermooweiler betrieben.<br />
Nach Mitteilung des Betreibers (13) kann ein konkreter Bezug zwischen der <strong>Deponiegas</strong>mengenentwicklung<br />
und der Zwischenabdeckung der Deponien mit Folie nur schwer abgeleitet<br />
werden.<br />
In der Deponie Gutenfurt (Bild 6, obere Grafik) wurde 1994 mit dem Aufbringen der Folienabdeckung<br />
begonnen. Der vorübergehende Rückgang in 1994 ist jedoch auf einen Umbau<br />
an der Entgasungsanlage zurückzuführen. Der untere Verlauf beschreibt die Gasmengen in<br />
der Deponie Obermooweiler ab 1991. Hier begann die Folienaufbringung bereits 1993. Der<br />
Rückgang der Gasmenge ist in dieser Deponie deutlicher erkennbar.<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007
Gasmenge ges. in Mio<br />
[Nm³/j]<br />
8,000<br />
7,000<br />
6,000<br />
5,000<br />
4,000<br />
3,000<br />
2,000<br />
1,000<br />
0,000<br />
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04<br />
Gasmenge ges. in Mio [ Nm³/ j] 7,293 6,473 5,766 6,056 4,652 4,000 3,756 2,120 2,874 2,459 1,961 1,413 1,235 1,189 1,135 1,110 1,007 1,102<br />
Gasmenge ges. in Mio<br />
[Nm³/j]<br />
2,000<br />
1,500<br />
1,000<br />
0,500<br />
0,000<br />
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04<br />
Gasmenge ges. in Mio [Nm³/j] 1,92 1,26 0,50 0,97 0,58 0,44 0,47 0,28 0,23 0,14 0,15 0,11 0,18 0,18<br />
Bild 6: <strong>Entwicklung</strong> der Gasmenge in den Deponien im Landkreis Ravensburg<br />
Oben: Deponie Gutenfurt, 1987–2004. Unten: Deponie Obermooweiler, 1991–2004, (13).<br />
3.4.3 Befeuchtung von Deponien<br />
Es ist naheliegend, dass Deponiebetreiber, die das Aufbringen einer Abdichtung nicht zeitlich<br />
verschieben können, Maßnahmen zur Befeuchtung von Deponien unterhalb der Oberflächenabdichtung<br />
erwägen. Wenngleich diese Vorgehensweise einer gewissen Schizophrenie<br />
nicht entbehrt, sind doch inzwischen in § 14.8 DepV die dafür erforderlichen Rechtsgrundlagen<br />
gelegt worden. Demnach kann die zuständige Behörde zur Beschleunigung biologischer<br />
Abbauprozesse und zur Verbesserung des Langzeitverhaltens von Deponien, auf denen<br />
Siedlungsabfälle mit hohen organischen Anteilen abgelagert worden sind, eine gezielte Befeuchtung<br />
des Abfallkörpers durch Infiltration von Wasser oder deponieeigenem Sickerwasser<br />
zulassen, wenn geeignete Voraussetzungen vorhanden sind und mögliche nachteilige
Auswirkungen auf den Deponiekörper und die Umwelt verhindert werden. Zu den Voraussetzungen<br />
gehören insbesondere:<br />
1. qualifizierte Basisabdichtung,<br />
2. funktionierendes Sickerwasserfassungssystem,<br />
3. funktionierendes aktives Entgasungssystem,<br />
4. Oberflächenabdichtung oder temporäre dichte Abdeckung,<br />
5. relevante Mengen noch abbaubarer organischer Substanz im Deponiekörper,<br />
6. Einrichtungen zur geregelten und kontrollierten Infiltration und zur Kontrolle des Gas- und Wasserhaushalts<br />
der Deponie und der Begrenzung der Infiltrationsmengen auf das notwendige<br />
Maß,<br />
7. Nachweis der ausreichenden Standsicherheit des Deponiekörpers, auch unter Berücksichtigung<br />
der zusätzlichen Wasserzugaben.<br />
Nach unseren eigenen Erfahrungen zeigt sich zumindest das Regierungspräsidium Stuttgart<br />
bei der Zulassung einer Sickerwasser-Infiltration sehr zurückhaltend. Im Antragsfall würde<br />
die Behörde gutachterliche Aussagen zur Erfüllung aller sieben Voraussetzungen für den für<br />
die Infiltration in Erwägung gezogenen Deponieteil fordern und auch nur die Einbringung der<br />
Wassermenge zulassen, die für die Steigerung der Stoffwechselvorgänge nachweislich erforderlich<br />
ist.<br />
4 Weitere <strong>Entwicklung</strong><br />
4.1 Maßnahmen nach der Deponiestilllegung<br />
Nach den Regelungen der TASi bedürfen Deponien der Nachsorge. Die Nachsorgephase<br />
beginnt nach der Schlussabnahme der stillgelegten Deponie durch die zuständige Behörde.<br />
In der Nachsorgephase sind insbesondere Langzeitsicherungsmaßnahmen durchzuführen<br />
zu dokumentieren.<br />
In § 13 Abs. 5 DepV werden die Anforderungen an die Nachsorge weiter konkretisiert. Hier<br />
ist insbesondere festgelegt, welche Kriterien zur Feststellung des Abschlusses der Nachsorgephase<br />
erfüllt sein müssen. Mit Blick auf das <strong>Deponiegas</strong> sind relevant:<br />
� Biologischer Abbauprozesse, sonstige Umsetzung oder Reaktionsvorgänge sind weitgehend<br />
abgeklungen.<br />
� Eine Gasbildung ist soweit zum Erliegen gekommen, dass keine aktive Entgasung erforderlich<br />
ist und schädliche Einwirkungen auf die Umgebung durch Gasmigrationen<br />
ausgeschlossen werden können.<br />
� Setzungen sind soweit abgeklungen, dass verformungsbedingte Beschädigungen des<br />
Oberflächenabdichtungssystems für die Zukunft ausgeschlossen werden können.<br />
Alle 3 Aspekte sind unmittelbar oder mittelbar in Verbindung mit der Entstehung von <strong>Deponiegas</strong><br />
in der Deponie zu sehen. Bei der Ermittlung von Folgekosten eines Deponiebetriebes<br />
ist es deshalb unumgänglich, auch die Kosten der <strong>weitere</strong>n Entgasung nach Abschluss des<br />
Deponiebetriebes zu ermitteln. Maßgebliche Größe dabei ist die Dauer der Gasentstehung.
Bei der Folgekostenberechnung für die Deponien im Landkreis wird dieser Berechnung jeweils<br />
eine aktuelle Gasprognose zugrunde gelegt. Dabei wurde festgelegt, dass der gebührenrechtlich<br />
relevante Nachsorgezeitraum 3 Jahre nach dem Rückbau der Aktiventgasung<br />
endet. Hieraus ergibt sich für die Deponie „Am Lemberg“ ein finanztechnischer Nachsorgezeitraum<br />
von 28 Jahren, gemessen am Verlauf der Gasprognose, die 1999 aktualisiert wurde.<br />
Dieser Zeitraum stimmt gut mit der Vergabe aus der Deponieverordnung überein, die für<br />
die Berechnung der Sicherheitsleistung einen Zeitraum von 30 Jahren vorgibt. Für den Siedlungsabfallteil<br />
Deponie „Burghof“ wird hierfür ein Zeitraum von 30 Jahren zugrunde gelegt.<br />
Für die Berechnungen werden aktuelle Kostenansätze herangezogen. Die Ansätze beruhen<br />
auf konkreten Werten der <strong>AVL</strong> oder anderer Deponiebetreiber, die beispielsweise von Ausschreibungsergebnissen<br />
herrühren. Bei einzelnen Fragestellungen, bei denen solche Werte<br />
nicht vorliegen, werden Erfahrungswerte eines beauftragten Gutachters eingesetzt.<br />
Nach uns aktuell vorliegenden Daten ergeben sich folgende spezifische Nachsorgekosten für<br />
die Deponieentgasung in Abhängigkeit vom Deponievolumen (14, 15):<br />
Deponie Deponievolumen Spezifische Nachsorgekosten<br />
A 4.016.000 m³ 0,39 €/m³<br />
„Am Lemberg“ 3.100.000 m³ 0,39 €/m³<br />
B 1.800.000 m³ 0,45 €/m³<br />
„Burghof” 4.980.000 m³ 0,52 €/m³<br />
C 1.000.000 m³ 0,69 €/m³<br />
D 515.000 m³ 1,81€/m³<br />
E 286.000 m³ 1,90 €/m³<br />
Bei diesen Daten wurden die notwendigen Begehungen für die Wirkungskontrollen des Entgasungssystems<br />
inklusive Begehungen und <strong>Deponiegas</strong>untersuchungen, Emissionsmessungen<br />
an den Verbrennungsanlagen sowie Ersatzinvestitionen an Leitungen und Sammelbalken<br />
im Rahmen des Aufbringens der Oberflächenabdichtung sowie für Verdichter und<br />
Gasfackel nebst zugehörigen Kosten für die Planung und Bauüberwachung, für eine Laufzeit<br />
von 30 Jahren berücksichtigt.<br />
In der Gesamtschau der Folgekostenberechnungen im Landkreis Ludwigsburg wird deutlich,<br />
dass die nach der Stilllegung zu erwartenden Kosten für die Entgasung nach der Oberflächenabdichtung<br />
und neben der Sickerwasserbehandlung zu den Hauptkostenfaktoren zu<br />
rechnen sind.<br />
4.2 Betrieb der Entgasung bei geringen Restgasmengen<br />
Nachdem vor 20 Jahren wesentliche Grundlagen geschaffen worden sind, die betriebssichere<br />
Erfassung und Verwertung von <strong>Deponiegas</strong> zu erforschen und technische Anlage zu realisieren,<br />
stellt sich zunehmend die Aufgabe der Restentgasung der Deponien, deren biologische<br />
Aktivität zurückgeht und allmählich zum Erliegen kommt. Diesbezüglich wurden auch in<br />
Baden-Württemberg FuE-Vorhaben durchgeführt. Es wird beispielsweise auf die Arbeiten
von Lehner auf der Deponie Horb-Rexingen zur <strong>Entwicklung</strong> eines Verfahrens zur Minimierung<br />
der Restgasemissionen von Hausmülldeponien und Altablagerungen (16) hingewiesen.<br />
Für die Behandlung von Schwach- und Restgasen aus Hausmülldeponien mit Methangehalten<br />
unter 25 Vol.-% stehen grundsätzlich unterschiedliche Behandlungstechniken zur Verfügung.<br />
Bisher werden Deponie-Schwachgase vorrangig mittels Biofiltern, durch eine Hochtemperaturverbrennung<br />
(Fackel) mit Stützfeuerung oder eine flammenlose nichtkatalytische<br />
Oxidation behandelt. Daneben werden Membranverfahren zur Aufkonzentrierung des Methangehaltes<br />
erprobt. Die katalytisch Schwachgasbehandlung sowie auch die stationäre<br />
Wirbelschichtfeuerung befinden sich noch in der <strong>Entwicklung</strong>sphase.<br />
4.2.1 Membranverfahren<br />
Membranverfahren zur Aufkonzentrierung des Methangehaltes von Deponieschwachgasen<br />
(17) stellen einen, der eigentlichen Behandlung, vorgeschalteten Aufbereitungsschritt dar.<br />
Der Einsatz der Membrantechnik führt zu einem an- sowie einem abgereicherten Produktgas.<br />
Das methanangereicherte <strong>Deponiegas</strong>teilstrom kann im Anschluss an die Vorbehandlung<br />
verwertet bzw. behandelt werden. Das zweite, abgereicherte Produktgas muss wiederum<br />
behandelt werden, was zusätzliche Kosten nach sich zieht. Als Alternative werden derzeit<br />
Versuche zur Rückführung des abgereicherten Permeats in den Deponiekörper durchgeführt.<br />
4.2.2. Katalytische Verfahren<br />
Verfahren zur katalytisch gestützten Behandlung von schwachmethanhaltigen <strong>Deponiegas</strong>en<br />
(18) werden seit einigen Jahren erprobt. So testet die Fa. Pro2 Anlagentechnik seit 2000<br />
eine entsprechende Katalysatoreneinheit. Abschließende Ergebnisse hinsichtlich der Betriebskosten,<br />
des Wirkungsgrades und der Katalysatorstandzeiten liegen uns noch nicht vor.<br />
4.2.3 Wirbelschichtfeuerung<br />
Bei der stationären Wirbelschichtfeuerung wird Deponierestgas und Verbrennungsluft in einem<br />
Reaktor mit Wirbelschicht, bestehend aus einem Inertstoff (z.B. Sand), zur Reaktion<br />
gebracht (19). Für die Verbrennung von Gasen mit geringem Heizwert ist die Wirbelschichtfeuerung<br />
wegen der realisierbaren großen Verweilzeit im Bereich hoher Temperaturen prinzipiell<br />
gut geeignet. Ein <strong>weitere</strong>r Vorteil ist, dass die zur Verbrennung eingesetzten Stoffe<br />
flammenlos verbrannt werden können. Das Verfahren der stationären Wirbelschichtfeuerung<br />
befindet sich derzeit noch in der <strong>Entwicklung</strong>sphase. Bislang liegen nur Laborergebnisse vor.<br />
4.2.4 Flammenloses nichtkatalytisches Verfahren<br />
In der VocsiBox ® der Fa. HAASE Energietechnik, einer flammenlosen, nichtkatalytischen<br />
Oxidation, wird durch einen regenerativen Wärmetauscher das Schwachgas soweit vorgewärmt,<br />
dass in vielen Fällen eine autotherme Verbrennung in Konzentrationsbereichen zwischen<br />
0,3 – 27 Vol-% Methan möglich ist (20).<br />
Das <strong>Deponiegas</strong> wird beim Durchströmen eines heißen Reaktionsbettes oxidiert. Der Betrieb<br />
verläuft nach der Anfahrphase bereits bei sehr geringen Energieinhalten des <strong>Deponiegas</strong>es<br />
autotherm, d.h. ohne <strong>weitere</strong> Energiezufuhr von außen. Es zeichnet sich durch die hohe Reinigungsleistung<br />
für Methan aus. Andere organische Gasbestandteile werden dabei auch mit
oxidiert. Die Anlagentechnik ist inzwischen erprobt und kann individuell an die Bedingungen<br />
der jeweiligen Deponie angepasst werden. Die VocsiBox ® ist ab einem Durchsatz von 500<br />
m³/h verfügbar.<br />
4.2.5 Hochtemperaturverbrennung mit Stützfeuerung<br />
Die Hochtemperaturverbrennung von <strong>Deponiegas</strong>en mittels Fackelanlagen ist seit Jahren<br />
Stand der Technik. Für geringe noch methanreiche Gasmengen stehen Anlagen mit einem<br />
Mindestdurchsatz von 10-20 m³/h zur Verfügung. Bei der Absaugung nur geringer Gasmengen<br />
sinkt der Erfassungsgrad allerdings deutlich ab. Bei CH4-Gehalten unter 27 Vol.-% können<br />
Hochtemperaturfackelanlagen nur mit Hilfe einer Stützfeuerung eingesetzt werden. Die<br />
Verfahrensweise ist daher vergleichsweise kostenintensiv.<br />
4.2.6 Biofilter<br />
Biofilteranlagen werden zur Behandlung von Deponierestgasen bislang hauptsächlich als<br />
passive Systeme eingesetzt. Hierbei werden auf der Deponieoberfläche sog. Entgasungsfenster<br />
aus unterschiedlichen Materialien (Kompost, Holzhackschnitzel, Rindenmulch, etc.)<br />
eingerichtet. Das im Deponiekörper produzierte Restgas soll die Filterschicht aufgrund des<br />
eigenen Überdruckes der Deponie passiv durchströmen.<br />
Vorteile passiv betriebener Biofilter ergeben sich durch sehr niedrige Investitions- und Betriebskosten.<br />
Hinsichtlich des Wirkungsgrades der passiven Systeme zur Methanoxidation<br />
liegen allerdings nur unzureichende Untersuchungsergebnisse vor. Die Durchströmungsverhältnisse<br />
und die Sauerstoffversorgung im Filter bleiben unbeeinflusst und sind u. a. stark<br />
von den Witterungseinflüssen (Luftdruck, Temperatur, Niederschläge, etc.) abhängig.<br />
4.2.7 Verfahrensauswahl<br />
Auf Grund der Vielzahl möglicher Schwachgas-Behandlungsverfahren wird es deutlich, dass<br />
keine Verfahrensempfehlung ausgesprochen werden kann. Vielmehr ist es erforderlich, auf<br />
der Grundlage deponiespezifischer Gegebenheiten (gastechnische Infrastruktur, Verwertungsmöglichkeiten,<br />
Personalverfügbarkeit), das geeignete Verfahren auszuwählen und<br />
hierbei auch die Folgekosten für den meist Jahrzehnte währenden Restbetrieb zu kalkulieren.<br />
Es ist erfreulich festzustellen, dass auf diesem Spezialgebiet der Deponieentgasung<br />
inzwischen Fachbüros tätig sind, die bereits über einige konkrete Erfahrungen verfügen und<br />
fundierte Planungsarbeiten ausführen können. Es wird an der Stelle angeregt, <strong>weitere</strong> Deponietagungen<br />
insbesondere auch diesem Thema zu widmen, um die Kenntnisse über die Verfahrensalternativen<br />
bei den Deponiebetreibern zu vertiefen.<br />
5 Danksagung<br />
Danken möchte ich Herrn Burkhardt (ICP), Herrn Betsch (AWG Rems-Murr-Kreis), Herrn<br />
Dehm (AWB Ravensburg) und Herrn Heinz (Rytec), die mir kollegial aktuelle Betriebsdaten<br />
oder -ergebnisse zur Verfügung gestellt haben, um sie im Rahmen der Fortbildungsveranstaltung<br />
nutzen zu können. Mein besonderer Dank gilt meinem Kollegen Peter Maier, der<br />
bereits am Aufbau der ersten Entgasungsanlagen auf der Deponie "Am Lemberg" beteiligt<br />
war und mit seinem ausgezeichneten Gedächtnis bei der Formulierung des 2. Kapitels ebenso<br />
hilfreich war, wie er in unserem betrieblichen Alltag unentbehrlich ist.
6 LITERATUR<br />
(1) Gasteiger, J., Schunk, A, 2002. Vernetzte Chemie: Methan in der Atmosphäre.<br />
http://www2.chemie.uni-erlangen.de/projects/vsc/chemie-medizinerneu/kohlenwasserstoffe/methan_atmosphaere.html<br />
(2) Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall), Bundesanzeiger<br />
Nr. 99a vom 29.05.1993.<br />
(3) Verordnung über Deponien und Langzeitlager und zur Änderung der Abfallablagerungsverordnung<br />
(DepV). 2002. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 52, Bonn,<br />
29.07.2002.<br />
(4) Schlaitzer, J., 1978. Entgasung der Deponie Poppenweiler. In: Fortschritte in der Deponietechnik.<br />
Stuttgarter Berichte zur Abfallwirtschaft, Band 9. Erich Schmidt Verlag, Bielefeld.<br />
(5) Rettenberger, G.; Ryser, W., 1981. Stand des Gasverwertungsprojektes für die Deponie<br />
"Am Lemberg", Landkreis Ludwigsburg. In: Gewinnung sowie Verwertung von Biogas<br />
aus Abfalldeponien und moderne Methoden zur Sickerwasserbeseitigung. Stuttgarter Berichte<br />
zur Abfallwirtschaft, Band 15. Erich Schmidt Verlag, Bielefeld.<br />
(6) Müller, K.; Rettenberger, G., 1986. Gasabsauge- und Gasverwertungsanlagen an<br />
Mülldeponien – Anleitung zur <strong>Entwicklung</strong> sicherheitstechnischer Konzepte. Ergebnisse des<br />
FuE-Vorhabens 1430293 der Universität Stuttgart im Auftrag des Bundesminister für Forschung<br />
und Technologie.<br />
(7) Rettenberger, G., 2004. Dissertation, Untersuchungen zur Charakterisierung der<br />
Gasphase in Abfallablagerungen. Stuttgarter Berichte zur Abfallwirtschaft, Band 82, Oldenbourg<br />
Industrieverlag GmbH.<br />
(8) Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich<br />
(EEG). 2004. Bundesratsdrucksache 290/04, Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH,<br />
Köln.<br />
(9) Leitfaden zur Überwachung des Betriebes von Siedlungsabfalldeponien, 1999. Ministerium<br />
für Umwelt und Verkehr, Reihe Abfall, Heft 56.<br />
(10) Reiling, W., 2004. Explosionsschutzdokument Deponie Burghof, 2004, im Auftrag der<br />
<strong>AVL</strong> GmbH.<br />
(11) Kabbe, G., Abschlussbericht zum Vorhaben „Möglichkeiten der Infiltration von Wasser<br />
in einen Deponiekörper zur Gewährleistung einer stabilen Gasproduktion und zur Reduzierung<br />
des Emissionspotenzials“, 1999. Institut für Siedlungswasserwirtschaft der Rheinisch-Westfälischen<br />
Technischen Hochschule Aachen.<br />
(12) Heinz, H., <strong>Deponiegas</strong> in der Stilllegungs- und Nachsorgephase am Beispiel der Deponie<br />
Dreieich-Buchschlag, 2005. Rytec GmbH Frankfurt am Main, Flörsheim.
(13) Dehm, D., Abfallwirtschaftsbetrieb Ravensburg, 2005. Persönliche Mitteilung.<br />
(14) Gutachten zur Ermittlung der Folgekosten für die Deponien des Landkreises Ludwigsburg.<br />
03/2003. Erstellt von der ICP Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH<br />
im Auftrag der <strong>AVL</strong> GmbH, Ludwigsburg.<br />
(15) Burkhardt, G., ICP Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH, 2005. Persönliche<br />
Mitteilung.<br />
(16) Lehner, J., 2004. <strong>Deponiegas</strong> – Beschleunigung der Abbauprozesse, Methanoxidationsfilter.<br />
Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg, Heft 77 der Reihe Abfall.<br />
(17) Yüce, S., Gebel, J., 2003. Untersuchung der Schwachgasnutzung mittels Membranverfahren<br />
in der Nachsorgephase von Hausmülldeponien. In: <strong>Deponiegas</strong> 2003 – Stilllegung<br />
und Nachsorge von Deponien, Hrsg. Rettenberger/Stegmann. Verlag Abfall Aktuell, Band 14.<br />
(18) Grundke, M., 2001. Katalytische Entsorgung von schwachmethanhaltigen <strong>Deponiegas</strong>en.<br />
Firmenschrift der Pro2 Anlagentechnik GmbH, Willich.<br />
(19) Steinbrecht, D., Matzmohr, R., Wolff, H.-J., Didik, H., 2003. Entsorgung von heizwertarmen<br />
Deponie-Restgasen mit einer Wirbelschichtfeuerung. In: <strong>Deponiegas</strong> 2003 – Stilllegung<br />
und Nachsorge von Deponien, Hrsg. Rettenberger/Stegmann. Verlag Abfall Aktuell,<br />
Band 14.<br />
(20) Autotherme Oxidation für Abluft und Schwachgase: VocsiBox ® , Firmenschrift der<br />
HAASE Energietechnik AG, Neumünster, 2005.<br />
Auf die Grundlagen der Deponieentgasung wird in diesem Bericht nicht eingegangen. Einen<br />
guten Überblick kann sich der Leser unter anderem in folgenden Quellen verschaffen:<br />
Puscher, H. J., 1995. Die Deponie, Nutzen und Folgen. Fortbildungsveranstaltung des Landkreistags<br />
Baden-Württemberg, Februar 1995.<br />
Eisenlohr, M., 2004. Deponieentgasung, Betrieb, Stilllegung, Nachsorge – technische Bereiche,<br />
betriebliche Sicherung. Fortbildungsveranstaltung nach Deponieverordnung des Landkreistags<br />
Baden-Württemberg, Mai 2004.
Anlage 1<br />
Auszug aus der Chronologie der Deponieentgasung der Deponie "Burghof"<br />
November 1982 Erstellung einer Projektstudie über die Erfassung und Verwertungsmöglichkeiten<br />
von <strong>Deponiegas</strong><br />
Oktober 1983 Inbetriebnahme der Gasabfackelungsanlage und der Gasstation 1a mit<br />
Anschluss von 18 Gasbrunnen<br />
November 1984 Abschluss eines Gasliefervertrages zwischen dem Landkreis Ludwigsburg<br />
und den Neckarwerken Esslingen AG<br />
Dezember 1985 Inbetriebnahme der Gasübergabestation<br />
Dezember 1985 Inbetriebnahme des Blockkraftwerkes / <strong>Deponiegas</strong>verwertungsanlage<br />
(1. Ausbauabschnitt)<br />
November 1986 Vergabe der Bau- und Lieferleistungen für die Zwangsentgasungsanlagen<br />
im Entgasungsabschnitt 1b<br />
September 1988 Inbetriebnahme der Wärmeauskopplung vom BKW zur Beheizung der<br />
Deponiegebäude<br />
September 1990 Inbetriebnahme des 3. Gasmotors<br />
März 1995 Fertigstellung der Gasstation 2 als Anbau an die Gasstation 1b<br />
Mai 1999 Inbetriebnahme der Hochtemperaturabfackelungsanlage<br />
2001 / 2002 Umbau und Anschluss von 30 Gasbrunnen im Zuge der temporären<br />
Folienabdeckung (1. Bauabschnitt)<br />
September 2003 Umbau und Anschluss von 10 Gasbrunnen im Zuge der temporären Folienabdeckung<br />
(2. Bauabschnitt)<br />
Oktober 2003 Wiederinbetriebnahme der umgebauten und modernisierten Gassammelstation<br />
1b/2 und der Gasübergabestation<br />
Dezember 2003 Bauabnahme der Entgasungsmaßnahmen in den Baufeldern 6 + 7 des<br />
Deponieabschnittes IX<br />
Oktober 2004 Modernisierung und Erweiterung der Gassammelstation 9a / 9b
Anlage 2







![Handlungshilfe Neue Deponieverordnung [PDF] - Landesanstalt für ...](https://img.yumpu.com/5952676/1/184x260/handlungshilfe-neue-deponieverordnung-pdf-landesanstalt-fur-.jpg?quality=85)