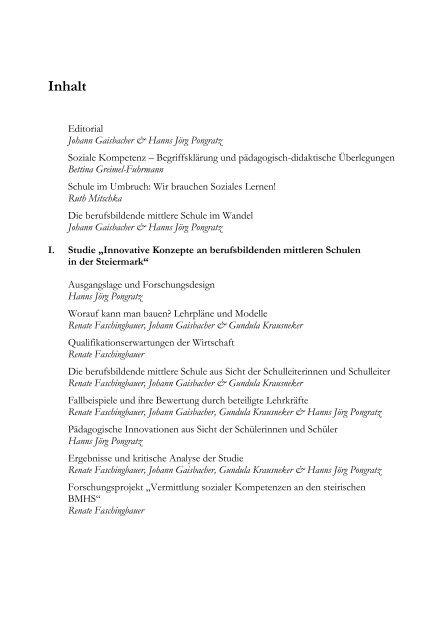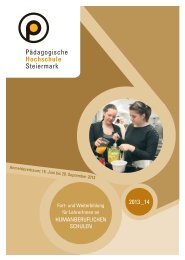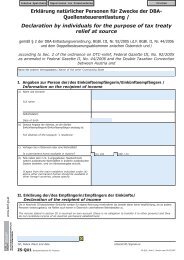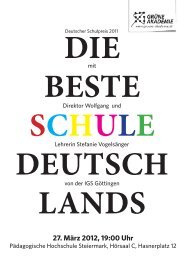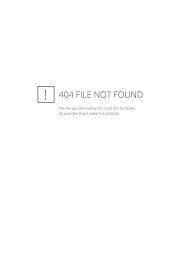Editorial - Pädagogische Hochschule Steiermark
Editorial - Pädagogische Hochschule Steiermark
Editorial - Pädagogische Hochschule Steiermark
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Inhalt<br />
<strong>Editorial</strong><br />
Johann Gaisbacher & Hanns Jörg Pongratz<br />
Soziale Kompetenz – Begriffsklärung und pädagogisch-didaktische Überlegungen<br />
Bettina Greimel-Fuhrmann<br />
Schule im Umbruch: Wir brauchen Soziales Lernen!<br />
Ruth Mitschka<br />
Die berufsbildende mittlere Schule im Wandel<br />
Johann Gaisbacher & Hanns Jörg Pongratz<br />
I. Studie „Innovative Konzepte an berufsbildenden mittleren Schulen<br />
in der <strong>Steiermark</strong>“<br />
Ausgangslage und Forschungsdesign<br />
Hanns Jörg Pongratz<br />
Worauf kann man bauen? Lehrpläne und Modelle<br />
Renate Faschingbauer, Johann Gaisbacher & Gundula Krausneker<br />
Qualifikationserwartungen der Wirtschaft<br />
Renate Faschingbauer<br />
Die berufsbildende mittlere Schule aus Sicht der Schulleiterinnen und Schulleiter<br />
Renate Faschingbauer, Johann Gaisbacher & Gundula Krausneker<br />
Fallbeispiele und ihre Bewertung durch beteiligte Lehrkräfte<br />
Renate Faschingbauer, Johann Gaisbacher, Gundula Krausneker & Hanns Jörg Pongratz<br />
<strong>Pädagogische</strong> Innovationen aus Sicht der Schülerinnen und Schüler<br />
Hanns Jörg Pongratz<br />
Ergebnisse und kritische Analyse der Studie<br />
Renate Faschingbauer, Johann Gaisbacher, Gundula Krausneker & Hanns Jörg Pongratz<br />
Forschungsprojekt „Vermittlung sozialer Kompetenzen an den steirischen<br />
BMHS“<br />
Renate Faschingbauer
II. Gelebte Innovation. Beispiele aus der Schulpraxis<br />
Konflikte kooperativ und gewaltfrei regeln durch Peer-Mediation<br />
Klaus Krottmayer<br />
Verantwortungsvolles Miteinander im Buddy-Projekt<br />
Klaudia Fuchs<br />
Koordinierte Krisenintervention durch ein Team<br />
Helga Jaklitsch & Klaus Krottmayer<br />
Schulsozialarbeit als Unterstützung der pädagogischen Tätigkeit<br />
Evelyn Awad<br />
Glück macht Schule – ein ganzheitlicher Gesundheitsansatz<br />
Eva-Maria Chibici-Revneanu<br />
Unterrichtsfach „Soziales Lernen“ – Fallbeispiele<br />
Thomas Eibel<br />
Kulturelle Vielfalt als Bereicherung – dann sind wir mehr als drei<br />
Evelyn Awad & Roswitha Gschweitl<br />
Lernstilanalyse als Basis der Individualisierung<br />
Horst Kollingbaum<br />
COOL! Das Cooperative Offene Lernen, eine Initiative mit Breitenwirkung<br />
Georg Neuhauser<br />
Schule anders denken und leben – das Modell der Handelsschule NEU<br />
Manfred Sparr<br />
Innovative architektonische Konzepte für eine zeitgemäße Pädagogik<br />
Georg Neuhauser & Alfred M. Kapper<br />
III. Externe Angebote zur Stärkung der Selbst- und Sozialkompetenz<br />
SCHAUSPIEL AKTIV! Ein theaterpädagogisches Angebot<br />
Stefan Egger<br />
Menschenrechtsbildung in Workshops gegen Gewalt und Rassismus<br />
Christian Ehetreiber<br />
AIDS-Prävention heißt das eigene Sexualleben zu reflektieren<br />
Eva Fellner-Rzehak, Flora Hutz & Günther Polanz<br />
Weltsicht entwickeln durch Globales Lernen<br />
Stefan Halbartschlager
<strong>Editorial</strong><br />
Johann Gaisbacher & Hanns Jörg Pongratz<br />
Das vorliegende Buch beschäftigt sich mit innovativen Schulprojekten zur Förderung<br />
und Entwicklung der Selbst- und Sozialkompetenz an berufsbildenden mittleren und<br />
höheren Schulen. Entsprechende Fähigkeiten und Fertigkeiten werden von Arbeitgeberseite<br />
immer wieder vehement eingefordert – die zukünftigen Arbeitnehmer/innen<br />
sollen als selbstbewusste, neugierige und zielorientierte Persönlichkeiten<br />
dem Qualifikationsprofil der heutigen dynamischen Arbeitswelt entsprechen.<br />
Wir wollen vorweg betonen, dass auch die Gesellschaft für ihre Weiterentwicklung<br />
engagierte, kritische und empathische junge Menschen benötigt, und wir sehen in<br />
beiden Forderungen keinen Widerspruch. Folge dieser Sichtweise ist, dass es im vorliegenden<br />
Buch nicht nur um Vermittlung von Kompetenzen für die Arbeitswelt geht,<br />
sondern auch um die Schule selbst und um die Frage, inwieweit im schulischen Umfeld<br />
bereits eine Kultur des erfolgreichen Miteinanders gelebt werden kann. Daher<br />
finden sich Aspekte der Lehrer/innenrolle bzw. förderlicher Schulstrukturen ebenso<br />
in diesem Buch wieder wie die eigentliche Förderung und Entwicklung von Selbst-<br />
und Sozialkompetenz im Rahmen des Unterrichts. Neben dem wissenschaftlichen Teil<br />
enthält der Band auch die Beschreibung von Modellen und Beispielen, erfolgreichen<br />
Initiativen an den Schulen wird eine Plattform geboten, Handelnde kommen zu Wort,<br />
Anregungen werden offeriert.<br />
Die berufsbildende mittlere Schule (BMS) steht zunächst im Mittelpunkt des Buches,<br />
ging es bei der dem Band zugrundeliegenden Studie doch um innovative Konzepte in<br />
diesem Schultyp. Aus der Entwicklung der letzten Jahre wissen wir, dass gerade Initiativen<br />
aus der BMS, in der man des Öfteren massiven Handlungsbedarf sah, schließlich<br />
ins berufsbildende höhere Schulwesen übernommen wurden. Auch dieser Umstand<br />
lässt es als sinnvoll erscheinen, den Ort erster Veränderungsschritte genauer zu betrachten.<br />
Die meisten Beiträge im Buch beschäftigen sich dementsprechend mit Inhalten,<br />
Aussagen und Beispielen, die für die gesamte Sekundarstufe II, teilweise auch für<br />
die Sekundarstufe I, von Anwendungsinteresse sein können. Ein großer Teil der Initiativen<br />
ist in der <strong>Steiermark</strong> beheimatet, dem Tätigkeitsmittelpunkt der Herausgeber,<br />
im Buch finden sich jedoch auch Beispiele und Artikel von Autor/innen aus anderen<br />
Bundesländern.<br />
Im Grunde gehen zeitgemäße pädagogische Konzepte davon aus, den Lernprozess<br />
beim Kind/Jugendlichen selbst anzusetzen, bei seinen Vorkenntnissen, seiner Neugier<br />
und seinen Stärken. Das Ich zu akzeptieren, zu entwickeln und zu stärken sowie darauf<br />
ein funktionierendes Wir aufzubauen ist ein wesentlicher Grundsatz der Reformpädagogik,<br />
des sozialen Lernens und der Individualisierung. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl<br />
von Übungen, die eine Stärkung der sozialen Kompetenzen ermöglichen. Aber
um welche Kompetenzen geht es eigentlich? Bettina Greimel-Fuhrmann thematisiert im<br />
ersten Beitrag des Buches diese wichtige Frage. Sie stellt zudem pädagogischdidaktische<br />
Überlegungen zur Förderung sozialer Kompetenz an und nennt für deren<br />
Vermittlung besonders geeignete Unterrichtsmethoden.<br />
In vielen Beiträgen ist eine Stimmung des Aufbruchs spürbar. Die Konzeption von<br />
Schule ist – ausgelöst auch durch den PISA-Schock oder die Diskussionen rund um<br />
das Bildungsvolksbegehren – zum gesamtgesellschaftlich debattierten Thema geworden.<br />
Knapp drei Viertel der österreichischen Bevölkerung halten es heute für wichtig,<br />
dass Schulreformen zügig durchgeführt werden. Wie geht es den Akteur/innen in<br />
dieser Situation? Die wohl aktivste Wegbereiterin des sozialen Lernens in Österreich,<br />
Ruth Mitschka, bringt in einem sehr persönlichen Bericht genau diese Ebene ein, Aufbruch,<br />
Rückschläge, Unterstützung, Erfolge, letztere danken wir wohl ihrer unverbrüchlichen<br />
Überzeugung, dass der eingeschlagene Weg der richtige war. Diese Ausdauer<br />
trägt inzwischen Früchte: Waren noch vor 20 Jahren Proponent/innen des sozialen<br />
Lernens mit der Frage „Wozu brauchen wir denn das?“ konfrontiert, wird ihnen<br />
heute die Frage „Wie macht man denn das? “ gestellt.<br />
Ein zweiter Artikel, der ebenfalls persönliche Aspekte in sich birgt, befasst sich mit<br />
der zweitbesten Lösung, einer im Lehrplan verankerten Unterrichtsstunde soziales<br />
Lernen – die beste wäre wohl die Vermittlung sozialer Kompetenzen in allen Gegenständen.<br />
Thomas Eibel beschreibt aus seiner Unterrichtspraxis exemplarisch Fallbeispiele<br />
zur Selbst- und Sozialkompetenz sowie zum Klassenklima, geht aber auch den Fragen<br />
nach: Was erwarten Schüler/innen und Lehrer/innen von einem persönlichkeitsbildenden<br />
Fach? Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich, um Schlüsselqualifikationen<br />
wirklich vermitteln zu können?<br />
Im zweiten Abschnitt des Buches beschreiben Johann Gaisbacher, Gundula Krausneker,<br />
Renate Faschingbauer & Hanns Jörg Pongratz in mehreren sachlogisch getrennten Beiträgen<br />
die Ergebnisse des dreijährigen Forschungsprojektes „Innovative Konzepte an<br />
berufsbildenden mittleren Schulen in der <strong>Steiermark</strong>“. Das Projekt basierte auf einem<br />
Mixed-method Design und inkludierte daher mehrere unterschiedliche Datenerhebungsvorgänge.<br />
Schulleiter/innen, engagierte Lehrer/innen, Schüler/innen, aber auch<br />
Expert/innen und Wirtschaftsvertreter/innen wurden befragt. Die Ergebnisse beinhalten<br />
eine Vielfalt von Zugängen zum Thema, Einzelmeinungen, Fallbeispiele,<br />
Sichtweisen von Gruppen Beteiligter wie auch zusammenfassende Resümees oder<br />
schulpraktische Schlussfolgerungen. Die untersuchten Initiativen häuften sich thematisch<br />
um die Bereiche „offenes Lernen“, „Selbstständigkeit“, „Praxisnähe“ oder<br />
„andere Lebenswelten“. Eines der vielleicht wesentlichsten Ergebnisse der Studie<br />
besteht darin, dass sie das trotz massiver struktureller Hindernisse ungetrübte Engagement<br />
der in den Initiativen tätigen Kolleg/innen sichtbar gemacht hat.<br />
Kinder und Jugendliche sind zum Lernen geboren, sie können gar nicht anders. Natürlich<br />
ist der Lernprozess abhängig von vielen Faktoren, ein wesentlicher ist, ob Störungen<br />
präventiv entgegengewirkt wird und ob sie, sofern solche eintreten, Vorrang<br />
haben. Zu diesem Thema finden sich im Buch mehrere Zugänge: Peer-Mediation, also
Konfliktregelung durch jugendliche Mediator/innen, hat sich in Österreich bereits<br />
sehr bewährt. Klaus Krottmayer beschreibt deren Vorteile für Schüler/innen, Lehrer/innen<br />
und für die Schulentwicklung. Er betont, dass die große Chance der Peer-<br />
Mediation neben dem Schlichten einzelner Streitigkeiten darin besteht, gewaltfreie<br />
Konfliktlösung als Bestandteil von Schulkultur zu etablieren.<br />
Helga Jaklitsch stellt in einem weiteren Beitrag ein sehr detailliertes Beispiel einer koordinierten<br />
Krisenintervention durch ein Kriseninterventionsteam vor. Ein wesentlicher<br />
Pfeiler dieses Konzepts sind ebenfalls Peer-Mediator/innen, bei größeren Problemfällen<br />
steht ein erweitertes Krisenregelwerk zur Verfügung.<br />
Schulsozialarbeit ist in einigen Ländern Europas bereits gesetzlich verankert, Österreich<br />
ist nicht darunter. Evelyn Awad skizziert die Sozialarbeit an ihrer Schule, eine der<br />
wenigen BMSn mit sozialpädagogischer Unterstützung. Sie thematisiert die Rolle der<br />
Sozialarbeiter/innen als Teil der Schulgemeinschaft und weist darauf hin, dass der<br />
Kontakt mit den Schulsozialarbeiter/innen für viele Schüler/innen die einzige Möglichkeit<br />
ist, ein Vertrauensverhältnis zu einer erwachsenen Person aufzubauen.<br />
Klaudia Fuchs beschreibt das sogenannte „Buddy-Projekt“, eine Initiative der PH Tirol,<br />
bei der Peer-Education, also das Lernen am Beispiel Gleichaltriger, im Mittelpunkt<br />
steht und verantwortliches und selbstwirksames Handeln gefördert wird. Aufeinander<br />
achten, füreinander da sein, miteinander lernen – so lautet das Motto der Buddys. Sie<br />
lernen für sich und andere Verantwortung zu übernehmen und erleben ihr Handeln<br />
als sinnvoll und wirksam.<br />
Soziales Lernen und selbstwertstärkende Unterrichtsmodelle zur Gewaltprävention<br />
finden sich auch im Unterrichtsfach „Glück macht Schule“. Eva-Maria Chibici-Revneanu<br />
skizziert die Inhalte einer inzwischen für alle Schultypen konzipierten Initiative: Freude<br />
am Leben und an der eigenen Leistung, gesunde Ernährung und körperliches<br />
Wohlbefinden, der Körper in Bewegung und als Ausdrucksmittel, das Ich und die<br />
soziale Verantwortung.<br />
Störungen Vorrang einzuräumen hat auch etwas mit Wertschätzung zu tun, und Wertschätzung<br />
ist gefordert, wenn es um kulturelle Heterogenität oder starke Gruppenbildung<br />
im Klassenverband geht. Evelyn Awad und Roswitha Gschweitl schildern erfolgreiche<br />
Bemühungen an ihrer Schule, gemeinsame Ziele über trennende Elemente zu<br />
stellen, Bewusstsein für die eigenen kulturellen Regeln, aber auch für jene anderer zu<br />
entwickeln und Brücken zwischen Kulturen zu schlagen.<br />
Den Menschen, die sich in Schulen aufhalten, mit Wertschätzung zu begegnen, heißt<br />
auch den Räumen Bedeutung beizumessen, Architektur einladend und inspirierend zu<br />
gestalten. Georg Neuhauser & Alfred Kapper sehen im typischen österreichischen Schulgebäude,<br />
in langen Gängen und daran aufgefädelten Klassenräumen, die Entsprechung<br />
zu einer Einfalt der Pädagogik, während eine architektonische Offenheit gegenüber<br />
neuen gestalterischen und räumlichen Antworten eine heute anzustrebende<br />
Vielfalt der Pädagogik ermöglicht.
Als wertschätzend und vor allem auch erfolgversprechend erweist sich auch die Ausrichtung<br />
des Lernprozesses nach dem/der einzelnen Schüler/in. Horst Kollingbaum<br />
beschreibt in seinem Beitrag eine umfangreiche Lernstilanalyse, mit der nicht nur festgestellt<br />
werden kann, wie jede/r einzelne Schüler/in am besten lernt, sondern auch,<br />
welche Lernusancen in einer Klasse vorherrschen und welche Konsequenzen dies für<br />
den Unterricht hat.<br />
Die Beiträge von Georg Neuhauser, einem der Initiator/innen von COOL (Cooperatives<br />
Offenes Lernen), bzw. Manfred Sparr betreffen Modelle, die das strukturelle Korsett<br />
der österreichischen „Regel“-Schule durchbrechen. Einzelne Fächer werden zu gemeinsamen<br />
Einheiten verbunden, Zeit und Raum der Lernprozesse zunehmend flexibler<br />
bzw. individualisierter. Einige COOL praktizierende Schulen oder die Bregenzer<br />
Handelsschule NEU stellen pädagogische „Treibhäuser der Zukunft“ dar. Beides sind<br />
Modelle, in denen Selbsttätigkeit, Eigenverantwortlichkeit und Zusammenarbeit den<br />
schulischen Alltag bestimmen.<br />
Der abschließende Teil des Buches beschreibt Angebote von Institutionen außerhalb<br />
der Schule, die als Erweiterung und/oder Vertiefung des schulischen Angebotes im<br />
Rahmen der Lehrpläne gesehen werden können. Allen ist gemeinsam, dass es dabei<br />
stark um die Lebenswelten Jugendlicher geht, die von der Ambivalenz zwischen<br />
Chancen und Verunsicherung geprägt sind. Stefan Egger stellt in einem Beitrag ein theaterpädagogisches<br />
Projekt vor, das in der <strong>Steiermark</strong> auf großes Interesse stößt und den<br />
Schüler/innen einen ganzheitlichen Zugang zu den Interpretationen klassischer und<br />
zeitgenössischer Theaterstücke eröffnet. Stefan Halbartschlager beschreibt den konzeptionellen<br />
Rahmen des Globalen Lernens und stellt die Workshopreihe „Weltsicht entwickeln“<br />
vor. Ausgehend von Produkten des täglichen Konsums werden Informationen<br />
zu deren Produktionsbedingungen und zu globalen Wirtschaftskreisläufen herausgearbeitet,<br />
die ökologischen Rahmenbedingungen thematisiert und den Schüler/innen<br />
neue Sichtweisen ermöglicht. Christian Ehetreiber sieht die Notwendigkeit<br />
politischer Bildungsoffensiven in allen jugendrelevanten Settings, die angebotenen<br />
Workshops sollen den Schüler/innen eine Kultur der Menschenrechte, Demokratie<br />
und soziokulturellen Vielfalt näher bringen. Eva Fellner-Rzehak, Flora Hutz & Günther<br />
Polanz informieren über Workshops zur AIDS-Prävention. Sexualität stellt bei vielen<br />
Jugendlichen einen Bereich dar, bei dem es trotz einer umfassenden multimedialen<br />
Informationsflut oft an einem Punkt mangelt: Wie setze ich dieses Wissen um, was hat<br />
HIV/AIDS konkret mit mir zu tun oder was kann es mit mir zu tun haben?<br />
Die 23 in diesem Buch versammelten Beiträge beschreiben praxiserprobte pädagogische<br />
Innovationen vor dem Hintergrund erziehungs- und sozialwissenschaftlicher<br />
Erkenntnisse. Ihre Autor/innen sind selbst Akteur/innen dieser wichtigen Initiativen<br />
im Rahmen des österreichischen Schulwesens, die in ihren Beiträgen einen Teil ihrer<br />
Erfahrungen und ihres umfassenden Wissens weitergeben. Wir sind davon überzeugt,<br />
dass auch Sie darin sehr viele interessante Informationen und im optimalen Fall Anwendbares<br />
für die eigene berufliche Tätigkeit finden werden.