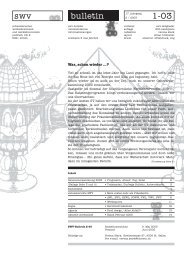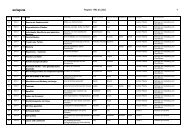DESIGN IN DER SCHULE - swv
DESIGN IN DER SCHULE - swv
DESIGN IN DER SCHULE - swv
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Universität Bern<br />
Institut für Erziehungswissenschaft<br />
Abteilung für Didaktik<br />
Master of Advanced Studies (MAS) in Fachdidaktik Kunst und Gestaltung<br />
Masterarbeit:<br />
<strong>DESIGN</strong> <strong>IN</strong> <strong>DER</strong> <strong>SCHULE</strong><br />
Argumente und Indizien für die Bezugsdisziplin Design<br />
und das Schulfach „Design und Technik“<br />
Zu Handen von:<br />
Prof. Dr. Rolf Becker, Studienleitung<br />
Universität Bern<br />
Muesmattstrasse 27<br />
3012 Bern<br />
Raimund Erdmann, Gutachter<br />
Dozent MAS Universität Bern<br />
Erdmann Design AG<br />
Stahlrain 2<br />
5200 Brugg<br />
Eingereicht durch:<br />
Beat Aepli<br />
Pädagogische Hochschule St.Gallen<br />
Notkerstrasse 27<br />
9000 St.Gallen<br />
beat.aepli@phsg.ch<br />
St. Gallen, 30. September 2011
Abstract II<br />
ABSTRACT<br />
Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen der Weiterbildung MAS Fachdidaktik Gestaltung<br />
und Kunst an der Universität Bern und befasst sich mit der Bezeichnung für die Gestaltungsfä-‐<br />
cher Technische und Textile Gestaltung.<br />
Das Thema Bezugsdisziplin begleitet seit mehreren Jahren den Fachdiskurs der pädagogischen<br />
Hochschulen und der Berufsverbände aus dem Gestalterischen Bereich.<br />
Die Resultate der Arbeit zeigen deutliche Zusammenhänge der bisherigen Lehrpläne mit pro-‐<br />
fessionellem Design. Untermauert wird diese Feststellung durch einen Blick auf die Ausbildung<br />
in den Fachhochschulen. Design ist eine Bezugsdisziplin, die den Gestaltungsfächern Techni-‐<br />
sche und Textile Gestaltung die wissenschaftliche Abstützung zu einem wesentlichen Teil der<br />
Tätigkeiten bieten kann.<br />
Die Arbeit versteht sich als Diskussions-‐Beitrag und Ausgangspunkt für eine künftige wissen-‐<br />
schaftliche Abstützung des Fachs Design und Technik. Zudem soll aufgezeigt werden, wo For-‐<br />
schungsbedarf besteht.<br />
Das Ausgangsmaterial lieferte die Untersuchung Bildung in zweitausend Zielen von Fries et al. 1<br />
(2007). Diese wurde verglichen mit der Publikation <strong>DESIGN</strong> BASICS von Heufler 2 (2006).<br />
Mit Hilfe eines Vergleichsrasters aus Schlüsselwörtern konnten systematisch in einer Triangula-‐<br />
tion Zusammenhänge zu verwandten Bereichen aufgezeigt werden. Für die Klärung von Design<br />
als Bezugsdisziplin wurden die Studiengänge an den Fachhochschulen zu Hilfe gezogen. Bei<br />
weiteren Untersuchungen konnten die Begriffe und der Sprachgebrauch in der Schweiz, in<br />
Deutschland und in Österreich verglichen werden. Zudem wurde das Untersuchungsgebiet auf<br />
den englischsprachigen Raum ausgeweitet; insbesondere nach Grossbritannien, den USA und<br />
Australien.<br />
Im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 wird im Moment von einem Fach Gestalten für die<br />
drei Fächer Technische Gestaltung, Textile Gestaltung und Bildnerische Gestaltung gesprochen.<br />
Die ersten beiden müssten mit Blick auf die aktuellen Begriffe als Design und Technik bezeich-‐<br />
net werden, der dritte wird von den beteiligten Fachpersonen als Bild und Kunst vorgeschla-‐<br />
gen.<br />
Der grosse Vorteil des Doppelbegriffs Design und Technik wäre, dass die Gestaltung und die<br />
Technik als zentrale Inhalte bereits im Titel erscheinen. Der Doppelbegriff ist zudem internati-‐<br />
onal in Gebrauch.<br />
1 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007): Bildung in zweitausend Zielen.<br />
2 Heufler, Gerhard (2006): <strong>DESIGN</strong> BASICS. Von der Idee zum Produkt.
Inhaltsverzeichnis III<br />
<strong>IN</strong>HALTSVERZEICHNIS<br />
1 Vorwort...................................................................................................................................7<br />
1.1 Einleitung ......................................................................................................................7<br />
1.2 Themenrelevanz............................................................................................................7<br />
1.3 Ziele............................................................................................................................... 8<br />
1.4 Fragen............................................................................................................................8<br />
1.5 Aktuelle Situation in der Volksschule............................................................................9<br />
1.5.1 Bezeichnungen der Schulfächer ........................................................................9<br />
1.5.2 Fachbezeichnungen vor dem Lehrplan 21.........................................................9<br />
1.5.3 Lehrplan 21......................................................................................................10<br />
1.5.4 Design und Technik .........................................................................................11<br />
1.5.5 Begriffe im Englischsprachigen Bereich...........................................................11<br />
1.5.6 Lehrmittel für die Lehrperson .........................................................................12<br />
1.5.7 Fachverbände ..................................................................................................13<br />
1.5.8 Fachdidaktik-‐Lehrpersonen und Berufsverbände ...........................................13<br />
1.6 Hypothesen .................................................................................................................14<br />
Hypothese 1 ................................................................................................................14<br />
Hypothese 2 ................................................................................................................14<br />
Hypothese 3 ................................................................................................................14<br />
Hypothese 4 ................................................................................................................14<br />
1.7 Konzept der Vorgehensweise......................................................................................14<br />
1.7.1 Übersicht .........................................................................................................15<br />
1.7.2 Vergleichsmengen ...........................................................................................15<br />
1.7.3 Kategoriensystem............................................................................................16<br />
1.8 Untersuchungsmethoden............................................................................................17<br />
1.8.1 Literaturstudium..............................................................................................17<br />
1.8.2 Sekundäranalyse und Vergleichsmenge..........................................................17<br />
1.8.3 Quantitative Messung .....................................................................................17<br />
1.8.4 Qualitative Messung........................................................................................18<br />
1.8.5 Vergleichsraster und Triangulation .................................................................18<br />
1.9 Abgrenzung .................................................................................................................19<br />
2 Design im Kontext.................................................................................................................20<br />
2.1 Verschiedene Sprachen – Verschiedene Sichtweisen .................................................20<br />
2.1.1 Babylonische Sprachverwirrung ......................................................................20<br />
2.1.2 Der Stein von Rosetta......................................................................................20<br />
2.2 «Bildung in 2000 Zielen» und «<strong>DESIGN</strong> BASICS».........................................................22<br />
2.2.1 Menge A: Nomen in «Bildung in 2000 Zielen» ................................................22<br />
2.2.2 Nomen im Design-‐Prozess von Heufler ...........................................................23<br />
2.2.3 Menge B: Nomen in «Design-‐Basics» ..............................................................24<br />
2.2.4 Nomen Lehrplan und Nomen Designprozess ..................................................25<br />
2.2.5 Vergleichsraster mit Klassierung .....................................................................26
Inhaltsverzeichnis IV<br />
2.2.6 Auswertung der Nomen ..................................................................................32<br />
2.2.8 Verben im Designprozess ................................................................................33<br />
2.2.9 Auswertung Verben.........................................................................................34<br />
3 Design als Wissenschaft........................................................................................................35<br />
3.1 Argumente aus der Fachliteratur ................................................................................35<br />
3.1 Studium Design ...........................................................................................................36<br />
3.1.1 Aktuelle Situation ............................................................................................36<br />
3.1.2 Studium in der Schweiz ...................................................................................36<br />
3.1.3 Studium in Deutschland ..................................................................................38<br />
3. 2 Design-‐Theorie ............................................................................................................38<br />
3.2.1 Literaturhinweise.............................................................................................38<br />
3.2.2 Teilgebiete von Design ....................................................................................39<br />
3.2.3 Interdisziplinarität ...........................................................................................39<br />
3.2.4 Intellektuelle Tiefe...........................................................................................40<br />
3.3 Design-‐Praxis ...............................................................................................................40<br />
3.3.1 Fachgebiet .......................................................................................................40<br />
3.3.2 Leistungsqualität der Ausbildung ....................................................................40<br />
3.4 Fachsprache ................................................................................................................41<br />
3.4.1 Wörterbuch .....................................................................................................41<br />
3.4.2 Formfächer ......................................................................................................41<br />
3.4.3 Prinzipien der Gestaltung ................................................................................41<br />
3.4.4 Every Thing Design ..........................................................................................41<br />
3.4.5 Die Welt der Dinge ..........................................................................................42<br />
3.4.6 Error-‐Design.....................................................................................................42<br />
3.4.7 Fachsprache in Lehrmitteln .............................................................................42<br />
3.5 Design-‐Geschichte.......................................................................................................43<br />
3.5.2 Design im Kunstunterricht...............................................................................43<br />
3.6 Bezugsdisziplinen ........................................................................................................43<br />
3.6.1 Modell der Disziplinen.....................................................................................43<br />
3.6.2 Modell mit verschiedenen Ebenen..................................................................46<br />
3.6.3 Bezugsdisziplinen im textilen Bereich .............................................................47<br />
3.7 Forschung....................................................................................................................47<br />
3.7.1 Tagungen .........................................................................................................48<br />
3.7.2 Wissenschaftliches Arbeiten ...........................................................................48<br />
4 Didaktik.................................................................................................................................49<br />
4.1 Fachdidaktische Aspekte von Design ..........................................................................49<br />
4.1.1 Lehrmittel Fachdidaktik...................................................................................49<br />
4.1.2 Textildidaktik ...................................................................................................49<br />
4.1.2 Technikunterricht ............................................................................................49<br />
4.2 Designprozess aus Sicht der Fachdidaktik...................................................................50<br />
4.2.1 Mitgestaltung, Emotionen und Spannung.......................................................50<br />
4.2.2 Methoden-‐Karten IDEO...................................................................................55<br />
4.2.3 Designprozesse................................................................................................56
Inhaltsverzeichnis V<br />
5 Vom Mosaikstein zum Gesamtbild .......................................................................................58<br />
5.1 Der Vergleichsraster....................................................................................................58<br />
5.1.1 Entwicklung des Vergleichsrasters ..................................................................58<br />
5.1.2 Bildung in 2000 Zielen .....................................................................................58<br />
5.1.3 Argumentarium ...............................................................................................59<br />
5.1.4 Referenzrahmen Gestaltung und Kunst ..........................................................60<br />
5.2 Fachhochschulen.........................................................................................................61<br />
5.2.1 Studiengänge in der Schweiz...........................................................................61<br />
5.2.2 Hochschule der Künste Bern, Berner Fachhochschule ....................................62<br />
5.2.3 Hochschule der Künste Nordwestschweiz.......................................................62<br />
5.2.4 Design & Kunst an der Hochschule Luzern ......................................................63<br />
5.2.5 Textildesign an der Hochschule Luzern ...........................................................64<br />
5.2.5 Zürcher Hochschule der Künste.......................................................................64<br />
5.3 Nachbardisziplinen und andere Länder.......................................................................65<br />
5.3.1 Kunst und Kultur aus Österreich......................................................................65<br />
5.3.2 Design als Marketing-‐Mittel für Europa ..........................................................66<br />
5.3.3 Österreich: technisches Werken .....................................................................67<br />
5.3.4 Österreich: Textiles Werken ............................................................................68<br />
5.3.5 Technische Standards USA und Deutschland ..................................................69<br />
5.3.6 Australien New South Wales: Design and Technology....................................71<br />
5.3.7 Australien New South Wales: Textile Technology ...........................................72<br />
5.3.8 Auswertung Triangulation ...............................................................................73<br />
5.4 Weitere Aspekte..........................................................................................................76<br />
5.4.1 Alltagsobjekte..................................................................................................76<br />
5.4.2 Wettbewerbe ..................................................................................................76<br />
5.4.3 Museen............................................................................................................76<br />
6 Erkenntnisse .........................................................................................................................77<br />
6.1 Zusammenfassung.......................................................................................................77<br />
6.1.1 Vergleich..........................................................................................................77<br />
6.1.2 Triangulation ...................................................................................................77<br />
6.2 Beantwortung der Hypothesen...................................................................................77<br />
Fachbezeichnungen ....................................................................................................77<br />
Verwandtschaft mit Design.........................................................................................78<br />
Studiendisziplinen .......................................................................................................78<br />
Bezugsdisziplinen ........................................................................................................78<br />
Gegenpositionen.........................................................................................................78<br />
6.3 Schlussfolgerungen .....................................................................................................79<br />
Literaturverzeichnis ....................................................................................................................80<br />
Anhang........................................................................................................................................ 86<br />
Anhang 1: Abbildungsverzeichnis.........................................................................................86<br />
Anhang 2: Tabellenverzeichnis .............................................................................................87<br />
Anhang 3: Begriffe ................................................................................................................89<br />
Anhang 4: Die Gestaltungsfächer .........................................................................................92
Inhaltsverzeichnis VI<br />
Anhang 5: Auswertung der Nomen in «Bildung in 2000 Zielen»..........................................93<br />
Anhang 6: Auswertung der Nomen aus der Vergleichsmenge.............................................95<br />
Anhang 7: Standards USA und Deutschland.........................................................................96<br />
Anhang 8: Beispiele von Designprozessen............................................................................99<br />
Anhang 9: Untersuchungsraster Triangulation...................................................................100
1 VORWORT<br />
1 VORWORT<br />
1.1 E<strong>IN</strong>LEITUNG<br />
Diese Masterarbeit geht der Frage nach, ob Design als Bezugsdisziplin für die gestalterischen<br />
Fächer „Technische und Textile Gestaltung“ gelten kann. Ferner wird untersucht, welche Alter-‐<br />
nativen es dazu geben könnte.<br />
Im Zusammenhang mit dem HarmoS-‐Konkordat 3 „Interkantonale Vereinbarung über die Harmo-‐<br />
nisierung der obligatorischen Schule“ werden aktuell die Lehrpläne für das Projekt Lehrplan 21 4<br />
ausgearbeitet. Der Autor ist daran beteiligt. Er unterrichtete über 20 Jahre an der Oberstufe der<br />
Volksschule die gestalterischen Fächer Bildnerische Gestaltung und Technische Gestaltung, lehr-‐<br />
te an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen Technische Gestaltung (Werken), Bildnerische<br />
Gestaltung und Bereichsdidaktik Gestaltung (Design). Seine Erfahrung aus der Gestaltung eines<br />
Lehrmittels über Bumerangs wie die Entwicklung und industrielle Herstellung dieses Spiel-‐ und<br />
Sportgeräts flossen in die Schulpraxis, in andere Lehrmittel und in das Interesse für die Beschäf-‐<br />
tigung mit Produktdesign ein. Die didaktische Auseinandersetzung mit Nussknackern in der Pro-‐<br />
jektarbeit der MAS Kunst und Gestaltung der Universität Bern waren eine Folge des Moduls<br />
Design und ebnete den Zugang und das Interesse zur Auseinandersetzung mit dem aktuellen<br />
Thema dieser vorliegenden Arbeit.<br />
1.2 THEMENRELEVANZ<br />
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat für Deutschland die Relevanz der Bezugs-‐<br />
disziplinen aufgezeigt. Klieme (2007) 5 hält fest:<br />
„Unterrichtsfächer korrespondieren mit wissenschaftlichen Disziplinen, die bestimmte<br />
Weltsichten (eine historische, literarisch-‐kulturelle, naturwissenschaftliche usw.) ausar-‐<br />
beiten und dabei bestimmte „Codes“ einführen [...].“<br />
In der Schweiz findet sich nichts Vergleichbares; es ist eine babylonische Sprachverwirrung fest-‐<br />
zustellen: Bisher wurden für die drei gestalterischen Fächer nach Fries 6 „22 im Detail unter-‐<br />
schiedliche Bezeichnungen“ in den Lehrplänen der Volksschule in der Deutschschweiz verwen-‐<br />
det. Im Anhang 2 sind deshalb die Definitionen nach Duden und weiterer Quellen aufgeführt.<br />
3 EDK (2009): HarmoS-‐Konkordat.<br />
4 EDK (2010): Projekt Lehrplan 21.<br />
5 Klieme, Eckhard et al. (2007): Expertise: Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. S. 25.<br />
6 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007): Bildung in zweitausend Zielen. S. 33.<br />
7
1 VORWORT<br />
1.3 ZIELE<br />
Die Arbeit möchte das Verständnis für die aktuellen begrifflichen und inhaltlichen Fachentwick-‐<br />
lungen fördern und die wissenschaftliche Abstützung der Fächer Technische und Textile Gestal-‐<br />
tung (Design & Technik) aufzeigen.<br />
1. Ein wichtiges Ziel ist eine Übersicht über die verwendeten und in Frage kommenden<br />
Fachbegriffe.<br />
2. Ein nächstes Ziel ist die Klärung der Frage, ob die bisherigen Lehrpläne Gemeinsamkei-‐<br />
ten mit Inhalten und Tätigkeiten aus dem Bereich Design aufweisen.<br />
3. Weiter soll geklärt werden, welches die wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen für die Ge-‐<br />
staltungsfächer Technische und Textile Gestaltung sind oder sein könnten.<br />
1.4 FRAGEN<br />
Zu Beginn der Arbeit standen folgende Fragen im Raum:<br />
• Welche Tätigkeiten werden in der Technischen Gestaltung und in der Textilen Ge-‐<br />
staltung ausgeübt, die auch im Designbereich eine Rolle spielen?<br />
• Mit welcher Untersuchungsmethode lassen sich die Lehrpläne aus der Volksschule<br />
mit Publikationen aus dem Designbereich vergleichen?<br />
• Kann Design als wissenschaftliche Bezugsdisziplin für die gestalterischen Fächer<br />
Technisches und Textiles Werken gelten?<br />
• Gibt es weitere Disziplinen, welche als Bezugsdisziplin gelten können?<br />
• Gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei den Inhalten, Zielen und Tätigkei-‐<br />
ten?<br />
8
1 VORWORT<br />
1.5 AKTUELLE SITUATION <strong>IN</strong> <strong>DER</strong> VOLKS<strong>SCHULE</strong><br />
Der Leiter der Pädagogischen Arbeitsstelle des LCH stellte bereits 2005 fest, dass ein ernst ge-‐<br />
nommenes Fach „in breit anerkannten wissenschaftlichen Konzepten“ gründen soll. 7<br />
1.5.1 Bezeichnungen der Schulfächer<br />
Die drei Schulfächer werden in den nachfolgenden Texten mit „Bildnerische Gestaltung“, „Tech-‐<br />
nische Gestaltung“ und „Textile Gestaltung“ bezeichnet. Die Begriffe „Gestaltung“ und „Design“<br />
werden synonym verwendet.<br />
Technische<br />
Gestaltung<br />
Abbildung 1: Die drei Gestaltungsfächer<br />
Drei Gestaltungsfächer<br />
Texsle<br />
Gestaltung<br />
1.5.2 Fachbezeichnungen vor dem Lehrplan 21<br />
Im Lehrmittel „Formen-‐Falten-‐Feilen“ 8 wird bereits unter „Didaktik – Allgemeines“ über die<br />
Fachbegriffe gesprochen. Auch bei der Datenerhebung von Fries 9 (2007) existierten für die Fä-‐<br />
cher Technische und Textile Gestaltung die unter Tabelle 1 aufgeführten Varianten: a) mit zwei<br />
Fächern und zwei Begriffen, b) mit zwei Fächern und einem gemeinsamen Begriff und c) mit<br />
einem Fach und einem Begriff.<br />
Tabelle 1: Zusammenstellung der zwei Fächer Technische und Textile Gestaltung (Fries 2007)<br />
Technische Gestaltung Textile Gestaltung gemeinsamer Fachbe-‐<br />
griff (Technische und<br />
Textile Gestaltung)<br />
Kantone<br />
Handarbeit / Werken Textilarbeit / Textiles Werken BS 1991<br />
Handarbeit Werken Handarbeit textil GR 1993<br />
Werken Handarbeit SG 1997<br />
Werken Textiles Gestalten BL 2004<br />
7<br />
Strittmatter, Anton (2005): Argumentieren, was das Zeug hält? S. 53.<br />
8<br />
Nell, Peter et al. (2002): Formen, Falten, Feilen. S. 3.<br />
9<br />
Fries, Anna Verena et al. (2007): Bildung in zweitausend Zielen. S. 32.<br />
Bildnerische<br />
Gestaltung<br />
9
1 VORWORT<br />
Werken Textiles Werken AG 2000<br />
Handarbeit ZH 1991<br />
Handwerkliches Gestalten SH 2001<br />
Manuelles Gestalten BS 2002<br />
Technisches und textiles<br />
Gestalten<br />
Textiles und Nichttextiles<br />
Gestalten<br />
BE 1995<br />
BL 1998<br />
Werken SO 1992/96, AI 1996/2004,<br />
AR 1996<br />
Werken und Gestalten TG 1996<br />
Gestalten (über alle drei<br />
Fachbereiche)<br />
10<br />
BL 2 1998 (nur Unterstufe, 1.<br />
und 2. Klasse)<br />
In Kanton Baselland gab es ab 1998 für die Unterstufe der Primarstufe ein gemeinsames Fach<br />
„Gestalten“ für alle drei Fächer.<br />
Dass die bisherigen zwei Fächer mindestens vom Begriff her neu zu einem Fach umfunktioniert<br />
wurden, erschwert die Fachdiskussion, weil die gewachsenen Strukturen in den Verbänden an-‐<br />
ders sind. Die eher unglückliche Bezeichnung mit dem substantivierten Verb Gestalten er-‐<br />
schwert zusätzlich die Legitimation, auch gegenüber andern Fächern.<br />
1.5.3 Lehrplan 21<br />
Bei der ersten Fassung des HarmoS-‐Konkordats 10 ist aus den sonst schon lange verschwundenen<br />
substantivierten Verben (Singen, Turnen, Rechnen, ...) einzig der Begriff „Gestalten“ übrig ge-‐<br />
blieben. Dies führte zu Diskussionen und zu Veränderungswünschen. 2010 wurden die Grundla-‐<br />
gen trotzdem für den Lehrplan 21 verabschiedet 11 .<br />
Die Vorgaben der Projektleitung waren ein gemeinsames Fach „Gestalten“ für den 1. Zyklus<br />
(Kindergarten und Unterstufe), und zwei Fächer für den zweiten und dritten Zyklus.“<br />
10 EDK (2009): HarmoS-‐Konkordat.<br />
11 EDK (2010): Grundlagen Lehrplan 21.
1 VORWORT<br />
Texsles und<br />
Technisches<br />
Gestalten<br />
Abbildung 2: Begriffe zu Beginn des Lehrplans 21<br />
1.5.4 Design und Technik<br />
Gestalten<br />
Bildnerisches<br />
Gestalten<br />
Ein Wechsel in die Berufswelt der Designer und Ingenieure. Diese Berufsgruppen sind laut Meret<br />
in der Fachzeitschrift Hochparterre (2011) 12 dabei, die „Zusammenarbeit bereits in der Ausbil-‐<br />
dung zu trainieren.“<br />
Diethard Janssen 13 plädiert für eine Einheit von Design und Technik: „Beide Disziplinen sollen die<br />
von uns Menschen geschaffene künstliche Umwelt gestalten und verändern.“ Neue Technolo-‐<br />
gien und Materialien sind nach Kurz & Zebner (2011) 14 wichtige Faktoren für eine gute Zusam-‐<br />
menarbeit der Bereiche Design und Technik.<br />
1.5.5 Begriffe im Englischsprachigen Bereich<br />
In Grossbritannien existiert das Fach „Design and Technology“ für „Gestaltung und Technik“. 15<br />
Ferner gibt es das Fach „Design and Arts“ für „Gestaltung und Kunst“. Die Beschreibung dieser<br />
Tatsache von Oelkers und Reusser 16 sind aufschlussreich. Erstaunlich ist der aktuelle Stand der<br />
Unterlagen und Lehrpläne: Die Universität Cambridge 17 publiziert bereits die national gültigen<br />
Unterlagen für die Kompetenzprüfungen im November 2012.<br />
In den USA 18 ist der Begriff Technology verbreitet. Aktuell läuft unter dem Begriff „ENG<strong>IN</strong>EER<strong>IN</strong>G<br />
ByDesign“ 19 ein Programm für die Schule, welches dem Design-‐Prozess gebührende Beachtung<br />
schenkt.<br />
In Australien wird gemäss Lehrplänen von New South Wales für den technischen Bereich „De-‐<br />
sign and Technology“ und für den textilen Bereich „Textile Technology“ verwendet. 20<br />
In Singapur hat das Ministry of Education den Lehrplan mit den Begriffen „Design and Technolo-‐<br />
gy“ erlassen. 21<br />
12<br />
Meret, Ernst (2011): Jetzt lernen die Ingenieure die Sprache der Gestalter. S. 22-‐27.<br />
13<br />
Jansen, Diethard (2010): Der gemeinsame Nenner. S.75.<br />
14 14<br />
Kurz & Zebner (2011) in Eisele und Bürdek (2001). Design. 21. Jahrhundert.<br />
15<br />
Verband in Grossbritannien: http://www.data.org.uk.<br />
16<br />
Oelkers, Jürgen und Reusser, Kurt (2008): Qualität entwickeln -‐ Standards sichern – mit Differenzen umgehen.<br />
17 Universität Cambridge (2009): Examination in November 2012. University of Cambridge.<br />
18 USA (2011): Internationale Technology und Ingenieur-‐Vereinigung (STEM).<br />
19 USA (2011): International Technology and Engineering Educators Association.<br />
20 Lehrplan New South Wales NSW (2003): Boards of Studies NSW. Sydney.<br />
11
1 VORWORT<br />
Selbst aus Samoa gibt es Unterlagen zum Fach „Design and Technology“ und zum „The Design<br />
Prozess“. 22 Die Suche ist nicht abschliessend.<br />
1.5.6 Lehrmittel für die Lehrperson<br />
In den Lehrmitteln für die Lehrpersonen werden die zu ihrer Entstehungszeit fachdidaktischen<br />
Inhalte thematisiert. In einzelnen Fachgebieten werden sie in der Praxis auch dann noch ver-‐<br />
wendet, wenn sich die Fachdidaktik in der Zwischenzeit weiter entwickelt hat. Die bewährten<br />
Lehrmittel werden weiterhin verwendet und aus Sicht der Ausbildungsinstitutionen und Auf-‐<br />
sichtsbehörden als sogenannte „versteckte Lehrpläne“ erlebt.<br />
Für die folgende ausgewählte Übersicht werden Publikationen herangezogen, welche in den<br />
Fächern Technische und Textile Gestaltung verwendet werden.<br />
a) Formen – Falten – Feilen (2002) 23 : Im Sammelordner sind Unterlagen für die Unter-‐ und Mit-‐<br />
telstufe der Volksschule zusammengestellt. Die Themenbereiche sind Ausdruck -‐ Spiel, Ge-‐<br />
brauchsgegenstände -‐ Hilfsmittel, Bauen und Bewegung -‐Fahrzeug -‐ Maschinen.<br />
Fazit: Die Themen sind immer noch aktuell.<br />
b) Werkfelder 1 und 2 (2002) 24 : Werkfelder 1 ist ein „Fundus für das konstruktive und plastische<br />
Gestalten.“ Die Kapitel sind Wohnen, Bauen, Konstruieren; Klang, Ton, Geräusche -‐ Energie,<br />
Antrieb, Bewegung – Schmuck -‐ Weitere Themenbereiche und Berichte. Werkfelder 2 befasst<br />
sich mit den Grundlagen zum Gestaltungsprozess, mit Werkstoffen, Techniken und Werkzeugen.<br />
Fazit: Anregungen und Beispiele für die Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler für Werkfel-‐<br />
der 1 und viel Sachwissen kurz zusammengefasst für Werkfelder 2.<br />
c) Fadenflip 1 und 2 (2001) 25 : Das Lehrmittel „fadenflip – Textiles Gestalten 1“ hat zum Thema<br />
„die Textilen Techniken und Gestalten“. Band 2 bringt „Nähgrundlagen, Schnittmuster, Nähen,<br />
Tricot, Patchwork, Flicken, Leder“ und „Rund um Textilien“ als Kapitelüberschriften.<br />
Fazit: Der Fokus liegt bei Materialkenntnissen, Technologien und Gestaltung.<br />
d) Textildidaktik (2005) 26 : Ein umfassendes Lehrwerk mit Stichwörtern wie „Erfahrungsfelder,<br />
Fachgeschichte, Fachdidaktische Grundlagen, Kulturwissenschaftliche Didaktikkonzepte, Ästheti-‐<br />
sche Bildung, Biographisches Lernen, Konstruktivistische Fachdidaktik, Kreativität, Neurobiolo-‐<br />
gie, Methodische Entscheidungen, pädagogische Diagnostik im Textilunterricht“.<br />
Fazit: Das Werk ist auf dem Weg zur Fachwissenschaftlicher Abstützung.<br />
21 Ministerium für Erziehung Singapur (2006): Design & Technology Syllabus.<br />
22 Samoa (ohne Datum): Design and Technonogy. The Design Process.<br />
23<br />
Nell, Peter et al. (2002): Formen, Falten, Feilen.<br />
24<br />
Speiser Niggli, Verena (2002): Werkfelder 1 und 2 (2002).<br />
25<br />
Lehrmittelverlag des Kantons St. Gallen (2008).<br />
26<br />
Kolhoff-‐Kahl, Iris (2005): Textildidaktik. Eine Einführung.<br />
12
1 VORWORT<br />
e) Fachdidaktik Technisches Gestalten / Werken (2003) 27 : Fachgeschichte, Fachverständnis,<br />
Ästhetische Bildung, Technik und technische Bildung, Didaktische Perspektive, Bezugswissen-‐<br />
schaftliche Perspektive und Infrastruktur.<br />
Fazit: Die Bezugswissenschaften und die Fachdidaktik werden eingehend thematisiert. Das<br />
Lehrmittel ist für die Technische und die Textile Gestaltung mit gemeinsamen Grundlagen konzi-‐<br />
piert.<br />
f) Werkweiser 1-‐3 (2002) 28 : Grundlagen, Unterrichtsvorhaben und im Anhang die Werkstoffe,<br />
Werkzeuge und Verfahren.<br />
Fazit: Ein Lehrmittel für die Technische und Textile Gestaltung, wobei das Material fächerüber-‐<br />
greifend verwendet wird. Die fachspezifischen Lernformen (S. 17) sind ein wichtiger Bestandteil<br />
der Fachdidaktik. Die didaktischen Schritte (S. 16) und die Phasen der Problemlösung basieren<br />
weitgehend auf der Planung einer „thematischen Unterrichtseinheit“ (S.15) durch die Lehrper-‐<br />
son. Wissenschaftliche Bezugsdisziplinen werden nicht thematisiert.<br />
1.5.7 Fachverbände<br />
Die Fachverbände der drei Gestaltungsfächer publizieren eigene Fachzeitschriften und setzen<br />
sich schulpolitisch für die Lehrpersonen und ihr Fach ein. Die inhaltlich nächsten Verbände sind:<br />
a) Schweizerischer Verband der LehrerInnen für bildnerische Gestaltung LBG/EAV,<br />
b) <strong>swv</strong> Design und Technik 29 , schweizerischer Werklehrerinnen-‐ und Werklehrerverein,<br />
c) LCH-‐tw 30 ist der Berufsverband der Lehrerinnen für Textile Gestaltung.<br />
1.5.8 Fachdidaktik-‐Lehrpersonen und Berufsverbände<br />
Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe 31 aus Fachverbänden und Vertretungen der Pädagogischen<br />
Hochschulen erarbeitete im Hinblick auf den Lehrplans 21 32 einen Vorschlag für die Fachbegriffe<br />
im Bildungsbereich: „Künste“ (Kunst, Design, Musik) anstelle des Vorschlags für den LP 21 Musik,<br />
Kunst und Gestaltung. Die zwei Bereiche (Fachbereiche): „Kunst und Design“, Unterteilung bei<br />
zwei Bereichen: „Design und Technik“ und „Bild und Kunst“.<br />
Design und<br />
Technik<br />
Abbildung 3: Vorschlag der Arbeitsgruppe<br />
27<br />
Birri, Christian et al. (2002): Didaktik Technische und Textile Gestaltung.<br />
28<br />
Dittli, Viktor et al. (2002): Werkweiser 3.<br />
29<br />
<strong>swv</strong> design und technik, Schweizerischer Werklehrerinnen-‐ und Werklehrerverein.<br />
30<br />
LCH-‐tw: Berufsverband der Lehrerinnen für Textile Gestaltung.<br />
31<br />
Arbeitsgruppe der SGL (Schweizerische Gesellschaft für Lehrerinnen-‐ und Lehrerbildung).<br />
32 Grundlagen für den Lehrplan 21.<br />
Kunst und<br />
Design<br />
Bild und<br />
Kunst<br />
13
1 VORWORT<br />
1.6 HYPOTHESEN<br />
Die folgenden vier Hypothesen beziehen sich auf die Schulfächer „Technische Gestaltung“ und<br />
„Textile Gestaltung“.<br />
Hypothese 1<br />
Es existiert bis jetzt noch keine allgemein anerkannte wissenschaftliche Bezugsdisziplin für diese<br />
Schulfächer.<br />
Hypothese 2<br />
In den Lehrplänen der Volksschule lassen sich Vorgehensweisen, Inhalte und Tätigkeiten fest-‐<br />
stellen, welche auch in professionellen Prozessen und -‐produkten im Zusammenhang mit Design<br />
Bestandteile der Tätigkeiten von Designern sind.<br />
Hypothese 3<br />
Design gehört aufgrund der Bezeichnungen der Studiengänge an Fachhochschulen und Universi-‐<br />
täten zu den Bezugswissenschaften.<br />
Hypothese 4<br />
Design als Bezugswissenschaft passt besser als andere in Frage kommende Wissenschaften zu<br />
den prozess-‐ und produktorientierten kreativen und handwerklichen Tätigkeiten von Gestalten<br />
und Erfinden.<br />
1.7 KONZEPT <strong>DER</strong> VORGEHENSWEISE<br />
Der Ausgangspunkt bildet eine Sekundäranalyse von „Bildung in zweitausend Zielen“ (Fries et<br />
al., 2007) 33 . Das Ziel ist die Darstellung der unterschiedlichen „Sprachen“ in Fachbüchern über<br />
Design und in der Darstellung von Lehrplänen in der Volksschulstufe und das Auffinden von Ge-‐<br />
meinsamkeiten und Unterschieden. Als Modell für die Darstellung wird ein Vergleichsraster ge-‐<br />
sucht. Als Vergleichsmenge wurden die Daten aus Design Basics von Heufler (2006) 34 gewählt.<br />
Sie ersetzen die geplanten Daten aus Lidwell (2003) 35 und Brandes (2009) 36 . Diese sind auf ei-‐<br />
nem zu hohen Abstraktionsniveau, um eine praktikable Vergleichsgrösse mit den Daten aus den<br />
Lehrplänen zu generieren.<br />
33 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007): Bildung in Zweitausend Zielen.<br />
34 Heufler, Gerhard (2006): <strong>DESIGN</strong> BASICS. Von der Idee zum Produkt.<br />
35 Lidwell, William et al. (2003): Design. Die 100 Prinzipien für erfolgreiche Gestaltung.<br />
36 Brandes, Uta et al. (2009): Designtheorie und Designforschung.<br />
14
1 VORWORT<br />
1.7.1 Übersicht<br />
Die Darstellung des Vorgehens, welches sich im Laufe des Arbeitsprozesses erweiterte.<br />
Abbildung 4: Übersicht über die Vorgehensweise<br />
1.7.2 Vergleichsmengen<br />
Fries et al. (2007) 37 untersuchten die Lehrpläne der Deutschschweiz anhand der verwendeten<br />
Begriffe. Dieses Vorgehen eignet sich für ähnliche Textsorten: Zielorientierte Lehrpläne aus der<br />
Schweiz konnten auf diese Art sehr gut verglichen werden. Für einen Vergleich über diesen Kon-‐<br />
text hinaus musste ein weiteres adäquates Verfahren herangezogen werden.<br />
37 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007) Bildung in zweitausend Zielen.<br />
15
1 VORWORT<br />
Die Reduktion der Komplexität konnte durch gemeinsame Nenner erreicht werden. In „Bildung<br />
in zweitausend Zielen“ (Fries et al. 2007) 38 wurden dazu die Nomen und später im Verlauf der<br />
Untersuchung auch die Verben verwendet. Das ergab das erste Konzentrat.<br />
Täsgkeiten<br />
Produkte<br />
Inhalte<br />
Konzentrat aus<br />
2000 Ziele<br />
Abbildung 5: Zwei vergleichbare Mengen<br />
Die Vergleichsmenge wurde in einem Fachbuch mit Information über den Bereich Design vermu-‐<br />
tet, das durch Gerhard Heufler 39 geschrieben wurde. Dieses musste zuerst ähnlich wie bei der<br />
Vergleichsmenge gefiltert und auf das Wesentliche reduziert werden: auf die Nomen und Ver-‐<br />
ben, welche Design und den Designprozess beschreiben.<br />
Diese zwei Vergleichsmengen entstanden im Hinblick auf:<br />
a) Vergleich der Nomen (Inhalte, Produkte, Themen, Materialien)<br />
b) Vergleich der Verben (Tätigkeiten, Verhalten, Beschäftigungen)<br />
c) Einer Zusammenfassung aus diesen beiden Vergleichen.<br />
1.7.3 Kategoriensystem<br />
Täsgkeiten<br />
Das Kategoriensystem von Fries et al. (2007) 40 mit den 480 Relationen konnte für die Bearbei-‐<br />
tung der Thesen nicht verwendet werden. Es wurde ursprünglich eingesetzt für den Vergleich<br />
von gleichartigen Texten (Lehrplänen).<br />
38 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007): Bildung in zweitausend Zielen.<br />
39 Heufler, Gerhard (2006): <strong>DESIGN</strong> BASICS. Von der Idee zum Produkt.<br />
40 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007): Bildung in zweitausend Zielen. S. 19.<br />
Produkte<br />
Inhalte<br />
Konzentrat aus<br />
<strong>DESIGN</strong> BASICS<br />
16
1 VORWORT<br />
1.8 UNTERSUCHUNGSMETHODEN<br />
In der folgenden Untersuchung wurden verschiedene Instrumente eingesetzt, welche sich im<br />
Idealfall ergänzen.<br />
1.8.1 Literaturstudium<br />
In den Studiengängen der Universitäten und Fachhochschulen wird nach der Disziplin Design /<br />
Gestaltung gesucht. Die Disziplinen, die sich bei der Literaturrecherche als Alternativen aufdrän-‐<br />
gen, werden erfasst und in einzelne Untersuchungen miteinbezogen.<br />
1.8.2 Sekundäranalyse und Vergleichsmenge<br />
Mit Hilfe der Lehrpläne der Deutschschweiz im Gestaltungsbereich einerseits und dem Fachge-‐<br />
biet des Designs andererseits wird ein Vergleich der zwei Gebiete möglich.<br />
Die Daten von „Bildung in zweitausend Zielen“ (Fries et al.) 41 bilden die eine Menge. Die Publika-‐<br />
tion „<strong>DESIGN</strong> BASICS“ (Heufler 2006) 42 bildet die Vergleichsmenge. Die Begriffe der Kategorien<br />
stammen aus dem Glossar der Computerlinguistik der Universität Zürich 43 :<br />
„Die wichtigsten lexikalischen Kategorien sind: Nomen (N), Verben (V), Adjektive (A) und<br />
Präpositionen (P). Lexikalische Kategorien werden auch syntaktische Kategorien oder<br />
Klassen genannt.“<br />
Wenn ausschliesslich Wörter mit 5 und mehr Nennungen genommen werden, dann gibt es fol-‐<br />
gende Ausgangslage: Die Nomen sind bei Fries et al. die grösste Gruppe 44 (200 Nennungen). Die<br />
Anzahl der Verben ist geringer (130 Nennungen). Die Adjektive (70 Nennungen) wurden nicht<br />
untersucht, weil sie die Eigenschaften der Verben und Nomen genauer beschreiben, das Kon-‐<br />
zentrat aber wieder erweitern würden (z. B. „abbaubar, grafisch, plastisch, werkstoffgerecht,<br />
funktionsgerecht, ...“). Präpositionen wurden schon bereits bei Fries nicht untersucht und folg-‐<br />
lich nicht in weitere Überlegungen einbezogen.<br />
1.8.3 Quantitative Messung<br />
Mit dem Einsatz der Suchfunktion einer Software wurde die Häufigkeit der Wörter erhoben.<br />
Dabei wurde darauf geachtet, dass diese stets identisch durchgeführt wurde (ganze Wörtern<br />
und die Gross-‐ und Kleinschreibung beachtend).<br />
41<br />
Fries, Anna-‐Verena et al. (2007): Bildung in zweitausend Zielen. S. 33ff.<br />
42<br />
Heufler, Gerhard (2006): Design Basics.<br />
43<br />
Wortkategorien: http://kitt.cl.uzh.ch/kitt/clglossar/index.php/Lexikalische_Kategorie.<br />
44 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007): Bildung in zweitausend Zielen. S. 34.<br />
17
1 VORWORT<br />
1.8.4 Qualitative Messung<br />
Mit Hilfe des «duden online» 45 werden die inhaltliche Nähe (Synonyme) oder Distanz eingeteilt.<br />
Bei der Suche in Texten nach Nomen wird nicht mit Lexemen 46 gearbeitet, weil die Genauigkeit<br />
darunter leiden würde. Somit konnte vermieden werden, dass bereits gemeinsame Wortteile zu<br />
Übereinstimmungen führten. Werk, Werken, Werkzeug, werken, Werkbank, Werkstatt, etc.<br />
konnten somit differenziert werden.<br />
1.8.5 Vergleichsraster und Triangulation<br />
Mit Hilfe eines Vergleichsrasters ist eine Triangulation möglich. Die Triangulation stammt aus<br />
dem Kontext der qualitativen Forschung der Sozialwissenschaften. Das Ziel ist es, ermittelte<br />
Daten und deren Interpretation mit anderen Untersuchungsergebnissen zu vergleichen.<br />
Die Definition von Triangulation nach Flick 47 :<br />
„Triangulation beinhaltet die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven auf einen unter-‐<br />
suchten Gegenstand oder allgemeiner: bei der Beantwortung von Forschungsfragen.<br />
Diese Perspektiven können sich in unterschiedlichen Methoden, die angewandt werden,<br />
und/oder unterschiedlichen gewählten theoretischen Zugängen konkretisieren, wobei<br />
beides wiederum mit einander in Zusammenhang steht bzw. verknüpft werden sollte.<br />
Weiterhin bezieht sie sich auf die Kombination unterschiedlicher Datensorten jeweils<br />
vor dem Hintergrund der auf die Daten jeweils eingenommenen theoretischen Perspek-‐<br />
tiven. Diese Perspektiven sollten so weit als möglich gleichberechtigt und gleichermas-‐<br />
sen konsequent behandelt und umgesetzt werden. Durch die Triangulation (etwa ver-‐<br />
schiedener Methoden oder verschiedener Datensorten) sollte ein prinzipieller Erkennt-‐<br />
niszuwachs möglich sein, dass also bspw. Erkenntnis auf unterschiedliche Ebenen ge-‐<br />
wonnen werden, die damit weiter reichen, als es mit einem Zugang möglich wäre.“<br />
Als Vergleichsmaterialien werden Texte ausgewählt, welche zu den Fragestellungen Material<br />
liefern konnten. Die Auswahl wäre anhand des Internets eigentlich grenzenlos und hätte die<br />
Bewältigung verunmöglicht. So musste eine subjektive Auswahl getroffen werden, welche für<br />
das Bearbeiten der Fragen sinnvoll war.<br />
45 Duden online: http://www.duden.de/.<br />
46 Lexem: http://kitt.cl.uzh.ch/kitt/clglossar/index.php/Lexem.<br />
47 Flick, Uwe: Triangulation (2011): Eine Einführung. S12.<br />
18
1 VORWORT<br />
1.9 ABGRENZUNG<br />
Diese Arbeit fokussiert sich auf die eigentliche Fragestellung, ob Design als mögliche Bezugsdis-‐<br />
ziplin und als Fachbegriff für die Lehrpläne der Volksschule und für die Ausbildung der Lehrper-‐<br />
sonen geeignet ist. Offen bleibt, welche Begriffe in Zukunft für die gestalterischen Fächer ver-‐<br />
wendet werden sollen. Diese Entscheidung liegt bei den bildungspolitischen Entscheidungsträ-‐<br />
gern.<br />
Die Arbeit verfolgt nicht das Ziel, die gemeinsamen oder eigenen Inhalte und Tätigkeiten der<br />
drei Gestaltungsfächer 48 oder die Überschneidungen und die genaue Abgrenzung von Design<br />
und Technik darstellen.<br />
Im Zusammenhang mit Design ist der Bereich der Emotionen ein wichtiges Gebiet. Dies konnte<br />
in der Projektarbeit des Autors über die Nussknacker 49 untersucht und dargelegt werden. In<br />
dieser Arbeit wird das Thema darum nur am Rande erwähnt.<br />
In den untersuchten Gebieten mussten die Recherchen beschränkt werden. Dies gilt bei der<br />
Auswahl der gewählten Vergleichstexte. Der Autor wählte für Untersuchungen Texte aus, die für<br />
die Fragestellung potenzielle Aussagen liefern konnten. Zusätzlich halfen elektronisch verfügba-‐<br />
re Lehrpläne aus anderen Ländern den Vergleich durchzuführen.<br />
Der Sprachraum wurde nebst Österreich und Deutschland auf England und andere englischspra-‐<br />
chigen Länder ausgedehnt, weil ein Teil der in Frage kommenden Wörter englische Lehnwörter<br />
sind. Der Vergleich mit Frankreich und Italien wäre sicher auch interessant gewesen und könnte<br />
in weiteren Untersuchungen durchgeführt werden.<br />
Der Autor setzt sich für die bezugswissenschaftliche Perspektive der Fächer Technische und Tex-‐<br />
tile Gestaltung ein. Dass der ganze Bereich der Ingenieurwissenschaften (Technik) nicht genauer<br />
untersucht wurde, hängt mit der Fragestellung dieser Arbeit zusammen. Mit dem am Ende der<br />
Untersuchungen vorgeschlagenen Doppelbegriff „Design und Technik“ wird der Bedeutung von<br />
Technik Rechnung getragen. Vielleicht können so die Anstrengungen und Erfolge von IngCH 50<br />
und des Technorama 51 ergänzt werden, damit auch in Zukunft genügend Nachwuchs in den<br />
technischen Berufen vorhanden ist. Vielleicht wird sich das Verbessern, wenn sich die zwei Be-‐<br />
reiche Design und Technik annähern. Aber das ist ebenfalls nicht das Thema dieser Arbeit.<br />
48 Bildnerische Gestaltung, Technische Gestaltung und Textile Gestaltung.<br />
49 Aepli, Beat (2009): Knackig! – Design erleben. Einführung in das Design am Beispiel Nussknacker.<br />
50 IngCH: IngCH: Engineers shape our Future. http://www.ingch.ch/ (24.05.2011).<br />
51 Technorama, swiss science center. http://www.technorama.ch/(20.09.2011)<br />
19
2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />
2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />
2.1 VERSCHIEDENE SPRACHEN – VERSCHIEDENE SICHTWEISEN<br />
2.1.1 Babylonische Sprachverwirrung<br />
Die babylonische Sprachverwirrung ist allgemein bekannt als Beispiel dafür, dass die Menschen<br />
sich wegen unterschiedlicher Sprachen nicht verständigen konnten. Die Gefahr von Unverständ-‐<br />
nis besteht aber auch in Fachkreisen. Diese Arbeit befasst sich mit dem Verständnis innerhalb<br />
der gleichen Fachsprache im Bezug auf das untersuchte Forschungsfeld Design / Gestaltung.<br />
Selbst wenn die ausserschulischen Bezeichnungen weggelassen und nur auf den schulischen<br />
Bereich fokussiert wird, stellen sich bei der verwendeten Fachsprache im Zusammenhang mit<br />
dem Kontext folgende Fragen:<br />
• Wer? Sind es Lehrpersonen oder Vertretungen von Fachverbänden mit dem Hintergrund<br />
von Bildnerischer Gestaltung (Bild und Kunst), Lehrpersonen aus der Technischen Ge-‐<br />
staltung oder der Textilen Gestaltung?<br />
• Was? Ist es ein Text für die Behörden der Erziehungsdirektion, für die Studierende der<br />
betreffenden Fächer, für die Reglemente und Lehrpläne?<br />
• Wann? Wie aktuell ist der Text? Wurde er vor 10 Jahren (z.B. bei der letzten Lehrplanre-‐<br />
vision) geschrieben oder basiert er auf den aktuellen Ergebnissen?<br />
• Wo? In welchem Kanton und für welche Stufe wurde ein Text entworfen? Erweitert: In<br />
welchem Land?<br />
• Wie? Wurde der Text geschrieben, publiziert, in Reglementen abgelegt ...<br />
• Warum? Was war den Anlass zu diesem Text?<br />
• Woher? Welches sind die Argumente für diesen Text und woher stammen sie?<br />
2.1.2 Der Stein von Rosetta<br />
Ein klassisches Beispiel für den Gebrauch von unterschiedlichen Sprachen und Schriften in Bezug<br />
auf die Zielgruppen ist der Stein von Rosetta. Dieser Stein, der ursprünglich aus einem zerstörten<br />
Tempel stammen soll, wurde 1799 von Soldaten Napoleons in der Nähe von Rosetta entdeckt. Er<br />
gelangte als Kriegsbeute zu den Engländern und ist seit 1802 im British Museum in London 52<br />
ausgestellt. Berühmt wurde der Stein durch eine historische Leistung: Jean-‐François Champolli-‐<br />
on 53 gelang es 1822, mit Hilfe dieses Steins die Hieroglyphen zu entziffern.<br />
52 Britisches Museum: The history oft the Rosetta Stone.<br />
53 Kemling, Lene (2009): Der Stein von Rosetta.<br />
20
2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />
(Bild des Steins von Rosetta, siehe Literaturverzeichnis Britisches Museum)<br />
Abbildung 6: Stein von Rosetta, Foto Britisches Museum London<br />
Auf dem Stein sind Informationen des Herrschers Ptolomaios V in zwei Sprachen und drei Schrif-‐<br />
ten geschrieben: für die Herrscher in Altgriechisch, für die Beamten in Demotisch und für die<br />
Priester als Hieroglyphen.<br />
Ähnlich präsentieren sich Texte, aus dem Bereich Gestaltung. Es sind teilweise verschiedene<br />
Sprachen. Die Wörter, die verwendet werden, müssten allgemeingültig definiert und übersetzt<br />
werden, damit auch das Gleiche darunter verstanden wird. Es stellt sich die Frage, ob es auch<br />
möglich ist, Texte aus unterschiedlichen Kontexten zu übersetzten, dass die Inhalte vergleichbar<br />
werden.<br />
21
2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />
2.2 «BILDUNG <strong>IN</strong> 2000 ZIELEN» UND «<strong>DESIGN</strong> BASICS»<br />
Die wissenschaftliche Untersuchung Bildung in zweitausend Zielen 54 hatte zum Ziel, die Deutsch-‐<br />
schweizer Lehrpläne aus dem Blickwinkel der drei Gestaltungsfächer zu vergleichen.<br />
Diese Publikation wird nachfolgend mit 2000 Ziele bezeichnet und das verwendete Datenmate-‐<br />
rial bildet das Ausgangsmaterial für eine Zweitstudie. Die Auszählung der Wörter 55 in den Ziel-‐<br />
formulierungen aus den 14 Lehrplänen bildet somit das Rohmaterial für den Vergleich mit DE-‐<br />
SIGN-‐BASICS 56 .<br />
Existiert eine Schnittmenge zwischen den beiden Elementen A = Lehrpläne und B = Beschreibung<br />
von Produkte-‐Design? Wenn ja, wie gross ist sie? Wenn nein, woran liegt das?<br />
Menge A Menge B<br />
A B<br />
Abbildung 7: Schnittmenge der zwei Konzentrate<br />
2.2.1 Menge A: Nomen in «Bildung in 2000 Zielen»<br />
In den Lehrplänen 57 sind die Begriffe über Material führend: Materialien {192}, Farben {152} und<br />
Werkstoffe {89}. Gefolgt vom hergestellten Produkt: Bilder {93}, Produkte {73}, Gegenstände<br />
{58}, Objekte {51}, und Werke {44}. Die Mittel der Bearbeitung weisen ebenfalls hohe Nennun-‐<br />
gen auf: Werkzeuge {98} und Maschinen {58}. Weitere Nennungen: Design {11}, Mode {16}, Ge-‐<br />
staltung {22} , Gestalten {28}. Zusammengesetzt mit einem anderen Wort ist Gestaltung wesent-‐<br />
lich häufiger (117): davon als Gestaltungselement(e) {21}, Gestaltungsprozesse {13}, Gestal-‐<br />
tungsmittel {19}, Gestaltungsaufgabe(n) {14}, und Gestaltungsübungen {11}.<br />
� Die Daten dazu befinden sich im Anhang.<br />
54 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007): Bildung in zweitausend Zielen.<br />
55 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007) S. 33: Eingesetzte IT-‐Software MAX QDA.<br />
56 Heufler, Gerhard (2006): <strong>DESIGN</strong> BASICS. Von der Idee zum Produkt.<br />
57 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007): Teil III, Kantonale Matrices und Tabellen.<br />
22
2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />
2.2.2 Nomen im Design-‐Prozess von Heufler<br />
Die am häufigsten gewählten Nomen aus 2000 Ziele wurden den Schritten eines Designprozes-‐<br />
ses zugeordnet 58 . Mit genügend Hintergrundwissen zum Begriff Design gelingt es, alle Nomen<br />
einem der fünf Arbeitsschritte zuzuordnen.<br />
Abbildung 8: Designprozess<br />
Ausarbeiten:<br />
Realisieren:<br />
Objekte, Produkte,<br />
Werke,<br />
Zeichen, Bilder,<br />
Gegenstände,<br />
Figuren,<br />
Bedeutung<br />
Modell, Verfahren,<br />
Werkzeuge,<br />
Techniken,<br />
Bildzeichen,<br />
Raum,<br />
Arbeitsgeräte,<br />
Technik<br />
Die Zuordnung kann nur bedingt präzise erfolgen. Insofern kann der Vergleich nur bedingt ge-‐<br />
wichtet werden und wird im Zusammenhang mit weiteren Untersuchungen in die Schlussresul-‐<br />
tate einfliessen. Denkbar wäre auch die Verwendung des Schemas von Heufler 59 mit 4 Schritten<br />
siehe Abbildung 15 in dieser Arbeit. Die Lösung wäre annähernd identisch.<br />
Fazit: Das Resultat zeigt, dass eine grosse Schnittmenge von Nomen aus Lehrplänen (im Gestal-‐<br />
tungsbereich) mit Nomen zu einem Designprozess besteht.<br />
58 Grahl, Peter und Walch, Josef (2008): Praxis Kunst, Design. S. 57.<br />
59 Heufler, Gerhard (2007): Design Basics. S. 76.<br />
Entwerfen:<br />
Materialien,<br />
Farben, Wirkung,<br />
Ssmmung,<br />
Gesetzmässigkeiten,<br />
Gestaltungselemente<br />
Planen:<br />
Ideen,<br />
Beobachtungen,<br />
Vorstellungen,<br />
Zusammenhänge,<br />
Beziehung,<br />
Herkunft<br />
Konzipieren:<br />
Mi}el, Funksonen,<br />
Werkstoffe,<br />
Eigenscha en,<br />
Körper, Natur, Fläche,<br />
Ausdruck, Lösungen<br />
23
2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />
2.2.3 Menge B: Nomen in «Design-‐Basics»<br />
Ähnlich wie bei Fries et al. (2007) 60 wurde eine Zusammenstellung des Textes auf Grund der<br />
verwendeten Nomen aufgelistet. Die Untersuchung erstreckt sich über die 14 Kapitel.<br />
Nicht berücksichtigt wurden die Kapitel: Vorwort (wie bei den Lehrplänen nicht berücksichtigt),<br />
Design aus Produzentensicht (Ökonomie und Marketing wird in der Konsumentensicht berück-‐<br />
sichtigt), Design als Prozess (wird in einem eigenen Kapitel behandelt) und Fallstudien (sind zu<br />
detailliert behandelt).<br />
Beispiel für die Vorgehensweise im ersten Abschnitt<br />
Im ausgewählten Text über Design wurden die Nomen herausgefiltert, welche mit der Beschrei-‐<br />
bung von Design im Zusammenhang stehen. Die Nomen in der eckigen Klammer wurden nicht<br />
aufgenommen, weil sie nicht direkt mit der Beschreibung des Designs in Verbindung stehen. Bei<br />
der Umsetzung der Untersuchung wurden ab der zweiten Tabelle ausschliesslich die zentralen<br />
Begriffe verwendet. Sonst hätten die Beispiele (Seite 22 in Heufler) wie Hände, Speisen, Mund,<br />
Besteck, Messer, Tisch, Gläser, Servietten, Schüsseln, Tischdecke, Tisch, Stühle, Leuchten, Spei-‐<br />
sen, Getränke etc. den eigentlichen Ausgangspunkt und die Untersuchungsanlage verfälscht.<br />
Diese Ebene von Gegenstands-‐ oder Produktbezeichnungen findet sich in den Lehrplänen nicht<br />
und würde zudem für einen Vergleich nicht dienlich sein. Es braucht wie es Fries et al. (S. 18)<br />
formulieren „ein Untersuchungsinstrument, das das Einhalten einer Distanz zum Untersu-‐<br />
chungsgegenstand möglich macht.“<br />
In der vorliegenden Untersuchung wird dies erreicht, indem die Texte nach bestimmten Vorga-‐<br />
ben ausgewählt (Wörter mussten einen offensichtlichen Zusammenhang mit der Beschreibung<br />
des Design haben, über die Besonderheiten, Inhalte und Tätigkeiten).<br />
Nun als Beispiel der Originaltext aus Heufler aus dem Kapitel „Vorbemerkung zur Konsumenten-‐<br />
sicht“ 61 . Er wurde grau markiert und die Nomen in die nachfolgende Tabelle eingefügt.<br />
„Eines der grössten Probleme für den Konsumenten ist die Beurteilung der Produktqualität.<br />
Diese Beurteilung erfolgt meist rein intuitiv und bleibt gern an der Oberfläche hängen. Zudem<br />
werden nur Teilaspekte des Produktes erfasst und erhoben. Auf [Grund} dieser unbefriedigen-‐<br />
den Form der Produktbeurteilung wurden verschiedene Methoden der Produktanalyse entwi-‐<br />
ckelt.<br />
Um die Objektivität des Verfahrens z. B. zu erhöhen, wurden wissenschaftliche Methoden einge-‐<br />
führt, womit die [Behauptung] „[Design] ist messbar geworden“ verbunden wurde.<br />
[Dieser problematischen Entwicklung soll ein Zitat des Astronomen Rudolf Kühn entgegengehal-‐<br />
ten werden: „...“]<br />
60 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007): Bildung in zweitausend Zielen.<br />
61 Heufler, Gerhard (2006), S. 21-‐25.<br />
24
2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />
Daraus kann klar abgeleitet werden, dass eine einseitige Verwissenschaftlichung Gefahren in<br />
sich birgt. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Die [Antwort] auf diese [Problematik]<br />
kann nur in einer ganzheitlichen Betrachtungsweise liegen.<br />
Auf designtheoretische [Arbeiten] von [Jochen Gors], [Berd Löbach] und [Arnold Schürer] auf-‐<br />
bauend, wurde das nachfolgend geschilderte Modell entwickelt. Dabei wird ein Produkt als Trä-‐<br />
ger unterschiedlichsten Funktionen gesehen, die auf den Menschen und seine Umgebung ein-‐<br />
wirken. Um dieses komplexe [Thema] zu veranschaulichen, wird dies im folgenden [Text] viel-‐<br />
fach am [Beispiel] [„Essbesteck“] verdeutlicht. …“<br />
Die so erhaltenen Nomen wurden in einer Tabelle aufgelistet:<br />
Tabelle 2: Design aus Konsumentensicht, Heufler S. 21<br />
Problem Konsument Produktqualität Beurteilung<br />
Oberfläche Teilaspekt Teilqualität Gesamtqualität<br />
Produktbeurteilung Methoden Produktanalyse Objektivität<br />
Verfahren Betrachtungsweise Verwissenschaftlichung Konsequenzen<br />
Modell Produkt Träger Funktionen<br />
Umgebung<br />
Abgebildet ist die erste Tabelle der Kapitel a-‐n.<br />
2.2.4 Nomen Lehrplan und Nomen Designprozess<br />
Alle Kapitel aus <strong>DESIGN</strong> BASICS ergaben mit der vorgestellten Vorgehensweise 293 Nomen. Der<br />
Wert nach dem Begriff zeigt die Anzahl Übereinstimmungen mit diesem Begriff. Die Felder mit<br />
Treffern wurden zusätzlich grau markiert.<br />
Tabelle 3: Vergleichsraster mit den meistgebrauchte Nomen aus „2000 Ziele“<br />
Material 2 Farbe(n) 1 Werkstoff(e) 0 Werkzeug(e) 0<br />
Bild(er) 0 Produkt 5 Gegenstand 0 Wirkung 0<br />
Verfahren 1 Objekt 3 Funktion(en) 6 Technik(en) 0<br />
Maschinen 0 Mittel 0 Bedeutung 0 Beziehung 3<br />
Vorstellungen 0 Zusammenhang 0 Raum 1 Eigenschaften 0<br />
Ideen 0 Körper 0 Werke 0 Figuren 0<br />
Form 2 Arbeitsgeräte 0 Gesetzmässigkeiten 0 Modell 2<br />
Beobachtungen 0 Natur 0 Fläche 0 Lösungen 0<br />
Gestaltungselemente 1 Gestaltungsprozess 0 Herstellungsprozess 0 Ausdruck 0<br />
Bildzeichen 0 Gestaltung 0 Herkunft 0 Sinne 1<br />
Gestaltungsmittel 0 Vorstellungskraft Zeichen 0 Accessoire(s) 0<br />
25
2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />
Stimmung 0 Zusammenspiel 0 Erlebnis(se) 1 Gruppe 0<br />
Es fällt auf, dass viele Bezeichnungen von Nomen in der Nähe der gesuchten Begriffe sind (z. B.<br />
Herstellungsprozess entspricht etwa dem Herstellungsverfahren, dem Designprozess oder auch<br />
dem Problemlösungsprozess) oder kommen in zusammengesetzten Wörtern vor (z. B. die Grup-‐<br />
pe in Gruppenbildung, Gruppenzugehörigkeit, Zielgruppendefinition). Andere sind im Suchraster<br />
bereits mehrfach vorhanden (z.B. Werkstoff gehört auch zu Material, Gegenstand zu Produkt,<br />
die Techniken zu den Verfahren).<br />
Fazit: Von den 48 meistverwendeten Nomen der Lehrpläne nach Fries haben 13 einen identi-‐<br />
schen Begriff in der Beschreibung von Design bei Heufler. Die Schnittmenge ist in geringem Mas-‐<br />
se vorhanden, wenn inhaltliche Ähnlichkeiten nicht berücksichtigt werden.<br />
2.2.5 Vergleichsraster mit Klassierung<br />
Im Vergleichsraster über die Kapitel a – n wurden die ausgewählten Nomen aus dem Text-‐<br />
Konzentrat von Heufler als Vergleichsraster verwendet und mit den Nomen aus den Lehrplänen<br />
verglichen und klassiert. Dazwischen wird ein Symbol zugeordnet und die Klassierung und Eintei-‐<br />
lung wird mit einer Texthervorhebung gekennzeichnet.<br />
Legende für die Quelle der Einteilung:<br />
Legende, gilt auch für die folgenden Seiten:<br />
D. für Duden online 62 und A. für Autor.<br />
Nomen Designprozess (normale senkrechte Schrift); Menge B von Kapitel 2.2<br />
Nomen Lehrpläne (kursive Schrift), Menge A von Kapitel 2.2<br />
= gleich oder fast gleich (synonym) (dunkles Feld)<br />
≈ im weiteren Sinn vergleichbar (mittleres Feld)<br />
≠ nicht gleich, eigenständig (helles Feld)<br />
Tabelle 4: Vorbemerkung zur Konsumentensicht, Heufler S. 21<br />
Problem = Problem Konsument = Menschen<br />
(A.)<br />
Produktqualität = Eigenschaf-‐<br />
ten (D.)<br />
Oberfläche = Oberfläche Teilaspekt = Aspekte (A.) Teilqualität = Eigenschaften<br />
(D.)<br />
Produktbeurteilung ≈ Er-‐<br />
kenntnisse (D.)<br />
Verfahren = Herstellungsver-‐<br />
fahren (D.)<br />
Methoden = Verfahren (D.) Produktanalyse ≈ Darstellung<br />
Betrachtungsweise = Aspekte<br />
(D.)<br />
62 http://www.duden.de/suchen/dudenonline (03-‐07-‐2011).<br />
(D.)<br />
Verwissenschaftlichung ≈<br />
Erkenntnis, Entwicklung (D.)<br />
26<br />
Beurteilung ≈ Erkenntnisse,<br />
Beurteilungskriterien (D.)<br />
Gesamtqualität = Eigenschaf-‐<br />
ten (D.)<br />
Objektivität ≈ Beurteilungskri-‐<br />
terien (D.)<br />
Konsequenzen = Wirkungen<br />
(D.)
2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />
Modell = Modell Produkt = Produkt Träger ≈ Funktion (D.) Funktionen = Funktionen<br />
Umgebung = Umgebung<br />
Zwischenresultat: 15 von 21 Begriffen sind gleich oder synonym, 6 sind im weiteren Sinn vergleichbar.<br />
In den Tabellen 6 -‐ 19 werden als „Konzentrat“ die zentralen Begriffe verwendet.<br />
Tabelle 5: Mensch/Objekt/Raum-‐Bezüge, Heufler S. 22-‐25<br />
Mensch = Mensch Objekt = Objekt Raum = Raum Humanbezug ≈ Mensch<br />
Umgebungsbezüge = Umge-‐<br />
bung, Mitwelt, Umfeld (A.)<br />
Gebrauchsprozess ≈ Verwen-‐<br />
dungsmöglichkeiten, Konsum-‐<br />
verhalten (A.)<br />
Benutzerebene = Verwen-‐<br />
dungsmöglichkeiten, Konsum-‐<br />
verhalten (A.)<br />
Betrachterebene = Wirkung<br />
(A.)<br />
Freude = Freude Sinn ≈ Interesse, Wirkungs-‐<br />
möglichkeit<br />
(D.)<br />
(D.)<br />
27<br />
Besitzerebene = Mensch (A.)<br />
Zwischenresultat: 8 von 11 Begriffen sind gleich oder synonym, 3 sind im weiteren Sinn vergleichbar.<br />
Tabelle 6: Praktische Funktionen, Heufler S. 26-‐31<br />
Anschaffung ≈ Herkunft,<br />
Werkstofflieferanten (D.)<br />
Entsorgung = Entsorgung Ökologie ≈ Umwelt, Entsor-‐<br />
Beherrschbarkeit = Handha-‐<br />
bung (A.)<br />
Kurzzeit-‐ bzw. Wegwerfpro-‐<br />
dukt ≈ Entsorgung (A.)<br />
Transport ≈ Handel (D.) Lagerung ≈ Raum, Planung<br />
gung (A.)<br />
Sicherheit = Unfallverhütung<br />
(A.)<br />
Rohstoffe ≈ Werkstoffwahl,<br />
Gewinnungsverfahren (A.)<br />
(D.)<br />
Nützlichkeitsansprüche ≈<br />
Wirkungsmöglichkeiten (A.)<br />
Pflege -‐ Instandstellung =<br />
Pflege<br />
Energie ≈ Entstehungsprozess,<br />
Maschinen, Materialien (A.)<br />
Zwischenresultat: 6 von 16 sind gleich oder synonym, 10 sind im weiteren Sinn vergleichbar.<br />
Tabelle 7: Produktfunktionen und Funktionsebenen im Design, Heufler S.32-‐35<br />
Nutzung = Anwendung<br />
(A.)<br />
Brauchbarkeit ≈ Wirkungs-‐<br />
möglichkeiten (A.)<br />
Haltbarkeit -‐ Reparierbarkeit<br />
≈ Pflege (A.)<br />
Beziehung = Beziehung<br />
Benutzer = Menschen (A.) Produkt = Produkt Funktionen = Funktionen Praktische Funktion = Funk-‐<br />
Produktsprachliche Funktio-‐<br />
nen (Semiotik) ≈ Funktion (A.)<br />
Ästhetische Funktionen ≈<br />
Funktion (A.)<br />
Anzeichenfunktionen ≈ Funkti-‐<br />
on (A.)<br />
Zwischenresultat: 4 von 8 sind gleich oder synonym, 4 sind im weiteren Sinn vergleichbar.<br />
Tabelle 8: Ästhetische Funktionen Heufler, S. 36-‐43<br />
Gestalt = Gestaltung (D.) Gestaltelemente = Gestaltungs-‐<br />
elemente<br />
tion (A.)<br />
Symbolische Funktionen ≈<br />
Funktion (A.)<br />
Form = Form Material = Material
2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />
Oberfläche = Oberfläche Farbe = Farbe Komplexität ≈ Eigenheiten,<br />
Eigenschaften (A.)<br />
Ordnung = Gliederung (A.) Banalität ≈ Eigenheiten, Eigen-‐<br />
schaften (A.)<br />
Originalität = Original, Einma-‐<br />
ligkeit (A.)<br />
Zwischenresultat: 8 von 10 Begriffen sind gleich oder synonym, 2 sind im weiteren Sinn vergleichbar.<br />
Tabelle 9: Produktsemantik Heufler, S. 44-‐47<br />
Designqualität ≈ Gestaltung,<br />
Lösungen, Beurteilungskrite-‐<br />
rien (A.)<br />
Uniformität ≈ Wirkung,<br />
Eigenschaften (A.)<br />
Kommunikationswissenschaft ≠ Psychologie ≠ Soziologie ≠<br />
Identitätsverlust ≠ Bedienungsprobleme ≠ Bedeutungsträger ≠<br />
Zwischenresultat: 2 von 8 Begriffen sind im weiteren Sinn ähnlich, 6 von 8 sind eigenständig<br />
Tabelle 10: Anzeichenfunktion Heufler, S. 48-‐51<br />
Abgrenzung ≠ Gruppenbildung ≈ Gruppen Oberflächenstrukturen =<br />
Textur (D.)<br />
Ausrichtung ≠ Standfestigkeit ≈ Statik (D.) Stabilität ≈ Statik (D.) Präzision ≠<br />
Veränderbarkeit / Beweglich-‐<br />
keit ≈ Veränderungen (A.)<br />
Bedienen = Handhabung (A.) Überschaubarkeit ≠<br />
28<br />
Farbkontraste = Farbkontras-‐<br />
Zwischenresultat: 3 von 11 Begriffen sind gleich oder synonym, 4 sind im weiteren Sinn vergleichbar und 4 eigen-‐<br />
ständig.<br />
Tabelle 11: Symbolfunktionen, Heufler, S. 52-‐57<br />
Form = Form Funktion = Funktion Emotion = Emotion Freude (fun) = Freude<br />
Zeitgeist-‐Gegenwartsbezug ≠ Gruppenzugehörigkeit –<br />
Status ≠<br />
Anpassung ≠ Unterscheidung = Unter-‐<br />
schiede (A.)<br />
Gefühlsbindung – Objektbe-‐<br />
setzung = Beziehung (A.)<br />
Zielgruppendefinition ≈<br />
Beziehung, Mensch, Konsum-‐<br />
verhalten (A.)<br />
te<br />
Mode = Mode<br />
Zwischenresultat: 7 von 11 Begriffen sind gleich oder synonym, 1 ist im weiteren Sinn vergleichbar, 3 sind eigen-‐<br />
ständig.<br />
Tabelle 12: Produktanalyse, S. 58-‐61<br />
Funktionsanalyse ≈ Funktio-‐<br />
nen, Darstellung (A.)<br />
Wiederverkaufswert ≠ Anforderungsprofil ≈ Bedürf-‐<br />
nisse (A.)<br />
Produktqualität ≈ Beurtei-‐<br />
lungskriterien (A.)<br />
Kostenanalyse ≠ Anschaffungskosten ≠ Unterhaltskosten ≠<br />
Beurteilung ≈ Beurteilungskri-‐<br />
terien (A.)<br />
Eigenschaftenprofil ≈ Beurtei-‐<br />
lungskriterien (A.)
2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />
Zwischenresultat: 5 von 9 Begriffen sind im weitere Sinn vergleichbar, 4 sind eigenständig.<br />
Tabelle 13: Vorbemerkungen zum Designprozess, Heufler S. 71<br />
Produktentwicklung = Ent-‐<br />
wicklung, Gestaltungsprozess<br />
(A.)<br />
Ergebnis = Lösung, Produkt,<br />
Objekt (D.)<br />
Verschwiegenheit ≠ Wettbewerbssituation ≈<br />
Konsumverhalten (A.)<br />
Prototyp = Modell, Lösung,<br />
Produkt, Original (D.)<br />
Vorserienmuster = Modell,<br />
Lösung, (A.)<br />
Geheimhaltungspflicht ≠ Markt ≠<br />
Konkurrenz ≠ Einbindung ≠ Unternehmensstruktur ≠ Interessenkonflikte ≠<br />
Zielvorgabe ≈ Gestaltungs-‐<br />
aufgabe (A.)<br />
Produkt = Produkt<br />
Zwischenresultat: 5 von 14 Begriffen sind gleich oder synonym, 2 sind im weiteren Sinn vergleichbar und 7 sind<br />
eigenständig.<br />
Tabelle 14: 10 Kriterien für qualitätsvolles Design, (nach: Lindinger, Herbert 63 ) in Heufler S. 71-‐72<br />
Nutzen, Nutzung ≈ Wirkungs-‐<br />
möglichkeit (A.)<br />
Ergonomische Anpassung ≈<br />
Handhabung (A.)<br />
Sicherheit ≈ Unfallverhütung<br />
(A.)<br />
Eigenständigkeit ≈ Eigenschaf-‐<br />
ten (A.)<br />
Beziehung = Beziehung Produkt-‐Nachbarschaft =<br />
Umgebung, Umfeld (A.)<br />
Farben = Farben Materialqualitäten = Materi-‐<br />
aleigenschaften<br />
Produkt = Produkt Umweltfreundlichkeit ≈ Um-‐<br />
welt (A.)<br />
Lebensdauer ≈ Materialeigen-‐<br />
schaften (A.)<br />
29<br />
Gültigkeit ≈ Wirkungsmöglich-‐<br />
keiten (A.)<br />
Nachahmung (Plagiat) ≠ Umfeld = Umfeld<br />
Angemessenheit ≠ Formen = Form<br />
Gebrauch = Anwendung (D.) Stellenwert ≠<br />
Herstellung = Produktion (D.) Gebrauchsvisualisierung ≈<br />
Zeichensprache (A.)<br />
Funktion = Funktion Objekt = Objekt Handhabung = Handhabung Gestaltungsqualität ≈ Lösun-‐<br />
gen (A.)<br />
Aufbau = Gliederung (D.) Erkennbarkeit ≈ Zeichenspra-‐<br />
Skelettbauweise ≈ Gestal-‐<br />
tungselemente (A.)<br />
che (A.)<br />
Formenprinzip ≈ Form (A.) Schalenbauweise ≈ Konstruk-‐<br />
tionen (A.)<br />
Beziehung = Beziehung Ganze ≈ Objekt, Produkt (A.) Teile = Elemente (A.)<br />
Formen = Form Volumen ≠ Masse ≠ Produktgrafik ≠<br />
63 Lindinger, Herbert: iF Industrie Forum Design Hannover in Designwissen von Haase et al. (2002), S. 74-‐76.
2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />
Durchgängigkeit ≠ Konstruktionsprinzipien =<br />
Konstruktionen (A.)<br />
Gestaltungsprinzipien = Ge-‐<br />
staltungselemente (A.)<br />
Prägnanz ≠ Eindeutigkeit ≈ Gestaltung Gestaltungselemente = Ge-‐<br />
staltungselemente<br />
Konsequenz ≠<br />
30<br />
Formübergänge = Form (A.)<br />
Kontraste ≠ Schriften = Schriften Proportionen = Proportionen Gliederung = Gestaltung (A.)<br />
Einklang ≠ Herstellung = Herstellungspro-‐<br />
zesse, Umsetzung (A.)<br />
Montage ≈ Konstruktion (A.) Wartung ≠<br />
Teile = Elemente (D.) Störungsfreiheit ≠ Vermeidung ≠ Irritation ≈ Emotion (A.)<br />
Blendung ≠ Fehlinformation ≠ Logik ≈ Regeln, Gesetzmässig-‐<br />
keit (D.)<br />
Herstellungsverfahren =<br />
Herstellungsprozess (A.)<br />
Gebrauch = Anwendung (A.) Gesamtwirkung = Wirkung,<br />
Gestaltung (A.)<br />
Material = Material<br />
Nutzer = Mensch (A.)<br />
Sinne = Sinne Neugierde ≈ Interesse (D.) Spielen = Spiele Gestalten = Gestaltung<br />
Lust = Freude (D.) Witz ≈ Emotionen (A.) Ironie ≈ Emotion (A.) Verfremdung ≈ Emotion (A.)<br />
Identifikation ≠ Objekt = Objekt Branche ≠ Kriterien = Kriterien<br />
Wertmassstäbe ≈ Kriterien<br />
(D.)<br />
Veränderung ≈ Entwicklung<br />
(D.)<br />
Industrieprodukte = Produkte<br />
(A.)<br />
Spannungsfeld ≠<br />
Fortschritt ≈ Entwicklung (D.) Wandel ≈ Entwicklung (D.) Gegebenheiten ≠ Entwicklungen = Entwicklung<br />
Künste ≠ Architektur ≠ Design = Design<br />
Zwischenresultat: 39 von 87 sind gleich oder synonym, 26 sind im weiteren Sinn vergleichbar, 22 sind eigenständig.<br />
Tabelle 15: Produktbestimmende Faktoren, Heufler S. 73, das auf Schürer aufbaut<br />
Menschenbezogene Faktoren<br />
≠<br />
Produkt-‐Gestalt = Gestaltung,<br />
Form (A.)<br />
Technische Faktoren ≠ Ökologische Faktoren ≠ Wirtschaftliche Faktoren ≠<br />
Werkstoffwahl ≈ Material (A.) Herstellungsverfahren =<br />
Lohnkosten ≠ Rohstoffverbrauch ≈ Umwelt,<br />
Mitwelt (A.)<br />
Herstellungsprozess (A.)<br />
Energieverbrauch ≈ Umwelt,<br />
Mitwelt (A.)<br />
Material-‐, Werkzeug-‐ kosten ≠<br />
Umweltbelastung ≈ Umwelt,<br />
Mitwelt (A.)<br />
Zwischenresultat: 2 von 12 ist gleich oder synonym, 4 sind im weiteren Sinn vergleichbar, 6 sind eigenständig<br />
Tabelle 16: Gestaltungsmodell, Heufler S. 74-‐75, das auf F.G. Winter beruht<br />
Aufgabenstellung ≈ Gestal-‐<br />
tungsaufgabe (A.)<br />
Integration / Ganzheit ≈<br />
Gestaltung, Elemente (A.)<br />
Designprozess = Gestaltungs-‐<br />
prozess (A.)<br />
Problemstellung = Problem-‐<br />
stellung<br />
Erfahrung = Erfahrung Sicherheit = Unfallverhütung<br />
(A.)<br />
Intuition = Idee (A.) Wagnis ≈ Gestaltungsprozess<br />
(A.)<br />
Problemlösungsprozess ≈<br />
Gestaltungsprozess (A.)<br />
Differenzierung / Zergliede-‐<br />
rung ≈ Elemente (A.)<br />
Problemlösung = Lösung (A.) Wissen = Wissen<br />
Gefühl = Gefühl Fantasie = Fantastisches<br />
Gestaltungsmodell ≈ Gestal-‐<br />
tungsprozess (A.)<br />
Zwischenresultat: 9 von 15 sind gleich oder synonym, 6 sind im weiteren Sinn vergleichbar, 0 sind eigenständig.
2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />
Tabelle 17: Begriffserläuterungen aus Heufler, S. 209-‐214<br />
Anmutung ≈ Emotion (A.) Anzeichenfunktion ≈ Funkti-‐<br />
on, Zeichensprache (A.)<br />
Ästhetik ≈ Gestaltung (A.) Animation ≈ Zeichnung (A.)<br />
Anthropometrie ≠ Brainstorming ≈ Planung (A.) Briefing ≈ Planung CAD ≈ Zeichnung (A.)<br />
CAID ≠ CAM ≠ Clay-‐Modell = Modell Corporate design ≈ Zeichen-‐<br />
Corporate Identity ≈ Aussage<br />
(A.)<br />
Dimensionszeichnungen =<br />
Pläne (A.)<br />
sprache (A.)<br />
Design = Design Designmodell = Modell (A.) Designstudie = Design (A.)<br />
Ergonomie = Handhabung<br />
(A.)<br />
Facelifting ≠ Formaler Freiheitsgrad ≈<br />
Gebrauchswert ≈ Bedeutung<br />
(A.)<br />
Gestaltung (A.)<br />
Ergonomiemodell = Modell<br />
(A.)<br />
31<br />
Explosionszeichnung = Pläne<br />
(A.)<br />
Funktionsmodell = Modell (A.) Gebrauchsmodell = Modell<br />
Haptisch ≈ Hände Industriel Design = Design (A.) Interdisziplinäres Arbeiten ≠<br />
Lastenheft = Vorgaben (A.) Look ≈ Ausdruck (A.) Nullserienmuster = Modell<br />
Moodboard ≈ Planung (A.) Ökologie ≈ Umwelt (A.) Packagezeichnung ≈ Planung<br />
(A.)<br />
Pragmatik ≈ Lösungsansätze<br />
(A.)<br />
Produktqualität = Eigenschaf-‐<br />
ten (A.)<br />
Produktanalyse = Darstellung<br />
(A.)<br />
Proportionsmodell = Modell<br />
(A.)<br />
(A.)<br />
(A.)<br />
Mock Up ≠<br />
Pflichtenheft = Vorgaben (A.)<br />
Produktdesign = Design (A.) Produktsprache ≈ Eigenschaf-‐<br />
ten (A.)<br />
Prototyp = Modell (A.) Rapid Prototyping ≈ Modell<br />
Redesign = Design (A.) Rendering ≈ Umsetzungen (A.) Scribble = Skizzen (A.) Semantik = Bedeutung, Inhalt<br />
Semiotik = Zeichensprache<br />
(A.)<br />
Simulation ≈ Experiment (A.) Sketch = Zeichnungen (A.) Stereo-‐Lithographie ≈ Modell<br />
Strukturmodell ≈ Modell (A.) Styling ≈ Design (A.) Symbolfunktion = Zeichen-‐<br />
Taktil ≈ Handhabung (A.) Tape Rendering ≈ Zeichnun-‐<br />
Wertanalyse ≈ Planung (A.)<br />
gen (A.)<br />
sprache (A.)<br />
(A.)<br />
(A.)<br />
(A.)<br />
Syntaktik ≈ Zeichensprache<br />
(A.)<br />
Usability ≈ Funktion (A.) User-‐Interface-‐Design ≈<br />
Handhabung (A.)<br />
Zwischenresultat: 25 von 60 sind gleich oder synonym, 30 sind im weiteren Sinn vergleichbar, 5 sind eigenständig.
2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />
2.2.6 Auswertung der Nomen<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Abbildung 9: Auswertung Vergleichsraster<br />
= gleich oder synonym (dunkles Feld)<br />
≈ im weiteren Sinn vergleichbar (mittleres Feld)<br />
≠ nicht gleich, eigenständig (helles Feld)<br />
� Die zusammenfassenden Daten zu Abbildung 7 sind im Anhang abgelegt.<br />
Hohe Übereinstimmungen und somit am meisten Wertungen im Bereich ‚gleich’ oder ‚synonym’<br />
ergeben sich in den Kapitel (a, b, e, h, k und m). Das sind die Themen, welche die Herstellung<br />
und die Elemente von gestalteten Produkten beschreiben. Wenig bis keine Übereinstimmung<br />
gibt es in den Kapiteln Produktsemantik (f), Produktanalyse (i), Vorbemerkung zum Designpro-‐<br />
zess (j) und produktbestimmende Faktoren.<br />
36%<br />
19%<br />
45%<br />
Abbildung 10: Die Übereinstimmung der Nomen<br />
gleich oder synonym<br />
eigenständig oder<br />
nicht vergleichbar<br />
im weiteren Sinn<br />
vergleichbar<br />
32
2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />
<strong>DESIGN</strong>-‐BASICS 64 ist eher auf Produkt-‐Design und damit auf die Technische Gestaltung (Design<br />
und Technik) ausgerichtet. Die Erkenntnisse dürften auch für das Fachgebiet Textil aussagekräf-‐<br />
tig sein, da die Fächer eng miteinander verwandt sind.<br />
Fazit: In den Lehrplanzielen, in den Vorgehensweisen und in den Inhalten des Designers finden<br />
sich hohe Übereinstimmungen. Die Übereinstimmung bei den Konzentraten der Nomen liegt bei<br />
44.7%. Die Übereinstimmung bei gleichen oder synonymen Begriffen liegt bei 35.8% „im weite-‐<br />
ren Sinn vergleichbar“ und 19.5% bei „eigenständig“ oder nicht vergleichbar.<br />
2.2.8 Verben im Designprozess<br />
Als Grundgerüst wurden die Verben aus der Beschreibung von Heufler (S. 81 -‐113) verwendet<br />
und die Verben aus den Lehrplänen (kursiv) zugeordnet und klassiert.<br />
Legende<br />
Verben Designprozess (normal)<br />
Verben Lehrpläne (kursiv)<br />
Tabelle 18: Verben in den vier Schritten des Design-‐Prozesses in Heufler S. 79-‐111<br />
Schritt 1<br />
Recherchieren und<br />
Analysieren<br />
Schritt 2<br />
Konzipieren<br />
Schritt 3<br />
Entwerfen<br />
Schritt 4<br />
33<br />
Optimieren und Ausar-‐<br />
beiten<br />
recherchieren = erforschen konzipieren = planen entwerfen = entwerfen optimieren ≈ verfeinern<br />
analysieren = analysieren kombinieren = kombinieren umsetzen = umsetzen ausarbeiten der Details ≈<br />
(an Bedürfnissen) orientieren<br />
≈ erkunden<br />
verfeinern<br />
entwickeln = entwickeln vorschlagen = entwerfen überprüfen = kontrollieren<br />
formulieren = benennen zulassen ≈ variieren diskutieren = besprechen (Modell) bauen = bauen<br />
definieren = darstellen auswählen = wählen weiterentwickeln = entwi-‐<br />
ckeln<br />
erproben ≈ anwenden<br />
festhalten = erfassen entscheiden ≈ wählen schreiben = erfassen freigeben ≈ umsetzen<br />
sammeln = sammeln suchen = suchen auswählen = wählen produzieren = umsetzen<br />
erforschen = erforschen zusammenfügen = zusam-‐<br />
mensetzen<br />
auswerten = auswerten strukturieren = ordnen sich vom Problem lösen ≈<br />
befragen ≈ erforschen, unter-‐<br />
suchen<br />
herausarbeiten ≈ differenzie-‐<br />
ren<br />
Lösungen suchen = entwickeln begleiten ≈ beobachten<br />
experimentieren<br />
gliedern = gliedern verallgemeinern ≈ kombinie-‐<br />
überschaubar machen =<br />
ordnen<br />
64 Heufler, Gerhard (2007): <strong>DESIGN</strong> BASICS.<br />
ren<br />
denken ≈ erfinden<br />
organisieren ≈ planen<br />
dokumentieren = dokumen-‐<br />
tieren
2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />
erkennen = verstehen beschreiben = darstellen Ideen aufgreifen ≈ interpretie-‐<br />
ren<br />
berücksichtigen = berücksich-‐<br />
tigen<br />
zusammenfassen ≈ kombinie-‐<br />
ren<br />
benennen = benennen Ideen verknüpfen = kombinie-‐<br />
ren<br />
abstrahieren ≈ reflektieren kombinieren = kombinieren<br />
ausdrücken = ausdrücken ermöglichen ≈ erarbeiten in Breite gehen = variieren<br />
kontrollieren = überprüfen erweitern = erweitern bewerten = beurteilen<br />
skizzieren = zeichnen prüfen = überprüfen<br />
herstellen (Modell) = herstel-‐<br />
len<br />
einigen ≈ nachvollziehen<br />
überprüfen = überprüfen ändern = umarbeiten<br />
auswählen = auswählen CAD anfertigen ≈ darstellen<br />
Modell anfertigen = bauen<br />
testen = untersuchen<br />
entscheiden = wählen, aus-‐<br />
wählen<br />
Erwähnenswert ist die hohe Anzahl von gleichen oder synonymen Verben, wie dies in der fol-‐<br />
genden Abbildung zum Ausdruck kommt.<br />
2.2.9 Auswertung Verben<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Recherchieren<br />
Analysieren<br />
Abbildung 11: Auswertung Designprozess<br />
Konzipieren Entwerfen Opsmieren<br />
Ausarbeiten<br />
= gleich oder synonym (dunkles Feld)<br />
≈ im weiteren Sinn vergleichbar (mittleres Feld)<br />
≠ nicht gleich, eigenständig (helles Feld): diese Variante kommt nicht vor<br />
Fazit: Die Übereinstimmung bei den Verben ist sehr hoch. Sie liegt in Recherchieren und Analy-‐<br />
sieren bei 75%, in Konzipieren bei 80%, in Entwerfen bei 74% und in Optimieren und Ausarbei-‐<br />
ten bei 40%. Die Tätigkeiten aus dem Bereich Design haben in der Schule zumeist verwandte<br />
Anwendungen.<br />
34
3 <strong>DESIGN</strong> ALS WISSENSCHAFT<br />
3 <strong>DESIGN</strong> ALS WISSENSCHAFT<br />
3.1 ARGUMENTE AUS <strong>DER</strong> FACHLITERATUR<br />
Design ist eine eigene Disziplin und wird grundsätzlich auf der tertiären Bildungsstufe an Fach-‐<br />
hochschulen studiert. In der Designtheorie werden die Disziplinen aufgeführt. Die Designpraxis<br />
hat einen erheblichen Anteil an der Wissenschaft Design, weil sie durch die Forschung erhobene<br />
Daten liefern kann und die Theorien in der Praxis überprüft und einsetzt. Die Fachsprache ist ein<br />
wesentlicher Teil einer Wissenschaft und führt zu einer Verständigung in-‐ und ausserhalb der<br />
Disziplin. Die Designgeschichte ist ein bedeutender Bereich der Wissenschaft.<br />
Design hat nach Mareis 65 folgende Nachbardisziplinen (nicht abschliessend): Architektur, Kunst,<br />
Ingenieurwesen, Informationstheorie, Semiotik, Ergonomie, Ökologie, Soziologie. Unter dem<br />
erweiterten Designbegriff, wie er von Friedrich (2008) 66 verwendet wird, fallen Themen wie „Äs-‐<br />
thetik“, „Ökonomik“ und „Ethik“.<br />
In Designtheorie und Designforschung von Brandes et al. (2009) 67 sind folgende Begriffe die<br />
„Bausteine“ einer Design-‐Theorie: „Kreationistische Theoreme, Ästhetik, Urteilskraft, Die gute<br />
Form, Harmonie-‐Lehren, Romantische Konzepte, Thesen angewandter Kunst, Wahrnehmung,<br />
Der Werkbund, Das Bauhaus und die Theorie, Neues durch Futurismus, Konstruktivismus und<br />
Dada, Die Metamorphose des Objekts und Vereinfachung und Funktionalität.“<br />
Der Begriff der Ingenieurwissenschaft oder Technik wird an mehreren Stellen erwähnt. Das be-‐<br />
ginnt in vielen Lehrbüchern 68 beim Ursprung des Industriedesigns. Technik und die Ausbildungen<br />
am jeweiligen Technikum (die heutigen Fachhochschulen) haben eine lange Tradition innerhalb<br />
der Wissenschaften und werden an dieser Stelle nicht zusätzlich legitimiert. In der Triangulation<br />
wird der Begriff Technik Teil des Untersuchungsrasters für die Fachbegriffe sein.<br />
65<br />
Mareis, Claudia (2011): Design als Wissenskultur. S. 87 / S. 113.<br />
66<br />
Friedrich et al. (2008): Wirklichkeit als Design-‐Problem.<br />
67<br />
Brandes et al. (2009): Designtheorie und Designforschung. S. 25-‐51.<br />
68 Schneider, Beat (2009): S. 16.<br />
35
3 <strong>DESIGN</strong> ALS WISSENSCHAFT<br />
3.1 STUDIUM <strong>DESIGN</strong><br />
3.1.1 Aktuelle Situation<br />
Die Beschreibung der aktuellen Situation der Fachwissenschaft ist schwierig, weil diese Disziplin<br />
noch keine lange Tradition im wissenschaftlichen Kontext aufweist. Eine ansprechende Einfüh-‐<br />
rung in das Thema „Design studieren“ bieten Baur und Erlhoff (2007) 69 . Mit der Bologna-‐<br />
Reform 70 wurde ein Fachhochschulgesetz geschaffen, worin sich die Fachhochschulen verpflich-‐<br />
ten, ein Bildungsreformen durchzuführen. Dazu gehört auch eine wissenschaftliche Abstützung<br />
der Fachgebieten und die Aufnahme von Forschungstätigkeit in diesen Fachgebieten. Die Kunst-‐<br />
gewerbeschulen und Schulen für Gestaltung wurden im Zuge dieser Umstellung zu eigenständi-‐<br />
gen Fachhochschulen (Beispiel Zürcher Hochschule der Künste, ZHdK) oder in Fachhochschulen<br />
integriert (Fachhochschulen Nordwestschweiz, fhnw). Die Bezeichnungen sind verwirrend, weil<br />
Hochschule und Fachhochschule in den Namensbezeichnungen nicht nach einem einheitlichen<br />
Muster bezeichnet werden.<br />
Design ist eine eigene Studiendisziplin im deutschsprachigen Raum. Eine über 600seitige Zu-‐<br />
sammenstellung befindet sich im Handbuch der Universitäten und Fachhochschulen (2010) 71 .<br />
Design und Gestaltung sind auf gleiche Stufe wie andere Studiendisziplinen in den Fachhoch-‐<br />
schulen zu setzen.<br />
3.1.2 Studium in der Schweiz<br />
Die Studienangebote 72 in der Schweiz sind so aufgeteilt, dass Kunst und Design auf der Stufe der<br />
8 Fachhochschulen gelehrt werden. Im Handbuch der Universitäten und Fachhochschulen 73 prä-‐<br />
sentiert sich die Ausgangslage leicht verwirrend: Einige Studiengänge sind unter Design aufge-‐<br />
führt, andere unter Gestaltung und wieder andere unter beiden Begriffen. Für die folgende Auf-‐<br />
zählung wurde Informationen aus dem Internet-‐Auftritt der Rektorenkonferenz der Fachhoch-‐<br />
schulen der Schweiz herangezogen.<br />
• Berner Fachhochschule BFH: Hochschule der Künste Bern: BA und MA Vermittlung von<br />
Kunst und Design, BA Kunst, BA Visuelle Kommunikation; MA Bildende Kunst, MA Design.<br />
• Fachhochschule Nordwestschweiz fhnw: Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel: BA<br />
Bildende Kunst, BA Produkt -‐ und Industriedesign mit Vertiefung Industriedesign, BA Pro-‐<br />
dukt-‐ und Industriedesign mit Vertiefung Mode-‐Design; BA Vermittlung in Kunst und Design;<br />
BA Visuelle Kommunikation mit Vertiefung Interaktion / Bild / Typographie; MA Design mit<br />
Vertiefung Visual Communication and Iconic Research; MA Design; MA Fine Arts;<br />
69 Baur, Ruedi et al. (2007): Design studieren. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag.<br />
70 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie bbt: Die Schweiz unterzeichnete 1999 die Bologna-‐Deklaration.<br />
71 Meinhold, Alexandra et al. (2010): Handbuch der Universitäten und Fachhochschulen.<br />
72 http://www.crus.ch (Universitäten).<br />
73 Meinhold, Alexandra et al. (2010): Handbuch der Universitäten und Fachhochschulen 2010. Deutschland, Österreich,<br />
Schweiz.<br />
36
3 <strong>DESIGN</strong> ALS WISSENSCHAFT<br />
MAS Design, Art & Innovation; MAS Graphic Design I (Bildlichkeit); MAS Graphic Design II<br />
(Medialität); Päd. Hochschule Brugg: MA Lehrberufe für Gestaltung und Kunst; MAS Vermitt-‐<br />
lung der Künste; Hochschule für Wirtschaft Olten: MAS Corporate Idendity & Design Ma-‐<br />
nagement.<br />
• Fachhochschule Ostschweiz FHO: Hochschule für Technik Rapperswil: MAS Human Compu-‐<br />
ter Interaction Design.<br />
• Hochschule Luzern HSLU: BA Produkt – und Industriedesign mit Vertiefung Design Manage-‐<br />
ment International oder Textildesign; BA Vermittlung in Kunst & Design mit den Vertiefun-‐<br />
gen Kunst, Kunst und Schule und Kunst und Vermittlung; BA Visuelle Kommunikation mit<br />
Vertiefung Animation / Graphic Design / Illustration / Video; MA Bildende Kunst mit Vertie-‐<br />
fung in Art in Public Spheres; MA Produkt-‐ und Industriedesign mit Vertiefung in Animag /<br />
Design Driven Product Management.<br />
• Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale HES-‐SO: Fachhochschule Genf Haute école<br />
d’art et de design de Genève HEAD: BA Bildende Kunst, BA Produkt-‐ und Industriedesign;<br />
MA Bildende Kunst; Ecole cantonale d’art du Valais ECAV: BA Bildende Kunst, MA Bildende<br />
Kunst; Ecole Cantonale d’art de Lausanne ECAL: BA Bildende Kunst; BA Produkt-‐ und Indust-‐<br />
riedesign; MAS Design et industrie du luxe.<br />
• Fachhochschule Kalaidos FH KAL: keine Angebote im Bereich Gestaltung und Kunst<br />
• Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI: Keine Angebote in Gestal-‐<br />
tung und Kunst.<br />
• Zürcher Fachhochschule ZHdK: Zürcher Hochschule der Künste ZHdK: BA Bildende Kunst, BA<br />
in Vermittlung von Kunst und Design; BA Style & Design; MA Design; Visuelle Kommunikati-‐<br />
on mit Vertiefung in Kast, Interaction Design, Game Design, Style & Design, Scientific Visuali-‐<br />
sation, Visuelle Kommunikation; MA Bildende Kunst, MA Composition / Theory; MA Design,<br />
MA Vermittlung in Kunst und Design / Art Education; MAS Bilden – Künste – Gesellschaft;<br />
MAS Design Culture, MAS Type Design an Typography.<br />
Fazit: Die Begriffe Kunst und Design sind vorherrschend.<br />
Von den acht Fachhochschulen bieten fünf Fachhochschulen eigene Studiengänge in Kunst und<br />
in Design an, eine Fachhochschule bietet ausschliesslich ein Spezialgebiet aus dem Gebiet Pro-‐<br />
dukt-‐Design an und zwei Fachhochschulen bieten keine Studiengänge in Kunst oder Design an.<br />
37
3 <strong>DESIGN</strong> ALS WISSENSCHAFT<br />
3.1.3 Studium in Deutschland<br />
Ein Blick nach Deutschland aus dem Buch „Designlehren“ von Bucholz (2007) zeigt folgendes Bild<br />
bei den 61 Gestaltungsschulen 74 :<br />
Textil und ...<br />
5%<br />
Architektur<br />
8%<br />
Gestaltung und ...<br />
5%<br />
Abbildung 12: Begriffe der Gestaltungsstudiengänge in Deutschland<br />
Die Ergänzung mit „und ...“ z. B. „Design und ...“ bedeutet die Kombination mit einem anderen<br />
Begriff: Design und Informatik, Design und Management, Design und Ingenieurwesen, Design<br />
und Innenarchitektur, Design und Medien, Design und Kunst. Beim Segment Gestaltung: Bauen<br />
und Gestalten, Architektur und Gestaltung. Die Restgruppe besteht aus dem Institut für Keramik<br />
und Glas, Fächergruppe Mediengestaltung, Buchkunst, Medienkunst und der Staatliche Zeichen-‐<br />
akademie.<br />
Fazit: Deutlich führend sind die zwei (eigentlich) identischen Begriffe Gestaltung mit 37% und<br />
Design mit 35%.<br />
3. 2 <strong>DESIGN</strong>-‐THEORIE<br />
Eine anerkannte Designtheorie ist ein wichtiger Faktor für das Verständnis und die Akzeptanz im<br />
Umgang mit anderen Disziplinen.<br />
3.2.1 Literaturhinweise<br />
Restgruppe<br />
5%<br />
Gestaltung<br />
32%<br />
Designtheorie und Designforschung: Brandes et al. (2009) 75 beschreiben in der Publikation den<br />
wissenschaftlichen Aspekt von Design. Ihre Überlegungen liefern den Pädagogischen Hochschu-‐<br />
len Impulse für die Abstützung der wissenschaftlichen Arbeiten in Gestaltungsbereich.<br />
Kompendium des Industrie-‐Design, Grundlagen der Gestaltung: Habermann 76 (2003) stellt Un-‐<br />
terlagen zur Verfügung, welche aufzeigen, dass im Bereich Gestaltung theoretische Grundlagen<br />
74 Buchholz, Kai (2007): Designlehren, Wege deutscher Gestaltungsausbildung. S. 402.<br />
75 Brandes et al. (2009): Designtheorie und Designforschung.<br />
Design<br />
22%<br />
Angewandte<br />
Kunst<br />
2%<br />
Bildende Künste<br />
8%<br />
Design und ...<br />
13%<br />
38
3 <strong>DESIGN</strong> ALS WISSENSCHAFT<br />
vorhanden sind, welche bisher in der Ausbildung und bei der Erstellung von Lehrmitten der Ge-‐<br />
staltungsfächer zu wenig berücksichtigt wurden.<br />
100 Prinzipien: Zur Design-‐Theorie gehört das Buch von Lidwell et al. (2004) 77 : „Design. Die 100<br />
Prinzipien für erfolgreiche Gestaltung“. Darin ist die Bandbreite von Design-‐Elementen aus ver-‐<br />
schiedenen Design-‐Disziplinen abgebildet.<br />
Design. Zur Praxis des Entwerfens: Im Buch von van den Boom et al. (2003) 78 werden Entwurfs-‐<br />
techniken aufgezeigt, die in adaptierter Form eingesetzt werden könnten.<br />
3.2.2 Teilgebiete von Design<br />
Design-‐Disziplinen: Heufler erwähnt die „international gebräuchlichen Begriffe“ für die Speziali-‐<br />
sierungsbereiche 79 in Englisch: Product Design, Transportation Design, Fashion Design, Environ-‐<br />
mental Design und Communication Design. Wettbewerbe: iF design award 80 weist folgende<br />
Gruppeneinteilung auf: product design, communication design, material design und packaging<br />
design. Der Eidgenössische Preis für Design 81 weist folgende Gruppeneinteilung auf: Grafikdes-‐<br />
gin, Mode, Fotografie, Produktdesign, Schmuck und Szenografie. Der „red dot design award“ 82<br />
ist nach seinem Selbstverständnis „einer der führenden und grössten Designwettbewerbe“ und<br />
weist folgende Gruppeneinteilung auf: design concept, product design und communication de-‐<br />
sign.<br />
3.2.3 Interdisziplinarität<br />
In der aktuellen Wissenschaftsdiskussion ist eine Tendenz erkennbar, dass Design nicht als eige-‐<br />
ne, sondern als übergreifende Disziplin betrachtet werden kann. In diesem Kontext ist Bürdek<br />
(2011, S. 20f) 83 der Auffassung, dass „fundiertes Wissen über Gestaltung selbst, das Entwerfen,<br />
die Produkte, die Interfaces und die services ... heute gefragt sind.“ Er plädiert dafür, die Diszip-‐<br />
lin vorerst als eigene Disziplin „inhaltlich voranzubringen“, denn anschliessend könne die „viel-‐<br />
beschworene Interdisziplinarität fundiert praktiziert werden“.<br />
76<br />
Habermann, Heinz (2003): Kompendium des Industrie-‐Designs. Grundlagen der Gestaltung.<br />
77<br />
Lidwell, William et al.(2004): Design, Die 100 Prinzipien für erfolgreiche Gestaltung.<br />
78<br />
van den Boom, Holger et al. (2003): Design. Zur Praxis des Entwerfens.<br />
79<br />
Heufler (2007, Seite 14).<br />
80<br />
Industrie Forum Design GmbH: http://www.ifdesign.de/awards_index_d.<br />
81<br />
Eidgenössischer Preis für Design: http://www.swissdesignawards.ch/federaldesign/2010/about/index.html?lang=de.<br />
82 red dot, Design Preise: http://red-‐dot.org/2026.html.<br />
83 Bürdek, Bernhard E. (2011): in Eisele, Petra und Bürdek E.: Design, Anfang des 21. Jh.<br />
39
3 <strong>DESIGN</strong> ALS WISSENSCHAFT<br />
3.2.4 Intellektuelle Tiefe<br />
Janssen 84 erwartet von der Designwissenschaft eine Entwicklung in Richtung „intellektueller<br />
Tiefe“ (S. 78). Die Erläuterungen von Maria-‐Elana Wachs 85 (2010, S. 128) sind ebenso beachtlich;<br />
sie stellt für die Design-‐Studierenden in Deutschland fest, dass die Vorbildung häufig nur auf<br />
dem „Kunstunterricht der Weiterbildenden Schulen mit dem Lehrmaterial der 70er Jahre“ be-‐<br />
stünde. Im Herbst 2011 wird die Deutsche Gesellschaft für Designtheorie und Designforschung<br />
eine Tagung zum Thema designDIDAKTIK 86 durchführen, woraus weitere Schritte in Bezug auf<br />
„intellektuelle Tiefe“ zu erwarten sind.<br />
3.3 <strong>DESIGN</strong>-‐PRAXIS<br />
3.3.1 Fachgebiet<br />
Die Designpraxis ist gleichwertig wie die Theorie. Die Praxis bildet eine Art Kontrollinstanz. So<br />
sind Publikationen wie „entwerfen, wissen, produzieren“ von Mareis et al. (2010) 87 wichtige<br />
Elemente für dieses Spiegeln der Theorie in der Praxis und umgekehrt.<br />
Der Designprozess als zentrales Element der Designpraxis wird in Kapitel 4.2.3 vorgestellt. Zu<br />
diesem Thema befindet sich in der deutschsprachigen Literatur wenig. Weiter zeigen sich die<br />
interessanten Publikationen im englischsprachigen Raum; insbesondere auch Internet in Bezug<br />
auf „design and technology“. 88<br />
3.3.2 Leistungsqualität der Ausbildung<br />
Nach Schneider (2009, 277) 89 habe Design in der Schweiz „seit jeher hohe Leistungsqualität“.<br />
Weiter stellt er fest, dass die bisherigen Ausbildungen in den „privaten Ateliers“ und an den<br />
Schulen für Gestaltung stattfanden. Diese Designausbildung an den vormaligen Kunstgewerbe-‐<br />
schulen hätten nach Schneider einen hohen Praxisbezug und generell „einen hohen Standard“<br />
erreicht.<br />
3.3.3 Praxis des Entwerfens<br />
Die Literatur von van den Boom und Romero-‐Tejedor (2003) 90 bringt interessante Ideen aus der<br />
Praxis des Designs. Es ist eine Anregung, den Entwurfsprozess kreativ und mit verschiedenen<br />
Mitteln anzugehen.<br />
84 Ebenda, S 75: Jansen, Diethard: Der gemeinsame Nenner.<br />
85 Wachs, Elena-‐Maria (2010): Vorwärts nach weit – definiert die Designbegriffe!<br />
86 Tagung designDIDAKTIK: http://www.dgtf.de/tg/81-‐perma-‐716 (03-‐09-‐2011).<br />
87 Mareis, Claudia et al. (2010): entwerfen wissen produzieren. Designforschung im Anwendungskontext.<br />
88<br />
Design and Technology (GB): http://www.design-‐technology.info/home.htm. (18.08.2011).<br />
89<br />
Schneider, Beat (2009): Design. Eine Einführung.<br />
90<br />
Van den Boom, Holger und Romero-‐Tejedor, Felicidad: Design. Zur Praxis des Entwerfens.<br />
40
3 <strong>DESIGN</strong> ALS WISSENSCHAFT<br />
3.3.4 Filme<br />
Eine besondere Variante sind Filme von DesignSuisse (2006). 91 Sie bieten Einblick in verschiede-‐<br />
ne Ateliers und dazu Informationen, welche den engen Bezug zur Praxis ermöglichen.<br />
3.4 FACHSPRACHE<br />
3.4.1 Wörterbuch<br />
Das Wörterbuch Design von Erlhoff et al. (2008) 92 ist ein erster Versuch in Richtung einer ge-‐<br />
meinsamen Fachsprache. Jedoch sind vereinzelte Begriffe noch nicht schlüssig definiert. Das<br />
beginnt bereits mit der Definition des Begriffs Design. So ist es nicht erstaunlich, wenn Eisele<br />
und Bürdek (2011, S. 21) 93 behaupten, dass Design „wissenschaftstheoretisch gesehen über wei-‐<br />
te Strecken immer noch im Stadium der Wunderheilung oder gar der Quaksalberei“ sei.<br />
Aus Grossbritannien erscheint eine bessere Nachricht: Zu den Nationalen Lehrplänen ist ein<br />
Design and Technology Vocabulary im Umfang von 30 Seiten erschienen. 94<br />
3.4.2 Formfächer<br />
Der Formfächer ist ein attraktives Hilfsmittel für die Erklärung von Designbegriffen. 95 „Das Bild-‐<br />
lexikon zeigt rund 450 Begriffe an 100 Objekten.“ Er sieht beinahe aus wie Musterkarten, welche<br />
für die Auswahl von Stoffen, Farben oder Materialien eingesetzt werden.<br />
3.4.3 Prinzipien der Gestaltung<br />
Lidwell et al. (2003) 96 ist mit dem Buch „Design, 100 Prinzipien der Gestaltung“ eine geschätzte<br />
Sammlung gelungen. Die Berührungspunkte zu den Nachbardisziplinen (siehe 3.6.1) werden<br />
darin übersichtlich dargestellt.<br />
3.4.4 Every Thing Design<br />
In einem speziell gestalteten Buch von Christian Brändle et al.(2009) 97 werden 700 ausgewählte<br />
Objekte der Sammlung des Museums für Gestaltung Zürich präsentiert.<br />
91<br />
Ernst, Meret und Eggenberger, Christian (2006): Designsuisse.<br />
92<br />
Erloff, Michael / Marshall, Tim (2008): Wörterbuch Design.<br />
93<br />
Eisele, Petra & Bürdek, Bernhard E. (2011): Design am Ende des 21. Jh.<br />
94<br />
The Design and Technology Association GB (2003): An Introduction to Design an Technology Vocabulary.<br />
95<br />
Zürcher Hochschule der Künste et al. (2010): FORMFÄCHER.<br />
96<br />
Lidwell, William et al. (2004): Design. 100 Prinzipien für erfolgreiche Gestaltung.<br />
97<br />
Brändle, Christian et al. (2009): Every Thing Design. Die Sammlungen des Museum für Gestaltung Zürich.<br />
41
3 <strong>DESIGN</strong> ALS WISSENSCHAFT<br />
3.4.5 Die Welt der Dinge<br />
Vera Franke veröffentlichte in den „Werkspuren“ (2/2010) eine Darstellung mit einer Mind-‐Map<br />
von Begriffen zur Welt der Dinge. 98 Zu dieser Welt gehören Verkaufsausstellungen in den Wa-‐<br />
renhäusern ebenso wie die Wohn-‐ und Arbeitsräume; auch Museen sind ein Teil davon. Im<br />
Werkbundarchiv in Berlin wird dieser Ansatz deutlich. So kann eine Publikation davon zum<br />
nächsten Kapitel überleiten: „Kampf der Dinge. Der Deutsche Werkbund zwischen Anspruch und<br />
Alltag.“ 99<br />
3.4.6 Error-‐Design<br />
Die Ausstellung „Böse Dinge. Positionen des (Un)geschmacks“ 100 des Gewerbemuseums Win-‐<br />
terthur lieferte provozierende Begriffe. Das Thema trifft den Zeitgeist und das Bedürfnis nach<br />
Hinweisen im Bereich Gestaltung. Der Ausstellungsführer Error-‐Design 101 liefert ebenfalls wert-‐<br />
volle Anregungen für die Beschäftigung mit Objekten und ihren Qualitäten. Auch im Internet<br />
finden sich anschauliche Beispiele 102 solcher Zusammenstellungen.<br />
3.4.7 Fachsprache in Lehrmitteln<br />
Eine Einteilung nach Tätigkeiten und Technologien wäre prinzipiell denkbar und wird in vielen<br />
Lehrmitteln auch verwendet: Im Werkweiser von Victor Dittli (2002) 103 werden am Ende der<br />
Publikation die Materialien und Technologien aufgezählt. Im Werkfelder von Verena Speiser-‐<br />
Niggli (2002) 104 ist der Band 2 den Grundlagen, Werkstoffen und Techniken gewidmet.<br />
Die Zusammenstellung der Herstellungs-‐ und Verarbeitungsverfahren in der Fachliteratur Mate-‐<br />
riology 105 zeigt die Verwandtschaft zu einzelnen Tätigkeiten in den Gestaltungsfächern auf. In<br />
der Schule kommen etwa die Hälfte dieser Verarbeitungsverfahren nicht zum Einsatz, weil sie zu<br />
schwierig, zu kompliziert, zu gefährlich oder zu teuer sind.<br />
Für die Gestaltungsfächer sind die Begriffe im Zusammenhang mit Material und Bearbeitungs-‐<br />
weisen wichtig. Diese Begriffe gehören in den Lehrplänen zu den häufigsten Nomen. 106<br />
Tabelle 19: 23 Verben nach Materiology<br />
Mechanisch fügen Kleben Kalandrieren Nähen<br />
Schneiden Tiefziehen Extrudieren Endbearbeiten<br />
98<br />
Franke, Vera (2007): Die Welt der Dinge. In Werkspuren 2/2010.<br />
99<br />
Werkbundarchiv – Museum der Dinge.<br />
100<br />
Böse Dinge. Positionen des (Un)geschmacks (2011, 16. Januar bis 31. Juli).<br />
101<br />
Marchsteiner, Uli (1998): ERROR <strong>DESIGN</strong> -‐ Irrtum im Objekt, Ausstellung in Zürich und Krems.<br />
102<br />
Darnell, Michael: Bad Human Factors Designs: in http://www.baddesigns.com/examples.html.<br />
103 Dittli, Viktor et al. (2002): Werkweiser 3.<br />
104 Speiser-‐Niggli, Verena (2002) Werkfelder 2: Grundlagen zu Gestaltung und Technik.<br />
105 Kula, Daniel et al. (2009): Materiology.<br />
106 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007).<br />
42
3 <strong>DESIGN</strong> ALS WISSENSCHAFT<br />
Giessen Schmieden Sintern Drucken<br />
Spritzgiessen Formgiessen Harzgiessen Falten<br />
Biegen Profilieren Digital Fertigen Rotationsformen<br />
Schweissen Thermoformen Spanend Bearbeiten<br />
3.5 <strong>DESIGN</strong>-‐GESCHICHTE<br />
Im Bereich Designgeschichte spiegelt sich das Verständnis des Umgangs mit Dingen. Die Design-‐<br />
geschichte von Walker (1992) 107 lieferte eine gute Grundlage für vertiefte Arbeiten. Bürdek<br />
(2005) 108 veröffentlichte im Jahr 2005 eine vorbildliche Publikation. Sie überzeugt sowohl in der<br />
Gestaltung als auch im Inhalt. Die Publikation von Hauffe (2008) 109 ist klein und handlich; sie liegt<br />
in vielen Buchhandlungen auf, ebenso das Design Handbook von Fiell (2006) 110 Weitere Publika-‐<br />
tionen beschränken sich auf eine Art Bildersammlung von Produkten und geben unzureichend<br />
Information über Elemente der Gestaltung. Das Buch „Designing Interactions von Moggridge“<br />
(2007) 111 ist ein vorbildliches Exemplar für abwechslungsreiche Einblicke in die jüngere Design-‐<br />
geschichte: Ein Beispiel, wie ein Produkt (z. B. eine Computermaus) sich aus unscheinbaren An-‐<br />
fängen im Gebrauch und der Interaktion mit den Menschen weiter entwickelt. Diese Publikation<br />
eignet sich gut dafür, nicht nur die technische Lösung von Problemen, sondern auch Produkte<br />
für den Einsatz im Alltag bewusst zu gestalten und zu optimieren.<br />
3.5.2 Design im Kunstunterricht<br />
In Deutschland wird auf der Gymnasialstufe im Unterricht Design oftmals als Bereich der Kunst<br />
behandelt. Dabei spielt hauptsächlich Designgeschichte eine tragende Rolle. In der Schweiz wer-‐<br />
den notabene dieselben Lehrmittel eingesetzt. Da sich die Räumlichkeiten in vielen Mittelschu-‐<br />
len aber nur bedingt für praktische Arbeiten im Bereich von Produkt-‐ oder Textildesign eignen,<br />
wird das Thema überwiegend theoretisch oder ausschliesslich im Bereich von Grafikdesign be-‐<br />
handelt. Lehrmittel sind die Publikation von Bruckner (1997) 112 und von Walch et al. (2008):<br />
Kunstunterricht-‐Design 113 .<br />
3.6 BEZUGSDISZIPL<strong>IN</strong>EN<br />
3.6.1 Modell der Disziplinen<br />
107<br />
Walker, John A. (1992): Designgeschichte. Perspektiven einer wissenschaftlichen Disziplin.<br />
108<br />
Bürdek, Bernhard E. (2005): Design – Geschichte, Theorie und Praxis der Produktgestaltung.<br />
109<br />
Hauffe, Thomas (2008): Design. Ein Schnellkurs.<br />
110<br />
Fiell, Charlotte und Peter (2006): Design. Handbook. Konzepte, Materialien, Stile. Köln: Taschen.<br />
111 Moggridge, Bill (2007): Designing interactions.<br />
112 Bruckner, Martin et al. (1997): Design. Arbeitsheft.<br />
113 Walch, Josef und Grahl, Peter (2008): Design. Praxis Kunst. Hamburg: Schroedel.<br />
43
3 <strong>DESIGN</strong> ALS WISSENSCHAFT<br />
Nachfolgend sind stichwortartig einige Literaturbausteine mit wesentlichen Inhalten aufgeführt.<br />
Design hat nach Mareis (2011) 114 folgende Nachbardisziplinen: Architektur, Kunst, Ingenieurwe-‐<br />
sen, Kybernetik, Informationstheorie, Systemtheorie, Semiotik, Ergonomie, philosophische Wis-‐<br />
senschaftstheorie und die mathematische Logik, sowie Ökologie und Soziologie.<br />
In der Publikation Positionen zur Designwissenschaft von Romero-‐Tejedor und Jonas (2010) 115<br />
werden verschiedene Aspekte dargestellt. Dabei werden auch Sichten von Nachbardisziplinen<br />
wie Ingenieurwissenschaften, Psychologie, Soziologie, Ethnologie, Rhetorik, Physik, Philosophie,<br />
Ergonomie, Semiotik, Informatik und Systemwissenschaften einbezogen. Tischner (2011) 116<br />
schafft einen Bezug zu Ethik und Moral.<br />
Ökonomie und Technologie werden von Bürdek (2007) 117 erwähnt. Hermann & Möller (2011) 118<br />
bringen die Ökonomie als bedeutenden Faktor ins Gespräch. Dazu werden bei Henseler (2011) 119<br />
weitere Gebiete wie Informatik und Kommunikation erwähnt. Die visuelle Information und die<br />
Kommunikation wird in der Arbeit von Alexander (2007) 120 thematisiert.<br />
Aufgrund dieser umfangreichen Unterlagen wurde das folgende Modell zusammengestellt, wel-‐<br />
ches die Verwandtschaft der Wissensgebiete zum Fach Design und Technik abbilden könnte.<br />
Durch weitere Forschungen könnte die Übereinstimmung des Modells mit den Studiengängen<br />
untersucht werden.<br />
114 Mareis, Claudia (2011): Design als Wissenskultur.<br />
115 Romero-‐Dejedor, Felicidad und Jonas, Wolfgang (2010): Positionen zur Designwissenschaft. S. 5ff.<br />
116 Tischner, Monika (2011) S. 83: in Eisele und Bürdek: „Design, Anfang des 21. Jahrhunderts.“<br />
117<br />
Bürdek, Bernhard E. (2007): Design. S. 277.<br />
118<br />
Herrmann, Christoph & Möller, Günther (2011) in Eisele, Petra & Bürdek, Bernhard E. S. 25.<br />
119<br />
Henseler, Wolfgang (2011) in Eisele, Petra & Bürdek, Bernhard E. S. 25ff<br />
120<br />
Alexander, Kerstin (2007): Kompendium der visuellen Information und Kommunikation.<br />
44
3 <strong>DESIGN</strong> ALS WISSENSCHAFT<br />
Abbildung 13: Disziplinen im Zusammenhang mit Design<br />
Die Schnittmenge von Design zu Inhalten aus den Lehrplänen konnte vorwiegend durch den<br />
Vergleich aufgezeigt werden. Der Bereich Textil-‐Design besitzt eine grosse Überschneidung mit<br />
dem Produkt-‐Design, wie dies bereits durch Fries et al. (2007) 121 zum Ausdruck kommt.<br />
In den Studiengängen der Fachhochschulen für Kunst und Design sind die Begriffe für Studien-‐<br />
gänge zum Thema Gestaltung oder Design nebst den Begriffen für die Kunst dominierend. Die<br />
Ingenieurwissenschaften sind in den Technischen Hochschulen zu finden und mit den Naturwis-‐<br />
senschaften und mit Design verwandten Disziplinen verknüpft.<br />
Fazit: Die zwei Bereiche von Design (Produkt-‐Design und Textil-‐Design) sind zusammen mit<br />
Technik (Ingenieurwissenschaften) die inhaltlich am nächsten verwandten Disziplinen zu den<br />
Fächern Technisches und Textiles Gestalten oder neu des Unterrichtsfachs „Design und Tech-‐<br />
nik“.<br />
121 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007). S. 32.<br />
45
3 <strong>DESIGN</strong> ALS WISSENSCHAFT<br />
3.6.2 Modell mit verschiedenen Ebenen<br />
Das Fach Design und Technik basiert auf den Disziplinen Textildesign und Produktdesign. Auf<br />
einer tieferen Ebene sind die übrigen Disziplinen von Design (Transport-‐Design, Interieur-‐Design<br />
und das Kommunikations-‐Design), die Ingenieurwissenschaften und die Kunst. Der ältere Begriff<br />
„angewandte Kunst“ für Design taucht in aktuellen Studiengängen der Schweizer Fachhochschu-‐<br />
len nicht mehr auf.<br />
Der Begriff Kultur wird in den zuvor untersuchten Literaturstellen nicht erwähnt. Seine Verwen-‐<br />
dung wird in das Untersuchungsraster für die Bezeichnung der Fächer aufgenommen, um das<br />
Vorkommen in der Praxis zu untersuchen, ebenso die Begriffe, Kunst (Art und Arts), Technik, und<br />
Ästhetik oder Ästhetische Bildung. Die Begriffe Design, Technik, Mode und Textile Gestaltung<br />
oder Textildesign werden ebenfalls gesetzt, um die Häufigkeit untereinander zu vergleichen.<br />
Abbildung 14: Modell mit verschiedenen Ebenen<br />
Philosophie, Ästhesk<br />
Naturwissenscha en,<br />
Sozialwissenscha en<br />
Architektur, Kunst, Design,<br />
Ingenieurwissenscha en<br />
Produktdesign,<br />
Texsldesign<br />
Design und Technik<br />
Fazit: Das Modell zeigt die gemeinsame Basis des Unterrichtsfachs „Design und Technik“.<br />
46
3 <strong>DESIGN</strong> ALS WISSENSCHAFT<br />
3.6.3 Bezugsdisziplinen im textilen Bereich<br />
Becker 122 weist auf die Vernetzung der Disziplinen in der textilen Sachkultur als Bereich der ma-‐<br />
teriellen Kultur hin. Die folgende Darstellung basiert auf der Beschreibung der Pädagogischen<br />
Hochschule Freiburg (Deutschland) zum Fachgebiet Textil und zeigt die Ausrichtung auf wissen-‐<br />
schaftliche Disziplinen. 123<br />
Abbildung 15: Fachgebiet Textil der Pädagogischen Hochschule Freiburg (D)<br />
3.7 FORSCHUNG<br />
Schneider (2009) 124 widmet sich in einem Kapitel der Forschung und Wissenschaft des Designs.<br />
Er führt die Verpflichtung des eidgenössischen Fachhochschulgesetzes zur Forschung und Ent-‐<br />
wicklung auf.<br />
Nach der Lektüre „Entwerfen -‐ Wissen -‐ Produzieren“ von Mareis et al. (2010) 125 wird bewusst,<br />
dass sich in diesem Fachgebiet einiges bewegt. Die Texte vom 6. Jahrestag der deutschen Gesell-‐<br />
schaft für Designtheorie und -‐forschung DGTF 126 bringen die Dynamik und Fragen der Designfor-‐<br />
schung zur Geltung.<br />
122<br />
Becker, Christian (2007): Perspektiven Textiler Bildung. S. 38.<br />
123<br />
Pädagogische Hochschule Freiburg.<br />
124<br />
Schneider, Beat (2009): Design. Eine Einführung. S. 273 – 288.<br />
125 Mareis et al. (2007): Entwerfen – Wissen – Produzieren.<br />
126 http://www.dgtf.de/<br />
Kultur-‐<br />
geschichte<br />
der Mode<br />
Texslkunst<br />
Mode-‐<br />
psychologie<br />
und<br />
-‐soziologie<br />
Texsl-‐ und<br />
Bekleidungs-‐<br />
technologie<br />
Fachgebiet<br />
Texsl<br />
Texsl-‐<br />
gestaltung<br />
und<br />
Modedesign<br />
Texsl-‐<br />
ökologie<br />
Texsl-‐<br />
wirtscha<br />
Bekleidungs-‐<br />
physiologie<br />
47
3 <strong>DESIGN</strong> ALS WISSENSCHAFT<br />
In ihrem Werk „Design als Wissenskultur“ stellt Mareis (2011) 127 verschiedene Tendenzen im<br />
Zusammenhang von Designforschung fest. Sie spricht sogar von eigentlichen „Glaubenskriegen“<br />
der verschiedenen Richtungen.<br />
3.7.1 Tagungen<br />
Die Deutsche Gesellschaft für Designtheorie und -‐forschung 128 ist ein Beispiel für das Ringen der<br />
Disziplin für eine systematische Vorgehensweise. Sie organisiert regelmässig Tagungen und pu-‐<br />
bliziert die Resultate, z. B. zur Designforschung im Anwendungskontext 129 . Im Herbst 2011 findet<br />
eine weitere Tagung in Schwäbisch Gmünd zum Thema „Wer gestaltet die Gestaltung?“ statt. 130<br />
3.7.2 Wissenschaftliches Arbeiten<br />
Die Designlehre etabliert sich nach Schneider (2009) gegenwärtig zusammen mit Designfor-‐<br />
schung an den Hochschulen für Gestaltung als „Designwissenschaft“ 131 . In der Publikation „De-‐<br />
signtheorie und Designforschung“ beschreiben Brandes et al. (2009) 132 den Aspekt der For-‐<br />
schung und deren Verfahren.<br />
3.7.3 Publikationen als Forschungsresultate<br />
In der Zeitschrift „Werkspuren“ zeigen sich stets gute Einblicke und Anregungen aus und für die<br />
Praxis. Die Ausgabe zum Thema Designvermitteln 133 brachte einen angeregten Einblick in die<br />
Überlegungen der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Für die Publikation von Forschungsre-‐<br />
sultaten spielt diese Zeitschrift eine führende Rolle, da sie sich an interessierte Lehrpersonen<br />
aus dem Gestaltungsbereich wendet.<br />
127<br />
Mareis, Claudia (2011): Design als Wissenskultur. S. 299.<br />
128<br />
http://www.dgtf.de/.<br />
129<br />
Mareis et al. (2010): Entwerfen – Wissen – Produzieren (6. Jahrestagung der dgtf von 2009).<br />
130 http://www.dgtf.de/tg-‐news.<br />
131 Schneider, Beat (2009): <strong>DESIGN</strong> – E<strong>IN</strong>E E<strong>IN</strong>FÜHRUNG. S. 276.<br />
132 Brandes et al. (2009): Designtheorie und Designforschung. S. 80-‐128.<br />
133 Felix, Karl (2010): Design. Teil 1-‐Eine Einführung. In Werkspuren 2/2010. Design vermitteln.<br />
48
4 DIDAKTIK<br />
4 DIDAKTIK<br />
4.1 FACHDIDAKTISCHE ASPEKTE VON <strong>DESIGN</strong><br />
Die Fachdidaktik der beiden Fächer Technische und Textile Gestaltung basiert auf wissenschaftli-‐<br />
chen Grundlagen von Gestaltung und auf der Praxis mit ihren reflektierten Erfahrungen. In der<br />
Fachdidaktik für die Unterrichtsfächer Technische und Textile Gestaltung (Design und Technik)<br />
wird nebst dem Bezug zu den Fachwissenschaften auch der Bezug zur Handlung eine wichtige<br />
Rolle einnehmen. Dabei spielen geschichtliche, kulturelle und pädagogische Aspekte mit. An<br />
dieser Stelle gilt es festzuhalten, dass die beiden Fächer unterschiedliche Traditionen haben. Der<br />
Zusammenschluss zu einem Fach hat die betroffenen Parteien vor schwierige Aufgaben gestellt.<br />
Die Besinnung auf die Bezugsdisziplin könnte dabei eine willkommene Hilfe bieten.<br />
4.1.1 Lehrmittel Fachdidaktik<br />
Birri et al. (2003, S. 19) 134 sprechen von drei Strömungen, welche in der 250-‐jährigen Fachge-‐<br />
schichte Werken festgestellt wurden: dem „handwerklichen Modell“, dem „kunstpädagogischen<br />
Modell“ und dem „technischen Modell“. Als wichtig erscheint die Feststellung, dass die drei<br />
Strömungen sich nicht ausschliessen, sondern ergänzen.<br />
4.1.2 Textildidaktik<br />
In ihrem Lehrmittel bringt Kahlhoff (2005) 135 den handlungsorientierten Unterricht ins Gespräch.<br />
Nach ihr soll das „Handlungsprodukt“ [der Lerngegenstand] den Unterricht bestimmen und nicht<br />
die Lehrpläne oder traditionellen Lernziele. Ein Ansatz, der mit einigen Tendenzen des nachfol-‐<br />
genden Kapitels im Widerspruch steht.<br />
4.1.2 Technikunterricht<br />
In der Publikation „Didaktik allgemeinbildenden Technikunterrichts“ von Schmayl (2010) 136 wird<br />
Technikunterricht als Teil der naturwissenschaftlichen und berufsvorbereitenden Ausbildung<br />
(des Fachs Arbeitslehre) beschrieben:<br />
„Nicht das Leben, sondern die Kultur hat der eigentliche Bezugspunkt der Schule zu sein.<br />
Allgemeinbildender Unterricht kommt seinem Auftrag nach, wenn er mit Hilfe abstrak-‐<br />
ter Kategorien aus den hauptsächlichen Kulturbereichen konkrete zeitliche Inhalte ent-‐<br />
zeitlicht, sich damit über Aktualität und Flüchtigkeit erhebt, die Welt ordnet und eben<br />
dadurch Teilhabe an ihr ermöglicht.“<br />
134 Birri, Christian et al. (2003): Lehrmittel Fachdidaktik Technisches Gestalten/Werken.<br />
135 Kohlhoff-‐Kahl, Iris (2005): Textildidaktik. Eine Einführung. Donauwörth: Auer.<br />
136 Schmayl, Winfried (2010): Didaktik allgemeinbildenden Technikunterrichts. Seite 97.<br />
49
4 DIDAKTIK<br />
Bei Hüttner (2005) 137 ist die Sprache verständlicher. Das älteste Lehrmittel aus Deutschland zum<br />
Thema Methodik des Technikunterrichts von Henseler und Höpken (1996) 138 erstaunt: Es wer-‐<br />
den bei der Bewertung von Technik Begriffe verwendet, die bei den heutigen Bezugsdisziplinen<br />
zu finden sind:<br />
„Ethische Dimension, ökologische Dimension, soziale Dimension, Anthropogene Dimension,<br />
volkswirtschaftliche Dimension, betriebswirtschaftliche Dimension, Technische Dimension und<br />
die Naturwissenschaftlich/mathematisch/logische Dimension.“ Die „Verträglichkeit mit dem<br />
Individuum, der Gesellschaft und der Umwelt“ wird als Ziel definiert.<br />
Fazit: In den untersuchten Lehrmitteln zum Technikunterricht fehlen weitgehend die gestalteri-‐<br />
schen Dimensionen, die Zusammenarbeit und der Austausch mit Design, die Kommunikation<br />
und die Emotionen.<br />
4.2 <strong>DESIGN</strong>PROZESS AUS SICHT <strong>DER</strong> FACHDIDAKTIK<br />
4.2.1 Mitgestaltung, Emotionen und Spannung<br />
Design-‐ oder Problemlösungsprozesse sind in verschiedenen Varianten in Fachbüchern und auf<br />
dem Internet einsehbar. Im Anhang ist eine Zusammenstellung solcher Prozesse zu finden. Be-‐<br />
reits ein erster Blick in die Lehr-‐ und Lernmittel mit dem Unterrichtsfach Design and Technology<br />
bringt Ideen, wie die Entwicklung weitergehen könnte.<br />
In der folgenden Tabelle wurde versucht, Elemente solcher Prozesse aus der Designgeschichte<br />
mit den verschiedenen Vorgehensweisen mit professionellen Designprozessen zu verbinden.<br />
Die Tabelle zeigt die Grenzen eines mehrstufigen Problemlösungsmodells, um die ganze Breite<br />
an Möglichkeiten in einem Designprozess abzudecken. Die folgende Tabelle soll als Anregung für<br />
Verbindungen und Wurzeln zur Design-‐, Kultur-‐ und Technikgeschichte dienen. Kursiv sind spe-‐<br />
zielle Hinweise zu möglichen Designhandlungen und Elementen des Designprozesses.<br />
Tabelle 20: Entwicklungen der Gestaltungsmethoden<br />
Stichwort, Begriff Methode, Elemente Quelle<br />
Steinzeit Jäger und Sammler, Verwendung von Werk-‐<br />
Ötzi, Mann aus dem Eis<br />
3350-‐3100 v. Chr.<br />
zeugen aus Stein, Bohrer, Klingen, Wurfhölzer,<br />
Seil, Haus, ...<br />
Transportgeräte, Lederkleid, Stoffkleid, Schuhe,<br />
Reparaturmaterial, Metallguss, Waffen, ...<br />
Bridgman 139 ,<br />
S. 7<br />
Museum<br />
Bozen<br />
137<br />
Hüttner, Andreas (2005): Technik unterrichten. Methoden und Unterrichtsverfahren im Technikunterricht.<br />
138<br />
Höpken, Gerd et al.(1996): Methodik des Technikunterrichts. S. 42-‐45.<br />
139<br />
Bridgman, Roger (2006): 1000 Erfindungen und Entdeckungen. Vom Faustkeil bis zur Gentechnik.<br />
50
4 DIDAKTIK<br />
Ägypter Dezimalzahlen, Schrift, Geometrie, Mathematik,<br />
Ingenieurleistungen, Planung, Dokumentation ...<br />
Bridgman<br />
S. 20<br />
Griechen Keramik, Philosophie, Proportion, Ästhetik Autor<br />
Römer<br />
(Vitruv, ca. 80-‐10 v. Chr., Architek-‐<br />
turtheoretiker) Bau von Kriegsma-‐<br />
schinen unter Cäsar und Augustus<br />
Festigkeit und Zweckmässigkeit und Schönheit<br />
Handwerk, Kunsthandwerk<br />
Bürdek 140<br />
Mittelalter Zünfte mit Regeln Autor<br />
Industriedesign<br />
(Cole, Henry; Semper, Gottfried;<br />
Morris, William) ab ca. 1849<br />
Weltausstellungen<br />
1873, 1976, 1889<br />
„Arts and Crafts“-‐Bewegung<br />
(Ruskin, John und Morris, William)<br />
ca. 1860<br />
„Jugendstil“, „Art Nouveau“ und<br />
„Modern Style“, ca. 1905<br />
Kunsthandwerkliche Renaissance<br />
(Van de Velde, Henry)<br />
Kunstgewerbeschulen<br />
ab Mitte 19. Jahrhundert<br />
Werkbund<br />
(Behrens, P.; Van de Velde, H.; u. a.)<br />
1907<br />
De Stijl<br />
(Doesburg, Theo; Mondrian, Piet<br />
und Rietveld, Gerrit T.), 1917<br />
Bauhaus Gründungsphase<br />
„Meister der Form und Meister des<br />
Zweckorientierung: neue Materialien und Techno-‐<br />
logien<br />
Trennung von Entwurf und Ausführung, Muster-‐<br />
bücher, Herstellung auf Vorrat (Gusseisen, Ele-‐<br />
mentebau, Industrielle Produktion)<br />
Wettbewerb, Mustermessen<br />
„Sehen lernen, Sehen durch Vergleichen“<br />
S. 17<br />
Bürdek<br />
S. 19<br />
(Hauffe S.<br />
18) 141<br />
Bürdek<br />
S. 21<br />
Kunstgewerbe, Arbeitsteilung aufheben Bürdek<br />
S. 23<br />
„künstlerisches Lebensgefühl“, Emotionen Bürdek<br />
S. 23<br />
„Elitebildung und Individualismus“ Bürdek<br />
kunstgewerbliche Sammlungen von „Vorbildern<br />
zur Geschmacksbildung“, Museen<br />
„industrielle Standardisierung und künstlerische<br />
Individualität“<br />
„mechanische Ästhetik“: zukunftsgerichtete ästhe-‐<br />
tische und soziale Utopien<br />
Kreis, Quadrat, Dreieck, Kugel, Würfel, Pyramide<br />
Zusammenarbeit von Kunst, Industrie und Hand-‐<br />
werk durch Erziehung und Propaganda fördern<br />
Analyse und Diskussion von Experimenten als<br />
140 Bürdek, Bernhard E. (2005): <strong>DESIGN</strong> – GESCHICHTE, THEORIE UND PRAXIS <strong>DER</strong> PRODUKTGESTALTUNG.<br />
141 Hauffe, Thomas (2008): Design. Ein Schnellkurs.<br />
S. 23<br />
Hauffe<br />
S. 19<br />
Bürdek<br />
S. 25<br />
Bürdek<br />
S. 27<br />
Bürdek<br />
S. 31<br />
51
4 DIDAKTIK<br />
Handwerks“ in Zusammenarbeit<br />
(Van de Velde, Henry; Gropius,<br />
Walter; Itten, Johannes und andere)<br />
1902, 1919-‐1923<br />
Bauhaus zweite Phase<br />
„Hochschule für Gestaltung“<br />
(Breuer, Marcel; Moholy-‐Nagy; und<br />
weitere) 1923-‐28<br />
Bauhaus dritte Phase<br />
(Meyer, Hannes; van der Rohe,<br />
Mies) 1928-‐33<br />
Hochschule für Gestaltung Ulm<br />
„Wissenschaftlichkeit“ demonstrie-‐<br />
ren durch Ergonomie, Ökonomie,<br />
Mathematik, Physik, Politologie,<br />
Psychologie, Semiotik, Soziologie,<br />
Wissenschaftstheorie und weitere<br />
industrielle Produktgestaltung,<br />
Berücksichtigen von funktionalen,<br />
kulturellen, technologischen und<br />
wirtschaftlichen Faktoren bei der<br />
Entwicklung<br />
(Albers, Jose; Bill, Max; Itten, Jo-‐<br />
hannes; Nonné-‐Schmidt Helene;<br />
Peterhans, Walter) 1953<br />
Systemforschung erste Generation<br />
ursprünglich aus der Weltraumfor-‐<br />
schung für komplexe Prozesse<br />
1960er Jahre<br />
Recycling Design<br />
(Arbeitsgruppe HfG Offenbach)<br />
1974<br />
Neuer Glanz der Dinge<br />
Memphis-‐Gruppe 1982<br />
Ausgangslage, „Theorie der Gestaltung“ erst<br />
nachher<br />
Typisierung, Normierung, serielle Herstellung und<br />
Massenprodukten<br />
systematische und wissenschaftlich fundierte<br />
Architekturausbildung<br />
soziale Bestimmung von Architektur und Design<br />
„Gestalter hat dem Volk zu dienen“<br />
Designmethoden:<br />
systematisches Nachdenken über Problemstellung<br />
Methoden von Analyse und Synthese, Begründung<br />
und Auswahl von Entwurfsalternativen<br />
„hohe Gebrauchstauglichkeit der Produkte, Erfül-‐<br />
lung ergonomischer und physiologischer Forde-‐<br />
rungen, hohe funktionelle Ordnung, sorgfältige<br />
Gestaltung bis ins Detail, harmonische Gestaltung<br />
mit einfachen und geringen Mitteln, intelligentes<br />
Design, basierend auf Bedürfnissen, Verhaltens-‐<br />
weisen der Benutzer sowie innovativer Technolo-‐<br />
gie“<br />
1. Aufgabenstellung<br />
2. Informationen sammeln<br />
3. Analysieren und mit Ziel vergleichen<br />
4. Alternative Lösungskonzepte<br />
5. Vergleich der Lösungen, Simulationen<br />
6. Lösungen anbieten zur Entscheidung<br />
Entwurf, Produktion und Verkauf durch die Desig-‐<br />
ner selbst<br />
Bürdek<br />
S. 33<br />
Bürdek<br />
S. 29<br />
Bürdek<br />
S. 43-‐47<br />
Bürdek<br />
S. 62<br />
Bürdek<br />
S. 63<br />
Abkehr vom reinen Funktionalismus Bürdek<br />
Design als Kunst Objekte ohne Funktion Bürdek<br />
S. 63<br />
S. 67<br />
52
4 DIDAKTIK<br />
Design-‐Prozess als Planungsprozess 1. Problemstellung<br />
Neues Deutsches Design<br />
Feyerabend, Paul (Ende 70er Jahre)<br />
Paradigmenwechsel<br />
Einheit von Form und Kontext<br />
(Alexander, Christopher: Mathematik<br />
und Architektur), 1977<br />
Neue Designmethoden<br />
(Norman, Donald), 1989<br />
Mind Mapping<br />
(Buzan, Tony: 1970er Jahre), 1990<br />
Design Thinking<br />
(Kelly, David: Industriedesign, Grün-‐<br />
der von IDEO; Terry Winograd: In-‐<br />
formatik und Leifer, Larry: Maschi-‐<br />
nenbau; Stanford University)<br />
2005<br />
Szenario als Prognoseinstrument<br />
Kahn, Hermann<br />
1960er Jahre<br />
Virtuelle Prototypen<br />
Bürdek/ Schüpbach (1992)<br />
142 Ambrose, Gavin (2010): <strong>DESIGN</strong> TH!NK<strong>IN</strong>G.<br />
2. Zustandsanalyse<br />
3. Problemdefinition/Zieldefinition<br />
4. Konzeptentwurf/Alternatienbildung<br />
5. Bewertung und Auswahlentscheidung<br />
6. Entwicklungsplanung und Ausführungspla-‐<br />
nung<br />
„Methoden, welche die Vielfalt fördern“<br />
Für welche Zielgruppe? (von innen nach aussen)<br />
früher: von „allgemeiner Problemstellung zu<br />
spezieller Lösung“ (von aussen nach innen)<br />
Was bedeuten die Dinge für uns?<br />
„Gestaltungsprobleme sind mit dem Kontext zu<br />
verbinden.“<br />
Bürdek<br />
S. 256<br />
Bürdek<br />
S. 256<br />
Bürdek<br />
S. 257<br />
Focus: Einsatz und Bedienung des Produkts Bürdek<br />
S. 258<br />
Überwindung des linearen Denkens Bürdek<br />
1. Definition (Auftrag)<br />
2. Recherche (Hintergrund)<br />
3. Ideenfindung (Lösungen)<br />
4. Prototyping (Ausarbeitung)<br />
5. Auswahl (Begründung)<br />
6. Umsetzung (Auslieferung)<br />
7. Lernen (Feedback)<br />
Wie wird morgen gelebt?<br />
Welche Produkte werden dabei benötigt?<br />
Wie und wo werden diese produziert?<br />
Wie verändert sich der Verkauf dieser Produkte?<br />
Herstellung von „virtuellen Prototypen“<br />
Szenario in der Software-‐Entwicklung<br />
S. 259<br />
Ambrose<br />
S. 12 142<br />
Bürdek<br />
S. 263<br />
Bürdek<br />
S. 264<br />
53
4 DIDAKTIK<br />
Mood Charts<br />
Picasso, P / Braque, G., 1980er Jahre<br />
Empirische Methoden<br />
1980er Jahre<br />
Zielgruppenbestimmungen durch<br />
Milieus: Schulze, Gerhard, 1992<br />
Produktkliniken<br />
Design-‐Empirie,<br />
Usability wichtige Ergänzung zu na-‐<br />
turwissenschaftlichem Denken<br />
Ethical Process<br />
Brown, Marvin T. (2003, 3ff) 143 Vor-‐<br />
schläge, Beobachtungen, Werthal-‐<br />
tungen, Annahmen und alternative<br />
Sichtweisen zur Lösung eines Prob-‐<br />
lems<br />
Collagen mit Bildern, um Stimmungen einzufan-‐<br />
gen oder anstelle von Beschrieben<br />
Bürdek<br />
S. 264<br />
Umfragen, Datenerhebung Bürdek<br />
Milieuforschung, um potenzielle Zielgruppen<br />
einzuschätzen<br />
Neue Produkte präsentieren und in späterer<br />
Umgebung testen, Stichproben mit 5-‐8 Personen<br />
Nützlichkeit<br />
Schulungsaufwand, Spass<br />
1. Klärungsbedarf feststellen<br />
2. Dialog initiieren<br />
3. Positionen begründen<br />
4. Unterschiedliche Wertpräferenzen festhalten<br />
5. Grundannahmen offen legen<br />
6. Andere Sichtweisen<br />
7. Innovative Lösungen<br />
S. 265<br />
Bürdek<br />
S. 266<br />
Bürdek<br />
S. 267<br />
Bürdek<br />
S. 271<br />
Friedrich<br />
S. 151<br />
In der folgenden Abbildung sind Methoden aufgeführt im Sinne einer zur Verfügung stehenden<br />
Auswahl. Diese Aufzählung ist nicht abschliessend.<br />
143 Braun, Marvin T.: The Ethical Prozess (2004, 3ff), zitiert in Friedrich et al. (2008, S. 151): Wirklichkeit als Design-‐<br />
Problem.<br />
54
4 DIDAKTIK<br />
Milieus<br />
Verbrau-‐<br />
cher als<br />
Partner<br />
Ethik<br />
Usability<br />
Emotion<br />
Mood<br />
Charts<br />
NID<br />
Zukunft<br />
Abbildung 16: Designprozess und Methoden<br />
4.2.2 Methoden-‐Karten IDEO<br />
Problem-‐<br />
lösung<br />
Methoden<br />
Prozesse<br />
Nutzer<br />
Planung<br />
IDEO wurde 1991 als Zusammenschluss von drei Designbüros gegründet und hat Mitarbeitende<br />
aus den verschiedensten Gebieten des Designs aus USA, Grossbritannien, Deutschland und Chi-‐<br />
na. 144 Die Karten bringen Ideen für verschiedene Vorgehensweisen in Design-‐Prozessen. Die 51<br />
Methoden-‐Karten von IDEO 145 sind in Englisch erhältlich.<br />
In der Publikation Design studieren von Baur und Erlhoff (2007) 146 ist eine Methodensammlung<br />
zu finden, welche für die Lehrpersonen und das Studium des Fachs anregend sind.<br />
144 http://mitworld.mit.edu/video/357/.<br />
145 Stout, William (keine Angabe): IDEO METHOD CARDS.<br />
146 Baur, Ruedi und Erlhoff, Michael (2007): Design studieren. S. 127ff.<br />
Team-‐<br />
arbeit<br />
Alterna-‐<br />
tiven<br />
Paradig-‐<br />
men-‐<br />
wechsel<br />
Mind<br />
Mapping<br />
Kontext<br />
CAD<br />
55
4 DIDAKTIK<br />
4.2.3 Designprozesse<br />
Der Designprozess (auch als Problemlösungsprozess, Produktionsprozess oder Gestaltungspro-‐<br />
zess bezeichnet) ist ein zentrales Element der Gestaltungsfächer.<br />
Bereits im Werkweiser bei Dittli (2003) 147 ist der kreative Prozess ein Thema. Die „Phasen der<br />
Problemlösung bei Werkaufgaben = methodisches Problemlösen“ werden vorgestellt. Dies ist<br />
eigentlich eine Variante des Designprozesses. In der Sachanalyse, der Gestaltungsanalyse und im<br />
didaktischen Vierfeldermodell von Aeppli und Mätzler (2007) 148 finden sich ebenfalls Parallelen<br />
zu Design-‐ und Lösungsprozessen. Auch Kiper (2007) 149 fordert, dass „handlungsorientiertes<br />
Lernen im Textilunterricht von Problemen ausgehend konzipiert werden sollte.“<br />
Abbildung 17: Designprozess in Heufler, S. 79<br />
147 Dittli, Viktor (2003): Werkweiser 3. S. 8.<br />
148 Aeppli, Pia und Mätzler Binder, Regine (2007): Den Faden aufnehmen. S. 171-‐174.<br />
149 Kiper, Hana (2007) in Becker (2007): Perspektiven Textiler Bildung. S. 74.<br />
150 Heufler, Berhard (2007): Design Basics. S. 95-‐97.<br />
In der Publikation <strong>DESIGN</strong> BASICS (Heufler 2007 S.<br />
95) 150 wird erwähnt, dass es unter Recherchie-‐<br />
ren/Analysieren neben den klassischen Methoden<br />
von „Versuch/Irrtum“ und „Warten auf Inspiration“<br />
verschiedene Methoden als „Methodische Prob-‐<br />
lemlösung gibt“: „klassisches Brainstorming, de-‐<br />
skriptiv-‐konstruktives Brainstorming, Analogienbil-‐<br />
dung oder die Haltung, „sich vom Problem zu lö-‐<br />
sen“. Und bei Schneider (2009) werden bereits ähn-‐<br />
liche Phasen des Entwurfsprozesses zusammenge-‐<br />
fasst zu: 1. Informationsphase, 2. Analytische Phase,<br />
3. Entwurfsphase, 4. Entscheidungsphase, 5. Phase<br />
der Kalkulation und Anpassung des Produkts und 6.<br />
Verwirklichungsphase. So erstaunt es wenig, dass<br />
diese Entwicklung nicht aufhörte und somit ver-‐<br />
schiedene Prozesse ermöglicht, immer angepasst<br />
auf die jeweilige Ausgangslage.<br />
56
4 DIDAKTIK<br />
Abbildung 18: Richmond, W. (2011)151: “The Design Cycle”<br />
Auf der Homepage von „Design-‐Technology“ 152 befinden sich Anregungen, Unterlagen, Filme<br />
und Hintergrundmaterial zu Designprozessen. Daraus stammt auch die Abbildung 16.<br />
Fazit: Normalerweise sind es die Lehrperson, die recherchieren, planen, Ziele setzen, Informati-‐<br />
onen sammeln. Die Schülerinnen und Schüler führen später die Arbeit der Lehrperson aus.<br />
Das Verbesserungspotential: Eine Möglichkeit dazu ist das Mitbeteiligen der Schülerinnen und<br />
Schüler schon ab Beginn des Design-‐ oder Gestaltungsprozesses. Sie recherchieren, analysieren<br />
und planen mindestens einen Teil selbst unter den gegebenen Rahmenbedingungen.<br />
151 http://www.design-‐technology.info/designcycle/default.htm<br />
152 http://www.design-‐technology.info/home.htm<br />
57
5 VOM MOSAIKSTE<strong>IN</strong> ZUM GESAMTBILD<br />
5 VOM MOSAIKSTE<strong>IN</strong> ZUM GESAMTBILD<br />
5.1 <strong>DER</strong> VERGLEICHSRASTER<br />
5.1.1 Entwicklung des Vergleichsrasters<br />
Das Raster besteht aus ausgewählten Wörtern, mit denen der Gebrauch der Fachbezeichnungen<br />
und die Fachwörter in verschiedenen Gebieten anhand von Publikationen verglichen werden<br />
können (Raster im Anhang 6). Diese Publikationen sollten aus verschiedenen Kontexten stam-‐<br />
men und die Resultate aus dem ursprünglichen Vergleich der Lehrpläne mit dem Designbe-‐<br />
schrieb in einer Triangulation bestätigen oder widerlegen.<br />
Die Begriffe aus Teil 1 der folgenden Tabellen sind Wörter, welche bei der Suche nach Bezeich-‐<br />
nungen der Unterrichtsfächer auftauchten.<br />
Die Begriffe aus Teil 2 der folgenden Tabellen sind Nomen aus den Design-‐ oder Produktionspro-‐<br />
zessen. Die meistverwendeten Nomen aus Fries (2007) sind ebenfalls darin enthalten, sowie<br />
Fachwörter, die im Moment in Diskussion für den neuen Lehrplan sind.<br />
Die Begriffe aus Teil 3 der folgenden Tabellen stammen aus dem Gebiet von Emotionen. Diese<br />
können ein Bestandteil von Designprozessen sein, welche nicht nur technische Lösungen anbie-‐<br />
ten.<br />
5.1.2 Bildung in 2000 Zielen<br />
223 Seiten, Voraussetzung für die grau hervorgehoben Felder = 10 Nennungen<br />
Tabelle 21: Lehrplanvergleich von Fries et al. (2007)<br />
Ästhetik 0, Ästhetische<br />
Bildung 0<br />
Gestaltung 22, Archi-‐<br />
tektur 4<br />
Kunst 9, Künste 0, Art 0,<br />
Arts 0<br />
Fachbezeichnungen<br />
Design 11, design 0 Fashion 0 Mode 16<br />
Gestalten 0 Handwerk 0, Handar-‐<br />
Technik 13, technology<br />
0<br />
beit 4<br />
Kultur 11, Kulturwis-‐<br />
senschaften 0<br />
Textil, Textildesign 0 Werken 13, Werkerzie-‐<br />
hung 0<br />
Artefakt 0 Entwurf 0 Form 37, Formen 120 Funktion 44 , Funktio-‐<br />
nen 69<br />
Gegenstand 58 Idee 0; Ideen 44 Kommunikation 0 Konzept 0, Planung 0,<br />
Plan 8<br />
58
5 VOM MOSAIKSTE<strong>IN</strong> ZUM GESAMTBILD<br />
Kreativität 0 Material 192 Objekt 51 Produkt 73<br />
Projekt 0 Prozess 13 Qualität 0 Realisierung 0, Ausfüh-‐<br />
Recherche 0, Analyse 0 Reflexion 0 Techniken 89, Techno-‐<br />
Prozess<br />
logien 59<br />
rung 1, Herstellung 17,<br />
59<br />
Konstruktion 4, Produk-‐<br />
tion 77, Umsetzung 0<br />
Verfahren 71<br />
Bedeutung 51 Beziehung 53 Eigenschaften 45 Emotion 0, Emotionen<br />
Ethik 0, Ethos 0 Gefühl 16, Fantasie 0,<br />
Emotionen<br />
5.1.3 Argumentarium<br />
Intuition 0, Wagnis 0<br />
Wirkung 82<br />
7 Seiten, Voraussetzung für die grau hervorgehoben Felder = 3 Nennungen.<br />
Mätzler-‐Binder (2005) 153 stellte ein Argumentarium zusammen.<br />
Tabelle 22: Argumentarium für das Fach Werken und Gestalten<br />
Ästhetik 4, Ästhetische<br />
Bildung 2<br />
Gestaltung 4, Architek-‐<br />
tur 0<br />
Kunst 5, Künste 0, Art,<br />
Arts<br />
Fachbezeichnungen<br />
Design 1, design 0 Fashion 0 Mode 1<br />
Gestalten 49 Handwerk 1, Handar-‐<br />
Technik 0, Technologie,<br />
0, technology 0<br />
beit 1<br />
Textil 2, Textildesign 0,<br />
Textile 1<br />
6<br />
Kultur 1, Kulturwissen-‐<br />
schaften 0<br />
Werken 48, Werkerzie-‐<br />
hung 0<br />
Artefakt 0 Entwurf 0 Form 3 Funktion 1<br />
Gegenstand 3 Ideen 2 Kommunikation 0 Konzept 0, Planung 0,<br />
Plan 4<br />
Kreativität 2 Material 7 Objekt 0 Produkt 3<br />
Projekt 0 Prozess 2 Qualität 0 Realisierung 0, Ausfüh-‐<br />
153 Mätzler Binder, Regine (2005): Argumentarium. In Werkspuren 1/2005, Seiten 52-‐59.<br />
rung 1, Herstellung 1,<br />
Konstruktion 1, Produk-‐
5 VOM MOSAIKSTE<strong>IN</strong> ZUM GESAMTBILD<br />
Recherche 0, Analyse 0 Reflexion 0 Techniken 2, Technolo-‐<br />
Prozess<br />
gien 0<br />
tion 1, Umsetzung 0<br />
Verfahren 5<br />
Bedeutung 3 Beziehung 0 Eigenschaften 2 Emotion 0, Emotionen<br />
Ethik 0, Ethos 0 Gefühl 0, Fantasie 0,<br />
Emotionen<br />
Intuition 0, Wagnis 0<br />
Wirkung 3<br />
5.1.4 Referenzrahmen Gestaltung und Kunst<br />
84 Seiten; Voraussetzung für die grau hervorgehoben Felder = 10 Nennungen.<br />
Ursula Homberger et al. (2007) 154 beschreiben in ihrem „Referenzrahmen für Gestaltung und<br />
Kunst“ die Fächer Gestaltung und Kunst.<br />
Tabelle 23: Untersuchungsraster<br />
Ästhetik 27, Ästhetische<br />
Bildung 57<br />
Gestaltung 109, Archi-‐<br />
tektur 8<br />
Kunst 142, Künste 3, Art<br />
0, Arts 0<br />
Fachbezeichnungen<br />
Design 44, design 0 Fashion 0 Mode 9<br />
Gestalten 19 Handwerk 0, Handar-‐<br />
Technik 3, technology<br />
0, Technologie 0<br />
beit 6<br />
0<br />
Kultur 30, Kulturen 1,<br />
60<br />
Kulturwissenschaften 0<br />
Textil 10, Textildesign 0 Werken 25, Werkerzie-‐<br />
hung 0<br />
Artefakt 1 Entwurf 2 Form 31 Funktion 7<br />
Gegenstand 2 Idee(n) 10 Kommunikation 9 Konzept 15, Planung 3,<br />
Plan 0<br />
Kreativität 17 Material 8 Objekt 5 Produkt 8, Produkte 21<br />
Projekt 11, Projekte 2 Prozess 10 Qualität 4 Realisierung 2, Ausfüh-‐<br />
Recherche 0, Analyse 3 Reflexion 15 Techniken 5, Technolo-‐<br />
gien 0<br />
154 Homberger, Ursula et al. (2007): Referenzrahmen für Gestaltung und Kunst.<br />
rung 1, Herstellung 6,<br />
Konstruktion 4, Produk-‐<br />
tion 16, Umsetzung 4<br />
Verfahren 14
5 VOM MOSAIKSTE<strong>IN</strong> ZUM GESAMTBILD<br />
Prozess<br />
Bedeutung 55 Beziehung 2 Eigenschaften 5 Emotionen 4, Emotion<br />
Ethik 0, Ethos 0 Gefühl 1, Fantasie 1,<br />
Emotionen<br />
5.2 FACHHOCH<strong>SCHULE</strong>N<br />
Intuition 0, Wagnis 0<br />
5.2.1 Studiengänge in der Schweiz<br />
Wirkung 13<br />
Umfang: 28 Seiten; Voraussetzung für die grau hervorgehoben Felder = 1 Nennung.<br />
In der Übersichtstabelle der Schweizer Berufsberatung (2009) 155 über alle Studienprogramme<br />
der Universitäten und Fachhochschulen wird als erstes die Begrifflichkeit untersucht. Die Anzahl<br />
der Universitäten oder Fachhochschulen, die dieses Studienfach anbieten, wird dadurch nicht<br />
erfasst. Wegen der besonderen Gewichtung von Studienfächern wird bereits mit einer einzelnen<br />
Nennung der Begriff in die Wertung aufgenommen.<br />
Tabelle 24: Universitäten und Fachhochschulen Schweiz<br />
Ästhetik 0, Ästhetische<br />
Bildung 0<br />
Gestaltung 1, Architek-‐<br />
tur 3<br />
Kunst 11, Künste 2, art<br />
1, Art 7, arts 0, Arts 13<br />
Fachbezeichnungen<br />
Design 31, design 1,<br />
Industriedesign 2,<br />
Produktdesign 0, Ob-‐<br />
jektdesign 1, Materi-‐<br />
aldesign 1<br />
Gestalten 0 Handwerk 0, Handar-‐<br />
Technik 4, Ingenieur-‐<br />
wissenschaften 0, Inge-‐<br />
nieur 0, technology 0,<br />
(...ingenieur 28)<br />
Fashion 0, fashion 0 Mode 2, Modedesign 0,<br />
beit 0<br />
0<br />
Textildesign 1<br />
Kultur 4, Kulturwissen-‐<br />
schaften 3<br />
Textil 0, Textildesign 1 Werken 0<br />
155 http://www.berufsberatung.ch/dyn/bin/12869-‐25878-‐1-‐ssf_tabellen_f_r_bbch_pa.pdf.<br />
61
5 VOM MOSAIKSTE<strong>IN</strong> ZUM GESAMTBILD<br />
5.2.2 Hochschule der Künste Bern, Berner Fachhochschule<br />
2 Seiten; Voraussetzung für die grau hervorgehoben Felder = 3 Nennungen.<br />
hkb.bfh: Die Bachelor-‐ und Masterstudiengänge in Vermittlung von Kunst und Design / Art Edu-‐<br />
cation an der Hochschule der Künste Bern. 156<br />
Tabelle 25: Fachbezeichnungen<br />
Ästhetik 0, Ästhetische<br />
Bildung 0<br />
Gestaltung 1, Architek-‐<br />
tur 0<br />
Kunst 11, Künste 1,<br />
Kunstwissenschaft 0,<br />
Art 10, Arts 1<br />
Fachbezeichnungen<br />
Design 9, design 1 Fashion 0 Mode 0<br />
Gestalten 1 Handwerk 0, Handar-‐<br />
Technik 0, Technologie<br />
0, technology 0<br />
beit 0<br />
Textil 0, Textiles 0,<br />
Textilien 0<br />
Kultur 0, Kulturwissen-‐<br />
schaften 0<br />
Werken 0, Werkerzie-‐<br />
hung 0<br />
Bachelor: BA Vermittlung in Kunst und Design: „ Das Studium vermittelt Grundlangen in den<br />
Bereichen Kunst, Design, Kunstwissenschaft, Medien, Materialität und Kommunikation.“ 157<br />
Master: MA in Art Education: „Das Masterstudium in Art Education ist ein künstlerisches-‐<br />
wissenschaftliches-‐pädagogisches Dreifachstudium für angehende Vermittlerinnen und Vermitt-‐<br />
ler in Kunst und Design.“ 158<br />
5.2.3 Hochschule der Künste Nordwestschweiz<br />
182 Seiten; Hürde für die grau hervorgehoben Felder = 10 Nennungen.<br />
fhnw: Studienführer 159 : Bachelor und Master Studienführer Gestaltung und Kunst 2011/2012 al.<br />
Tabelle 26: Hochschule der Künste Nordwestschweiz (Teil der fhnw)<br />
Ästhetik 1, Ästhetische<br />
Bildung 0<br />
Gestaltung 76, Archi-‐<br />
tektur 7<br />
Kunst 198, Künste 4, Art<br />
10, Arts 1<br />
Fachbezeichnungen<br />
Design 157, design 2,<br />
Produktdesign 1<br />
Gestalten 11 Handwerk 1, Handar-‐<br />
Technik 27, technology<br />
0<br />
Fashion 4 Mode 31, Textildesign 0<br />
beit 0<br />
Textil 1, Textiles 0,<br />
Textilien 0<br />
Kultur 11, Kulturwis-‐<br />
senschaften 3<br />
Werken 1<br />
156 http://www.hkb.bfh.ch/fileadmin/PDFs/Gestaltung/VKD/Kurztext_BA_MA_ArtEd_Web.pdf.<br />
157 http://www.hkb.bfh.ch/de/studium/bachelor/bavkd/.<br />
158 http://www.hkb.bfh.ch/de/studium/master/maartedu/.<br />
159 Studienführer fhnw, Bachelor-‐ und Master-‐Studienführer Gestaltung und Kunst 2011/2012.<br />
62
5 VOM MOSAIKSTE<strong>IN</strong> ZUM GESAMTBILD<br />
Artefakt 0 Entwurf 27 Form 18 Funktion 2<br />
Gegenstand 2 Ideen 2 Kommunikation 78 Konzept 13, Planung 10,<br />
Plan 0<br />
Kreativität 3 Material.9 Objekt 6 Produkt 11<br />
Projekt 60 Prozess 6 Qualität 10 Realisierung 9, Ausfüh-‐<br />
Recherche 20, Analyse<br />
10<br />
Prozess<br />
Reflexion 39 Techniken 9, Technolo-‐<br />
gien 1<br />
rung 6, Herstellung 4,<br />
63<br />
Konstruktion 4, Produk-‐<br />
tion 3, Umsetzung 11<br />
Verfahren 3<br />
Bedeutung 7 Beziehung 1 Eigenschaften 0 Emotion 0<br />
Ethik, Ehos 0 Gefühl 2, Fantasie 0,<br />
Emotionen<br />
Intuition 0, Wagnis 0<br />
Wirkung 3<br />
5.2.4 Design & Kunst an der Hochschule Luzern<br />
2 Seiten; Voraussetzung für die grau hervorgehoben Felder = 3 Nennungen.<br />
FH Zentralschweiz: Master of Arts in Design 160 , Prospekt über die Studiengänge.<br />
Tabelle 27: FH Zentralschweiz: Design & Kunst, Hochschule Luzern<br />
Ästhetik 0, Ästhetische<br />
Bildung 0<br />
Gestaltung 3, Architek-‐<br />
tur 0<br />
Kunst 7; Künste 0, Art 0,<br />
Arts 2<br />
Design 22, design 2,<br />
Produktdesign 1<br />
160 Hochschule Luzern: Master of Arts in Design.<br />
Gestalten 0 Handwerk 0, Handar-‐<br />
Fashion 0, fashion 0 Mode 0, Textildesign 1<br />
beit 0<br />
Technik 0, technology 0 Textil 1, Textiles 4,<br />
Textilien 0<br />
Kultur 1, Kulturwissen-‐<br />
schaften 0<br />
Werken 0
5 VOM MOSAIKSTE<strong>IN</strong> ZUM GESAMTBILD<br />
5.2.5 Textildesign an der Hochschule Luzern<br />
1 Seite; Voraussetzung für die grau hervorgehoben Felder = 3 Nennungen.<br />
Flyer Textildesign Hochschule Luzern, Textildesign 161 .<br />
Tabelle 28: Textildesign<br />
Ästhetik 0, Ästhetische<br />
Bildung 0<br />
Gestaltung 1, Architek-‐<br />
tur 1<br />
Kunst 0, Künste 0, Art 0,<br />
Arts 2, art 0, arts 0<br />
Fachbezeichungen<br />
Design 6, design 8,<br />
Produktdesign 1<br />
Gestalten 0 Handwerk 0, Handar-‐<br />
Fashion 0, fashion 1 Mode 1, Textildesign 3<br />
beit 0<br />
Technik 0, technology 2 Textil 0, Textiles 0,<br />
5.2.5 Zürcher Hochschule der Künste<br />
Textilien 1, Textildesign<br />
3<br />
Kultur 0, Kulturwissen-‐<br />
schaften 0<br />
Werken 0<br />
136 Seiten, Voraussetzung für die grau hervorgehoben Felder = 10 Nennungen.<br />
Studienangebot 2011 162 ; ZHdK: Zürcher Hochschule der Künste<br />
Tabelle 29: ZHdK<br />
Ästhetik 5, Ästhetische<br />
Bildung 11<br />
Gestaltung 36, Archi-‐<br />
tektur 3<br />
Kunst 129, Künste 128,<br />
Art 28, Arts 220<br />
Fachbezeichnungen<br />
Design 165, design 25,<br />
Industriedesign 1<br />
Gestalten 21 Handwerk 5, Handar-‐<br />
Fashion 0, fashion 0 Mode 0, Modedesign 0<br />
beit 0<br />
Technik 3, technology 0 Textil 1, Textiles 0,<br />
Textilien 1, T.-‐design 0<br />
Kultur 23, Kulturwis-‐<br />
senschaften 0<br />
Werken 1<br />
Artefakt 0 Entwurf 5 Form 6 Funktion 5<br />
Gegenstand 2 Ideen 11 Kommunikation 29 Konzept 3, Planung 5,<br />
Plan 0<br />
Kreativität 2 Material 4 Objekt 1 Produkt 3<br />
Projekt 7 Prozess 0 Qualität 4 Realisierung 1, Ausfüh-‐<br />
161 Hochschule Luzern, Textildesign.<br />
162 Zürcher Hochschule der Künste, Studienangebot 2011.<br />
rung 0, Herstellung 1,<br />
64
5 VOM MOSAIKSTE<strong>IN</strong> ZUM GESAMTBILD<br />
Recherche 0, Analyse 7 Reflexion 18 Techniken 5, Technolo-‐<br />
Prozess<br />
gien 6<br />
65<br />
Konstruktion 4, Produk-‐<br />
tion 14, Umsetzung 10<br />
Verfahren 12<br />
Bedeutung 11 Beziehung 0 Eigenschaften 0 Emotion 0<br />
Ethik 0, Ethos 0 Gefühl 0, Fantasie 2,<br />
Emotionen<br />
Intuition 0, Wagnis 0<br />
Wirkung 1<br />
5.3 NACHBARDISZIPL<strong>IN</strong>EN UND AN<strong>DER</strong>E LÄN<strong>DER</strong><br />
5.3.1 Kunst und Kultur aus Österreich<br />
294 Seiten. Wien: EDUCULT; Voraussetzung für die grau hervorgehoben Felder = 10 Nennungen.<br />
Der Text von Michael Wimmer 163 (2007) ist ein Bericht im Auftrag des Bundesministeriums für<br />
Unterricht, Kunst und Kultur. Es geht darin um die „Kulturelle Bildung in Österreich -‐ Strategien<br />
für die Zukunft“.<br />
Tabelle 30: Kulturelle Bildung Österreich<br />
Ästhetik 3, Ästhetische<br />
Bildung 7<br />
Gestaltung 16, Archi-‐<br />
tektur 46<br />
Kunst 469, Künste 7, Art<br />
30, Arts, 96<br />
Fachbezeichnungen<br />
Design 45, design 4,<br />
Produktdesign 0, De-‐<br />
signpädagogik 5<br />
Gestalten 11<br />
(plastisches, bildneri-‐<br />
sches, kreatives, hand-‐<br />
werkliches, texties, ...)<br />
Technik 19, technology<br />
0<br />
Fashion 1, fashion 0 Mode 11, Modedesign<br />
Handwerk 6, Handar-‐<br />
beit 0<br />
Textil 5, Textiles 10,<br />
Textilien 0, Textildesign<br />
0<br />
0<br />
Kultur 267, Kulturwis-‐<br />
senschaften 6<br />
Werken 26, Werkerzie-‐<br />
hung 21<br />
Artefakt 0, Artefakte 1 Entwurf 0 Form* 21 Funktion 18<br />
Gegenstand 7 Ideen 38 Kommunikation 19 Konzept 17, Planung 17,<br />
Plan 3<br />
163 Wimmer Michael (2007): Vielfalt und Kooperation. Kulturelle Bildung in Österreich -‐ Strategien für die Zukunft.
5 VOM MOSAIKSTE<strong>IN</strong> ZUM GESAMTBILD<br />
Kreativität 49 Material 9; Materialien<br />
14<br />
Objekt 0, Objekte 9 Produkt 8, Produkte 4<br />
Projekt 187 Prozess 22 Qualität 54 Realisierung 8, Ausfüh-‐<br />
Recherche 3, Analyse 4 Reflexion 7 Techniken 9, Technolo-‐<br />
gien 11<br />
Prozess *ohne „in Form von“ (23 abgezogen)<br />
rung 1, Herstellung 4,<br />
66<br />
Konstruktion 1, Produk-‐<br />
tion 9, Umsetzung 32<br />
Verfahren 4<br />
Bedeutung 48 Beziehung 7 Eigenschaften 2 Emotion 2<br />
Ethik 3, Ethos 1 Gefühl 6, Gefühle 15,<br />
Emotionen<br />
Fantasie 3, Intuition 0,<br />
Wagnis 0<br />
Wirkung 6<br />
5.3.2 Design als Marketing-‐Mittel für Europa<br />
54 Seiten; Voraussetzung für die grau hervorgehoben Felder = 10 Nennungen.<br />
Die Broschüre “Design, treibende Kraft für Europa” des BEDA 164 unterstreicht die Marketing-‐<br />
Seite von Design.<br />
Tabelle 31: Design, treibende Kraft für Europa<br />
Ästhetik 6, Ästhetische<br />
Bildung 0<br />
Gestaltung 7, Architek-‐<br />
tur 5<br />
Kunst 8, Künste 1, Art<br />
17, Arts 0<br />
Fachbezeichnungen<br />
Design 373, design 5,<br />
Produktdesign 2<br />
Fashion 0, fashion 5 Mode 7<br />
Gestalten 0 Handwerk 4, Handar-‐<br />
beit 0<br />
Technik 1, technology 1 Textil 0, Textiles 0,<br />
Textilien 0, Textildesign<br />
0<br />
Kultur 32, Kulturwis-‐<br />
senschaften 0<br />
Werken 0, Werkerzie-‐<br />
hung 0<br />
Artefakt 1, Artefakte 3 Entwurf 0 Form 11 Funktion 13<br />
Gegenstand 3 Ideen 13 Kommunikation 14 Konzept 9, Planung 4,<br />
Plan 1<br />
Kreativität 7 Material 1 Objekt 7 Produkt 13<br />
Projekt 8 Prozess 14 Qualität 12 Realisierung 0, Ausfüh-‐<br />
164 Mac Donald, Stuard (2004): Design, Treibende Kraft für Europa.
5 VOM MOSAIKSTE<strong>IN</strong> ZUM GESAMTBILD<br />
Recherche 0, Analyse 1 Reflexion 1 Techniken 0, Technolo-‐<br />
Prozess<br />
gien 17<br />
rung 0, Herstellung 1,<br />
67<br />
Konstruktion 0, Produk-‐<br />
tion 12, Umsetzung 3<br />
Verfahren 1<br />
Bedeutung 26 Beziehung 2 Eigenschaften 2 Emotion 0, Emotionen<br />
Ethik 5, Ethos 0 Gefühl 0, Gefühle 1,<br />
Emotionen<br />
Fantasie 0, Intuition 0,<br />
Wagnis 0<br />
5.3.3 Österreich: technisches Werken<br />
Wirkung 2<br />
5 Seiten; Voraussetzung für die grau hervorgehoben Felder = 3 Nennungen.<br />
Österreich: Technisches und Textiles Werken, Volksschule (2007) 165<br />
Tabelle 32: Volksschule Technisches und Textiles Werken Österreich<br />
Ästhetik 0, Ästhetische<br />
Bildung 0<br />
Gestaltung 0, Architek-‐<br />
tur 0, Produktgestal-‐<br />
tung 3<br />
Kunst 0, Künste 0, Art 0,<br />
Arts 0<br />
Fachbezeichnungen<br />
Design 0, design 0 Fashion 0 Mode 0<br />
Gestalten 2 Handwerk 0, Handar-‐<br />
beit 0<br />
2<br />
Kultur 0, Kulturwissen-‐<br />
schaften 0<br />
Technik 3, technology 0 Textil 0, Textildesign 0 Technisches Werken 7,<br />
Werkerziehung 0<br />
Artefakt 0 Entwurf 0 Form 4 Funktion 7<br />
Gegenstand 0 Ideen 0, Idee 0 Kommunikation 0 Konzept 0, Plan 0, Pla-‐<br />
nung 1<br />
Kreativität 0 Material 2 Objekt 0 Produkt 0<br />
Projekt 0 Prozess 0 Qualität 0 Realisierung 0, Ausfüh-‐<br />
165 Österreich, technisches Werken, Lehrplan der Volksschule.<br />
rung 0, Herstellung 2,<br />
Konstruktion 0, Produk-‐
5 VOM MOSAIKSTE<strong>IN</strong> ZUM GESAMTBILD<br />
Recherche 0, Analyse 0 Reflexion 0 Techniken 0, Technolo-‐<br />
Prozess<br />
gien 1<br />
tion 0, Umsetzung 0<br />
Verfahren 0<br />
Bedeutung 3 Beziehung 0 Eigenschaften 1 Emotion 0, Emotionen<br />
Ethik 0, Ethos 0 Gefühl 0, Fantasie 0,<br />
Emotionen<br />
Intuition 0, Wagnis 0<br />
5.3.4 Österreich: Textiles Werken<br />
Wirkung 0<br />
1,5 Seiten; Voraussetzung für die grau hervorgehoben Felder = 3 Nennungen.<br />
Österreich, Oberstufe: Textiles Werken (2004) 166<br />
Tabelle 33: Gymnasium Österreich, Oberstufe: Textiles Werken<br />
Ästhetik 0, Ästhetische<br />
Bildung 0<br />
Gestaltung 1, Architek-‐<br />
tur 0<br />
Kunst 0, Künste 0, Art 0,<br />
Arts 0<br />
Fachbezeichnungen<br />
Design 1, design 0 Fashion 0, fashion 0 Mode 1, Kleidung 1<br />
Gestalten 0 Handwerk 0, Handar-‐<br />
Technik 0, technology<br />
0, Textiltechnologie 1<br />
beit 0<br />
Textil 0, Textildesign 0,<br />
Textiles Werken 2<br />
0<br />
textile Kultur 3 , Kultur<br />
68<br />
1, Kulturwissenschaften<br />
0<br />
Werken 4, Werkerzie-‐<br />
hung 0<br />
Artefakt 0 Entwurf 1 Form 1 Funktion 1<br />
Gegenstand 0 Ideen 0, Idee 0 Kommunikation 0 Konzept 0, Planung 0,<br />
Plan 0<br />
Kreativität 0 Material 0 Objekt 0 Produkt 0, Produkte 3<br />
Projekt 0 Prozess 0 Qualität 0 Realisierung 0, Ausfüh-‐<br />
166 Österreich Lehrplan Oberstufe, Textiles Werken.<br />
rung 0, Herstellung 2,<br />
Konstruktion 0, Produk-‐<br />
tion 0, Umsetzung 0
5 VOM MOSAIKSTE<strong>IN</strong> ZUM GESAMTBILD<br />
Recherche 0, Analyse 0 Reflexion 0 Techniken 1, Technolo-‐<br />
Prozess<br />
gien 1<br />
Verfahren 1<br />
Bedeutung 0 Beziehung 0 Eigenschaften 1 Emotion 0, Emotionen<br />
Ethik 0, Ethos 0 Gefühl 0, Fantasie 0,<br />
Emotionen<br />
Intuition 0, Wagnis 0<br />
Wirkung 0<br />
5.3.5 Technische Standards USA und Deutschland<br />
USA 249 Seiten; Voraussetzung für die grau hervorgehoben Felder = 10 Nennungen<br />
Die amerikanischen Standards 167 wurden im Jahr 2000 durch die ITEA International Technology<br />
Education Association publiziert (Internationalen Energie-‐Bildungsverband). Die deutsche Über-‐<br />
setzung erfolgte durch den Verein deutscher Ingenieure (VDI) 168 . (260 Seiten)<br />
Tabelle 34: Begriffe USA<br />
Ästhetik aesthetic 2<br />
aesthetics 2, Ästheti-‐<br />
sche Bildung aesthetic<br />
education 0<br />
Gestaltung shaping 8<br />
(Formgebung)<br />
Kunst, Künste art 10,<br />
arts 19<br />
Fachbezeichnungen<br />
Artefakt artefact, arti-‐<br />
fact 4<br />
Design design 949,<br />
Design 80<br />
Gestalten designing 169<br />
57<br />
Technik technology<br />
776, Technology 226<br />
Entwurf: draft 2, minute<br />
3; scheme 1, draft 2,<br />
layout 5; development<br />
250<br />
Fashion wie Textil<br />
(fashion ist nur Mode-‐<br />
design ohne Textilde-‐<br />
sign)<br />
Handwerk craft 2 (Töp-‐<br />
fer, Handwerk), trade<br />
32 (Spengler, eher mit<br />
Maschinen), (business<br />
13), handcraft 0<br />
Textil fashion 2, Fashion<br />
0<br />
Form shape 24,<br />
shaping 8, modelling 1<br />
167 ITEEA, International Technology and Engineering Educators Association.<br />
168 Höpken, Gerd (2003): Standards für eine allgemeine technische Bildung.<br />
169 Sinn, Stefanie, Designerin aus Donaueschingen half bei Fragen.<br />
0<br />
Mode siehe fashion<br />
Kultur culture 11<br />
Werken work 199<br />
69<br />
siehe Handwerk, crafts<br />
Funktion function 43
5 VOM MOSAIKSTE<strong>IN</strong> ZUM GESAMTBILD<br />
Gegenstand object 19,<br />
objects 8, thing 7, item<br />
22, article 0<br />
Kreativität creativity 22 Material material 33,<br />
Ideen: ideas 136 Kommunikation: com-‐<br />
materials 178<br />
munication 116<br />
70<br />
Konzept, Planung: con-‐<br />
cept 34, plan 22, plan-‐<br />
ning 15, schedule 0,<br />
timeframe 0, brief 8<br />
Objekt object 19 Produkt product 192,<br />
outcomes 9<br />
Projekt project 20, Prozess process 324 Qualität: quality 52 Realisierung, Produkti-‐<br />
Recherche, Analyse<br />
Analyse analysis 12,<br />
test 39, verifying 0<br />
Prozess<br />
Bedeutung importance<br />
22, significance 1,<br />
meaning 3, weight 6,<br />
subject 18<br />
Reflexion reflection 0,<br />
reflect 15<br />
Beziehung relationship<br />
3, relation 5, connection<br />
Ethos ethics 3 Gefühl feel 3, sense 7,<br />
Emotionen<br />
3<br />
feeling 0<br />
Techniken, Technolo-‐<br />
gien: techniques 41,<br />
technologies 280<br />
Eigenschaften: proper-‐<br />
ties 10<br />
Wirkung effect 24,<br />
results 49, conse-‐<br />
guences 28<br />
on, Konstruktion reali-‐<br />
zation 1, implementati-‐<br />
on 9, construction 60,<br />
production 63<br />
Verfahren procedure<br />
10, method 27, opera-‐<br />
tion 18, process 324<br />
Emotion emotion 0<br />
Die Begriffe über die Sprachgrenzen und Länder sind nicht identisch. So ist es möglich, dass ein-‐<br />
zelne Fachwörter durch das verwendete Messsystem ungenau bewertet wurden. Die Resultate<br />
dürften trotzdem nur unbedeutend abweichen, weil sie in der Triangulation aufgefangen wer-‐<br />
den. In diesem Fall geschieht dies durch die deutschsprachigen Wörter und ihre Verwendung.<br />
Im Anhang 7 sind die Daten gegenübergestellt. Die Beobachtung: Der Begriff „Design“ wird<br />
übersetzt in „Entwurf und Konstruktion“. „The Designed World“ wird übersetzt in „Die techni-‐<br />
sche Welt“.<br />
Fazit: Es scheint, dass die Begriffe „Design“ oder „Gestaltung“ für den deutschen Ingenieurver-‐<br />
band (VDI) bewusst vermiedene Wörter sind. Wenn der Begriff (design/Design) in der amerika-‐<br />
nischen Originalfassung 1000fach vorkommt und in der Übersetzung gar nicht mehr, dann ent-‐<br />
spricht das nicht dem aktuellen Sprachgebrauch. Wenn Design ebenso oft wie der Begriff Tech-‐<br />
nik (technology/Technology) vorkommt, kann das Wort nicht so wie beschrieben übersetzt wer-‐<br />
den. Vielleicht hat dies einen Zusammenhang mit der internen Sprachkultur innerhalb der Be-‐<br />
rufsgruppe der Ingenieure. Eine Art „Rosetta-‐Effekt“ 170 kommt zur Geltung.<br />
170 „Rosetta-‐Effekt“: Dieselben Inhalte werden in unterschiedlichen „Kulturen“ anders bezeichnet und geschrieben.
5 VOM MOSAIKSTE<strong>IN</strong> ZUM GESAMTBILD<br />
5.3.6 Australien New South Wales: Design and Technology<br />
43 Seiten 171 , Voraussetzung: 10 Nennungen für die graue Markierung.<br />
Der Lehrplan des australischen Bundesstaats New South Wales NSW 172 lieferte folgende Ver-‐<br />
gleichszahlen (Lehrplan über alle Fächer des 7. – 10. Jahrs) für das Fach Design und Technik:<br />
Tabelle 35: Australien NSW: Design and Technology<br />
Ästhetik aesthetic 2,<br />
aesthetics 5, Ästheti-‐<br />
sche Bildung aesthetic<br />
education 0<br />
Gestaltung formation 0<br />
fashioning 0, shaping 0,<br />
architecture 0<br />
Kunst, Künste art 1, arts<br />
0<br />
Fachbezeichnungen<br />
Design design 280,<br />
Design 97<br />
Gestalten designing 18 Handwerk crafts 1,<br />
Technik, Technologie<br />
technology 37, Techno-‐<br />
logy 100<br />
Artefakt artifact 0 Entwurf: draft 0, deve-‐<br />
Gegenstand thing 0,<br />
object 0<br />
lopment 30<br />
Kreativität creativity 5 Material material 3,<br />
Fashion fashion 2 Mode siehe fashion<br />
trades 0, business 0,<br />
handcraft 0<br />
Kultur culture 0<br />
Textil siehe fashion Werken work 37<br />
Form shape 0, shaping<br />
0, modelling 3<br />
Ideen: ideas 62 Kommunikation: com-‐<br />
materials 46<br />
munication 11<br />
Funktion function 6<br />
71<br />
Konzept, Planung: con-‐<br />
cept 1 , plan 10, plan-‐<br />
ning 11, schedule 0,<br />
timeframe 0, brief 0<br />
Objekt object 0 Produkt product 0,<br />
outcomes 50<br />
Projekt project 51 Prozess process 38 Qualität: quality 24 Realisierung, Produkti-‐<br />
Recherche, Analyse<br />
Analyse analysis 4, test<br />
4, verifying 0<br />
Prozess<br />
Reflexion reflection 2 Techniken, Technolo-‐<br />
gien: techniques 43,<br />
technologies 38<br />
on construction 9, pro-‐<br />
duction 9<br />
Verfahren procedure 0<br />
method 1, process 38<br />
171 Design und Technology: http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/syllabus_sc/pdf_doc/design_tech_710_syl.pdf .<br />
172 Übersicht über alle Bereiche: http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/syllabus_sc/index.html#d.
5 VOM MOSAIKSTE<strong>IN</strong> ZUM GESAMTBILD<br />
Bedeutung importance<br />
2, significance 0, mean-‐<br />
ing 1, weight 1, subject<br />
0<br />
Beziehung relationship<br />
2, relation 13, connec-‐<br />
tion 0<br />
Eigenschaften: proper-‐<br />
ties 5<br />
Ethos ethics 2 Gefühl feel 0, sense 2 Wirkung effect 0,<br />
Emotionen<br />
results 7, conseguences<br />
5.3.7 Australien New South Wales: Textile Technology<br />
47 Seiten. Voraussetzung für die graue Markierung: 10 Nennungen.<br />
Unter „Textile Technology“ finden sich folgende Begriffe 173<br />
Tabelle 36: Australien NSW: Textile Technology<br />
Ästhetik aesthetic(s) 38,<br />
Ästhetische Bildung<br />
Gestaltung formation 0,<br />
Architektur, architec-‐<br />
ture 0<br />
Kunst, Künste art 0, arts<br />
0<br />
Fachbezeichnungen<br />
Design design 184,<br />
Design 12, (Costume<br />
Design 7)<br />
Gestalten designing 14 Handwerk crafts 0,<br />
Technik, Technologie<br />
technology 7, Techno-‐<br />
logy 59 (Textiles Tech-‐<br />
nology)<br />
Artefakt artifact 0 Entwurf: draft 1, deve-‐<br />
Gegenstand thing 0,<br />
object 0<br />
lopment 33<br />
Kreativität creativity 0 Material material 14,<br />
0<br />
Emotion emotion 0<br />
Fashion fashion 11 Mode siehe fashion<br />
trades 0, business 0,<br />
handcraft 0<br />
Textil siehe fashion<br />
textile 163 (materials)<br />
Form shape 0, shaping<br />
0, modelling 0<br />
Ideen: ideas 46 Kommunikation: com-‐<br />
materials 74<br />
munication 5<br />
Kultur culture 2<br />
Werken work 138<br />
Funktion function 2<br />
72<br />
Konzept, Planung: con-‐<br />
cept 1 , plan 13, plan-‐<br />
ning 7, schedule 0,<br />
timeframe 3, brief 10<br />
Objekt object 0 Produkt product 2,<br />
outcomes 40, Outco-‐<br />
mes 13<br />
173 Australien NSW: http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/syllabus_sc/pdf_doc/textiles_tech_710_support.pdf
5 VOM MOSAIKSTE<strong>IN</strong> ZUM GESAMTBILD<br />
Projekt project 52 Prozess process 47 Qualität: quality 35 Realisierung, Produkti-‐<br />
Recherche, Analyse<br />
Analyse analysis 0, test<br />
1, verifying 0<br />
Prozess<br />
Bedeutung importance<br />
2, significance 2, mean-‐<br />
ing 1, weight 0, subject<br />
0<br />
Reflexion reflection 3 Techniken, Technolo-‐<br />
Beziehung relationship<br />
3, relation 11, connec-‐<br />
tion 0<br />
Ethos ethics 2 Gefühl feel 0, sense 2,<br />
Emotionen<br />
sensation<br />
5.3.8 Auswertung Triangulation<br />
gien: techniques 54,<br />
technologies 1<br />
Eigenschaften: proper-‐<br />
ties 40<br />
Wirkung effect 1, re-‐<br />
sults 1, conseguences 0<br />
on, construction 44,<br />
production 35<br />
Verfahren procedure 4<br />
method 2, process 47<br />
Emotion emotion 0<br />
Die grau hervorgehobenen Begriffe als Vorselektion werden im folgenden Raster ausgewertet.<br />
Je mehr Punkte, umso mehr waren sie in den 16 Rastern 174 bei den Favoriten. 16 von 16, das<br />
wäre in allen Nennungen aus Teil 1 ein herausragendes Ergebnis. Sie wurde von keinem Begriff<br />
erreicht. In Teil2 und drei waren maximal 12 Nennungen möglich. Die Prozentzahlen geben die<br />
relative Klassierung an: In wie vielen Teilrastern ein Begriff zu den Favoriten gehörte.<br />
Mit der Triangulation sollten Fragen und Erkenntnisse überprüft werden. Ob es Aussagen über<br />
die Verwendung der Fachbegriffe und der Vorgehensweisen in einem Designprozess gibt. Und<br />
ob die Emotionen ein Thema sind. Die dritte Frage kam nicht über die Hypothesen in das Raster,<br />
sondern über die Unterschiede zwischen „Designtexten“ und „Techniktexten“. An dieser Stelle<br />
sei ein Hinweis auf die Wettbewerbsverfahren und Bewertungskriterien von Designkriterien<br />
erlaubt. Sicher ein spannendes Feld für weitere Forschungen.<br />
Die Auswertung der Triangulation erbrachte folgende Indizien:<br />
Fachbezeichnungen:<br />
Bei den Fachbegriffen dominiert der Begriff Design, deutlich dahinter liegend die Begriffe Gestal-‐<br />
tung und Werken. Kunst, Kultur und Technik als verwandte Disziplinen gehören etwa bei der<br />
Hälfte zu den ausgewählten Begriffen. Mode und Wörter mit Textil kommen weniger häufig vor.<br />
174 Teil 1 des Rasters ist den Fachbezeichnungen, Teil 2 den Prozessen und Teil 3 den Emotionen gewidmet.<br />
73
5 VOM MOSAIKSTE<strong>IN</strong> ZUM GESAMTBILD<br />
Prozess:<br />
Die folgenden Elemente des Gestaltungsprozesses gehören mit über 50% zu den ausgewählten<br />
Begriffen: Die Ideen, das Konzept, das Material, das Verfahrung (die Technik) und die Realisie-‐<br />
rung (=Produktion), an dieser Stelle aufgeführt in der Reihenfolge des Designprozesses. Das Pro-‐<br />
jekt und der Prozess gehören ebenfalls zu den häufig eingesetzten Begriffen. Nicht ganz überra-‐<br />
schend ist der Begriff Produkt mit 92% führend. Die Recherche (Analyse) ist ebenso wenig ver-‐<br />
treten wie der Entwurf.<br />
Emotionen:<br />
Die Emotionen finden im Raster vor allem beim Begriff Bedeutung ihren Niederschlag. Die Be-‐<br />
ziehung ergänzt diesen Bereich.<br />
Zu den Fachbezeichnungen:<br />
Zwei der ursprünglich für den Rater gewählte Begriffe kamen häufiger vor als diejenigen mit der<br />
ursprünglichen Suchabfrage: Die Analyse hat mehr Treffer als die Recherche. Und die Produktion<br />
mehr als die Realisierung.<br />
Fazit: Lehrpläne von Fachhochschulen verwenden ebenso wie Texte aus dem Umfeld von Design<br />
und Technik die Fachbegriffe, welche sich international durchgesetzt haben. Die Begriffe Design<br />
und Technik gehören dazu.<br />
Wesentliche Arbeitsschritte des Designprozesses konnten sowohl in Lehrplänen als auch in Ver-‐<br />
gleichstexten nachgewiesen werden.<br />
Die Emotionen spielen bei den untersuchten Texten eine untergeordnete Rolle.<br />
74
5 VOM MOSAIKSTE<strong>IN</strong> ZUM GESAMTBILD<br />
Tabelle 37: Indizien anhand von Begriffen<br />
Bildung in 2000 Zielen<br />
Argumentarium<br />
Referenzrahmen<br />
Studiengänge in der Schweiz<br />
Hochschule der Künste Bern<br />
Hochschule der Künste fhnw<br />
Design & Kunst Hochschule Luzern<br />
Textildesign Hochschule Luzern<br />
Fachbegriffe<br />
Ästhetik 5/16 31<br />
Design 14/16 88<br />
Fashion 1/16 6<br />
Mode 5/16 31<br />
Gestaltung 9/16 56<br />
Gestalten 8/16 50<br />
Handwerk 1/16 6<br />
Kultur 9/16 56<br />
Kunst 11/16 69<br />
Technik 9/16 56<br />
Textil 6/16 38<br />
Werken 9/16 56<br />
Prozess<br />
Artefakt 0/12 0<br />
Entwurf 4/12 33<br />
Form 8/12 67<br />
Funktion 6/12 46<br />
Gegenstand 3/12 25<br />
Ideen 8/12 67<br />
Kommunikation 6/12 46<br />
Konzept 8/12 67<br />
Kreativität 3/12 23<br />
Material 7/12 58<br />
Objekt 3/12 23<br />
Produkt 11/12 92<br />
Projekt 7/12 58<br />
Prozess 7/12 58<br />
Qualität 6/12 50<br />
Realisierung 10/12 83<br />
Recherche 2/12 17<br />
Reflexion 4/12 33<br />
Techniken 8/12 67<br />
Verfahren 8/12 67<br />
Emotionen<br />
Bedeutung 8/12 67<br />
Beziehung 5/12 42<br />
Eigenschaften 3/12 25<br />
Emotionen 0/12 0<br />
Ethik 0/12 0<br />
Gefühl 3/12 25<br />
Wirkung 4/12 33<br />
Zürcher Hochschule der Künste<br />
Kunst und Kultur, Österreich<br />
Design als Marketing<br />
Technisches Werken Österreich<br />
Textiles Werken Österreich<br />
Standards USA und D<br />
Design and Technology NSW, AU<br />
Textile Technology NSW, AU<br />
Auswahl in Zahlen<br />
75<br />
Auswahl in Prozenten
5 VOM MOSAIKSTE<strong>IN</strong> ZUM GESAMTBILD<br />
5.4 WEITERE ASPEKTE<br />
5.4.1 Alltagsobjekte<br />
Design und seine Auswirkungen finden im Alltag statt. In der Projektarbeit des Autors 175 mit dem<br />
Titel: „Knackig! Design erleben.“ konnten Bezüge zum Design im Alltag hergestellt werden. Das<br />
Schulbuch Bumerang 176 war ein erster Schritt des Autors in Richtung Design.<br />
5.4.2 Wettbewerbe<br />
Die Designwettbewerbe sind wichtige Antriebe für die Praxis und für das Marketing. Die Publika-‐<br />
tionen des Design-‐Museums London sind dienlich 177 . Angepasste Qualitätskriterien fördern die<br />
Entwicklung in bestimmte Richtungen. Interessant sind die Kriterien für gutes Design. Diese ge-‐<br />
ben Anregungen für die Didaktik und die Praxis. In Haase (2002) 178 werden die Kriterien des IF-‐<br />
Wettbewerbs in Hannover verwiesen. Die 10 Kriterien sind für gestaltete Produkte innerhalb<br />
der Schule in adaptierter Form übertragbar:<br />
1. Praktischer Nutzen, 2. Ausreichende Sicherheit, 3. Lebensdauer und Gültigkeit, 4. Ergonomi-‐<br />
sche Anpassung, 5. Technische und formale Eigenständigkeit, 6. Umfeld-‐Beziehung, 7. Umwelt-‐<br />
freundlichkeit, 8. Gebrauchsvisualisierung, 9. Hohe Gestaltungsqualität und 10. Sinnlich-‐geistige<br />
Stimulanz.<br />
5.4.3 Museen<br />
Die Designmuseen wurden in der Triangulation nicht berücksichtigt. Ein wesentlicher Grund ist<br />
die nicht eindeutige Klassierung durch die Begriffsverwendungen. Hauffe (2008) 179 hat dies ele-‐<br />
gant gelöst, indem er von einer „Auswahl“ spricht: 20 aus Deutschland, 12 internationale Muse-‐<br />
en. Bei der Zusammenstellung von Schneider (2009) 180 fehlen so wichtige Museen wie das Rös-‐<br />
ka-‐Museum in Göteborg oder das Design-‐Museum in Kopenhagen. Es werden 22 Museen für die<br />
Schweiz, Europa und die USA erwähnt.<br />
Auch ein technisches Museum bietet in vielen Bereichen Aspekte der Gestaltung an. Das Swiss<br />
Science Center Technorama 181 ist dazu ein anschauliches Beispiel für das Faszinieren mit Phä-‐<br />
nomenen, einem emotionalem Bezug zur Technik.<br />
175 Aepli, Beat (2009): Knackig! Design erleben. Projektarbeit an der Universität Bern.<br />
176 Aepli, Beat (1987): Bumerang. Bausteine für das Werken.<br />
177 Design Museum London (2008, 2009, 2010, 2011): Designs oft he year.<br />
178 Text aus Haase, Frank et al. (2002): <strong>DESIGN</strong>WISSEN.<br />
179 Hauffe, Thomas (2008): <strong>DESIGN</strong>. Ein Schnellkurs, S. 190-‐191.<br />
180 Schneider, Beat (2009): <strong>DESIGN</strong>. Eine Einführung, S. 294.<br />
181 Technorama, swiss science center. http://www.technorama.ch/.<br />
76
6 ERKENNTNISSE<br />
6 Erkenntnisse<br />
6.1 ZUSAMMENFASSUNG<br />
6.1.1 Vergleich<br />
Der Vergleich der Lehrpläne mit den Tätigkeiten und Inhalten von professionellem Design führ-‐<br />
te zu aufschlussreichen Ergebnissen. Die „Fächer Technische und Textile Gestaltung“ könnten<br />
erheblich an Gehalt gewinnen, wenn dieser Bezug bewusst wahrgenommen wird. Insbesondere<br />
sind die gestalterischen Elemente ein Thema, das es auszubauen und zu optimieren gilt. Das<br />
Interesse für die Herstellung von eigenen Produkten, die Gestaltungsmöglichkeiten und das<br />
Verständnis von Technik sind Ausgangspunkte für Arbeiten im Bereich von „Design und Tech-‐<br />
nik“ in der Schule und könnten auch Ausgangspunkte für weitere Forschungen in der Fachdis-‐<br />
ziplin sein.<br />
6.1.2 Triangulation<br />
Mit der Triangulation konnten die Resultate überprüft werden. Daraus ergaben sich folgende<br />
Indizien:<br />
1. Bereits in den Lehrplänen von 2007 sind die Bezugsdisziplinen „Design“ und „Kunst“ annä-‐<br />
hernd im gleichen Ausmass mit „Gestaltung“ präsent, obwohl in den damaligen Fachbe-‐<br />
zeichnungen diese zwei Begriffe nicht existierten.<br />
2. „Design“ führt in den Fachbezeichnungen der Triangulation mit einem Wert von rund 90%.<br />
Das bedeutet, der Begriff wird in den verschiedenen Vergleichsdokumenten aus dem Be-‐<br />
reich Gestaltung in der Praxis annähernd flächendeckend verwendet.<br />
3. Der Begriff „Design“ wird sowohl in den Fachhochschulen der Schweiz, in Deutschland als<br />
auch im englischsprachigen Raum eingesetzt.<br />
6.2 BEANTWORTUNG <strong>DER</strong> HYPOTHESEN<br />
Fachbezeichnungen<br />
Die Hypothese 1 lautete: Es existiert bis jetzt noch keine allgemein anerkannte wissenschaftliche<br />
Bezugsdisziplin für die Schulfächer technische und textile Gestaltung in der Schweiz.<br />
Die Hypothese konnte bestätigt werden.<br />
1. Es existiert nicht eine einzige Bezugsdisziplin, die den breiten Bereich der handwerkli-‐<br />
chen, gestalterischen und technischen Tätigkeiten des Fachs abdeckt.<br />
2. Unterstützend kommt dazu, dass eine allgemeine Anerkennung in dem untersuchten<br />
Feld sehr schwierig zu finden ist, weil mehrere verwandte Fachdisziplinen in einem Ge-‐<br />
77
6 ERKENNTNISSE<br />
staltungsprozess involviert sind und mindestens auch als Bezugsdisziplinen zusätzlich<br />
erwähnt werden müssten.<br />
Verwandtschaft mit Design<br />
Die Hypothese 2 lautete: In den bisherigen Lehrplänen der Volksschule lassen sich Vorgehenswei-‐<br />
sen, Inhalte und Tätigkeiten feststellen, welche auch in professionellen Prozessen und -‐produkten<br />
im Zusammenhang mit Design Bestandteile der Tätigkeiten von Designerinnen und Designern<br />
sind.<br />
Die Hypothese 2 konnte ebenfalls bestätigt werden. Eine enge Verwandtschaft der bisherigen<br />
Schulfächer im Gestaltungsbereich mit professionellem Design konnte nachgewiesen werden.<br />
Studiendisziplinen<br />
Die Hypothese 3 lautete: Design gehört aufgrund der Bezeichnungen der inhaltlich naheliegen-‐<br />
den Studiengänge an Fachhochschulen und Universitäten zu den Bezugswissenschaften.<br />
Die Hypothese 3 konnte bestätigt werden. Nach den Bezeichnungen der Studienrichtungen in<br />
den gestalterischen Fachhochschulen sind „Design“ und „Gestaltung“ die dominanten Begriffe<br />
und könnten als Bezugsdisziplin betrachtet werden.<br />
Bezugsdisziplinen<br />
Die Hypothese 4 lautete: Design als Bezugsdisziplin passt besser als andere in Frage kommende<br />
Wissenschaften zu den prozess-‐ und produktorientierten kreativen und handwerklichen Tätigkei-‐<br />
ten von Gestalten und Erfinden.<br />
Die Hypothese 4 konnte nicht bestätigt werden. Sie könnte nur dann bestätigt werden, wenn<br />
unter dem Fach „Technische und Textile Gestaltung“ prozess-‐ und produktorientierte kreative<br />
und handwerkliche Tätigkeiten von Gestalten und Erfinden gemeint sind. Dies ist weder in der<br />
Praxis noch in der verwendeten Didaktik der Fall. Die am Lehrplan beteiligten Fachpersonen und<br />
Praktiker könnte dazu eine Klärung liefern. Auch die Fachhochschulen können beratend an die-‐<br />
sem Diskurs teilhaben.<br />
Gegenpositionen<br />
„Technisches und Textiles Gestalten“ stossen auf Akzeptanz bei den Behörden, neue Begriffe<br />
könnten Diskussionen auslösen. Das Argument überzeugt nicht, weil die Fachhochschulen diese<br />
Begriffe verwenden und sie den Bezug zur Disziplin aufzeigen.<br />
„Technikunterricht“ ist in Deutschland weit verbreitet, also wird daraus geschlossen, dass auch<br />
bei uns der Begriff „Technik“ als Fachbegriff verwendet wird. Als Gegenargument kann darauf<br />
geantwortet werden: Der Inhalt stimmte in diesem Fall nicht mit der Bezeichnung überein. Denn<br />
unter Technikunterricht wird inhaltlich etwas Anderes verstanden als das, was in der Schweiz in<br />
der Praxis durchgeführt wird: Eine Verbindung von Design und Technik.<br />
78
6 ERKENNTNISSE<br />
6.3 SCHLUSSFOLGERUNGEN<br />
Eine Übersicht über die verwendeten Fachbegriffe wurde zusammengestellt und mit Hilfe einer<br />
Vergleichsuntersuchung in den Kontext gestellt. Es sind gute Argumente und Indizien vorhan-‐<br />
den, welche den Begriff „Design und Technik“ zum Favoriten heraushebt. Die nächst verwand-‐<br />
ten Disziplinen sind „Produktdesign und Technik“ und „Textildesign und Technik“.<br />
Die bisherigen Lehrpläne besitzen Gemeinsamkeiten mit Inhalt und Tätigkeiten aus dem Bereich<br />
Design. Dies konnte durch den Vergleich zweier Text-‐Konzentrate und der Überprüfung mit<br />
Studieninhalten und weiteren Unterlagen aus dem Kontext der Untersuchung bestätigt werden.<br />
Die dritte Frage, welches die wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen für die Gestaltungsfächer<br />
Technische und Textile Gestaltung sind oder sein könnten, kann aufgrund der Untersuchung<br />
beantwortet werden. Es sind in erster Linie Design und Technik mit den Disziplinen Produktde-‐<br />
sign, Technik und Textildesign. Es gibt noch weitere Disziplinen, von denen einige näher und<br />
andere entfernter verwandt sind.<br />
Als mögliche Entwicklungstendenzen werden vorgeschlagen:<br />
1. Neue Fachbezeichnungen sind auf dem Hintergrund der Studiendisziplinen an Fachhoch-‐<br />
schulen und Universitäten zu definieren. Design und Technik erfüllt die Vorgabe.<br />
2. Der Design-‐ und Problemlösungsprozess soll in die Schulpraxis von Design und Technik inte-‐<br />
griert werden und zwar so, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur vorgegebene Pläne<br />
ausführen, sondern bereits bei der Recherche, Ideensuche und bei der Planung einbezogen<br />
werden.<br />
3. Bei den Lehrmitteln für das Kennenlernen der Gestaltungselemente ist eine Lücke feststell-‐<br />
bar. Diese sollte geschlossen werden.<br />
4. Die Emotionen, der persönliche Bezug und die Verbindung mit der Lebenswelt sind für die<br />
Lehr-‐ und Lernpraxis von Design und Technik ebenso zu integrieren, wie ethische und öko-‐<br />
logische Aspekte. Die Bezugsdisziplinen Ethik und Ökologie liefern dazu Hintergründe.<br />
5. Der Technikbezug ist nicht nur für die Bewältigung des Alltags zu fördern.<br />
6. Aus den Fertigkeiten für den Umgang mit Werkzeug und Material, den Regeln der Gestal-‐<br />
tung und Konstruktion, der inneren Beteiligung und dem Wissen und Verständnis für die<br />
Sache lassen sich Elemente für gutes Handwerk und die Hinführung zu Berufen ableiten.<br />
Lehrpläne sind flexibel gestaltet und werden auch in der Zukunft notwendige Anpassungen zu-‐<br />
lassen. Hoffentlich verhelfen sie zu anregendem und sinnvollem Unterricht mit engagierten<br />
Lehrpersonen, welche Schülerinnen und Schüler für Design und Technik begeistern!<br />
79
LITERATURVERZEICHNIS<br />
LITERATURVERZEICHNIS<br />
Aepli, Beat (1987): Bumerang. Bausteine für das Werken. Hölstein / Zürich: Verlag svhs und zkm,<br />
heute swch.ch.<br />
Aepli, Beat (2009): Knackig! – Design erleben. Einführung in das Design am Beispiel Nussknacker.<br />
Projektarbeit im Rahmen der MAS Kunst und Gestaltung. Universität Bern.<br />
Aeppli, Pia und Mätzler Binder, Regine (2007): Den Faden aufnehmen. In: Becker, Christian<br />
(Hrsg.). Perspektiven Textiler Bildung. Hohengehren: Schneider.<br />
Alexander, Kerstin (2007): Kompendium der visuellen Information und Kommunikation. Berlin,<br />
Heidelberg, New York: Springer.<br />
Ambrose, Gavin (2010): Design Thinking. München: Stiebner.<br />
Australien: Lehrplan von New South Wales NSW (2003-‐2007): Boards of Studies NSW. Sydney.<br />
Übersicht über alle Bereiche http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/syllabus_sc/index.html#d<br />
Textiltechnik:<br />
http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/syllabus_sc/pdf_doc/textiles_tech_710_support.pdf.<br />
Design und Technology:<br />
http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/syllabus_sc/pdf_doc/design_tech_710_syl.pdf<br />
Baur, Ruedi et al. (2007): Design studieren. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag.<br />
Becker, Christian (2007): Perspektiven Textiler Bildung. Hohengehren: Schneider.<br />
Berufsberatung Schweiz: http://www.berufsberatung.ch/dyn/bin/12869-‐25878-‐1-‐<br />
ssf_tabellen_f_r_bbch_pa.pdf. (03-‐09-‐2011).<br />
Birri, Christian et al. (2003): Lehrmittel Fachdidaktik Technisches Gestalten / Werken. Basel /<br />
St. Gallen: Eigenverlag.<br />
Brandes, Uta et al. (2009): Designtheorie und Designforschung. Paderborn: Wilhelm Fink.<br />
Braun, Marvin T. (2004): The Ethical Prozess. In Friedrich et al. (2008, S. 151): Wirklichkeit als De-‐<br />
sign-‐Problem. Würzburg: Ergon.<br />
Brändle, Christian et al. (2009): Every Thing Design. Die Sammlungen des Museum für Gestal-‐<br />
tung Zürich. Ostfildern: Hatje Cantz.<br />
Bridgman, Roger (2006): 1000 Erfindungen und Entdeckungen. Vom Faustkeil bis zur Gentech-‐<br />
nik. London: Dorling Kindersley.<br />
Britisches Museum (2011): Foto des Steins von Rosette.<br />
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_image.aspx?image=an16456b.jpg<br />
&retpage=15633<br />
Bruckner, Martin et al. (1997): Design. Arbeitsheft. Stuttgard: Klett.<br />
Buchholz, Kai (2007): Designlehren, Wege deutscher Gestaltungsausbildung. Stuttgart: Arnold-‐<br />
sche.<br />
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie bbt: Bologna-‐Deklaration.<br />
http://www.bbt.admin.ch/themen/hochschulen/00215/00224/index.html?lang=de.<br />
(03.07.2011).<br />
80
LITERATURVERZEICHNIS<br />
Bürdek, Bernhard E. (2005): <strong>DESIGN</strong>. Geschichte, Theorie und Praxis der Produktgestaltung. Ba-‐<br />
sel: Birkhäuser.<br />
Bürdek, Bernhard E. (2011): in Eisele, Petra und Bürdek Bernard: Design, Anfang des 21. Jh.<br />
Ludwigsburg: avedition.<br />
Design Museum London (2008, 2009, 2010, 2011): Designs oft he year. Brit Insurance (design<br />
award). London: Design Museum.<br />
Deutsche Gesellschaft für Designtheorie und -‐forschung. Tagung designDIDAKTIK:<br />
http://www.dgtf.de/tg/81-‐perma-‐716 (03-‐09-‐2011).<br />
Design and Technology (GB): http://www.design-‐technology.info/home.htm. (18.08.2011).<br />
Dittli, Viktor et al. (2002): Werkweiser 3 für technisches und textiles Gestalten, Handbuch für<br />
Lehrkräfte 7.-‐9. Schuljahr. Bern: blmv, sabe, swch.<br />
Dugger, William E. (2000): Standards for Technological Literacy: Content for the Study of Tech-‐<br />
nology. Virginia: ITEA (International Technology Education Association (Technology for All<br />
Americans Projekt). www. iteaconnekt.org.<br />
Duden: Duden online: http://www.duden.de/. (verschiedene Termine im 2011).<br />
Eidgenössischer Preis für Design:<br />
http://www.swissdesignawards.ch/federaldesign/2010/about/index.html?lang=de (20-‐08-‐11).<br />
Eisele, Petra & Bürdek, Bernhard E. (Hrsg.) (2011): Design, Anfang des 21. Jh.; Diskurse und Per-‐<br />
spektiven. Ludwigsburg: avedition.<br />
England, offizieller Lehrplan: Department for Education and Skills (2004): Design and technology:<br />
Key Stages 1-‐4. The National Curriculum for England. London: department for education and<br />
skills.<br />
Erdmann, Raimund (2007): Design -‐ Recherchieren und Konzeptionieren. Kursunterlagen Uni-‐<br />
verstität Bern, MAS in Fachdidaktik Kunst und Gestaltung. Brugg: Erdmann Design AG.<br />
Erloff, Michael / Marshall, Tim (2008): Wörterbuch Design. Begriffliche Perspektiven des Design.<br />
Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser.<br />
Ernst, Meret und Eggenberger, Christian (2006): Designsuisse. inkl. 2 DVDs. Zürich: Verlag Hoch-‐<br />
parterre/Scheidegger & Spiess.<br />
Europa: Mac Donald, Stuard (2004): Design, Treibende Kraft für Europa. Barcelona, Bureau of<br />
European Design Associations-‐BEDA auch unter:<br />
http://www.designluxembourg.lu/binaries/hima.Document/A6EE8429C23F8FB3E88D7B67547<br />
8A8E2/download_document/wb.pdf. (01.08.2011).<br />
Fachhochschule Bern:<br />
http://www.hkb.bfh.ch/fileadmin/PDFs/Gestaltung/VKD/Kurztext_BA_MA_ArtEd_Web.pdf.<br />
(10.09.2011).<br />
Fachhochochschule Luzern: Master of Arts in Design: http://www.hslu.ch/d-‐master-‐design<br />
(10.09.2011).<br />
Fachhochschule Nordwestschweiz: Fächerporträt Technische Gestaltung im Studiengang Sekun-‐<br />
darstufe I in: http://www.fhnw.ch/ph/isek/Sekundarstufe%201/faecherportraets/technische-‐<br />
gestaltung-‐im-‐studiengang-‐sekundarstufe-‐i. (19.05.2011).<br />
81
LITERATURVERZEICHNIS<br />
Fachhochschule Nordwestschweiz fhnw: Fächerporträts/Bild und Kunst:<br />
http://www.bildnerischeundtechnischegestaltung.ch/fileadmin/stephan/bildnerische-‐<br />
gestaltung-‐im-‐studiengang-‐sekundarstufe-‐i.pdf. (10.09.2011).<br />
http://www.fhnw.ch/hgk/bachelor-‐und-‐master/master-‐of-‐arts-‐ma/cooperative-‐master-‐s-‐in-‐<br />
art-‐and-‐design-‐education-‐an-‐secondary-‐teaching/cooperative-‐master. (10.09.2011)<br />
Fachkommission des LCH für Textile Gestaltung: http://lch.ch/cms/front_content.php?idcat=28<br />
(24.09.2011)<br />
Felix, Karl (2010): Design. Teil 1-‐Eine Einführung. In Werkspuren 2/2010. Design vermitteln. Posi-‐<br />
tionen und Haltungen. Zug: SWV. Werkspuren.<br />
Fiell, Charlotte und Peter (2006): Design. Handbook. Konzepte, Materialien, Stile. Köln: Taschen.<br />
Flagmeier, Renate (2007): Kampf der Dinge. Der Deutsche Werkbund zwischen Anspruch und<br />
Wirklichkeit. Leipzig: Koehler & Amelang GmbH.<br />
Flick, Uwe: Triangulation (2011): Eine Einführung. Wiesbaden: VS Verlag.<br />
Franke, Vera (2010): Design. Teil 2-‐Positionen der Dozierenden. In Werkspuren 2/2010. Design<br />
vermitteln. Positionen und Haltungen. Zug: SWV Werkspuren.<br />
Freiburg: Pädagogische Hochschule Freiburg (D): https://www.ph-‐freiburg.de/haushalt-‐<br />
textil/mode-‐und-‐texteil/studium.html. (26.07.2011).<br />
Friederich, Thomas (2008): Wirklichkeit als Design-‐Problem. Würzburg: Ergon.<br />
Fries, Anna-‐Verena et al. (2007): Bildung in 2000 Zielen. Bildnerisches und Technisches Gestalten<br />
in den Lehrplänen der Deutschschweiz. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich.<br />
Gaus-‐Hegner, Elisabeth und Mätzler Binder, Regine (2005): Technisches und Textiles Gestalten.<br />
Fachdiskurs um Kernkompetenzen. Zürich: Verlag Pestalozzianum.<br />
Gewerbemuseum Winterthur (2011): Böse Dinge. (2011, 16. Januar bis 31. Juli). Winterthur:<br />
Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Werkbundarchiv-‐Museum der Dinge, Berlin.<br />
Grossbritannien: Verband in Grossbritannien: http://www.data.org.uk http://www.design-‐<br />
technology.info/ oder auch http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/design/; Lehrplan: Na-‐<br />
tionales Curriculum England http://curriculum.qcda.gov.uk/index.aspx. (02.08.2010).<br />
Habermann, Heinz (2003): Kompendium des Industrie-‐Design. Grundlage der Gestaltung. Berlin:<br />
Springer.<br />
Haase, Frank und Biller, Rudi (2002): Designwissen: Entstehung – Umsetzung – Perspektiven.<br />
Sternenfels (D): Verlag Wissen und Praxis.<br />
Hauffe, Thomas (2008): <strong>DESIGN</strong>. Ein Schnellkurs. Köln: DuMont.<br />
Henseler, Wolfgang (2011) in Eisele, Petra & Bürdek, Bernhard E.: Design, Anfang des 21. Jh.<br />
Ludwigsburg: avedition.<br />
Heufler, Gerhard (2006): Design Basics, Von der Idee zum Produkt. Sulgen/Zürich: Niggli.<br />
Herrmann, Christoph & Möller, Günther (2011) in Eisele, Petra & Bürdek, Bernhard E.: Design,<br />
Anfang des 21. Jh. Ludwigsburg: avedition.<br />
82
LITERATURVERZEICHNIS<br />
Hochschule der Künste Zürich ZHdK:<br />
http://www.zhdk.ch/fileadmin/data_zhdk/hochschule/Medien___Kommunikation/Publikation<br />
en/20101015_Studienangebot_2011.pdf (03.08.11)<br />
Homberger, Ursula et al. (2007): Referenzrahmen für Gestaltung und Kunst. Zürich: Pädagogi-‐<br />
sche Hochschule.<br />
Höpken, Gerd (2003): Standards für eine allgemeine technische Bildung. Villingen-‐<br />
Schwenningen: Neckar-‐Verlag. [Übersetzung von: Dugger, William E. (2000): Standards for<br />
Technological Literacy: Content for the Study of Technology. Virginia: ITEA (International Tech-‐<br />
nology Education Association and ist (Technology for all Americans, Projekt). www. itea-‐<br />
connekt.org.] (01.10.2010)<br />
Hüttner, Andreas (2005): Technik unterrichten. Methoden und Unterrichtsverfahren im Tech-‐<br />
nikunterricht. Haan-‐Gruiten: Europa-‐Lehrmittel.<br />
Industrie Forum Design GmbH: http://www.ifdesign.de/awards_index_d (20-‐08-‐11)<br />
Institut für Computerlinguistik Zürich: Institut Computerlinguistik der Universität Zürich. Wortka-‐<br />
tegorien inhttp://kitt.cl.uzh.ch/kitt/clglossar/index.php/Lexikalische_Kategorie (14.08.11)<br />
IngCH: Engineers shape our Future. http://www.ingch.ch/ (24.05.2011)<br />
Jansen, Diethard (2010): Der gemeinsame Nenner. S 75 in Romero-‐Tejedor, Felicidad (2010)<br />
Positionen zur Designwissenschaft. Kassel: University Press.<br />
Keller, Anita et al. (2001): Fadenflip 1 und 2. Luzern: Kantonaler Lehrmittelverlag.<br />
Kemling, Lene (2009): Der Stein von Rosette. http://www.planet-‐<br />
wissen.de/laender_leute/aegypten/hieroglyphen/der_stein_von_rosette.jsp. (25.05.2011)<br />
Kiper, Hana (2007): Handeln und Lernen im Textilunterricht. in Becker, Christian (2007). Perspek-‐<br />
tiven Textiler Bildung. Baltmannsweiler: Schneider.<br />
Klieme, Eckhard et al. (2007): Expertise: Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Bonn:<br />
Bundesministerium für Bildung und Forschung.<br />
Kohlhoff-‐Kahl, Iris (2005): Textildidaktik. Eine Einführung. Donauwörth: Auer.<br />
Kula, Daniel et al. (2009): Materiology. Basel: Birkhäuser.<br />
Kurz Melanie & Zebner Frank (2011): Zum Verhältinis von Design und Technik. S. 174 in Eisele,<br />
Petra und Bürdek, Bernhard (2011). Design. 21. Jahrhundert. Ludwigsburg: avedition.<br />
Lidwell, William et al. (2004): Design, Die 100 Prinzipien für erfolgreiche Gestaltung. München:<br />
Stiebner.<br />
Lindinger, Herbert (o. A.): Industrie Forum Hamburg, Bewertungskriterien. In Haase, Frank et al.<br />
(2002): Designwissen. Entstehung, Umsetzung, Perspektiven. Sternenfels: Verlag Wissen und<br />
Praxis.<br />
MacDonald, Stuard et al. (2006): Design, treibende Kraft für Europa. Barcelona: BEDA, Bureau of<br />
European Design Associations.<br />
Marchsteiner, Uli (1998): ERROR <strong>DESIGN</strong> -‐ Irrtum im Objekt, Ausstellung in Zürich und Krems.<br />
Krems: Kunsthalle, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung.<br />
Mareis, Claudia et al. (2010): entwerfen wissen produzieren. Designforschung im Anwendungs-‐<br />
kontext. Bielefeld: transcript.<br />
83
LITERATURVERZEICHNIS<br />
Mareis, Claudia (2011): Design als Wissenskultur: Interferenzen zwischen Design-‐ und Wissens-‐<br />
diskursen seit 1960. Bielefeld: transcript.<br />
Mätzer Binder, Regine (2005): Argumentarium. In Werkspuren 1/2005. Zug: Werkspuren.<br />
Meinhold, Alexandra et al. (2020): Handbuch der Universitäten und Fachhochschulen 2010.<br />
Deutschland, Österreich, Schweiz. Berlin: Walter de Gruyter.<br />
Meret, Ernst (3/2011): Jetzt lernen die Ingenieure die Sprache der Gestalter. Zeitschrift Hochpar-‐<br />
terre 3/2011. Zürich: Hochparterre.<br />
Ministerium für Erziehung Singapur (2006): Design & Technology Syllabus.<br />
http://www.moe.gov.sg/education/syllabuses/sciences/files/design-‐and-‐technology-‐lower-‐<br />
secondary-‐nt-‐2007.pdf. (22.09.2011)<br />
Moggridge, Bill (2007): Designing interactions. Cambridge: MIT.<br />
Nell, Peter et al. (2002): Formen, Falten, Feilen. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.<br />
Natech: Plattform für die Einbindung von Technik und Naturwissenschaften in die Bildung.<br />
www.natech-‐education.ch. (4.05.2011).<br />
Oelkers, Jürgen und Reusser, Kurt (2008): Bildungsforschung Band 27: Qualität entwickeln -‐<br />
Standards sichern – mit Differenzen umgehen. Berlin: Bundesministerium für Bildung und For-‐<br />
schung (BMBF).<br />
Österreich: Wimmer Michael (2007): Vielfalt und Kooperation. Kulturelle Bildung in Österreich -‐<br />
Strategien für die Zukunft, erreichbar unter:<br />
www.bmukk.gv.at/medienpool/15735/kulturelllebildung.pdf. (01.06.2011).<br />
Österreich Fachhochschulen: Fachrichtung Kunst und Design (einschliesslich Kunsthandwerk)<br />
http://www.htl.at/de/htlat/lehrplaene.html?tx_eduhilehrplandb_pi1%5Bfaculty%5D=11&tx_e<br />
duhilehrplandb_pi1%5Bschooltype%5D=&no_cache=1. (01.06.2011).<br />
Peterhans, Franziska (2011), Zentralsekretärin des LCH: Das Heft in der Hand. In der Zeitschrift<br />
„Bildung Schweiz“ 6 / 2011, Seite 27. Zürich: Bildung Schweiz.<br />
red dot, Design Preise: http://red-‐dot.org/2026.html. (25.06.2011).<br />
Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (crus): http://www.crus.ch/information-‐<br />
programme/studieren-‐in-‐der-‐schweiz/studienangebote.html.(19.05.2011).<br />
Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz KFH: www.kfh.ch. (03-‐09-‐11).<br />
Romero-‐Tejedor, Felicidad und Jonas, Wolfgang (2010): Positionen zur Designwissenschaft. Kas-‐<br />
sel: Kassel University Press.<br />
Schmayl, Winfried (2010): Didaktik allgemeinbildenden Technikunterrichts. Baltmannsweiler:<br />
Verlag Hohengehren.<br />
Schneider, Beat (2009): Design. Eine Einführung. Basel: Birkhäuser.<br />
Schweizerische Gesellschaft für Lehrerinnen-‐ und Lehrerbildung SGL, Arbeitsgruppe (2009): Die<br />
Zukunft gestalterischer Fächer in: Bildung Schweiz, 6/2009.<br />
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK (2009): HarmoS-‐Konkordat.<br />
http://www.edk.ch/dyn/11659.php. (19.05.2011).<br />
84
LITERATURVERZEICHNIS<br />
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK (2010): Projekt Lehrplan 21.<br />
http://web.lehrplan.ch/sites/default/files/Grundlagenbericht.pdf. (19.05.2011) .<br />
Schweizerischer Verein für Werklehrerinnen und Werklehrer. http://www.werkspuren.ch/?id=3.<br />
(2.08.2011).<br />
Sennett, Richard (2009): Handwerk. Berlin: Berlin Verlag.<br />
Speiser Niggli, Verena (2002): Werkfelder 1 und 2. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.<br />
Strittmatter, Anton (2005): Argumentieren, was das Zeug hält? In Gaus-‐Hegner und Mätzler<br />
Binder (Hrsg.)(2005): Technisches und Textiles Gestalten. Fachdiskurs um Kernkompetenzen.<br />
Zürich: Verlag Pestalozzianum.<br />
Technorama, swiss science center. http://www.technorama.ch/(20.09.2011)<br />
The Design and Technology Association GB (2003): An Introduction to Design and Technology<br />
Vocabulary. Warwickshire: DATA.<br />
Tischner, Monika (2011) in Eisele und Bürdek: Design, Anfang des 21. Jahrhunderts. Ludwigs-‐<br />
burg: avedition.<br />
Universität Cambridge (2012): Syllabus. Cambridge 0 Level Design and Technology for examina-‐<br />
tion in November 2012. University of Cambridge.<br />
http://www.gov.mu/portal/sites/mesweb/CIE%20Syllabus%20and%20Support%20Materia%20<br />
(E)/pdf/6043_y12_sy.pdf. (15.09.2011).<br />
USA: ITEEA, International Technology and Engineering Educators Association.<br />
http://www.iteaconnect.org/TAA/Publications/TAA_Publications.html. (22-‐01-‐11).<br />
Übersetzungen durch BEOL<strong>IN</strong>GUS, TU Chemnitz: http://dict.tu-‐chemnitz.de ; Pocket Oxford<br />
German Dictionary: http://www.wordreference.com/de/ und google-‐Übersetzer.<br />
van den Boom, Holger et al. (2003): Design. Zur Praxis des Entwerfens. Hildesheim: Olms.<br />
Walch, Josef et al. (2008): Design. Praxis Kunst. Hamburg: Schroedel.<br />
Wachs, Elena-‐Maria (2010): Vorwärts nach weit – definiert die Designbegriffe! In: Positionen zur<br />
Designwissenschaft von Romero-‐Tejedor, Felicidad und Jonas, Wolfgang. Kassel: University<br />
Press.<br />
Walker, John A. (1992): Designgeschichte. Perspektiven einer wissenschaftlichen Disziplin. Mün-‐<br />
chen: scaneg.<br />
Werkbundarchiv – Museum der Dinge (2007): Kampf der Dinge. Der Deutsche Werkbund zwi-‐<br />
schen Anspruch und Wirklichkeit. Berlin: Werkbundarchiv – Museum der Dinge.<br />
Zürcher Hochschule der Künste (2010): Formfächer. Ludwigsburg: avedition.<br />
85
ANHANG<br />
ANHANG<br />
ANHANG 1: ABBILDUNGSVERZEICHNIS<br />
Abbildung 1: Die drei Gestaltungsfächer ......................................................................................9<br />
Abbildung 2: Begriffe zu Beginn des Lehrplans 21......................................................................11<br />
Abbildung 3: Vorschlag der Arbeitsgruppe .................................................................................13<br />
Abbildung 4: Übersicht über die Vorgehensweise......................................................................15<br />
Abbildung 5: Zwei vergleichbare Mengen ..................................................................................16<br />
Abbildung 6: Stein von Rosetta, Foto Britisches Museum London .............................................21<br />
Abbildung 7: Schnittmenge der zwei Konzentrate......................................................................22<br />
Abbildung 8: Designprozess........................................................................................................23<br />
Abbildung 9: Auswertung Vergleichsraster.................................................................................32<br />
Abbildung 10: Die Übereinstimmung der Nomen.......................................................................32<br />
Abbildung 11: Auswertung Designprozess..................................................................................34<br />
Abbildung 12: Begriffe der Gestaltungsstudiengänge in Deutschland .......................................38<br />
Abbildung 13: Disziplinen im Zusammenhang mit Design ..........................................................45<br />
Abbildung 14: Modell mit verschiedenen Ebenen......................................................................46<br />
Abbildung 15: Fachgebiet Textil der Pädagogischen Hochschule Freiburg (D)...........................47<br />
Abbildung 16: Designprozess und Methoden.............................................................................55<br />
Abbildung 17: Designprozess in Heufler, S. 79............................................................................56<br />
Abbildung 18: Richmond, W. (2011): “The Design Cycle”...........................................................57<br />
Abbildung 19: Drei Fächer und ihre Schnittstellen .....................................................................92<br />
86
ANHANG<br />
ANHANG 2: TABELLENVERZEICHNIS<br />
Tabelle 1: Zusammenstellung der zwei Fächer Technische und Textile Gestaltung .....................9<br />
Tabelle 4: Design aus Konsumentensicht, Heufler S. 21 .............................................................25<br />
Tabelle 5: Vergleichsraster mit den meistgebrauchte Nomen aus „2000 Ziele“ ........................25<br />
Tabelle 6: Vorbemerkung zur Konsumentensicht, Heufler S. 21 ................................................26<br />
Tabelle 7: Mensch/Objekt/Raum-‐Bezüge, Heufler S. 22-‐25 .......................................................27<br />
Tabelle 8: Praktische Funktionen, Heufler S. 26-‐31 ....................................................................27<br />
Tabelle 9: Produktfunktionen und Funktionsebenen im Design, Heufler S.32-‐35......................27<br />
Tabelle 10: Ästhetische Funktionen Heufler, S. 36-‐43 ................................................................27<br />
Tabelle 11: Produktsemantik Heufler, S. 44-‐47 ..........................................................................28<br />
Tabelle 12: Anzeichenfunktion Heufler, S. 48-‐51........................................................................28<br />
Tabelle 13 Symbolfunktionen, Heufler, S. 52-‐57.........................................................................28<br />
Tabelle 14: Produktanalyse, S. 58-‐61..........................................................................................28<br />
Tabelle 15: Vorbemerkungen zum Designprozess, Heufler S. 71 ...............................................29<br />
Tabelle 16: 10 Kriterien für qualitätsvolles Design, (nach: Lindinger) in Heufler S. 71-‐72..........29<br />
Tabelle 17: Produktbestimmende Faktoren, Heufler S. 73, das auf Schürer aufbaut.................30<br />
Tabelle 18: Gestaltungsmodell, Heufler S. 74-‐75, das auf F.G. Winter beruht ...........................30<br />
Tabelle 19: Begriffserläuterungen aus Heufler, S. 209-‐214 ........................................................31<br />
Tabelle 20: Verben in den vier Schritten des Design-‐Prozesses in Heufler S. 79-‐111.................33<br />
Tabelle 21: 23 Verben nach Materiology....................................................................................42<br />
Tabelle 22: Entwicklungen der Gestaltungsmethoden ...............................................................50<br />
Tabelle 23: Lehrplanvergleich von Fries et al. (2007) .................................................................58<br />
Tabelle 24: Argumentarium für das Fach Werken und Gestalten...............................................59<br />
Tabelle 25: Untersuchungsraster................................................................................................60<br />
87
ANHANG<br />
Tabelle 26: Universitäten und Fachhochschulen Schweiz ..........................................................61<br />
Tabelle 27: Fachbezeichungen....................................................................................................62<br />
Tabelle 28: Hochschule der Künste Nordwestschweiz (Teil der fhnw) .......................................62<br />
Tabelle 29: FH Zentralschweiz: Design & Kunst, Hochschule Luzern ..........................................63<br />
Tabelle 30: Textildesign ..............................................................................................................64<br />
Tabelle 31: ZHdK .........................................................................................................................64<br />
Tabelle 32: Kulturelle Bildung Österreich ...................................................................................65<br />
Tabelle 33: Design, treibende Kraft für Europa...........................................................................66<br />
Tabelle 34: Volksschule Technisches und Textiles Werken Österreich.......................................67<br />
Tabelle 35: Gymnasium Österreich, Oberstufe: Textiles Werken...............................................68<br />
Tabelle 36: Begriffe USA .............................................................................................................69<br />
Tabelle 37: Australien NSW: Design and Technology .................................................................71<br />
Tabelle 38: Australien NSW: Textile Technology ........................................................................72<br />
Tabelle 39: Indizien anhand von Begriffen..................................................................................75<br />
Tabelle 40: Anzahl Treffer der Nomen........................................................................................93<br />
Tabelle 41: Auswertung des Vergleichsrasters mit Klassierung..................................................95<br />
Tabelle 42: Vergleichstabelle USA-‐D, Inhaltsverzeichnis ............................................................96<br />
Tabelle 43: Vergleich USA-‐D, Standards .....................................................................................97<br />
Tabelle 44: Untersuchungsraster..............................................................................................100<br />
88
ANHANG<br />
ANHANG 3: BEGRIFFE<br />
Ästhetik<br />
Nach Duden:<br />
„1. Wissenschaft, Lehre vom Schönen<br />
2. das stilvoll Schöne; Schönheit<br />
3. Schönheitssinn“<br />
Design<br />
Nach Duden:<br />
„formgerechte und funktionale Gestaltgebung und daraus sich ergebende Form eines<br />
Gebrauchsgegenstands o. Ä.; Entwurf[szeichnung]. Das Wort stand 1973 erstmals im<br />
Rechtschreibduden.<br />
Synonyme zu Design<br />
• Aufmachung, Dekor, Formgebung, Formgestaltung, Gestaltung; (Jargon) Styling<br />
• Entwurf, Entwurfszeichnung, Form, Muster, Plan“<br />
Ergänzung: Der Begriff Design wird als kreativer Prozess verstanden, in welchem die Tätigkeiten<br />
des „Konzeptionierens, Entwerfens, Konstruierens und Gestaltens“ 182 die Grundlagen bilden.<br />
Gestaltung<br />
Nach Duden:<br />
„1. das Gestalten; das Gestaltetsein;<br />
2. (seltener) etwas Gestaltetes, gestaltete Einheit“<br />
Ergänzung ausserhalb des Dudens:<br />
Im internationalen Kontext wird nach dem Wörterbuch Design „der Begriff Design meist<br />
äquivalent mit Gestaltung verwendet“ 183 .<br />
In den bisherigen Lehrplänen in der Schweiz wird Gestaltung (oder auch Gestalten) im Zusam-‐<br />
menhang mit den Fächern Technische Gestaltung, Textile Gestaltung und die Bildnerische Ge-‐<br />
staltung verwendet, im Projekt Lehrplan 21 wird der Begriff „Gestaltung und Musik“ als Überbe-‐<br />
griff und „Gestalten“ als Begriff im 1. Zyklus (Kindergarten bis dritte Klasse) für die drei (zwei)<br />
Fächer Bildnerische Gestaltung, Technische Gestaltung und Textile Gestaltung eingesetzt.<br />
182 Definition in Anlehnung an Hermann & Möller. Für das Wort Design existiert nach den Herausgebern des Wörter-‐<br />
buchs Design „keine allgemein gültige Definition“. Heufler (2006) verweist auf die Definition des Weltdachverbands<br />
der Designorganisationen ICSID: „Design ist eine kreative Tätigkeit mit dem Ziel, die vielschichtigen Qualitäten von<br />
Objekten, Prozessen, Dienstleistungen und ihren Systemen im gesamten Lebenszyklus zu etablieren. Daher spielt<br />
Design eine zentrale Rolle bei der innovativen Humanisierung von Technologie und ist entscheidende für den kulturel-‐<br />
len sowie wirtschaftlichen Austausch.“<br />
183 Diefenthaler, Annette (2008) in Wörterbuch Design, S. 177.<br />
89
ANHANG<br />
Gestalten<br />
Nach Duden:<br />
Das Wort Gestaltung kommt im Duden als Verb gestalten vor:<br />
„1. Einer Sache eine bestimmte Form, ein bestimmtes Aussehen geben<br />
2. sich in einer bestimmten Art entwickeln; werden“<br />
Handwerk<br />
Nach Duden:<br />
„1a. [selbständige] berufsmässig ausgeübte Tätigkeit, die in einem durch Tradition ge-‐<br />
prägten Ausbildungsgang erlernt wird und die in einer manuellen, mit Handwerkszeug<br />
ausgeführten produzierenden oder reparierenden Arbeit besteht<br />
1b. jemandes Beruf, Tätigkeit; Arbeit [mit der sich jemand ernährt]<br />
2. Berufsstand der Handwerker<br />
Kultur<br />
Synonym: Gewerbe<br />
Arbeit, Beruf, berufliche Tätigkeit, Beschäftigung, Metier; (umgangssprachlich) Job; (ös-‐<br />
terreichisch, sonst veraltet) Profession“<br />
Nach Duden:<br />
„1.a. Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemein-‐<br />
schaft als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung<br />
1.b. Gesamtheit der von einer bestimmten Gemeinschaft auf einem bestimmten Gebiet<br />
während einer bestimmten Epoche geschaffenen, charakteristischen geistigen,<br />
künstlerischen, gestaltenden Leistungen<br />
2.a. Verfeinerung, Kultiviertheit einer menschlichen Betätigung, Äußerung, Hervorbrin-‐<br />
gung<br />
2.b. Kultiviertheit einer Person<br />
3.a. (Landwirtschaft, Gartenbau) das Kultivieren des Bodens<br />
3.b. (Landwirtschaft, Gartenbau) das Kultivieren<br />
4. (Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft) auf größeren Flächen kultivierte junge<br />
Pflanzen<br />
5. (Biologie, Medizin) auf geeigneten Nährböden in besonderen Gefäßen gezüchtete<br />
Gesamtheit von Mikroorganismen oder Gewebszellen“<br />
Kunst<br />
Nach Duden (gesamte Definition):<br />
„1a. schöpferisches Gestalten aus den verschiedensten Materialien oder mit den Mitteln<br />
der Sprache, der Töne in Auseinandersetzung mit Natur und Welt<br />
1b. einzelnes Werk, Gesamtheit der Werke eines Künstlers, einer Epoche o. Ä.; künstleri-‐<br />
sches Schaffen<br />
2. das Können, besonderes Geschick, [erworbene] Fertigkeit auf einem bestimmten Ge-‐<br />
biet<br />
90
ANHANG<br />
Technik<br />
3. in „Kunst sein“<br />
Synonyme zu Kunst:<br />
Gesamtkunstwerk, (künstlerisches) Schaffen, Kunstwerk, Werk; (gehoben) Vermögen“<br />
Nach Duden (gesamte Definition):<br />
„1. Gesamtheit der Massnahmen, Einrichtungen und Verfahren, die dazu dienen, die Er-‐<br />
kenntnisse der Naturwissenschaften für den Menschen praktisch nutzbar zu machen<br />
2. besondere, in bestimmter Weise festgelegte Art, Methode des Vorgehens, der Ausfüh-‐<br />
rung von etwas<br />
3. technische Ausrüstung, Einrichtung für die Produktion<br />
4. technische Beschaffenheit eines Geräts, einer Maschine o. Ä.<br />
5. Stab von Technikern<br />
6. (österreichisch) technische Hochschule<br />
Synonyme zu Technik:<br />
• Erfahrung, Fertigkeit, Geübtheit, Gewandtheit, Know-‐how, Praxis, Routine, Übung,<br />
Vertrautheit<br />
• Arbeitsweise, Art, Berechnung, Diplomatie, Handhabung, Kalkül, Methode, Plan, Po-‐<br />
litik, Praktik, Praxis, Strategie, System, Verfahren, Vorgehen, Vorgehensweise, Weg;<br />
(bildungssprachlich), Raffinesse<br />
• Ausrüstung, Handwerkszeug, Material, Outfit, Rüstzeug, Staffierung, Werkzeug<br />
• Hightech, Technologie“<br />
Weitere Fachbegriffe im Designbereich finden sich im digitalen Designlexikon 184 .<br />
184 http://www.designlexikon.net/Fachbegriffe/IntroAbisZ/fachbegriffed.html.<br />
91
ANHANG<br />
ANHANG 4: DIE GESTALTUNGSFÄCHER<br />
In dieser Arbeit werden zwei der drei dargestellten Fächer untersucht, die Technische und Texti-‐<br />
le Gestaltung.<br />
eigene Elemente von<br />
Technischer Gestaltung<br />
Technische Gestaltung<br />
gemeinsame Elemente:<br />
Technische Gestaltung<br />
und Textile Gestaltung<br />
eigene Elemente von<br />
Textiler Gestaltung<br />
Abbildung 19: Drei Fächer und ihre Schnittstellen<br />
Textile Gestaltung<br />
gemeinsame Elemente:<br />
Technische Gestaltung und<br />
Bildnerische Gestaltung<br />
Bildnerische Gestaltung<br />
eigene Elemente von<br />
Bildnerischer Gestaltung<br />
Gemeinsame Elemente:<br />
Bildnerische Gestaltung und<br />
Textile Gestaltung<br />
gemeinsame Elemente<br />
aller drei Bereiche<br />
92
ANHANG<br />
ANHANG 5: AUSWERTUNG <strong>DER</strong> NOMEN <strong>IN</strong> «BILDUNG <strong>IN</strong> 2000 ZIELEN»<br />
Die Tabelle zeigt die Nomen mit mehr als zehn Nennungen und ihre Anzahl in Klammern. Da die<br />
Treffer von 2000 Ziele 185 teilweise nicht mit den eigenen Recherchen übereinstimmten, wurden<br />
sie neu berechnet. Zusätzlich wurden die Mehr-‐ oder Einzahl der Begriffe dazu genommen und<br />
in einer eckigen Klammer angefügt: Wenn eine zweite Form fehlt, ist das Wort ist in der andern<br />
Form nicht vorhanden oder hat keine Treffer. In der geschweiften Klammer ist das {Total}: Die<br />
Sterne (mit dem Symbol: *) zeigen an, dass ein Abzug bei Begriffen der Tabelle getätigt werden,<br />
damit diese vorgegebenen Begriffe nicht mitgezählt werden (130 für äusserste Kolonne, 60 für<br />
die Kolonne mit Kleinbuchstaben, 14 für die um 90 Grad gedrehten Begriffe). Die Reihenfolge<br />
der Aufzählung ist nach Fries und den publizierten Resultaten in Klammern belassen.<br />
Tabelle 38: Anzahl Treffer der Nomen<br />
Materialien 126 (177) [Mate-‐<br />
rial* 196-‐130*] {192}<br />
Bilder 65 (117) [Bild 28]<br />
{93}<br />
Verfahren* 201-‐130* (78)<br />
{71}<br />
Maschinen 54 (55) [Maschi-‐<br />
ne* 64-‐60*] {58}<br />
Vorstellungen 44 (52) [Vor-‐<br />
stellung* 69-‐60*] {53}<br />
Farben 88 (152) [Farbe 64]<br />
{152}<br />
Produkt 32 (83) [Produkte<br />
41] {73}<br />
Objekte 43 (74) [Objekt 8]<br />
{51}<br />
Werkstoffe* 144-‐60* (141)<br />
[Werkstoff 5] {89}<br />
Gegenstand* 134-‐130* (82)<br />
[Gegenstände 54] {58}<br />
Funktionen 25 (69) [Funktion<br />
44] {69}<br />
Mittel 38 (55) {38} Bedeutung* 60-‐14* (52)<br />
Zusammenhang* 33-‐14 (47)<br />
[Zusammenhänge 28] {47}<br />
[Bedeutungen 5] {51}<br />
Raum 20 (29) [Räume 24 (17)]<br />
{44}<br />
Werkzeuge 81 (124) [Werk-‐<br />
zeug* 77-‐60*] {98}<br />
Wirkung 34 (81) [Wirkun-‐<br />
gen 48] {82}<br />
Techniken* 89-‐60* (59)<br />
[Technik 13] {42}<br />
93<br />
Beziehung 46 (52) [Beziehun-‐<br />
gen 7] {53}<br />
Eigenschaften 45 (45) [Eigen-‐<br />
schaft 0] {45}<br />
Ideen 44 (44) [Idee 0] {44} Körper 37 (44) {37} Werke 41 (41) [Werk 3] {44} Figuren 30 (37) [Figur 7] {37}<br />
Form 37 (37) [Formen 83]<br />
{120}<br />
Beobachtungen 28 [Beobach-‐<br />
tung 7] {35}<br />
Gestaltungselemente 26<br />
[Gestaltungselement 2] {28}<br />
Arbeitsgeräte 21 (30) [Ar-‐<br />
beitsgerät 0] {21}<br />
Gesetzmässigkeiten 29 {29} Modell 14 (29) [Modelle 9]<br />
{23}<br />
Natur 28 {28} Fläche 27 [Flächen 11] {38} Lösungen 27 [Lösung 0] {27}<br />
Gestaltungsprozess 6 (13)<br />
[Gestaltungsprozesse 7] {13}<br />
Bildzeichen 22 (22) {22} Gestaltung 22 (22) [Gestal-‐<br />
tungen 0] {22}<br />
Herstellungsprozesse 12 (13)<br />
[Herstellungsprozess 0] {12}<br />
Herkunft 22 (22) [Herkünfte<br />
0) {22}<br />
Ausdruck 23 (23) {23}<br />
Sinne 9 (22) [Sinn 4] {13}<br />
Gestaltungsmittel 19 (19) {19} Vorstellungskraft 19 (19) {19} Zeichen 34 (19) {34} Accessoires 18 (18) [Acces-‐<br />
soire 0] {18}<br />
Stimmungen 18 (18) [Stim-‐<br />
mung 4] {22}<br />
Rohstoffe* 67-‐60* (17)<br />
[Rohstoff 3] {10}<br />
Werkstoffkombinationen 16<br />
(16) {17}<br />
Zusammenspiel 18 (18){18} Erlebnisse 17 (9) [Erlebnis 8]<br />
Bearbeitungsweisen 16 (16)<br />
[Bearbeitungsweise 0] {16}<br />
Mitteilungen 9 (15) [Mittei-‐<br />
lung 6] {15}<br />
{25}<br />
185 Fries et al. (2007): Bildung in zweitausend Zielen, S. 113-‐118.<br />
Gruppen 26 (17) [Gruppe 0]<br />
{26}<br />
Mode 16 (16) [Moden 0] {16} Proportionen 16 (16) [Pro-‐<br />
Möglichkeiten 15 (15) [Mög-‐<br />
lichkeit 5] {20}<br />
portion 1] {17}<br />
Vorgaben 15 (15) [Vorgabe<br />
0] {15}
ANHANG<br />
Wirklichkeit 16 (15) {16} Zeichnungen 9 (15) [Zeich-‐<br />
nung 5] {14}<br />
Epochen 14 (14) [Epoche 0]<br />
{14}<br />
Merkmale 14 (14)<br />
[Merkmal 0] {14}<br />
Gestaltungsaufgaben 13 (13)<br />
[Gestaltungsaufgabe 1] {14}<br />
Farbkontraste 12 (12) [Farb-‐<br />
kontrast 0] {12}<br />
Vorgänge 12 (12) [Vorgang 0]<br />
{12}<br />
Gefühle 14 (14) [Gefühl 2]<br />
{16}<br />
Umfeld 14 (14)<br />
{14}<br />
Zusammenarbeit 15 {15} Aussage* 74-‐60* (14) [Aus-‐<br />
sagen 6] {20}<br />
Handhabung 14 (14) [Hand-‐<br />
habungen 0] {14}<br />
Aktionen 13 (13) [Aktion 1]<br />
{14}<br />
Medien 14 (14) [Medium 1]<br />
{15}<br />
Einfluss 13 (13) [Einflüsse 3]<br />
Spiele 13 (13) [Spiel 2] {15} Vorhaben 13 (13) {13} Werken 13 (13) {13}<br />
Kleidung 12 [Kleid 0] {12} Technik 13 (12) [Techni-‐<br />
ken* 89-‐60] {42}<br />
Alltag 6 (12) {6} Arbeitsplatz 11 (11) [Arbeits-‐<br />
plätze 0] {11}<br />
{16}<br />
Unfallgefahren 12 (12) [Un-‐<br />
fallgefahr 0] {12}<br />
94<br />
Bearbeitung 13 (11) [Bearbei-‐<br />
tungen] {13}<br />
Bildsprache 11 (11) {11} Design 11 (11) {11} Gebilde 11 (11) {11} Gestaltungsübungen 11 (11)<br />
Kenntnisse 11 (11) [Kenntnis<br />
0] {11}<br />
Prozess 11 (11) [Prozesse 2]<br />
{13}<br />
Unfallverhütung 11 (10) {11} Unterschiede (12) 11 [Unter-‐<br />
Arbeitsschritte 9 (10) [Ar-‐<br />
beitsschritt 0] {9}<br />
schied 2] {14}<br />
Entwicklung 10 (10) [Entwick-‐<br />
lungen 2] {12}<br />
Grundkenntnisse 10 (10) {10} Kulturen 10 (10) [Kultur 1]<br />
{11}<br />
Schnittmuster 10 (10) {10} Textur 10 (10) [Texturen 2]<br />
{12}<br />
{11}<br />
Skizzen 11 (10) [Skizze 2] {13} Szenen 11 (11) [Szene 3] {14}<br />
Verarbeitung 11 (11) {11} Wert 11 (11) [Werte 2] {13}<br />
Experimente 10 (10) [Experi-‐<br />
ment* 61-‐60*] {11}<br />
Farbmuster 9 (10) {9}<br />
Nähmaschine 10 (10) {10} Prinzipien 10 (11) {10}<br />
Umwelt 10 (10) {10} Zeitaufwand 10 (10) {10}
ANHANG<br />
ANHANG 6: AUSWERTUNG <strong>DER</strong> NOMEN AUS <strong>DER</strong> VERGLEICHSMENGE<br />
Die folgende Tabelle liefert eine Zusammenfassung des Designbuchs 186 .<br />
Tabelle 39: Auswertung des Vergleichsrasters mit Klassierung<br />
Kapitel in Heufler Seiten Anzahl = ≈ ≠<br />
zur Konsumentensicht 21 21 15 6 0<br />
Mensch/Objekt/Raum-‐Bezüge 22-‐25 11 8 3 0<br />
Praktische Funktionen 26-‐31 16 6 10 0<br />
Produktfunktionen und Funkti-‐<br />
onsebenen im Design<br />
32-‐35 8 4 4 0<br />
Ästhetische Funktionen 36-‐43 10 8 2 0<br />
Produktsemantik 44-‐47 8 0 2 6<br />
Anzeichenfunktion 48-‐51 11 3 4 4<br />
Symbolfunktionen 52-‐57 11 7 1 3<br />
Produktanalyse 58-‐61 9 0 5 4<br />
Vorbemerkungen zum Design-‐<br />
prozess<br />
10 Kriterien für qualitätsvolles<br />
Design<br />
71 14 5 2 7<br />
71-‐72 87 39 26 22<br />
Produktbestimmende Faktoren 73 12 2 4 6<br />
Gestaltungsmodell 74-‐75 15 9 6 0<br />
Begriffserläuterungen 209-‐214 60 25 30 5<br />
Total 293 131 105 57<br />
Legende<br />
= gleich oder synonym (dunkle Felder)<br />
≈ im weiteren Sinn vergleichbar (mittlere Felder)<br />
≠ nicht gleich, eigenständig (helle Felder)<br />
186 Heufler, Gerhard (2006): Design Basics, Von der Idee zum Produkt.<br />
95
ANHANG<br />
ANHANG 7: STANDARDS USA UND DEUTSCHLAND<br />
Tabelle 40: Vergleichstabelle USA-‐D 187 , Inhaltsverzeichnis<br />
Standards for Technological Literacy (USA) Standards für eine allgemeine technische Bildung<br />
(Die Übersicht im Original) (Die deutsche Übersetzung)<br />
1 Preparing Students for a Technological World 1 Vorbereitung von Schülern auf eine technische<br />
2 Overview of Standards for Technological Litera-‐<br />
cy<br />
(D)<br />
Welt<br />
2 Überblick über die Standards für eine allgemei-‐<br />
ne Technische Bildung<br />
3 The Nature of Technology 3 Charakteristische Eigenschafen technischer<br />
Produkte und Prozesse<br />
4 Technology and Society 4 Wechselbeziehungen zwischen Technik und<br />
Gesellschaft<br />
5 Design 5 Entwurf und Konstruktion technischer Produkte<br />
6 Abilities for a Technological World 6 Notwendige Fähigkeiten für das Leben in einer<br />
technischen Welt<br />
7 The Designed World 7 Die technische Welt<br />
8 Call to Action 8 Aufruf zum Handeln<br />
Beobachtungen: Der Begriff „Design“ wird unter Kapitel 5 übersetzt in „Entwurf und Konstrukti-‐<br />
on“. [Gestaltung oder Design wären mögliche Übersetzungen.]<br />
„The Designed World“ unter Kapitel 7 wird übersetzt in „Die technische Welt“. [Die gestaltete<br />
Welt wäre präziser.]<br />
187 Dugger, William E. (2000): Standards for Technological Literacy: Content for the Study of<br />
Technology. Virginia: ITEA (International Technology Education Association (Technology for All<br />
Americans Projekt). www. iteaconnekt.org. Die deutsche Übersetzung von Höpken, Gerd<br />
(2003): Standards für eine allgemeine technische Bildung. Villingen-‐Schwenningen: Neckar-‐<br />
Verlag.<br />
96
ANHANG<br />
Tabelle 41: Vergleich USA-‐D, Standards<br />
Standards for Technological Literacy (USA) Standards für eine allgemeine technische Bildung<br />
Chapters 3: Students will develop an understand-‐<br />
ing of The Nature of Technology. This includes<br />
acquiring knowledge of:<br />
(D)<br />
Kapitel 3: Die Schüler sollen ein Verständnis für<br />
das Wesen der Technik entwickeln. Das schliesst<br />
das Wissen über die (folgenden) Inhalte ein.<br />
1. The characteritecs and scope of technology. 1. Das Wesen und die Reichweite von Technik<br />
2. The concepts of technology. 2. Die Grundbegriffe der Technik<br />
3. The relationships among technologies and<br />
the connections between technology and<br />
other fields.<br />
Chapters 4: Students will develop an understand-‐<br />
ing of Technology and Society. This includes learn-‐<br />
ing about:<br />
4. The cultural, sozial, economic, an political<br />
effect of technology.<br />
5. The effects of technology on the environ-‐<br />
ment.<br />
6. The role of society in the development an use<br />
of technology.<br />
3. Die Wechselbeziehungen zwischen unter-‐<br />
schiedlichen Technologien und Verbindungen<br />
zwischen Technik und anderen Lernbereichen<br />
Kapitel 4: Die Schüler sollen ein Verständnis für<br />
die Zusammenhänge von Technik und Gesellschaft<br />
entwickeln. Das schliesst die (folgenden) Inhalte<br />
ein.<br />
4. Kulturelle, soziale, ökonomische und politi-‐<br />
sche Auswirkungen von Technik<br />
5. Die Auswirkungen von Technik auf die Um-‐<br />
welt<br />
6. Die Rolle der Gesellschaft bei der Entwicklung<br />
und Nutzung von Technik<br />
7. The influence of technology on history. 7. Die Auswirkungen von Technik auf die Ge-‐<br />
Chapters 5: Students will develop an understand-‐<br />
ing of Design. This include knowing about:<br />
schichte<br />
Kapitel 5: Die Schüler sollen ein Verständnis für<br />
Entwurf und Konstruktion entwickeln. Das<br />
schliesst die (folgenden) Inhalte ein.<br />
8. The attributes of design. 8. Die Besonderheiten des Konstruktionsprozes-‐<br />
9. Engineering design. 9. Technische Konstruktionen<br />
10. The role of troubleshooting, research and<br />
development, invention and innovation, and<br />
experimentation in problem solving.<br />
Chapters 6: Students will develop Abilities for a<br />
Technological World. This includes becoming able<br />
to:<br />
ses<br />
10. Die Bedeutung von Fehlersuche, von For-‐<br />
schung und Entwicklung, Erfindung und inno-‐<br />
vation und von Experimenten bei der Lösung<br />
von Problemen<br />
Kapitel 6: Schüler sollen Fähigkeiten zur Vererei-‐<br />
tung auf eine technische Welt erwerben. Das<br />
schliesst die (folgenden) Inhalte ein.<br />
11. Apply the design process. 11. Den Konstruktionsprozess anwenden<br />
97
ANHANG<br />
12. Use an maintain technological products. 12. Technische Produkte und Systeme nutzen<br />
und warten<br />
13. Assess the impact of products and systems. 13. Die Auswirkungen der Technik bewerten<br />
Chapters 7: Students will develop and understan-‐<br />
dign of The Designed World. This inculdes selcting<br />
and using:<br />
Kapitel 7: Schüler sollen ein Verständnis für die<br />
technische Welt entwickeln. Das schliesst (folgen-‐<br />
de) Inhalte ein.<br />
14. Medical technologies. 14. Medizintechnik<br />
15. Agricultural and related biotechnologies. 15. Agrar-‐ und Biotechnologie<br />
16. Energy and power technologies. 16. Energietechnik<br />
17. Information and communication technolo-‐<br />
gies.<br />
17. Informations-‐ und Kommunikationstechnik<br />
18. Transportation technologies. 18. Transport-‐ und Verkehrstechnik<br />
19. Manufacturing technologies. 19. Produktionstechnik<br />
20. Construction technologies. 20. Bautechnik<br />
Zitat der Seite 15 Zitat der Seiten 20/21<br />
Beobachtungen: Der Begriff „Design process“ wird übersetzt in „Konstruktionsprozess“. [Gestal-‐<br />
tungsprozess, Designprozess oder Produktionsprozess wären mögliche Übersetzungen.]<br />
„The Designed World“ wird übersetzt in „Die technische Welt“. [Es wäre auch möglich von der<br />
„gestalteten Welt“ zu sprechen.]<br />
98
ANHANG<br />
ANHANG 8: BEISPIELE VON <strong>DESIGN</strong>PROZESSEN<br />
designwissen.net; Der Designprozess; (zwei versch.<br />
Modelle: 5stufig und 10stufig<br />
http://www.designwissen.net/seiten/der-‐<br />
designprozess-‐als-‐stufenmodell<br />
Erdmann Design AG<br />
http://www.erdmann.ch/fileadmin/media/pdf/servi<br />
cedesign.pdf<br />
Heufler, Gerhard (2006):<br />
http://www.zeno.org/Shop/F/0325-‐12830251-‐isbn-‐<br />
3721205316-‐heufler-‐gerhard-‐design-‐basics-‐english.htm<br />
Design Process, 13 Schritte (England)<br />
http://www.techitoutuk.com/knowledge/designpro<br />
cess.html<br />
Massachusetts Departement of Elementary & Sec-‐<br />
ondary Eduction<br />
http://www.doe.mass.edu/frameworks/scitech/200<br />
1/standards/strand4.html<br />
University of Hertfordshire<br />
http://www.ider.herts.ac.uk/school/courseware/des<br />
ign/overview/overview.html<br />
MIT, Massachusetts Institute of technology<br />
http://ocw.mit.edu/courses/civil-‐and-‐<br />
environmental-‐engineering/1-‐012-‐introduction-‐to-‐<br />
civil-‐engineering-‐design-‐spring-‐<br />
2002/projects/design_process/<br />
The Engineering Design Process in: Museum of<br />
Science Boston<br />
http://www.mos.org/eie/engineering_design.php<br />
e-‐teaching kunst, Elmecker Christoph: Design als<br />
Prozess<br />
http://www.e-‐teaching-‐<br />
austri-‐<br />
a.at/02_cont/03content/03_be/be_pp/05/design_p<br />
rozess/design_prozess(M).pdf<br />
Teacher Webspace, Halifax Regional Scholl Board<br />
http://hrsbstaff.ednet.ns.ca/mblen/images/design_<br />
process.jpg<br />
(Die links wurden am 25.09.2011 überprüft.)<br />
Analyse des Bedarfs; Informationen sammeln zu Umfeld und Pro-‐<br />
dukt; Voraussetzungen und Bedingungen zusammenführen; Erste<br />
Lösungsansätze, Hypothesen; Alternativen werden entworfen; Kritik<br />
der Alternativen: Optimierung; Reinzeichnungen, Modellbau;<br />
Prototyp; Produkt-‐ und Herstellungsinformationen; Präsentation<br />
Bedarfsanalyse; Problemanalyse; Benchmarking; Projektdefinition<br />
(Ziel: Problemerkennung); Benutzeranalyse; Skizzen, Modelle,<br />
Muster (Ziel: Lösungsvarianten; Herstellung; Produktdokumentation<br />
Idee, Recherchieren, Analysieren (Ziel: Problemerkennung); Konzi-‐<br />
pieren (Ziel: Lösungsvarianten); Entwerfen, Ausarbeiten (Ziel:<br />
Problemlösung); Optimieren (Ziel: Realisierung); Serienreife<br />
Identify a Need; Design Brief; Task Schedule; Analysis of Brief;<br />
Research; Specification; Generate Ideas; Choose Solution; Develop<br />
Solution; Make Solution; Test Solution; Midfy Solution; Evaluation<br />
Identify the Need or Problem; Research the Need or Problem;<br />
Develop Possible Solution(s); Select the Best Possible Solution(s);<br />
Construct a Prototype; Test and Evaluate the Solution(s); Communi-‐<br />
cate the Solution(s); Redesign (Kreislauf)<br />
Design Brief; Product Design Specification; Concept Design; Detail<br />
Design; Manufacturing and Testing; Sales<br />
General Design Process; Understand Problem; Conceptual Design;<br />
Embodiment Design; Detail Design; Prototype and Testing; Com-‐<br />
pletion (Implementation)<br />
Ask; Imagine; Plan; Create; Improve<br />
Research, Analyse des Ist-‐Zustands; Briefing, Pflichtenheft; Konzep-‐<br />
tion; Präsentation -‐ Auswahl nach Kriterien; Entwurfsausarbeitung;<br />
Präsentation -‐ Entscheidung zur Realisierung; Realisierung<br />
Identify the problem; The Design Brief; Investigation & Research;<br />
Identify Possible Solutions; Chosse Best Solution; Develop Solu-‐<br />
tion; Implement Solution; Test Solution; Evaluate Report Findings;<br />
(Kreislauf)<br />
99
ANHANG<br />
ANHANG 9: UNTERSUCHUNGSRASTER TRIANGULATION<br />
Das Werkzeug ist in den drei Teilen alphabetisch geordnet. Einzelne Begriffe sind inhaltlich prak-‐<br />
tisch identisch, werden aber separat erhoben, beispielsweise Design und Gestaltung. Dies ist in<br />
Teil 1 wichtig, weil es die verwendeten Begriffe dieser Auswahl untersucht werden.<br />
Andere sind inhaltlich nahe, werden aber im selben Feld erhoben. Dies zeigt sich im Wort Reali-‐<br />
sierung: Ausführung, Herstellung, Konstruktion, Produktion, Umsetzung.<br />
In Teil 2 geht es um die einzelnen Bausteine des Designprozesses. Und im Teil 3 wird untersucht,<br />
welche der verschiedenen Bausteine den Bereich Emotion oder Gefühl abbilden.<br />
Tabelle 42: Untersuchungsraster<br />
Ästhetik, Ästhetische<br />
Bildung<br />
Design, design Fashion Mode<br />
Gestaltung, Architektur Gestalten Handwerk, Handarbeit Kultur; Kulturwissen-‐<br />
schaften<br />
Kunst, Künste, Art, Arts Technik, technology Textil, Textildesign Werken<br />
Teil 1 ist mit der Frage nach der Fachbezeichnung angelegt<br />
Artefakt Entwurf Form Funktion<br />
Gegenstand Ideen, Idee Kommunikation Konzept, Planung, Plan<br />
Kreativität Material Objekt Produkt<br />
Projekt Prozess Qualität Realisierung, Ausfüh-‐<br />
Recherche, Analyse Reflexion Techniken, Technolo-‐<br />
Teil 2 hat den Prozess im Fokus<br />
gien<br />
100<br />
rung, Herstellung, Kon-‐<br />
struktion, Produktion,<br />
Umsetzung<br />
Verfahren<br />
Bedeutung Beziehung Eigenschaften Emotion, Emotionen<br />
Ethik, Ethos Gefühl, Fantasie, Intui-‐<br />
tion, Wagnis<br />
Teil 3 sucht nach Begriffen im Bereich Emotionen<br />
Wirkung