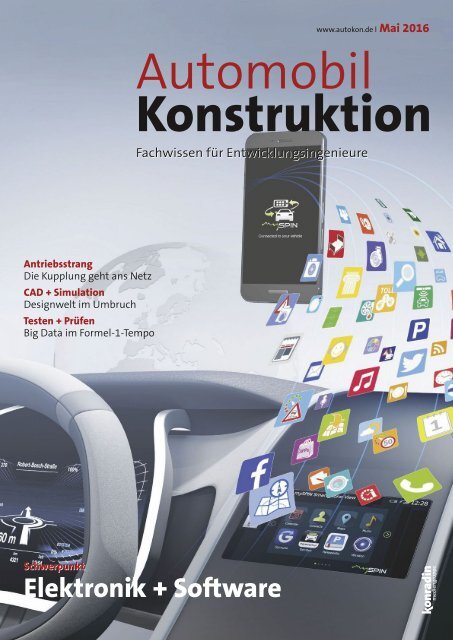Automobilkonstruktion 02.2016
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
www.autokon.de l Mai 2016<br />
Automobil<br />
Konstruktion<br />
Fachwissen für Entwicklungsingenieure<br />
Antriebsstrang<br />
Die Kupplung geht ans Netz<br />
CAD + Simulation<br />
Designwelt im Umbruch<br />
Testen + Prüfen<br />
Big Data im Formel-1-Tempo<br />
Schwerpunkt<br />
Elektronik + Software<br />
2/2016 1 AutomobilKonstruktion
Boost your efficiency<br />
• Aerodynamiksysteme • Motorkapselung • Unterbodensysteme<br />
• Fluidsysteme • Ansaugsysteme • Alternative Antriebstechnik<br />
www.roechling.com<br />
2 AutomobilKonstruktion 2/2016
EDITORIAL<br />
Der falsche Anreiz<br />
Was soll das? Was hat sich die Bundesregierung eigentlich<br />
dabei gedacht, eine Kaufprämie für Elektrofahrzeuge auszuloben?<br />
Natürlich, sie will die bislang äußerst schleppende<br />
Nachfrage nach Autos mit Hybrid- und E-Antrieb ankurbeln.<br />
Denn das selbst gesetzte Ziel, bis 2020 eine Million<br />
Elektroautos auf Deutschlands Straßen fahren zu sehen,<br />
scheint angesichts der derzeit rund 25 000 zugelassenen<br />
E-Mobile kaum noch zu erreichen zu sein.<br />
Der Anreiz einer Kaufprämie ist jedoch ein so altbackenes<br />
Mittel, dass ich an dessen Wirkung ernsthaft zweifle. Beim<br />
Aale-Dieter auf dem Hamburger Fischmarkt mag das noch<br />
funktionieren. Aber werden 4000 Euro Bonus tatsächlich<br />
dazu führen, dass der Autokäufer in Zukunft eher das<br />
E-Mobil als den Benziner oder Diesel wählt?<br />
Die Gründe, warum die Elektromobilität in Deutschland<br />
lahmt, liegen anderswo. Nehmen wir beispielsweise die<br />
Ladeinfrastruktur. Verkehrsminister Alexander Dobrindt<br />
will nun 300 Mio. Euro bereitstellen, um 15 000 neue<br />
Stromtankstellen zu errichten. Warum erst jetzt? Und wo<br />
verstecken sich eigentlich die Energieversorger, in deren<br />
Taschen der Gewinn ja schließlich wandern wird?<br />
Und wie ist es um die Reichweite der batteriebetriebenen<br />
Fahrzeuge bestellt? Immerhin eines der entscheidenden<br />
Kriterien beim Autokauf. Deutsche Hersteller hinken da<br />
dem amerikanischen Vor reiter Tesla im wahrsten Sinn des<br />
Wortes meilenweit hinterher. Und dafür sollen sie jetzt<br />
auch noch gepampert werden? Nicht zu fassen.<br />
Das Argument, mit der Kaufprämie etwas für das Umweltbewusstsein<br />
der Autofahrer zu tun, ist ebenfalls fadenscheinig.<br />
Was nämlich bei der Öko-Diskussion immer gern<br />
vergessen wird, ist die Gesamtenergiebilanz eines Autos.<br />
Leichtbaumaterialien wie Aluminium schlagen bei der<br />
Herstellung mit einem viel höheren Energie verbrauch zu<br />
Buche als der klassische Stahl. Und der Strom aus der<br />
Steckdose ist auch nicht CO 2 -neutral, selbst dann nicht,<br />
wenn es sich um Solarstrom handelt. Man bedenke nur,<br />
wie energieintensiv die Herstellung von Siliziumwafern ist.<br />
EINE KLASSE<br />
FÜR SICH<br />
optoNCDT 1320/1420<br />
Laser-Triangulationssensoren für<br />
schnelle und präzise Messungen<br />
Kompakt und leicht: einfache<br />
Integration in beengte Bauräume<br />
Robustes und langlebiges Design<br />
Reproduzierbarkeit ab 0,5 μm<br />
Kleiner Lichtfleck<br />
Analog- und Digitalausgang<br />
Einzigartiges Bedienkonzept über Webbrowser<br />
Presets für verschiedene Oberflächen<br />
Deshalb nochmal die Frage: Was soll das?<br />
Jens Peter Knauer,<br />
Chefredakteur<br />
Tel. +49 8542 1680<br />
www.micro-epsilon.de/opto<br />
2/2016 3 AutomobilKonstruktion
Antriebsstrang<br />
Die Kupplung geht ans Netz<br />
CAD + Simulation<br />
Designwelt im Umbruch<br />
Testen + Prüfen<br />
Big Data im Formel-1-Tempo<br />
www.autokon.de l Mai 2016<br />
2/2016 1 AutomobilKonstruktion<br />
INHALT<br />
16<br />
ELEKTRONIK +<br />
SOFTWARE<br />
38<br />
ANTRIEB +<br />
ANTRIEBSSTRANG<br />
30<br />
CAD + SIMULATION<br />
46<br />
FORSCHUNG<br />
ELEKTRONIK + SOFTWARE<br />
16 Wie man die Fahrzeugelektronik für<br />
Fahrerassistenzsysteme fit macht<br />
18 Crimp- und Beschichtungstechnologie optimiert<br />
Verbindung von Aluminiumleitungen<br />
20 Bosch positioniert Vernetzungsplattform My Spin<br />
als Alternative zu Google und Apple<br />
22 Smart Antenna eröffnet neue Optionen für die<br />
Architektur von Infotainmentsystemen<br />
24 Michael Bischoff von Preh zum Thema<br />
Elektromobilität<br />
26 Etas bringt neue Ascet-Version in Eclipse<br />
auf den Markt<br />
28 Produkte<br />
CAD + SIMULATION<br />
30 Designwelt im Umbruch: Trotz digitaler<br />
3D-Visualisierung sind Claymodelle unerlässlich<br />
32 Produkte<br />
ANTRIEB + ANTRIEBSSTRANG<br />
34 Dr.-Ing. Oliver Maiwald, Continental, zum Thema<br />
48-Volt-Hybride<br />
36 Mediendichtes Housing mit Duroplast<br />
38 Elektrifizierte Kupplungen machen Handschaltgetriebe<br />
fit für kraftstoffsparende Fahrstrategien<br />
40 ND-AGR-Filter für Sechszylinder-Dieselmotor als<br />
Kooperationsprodukt von GKD und ElringKlinger<br />
41 Clevere Kombinationen helfen bei Problemen mit<br />
Downsizing-Motoren<br />
42 Produkte<br />
Automobil<br />
Konstruktion<br />
Fachwissen für Entwicklungsingenieure<br />
Schwerpunkt<br />
Elektronik + Software<br />
Titelbild:<br />
mySpin ist eine flexible Lösung<br />
zur Smartphone-Integration<br />
und kann Fahrzeug-daten für<br />
Apps bereitstellen<br />
Bild: Bosch<br />
AUS DER FORSCHUNG<br />
46 Alte Ideen aktuell interpretiert –<br />
oder völlig neue Konzepte<br />
FAHRWERK<br />
48 4-Punkt-Lager für Lenksäulen ermöglicht<br />
Durchmessertoleranzausgleich<br />
50 Produkte<br />
4 AutomobilKonstruktion<br />
2/2016
Dichtungen.<br />
Stanzteile.<br />
Isolierteile.<br />
Individuelle und<br />
wirtschaftliche<br />
Lösungen<br />
48<br />
FAHRWERK<br />
58<br />
TESTEN + PRÜFEN<br />
• Jede Form, jedes Material,<br />
jede Größe<br />
• Vielseitige Technologien<br />
im Bereich des Stanzens<br />
und des Wasserstrahlund<br />
Laserschneidens<br />
KAROSSERIE + INTERIEUR<br />
52 Thermoplastische Composites –<br />
vom Krallenprofil bis zum Organoblech<br />
54 Produkte<br />
TESTEN + PRÜFEN<br />
57 AVL List stärkt Präsenz in Deutschland mit neuem<br />
Technologiezentrum in Bietigheim-Bissingen<br />
60 SKF frisiert sein Windkraftanlagen-Prüfsystem für<br />
Datenverarbeitung bei der Scuderia Ferrari<br />
62 Wenn sich perfekt generierter Code mit anderem<br />
perfekt generierten Code überschneidet<br />
64 Scanning-Vibrometer rüsten auf<br />
RUBRIKEN<br />
3 Editorial<br />
6 Aus der Branche<br />
10 Neues auf autokon.de<br />
12 VDI Wissensforum: Fachmesse ConCarExpo<br />
66 „Wir berichten über“ und Impressum<br />
• Hohe Flexibilität durch<br />
eigenen Werkzeugbau<br />
• Lösung komplexer<br />
kundenspezifischer<br />
Aufgabenstellungen<br />
Antenne<br />
Heckleuchte<br />
Parkhilfe<br />
Türschloss<br />
Sitzsysteme<br />
Entlüftung<br />
Anwendungsbeispiele am Auto<br />
Schlösser –<br />
Ihr zuverlässiger<br />
Partner für die<br />
Automotive-Branche.<br />
www.schloesserdichtungen.de<br />
Dachsysteme<br />
Display<br />
Einspritzpumpe<br />
Standheizung<br />
aktive<br />
Motorhaube<br />
Kühler<br />
Schlösser GmbH & Co. KG<br />
Wilhelmstraße 8 | 88512 Mengen<br />
Tel. +49 7572 606-0 | Fax 606-5598<br />
info@schloess.de<br />
2/2016 5 AutomobilKonstruktion
AUS DER BRANCHE<br />
Lösung für urbane Mobilität<br />
Schaeffler stellt zukunftsweisenden Bio-Hybrid vor<br />
Mit dem Bio-Hybrid stellt der Automobil- und<br />
Industriezulieferer Schaeffler ein innovatives<br />
Mikromobilitätskonzept vor. Die Studie zeigt,<br />
wie sich das Unternehmen eine Lösung für<br />
urbane Mobilität vorstellen kann. „Die reine<br />
Elektromobilität im Pkw-Bereich wird nicht<br />
ausreichen, um nachhaltige, energieeffiziente<br />
Mobilität für morgen zu garantieren“, erklärt<br />
Prof. Peter Gutzmer, stellvertretender Vorsitzender<br />
des Vorstandes und Vorstand Technologie<br />
bei der Schaeffler AG. „Der Bio-Hybrid<br />
ist nah am Fahrrad positioniert, jedoch ohne<br />
Nachteile in puncto Wetterschutz und Stauraum.<br />
Dank des Pedelec-Antriebs mit einer<br />
Der Bio-Hybrid vereint die Vorteile Stabilität und<br />
Wetterschutz mit dem Energieverbrauch und der<br />
Raumausnutzung eines Pedelecs Bild: Schaeffler<br />
Begrenzung auf 25 km/h darf er ohne Führerschein<br />
betrieben werden.“ Durch den elektrisch<br />
unterstützten Antrieb ist der Fahrer<br />
sportlich und zugleich komfortabel unterwegs.<br />
Für eine erhöhte Sicherheit und Fahrstabilität<br />
sorgt die neue Fahrzeugplattform<br />
mit zwei Vorder- und Hinterrädern. Aufgrund<br />
der kompakten Abmessungen (2,1 m lang,<br />
1,5 m hoch, 85 cm breit) und einer Spurweite<br />
von 80 cm lässt sich der Bio-Hybrid auch bequem<br />
auf Fahrradwegen bewegen. Der elektrische<br />
Rückwärtsgang ermöglicht zudem ein<br />
müheloses Manövrieren. Verbunden mit einem<br />
portablen Batteriesystem, einem variablen<br />
Gepäckfach und einer Automatikschaltung<br />
lässt sich der 1+1-Sitzer (zwei Sitzplätze)<br />
bereits heute in die bestehende Infrastruktur<br />
sowie in den Alltag integrieren.<br />
www.schaeffler.com<br />
Weitere Investition in das Technologiezentrum im chinesischen Anting<br />
ZF TRW nimmt neue Crashtest-Schlittenanlage in Betrieb<br />
ZF TRW, die Division Aktive & Passive<br />
Sicherheitstechnik der ZF<br />
Friedrichshafen AG, hat eine neue<br />
Crashtest-Schlittenanlage in ihrem<br />
Technologiezentrum in Anting<br />
eingeweiht. Die moderne Forschungs-<br />
und Entwicklungseinrichtung<br />
verfügt nun über das<br />
neueste Modell des Servo Sled<br />
und ist damit die vierte Crashtest-<br />
Anlage des Unternehmens.<br />
Das größte Technologiezentrum<br />
von ZF TRW mit einer Fläche von<br />
66 000 m 2 und mehr als 1200 Mitarbeitern<br />
in der Entwicklung, Forschung<br />
und Technik wurde im Juni<br />
2014 offiziell eröffnet. Es wurde<br />
mit dem Ziel konzipiert und gebaut,<br />
mehr als 20 technische<br />
Prüflabore für alle Hauptgeschäftsfelder<br />
von ZF TRW unter<br />
einem Dach zu vereinen, darunter<br />
Fahrerassistenzsysteme, Bremsen,<br />
Lenkung, Insassenschutz<br />
und Elektronik. So will das Unternehmen<br />
Fahrzeughersteller dabei<br />
unterstützen, fortschrittliche<br />
Sicherheitssysteme in China und<br />
der Region Asien-Pazifik auf den<br />
Markt zu bringen.<br />
„Unser Prüf- und Validierungsprogramm<br />
für Insassenschutzsysteme<br />
ist ein unverzichtbarer Teil der<br />
Forschung und Entwicklung und<br />
der gesamten Unternehmensstrategie“,<br />
betont Norbert Kagerer,<br />
Global Vice President für Occupant<br />
Safety Systems Engineering.<br />
„Eine Schlittenanlage direkt<br />
vor Ort in Anting ist ein wichtiger<br />
unterstützender Faktor für unser<br />
künftiges Wachstum in China. Wir<br />
können nun noch enger mit lokalen<br />
und internationalen Fahrzeugherstellern<br />
zusammenarbeiten<br />
und Tests durchführen, die speziell<br />
auf den chinesischen Markt<br />
zugeschnitten sind.“<br />
Die Anlage ermöglicht fortschrittliche<br />
Frontalaufpralltests mit statischen<br />
Gier- und Nickeinstellungen<br />
für realistische 3D-Crash-Simulationen,<br />
welche über die US<br />
NCAP-Anforderungen OMDB (Oblique<br />
Moving Deformable Barrier)<br />
bei 90 km/h noch hinausgehen.<br />
Bei Seitenaufpralltests können<br />
Lastfälle abgebildet werden, die<br />
mit den Bestimmungen von IIHS,<br />
US NCAP, Euro NCAP, C NCAP und<br />
der UN R95 übereinstimmen. Aufprallszenarien<br />
für Vordersitze und<br />
Rücksitze können einzeln oder in<br />
Kombination dargestellt werden.<br />
Der Schlitten ist groß genug, um<br />
auch Lastfälle für die Auswirkungen<br />
eines Aufpralls auf der stoßabgewandten<br />
Seite und die Interaktion<br />
zwischen Fahrer und Beifahrer<br />
in solch einem Szenario zu<br />
simulieren. Voraussichtlich mehr<br />
als 1000 Tests pro Jahr sind möglich.<br />
www.zf.com<br />
Die neue Crashtest-Schlittenanlage im<br />
Technologiezentrum in Anting, China<br />
Bild: ZF<br />
6 AutomobilKonstruktion 2/2016
preh.com<br />
In der neuen Mercedes-Benz E-Klasse<br />
können erstmals alle Funktionen von<br />
Kombiinstrument und Infotainmentsystem<br />
gewählt werden, ohne die Hände<br />
vom Lenkrad zu nehmen. Die hochpräzisen<br />
Touch Control Buttons dafür<br />
hat Preh entwickelt.<br />
2/2016 7 AutomobilKonstruktion
AUS DER BRANCHE<br />
Elektronik- und Software-Entwicklung für die Automobilbranche<br />
Bertrandt eröffnet zweite Betriebsstätte in Regensburg<br />
Seit 1. März ist Bertrandt mit einer<br />
zweiten Betriebsstätte in Regensburg<br />
präsent. Neben den Räumlichkeiten<br />
im nahegelegenen<br />
Neutraubling hat der Entwicklungsspezialist<br />
im Innovationszentrum<br />
TechBase rund 400 m²<br />
Büro- und 100 m² Labor- und<br />
Werkstattflächen angemietet.<br />
Damit integriert sich Bertrandt<br />
in ein Netzwerk aus technologieorientierten<br />
Unternehmen und<br />
Forschungseinrichtungen.<br />
„In unseren neuen Räumlichkeiten<br />
der TechBase Regensburg<br />
liegt der Leistungsschwerpunkt<br />
In den neuen Räumlichkeiten werden<br />
Fahrerassistenzsysteme weiterentwickelt<br />
sowie deren Einsatzgebiete<br />
ausgeweitet Bild: Bertrandt<br />
auf Software- und Elektronik -<br />
entwicklung – mit einer klaren<br />
Spezialisierung auf die auto -<br />
mobilen Trendthemen Elektro -<br />
mobilität, Fahrerassistenz -<br />
systeme sowie Safety und<br />
Security“, erklärt Ralf Schoenen,<br />
Leiter Elektronik und Software-<br />
Entwicklung der Betriebsstätte<br />
Regensburg. Seine Teams ent -<br />
wickeln vor Ort beispielsweise<br />
Assistenzsysteme, die auf Basis<br />
von Umfelddaten die Längsführung<br />
(Beschleunigen, Bremsen)<br />
teilautomatisieren.<br />
www.bertrandt.com<br />
2015: Umsatz wächst, Ergebnis schrumpft<br />
Leoni strukturiert Bordnetzbereich um<br />
Leoni, Anbieter von Kabeln und<br />
Kabelsystemen für die Automobilbranche<br />
und weitere Industrien,<br />
hat seinen Umsatz 2015 um rund<br />
10 % auf 4,5 Mrd. Euro gesteigert.<br />
Das Ergebnis vor Zinsen und<br />
Steuern (Ebit) ging allerdings auf<br />
151,3 Mio. Euro zurück. Hauptgrund<br />
waren außerplanmäßig hohe<br />
Aufwendungen bei Neuprojekten<br />
des Unternehmensbereichs<br />
Wiring Systems. „Es hat für uns<br />
Priorität, die Probleme im Bordnetz-Bereich<br />
aufzuarbeiten“, betont<br />
Dieter Bellé, Vorstandsvorsitzender<br />
der Leoni AG. „Wir haben<br />
Maßnahmen ergriffen, um die Effizienz<br />
nachhaltig zu steigern.“<br />
Der Unternehmensbereich Wiring<br />
Systems (WSD) hat den Umsatz<br />
Die Leistungsverteilung<br />
der nächsten Bordnetz-<br />
Generation wird von<br />
einer dezentralen Architektur<br />
geprägt sein, die<br />
Leoni derzeit entwickelt<br />
Bild: Leoni<br />
im Berichtsjahr um 11 % auf<br />
knapp 2,7 Mrd. Euro gesteigert.<br />
Das Ebit nahm jedoch deutlich<br />
ab. Hauptursache waren massive<br />
Kostensteigerungen beim Hochlauf<br />
neuer Projekte. Um die Profitabilität<br />
zu erhöhen, hat das Unternehmen<br />
ein umfangreiches<br />
Effizienzprogramm auf den Weg<br />
gebracht. Es wird angestrebt, die<br />
Performance der für die Ergebnisbelastung<br />
maßgeblichen Projekte<br />
zu steigern, die Prozesse in Projektplanung<br />
und -umsetzung zu<br />
verbessern sowie die Matrix-Organisation<br />
zu vereinfachen, um<br />
kurze Entscheidungswege, klare<br />
Zuständigkeiten und geringere<br />
Kosten zu ermöglichen.<br />
www.leoni.com<br />
In zwei Jahren 1100 neue Arbeitsplätze geschaffen<br />
Boysen-Gruppe steigert Umsatz auf knapp 1,5 Mrd. Euro<br />
Im zurückliegenden Geschäftsjahr<br />
hat der Abgastechnik-Spezialist<br />
Boysen einen Umsatz in Höhe<br />
von 1,46 Mrd. Euro erzielt – erwirtschaftet<br />
von rund 3300 Mitarbeitern<br />
an weltweit 17 Standorten.<br />
„Die Leistung und das Ergebnis<br />
der Gruppe liegen über der<br />
Planung“, erklärt Geschäftsführer<br />
Rolf Geisel. „Innerhalb von nur<br />
zwei Jahren haben wir damit beim<br />
Umsatz um 43 Prozent und bei<br />
der Personalentwicklung um<br />
50 Prozent zugelegt“, zieht Geisel<br />
den Vergleich zum Jahr 2013, in<br />
dem die Unternehmensgruppe<br />
mit 2200 Beschäftigten einen<br />
Umsatz in Höhe von 1,02 Mrd.<br />
Euro erzielt hatte. „Wir haben<br />
massiv investiert. Und jetzt zeigt<br />
sich, dass sich diese enormen<br />
Vorleistungen auch wie erhofft<br />
auswirken“, verweist der Boysen<br />
Chef auf die damit verbundenen<br />
Neuaufträge der Hauptkunden im<br />
Automobilbereich. Als Beispiele<br />
für 2015 nennt er die erfolg -<br />
reichen Anläufe der Serien -<br />
produktion von Abgastechnik<br />
für den Audi A4, den BMW 3er<br />
(Modellüberarbeitung) und 7er<br />
sowie den GLC und die E-Klasse<br />
von Mercedes-Benz.<br />
www.boysen-online.de<br />
Erprobung auf dem Multi-Achsen-Prüfstand: Boysen will nunmehr auch im Nutzfahr<br />
ze ugges chä f t durchstar te n Bild: Boysen<br />
8 AutomobilKonstruktion 2/2016
RIVSET ® HDX<br />
Neue Stanzniettechnik für hochfeste Verbindungen<br />
Kaltfügen pressgehärteter Stähle<br />
Der moderne Leichtbau stellt mit den aktuellen Werkstoffen bzw. Werkstoffkombinationen erhöhte<br />
Anforderungen an die Verbindungstechnik.<br />
Das bewährte mechanische Fügeverfahren RIVSET ® Stanznieten geht mit dem HDX neue Wege.<br />
Durch die innovative Teilegeometrie des Halbhohlniets können pressgehärtete Stähle beispielsweise mit<br />
Aluminium gefügt werden.<br />
Profitieren Sie von Verarbeitungssystemen mit kurzen Prozesszeiten ohne Vorlochoperation. Sie sind<br />
modular einsetzbar, verschleiß- und wartungsarm. Überzeugen Sie sich.<br />
Begeisterung für erfolgreiche Verbindungen.<br />
Tel. +49(0)521/4482-189<br />
fuegetechnik@boellhoff.com<br />
www.boellhoff.de<br />
2/2016 9 AutomobilKonstruktion
AUS DER BRANCHE<br />
LEUTE<br />
Entwicklung und Herstellung neuartiger Multifunktionsschalter<br />
Daimler zeichnet Preh mit Special Award aus<br />
Christoph Hummel, Preh<br />
Anfang Januar hat Christoph Hummel (49) den Vorsitz der<br />
Geschäftsführung der Preh GmbH übernommen. Er folgt auf<br />
Dr. Michael Roesnick (62), der Ende Dezember in den Ruhestand<br />
gegangen ist. Neben dem Vorsitz verantwortet CEO<br />
Hummel jetzt die Bereiche Vertrieb/Marketing, Projekt -<br />
management, E-Mobility, Preh IMA Automation und Qualität.<br />
Matthias Zink, Schaeffler<br />
Der Aufsichtsrat der Schaeffler AG hat Matthias Zink (46),<br />
Leiter des Unternehmensbereichs Getriebesysteme, mit<br />
Wirkung zum 1. Januar 2017 zum Mitglied des Vorstands<br />
der Schaeffler AG bestellt. Er wird Nachfolger von Norbert<br />
Indlekofer (58), dessen Vertrag auf eigenen Wunsch nicht<br />
verlängert wurde.<br />
Rainer Joest, Freudenberg<br />
Rainer Joest ist neuer President Sales and Marketing für das<br />
Automobilgeschäft von Freudenberg Sealing Technologies.<br />
Er blickt auf eine langjährige Erfahrung bei Freudenberg sowohl<br />
in Forschung- und Entwicklung, im Vertrieb und in der<br />
Produktion zurück. Schon 1978 trat er in die Forschungsabteilung<br />
des Unternehmens ein.<br />
Bruno Fankhauser, Leoni<br />
Bruno Fankhauser (44) ist neues Mitglied des Vorstands der<br />
Leoni AG und trägt die Verantwortung für den Unternehmensbereich<br />
Wire & Cable Solutions (WCS). Fankhauser hatte im<br />
Jahr 2004 die Geschäftsführung des Schweizer Kabelunternehmens<br />
Studer übernommen und kam 2006 mit der Übernahme<br />
dieser Gesellschaft durch Leoni in den Konzern.<br />
Klaus Löckel, Dassault Systèmes<br />
Dassault Systèmes hat Klaus Löckel (47) zum neuen Senior<br />
Director EuroCentral, Business Transformation Sales ernannt.<br />
Er übernimmt die Position von Andreas Grätsch, der das Unternehmen<br />
aus persönlichen Gründen im Februar verlassen<br />
hat. Löckel ist seit 2013 als Sales Director Industry Transportation<br />
& Mobility bei Dassault Systèmes tätig.<br />
Herve Boyer, Nexteer Automotive<br />
Mit Wirkung zum 01. März 2016 hat Nexteer Automotive<br />
Herve Boyer zum Vice President, Chief Operating Officer für<br />
Europa und Südamerika ernannt. Boyer soll die Wachstumsbestrebungen<br />
des Unternehmens in Europa und Südamerika<br />
weiter vorantreiben. Zudem ist er Mitglied im Global Strategic<br />
Council von Nexteer.<br />
Bei der Verleihung des Daimler Supplier Awards 2015 ging der Special Award an<br />
den Bediensystemspezialisten Preh. V.l: Christoph Hummel, Vorsitzender der<br />
Preh-Geschäftsführung; Prof. Dr. Thomas Weber, Vorstand Konzernforschung und<br />
Mercedes-Benz Cars Entwicklung und Jochen Ehrenberg, Preh-Geschäftsführer<br />
Produktentwicklung und Werke Bild: Preh<br />
Für die Entwicklung und Herstellung<br />
neuartiger Multifunktionsschalter<br />
hat Daimler die Preh<br />
GmbH mit einem Special Award<br />
geehrt. Mit dem Daimler Supplier<br />
Award prämiert das Unternehmen<br />
einmal jährlich Spitzenqualität,<br />
Innovationskraft und partnerschaftliche<br />
Zusammenarbeit seiner<br />
Zulieferer. Insgesamt wurden<br />
in diesem Jahr zehn Awards an<br />
Geschäftspartner verliehen.<br />
Den Special Award überreichte<br />
Prof. Dr. Thomas Weber, Vorstand<br />
Konzernforschung und Mercedes-<br />
Benz Cars Entwicklung, an die<br />
Preh-Geschäftsführer Christoph<br />
Hummel und Jochen Ehrenberg.<br />
„Mit der Integration der innovativen<br />
Touch-Bedienung in die Speichen<br />
des Lenkrads haben wir in<br />
der neuen E-Klasse Maßstäbe gesetzt“,<br />
sagte Weber bei der Übergabe<br />
der vom Daimler-Design -<br />
bereich entworfenen Trophäe.<br />
Bei der ausgezeichneten Entwicklung<br />
handelt es sich um Multifunktionsschalter<br />
für Lenkräder.<br />
Die dort integrierten Touch Control<br />
Buttons sind berührungssensitiv.<br />
Sie reagieren exakt auf horizontale<br />
und vertikale Wischbewegungen<br />
des Daumens. So kann<br />
der Fahrer mit dem einen Schalter<br />
alle fahrzeugrelevanten Funktionen<br />
steuern und mit dem anderen<br />
alle Funktionen des zentralen Displays<br />
– wie Navigation und Infotainment<br />
– während beide Hände<br />
am Steuer bleiben.<br />
„Wir verstehen den Special Award<br />
nicht nur als Lob für unsere Innovationskraft,<br />
sondern zugleich als<br />
Ansporn für künftige Projekte“,<br />
sagte Christoph Hummel. Und<br />
Dieter Zetsche zeigte sich begeistert<br />
von der engen Zusammenarbeit<br />
von Daimler und seinen Lieferanten:<br />
„Im digitalen Zeitalter<br />
brauchen wir eine Kultur, die Innovation<br />
konsequent fördert. Nur<br />
so können wir die Chancen der<br />
Digitalisierung optimal nutzen.“<br />
www.preh.com<br />
10 AutomobilKonstruktion 2/2016
Zwei neue Standorte beschleunigen Projekte für das autonome Fahren<br />
Elektrobit baut Autosar-Entwicklung weltweit aus<br />
In Timisoara (Temeswar) in Rumänien und<br />
Bangalore in Indien eröffnet Elektrobit (EB)<br />
zwei neue internationale Niederlassungen.<br />
Im Zuge dieser Expansion stellt das Unternehmen<br />
bis zu 80 zusätzliche Entwickler ein. Mit<br />
diesen zusätzlichen Ressourcen und Mitarbeitern<br />
wird EB die Entwicklung seiner Steuergerätesoftware<br />
EB tresos sowie der nächsten<br />
Generation von Autosar vorantreiben. Das<br />
Unternehmen beliefert wichtige Automobilhersteller<br />
mit Software und Services für eine<br />
Vielzahl von Einsatzgebieten. „Automobilhersteller<br />
fordern immer ausgefeilte Funktionen<br />
und Vernetzungsoptionen für ihre Fahrzeuge,<br />
ohne dass die Sicherheit darunter leiden darf.<br />
Darum ist es für EB besonders wichtig, unsere<br />
Aktivitäten im Bereich ECU-Lösungen zu<br />
erweitern“, sagt Alexander Kocher, President &<br />
Managing Director von Elektrobit. „Mit dem Ausbau<br />
in Timisoara und Bangalore können wir uns<br />
darauf konzentrieren, die komplexen Marktanforderungen<br />
zu erfüllen und unseren Kunden<br />
weltweit innovative Lösungen zu bieten.“<br />
www.elektrobit.com<br />
Hochspannungsantriebssysteme<br />
Valeo kündigt ein Joint-<br />
Venture-Projekt mit<br />
Siemens an<br />
Im Bereich der Hochspannungsantriebssysteme<br />
kündigt Valeo<br />
ein 50:50-Joint-Venture-Projekt<br />
mit Siemens an. Mit diesem<br />
Gemeinschaftsunternehmen würden<br />
die beiden Hersteller Ihre<br />
Kräfte bündeln, um gemeinsam<br />
eine innovative Komplettlösung<br />
von Hochspannungs-Komponenten<br />
(mit mehr als 60 V) und -Systemen<br />
anzubieten, die in allen<br />
Elektrofahrzeugtypen eingesetzt<br />
werden kann. „Wir freuen uns<br />
über die Aussicht, unsere Stärken<br />
im Bereich der elektrischen<br />
Antriebssysteme mit Siemens<br />
zusammenzulegen“, erklärt<br />
Jacques Aschenbroich, CEO von<br />
Valeo. „Mit der Expertise von<br />
Siemens, einem führenden<br />
Anbieter im Bereich Leistungselektronik<br />
und Elektromotoren,<br />
würde Valeo seinen technologischen<br />
Vorsprung fortschreiben<br />
und eine komplette Palette von<br />
Technologien anbieten können.“<br />
Klaus Helmrich, Mitglied des Vorstands<br />
der Siemens AG erklärt<br />
seinerseits: „Das Joint Venture<br />
zwischen Valeo und Siemens ist<br />
ein weiteres Beispiel für ein<br />
Unternehmen mit einer echten<br />
europäischen Dimension.“ Das<br />
Vorhaben ist noch den Arbeitnehmervertretungen<br />
zur Beratung<br />
vorzulegen und bedarf noch der<br />
Genehmigung der entsprechenden<br />
Aufsichtsbehörden.<br />
www.valeo.com<br />
Von A wie Antriebsstrangentwicklung über M wie Motorapplikation<br />
bis X wie XiL – alles Wissenswerte zu uns<br />
finden Sie auf www.schaeffler-engineering.com!<br />
Unser Antrieb<br />
ist der Antrieb von morgen<br />
Beim Antrieb zählt jedes Detail. Deshalb sorgen wir als Spezialist<br />
für mechatronische Systeme dafür, dass alle Komponenten perfekt<br />
zusammenspielen. Seit mehr als drei Jahrzehnten stehen wir unseren<br />
Kunden zur Seite – von der Idee bis zur Serie. Mit uns wird der Antrieb von<br />
morgen schon heute Wirklichkeit.<br />
Schaeffler Engineering – Partner für den Antrieb von morgen<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 11
Neues auf www.autokon.de<br />
Sicherheitssystem erkennt auch kleine Kinder<br />
Weniger Unfälle beim Rückwärtsfahren<br />
Harmann, ein Anbieter für<br />
vernetzte Lösungen im Automotive-,<br />
Consumer- und<br />
Enterprise-Markt, hat ein<br />
Sicherheitssystem namens<br />
Reverse Pedestrian Detection<br />
entwickelt. Es hilft dabei, die<br />
toten Winkel zu eliminieren<br />
und kombiniert die Daten<br />
verschiedener, im Auto eingebauter Harmann-<br />
Technologien wie Rückfahrkamera und Sensoren,<br />
um Fußgänger hinter einem Fahrzeug zu erfassen.<br />
Das System kann auch kleine Kinder<br />
erkennen.<br />
www.autokon.de Suchwort Harmann<br />
Vollautomatisch Parken mit sicherer Igus-Energieführung<br />
Parksystem spart Nerven<br />
An einem Samstag mal kurz<br />
noch in die Stadt, doch alle<br />
Parkhäuser sind besetzt.<br />
Die Suche nach den letzten<br />
freien Plätzen raubt einem<br />
schon vor dem Einkauf den<br />
letzten Nerv und zugleich<br />
noch<br />
wertvolle Zeit. Bei diesem Problem kann das<br />
automatische Robotersystem Ray des bayrischen<br />
Unternehmens Serva Transport Systems<br />
GmbH helfen.<br />
www.autokon.de Suchwort Igus<br />
Umwelt- und Wirtschaftspreis für E-Clutch<br />
Schaeffler gewinnt GreenTec Award<br />
In der Kategorie Automobilität<br />
hat Schaeffler die Nase<br />
vorn. Bei dem Umwelt- und<br />
Wirtschaftspreis „GreenTec<br />
Award“ belegt der Zulieferer<br />
mit der E-Clutch den ersten<br />
Platz. Warum das so ist,<br />
erläuterte Marco Voigt,<br />
Geschäftsführer der Green-<br />
Tec Awards, bei der Vorab-Preisverleihung in<br />
Berlin. Die E-Clutch ermöglicht unter anderem<br />
die Funktionen Start-Stopp und Segeln beim<br />
Handschalter.<br />
www.autokon.de Suchwort Schaeffler<br />
Bild: Yuasa<br />
Website von Hirschmann MCS<br />
Einladung zum schnellen Dialog<br />
Mit einem neuen Internetauftritt<br />
präsentiert<br />
sich Hirschmann<br />
MCS nun in zeitgemäßer<br />
Form in Verbindung<br />
mit mehr<br />
Nutzerfreundlichkeit,<br />
Übersichtlichkeit und<br />
einem hohen Anspruch<br />
auf Vollständigkeit. Ob<br />
PC, Smartphone oder Tablet – die<br />
Website passt sich allen Anforderungen<br />
an und lädt zum schnellen<br />
Dialog ein.<br />
Mit wenigen Klicks wird der Besucher<br />
durch die Welt der Hirschmann<br />
Produkte geführt und erhält,<br />
neben detaillierten Informationen,<br />
Einblicke zu möglichen<br />
Anwendungsgebieten und vielseitigen<br />
Branchenlösungen. Eine<br />
neue Navigationsstruktur macht<br />
das Angebot übersichtlicher. Mit<br />
praktischen Anwendungsbeispielen<br />
erfahren die Leser mehr über<br />
den branchenübergreifenden Einsatz<br />
von Sensoren und Steuerungen<br />
für mobile Maschinen. Auch<br />
Yuasa europaweit einheitlich im Netz<br />
Intelligente Batterie-Suchfunktion<br />
die Dienstleistungen kommen<br />
nicht zu kurz: Der neue integrierte<br />
Servicebereich erleichtert die<br />
Kontaktaufnahme für Reparaturen<br />
und Ersatzteile. Auch finden Sie<br />
News über Projekte, Innovationen<br />
oder Veranstaltungen rund um<br />
das Unternehmen, sowie Informationen<br />
über die Leistungen der<br />
Systemintegratoren.<br />
Der bewusste Einsatz von Bildern<br />
mit starken Motiven spielt zudem<br />
eine zentrale Rolle. Schon bevor<br />
das erste Wort gelesen wird, soll<br />
der Besucher einen visuellen Eindruck<br />
und ein schnelleres Verständnis<br />
für die Inhalte und die<br />
Botschaften erhalten.<br />
www.hirschmann-mcs.com<br />
Auf der neuen Homepage vereint<br />
Yuasa Battery erstmals alle drei<br />
Geschäftsbereiche Industrial, Automotive<br />
und Motorcycle unter einem<br />
Dach. Kunden aus den Bereichen<br />
will der Hersteller damit professionell<br />
informieren und mit<br />
neuen Tools unterstützen. Das<br />
Unternehmen präsentiert sich auf<br />
der Homepage zusammen mit<br />
den Seiten der Niederlassungen<br />
Großbritannien, Frankreich, Spanien<br />
und Italien nun in einem einheitlichen<br />
Look.<br />
Die Suche nach der passenden<br />
Batterie erleichtert ein innovatives<br />
Suchwerkzeug:<br />
Anhand verschiedener<br />
Kriterien wie<br />
Hersteller, Modell<br />
und Anwendung<br />
können Nutzer die<br />
richtige Batterie für<br />
ihre Anwendung ermitteln. Auch<br />
über die Teilenummer, z. B. eines<br />
Fremdfabrikats, lässt sich die<br />
passende Batterie herausfiltern.<br />
Die für mobile Geräte optimierte<br />
Webseite mit selbsterklärender<br />
Navigation zeigt neben der kompletten<br />
Produktpalette alle zugehörigen<br />
Teilenummern und Batterieabbildungen.<br />
Im Downloadbereich<br />
können Kunden Prospekte,<br />
detaillierte Datenblätter und Anleitungen<br />
zur Nutzung einer Batterie<br />
herunterladen.<br />
www.yuasaeurope.com<br />
Bild: Hirschmann MCS<br />
12 AutomobilKonstruktion 2/2016
DICHT UND SICHER<br />
LEE BETAPLUG ® Dichtstopfen<br />
Unser bewährtes Konzept,<br />
Kanäle und Bohrungen zu verschließen<br />
Das rationelle Prinzip:<br />
konischer Verschluss-Stopfen<br />
in konischer Aufnahmebohrung.<br />
In der Automobilindustrie erfolgreich<br />
eingesetzt im Getriebe- und<br />
Motorenbau, bei Ölfiltern, Ölkühlern<br />
und -pumpen sowie anderen Anbauaggregaten.<br />
Ø 5 mm bis 20 mm<br />
Für Drücke bis 50 bar<br />
Für Öl- und Kühlkanäle<br />
in Motoren und Getrieben<br />
Für Kernstützlöcher<br />
Mit BETAPLUG ® entsteht ein perfekter, formschlüssiger Sitz – DICHT UND SICHER!<br />
LEE Hydraulische<br />
Miniaturkomponenten GmbH<br />
Am Limespark 2 · 65843 Sulzbach<br />
Telefon 06196 773 69- 0<br />
Fax 06196 773 69-69<br />
E-Mail info@lee.de · www.lee.de<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 13
WEITERBILDUNG<br />
Timo Taubitz, Geschäftsführer der VDI Wissensforum GmbH, über die Hintergründe der neuen Fachmesse ConCarExpo<br />
„Wir decken das gesamte Spektrum ab“<br />
Das VDI Wissensforum ist seit mehr als 50 Jahren einer<br />
der Marktführer für die Organisation und Planung von<br />
Tagungen, Konferenzen, Foren und Seminaren für Ingenieure<br />
sowie Fach- und Führungskräfte im technischen<br />
Umfeld. Jetzt folgt der nächste Schritt: Am 29. und<br />
30. Juni 2016 findet in Düsseldorf die internationale<br />
Fachmesse ConCarExpo statt. Unsere Redaktion sprach<br />
mit Timo Taubitz, dem Geschäftsführer der Wissens -<br />
forum GmbH über die Hintergründe.<br />
„Die Kombination von<br />
Ausstellung, vier parallelen,<br />
internationalen VDI-<br />
Fachkonferenzen, Messebühne,<br />
Fahrzeugpräsentationen<br />
und Vortragsprogramm<br />
bieten andere<br />
Veranstaltungen in dieser<br />
Intensität nicht.“<br />
Timo Taubitz ist Geschäftsführer der<br />
VDI Wissensforum GmbH<br />
Bild: VDI Wissensforum<br />
Gegensatz zu den großen Publikumsmessen –<br />
sehr intensiv informieren. Das Konferenzprogramm<br />
umfasst vier separate, internationale<br />
Konferenzen mit hochkarätiger Besetzung.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Welche Konferenzen finden zu<br />
welchen Themenkreisen statt?<br />
Wir sind überzeugt davon, dass wir mit den<br />
vier internationalen Konferenzen für die Besucher<br />
genau die wichtigen Zukunftstrends abbilden.<br />
Auf der „Automated Driving“ berichten<br />
Experten von OEMs und Tier1 über die neuesten<br />
technischen Möglichkeiten im Bereich<br />
Fahrerassistenzsysteme und Sensorik, aber<br />
auch über rechtliche Aspekte des autonomen<br />
Fahrens. Die „HMI & Connectivity“ greift Themen<br />
rund um Mensch-Maschine-Schnittstellen<br />
auf. Die „IT Security for Vehicles“ befasst<br />
sich mit den vielfältigen Anforderungen an<br />
vernetzte Fahrzeuge. Experten aus der Automobil-<br />
und IT-Industrie berichten zu Themen<br />
wie dem Schutz vor Zugriffen von außen, Verschlüsselung<br />
und Datenschutz. Die „Safety<br />
Systems“ richtet sich an Experten aus den Bereichen<br />
Integrale und passive Sicherheitssysteme<br />
und stellt die Auswirkungen des automatisierten<br />
Fahrens auf die Fahrzeugsicherheit<br />
in den Fokus.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Wie ist die Idee entstanden, als<br />
VDI Wissensforum eine Messe ins Leben zu<br />
rufen?<br />
Wir haben sehr viel Erfahrung als Weiterbildungsspezialist<br />
für Ingenieure sowie für Fachund<br />
Führungskräfte im technischen Umfeld<br />
der Automobilbranche. Das war eine Grundvoraussetzung<br />
für uns, um diese Plattform ins<br />
Leben zu rufen. Die Themen der ConCarExpo<br />
(CCE) spiegeln die internationalen Megatrends<br />
in der Branche wider: Das vernetzte<br />
Das Interview führte Jürgen Goroncy, freier<br />
Mitarbeiter der AutomobilKonstruktion<br />
Fahrzeug gewinnt immer mehr an Bedeutung.<br />
Dadurch erhält auch die IT-Security einen<br />
noch höheren Stellenwert. Vernetzungen wie<br />
Car2Car und Car2X wachsen immer stärker mit<br />
den Innovationen der Consumer Electronics<br />
zur Mobilität der Zukunft zusammen.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Welche Konzeption steht hinter<br />
der ConCarExpo?<br />
Die CCE kombiniert die Konzepte von Messe<br />
und Konferenzen. Das begleitende Konferenzprogramm<br />
und ein Messeforum mit mehr als<br />
100 vielseitig ausgerichteten Vorträgen sowie<br />
spezielle Pkw-Präsentationen bieten parallel<br />
zur Messe viele Möglichkeiten zur Wissensaktualisierung,<br />
Kontaktaufnahme und Networking.<br />
Der Besucher kann sich auf der CCE – im<br />
Automobil<br />
Konstruktion Welche Partner und Unterstützer<br />
konnten Sie für die Messe gewinnen?<br />
Das Interesse von potenziellen Partnern war<br />
sofort sehr groß. Wir konnten namhafte Branchenverbände<br />
wie den VDA, Bitkom, ITS<br />
Deutschland und den internationalen Fachverband<br />
CVTA (Connected Vehicle Trade Association)<br />
aus den USA als Unterstützer gewinnen.<br />
In dieser Allianz wird die ConCarExpo somit<br />
zum idealen Treffpunkt für alle, die mehr zum<br />
Connected Car wissen möchten und seine Zukunft<br />
entscheidend mitgestalten wollen. Im<br />
Messebeirat sind unter anderem Vertreter von<br />
Google, Porsche, Ericsson und Opel vertreten.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Was zeichnet die ConCarExpo<br />
besonders aus, was ist ihr Alleinstellungsmerkmal?<br />
Vor allem die Kombination von Ausstellung,<br />
14 AutomobilKonstruktion 2/2016
Bisher hat das VDI Wissensforum<br />
erfolgreich Tagungen<br />
und Konferenzen für<br />
Ingenieure organisiert.<br />
Jetzt folgt die internationale<br />
Fachmesse ConCarExpo<br />
Bild: VDI Wissensforum<br />
vier parallelen internationalen VDI-Fachkonferenzen,<br />
Messebühne, Fahrzeugpräsentationen<br />
und Vortragsprogramm im Messeforum<br />
bieten andere Veranstaltungen in dieser Intensität<br />
nicht. Ein weiteres Highlight ist die<br />
Verleihung des CAR Connect Awards (in 2015<br />
haben 12.000 Leser online über die besten<br />
vernetzten Applikationen und Anwendungen<br />
abgestimmt). Eröffnet wird die Messe durch<br />
eine Keynote von einem Schwergewicht in der<br />
Branche. Wir konnten dafür Elmar Frickenstein,<br />
Bereichsleiter Elektrik/Elektronik und<br />
Fahrerarbeitsplatz bei der BMW AG in München<br />
und profunder Kenner der Materie, gewinnen.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Welche Zielgruppen sprechen<br />
sie an?<br />
Eine wichtige Zielgruppe sind natürlich die<br />
Automobilhersteller und ihre wichtigsten<br />
Tier-1 und Tier-2-Lieferanten. Außerdem bieten<br />
wir für Mobilfunk- und Netzanbieter, Software-Entwickler,<br />
Internet-Provider sowie Anbieter<br />
von Verkehrstechnik die richtige Plattform<br />
für ihre Produkte und Systeme. In einem<br />
Satz: Die CCE ist das richtige Angebot für alle<br />
Unternehmen, die Produkte und Lösungen für<br />
vernetzte Fahrzeuge und Mobilitätslösungen<br />
der Zukunft anbieten.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Wieviel Aussteller und Besucher<br />
erwarten Sie?<br />
Nach dem heutigen Buchungsstand erwarten<br />
wir mit 80 bis 100 Ausstellern das internationale<br />
„Who is Who“ der Branche. Bei den Besuchern<br />
rechnen wir, konservativ geschätzt,<br />
mit etwa 1 000 Personen.<br />
Die ConCarExpo findet<br />
Ende Juni auf dem<br />
Messegelände in<br />
Düsseldorf statt<br />
Bild: Messe Düsseldorf/<br />
Tillmann & Partner<br />
Automobil<br />
Konstruktion Welche Besuchergruppen<br />
werden erwartet?<br />
Entscheider, Einkäufer, Entwicklungsingenieure,<br />
Produktdesigner, Softwareentwickler<br />
und alle, die sich über die technologischen<br />
Entwicklungen und künftige Anwendungsgebiete<br />
von vernetzten Fahrzeugen und Mobilitätslösungen<br />
informieren wollen. Dabei ist die<br />
Zielgruppe der Besucher durch unser Angebot<br />
sehr stringent definiert und es gibt wenig<br />
Streuverluste.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Vermutlich kommen auch viele<br />
Aussteller und Besucher aus dem Ausland?<br />
Die internationale Ausrichtung wird sehr stark<br />
sein. Die begleitenden vier Konferenzen finden<br />
in englischer Sprache statt.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Was sind die wichtigsten<br />
Herkunftsländer?<br />
Aus Europa werden die klassischen Automotiv-<br />
und Telematik-Länder wie Deutschland,<br />
Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien,<br />
Niederlande, Schweden und Finnland dominieren.<br />
Die USA und führende asiatische High-<br />
Tech-Nationen werden darüber hinaus auch<br />
vertreten sein.<br />
Anmeldung und Programm unter<br />
www.concarexpo.com oder über<br />
VDI Wissensforum GmbH, ConCarExpo 2016<br />
Tel.: +49 211 6214-667<br />
info@concarexpo.com<br />
Zur Person<br />
Timo Taubitz (49) studierte Volkswirtschaft an der<br />
Universität Heidelberg. Anschließend war er mehr als<br />
zehn Jahre lang in verschiedenen Positionen im Veranstaltungs-<br />
und Weiterbildungsbereich tätig. 2004<br />
übernahm er die Geschäftsführung der BME-Akademie<br />
GmbH, dem Weiterbildungsträger des Bundesverbands<br />
Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.<br />
(BME). Im April 2007 wird Timo Taubitz als Geschäftsführer<br />
der VDI Wissensforum GmbH berufen.<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 15
ELEKTRONIK + SOFTWARE<br />
Herausforderung automatisiertes Fahren<br />
Wie man die Fahrzeugelektronik für Fahrerassistenzsysteme fit macht<br />
So könnte die zukünftige E/E-Architektur<br />
(schematisch) für automatisiert fahrende<br />
Pkw aussehen<br />
Bilder: Audi Electronics Venture GmbH<br />
Umfassendes automatisiertes<br />
Fahren ist mit der heutigen Bordelektronik<br />
praktisch nicht möglich.<br />
Audi entwickelt deshalb eine<br />
E/E-Architektur mit einem neuen<br />
Entwicklungskonzept und neuen<br />
Systemansätzen.<br />
Der Autor: Hartmut Hammer ist freier Mitarbeiter der<br />
AutomobilKonstruktion<br />
Aktuell sind die verfügbaren Fahrerassistenzfunktionen<br />
eine sehr heterogene Gruppe und<br />
gehören zu verschiedenen Domänen, wie etwa<br />
der Parkassistent oder der Fernlichtassistent.<br />
Zwischen diesen Domänen besteht bisher<br />
nur ein eingeschränkter Informationsaustausch,<br />
auch die Nutzung gemeinsamer Basiskomponenten<br />
ist nur schwach ausgeprägt.<br />
„Damit komplexere Assistenzfunktionen realisiert<br />
werden können, muss eine Konsolidierung<br />
auf funktionaler Ebene erfolgen. Synergien<br />
zwischen allen Applikationen müssen<br />
konsequent ausgeschöpft werden“, fordert<br />
Florian Netter, zuständig für das Software<br />
Competence Center bei der Audi Electronics<br />
Venture GmbH.<br />
Hardware und Software angepasst<br />
Audi wird künftig alle von den Sensoren erfassten<br />
Messgrößen des direkten Fahrzeugumfelds<br />
in einer zentralen Sensordatenfusion<br />
verarbeiten. Ergänzt werden sie um Informationen<br />
aus der Car-to-X-Kommunikation (ein<br />
weiterer Sensor mit mittlerer Reichweite) sowie<br />
Informationen aus dem Backend (große<br />
Reichweite).<br />
Hardwareseitig hat man dafür seine Hausaufgaben<br />
schon gemacht: das sogenannte ZFAS<br />
(Zentrales Fahrerassistenz-Steuergerät) ist eine<br />
bereits seriennahe Hardwarearchitektur, in<br />
der alle Sensorinformationen für automatisiertes<br />
Fahren zusammenlaufen. Die leistungsfähigen<br />
Elektronikbausteine des ZFAS verfügen<br />
über die Rechenleistung eines heutigen Mittelklasseautos<br />
und verarbeiten die Daten mit<br />
bis zu 750 GFlops. Das ZFAS könnte noch 2016<br />
mit dem neuen Audi A8 in Serie gehen.<br />
Analog zum ZFAS werden künftig weitere leistungsfähige<br />
Steuergeräte jeweils mehrere<br />
kleine ECUs eines Fahrzeug-Subsystems (den<br />
sogenannten Domains, zum Beispiel Antriebsmanagement,<br />
Karosserie, Multimedia, pilo-<br />
16 AutomobilKonstruktion 2/2016
Florian Netter: „Wichtig<br />
ist eine enge Verzahnung<br />
der Fahrzeugfunktionen<br />
mit der Softwaretechnologie.“<br />
Das ZFAS hat unter<br />
anderem Rechenbausteine<br />
von Mobileye (EyeQ3) und<br />
Nvidia (Tegra K1) an Bord<br />
(rechts)<br />
Wichtig ist eine frühzeitige<br />
Anwendung der Entwicklungselemente<br />
schon ab der<br />
Konzeptphase<br />
tiertes Fahren) zusammenfassen. Der dichte<br />
Datenverkehr zwischen den Domains überfordert<br />
allerdings die Bandbreite bisheriger Bustopologien.<br />
Als neuen Backbone zwischen<br />
den Domain-Steuergeräten setzt Audi auf das<br />
Ethernet-Protokoll mit einer Bandbreite von<br />
bis zu 1 GBit/s.<br />
Neue Interfaces<br />
Ergänzend müssen die Systemeigenschaften<br />
der Car-to-X-Kommunikation, der cloudbasierten<br />
Dienste, der Mobile Devices und der Übertragungsstandards<br />
– etwa die Datenrate und<br />
Latenzzeit moderner Mobilfunkstandards in<br />
der E/E-Architektur berücksichtigt werden. Zusätzlich<br />
gilt es, Aspekte wie funktionale Sicherheit<br />
(Safety), Datensicherheit (Security)<br />
und die jeweils regionalen Datenschutzbestimmungen<br />
(Privacy) sukzessive in die Systemarchitektur<br />
zu integrieren. „Als sehr hilfreich<br />
hat sich das Denken in Kommunikationswirkketten<br />
erwiesen, bei der einzelne Datenströme<br />
vom Anfangs- bis zum Endpunkt<br />
komplett analysiert und optimiert werden“, so<br />
Florian Netter.<br />
Eine andere wichtige Schnittstelle sind die Interfaces<br />
zwischen den Domänen einer Systemarchitektur.<br />
Audi verwendet standardisierte<br />
Schnittstellenadapter, mit denen die Wiederverwendbarkeit<br />
von Softwarekomponenten<br />
gesteigert und Entwicklungskosten gesenkt<br />
werden können. Ein von Audi selbst entwickeltes<br />
Mobile Computing Framework enthält<br />
Softwarebibliotheken für die Androidund<br />
Apple-Betriebssysteme und wird genutzt,<br />
um Apps für mobile Endgeräte zu entwickeln.<br />
Für cloudbasierte Dienste steht ein weiteres<br />
Framework bereit, mit dessen Hilfe Datenanalysen<br />
durchgeführt und Datenverarbeitung in<br />
Echtzeit implementiert werden kann.<br />
Bessere Methoden und Prozesse<br />
Virtuelle Entwicklungsmethoden sind neben<br />
den Plattformen und der Systemarchitektur eine<br />
weitere wichtige Komponente in der automobilen<br />
Softwareentwicklung. Deshalb entwickelt<br />
die Audi Electronics Venture GmbH die<br />
Functional Engineering Platform (FEP), eine<br />
skalierbare Testumgebung. Sie vernetzt virtuell<br />
alle Teilsysteme bis hin zu mobilen Endgeräten<br />
und cloudbasierten Diensten und ermöglicht<br />
eine frühzeitige Verifizierung und Validierung<br />
von Algorithmen, Architekturen,<br />
Steuergeräten und Hardwaremustern.<br />
Parallel dazu kann die FEP mit realen Steuergeräten<br />
und HiL-Prüfständen verknüpft werden,<br />
sodass auch Prüfstands- und Fahrzeugtests<br />
möglich sind. Die Integration von Sensormodellen,<br />
wie etwa einem Radar, und die<br />
Kopplung mit Fahrermodellen und einer Verkehrssimulation<br />
ergeben flexible Einsatzmöglichkeiten.<br />
Eine einheitliche Systemarchitektur, Plattformen<br />
und eine virtuellen Entwicklung sind aber<br />
lediglich technische Voraussetzungen für softwareintensive<br />
Innovationen. Audi sieht in ihrer<br />
Einbettung in adaptive Prozesse den<br />
Schlüssel zur schnellen und nachhaltigen Entwicklung.<br />
Das modulare Framework von Audi<br />
für die Embedded Softwareentwicklung ist<br />
nach Automotive Spice Level 3 zertifiziert und<br />
umfasst gemeinsame Tools, geeignete Entwicklungsmethoden,<br />
eine leistungsfähige Infrastruktur<br />
und kann nach Angaben von Florian<br />
Netter an die spezifischen Rahmenbedingungen<br />
jedes Projekts angepasst werden.<br />
Audi AG<br />
+49 (0)841 89-0<br />
www.audi.de<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 17
Crimpkontakt mit SMC-Technologie<br />
für 2,5-mm²-Aluminiumleitungen<br />
Bilder: Delphi<br />
Das Netz hält<br />
Crimp- und Beschichtungstechnologie optimiert Verbindung von Aluminiumleitungen<br />
Leichtbau macht auch vor dem<br />
Bordnetz nicht Halt: Aluminiumleitungen<br />
sparen Gewicht, verlangen<br />
aber werkstoffgerechte Crimpund<br />
Korrosionsschutzlösungen.<br />
Delphi Automotive entwickelt für<br />
Leitungsquerschnitte von 2,5 bis<br />
6 mm 2 eine neue Generation von<br />
Crimpverbindungen.<br />
Der Autor: Hartmut Hammer ist freier Mitarbeiter der<br />
AutomobilKonstruktion<br />
Seit einem Jahrzehnt beschäftigt sich Delphi<br />
nach eigenen Angaben intensiv mit Aluminiumkabeln<br />
und den dazugehörigen Kontaktierungstechniken.<br />
Hauptmotivation ist Leichtbau,<br />
da Aluminium im Vergleich zu Kupfer<br />
deutlich leichter, elektrisch gut leitend und<br />
preisgünstiger ist und geringere Preisschwankungen<br />
aufweist. Inzwischen hat Delphi etliche<br />
Aluminiumleitungen mit Querschnitten<br />
von 10 bis 120 mm² im Umfeld der Batterie<br />
und der Leistungselektronik in Serie gebracht.<br />
Doch auch für Kabelquerschnitte im mittleren<br />
Querschnittsbereich von 2,5 bis 6 mm 2 sieht<br />
man gute Marktchancen, da diese Querschnittsklassen<br />
einen großen Anteil an der<br />
Gesamtmasse des Bordnetzes haben. „Bei einer<br />
intelligenten Substitution von Kupferdurch<br />
Aluminiumkabel ist in diesen Querschnittsklassen<br />
eine Gewichtsersparnis von<br />
bis zu 48 % möglich“, erläutert Christian<br />
Schäfer, Leiter Vorentwicklung für E/E-Systeme<br />
und Bordnetz bei Delphi in Europa.<br />
Optimierte Leitfähigkeit und Festigkeit<br />
Aluminiumleitungen erfordern aber eine andere<br />
Verarbeitung als Kupferleitungen, da erstens<br />
sich auf Aluminium in Sekundenschnelle<br />
eine nicht leitende Oxidschicht bildet, die für<br />
eine schlechte Querleitfähigkeit zwischen den<br />
Aluminiumlitzen sorgt. Zweitens ist bei zwei<br />
Metallen mit unterschiedlichem Potenzial hier<br />
das Kupfer des Kontaktes und das Aluminium<br />
der Leitung ein Schutz gegen galvanische Korrosion<br />
notwendig.<br />
Christian Schäfer: „Für eine bessere Querleitfähigkeit<br />
verschweißen wir die Einzeldrähte<br />
im Anschlussbereich per Ultraschall-Verfahren<br />
zu einem formschlüssigen Nugget. Durch dieses<br />
Kompaktieren – ein Alleinstellungsmerkmal<br />
von Delphi – wird die Oxidschicht der Einzeldrähte<br />
aufgebrochen und die Querleitfähigkeit<br />
sichergestellt.“ Zusätzlich verfügt der<br />
Nugget über eine verbesserte Festigkeit, die<br />
zusammen mit dem Crimp des Terminals auch<br />
für eine robuste mechanische Verbindung<br />
18 AutomobilKonstruktion 2/2016
ELEKTRONIK + SOFTWARE<br />
Die Einzeldrähte sind per Ultraschall-<br />
Verfahren zu einem formschlüssige<br />
n<br />
Nugget verarbeitet<br />
Die Rautenprägung in den<br />
Crimpzonen sorgt für eine<br />
gute Formfestigkeit und<br />
hohe elektrische Leitfähigkeit<br />
der Verbindung<br />
sorgt. Denn der Crimp ist mit einer Rautenprägung<br />
versehen, die mit dem Aluminium einen<br />
starken mechanischen Formschluss erzeugt.<br />
Angenehmer Nebeneffekt: An den Rautenkanten<br />
wird so die Aluminium-Oxidschicht aufgebrochen,<br />
was eine Vielzahl an elektrischen<br />
Kontaktpunkten zur Folge hat und die Leitfähigkeit<br />
verbessert.<br />
Durch seinen separaten Ader- und Isolationscrimp<br />
erleichtert das neue Terminal außerdem<br />
die Positions- und Lagebestimmung der<br />
Aluminiumleitung. Hinzu kommt, dass die<br />
Nuggets und Crimpverbindungen auf den gleichen<br />
Standardmaschinen wie für Kupferanwendungen<br />
hergestellt werden, lediglich erweitert<br />
um den Prozessschritt Ultraschallschweißen<br />
und Trimmen. Die Rauten im Adercrimp<br />
lassen sich durch Wechseleinsätze in<br />
den Werkzeugen sehr einfach realisieren. „Auf<br />
den Standard-Fertigungsanlagen haben wir in<br />
den letzten Jahren bereits mehrere tausend<br />
Kilometer Aluminiumleitungen mit nuggetförmigen<br />
Kontaktteilen in verschiedenen Leitungsquerschnitten<br />
für Kunden in Serie gefertigt“,<br />
betont Christian Schäfer.<br />
Korrosionsschutz<br />
Aluminium direkt auf Kupfer bedeutet zwei<br />
Metalle mit unterschiedlichem Potenzial.<br />
Kommt ein Elektrolyt wie etwa Salzwasser hinzu,<br />
kann galvanische Korrosion die Kontaktierung<br />
zwischen Kupfer und Aluminium schädigen.<br />
Diese Situation will Delphi mithilfe der<br />
Selective Metal Coating(SMC)-Technologie<br />
entschärfen, nach eigenen Angaben ein weiteres<br />
Alleinstellungsmerkmal. SMC benötigt<br />
Gewichtsanteile von Leiterquerschnitten im<br />
Fahrzeug (rot: Kupferleitungen empfohlen, rosa:<br />
Kupferleitungen empfohlen, eventuell mit Aluminiumleitungen<br />
substituierbar, grau: gut mit Aluminium -<br />
leitungen substituierbar)<br />
laut Christian Schäfer keine zusätzlichen Abdichtmaterialien<br />
und Additive wie Lacke, Pulver<br />
oder Fette. Diese bei herkömmlichen Terminals<br />
oft noch erforderlichen Stoffe verursachen<br />
dort kostenintensive Fertigungsschritte<br />
mit Kameraüberwachung und spezielle Lagerfristen<br />
und -bedingungen.<br />
Delphi hingegen verzichtet auf eine äußere<br />
Abdichtung des Crimps. Der Crimpbereich<br />
wird aus feuerverzinntem Bandmaterial ausgestanzt<br />
und mit einer Kupfer-Zink-Legierung<br />
(Messingschicht) sowie einer Verzinnung versehen.<br />
Diese zwei galvanischen Schutzschichten<br />
reduzieren das elektrochemische<br />
Potenzial und verlangsamen unter Elektrolyteinwirkung<br />
die Diffusion der reaktiven Stoffe,<br />
sodass die Korrosion stark vermindert wird<br />
und keine Funktionseinschränkung über die<br />
Lebensdauer zu erwarten ist. Das liegt nicht<br />
zuletzt daran, dass bei einer offenen Crimpverbindung<br />
eindringende Feuchtigkeit schnell<br />
wieder trocknen kann. Christian Schäfer: „Ohne<br />
Elektrolyten – üblicherweise die normale<br />
Situation in Innenraum ist überhaupt keine<br />
galvanische Korrosion zu erwarten.“<br />
Auch die SMC-Technologie basiert auf galvanischen<br />
Standardprozessen. Delphi hat auf diese<br />
Weise bereits verschiedene Kontaktteile in<br />
sechsstelliger Anzahl beschichtet. Sie versehen<br />
derzeit in Flottentests und Feldversuchen<br />
so zuverlässig ihren Dienst, dass ein Serienstart<br />
2017 realistisch erscheint.<br />
Delphi Automotive<br />
Tel.: +49 202 291 2115<br />
thomas.aurich@delphi.com<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 19
Der dritte Weg<br />
Vernetzungsplattform My Spin als Alternative zu den Lösungen von Google und Apple<br />
Die Robert Bosch GmbH treibt die<br />
Vernetzung des Fahrzeugs mit dem<br />
Internet und seiner Umwelt voran.<br />
Unter anderem soll die mit dem<br />
Pilotkunden Jaguar/Land Rover<br />
realisierte Smartphone-Integrationslösung<br />
My Spin zu einer<br />
Connectivity-Plattform ähnlich den<br />
bekannten Apple- und Android-<br />
Lösungen ausgebaut werden.<br />
Der Autor: Hartmut Hammer ist freier Mitarbeiter der<br />
AutomobilKonstruktion<br />
Das Auto geht ans Netz – mit dem elektrischen<br />
Antrieb zwar nur zögerlich, dafür bereits<br />
heute mit aller Macht ins Internet. Eine<br />
Schnittstelle ins World Wide Web gehört heute<br />
bei Neuwagen zum guten Ton, Bosch bietet<br />
dafür sogar zwei Ansätze: Zum einen über das<br />
Smartphone des Fahrers, zum anderen mit der<br />
Connectivity-Control-Unit (CCU), einer Vernetzungshardware<br />
eher für gewerbliche Kunden.<br />
Die Smartphone-Lösung My Spin bindet sowohl<br />
Geräte mit Android- als auch iOS-Betriebssystem<br />
ins Infotainment des Fahrzeugs<br />
ein. Eine weitere Lösung für Windows-Mobiltelefone<br />
hat die Prototypenphase bereits erfolgreich<br />
durchlaufen. Vorteil ist, dass über diese<br />
Schnittstelle immer die neueste Smartphone-<br />
Generation in das Auto eingebunden ist, ohne<br />
dass der OEM großen technischen Aufwand<br />
betreiben und die extrem kurzen Entwicklungszyklen<br />
der Consumer Elektronik mitge-<br />
hen muss. Oder wie es Dr. Wolfgang Ziebart,<br />
Leiter technische Entwicklung bei Jaguar Land<br />
Rover, ausdrückt: „Wir koppeln den Teil des<br />
Infotainments, der sich schnell ändert, an die<br />
Smartphone-Industrie. Den Wettlauf mit den<br />
IT-Konzernen können sie nicht gewinnen. Im<br />
Fahrzeug hingegen realisieren wir nur die Basis-Funktionalität,<br />
die notwendig ist, wenn die<br />
Connectivity fehlt.“<br />
Vielfältige Kooperationen<br />
Nach dem Pilotkunden Jaguar Land Rover, der<br />
My Spin seit 2014 sukzessive in seine Flotte<br />
integriert, kommt 2016 in China die Marke JAC<br />
hinzu, 2017 Changan Ford. Ebenso wurde mit<br />
Tencent eine Kooperation angeschlossen, einem<br />
der größten chinesischen IT-Unternehmen<br />
für Musikservices und Kommunikations-<br />
Apps. Tencent wird für My Spin eine Auswahl<br />
seiner Kommunikationsangebote während der<br />
20 AutomobilKonstruktion 2/2016
ELEKTRONIK + SOFTWARE<br />
Autofahrer wollen die vom Smartphone<br />
gewohnte Vernetzung und den Zugriff<br />
auf Online-Musikdienste, soziale Netzwerke<br />
und Apps auch im Auto nutzen<br />
Bilder: Bosch<br />
Fahrt verfügbar machen. Der Fokus des My<br />
Spin-Angebots liegt aktuell vor allem auf Navigations-<br />
und Medienanwendungen. Bosch arbeitet<br />
dafür nicht nur mit bekannten Anbietern<br />
wie Tom Tom zusammen, sondern auch<br />
mit unbekannteren Start-Ups, die innovative<br />
Funktionen entwickeln. Auf dem Weg ist auch<br />
die Nutzung von Fahrzeugdaten in den Apps,<br />
etwa des Reifendrucks oder des Tankfüllstands.<br />
Bei letzterem wird dann beispielsweise<br />
die App eine Tankstelle empfehlen, sobald<br />
die Tankanzeige auf Reserve ist.<br />
Der Tencent-Deal zeigt auch die Entwicklungsrichtung<br />
auf, die Bosch mit My Spin einschlägt:<br />
immer mehr Anwendungen und diese<br />
an regionale Märkte angepasst. Aktuell ist<br />
man in Nordamerika, Europa, seit Ende 2015<br />
auch in Indien und China (insgesamt in 34<br />
Ländern) aktiv und führt im Portfolio etwa 50<br />
automobile Apps. Damit überflügelt man die<br />
Wettbewerber Android Auto (Google) und<br />
Apple Car Play, die zusammen weniger Apps<br />
anbieten und auch jeweils in weniger Ländern<br />
aktiv sind. 2017 will man zudem mit einer My<br />
Spin-Lösung für Motorräder in Serie gehen<br />
und diese sukzessive auf Roller und sogar<br />
E-Bikes ausweiten.<br />
Kontrolle behalten<br />
Den Erfolg gegen die eigentlich bekannteren<br />
Wettbewerber Android Auto und Apple Car<br />
Play führt Torsten Mlasko, Geschäftsführer der<br />
Bosch SoftTec GmbH, auf die eindeutigeren<br />
Rahmenbedingungen zurück: „My Spin ist<br />
stark an den Wünschen und Vorstellungen der<br />
OEM orientiert. So behalten sie mit einer White<br />
List die volle Kontrolle darüber, welche<br />
Apps sie den Kunden zur Verfügung stellen<br />
und wie deren Oberfläche aussieht – und was<br />
mit den verfügbaren Informationen passiert.“<br />
Analog hat der Autofahrer mit dem OEM einen<br />
Mit mySpin will<br />
Bosch eine einfach<br />
integrierbare und<br />
hardwareunabhängige<br />
Lösung für alle<br />
OEMs bieten<br />
Ansprechpartner für alle Fragen rund um seine<br />
Connectivity und muss sich in Sachen Datenschutz<br />
nicht noch zusätzlich mit einer „Datenkrake“<br />
wie Google beschäftigen. Was nur zwischen<br />
den Zeilen geäußert wird, ist das allgemeine<br />
Unbehagen über die Macht von IT-Konzernen<br />
wie Google oder Apple, an die man die<br />
Kontrolle über das automobile Infotainment<br />
und Datenmanagement auf keinen Fall verlieren<br />
möchte. Denn natürlich wollen die OEM<br />
und Zulieferer in eigener Verantwortung aus<br />
„Big Data“ die margenträchtigen Killerapplikationen<br />
und Services schürfen.<br />
In puncto Bediensicherheit entspricht My Spin<br />
nach Angaben von Mlasko den gängigen Guidelines.<br />
Die von Bosch ausgewählten und angepassten<br />
Apps lassen sich per Touchscreen<br />
in der Mittelkonsole bedienen. Gleichzeitig<br />
wird das Smartphone bei aktivem My Spin für<br />
die Dauer der Fahrt gesperrt, ebenso bleiben<br />
besonders ablenkende Icons im Touchscreen<br />
Auch Nutzer des<br />
Jaguar XE Bluefire<br />
können dank My<br />
Spin sicher auf<br />
ihre Smartphones<br />
zugreifen<br />
deaktiviert, und eine intelligente Informationsverdichtung<br />
mit Priorisierung der Informationen<br />
soll den Fahrer weniger ablenken.<br />
Eher für die Ansprüche von Flottenbetreibern<br />
mit Pkw und Nutzfahrzeugen, aber auch für Eisenbahnunternehmen,<br />
ist die CCU von Bosch<br />
gedacht. Diese fest im Fahrzeug installierte<br />
Hardware mit Mobilfunkmodul und eigener<br />
SIM-Karte wird über die OBD-Diagnoseschnittstelle<br />
mit dem Bordnetz des Fahrzeugs verbunden<br />
und ist für die Erstausrüstung wie<br />
auch zur Nachrüstung erhältlich. Sie bietet<br />
neben Navigation und Infotainment auch Flottenmanagement-,<br />
Wartungs-, Sicherheits- und<br />
Mautfunktionen an.<br />
Robert Bosch GmbH<br />
Tel.: +49 711 8110<br />
www.bosch.com<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 21
ELEKTRONIK + SOFTWARE<br />
Signalqualität statt Systemkomplexität<br />
Smart Antenna eröffnet neue Optionen für die Architektur von Infotainmentsystemen<br />
Reichhaltige Funktionsvielfalt: Die neue<br />
Smart Antenna von Hirschmann<br />
Bilder: Hirschmann<br />
Hirschmann will mit einer neuartigen<br />
Antenne die Infotainment-<br />
Struktur aufräumen. Dabei<br />
bekommt die Antenne neben dem<br />
Senden und Empfangen auch die<br />
Signalverarbeitung zugeteilt, was<br />
nicht nur weitere ECUs einspart.<br />
Der Autor: Steffen Lang, Product Management, Hirschmann<br />
Car Communication GmbH, Neckartenzlingen<br />
Autofahrer – egal welchen Alters – stehen<br />
beim Bedienen ihrer Infotainment- und Assistenzsysteme<br />
oftmals vor einer Herausforderung.<br />
Es ist zu beobachten, dass mit steigender<br />
Anzahl an Funktionen auch die Größe der<br />
Bildschirme zunimmt: In einem Tesla S zum<br />
Beispiel kann man die meisten Funktionen<br />
auf einem 17-Zoll Touchscreen steuern, so<br />
dass viele manuelle Schalter wegfallen. Das<br />
bringt zwar für die Insassen eine bessere<br />
Übersichtlichkeit mit sich, löst aber nicht das<br />
Problem der stetig wachsenden Komplexität<br />
der Fahrzeugelektronik im Hintergrund. Denn<br />
je mehr Funktionen verfügbar sein sollen,<br />
desto mehr Elektronik und elektronische Steuergeräte<br />
(ECU = Electronic Control Unit) sind<br />
notwendig. Die Head-Unit (HU) integriert bereits<br />
einige Funktionen. Die restlichen werden<br />
von Steuergeräten zur Verfügung gestellt, die<br />
über das gesamte Fahrzeug verteilt und miteinander<br />
vernetzt sind. Rund 50 verschiedene<br />
ECUs findet man derzeit in einem Mittelklassefahrzeug,<br />
bei Oberklassefahrzeugen mit einer<br />
größeren Anzahl von Assistenzsystemen<br />
sind sogar 80 bis 100 Geräte keine Ausnah-<br />
me. Entsprechend aufwändig ist die Gestaltung<br />
und Vernetzung dieser elektronischen Architekturen<br />
– zudem muss bei der Entwicklung<br />
neuer Fahrzeugmodelle berücksichtigt<br />
werden, dass neue „Smart Devices“ reibungslos<br />
integrierbar sind.<br />
Einen Ausweg aus diesem Komplexitäts-Dilemma<br />
bietet die Smart Antenna von Hirschmann<br />
Car Communication. Als Gegenentwurf<br />
zu bisherigen Infotainment-Systemarchitekturen<br />
basiert sie auf einer geänderten Partitionierung<br />
der Steuergeräte und deren Services<br />
im Fahrzeug, um die Wege im Auto so kurz wie<br />
möglich zu halten und Funkdienste an zentraler<br />
Stelle zu kapseln. Dazu vereint die Smart<br />
Antenna zwei Funktionsgruppen: zum einen<br />
die Sende- und Empfangstechnik, sprich Antennen<br />
plus ggf. Verstärker und zum anderen<br />
die elektronische Weiterverarbeitung der Signale.<br />
Einheit aus Tuner, Transceiver und Antennen<br />
Die Smart Antenna baut auf einer typischen<br />
Dachantenne im Haifischflossen-Design<br />
(Sharkfin) auf. Diese wird um ein elektronisches<br />
Steuergerät (ECU) erweitert, das sich<br />
unmittelbar unter der Dachantenne befindet<br />
und die empfangenen Signale von Diensten<br />
wie AM/FM/DAB Radio, Mobilfunk, GPS, Bluetooth<br />
oder digitalem TV direkt weiterverarbeitet.<br />
Das umfasst Tuning, Demodulation, Dekodierung<br />
von Daten und das Handling der unteren<br />
Schichten von Kommunikationsprotokollen.<br />
Mit diesem Aufbau bildet die Smart Antenna<br />
eine neue „Einheit“ aus Tuner, Transceiver<br />
und Antennen. Das reduziert – erstens – die<br />
Komplexität bei der Integration unterschiedlicher<br />
Funkdienste: Mobilfunkstandards (GSM,<br />
UMTS, LTE) und Navigationsdienste (GPS, Glonass,<br />
Galileo, BeiDou) werden mit Rundfunk<br />
(AM/FM, DAB, SiriusXM), Keyless Entry (Bluetooth<br />
LE) sowie Car-to-X (802.11p) an einer<br />
Stelle kombiniert und zentral aufbereitet.<br />
Über eine wohldefinierte Schnittstelle lässt<br />
22 AutomobilKonstruktion 2/2016
Haube<br />
Anschluss für externe Antennen<br />
Interne Antennen<br />
Steuergerät<br />
(Transceiver, Tuner)<br />
Stromversorgung, CAN etc.<br />
Ethernet/MOST<br />
Bluetooth Antenne<br />
Aufbau der Smart Antenna<br />
im<br />
Überblick<br />
Vergleich der Systeme: links die traditionelle<br />
Architektur, rechts die Architektur mit Smart<br />
Antenna<br />
sich nun die Gesamtheit dieser Funkdienste,<br />
von z.B. einer Head-Unit aus, bequem und<br />
einheitlich nutzen. Da nicht alle genannten<br />
Dienste stets in jedem Fahrzeug gefordert<br />
sind, wurde beim Design der Smart Antenna<br />
auf Skalierbarkeit geachtet. Somit sind viele<br />
Ausstattungs-Varianten mit ein und derselben<br />
Plattform realisierbar.<br />
Die Smart Antenna verringert – zweitens – die<br />
Distanzen, die analoge HF-Signale im Auto<br />
zwischen Antenne und Empfangsgerät zurücklegen.<br />
Das kommt den Fahrzeuginsassen<br />
beim Telefonieren, Radiohören, Navigieren<br />
oder Fernsehen zugute. Weniger Verluste auf<br />
kürzeren Leitungen und ggf. weniger HF-Steckverbindungen<br />
sorgen für einen besseren Signal-Rausch<br />
Abstand (S/N), was in Summe einen<br />
besseren Empfang ergibt. Die unmittelbare<br />
Signalverarbeitung und die Position am<br />
Fahrzeugdach sind dabei auch für den Empfang<br />
von GHz-Signalen für WLAN- und Bluetooth-Verbindungen<br />
ideal. Falls das Steuergerät<br />
und die Antenne nicht gemeinsam an einer<br />
Stelle am Dach montierbar sind – wie etwa<br />
bei Cabrios – lassen sich die Komponenten<br />
auch entkoppelt verbauen.<br />
Der Bauraum einer typischen Sharkfin-Antenne<br />
erlaubt nur die Unterbringung von kleineren<br />
Antennen mit wenigen Zentimetern Länge<br />
und damit nur den Empfang von bestimmen<br />
Frequenzbereichen. Daher stellt die Sharkfin-<br />
Antenne zwar den GNSS-, Telefon-, Bluetoothund<br />
Satelliten-Radio-Empfang sicher; die Antennen<br />
für den terrestrischen Radio- und TV-<br />
Empfang sind aufgrund ihrer Größe jedoch je<br />
nach verfügbaren Bauräumen an anderen<br />
Stellen im Fahrzeug untergebracht. Zum Beispiel<br />
befinden sich Rundfunk-Antennen oftmals<br />
in der nahegelegenen Heckscheibe. Die<br />
Zuführung dieser Antennen zur Smart Antenna<br />
ergibt in Summe das Smart Antenna System.<br />
Die Bündelung der Funktionen und die unmittelbare<br />
Signalverarbeitung sorgen – drittens –<br />
für Einsparungen bei der Verkabelung. Denn<br />
im Auto werden weniger Meter Koaxial-Kabel<br />
verwendet bzw. durch kostengünstigere und<br />
verlustfreie Ethernet-Kabel ersetzt. Insgesamt<br />
vermindert sich die Anzahl an Kabeln und unnötigen<br />
Schnittstellen im Auto, was die Montagezeiten<br />
in der Produktion reduzieren kann.<br />
Diese Systemarchitektur trägt maßgeblich dazu<br />
bei, die immense Komplexität von Head-<br />
Units zu reduzieren, zumal die Adaption neuer<br />
Technologien für Head-Units mit einem hohen<br />
Entwicklungsaufwand verbunden ist. Der Datentransfer<br />
von der Smart Antenna an die<br />
Head-Unit erfolgt nur noch über ein digitales<br />
Bussystem, wobei aktuelle Standards wie<br />
MOST150 oder Automotive Ethernet wahlweise<br />
unterstützt werden.<br />
Gerüstet für zukünftige Trends<br />
Mit dem Smart Antenna-Konzept können sich<br />
Automobilhersteller außerdem auf drei Trends<br />
vorbereiten. Insbesondere im GHz-Bereich<br />
stehen Entwicklungen an, für die die Smart<br />
Antenna-Architektur bereits durch die Unterbringung<br />
der Antennen auf dem Dach (= ideal<br />
für die Reichweite und Abstrahlung) und die<br />
unmittelbare Signalverarbeitung (= ideal für<br />
GHz-Signale) beste Voraussetzungen schafft.<br />
Den ersten Anwendungsfall stellt eine WLAN<br />
Verbindung „nach Außen“ (2,4 und 5 GHz)<br />
dar. So werden z.B. die Erwartungen der Kunden<br />
bzgl. Softwareupdates im Auto zunehmen<br />
und sich den Standards annähern, die bei der<br />
Aktualisierung von Smartphones üblich sind.<br />
Die Zeiten, in denen nur eine Autowerkstatt<br />
neue Software aufspielen konnte, werden<br />
bald der Vergangenheit angehören. Ein mögliches<br />
Szenario ist, dass sich das Auto über<br />
Nacht in das heimische Netzwerk einloggt und<br />
entsprechende Softwarepakete herunterlädt.<br />
Mit Hilfe von Bluetooth Low Energy (2,4 GHz)<br />
kann zukünftig das Smartphone die Funkfernbedienung<br />
ersetzen, so dass sich Autos per<br />
Bluetooth-Verbindung und entsprechender<br />
Verschlüsselung öffnen lassen. Auch weitere<br />
Funktionen sind hiermit möglich: die neue<br />
Mercedes E-Klasse verwendet für ihren „Remote-Park-Pilot“<br />
bereits eine Bluetooth-Verbindung<br />
zwischen Fahrzeug und Smartphone.<br />
Auch für diese Anwendung ist die Smart Antenna<br />
auf dem Dach optimal geeignet.<br />
Der dritte Trend ist die Car-to-X Kommunikation<br />
im Frequenzbereich von 5,9 GHz. Für die<br />
direkte Kommunikation der Fahrzeuge untereinander<br />
oder mit der Umgebung ist bereits<br />
der Funkstandard 802.11p spezifiziert. Dessen<br />
verpflichtende Einführung durch den Gesetzgeber<br />
wird derzeit in den USA diskutiert, was<br />
die Wahrscheinlichkeit auf serienmäßig ausgestattete<br />
Fahrzeuge mit 802.11p deutlich erhöht.<br />
Hirschmann Car Communication GmbH<br />
Tel.: +49 7127 14-1415<br />
oemsales@hirschmann-car.com<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 23
ELEKTRONIK + SOFTWARE<br />
Michael Bischoff, Bereichsleiter Batteriemanagement und E-Mobilität bei Preh<br />
„Leitmärkte liegen in Asien“<br />
Der deutsch-chinesische Zulieferer Preh hat Ende 2013<br />
seine Aktivitäten im Batteriemanagement und in der<br />
E-Mobilität in einem eigenen Geschäftsbereich<br />
gebündelt. Im Interview mit AutomobilKonstruktion<br />
erläutert Bereichsleiter Michael Bischoff das bisher<br />
Erreichte und die Zukunftsziele.<br />
Preh ist mit unterschiedlichen Produkten und Systemen<br />
in den Markt der E-Mobilität eingestiegen<br />
Bilder: Preh<br />
Automobil<br />
Konstruktion Welche Produkte bietet Preh für<br />
elektrisch angetriebene Automobile an?<br />
Preh liefert Steuergeräte für das Batteriemanagement<br />
(BMS). Unsere jüngste Entwicklung<br />
ist eine Battery Control Unit (BCU), bestehend<br />
aus einem Steuergerät, einem hochgenauen<br />
Stromsensor und weiteren Komponenten.<br />
Steuergerät und Stromsensor sind selbstverständlich<br />
auch separat einsetzbar.<br />
Das Interview führte Jürgen Goroncy,<br />
freier Mitarbeiter der AutomobilKonstruktion<br />
„Mittelfristig rechnen<br />
wir damit, dass durch<br />
die CO 2 -Gesetzgebung<br />
das Thema Elektromobilität<br />
gegen Ende des<br />
Jahrzehnts einen neuen<br />
Schub bekommen wird“<br />
Michael Bischoff, Bereichsleiter der<br />
E-Mobility-Sparte von Preh<br />
Automobil<br />
Konstruktion Welche Vorteile bietet der Stromsensor<br />
im Vergleich zum Wettbewerb?<br />
Unser Stromsensor ist in zwei Genauigkeitsklassen<br />
verfügbar – Standard und hochgenau.<br />
Letzterer erfüllt höchste Anforderungen und<br />
bietet damit eine sehr präzise Vorhersage<br />
über die Restreichweite eines batteriegetriebenen<br />
Fahrzeugs. Das nach ASIL C-Standard<br />
konzipierte Sensorsystem erreicht bei 0,1 Prozent<br />
Anfangskalibrierung noch nach zehn Jahren<br />
eine Messgenauigkeit von 0,35 Prozent.<br />
Damit misst der Preh-Sensor um den Faktor<br />
vier genauer als bisherige Systeme. Zusammen<br />
mit seiner Eignung für bis zu 400 Volt<br />
Systemspannung und Dauerströmen von bis<br />
zu 500 Ampere steht er mit an der Spitze ver-<br />
gleichbarer Produkte für Pkw. Die Nutzfahrzeugvariante<br />
ist sogar für Spannungen bis<br />
800 Volt geeignet.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Wie sieht es mit Alleinstellungsmerkmalen<br />
bei den BCUs aus?<br />
Unsere BCU umfasst nicht nur das Steuergerät<br />
für das Batteriemanagement und den Stromsensor:<br />
Zusätzlich sind noch ein Vorladewiderstand,<br />
ein Vorladerelais und zwei Hochvoltrelais<br />
integriert. Um den Ansprüchen an funktionale<br />
Sicherheit zu genügen, erfüllt die BCU<br />
die ISO 26262-Spezifikationen auf ASIL C-Level.<br />
Hier sehe ich einen gewissen Vorsprung<br />
für unsere Lösung im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten.<br />
Die BCU sorgt für eine allpolige<br />
Trennung der Lithium-Ionen-Batterie vom<br />
Fahrzeug. Je ein Relais im positiven und negativen<br />
Pfad sorgt für die Trennung. Die BCU ist<br />
ebenfalls für Batteriespannungen bis 400 Volt<br />
und Spitzenströme von 500 Ampere ausgelegt.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Seit wann ist Preh in diesem<br />
Segment aktiv, und an welche Kunden liefern<br />
Sie schon?<br />
Wir haben 2008 mit diesen Aktivitäten angefangen<br />
und liefern derzeit die Steuergeräte<br />
des Batteriemanagements für die Elektromodelle<br />
BMW i3 und BMW i8 sowie für verschiedene<br />
BMW-Modelle mit Active-Hybrid-Antrieb.<br />
Hinzu kommen einige Entwicklungsprojekte<br />
für Kunden, die ich noch nicht nennen darf.<br />
24 AutomobilKonstruktion 2/2016
Unsere Produkte für das Batteriemanagement<br />
bieten wir sowohl in einer 48-Volt-Version als<br />
auch für Hochvolt-Applikationen an. Im Frühjahr<br />
2015 haben wir zum Beispiel einen Auftrag<br />
für die Serienentwicklung eines 48-Volt-<br />
BMS unterzeichnet.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Können Sie schon etwas über<br />
Umsätze und eventuell Gewinne sagen?<br />
Über Umsätze und Gewinne wollen wir nichts<br />
sagen. Die bisherige Geschäftsentwicklung<br />
lässt sich indirekt über die Mitarbeiterzahlen<br />
ablesen. 2013 haben sich bei Preh vielleicht<br />
30 Mitarbeiter in Bad Neustadt um die Themen<br />
Batteriemanagement und E-Mobilität gekümmert,<br />
gut zwei Jahre später sind wir schon<br />
75 Personen weltweit in diesem Geschäftsbereich.<br />
Mittelfristig rechnen wir damit, dass<br />
durch die CO 2 -Gesetzgebung das Thema Elektromobilität<br />
gegen Ende des Jahrzehnts einen<br />
neuen Schub bekommen wird.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Sehen Sie Pkw und Lkw als<br />
einzigen Markt oder könnten Sie sich Ihre<br />
Produkte auch in Off-Road Fahrzeugen oder<br />
ganz woanders vorstellen?<br />
Natürlich. Beispielsweise sind Hubwagen und<br />
Gabelstapler häufig mit einem batterieelektrischen<br />
Antrieb ausgerüstet. Damit passen diese<br />
Flurförderfahrzeuge genau in das Einsatzprofil<br />
unseres Batteriemanagements. Daneben<br />
bieten sich auch stationäre Anwendungen<br />
für Batteriespeicher von Photovoltaikan-<br />
lagen oder für größere Pufferspeicher von<br />
Energieversorgern an.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Haben Sie bereits Vorstellungen,<br />
wie sich diese Anwendungsmöglichkeiten Ende<br />
des Jahrzehnts in der Umsatzverteilung des<br />
Geschäftsbereichs niederschlagen könnten?<br />
Den Löwenanteil des Gesamtumsatzes werden<br />
wir sicher mit Automotive-Anwendungen<br />
verdienen.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Wo sehen Sie die Leitmärkte für<br />
die Elektromobilität?<br />
Das werden zunächst China und generell<br />
Asien sein, da dort viele Megacities nach neuen<br />
Mobilitätslösungen suchen. Das Gleiche<br />
gilt für einige amerikanische Millionenstädte.<br />
Allerdings sollte man europäische Metropolen<br />
nicht vergessen, die zwecks Luftreinhaltung<br />
ebenfalls auf lokal emissionsfreie Mobilität<br />
angewiesen sind.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Wie könnten Sie von Europa aus<br />
einen stark boomenden chinesischen Markt<br />
bedienen?<br />
Mit unserem chinesischen Investor und Produktionskapazitäten<br />
in China werden wir in<br />
China quasi als chinesisches Unternehmen<br />
betrachtet. Die Produktion vor Ort umfasst die<br />
komplette Wertschöpfungskette. Von daher<br />
sind wir dort bereits gut aufgestellt, vernetzt<br />
und können somit auf neue Situationen rasch<br />
reagieren.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Und was ist mit den anderen<br />
Märkten?<br />
Kunden wie BMW und andere in Europa bedienen<br />
wir von Bad Neustadt aus.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Wie schätzen Sie den deutschen<br />
Markt für E-Mobilität ein?<br />
Es gibt ja jetzt Absichtserklärungen der Bundesregierung,<br />
die E-Mobilität in Deutschland<br />
weit stärker zu fördern als bisher. Ob das Angedachte<br />
wirklich ausreicht, wird sich zeigen.<br />
Andererseits sehe ich im Markt gewisse Anzeichen,<br />
dass Elektrofahrzeuge bald auf der<br />
Straße und im Gebrauchtmarkt präsenter werden<br />
und dadurch eher Begehrlichkeiten bei<br />
ökologisch interessierten Kunden wecken<br />
könnten.<br />
Automobil<br />
Konstruktion<br />
www.preh.de<br />
Vielen Dank für das Gespräch.<br />
Zur Person<br />
Michael Bischoff studierte Elektrotechnik an der<br />
Universität Kaiserslautern. Danach wechselte er in<br />
die Entwicklung von Steuergeräten für Airbags zu<br />
Siemens nach Regensburg, später zu Conti Temic nach<br />
Ingolstadt. Nach weiteren Stationen bei Magna und<br />
Takata übernahm er im November 2013 die Bereichsleitung<br />
der E-Mobility-Sparte von Preh.<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 25
ELEKTRONIK + SOFTWARE<br />
Reduzierte Durchlaufzeiten und Komplexität<br />
Etas bringt neue Ascet-Version in Eclipse auf den Markt<br />
Die Eclipse-<br />
basierte integrier-<br />
te<br />
Entwicklungs-<br />
umgebung von<br />
Ascet V7<br />
Bilder: Etas GmbH<br />
Toolketten im Automotive-Bereich<br />
bestehen aus einer großen Anzahl<br />
von Einzeltools. Diese Tools müssen<br />
aufeinander abgestimmt werden,<br />
was die Hersteller der einzelnen<br />
Tools sowie die Verantwortlichen<br />
und Benutzer der Toolkette vor eine<br />
große Herausforderung stellt.<br />
Zudem müssen die finalen Steuergeräte<br />
im Verbund getestet werden,<br />
was neue Konzepte für flexible<br />
Hardware-in-the-Loop-Tests<br />
vernetzter Steuergeräte erfordert.<br />
OEMs, Tier 1s und Dienstleister nutzen diese<br />
Tools gemeinsam. Ein erheblicher zeitlicher<br />
und finanzieller Aufwand entsteht durch die<br />
projektbezogene Anpassung der Toollandschaft.<br />
Daneben sind OEMs und Tier 1s zwei<br />
weiteren großen Herausforderungen ausgesetzt.<br />
Zum einen dem steigenden Kunden-<br />
druck, Entwicklungszyklen für neue Funktionen<br />
zu verkürzen. Zum anderen erwarten Kunden,<br />
dass Aktualisierungen neuer Funktionen,<br />
die zum überwiegenden Teil über Software<br />
realisiert werden, auch für Funktionen in ihrem<br />
Fahrzeug eingesetzt werden – analog zu<br />
mobilen Geräten.<br />
Zudem ist eine standardisierte und weitgehend<br />
automatisierte Toolkette gefragt, die<br />
„Reibungsverluste“ minimiert und die bei sicherheitskritischen<br />
Funktionen die notwendige<br />
Zertifizierung erleichtert (ISO26262/IEC<br />
61508). Genau hier setzt Etas mit einer durchgängigen<br />
und automatisierten Lösung an und<br />
bringt mit Ascet V7 eine neue Version auf den<br />
Markt, die auf der quelloffenen Plattform<br />
Eclipse basiert.<br />
Durchgängig von der Idee zum fertigen Code<br />
Oft arbeiten Funktions- und Softwareentwickler<br />
in unterschiedlichen Abteilungen oder sogar<br />
in verschiedenen Unternehmen und Ländern.<br />
Eine durchgängige Toolkette fördert<br />
hierbei eine effiziente und transparente Zusammenarbeit<br />
und unterstützt sowohl im Rahmen<br />
der Entwicklung neuer als auch bei der<br />
Erweiterung existierender Funktionen das<br />
ideale Zusammenspiel unterschiedlicher Experten.<br />
Die Entwicklung beginnt oft beim Funktionsentwickler,<br />
der anhand physikalischer Formeln<br />
und Tools das zu entwickelnde System<br />
beschreibt. Zur Überprüfung sollte das resultierende<br />
Modell jederzeit simuliert werden<br />
können. Je nach gewünschter Testtiefe werden<br />
Tools wie Isolar-Eve (PC-basierte Tests) oder<br />
Intecrio (Rapid Prototyping) verwendet. Beim<br />
nächsten Schritt, der Erstellung von Steuergerätecode,<br />
nehmen Ascet-Coderund Isolar A<br />
(für Autosar ECUs) dem Softwareentwickler<br />
viele arbeitsintensive Aufgaben ab, wie z. B.<br />
die automatische Erzeugung von sicherem<br />
C-Code. Für umfangreiche Tests sowie für die<br />
Kalibrierung der Funktion im Steuergerät können<br />
die Inca-Produkte zum Einsatz kommen.<br />
Zusätzlich zu der eigentlichen Tätigkeit der<br />
Funktionsentwicklung müssen weitere Aufgaben<br />
erfüllt werden. Diese Aufgaben sind unter<br />
anderem: Testen, Visualisieren, Simulieren,<br />
Entwickeln von Testumgebungen, Dokumentieren,<br />
Verwalten von Versionen, Zertifizieren<br />
und Berichtswesen. Auch hierfür bietet das<br />
Etas-Portfolio geeignete Tools, die sich leicht<br />
in die Kunden-Toolkette integrieren lassen.<br />
26 AutomobilKonstruktion 2/2016
Drei Busse verbinden die HiL-Systeme<br />
zum Network-Labcar<br />
Die standardisierten Schnittstellen von Network-Labcar<br />
ermöglichen Flexibilität und sparen Kosten<br />
Skalierbarer Steuergeräteverbund in-the-Loop<br />
Um den steigenden Testaufwand trotz kürzerer<br />
Entwicklungszyklen zeitlich bewältigen zu<br />
können und die Kostenkontrolle langfristig zu<br />
behalten, beginnen Softwaretests mittlerweile<br />
lange, bevor Testfahrzeuge bereitstehen. Ein<br />
Schlüssel dazu: Hardware-in-the-Loop(HiL)-<br />
Tests. Etas hat die Möglichkeiten dieser virtuellen<br />
Erprobung in den letzten Jahren kontinuierlich<br />
ausgeweitet – auch über das einzelne<br />
Steuergerät hinaus: Network-Labcar ist eine<br />
Lösung, um hochgradig vernetzte Steuergeräteverbunde<br />
in-the-Loop zu testen.<br />
Verknüpfung von Komponenten zum Netzwerk-HiL<br />
Gerade komplexe Funktionen im Fahrzeug, ob<br />
hybride Antriebe, adaptive Fahrwerke oder aktive<br />
Sicherheitssysteme, greifen immer häufiger<br />
auf mehrere Steuergeräte zu. Etas bietet<br />
die Möglichkeit, einzelne Steuergeräte bzw.<br />
Cluster der beteiligten ECUs oder, wann immer<br />
nötig, auch das gesamte Netzwerk eines<br />
Fahrzeugs zu testen. Die Daten dazu werden<br />
zeitlich synchronisiert per Gigabit-Ethernet in<br />
Echtzeit zwischen den Komponenten-HiLs<br />
übertragen. Das ist die zwingende Voraussetzung,<br />
um das komplexe Zusammenspiel der<br />
ECUs realitätsnah zu testen. Gewährleistet<br />
wird sie durch einen Systemaufbau mit drei<br />
getrennten Netzwerk-Bussen, denen jeweils<br />
spezifische Aufgaben zukommen: Ein Bus ist<br />
für den Datenaustausch mit einem Host-PC reserviert,<br />
auf dem die Labcar-Bedien- und Automatisierungssoftware<br />
läuft. Ein zweiter<br />
sorgt für die zeitliche Synchronisation der jeweils<br />
integrierten Komponenten-HiLs. Und ein<br />
dritter Bus gewährleistet die Echtzeit-Kommunikation<br />
im Netzwerk.<br />
Die Basis der neuen Network-Labcar-Lösung<br />
bilden die jeweils neueste Version der Labcar-<br />
Operator-Software und des Simulationstargets<br />
Labcar-RTPC (Real-Time-PC). In dem neuen<br />
Etas-System kann eine beliebige Anzahl<br />
von RTPCs integriert werden.<br />
Flexibles, modulares Konzept<br />
Die Verbindung von leistungsstarken Simulationstargets,<br />
Echtzeit-Kommunikation und der<br />
zeitlichen Synchronisation einer skalierbaren<br />
Anzahl domänenspezifischer HiLs über das<br />
Precision Time Protocol (PTP) gemäß<br />
IEEE1588-Standard verschafft Entwicklungs -<br />
abteilungen hohe Flexibilität. Sie können einfach<br />
das Netzwerk-HiL nach und nach beliebig<br />
erweitern, lediglich durch das Zusammenführen<br />
einzelner Komponenten-HiLs, und sich so<br />
der wachsenden Systemkomplexität annähern.<br />
Der konsequent modulare Ansatz erlaubt<br />
es auch, dass Anwender jederzeit aus<br />
dem Gesamtnetzwerk in die Einzelbetrachtung<br />
der jeweils angebundenen Komponenten-HiLs<br />
wechseln können. Sie können bereits<br />
getestete Software aus anderen Projekten<br />
oder frühere Softwarestände ihres Projekts<br />
einbinden. Diese Option des „schwimmenden<br />
Übergangs“ ist im Markt einzigartig.<br />
Volle Kostenkontrolle<br />
Der Einsatz von standardisierter, im Automotive-Umfeld<br />
bewährter Technik und der konsequente<br />
Fokus auf Skalierbarkeit machen Network-Labcar<br />
zu einer zukunftssicheren Lösung,<br />
die stets passende Antworten auf die<br />
wachsende Komplex ität vernetzter Fahrzeuge<br />
findet. Nicht nur die Komplexität bleibt dadurch<br />
beherrschbar, sondern auch die Entwicklungskosten.<br />
Einerseits können virtualisierte<br />
Tests parallel an unterschiedlichen Orten<br />
im 24/7-Betrieb durch geführt werden.<br />
Zum anderen wird die Korrektur von Softwarefehlern<br />
mit jedem Schritt in Richtung Produktionsstart<br />
teurer. Je realitätsnaher frühzeitige<br />
Softwaretests durchgeführt werden, desto geringer<br />
ist die Wahrscheinlichkeit, in späten<br />
Entwicklungsstadien Fehler zu finden, die<br />
dann sehr zeit- und kosten intensiv zu beheben<br />
wären. Darüber hinaus arbeitet Etas konsequent<br />
daran, für den Kunden die günstigste<br />
Lösung zu entwickeln. So lassen sich nun<br />
beim Aufsetzen der Netzwerk-HiLs Standard-<br />
Ethernet-Switches statt teurer Shared-Memory-Karten<br />
nutzen – ohne Leistungseinbußen<br />
bei der HiL-Simulation.<br />
ETAS GmbH<br />
Telefon +49 711 3423–2240<br />
anja.krahl@etas.com<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 27
ELEKTRONIK + SOFTWARE<br />
Universelle Slave-Bausteine senken Systemkosten und Platzbedarf<br />
Kostenoptimierte LIN-Controller-ICs<br />
Melexis erweitert sein Angebot an<br />
ICs und Board-Level-Produkten<br />
für LIN-Anwendungen um die<br />
Bausteine MLX81107/MLX81109.<br />
Sie bieten einen Physical Layer<br />
LIN Transceiver, LIN Controller,<br />
Spannungsregler, 16-Bit-RISC-Mikrocontroller,<br />
32 KByte Flash-<br />
Speicher, einen 20-Kanal<br />
A/D-Wandler und eine 16-Bit-<br />
PWM-Funktion (Pulsweitenmodulation).<br />
Der LIN-Protokoll-Handler<br />
entspricht den Standards LIN 2.0,<br />
2.1 und 2.2 sowie SAE J2602. Die<br />
ICs bieten vier High-Voltage-fähige<br />
(12V-Direkt) I/Os, sowie acht<br />
Low-Voltage-fähige (5V) I/Os. Jeder<br />
I/O lässt sich programmieren,<br />
um die Anwendungskomponenten<br />
über den integrierten Flash-<br />
Speicher anzusteuern.<br />
Der hohe Integrationsgrad des<br />
MLX81107/9 soll die Kosten für<br />
die Stückliste und verringern und<br />
für Platzeinsparung auf der Leiterplatte<br />
sorgen (5 x 5 mm QFN-Gehäuse).<br />
Die Kombination des LIN-<br />
Controllers und LIN-Treibers mit<br />
direkt angesteuerten High/Low-<br />
Voltage-fähigen I/Os bedeutet<br />
laut Melexis, dass sich LIN<br />
schnell umsetzen lässt. Der Betriebstemperaturbereich<br />
beträgt<br />
-40 bis +125 °C. Hinzu kommen<br />
eine Abschaltung bei Übertemperatur<br />
und Schutz bei Load Dumps<br />
(40 V).<br />
www.melexis.com<br />
Für wirtschaftliche Prototypen und mittlere Serien<br />
Kabelverbindungssysteme nach Maß<br />
Die Hellwig A.S.E,<br />
Sprockhövel, entwickelt<br />
und produziert<br />
kundenspezifische Kabelverbindungen.<br />
Die<br />
Maschinen und Anlagen<br />
des Unternehmens<br />
sind speziell für die<br />
Entwicklung und Produktion<br />
kleiner und<br />
mittlerer Serien ausgelegt, so<br />
dass Kunden keinen Maschinenpark<br />
mitfinanzieren müssen, der<br />
„Luxus“ wäre. Die Maßanfertigungen<br />
reichen von der Standardlösung<br />
bis zum Hightech-System.<br />
Die markt- und anwendungsgerechten<br />
elektrischen Verbindungen<br />
sollen höchste Qualitätsansprüche<br />
erfüllen und den Umweltanforderungen<br />
entsprechen. Zertifizierungen<br />
nach DIN EN ISO<br />
9001 und DIN EN ISO 14001, moderne<br />
Produktionseinrichtungen<br />
und eine Vielzahl von Isolationsund<br />
Leiterwerkstoffen sorgen für<br />
eine große Flexibilität in der Anfertigung<br />
individueller Lösungen.<br />
Je nach Einsatzzweck werden<br />
Kupfer- oder legierte Leiter, Fluorwerkstoffe,<br />
thermoplastische<br />
Materialien oder Faserwerkstoffe<br />
eingesetzt. Die Montage und<br />
Anspritzung verschiedenster<br />
Steckverbinder an diverse Kabeltypen<br />
erfolgt in fast allen Längenmaßen.<br />
www.hellwig-ase.de<br />
Neuheiten bei Ipetronik<br />
Akustik-Messungen und kabellose Datenübermittlung<br />
Die neuste Version der Messsoftware<br />
IPEmotion von Ipetronik ermöglicht<br />
jetzt auch die Analyse<br />
von akustischen Signalen und Vibrationen<br />
mit dem Campbell-Diagramm.<br />
Als entsprechende Hardwareplattform<br />
dient das vierkanalige<br />
Messmodul Mx-Sens2 4, das<br />
durch eine Kanalabtastrate von<br />
bis zu 100 kHz prädestiniert ist<br />
zur Erfassung dynamischer Messsignale,<br />
beispielsweise von ICPgespeisten<br />
Mikrofonen und Beschleunigungsaufnehmern.<br />
Analoge<br />
Messgrößen, Schallmessungen<br />
und Bauteilschwingungen<br />
können in IPEmotion synchron<br />
mit digitalen Messgrößen aus<br />
den Fahrzeug-Steuergeräten über<br />
CAN-Bus-, FlexRay- und LIN-Bus-<br />
Netzwerke aufgezeichnet werden.<br />
Der Datenlogger M-Log V3 wird<br />
nun mit dem neuen Hardware-<br />
Modul COMgate V3 als Erweiterung<br />
zur kabellosen Datenübermittlung<br />
angeboten. Das COMgate<br />
V3 ermöglicht laut Hersteller eine<br />
schnelle, sichere und komfortable<br />
Datenfernübertragung mit<br />
4G- bzw. LTE-Geschwindigkeit.<br />
Durch die zweite Gigabit-Ethernet-Schnittstelle<br />
am COMgate V3<br />
hat der Anwender nun die Möglichkeit,<br />
das Gesamtsystem aus<br />
Datenlogger und COMgate über<br />
die Software IPEmotion zu konfigurieren.<br />
Mit dem neuen Treiber IPEaddon<br />
Inca 5 lassen sich Messmodule<br />
auf Basis von CAN-Bus und XCPonETH-Protokollen<br />
über die BOAund<br />
OHI-Schnittstelle von Inca<br />
einbinden und mit der Etas-Software<br />
konfigurieren. Damit können<br />
beispielsweise zeitsynchron zu<br />
den Messdaten vom Steuergerät<br />
analoge Messdaten über die ETK-<br />
Schnittstelle erfasst werden.<br />
www.ipetronik.com<br />
Gewicht und Bauraum sparen<br />
Bordnetz der Zukunft<br />
Die Dräxlmaier Group hat in ihrem<br />
Versuchsfahrzeug Smart KSK das<br />
gesamte 12 Volt-Versorgungsnetzwerk<br />
durch eine Backbone-Struktur<br />
ersetzt. Mit dieser dreilagigen<br />
Multischiene sparen die Entwickler<br />
nicht nur Gewicht und Bauraum,<br />
auch die Stabilität des<br />
Bordnetzes soll erhöht werden.<br />
So führe ihr Sandwich-Aufbau annähernd<br />
zu einer EMV-Feldauslöschung.<br />
Die Anbindung erfolgt<br />
über Schweiß-, Schraub- sowie<br />
Steckkontakte. Damit wird eine<br />
Multi-Drop-Fähigkeit realisiert,<br />
die eine dezentrale Anbindung<br />
der einzelnen Stromverteiler ermöglicht.<br />
Die Auslegung des Leitungssatzes<br />
ist dadurch optimiert<br />
und ermöglicht im Durchschnitt<br />
um einen Meter kürzere Versorgungsleitungen.<br />
Die zweite wesentliche Innovation<br />
des Versuchsfahrzeugs sind<br />
die sieben vollelektronischen<br />
Stromverteiler. Sie sind baugleich<br />
und unterscheiden sich lediglich<br />
in ihrer Konfiguration bezüglich<br />
der verschiedenen Lastpfade. Eine<br />
genaue Analyse der einzelnen<br />
Lastprofile der angebundenen<br />
Funktionen ermöglicht eine Optimierung,<br />
im Durchschnitt sinkt<br />
der Leitungsquerschnitt um die<br />
Hälfte.<br />
www.draexlmaier.com<br />
28 AutomobilKonstruktion 2/2016
Konfigurationsaufwand bei Radkraftmessung<br />
Steuereinheit KiRoad Performance<br />
Mit der KiRoad Performance bringt Kistler eine<br />
benutzerfreundliche, smart konfigurierbare<br />
und bedienbare Steuereinheit auf den Markt.<br />
Beim Systemstart liest die KiRoad Performance<br />
die individuellen Kenndaten der einzelnen<br />
RoaDyn-Radkraftsensoren ein. Dabei<br />
erkennt sie automatisch, welcher Sensor an<br />
welchem Eingang angeschlossen ist. Mit der<br />
KiCenter Software können sämtliche Einstellungen<br />
über ein Mobile-Device gesteuert werden.<br />
Die KiRoad Performance übernimmt nicht<br />
nur die Energieversorgung aller Radkraftsensoren,<br />
sondern bereitet die Rohsignale der<br />
Messzellen übersprech- und hebelarmkompensiert<br />
auf. Diese Daten stellt sie in digitaler<br />
und analoger Form zur Verfügung.<br />
Die KiRoad Performance ist speziell ausgerichtet<br />
auf begrenzte Platzverhältnisse (199 x<br />
182 x 127 mm). Sie ist flexibel skalierbar und<br />
unterstützt Messungen mit einem bis maximal<br />
vier Radkraftsensoren. Darüber hinaus ist eine<br />
synchrone Kaskadierung mehrerer KiRoad<br />
Performance Einheiten möglich. Zahlreiche digitale<br />
sowie analoge Schnittstellen ermöglichen<br />
eine flexible Datenausgabe. Über zusätzliche<br />
analoge Sensoreingänge (zwei Kanäle<br />
pro Radkraftsensor) können weitere Sensoren,<br />
z. B. Winkelkorrektur- oder Beschleunigungssensoren,<br />
angeschlossen werden. Das<br />
erlaubt eine zeitsynchrone Erfassung zusätzlicher<br />
Messgrößen.<br />
www.kistler.com<br />
Höhere Datenraten für die Automotive-Sparte<br />
Neue CAN-FD-Karten<br />
Das CAN-FD-Protocol ist inzwischen<br />
internationaler ISO 11898-1 Standard.<br />
Janz Tec bietet für diesen Data<br />
Link Layer neue CAN-Produkte.<br />
Neben den bereits vielfach eingesetzten<br />
passiven CAN-Adapterkarten<br />
und Embedded-PC-Systemen<br />
mit integrierter CAN-Schnittstelle<br />
gibt es jetzt zwei neue CAN-FD-fähige<br />
aktive Karten: CAN-PCIH/FD und<br />
CAN-PMC/FD.<br />
Hier kommen ARM-basierte Prozessoren<br />
mit einem direkt angeschlossenen<br />
FPGA zum Einsatz. Das garantiere<br />
laut Hersteller eine optimale<br />
Performance zwischen der Firmware,<br />
die auf dem ARM-Kern läuft<br />
und dem CAN-FD-fähigen IP Core,<br />
welcher im FPGA abgearbeitet wird.<br />
Beide Karten sind in Versionen mit<br />
zwei und vier Kanälen verfügbar.<br />
www.janztec.com<br />
Mikrocontroller<br />
Sicherheit für intelligentere Fahrzeuge<br />
STMicroelectronics hat die ersten Mikroprozessoren<br />
seiner SPC57-Familie vorgestellt.<br />
Basierend auf der 32-Bit-Plattform SPC5,<br />
zielt die neue Produktfamilie auf kostensensible<br />
Automotive-Systeme, die höchste Sicherheitsanforderungen<br />
bis zum höchsten<br />
Automotive Safety Integrity Level ASIL-D gemäß<br />
ISO 26262 erfüllen müssen. Fehler<br />
können beispielsweise bereits<br />
entstehen,<br />
wenn ein einziges<br />
kosmisches<br />
Strahlungsteilchen<br />
den Status eines<br />
Bits in einer Speicherzelle<br />
verändert.<br />
Bei den neuen Mikrocontrollern<br />
handelt es sich um System-on-<br />
Chip-Bausteine (SoCs), die für kritische Applikationen<br />
konzipiert sind, etwa Airbags,<br />
ABS-Anlagen, Servolenkungen sowie Gleichspannungswandler<br />
und Wechselrichter für<br />
Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Die QFP-Gehäuse<br />
in Exposed-Pad-Bauweise sind für<br />
mehr Anwender-Pins ausgelegt und für<br />
thermisch anspruchsvolle Anwendungen<br />
geeignet.<br />
www.st.com<br />
6<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 29
CAD + SIMULATION<br />
Der Clay bleibt – noch<br />
Designwelt im Umbruch: Trotz digitaler 3D-Visualisierung sind Claymodelle unerlässlich<br />
Die roten Vorderreifen sind eine<br />
Reminiszenz an das zu seiner Zeit<br />
ebenfalls avantgardistische Opel-<br />
Motorrad Motoclub 500, das schon<br />
1928 auf zwei roten Reifen rollte<br />
Bild: Opel<br />
Wir haben uns mit den Designspezialisten<br />
des Opel GT Concept<br />
und des Porsche Mission E darüber<br />
unterhalten, wie wichtig Claymodelle<br />
in Zeiten von 3D-Animation und<br />
Virtual Reality noch sind. Zudem<br />
haben wir hinterfragt, wie Concept<br />
Cars eine Marke weiterbringen.<br />
Die Interviews führte Tobias Meyer, freier Mitarbeiter<br />
der AutomobilKonstruktion<br />
Christian Braun, Manager Visualization Style<br />
erklärt, wie bei Porsche ein Entwurf zum fertigen<br />
Wagen wird: „Wir entwickeln bei Porsche<br />
das Design der Fahrzeuge in unserem Designdepartment.<br />
Die Designer kennen das<br />
Fahrzeug sehr genau von der Proportion bis<br />
hin zum kleinsten Detail. Um dies digital zu<br />
unterstützen, nutzen wir Tools von Autodesk.<br />
Schon in der ganz frühen Phase des Designs<br />
visualisieren wir vieles in Vred, um erste Ideen<br />
zu zeigen. Von mehreren Entwürfen fallen<br />
dann einige in den ersten Entscheidungsrunden<br />
weg, aus einigen Entwürfen werden Details<br />
in die übrig gebliebenen Konzepte übernommen.<br />
Aus den vielen Anfangsideen läuft<br />
dann langsam – wie in einem Trichter – alles<br />
auf das finale Konzept zu.<br />
Relativ bald kommt dann die Strak-Abteilung<br />
dazu, sie erzeugt die Oberflächen in höchster<br />
Qualität, Rundungen und Kanten erscheinen<br />
dann perfekt. Für die Strak Abteilung visualisieren<br />
wir in Dienstleistung, soweit ich weiß<br />
ist das in der Industrie einzigartig. Diese Daten<br />
übernehmen wir ebenfalls sofort in unsere<br />
CAD-Datei. Lichtberechnungen und andere Effekte<br />
können nun perfekt visualisiert werden,<br />
was für uns ein riesiger Benefit ist. Später<br />
werden aus dieser Datei auch die Werkzeuge<br />
für die Produktion gefräst.<br />
Künftig wollen wir diese Daten auch im HMI<br />
des Autos nutzen, etwa indem wir den Wagen<br />
als 3D-Ansicht auf einem Display im Armaturenbrett<br />
zeigen und der Fahrer durch antippen<br />
eines bestimmten Bereiches z.B. den Heckspoiler<br />
ausfahren kann. Hier können wir dann<br />
exakt das Modell abbilden, das sich der Kunde<br />
selbst konfiguriert hat. Das klingt trivial, ist<br />
aber sehr umfangreich, da wir hier mit einem<br />
100% korrekten Modell des Fahrzeuges arbeiten<br />
können. Würden sie für die Displays neue<br />
3D-Modelle generieren, müssten sie diese<br />
erst wieder prüfen und in allen Details auf Kor-<br />
rektheit absichern. Das Problem ist aktuell<br />
noch, dass die Originalmodelle mit 20 bis 30<br />
Millionen Polygonen zu schwer sind – wir sind<br />
aktuell aber schon mit Autodesk im Gespräch,<br />
wie wir die Verwendung unseres Datensatzes<br />
dafür realisieren können. Entscheidend wird<br />
hier sein, einen Toleranz-Standard zu definieren,<br />
wie weit wir das Modell reduzieren: Was<br />
lassen wir weg, was muss bleiben.<br />
Ebenso vorstellbar wäre die Verwendung der<br />
Daten in einem virtuellen Konfigurator, der<br />
vom Kunden im Händler-Showroom via<br />
3D-Brille „betreten“ wird. Dort kann er sich<br />
seinen Wagen exakt so zusammenstellen und<br />
die Ergebnisse von Farbe bis Lederart sofort<br />
einschätzen.<br />
Boris Jacob ist Chief Exterior Designer bei<br />
Opel und braucht nach wie vor handgefertigte<br />
Modelle, auch wenn im virtuellen Raum inzwischen<br />
beinahe alles wie echt aussieht:<br />
„Ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit des<br />
Clays: Als ein Kollege das Modell des neuen<br />
GT zum ersten Mal sah, sagte er: Das ist so ein<br />
Auto, das ich gerne waschen würde. Solche<br />
Emotionen entstehen im 3D-Modell am Monitor<br />
nicht, und Design ist eben eine sehr sensitive<br />
Sache. Bis solche Dinge virtuell nachgebildet<br />
werden können, bleibt der Clay sicherlich<br />
ein Teil jeden Konzepts. Denn ob der Funke<br />
überspringt, sieht man wirklich oft erst im<br />
Clay-Modell. Die Nachfolgende Generation<br />
wird auf den Clay aber verzichten können, einfach<br />
weil sie andere Sehgewohnheiten hat als<br />
wir. Es wird für sie normal sein, Produkte in<br />
der Virtuellen Realität zu beurteilen. Wenn es<br />
irgendwann holographische Projektionen<br />
gibt, die man z.B. mit einem Handschuh auch<br />
ertasten können wird, kann das Ganze so real<br />
werden, dass man keinen Unterschied mehr<br />
sieht. Dann fällt das Claymodelling endgültig.<br />
Ähnlich sieht man es bei den Stuttgarter<br />
Sportwagenbauern: „Wir arbeiten auch bei<br />
30 AutomobilKonstruktion 2/2016
Das zentrale Element des Porsche-<br />
Cockpits musste beim Mission E<br />
neu gedacht werde, der sonst übliche<br />
Drehzahlmesser ist durch den<br />
E-Antrieb obsolet geworden<br />
Bild: Porsche<br />
Porsche schaut durch<br />
Konzeptstudien wie<br />
den Mission E über den<br />
Tellerrand hinaus. Einige<br />
Designelemente finden<br />
sich vielleicht in<br />
späteren Serienfahrzeugen<br />
wieder<br />
Bild: Porsche<br />
Porsche immer noch mit Clay-Modellen. Vieles<br />
kann inzwischen im Virtuellen erledigt werden.<br />
Wir müssen z.B. während der Ideenfindung<br />
ganz am Anfang nicht mehr für jedes<br />
Konzept ein Modell bauen. Auch in den Details<br />
im Innenraum mit Oberflächen und Ausstattungen<br />
fallen Entscheidungen heute großteils<br />
am Computer. Da sparen wir heute extrem<br />
viel Modellarbeit. Zur endgültigen finalen<br />
Entscheidung ist das Modell aber immer<br />
noch wichtig. Wir wollen aber auch hier weiterkommen,<br />
ein ganz klarer Konzernauftrag ist<br />
die Digitalisierung im Design.<br />
Auch die Erstellung von Pressebildern wird<br />
von uns Designern begleitet und basiert auf<br />
den 3D-Daten. Wir entscheiden über Licht,<br />
Winkel, Kulisse etc. Nur so können wir sicher<br />
sein, dass unser Produkt immer auf die gleiche<br />
Weise wahrgenommen wird. Ein Designer<br />
kennt sein Produkt seit Beginn. Wir wissen,<br />
wo welche Kanten rund abfallen müssen, was<br />
ein Außenstehender mit einem zusätzlich eingebautem<br />
Highlight vielleicht versehentlich<br />
wie eine harte Kante aussehen lassen würde.<br />
Ein weiterer Vorteil: Wir können auf den Datensätzen<br />
global aufbauen, sprich, wenn wir<br />
etwa in der 911er-Serie ein Produktaufwertung<br />
oder auch die neue Generation planen, setzen<br />
wir wieder an den bestehenden Daten an. Wir<br />
müssen also nie von vorne anfangen.<br />
Warum aufwändige Konzeptsudien so wichtig<br />
für den Designprozess sind, können die Experten<br />
ebenfalls erklären: „Die Leute müssen<br />
den neuen GT Concept nicht unbedingt als Serienfahrzeug<br />
sehen, es ist aber wichtig, ihnen<br />
zu zeigen, wofür wir als Konzern stehen und<br />
wo wir hin wollen. Wenn wir das nicht formulieren<br />
können, sind wir bedeutungslos. Daher<br />
sind solche Concept Cars so wichtig, weil man<br />
einmal ohne die Rahmen der jeweiligen Serie<br />
völlig frei denken kann und so auf Ideen<br />
kommt, die man sonst nie hätte. Und einige<br />
sind dann so gut, dass sie sich schnell auch<br />
in anderen Opel-Produkten-Fahrzeugen finden.<br />
Wenn man eine Marke sauber ausrichten<br />
will – und das wollen wir – darf man nicht jedem<br />
gefallen wollen und deswegen überall<br />
Kompromisse eingehen. Viele fragen z.B. warum<br />
der GT Concept rote Reifen habe, worauf<br />
ich antworte: Genau aus diesem Grund, weil<br />
wir jetzt darüber sprechen. Ich habe lieber<br />
50 %, denen der Wagen sehr gefällt, als 80 %,<br />
denen er mehr oder weniger egal ist, weil sie<br />
aufgrund der Kompromisse zwar mit ihm leben<br />
können, aber so richtig gefällt er ihnen<br />
trotzdem nicht. Das bringt nichts, denn so einen<br />
Wagen kauft niemand.“<br />
Ähnlich sieht es Christian Braun: „Showcars,<br />
wie etwa der Porsche Mission E, sind sehr<br />
wichtig für den Designprozess, denn hier<br />
kann man immer einen Schritt weiter gehen.<br />
Denn die Serienentwicklung läuft mehr evolutionär<br />
ab, ein Concept Car kann revolutionärer<br />
sein. Auch wenn das Fahrzeug dann nicht in<br />
Serie geht, kann es passieren, dass uns bestimmte<br />
Partien so gut gefallen haben, dass<br />
wir sie in anderen Fahrzeugen wieder aufgreifen.<br />
Das ist immer gut, um die Gesamtlinie<br />
der Marke weiterzuentwickeln.“<br />
Ebenso einig sind sich die beiden Designspezialisten,<br />
dass Zeitlosigkeit wichtiger ist, als<br />
schnelllebige Trends: „Krasse Outfits sind<br />
meist nur kurz hipp und dann sofort wieder<br />
völlig out, ein zeitloser schwarzer Anzug dagegen<br />
unterstreicht die Persönlichkeit, genau<br />
so sollte auch der Opel GT Concept sein:<br />
Schlicht, aber dennoch mit guten Proportionen.<br />
Nur so kann ein Auto auch eine Generation<br />
überzeugen, die nicht mehr sofort unter<br />
die Motorhaube sehen will, sich stattdessen<br />
aber dafür interessiert, wie gut die Steuerung<br />
und Integration mit dem Smartphone harmoniert.<br />
Diese Generation will Autos, die Akzente<br />
in der Technologie und Ökologie setzen,<br />
aber trotzdem schick aussehen.“<br />
Porsche setzt ebenso auf Dauerhaftigkeit im<br />
Design: „Die Visualisierung hilft uns beispielsweise<br />
auch unheimlich, um feste Größen im<br />
Interieur auf neue Gegebenheiten zu trimmen:<br />
Der mittige Drehzahlmesser ist bei uns eine<br />
dieser Kerndesignelemente. Mit dem Elektroantrieb<br />
wir dieser eigentlich obsolet, weglassen<br />
können wir ihn aber natürlich nicht, dafür<br />
ist das Teil zu elementar für einen Porsche. In<br />
der 3D-Visualisierung können wir hier nun<br />
sehr einfach mit neuen Ideen spielen.“<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 31
CAD + SIMULATION<br />
Elektroauto-Hersteller Faraday Future setzt auf Dassault Systèmes<br />
Beschleunigung der Entwicklung zukunftsweisender Autos<br />
Dassault Systèmes gab bekannt,<br />
dass Faraday Future auf die<br />
3D-Experience-Plattform des Unternehmens<br />
setzt. Der Elektroauto-Hersteller<br />
nutzt bereits die<br />
Branchenlösungen „Target Zero<br />
Defect“ und „Smart Safe & Connected“<br />
zur Entwicklung und Bereitstellung<br />
seines neuen vollelektrischen<br />
Fahrzeug- und vernetzten<br />
Automotive-Konzepts.<br />
Nach Einschätzung von Faraday<br />
Future und Dassault Systèmes findet<br />
derzeit ein fundamentaler<br />
Wandel im Verhältnis zwischen<br />
Mensch und Autos statt. Die neue<br />
Fahrzeuggeneration verlangt von<br />
den Herstellern die<br />
Verbindung aus herkömmlichen<br />
Konstruktionstechniken<br />
mit Internet-Konnektivität,<br />
alternativen<br />
Energiequellen und<br />
Technologien für das<br />
autonome Fahren.<br />
Für Faraday Future ist<br />
die 3D-Experience-<br />
Plattform von Dassault Systèmes<br />
die einzige Innovationsplattform,<br />
die diese Verbindung aus Konstruktion<br />
und Technologie möglich<br />
macht.<br />
Die Branchenlösungen „Target Zero<br />
Defect“ und „Smart Safe &<br />
Connected“ basieren auf der<br />
Plattform und wurden unternehmensweit<br />
innerhalb von zwei Wochen<br />
für mehr als 400 Mitarbeiter<br />
eingeführt. Faraday Future kann<br />
damit auf eine Art und Weise konstruieren,<br />
simulieren und die Produktion<br />
vorbereiten, die nach eigener<br />
Aussage mit keiner anderen<br />
Lösung machbar war.<br />
www.3ds.com<br />
Neue Software für Automobil-Zulieferer<br />
Große JT- und PLM-XML-Baugruppen einfach konvertieren<br />
Die Software-Schmiede<br />
Core Technologie<br />
hat speziell für Zulieferer<br />
eine neue Version<br />
der Konvertierungssoftware<br />
3D Evolution freigeschaltet.<br />
Anlass für<br />
die Neuentwicklung:<br />
Sobald große Baugruppen<br />
aus dem<br />
PLM-System versendet<br />
werden, müssen oft mehrere<br />
Gigabyte JT-Parts und die Baugruppenstruktur<br />
im PLM-XML Format<br />
in das eigene CAD System<br />
konvertiert werden. 3D Evolution<br />
4.0 SP1 soll durch eine 64-Bit-Engine<br />
sowohl im Batchmodus als<br />
auch interaktiv eine schnelle, einfache<br />
Konvertierung für Catia V5,<br />
Creo, Solidworks und NX sowie<br />
für Standardformate wie Step ermöglichen.<br />
In der Interaktion wird<br />
der Anwender durch Funktionen<br />
zum separaten Laden der Baugruppenstruktur<br />
und Nachladen<br />
der Unterbaugruppen unterstützt.<br />
Bereits beim Laden kann so eine<br />
Auswahl und Separierung der<br />
Umfänge anhand des Strukturbaums<br />
durchgeführt werden. Zudem<br />
wird die intuitive Auswahl<br />
gewünschter Umfänge ermöglicht,<br />
die separat abgespeichert<br />
werden können. Filterfunktionen<br />
für tesselierte Modelle oder<br />
B-Rep-Körper sollen den schnellen<br />
Zugriff und die Filterung der<br />
gewünschten Beschreibung erlauben.<br />
Im Batchmodus kann<br />
durch eine systemeigene Skript-<br />
Sprache eine Anpassung der Software<br />
an spezielle Erfordernisse<br />
durchgeführt werden.<br />
www.coretechnologie.com<br />
IPG Automotive Software-Release 5.1<br />
Mehr Effizienz mit virtuellem Fahrversuch<br />
Das Karlsruher Unternehmen IPG Automotive<br />
hat seine Simulationslösungen für die Automobil-<br />
und Zuliefererindustrie CarMaker,<br />
TruckMaker und MotorcycleMaker weiter optimiert.<br />
Mit der Version 5.1 der CarMaker-Produktfamilie<br />
für Office- und HIL-Anwendungen<br />
sollen Anwender ab sofort von einer Vielzahl<br />
zusätzlicher Features und einer verbesserten<br />
Nutzerfreundlichkeit profitieren. Die für das<br />
Produktportfolio von IPG Automotive charakteristische<br />
Offenheit wurde mit einer neuen<br />
Schnittstelle zu GT-Suite von Gamma Technologies<br />
weiter ausgebaut, über die nun auch<br />
GT-Antriebsstrangmodelle direkt in CarMaker<br />
integriert werden können.<br />
Die 3D-Visualisierung IPGMovie enthält mit<br />
Version 5.1 eine sowohl horizontal als auch<br />
vertikal gespiegelte Ansicht beispielsweise<br />
zur Nutzung als Rückspiegel in Fahrsimulatoren.<br />
IPGMovie soll zudem mit der Möglichkeit<br />
überzeugen, die Visualisierung und die Simulationsdatenanzeige<br />
von IPGControl miteinander<br />
zu synchronisieren. Auch die Funktionalitäten<br />
des Test Managers wurden grundlegend<br />
erweitert: Mit dem neu entwickelten Test Configurator<br />
können automatisch Testvarianten<br />
generiert und so Testkataloge schneller befüllt<br />
werden. Mittels einer zusätzlichen Programmierschnittstelle<br />
lässt sich der Test Manager<br />
über Skripte fernsteuern.<br />
Die Fahrzeugmodelle und das Road-Modell<br />
der CarMaker-Produktfamilie bieten im Release<br />
5.1 ebenfalls neue Features: Durch optimierte<br />
Algorithmen im Bereich der Mehrkörpersysteme<br />
will IPG Automotive eine deutliche<br />
Verbesserung der Simulationsgeschwindigkeit<br />
und der Ressourceneffizienz erzielt haben.<br />
Die überarbeitete Schnittstelle zu ADAS<br />
RP erlaubt den Export von Straßennetzwerken<br />
in das Road5-Format, was den schnellen Aufbau<br />
komplexer Straßentopologien in CarMaker<br />
ermöglichen soll.<br />
www.ipg.de<br />
32 AutomobilKonstruktion 2/2016
Rechnergestützten Entwicklung von Karosseriekonzepten<br />
Schnellere virtuelle Fahrzeugentwicklung<br />
Tecosim und FCMS zeigen einen<br />
neuen Ansatz für einen beschleunigten<br />
Entwicklungsprozess in<br />
der frühen Konzeptphase: Tec-<br />
Concept, eine neuartige Methode<br />
zur Berechnung von kompletten<br />
Fahrzeug- oder Komponentenentwürfen,<br />
die bereits in der frühen<br />
Entwicklungsphase aber auch in<br />
der späteren Detaillierung vielfältige<br />
Optimierungspotenziale aufzeigen<br />
soll. So können komplexe<br />
und vielfältige Anforderungen, etwa<br />
Qualität, Gewicht, Steifigkeit<br />
oder Crash-Verhalten frühzeitig<br />
und gleichzeitig aufeinander abgestimmt<br />
werden. Auch für die<br />
Entwicklung von Plattformen und<br />
Derivaten lassen sich Potenziale<br />
hinsichtlich Entwicklungszeitverkürzung,<br />
Entwicklungskosten und<br />
Steigerung der Produktqualität<br />
durch Variantenbildung und rechnerischer<br />
Optimierung heben. Zudem<br />
können einzelne Entwicklungsvorgaben<br />
hinsichtlich Funktion<br />
oder Machbarkeit, etwa Lackierbarkeit,<br />
Tiefziehen, Gießen<br />
oder die Kostenentwicklung, berücksichtigt<br />
werden.<br />
www.tecosim.de<br />
Stahl und Aluminium<br />
Neue Werkstoffsimulation<br />
für Legierungen<br />
Version 9 von JMatPro soll insbesondere<br />
für Aluminium- und<br />
Stahllegierungen Verbesserungen<br />
und Erweiterungen mitbringen,<br />
teilt die Metatech GmbH mit. Für<br />
Aluminium-Legierungen können<br />
mit der neuen Version jetzt Fließkurven<br />
in Abhängigkeit von Wärmebehandlung,<br />
Temperatur und<br />
Umformgeschwindigkeit berechnet<br />
werden und direkt in FEM-Systeme<br />
zur Umformsimulation exportiert<br />
werden. Für die Wärmebehandlung<br />
von Stählen wurden<br />
die Möglichkeiten bei der Berechnung<br />
von Ausscheidungen mit<br />
JMatPro erweitert – auch die Veränderung<br />
der mechanischen Eigenschaften<br />
beim Anlassen und<br />
der Sekundärhärte können vorhergesagt<br />
werden. Die mit JMat-<br />
Pro berechneten ZTU-Schaubilder<br />
können besser für die Vorhersage<br />
der Eigenschaften der Gefüge unmittelbar<br />
nach dem Abschrecken<br />
genutzt werden. Verbesserungen<br />
bei der Erstarrungssimulation für<br />
Gießereien betreffen neben Aluminium-Legierungen<br />
auch Werkstoffe<br />
auf Mg-, Co-, Ni-, Ti- und Zr-<br />
Basis. Unterkühlungen, wie sie<br />
beispielsweise beim Druckguss<br />
und Kokillenguss entstehen, werden<br />
durch die Berücksichtigung<br />
der Rückdiffusion präziser bestimmt.<br />
www.metatech.pro<br />
Internationale Zuliefererbörse<br />
Die Digitalisierung der Mobilität<br />
18. – 20. Oktober 2016<br />
Wolfsburg | Allerpark<br />
www.izb-online.com<br />
Veranstalter:<br />
Jetzt Termin vormerken!<br />
Wolfsburg AG | MobilitätsWirtschaft<br />
Major-Hirst-Str. 11<br />
38442 Wolfsburg<br />
Telefon +49 53 61. 8 97- 13 12<br />
izb@wolfsburg-ag.com<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 33
ANTRIEB + ANTRIEBSSTRANG<br />
Oliver Maiwald, Leiter Technology & Innovations bei der Division Powertrain von Continental<br />
„48-Volt-Hybride stoßen in Leistungsbereiche von<br />
kleineren Vollhybriden vor“<br />
Das Hybridsystem „48-Volt Eco Drive“ von Continental<br />
kann nicht nur rekuperieren und boosten, sondern ist<br />
in eine intelligente Betriebsstrategie eingebettet,<br />
sagt Dr.-Ing. Oliver Maiwald, Leiter Technology &<br />
Innovations bei der Division Powertrain von<br />
Continental.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Continental warb Anfang des<br />
Jahres auf der CES in Las Vegas mit einem<br />
„Connected Energy Management“ (CEM) in<br />
Verbindung mit seinem 48-Volt-Mildhybridsystem.<br />
Was muss man sich darunter vorstellen?<br />
Beim CEM verknüpfen wir hoch aufgelöste<br />
Straßendaten des E-Horizon und vom Fahrzeug<br />
– zum Beispiel per Radarsensorik generierte<br />
– aktuelle Verkehrsinformationen mit<br />
der Steuerung unseres 48-Volt Eco Drive. Die<br />
Algorithmen des Connected Energy Managers<br />
Das Interview führte Hartmut Hammer,<br />
freier Mitarbeiter der AutomobilKonstruktion<br />
„Wenn in das 48-Volt-<br />
Teilbordnetz künftig<br />
weitere Leistungsverbraucher<br />
integriert sein<br />
sollten, könnte die rekuperierte<br />
Energie ganz<br />
effizient direkt für diese<br />
48-Volt-Systeme<br />
verwendet werden.“<br />
Dr.-Ing. Oliver Maiwald, Leiter<br />
Technology & Innovation,<br />
Continental Division Powertrain<br />
Bilder: Continental<br />
können damit die Fahrstrategie des Hybridantriebs<br />
optimal an die kommende Strecke anpassen<br />
und so dessen Energieeffizienz verbessern.<br />
Sie können dem Fahrer etwa empfehlen,<br />
den Fuß vom Gas zu nehmen, sobald<br />
er sich einer Stoppstelle, roten Ampel oder einer<br />
(auch temporären) Geschwindigkeitsbegrenzung<br />
nähert. Dann wird der Motor abgeschaltet<br />
und vom Antriebsstrang entkoppelt,<br />
das Fahrzeug rollt möglichst lange aus und<br />
wechselt zum optimalen Zeitpunkt in die Rekuperationsphase.<br />
So kann das 48-Volt-System<br />
unter veränderten Randbedingungen<br />
stets die größtmögliche Energiemenge „ernten“,<br />
sprich, Bewegungsenergie in elektrische<br />
Energie umwandeln. Der Einsatz der Radbrem-<br />
sen, die Bewegungsenergie lediglich in Wärmeenergie<br />
umwandeln, wird dadurch in einem<br />
beträchtlichen Umfang vermieden.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Wann können wir CEM auf der<br />
Straße „erfahren“?<br />
Etwa 2018 dürfte es soweit sein. Allerdings<br />
wird das CEM weitgehend im Hintergrund und<br />
für den Autofahrer fast nicht bemerkbar agieren.<br />
Es wird aus den vorhandenen Daten individuell<br />
eine optimale Fahrstrategie ermitteln.<br />
Übrigens nicht nur für die einsehbaren Streckenabschnitte,<br />
sondern weit darüber hinaus,<br />
Stichwort Prädiktion. So wird CEM auch Daten<br />
wie Zufahrtsbeschränkungen für Innenstädte<br />
berücksichtigen. Denn je nach Rekuperationspotenzial<br />
auf der vor mir liegenden Stadtdurchfahrt<br />
muss CEM dann entscheiden, ob<br />
ich mit einer vollen Batterie in das Stadtgebiet<br />
fahre oder ob ich im Stadtgebiet die nötige<br />
elektrische Energie rekuperieren kann.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Wie hoch ist der Spareffekt von<br />
CEM?<br />
Besonders das Motor-aus-Segeln, ein abgeschalteter<br />
und vom Antriebsstrang abgekoppelter<br />
Verbrennungsmotor, erweist sich als<br />
sehr effizient – analog zum Start-Stopp-System.<br />
Wir schätzen, dass ein Fahrzeug bis zu<br />
25 Prozent seiner Fahrtstrecke ohne verbrennungsmotorischen<br />
Antrieb zurücklegen kann.<br />
Unter dem Strich spart das CEM nochmals<br />
drei bis vier Prozent Kraftstoff in der 48-Volt-<br />
Anwendung ein, ohne dass technisch in die<br />
Hybridarchitektur eingegriffen werden muss.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Apropos Hybridarchitektur:<br />
Wie ist das 48-Volt Eco Drive System von<br />
Continental technisch aufgebaut?<br />
48-Volt Eco Drive setzt beim Serienstart in diesem<br />
Jahr auf einen per Riementrieb eingebundenen<br />
wassergekühlten Asynchronmotor. Dafür<br />
haben wir einen 48-Volt-Baukasten entwickelt,<br />
der nicht nur Elektromotoren mit Rekuperationsleistungen<br />
von 10 bis 16 Kilowatt<br />
34 AutomobilKonstruktion 2/2016
Das GTC II setzt hybride Betriebsstrategien in einem<br />
Fahrzeug mit Handschaltgetriebe um. Zusammen mit<br />
der elektrifizierten Kupplung ermöglicht die Betriebsstrategie<br />
des 48-Volt Eco Drives Funktionen wie<br />
elektrisches Anfahren und Stop-and-Go sowie eine<br />
Rekuperation bis fast in den Stand<br />
Leistungen umfasst, sondern auch die dazu<br />
passenden Riemen, DC/DC-Wandler als Verbindung<br />
zum 12-Volt-Netz sowie das Batteriemanagement.<br />
Die passenden Lithium-Ionen-<br />
Energiespeicher und Riemenspanner sowie<br />
die Verkabelung des 48-Volt-Teilbordnetzes<br />
bezieht Continental von Lieferanten. In dieser<br />
ersten Ausbaustufe spart 48-Volt Eco Drive im<br />
Schnitt etwa 13 Prozent Kraftstoff im NEFZ, im<br />
Stadtverkehr sogar bis zu 21 Prozent.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Sind schon weitere<br />
Ausbaustufen in Planung?<br />
Etwa 2019 oder 2020 werden wir eine P2-Architektur<br />
anbieten, bei der das 48-Volt-System<br />
samt Riementrieb zwischen Motor und Getriebe<br />
angebracht sein wird. Diesen Ansatz haben<br />
wir erst kürzlich in der zweiten Generation<br />
des Gasoline Technology Car (GTC II) – ein<br />
Technologieträger von Continental und Schaeffler<br />
in enger Zusammenarbeit mit Ford – auf<br />
dem diesjährigen Motorensymposium in Wien<br />
vorgestellt. Die elektrische Maschine ist beim<br />
GTC II mit einem Riemen zwischen Verbren-<br />
nungsmotor und Handschaltgetriebe angebunden.<br />
Zwei Kupplungen, in Antriebsrichtung<br />
vor und hinter dem Riementrieb, erlauben<br />
es, den Verbrennungsmotor vollständig<br />
abzukoppeln und die elektrische Maschine<br />
komplett unabhängig vom Verbrennungsmotor<br />
zu nutzen. So ist beim GTC II Segeln ebenso<br />
möglich wie elektrisches Anfahren, etwa<br />
im Stau.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Was hat das für Vorteile?<br />
Weil das Schleppmoment des Motors entfällt,<br />
kann in Verzögerungsphasen mehr kinetische<br />
Energie für die Rekuperation genutzt werden.<br />
Nicht zuletzt deshalb verzeichnen wir beim<br />
GTC II einen mehr als 25 Prozent geringeren<br />
Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Serien-<br />
Referenzfahrzeug. Zusätzlich wird die Abkühlung<br />
des Verbrennungsmotors und der Abgasnachbehandlung<br />
durch die Vermeidung des<br />
verbrennungsmotorischen Schubbetriebes reduziert.<br />
Dank des ebenfalls eingebauten elektrisch<br />
beheizbaren 48-Volt-Katalysators von<br />
Continental setzt die Umwandlung von Rohemissionen<br />
im Katalysator auch nach langen<br />
Motor-Aus-Phasen sofort wieder ein. Diese<br />
Strategie trägt wesentlich dazu bei, dass das<br />
GTC II die strengen Emissionsgrenzwerte der<br />
Abgasnorm Euro 6c (2017/2018) erfüllt.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Was hat Continental sonst noch<br />
in dieser Richtung vor?<br />
Parallel dazu entwickeln wir einen riemenlosen,<br />
direkt auf der Kurbelwelle sitzenden Starter-Generator<br />
in Form eines Scheibenläufers.<br />
Diese Integrationsstufe vermeidet zusätzlich<br />
die Reibverluste des Riementriebs und könnte<br />
noch einmal zwei bis drei Prozent mehr Kraftstoff<br />
sparen. Sie würde sich auch für kurze<br />
elektrische Fahrphasen wie Ein/Ausparken<br />
oder das Stauschieben im Stadtverkehr hervorragend<br />
eignen. Dafür sind leistungsstärkere<br />
48-Volt-Elektromotoren erforderlich, die<br />
aber mit künftigen Leistungen von 20 Kilowatt<br />
oder sogar mehr bereits am Horizont sichtbar<br />
sind. Dermaßen optimierte 48-Volt-Hybride<br />
würden damit in die Leistungsbereiche von<br />
kleineren Vollhybriden vorstoßen und diese<br />
eventuell ersetzen können.<br />
www.continental.de<br />
Zur Person<br />
Dr.-Ing. Oliver Maiwald (42), studierte Maschinenbau<br />
in Stuttgart und promovierte in Karlsruhe. Danach<br />
wechselte er zur IAV in die Vorentwicklung. Nach weiteren<br />
Stationen bei Bertrandt (Powertrain-Entwicklung)<br />
und Delphi (Diesel Systems) trat er im Januar<br />
2014 bei der Continental Division Powertrain als Leiter<br />
Technology & Innovation ein.<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 35
ANTRIEB + ANTRIEBSSTRANG<br />
Hybrid plastics in Motor und Getriebe<br />
Mediendichtes Housing mit Duroplast<br />
Die Dichtheitsanforderungen im Automobil,<br />
insbesondere im Bereich<br />
Motor und Getriebe, steigen stetig.<br />
Hinzu kommen immer höhere Temperaturanforderungen<br />
und aggressivere<br />
Medien. Der Werkstoff Duroplast<br />
ist ein bewährtes Material für<br />
diese Anwendungen. Bisher waren<br />
die Verarbeitungsverfahren aufwendig<br />
und teuer. Die Kolektor Kautt &<br />
Bux GmbH in Herrenberg bietet die<br />
Umhüllung von Komponenten mit<br />
einem neuartigen Verfahren an,<br />
wodurch die Neuentwicklungen bei<br />
gleichbleibend hoher Qualität<br />
wesentlich preisgünstiger werden.<br />
Mit zunehmender Nähe zu Motor bzw. Getriebe steigen die Anforderungen an das Produkt, insbesondere<br />
auch in Bezug auf die Dichtheit des Systems bei direktem Motor- oder Getriebeölkontakt<br />
Bei den zu umhüllenden Komponenten kann<br />
es sich um ganz verschiedene Produkte handeln,<br />
mit den ihnen jeweils eigenen Besonderheiten<br />
und Anforderungen. Beispielsweise<br />
seien hier elektronische Komponenten, Sensoren,<br />
Stanzgitter, oder Steckerverbindungen<br />
genannt. Oftmals ist es dabei notwendig,<br />
auch Kabel fest mit dem System zu verbinden.<br />
Mit zunehmender Nähe zu Motor bzw. Getriebe<br />
steigen die Anforderungen an das Produkt,<br />
insbesondere auch in Bezug auf die Dichtheit<br />
des Systems bei direktem Motor- oder Getriebeölkontakt.<br />
In der Regel reichen bei Bauteilen<br />
im Motorraum und bei Anbauteilen Dichtheitsklassen<br />
IPX9K oder IPX7 aus.<br />
Diese Dichtheit ist auch mit herkömmlichen<br />
Verfahren, wie z.B. Vergusslösungen zu erzielen,<br />
wenn keine störenden Einflussgrößen<br />
vorhanden sind. Sobald diese Anforderungen<br />
allerdings mit Vibration oder Temperaturwechsel<br />
überlagert werden, kann es erforderlich<br />
werden, neue Wege zu gehen, da über die Lebensdauer<br />
diese Lösungen zu Delamination<br />
und damit zu erhöhten Leckraten neigen. Bei<br />
Komponenten oder Systemen, die in direktem<br />
Kontakt zum Medium stehen, wird in der Re-<br />
Management, Kolektor Kautt & Bux, Herrenberg<br />
Bei Kolektor können nahezu alle notwendigen Tests Inhouse durchgeführt werden<br />
Bilder: Kolektor Kautt & Bux<br />
gel eine Öldichtheit ab 10 -5 mbar l/s gefordert.<br />
Hinzu kommen die automobilspezifischen<br />
Standardtests wie Temperaturwechseltest und<br />
Temperaturschocktest sowie Einlagerungen<br />
im Medium und unter Temperatur.<br />
Längere Lebenszeit und Manipulationsschutz<br />
Kolektor Kautt & Bux verfügt über eine neue<br />
Verfahrenstechnologie, bei der beispielsweise<br />
Stanzgitter mit angeschweißter Sensorik und<br />
Magnet direkt mediendicht umhüllt werden.<br />
Dieses kostengünstige Verfahren der Duroplastverarbeitung<br />
eignet sich für alle Sensoren<br />
im Bereich Motor, Getriebe, Tank, Batterie<br />
oder Dosierung von Kraftstoffen (Diesel, Benzin,<br />
AdBlue) – kurz gesagt überall dort, wo<br />
nicht zuletzt aus sicherheitstechnischen Aspekten<br />
sicher funktionierende Systeme essentiell<br />
sind. Der Vorteil des Duroplast Housings<br />
ist neben der erhöhten Temperatur- und Medienbeständigkeit<br />
auch die Verlängerung der<br />
Lebenszeit der eingeschlossenen Bauelemente,<br />
da sich diese auch bei Vibration nicht von<br />
der Platine ablösen können. Eine umhüllte<br />
Elektronik ist manipuliersicher geschützt und<br />
kann nur sehr aufwendig geöffnet werden.<br />
36 AutomobilKonstruktion 2/2016
Füllverhalten des Duroplasts an einem Elektronikbauteil<br />
Produktbeispiel im Schnitt<br />
Bei dieser neuen Fertigungstechnologie ist<br />
auch eine Integration von Steckkontakten,<br />
Steckern, Anschraubpunkten oder auch Zentrierdomen,<br />
wie Sie beispielsweise bei Getriebesteuerungen<br />
Verwendung finden, möglich.<br />
Des Weiteren ist das Umspritzen oder die Integration<br />
von Buchsen zur Fixierung möglich,<br />
aus Kostengründen jedoch nicht zwingend erforderlich.<br />
Auf Grund der hohen Festigkeiten<br />
der Duroplaste und einer im Vergleich zu Thermoplasten<br />
nahezu geradlinigen Schubmodulkurve<br />
in einem breiten Temperaturbereich ist<br />
eine direkte Verschraubung gegen das Duroplastbauteil<br />
bei den meisten Anwendungen<br />
ausreichend. Zahlreiche Fertigungsschritte,<br />
die bei anderen Verfahren notwendig sind,<br />
können nun in einem Arbeitsgang erledigt<br />
werden und liefern damit ein wirtschaftliches<br />
aber auch robustes Produkt.<br />
Neuentwicklung mit komplettem Inhouse-Test<br />
Das Einbinden von Kabeln in den Leckagepfad<br />
ist ein wichtiges Element für eine mediendichte<br />
Lösung. Die Kolektor Kautt & Bux GmbH in<br />
Herrenberg entwickelt derzeit die Anbindung<br />
von ETFE-Kabeln für Getriebeapplikationen<br />
und weitere Anwendungen. Das Ziel ist es, gemäß<br />
den geforderten und beschriebenen Temperaturwechseltests<br />
eine leckagefreie Lösung<br />
anbieten zu können. Die ersten Versuchsergebnisse<br />
sehen vielversprechend aus.<br />
Vorteilhaft wirkt sich hierbei aus, dass bei Kolektor<br />
nahezu alle dazu notwendigen Tests In-<br />
house durchgeführt werden können. Neben<br />
dem Heliumtest können Produkte oder Baugruppen<br />
mittels Schliffbildern, SAM (Scanning<br />
Acoustic Microscopy) oder CT (Computer Tomography)<br />
analysiert werden. Schliffbilder<br />
und CT liefern insbesondere bei komplexen<br />
Geometrien und bei der Schadensanalyse hilfreiche<br />
Daten. Bei der SAM Analyse können die<br />
Bauteile auf Lunker, Risse und Delamination<br />
zerstörungsfrei geprüft werden. Mittels eines<br />
akustischen Signals wird die Reflektion an Mediengrenzen<br />
ermittelt und in ein Videosignal<br />
umgewandelt. Die Auswertung liefert μm-genaue<br />
Ergebnisse, die als Falschfarbenbild dargestellt<br />
werden.<br />
Kolektor Kautt & Bux arbeitet aktuell mit mehreren<br />
Tier1 und OEMs an der Umsetzung neuer<br />
Sensorik, welche sich mittlerweile kurz vor Serienreife<br />
befindet, so dass in den nächsten<br />
Monaten Details zu den einzelnen Projekten<br />
veröffentlicht werden.<br />
Kolektor Kautt & Bux GmbH<br />
Tel.: +49 7032 93 56-245<br />
sylvia.fischer@kolektor.com<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 37
ANTRIEB + ANTRIEBSSTRANG<br />
Die Kupplung geht ans Netz<br />
Elektrifizierte Kupplungen machen Handschaltgetriebe fit für kraftstoffsparende Fahrstrategien<br />
Eine Speicherfeder im Aktuator nutzt<br />
die Schließenergie der Membranfeder<br />
größtenteils wieder zum Öffnen<br />
Bild: ZF<br />
Der E-Motor mit Spindeltrieb kann bei<br />
der MT Plus von Schaeffler unabhängig<br />
vom Fahrer Kupplungsvorgänge einleiten<br />
Bild: Schaeffler<br />
Fahrzeuge mit Handschaltgetrieben<br />
lassen bisher keine automatisierten<br />
Eingriffe der Fahrzeugsteuerung zu.<br />
Dabei kann die Verknüpfung mit<br />
elektronischen Fahrstrategien<br />
beträchtlich Kraftstoff sparen.<br />
40 Mio. Neufahrzeuge pro Jahr mit Handschaltgetriebe<br />
können aktuell nicht von den<br />
Vorteilen kraftstoffsparender elektronischer<br />
Fahrstrategien profitieren. Dieses enorme Einsparpotenzial<br />
– bis zu zehn Prozent weniger<br />
Verbrauch sind in der Diskussion – möchten<br />
Zulieferer wie Schaeffler oder ZF nicht brach<br />
liegen lassen. Sie haben die bislang mechanische<br />
oder hydraulische Kupplungsbetätigung<br />
elektrifiziert und sind nach eigenen Angaben<br />
mit dieser Technik schon serienreif, wenn<br />
Der Autor: Hartmut Hammer, freier Mitarbeiter der<br />
AutomobilKonstruktion<br />
auch aktuell noch ohne Serienauftrag.<br />
Am weitesten könnte bisher Schaeffler sein.<br />
Dort rechnet man schon in diesem Jahr mit einem<br />
ersten Vertragsabschluss mit einem europäischen<br />
OEM und hofft, 2018 oder 2019<br />
als erster in Serie gehen zu können. Insgesamt<br />
drei verschiedene Technikstufen der<br />
Kupplungsbetätigung übernehmen das Kuppeln<br />
entweder nur in bestimmten Fahrsituationen<br />
oder führen alle Kupplungsvorgänge<br />
vollautomatisiert aus. „Die elektrifizierte<br />
Kupplung von Schaeffler ebnet dem Handschaltgetriebe<br />
den Weg in die Hybridisierung<br />
und eröffnet damit den preissensiblen A-, B-<br />
und C-Fahrzeugsegmenten neue Einsparpotenziale“,<br />
ist Matthias Zink, Leiter Unternehmensbereich<br />
Getriebesysteme bei Schaeffler,<br />
überzeugt.<br />
Geringer Aufwand – hoher Ertrag<br />
In der Grundvariante MT Plus wird das Grundprinzip<br />
der hydraulischen Kraftübertragung<br />
beibehalten, aber ein zusätzlicher elektrisch<br />
angetriebener Aktuator direkt in die Drucklei-<br />
tung eingebaut. Auf diese technisch einfache<br />
Weise glaubt Schaeffler, die Mehrkosten von<br />
MT Plus gegenüber einer klassischen Kupplungsbetätigung<br />
unter 100 Euro halten zu können.<br />
Laut Matthias Zink wird die MT plus wohl<br />
die erste Serienanwendung von Schaeffler<br />
werden.<br />
Schon diese vergleichsweise einfache Teilautomatisierung<br />
genügt für die Segelfunktion,<br />
bei der – wenn der Fahrer vom Gas geht – der<br />
Motor vom Getriebe getrennt und entweder<br />
ganz abgeschaltet oder im Leerlauf weiterbetrieben<br />
wird. Im künftigen WLTP-Verbrauchsmesszyklus<br />
lässt sich mit abgestelltem Motor<br />
so der Kraftstoffverbrauch um mindestens<br />
drei Prozent senken, im realen Stadtverkehr<br />
sogar um bis zu acht Prozent. Berechnet man<br />
mit diesen Werten die Kosten pro eingesparten<br />
Gramm CO 2 pro Kilometer, kommt man auf<br />
25 bis 40 Euro. Nicht schlecht, wenn man<br />
weiß, dass manche OEMs in ihrer Not für Techniken<br />
inzwischen schon 70 oder 80 Euro pro<br />
eingespartem Gramm CO 2 zu zahlen bereit<br />
sind, nur um den ab 2021 drohenden Straf-<br />
38 AutomobilKonstruktion 2/2016
MOVE<br />
WITH OUR<br />
EXPERIENCE<br />
Check Valves<br />
Relief Valves<br />
Calibrated Orifices<br />
zahlungen (95 Euro für jedes Gramm CO 2 über<br />
dem Flottengrenzwert von 95 Gramm CO 2 pro<br />
Kilometer) zu entgehen.<br />
Für die Autofahrer könnte es noch besser werden.<br />
Der WLTP-Zyklus bietet nur wenige Situationen<br />
für Segeln. Im Straßenverkehr hingegen<br />
haben die die Schaeffler-Ingenieure<br />
durch eine ausgeklügelte Betriebsstrategie<br />
mit konsequentem Segeln in allen Gangstufen<br />
mehr als acht Prozent Kraftstoff eingespart.<br />
Das korrespondiert in etwa mit den elf Prozent<br />
Einsparpotenzial, das die Ingenieure von ZF<br />
ebenfalls auf der Straße (und das nach eigenen<br />
Angaben mit laufendem Motor!) ermittelt<br />
haben.<br />
Den Fuß von der Kupplung entkoppelt<br />
In der Ausbaustufe Clutch-by-Wire (CBW) wird<br />
die mechanische oder hydraulische Anbindung<br />
des Pedals an das Ausrücksystem entfernt<br />
und durch einen Pedalkraftsteller (sensiert<br />
die Pedalstellung und -kraft) und einen<br />
mechatronischen Aktor (öffnet und schließt<br />
die Kupplung) ersetzt. Dieses Ausrücksystem<br />
ist – zusätzlich zur Segelfunktion – gut mit einer<br />
Stopp-Start-Funktion kombinierbar und ermöglicht<br />
hoch dynamische Eingriffe. Außerdem<br />
lässt sich hier die Umsetzung von Pedalweg<br />
in Kupplungsweg per Software „tunen“,<br />
bis hin zu einer gangabhängigen Adaption<br />
oder der Wahl eines Sportmodus, was bisher<br />
Automatikgetrieben vorbehalten war.<br />
Ganz ohne Pedal kommt die Variante „Elektronisches<br />
Kupplungsmanagement“ (EKM) aus.<br />
Hier detektiert der Sensor den Kupplungswunsch<br />
nicht am Pedal, sondern am Schalthebel.<br />
Das Signal zum Auskuppeln liefert ein<br />
Sensor in dem Moment, in dem der Fahrer<br />
Die drei elektrifizierten Kupplungsvarianten<br />
von Schaeffler bieten<br />
sukzessive mehr Funktionen<br />
Bild: Schaeffler<br />
zum Schalten ansetzt. Ebenso erfolgt das Einkuppeln<br />
automatisch, wenn der Gang eingelegt<br />
ist. In dieser Variante lässt sich auch gut<br />
ein Elektromotor in den Antriebsstrang integrieren.<br />
Etwa in Form eines 48 Volt-Hybridantriebs,<br />
der beim Einparken, im Stop-and-Go-<br />
Verkehr oder im langsamen Stadtverkehr den<br />
Vortrieb übernimmt.<br />
Mehr Komfort und Robustheit<br />
Neben den Effizienzvorteilen im Fahrbetrieb<br />
bietet die elektrifizierte Kupplung noch weitere<br />
Vorteile. So spricht ZF bei seiner Clutch-by-Wire<br />
von einer Leistungsaufnahme des Aktuators<br />
von weniger als 0,1 kW sowie von Öffnungsund<br />
Schließzeiten der Kupplung unter 100 ms.<br />
Zudem soll die CBW selbst für drehmomentstarke<br />
Motoren, die eine sehr hohe Ausrückekraft<br />
erfordern, ein angenehmes Pedalgefühl<br />
ermöglichen und das einmal festgelegte Pedalfeedback<br />
ändert sich über die gesamte Fahrzeug-Lebensdauer<br />
nicht. Nicht zuletzt kann die<br />
Software der elektrifizierten Kupplung durch<br />
partielles oder vollständiges Auskuppeln das<br />
Abwürgen des Motors verhindern.<br />
Schaeffler AG<br />
Tel.: +49 9132 82-0,<br />
info@schaeffler.com<br />
ZF Friedrichshafen AG<br />
Tel.: +49 7541 77-0<br />
postoffice@zf.com<br />
Flow Controls<br />
Restrictor Checks<br />
Betaplugs<br />
LEE Hydraulische<br />
Miniaturkomponenten GmbH<br />
Am Limespark 2 · 65843 Sulzbach<br />
Telefon 06196 / 7 73 69 - 0<br />
E-mail info@lee.de · www.lee.de<br />
Safety Screens<br />
Shuttle Valves<br />
Airbleed<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 39
ANTRIEB + ANTRIEBSSTRANG<br />
Gebündelte Kompetenzen für Polizeifilter<br />
ND-AGR-Filter für Sechszylinder-Dieselmotor als Kooperationsprodukt von GKD und ElringKlinger<br />
Unverzichtbar für Niederdruck-<br />
Abgasrückführungen (ND-AGR) sind<br />
Filter, die Motor und Turbolader auf<br />
der Frischluftseite vor schädlichen<br />
Partikeln schützen. BMW setzt<br />
bei seinem Sechszylinder-Dieselmotor<br />
auf einen Filter, den GKD<br />
und ElringKlinger in einer Kooperation<br />
maßgeschneidert produzieren.<br />
Sie entwickelten ein Bauteil,<br />
das Spezialdichtung und Filter einbaufertig<br />
vereint.<br />
Zur Einhaltung der vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte<br />
gilt die Niederdruck-Abgasrückführung<br />
insbesondere bei hohen Belastungen<br />
als Schlüsseltechnologie. Dabei gilt<br />
es, den Druckverlust innerhalb des Abgasrückführungssystems<br />
so gering wie möglich<br />
zu halten, damit der Kraftstoffverbrauch nicht<br />
ansteigt. Um die Bauteile auf der Frischluftseite<br />
vor Beschädigung durch Partikel aus<br />
dem Verbrennungsprozess oder vorgeschalteten<br />
keramischen Abgasfiltern zu schützen,<br />
sind Niederdruck-Abgasfilter unverzichtbar.<br />
Durch seine spezifische 3D-Gewebebindung<br />
ist das Volumetric Gewebe von GKD deutlich<br />
dicker als beispielsweise Quadratmaschengewebe.<br />
So kombiniert es ein um 70 % höheres<br />
Gewebevolumen bei analogem Materialeinsatz<br />
mit einem geringeren Druckverlust sowie<br />
einem breiteren Partikelabscheidegrad.<br />
Zuverlässiger Bauteilschutz<br />
Als integriertes Bauteil aus dem Filtermedium<br />
und einer Spezialdichtung von ElringKlinger<br />
kommt der neue AGR-Filter in einem Baukastenmotoren<br />
von BMW zum Einsatz. Schon bei<br />
Erstellt aus Unterlagen von ElringKlinger und GKD<br />
Die integrierte Dichtungslösung in der spezifischen<br />
Einbausituation<br />
Bilder: GKD/ElringKlinger<br />
einem Vorgängermodell vertraute BMW auf<br />
Volumetric Gewebe von GKD. Die Leistungsfähigkeit<br />
des 3D-Gewebes als Polizeifilter vor<br />
dem Turbolader prädestinierte es deshalb<br />
auch für den Sechszylindermotor. Das in dieser<br />
Zusammenarbeit für den Dieselmotor entwickelte<br />
Dichtungs- und Filtersystem gewährleistet<br />
bei einem spezifischen Massenfluss<br />
von über 80 kg/h einen Druckverlust von weniger<br />
als sechs Millibar. Alle Partikel, die eine<br />
Größe von 200 μm überschreiten, werden vor<br />
dem AGR-Niederdruckstrang abgeschieden.<br />
Mit der dauerhaften Beständigkeit gegenüber<br />
Temperaturen von mindestens 800 °C, dieselsauren<br />
Kondensaten und den thermomechanischen<br />
Belastungen bei allen Betriebszuständen<br />
erfüllt das System die geforderte<br />
Langzeitrobustheit.<br />
Erfolgreiches Co-Engineering<br />
Auf dieser Basis legte die ElringKlinger AG eine<br />
auf die vorgegebene Bauraumgeometrie<br />
abgestimmte Dichtung aus. Neben der Definition<br />
der Abdichtungsart waren dafür auch intensive<br />
gemeinsame Überlegungen mit GKD<br />
zur Gegendruckoptimierung, besten Filtergeometrie<br />
und Herstellbarkeit erforderlich. GKD<br />
definierte für die konkrete Einbausituation<br />
Druckverlust, Rückhalterate und Stabilität des<br />
Volumetric Gewebes. In enger Zusammenarbeit<br />
mit GKD prüfte ElringKlinger, wie und in<br />
welchen Geometrien das geforderte<br />
Medium serientauglich<br />
in die Dichtung integriert werden<br />
konnte. Denn bei allen<br />
Betriebszuständen muss eine<br />
hohe Dichtheit gewährleistet<br />
sein – im kalten Zustand<br />
ebenso wie unter Volllast, bei<br />
den gegebenen thermodynamischen<br />
Belastungen von -40 bis<br />
+820 °C und den Frequenzbelastungen<br />
durch Motorschwingungen und Eigenschwingung<br />
des Bauteils.<br />
Basis für die Dichtung ist ein hochtemperaturstabiler<br />
Edelstahlträger mit entsprechender<br />
Beschichtung. Beide Werkstoffe sind zudem<br />
äußerst chemieresistent, sodass sie den dieselsauren<br />
Kondensaten mit pH-Wert 2, die<br />
beim Abkühlen der Abgasanlage bei der Stickoxidumwandlung<br />
durch die SCR entstehen,<br />
standhalten. Werkstoffeigenschaften, die das<br />
Volumetric Gewebe analog erfüllt. Für die spezifische<br />
Flanschgeometrie und Einbausituation<br />
des Motors konstruierte ElringKlinger eine<br />
Dichtungslösung, die das zur Funktion des Gesamtsystems<br />
definierte Volumetric Gewebe<br />
schlüssig mit der Dichtung in einem Bauteil<br />
verbindet. Möglich macht dies ein spezielles,<br />
hierfür entwickeltes Werkzeugverfahren.<br />
Starke Synergien<br />
Während der Projektdauer von 24 Monaten<br />
stimmte der Dichtungsspezialist in gemeinsamen<br />
Gesprächen mit dem OEM beispielsweise<br />
optimale Materialdicken, -auslegungen,<br />
Schraubenkräfte oder Abstände, aber auch ergänzende<br />
Anforderungen etwa zur Dauerhaltbarkeit<br />
nach den ersten Bauteiltests auf dem<br />
Motorenprüfstand ab. Bei allen Fragen zum<br />
Filtermedium stand ihm GKD zur Seite. Aktuell<br />
arbeiten die Partner bereits an ND-AGR-Applikationen,<br />
die die Funktionen Dichten und Filtern<br />
in einem Bauteil für Benzinmotoren realisieren.<br />
Synergien heben wollen die beide Unternehmen<br />
beispielsweise auch mit der Serienproduktion<br />
von Automatikgetriebeplatten<br />
mit integriertem Filtergewebe.<br />
GKD – Gebr. Kufferath AG<br />
Tel.: +49 0 2421 803-0<br />
solidweave@gkd.de<br />
40 AutomobilKonstruktion 2/2016
Vieles zum Guten gewandelt<br />
Clevere Kombinationen helfen bei Problemen mit Downsizing-Motoren<br />
Das Downsizing von Verbrennungsmotoren<br />
führt zu stärkeren Torsionsschwingungen.<br />
In Fahrzeugen<br />
mit Automatikgetrieben kann diese<br />
Problematik aber oft mit einem<br />
Drehmomentwandler als Anfahrelement<br />
ausgeglichen werden.<br />
Die Schaeffler-Marke LuK hat viel Erfahrung in<br />
der Entwicklung und Produktion dieser Produkte.<br />
Beispielsweise konnte bei einem Drehmomentwandler<br />
im Zeitraum zwischen 2005<br />
und 2013 das Gewicht um 2,1 Kilogramm gesenkt<br />
werden, bei gleicher oder teilweise verbesserter<br />
Funktionalität. Das ist umso wichtiger,<br />
als der zur Verfügung stehende Bauraum<br />
immer kleiner wird.<br />
Die Torsionsschwingungen der Downsizing-<br />
Motoren dämpft Schaeffler mit dem bekannten<br />
Fliehkraftpendel (FKP), das direkt in den<br />
Drehmomentwandler integriert ist. Es ist laut<br />
Hersteller anderen Dämpfungskonzepten<br />
deutlich überlegen, da es ein Schließen der<br />
Überbrückungskupplung bei einer Motordrehzahl<br />
nahe der Leerlaufdrehzahl ermöglicht.<br />
Mit dem seit 2010 in Serie an einem Doppeldämpfer<br />
angebrachten FKP sind beispielsweise<br />
Überbrückungsdrehzahlen von weniger als<br />
1000 Umdrehungen pro Minute realisierbar.<br />
Mehr Schwingwinkel und mehr Pendelmasse<br />
Mit einer weiteren Vergrößerung des Schwingwinkels<br />
und der Pendelmasse will LuK die<br />
Dämpfungsqualität noch weiter verbessern.<br />
Ein solches FKP der zweiten Generation hat<br />
bei Messungen die Torsionsschwingungen im<br />
Vergleich zur ersten Generation bereits halbiert.<br />
Und es bietet noch Optimierungspotenzial:<br />
So konzentriert sich LuK auf eine weitere<br />
Bahnoptimierung bei niedrigen Drehzahlen<br />
und ordnet dafür Druckfedern zwischen den<br />
Pendelmassen an. Erste Simulationen bestätigen<br />
diese Überlegungen.<br />
Für Motoren mit Zylinderabschaltung wird das<br />
FKP jeweils motorenspezifisch ausgelegt. Bei<br />
Der Autor: Jürgen Goroncy, freier Mitarbeiter der<br />
AutomobilKonstruktion<br />
Im Vergleich zu 2006 (links) ist der Drehmomentwandler deutlich kleiner geworden<br />
Achtzylindermotoren mit Zylinderabschaltung<br />
beispielsweise wird es auf den reduzierten<br />
Vierzylindermodus ausgelegt. Bei Sechs- oder<br />
Vierzylindermotoren kann die höhere Isolation<br />
des Fliehkraftpendels auch dann erforderlich<br />
sein, wenn alle Zylinder aktiviert sind. In<br />
diesem Fall können zwei Fliehkraftpendel installiert<br />
werden, von denen das eine für die<br />
Erregerordnung mit Zylinderdeaktivierung und<br />
das andere für die Erregerordnung des Vollmotors<br />
ausgelegt ist.<br />
Intelligent kombiniert heißt Bauraumbedarf<br />
reduziert<br />
Mit jeder neuen Motorengeneration wird der<br />
dem Drehmomentwandler zugestandene Bauraum<br />
immer geringer, die Erwartung an seine<br />
Torsionsschwingungsisolation aber immer höher.<br />
Mit einem kleiner konstruierten Torus<br />
lässt sich der verfügbare Raum für den Dämpfer<br />
wenigstens etwas vergrößern.<br />
Schaeffler hat mit dem neuen integrierten<br />
Drehmomentwandler (ITC, Integrated Torque<br />
Converter) einen weiteren Ansatz gewählt: die<br />
Kombination der Turbine mit dem Kolben der<br />
Überbrückungskupplung. Üblicherweise sind<br />
diese Bauteile separat. Schaeffler hat jetzt die<br />
Turbine – bei geringfügig größerem Platzbedarf<br />
– verstärkt, damit sie dem Betätigungsdruck<br />
der Überbrückungskupplung standhält.<br />
Dafür entfällt der Kolben, der üblicherweise<br />
sehr viel Bauraum beansprucht.<br />
Jetzt übernehmen die Turbine und die Pumpe<br />
auch die Funktion der Überbrückungskupplung.<br />
Bei einer Anfahrt ist die Turbine aktiv<br />
und leistet die erforderliche Drehmomenterhöhung.<br />
Bei höheren Fahrgeschwindigkeiten<br />
kann die Überbrückungskupplung schließen,<br />
sodass das Drehmoment ohne Umweg über<br />
den hydrodynamischen Kreislauf zur Verfügung<br />
steht.<br />
Sanfter und ökonomischer kuppeln<br />
Das Schließen der Überbrückungskupplung<br />
erfordert jedoch eine genauere Analyse des<br />
Turbinenschubs. Dieser entsteht durch unterschiedliche<br />
Ölgeschwindigkeiten auf den beiden<br />
Seiten der Turbine. Theoretische Überlegungen<br />
ließen vermuten, dass einerseits an<br />
der Reibfläche der Turbine eine hydrostatische<br />
Lagerung entsteht, die zu einem geringen<br />
Schleppmoment an der Überbrückungskupplung<br />
führt. Andererseits könnte durch eine<br />
Drehzahldifferenz zwischen der Turbine<br />
und dem Laufrad der Abstand zwischen den<br />
Reibflächen der Überbrückungskupplung geringer<br />
werden, was eine Vorstufe zur geschlossenen<br />
Überbrückungskupplung darstellen<br />
und ein sanftes Schließen ermöglichen würde.<br />
Messungen mit einem Prototyp dieses ITC und<br />
mit einer klassischen Variante an einem Prüfstand<br />
bestätigten diese theoretischen Betrachtungen.<br />
Wie erwartet, beginnt das Einkuppeln<br />
bei niedrigen Betätigungsdrücken,<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 41
ANTRIEB + ANTRIEBSSTRANG<br />
ohne dass es zu einem Drehmomentstoß<br />
kommt. Außerdem lässt sich feststellen, dass<br />
der Druck, bei dem der Kupplungsschlupf in<br />
der Einkupplungsphase geendet hat, und der<br />
Druck, bei dem der Schlupf in der Auskuppelphase<br />
begonnen hat, sehr dicht beieinander<br />
liegen. Diese kleine Hysterese beim Einkuppeln<br />
bestätigt die Regelbarkeit der Überbrückungskupplung.<br />
Abgesehen vom Bauraum bietet die ITC-Konstruktion<br />
im Vergleich zu einem klassischen<br />
Drehmomentwandler noch mehr Vorteile. Sie<br />
kommt mit weniger Bauteilen aus, vor allem<br />
ohne aufwendiges Axiallager zwischen Turbine<br />
und Leitrad sowie ohne den oben erwähnten<br />
Kolben. Sie ist dadurch kostengünstiger<br />
und leichter. Dennoch ermöglicht sie sanftes<br />
Einkuppeln ohne Schleppmoment. Zudem<br />
überzeugt die ganze Konstruktion durch Robustheit<br />
und einen Dämpfer, der größere Freiheiten<br />
bei der Variation seiner Eigenschaften<br />
bietet.<br />
Systemwechsel spart Kosten<br />
Bauraumoptimierte Drehmomentwandler erfordern<br />
zwingend auch schmalere Freiläufe<br />
der Leiträder. Diese ermöglichen das Schalten<br />
vom Wandlermodus in den Kupplungsmodus.<br />
FKP für Anwendung mit Drehmomentwandler<br />
und Zylinderabschaltung<br />
von acht auf vier<br />
Zylinder<br />
Bilder: Schaeffler<br />
Eine interessante Option ist der Kipphebel-<br />
Freilauf. Da die Position des Kipphebels in Relation<br />
zum Leitrad unveränderlich ist, kann<br />
man auf den separaten Außenring verzichten<br />
und die Anlageflächen in das Aluminium des<br />
Leitrades integrieren.<br />
Allerdings kann diese Variante nur an bestimmten<br />
Positionen einkuppeln. Es hat sich<br />
jedoch gezeigt, dass der Anbindungswinkel<br />
von 2,4 Grad so klein ist, dass kein nennenswerter<br />
Unterschied zwischen dem Kipphebelund<br />
dem Rollen-Freilauf erkennbar ist. Durch<br />
den Wegfall des komplexen Außenrings eines<br />
Rollenfreilaufs ist die Kipphebel-Variante signifikant<br />
kostengünstiger.<br />
Schaeffler AG<br />
Tel.: +49 9132 820<br />
www.schaeffler.com<br />
Flusszellenbasierter Antrieb im ersten Dauertest unter Realbedingungen<br />
14 Stunden nonstop im Stadtzyklus<br />
Gerade erst erhielt der Quantino seine Straßenzulassung<br />
für Europa und schon ist der City-Sportler<br />
mit Flusszellen-Technologie bereits<br />
im Dauertest. Das Entwickler-Team der Nano-<br />
Flowcell AG um Chief Technology Officer Nunzio<br />
La Vecchia unterzog den Quantino einem<br />
14-stündigen Dauertest. Anspruch der Nonstop-Fahrt<br />
war, die Alltagstauglichkeit und<br />
Systemintegrität des NanoFlowcell-Systems<br />
unter Dauerbelastung zu testen. Die Testfahrt<br />
bestand überwiegend aus Stadtfahrzyklen mit<br />
variablen Geschwindigkeiten von bis zu<br />
74 km/h.<br />
Nach den ersten kurzen Betriebsfahrten während<br />
der Abstimmungsphase sollte der Quantino<br />
auf einem Testgelände in der Nähe von<br />
Zürich nun unter Beweis stellen, was La<br />
Vecchia sich von der NanoFlowcell erhofft:<br />
Umweltfreundliche Energie für<br />
Reichweiten, die selbst effizienteste<br />
Elektroautos bislang nicht<br />
erzielen konnten. Chefentwickler<br />
La Vecchia ließ es sich nicht nehmen,<br />
selber als Testpilot den<br />
Dauertest im Quantino zu fahren.<br />
Unter juristischer Aufsicht fuhr<br />
der Quantino 14 Stunden nonstop,<br />
ohne nachgetankt zu werden.<br />
Auf der Testfahrt hätte der Wagen<br />
die meisten Elektromobile sowohl<br />
theoretisch wie auch unter Realbedingungen<br />
bereits nach wenigen Stunden<br />
hinter sich gelassen. Möglich werden die<br />
Fahrleistungen laut Hersteller durch den sehr<br />
effizienten NanoFlowcell-Antrieb und die Verwendung<br />
proprietärer Elektrolytflüssigkeiten.<br />
Die Herstellung auf industriellem Level soll<br />
weniger als 10 Cent pro Liter kosten. Aktuell<br />
beträgt die Energiedichte etwa 600 Wh pro Liter.<br />
Während der Testfahrt wurden etwa 70 l<br />
Elektrolytflüssigkeit verbraucht, die durchschnittliche<br />
Energieaufnahme lag bei etwa 12<br />
bis 14 kWh auf 100 km. Der Treibstoff sei weder<br />
entflammbar noch explosiv, die entstehenden<br />
Abgase bestünden nach Aussage der<br />
NanoFlowcell AG lediglich aus ionisiertem<br />
Wasserdampf.<br />
Als weltweit erstes straßenzugelassenes Niedervolt-Fahrzeug<br />
mit flusszellenbasiertem Antrieb<br />
bietet der Quantino eine Beschleunigung<br />
von 0 auf 100 km/h in unter fünf Sekunden<br />
und eine Höchstgeschwindigkeit von<br />
200 km/h.<br />
www.nanoflowcell.com<br />
42 AutomobilKonstruktion 2/2016
Elektrischer Achsantrieb von ZF geht 2018 in Serie<br />
Systemintegration von elektrischer Maschine, Getriebe und Leistungselektronik<br />
Das elektrische Antriebssystem,<br />
von ZF wird 2018 bei einem europäischen<br />
Automobilhersteller in<br />
Serie gehen. Der modulare Ansatz<br />
deckt mit verschiedenen<br />
Leistungsklassen und Baulängen<br />
die Anforderungen unterschiedlicher<br />
Kunden und Modelle ab –<br />
von Kompaktwagen bis hin zu<br />
leichten Nutzfahrzeugen. Der Einsatz<br />
der Antriebssysteme ist in<br />
Hybrid-, Brennstoffzellen- sowie<br />
batteriebetriebenen Fahrzeugen<br />
möglich.<br />
In einem achsparallelen elektrischen<br />
Antriebsmodul integriert ZF<br />
eine elektrische ASM, ein zweistufiges<br />
Ein-Gang-Getriebe, Differenzial,<br />
Gehäuse und Kühler sowie<br />
die Leistungselektronik samt<br />
Software. Motor und Getriebe teilen<br />
sich ein Gehäuse, was zu Vereinfachungen<br />
in der Produktion<br />
und für die Endmontage beiträgt.<br />
Das System leistet bis zu 150 kW<br />
bei einem Achsmoment von max.<br />
3500 Nm. Das Antriebssystem<br />
wiegt 113 kg und ist axial rund<br />
450 mm lang, 380 mm breit und<br />
510 mm hoch.<br />
Die ASM kommt ohne Seltene Erden<br />
wie Neodym und Dysprosium<br />
aus. Außerdem erlaube die ASM<br />
eine weite Spreizung zwischen<br />
Dauer- und Spitzenleistung und<br />
bietee sich daher insbesondere<br />
bei kurzzeitigen hohen<br />
Leistungsanforderungen an.<br />
Drehzahlen von rund 13 000 min -1<br />
stellen in puncto Geräuschentwicklung<br />
besondere Anforderungen<br />
an das Getriebe. ZF setzt hier<br />
auf eine achsparallele Ein-Gang-<br />
Übersetzung im Verhältnis 9,6:1,<br />
die das Drehzahlniveau in zwei<br />
aufeinanderfolgenden Stirnradstufen<br />
absenkt.<br />
Verluste sollen in der Leistungselektronik<br />
des Achsantriebssystems<br />
vermindert werden: Durch<br />
das Anheben der Ansteuerspan-<br />
nung mit Hilfe spezieller Modulationsverfahren<br />
kann der Motorstrom<br />
bei unveränderter Leistung<br />
abgesenkt werden. Unter Berücksichtigung<br />
üblicher Fahrzyklen<br />
trage dieses Verfahren zur Erhöhung<br />
der Reichweite bei.<br />
www.zf.com<br />
Smarte Aktoren für Radnabenantriebe<br />
Bleifreie Piezomaterialien und Bremsen für Elektroautos<br />
Smarte Aktoren, die weder an<br />
Elektromotoren noch an fluidtechnische<br />
Antriebe erinnern,finden<br />
bereits in Autos und Kameras<br />
Verwendung. Elektroautos unterscheiden<br />
sich aber nicht nur hinsichtlich<br />
des Antriebsaggregates<br />
von konventionellen Pkw, sondern<br />
auch in Bezug auf die Bremsen<br />
sowie die Fahrwerksdämpfung:<br />
Radnabenmotoren beanspruchen<br />
den Raum, in dem heute<br />
allein Lager und Bremsen untergebracht<br />
sind. Zugleich erhöhen<br />
die E-Motoren die ungefederten<br />
Massen. Gefragt sind daher<br />
Dämpfer mit adaptiver Wirkung,<br />
um besser mit unterschiedlichen<br />
Beladungszuständen und Fahrbahnqualitäten<br />
fertig zu werden.<br />
Geforscht wird deswegen an Betriebs-<br />
und Feststellbremsen, die<br />
sich raumsparend in die Radnabenantriebe<br />
integrieren lassen.<br />
Ein französisches Forscherteam<br />
arbeitet an magnetorheologischen<br />
Bremsen, die dank einer<br />
piezoaktorischen Schwingungsanregung<br />
eine erhöhte Effizienz<br />
besitzen. Diese Bremsen können<br />
kleiner und leichter dimensioniert<br />
werden.<br />
Jürgen Rödel von der TU Darmstadt<br />
weist mit seinem Forscherteam<br />
einen Weg hin zu bleifreien<br />
Piezoaktoren. Dabei setzen die<br />
Materialwissenschaftler auf Barium-Titanat<br />
mit komplexen Rezepturen.<br />
Damit soll es möglich werden,<br />
Injektoren für die Hochdruckeinspritzung<br />
von Kraftstoff<br />
und die Ultraschallsensoren von<br />
Einparkhilfen ‚bleifrei‘ herzu -<br />
stellen.<br />
Die Forschungsfortschritte werden<br />
auf der Konferenz und Ausstellung<br />
„Actuator“ vom 13. bis<br />
15. Juni 2016 in der Messe Bremen<br />
gezeigt und diskutiert.<br />
www.actuator.de<br />
Urea-Sensor von Continental<br />
Mit Ultraschall AdBlue von außen messen<br />
Viele Personenwagen und Nutzfahrzeuge<br />
mit Dieselmotor verfügen<br />
bereits über ein SCR-System.<br />
Durch Reaktion mit einer wässrigen<br />
Harnstofflösung („AdBlue“<br />
bzw. Urea-Lösung) werden im<br />
Abgasstrang chemisch<br />
Stickoxide zu Stickstoff<br />
(N2) und Wasser<br />
verwandelt<br />
(„reduziert“).<br />
Dieses Verfahren<br />
funktioniert<br />
umso besser,<br />
je genauer die Menge der<br />
eingespritzten Harnstofflösung<br />
dosiert wird. Dafür ist es erforderlich,<br />
die Konzentration des Harnstoffs<br />
zu bestimmen. Für diese<br />
Aufgabe geht jetzt erstmals ein<br />
Urea-Sensor des von Continental<br />
in Produktion. Dieser kann sowohl<br />
Qualität, als auch Füllstand<br />
und Temperatur der Urea-Lösung<br />
im Tank messen.<br />
Der Sensor nutzt Piezoelemente,<br />
ein NTC-Thermometer und einen<br />
ASIC, die Continental bereits für<br />
die Ölstandsbestimmung einsetzt.<br />
Ultraschallsignale messen<br />
sowohl den Harnstoffanteil im<br />
Wasser, als auch den Füllstand im<br />
Tank. Dazu kann der Urea-Sensor<br />
wahlweise in den Tank oder in<br />
die Dosiereinheit eingeschweißt<br />
werden.<br />
Die Einspritzmenge der Urea-Lösung<br />
muss bedarfsgerecht, also<br />
je nach Motorlast,<br />
berechnet werden.<br />
Für die Berechnung<br />
der<br />
korrekten<br />
Einspritzmenge<br />
spielt<br />
der tatsächliche<br />
Harnstoffgehalt in der Ad-<br />
Blue-Lösung (ihre Qualität) eine<br />
Rolle. Außerdem darf die Urea-Lösung<br />
nicht zu kalt sein. Dank der<br />
Ultraschallmesstechnik ist es<br />
möglich, die Flüssigkeit von außen<br />
zu messen, was auch der<br />
Frostsicherheit des Urea-Systems<br />
zugute kommen kann.<br />
Der Urea-Sensor kann alle Daten<br />
als Eingangsgröße für die AdBlue-<br />
Zumessung liefern. Um auch bei<br />
einer Neigung des Fahrzeugs den<br />
korrekten Füllstand bestimmen<br />
zu können, liefert ein zweiter Füllstandsmesspfad<br />
auch in Schräglagen<br />
zuverlässig ein Signal.<br />
www.continental.de<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 43
ANTRIEB + ANTRIEBSSTRANG<br />
Continental-Bauteil für Anwendung in Premiumfahrzeugen<br />
Getriebeadapter ist 55 Prozent leichter als die Aluminiumvariante<br />
Bei Leichtbau-Komponenten spielen<br />
technische Kunststoffe eine<br />
immer wichtigere Rolle. ContiTech<br />
hat jetzt einen neuen Getriebeadapter<br />
für Pkw auf den Markt gebracht.<br />
Das Besondere: Durch die<br />
Verwendung des glasfaserverstärkten<br />
Polyamids Ultramid der<br />
BASF ist das Bauteil<br />
um 55 % leichter als<br />
die bisher eingesetzte<br />
Aluminiumvariante.<br />
Der Getriebeadapter<br />
kommt erstmals in<br />
der neuen Mercedes-Benz<br />
E-Klasse<br />
zum Einsatz. Er ist<br />
ein zentraler Bestandteil<br />
der Lagerung des 9G-TRONIC-<br />
Getriebes und soll zukünftig<br />
ebenfalls in Modellen der Mercedes-Benz<br />
C- und S-Klasse eingesetzt<br />
werden.<br />
Möglich wird die starke Gewichtsreduktion<br />
durch eine optimale<br />
Materialausnutzung. Im Pkw eingesetzt,<br />
steht der Getriebeadapter<br />
im direkten Kraftfluss zwischen<br />
dem Getriebe und dem<br />
Chassis. Diesen Belastungen soll<br />
er dauerhaft und zuverlässig<br />
standhalten. Das Bauteil ist für<br />
Premiumfahrzeuge vorgesehen<br />
und erfülle laut Hersteller deren<br />
hohe Anforderungen hinsichtlich<br />
Komfort, Lebensdauer und<br />
Crashsicherheit.<br />
ContiTech stellt seit 2006 Leicht-<br />
baukomponenten für die Automobilbranche<br />
aus Hochleistungspolyamiden<br />
her. Hierzu gehören unter<br />
anderem hochbelastbare Motorlager,<br />
von denen 2013 über<br />
drei Millionen Stück gefertigt wurden.<br />
2014 stellte ContiTech zudem<br />
den ersten Getriebequerträger<br />
aus dem Hochleistungspolyamid<br />
für die Hinterachse vor. Im<br />
Jahr 2015 folgte das erste Federbeinstützlager,<br />
das im Pkw-Fahrwerk<br />
sowohl an der Vorder- wie<br />
Hinterachse zum Einsatz kommt.<br />
Auch Pendel- und Drehmomentstützen<br />
aus Polyamid hat Conti-<br />
Tech bereits millionenfach ge -<br />
liefert.<br />
www.contitech.de<br />
FEV realisiert kompaktes Automatikgetriebe für Stadtfahrzeuge<br />
Günstig dank Serienteilen<br />
Ein kompaktes Doppelkupplungsgetriebe<br />
speziell für Kleinwagen<br />
hat der Aachener Engineering-<br />
Dienstleister FEV entwickelt. Das<br />
5DCT130-Getriebe verfügt über<br />
fünf Gänge und ist für ein Drehmoment<br />
von 130 Nm ausgelegt.<br />
Es unterstützt ein schnell arbeitendes<br />
Motor-Start/Stopp-System,<br />
eine Segelfunktion mit ausgeschalteter<br />
Verbrennungskraftmaschine<br />
und verfügt über eine<br />
Park-by-Wire-Funktion.<br />
Mit Blick auf die Kostentreiber<br />
greift FEV für das Doppelkupplungsgetriebe<br />
auf bestehende Serienkomponenten<br />
zurück, die aufgrund<br />
hoher Fertigungszahlen<br />
vergleichsweise<br />
günstig zu beschaffen<br />
sind. Gleichzeitig entspricht<br />
das Getriebe –<br />
dank nur einer Triebwelle<br />
– den Bauraumvorgaben<br />
eines schlanken Getriebes<br />
für das Kleinwagensegment.<br />
Um die Kupplungsregelung<br />
und -kühlung zu realisieren,<br />
haben sich die<br />
Experten für eine verbrennungsmotorisch<br />
betriebene Pumpe<br />
entschieden, deren Hydraulikventile<br />
aus dem Zuliefererregal<br />
stammen. Der bedarfsgerechte<br />
elektromechanische Aktuator des<br />
Gangstellers ist ebenfalls ein führendes<br />
Serienprodukt und steuert<br />
die zusätzliche Park-by-Wire-<br />
Funktion bei. Neben dem Gangaktuator<br />
kommen zudem Bauteile<br />
aus dem Regal in Form von Anbau-Steuergerät,<br />
Doppelkupplung<br />
und Differenzial, Serien-Synchronisierungen<br />
sowie ausschließlich<br />
Katalog-Wälzlager<br />
zum Einsatz.<br />
www.fev.de<br />
BorgWarners stattet Geelys Elektroauto mit eGearDrive-Getriebe aus<br />
Laufruhe und erhöhte Reichweite<br />
BorgWarners eGearDrive-Getriebe<br />
wird Geelys EC7-EV<br />
Limousine antreiben.<br />
Ein 95 kW<br />
(129 PS) starker<br />
Elektromotor, der<br />
bei einer Reichweite<br />
von 253 km eine<br />
Höchstgeschwindigkeit<br />
von<br />
140 km/h ermöglicht,<br />
treibt das erste in Serie produzierte Elektroauto<br />
des chinesischen Herstellers an. BorgWarners<br />
speziell für den wachsenden Elektrofahrzeug-Markt<br />
entwickeltes eGearDrive-Getriebe soll einen hocheffizienten<br />
Getriebezug für eine erhöhte Reichweite<br />
und große Laufruhe bieten. Zudem ist es mit individuell<br />
anpassbaren Übersetzungsverhältnissen für<br />
verschiedene Motorgrößen verfügbar.<br />
BorgWarners kompaktes eGearDrive-Getriebe verbinde<br />
eine hohe Drehmomentkapazität mit einem<br />
reibungslosen, ruhigen Betrieb. Der laut Hersteller<br />
hocheffiziente Getriebezug und die platzsparende,<br />
leichte Bauweise des eGearDrive-Getriebes sollen<br />
zu einer erhöhten Reichweite beitragen, was wiederum<br />
die benötigte Batteriekapazität reduziert. Darüber<br />
hinaus ist ein elektronisch betätigtes Parksperrsystem<br />
verfügbar. Rund 99 % der im eGearDrive-Getriebe<br />
verwendeten Materialien sind recycelbar.<br />
www.borgwarner.com<br />
44 AutomobilKonstruktion 2/2016
Modulare Lösungsansätze für den Antriebsstrang<br />
Elektrifizierung über die gesamte Bandbreite<br />
Mit dem Hochvolt-Hybridmodul in<br />
P2-Anordnung zeigt Schaeffler einen<br />
neuen Ansatz zur Elektrifizierung<br />
des Antriebsstrangs, der modular<br />
angepasst werden kann.<br />
Das Modul besteht aus einer automatisierten<br />
Trennkupplung und<br />
der elektrischen Maschine. Die<br />
Trennkupplung wird mittels eines<br />
elektromechanischen Zentralausrückers<br />
betätigt, der über einen<br />
Kugelgewindetrieb die Kupplung<br />
mechanisch ohne eine hydraulische<br />
Übertragungsstrecke betätigt.<br />
Dadurch wird außerhalb des<br />
Moduls kein weiterer Bauraum für<br />
die Aktorik benötigt. Zur Übertragung<br />
der Zugmomente des Verbrennungsmotors<br />
in Richtung Getriebe<br />
kommt ein Freilauf zum<br />
Einsatz, während Drehmomente<br />
in Richtung des Verbrennungsmotors<br />
über die Kupplung geführt<br />
werden. So soll die Kupplung<br />
trotz hoher Drehmomente<br />
schlank dimensioniert<br />
werden<br />
können.<br />
Mit seiner Variabilität<br />
und dem Drehmomentbereich<br />
von bis zu<br />
800 Nm kann das P2-Hybridmodul<br />
sowohl in 48-Volt-Architekturen,<br />
als auch in Hochvolt-Antriebskonzepten<br />
zum Einsatz<br />
kommen. Bei dem Hybridmodul<br />
ist der E-Maschine ein Dämpfer<br />
vorgeschaltet. Kommt der mechanische<br />
Dämpfer in schwingungstechnisch<br />
anspruchsvollen Drehzahlbereichen<br />
an seine Grenzen,<br />
greift der Elektromotor ein und<br />
garantiert durch eine aktive<br />
Dämpfung die Erfüllung der akustischen<br />
Anforderungen. Für den<br />
amerikanischen Markt wurde eine<br />
Variante des P2-Hybridmoduls<br />
mit integriertem Drehmomentwandler<br />
entwickelt.<br />
Während derzeitige Hybridfahr-<br />
zeuge mit hohen Spannungen<br />
von über 300 V arbeiten, setzt<br />
Schaeffler auch auf ein 48-Volt-<br />
Bordnetz, um rein elektrisches<br />
Fahren in niedrigen Geschwindigkeitsbereichen<br />
zu realisieren. Aktuell<br />
hat Schaeffler ein Konzeptfahrzeug<br />
mit einem neuen<br />
TDA-System (Transmission Driven<br />
Accessories) ausgestattet. Das<br />
System treibt die Nebenaggregate<br />
mittels einer 48-Volt-E-Maschine<br />
an. Dadurch entfällt der konventionelle<br />
Riementrieb, die Nebenaggregate<br />
können unabhängig<br />
angetrieben werden. So lassen<br />
sich z.B. Boosten oder Segeln<br />
realisieren.<br />
www.schaeffler.de<br />
Volvo-Getriebe für Lkw<br />
Anfahren aus dem Stand mit 325 Tonnen<br />
Die neue I-Shift-Version von Volvo Trucks<br />
macht es möglich, zwei Kriechgänge hinzuzufügen.<br />
Das bedeutet unter anderem, dass der<br />
Lkw mit einem Gesamtzuggewicht von bis zu<br />
325 t aus dem Stand anfahren kann. So kann<br />
der Lkw zudem mit extrem niedrigen Geschwindigkeiten<br />
von 0,5 bis 2 km/h fahren.<br />
Das sei bei präzisen Fahrmanövern, wie sie<br />
bei Baustelleneinsätzen und Instandhaltungsarbeiten<br />
erforderlich sind, enorm hilfreich.<br />
Für Transportunternehmen, die Schwertransporte<br />
auf schwierigem Untergrund durchführen,<br />
aber auch auf normalen Autobahnen unterwegs<br />
sind, sollen die Kriechgänge außerdem<br />
hohe Flexibilität und Potenzial zum Kraftstoff<br />
bieten.<br />
Das Getriebe ist als Direct Drive- oder Overdrive-Getriebe<br />
mit einem oder zwei Kriechgängen<br />
erhältlich. Außerdem können zwei Rückwärtskriechgänge<br />
spezifiziert werden. Dies<br />
sei ein Vorteil bei Rückfahrmanövern, die große<br />
Präzision erfordern. I-Shift-Crawler ist eine<br />
Weiterentwicklung des automatisierten<br />
I-Shift-Getriebes von Volvo Trucks.<br />
Das Getriebe ist 12 cm länger als eine herkömmliche<br />
I-Shift-Einheit. Bei einem Getriebe<br />
mit einem einzigen Kriechgang beträgt die<br />
Übersetzung 19:1 bei einem Direct Drive-Getriebe<br />
bzw. 17:1 bei einem Overdrive-Getriebe.<br />
(Die Übersetzung des kleinsten Gangs bei einem<br />
normalen I-Shift-Direct Drive-Getriebe beträgt<br />
15:1). Bei einem Direct Drive- oder Overdrive-Getriebe<br />
mit zwei Kriechgängen beträgt<br />
die kleinste Übersetzung 32:1. Die Übersetzung<br />
des kleinsten Rückwärtsgangs beträgt<br />
37:1 bei einem Direct Drive-Getriebe.<br />
www.volvotrucks.com<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 45
AUS DER FORSCHUNG<br />
E-Motoren beleben die Branche<br />
Alte Ideen aktuell interpretiert – oder völlig neue Konzepte<br />
Gefördert durch das Trendthema<br />
Elektromobilität verzeichnet die<br />
E-Motorenbranche einen Innovationsschub.<br />
Dabei laufen auch völlig neue<br />
Spieler auf den Platz. Wir haben uns<br />
bei einigen umgesehen.<br />
Der Dynax MGi25–48<br />
von Compact Dynamics<br />
hat das Prinzip der Axialflussmotoren<br />
wieder<br />
aufgegriffen, weil damit<br />
am Besten die Anforderungen<br />
für die E-Mobilität erfüllt werden<br />
könnten<br />
Bild: Compact Dynamics<br />
Der Autor: Tobias Meyer ist freier Mitarbeiter<br />
der AutomobilKonstruktion<br />
Fabian Lorenz (l.) und Johannes<br />
Rudolph von der TU Chemnitz beim<br />
Einrichten des neuen Multi-Materialdruckers,<br />
der bis zu drei Werkstoffe<br />
parallel verarbeitet und höhere<br />
Druckgeschwindigkeiten erreicht<br />
Bild: TU Chemnitz/Uwe Meinhold<br />
Einer der Neulinge könnte etwa die Firma<br />
Compact Dynamics aus Starnberg sein, sie hat<br />
ein neuartiges E-Motorenkonzept entworfen,<br />
das auf der bereits 1895 patentierten Transversalflussmaschine<br />
beruht. Derzeit sind bei<br />
Elektrofahrzeugen aufgrund der hohen Batteriespannungen<br />
(300 - 800 V) umfassende<br />
Schutzmaßnahmen notwendig. Diese könnten<br />
entfallen, wenn der Antrieb im Niederspannungsbereich<br />
unter 60 V mithilfe eines Axialflussmotors<br />
betrieben wird. Durch den extrem<br />
einfachen Aufbau der Kupferwicklungen verläuft<br />
der magnetische Fluss, im Gegensatz zu<br />
konventionellen Elektromotoren, nicht quer,<br />
sondern parallel zur Drehachse. Zurzeit werden<br />
diese Motoren in Kleinserien vorwiegend<br />
handgefertigt. Die im Projekt GroAx entwickelten<br />
Verfahren sollen eine Großserienfertigung<br />
des Axialflussmotors ermöglichen (Zielgröße<br />
50 000 Stück pro Jahr) und gleichzeitig zu einer<br />
Reduktion der Herstellkosten um über<br />
60 % bei optimierten technischen Eigenschaften<br />
führen. Unter anderem werden ein dreidimensionales<br />
Nasswickelverfahren zur Herstellung<br />
der Rotorglocke und eine komplett sensorlose<br />
Motorregelung erarbeitet.<br />
Der permanenterregte dreiphasige E-Motor ist<br />
einfach aufgebaut und kann durch simple<br />
Größenänderung auf andere Leistungsklassen<br />
skaliert werden. Hierbei wird im Wesentlichen<br />
nur auf eine andere Wicklung und Leistungselektronik<br />
gesetzt, die Aktivkomponenten für<br />
beide Anwendungen sind baugleich, was zu<br />
Kostenvorteilen führt. Die Maschinen sind auf<br />
48-V- und Hochvoltanwendung anpassbar.<br />
Man habe den Transversalfluss als Basis für<br />
die sogenannte Dynax-Technologie weiterentwickelt,<br />
womit bisher nicht erreichte Leistungsdichten<br />
nun möglich würden. Bei einer<br />
Spannung von unter 60 V erreiche man 25 kW<br />
und mehr bei Drehzahlen von bis zu 10 000<br />
min -1 . Das volle Drehmoment liegt dabei bereits<br />
ab Drehzahl 1 an. Mit der Tangentialwicklung<br />
sei es laut Compact Dynamics zudem<br />
möglich, das eingesetzte Kupfer zu 100 %<br />
drehmomentbildend zu verwenden, da kein<br />
zusätzlicher Platz für Wickelköpfe notwendig<br />
ist. „Aktuell stellt der Dynax in der 48V-Anwendung<br />
den technischen Benchmark für Motoren<br />
dieser Größe mit einer Peakleistung von<br />
mehr als 25 kW (bei 58V Zwischenkreisspannung)<br />
– eine Leistungsklasse, bei der herkömmliche<br />
Asynchronmotoren nicht mehr eingesetzt<br />
werden können“, erklärt Projektleiter<br />
Oliver Schwab.<br />
Neue Konzepte schaffen Platz und Sicherheit<br />
Durch die Elektromobilität ergeben sich für<br />
die Automotive-Branche völlig neue Möglichkeiten.<br />
So wird etwa am Fraunhofer-Institut für<br />
Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung<br />
IFAM in Bremen derzeit ein luftgekühlter<br />
Radnabenmotor entwickelt. Diese<br />
Technik soll Kosten und Energieverbrauch von<br />
Elektrofahrzeugen senken, ganz einfach durch<br />
den Wegfall des klassischen mechanischen<br />
Antriebsstranges aus Kupplung, Getriebe, Differentialen<br />
und Antriebswellen. Zugleich vergrößert<br />
dies das Platzangebot im Fahrzeug<br />
und ermöglicht die Realisierung aktiver Fahrsicherheitskonzepte<br />
durch unabhängige Drehmomenteinstellung<br />
an jedem angetriebenen<br />
46 AutomobilKonstruktion 2/2016
Rad. „In den letzten 50 Jahren hat sich immer<br />
wieder gezeigt: Wenn irgendwo Mechanik<br />
wegfällt und Elektronik dafür kommt, wird es<br />
billiger“, so Projektleiter Hermann Pleteit.<br />
Flexibel für Nutzfahrzeuge<br />
Das Projekt Eskam wird durch die Groschopp<br />
AG koordiniert. Die Motivation dazu resultierte<br />
aus der Erkenntnis, dass hierzulande zwar<br />
sehr starke Innovationen entstehen, es häufig<br />
aber an geeigneten Technologien für eine Serienfertigung<br />
fehlt. Auch bezüglich Wirkungsgrad<br />
und Leistungsdichte sei noch nicht das<br />
Optimum erreicht, Reserven gebe es auch bezüglich<br />
Kompaktheit und Gewicht. Meist bezieht<br />
sich die Entwicklung zudem auf ein ganz<br />
spezifisches Fahrzeug, die Übertragbarkeit<br />
des Konzepts auf andere Typen ist nicht gewährleistet,<br />
es muss wieder neu entwickelt<br />
werden. Viele Lösungen gibt es bereits für<br />
Pkw – insbesondere bei Nutzfahrzeugen, speziell<br />
auch bei Kommunal- oder Agrarfahrzeugen,<br />
gibt es jedoch kaum brauchbare Lösungen.<br />
Zur Eliminierung möglichst all dieser Defizite<br />
wurde das Projekt Eskam initiiert.<br />
Das Herzstück des Antriebsmoduls umfasst<br />
dabei zwei schnell drehende elektrische Maschinen<br />
mit je einem mechanischen Getriebe<br />
und gemeinsamer Leistungselektronik. Die<br />
kurze Verbindung zu den Rädern übernimmt<br />
ein Subframe. Wesentliche Zielstellung des<br />
Gesamtkonzepts war eine maximale Skalierbarkeit<br />
der Komponenten. Dies gilt einerseits<br />
für die bauraumabhängigen Einbaubedingungen<br />
(Vorder- und Hinterachse – bei weitgehender<br />
Freiheit bezüglich der Wahl der Winkellage),<br />
andererseits jedoch auch für die Einstellung<br />
der Leistungsparameter, die für Kleinfahrzeuge<br />
oder auch Busse und Trucks benötigt<br />
werden. Die Auslegung der Komponenten<br />
basiert auf realitätsnahen Fahrzyklen, wobei<br />
ein geringer Kosten- und<br />
Materialaufwand sowie eine hohe Energieeffizienz<br />
angestrebt wurden. Die Technologien für<br />
die einzelnen Bauteile von Motor und Getriebe<br />
sollen für den Leichtbau geeignet und absolut<br />
serientauglich sein.<br />
Die fremd erregten Sychronmaschinen zeichnen<br />
sich durch eine hohe Leistungsdichte aus<br />
und können energie- und wirkungsgradoptimal<br />
betrieben werden. Als Motorleistung wurden<br />
2 x 20 kW im Dauerbetrieb mit einer maximalen<br />
Drehzahl von 20 000 min -1 konzipiert<br />
und erzielt. Die erstellten Demonstratoren,<br />
die besonders geeignet sind für Kommunalfahrzeuge,<br />
wurden erfolgreich getestet und<br />
sind konzeptionell bezüglich der Parameter<br />
absolut skalierbar auf andere Fahrzeugvarianten,<br />
bis hin zu Bussen und Trucks. Zwei<br />
gleichwertige Regler steuern die E-Maschinen<br />
unabhängig, sodass auf ein Differenzial verzichtet<br />
werden kann und das Fahrzeug auch<br />
mit nur einer Antriebsseite manövrierfähig<br />
bleibt. Die Ölkühlung der Motoren übernimmt<br />
gleichzeitig die Schmierung des Getriebes.<br />
Das Magnesiumgehäuse kommt mit 5 mm<br />
Wandstärke aus. Die komplette Antriebseinheit<br />
wiegt 86 kg, ein potentielles Nutzfahrzeug<br />
könnte mit 1300 kg Eigengewicht nochmals<br />
700 kg zuladen. Dabei wird eine Steigfähigkeit<br />
von 30 % angestrebt, die Höchstgeschwindigkeit<br />
liegt bei 120 km/h.<br />
E-Motor aus dem 3D-Drucker<br />
Bei den klassischen Fertigungsverfahren wie<br />
dem Stanzen von Elektroblechen oder dem<br />
Wickeln von Kupferspulen waren in den vergangenen<br />
Jahren nur geringe Kostenreduktionen<br />
möglich. Ziel des Projekts PriMa3D der TU<br />
Chemnitz, dem Fraunhofer IFAM Dresden und<br />
Wittenstein ist es, den Elektromotor mithilfe<br />
des 3D-Drucks herzustellen. Johannes Rudolph<br />
und Fabian Lorenz haben im Labor der<br />
TU Chemnitz bereits ein fünf Zentimeter großes<br />
Teil, das in einem Elektromotor als Magnetkreis<br />
fungieren soll, in einem von ihnen<br />
In Elektro-Nutzfahrzeugen der Zukunft ist der Antrieb<br />
in die Achse integriert. Die Eskam-Module aus Antrieb<br />
und Achse sind auf verschiedene Fahrzeugtypen<br />
skalierbar<br />
Bild: Fraunhofer IWU / Hochschule für Wirtschaft und Technik, Aalen<br />
entwickelten 3D-Druckverfahren gefertigt.<br />
„Unser 3D-Drucker besteht zu einem großen<br />
Teil auf Standardbauteilen – wir haben bereits<br />
bekannte additive Technologien kombiniert<br />
und modifiziert“, erläutert Rudolph. Gedruckt<br />
werde mit einer speziell hergestellten neuartigen<br />
Paste, die aus feinem Metall- oder Keramikpulver<br />
und Bindemitteln besteht. „Durch<br />
den Einsatz verschiedener Druckköpfe lässt<br />
sich das Gerät zudem schnell für unterschiedliche<br />
Druckjobs umrüsten“, ergänzt Lorenz.<br />
Die Vorteile des 3D-Druckverfahrens liegen<br />
aus Sicht der Forscher vor allem darin, dass<br />
es preisgünstig und sehr flexibel ist.<br />
„Inzwischen sind die Grundzüge und die Entwicklungsrichtung<br />
unseres Verfahrens klar“,<br />
sagt Rudolph. So wächst im Drucker ein durch<br />
Aushärtung bereits verfestigtes, aber noch<br />
nicht belastbares Werkstück – der sogenannte<br />
Grünling. Durch eine Wärmebehandlung<br />
versintert er anschließend zu einem stabilen<br />
Körper. Als Beispiele nennen die Forscher hitzebeständige<br />
elektrische Antriebe, bei denen<br />
die isolierende Keramikummantelung gleich<br />
mitgedruckt wird.<br />
TU Chemnitz<br />
Tel.: +49 371 531-38938<br />
johannes.rudolph@etit.tu-chemnitz.de<br />
Compact Dynamics GmbH<br />
Tel.: +49 8151 9043-74<br />
oliver.schwab@compact-dynamics.de<br />
Groschopp AG<br />
Tel.: +49 2162 374-102<br />
pflug@groschopp.de<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 47
FAHRWERK<br />
Hoher Winkelausgleich, große Toleranzen<br />
Spezielles 4-Punkt-Lager für Lenksäulen ermöglicht Durchmessertoleranzausgleich von bis 0,11 mm<br />
Bei Standardlagern, wie sie auch<br />
bei Lenksäulen in Fahrzeugen zum<br />
Einsatz kommen, müssen Gehäuse<br />
und Lenkwelle in der Regel einen<br />
sehr präzisen Passungs-Sitz, zum<br />
Beispiel von h6, aufweisen und<br />
daher nach dem Urformprozess<br />
nachbehandelt werden. Um diesen<br />
aufwändigen und kostspieligen Fertigungsschritt<br />
zukünftig vermeiden<br />
zu können, ließ ein Zulieferunternehmen<br />
für eine Lenksäule von den<br />
Experten der Rollax GmbH & Co. KG<br />
eigens ein Speziallager entwickeln.<br />
Das von Rollax entwickelte Speziallager für<br />
eine Lenksäule wird in Fahrzeugen eines<br />
deutschen Automobilherstellers eingesetzt<br />
Bilder: Rollax GmbH & Co. KG<br />
Das 4-Punkt-Lager fängt Winkelfehler der<br />
Lenkwelle bis zu 3° sowie Koaxialitätsfehler<br />
und Durchmessertoleranzen von Welle und<br />
Gehäuse bis zu 0,11 mm ab. Da Rollax-Lager<br />
im Gegensatz zu Katalogware in Bauform und<br />
Größe variabel sind und präzise auf den jeweiligen<br />
Anwendungsfall angepasst werden<br />
können, lassen sich auch zusätzliche Sonderfunktionen,<br />
wie beispielsweise eine einstell-<br />
Die Autorin: Iris Gehard aus München,<br />
freie Redakteurin für Rollax, Bad Salzuflen<br />
bare Reibung, unkompliziert umsetzen.<br />
Bei Standardlagern aus 100Cr6 werden Außen-<br />
und Innenring gedreht, gehärtet und anschließend<br />
gehohnt. Sie weisen dadurch eine<br />
geringe Reibung sowie eine hohe Präzision<br />
auf und eignen sich besonders für hohe Geschwindigkeiten,<br />
haben jedoch einen gravierenden<br />
Nachteil: Die Lager haben feste Größen<br />
und benötigen zur einwandfreien Funktion<br />
gegenüber Gehäuse und Welle eine Passungstoleranz<br />
von beispielsweise h6, im vorliegenden<br />
Fall also 13 bis 20 μm. Winkel- und<br />
Koaxialfehler werden gar nicht kompensiert,<br />
so dass die umgebenden Komponenten diese<br />
aufnehmen müssen. Da es sich beim Gehäuse<br />
allerdings um eine Schweißbaugruppe handelt,<br />
ist der Lagersitz derartigen Fehlern unterworfen,<br />
die dann bei der Fertigung in einem<br />
nachgelagerten Dreh-/Fräs- beziehungsweise<br />
Schleifprozess ausgeglichen werden müssen.<br />
Spezialanfertigung mit hohem Toleranzausgleich<br />
Um bei einer Lenksäule, die in Fahrzeugen eines<br />
deutschen Automobilherstellers eingesetzt<br />
wird, auf diesen Aufwand verzichten zu<br />
können, ließ ein Zulieferer ein spezielles Lager<br />
von Rollax entwickeln: „Die Vorgabe war,<br />
dass das Lager eine mögliche Misslage der<br />
48 AutomobilKonstruktion 2/2016
Patrick Berges, Projektleiter bei der<br />
Rollax: „Wir passen uns soweit irgend<br />
möglich den Bauteilen des Kunden an –<br />
im Fall des 4-Punkt-Lagers beispielsweise<br />
an die Maße der Lenkwelle.“<br />
Das 4-Punkt-Lager besitzt einen tiefgezogenen<br />
Außenring sowie einen Innenring,<br />
der in einer besonderen Wellen-Form<br />
hergestellt wurde<br />
Lenkwelle sowie mögliche Koaxialitäts-Fehler<br />
von Lenksäulengehäuse und Lenkwelle kompensiert“,<br />
erklärt Patrick Berges, Projektleiter<br />
bei der Rollax GmbH & Co. KG in Bad Salzuflen.<br />
„Gehäuse- und Lenkwellentoleranzen<br />
sollten ebenfalls so gut wie möglich ausgeglichen<br />
werden.“ Rollax konstruierte daher ein<br />
4-Punkt-Lager, dessen Außenring tiefgezogen<br />
und dessen Innenring in einer besonderen<br />
Wellen-Form hergestellt werden, wodurch es<br />
deutlich leichter ist, als die gedrehte Variante.<br />
Diese neue Konstruktion konnte die Ansprüche<br />
des Projektes sogar übertreffen und Winkel-<br />
sowie Koaxialitätsfehler von Welle und<br />
Gehäuse deutlich mehr als im geforderten<br />
Maße ausgleichen. Durch die spezielle Werkstoffwahl<br />
können die Durchmessertoleranzen<br />
im Gehäuse vollständig kompensiert werden.<br />
Darüber hinaus sorgt die spezielle Form des<br />
Innenrings dafür, dass die Durchmessertoleranz<br />
beziehungsweise die Rundheit der Lenkwelle<br />
im Zehntel-Millimeterbereich abgefangen<br />
wird, ohne die Stützwirkung zu vermindern.<br />
Zusätzlich sind zwei Toleranzringe im Inneren<br />
des Lagers aus Elastomeren gefertigt;<br />
das federnde Material unterstützt ebenfalls<br />
die Aufnahme von Abweichungen. „Dieses Zusammenspiel<br />
von Toleranzausgleichen und<br />
gleichzeitig hohen Belastungen umzusetzen,<br />
war bei der Konstruktion die größte Herausforderung“,<br />
so Berges. „Es gab viele Entwicklungsschleifen,<br />
um die geeignetsten Materialien<br />
und Formen zu finden.“ Für die auf niedrige<br />
Drehzahlen ausgelegten Lager verwendet<br />
Rollax zur Kostenoptimierung, wenn möglich,<br />
reine Ur- und Umformteile.<br />
Kein Schleifprozess mehr notwendig<br />
Insgesamt machen die Eigenschaften des<br />
neuen Lagers nun eine exakte Passung von<br />
Gehäuse und Welle überflüssig. Somit spart<br />
sich der Kunde eine Nachbehandlung des Gehäuses<br />
und der Welle nach dem Urformprozess.<br />
„Es ist kein Drehen und Fräsen oder<br />
Schleifen notwendig. Dadurch erzeugt das Lager<br />
große Kostenvorteile innerhalb der Applikation“,<br />
erklärt Berges. Da die Experten von<br />
Rollax bereits sehr früh in die Entwicklung der<br />
Lenksäule eingebunden wurden, konnte das<br />
Lager außerdem exakt auf Kundenmaß konstruiert<br />
werden.<br />
„Wir beraten Kunden im Vorfeld einer Entwicklung<br />
ausführlich und kostenlos, wie ein Lager<br />
aussehen kann, das nicht nur alle Anforderungen<br />
am besten in sich vereint, sondern auch<br />
besonders kosten- und anwendungsgerecht<br />
ist“, so Berges. „Wir passen uns also soweit<br />
irgend möglich den Bauteilen des Kunden an<br />
– im Fall des 4-Punkt-Lagers beispielsweise<br />
an die Maße der Lenkwelle.“ Bei Katalogware<br />
dagegen, die es nur in festgelegten Größen<br />
gibt, hätte der Automobilzulieferer die Konstruktion<br />
der Lenksäule auf den vorgegebenen<br />
Standard abstimmen, also bereits im Vorfeld<br />
auf bestimmte Freiheiten im Design sowie<br />
auf Möglichkeiten der Bauraum- und Funktionsoptimierung<br />
seines Systems verzichten<br />
müssen.<br />
Sonderfunktionen wie einstellbare Reibung<br />
Generell zeichnen sich Rollax-Lager aufgrund<br />
ihrer anwendungsbezogenen Entwicklung dadurch<br />
aus, dass sie in Bauform und Größe<br />
sehr variabel sind. Je nach Kundenwunsch<br />
können Toleranzen der Bohrung von 0,2 mm,<br />
der Welle von 0,11 mm sowie Koaxialitätsfehler<br />
von bis zu 0,5 mm kompensiert werden.<br />
Winkelfehler können bis zu 3° ausgeglichen<br />
werden, bei Pendellagern auch mehr. Zudem<br />
sind mehrere Funktionen in einem kundenspezifischen<br />
Lager vereinbar. So besteht auch<br />
die Option, die Reibung des Lagers nach dem<br />
Verbau einzustellen. Darüber hinaus können<br />
in das Lager Krampen für die axiale Sicherung<br />
eingefügt werden, so dass als weitere Einsparung<br />
der klassische Sprengring entfallen<br />
kann. Weitere Spezialanforderungen wie Kombinationslager<br />
aus Axial- und Radiallager können<br />
genauso umgesetzt werden wie unterschiedliche<br />
Dichtungskonzepte.<br />
„Wir ermöglichen unseren Kunden neue Möglichkeiten<br />
in der Entwicklung, insbesondere in<br />
der Auslegung bezüglich Bauraum und Funktionsintegration“,<br />
fasst Berges zusammen.<br />
„Häufig lohnt es sich bei einer Neuentwicklung,<br />
frühzeitig über die Lagerfunktionen<br />
nachzudenken anstatt Standards einzuzeichnen.<br />
Dabei unterstützen wir gerne.“<br />
Rollax GmbH & Co. KG<br />
Tel.: +49 5222 96330-0<br />
info@rollax.de<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 49
FAHRWERK<br />
Umweltschonendes Bremssystem<br />
Internationaler Entwicklungszusammenschluss<br />
Das Projekt Lowbrasys (LOW environmental<br />
BRAke SYStem) ist Ergebnis<br />
der Zusammenarbeit von<br />
Brembo, Ford, Continental Teves,<br />
Federal Mogul und Flame Spray<br />
mit dem Institut Mario Negri, der<br />
TU Ostrava, dem KTH Royal Institute<br />
of Technology, der Universität<br />
Trento und dem EC Joint Research<br />
Centre.<br />
Das im September 2015 begonnene<br />
Projekt wird in den nächsten<br />
36 Monaten weiterentwickelt, um<br />
Bremssysteme mit niedrigem Umwelteinfluss<br />
zu erfinden und zu<br />
demonstrieren, dass die Emissionen<br />
von Mikro- und Nanopartikeln<br />
um 50 % gesenkt werden<br />
können. Es konzentriert sich auf<br />
die folgenden Schwerpunkte:<br />
• Neuartig definierte Materialien<br />
Neue Materialklasse für Stoßdämpferdichtungen<br />
Komfort bei minus 40 Grad<br />
Mit einem neuen Hochleistungswerkstoff<br />
will Freudenberg Sealing<br />
Technologies dafür sorgen,<br />
dass Stoßdämpfer auch bei<br />
-40 °C ihre Funktion sicher erfüllen.<br />
Gleichzeitig ist die neue Materialmischung,<br />
die in Dämpferdichtungen<br />
für Pkw und Nutzfahrzeuge<br />
zum Einsatz kommt, deutlich<br />
verschleißbeständiger als<br />
konventionelle Werkstoffe.<br />
Um den Temperatureinsatzbereich<br />
von Fluorkautschuk-Werkstoffen<br />
zu erhöhen, werden spezielle<br />
Tieftemperatur-Polymere<br />
für Bremsbeläge und Scheiben,<br />
um die Gesamtpartikelemission<br />
wie auch die Umweltbelastung<br />
zu senken<br />
•Bremsstrategien zur Optimierung<br />
des Bremsvorgangs<br />
•Eine Technologie zum Auffangen<br />
der Teilchen nahe der<br />
Quelle<br />
•Systemintegration und Tests<br />
neuer Beläge, Scheiben, Komponenten<br />
sowie Steuerungssysteme<br />
in der Instrumententafel<br />
des Fahrzeugs<br />
• Verbesserung der Messtechniken<br />
und Erkennbarkeit von<br />
Bremswirkungen<br />
• Eine umfassende Untersuchung<br />
empfehlenswerter Fahrpraktiken<br />
www.brembo.com<br />
eingesetzt, die mit Peroxiden vernetzt<br />
werden. Normalerweise weisen<br />
solche Elastomere jedoch einen<br />
erhöhten Verschleiß auf. Da<br />
die höhere Kältebeständigkeit allein<br />
aus den verbesserten Materialeigenschaften<br />
resultiert, sind<br />
keine konstruktiven Änderungen<br />
am Stoßdämpfer notwendig. Daher<br />
können auch bestehende<br />
Fahrzeugmodelle nachträglich<br />
auf die neuen Dichtungen umgestellt<br />
werden.<br />
Eine weitere Anwendung für den<br />
neuen Werkstoff besteht in Stoßdämpfern<br />
für Nutzfahrzeuge.<br />
Um deren<br />
Anforderung zu erfüllen,<br />
werden Dämpferdichtungen<br />
hier mit<br />
einem Stahlring verstärkt.<br />
Kommt das<br />
neue Material von<br />
Freudenberg zum<br />
Einsatz, könnte die<br />
Konstruktion geändert<br />
werden.<br />
www.freudenberg.<br />
com<br />
Kombinierte Vorderachs- und Hinterachslenkung<br />
Doppelt lenkt sicherer<br />
Lenkung im Kunststoffgehäuse<br />
40 Prozent leichter<br />
Eine Neuheit präsentiert Tedrive<br />
mit dem Kunststoffgehäuse für<br />
mechanische Lenksysteme. So<br />
lässt sich laut Hersteller gegenüber<br />
Lösungen aus Aluminium eine<br />
Gewichtseinsparung von bis<br />
zu 40 % realisieren. Das Kunststoffgehäuse<br />
eigne sich besonders<br />
für den Einsatz in Kleinstund<br />
Kleinwagensegmenten sowie<br />
in Elektrofahrzeugen und kann<br />
darüber hinaus unter gewissen<br />
Rahmenbedingungen an die Lasten<br />
im unteren Mittelklassesegment<br />
angepasst werden. Zudem<br />
sei das Gehäuse kostenneutral im<br />
Vergleich zu Aluminium, unter anderem<br />
weil nach dem Spritzguss<br />
keine weitere maschinelle Bearbeitung<br />
nötig ist.<br />
Eine besondere Herausforderung<br />
lag für die Konstrukteure in den<br />
In neuen ZF-Testfahrzeug kommt<br />
die aktive Hinterachskinematik<br />
AKC zum Einsatz, die über eine<br />
gemeinsame Steuerungselektronik<br />
mit der elektrischen Servolenkung<br />
Dual Pinion EPS an der Vorderachse<br />
vernetzt ist. Um die Wirkungsweise<br />
zu verdeutlichen,<br />
lässt sich die aktive Hinterachskinematik<br />
aktiv hinzuschalten. Bei<br />
niedrigen Geschwindigkeiten bewegt<br />
AKC dann die Hinterräder in<br />
Gegenrichtung zum Lenkeinschlag<br />
der Vorderräder: Der Wendekreis<br />
des Fahrzeugs verkleinert<br />
sich zugunsten des Fahrkomforts.<br />
Geht es zügiger voran, lenken die<br />
Hinter- und Vorderräder in dieselbe<br />
Richtung, was die Stabilität<br />
des Fahrzeugs verbessert. Durch<br />
einen Lenkeinschlag aller Räder<br />
in dieselbe Richtung reduziert<br />
sich die Drehung des Fahrzeugs<br />
um die Hochachse, sodass ein sicheres<br />
Fahren möglich ist.<br />
Bei der Basisachse handelt es<br />
sich um eine modulare Weiterentwicklung<br />
einer Schräglenkerhinterachse.<br />
Dabei wurde der hintere<br />
der beiden radseitigen Kinematikpunkte<br />
des unteren Querlenkers<br />
durch einen Integrallenker<br />
ersetzt und ein Spurlenker ergänzt.<br />
Dieser definiert den Spurverlauf<br />
über dem Radhub und erlaubt<br />
eine präzise Einstellung der<br />
Vorspur. Alternativ zu einem bei<br />
Schräglenkerachsen üblichen Federbein<br />
ermöglicht der weit außen<br />
liegende Integrallenker die<br />
Verwendung von getrennten Federn<br />
und Dämpfern.<br />
www.zf.com<br />
hohen Belastungen und Temperaturbereichen,<br />
die auf einzelne<br />
Komponenten einwirken. Tedrive<br />
kooperierte deshalb eng mit den<br />
Werkstoffexperten eines führenden<br />
Kunststoffherstellers sowie<br />
dem erfahrenen Team der Josef<br />
Mawick Spritzgusstechnik, um<br />
ein optimales Zusammenspiel<br />
von Material und Konstruktion zu<br />
erhalten. Das Ergebnis ist ein robustes<br />
Gehäuse, das den Lebensdauertests<br />
von rund zehn Jahren<br />
oder 240 000 Kilometern standhält.<br />
Die Belastungstests bestätigten<br />
zudem einen möglichen<br />
Temperaturbereich von -40 bis<br />
+80 °C mit einer kurzfristigen maximalen<br />
Temperaturbelastung von<br />
105 °C.<br />
www.td-steering.com<br />
50 AutomobilKonstruktion 2/2016
Weiterfahrt bei nahezu jedem Reifenschaden<br />
Hightech-Kühlrippen steigern Notlauffähigkeit<br />
Bridgestone kündigt die Markteinführung des Touring-Reifens<br />
DriveGuard an. Er wurde entwickelt, damit sich Autofahrer<br />
zukünftig keine Sorgen mehr um Reifenschäden machen<br />
müssen – weder in der Lauffläche noch in der Seitenwand.<br />
Er ist nicht auf die Serienausstattung bestimmter<br />
Marken oder Modelle beschränkt und kann auf nahezu alle<br />
Pkw montiert werden, die mit Reifendruckkontrollsystem<br />
(RDKS) ausgerüstet sind. Das RDKS ist seit November<br />
2014 für alle Neuwagen in Europa Pflicht.<br />
Die neue DriveGuard-Technologie basiert auf Hightech-<br />
Kühlrippen (Cooling Fins) sowie stützenden, verstärkten<br />
und strapazierfähigen Seitenwänden. Diese soll es den<br />
Fahrern ermöglichen, auch trotz eines Reifenschadens die<br />
Kontrolle zu behalten sowie sicher und komfortabel noch<br />
weitere 80 km bei bis zu 80 km/h zu fahren – ausreichend<br />
LOCHLOS verschrauben<br />
... mit EJOT FDS ® Schrauben<br />
EJOT FDS®<br />
Die EJOT FDS ® <br />
<br />
<br />
FDS ® <br />
<br />
Entscheidender Vorteil ist die einseitige Zugänglichkeit bei der Monta-<br />
® <br />
<br />
Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrem nächsten Projekt!<br />
www.industrie.ejot.de<br />
EJOT Qualität verbindet ®<br />
EJOT GmbH & Co. KG Industrial Division<br />
INNOVATIVE CONNECTIVITY<br />
SOLUTIONS<br />
weit, um den Reifen sicher zu wechseln oder zu reparieren.<br />
Die hochentwickelte Polyester-Karkasse bietet eine<br />
hohe Widerstandsfähigkeit gegen Hitzeentwicklung und<br />
verbessert dadurch die Notlauffähigkeit des Reifens. Die<br />
Gummimischung mit Nano-Pro-Tech verringert die Reibung<br />
zwischen den Kohlenstoffmolekülen und damit auch die<br />
Hitzeentwicklung in der Seitenwand des Reifens. So soll<br />
der DriveGuard auch im Notlauf länger seine Form behalten.<br />
Die Kühlrippen an der Seitenwand des Reifens leiten<br />
die Reibungswärme von der Seitenwand ab, verlangsamen<br />
die Hitzeentwicklung und steigern somit die Sicherheit sowie<br />
die Notlauffähigkeit.<br />
Unabhängige Tests des TÜV Süd sollen belegen, dass der<br />
Reifen bei den für Autofahrer besonders wichtigen Leistungskriterien<br />
Sicherheit und Nässe ganz vorne liegt. Der<br />
Reifen sei zudem vollständig recycelbar.<br />
Der Bridgestone DriveGuard ist in Europa seit März in 19<br />
Sommer- und 11 Wintergrößen von 185/65 R15 bis<br />
245/40 R18 erhältlich. Die Größen kommen in mehreren<br />
Etappen auf den Markt.<br />
www.bridgestone.com<br />
CORE ULTIMATE FIBEROPTIC MINIMAX<br />
Rugged, sealed, circular connectors<br />
Over 30,000 references<br />
Cable assembly solutions<br />
Visit us at<br />
Sensor + Test 2016<br />
Hall 2, Stand 5-242<br />
THE RELIABLE EXPERT<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 51<br />
www.fischerconnectors.com
KAROSSERIE + INTERIEUR<br />
Der Neue mit 25 Jahren Erfahrung<br />
Thermoplastische Composites – vom Krallenprofil bis zum Organoblech<br />
Thermoplastische Carbon-Composites<br />
sind der jüngste Leichtbau-<br />
Trend. Für die Automobilindustrie<br />
ist diese Technik ziemlich neu. Doch<br />
nun betritt ein relativ unbekannter<br />
Player die Bühne, der 25-jährige<br />
Erfahrung mitbringt: Xperion ist<br />
Stamm zulieferer für Boeing und<br />
Airbus und fertigt solche Compo -<br />
sites im kontinuierlichen Prozess.<br />
Der Autor: Olaf Stauß, Redakteur Industrieanzeiger,<br />
Konradin Verlag, Leinfelden-Echterdingen<br />
„Performance Polymer Composites“ (PPC)<br />
nennt sich der Unternehmensbereich von<br />
Xperion, der in Markdorf jede Woche 3,5 km<br />
endlosfaserverstärkte Composite-Profile produziert.<br />
Der kleine Standort unweit des Bodensees<br />
ist im letzten Jahr enorm gewachsen.<br />
Die Mitarbeiterzahl ist von 24 auf 35 gestiegen,<br />
der Umsatz um 25 %. Die Profile sind aus<br />
thermoplastischen Composites, überwiegend<br />
mit Carbonfaser-Verstärkung. Sie gehen zu 80<br />
% in die Luftfahrtindustrie und werden dort im<br />
Interieur der Flugzeuge verbaut. Zum Beispiel<br />
in den Trägerkonstruktionen für die Gepäckfächer<br />
oder in den Unterbauten von Küchen und<br />
Toiletten – in diversen Ausführungen und<br />
Abmessungen. Auch flächige Composite-<br />
Sheets für Abdeckungen sind darunter.<br />
„Die endlosfaserverstärkten Thermoplastbauteile<br />
in der Boeing 787 stammen bestimmt zur<br />
Hälfte aus Markdorf“, schätzt Laurens de la<br />
Ossa, Senior Sales Manager. Die derzeit hoch-<br />
25 Jahre thermoplastische Composites im Serien -<br />
einsatz: Xperion PPC produziert Profile und Laminate<br />
für den Flugzeugbau und die Automobilindustrie<br />
Bild: Xperion<br />
laufende Produktion der B 787 steigert den<br />
Durchsatz mächtig. Darüber hinaus liefert<br />
Xperion PPC auch Composites für die<br />
Airbus-Maschinen A320, A330 und A350.<br />
Die Markterfolge im Flugzeugbau gaben jedoch<br />
nicht den Ausschlag, dass nun auch der<br />
Automotive-Sektor auf Xperion aufmerksam<br />
wird. Die Automobilindustrie hat die Vorteile<br />
thermoplastischer Composites erkannt: Sie<br />
sind genauso leichtgewichtig wie duromere<br />
Composites, können aber in kürzerer Zeit verarbeitet<br />
werden. Durch ihre Schlagzähigkeit<br />
bieten sie noch bessere mechanische Eigenschaften<br />
und eine höhere Schadenstoleranz,<br />
außerdem lassen sie sich recyceln.<br />
52 AutomobilKonstruktion 2/2016
Technologisch anspruchsvoll: Das „Krallenprofil“<br />
entsteht umformtechnisch durch<br />
intermittierende Pressenhübe<br />
Bild: Xperion<br />
Dass sie leicht sind, muss Laurens de la Ossa<br />
nicht betonen: Die Krallenprofile substituieren<br />
Alu-Strangpressprofile in Flugzeugen und<br />
sparen mehr als 40 % Gewicht ein<br />
Bild: Stauß<br />
Hinzu kommt eine Besonderheit in Markdorf:<br />
Xperion produziert die Composites-Profile<br />
durch „Conti nuous Compression Moulding“<br />
(CCM). Als Zwischenprodukt in dem kontinuierlichen<br />
Prozess entstehen flächige<br />
Laminate, die komplett konsolidiert sind. Sie<br />
werden inline im unmittelbar folgenden<br />
Schritt zum Profil umgeformt. Die hohe Qualität<br />
der Laminate ist die Voraussetzung dafür,<br />
dass das Umformen gelingt. Mit ihnen hat<br />
Xperion also jene Vorprodukte in der Hand,<br />
die die Automobilbauer benötigen, um sie als<br />
leichte „Organobleche“ wie Metallbleche umzuformen<br />
und ohne Mehraufwand in der Produktion<br />
eine Gewichtseinsparung beim Fahrzeug<br />
zu erreichen.<br />
Der CCM-Prozess ist 25 Jahre alt. Die ersten<br />
Profile wurden bei Dornier gefertigt. Boeing<br />
signalisierte großes Interesse an der Methode,<br />
sodass die Technologie auch nach Abwicklung<br />
von Dornier weiterentwickelt wurde<br />
– seit 2007 unter dem Dach der 200 Mitarbeiter<br />
umfassenden Xperion GmbH & Co. KG, die<br />
Compo sites für unterschiedliche Branchen<br />
produziert. Xperion wiederum gehört zur<br />
Avanco-Gruppe mit über 500 Beschäftigten<br />
und Euro-Umsätzen im dreistelligen Millio -<br />
nen bereich. Die Qualität der CCM-Produkte ist<br />
inzwischen besiegelt: Xperion PPC steht in der<br />
Qualified suppliers list von Boeing.<br />
„In den nächsten fünf Jahren werden wir unseren<br />
Umsatz in der Luftfahrt wahrscheinlich<br />
verdrei- oder verfünffachen“, schätzt de la Ossa.<br />
„Kommt das eine oder andere Automotive-<br />
Projekt dazu, könnten wir den Umsatz sogar<br />
verzehnfachen.“ Überlegungen für eine massive<br />
Vergrößerung der Produktionsfläche am<br />
Bodensee sind bereits im Gange.<br />
Composites mit gekonntem Lagen-Aufbau können<br />
Titan-Bauteile substituieren<br />
„Continuous Compression Moulding“ funktioniert<br />
so: Vor der Prozesskammer wird der Lagen-Aufbau<br />
aus UD-Tapes oder Prepregs vorbereitet.<br />
Auf bis zu 100 Rollen laufen kontinuierlich<br />
Bänder zusammen, die ihren Thermoplastanteil<br />
bereits in sich tragen. Die Lagen<br />
haben Faserrichtungen in 0°-, ±45°- und 90°-<br />
Richtung – je nach Maßgabe der zu erzielenden<br />
Composite-Eigenschaften. „Ordnet man<br />
die Fasern richtig an, kann man alles machen“,<br />
erläutert Laurens de la Ossa. „Beispielsweise<br />
Eigenschaften wie von<br />
Titan-Bauteilen erzielen. Macht man es aber<br />
falsch, landet man unterhalb des schlechtesten<br />
Aluminiums.“<br />
Im Werkzeug werden die Lagen gezielt aufgeheizt,<br />
dann durch intermittierende Pressenhübe<br />
in Form gebracht und schließlich gekühlt.<br />
Das klingt simpel. Das Know-how liegt jedoch<br />
in der komplizierten 3D-Kontur des Werkzeugs,<br />
in der Temperierkurve und in der zeitlich<br />
richtigen Abstimmung aller Parameter<br />
aufeinander.<br />
Die Liefermöglichkeiten reichen vom Laminat<br />
als Halbzeug über kleine Profilgeometrien bis<br />
hin zu meterlangen Composites, von denen<br />
eines auf der Messe JEC World zu sehen sein<br />
wird. Das größte Liefervolumen hat ein rund<br />
20 mm breites „Krallenprofil“ aus Carbon -<br />
faser-verstärktem Thermoplast für den Flugzeugbau.<br />
Als Kopie eines früheren Alu-Strangpressprofils<br />
spart es 40 % Gewicht ein und<br />
kann doch 30 % höhere Lasten aufnehmen –<br />
aus Vorsicht wurde es überdimensioniert.<br />
Die konstruktiven Möglichkeiten sind vielfältig.<br />
Auf de la Ossas Schreibtisch liegt ein Muster,<br />
das sich so dünn anfühlt wie eine Rasierklinge,<br />
nur 0,2 mm dick. Es umfasst nur zwei<br />
Gewebelagen. Hybride Profile aus Carbonund<br />
Glas fasern sind ebenso möglich wie<br />
smarte Composites mit integrierten Funktionen<br />
wie Blitzschutz, Sensorik oder Lebensdauerüberwachung.<br />
Xperion liefert auch weiterbearbeitete<br />
und montierte Bauteile, die direkt<br />
eingebaut werden.<br />
Und die Kosten? Natürlich höher als bei Aluminium,<br />
aber niedriger als gedacht. Als Hausnummer<br />
für ein Carbon-Standardhalbzeug<br />
gibt de la Ossa zwischen 50 und 80 Euro/kg<br />
an. Nicht unbedingt teuer für ein Material, das<br />
Titan substituieren kann und dazu noch sehr<br />
spezifische Aufgaben erfüllt.<br />
Xperion Components GmbH & Co. KG<br />
Tel.: +49 6201 29 086-0<br />
info@xperion-components.de<br />
Artikel aus Industrieanzeiger 4/2016<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 53
Die neuen Kopfstützen<br />
bieten Passagieren in Linienund<br />
Reisebussen einen<br />
deutlich verbesserten<br />
Komfort<br />
Bild: EvoBus<br />
Alles eine Frage des Komforts<br />
Sicherer Halt: Friktionsscharniere in Kopfstützen bei EvoBus<br />
Der Markt für die Hersteller von<br />
Linien- und Reisebussen ist hart<br />
umkämpft. Auf der Überholspur<br />
bleibt nur, wer innovativ ist und<br />
eindeutige Wettbewerbsvorteile<br />
bietet – beispielsweise beim<br />
Passagierkomfort.<br />
Die einfache Konstruktion der Friktionsscharniere<br />
wird ergänzt durch eine<br />
komfortable, wartungsfreie Technologie<br />
der konstanten Friktion, die der Kopfstütze<br />
im gesamten Bewegungsbereich<br />
einen konstanten Widerstand mit<br />
Nulldrift und ohne Spielfreiheit bietet<br />
Bild: Southco<br />
Zum Reisekomfort der Buspassagiere tragen<br />
genügend Beinfreiheit bei, ein komfortabler<br />
Sitz und bequeme Kopfstützen. Doch bis vor<br />
Kurzem bestanden Kopfstützen in Bussen<br />
kaum aus mehr als einem starren Rahmen,<br />
der mit einem dicken Stück Schaumstoff bedeckt<br />
war. Von gutem Komfort konnte man da<br />
nicht sprechen, allein schon deshalb nicht,<br />
weil vor allem auf längeren Reisestrecken keine<br />
angenehme Ruheposition zu finden war.<br />
Davon abgesehen hatten diese Kopfstützen<br />
einen technischen Nachteil: Sie mussten regelmäßig<br />
überholt werden.<br />
Vor diesem Hintergrund hat EvoBus, ein führender<br />
deutscher Bushersteller und eine<br />
100%ige Tochterfirma der Daimler AG, nach<br />
einer Lösung für die Sitze seiner Premium -<br />
busse gesucht, die es den Passagieren ermöglichen<br />
sollte, die Kopfstützen nach eigenen<br />
Wünschen in eine festbleibende Position<br />
zu verstellen. Die Suche nach einer innovativen<br />
Produktlösung führte EvoBus dann zu<br />
Southco, einen Pionier in der Technologie der<br />
Drehmomentscharniere.<br />
Im Rahmen der Zusammenarbeit wurde eine<br />
Lösung geschaffen, die auf der Produktreihe<br />
Der Autor: Bernhard Wiegert,<br />
Fachjournalist, Bornheim<br />
der eingebetteten ST-Scharniere von Southco<br />
basierte – in der mit Kunststoff umspritzten<br />
Kopfstütze wurde ein eingebettetes Scharnier<br />
mit konstantem Drehmoment eingebaut.<br />
Raffinierte Lösung<br />
Mit den bisherigen Konstruktionen ließen sich<br />
Kopfstützen nur mühsam und meist nur kurzzeitig<br />
vertikal einstellen, denn auf Dauer<br />
konnten sie ihre Position nicht halten und damit<br />
den Kopf des Passagiers nicht dauerhaft<br />
stützen. Das wiederum beeinträchtigte die Zuverlässigkeit<br />
und Funktionalität der Kopfstützen<br />
und verkürzte ihren Lebenszyklus.<br />
Die Lösungen, die Southco für Kopfstützen<br />
entwickelt hat, basieren standardmäßig auf<br />
einer in die Kopfstütze integrierten Positioniertechnologie,<br />
die die verlässliche und flexible<br />
Funktion eines konstanten Drehmoments<br />
in einem kleinen Gehäuse bietet und somit<br />
eine nahtlose Integration mit der Kopfstützenform<br />
des Busherstellers ermöglicht.<br />
Durch das asymmetrische Drehmoment können<br />
die Ingenieure unterschiedliche Bedienaufwände<br />
für die verschiedenen Bewegungsrichtungen<br />
definieren. So können die Passagiere<br />
die Flügel der Kopfstütze beim Einstellen<br />
leicht nach vorne bewegen, und sie werden<br />
dennoch gestützt, wenn das volle Gewicht des<br />
Passagiers dagegen drückt. Außerdem ist das<br />
Scharnier umschlossen und verdeckt, was<br />
auch zu einer ansprechenderen Ästhetik des<br />
Sitzdesigns beiträgt. Die einfache Konstruktion<br />
wird ergänzt durch eine komfortable, wartungsfreie<br />
Technologie der konstanten Friktion,<br />
die der Kopfstütze im gesamten Bewegungsbereich<br />
einen konstanten Widerstand<br />
mit Nulldrift und ohne Spielfreiheit bietet.<br />
Weltweite Präsenz als Wettbewerbsvorteil<br />
Bei der Entwicklung der neuen Kopfstützenkonstruktion<br />
nutzte EvoBus die internationale<br />
Fertigungs- und Entwicklungspräsenz von<br />
Southco. Denn Southco war in der Lage, das<br />
Design in Deutschland zu entwickeln und<br />
gleichzeitig bei der Produktion in Indien vor<br />
Ort unterstützend mitzuwirken, wo das Expertenteam<br />
des Unternehmens eng mit Vertretern<br />
der Daimler-Gruppe und ihrem Subunternehmer<br />
zusammenarbeitete.<br />
Durch die einzigartige Kopfstützenkonstruktion<br />
wird im gesamten Linien- und Reisebussegment<br />
der Komfort für Passagiere neu definiert.<br />
Außerdem bedeutet Southcos Ansatz<br />
bei der Scharnierherstellung, dass die Kopfstützen<br />
während ihres ganzen Lebenszyklus<br />
keine Wartung oder Neu justierung benötigen.<br />
Southco Europe Ltd., Worcester,<br />
Ulrike Sturman, Tel.: +44 1905 346661,<br />
usturman@southco.com<br />
54 AutomobilKonstruktion 2/2016
KAROSSERIE + INTERIEUR<br />
Kiekert präsentiert Prototypen<br />
Durchbruch bei Türschutzsystemen<br />
Die Kiekert AG hat ein Prototypenfahrzeug<br />
mit der elektro-mechanischen<br />
Türschutzfunktion i-protect<br />
fertiggestellt. Die Technologie soll<br />
das ungewollte Anschlagen von<br />
Autotüren an unmittelbare Hindernisse<br />
verhindern. Die Idee für das<br />
neuartige Türschutzsystem<br />
stammt von einer Schülergruppe<br />
der Erzbischöflichen Liebfrauenschule<br />
aus Köln. Mit dieser Idee<br />
hatten die Schüler den bundesweiten<br />
Wettbewerb „business@school“<br />
der Unternehmensberatung<br />
Boston Consulting Group<br />
gewonnen. Im Rahmen seines<br />
weltweiten Trendscoutings hat<br />
Kiekert die Entwicklung des Projektes<br />
begleitet.<br />
Ein modernes Sensorsystem zur<br />
Umfelderkennung und ein innovatives<br />
Türbremssystem zeichnen<br />
i-protect aus und sichern eine Kollisionsvermeidung.<br />
Die im Fahrzeug<br />
eingebaute Elektronik wertet<br />
das Signal aus und gibt den Halte-<br />
befehl unmittelbar an die Türbremse<br />
weiter, sobald sich ein<br />
Hindernis in der Nähe der Tür befindet.<br />
Der Stoppmechanismus<br />
von i-protect setzt am Fangband<br />
der Autotür an und stoppt die Autotür<br />
bei Bedarf elektromagnetisch<br />
zentimetergenau vor dem<br />
Hindernis. i-protect erkennt statische<br />
Objekte in beliebiger Bauform<br />
und Größe im Schwenkraum<br />
der Tür. Die Technologie zeichnet<br />
sich durch eine unbestromte Haltekraft<br />
aus. Hierbei erfolgt der<br />
Stromverbrauch ausschließlich<br />
bei der Bewegung und beim Bremsen<br />
der Tür. Die lageabhängige<br />
Haltekraft der Tür und eine stufenlose<br />
Türfeststellung verschaffen<br />
dem Endverbraucher zusätzlichen<br />
Komfort beim Aussteigen aus dem<br />
Fahrzeug. Kiekert wird i-protect im<br />
nächsten Schritt zur Integration in<br />
verschiedenste Fahrzeugkonzepte<br />
weiterentwickeln.<br />
www.kiekert.com<br />
Leichtbau bei Audi und Lamborghini<br />
Strukturklebstoff im Fahrzeug<br />
Strukturklebstoffe von Dow Automotive wie beispielsweise<br />
Betaforce eignen sich laut Hersteller besonders in der<br />
Hybridbauweise, also der Kombination unterschiedlicher<br />
Materialien in einem Fahrzeug. Dies sei einer der vielversprechendsten<br />
Ansätze, um Leichtbauziele zu erreichen,<br />
ohne bei anderen Anforderungen Kompromisse eingehen<br />
zu müssen. Verbundwerkstoffe auf Kohlenfaserbasis<br />
gehören dabei zunehmend in diesen Materialmix. Daher<br />
kommen solche Klebstoffe jetzt auch in aktuellen Fahrzeugen<br />
von Audi und Lamborghini als Fügelösung für<br />
strukturelle Karbonfaserbauteile wie Säulen und Tunnel<br />
mit lackierten Aluminiumsubstraten zum Einsatz.<br />
Zu den mit individuell eingestellten Klebstoff-Varianten<br />
ausgerüsteten Modellen gehören derzeit der Audi R8<br />
und der Lamborghini Huracan. Neben Vorteilen hinsichtlich<br />
des Gewichtes soll der Einsatz von Strukturklebstoffen<br />
zusätzliche Leistungsmerkmale in der Verarbeitbarkeit<br />
bieten und macht ihn daher auch aus produktionstechnischer<br />
Sicht interessant. Dazu gehören beispielsweise<br />
das vorbehandlungsfreie Fügen von CFK-Werkstoffen,<br />
eine optimierte Offenzeit und ein ausgewogenes<br />
Verhältnis der mechanischen Eigenschaften, zur Verbesserung<br />
der Fahrzeugsteifigkeit und Fahreigenschaften.<br />
Klebstoffe von Dow Automotive seien daher auch für<br />
weitere Modelle von Audi und Lamborghini in der Diskussion.<br />
www.dowautomotive.com<br />
Anzeigendaten einfach und sicher übermitteln.<br />
PDF<br />
<br />
<br />
Besuchen Sie uns auf<br />
Unsere Leidenschaft<br />
ist Kundenorientierung.<br />
Prüfen mit Verstand.<br />
www.zwick.de<br />
<br />
<br />
ZwickRoell.tv<br />
Prüfen mit Verstand<br />
www.konradin-ad.de<br />
Prüfsysteme<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 55
KAROSSERIE + INTERIEUR<br />
Odelo macht OLED-Heckleuchten serienreif<br />
Flächenlicht sorgt für Designfreiheit<br />
Als weltweit erster Automobilzulieferer<br />
bringt Odelo die organische<br />
Licht-emittierende Diodentechnologie<br />
(OLED) in Heckleuchten<br />
zur Serienreife. Eine Herausforderung<br />
war es, den hohen spezifischen<br />
Anforderungen der Automobilindustrie<br />
gerecht zu werden.<br />
Bisher wurde die Technologie<br />
lediglich in Prototypen präsentiert.<br />
Mit der technischen Weiterentwicklung<br />
ist es nun gelungen,<br />
die OLEDs zuverlässig, stabil<br />
und praxistauglich in Heckleuchten<br />
zu integrieren.<br />
Automobildesignern sollen sich<br />
mit den OLEDs neuartige und visionäre<br />
Gestaltungsmöglichkeiten<br />
eröffnen. Statt punktuell zu<br />
leuchten, wie etwa LEDs, sind<br />
OLEDs Flächenlichtquellen. Der<br />
Leuchtendesigner hat hierbei die<br />
komplette Freiheit, diese Flächen<br />
zu gestalten und in homogenem<br />
Licht erstrahlen zu lassen. Besonders<br />
reizvolle Möglichkeiten eröffnen<br />
sich für die Leuchtendesigner<br />
mit der Animationstechnik:<br />
Die OLEDs lassen sich individuell<br />
programmieren, bei der Gestaltung<br />
der Animationen seien laut<br />
Hersteller „der Fantasie keine<br />
Grenzen gesetzt.“<br />
www.odelo.de<br />
IAC FiberFrame feiert Premiere in der Mercedes-Benz E-Klasse<br />
Schiebedachrahmen aus Naturfaser<br />
International Automotive Components (IAC)<br />
stattet den Dachhimmel der neuen Mercedes-<br />
Benz E-Klasse mit einem Verstärkungsrahmen<br />
aus Naturfasern für das Schiebedach aus. Die<br />
Leichtbaukomponente wurde unter der Bezeichnung<br />
IAC FiberFrame entwickelt. Als neuartige<br />
Leichtbaulösung ersetzt die Technik in<br />
der E-Klasse den üblicherweise aus Metall bestehenden<br />
Verstärkungsrahmen des Schiebedaches<br />
durch einen laut Hersteller „ökologisch<br />
nachhaltigeren Werkstoff“. Dabei<br />
kommt das speziell für den Anwendungsfall<br />
entwickelte Naturfaserhalbzeug IAC EcoMat-<br />
Hot als Verstärkung zum Einsatz. Der Werkstoff<br />
des Rahmens besteht zu 70 % aus nachwachsenden<br />
Rohstoffen. Die Fasermatte wird<br />
in einem Heißpressverfahren hergestellt.<br />
Für die erforderliche Belastbarkeit und Wärmebeständigkeit<br />
des Leichtbauteils sorgt dabei<br />
das Bindemittel Acrodur 950 L von BASF.<br />
Als Alternative zu Phenolharzen verfestigt der<br />
wasserbasierte, emissionsarme Binder die<br />
Naturfasern.<br />
Der FiberFrame verfüge laut IAC über eine<br />
hohe Biegesteifigkeit und ermöglicht bis zu<br />
50 % Gewichtseinsparung verglichen mit gewöhnlichen<br />
Stahlblechrahmen. Gegenüber<br />
thermoplastischen Kunststoffanwendungen<br />
tritt bei FiberFrame in Klimatests kein Bauteilverzug<br />
auf. Außerdem benötigen die hier eingesetzten<br />
Formwerkzeuge wesentlich kürzere<br />
Vorlaufzeiten als gewöhnliche Stahlformwerkzeuge.<br />
Die Produktion der Schiebedachrahmen<br />
für die E-Klasse startete im November<br />
2015 im IAC Werk in Prestice, Tschechien, dem<br />
Kompetenzzentrum des Unternehmens für<br />
Dachhimmel und Overhead-Systeme. Neben<br />
Dachhimmelsystemen aus Prestice beliefert<br />
IAC die neue E-Klasse mit Radhausschalen<br />
und Radkastenabdeckungen, gefertigt in<br />
Celle, sowie Rücksitzbezügen aus dem<br />
tschechischen Zakupy.<br />
www.iacgroup.com<br />
Aluminiumlegierung für den Fahrzeugbau<br />
Hoher Recyclinganteil<br />
Novelis hat eine neuentwickelte Legierung für<br />
die Automobilindustrie mit einem Recyclinganteil<br />
von bis zu 75 % auf den Markt gebracht.<br />
Die Legierung RC5754 eigne sich vor allem für<br />
die Herstellung von Strukturbauteilen in der<br />
Serienproduktion im Karosseriebau. Die Legierung<br />
wurde in Zusammenarbeit mit Jaguar<br />
Land Rover entwickelt und bildet ein zentrales<br />
Element des Projekts Realcar (REcycled ALuminium<br />
CAR). RC5754 wurde erstmals im neuen<br />
Jaguar XE angewendet und wird zukünftig<br />
bei allen bestehenden und neuen Modellen<br />
von Jaguar Land Rover zum Einsatz kommen.<br />
Das 2008 von Jaguar Land Rover gestartete<br />
Programm Realcar ist eine multilaterale Initiative<br />
zur Entwicklung eines geschlossenen Produktionskreislaufs<br />
für den Fahrzeugbau, bei<br />
dem Fahrzeuge am Ende ihres Produktlebenszyklus<br />
recycelt und wieder der Produktion zugeführt<br />
werden können. Die von Novelis speziell<br />
für das Programm entwickelte Aluminiumlegierung<br />
RC5754 ist auf einen besonders<br />
hohen Recyclinganteil ausgelegt, so dass<br />
noch mehr aufbereitetes Aluminium aus der<br />
Fahrzeugverschrottung aufgenommen werden<br />
kann als bisher möglich.<br />
Durch seine mehr als 40 Jahre Erfahrung in<br />
der Automobilindustrie leistete Novelis Pionierarbeit<br />
im Einsatz herkömmlicher Aluminiumlegierungen<br />
im Fahrzeugbau – wie etwa<br />
6111, 6016 und der ursprünglichen 5754 Legierung<br />
– sowie durch das spezielle Novelis<br />
Advanz-Produktportfolio. RC5754 erweitert<br />
nunmehr das aktuelle Legierungsangebot von<br />
Novelis.<br />
Novelis arbeitet mit vielen weltweit führenden<br />
Automarken zusammen und versorgt sie mit<br />
einer ganzen Palette stabiler, formbarer und<br />
leichter Aluminiumwalzprodukte, die derzeit<br />
in über 180 Fahrzeugmodellen zum Einsatz<br />
kommen, so zum Beispiel im neuen Ford F-150<br />
und Range Rover mit Aluminiumkarosserie.<br />
Bis zum Ende des Jahrzehnts prognostiziert<br />
Novelis einen Anstieg der globalen Nachfrage<br />
nach Aluminiumblechen für den Karosseriebau<br />
um jährlich etwa 25 %. Um diesen Bedarf<br />
zu decken, hat das Unternehmen seine Produktionskapazitäten<br />
in den letzten Jahren in<br />
Europa, Nordamerika und Asien wesentlich<br />
ausgebaut.<br />
www.novelis.com<br />
56 AutomobilKonstruktion 2/2016
TESTEN + PRÜFEN<br />
Flexibles Plug&Play-Messtechniksystem<br />
Mehr Transparenz im Fahrzeug<br />
In-tech hat das flexible Messsystem<br />
Orange-Rack entwickelt,<br />
welches die Energieversorgung<br />
und das Energiemanagement für<br />
sämtliche Messtechnik im Fahrzeug<br />
liefert und zudem den<br />
Schnellzugriff auf alle Kommunikationsbusse<br />
für Live-Analysen<br />
ermöglicht. Eine integierte Breakout-Einheit<br />
stellt alle wichtigen<br />
Kommunikationsschnittstellen<br />
zum Fahrzeug zur Verfügung, um<br />
dort Datenlogger, Tablets und PCs<br />
anzuschließen. Ob CAN, LIN, Flexray,<br />
OBD oder analoge Signale.<br />
Die Besonderheit des Systems<br />
stellt die eigene integrierte<br />
Stromversorgung dar, um das<br />
Fahrzeug-Bordnetz nicht zu beeinflussen.<br />
Die integrierte Rack-<br />
Batterie versorgt die Messtechnik<br />
mit Strom und wird über ein eigenes<br />
Netzteil geladen.<br />
Die Datenlogger können somit<br />
die Daten des Fahrzeugs sogar<br />
bei Stillstand auslesen ohne dass<br />
die Autobatterie entladen wird,<br />
beispielsweise über Nacht.<br />
Dieses Vorgehen wird durch intelligentes<br />
Energiemanagement<br />
möglich: Die Rack-Batterie wird<br />
während der Fahrt durch die<br />
Lichtmaschine im Fahrzeug bzw.<br />
den DC/DC-Wandler bei Elektrofahrzeugen<br />
geladen. Bei stehendem<br />
Motor, trennt sich das Rack<br />
automatisch von der Lichtmaschine.<br />
Somit wird die Fahrzeugbatterie<br />
durch die Messtechnik nicht<br />
belastet. Im Notfall kann das<br />
System sogar Starthilfe geben.<br />
www.in-tech.de<br />
Break-Out-Box für OBD-Messungen<br />
Halber Platz – volle Leistung<br />
Die Kurzschlussstecker von Schützinger werden<br />
schon seit vielen Jahren für Break-Out-Boxen<br />
genutzt. Mit der Anzahl der Kontaktpunkte<br />
stieg der Platzbedarf. Dem begegnete man zunächst<br />
mit der Verringerung des Rastermaßes<br />
von 19 auf 10 mm, dann wurde von 4 mm auf<br />
das 2-mm-System gewechselt. An die Grenzen<br />
stieß man spätestens mit Strömen über 12 A.<br />
Statt zwei Buchsen, die durch einen Kurzschlussstecker<br />
mit zwei Kontaktstiften verbunden<br />
werden, liegen die zwei Kontakte nun<br />
koaxial in der Brückenbuchse und werden<br />
durch einen Brückenstecker mit zwei koaxialen<br />
Federkörben verbunden. Das halbiert den<br />
Platzbedarf. Als erstes Produkt bringt Schützinger<br />
eine Break-Out-Box für das OBD-II-System<br />
auf den Markt. Die Box kann mit minimalem<br />
Platzbedarf zwischengeschaltet werden.<br />
Durch ziehen des Brückensteckers wird die<br />
einzelne Leitung unterbrochen und Fehler<br />
können simuliert werden. Bei gestecktem Brückenstecker<br />
bietet dieser einen Messabgriff,<br />
der auch für die üblichen Sicherheitsstecker<br />
mit starrer Hülse geeignet ist.<br />
www.schuetzinger.de<br />
Kamera für Crashtests und raue Umgebungen<br />
2000 Frames pro Sekunde bei 150 G<br />
Der niederbayerische Kameraentwickler PCO<br />
AG geht mit einem neuen High-Speed-Modell<br />
ins Rennen, das gezielt für die anspruchsvollen<br />
Anforderungen der automobilen Sicherheitsforschung<br />
konzipiert wurde:<br />
der Pco.dimax cs. Mit einem Gewicht<br />
von 1 kg und Maßen von<br />
85 x 85 x 104 mm bewältigt<br />
die Kamera über 2000 fps<br />
bei FullHD-Auflösung. Kompaktheit<br />
und Leichtgewicht<br />
sollen selbst an schwer<br />
zugänglichen Stellen einen<br />
schnellen und einfachen<br />
Einsatz ermöglichen;<br />
die robuste Bauweise sichert hohe Widerstandsfähigkeit<br />
gegen Beschleunigungskräfte<br />
von bis zu 150 G. Somit eigne sich die Kamera<br />
laut Hersteller ideal zum On- und Offboard-<br />
Einsatz bei Schlittenversuchen oder<br />
Crashtests sowie anderen industriellen<br />
Szenarien mit rauer Umgebung.<br />
Für Datensicherheit ist dabei gesorgt: Kommt<br />
es zu einer Trennung vom Stromnetz, so wird<br />
der 9-GB-Bildspeicher optional durch ein Akkupack<br />
unterstützt, das die Datenspeicherung<br />
weiter gewährleistet. Neben einer elektronischen<br />
Objektivsteuerung und einem HD-SDI-<br />
Ausgang, der den Anschluss eines kompakten<br />
Monitors ermöglicht, besteht unter anderem<br />
die Option, mit der Junction Box bis zu 10<br />
Kameras on- und offboard zu betreiben.<br />
www.pco.de<br />
SANTOX<br />
macht<br />
Technik<br />
mobil.<br />
Das Beste, was Ihrer<br />
hochwertigen Technik<br />
begegnen kann, ist ein<br />
Santox.<br />
Top Design und Qualität<br />
zum Serienpreis.<br />
In Alu und ABS.<br />
Fachkundige Beratung<br />
und maßgeschneiderter<br />
Ausbau inklusive.<br />
www.santox.com<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 57
TESTEN + PRÜFEN<br />
Zukünftige Antriebe auf dem Prüfstand<br />
AVL List stärkt Präsenz in Deutschland mit neuem Technologiezentrum in Bietigheim-Bissingen<br />
Ganze Bandbreite an Technologien<br />
Für ihre Kunden fährt AVL im neuen 20 000 m 2<br />
großen Standort das gesamte eigene Technologie-Portfolio<br />
auf. So umfasst das Tech Center<br />
ein Hauptgebäude in Massivbauweise und<br />
daran unmittelbar anschließend Motorenprüfstände<br />
in Containerbauweise. Im Hauptgebäude<br />
sind zum jetzigen Zeitpunkt zwei Allradrollenprüfstände<br />
untergebracht. Einer für<br />
kombinierte Emissions- und Klimamessungen,<br />
der andere für Akustik- und Emissionsmessungen.<br />
Daneben befinden sich zwei Antriebsstrangprüfstände<br />
sowie eine aktuell noch leere Kammer,<br />
die später flexibel mit einem Rollen- oder<br />
Antriebsstrangprüfstand ausgerüstet werden<br />
kann. Eine Vorkonditionierfläche mit einer<br />
konstanten Temperatur von 23 °C bietet Platz<br />
für bis zu 26 Fahrzeuge. Vier Fahrzeuge können<br />
vorab in einer separaten Klimakammer<br />
auf bis zu -7 °C gekühlt werden. Darüber hinaus<br />
verfügt das Technologiezentrum über<br />
mehrere Hardware-in-the-Loop (HiL)-Prüfstän-<br />
Der<br />
Rollenpr<br />
üfs<br />
tan<br />
de<br />
rmö<br />
gli<br />
cht<br />
kombinier<br />
ier<br />
te<br />
Emi<br />
missi<br />
si<br />
ons<br />
- u<br />
nd Klima-<br />
messungen<br />
undv<br />
verfügt<br />
über<br />
vie<br />
r einzelneln an<br />
get<br />
rieben<br />
en<br />
eRoll<br />
llen<br />
Bild<br />
:AV<br />
AVL/Pe<br />
ter<br />
Ried<br />
iedler<br />
e<br />
Neben der Entwicklung und Applikation<br />
von Otto- und Dieselmotoren<br />
sowie Getrieben unterstützt AVL<br />
ihre Kunden bei Herausforderungen<br />
wie Real Driving Emissions, CO 2 -<br />
Reduktion und Flottenverbrauchszielen<br />
sowie NVH-Fragestellungen.<br />
Der Autor: Philipp Milanes, Leiter Standort Stuttgart,<br />
AVL Deutschland GmbH<br />
Kaum ein Thema wird aktuell so häufig diskutiert<br />
wie die Senkung von Kraftstoffverbrauch<br />
und Schadstoffemissionen beim Verbrennungsmotor.<br />
Gesenkte Grenzwerte für gasförmige<br />
Schadstoffe und Partikelemissionen,<br />
neue Testverfahren sowie Flottenverbrauchsziele<br />
halten die Branche auf Trab und bedeuten<br />
große Herausforderungen. Um Kunden bei<br />
zukünftigen Aufgaben bestmöglich unterstützen<br />
zu können, hat AVL in der Region Stuttgart,<br />
dem Zentrum des deutschen Fahrzeugbaus,<br />
innerhalb von 15 Monaten ein hochmodernes<br />
Test- und Entwicklungszentrum gebaut.<br />
Schließlich haben dort mehrere Premiumhersteller<br />
ihren Sitz, bei denen mehr als<br />
nur die Einhaltung der Abgasvorschriften für<br />
die Typzulassungen gefragt ist. Im Vordergrund<br />
stehen bei diesen anspruchsvollen<br />
Kunden vielmehr markenspezifische Faktoren.<br />
Hierzu zählen beispielsweise das Akustikverhalten<br />
und die Fahrbarkeit der einzelnen Modelle,<br />
um sich dadurch von den Wettbewerbern<br />
differenzieren zu können.<br />
58 AutomobilKonstruktion 2/2016
Einer der beiden Antriebsstrangprüfstände – am neuen<br />
Standort präsentiert AVL den Kunden das gesamte<br />
Spektrum an eigenen Technologien<br />
Bild: AVL/Peter Riedler<br />
de sowie Fahrzeug- und Motormontage, Werkstätten,<br />
Büroräume, Labore und Lager.<br />
An das Hauptgebäude grenzen derzeit vier<br />
Motorenprüfstände in Containerbauweise an,<br />
die im Drei-Schicht-Betrieb 24 Stunden an sieben<br />
Tagen die Woche genutzt werden. Für vier<br />
weitere Motorenprüfstände sind die Fundamente<br />
bereits gelegt, zwei werden noch in<br />
diesem Jahr errichtet. Darüber hinaus ermöglicht<br />
das Areal die Erweiterung um nochmals<br />
zwölf Prüfstände.<br />
Zunehmende Komplexität und Variantenvielfalt<br />
Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat AVL am Standort<br />
bereits über 80 Arbeitsplätze geschaffen –<br />
mit steigender Tendenz – und etwa 50 Millionen<br />
Euro investiert. Die Angestellten des Tech<br />
In der Region Stuttgart eröffnete die AVL List GmbH<br />
Anfang des Jahres ihr neues Technologiezentrum<br />
Bild: AVL/Alfred Drossel<br />
Centers ergänzen die bisher schon über 200<br />
in der Region angesiedelten AVL-Mitarbeiter,<br />
die hauptsächlich Entwicklungsaufträge erledigen.<br />
In Bietigheim-Bissingen steht jedoch<br />
nicht bloß die neueste Prüf- und Messtechnik<br />
aus eigener Produktion bereit. Die gesamte<br />
AVL-Entwicklungsmethodik wird ebenfalls abgedeckt:<br />
von der modellbasierten Entwicklung<br />
am virtuellen Prüfstand über den Motorenprüfstand,<br />
den Antriebsstrangprüfstand bis<br />
zur Validierung im Gesamtfahrzeug. So ist<br />
man bei AVL in der Lage, nicht nur Teilsysteme<br />
wie z.B. Motor, Getriebe, Elektroantrieb<br />
und Energiespeicher zu optimieren, sondern<br />
auch die Kombination dieser Antriebskomponenten.<br />
„Das Technologiezentrum ist für die Erfüllung<br />
hoch anspruchsvoller Entwicklungsaufgaben<br />
ausgelegt und flexibel gestaltet, sodass wir<br />
auf zukünftige Anforderungen rasch reagieren<br />
können“, so AVL-CEO Helmut List bei der Eröffnungsveranstaltung<br />
Anfang des Jahres in<br />
Bietigheim-Bissingen.<br />
Insbesondere die Interaktion der Antriebsstrangkomponenten<br />
dürfte in der Zukunft sehr<br />
komplex und vielfältig ausfallen: neben der<br />
Aufgliederung von Fahrzeugkonzepten wird es<br />
mittelfristig auch ein Nebeneinander verschiedener<br />
Antriebskonzepte geben. Rein<br />
elektrisch angetriebene Fahrzeuge drängen<br />
vorerst ausschließlich in bestimmten Segmenten<br />
in den Markt. Sind größere Reichweiten<br />
erforderlich, wird der Verbrennungsmotor<br />
weiterhin eine dominante Rolle einnehmen,<br />
begleitet von einem Elektroantrieb mit unterschiedlichen<br />
Elektrifizierungsgraden.<br />
Physikalische Grenzen noch weit entfernt<br />
Gleichzeitig wachsen jedoch auch die Ansprüche<br />
der Kunden. Kürzere Entwicklungszeiten<br />
und eine höhere Produktivität in der Entwicklung<br />
verlangen nach einem schnellen und reibungslosen<br />
Zusammenspiel sämtlicher an der<br />
Entwicklung beteiligten Bereiche. Angefangen<br />
bei der ersten Simulation einzelner Fahrzeugkomponenten<br />
über Systemintegrationsprüfungen<br />
bis hin zu den finalen Gesamtfahrzeugtests<br />
auf dem Prüfstand. So lässt sich die Effizienz<br />
des Antriebsstrangs Schritt für Schritt<br />
weiter optimieren. Schließlich ist man bei AVL<br />
überzeugt, dass die Grenzen der Physik noch<br />
nicht erreicht und Effizienzsteigerungen von<br />
bis zu 20 % möglich sind.<br />
AVL Deutschland GmbH<br />
Tel.: +49 6134 7179-0<br />
avl.deutschland@avl.com<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 59
TESTEN + PRÜFEN<br />
Big Data im Formel-1-Tempo<br />
SKF frisiert sein Windkraftanlagen-Prüfsystem für Datenverarbeitung bei der Scuderia Ferrari<br />
Freuen sich über die erzielten<br />
Effizienzsteigerungen auch<br />
abseits der Rennstrecke:<br />
Mario Kuluridis, Teamleiter<br />
für Prüfanlagen (links), und<br />
Luca Bacigalupo, Maschinenbauingenieur<br />
bei Ferrari<br />
Bilder: SKF<br />
In den italienischen „belle<br />
macchine“ der Scuderia Ferrari<br />
stecken zahlreiche Komponenten<br />
des schwedischen<br />
Konzerns SKF, der die Lager<br />
für die Formel 1 u. a. im<br />
deutschen Schweinfurt<br />
produziert<br />
In der Formel 1 ist eine blitzschnelle<br />
Datenverarbeitung inzwischen<br />
unverzichtbar. Das gilt nicht für die<br />
Telemetrie während des Rennens,<br />
sondern auch für die Forschungs -<br />
labors: Dank einer individuell für<br />
Ferrari angepassten Hard- und Software-Lösung<br />
von SKF können die<br />
Ingenieure der Scuderia nun in<br />
Echtzeit die Vorgänge in den einzelnen<br />
Prüfkammern für Antriebs -<br />
einheiten verfolgen.<br />
Die ersten Überlegungen der Scuderia Ferrari,<br />
ihre Prüfkammern zu modernisieren, begannen<br />
bereits 2011: Damals deutete sich an,<br />
dass der altgediente 2,4-Liter-V8-Saugmotor –<br />
bedingt durch eine Regeländerung – bald Geschichte<br />
sein würde. In den Startlöchern<br />
stand ein komplett neues Antriebskonzept<br />
Der Autor: Dietmar Seidel, Leiter Technische<br />
Fachpresse Deutschland bei SKF, Schweinfurt<br />
aus einem 1,6 Liter-V6-Turbo zuzüglich Elektromotor<br />
inklusive Rückgewinnungssystem<br />
auf Basis von kinetischer und thermischer<br />
Energie. Angesichts dieser drastischen Änderung<br />
war klar, dass der Rennstall eine neue<br />
Generation von Testanlagen benötigte.<br />
Hinzu kam, dass bis dato nicht alle Prüfkammern<br />
mit speziellen Systemen zur kontinuierlichen<br />
Überwachung des Vibrationsverhaltens<br />
von Antriebskomponenten ausgestattet waren.<br />
„Wir mussten wirklich zu jeder einzelnen<br />
Prüfkammer hingehen, um uns anzuschauen,<br />
was genau dort vor sich geht“, erinnert sich<br />
Mario Kuluridis, Teamleiter für Prüfanlagen sowie<br />
die mechanische und hydraulische Entwicklung<br />
in der Testabteilung für Antriebssysteme.<br />
„Ein Online-Check von hochfrequenten<br />
Daten in Echtzeit war schlicht nicht möglich.<br />
Dadurch war die Fehlersuche zu langsam. Außerdem<br />
ließen sich so keine Prognosen über<br />
die Lebensdauer von Komponenten auf Basis<br />
von Trendwerten erstellen.“<br />
„Tuning“ für mehr Daten-Speed<br />
Auf der Suche nach alternativen Überwachungssystemen<br />
wandten sich Kuluridis und<br />
sein Team schließlich auch an SKF. Zwar arbeiten<br />
die Scuderia Ferrari und SKF schon seit<br />
1947 zusammen, aber im Rahmen dieser Partnerschaft<br />
ging es bislang vor allem um spezielle<br />
Racing-Lager. Dennoch fanden auch die<br />
Elektronik-Experten beider Seiten einen gemeinsamen<br />
Ansatzpunkt: die IMx-Plattform<br />
von SKF samt Aptitude Observer Software. IMx<br />
bietet Zustandsüberwachung, Anlagenschutz<br />
und vorbeugende Instandhaltungsplanung in<br />
Echtzeit. Der Haken an der Sache: Die Standardausführung<br />
ist eigentlich für Anwendungsgebiete<br />
wie etwa Windenergieanlagen<br />
entwickelt worden. Deren Zustandsüberwachung<br />
erfordert viel weniger Datenmengen,<br />
Kanäle und Rechenoperationen bzw. -geschwindigkeiten<br />
als das, was die Scuderia<br />
Ferrari nun für ihre Höchstleistungs-Teststände<br />
benötigte. Ergo galt es für die Ingenieure,<br />
ihre IMx-Plattform zu tunen.<br />
Ferrari schwebte ein integriertes, drahtloses<br />
System vor, das bei hochfrequenten Vibrationstests<br />
einzelne Elemente des Prüflings<br />
überwachen konnte. Um die IMx-Plattform an<br />
das Volumen und die Geschwindigkeit des dabei<br />
anfallenden Datenflusses anzupassen,<br />
konzipierte SKF eine erweiterte Lösung. Dazu<br />
gehörte unter anderem zusätzliche Hardware,<br />
die in die bereits vorhandene Infrastruktur zu<br />
integrieren war. Dabei mussten die Experten<br />
60 AutomobilKonstruktion 2/2016
darauf achten, dass sich auch das gesamte,<br />
neu geschnürte Hardware-Paket über dieselbe<br />
Oberfläche steuern lässt: Den Prüfingenieuren<br />
der Scuderia Ferrari war sehr daran gelegen,<br />
beispielsweise Messungen zu starten oder<br />
auch Ergebnisse anzeigen lassen zu können,<br />
ohne dafür ständig zwischen verschiedenartigsten<br />
Applikationen bzw. Geräten wechseln<br />
zu müssen. Zudem wünschte sich das Team<br />
ein erweiterbares System mit regelmäßigen<br />
Updates, bis zu 30 zusätzliche Sensoren und<br />
die Möglichkeit, Routineberechnungen in kurzen<br />
Zyklen durchzuführen.<br />
Effizienzsteigerndes Frühwarnsystem<br />
2013 nahm Ferrari das auf seine Bedürfnisse<br />
zugeschnittene System in Betrieb – rechtzeitig<br />
vor Inkrafttreten der Regeländerung in Sachen<br />
Antriebskonzept. Heute verarbeitet die<br />
getunte Plattform bis zu 100 000 Messungen<br />
pro Sekunde. Sie kann komplexe Analysen<br />
vornehmen und die Ergebnisse an das Telemetrie-System<br />
schicken, so dass die Entwicklungsingenieure<br />
in der Lage sind, den Status<br />
des Prüflings online zu überprüfen. Angesichts<br />
der enormen Datenmengen sind die Berechnungs-<br />
und Übertragungsgeschwindigkeiten<br />
des Systems dabei von entscheidender<br />
Bedeutung: Die Aptitude Observer Software<br />
fasst die Beobachtungen zehn bis zwanzig<br />
Mal pro Sekunde zu überschaubaren Ergebnissen<br />
zusammen. „Das hilft dem Team, sich<br />
auf Resultate statt Daten konzentrieren zu<br />
können“, betont Kuluridis.<br />
Den Prüfingenieuren zufolge liegen die Vorteile<br />
auf der Hand: Jetzt lassen sich die Vorgänge<br />
in den einzelnen Prüfkammern in Echtzeit beobachten.<br />
Außerdem ermöglichen speziell für<br />
die Plattform entwickelte Analyseverfahren<br />
und Diagnosen die Identifizierung und Behebung<br />
potenzieller Probleme, bevor daraus<br />
kostspielige Stillstände werden. Anders ausgedrückt:<br />
Da Schäden zu Verlusten einzelner<br />
Antriebskomponenten oder im schlimmsten<br />
Fall des gesamten Prüflings führen könnten,<br />
erhöht das neue „Frühwarnsystem“ die Effizienz<br />
der kompletten Prüfeinrichtung. Kuluridis:<br />
„Sobald wir gewisse Unregelmäßigkeiten<br />
Eine speziell „getunte“ Version des Online-Zustandsüberwachungssystems<br />
Multilog IMx-T von SKF verhilft<br />
Ferrari zu einer höheren Effizienz ihrer Prüfeinrichtung<br />
feststellen, tauschen wir das problematische<br />
Teil aus. Danach können wir sofort weitermachen.<br />
Dadurch haben wir Schäden und Ausfallzeiten<br />
spürbar reduziert.“<br />
SKF GmbH<br />
Tel.: +49 9721 56-0<br />
marketing@skf.com<br />
compact and ruggedized<br />
visit us @<br />
ATE Stuttgart<br />
booth #C1009<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 61
TESTEN + PRÜFEN<br />
Code auf Kollisionskurs<br />
Wenn sich perfekt generierter Code mit anderem perfekt generierten Code überschneidet<br />
Durch vereinheitlichte Steuergeräte<br />
können sich Sicherheitslevels überschneiden.<br />
Eine neue Software soll<br />
solche Kollisionen bereits dem Programmierer<br />
aufzeigen. Bisher waren<br />
solche Fehler schwer oder erst spät<br />
festzustellen – häufig waren Applikationen<br />
schon so weit entwickelt,<br />
dass eine Änderung nur sehr mühsam<br />
nachgepflegt werden konnte.<br />
Steuergeräte vereinen immer mehr<br />
Software auf immer weniger Hardware<br />
Bild: BMW<br />
Altium/Tasking ist seit über 30 Jahren darauf<br />
spezialisiert, Compiler und Entwicklungsumgebungen<br />
für den Embedded-Processing-<br />
Markt anzubieten, insbesondere für das Automotive-Segment.<br />
Seitdem hat sich der<br />
Schwerpunkt in der Wettbewerbslandschaft<br />
für Embedded-Tools in diesem Bereich verschoben.<br />
In einer früheren Marktphase konzentrierten<br />
sich die Alleinstellungsmerkmale<br />
sehr stark auf Performance-Kennzahlen, auf<br />
den Codeumfang, auf die Speichernutzung<br />
und auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit –<br />
also auf die Resultate von Optimierungen<br />
während des Compilierungsprozesses. In gewissem<br />
Maß kam zu diesen Aspekten die<br />
Leistungsaufnahme des Systems hinzu. Diese<br />
mag zwar im Automotive-Bereich kein so entscheidendes<br />
Kriterium sein wie auf anderen<br />
Märkten. Wichtig ist sie aber gleichwohl, da<br />
die Zahl der prozessorbasierten Systeme im<br />
Auto zunimmt und die endlichen Energieressourcen<br />
immer weiter ausgereizt werden.<br />
Überwogen werden alle diese Gesichtspunkte<br />
jedoch von einem Aspekt, dem immer mehr<br />
Aufmerksamkeit gewidmet wird. Gemeint sind<br />
die Korrektheit des erzeugten Codes sowie die<br />
Sicherheitsrelevanz.<br />
Mehr ECUs, höhere Komplexität<br />
In den zurückliegenden 30 Jahren gab es mehrere<br />
parallele Trends. So war in den 1980er<br />
Jahren in der Automobilindustrie eine markan-<br />
Der Autor: Jan Schlemminger, Field Application<br />
Engineer für Tasking-Produkte bei Altium, Karlsruhe<br />
te Zunahme der (allgemeinen) Qualitätsniveaus<br />
zu beobachten, und in den 1990er Jahren<br />
wurden viele bis dato mechanische Systeme<br />
durch elektrische Lösungen ersetzt oder<br />
zumindest ergänzt. Die elektronische Kraftstoffeinspritzung<br />
und das Antiblockiersystem<br />
sind hier zwei herausragende Beispiele. Auf<br />
Mikrocontrollern basierende elektronische<br />
Steuergeräte (Electronic Control Units – ECUs)<br />
wurden der Standard für die Steuerung von<br />
Subsystemen im Auto und die Zahl der ECUs<br />
pro Fahrzeug vervielfachte sich. Nach dem<br />
Jahr 2000 stieg die Komplexität steil an. Multi-Core-Prozessoren<br />
waren erforderlich, um<br />
den Rechen- und Sicherheitsanforderungen<br />
von Antriebsstrang-Anwendungen gerecht zu<br />
werden. Darüber hinaus ist eine entsprechende,<br />
weiter anhaltende Komplexitätszunahme<br />
der Algorithmen zu beobachten, die in Chassissteuerungs-<br />
und Fahrerassistenzsystemen<br />
zum Einsatz kommen.<br />
Im größeren Kontext der Generierung von Em-<br />
bedded-Code wurde man sich gleichzeitig immer<br />
mehr bewusst, dass es eines strukturierten<br />
und disziplinierten Ansatzes bei der Softwareentwicklung<br />
bedurfte, denn die Anfälligkeit<br />
jeglicher Arten sicherheitskritischer Systeme<br />
gegen Softwarefehler war nicht mehr zu<br />
übersehen.<br />
Das Bekenntnis zu Fehlern<br />
In diesem Zeitraum vollzog sich in der Automobilindustrie<br />
ein ebenso rapider Umschwung<br />
hin zu mehr Produktqualität. Über<br />
die intern aufgestellten Qualitätsprogramme<br />
und den Wettbewerbsdruck hinaus kamen externe<br />
Qualitätsstandards ins Spiel, deren Einhaltung<br />
nachgewiesen werden musste. Ein<br />
herausragendes Beispiel ist hier die Norm ISO<br />
26262 „Road vehicles – Functional safety“:<br />
Sie wurde mit dem Ziel geschaffen, die Sicherheit<br />
elektrischer und elektronischer Systeme<br />
in Straßenfahrzeugen zu gewährleisten. Ebenso<br />
wie andere sicherheitsrelevante ISO-Nor-<br />
62 AutomobilKonstruktion 2/2016
Ausgabe des Safety Checkers<br />
Bild: Tasking/Altium<br />
Definition von Sicherheitsklassen<br />
und Zugriffsrechten<br />
Bild: Tasking/Altium<br />
men strebt auch die ISO 26262 nicht das Erstellen<br />
von Systemen an, die nicht ausfallen<br />
können und werden. Stattdessen wird die Tatsache,<br />
dass Fehler auftreten werden, explizit<br />
anerkannt. Deshalb soll sichergestellt werden,<br />
dass die Reaktion des gesamten Systems<br />
auf einen Ausfall unter allen Umständen zu einem<br />
sicheren Resultat führt. Die Norm soll also<br />
gewährleisten, dass der angewandte Designprozess<br />
so angelegt ist, dass er ein sicheres<br />
System hervorbringt.<br />
Während für die Tasking Compiler ein strukturiertes<br />
Programm in Form vom ISO 26262<br />
Safety Kit angeboten wird, muss der Anwender<br />
auch für seine Applikation nachweisen,<br />
dass diese den Richtlinien der ISO 26262 entspricht.<br />
Insbesondere ein Nachweis der „Freedom<br />
from interference“ ist bislang nicht oder<br />
nur eingeschränkt automatisiert möglich.<br />
Der Nachweis, dass ein Fehler in einem Element<br />
sich nicht auf andere Elemente ausweitet,<br />
ist nur durch Betrachtung des Gesamtsystems<br />
möglich. Klassisches Unit-Testing deckt<br />
dies teilweise durch System- bzw. Integrationstests<br />
ab, jedoch erfolgt stets eine Instrumentierung<br />
und es müssen sehr viele Testfälle<br />
ausgearbeitet werden. Dies führt zu Einschränkungen:<br />
• Die Applikation wird für die Tests modifiziert<br />
und Tests auf der Hardware sind durch<br />
Einflüsse von Peripherie wie einem Watchdog<br />
und zusätzlichem Flash- und RAM-Bedarf<br />
nur eingeschränkt oder generell nicht<br />
möglich.<br />
• Der Systemtest erfordert eine hohe Anzahl<br />
an Testcases und wird daher erst durchgeführt,<br />
wenn ein großer Teil der Applikation<br />
bereits fertig ist. Für substanzielle Anpassungen<br />
der Applikation ist es dann bereits<br />
zu spät.<br />
In der Praxis wird daher der Nachweis bislang<br />
händisch durch ein Review der Designspezifikationen<br />
durchgeführt sowie im laufenden<br />
Betrieb durch eine Memory Protection Unit<br />
(MPU) überwacht. Die manuelle Prüfung ist<br />
fehleranfällig, aufwendig und es besteht die<br />
Möglichkeit, dass die Applikation von der<br />
Spezifikation abweicht. Weiterhin erlaubt die<br />
MPU nur eine begrenzte Anzahl an Speicherbereichen<br />
und erkennt Fehler erst, wenn diese<br />
auftreten. Für Tests ist stets eine Instrumentierung<br />
notwendig und die MPU wird erst bei der<br />
finalen Integration eingeschaltet. Um unvorhersehbare<br />
Fehler während der Laufzeit abzufangen,<br />
ist die MPU essentiell. Im Umkehrschluss<br />
sollte sie jedoch nicht als Testwerkzeug<br />
verwendet werden, um Designfehler<br />
während der Entwicklung aufzuspüren.<br />
Inspiration durch OpenSource-Betriebssystem<br />
In einem komplett anderen Kontext erlaubt<br />
das Prinzip der Vergabe von Zugriffsrechten<br />
und Eigentümern unter Linux seit Jahrzehnten,<br />
mehrere Nutzer auf einem Rechner getrennt<br />
voneinander ohne Sicherheitsrisiken arbeiten<br />
zu lassen. Klar definierte Zugriffsrechte, wer<br />
welche Dateielemente ausführen, lesen oder<br />
schreiben kann, verhindern unautorisierte Zugriffe<br />
bevor sie auftreten. Tasking hat dieses<br />
Prinzip für den Nachweis der „Freedom from<br />
Interference“ adaptiert und daraus den Safety<br />
Checker entwickelt.<br />
Dieses auf Safety Level spezialisierte Tool ist<br />
eine gute Ergänzung zu bestehenden Testtools,<br />
da es ermöglicht, bereits in der Entwicklung<br />
Verletzungen zu detektieren. Dazu wird<br />
die Applikation in Sicherheitsklassen unterteilt<br />
und Zugriffsrechte zugewiesen. Bereits<br />
der Compilierungsprozess zeigt Verletzungen<br />
an, ohne dass Testfälle oder Instrumentierungen<br />
nötig wären. Das Tool selbst modifiziert<br />
die Applikation nicht, sämtliche zur Auswertung<br />
erforderlichen Informationen werden als<br />
Debuginformationen gespeichert. Auch Multicore-Applikationen<br />
können ohne Einschränkungen<br />
geprüft werden.<br />
Im Einzelnen bietet der Safety Checker folgende<br />
Möglichkeiten:<br />
• Hardwarenahe Entwicklung verbunden mit<br />
der Fähigkeit, die Einhaltung der übergeordneten<br />
Sicherheitsanforderungen zu<br />
überprüfen.<br />
• Lückenschluss zwischen den Anforderungen<br />
der ISO 26262 und traditionellen Softwaretests,<br />
die begleitend zu statischen<br />
Analysetools verwendet werden.<br />
• Zuordnung von Linker-Abschnitten zu applikationsspezifischen<br />
Sicherheitsklassen,<br />
auch für existierende Objektdateien, für die<br />
kein Quellcode verfügbar ist.<br />
• Verwendung unmodifizierter Applikationen<br />
zur Durchführung von Tests bei gleichzeitiger<br />
sofortiger Darstellung von Zugriffen zwischen<br />
verschiedenen Sicherheitsklassen<br />
und etwaigen Verletzungen.<br />
Altium Europe GmbH<br />
Tel.: +49 721 8244 108<br />
frank.kraemer@altium.com<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 63
TESTEN + PRÜFEN<br />
Mehr Licht für höhere Produktivität<br />
Scanning-Vibrometer rüsten auf<br />
Die Laser-Sc<br />
anning<br />
ing-Vi<br />
bromet<br />
etrie<br />
hat sich<br />
al<br />
s berü<br />
hrungs-<br />
los<br />
ses,<br />
s schne<br />
nelle<br />
lles,<br />
fläche<br />
henha<br />
nhafte<br />
ftes sVer<br />
erf<br />
ahren zur Messung<br />
von Schwi<br />
ngu<br />
ngen in vielen Anwendungsberei<br />
chen<br />
bewährt. Beispiele gibt es im Fahrzeug-, Flugzeug- g und<br />
Mas<br />
chinenbau,i<br />
ind<br />
der<br />
Mikrosystem- und Datentechnik<br />
Bilder: Polytec<br />
Die Laser-Scanning-Vibrometrie<br />
hat sich als berührungsloses,<br />
rückwirkungsfreies, schnelles<br />
und flächenhaftes Verfahren zur<br />
Messung von Schwingungen<br />
bewährt. Die Anforderungen an<br />
die optische Empfindlichkeit der<br />
Vibrometer steigen jedoch, denn für<br />
die Entwicklung hochwertiger<br />
Produkte wird es zunehmend wichtiger,<br />
verlässliche Werte möglichst<br />
schnell zu erzeugen, z.B. um<br />
Computersimulationen zu validieren<br />
oder Daten zu visualisieren.<br />
metrie bei Polytec, Waldbronn; Ellen-Christine Reiff,<br />
Redaktionsbüro Stutensee<br />
Obwohl heute nahezu jedes Produkt am Bildschirm<br />
entsteht und leistungsfähige Modelle<br />
es erlauben, wichtige Produkteigenschaften<br />
präzise zu gestalten und vorherzusagen, ist<br />
nach wie vor die Analyse des Prototyps unverzichtbar<br />
und der Prüfstein für jedes Modell.<br />
Da sich die tatsächlichen dynamischen Eigenschaften<br />
anhand der optischen Schwingungsanalyse<br />
zuverlässig ermitteln lassen, sind<br />
Scanning-Vibrometer überall dort ein wichtiges<br />
Testinstrument, wo die dynamischen und<br />
akustischen Eigenschaften zu den wesentlichen<br />
Qualitätsmerkmalen der Produkte ge -<br />
hören.<br />
Optische Empfindlichkeit bestimmt die Leistung<br />
Das Verfahren, das sich für Modaltests großer<br />
Strukturen ebenso eignet wie für Schwingformanalysen<br />
kleinerer Geräte, basiert auf der<br />
Laser-Doppler-Vibrometrie. Bei dieser werden<br />
aus dem von einer schwingenden Struktur zurück<br />
gestreuten Laserlicht die Schwingfrequenz<br />
und die -amplitude bestimmt. Bei einem<br />
Scanning-Vibrometer ist das Laser-Doppler-Vibrometer<br />
nun mit einer Scanner-Spiegel-<br />
Einheit und einer Videokamera in einem gemeinsamen<br />
Messkopf integriert. Während der<br />
Messung scannt der Laserstrahl die Oberfläche<br />
des Messobjekts und liefert so eine räumlich<br />
hoch aufgelöste Reihe von Einzelpunktmessungen.<br />
Diese sequenziell gemessenen<br />
Schwingungsdaten werden zu einem gemeinsamen<br />
flächenhaften Datenmodell zusammengesetzt<br />
und lassen sich dann je nach Applikation<br />
entsprechend auswerten.<br />
Dabei definiert die optische Empfindlichkeit<br />
die Leistungsfähigkeit eines Scanning-Vibrometers.<br />
Sie bestimmt, auf welchen Oberflächen<br />
gemessen werden kann und ist verantwortlich<br />
für den Signal-Rauschpegel, den<br />
Messabstand und damit auch für die Größe<br />
der scanbaren Fläche. Von einer höheren Empfindlichkeit<br />
kann der Anwender also gleich in<br />
mehrfacher Hinsicht profitieren: Gute Messdaten<br />
mit niedrigem Rauschen lassen sich dann<br />
z.B. auch von eher schlecht reflektierenden<br />
Oberflächen erhalten. Außerdem müssen kritische<br />
Objektoberflächen nicht zwangsläufig<br />
vorbehandelt werden. Dadurch verkürzt sich<br />
die Vorbereitungszeit für Prüfungen und Messungen<br />
sind selbst bei Oberflächen möglich,<br />
die keine Veränderungen erlauben.<br />
Auch der realisierbare Abstand zwischen<br />
Messkopf und -objekt vergrößert sich, wenn<br />
die optische Empfindlichkeit des Vibrometers<br />
steigt. Daraus ergibt sich ein größerer Scanbereich.<br />
Große Testobjekte müssen dann nicht<br />
so oft umpositioniert werden, was Zeit und<br />
damit Kosten spart. Eine höhere optische<br />
Empfindlichkeit ist damit der Schlüssel zu<br />
mehr Datenqualität und Produktivität.<br />
Achtmal stärkerer Signalpegel<br />
Polytec hat jetzt entsprechend gehandelt. Mit<br />
der Zusatzoption Xtra erhalten die bewährten<br />
Vibrometer der Baureihe PSV-500 und<br />
PSV-500–3D eine deutlich höhere optische<br />
Empfindlichkeit. Die Grundlage dafür liefert<br />
ein leistungsstarker, dabei aber nach wie vor<br />
augensicherer Infrarotlaser (Lasersicherheit<br />
Klasse 2). Durch seinen Einsatz erhöht sich<br />
die Menge des von der Oberfläche reflektierten<br />
Lichts. Das Plus an Streulicht sorgt für einen<br />
achtmal stärkeren Signalpegel als beim<br />
Basismodell, das dadurch wesentlich resistenter<br />
gegen Signalrauschen ist. Das Signal-<br />
Rausch-Verhältnis verbessert sich und Resonanzfrequenzen<br />
im FFT-Spektrum (Fast Fourier<br />
Transform) werden sehr deutlich sichtbar. Das<br />
64 AutomobilKonstruktion 2/2016
Höhere optische Empfindlichkeit bedeutet größeren Messabstand (Messkopf-Objekt)<br />
beziehungsweise einen größeren Scanbereich. Große Objekte müssen dann<br />
nicht umpositioniert werden<br />
Weniger Rauschen: Resonanzfrequenzen im FFT-Spektrum werden deutlich sichtbar.<br />
Durch die reduzierte Mittelungszahl verkürzen sich die Messzeiten<br />
Resultat ist eine präzisere Datenanalyse und<br />
FE-Modellvalidierung, und das bei deutlich<br />
kürzeren Messzeiten. Das neue PSV-Xtra ist<br />
sowohl als neues System als auch als Upgrade<br />
für die Basismodelle verfügbar.<br />
Von den Vorzügen der höheren optischen<br />
Empfindlichkeit können viele Anwendungsbereiche<br />
profitieren, denn überall lässt sich Zeit<br />
sparen, sei es, dass die Oberflächenvorbehandlung<br />
nicht mehr notwendig ist, oder die<br />
Objekte durch die größere Messdistanz nicht<br />
mehr umpositioniert werden müssen.<br />
Gleichzeitig wurde die Geschwindigkeitsgrenze<br />
auf 30 m/s erhöht, was den Einsatz bei Ultraschallanwendungen<br />
und Dauerschwingtests<br />
mit hohen Amplituden erweitert. Hinzu kommt,<br />
dass durch das bessere Signal-Rauschverhältnis<br />
die Anzahl der notwendigen Mittelungen<br />
deutlich sinkt. Die Einsparungen, die sich allein<br />
dadurch ergeben sind beachtlich, wie die<br />
beiden folgenden Beispiele belegen.<br />
Die Messzeit verkürzt<br />
sich bei dieser Schwingungsmessung<br />
um 66 %<br />
12 Mittelungen statt bisher<br />
30: Die Messzeit verkürzt<br />
sich so um 61 %.<br />
Dadurch sind mehr<br />
Messungen am Tag<br />
möglich<br />
Messzeiten verkürzen sich um über 60 Prozent<br />
Bei einer typischen Periodic-Chirp-Anwendung,<br />
also einer zeitabhängigen Frequenzänderung,<br />
wurde die Anzahl der Mittelungen von<br />
15 beim Basismodell auf 5 bei der Ausführung<br />
mit dem Xtra-Upgrade geändert. Alle anderen<br />
Parameter blieben gleich, also Bandbreite,<br />
Frequenzauflösung, Anzahl der FFT-Linien und<br />
Messpunkte. Das Anregungssignal ist periodisch,<br />
sodass nur das Rauschen durch die<br />
Mittelungszahl reduziert wird. Bei gleicher Ergebnisqualität<br />
reduzierte sich hier die Messzeit<br />
für 143 Messpunkte von knapp zwei Stunden<br />
auf 38 Minuten, also um satte 66 %. Bei<br />
gutem Signal kann bei dieser Art der Schwingungsmessung<br />
die Mittelungszahl theoretisch<br />
sogar auf 1 reduziert werden; eine Überlappung<br />
der Zeitfenster ist hier nicht anwendbar.<br />
Ähnlich hoch ist die Zeitersparnis, wenn mit<br />
einer Rauschanregung gearbeitet wird. Die<br />
Amplitude des Anregungssignals ist hier statistisch<br />
verteilt. Deshalb sind Mittelungen<br />
zwingend notwendig, auch um eine stabile<br />
Übertragungsfunktion zu erhalten. Bei gutem<br />
Signal kann die Mittelungszahl reduziert werden,<br />
muss aber deutlich über 1 belassen werden.<br />
Überlappung ist hier zulässig, ihr Wert ist<br />
aber unabhängig von der Signalqualität. Für<br />
die gleiche Ergebnisqualität genügen mit dem<br />
Xtra-Upgrade 12 Mittelungen statt bisher 30.<br />
Dadurch verkürzt sich die Messzeit bei glei-<br />
cher Messpunktanzahl von eineinviertel Stunden<br />
auf 30 Minuten, was einer Zeitersparnis<br />
von 61 % entspricht. Dadurch sind pro Tag<br />
deutlich mehr Messungen durchführbar und<br />
komplexe Produktentwicklungen sind effizienter<br />
denn je zu realisieren.<br />
Polytec GmbH<br />
Tel.: +49 7243 604-3680<br />
c.petzhold@polytec.de<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 65
INSERENTENVERZEICHNIS<br />
Automobil<br />
Konstruktion<br />
Fachwissen für Entwicklungsingenieure<br />
Herausgeberin: Katja Kohlhammer<br />
Verlag:<br />
Konradin-Verlag Robert Kohlhammer GmbH,<br />
Ernst-Mey-Straße 8,<br />
70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany<br />
Geschäftsführer: Peter Dilger<br />
Verlagsleiter: Peter Dilger<br />
ISSN 1866–9131<br />
AVL Deutschland GmbH,<br />
Mainz-Kastel 68<br />
Böllhoff Produktion GmbH ,<br />
Bielefeld 9<br />
COUTH BUTZBACH<br />
Produktkennzeichnung<br />
GmbH, Solingen 45<br />
EJOT GmbH & Co.KG<br />
Geschäftsbereich Verbindungstechnik,<br />
Bad Berleburg 51<br />
Fischer Connectors GmbH,<br />
Zorneding 51<br />
KACO GmbH + Co.KG<br />
Dichtungswerke,<br />
Heilbronn 37<br />
Kratzer Automation AG,<br />
Unterschleißheim 29<br />
LEE-Hydraulische Miniatur-<br />
Komponenten GmbH,<br />
Sulzbach 13,39<br />
MICRO-EPSILON MESSTECH-<br />
NIK GmbH & Co.KG,<br />
Ortenburg 3<br />
PCO AG, Kelheim 61<br />
Preh GmbH,<br />
Bad Neustadt 7<br />
Röchling Automotive<br />
AG & Co.KG,<br />
Mannheim 2<br />
Santox Gehäuse-Systeme<br />
GmbH, Löffingen 57<br />
Schaeffler Engineering GmbH,<br />
Werdohl 11<br />
SCHLÖSSER GmbH & Co.KG,<br />
Mengen 5<br />
Wolfsburg AG,<br />
Wolfsburg 33<br />
Zwick GmbH & Co. KG,<br />
Ulm 55<br />
REDAKTION<br />
Chefredakteur: Jens-Peter Knauer,<br />
Phone +49 711 7594–407<br />
Redaktion:<br />
Dr.-Ing. Ralf Beck, Phone +49 711 7594–424<br />
Irene Knap, Phone +49 711 7594–446<br />
Bettina Tomppert, Phone +49 711 7594–286<br />
Redaktionelle Mitarbeit:<br />
Dr.-Ing. Rolf Langbein<br />
Dipl.-Ing. Jürgen Goroncy<br />
Tobias Meyer<br />
Hartmut Hammer<br />
Redaktionsassistenz:<br />
Gabriele Rüdenauer, Phone +49 711 7594–257,<br />
Fax +49 711 7594–398<br />
E-Mail: ak.redaktion@konradin.de<br />
Layout:<br />
Matthias Rösiger, Phone +49 711 7594–273<br />
Wir berichten über<br />
Airbus 52<br />
Altium 62<br />
Apple 20<br />
Audi 16<br />
AVL List 4, 58<br />
BASF 44, 56<br />
Bertrandt 8<br />
BMW 24, 40<br />
Boeing 52<br />
BorgWarner 44<br />
Bosch 20<br />
Boston Consulting<br />
Group 55<br />
Boysen 8<br />
Brembo 50<br />
Bridgestone 51<br />
Changan Ford 20<br />
Compact Dynamics 46<br />
Continental 34<br />
Continental Teves 50<br />
ContiTech 44<br />
Core Technologie 32<br />
Daimler 10, 54<br />
Dassault Systèmes 10, 32<br />
Delphi 18<br />
Dow Automotive 55<br />
Dräxlmaier 28<br />
EC Joint Research<br />
Centre 50<br />
Elektrobit 11<br />
ElringKlinger 40<br />
Etas 4, 26, 28<br />
EvoBus 54<br />
Faraday Future 32<br />
FCMS 33<br />
Federal Mogul 50<br />
Ferrari 60<br />
FEV 44<br />
Flame Spray 50<br />
Ford 50, 56<br />
Fraunhofer IFAM 46<br />
Freudenberg 10, 50<br />
Geely 44<br />
GKD 40<br />
Google 20<br />
Groschopp 46<br />
Harmann 12<br />
Hirschmann 22<br />
Hirschmann MCS 12<br />
IAC 56<br />
Igus 12<br />
Institut Mario Negri 50<br />
In-tech 57<br />
Ipetronik 28<br />
IPG Automotive 32<br />
JAC 20<br />
Jaguar Land Rover 20, 56<br />
Janz Tec 29<br />
Josef Mawick<br />
Spritzgusstechnik 50<br />
Kiekert 55<br />
Kistler 29<br />
Kolektor Kautt & Bux 36<br />
KTH Royal Institute of<br />
Technology 50<br />
Leoni 8, 10<br />
LuK 41<br />
Melexis 28<br />
Mercedes 22<br />
Metatech 33<br />
NanoFlowcell 42<br />
Nexteer Automotive 10<br />
Novelis 56<br />
Odelo 56<br />
Opel 30<br />
PCO 57<br />
Polytec 64<br />
Porsche 30<br />
Preh 10, 24<br />
Range Rover 56<br />
Rollax 48<br />
Schaeffler<br />
6, 10, 12, 38, 41, 45<br />
Serva Transport<br />
Systems 12<br />
SKF 60<br />
Southco 54<br />
STMicroelectronics 29<br />
Tasking 62<br />
Tecosim 33<br />
Tedrive 50<br />
Tencent 20<br />
Tesla 22<br />
Tom Tom 20<br />
TU Chemnitz 46<br />
TU Ostrava 50<br />
TÜV Süd 51<br />
Universität Trento 50<br />
VDI 14<br />
Volvo Trucks 45<br />
Wittenstein 46<br />
Xperion 52<br />
ZF 38, 43, 50<br />
ZF TRW 6<br />
ANZEIGEN<br />
Gesamtanzeigenleitung: Andreas Hugel,<br />
Phone +49 711 7594–472<br />
Auftragsmanagement: Annemarie Olender,<br />
Phone +49 711 7594–319<br />
Zur Zeit gilt die Anzeigenpreisliste vom 1.10.2015<br />
LESERSERVICE<br />
Ute Krämer, Phone +49 711 7594–5850, Fax –15850<br />
E-Mail: ute.kraemer@konradin.de<br />
AutomobilKonstruktion erscheint mit vier Ausgaben pro Jahr.<br />
Bezugspreise Inland 18,40 Euro inkl. Versandkosten und<br />
MwSt.; Ausland: 20,40 Euro inkl. Versandkosten;<br />
Einzelverkaufspreis: 4,80 Euro inkl. MwSt.<br />
zzgl. Versandkosten.<br />
Bezugszeit: Das Abonnement kann erstmals vier Wochen zum<br />
Ende des ersten Bezugsjahres gekündigt werden. Nach Ablauf<br />
des ersten Jahres gilt eine Kündigungsfrist von jeweils vier<br />
Wochen zum Quartalsende.<br />
AUSLANDSVERTRETUNGEN<br />
Schweiz, Italien, Frankreich, Belgien, Luxemburg: IFF media<br />
ag, Frank Stoll, Technoparkstrasse 3, CH-8406 Winterthur<br />
Tel: +41 52 633 08 88, Fax: +41 52 633 08 99,<br />
e-mail: f.stoll@iff-media.ch<br />
Großbritannien: Jens Smith Partnership, The Court, Long<br />
Sutton, GB-Hook, Hampshire RG29 1TA, Phone 01256 862589,<br />
Fax 01256 862182, E-Mail: media@jens.demon.co.uk<br />
USA: D A Fox Advertising Sales, Inc., 5 Penn Plaza # 19,<br />
New York, NY 10001–1738,<br />
Phone + (212)8963881<br />
E-Mail: detleffox@comcast.net<br />
BANKVERBINDUNGEN<br />
Baden-Württembergische Bank, 2 623 887<br />
(BLZ 600 501 01) BIC: SOLADEST,<br />
IBAN: DE28 6005 0101 0002 6238 87;<br />
Postbank Stuttgart, Konto 44 689–706,<br />
BLZ 600 100 70<br />
Gekennzeichnete Artikel stellen die Meinung des Autors,<br />
nicht unbedingt die der Redaktion dar. Für unverlangt eingesandte<br />
Manuskripte keine Gewähr. Alle in AutomobilKonstruktion<br />
erscheinenden Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.<br />
Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen<br />
gleich welcher Art, nur mit schriftlicher Genehmigung<br />
des Verlages.<br />
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Stuttgart.<br />
Druck: Konradin Druck GmbH, Leinfelden-Echterdingen.<br />
Printed in Germany.<br />
© 2016 by Konradin-Verlag Robert Kohlhammer GmbH,<br />
Leinfelden-Echterdingen.<br />
66 AutomobilKonstruktion 2/2016
Das Stellen-Portal für Ihren Erfolg!<br />
DAS<br />
NEUE<br />
KARRIERE-<br />
PORTAL!<br />
Sind Sie auf der Suche<br />
nach …<br />
<br />
<br />
<br />
Dann nutzen Sie ab sofort die<br />
Vorteile von fachjobs24.de :<br />
Optimale Bewerberansprache und<br />
<br />
Branchen-Channels<br />
Einzigartiges, branchenübergreifendes<br />
Netzwerk<br />
Kompetente Beratung durch erfahrene<br />
Experten in allen Branchen<br />
Das innovative Stellenportal für User, Leser<br />
und Arbeitgeber<br />
37 Online-Partner, 31 Print-Partner, 1 Adresse!<br />
Die 6 Branchen-Channels auf fachjobs24.de<br />
Architektur<br />
und Design<br />
Industrie<br />
Handwerk<br />
Wissen<br />
Augenoptik<br />
Arbeitswelt<br />
2/2016 AutomobilKonstruktion 67<br />
Jetzt gleich neue Jobs finden oder inserieren: www.fachjobs24.de
AVL<br />
Team<br />
SUITE <br />
POWERTRAIN DEVELOPMENT IST EIN TEAMSPORT<br />
AVL Team SUITE<br />
Success Based on Interplay<br />
Angesichts immer strengerer Normen und Gesetzesanforderungen steigt die Komplexität der Antriebsstrangentwicklung.<br />
Daher können Fahrzeugentwickler nun auf die AVL Team SUITE zurückgreifen –<br />
eine Zusammenstellung von komplementären Mess- und Testsystem-Softwareprodukten, die wie eine<br />
Sportmannschaft entsprechend den individuellen Anforderungen anpassbar ist. Die AVL Team SUITE<br />
gigkeit,<br />
Funktionalität, Kompatibilität und Performance in den Bereichen Automatisierung, Simulation,<br />
<br />
DER MEHRWERT<br />
<br />
• Höchste Kompatibilität über die gesamte Entwicklungskette<br />
• Einzigartiges Team-Konzept mit höchster Individualisierbarkeit, das allen Kundenanforderungen gerecht wird<br />
• Sicheres Investment mit zukunftsorientierten Lösungen von einem kompetenten Partner<br />
info@avl.com, www.avl.com/meet-the-team<br />
68 AutomobilKonstruktion 2/2016