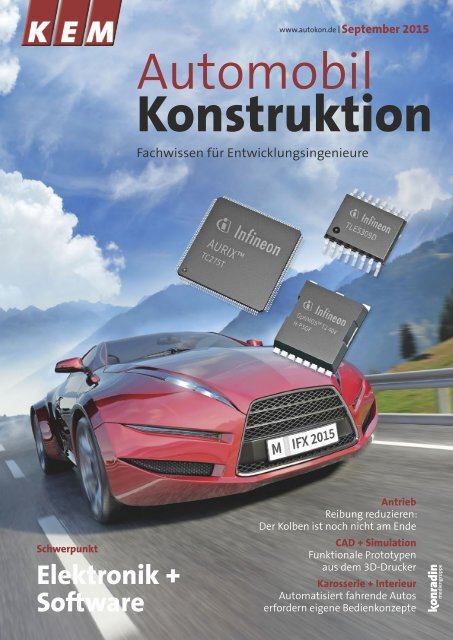Automobilkonstruktion 03.2015
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
www.autokon.de l September 2015<br />
Automobil<br />
Konstruktion<br />
Fachwissen für Entwicklungsingenieure<br />
Schwerpunkt<br />
Elektronik +<br />
Software<br />
Antrieb<br />
Reibung reduzieren:<br />
Der Kolben ist noch nicht am Ende<br />
CAD + Simulation<br />
Funktionale Prototypen<br />
aus dem 3D-Drucker<br />
Karosserie + Interieur<br />
Automatisiert fahrende Autos<br />
erfordern eigene Bedienkonzepte
IAA 2015: 15. - 18. September, Halle 4.1, Stand E21<br />
Aachener Kolloquium: 5. - 7. Oktober, Stand 31<br />
Unser Herz schlägt für Motoren – groß und klein<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Sie unter www.federalmogul.com.<br />
www.federalmogul.com
EDITORIAL<br />
Autonome Bewegung<br />
Leichtbau? CO 2 -Reduktion? Downsizing? Wichtige Themen,<br />
zweifellos. Aber kaum eines beflügelt die Phantasie der<br />
automobilen Welt derzeit so sehr wie das autonome Fahren.<br />
Was vor ein paar Jahren noch nach Science Fiction klang, ist<br />
längst in der Realität angekommen. Das Beratungsunternehmen<br />
Oliver Wyman beispielsweise geht in einer aktuellen<br />
Studie davon aus, dass teil- und vollautomatisierte Fahr -<br />
zeuge bereits im Jahr 2035 voraussichtlich zwischen 20 und<br />
30 % der globalen Fahrzeugproduktion ausmachen werden<br />
– eine autonome Bewegung in völlig neuem Sinn.<br />
Auf der kommenden IAA in Frankfurt werden entsprechende<br />
Konzepte und Studien an vielen Messeständen breiten<br />
Raum einnehmen. Einen kleinen Vorgeschmack bieten wir<br />
Ihnen in diesem Heft. Denn den Weg zum autonomen Auto<br />
zu begleiten, zu beobachten und zu kommentieren, ist<br />
selbstverständlich auch unsere Aufgabe. So widmet sich die<br />
Titelgeschichte (ab Seite 32) den technischen Aspekten<br />
einer zuverlässigen und redundanten Leistungselektronik.<br />
Um das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine<br />
geht es in dem Beitrag „Fahreradaption als Brückenschlag“<br />
ab Seite 42. Das kürzlich vorgestellte Konzeptfahrzeug von<br />
ZF (Seite 56) zeigt, welche Vorteile vernetzte Komponenten<br />
bieten. Und welche speziellen Bedienkonzepte automatisiert<br />
fahrende Autos verlangen, erfahren Sie im Beitrag<br />
„Bedienung, bitte!“ ab Seite 64.<br />
Die größten zu bestehenden Herausforderungen des autonomen<br />
Fahrens liegen jedoch nicht in der Technik, sondern<br />
in der Akzeptanz. Unter der zugegebenermaßen etwas<br />
provokanten Überschrift „Idiotensicherheit schafft Idioten“<br />
(Seite 68) fasst unser Autor Tobias Meyer zusammen, wie<br />
Experten den größten Unsicherheitsfaktor des Straßenverkehrs<br />
beurteilen: den Menschen.<br />
PRÄZISE<br />
LASER-SCANNER<br />
zur Profil- und Spaltmessung<br />
• Kompakte Bauform mit integriertem Controller<br />
• Für schnelle Messungen mit hoher Genauigkeit<br />
• Umfangreiche Software im Lieferumfang<br />
• Einfache Einstellung über vordefinierte<br />
Messprogramme<br />
• Verschiedene Schnittstellen zur direkten<br />
Anbindung an SPS möglich<br />
Blue Laser Scanner für organische<br />
Oberflächen und heiße Metalle<br />
Natürlich widmen wir uns in dieser Ausgabe auch den<br />
Basics, denn ein Auto bleibt immer noch ein Auto. So erfahren<br />
Sie, welche Optimierungspotenziale beim Verbrennungsmotor<br />
zu erwarten sind (Seite 24), wie Geometrieänderungen<br />
die Federkonstanten von Fahrwerkslagern beeinflussen<br />
(Seite 60) oder wie eine Low-Emission-Schaumdichtung<br />
für saubere Luft im Innenraum sorgt (Seite 66).<br />
Leichtbau? CO 2 -Reduktion? Downsizing? Aber ja!<br />
Jens Peter Knauer,<br />
Chefredakteur<br />
Tel. +49 8542 1680<br />
www.micro-epsilon.de/scan
Schwerpunkt<br />
www.autokon.de l September 2015<br />
Fachwissen für Entwicklungsingenieure<br />
Antrieb<br />
Reibung reduzieren:<br />
Der Kolben ist noch nicht am Ende<br />
CAD + Simulation<br />
Funktionale Prototypen<br />
aus dem 3D-Drucker<br />
Karosserie + Interieur<br />
Automatisiert fahrende Autos<br />
erfordern eigene Bedienkonzepte<br />
INHALT<br />
24<br />
ANTRIEB<br />
42<br />
ELEKTRONIK + SOFTWARE<br />
46<br />
CAD +SIMULATION<br />
56<br />
FORSCHUNG<br />
ANTRIEB<br />
18 Prof. Dr.-Ing. Heinz K. Junker, Mahle: „Klimakompressor<br />
schließt Lücke in unserem Portfolio“<br />
20 Wie ein neuer Kettenspanner in 2K-Technologie<br />
entstand<br />
22 Warum die richtige Schmierung schon zu Beginn<br />
der Konstruktion bedacht werden sollte<br />
24 Sparpotenzial durch Systemuntersuchungen und<br />
Detailoptimierungen am Produkt<br />
26 Produkte<br />
ANTRIEBSSTRANG<br />
28 Weniger CO2-Emissionen und höhere Zuverlässigkeit<br />
30 Produkte<br />
SCHWERPUNKT<br />
ELEKTRONIK + SOFTWARE<br />
32 Sichere Systeme für fahrerlose Autos<br />
36 48-Volt-System: Die Spannung steigt<br />
38 Optimiertes Wärmemanagement durch<br />
Elektrifizierung der Kühlschleifen<br />
40 Harald Kröger, Mercedes-Benz Cars: „Kompetenz bei<br />
Batteriesystemen ist unerlässlich“<br />
42 Bertrandt begleitet den Weg zum autonomen Fahren<br />
44 Produkte<br />
4 AutomobilKonstruktion 3/2015<br />
CAD + SIMULATION<br />
46 Wie Audi seine Produkte im virtuellen Raum<br />
optimiert<br />
48 FFF-Drucker aus der Open-Source-Bewegung bieten<br />
günstige Alternative zu teuren Sinterdruckern<br />
50 Warum sich PSA Peugeot Citroën für die<br />
CAM-Software Hypermill entschieden hat<br />
52 Produkte<br />
AUS DER FORSCHUNG<br />
54 Co-Simulationen machen genauere Vorhersagen und<br />
binden auch reale Prüfstände mit ein<br />
56 Konzeptfahrzeug von ZF soll zeigen, welche Vorteile<br />
vernetzte Komponenten bieten<br />
FAHRWERK<br />
58 Magneto-mechanische Dämpfung soll Geräuschentwicklung<br />
von Bremsscheiben reduzieren<br />
59 Einrohr-Stoßdämpfer: flexibel und dynamisch<br />
60 Wie beeinflusst eine Geometrieänderung die<br />
Federkonstante?<br />
62 Produkte<br />
Elektronik +<br />
Software<br />
Automobil<br />
Konstruktion<br />
Titelbild:<br />
Auf dem Weg zum marktreifen autonomen<br />
Fahren will Infineon helfen, die<br />
letzten Probleme zu lösen. Dabei muss<br />
die Übergabe zwischen automatisiertem<br />
Fahrzeug und Fahrer sicher erfolgen.<br />
Seite 32 Bild: Infineon
Schmierfrei<br />
leicht gemacht<br />
66<br />
KAROSSERIE + INTERIEUR<br />
76<br />
TESTEN + PRÜFEN<br />
KAROSSERIE + INTERIEUR<br />
64 Automatisiert fahrende Autos wollen anders<br />
bedient sein<br />
66 Low-Emission-Schaumdichtung für saubere Luft<br />
68 Probleme des autonomen Fahrens:<br />
„Idiotensicherheit schafft Idioten“<br />
69 Produkte<br />
TESTEN + PRÜFEN<br />
74 Mess- und Testeinrichtungen für schnellere und<br />
bessere Produktvalidierung<br />
76 Qualitätsprüfung bei Hochfrequenz-Sensorik für<br />
Fahrerassistenzsysteme<br />
78 Kuka prüft Dichtheit von Automatikgetrieben mit<br />
Inficon-Geräten<br />
80 Substitution von Keilabsorbersystemen durch<br />
Breitband-Kompaktabsorber (BKA)<br />
81 Produkte<br />
RUBRIKEN<br />
3 Editorial<br />
6 Aus der Branche<br />
17 Neues auf autokon.de<br />
83 „Wir berichten über“ und Impressum<br />
... und leicht in<br />
Form gebracht<br />
Mit iglidur ® Sonderteilen Schmierung eliminieren<br />
und Gewicht reduzieren: vom Fahrwerk bis zum<br />
Getriebe maßgeschneiderte iglidur ®<br />
Polymergleitlager<br />
nach Wunsch. Halten länger, kosten<br />
weniger. Schnell geliefert. igus.de/automotive<br />
plastics for longer life ®<br />
Technische Beratung:<br />
Tel. 02203 9649-694<br />
Besuchen Sie uns: Motek – Halle 4 Stand 4310,<br />
EMO, Mailand – Halle 3 Stand E10/F07
AUS DER BRANCHE<br />
Messring errichtet zukunftsweisendes Labor zur Dummy-Kalibrierung<br />
Crashen, messen, kalibrieren<br />
Leichtbau-Institut der TU Dresden<br />
ILK erweitert Analysemöglichkeiten<br />
Das Institut für Leichtbau und<br />
Kunststofftechnik (ILK) der Technischen<br />
Universität Dresden hat<br />
die Analysemöglichkeiten in seinem<br />
werkstoff-physikalischen<br />
Prüflabor erweitert. Im Prüflabor<br />
arbeiten die ILK-Wissenschaftler<br />
nun mit der Analyse-Software<br />
Thermokinetics der Netzsch Gerätebau<br />
GmbH. Die unterschied -<br />
lichen Messdaten, die bei der<br />
Analyse von Polymeren und Verbundwerkstoffen<br />
anfallen – etwa<br />
aus der Rheologie, der Dynamisch-Mechanischen<br />
Analyse<br />
(DMA), der Differenzkalorimetrie<br />
(DSC), der Dilatometrie oder der<br />
Neue Analysemöglichkeiten<br />
im werkstoff-physikalischen<br />
Prüflabor Bild: TUD/ILK<br />
Thermogravimetrie (TGA) – können<br />
durch die neue Software verknüpft<br />
und beispielsweise zur Erstellung<br />
von Materialmodellen<br />
verwendet werden, die zur Beschreibung<br />
der prozessabhängigen<br />
Viskosität dienen. Die analytischen<br />
Modelle stellen eine wichtige<br />
Grundlage für die realitätsnahe<br />
und effektive Simulation komplexer<br />
Formfüll- und Vernetzungsvorgänge<br />
von Reaktionsharzen dar.<br />
Es können die Parameter Zeit,<br />
Temperatur, Vernetzungsgrad und<br />
Druck in die Modellbildung einbezogen<br />
werden.<br />
http://tu-dresden.de/mw/ilk<br />
Ausstellung macht Geschichte erlebbar<br />
Schaeffler feiert 50 Jahre LuK<br />
Die Crashtestanlage mit der 136 m langen Microtrack-Schienenanlage Bild: Messring<br />
Die Firma Messring aus Krailling<br />
hat bei GSK Protech in Nanjing<br />
(China) erstmals in ihrer Firmengeschichte<br />
ein komplettes und mit<br />
moderner Technik ausgestattetes<br />
Dummy-Kalibrierlabor für einen<br />
Kunden geplant, ausgerüstet und<br />
Ende 2014 termingemäß in Betrieb<br />
genommen. GSK Protech<br />
wird die Anlage nicht nur für eigene<br />
Produkte nutzen, sondern auch<br />
anderen Fahrzeugherstellern und<br />
Zulieferern zur Verfügung stellen.<br />
Die Crashtestanlage hat eine Gesamtfläche<br />
von 7900 m² inklusive<br />
Vorbereitungsräume und Labor.<br />
Die Länge der von Messring eingebauten<br />
Microtrack-Schienenanlage<br />
beträgt insgesamt 136 m, was<br />
Höchstgeschwindigkeiten von bis<br />
zu 90 km/h bei Crashtests erlaubt.<br />
Zum Gesamtumfang der verbauten<br />
Anlagentechnologie zählen<br />
unter anderem der bewährte<br />
Elektromotor, der die Testfahrzeuge<br />
auf der Schienenanlage beschleunigt,<br />
zwei Filmgruben zur<br />
Video- und Fotodokumentation,<br />
ein Flying-Floor für Seitenaufprallversuche<br />
und diverse Spezialbarrieren.<br />
Damit ist das chinesische<br />
Unternehmen in der Lage, jegliche<br />
Testprotokolle der wichtigsten<br />
weltweiten gesetzlichen und sonstigen<br />
anerkannten Prüfstandards<br />
und Vorschriften zu erfüllen – eine<br />
Tatsache, die vor allem für Unternehmen<br />
wichtig ist, die ihre Pro-<br />
dukte auf dem amerikanischen<br />
oder europäischen Markt verkaufen<br />
wollen.<br />
Insgesamt hat GSK Protech derzeit<br />
14 unterschiedliche Dummy-Typen<br />
in Nanjing im Einsatz. Dabei setzt<br />
das Unternehmen auf Messrings<br />
professionelle und selbst entwickelte<br />
Testsoftware Crashsoft.<br />
Diese steuert Prüfstände, verwaltet<br />
alle Testinformationen, wertet<br />
Daten aus und garantiert die Reproduzierbarkeit<br />
von Tests. Außerdem<br />
ist es erforderlich, bei der<br />
Vielfalt an unterschiedlichen Testläufen<br />
und Dummy-Typen eine<br />
leistungsfähige Software einzusetzen,<br />
die allen Testanforderungen<br />
und Richtlinien gerecht wird. Insgesamt<br />
wurden auf der kompletten<br />
Anlage, inklusive der Dummys,<br />
über 700 Sensoren verbaut. Damit<br />
ist diese Testanlage eine der modernsten<br />
und größten in China.<br />
In den vergangenen zehn Jahren<br />
hat Messring in China bereits über<br />
zehn große Crashtestanlagen gebaut.<br />
Seit 2014 ist das Unternehmen<br />
mit einer eigenen Tochtergesellschaft<br />
in Chongqing vertreten.<br />
www.messring.de<br />
Schaeffler hat am Standort in Bühl<br />
das 50-jährige Bestehen der Marke<br />
LuK mit rund 100 geladenen<br />
Gästen gefeiert. Angefangen hat<br />
die Erfolgsgeschichte des Unternehmens<br />
mit der Entscheidung<br />
der Brüder Dr. Georg und Dr. Wilhelm<br />
Schaeffler, sich in der Firma<br />
Lamellen- und Kupplungsbau August<br />
Häussermann maßgeblich zu<br />
Die Ausstellung „Die LuK<br />
Story. 50 Jahre. Qualität.<br />
Technologie. Innovation.“<br />
macht die Unternehmensgeschichte<br />
der Marke<br />
erlebbar Bild: Schaeffler<br />
engagieren und in der Folge das<br />
Unternehmen LuK zu gründen. Innerhalb<br />
von nur einem halben Jahr<br />
entstand die erste Produktionsstätte<br />
und bereits Mitte 1965 lieferte<br />
LuK Tellerfederkupplungen<br />
an VW – jeden Monat 25 000<br />
Stück dieser in Europa damals<br />
noch recht neuen Technologie.<br />
www.schaeffler.com<br />
6 AutomobilKonstruktion 3/2015
preh.com<br />
17. - 27. September 2015<br />
Halle 5.1, Stand A26
AUS DER BRANCHE<br />
Auszeichnung<br />
Brose einer der besten Lieferanten des Volkswagen Konzerns<br />
Brose wurde am 15. Juli 2015 mit<br />
dem Volkswagen Group Award<br />
ausgezeichnet. Mit diesem Preis<br />
ehrt VW seine besten Lieferanten<br />
für ihre unternehmerische Gesamtleistung.<br />
„Um richtig gute Autos zu bauen,<br />
braucht man richtig gute Partner.<br />
Und die haben wir“, sagte Winterkorn<br />
bei der Preisverleihung in<br />
Neuburg bei Ingolstadt. Die Gewinner<br />
zeichnen sich laut VW<br />
durch Innovationskraft, Produktqualität,<br />
Entwicklungskompetenz,<br />
Nachhaltigkeit und professionelles<br />
Projektmanagement aus.<br />
„Diese Auszeichnung hat einen<br />
ganz besonderen Stellenwert“,<br />
betonte Jürgen Otto. „Sie ist eine<br />
Anerkennung für die Leistungsfähigkeit<br />
und Kompetenz unserer<br />
Mitarbeiter sowie eine Bestätigung,<br />
die Zusammenarbeit auszubauen.“<br />
www.brose.com<br />
Von links: Dr. Francisco Javier Garcia Sanz, Konzernvorstand Beschaffung Volkswagen<br />
AG, Jürgen Otto, Vorsitzender der Geschäftsführung der Brose Gruppe, Prof. Dr. Martin<br />
Winterkorn, Vorstandsvorsitzender Volkswagen AG Bild: Brose<br />
Weichen für weiteres Wachstum gestellt<br />
Kiekert: Neue Niederlassung in China<br />
Die auf automobile Schließsysteme<br />
spezialisierte Kiekert AG hat<br />
ihre Minderheitsbeteiligung am<br />
vormals eigenständigen Produktionswerk<br />
Henan North Xingguang<br />
Locking Systems Co. Ltd. (HXG)<br />
auf einen 100%igen Anteil erhöht.<br />
Fortan firmiert der im Jahr 2005<br />
gegründete Produktionsstandort,<br />
der 2014 mit 550 Mitarbeitern 50<br />
Mio. Euro Umsatz erwirtschaftete,<br />
unter Kiekert China Zhengzhou<br />
(KCZ). Das Unternehmen stärkt damit<br />
seine Marktposition und Präsenz<br />
in Asien.<br />
Mit Kiekert China Zhengzhou<br />
schafft das Unternehmen zusätzliche<br />
Kapazitäten in den Bereichen<br />
Seitentür-, Motorhauben- und<br />
Heckschlösser. Über den Kaufpreis<br />
im April 2015 unterzeichneten<br />
Kaufvertrag wurde Stillschweigen<br />
vereinbart.<br />
Das neu akquirierte Produktionswerk<br />
wird in den Unternehmensverbund<br />
integriert und zu einer<br />
unternehmerischen Einheit mit<br />
identischen Prozessen, Entscheidungswegen<br />
und Qualitätsstandards<br />
verschmolzen. „Die Übertragung<br />
der Kiekert-DNA auf unsere<br />
neuen Kollegen in Zhengzhou wird<br />
Der neue Standort Kiekert China<br />
Zhengzhou (KCZ) Bild: Kiekert<br />
unsere erfolgreiche Globalisierung<br />
fortführen. Mit KCZ schaffen wir<br />
neue Kapazitäten, um unsere Kunden<br />
und das Wachstum in Asien<br />
weiter zu unterstützen“, betont Dr.<br />
Karl Krause, Vorstandsvorsitzender<br />
der Kiekert AG.<br />
Die 1857 gegründete Kiekert AG ist<br />
Spezialist für Schließsysteme im<br />
Automobil. Ihre 5600 Mitarbeiter<br />
in neun Ländern entwickeln, produzieren<br />
und vertreiben maßgeschneiderte<br />
Kundenlösungen.<br />
www.kiekert.com<br />
Schub für die E-Mobilität<br />
Bessere Interoperabilität von Ladeinfrastruktur und E-Fahrzeugen<br />
Ein flächendeckendes Schnellladenetz<br />
um die Elektromobilität<br />
in Deutschland zu fördern, ist das<br />
Ziel des SLAM-Projekts (Schnellladenetz<br />
für Achsen und Metropolen).<br />
Im Fokus des vom Bundesministerium<br />
für Wirtschaft und<br />
Energie geförderten Vorhabens<br />
steht die Interoperabilität, damit<br />
jedes Auto an jeder Ladesäule<br />
aufgeladen werden kann.<br />
Die Partner im SLAM-Projekt sind<br />
u.a. VW, BMW, Daimler, Porsche,<br />
EnBW und das Fraunhofer Institut.<br />
Sie wählten das Charging Discovery<br />
System von Scienlab mit<br />
vordefinierten Testmöglichkeiten<br />
als sogenanntes Golden Test Device<br />
zur Absicherung des Ladevorgangs<br />
aus. Automobilhersteller<br />
und -zulieferer, Hersteller und Betreiber<br />
von Ladeinfrastruktur sowie<br />
Zertifizierungsstellen und<br />
Werkstätten können damit künftig<br />
den Ladevorgang überprüfen.<br />
Schon bei der Entwicklung ermöglicht<br />
das System, die einzelnen<br />
Komponenten mit realen Leistungsströmen<br />
zu testen.<br />
www.scienlab.de<br />
Das Charging Discovery System sichert die Interoperabilität Bild: Scienlab<br />
Optische 3D-Digitalisierung<br />
Zeiss übernimmt Mehrheit<br />
an Steinbichler<br />
Die Carl Zeiss AG beschleunigt ihren<br />
Eintritt in den Marktsektor Optische<br />
3D-Digitalisierung durch<br />
Mehrheitsbeteiligung an der<br />
Steinbichler Optotechnik GmbH.<br />
Steinbichler gilt als einer der weltweit<br />
führenden Anbieter von Systemen<br />
für die Digitalisierung mit<br />
optischen 3D-Sensoren und in der<br />
Oberflächeninspektion an Karosserie-und<br />
Blechteilen. Das Unternehmen<br />
bringt Kompetenzen in<br />
Photogrammetrie und Laserscan<br />
mit und bietet passende Softwareprodukte<br />
und Services an.<br />
www.zeiss.de<br />
www.steinbichler.de<br />
8 AutomobilKonstruktion 3/2015
BERTRANDT IST ... DYNAMIK ...<br />
ENGINEERING-PARTNER ... KUNDENORIENTIERUNG ...<br />
MOBILITÄT ... INNOVATION ... KNOW-HOW ...<br />
CO 2<br />
-Reduktion, Ressourcenschonung, Kosteneffizienz<br />
und innovative Mobilitätskonzepte<br />
sind zentrale Forderungen der mobilen Welt.<br />
Als einer der führenden Entwicklungspartner<br />
für die Automobil- und Luftfahrtindustrie<br />
unterstützen wir unsere Kunden entlang der<br />
gesamten Produktentstehung. Im Bertrandt-<br />
Engineering-Netzwerk stehen rund 12.000<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter international<br />
für kundenindividuelle Lösungen.<br />
FÜR JEDEN KUNDEN DIE BESTE LÖSUNG.<br />
www.bertrandt.com<br />
Bertrandt AG, Birkensee 1, 71139 Ehningen, Tel.: +49 7034 656-0, info@bertrandt.com
AUS DER BRANCHE<br />
Neubauprojekt für über 11 Mio. Euro<br />
Preh wächst und investiert weiter<br />
Der Umsatz von Preh ist 2014 um<br />
17,5 % auf 611 Mio. Euro, das Ebit<br />
um 31 % auf 54,5 Mio. Euro gewachsen.<br />
Im ersten Quartal 2015<br />
lag der Umsatz 22 % über dem<br />
Vorjahreszeitraum. Um den<br />
Wachstumskurs auch künftig halten<br />
zu können, hat Preh bereits im<br />
vergangenen Jahr ein Neubau-Investitionsprogramm<br />
auf den Weg<br />
gebracht, das nun schon sehr konkrete<br />
Formen annimmt. Bis zum<br />
Das neue Entwicklungszentrum<br />
am Stammsitz in<br />
Bad Neustadt<br />
Bild: Preh<br />
Sommer 2016 wird der Automobilzulieferer<br />
an seinem Stammsitz in<br />
Bad Neustadt 11 Mio. Euro in den<br />
Ausbau der Entwicklungs- und Logistikkapazitäten<br />
investieren. Den<br />
Kern bildet das neue Forschungsund<br />
Entwicklungszentrum, das auf<br />
einer Grundfläche von 2300 m 2<br />
entsteht und über eine Brutto-<br />
Geschossfläche von rund 7600 m²<br />
verfügen wird.<br />
www.preh.com<br />
Seit 2001 auf dem Markt<br />
ZF TRW fertigt 60 Millionen elektrische Parkbremsen<br />
ZF TRW hat seit der Einführung<br />
2001 insgesamt 60 Millionen elektrische<br />
Parkbremsen (EPB) produziert.<br />
Die EPB ist Bestandteil<br />
des Technologiekonzepts des Unternehmens<br />
und ein integrierter<br />
Bestandteil des Bremssystems,<br />
der die Anzahl der mechanischen<br />
Komponenten reduziert.<br />
Das System erhöht die Sicherheit<br />
und kann mit Fahrzeugsensoren<br />
und Systemen wie ESP kombiniert<br />
werden, um z.B. das Fahrzeug bei<br />
Gefahr automatisch abzubremsen.<br />
Statt des herkömmlichen Handbremshebels<br />
kommen nur ein<br />
Schalter und elektrische Leitungen<br />
zum Einsatz. So sind mehr Standard-<br />
und Sonderausstattungen<br />
im Fahrzeug möglich.ZF TRW bietet<br />
unterschiedliche EPB-Lösungen<br />
an, u.a. eine integrierte elektrische<br />
Parkbremse (EPBi), die<br />
durch das ESP angesteuert wird<br />
sowie eine EPB für die Vorderachse,<br />
die auch für kleinere Fahrzeuge<br />
erschwinglich ist.<br />
Der Zulieferer arbeitet aktuell an<br />
mehreren Weiterentwicklungen.<br />
www.zf.com<br />
Eine von 60 Millionen elektrischen Parkbremsen<br />
Bild: ZF TRW<br />
BMWi-Leuchtturmprojekt mit 16 Partnern gestartet<br />
Continental leitet Forschungsprojekt „Kooperatives hochautomatisiertes Fahren“<br />
Der Automobilzulieferer Continental<br />
übernimmt die Koordination<br />
des Forschungsverbundprojekts<br />
„Kooperatives hochautomatisiertes<br />
Fahren“ (Ko-HAF).<br />
„Ko-HAF bringt uns einen Schritt<br />
weiter in Richtung hochautomatisiertes<br />
Fahren, wobei Verkehrssicherheit<br />
auf hohem Niveau die<br />
unverzichtbare Grundlage bildet“,<br />
erklärt Dr. Stefan Lüke, Continental<br />
Chassis & Safety, Projektkoordinator<br />
Ko-HAF. „Das Projekt<br />
erforscht neben der Einbindung<br />
des Fahrers auch die übergreifende<br />
Funktion und Kommunikation<br />
der Fahrzeuge untereinander“.<br />
Mit 36,3 Mio. € Budget und der<br />
Das automatisierte Fahren muss nicht dauerhaft überwacht werden Bild: Continental<br />
Unterstützung durch ein Konsortium<br />
aus Automobilherstellern, Zulieferern<br />
und öffentlichen Partnern<br />
wie des Bundesministeriums für<br />
Wirtschaft und Energie (BMWi)<br />
startete Ko-HAF im Juni 2015.<br />
Ziel des dreijährigen Projekts ist<br />
die Erforschung von Systemen und<br />
Funktionen, die dem Fahrer die<br />
Fahraufgabe für einen gewissen<br />
Zeitraum abnehmen können. In<br />
dieser Zeit muss das Fahrzeug<br />
sein Umfeld und die Verkehrssituation<br />
einschätzen, besonders<br />
bei hohen Geschwindigkeiten und<br />
komplexen Szenarien eine große-<br />
Herausforderung.<br />
Ko-HAF verfolgt dafür eine Lösung,<br />
bei der Fahrzeuge per Mobilfunk<br />
mit einem Server kommunizieren.<br />
Dieser sammelt Informationen<br />
über den Verkehr, wertet sie aus<br />
und stellt sie den Fahrzeugen wieder<br />
zur Verfügung<br />
Continental ist mit den Divisionen<br />
Chassis & Safety sowie Interior beteiligt<br />
und entwickelt u.a. Schnittstellen<br />
zum Informationsaustausch<br />
sowie die fahrstreifengenaue<br />
Ortung durch das Fahrzeug.<br />
Als Lösung wird das M2XPro-Konzept<br />
zur Vernetzung von Sensordaten<br />
mit dem Globalen Navigationssatellitensystem<br />
und Landmarken<br />
verfolgt. Ein weiterer Schwerpunkt<br />
ist das kooperative Verhalten<br />
der Fahrzeuge bei verschiedenen<br />
Fahrmanövern. Validierungsmethoden<br />
sind geplant und werden<br />
entwickelt.<br />
Bereits erhältliche Fahrerassistenzsysteme<br />
stellen die Basis<br />
künftiger Entwicklungen dar. Forschungsprojekte<br />
und die Teilnahme<br />
an Wettbewerben sind dafür<br />
so wichtig wie Tests auf öffentlichen<br />
Straßen.<br />
Die Division Chassis & Safety entwickelt<br />
Technologien und Produkte,<br />
deren Kompetenz und Vernetzung<br />
das Fundament für automatisiertes<br />
Fahren bilden.<br />
www.continental-automotive.de<br />
www.continental-corporation.com<br />
10 AutomobilKonstruktion 3/2015
MOBILITÄT FÜR MORGEN<br />
URBANE MOBILITÄT<br />
Wie wird die Menschheit in Zukunft reisen, wie Waren transportieren? Welche und wie viele<br />
Ressourcen werden wir dabei nutzen? Angesichts rasanter Entwicklungen im Bereich des<br />
Personen- und Güterverkehrs sorgen wir für wegweisende und bewegende Momente. Wir<br />
entwickeln Komponenten und Systeme für Verbrennungsmotoren, die so sauber und effizient<br />
sind wie nie zuvor. Und wir treiben Technologien voran, die Hybridfahrzeuge und alternative<br />
Antriebe in neue Dimensionen führen – für Private, Unternehmen und die öffentliche Hand.<br />
Die Herausforderungen sind groß. Wir liefern die Antworten.<br />
schaeffler-mobility.de
AUS DER BRANCHE<br />
LEUTE<br />
Christoph Hummel, Preh<br />
Nach 16 Jahren an der Spitze der Preh GmbH geht der<br />
Vorsitzende der Geschäftsführung, Dr. Michael Roesnick (61),<br />
zum Jahresende in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird der<br />
49-jährige Christoph Hummel, der bereits seit dem Jahr 2008<br />
Mitglied der Geschäftsführung des Automobilzulieferers und<br />
Automationsspezialisten ist.<br />
Dietmar Marx, Federal-Mogul Powertrain<br />
Preferred Supplier<br />
Knorr-Bremse zeichnet Findling aus<br />
Zum zweiten Mal in Folge hat die<br />
Knorr-Bremse AG die Findling<br />
Wälzlager GmbH als Preferred<br />
Supplier ausgezeichnet. Damit<br />
würdigt das Unternehmen herausragende<br />
Leistungen bei der Lieferung<br />
von Produkten und Dienstleistungen.<br />
Knorr-Bremse setzt<br />
Produkte von Findling in einer Reihe<br />
von Anwendungen im Bereich<br />
der Schienenverkehrssysteme ein.<br />
Zudem übernehmen die Wälzlagerexperten<br />
aus Karlsruhe die<br />
Konstruktion von Sonderteilen,<br />
Belieferungen von Entwicklungsmustern<br />
und den technischen<br />
Support für die Konstruktionsabteilungen.<br />
Durch die langjährige<br />
Zusammenarbeit mit Knorr-Bremse<br />
haben sich bei Findling diverse<br />
Prozessverbesserungen ergeben.<br />
www.findling.com<br />
Federal-Mogul Powertrain hat Dietmar Marx (46) zum neuen<br />
Werkleiter des Standorts Burscheid berufen. Er tritt die Nachfolge<br />
von Johannes Pink an. Marx verantwortete zuletzt als<br />
Mitglied der Geschäftsleitung die weltweite Produktion für<br />
die Continental Emitec GmbH in Lohmar, ein auf Katalysatoren<br />
und Diesel-Partikelfilter spezialisiertes Unternehmen.<br />
Philip Nelles, Contitech<br />
Philip Nelles (41) ist neuer Geschäftsführer der Contitech<br />
Power Transmission Group. Er folgt auf Konrad Müller, der<br />
die Leitung des Geschäftsbereiches Air Spring Systems<br />
übernommen hat. Nelles ist bereits seit 2010 für die Power<br />
Transmission Group tätig. Zuletzt hat er das Segment Automobile<br />
Erstausrüstung geleitet.<br />
Dr. Stephan Weng, Getrag<br />
Zum 1. April 2015 hat Dr. Stephan Weng die Position des<br />
Chief Operating Officers bei Getrag übernommen. Diese<br />
Funktion bündelt die Bereiche Produktion, Einkauf<br />
und künftig auch Qualität. Zuletzt war er Mitglied des<br />
Executive Boards bei der Knorr-Bremse Systems for<br />
Commercial Vehicles GmbH.<br />
Dr. Jens Ludmann, FEV<br />
Dr. Jens Ludmann hat als Geschäftsführer der FEV GmbH die<br />
Verantwortung für das Europageschäft des Entwicklungsdienstleisters<br />
übernommen. Ludmann war zuletzt als Chief<br />
Technology Officer beim chinesischen Automobilhersteller<br />
Qoros Auto Co. Ltd tätig und folgt auf Dr. Markus Schwaderlapp,<br />
der sich neuen Aufgaben bei der Deutz AG widmet.<br />
Thomas Spangler, Brose<br />
Nach fünfjähriger Tätigkeit als Präsident Brose Asien ist<br />
Thomas Spangler (50) nach Coburg zurückgekehrt. Zum<br />
1. Juli 2015 hat er den neu geschaffenen Bereich Technik<br />
übernommen. In dieser Funktion verantwortet er die weltweite<br />
Produktion sowie die Steuerung der Zentralen Qualität, Logistik,<br />
Zentralen Entwicklung und Produktionstechnologie.<br />
Findling Wälzlager ist erneut Preferred Supplier Bild: Findling<br />
Doppelkupplungsgetriebe 7DCT300<br />
Getrag erhält Innovationspreis von Renault<br />
Getrag hat für das effiziente Doppelkupplungsgetriebe<br />
7DCT300<br />
die begehrte Auszeichnung „Prix<br />
de l’innovation Renault-Nissan“<br />
im Jahr 2015 erhalten. Das Unternehmen<br />
aus Untergruppenbach<br />
hatte die Produktion des Doppelkupplungsgetriebes<br />
im Februar<br />
dieses Jahres gestartet. Der Getriebespezialist<br />
beliefert aus dem<br />
Werk in Neuenstein Kunden im europäischen<br />
Markt, ab 2017 wird<br />
das 7DCT300 dann auch in China<br />
für den asiatischen Markt produziert.<br />
Mittelfristig plant Getrag,<br />
das 7DCT300 mit dem kompakten<br />
6DCT150/200 zu ergänzen. Das<br />
7DCT300 basiert auf einer neuen<br />
modularen Plattform und ist für<br />
Drehmomente bis 300 Nm ausgelegt.<br />
Zur hohen Effizienz des<br />
Getriebes trägt auch die Smart<br />
Actuation genannte bedarfsgeregelte<br />
Betätigung bei, die einen<br />
Leistungsbedarf unter 40 W erreicht.<br />
Damit verbraucht das Getriebe<br />
weniger Energie als eine<br />
Glühlampe und ist um 3,5% effizienter<br />
als die zweite Generation.<br />
www.getrag.com<br />
Innovationspreis<br />
für das<br />
7DCT300<br />
Bild: Getrag<br />
12 AutomobilKONSTRUKTION 3/2015
ONSERT ®<br />
Eine effiziente Verbindung<br />
Schnelles und prozesssicheres Kleben<br />
Mit der ONSERT ® Technologie bieten Ihnen Böllhoff und Delo ein System zum Aufbringen<br />
von Verbindungselementen mittels lichthärtender Klebstoffe auf unterschiedlichen Materialien.<br />
Das innovative Fügeverfahren bietet beste Voraussetzungen für den vielfältigen Einsatz in<br />
verschiedensten Branchen.<br />
Profitieren Sie von:<br />
■ Kurzen Aushärtungszeiten<br />
■ Anspruchsvoller Optik bei Design- und Sichtflächen<br />
■ Gestaltungsfreiheit<br />
Ihr Partner für erfolgreiche Verbindungen – weltweit.<br />
Tel. +49 521 4482 -189<br />
fat@boellhoff.com<br />
www.boellhoff.de
AUS DER BRANCHE<br />
Messen Composites Europe und Hybrid Expo<br />
Aussteller präsentieren Innovationen für den Leichtbau im Automobil<br />
Leichtbau-Kühlergrill von Audi<br />
Bild: Composites Europe<br />
Auf der Composites Europe, die<br />
vom 22. bis 24. September in<br />
Stuttgart stattfindet, zeigen 450<br />
Aussteller eine Vielfalt an Leichtbau-<br />
und Verbundwerkstoff-Innovationen,<br />
hauptsächlich für den<br />
Automobilbau. Erwartet werden<br />
rund 11 000 Entscheider aus der<br />
Industrie auf der von Reed Exhibitions,<br />
EuCIA, AVK, dem VDMA-Forum<br />
Composite Technology und<br />
der Fachzeitschrift Reinforced<br />
Plastics organisierten Fachmesse.<br />
Bei der bio!CAR Konferenz im Rahmen<br />
der Messe bekommen auch<br />
bio-basierte Werkstoffe ein Forum.<br />
Evonik zeigt einen 3D-Partikelschaumkern,<br />
der bessere Eigenschaften<br />
und Verarbeitungsmöglichkeiten<br />
als PU-Schaum haben<br />
und in der Serienfertigung von<br />
namhaften deutschen Fahrzeugherstellern<br />
eingesetzt werden soll,<br />
um Materialverlust und Arbeitsschritte<br />
zu reduzieren.<br />
Die CQFD Composites aus Wittenheim/Frankreich<br />
stellt einen für<br />
Hyundai entwickelten Front-Stoßstangen-Träger<br />
aus. Er besteht aus<br />
einem kunststoffumspritzten Composite-Einsatz<br />
aus einseitig ausgerichteten<br />
Glas- oder Carbonfasern<br />
in einer thermoplastischen<br />
Matrix aus A-PA6.<br />
Die Delcotex Delius Techtex GmbH<br />
& Co. KG aus Bielefeld präsentiert<br />
eine schwer entflammbare Instrumententafel,<br />
deren gespritzte<br />
Bauteile an kritischen Stellen mit<br />
Gittergewebe verstärkt wurden.<br />
Zu den Ausstellungsstücken der<br />
Scott Bader Company Ltd. aus<br />
Wellinborough/Großbritannien gehört<br />
das Rennmotorrad „Ariane<br />
Moto 3 World Championship“ mit<br />
Karosserieteilen aus einem speziellen<br />
Materialverbund. Der Hersteller<br />
verspricht hohen Aufprallschutz<br />
und Widerstandsfähigkeit<br />
gegen Schäden.<br />
Highlight am Messestand der<br />
Hennecke GmbH aus Sankt Augustin<br />
ist das neue Leichtbaudach<br />
des Smart Fortwo in Sandwich-<br />
Bauweise aus PUR, Glasfaser, Papierwabe<br />
und einer Thermoplast-<br />
Außenhaut. Es soll bei gleicher<br />
Festigkeit rund 30 % leichter als<br />
das Dach des Vorgängers sein. Die<br />
einzelnen Schichten werden laut<br />
Hersteller nicht aufwändig mehrstufig<br />
verklebt, sondern in einem<br />
Arbeitsschritt produziert.<br />
Ein weiteres Exponat bei Hennecke<br />
ist eine Tür in einer Stahl-<br />
Kunststoff-Hybridbauweise. Eine<br />
sehr dünne Stahl-Außenhaut wurde<br />
durch das gezielte Hinterspritzen<br />
mit Kunststoff stabilisiert.<br />
Die KraussMaffei Technologies<br />
GmbH aus München zeigt einen<br />
temperaturfesten Kotflügel für Parat-Landmaschinen<br />
als Beispiel<br />
für großflächige Bauteile mit sofort<br />
lackierfähigen Oberflächen.<br />
Ein spezielles Verfahren soll einen<br />
hohen Automatisierungsgrad, kurze<br />
Zykluszeiten unter 60 Sekunden<br />
sowie komplexe, dünnwandige<br />
und dennoch großflächige Bauteile<br />
ermöglichen.<br />
Die Iprotex GmbH & Co. KG aus<br />
Münchberg präsentiert Hybridgewirke,<br />
-gewebe und -geflechte aus<br />
glasfaserverstärktem Kunststoff,<br />
die bei Querlenkern und Stoßfänger<br />
Aluminium und Stahl ersetzen<br />
sollen. Auch andere Spezialfasern<br />
wie Aramid, Basalt oder Carbon<br />
verarbeitet das Unternehmen.<br />
Das Gummiwerk Kraiburg GmbH &<br />
Co. KG aus Waldkraiburg stellt<br />
Brandschutzmischungen nach EN<br />
45545 R1HL3 und Verklebungen<br />
von CFK und Metall, die die Vorteile<br />
von beiden Materialien verbinden<br />
sollen, aus. Ein weiterer Vorteil<br />
sei die einfache Integration<br />
des Klebeverfahrens in den Herstellungsprozess.<br />
www.composites-europe.com<br />
Gleichzeitig findet, ebenfalls in<br />
Stuttgart, die Hybrid Expo statt.<br />
Deren Aussteller zeigen Verbindungstechniken<br />
für unterschiedliche<br />
Materialklassen, mit denen<br />
sich individuelle Vorteile verschiedener<br />
Werkstoffe in Multimaterialsystemen<br />
vereinen lassen.<br />
www.hybrid-expo.com<br />
Neuer Großer Zulieferer für automobile Innenausstattung<br />
Yanfeng Automotive Interiors Joint Venture startet<br />
Anfang Juli 2015 hat Yanfeng Automotive<br />
Interiors, Zulieferer für<br />
automobile Innenausstattung, offiziell<br />
seine Arbeit aufgenommen.<br />
Das Joint Venture zwischen Yanfeng<br />
Automotive Trim Systems Co.<br />
Ltd. und Johnson Controls gehört<br />
eigenen Angaben zufolge mit<br />
einem Umsatz von rund 8,5 Mrd.<br />
US-Dollar und einem Auftragsbestand<br />
von 10 Mrd. US-Dollar in<br />
den nächsten Jahren zu den großen<br />
Anbieter automobiler Innenausstattung.<br />
Yanfeng hält 70 %<br />
des gemeinsamen Unternehmens,<br />
Johnson Controls die restlichen<br />
30 %. Das Portfolio umfasst Instrumententafeln<br />
und Cockpitsysteme,<br />
Türverkleidungen, Mittelkonsolen<br />
und Dachbedieneinheiten.<br />
Yanfeng Automotive Interiorshat<br />
den Hauptsitz in Shanghai<br />
und beschäftigt mehr als 28 000<br />
Mitarbeiter an über 90 Produktions-<br />
und Entwicklungsstandorten<br />
in 17 Ländern.<br />
www.yfai.com<br />
Yanfeng zeigt Fahrzeuginnenraum der Zukunft Bild: obs/Yanfeng Automotive Interiors<br />
14 AutomobilKonstruktion 3/2015
KSPG Automotive India<br />
Neue Fabrik in Supa<br />
Der Gleitlagerbereich der KSPG<br />
Automotive India Private Ltd. baut<br />
in Supa, Indien, neue Produktionshallen<br />
speziell für die Herstellung<br />
von in Gleitlagern eingesetzten<br />
Rohmaterialien. Die neuen<br />
Fabrikanlagen auf dem rund<br />
40 000 m² großen Gelände sollen<br />
Ende 2015 fertig gestellt werden,<br />
da der Leasingvertrag für die bisher<br />
verwendeten Gebäude im<br />
26 km entfernten Ahmednagar<br />
2016 ausläuft.<br />
Mit dem Neubau festigt KSPG die<br />
Aktivitäten im indischen Markt.<br />
Die bisherige Produktion des<br />
Standortes Ahmednagar wird aufgeteilt:<br />
Die Anlagen zur Herstellung<br />
von motorischen Lagerschalen<br />
gehen nach Takwe in der Nähe<br />
von Pune, wo sich bereits ein<br />
Großteil der Produktionsanlagen<br />
befindet. Supa erhält die Vormaterialproduktion:<br />
Sinteranlagen zur<br />
Herstellung von Bronze sowie die<br />
Gieß- und Walzplattieranlage zur<br />
Herstellung von Aluminiummaterialien.<br />
Das Produktspektrum der indischen<br />
Gesellschaft umfasst motorische<br />
Lagerschalen, Buchsen und<br />
Anlaufscheiben für den Pkw- und<br />
Nutzfahrzeugsektor. Zu den Kunden<br />
zählen unter anderem Maruti<br />
Suzuki, Mahindra & Mahindra, Tata<br />
Motors, Honda, Cummins sowie<br />
Kirloskar Oil Engines. Darüber hinaus<br />
wird auch der Ersatzteilmarkt<br />
beliefert.<br />
Neben Gleitlagern für Verbrennungsmotoren<br />
stellt KSPG auch<br />
Gleitelemente für weitere Applikationen<br />
wie Getriebe und Bremsen<br />
her. Das Werk in Takwe produziert<br />
außerdem Öl-, Kühlmittel- und Vakuumpumpen<br />
sowie AGR-Ventile.<br />
www.kspg.com<br />
Produkte für mehrere Fahrzeugmodelle der BBA<br />
Leoni weiht fünftes Bordnetz-Werk in China ein<br />
Leoni, Anbieter von Kabeln und<br />
Kabelsystemen für die Automobilbranche<br />
und weitere Industrien,<br />
hat im August sein fünftes chinesisches<br />
Bordnetz-Werk eingeweiht.<br />
Das neue Werk in der Stadt<br />
Tieling im Norden des Landes entwickelt<br />
und produziert Produkte<br />
für mehrere Fahrzeugmodelle der<br />
BMW Brilliance Automotive Ltd.<br />
(BBA), ein Gemeinschaftsunternehmen<br />
der BMW AG und der<br />
Brilliance China Automotive Holdings<br />
Ltd.<br />
In das über 25 000 m² große Gebäude<br />
und die Anlagen in Tieling<br />
investierte Leoni insgesamt<br />
35 Mio. Euro und erweiterte damit<br />
Fertigungskapazitäten und Geschäft<br />
im Wachstumsmarkt China.<br />
In the line. In the measuring room.<br />
And in between.<br />
ZEISS Car Body Solutions.<br />
The moment you know that you have<br />
purchased much more than just a machine.<br />
This is the moment we work for.<br />
Erleben Sie Messtechnik im Karosseriebau<br />
14.-15. Oktober 2015 in Oberkochen<br />
Der Start der Serienproduktion ist<br />
für Anfang 2016 mit bis zu 2000<br />
Mitarbeitern geplant. Die Leoni-<br />
Gruppe ist seit mehr als 20 Jahren<br />
mit aktuell über 9000 Mitarbeitern<br />
an nunmehr zwölf Produktionsstandorten<br />
in China vertreten.<br />
www.leoni.com<br />
14.-15.<br />
OKTOBER<br />
Wir bieten zuverlässige Komplettlösungen für Fertigungslinie, Messraum und produktionsnahen Einsatz.<br />
Damit ist ZEISS der ideale Partner für die systematische Überwachung der Karosseriefertigung.<br />
Alle Produkte und Services von ZEISS sind aufeinander abgestimmt – somit ist Qualität und Produktivität<br />
gewährleistet. ZEISS bietet Ihnen innerhalb des Car Body Forums am 14. und 15.10.2015 die Möglichkeit, sich<br />
über die Vernetzung von IN LINE, AT LINE und OFF LINE zu informieren.<br />
IN LINE<br />
AT LINE<br />
OFF LINE<br />
Anmelden unter: www.zeiss.de/metrology/carbody-forum
AUS DER BRANCHE<br />
IN KÜRZE<br />
Rassini erhält Qualitätspreis<br />
von Daimler Trucks<br />
Das mexikanische Unternehmen<br />
Rassini wurde von Daimler<br />
Trucks North America mit dem<br />
Masters of Quality Award 2014<br />
geehrt, der höchsten Auszeichnung<br />
für Zulieferer. Rassini liefert<br />
Daimler Vorder- und Hinterachsfederungskomponenten,<br />
die in Freightliner-Cascadia-<br />
Trucks zum Einsatz kommen.<br />
BASF eröffnet Harzfabrik<br />
in Shanghai<br />
BASF hat eine neue Anlage für<br />
Harze und kathodische Tauchlacke,<br />
die im Bereich der Auto -<br />
serienlacke Anwendung finden,<br />
im Shanghai Chemical Industry<br />
Park (SCIP) in China eröffnet. Die<br />
Anlage ergänzt das globale Netzwerk<br />
der BASF zur Produktion<br />
hochwertiger Beschichtungen.<br />
Borbet errichtet neues Werk<br />
nahe Görlitz<br />
In Kodersdorf nahe Görlitz errichtet<br />
die Borbet-Gruppe ihr<br />
neues Werk, die Borbet Sachsen<br />
GmbH, mit einer Kapazität von<br />
zwei Millionen Rädern pro Jahr.<br />
Der Bau der Halle wird voraussichtlich<br />
im November beendet<br />
sein. Im Frühjahr 2016 soll die<br />
Produktion von Leichtmetallrädern<br />
beginnen.<br />
Benecke-Kaliko erweitert<br />
Produktion in Mexiko<br />
Benecke-Kaliko hat im mexikanischen<br />
San Luis Potosí mit dem<br />
Bau einer neuen, 7000 m 2 großen<br />
Produktionshalle direkt neben<br />
dem bisherigen Werk begonnen.<br />
Dort werden ab dem<br />
3. Quartal kommenden Jahres<br />
Tepeo- und Tepeo-2-Folien für<br />
den nordamerikanischen Markt<br />
produziert. In die Erweiterung investiert<br />
Benecke-Kaliko rund<br />
11,4 Mio. Euro.<br />
Schmolz + Bickenbach beliefert Schmitz Cargobull<br />
Neue Fertigungstechnik für Lkw-Trägerprofile<br />
Die Trägerprofile kommen in Genios-Fahrzeugen zum Einsatz Bild: Schmitz Cargobull<br />
Testen von Automobilbauteilen<br />
Wuxi Xindebao wählt Moogs Lösung<br />
Wuxi Xindebao hat kürzlich erfolgreich<br />
ein Testprogramm zur Lebensdauerprüfung<br />
von Flex-Kupplungen<br />
unter Verwendung eines<br />
neuen Simulationstisches durchgeführt,<br />
der speziell von Moog<br />
entworfen wurde, um kleinere<br />
Nutzlasten von bis zu 100 kg<br />
handhaben zu können. Der hydraulische<br />
Simulationstisch<br />
H-ST-100 ergänzt Moogs Simulationstischlösungen,<br />
die für Xindebao<br />
zum Testen von Auspuffanlagen<br />
für Autos entwickelt wurden.<br />
Er ist als elektrische oder hydraulische<br />
Version verfügbar, je nach<br />
gewünschter Leistung.<br />
Mit der Moog-H-ST-100-Testlösung<br />
ist es Xindebao möglich, die Lebensdauer<br />
von Flex-Kupplungen<br />
zu testen, indem die relevanten<br />
Bewegungen von zwei Enden<br />
(Krümmeranschluss und Auspuffrohrende)<br />
in sechs Freiheitsgraden<br />
(DOF) simuliert werden. Dabei<br />
werden Daten, die in einem realen<br />
Fahrzeug gemessen wurden, über<br />
den Moog-Test-Controller und<br />
die Replication-and-Runner-Anwendungssoftware<br />
ausgegeben,<br />
um spezifische Straßenbedingungen<br />
nachzubilden, die für die<br />
Tests erforderlich sind.<br />
Wuxi Xindebao ist ein OEM-Zulieferer<br />
von Untersystemen für Auspuffanlagen<br />
für Automobilmarken<br />
wie Volkswagen, GM, Ford JV, FAW<br />
Bis zu 650 Lkw-Trägerprofile der<br />
neusten Generation wöchentlich<br />
in dauerhaft reproduzierbarer<br />
Qualität und bei Bedarf Just-in-sequence-Lieferung<br />
direkt in die<br />
Trailer-Produktion der Schmitz<br />
Cargobull AG in Altenberge: Diesen<br />
Anspruch erfüllt die Schmolz<br />
+ Bickenbach Distributions GmbH<br />
mit der neuen Fertigungslinie, die<br />
jetzt in Düsseldorf in Betrieb genommen<br />
wurde. Als langjähriger<br />
Partner des Herstellers von Sattelziellen<br />
Verfahren wird die von<br />
Schmitz Cargobull patentierte<br />
Kontur präzise in die Profile aus<br />
Breitflachstahl und Blech eingebracht.<br />
Das ermöglicht es, die<br />
Bauteile bei der Herstellung der<br />
Auflieger präzise kalt zu fügen.<br />
Dadurch entfällt das Verschweißen<br />
des Materials und damit das<br />
Risiko von Hitzeeinfluss auf das<br />
Material. Im Ergebnis steigt die<br />
Verbundfestigkeit der verbauten<br />
Komponenten und damit die Belastbarkeit<br />
in der Anwendung. Bis<br />
zu fünfmal täglich liefert Schmolz<br />
+ Bickenbach die Trägerprofile<br />
nach Bedarf just in sequence ins<br />
Produktionswerk von Schmitz Cargobull<br />
in Altenberge bei Münster.<br />
www.schmolz-bickenbach.de<br />
www.cargobull.com<br />
und SAIC und hatte von Tenneco<br />
China eine Anfrage erhalten, eine<br />
lokale Lösung für Lebensdauerund<br />
Abnahmetests auszuarbeiten.<br />
www.moog.com<br />
aufliegern und Anhängern investierte<br />
das Stahlhandels- und<br />
Dienstleistungsunternehmen rund<br />
1,8 Mio. Euro in die Entwicklung<br />
und Konstruktion der Anlagentechnik.<br />
Die Produktionstechnologie entwickelte<br />
Schmolz + Bickenbach in<br />
enger Zusammenarbeit mit<br />
Schmitz Cargobull. Sie ist auf die<br />
technischen Anforderungen der<br />
aktuellen Generation von Trägerprofilen<br />
ausgelegt: Mit einem spe-<br />
Hydraulischer<br />
Simulationstisch<br />
H-ST-100<br />
Bild: Moog<br />
16 AutomobilKonstruktion 3/2015
ONLINE<br />
Neues auf www.autokon.de<br />
Kcomplett überarbeitete Info Center App von Eplan<br />
Mit 4 Klicks zu allen Inhalten<br />
Eplan präsentiert die komplett überarbeitete Eplan Info Center App. Anwender<br />
profitieren von einem deutlich verbesserten Handling durch einen<br />
Relaunch der Benutzeroberfläche und direkten Zugriff auf die aktuellen<br />
News oder Veranstaltungshinweise. Konnten User früher Trainings<br />
nur über die Homepage buchen, sind sie mit<br />
der neuen App schneller am Ziel und sparen<br />
Zeit. Auch aktuelle Produktinformationen in<br />
Form von animierten PDF´s der Broschüren<br />
sind in der App zu finden. Selbstverständlich<br />
ist auch ein direkter Zugriff auf diverse Produkt-<br />
und Unternehmensvideos bei YouTube in<br />
Sekundenschnelle möglich. In maximal vier<br />
Klicks ist der Nutzer beim gewünschten Inhalt.<br />
Die Info Center App ist jetzt für IOS und Android<br />
in Deutsch und Englisch kostenlos verfügbar.<br />
Auch die Apps zum Eplan Data Portal<br />
wie auch zu Eplan View sind bereits für iOS<br />
verfügbar.<br />
www.eplan.de/apps<br />
Online-Auswertung von Kosten, Strecke und CO 2 -Emissionen<br />
Spritverbrauch per App ermitteln<br />
Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, kann bequem per App seinen Verbrauch<br />
bestimmen. Mit dem „EnergieCheck“ lassen sich direkt an der<br />
Tankstelle die Daten der Tankrechnung und der Kilometerstand eintragen.<br />
Die App zeigt dann den Verbrauch in l pro 100 km an; an einem bestimmten<br />
Tag, in einer Woche, einem Monat oder Jahr. Es lassen sich<br />
mehrere Fahrzeuge verwalten, die mit Benzin, Diesel, Erdgas oder Autogas<br />
betrieben werden; zum Beispiel Privat- und Firmenwagen, Busse,<br />
Lastwagen oder Motorräder. Daten zum Verbrauch von Heizenergie,<br />
Strom, Wasser und zum Ertrag von Photovoltaikanlagen können mit der<br />
App ebenfalls gesammelt und ausgewertet werden. Genutzt werden<br />
kann der EnergieCheck auch, um den Spritverbrauch der Klimaanlage zu<br />
ermitteln. Dazu sind die erste Fahrt mit Klimaanlage an einem Tag und<br />
die Vergleichsfahrt ohne Klimaanlage an einem anderen Tag einzutragen.<br />
Zum Vergleich: Laut ADAC steigt der Spritverbrauch durch eine<br />
Klimaanlage um durchschnittlich 10 bis 15 %.<br />
www.co2online.de/energiecheck<br />
Wachsende Allergiegefahr durch Ambrosia<br />
Innenraumfilter blockieren aggressive Pollen<br />
Allergien werden zur wachsenden<br />
Gesundheitsgefahr in<br />
Europa. Und mit ihnen steigt<br />
die Belastung durch einen<br />
aggressiven Einwanderer,<br />
das Beifußblättrige Traubenkraut<br />
(Ambrosia). Seine Blütezeit<br />
erstreckt sich von Juli<br />
bis Oktober. Die Leidenszeit<br />
von Allergikern verlängert sich somit bis in den Herbst hinein. Für<br />
freies Durchatmen bieten Innenraumfilter von Mann-Filter den richtigen<br />
Schutz. Sie verhindern den Kontakt zu Ambrosia- und anderen<br />
Pollen, Feinstaub und sonstigen Kleinstpartikeln im<br />
Fahrzeuginneren.<br />
www.autokon.de Suchwort Ambrosia<br />
Kein toter Winkel mit Kamera-Monitor-System<br />
Kameras ersetzen Spiegel<br />
Kameratechnologien<br />
halten immer stärker<br />
Einzug in die unterschiedlichsten<br />
Fahrzeugklassen.<br />
Continental<br />
hat erstmals in einem<br />
Versuchsträger ein<br />
Kamera-Monitor-System<br />
demonstriert, das die Außen- und Innenspiegel eines Pkw ersetzt.<br />
Anstelle der bisherigen Rückspiegel zeigen dem Fahrer zwei<br />
Monitore mit organischen Leuchtdioden (OLED) in den jeweils gewohnten<br />
Blickrichtungen das Geschehen im rückwärtigen<br />
und seitlichen Fahrzeugumfeld.<br />
www.autokon.de Suchwort Continental<br />
Bestandsaufnahme, Entwicklungen und künftige Einsatzgebiete<br />
Kompetenzatlas Fahrsimulation<br />
Das Virtual Dimension Center<br />
(VDC) Fellbach, die Technische<br />
Universität (TU) Berlin<br />
und das Automotive Simulation<br />
Center Stuttgart asc(s haben<br />
jetzt auf der 1. Fachtagung<br />
Fahrsimulatoren den gemeinsamen<br />
Kompetenzatlas<br />
Fahrsimulation vorgestellt.<br />
Darin wird eine Bestandsaufnahme<br />
durchgeführt und es werden aktuelle Entwicklungen und<br />
künftige Einsatzgebiete behandelt. Auf der Fachtagung in Stuttgart<br />
standen der fachliche Austausch und die Diskussion<br />
über Chancen und Herausforderungen im Mittelpunkt.<br />
www.autokon.de Suchwort Kompetenzatlas<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 17
ANTRIEB<br />
Prof. Dr.-Ing. Heinz K. Junker, Aufsichtsratsvorsitzender der Mahle GmbH, über Technik und Portfolio im Unternehmen<br />
„Klimakompressor schließt<br />
Lücke in unserem Portfolio“<br />
Nach knapp zwei Jahrzehnten an der Spitze der<br />
Geschäftsführung von Mahle übernimmt<br />
Prof. Dr.-Ing. Heinz K. Junker den Aufsichtsratsvorsitz<br />
des Unternehmens. Für die AutomobilKonstruktion<br />
blickt er in die Vergangenheit zurück und äußert sich<br />
zur Zukunft der Antriebstechnik.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Mit welchen Strategien und Produkten<br />
hat Mahle auf die große Herausforderung<br />
CO 2 reagiert?<br />
Junker: Wir haben beispielsweise in enger Kooperation<br />
mit unseren Kunden neue Produkte<br />
zur Optimierung des Verbrennungsmotors entwickelt.<br />
Mit diesen Produkten sind wir mit vorne<br />
dabei, wenn es um Wirkungsgradverbesserungen<br />
geht. Beispiele sind Stahlkolben für<br />
Pkw-Dieselmotoren, Reibungsreduzierung, das<br />
Turbolader-Joint Venture mit Bosch sowie bedarfsgeregelte<br />
Öl- und Wasserpumpen.<br />
Das Interview führte Jürgen Goroncy, freier<br />
Mitarbeiter der AutomobilKonstruktion<br />
„Mit dem Zukauf der<br />
Klimasparte von Delphi<br />
wird Mahle künftig auch<br />
Klimakompressoren<br />
anbieten.“<br />
Mahle entwickelte sich unter Heinz<br />
K. Junker zu einem Zulieferunternehmen,<br />
das viele Bereiche der Automobiltechnik<br />
abdeckt Bilder: Mahle<br />
Automobil<br />
Konstruktion Und wie haben Sie die die wirtschaftliche<br />
Zäsur der Jahre 2008/2009 überwunden?<br />
Junker: Die Folgen der Wirtschaftskrise konnten<br />
wir mit unserer traditionell breiten Aufstellung<br />
in allen wichtigen Märkten relativ gut<br />
meistern. Eine andere Lehre aus der Wirtschaftskrise<br />
ist die Umgestaltung der Produktion<br />
zu einer flexibleren, nachfrageorientierteren<br />
Organisation. Wir können nicht immer davon<br />
ausgehen, dass die Nachfrage jedes Jahr um<br />
drei Prozent wächst, sondern müssen uns auf<br />
einen deutlich niedrigeren Break-Even-Point<br />
ausrichten.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Sind Behr und Letrika Belege dafür,<br />
dass Mahle sich zum Fullliner in Sachen<br />
Antrieb entwickeln will?<br />
Junker: Fullliner ist etwas zu hoch gegriffen. Wir<br />
haben nicht die Absicht, auch noch Einspritzsysteme,<br />
Abgasnachbehandlung oder ähnliches<br />
zu machen. Behr und Letrika waren strategische<br />
Opportunitäten, unser Produktportfolio<br />
sinnvoll zu erweitern und abzurunden. Die<br />
Themen Thermomanagement, Mechatronik<br />
und Elektrik standen schon lange auf unserer<br />
Agenda.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Die Mahle-Tochter Letrika arbeitet<br />
an einem Elektroantrieb mit etwa 50 Kilowatt<br />
Leistung. Ist das eine 48-Volt-Lösung?<br />
Junker: Nein, das ist ein Antrieb mit Hochvolt-<br />
Technik. Allerdings ist Letrika mit Elektroantrieben<br />
auf Niedervolt-Basis bereits bei Zweirädern,<br />
im Freizeitsegment oder kleinen Logistikfahrzeugen<br />
in sehr hohen Stückzahlen aktiv.<br />
Ein Beispiel ist das Letrika-Aggregat mit 48 Volt<br />
Betriebsspannung im Renault Twizy. Besonders<br />
im Bereich der großstädtischen Mobilität<br />
erwarte ich in nächster Zeit viele neue Konzepte,<br />
für die 48-Volt-Elektroantriebe sehr attraktiv<br />
sein können.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Stichwort elektrischer Antrieb:<br />
Steht schon eine Industrialisierung Ihres Range<br />
Extenders in Aussicht?<br />
Junker: Unser Range Extender ist für uns eine<br />
Plattform zur Präsentation unserer umfassenden<br />
Engineering-Kompetenz inklusive Integration<br />
von Verbrenner und E-Antrieb. Eine Serienfertigung<br />
war nicht unsere Priorität. Kundeninteresse<br />
ist allerdings vorhanden, jedoch benötigt<br />
das von uns geforderte Geschäftsmodell<br />
Kunden, die über eine lange Laufzeit eine Garantie<br />
über gewisse Stückzahlen geben. Sonst<br />
lohnen sich die massiven Investitionen in eine<br />
Fertigung nicht.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Wo sehen Sie die Marktnische<br />
des Range Extenders im Wettbewerb mit<br />
48-Volt-Mildhybrid und Plug-in-Hybrid?<br />
Junker: Plug-in-Hybride sind besonders für große<br />
Fahrzeuge wie Oberklasse-Limousinen und<br />
SUV der bevorzugte Lösungsansatz. Dank einer<br />
elektrischen Reichweite von 40 oder 50 Kilometern<br />
und unter Berücksichtigung des aktuellen<br />
Verbrauchszyklus sind mit einem Plug-in-<br />
Hybrid Emissionswerte von deutlich weniger<br />
als 100 Gramm CO 2 pro Kilometer möglich. Allerdings<br />
erfordert ein Plug-in-Hybrid konzeptbedingt<br />
zwei vollwertige Antriebe, was ihn<br />
für kostensensiblere Fahrzeugsegmente zurzeit<br />
18 AutomobilKonstruktion 3/2015
nicht zur ersten Option macht.<br />
In diesen Segmenten sehe ich für einen<br />
48-Volt-Mildhybrid deutlich bessere Chancen,<br />
die Emissionsziele bei ungleich geringeren<br />
Kosten zu erreichen. Noch vor Jahren hielt ich<br />
persönlich diese Technik eher für ein Nischenprodukt.<br />
Allerdings offenbart sich jetzt nach<br />
und nach ihr Nutzen zum Erreichen der<br />
CO 2 -Ziele. Ein Range Extender ist meiner Ansicht<br />
nach für kleinere batterieelektrische Fahrzeuge<br />
optimal, bei denen bezüglich Reichweite<br />
keine Kompromisse gemacht werden sollen.<br />
Stahlkolben für Pkw sorgen für Wachstum im Geschäftsbereich Motorsysteme und -komponenten<br />
Automobil<br />
Konstruktion Welche Nebenaggregate und<br />
Techniken für Verbrennungsmotoren stehen für<br />
die Zukunft auf der Mahle-Agenda?<br />
Junker: Mit dem Zukauf der Klimasparte von<br />
Delphi werden wir künftig auch Klimakompressoren<br />
im Portfolio führen. Unsere Kunden fordern<br />
berechtigterweise Komplettsysteme inklusive<br />
Systemauslegung. Die Entwicklungsressourcen<br />
für die Systemauslegung mussten wir<br />
bereitstellen, ohne aber die Wertschöpfung<br />
aus der Fertigung von Klimakompressoren generieren<br />
zu können. Dieses Missverhältnis haben<br />
wir jetzt abgeschafft.<br />
Klimakompressoren sind außerdem ein interessantes<br />
Produkt, wenn es in Richtung Elektrifizierung<br />
des Antriebsstrangs geht. Bei einem<br />
Plug-in-Hybrid ist es definitiv erforderlich, dass<br />
der Klimakompressor elektrisch angetrieben<br />
wird, bei anderen Hybridvarianten zumindest<br />
erwägenswert.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Welche technischen Innovationen<br />
sind bei Motorsystemen und -komponenten<br />
noch zu erwarten?<br />
Junker: Wir machen 30 Prozent unseres Umsatzes<br />
mit Motorsystemen für Nutzfahrzeuge. Dort<br />
geht die Kraftstoffeffizienz über alles. Mahle<br />
hat erst kürzlich alle Anteile der früheren Amovis<br />
GmbH übernommen. Dieses innovative<br />
Start-Up-Unternehmen verfügt über eine hohe<br />
Kompetenz im Bereich der intelligenten Abgaswärme-Rückgewinnung<br />
mittels ORC (Organic<br />
Rankine Cycle). Mit einem solchen weiterentwickelten<br />
Dampfkreisprozess lassen sich beispielsweise<br />
bei Nutzfahrzeugen der Kraftstoffverbrauch<br />
und damit die CO 2 -Emissionen um<br />
bis zu fünf Prozent senken. Die von Amovis<br />
entwickelte Axialkolbenmaschine und unser<br />
Know-how bei der Wärmeübertragung sind<br />
Schlüsseltechniken für Systeme zur effizienten<br />
Abgaswärmenutzung. Mahle ist das einzige<br />
Thermomanagement-Systeme<br />
ergänzten systematisch das<br />
Produktportfolio<br />
Unternehmen, das ein komplettes ORC-System<br />
zur Verfügung stellen kann. Wir rechnen fest<br />
damit, dass erste Trucks damit 2020 auf der<br />
Straße unterwegs sein werden.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Sehen Sie weitere technische<br />
Innovationen bei Motorsystemen und<br />
-komponenten?<br />
Junker: Es bleibt abzuwarten, ob eine mechanische<br />
Regelung der Nebenaggregate ausreicht.<br />
Vielleicht wäre es besser, elektrisch betriebene<br />
Nebenaggregate zu bevorzugen und<br />
somit den Verbrennungsmotor von all diesen<br />
Zusatzaufgaben zu entlasten.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Sie werden bei Mahle den Aufsichtsratsvorsitz<br />
übernehmen. Hat das Auswirkungen<br />
auf Ihre Lehrtätigkeit an der Universität<br />
Bochum und andere Aktivitäten?<br />
Junker: Ich werde die Lehrtätigkeit weiterführen,<br />
weil sie mir viel Freude bereitet. Außerdem<br />
hält der Umgang mit jungen Menschen einen<br />
auch geistig jung und fit. Neben dem Aufsichtsratsvorsitz<br />
bei Mahle werde ich auch den<br />
Vorsitz im stimmberechtigten Gesellschaftergremium<br />
von Mahle übernehmen. Ich sehe das<br />
als meine mit Abstand wichtigste Aufgabe in<br />
den nächsten Jahren. Hinzu kommt, dass ich<br />
bei unseren Tochterunternehmen, an denen<br />
noch Dritte Gesellschafteranteile halten, wei-<br />
terhin im Aufsichtsrat sitzen oder ihn sogar<br />
führen werde.<br />
Mit meinem Nachfolger ist außerdem abgesprochen,<br />
dass ich die technische Weiterentwicklung<br />
des Konzerns eng begleiten werde.<br />
Denn der technische Wandel wird alle Unternehmen<br />
in unserer Industrie noch stärker fordern.<br />
Fokussieren lässt sich diese Entwicklung<br />
auf die dramatische Verschärfung des<br />
CO 2 -Grenzwerts, die den OEMs und Zulieferern<br />
alles an technischer Expertise abverlangt.<br />
IAA: Halle 8.0, Stand C40<br />
www.mahle.com<br />
Zur Person<br />
Prof. Dr.-Ing. Heinz K. Junker (65) wurde 1949 in<br />
Wegberg/NRW geboren. Nach seinem Abschluss zum<br />
Diplom-Ingenieur Fachrichtung Kraftfahrwesen an der<br />
RWTH Aachen promovierte er 1984 zum Dr.-Ing.<br />
Anschließend war er stellvertretender Geschäftsführer<br />
der Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen<br />
Aachen mbH. 1986 wurde er zum Hauptabteilungsleiter<br />
der Entwicklung bei TRW Ehrenreich in Düsseldorf<br />
berufen. Seit 1987 ist Junker auch Lehrbeauftragter für<br />
Fahrzeugdynamik an der Ruhr-Universität Bochum, seit<br />
1994 Honorarprofessor. Nach weiteren Stationen<br />
bei TRW wechselte er 1996 als Vorsitzender der<br />
Geschäftsführung und CEO zu Mahle.<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 19
ANTRIEB<br />
Kunststoff im Motor: Detailarbeit beim Downsizing<br />
Wie ein neuer Kettenspanner in 2K-Technologie entstand<br />
Führungsschiene für<br />
Steuerkette mit schwingungs-<br />
und geräuschdämpfender<br />
Wirkung<br />
Bilder: Weiss<br />
Konstrukteure von Kfz-Motoren<br />
können das sicherlich bestätigen:<br />
Die Tücke liegt im Detail. Selbst<br />
bei der Lösung von vermeintlich<br />
einfachen Aufgaben wie der optimalen<br />
Schwingungsdämpfung von<br />
Steuerketten ist ein hohes Maß<br />
an Werkstoff- und Prozess-Knowhow<br />
erforderlich. Ein Werkstattbericht<br />
der Weiss Kunststoffverarbeitung<br />
zeigt, welche Herausforderungen<br />
zu lösen sind und wie<br />
sie gemeinsam mit dem Kettenhersteller<br />
bei einem Dreizylindermotor<br />
gemeistert wurden.<br />
Die Autorin: Renate Gratwohl, Markkom, für Weiss<br />
Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG, Illertissen<br />
Das Downsizing ist ein wichtiger Trend in der<br />
Motorentechnik. Wo bei früheren Generationen<br />
eines Automodells ein Sechszylinder mit 2,5 l<br />
Hubraum zum Einsatz kam, reicht dem neuesten<br />
Modell ein hochaufgeladener 1,8 l-Vierzylinder.<br />
In der Kompaktklasse kommen sogar<br />
zunehmend Dreizylindermotoren zum Einsatz.<br />
Und die Autotester sind sich einig: Das ist kein<br />
Verlust. Die neuen Motoren sind sparsamer<br />
und keineswegs leistungsärmer.<br />
Für die Konstrukteure der Motoren bedeutet<br />
diese Entwicklung allerdings nicht nur Grundlagenentwicklung,<br />
sondern auch sehr viel Detailarbeit.<br />
Ein solches Detail betrifft die Kette<br />
des Nockenwellentriebs. Sie wird durch Schienen<br />
aus hochbelastbarem Polyamid (PA 66)<br />
geführt, die unter Öl laufen und hohen mechanischen<br />
Beanspruchungen ausgesetzt sind.<br />
Diese Schienen führen die Kette und halten sie<br />
unter Spannung. Zugleich haben sie die Aufgabe,<br />
Schwingungen zu dämpfen bzw. zu verlagern<br />
und das Geräuschniveau zu mindern.<br />
Ziel: 2K-Führungsschiene mit Zusatzeigenschaften<br />
Die Weiss Kunststoffverarbeitung GmbH & Co.<br />
KG ist seit Jahrzehnten Spezialist für die Fertigung<br />
dieser anspruchsvollen Kunststoffkomponenten<br />
und hat gemeinsam mit einem Motoren-<br />
und einem Kettenhersteller eine Lösung<br />
erarbeitet, die an die Anforderungen von kompakten<br />
Motoren mit hoher Leistungsdichte angepasst<br />
ist.<br />
Ziel der Entwicklung war es, zusätzliche schwingungsdämpfende<br />
Eigenschaften in die Führungsschiene<br />
einzubringen. Auf der theoretischen<br />
Ebene ist das einfach zu lösen: Zwischen<br />
den Seitenrippen der Schienen ist genug Platz,<br />
um mit Hilfe des Zweikomponenten-Spritzgießens<br />
(2K) ein thermoplastisches Elastomer<br />
(TPE) anzuspritzen. Das sind weiche Kunststoffe<br />
mit schwingungs- und geräuschdämpfender<br />
Wirkung.<br />
Werkstoff schwer zu verarbeiten<br />
In der Praxis ist diese Aufgabenstellung aber<br />
keineswegs trivial, obwohl Weiss umfangreiche<br />
Erfahrung mit der Werkstoff-Kombination PA<br />
und TPE im 2K-Spritzguss hat. Projektingenieur<br />
Stefan Martini: „Wir mussten hier ein spezielles<br />
TPE auf Polyesterbasis verwenden, das gummiartige<br />
Eigenschaften hat und öl- sowie temperaturbeständig<br />
ist. Dieser Spezialwerkstoff ist in<br />
der Schmelze zäh und klebrig und daher<br />
schwer zu verarbeiten. Außerdem geht er keine<br />
Verbindung mit Polyamid ein.“<br />
Diese Herausforderungen konnten aber gemeistert<br />
werden. Die Haftung des TPEs, das mit einer<br />
Wandstärke von jeweils sieben Millimetern<br />
an beiden Seiten der Schiene angespritzt wird,<br />
ist auf mechanische Weise gewährleistet:<br />
20 AutomobilKonstruktion 3/2015
Durchbrüche im Mittelsteg der Schiene gewährleisten<br />
ein Überströmen des Werkstoffs<br />
beim Spritzprozess auf beide Seiten und schaffen<br />
somit eine zuverlässige Verbindung.<br />
DRIVE<br />
WITH OUR<br />
EXPERIENCE<br />
Exakte Taktung von 1K- und 2K-Prozesschritt<br />
Da das PA mit sehr hoher und das TPE mit<br />
deutlich niedrigerer Temperatur verarbeitet<br />
wird, mussten bei der Gestaltung des 2K-Prozesses<br />
einige prozesstechnische Kniffe integriert<br />
werden. Und weil das Abkühlen des Kettenspanners<br />
eine Schwindung des Materials<br />
zur Folge hat, muss der Robotergreifer beim<br />
Ablegen und Wiederaufnehmen ein und desselben<br />
Bauteils in der Lage sein, die Maßänderungen<br />
zu kompensieren.<br />
Check Valves<br />
Blick in die 2K-Spritzgießmaschine<br />
mit robotergestützter<br />
Entnahme: Bei<br />
der neuesten Generation<br />
von Kettenspannern wird<br />
ein schwingungsdämpfendes<br />
TPE angespritzt<br />
Relief Valves<br />
Flow Controls<br />
Calibrated Orifices<br />
Safety Screens<br />
Wegen dieser und anderer Besonderheiten im<br />
Spritzgießprozess war die Konstruktion einer<br />
separaten Produktionszelle für das Bauteil erforderlich<br />
– eine Aufgabe, die Weiss traditionell<br />
mit eigenen Ressourcen erledigt und dabei<br />
auch die Automatisierungstechnik plant. Robert<br />
Heller, bei Weiss u.a. verantwortlich für<br />
die Konstruktion der Automatisierungseinrichtungen:<br />
„Wir haben das Zusammenspiel von<br />
2K-Maschine und Roboter so strukturiert, dass<br />
der Roboter der Master ist und quasi den Takt<br />
der Produktion gibt.“<br />
So komplex der Produktionsprozess auch ist:<br />
Die Entwickler der drei Unternehmen konnten<br />
das Projekt zu einem erfolgreichen Ergebnis<br />
führen. Der 2K-Kettenspanner bewährt sich bereits<br />
in der Praxis und trägt zum ruhigen,<br />
schwingungsarmen Lauf des Dreizylindermotors<br />
bei.<br />
Restrictor Checks<br />
Betaplugs<br />
Shuttle Valves<br />
Airbleed<br />
Weiss Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG<br />
Tel.: +49 7303 9699-64<br />
info@weiss-kunststoff.de<br />
LEE Hydraulische<br />
Miniaturkomponenten GmbH<br />
Am Limespark 2 · 65843 Sulzbach<br />
Telefon 06196 / 7 73 69 - 0<br />
E-mail info@lee.de · www.lee.de
ANTRIEB<br />
Maßgeschneidertes Fett als Konstruktionselement<br />
Warum die richtige Schmierung schon zu Beginn der Konstruktion bedacht werden sollte<br />
Lager und Fett bilden in der Anwendung eine sensible Einheit. Konstrukteure sollten daher schon zu Beginn der<br />
Entwicklung die Eigenschaften des Schmierfettes berücksichtigen<br />
Bild: Rhenus Lub<br />
Um Sicherheit, Zuverlässigkeit<br />
und Komfort neuer Fahrzeuge zu<br />
gewährleisten, braucht die Automobilindustrie<br />
reproduzierbare<br />
Prozesse und Hochleistungsfette,<br />
die genauso präzise formuliert<br />
und produziert werden wie andere<br />
Fahrzeug-Komponenten. Warum<br />
Automobilhersteller bei der Wahl<br />
ihrer Zulieferer auch die dortigen<br />
Produktionsverfahren genauer<br />
unter die Lupe nehmen sollten,<br />
zeigt der Mönchengladbacher<br />
Mittelständler Rhenus Lub.<br />
Der Autor: Michael Obst , Relations & Co.<br />
für Rhenus Lub, Mönchengladbach<br />
Bei fast allen Konstruktionen hat die Wahl des<br />
richtigen Schmierstoffs einen nachhaltigen Einfluss<br />
auf Lebensdauer und Qualität der fertigen<br />
Komponente. Gerade die aktuell am Fahrzeugmarkt<br />
angestrebten Ziele – geringerer<br />
Energieverbrauch, höhere Leistung und weniger<br />
Emissionen – lassen sich nur erreichen,<br />
wenn alle Fahrzeugkomponenten exakt aufeinander<br />
abgestimmt sind. Um diese Aufgabe<br />
zu meistern, setzen immer mehr Konstruktionsabteilungen<br />
auf Konstruktionspartnerschaften<br />
mit erfahrenen Lieferanten. Im engen Austausch<br />
zwischen Schmierstoff- und Automobilexperten<br />
entstehen so Hochleistungsfette, die<br />
exakt auf die Anforderungen neuartiger Fahrzeugkomponenten<br />
abgestimmt sind.<br />
Konstrukteure wissen: Das komplexe System<br />
aus Lager mit Gehäuse, Dichtung, Wälzkörper<br />
und Fett bildet in der Anwendung eine sensible<br />
Einheit. Umso wichtiger ist es, gleich zu Beginn<br />
der Konstruktion die Eigenschaften des<br />
Schmierfettes zu berücksichtigen und sich auf<br />
das Know-how von Fettspezialisten zu verlassen.<br />
Welche Vorteile sich dadurch erzielen lassen,<br />
zeigen zwei Praxisbeispiele:<br />
Die Konstruktionsabteilung eines namhaften<br />
Autobauers hatte es sich zum Ziel gesetzt, den<br />
Fahrkomfort ihrer Kunden nachhaltig zu steigern.<br />
Dazu soll die Aufhängung der Chassis optimiert<br />
werden. Dort stellen bis zu 30 Kugelgelenke<br />
sicher, dass Fahrzeuginsassen selbst bei<br />
unruhiger Straßenlage ihre Fahrt ganz entspannt<br />
genießen können. „In enger Zusammenarbeit<br />
mit der Entwicklungsabteilung unseres<br />
Kunden haben wir für diesen Anwendungsfall<br />
das Spezial-Hochleistungsfett LQU 2 entwickelt“,<br />
sagt Carsten Puke, Leiter Forschung &<br />
Entwicklung Fette bei Rhenus Lub. „Es ist mechanisch<br />
überaus stabil und nimmt selbst hohe<br />
Drücke problemlos auf. Dank seiner guten<br />
Alterungsbeständigkeit und des optimalen Korrosionsschutzes<br />
garantiert es den zuverlässigen<br />
Lauf der stark belasteten Kugelgelenke –<br />
und das ein ganzes Autoleben lang. Dabei ist<br />
es sehr gut verträglich mit den Elastomeren,<br />
die für die Schutzmanschetten der Kugelgelenke<br />
verwendet werden.“<br />
In einem anderen Fall wollte ein Kunde die<br />
Schmierung im Kreuzgelenk der Kardanwellen<br />
seiner Fahrzeuge zugleich zuverlässiger, effektiver<br />
und sicherer gestalten: „Temperaturbeständigkeit,<br />
mechanische Stabilität und gutes<br />
Druckaufnahmevermögen – dies waren die<br />
wichtigsten Anforderungen bei unserer Suche<br />
nach dem optimalen Schmierstoff“, so Puke.<br />
„Auf der Basis eines teilsynthetischen Öls haben<br />
wir extra für diesen Anwendungsfall das<br />
Hochtemperatur-EP-Fett LKI 2 formuliert. Mit einem<br />
weiten Temperaturbereich von –40 bis<br />
+150 °C sichert es auch bei extremen klimatischen<br />
Bedingungen eine zuverlässige Kraftübertragung.“<br />
Selbst Temperaturspitzen von<br />
bis zu 200 °C soll das Lithiumkomplexfett unbeschadet<br />
überstehen. Es sei zugleich sehr alterungs-<br />
und wasserbeständig und schütze die<br />
Einsatzstellen zuverlässig vor Korrosion.<br />
Potenziale voll ausschöpfen<br />
Im Idealfall beginnt die Kooperation zwischen<br />
Automobilindustrie und Schmierstoffexperten<br />
bereits im ersten Entwicklungsstadium neuer<br />
Komponenten. Über den gesamten Konstruktionszeitraum<br />
hinweg arbeiten die Fachleute von<br />
Rhenus Lub eng mit den Herstellern zusammen,<br />
um das Hochleistungsfett optimal auf die<br />
Anforderungen neuer Konstruktionen abzustimmen.<br />
Das setzt auf beiden Seiten ein aus-<br />
22 AutomobilKonstruktion 3/2015
gezeichnetes Fachwissen voraus. Rhenus Lub<br />
investiert daher nicht nur kontinuierlich in die<br />
Modernisierung seiner Produktionsanlagen,<br />
sondern auch in die Bereiche Forschung & Entwicklung.<br />
Rund 20% aller Mitarbeiter sind hier<br />
beschäftigt.<br />
Neue Fabrik nach 4.0-Standard<br />
Um seine Kunden auch in Zukunft mit Spezialfetten<br />
zu versorgen, hat Rhenus Lub rund zwei<br />
Millionen Euro in den Ausbau seiner Fettfabrik<br />
nach den Vorgaben von Industrie 4.0 investiert.<br />
Einen wichtigen ersten Schritt von der reinen<br />
Fettproduktion hin zur Smart Factory hatte<br />
das Unternehmen bereits Ende 2005 mit der<br />
Inbetriebnahme seiner spezialisierten Fettfabrik<br />
vollzogen. Schon damals wurden die 15<br />
Fertigungslinien mit rund 1200 Sensoren, Prozessgebern,<br />
Stellmotoren und Aktuatoren ausgestattet,<br />
die fast alle elektronisch angesteuert<br />
werden können.<br />
In der nächsten Stufe automatisierte Rhenus<br />
Lub nun die immer komplexer werdenden Fertigungsprozesse<br />
für Hochleistungsfette mit<br />
neuester Prozessleittechnik (PLS) und einem<br />
Manufacturing Execution System (MES) und<br />
verband sie mit dem Enterprise-Resource-Planning-System<br />
(ERP). Dabei nahmen die Schmierstoffexperten<br />
nicht nur eine komplette vertikale,<br />
sondern auch eine horizontale Vernetzung<br />
aller Fertigungsschritte vor. Sie beginnt in der<br />
Produktionsvorbereitung: Mitarbeiter kommissionieren<br />
alle Rohstoffe und Additive, die für<br />
das jeweilige Hochleistungsfett benötigt werden<br />
bereits vor Beginn des eigentlichen Produktionsvorgangs,<br />
wiegen sie genau ab und<br />
versehen jede Zutat mit einem speziellen Barcode.<br />
Im nächsten Abschnitt, der automatisch<br />
gesteuerten Produktion, lotst ein Handgerät<br />
den Mitarbeiter durch alle Verfahrensschritte.<br />
Die automatische Bedienführung unterstützt<br />
jene Arbeitsabläufe, die nicht automatisiert<br />
werden konnten.<br />
Schritt für Schritt zum Hochleistungsfett<br />
Die einzelnen Arbeitsschritte für die Produktion<br />
jeder der rund 1000 verschiedenen Rezepturen<br />
für Hochleitungsfette sind im System hinterlegt.<br />
Auf dem Handgerät wird der Bediener<br />
chronologisch durch die Arbeitsabläufe geleitet.<br />
Jeder der zuvor kommissionierten Rohstoffe<br />
kann erst dann hinzugefügt werden, wenn<br />
der entsprechende Arbeitsschritt ansteht und<br />
wenn per Scanner die Identifikationsnummer<br />
des jeweiligen Behälters und des Stoffes korrekt<br />
erfasst wurde. Sind die Anforderungen erfüllt,<br />
quittiert der Mitarbeiter den Arbeitsschritt<br />
am Handgerät und der nächste Ablaufschritt<br />
wird freigeschaltet.<br />
Dank der neuen Prozesssteuerung wird die<br />
Herstellung selbst komplexer Fettrezepturen<br />
nun nochmals genauer, transparenter – und<br />
vor allem wiederholbarer!, trotz der teils natürliche<br />
Rohstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften.<br />
So will Rhenus Lub sicherstellen,<br />
dass die VDA-Normen, ISO TS 16949 sowie die<br />
technischen Richtlinien seiner Kunden stets<br />
optimal erfüllt werden.<br />
Rhenus Lub GmbH & Co KG<br />
Tel.: +49 2161 40645-10<br />
michael.obst@relations-co.de<br />
Stahl für das Automobil –<br />
Holt für Sie und die Umwelt<br />
das Beste raus.<br />
Your Life. Our Steel. Individuelles Design,<br />
hoher Komfort, maximale Sicherheit, minimale<br />
CO 2 Emissionen – das sind die<br />
Faktoren, die in Zukunft für das richtige<br />
Fahrgefühl sorgen.<br />
Nachhaltig vereinen lassen sie sich nur mit<br />
Langprodukten aus modernem Hightech-<br />
Edelstahl. Als Hersteller und Verarbeiter von<br />
Edelbaustahl, Werkzeugstahl sowie rost-,<br />
säure- und hitzebeständigem Stahl, sind<br />
wir Ihr Partner für maßgeschneiderte<br />
Lösungen rund ums Automobil. Ob hochbelastbare<br />
Antriebs- und Motorenkomponenten,<br />
anspruchsvoller Karosseriebau,<br />
komplexer Formenbau für die Innenausstattung<br />
oder Druckgusswerkzeuge aus<br />
dem neuen Thermodur E 40 K Superclean –<br />
lassen Sie uns gemeinsam für Freude am<br />
Fahren sorgen.<br />
SCHMOLZ + BICKENBACH GROUP<br />
www.dew-stahl.com
ANTRIEB<br />
Kolben mit weniger Reibung<br />
Sparpotenzial durch Systemuntersuchungen und Detailoptimierungen am Produkt<br />
Reibleistungsmessungen am befeuerten<br />
Motor sind genauer als Untersuchungen<br />
im Schleppbetrieb Bild: Mahle<br />
Nicht nur die Verbrennung hat<br />
großen Einfluss auf die Kraftstoff -<br />
effizienz eines Motors. Zulieferer<br />
wie Mahle oder KSPG widmen sich<br />
intensiv der Reibungsreduzierung,<br />
um durch weniger Reibverluste<br />
die Motoren zu optimieren.<br />
Der Autor: Hartmut Hammer, freier Mitarbeiter<br />
der AutomobilKonstruktion<br />
Welche Effekte reibungsreduzierende Maßnahmen<br />
auslösen können, untersucht die Mahle<br />
GmbH seit einigen Jahren systematisch in ihrem<br />
Motorenversuch. Dort analysiert man bei<br />
befeuertem Motorbetrieb die Verlustleistungen<br />
klassischer Motorsysteme – wie etwa dem Kurbeltrieb<br />
– nach der Formel „Indizierte Leistung<br />
minus effektive Leistung gleich Reibleistung“.<br />
Konkret heißt das: Mitteldruck im Brennraum<br />
minus Drehmoment am Schwungrad gleich<br />
Reibmitteldruck. Diese in Abhängigkeit von<br />
Last, Drehzahl und Motortemperatur erfolgenden<br />
Messungen sind nach Angaben von Mahle<br />
deutlich realitätsnäher als die üblichen Reibleistungsuntersuchungen<br />
im Schleppbetrieb.<br />
Um den Einfluss einer Parameteränderung –<br />
etwa einer zusätzlichen Beschichtung oder einer<br />
anderen Kolbengeometrie bewerten zu<br />
können, werden die Kennfelder der zu vergleichenden<br />
Varianten voneinander subtrahiert.<br />
Das Ergebnis ist ein charakteristisches Reibmitteldruck-Differenzkennfeld<br />
für jede Änderung.<br />
Auf diese Weise kann jedes einzelne<br />
Bauteil, ein Teilbereich oder das Gesamt-Motorsystem<br />
optimiert werden – je nach Vorgabe<br />
des Kunden. Für noch detailliertere Analysen<br />
teilt Mahle das Motorbetriebs-Kennfeld in vier<br />
repräsentative Quadranten auf, für die jeweils<br />
ein eigenes Ranking der Wirksamkeit der Einzelmaßnahmen<br />
erstellt wird. Mit dieser Metho-<br />
24 AutomobilKonstruktion 3/2015
de sieht Mahle noch ein Optimierungspotenzial<br />
von zwei bis fünf Prozent der bisherigen<br />
Reibleistung des Motors. Kombiniert mit spezifischen<br />
Fahrzeugdaten rechnet dann ein Simulationsprogramm<br />
die gemessene Reibleistungsdifferenz<br />
in eine Kraftstoff- und Emissionsersparnis<br />
um.<br />
Der Kolben ist noch nicht am Ende<br />
Die KSPG AG arbeitet seit 2006 mit seinen Liteks-Aluminiumkolben<br />
für Ottomotoren an der<br />
Verringerung von Gewicht und Reibung. So ist<br />
die seit 2013 in den Mazda-Skyactiv-Motoren<br />
in Serie gegangene dritte Liteks-Generation gut<br />
24 % leichter und 46 % reibungsärmer als die<br />
Referenzkolben aus dem Jahr 2005. Bei der<br />
neuen, vierten Liteks-Generation (Serienstart<br />
Ende dieses Jahrzehnts) will KSPG mit mehreren<br />
Detailmodifikationen das Kolbengewicht<br />
im Vergleich zur dritten Liteks-Generation<br />
nochmals um fünf Prozent und die Reibleistung<br />
sogar um ein Viertel senken.<br />
Beispielsweise kann mit einer neu gestalteten<br />
Schaftabstützung die Spannungsverteilung innerhalb<br />
des Kolbens homogenisiert und so die<br />
Ringfeld-Hinterschnitte vergrößert werden. Eine<br />
Variante mit Ringträger und Kühlkanal ist<br />
speziell für Hochleistungs-Ottomotoren geplant.<br />
Des Weiteren verringert man die Wandstärke<br />
des Kolbenbodens bis zu 30 % im Vergleich<br />
zur Vorgängergeneration. Für weniger<br />
Reibung modifiziert KSPG die Kolbengrundstruktur<br />
und die Schaftbreiten. Außerdem wird<br />
das Laufspiel des Kolbens asymmetrisch ausgeführt,<br />
Druck- und Gegendruckseite weisen<br />
über die Schafthöhe variable Ovalitäten auf.<br />
Zudem soll eine neue Schaftbeschichtung<br />
dank einer Kombination aus Nanopartikeln,<br />
Bindemittel, Festschmierstoff und Additiven<br />
vor allem die Mischreibung im Kontakt zur Zylinderlauffläche<br />
verringern.<br />
Beim neuen Beschichtungsverfahren von KSPG wird der Beschichtungswerkstoff per Lichtbogen<br />
geschmolzen und mithilfe eines Gases an die Zylinderlaufbahn zerstäubt Bild: KSPG<br />
2015 veredelt man damit die Laufflächen von<br />
Motorblöcken für einen deutschen Premiumhersteller.<br />
Seine Werkstoffkompetenz hat KSPG auch bei<br />
den Gleitlagern von Common-Rail-Hochdruckpumpen<br />
nutzbringend eingesetzt. Hier hat man<br />
eine neue Polyamidschicht entwickelt, in der<br />
unter anderem nanoverstärkte Wolframdisulfid-Partikel<br />
eingelagert sind. An den hydrodynamischen<br />
Lagerstellen der Common-Rail-<br />
Hochdruckpumpen sorge der Gleitlager-Werkstoff<br />
KS P232 für einen schnellen Gleitfilmaufbau<br />
schon bei niedrigen Drehzahlen. Dies<br />
macht sich vor allem in einem Rückgang der<br />
verschleißintensiven Mischreibungsphasen bei<br />
Motoren mit Stopp-Start-Automatik bemerkbar.<br />
Viel wichtiger ist laut KSPG aber, dass mit dem<br />
neuen Gleitlager das Lagerspiel verringert werden<br />
könne, was weniger Leckage an diesen<br />
dieselgeschmierten Lagerstellen bedeute. Resultat<br />
sei eine Verringerung des effizienzmindernden<br />
Dieselverlusts der Pumpe um bis zu<br />
45% – das sind mehrere Liter pro Stunde.<br />
IAA Mahle: Halle 8.0, Stand C40<br />
IAA KSPG: Halle 8.0, Stand F26<br />
Mahle GmbH<br />
Tel.: +49 711 501-0<br />
info@mahle.com<br />
KSPG AG<br />
Tel.: +49 7132 33-0<br />
info@kspg.com<br />
Produktive Schicht-Arbeiter<br />
Für den Laufpartner Zylinderlauffläche hat<br />
KSPG eine Plasma-Beschichtungstechnik in Eigenregie<br />
entwickelt und industrialisiert. Nach<br />
eigenen Angaben mindert die Beschichtung<br />
die Reibung im Tribosystem um etwa 25 %. Des<br />
Weiteren kann jetzt auf die bisher üblichen<br />
Graugussbuchsen verzichtet werden, die neuen<br />
Laufflächen aus Aluminium sparen pro Zylinder<br />
etwa 300 g Gewicht ein und sorgen<br />
durch ihre bessere Wärmeabfuhr für einen<br />
Temperaturrückgang von etwa 20 °C an der<br />
Lauffläche. In Summe, so KSPG, hat diese Beschichtungstechnik<br />
zwei bis drei Prozent weniger<br />
CO 2 im NEFZ-Zyklus zur Folge. Seit August<br />
Bei geringen Drehzahlen<br />
halbiert die neue Gleitlagerbeschichtung<br />
KS<br />
P232 die Reibleistung<br />
Bild: KSPG<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 25
ANTRIEB<br />
SKF ePowertrain-Lösungen<br />
Kostenreduzierungen bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen<br />
Die aktuelle ePowertrain-Technologie<br />
von SKF wurde entwickelt,<br />
um Herstellern von Hybrid- und<br />
Elektrofahrzeugen eine Senkung<br />
der Produktions- und Montagekosten<br />
zu ermöglichen. Zum<br />
Portfolio gehören mehrere, teilweise<br />
aufeinander abgestimmte<br />
Produkte, etwa die SKF Rotor Positioning<br />
Sensor Bearing Unit, die<br />
eine verbesserte Steuerung von<br />
Dauermagnetmotoren erlauben<br />
soll. Die Kompakteinheit besteht<br />
aus einem reibungsarmen Lager<br />
und einem intelligenten Sensor.<br />
Sie lässt sich in der Fertigungsstraße<br />
schnell installieren, verbessert<br />
die Leistungsdichte und Drehmomentsteuerung<br />
des<br />
Motors und mindert<br />
laut SKF den Geräusch-<br />
und<br />
Schwingungspegel.<br />
Ebenfalls erhältlich<br />
ist<br />
die SKF Motor Encoder Sensor Bearing<br />
Unit. Die Einheit stellt präzise<br />
Signalgeberimpulse für die<br />
Echtzeitmessung der Drehzahl,<br />
Drehrichtung und Inkrementalposition<br />
des Motors<br />
bereit. Das integrierte<br />
Lager<br />
soll für einen<br />
reibungsarmen<br />
und<br />
leisen Betrieb<br />
auch<br />
bei hohen Drehzahlen sorgen.<br />
Weitere Produkte aus dem ePowertrain-Portfolio<br />
sind kundenspezifische<br />
Lenksäulenlager (die<br />
bei Wahrung der Leistungscharakteristik<br />
den Geräuschpegel mindern<br />
können) und robuste, reibungsarme<br />
Kugellager für hohe<br />
Drehzahlen, mit denen sich die<br />
Effizienz und Leistungsdichte von<br />
Elektromotoren verbessern lassen<br />
soll.<br />
www.skf.de<br />
Federal-Mogul Powertrain mit Ventiltrieb-Technologie auf der IAA<br />
Schlanke Hohlventile für hohe Motortemperaturen und steigende Zylinderdrücke<br />
Zu den neuen Komponenten des<br />
Ventiltrieb-Geschäftsbereiches<br />
von Federal Mogul gehören auch<br />
natriumgefüllte Hohlschaftventile<br />
mit extrem kleinen Schaftdurchmessern.<br />
Diese reduziere nach<br />
Herstelleraussage auf der einen<br />
Seite das Gewicht und halte auf<br />
der anderen Seite den höheren<br />
Temperaturen stand, die in<br />
Downsizing-Motoren vorkommen.<br />
Im Gegensatz zu konventionellen<br />
Vollschaftventilen, die rund 75%<br />
der Wärme über Ventilkopf und<br />
Ventilsitz ableiten, reduziert das<br />
Hohlschaftventil die Bauteiltemperatur<br />
durch eine erhöhte Wärmeabfuhr<br />
über die Ventilführung.<br />
Auf diese Weise ließen sich die<br />
Temperaturen am Ventilkopf um<br />
80 bis 150 °C senken. Die Hohlventile<br />
können neben der Auslassseite<br />
auch auf der Einlassseite zur<br />
Gewichtsreduzierung verbaut werden.<br />
Um das Maximum an Korrosions-<br />
und Temperaturbeständigkeit<br />
zu erzielen, verwendet das Unternehmen<br />
eine Kombination aus<br />
verschiedenen Werkstoffen. Die<br />
Technologie ist dabei kompatibel<br />
mit bewährten Verfahren zur Steigerung<br />
der Verschleißfestigkeit<br />
wie Nitrierhärten,<br />
Hartverchromung<br />
und Sitzpanzerung.<br />
Hochpräzisionsbohren<br />
in Verbindung<br />
mit etablierten<br />
Reibschweißprozessen<br />
ermöglicht<br />
Federal-Mogul<br />
Schaftdurchmesser<br />
von bis zu<br />
fünf Millimetern.<br />
Somit können sowohl<br />
Downsizing-<br />
Motoren mit klei-<br />
nen Zylinderbohrungen als auch<br />
leistungsfähige Motorradmotoren<br />
ausgerüstet werden.<br />
Hohlventile mit kleinen Schaftdurchmessern<br />
sind bereits seit<br />
Jahren im Motorsport etabliert. Für<br />
den Großserieneinsatz war jedoch<br />
besonderes Fertigungs-Know-how<br />
nötig, um die geforderte Kombination<br />
aus Qualität und Zuverlässigkeit<br />
kostengünstig in geeigneten<br />
Stückzahlen produzieren zu können.<br />
IAA: Halle 4.1, Stand E21<br />
www.federalmogul.com<br />
26 AutomobilKonstruktion 3/2015
Ebm-Papst auf der IAA<br />
Neue Sitzbelüftung und Zusatzölpumpen<br />
Eines der großen Themen der<br />
Automobilindustrie ist die CO 2 -<br />
Reduktion, mit der auch das<br />
Downsizing einhergeht. Auch Zuliefrer<br />
Ebm-Papst reagiert mit Systemlösungen<br />
auf kleinem Bauraum<br />
auf diesen Trend. Als besonderes<br />
Highlight werden in diesem<br />
Jahr am IAA-Stand von Ebm-Papst<br />
die Sitzbelüftung der neuen Generation<br />
und Zusatzölpumpen zu sehen<br />
sein. Die Sitzbelüftung zeichnet<br />
sich laut Hersteller durch eine<br />
Erhöhung der Luftmenge sowie eine<br />
Reduktion der Geräusche aus.<br />
Die integrierten Zusatzölpumpen<br />
sollen besonders kompakt und<br />
dabei eine der höchsten Leistungsdichten<br />
im Markt bieten.<br />
Der Ventilatorenspezialist hat<br />
2014 Aufsatzkühllösungen für die<br />
F1-Rennwagen von Mercedes AMG<br />
Petronas entwickelt, die die temperaturempfindlichen<br />
Komponenten<br />
der Boliden im Stand auf die<br />
optimale Betriebstemperatur herunterkühlen.<br />
Sobald der Rennwagen<br />
steht, werden die Seitenkästen<br />
und der Überrollbügel mit<br />
S-Force-Axialventilatoren gekühlt,<br />
deren Leistungskurve den hohen<br />
Gegendruck-Charakteristiken des<br />
Mercedes-Systems entsprechen.<br />
Dies verbessere den erzeugten<br />
Luftstrom um 518 %, heißt es.<br />
IAA: Halle 4.0, Stand C18<br />
www.ebmpapst.com<br />
Kunststoffstopfen für medienführende Leitungen<br />
Für Anwendungen mit wenig Bauraum<br />
Mit dem Kunststoffstopfen<br />
GPN 245 hat Pöppelmann Kapsto<br />
einen neuen QC-Stopfen zum Verschließen<br />
von Wasser-, Luft-, Öloder<br />
Kraftstoffleitungen im Programm.<br />
Die bereits vorhandene<br />
Form A ist durch eine weitere Form<br />
B ergänzt worden, die sich dank<br />
ihrer flachen Abmessungen auch<br />
für Anwendungen mit wenig Bauraum<br />
eignet. Die radial montierte<br />
Ringlasche ermögliche laut Hersteller<br />
ein einfaches Handling des<br />
Stopfens. Der QC-Stopfen ist in<br />
Anlehnung an SAE J2004 ausgeführt.<br />
Er schützt medienführende<br />
Leitungen bis zur Endmontage<br />
sicher vor Verschmutzung und Beschädigung.<br />
Die Klemmung erfolgt<br />
dabei auf den innenliegenden<br />
Dichtungsringen des Connectors.<br />
Innerhalb gewisser Grenzen ist er<br />
auch für Drucktests geeignet.<br />
Schutzelemente für Anwendungen<br />
mit erhöhten Sauberkeitsanforderungen<br />
wie beispielsweise Einspritzanlagen<br />
oder Sicherheitssystemen,<br />
bei denen auch geringste<br />
Partikelkontaminationen zu Ausfällen<br />
führen können, fertigt das<br />
Unternehmen in einem Sauberraum.<br />
Neben dem umfangreichen<br />
Standardprogramm entwickelt<br />
Pöppelmann Kapsto zudem in enger<br />
Zusammenarbeit mit den Kunden<br />
individuelle Sonderlösungen.<br />
www.poeppelmann.com<br />
BlueSeal sorgt für weniger Reibung und spart Platz und Gewicht<br />
Mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen<br />
Freudenberg Sealing Technologies<br />
optimierte den Simmerring<br />
BlueSeal in<br />
mehreren Evolutionsstufen.<br />
Mit dem Ziel,<br />
Robustheit mit geringer<br />
Reibung zu vereinen, hat<br />
Freudenberg den PTFE-Simmerring<br />
zunächst zum reibungsoptimierten<br />
POP-Simmerring weiterentwickelt.<br />
Durch Anpassung<br />
des Materials und der Geometrie<br />
erreiche dieser hinsichtlich der<br />
Reibungsverluste das niedrige Niveau<br />
eines auf eine Elastomerdichtlippe<br />
setzenden Energy<br />
Saving Seal (ESS).<br />
Jeder Millimeter, der beispielsweise<br />
an einem Kurbelwellen-Simmerring<br />
gespart wird, könne zu einem<br />
Bauraum- und Gewichtsvorteil<br />
des gesamten Motorblocks<br />
führen. Dies forcierte die Entwicklung<br />
des BlueSeal. Seine Pluspunkte<br />
sind erstens eine Gewichtseinsparung<br />
von 40%, zweitens<br />
ein axial um rund die Hälfte<br />
reduzierter Einbauraum sowie drittens<br />
30% weniger Reibungsverluste.<br />
Das grundlegend Neue: Bei<br />
ihm besteht auch die statische<br />
Dichtung zum Gehäuse hin aus<br />
PTFE anstelle von Elastomer. Das<br />
Dichtungsdesign beinhaltet damit<br />
nur noch zwei Materialien: PTFE<br />
und Metall. Bei allen herkömmlichen<br />
Konzepten einschließlich<br />
des POP ist für die Gummierung<br />
zur Luftseite hin sowie zum Anbinden<br />
der PTFE-Manschette axialer<br />
Bauraum erforderlich. Der BlueSeal<br />
verzichtet auf diese axiale Gummierung<br />
und bindet die PTFE-Manschette<br />
außen an die Luftseite des<br />
Metall-Versteifungsrings an. Die<br />
Dichtlippe nach dem POP-Prinzip<br />
garantiere zudem minimale Reibung<br />
und damit auch einen geringen<br />
Verschleiß der Welle.<br />
www.fst.com<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 27
ANTRIEBSSTRANG<br />
Lagersätze für Doppelkupplungen<br />
Weniger CO 2 -Emissionen und höhere Zuverlässigkeit<br />
Speziell in Klein- und Mittelklasseautos<br />
erfreuen sich<br />
Doppelkupplungssysteme<br />
wachsender Beliebtheit<br />
Für die Automobilindustrie sind<br />
niedriger Kraftstoffverbrauch und<br />
geringer CO 2 -Ausstoß Schlüsselfaktoren.<br />
Die daraus resultierenden<br />
Anforderungen wirken sich<br />
auch auf die Entwicklung des<br />
Antriebsstrangs aus: Im Trend<br />
liegen Doppelkupplungssysteme,<br />
die Fahrkomfort und Umwelt -<br />
anforderungen gleichermaßen<br />
berücksichtigen. Für solche Sys -<br />
teme hat SKF spezielle Lagersätze<br />
entwickelt.<br />
Der Autor: Dietmar Seidel, Leiter Technische<br />
Fachpresse Deutschland bei SKF, Schweinfurt<br />
Doppelkupplungssysteme kommen in Automatikgetrieben<br />
zum Einsatz, wo sie für einen<br />
effizienten Schaltvorgang sorgen. In den vergangenen<br />
Jahren sind diese Systeme kontinuierlich<br />
weiterentwickelt worden. Außerdem gehen<br />
Experten davon aus, dass sich die entsprechende<br />
Technik im Markt noch weiter verbreiten<br />
wird. Das liegt unter anderem an den<br />
immer strengeren Emissionsvorschriften, dem<br />
anhaltenden Downsizing von Motoren und der<br />
zunehmenden Verkehrsdichte in Ballungsräumen.<br />
All diese Faktoren zusammen tragen dazu<br />
bei, dass sich Doppelkupplungslösungen<br />
auch in Klein- und Mittelklasseautos steigender<br />
Beliebtheit erfreuen.<br />
Höhere Kräfte<br />
Im Vergleich zu konventionellen Schaltgetrieben<br />
arbeiten Doppelkupplungssysteme effizienter,<br />
reduzieren den Kraftstoffverbrauch und<br />
senken so die CO 2 -Emissionen. Doch je komplexer<br />
die Systeme werden, desto höher sind<br />
auch die Anforderungen an die Komponenten,<br />
die in der Kupplungseinheit verbaut sind. Dazu<br />
gehören nicht zuletzt die Lager: Konstruktionsbedingt<br />
müssen sie höheren Belastungen und<br />
Umgebungstemperaturen standhalten. Zur Orientierung:<br />
Bei manueller Schaltung nehmen die<br />
Lager Kräfte bis zu 2800 N auf. In Doppelkupplungssystemen<br />
können diese Kräfte zum Teil<br />
auf über 7000 N steigen.<br />
Auf der VDI-Fachtagung „Kupplungen und<br />
Kupplungssysteme in Antrieben“ zeigte SKF,<br />
wie man solchen Anforderungen begegnet.<br />
Nach intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit<br />
hat das Unternehmen einen Doppelkupplungslagersatz<br />
geschaffen, in dem eine<br />
ganze Reihe von Optimierungen umgesetzt<br />
worden sind. Beispielsweise verfügen die Lager<br />
über eine größere Laufbahnbreite, um die<br />
28 AutomobilKonstruktion 3/2015
Doppelkupplungslagersatz<br />
von SKF<br />
Skizze eines Doppelkupplungssystems<br />
reibungslose Funktion auch unter Maximallast<br />
sicherzustellen. Außerdem wurden sämtliche<br />
Komponenten sowie die innere Geometrie der<br />
Lager auf die höheren Fliehkräfte abgestimmt,<br />
die bei solchen Kupplungssystemen mit größerem<br />
Durchmesser entstehen und dadurch zu<br />
einer entsprechend größeren Belastung sämtlicher<br />
Lagerbestandteile führen.<br />
Höhere Temperaturen<br />
Um der vergleichsweise hohen Betriebstemperatur<br />
in Doppelkupplungssystemen zu begegnen,<br />
benutzt SKF außerdem sorgfältig ausgewählte<br />
Kunststoffe, die mit dem Schmierstoff<br />
kompatibel sind und die nötigen Materialeigenschaften<br />
aufweisen – wie etwa die notwendige<br />
Zähigkeit über die gesamte Nutzungsdauer<br />
hinweg. Beim Käfig kommt zum Beispiel<br />
glasfaserverstärktes Polyamid PA46 zum Einsatz,<br />
das sich speziell für hohe mechanische<br />
Belastungen und Temperaturen eignet: Es zeigt<br />
ein sehr gutes Gleichgewicht zwischen Chemikalienbeständigkeit,<br />
Verschleißfestigkeit<br />
und Hitzebeständigkeit.<br />
Ergänzende Stützlager<br />
Neben den Doppelkupplungslagersätzen hat<br />
SKF zusätzlich Doppelkupplungs-Stützlager entwickelt.<br />
Dieser Lagertyp ist notwendig, um die<br />
hohen Axialbelastungen des Doppelkupplungssystems<br />
aufzunehmen. Das Stützlager sitzt auf<br />
der Antriebswelle. Es kann – abhängig vom<br />
Kupplungstyp – auch als abgedichtetes Lager<br />
geliefert werden. Dafür nutzt SKF ein im Unternehmen<br />
selbst entwickeltes Dichtungsdesign.<br />
Das tribologische Gesamtsystem der abgedichteten<br />
Variante ist von SKF so ausgelegt worden,<br />
dass das Stützlager möglichst kühl und ruhig<br />
läuft, um das Schmiermittel zu schonen und dadurch<br />
die Lagergebrauchsdauer zu verlängern.<br />
Ein abgedichtetes Doppelkupplungs-<br />
Stützlager von SKF<br />
Bilder: SKF<br />
SKF GmbH<br />
Tel.: +49 9721 56-2843<br />
dietmar.seidel@skf.com<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 29
ANTRIEBSSTRANG<br />
Getriebe-Kugellager: neue Öle im Visier<br />
Wenn Kugellager zehnmal länger leben<br />
Um den Kraftstoffverbrauch und<br />
die Schadstoffemissionen zu senken,<br />
sind leichte, kompakte und<br />
reibungsarme Getriebe gefragt.<br />
Als Folge kommen aber auch niedrigviskose<br />
Getriebeöle zum Einsatz.<br />
Der dünnere Ölfilm sorge<br />
laut NSK aber dafür, dass die<br />
Oberflächen der Kugeln und Laufbahnen<br />
sehr empfindlich auf Verschleiß<br />
reagieren. Entsprechend<br />
hoch fallen die neuen Anforderungen<br />
an Kugellager aus.<br />
Die Entwicklungsaufgabe für NSK<br />
lautete daher: Verbessern der<br />
Qualität und Beschaffenheit der<br />
Oberflächen, damit sie trotz der<br />
dünneren Ölfilme noch länger halten.<br />
Dazu gilt es allerdings, die<br />
Oberfläche der Wälzelemente so<br />
lange wie möglich in einwandfreiem<br />
Zustand zu erhalten, um das<br />
Abplatzen der Laufbahnoberfläche<br />
des Kugellagers zu verhindern<br />
beziehungsweise hinauszuzögern.<br />
Die bei diesen Pittings entstehenden<br />
Partikel können weitere Eindrücke<br />
auf der Laufbahn hinterlassen,<br />
die zu einer zusätzlichen<br />
Schädigung der Laufbahnen und<br />
Wälzelemente führen.<br />
Unter dem Markennamen EQTF<br />
(Extra Quality Tough ball Bearings<br />
for transmissions) entstanden Getriebelager<br />
mit Kugeln aus Spezialstahl,<br />
die durch Einsatzhärten<br />
(Carbonitrieren) und durch Beigabe<br />
harter Siliziumnitrid-Partikel eine<br />
Oberfläche mit verbessertem<br />
Verschleißschutz besitzen sollen.<br />
Weil Viskosität, Einsatztemperaturen<br />
und Drehzahlen variieren,<br />
passt NSK die EQTF-Lager mit verbesserten<br />
Rechnungsmethoden<br />
zusammen mit dem Getriebehersteller<br />
individuell an den jeweiligen<br />
Einsatzfall an.<br />
So ließe sich die Lebensdauer verdoppeln<br />
oder sogar verdreifachen.<br />
In Verbindung mit Innen- und Au-<br />
ßenringen, deren Oberflächen<br />
NSK mit eigenen Wärmebehandlungsverfahren<br />
(UR, HTF) verbessert,<br />
falle die Lebensdauer mehr<br />
als zehnmal so hoch wie die eines<br />
herkömmlichen Lagers aus. Der<br />
Getriebehersteller könnte daher<br />
für die gleiche Leistung ein wesentlich<br />
kleineres Lager einsetzen.<br />
Die EQFT-Technologie bietet sich<br />
an bei Antrieben, die typischerweise<br />
kompakt ausfallen – also<br />
zum Beispiel bei Doppelkupplungsgetrieben.<br />
Noch bessere Ergebnisse ließen<br />
sich erzielen, wenn NSK einen<br />
selbst entwickelten und ebenfalls<br />
einsatzgehärteten Spezialstahl<br />
(HTF) verwendet.<br />
www.nskeurope.de<br />
Getriebedichtungen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge<br />
Mit integriertem Blitzableiter oder Drehgeber<br />
Freudenberg Sealing Technologies<br />
stellt eine Dichtung für Hybridund<br />
Elektrofahrzeuge vor, die Ströme<br />
gezielt ableiten kann und daher<br />
vor elektrostatischer Aufladung<br />
schützt. Der mit etwa<br />
400 V arbeitende Elektromotor<br />
von Plug-in-Hybridfahrzeugen befindet<br />
sich in der Regel anstelle eines<br />
hydrodynamischen Wandlers<br />
auf der Eingangswelle des Automatikgetriebes.<br />
Eine gute Abdichtung<br />
muss an dieser Stelle mehr<br />
leisten, als den Antrieb vor Verschmutzung<br />
durch das Getriebeöl<br />
zu schützen. Denn im Motor kann<br />
sich zwischen dem Gehäuse und<br />
der Welle ein elektrisches Potenzial<br />
aufbauen, das im Extremfall zu<br />
unkontrolliertem Stromfluss und<br />
Schäden führen könnte, insbesondere<br />
im Bereich der Lager. Ein<br />
klassischer Dichtring aus Elastomeren<br />
wirkt jedoch isolierend und<br />
kann daher aufgebaute elektrische<br />
Potenziale nicht ableiten.<br />
Die neue Dichtung wirke nach Aussage<br />
von Freudenberg wie ein<br />
Blitzableiter: Strom wird durch ein<br />
auf die Dichtung aufgebrachtes<br />
leitfähiges Vlies gezielt vom Gehäuse<br />
auf die Welle geleitet, so<br />
dass elektrostatische Aufladung<br />
erst gar nicht entstehen kann. So<br />
würden teure Zusatzelemente wie<br />
verschleißende Kohlebürsten<br />
überflüssig. Sie kann nicht nur in<br />
Plug-in-Hybridfahrzeugen, sondern<br />
auch in den Getrieben für<br />
batterieelektrische Fahrzeuge verwendet<br />
werden.<br />
Dichtungskonzepte stellte Freudenberg<br />
auch für nichtelektrifizierte<br />
Fahrzeuggetriebe vor. So wird<br />
für die Steuerung des Getriebes<br />
die Drehzahl an der Getriebe-Eingangswelle<br />
gemessen – wichtig ist<br />
das beispielsweise, um Schaltungen<br />
so sanft wie möglich ablaufen<br />
zu lassen. Für die Messung wird<br />
heute in der Regel ein separater<br />
Drehgeber (Encoder) verwendet,<br />
der die Drehzahl anhand magnetisierter<br />
Segmente bestimmt. Freudenberg<br />
hat nun einen Wellendichtring<br />
entwickelt, bei dem die<br />
magnetisierbaren Segmente direkt<br />
auf das Elastomer aufgebracht<br />
sind. Immer häufiger liefert Freudenberg<br />
eine komplett vormontierte<br />
Einheit aus Kunststoff-Stirndeckel,<br />
der statischen Gehäuseabdichtung<br />
sowie dem Wellendichtring.<br />
Anders als bei einem<br />
Metallteil müssen die Dichtungen<br />
nicht separat montiert werden: Sie<br />
werden direkt mit dem Kunststoff<br />
umspritzt.<br />
www.fst.com<br />
30 AutomobilKonstruktion 3/2015
KTR auf der IAA<br />
Bogenzahnkupplungen für Kfz-Elektroantriebe<br />
Mit dem Einzug der Elektromobilität<br />
verändern sich die Aufgabe der<br />
einzelnen Antriebskomponenten.<br />
Die Wellenverbindungen im Antriebsstrang<br />
sollen nicht nur Leistung<br />
übertragen und Fluchtungsfehler<br />
in mehreren Achsen ausgleichen.<br />
Ihre Aufgabe ist es auch,<br />
die elektrische Isolation des E-Motos<br />
gegenüber anderen antriebstechnischen<br />
Komponenten zu gewährleisten<br />
und damit die gefürchtete<br />
Elektrokorrosion von<br />
Wälzlagern oder Zahnrädern zu<br />
verhindern.<br />
Die doppelkardanischen BoWex-<br />
Bogenzahnkupplung von KTR ermöglicht<br />
eine formschlüssige<br />
Drehmomentübertragung, gleicht<br />
axiale, radiale und winklige Wellenverlagerungen<br />
aus und ist dank<br />
der Kunststoff-/ Stahl-Gleitpaarung<br />
wartungsfrei. Die gewünschte<br />
elektrische Isolierung wird durch<br />
Polyamid als Werkstoff für die<br />
Kupplungshülse sichergestellt.<br />
Dieser Kupplungstyp, den KTR auf<br />
der IAA ausstellt, bewährt sich bereits<br />
in ersten Projekte der Elektromobilität.<br />
Zwischen Elektromotor<br />
und Getriebe kommen Bogenzahnkupplungen<br />
vom Typ BoWex<br />
zum Einsatz, die speziell an jeden<br />
einzelnen Anwendungsfall angepasst<br />
werden. In einem Fall ist die<br />
BoWex in Baugröße 48 ausgelegt<br />
für eine Dauerleistung von 50 kW<br />
bei 8000 min -1 und eine maximale<br />
Motorleistung von 150 kW. Die<br />
Kupplung ist hier zwischen E-Motor<br />
und dem Stirnradgetriebe<br />
montiert, das auf die Vorderachse<br />
wirkt.<br />
Bei diesem Beispiel liegt die maximale<br />
Überdrehzahl dieses Elektroantriebs<br />
mit 13 500 min -1 deutlich<br />
höher als bei verbrennungsmotorischen<br />
Antrieben. Für KTR stelle<br />
dieser Wert aber keine Herausforderung<br />
dar, denn im Werkzeugmaschinenbau<br />
– einem Kernmarkt<br />
für KTR-Wellenkupplungen – sind<br />
hohe Drehzahlen bis 40 000 min -1<br />
üblich.<br />
Zudem zeigt KTR auf der IAA eine<br />
Alternative zur bisher eingesetzten<br />
doppelkardanischen BoWex,<br />
bei der das Zwischenstück aus<br />
glasfaserverstärktem Kunststoff<br />
(GFK) hergestellt wird. GFK ist<br />
ebenfalls nicht leitend, extrem<br />
verschleißfest und es überträgt<br />
hohe Drehmomente auf kleinem<br />
Bauraum und bei geringem Gewicht.<br />
IAA: Halle 4.0, Stand D07<br />
www.ktr.com
ELEKTRONIK + SOFTWARE<br />
Sichere Systeme für fahrerlose Autos<br />
Auf dem Weg zum marktreifen autonomen Fahren will Infineon helfen, die letzten Probleme zu lösen<br />
Bis 2025 soll es soweit sein, dass sich Autos von selbst durch den Verkehr bewegen. Egal ob in der Stadt, auf<br />
der Landstraße oder auf der Autobahn. Auf dem Weg dorthin sind jedoch noch einige Hürden zu nehmen.<br />
Neben den rechtlichen Voraussetzungen beinhalten die technischen Aspekte höchst zuverlässige, redundante<br />
Systeme mit Sensoren, Aktuatoren, Mikrocontrollern oder Leistungsbauelementen, die beim Ausfall in einen<br />
sicheren Zustand geführt werden können. Außerdem muss die Übergabe zwischen automatisiertem Fahrzeug<br />
und Fahrer sicher und komfortabel erfolgen. Letztendlich muss auch die Integration in das Verkehrssystem<br />
mit Mischverkehr oder separaten Spuren sowie die Anpassung der Infrastruktur gewährleistet sein. Ein übergreifender<br />
Systemansatz und leistungsfähige Halbeiter sind die Grundvoraussetzung<br />
für die Realisierung und den Erfolg selbstfahrender Fahrzeuge. Marktforscher<br />
gehen davon aus, dass ab 2020 hochautomatisiertes Fahren als<br />
Sonderausstattung einem breiteren Publikum der Premium-OEMs<br />
angeboten wird. Vollautomatisiertes Fahren soll dann ab etwa<br />
2025 kommen. Entsprechende Fahrzeuge können dann eigenständig<br />
jegliche Fahrsituation meistern und benötigen<br />
keinen Eingriff des Fahrers mehr – gleichwohl ist die<br />
Übergabe der Fahraufgabe an den Fahrer möglich.<br />
Das Oikos ECU-Designkit zur Entwicklung von<br />
Steuergeräten im Automobil basiert auf dem<br />
32-bit Aurix-Mikrocontroller und nutzt dessen integrierte<br />
Sicherheitsfunktionen<br />
Der Autor: Kai Konrad, Senior Marketing Manager,<br />
Automotive Safety Systems, Infineon Technologies,<br />
Neubiberg<br />
32 AutomobilKonstruktion 3/2015
Was heißt nun automatisiertes bzw. autonomes<br />
Fahren? Abhängig vom Automatisierungsgrad<br />
hat die Society of Automotive Engineers<br />
(SAE International) verschiedene Stufen,<br />
bzw. Levels definiert (siehe Abbildung). Ähnliche<br />
Klassifizierungen gibt es auch vom VDA,<br />
der BASt-Projektgruppe oder der National<br />
Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)<br />
in den USA.<br />
Nach SAE steht das Level 0 für die komplette<br />
Kontrolle durch den Fahrer, Level 1 definiert assistiertes<br />
Fahren. Typisch für die entsprechende<br />
Unterstützung sind Bremsassistenten oder<br />
ACC-Systeme, diese assistieren bei der Längs-<br />
oder Querführung, während der Fahrer immer<br />
noch für alle dynamischen Aspekte verantwortlich<br />
ist. Mit Level 2 (teilautomatisiert) übernehmen<br />
Fahrerassistenzsysteme für eine gewisse<br />
Zeit sowohl die Längs- als auch Querführung,<br />
während der Fahrer die Systeme dauerhaft<br />
überwacht. Mit Parkassistenzsystemen, ACC<br />
oder Spurhaltesystemen ist Level 2 bereits<br />
heute in Automobilen implementiert.<br />
Mit Level 3 beginnt die konditioniert automatisierte<br />
Phase und das Monitoring der Fahrumgebung,<br />
während der Fahrer das System<br />
nicht mehr dauerhaft überwachen muss. Das<br />
automatisierte System steuert alle dynamischen<br />
Fahraspekte, wobei bei ausreichender<br />
Reaktionszeit auf den Fahrer zurückgegriffen<br />
werden kann. Entsprechende Systeme für Level<br />
3 zu entwickeln mit Stauüberwachung, Autobahnfahrt,<br />
automatisierten Parksystemen,<br />
etc. stellt eine Herausforderung dar.<br />
Ab Level 4 liegen hochautomatisierte Systeme<br />
vor, die kein unmittelbares Eingreifen des Fahrers<br />
mehr erfordern. Mit Level 5 spricht man<br />
dann von autonomen Fahren bzw. selbstfahrenden<br />
Fahrzeugen, indem das System unter<br />
allen Straßen- und Umgebungsbedingungen<br />
alle Aufgaben übernimmt, die sonst der Fahrer<br />
ausübt.<br />
Höchst zuverlässig und immer verfügbar<br />
Um die höheren Level mit weitgehend automatisiertem<br />
bzw. autonomem Fahren zu erreichen,<br />
muss die Board-Architektur grundsätzlich<br />
überdacht werden. Bisher nutzen Fahrzeugsysteme<br />
verteilte Steuerungen, wobei für<br />
nahezu jede Funktion eine Steuereinheit (ECU)<br />
zur Verfügung steht, die über entsprechende<br />
Schnittstellen verbunden sind. Für künftige<br />
vernetzte Board-Architekturen ist eine Aufteilung<br />
der Funktionalitäten in Domänen (Antrieb,<br />
Fahrerassistenz, Komfortfunktionen, Infotainment,<br />
etc.) mit verteilten Computing-Ressourcen<br />
erforderlich, die über schnelle, breitbandige<br />
interne Netzwerke verbunden sind.<br />
Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten,<br />
muss eine hohe Redundanz aller Technologien<br />
und Systeme implementiert werden. Darüber<br />
hinaus benötigen automatisierte Fahrzeuge<br />
zahlreiche bestehende und neue Sensoren.<br />
Der Trend erfordert auch eine signifikant höhere<br />
Rechenleistung, mehr Speicherkapazitäten,<br />
externe Konnektivität und die Möglichkeit von<br />
Upgrades im Feld. Außerdem sind ständig aktuelle<br />
Informationen über die Straßen- und Verkehrsbedingungen<br />
erforderlich, die über sichere<br />
Car-to-Car-Kommunikation und entsprechende<br />
Gateways erfasst werden. Darüber hinaus<br />
sind auch Technologien gefragt, um den Fahrer<br />
zu beobachten (Aufmerksamkeits- bzw. Müdigkeitskontrolle).<br />
Die Sicherstellung von funktionaler Sicherheit<br />
(Safety) und Datensicherheit (Security) kann<br />
nicht mehr für sich allein betrachtet werden.<br />
So werden die wesentlichen Systemeigenschaften<br />
wie Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit,<br />
funktionale und Datensicherheit mittlerweile<br />
unter dem Oberbegriff Dependability zusammengefasst.<br />
Es muss gewährleistet werden, dass im Fehlerfall<br />
innerhalb eines Fahrerassistenzsystems<br />
vom System selbst keine Gefahr ausgeht, sich<br />
also entweder abschaltet oder in einen sicheren<br />
Notbetrieb geht. Systeme, die im Fehlerfall<br />
abschalten und in einen sicheren Betriebszustand<br />
gehen, werden als Fail-Safe-Systeme<br />
bezeichnet.<br />
Abhängig vom Automatisierungsgrad<br />
hat die Society of<br />
Automotive Engineers (SAE International)<br />
verschiedene Levels<br />
für selbstfahrende Fahrzeuge<br />
definiert<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 33
ELEKTRONIK + SOFTWARE<br />
Insbesondere wenn das System aktiv am Fahrbetrieb<br />
beteiligt ist, kann ein Abschalten im<br />
Fehlerfall nicht möglich oder gar gefährlich<br />
sein, was einen fehlertoleranten Systementwurf<br />
erfordert. Heutige elektrische Lenksysteme<br />
haben z.B. genug Kraft, den Fahrerwunsch<br />
zu übersteuern – sprich im Fehlerfall dem Fahrer<br />
das Lenkrad aus der Hand zu reisen. Auf der<br />
anderen Seite kann man die Lenkunterstützung<br />
nicht einfach abschalten. Denn selbst geübte<br />
Fahrer können bereits dann verunsichert und in<br />
Gefahr gebracht werden, wenn nur das Gefühl<br />
aufkommt, dass die Lenkung nicht erwartungs-<br />
Bereits heute ist eine redundante Auslegung<br />
der elektrischen Lenkung möglich. Die Leistung<br />
der redundanten Einzelsysteme kann<br />
über Mikrocontroller und Endstufe skaliert<br />
werden. Neue, hochverfügbare Sensoren<br />
können je nach Anwendungsfall nur in einfacher<br />
Ausführung eingesetzt werden<br />
Bilder: Infineon<br />
gemäß funktioniert. In diesen Fällen sind sogenannte<br />
Fail-Operational-Systeme gefordert, die<br />
zumindest einen Notbetrieb ermöglichen. Diese<br />
Systeme erfordern jedoch eine umfangreichere<br />
und komplexere Systemarchitektur. Der<br />
Übergang von Fail-Safe- hin zu Fail-Operational-Systemen<br />
geht mit einem hohen Maß an<br />
Redundanz für das Systemdesign einher, ähnlich<br />
wie wir es auch aus der Luftfahrtindustrie<br />
kennen. Alle sicherheitsrelevanten Funktionen,<br />
von der Lenkung über die Stromversorgung bis<br />
hin zum Kommunikationsnetzwerk müssen redundant<br />
sein.<br />
Die für das autonome Fahren erforderliche<br />
Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und<br />
seiner Umgebung birgt auch ein Sicherheitsrisiko.<br />
Das Gefährdungspotenzial reicht von<br />
der Manipulation von Hardware und Software<br />
bis hin zum Cyber-War, wenn Steuereinheiten<br />
erfolgreich „gehackt“ werden. Vor diesem Hintergrund<br />
sind umfassende Sicherheitsfunktionen<br />
erforderlich, um Leib und Leben aller Verkehrsteilnehmer,<br />
aber auch die Datenintegrität<br />
und die Privatsphäre des Fahrers zu schützen.<br />
Erforderliche Funktionsblöcke<br />
Um hochautomatisierte bzw. autonome Fahrzeuge<br />
zu entwickeln, sind unterschiedliche<br />
Funktionsblöcke erforderlich. So benötigen die<br />
Antriebs- und Steuerungsfunktionen innovative<br />
Lösungen für das Bremsen, Lenken, Beschleunigen,<br />
die Aufhängung und das Getriebe.<br />
Darüber hinaus erfordern die Fahrzeuge redundante<br />
Systeme wie Sensoren und Steuerungen<br />
sowie ein mehrfaches an Computing-<br />
Leistung als heutzutage, um alle Informationen<br />
in Echtzeit verarbeiten zu können. Zu den Sensoren<br />
gehören Radar-, Ultraschall-, Kamera-,<br />
Laser-, GPS- und hochauflösende Straßenkarten-Systeme.<br />
Die Sensordaten müssen gesammelt,<br />
miteinander verknüpft und für die Verarbeitung<br />
vorbereitet werden. Außerdem ist eine<br />
externe sichere Kommunikation erforderlich,<br />
um die Umgebung abbilden zu können.<br />
Letztendlich müssen leistungsfähige Datenverarbeitungsfunktion<br />
und Funktionen zur Entscheidungsfindung<br />
implementiert werden.<br />
Bei höheren Automatisierungs-Leveln sind<br />
zwei weitere wesentliche Schritte erforderlich:<br />
34 AutomobilKonstruktion 3/2015
12.–14. Oktober 2015<br />
Messe Stuttgart<br />
Auf dem Weg zu den<br />
Leveln 4/5 ist ein<br />
ganzheitlicher Ansatz<br />
erforderlich. So werden<br />
die wesentlichen Systemeigenschaften<br />
wie Zuverlässigkeit,<br />
Verfügbarkeit, funktionale<br />
Sicherheit und Datensicherheit<br />
mittlerweile unter dem Oberbegriff<br />
„Dependability“ zusammengefasst<br />
Bisher haben typische Fahrerassistenzsysteme<br />
die Daten von entsprechenden Sensoren gesammelt<br />
und dann für eine bestimmte Funktion<br />
mittels entsprechender ECU bzw. Algorithmus<br />
verarbeitet. Die Ergebnisse wurden angezeigt<br />
oder zur Steuerung eines spezifischen Aktuators<br />
genutzt. Für ein autonomes System<br />
muss das Fahrzeug jedoch jederzeit ein Abbild<br />
seiner Umgebung, den Fahrer im Blick und ein<br />
Status-Modell des Autos verfügbar haben. Dies<br />
erfordert eine Zusammenführung der Sensordaten<br />
sowie Redundanz bei den Steuereinheiten<br />
und Algorithmen.<br />
Der zweite wichtige Schritt ist die Implementierung<br />
eines umfassenden Sicherheitskonzeptes<br />
mit vielfältigen Funktionen wie LDW (Lane Departure<br />
Warning), LKW (Lane Keep Assistant),<br />
FCW (Forward Collision Warning), BSD (Blind Spot<br />
Detection), HBA (High Beam Assist), TSR (Traffic<br />
Sign Recognition), BUA (Back-up Aid), etc.<br />
Für die Gewährleistung der Datensicherheit reichen<br />
reine Software-Konzepte nicht aus. Dafür<br />
bieten z.B. Mikrocontroller der Aurix- und Audomax-Familien<br />
spezielle Funktionsblöcke wie<br />
Security Hardware Extension (SHE) oder Hardware<br />
Security Module (HSM). Das HSM übernimmt<br />
durch Signatur von Nachrichten oder sogar<br />
der vollständigen Verschlüsselung die gesicherte<br />
Kommunikation mit anderen Mikrocontrollern.<br />
Weiterhin kann das HSM genutzt werden,<br />
den Mikrocontroller sicher zu booten, um<br />
Attacken durch Viren und Trojaner zu unterbinden<br />
und unerlaubten Zugriff zu verhindern.<br />
Elektrische Servolenkung mit kosteneffizienter<br />
Redundanz<br />
Um eine hohe Verlässlichkeit bzw. Verfügbarkeit<br />
für sicherheitskritische System zu erreichen,<br />
ist noch einiges an Arbeit auf allen Ebenen<br />
der Wertschöpfungskette notwendig. Die<br />
Systeme müssen ja andererseits trotzdem bezahlbar<br />
bleiben. Heute ist es jedoch bereits<br />
möglich die elektrische Servolenkung (EPS)<br />
moderat redundant zu gestalten, also nicht<br />
einfach ein komplettes, zweites Lenksystem<br />
einzubauen, sondern z.B. hochverfügbare<br />
Komponenten mit integrierter Redundanz kosteneffizient<br />
zu nutzen. Die elektrische Servolenkung<br />
wird u.a. dafür benötigt, um Fahrerassistenzsysteme<br />
wie beispielsweise Seitenwindkompensation,<br />
Spurhalteassistent und<br />
Einparkhilfen zu ermöglichen.<br />
Für die effiziente Entwicklung von hochsicheren<br />
Automotive-Anwendungen wie elektrischen<br />
Lenksystemen aber auch für Anwendungen wie<br />
Batteriemanagement oder Hochvoltinvertern<br />
bietet Infineon das Oikos EVMKit an. Das ECU-<br />
Designkit zur Entwicklung von Steuergeräten<br />
im Automobil basiert auf dem 32-bit Aurix-Mikrocontroller<br />
und nutzt dessen integrierte Sicherheitsfunktionen.<br />
Infineon Technologies AG<br />
Tel.: +49 89 234-65555<br />
support@infineon.com<br />
Smart car, Smart city, Smart grid: grundlegende<br />
Technologien und Nutzermodelle<br />
für CO 2-reduzierte Mobilität präsentiert<br />
die kombinierte Messe und Konferenz<br />
WORLD OF ENERGY SOLUTIONS im<br />
Themenbereich e-mobility solutions.<br />
Die Schwerpunkte reichen von der Batterieherstellung<br />
und Wasserstofftechnologien<br />
zur Systemintegration und zu intermodalen<br />
Mobilitätskonzepten.<br />
Seien Sie mit dabei!<br />
+ Konferenz + Abendveranstaltung<br />
+ Messe + f-cell award<br />
+ Seminare + International<br />
+ Ride&Drive matchmaking<br />
www.world-of-energy-solutions.de
ELEKTRONIK + SOFTWARE<br />
Die Spannung steigt<br />
Verschiedene Hersteller experimentieren mit 48-Volt-Systemen, 2016 gehen die ersten in Serie<br />
So könnte die Architektur<br />
eines künftigen 48-Volt-<br />
Bordnetzes aussehen<br />
Zwischen dem altbewährten<br />
12-Volt-Bordnetz und den<br />
Hybriden sowie Elektrofahrzeugen<br />
werden bald 48-Volt-Bordnetz -<br />
systeme Einzug halten. Die ersten<br />
Serienanwendungen lassen aber<br />
noch wenige Rückschlüsse auf<br />
Standards zu.<br />
Der Autor: Hartmut Hammer, freier Mitarbeiter der<br />
AutomobilKonstruktion<br />
Als einer der ersten Zulieferer hat Delphi Vollzug<br />
beim 48-Volt-Bordnetz gemeldet. „Wir bearbeiten<br />
aktuell drei Serienentwicklungsprojekte<br />
für 48-Volt-Systeme“, bestätigt Christian<br />
Schäfer, Leiter Vorentwicklung für E/E-Systeme<br />
und Bordnetz bei Delphi in Europa. „Beim ersten<br />
mit Serienstart 2016 handelt es sich um einen<br />
Leitungssatz samt Steckverbindungen für<br />
einen Mild Hybrid eines europäischen Volumenherstellers.<br />
Inklusive Boost- und Rekuperationsfunktion<br />
sowie zusätzlich mit Anschluss<br />
einer Zuheizung und eines Klimakompressor<br />
an dieses Spannungsnetz.“<br />
Als große Herausforderungen für diesen Serienauftrag<br />
bezeichnet Schäfer die Anpassung<br />
der Komponenten an das NVH-Verhalten des<br />
Verbrennungsmotors und die hohen Ströme im<br />
48-Volt-System. Denn ein Dreizylinder-Downsizing-Motor<br />
stellt höhere NVH-Anforderungen<br />
an die Vibrationsklasse der Leitungen und<br />
Steckverbindungen als ein herkömmlicher Motor<br />
mit mehr Zylindern. Da Delphi die 48-Volt-<br />
Systemkomponenten aus dem bestehenden<br />
12-Volt-Produktportfolio heraus entwickelt –<br />
Hochvoltkomponenten wären dafür überdimensioniert<br />
und zu kostspielig – müssen deren<br />
Eigenschaften an die höheren Anforderungen<br />
angepasst werden. Beispielsweise müssen<br />
die Kabel und Steckverbinder hohe Ströme von<br />
bis zu 300 A verkraften. Die beiden anderen<br />
Serienaufträge betreffen ein ähnliches Kontaktierungssystem<br />
wie eben genannt, sowie ein<br />
48-Volt-Verteilzentrum, das 2017 bei einem europäischen<br />
OEM in Serie gehen soll.<br />
Ganz Branche arbeitet an ähnlichen Lösungen<br />
Einen ähnlichen Zeithorizont nennt auch Continental.<br />
2016 sollen laut Bernd Mahr, Executive<br />
Vice President der Business Unit Hybrid Electric<br />
Vehicle bei Continental, „die ersten Komponenten<br />
der 48-Volt-Eco-Drive-System in Serie<br />
gehen, weitere Projekte sind bereits in der Serienentwicklung.“<br />
Schätzungsweise arbeitet<br />
die ganze Branche an diesem Thema. Beweggrund<br />
ist vor allem das Damoklesschwert „95<br />
Gramm“, das mit empfindlichen Strafzahlungen<br />
droht, sollten die OEMs die ambitionierten<br />
CO 2 -Vorgaben nicht erfüllen. Wobei die Not teilweise<br />
so groß ist, dass ein europäischer OEM<br />
wohl plant, alle Modelle mit einem 48-Volt-<br />
Teilbordnetz auszurüsten.<br />
Denn ein 48-Volt-Mildhybridsystem kann den<br />
Kraftstoffverbrauch je nach Fahrprofil etwa um<br />
10 bis 25 Prozent senken, etwa durch Boosten,<br />
Rekuperieren, einen optimierten Motorwirkungsgrad<br />
durch Lastpunktverschiebung oder<br />
eine Segelfunktion. Zudem lassen sich elektrische<br />
Verbraucher mit höherem Energiebedarf –<br />
36 AutomobilKonstruktion 3/2015
Bidirektionaler 48/12-Volt-DC/DC-Konverter mit hoher<br />
Leistungsdichte und hohem Wirkungsgrad<br />
wie etwa Frontscheibenheizungen, elektrisch<br />
betriebene Lenkungen, Öl- und Wasserpumpen<br />
sowie Lader – ebenfalls effizienter betreiben<br />
und ein 48-Volt-Bordnetz erfordert keinen signifikant<br />
aufwändigeren Berührungsschutz und<br />
– anders als bei Hochvolt-Hybriden – kaum Eingriffe<br />
in die Motor- und Getriebekonfiguration.<br />
Die Effizienz des 48 Volt-Mildhybrids liegt nicht<br />
zuletzt in der höheren (Rekuperations-)Leistung<br />
des Generators von aktuell 10 bis 15 kW<br />
begründet. Zum Vergleich: Ein herkömmlicher<br />
12-Volt-Generator entwickelt drei bis fünf Kilowatt<br />
Leistung. Leistungssteigerungen bis 18 kW<br />
halten die Experten für mittelfristig möglich.<br />
Ebenfalls noch nicht endgültig definiert ist das<br />
Layout des Energiespeichers, hier sind Lithium-Ionen-Batterien,<br />
Supercaps oder Exoten<br />
wie eine Blei-Kohlenstoff-Batterie im Gespräch.<br />
„Die Verbindung zum bisherigen 12 Volt-Bordnetz<br />
stellt optimaler Weise ein bidirektionaler<br />
DC/DC-Konverter her. Für den Energietransport<br />
vom 12- zum 48-Volt-Bordnetz dürfte eine Konverterleistung<br />
von einem Kilowatt ausreichen,<br />
in die andere Richtung sind etwa drei Kilowatt<br />
angebracht“, so Christian Schäfer.<br />
De-facto-Standards<br />
Ähnlich wie beim 12-Volt-Bordnetz wird es<br />
wohl nur wenige nationale und internationale<br />
Standards und Vorgaben geben. Realistischer<br />
erscheinen informelle Festlegungen und Vereinheitlichungen,<br />
die dann über kurz oder lang<br />
zu De-facto-Standards mutieren.<br />
Kostengünstige 48 Volt-Systeme mit riemengetriebenem<br />
Generator richten sich eher an<br />
Kompakt- und Mittelklassefahrzeuge. Plug-In-<br />
Hybridantriebe hingegen werden wohl eher mit<br />
Hochvolttechnik realisiert, auch wenn es erste<br />
Ansätze für 48 Volt- Plug-In-Hybridantriebe<br />
gibt. Was aber nicht ausschließt, dass in Einzelfällen<br />
auch alle drei Spannungsebenen<br />
(12 V, 48 V und Hochvolt) in einem Fahrzeug integriert<br />
sein könnten.<br />
IAA Delphi: Halle 5.1, Stand B06<br />
IAA Continental: Halle 5.1, Stand A02<br />
Delphi Automotive<br />
Tel.: +49 202 291 2115<br />
thomas.aurich@delphi.com<br />
Continental Automotive, Division Powertrain<br />
Tel.: +49 941 790-61302<br />
simone.geldhaeuser@continentalcorporation.com<br />
Christian Schäfer, Leiter Vorentwicklung für E/E-Systeme und Bordnetz bei Delphi<br />
in Europa: „Unser Fokus ist darauf ausgerichtet, Systemanbieter für 48 Volt zu<br />
werden, mit integrierten Lösungen, ganzheitlicher Beratung und einem ähnlichen<br />
Leistungsspektrum wie bei 12-Volt- und Hochvoltsystemen.“<br />
Bilder: Delphi<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 37
ELEKTRONIK + SOFTWARE<br />
Aktuatoren helfen, Emissionswerte zu reduzieren<br />
Optimiertes Wärmemanagement durch Elektrifizierung der Kühlschleifen<br />
Die Autorin: Nicole Hillmayr<br />
für Sonceboz, Schweiz<br />
Linearaktuator 7496 (Prototyp)<br />
BLDC-Motor 5810<br />
Bilder: Sonceboz<br />
Das Wärmemanagement gewinnt<br />
zunehmend an Bedeutung. Die Automobilhersteller<br />
tendieren immer<br />
mehr zu einem optimierten Wärmemodell<br />
durch die effiziente<br />
Steuerung von Temperatur und<br />
Energieverlusten. Dieser Trend ist<br />
nicht nur eine Folge einer strengeren<br />
Regulierung der Schadstoffemissionen<br />
durch die Euro-Normen,<br />
sondern auch ein Weg der<br />
Automobilhersteller, den Kraftstoffverbrauch<br />
ihrer künftigen<br />
Modelle zu optimieren und sich so<br />
von den Mitbewerbern abzuheben.<br />
Neue Technologien, wie die<br />
Elektrifizierung und Motorisierung<br />
der Baugruppen des Wärmemanagements,<br />
können dazu<br />
beitragen, dieses dynamischer<br />
und intelligenter zu machen. Das<br />
Schweizer Unternehmen Sonceboz<br />
SA bietet dafür mechatronische<br />
Aktuatoren, mit deren Hilfe schon<br />
heute die Ziele der Emissionsreduzierung<br />
für 2020 erreicht werden<br />
könnten.<br />
Zunehmend strengere Regulierungen wie etwa<br />
die Euro-Normen und ihre Äquivalente auf<br />
weltweiter Ebene machen ein vorausschauendes<br />
Temperaturmanagement an den Antriebsbaugruppen<br />
zwingend notwendig. Die Tendenz<br />
in der Automobilbranche orientiert sich deutlich<br />
von der separaten Einzelkühlung hin zu einer<br />
strategisch vollständigen Optimierung der<br />
Betriebstemperaturen des gesamten Antriebssystems.<br />
Um dies zu erreichen, müssen die<br />
Wärmeflüsse im Motorraum und im Fahrgastraum<br />
geregelt und koordiniert werden. So lässt<br />
sich der Energieverbrauch verringern und ein<br />
umweltschonenderes Fahren erreichen. Diese<br />
Optimierung vervielfacht die Kühlschleifen an<br />
Zylinderkopf, Motorblock, Schaltgetriebe oder<br />
Batterien. Je nach Situation, beispielsweise<br />
beim Starten des Motors, bei Teillast im Leerlauf<br />
oder unter Volllast, können diese Schleifen<br />
untereinander verbunden oder voneinander<br />
getrennt werden. Die dazu erforderliche Feinund<br />
Dynamiksteuerung lässt sich mit Hilfe von<br />
elektrischen Aktuatoren erreichen. Sonceboz<br />
hat eine ganze Serie dieser Schlüsselkomponenten<br />
entwickelt.<br />
Vor nicht allzu langer Zeit regelten noch konventionelle<br />
Thermostate wie Wachsaktuatoren<br />
selbstständig und vordefiniert auf Basis der<br />
Temperatur der Kühlflüssigkeit des Motors.<br />
Heute ermöglicht ein angetriebener Thermostat,<br />
der ein Ventil und einen mechatronischen<br />
Aktuator kombiniert, ein vielfach genaueres,<br />
flexibleres und dynamischeres Management.<br />
In der Praxis ist es heute möglich,<br />
die Temperatur eines Bauteils direkt zu messen<br />
und auf Grundlage dieser und anderer Daten<br />
vorausschauend zu agieren: mit Hilfe einer<br />
adäquaten Programmierung wird flexibel entsprechend<br />
definierter Szenarien schnell und<br />
innerhalb weniger Sekunden geregelt. Dies ist<br />
die Alternative zur konventionellen Steuerung<br />
mit ihrer mehr oder weniger hohen Trägheit<br />
durch Abschätzung der Bauteiltemperatur auf<br />
Basis des Temperaturwertes der Kühlflüssigkeit.<br />
Dieser Aspekt ist besonders in den Phasen des<br />
Temperaturanstiegs interessant. Durch das<br />
schnellere Erreichen optimaler Betriebstemperaturen<br />
wird eine Verminderung von Verschleiß,<br />
Ablagerungen und Schadstoffemissionen<br />
erreicht. Mit Hilfe eines Sonceboz-Aktuators<br />
der Serie 5810 (Drehbewegung) oder der<br />
Serie 7496 (lineare Bewegung) kann die Thermostatsteuerung<br />
entsprechend dem geplanten<br />
Ventiltyp realisiert werden. Diese intelligenten<br />
Aktuatoren wandeln die Steuersignale in genaue<br />
und schnelle mechanische Bewegungen<br />
um, die eine optimale Regulierung der Ventilöffnung<br />
ermöglichen. Eine Steuerung dieser<br />
Art erlaube laut Sonceboz eine Verbesserung<br />
des Wirkungsgrades der Motorantriebsgruppe<br />
und das Erreichen einer Kraftstoffeinsparung<br />
von bis zu 3%.<br />
38 AutomobilKonstruktion 3/2015
BLDC-Aktuatoren für die Steuerung von Mehrwegmodulen<br />
oder elektrischen Thermostaten<br />
Der Aktuator der Serie 5810 von Sonceboz ist<br />
als intelligentes Bauteil für die Elektrifizierung<br />
von Anwendungen zum Wärmemanagement,<br />
insbesondere für Thermostatfunktionen und<br />
zur Betätigung von Wasser- oder Mehrwegventilen<br />
bei Nutzfahrzeugen (Lkw, Reisebusse) sowie<br />
Personenkraftwagen konzipiert. Dieser Aktuator<br />
basiert auf einer Antriebskonstruktion<br />
der Technologie MM122, bestehend aus einem<br />
Dauermagnetrotor mit fünf Polpaaren sowie einem<br />
Dreiphasen-Stator mit Kompaktwicklung.<br />
Mit einer Bauhöhe von 25 mm sind die Aktuatoren<br />
der Serie 5810 kompakt und verfügen<br />
über ein maximales Drehmoment von 1,5 Nm<br />
bei einer Geschwindigkeit von bis zu<br />
20 U/min. Dank ihrer robusten Bauweise sind<br />
sie widerstandsfähig gegen Motorvibrationen<br />
besonders auf die proportionale Flussregelung<br />
von Thermostaten als auch auf die On/Off-<br />
Schaltung von Ventilen im Allgemeinen zugeschnitten.<br />
Dabei ersetzen sie Zylinderspulen<br />
oder Druckluftaktuatoren in den Automobilanwendungen<br />
etwa für die Split-Cooling-Funktionen<br />
oder auch für den AGR-Kühlerbypass.<br />
Diese Aktuator-Serie basiert ebenfalls auf einer<br />
Konstruktion mit dem kontaktlosen Dreiphasenmotor<br />
MM122 mit Dauermagnet. In kompakter<br />
Paketbauweise integrieren die Aktuatoren<br />
der Serie 7496 eine BLDC-Steuerungselektronik<br />
mit Anpassung der Geschwindigkeit und<br />
des Stromverbrauchs je nach Last, verschiedene<br />
Typen von Positionssensoren und einen LIN-<br />
Kommunikationsbus. Sie sind in der Lage, über<br />
einen Hub von 15 mm eine Axialkraft von 150 N<br />
zu liefern und sind darüber hinaus resistent<br />
gegen die harten Bedingungen in der Motor-<br />
potenziell justieren zu können. Die Herausforderung<br />
besteht darin, eine Gesamtheit von optimalen<br />
Kombinationen für die unterschiedlichen<br />
Systembestandteile zu finden. Unter diesen<br />
Bedingungen erreicht man, dass der Motor<br />
soweit als möglich im Bereich seines maximalen<br />
Wirkungsgrades gehalten wird, die Schadstoffemission<br />
minimiert und die Reichweite<br />
maximiert wird.<br />
Neben der Optimierung der Betriebstemperaturen<br />
des Motors müssen zahlreiche weitere Elemente<br />
in das allgemeine Temperaturmanagement<br />
integriert werden: Hierzu zählen die Temperaturregelung<br />
im Fahrgastraum durch Heizung<br />
und Klimaanlage, das Automatikgetriebe,<br />
die elektrischen Antriebsmotoren, der Stromumrichter<br />
oder die Batterien bei Hybridfahrzeugen.<br />
Es geht darum, den Wärmeaustausch<br />
zwischen den Bauteilen, die zum betrachteten<br />
On-demand-/<br />
elektrische<br />
Hilfsmittel<br />
9%<br />
60%<br />
Elektrischer Thermostat<br />
Split-Kühlventil<br />
Konventionelle<br />
Hilfsmittel<br />
91%<br />
Elektrische Abhitze-<br />
Rückgewinnung<br />
40%<br />
2010 2020<br />
AktiveGitterklappen<br />
Skizze Chassis<br />
Dehnungsventile<br />
Zweckbestimmte elektrisierte Hilfsmittel,<br />
die bis 2020 erforderlich sind<br />
Zweckbestimmte elektrisierte Hilfsmittel,<br />
die bis 2020 erforderlich sind<br />
und Temperaturen von bis zu +140 °C. Sie eignen<br />
sich deshalb besonders für Anwendungen<br />
im Bereich der Wärmesteuerung. Dank eines<br />
LIN-Kommunikationsbusses und ihrer spezifischen<br />
Antriebselektronik fügen sich diese Antriebe<br />
leicht in allgemeine elektronische Architekturen<br />
ein. Die Antriebsart BLDC erlaubt außerdem<br />
eine automatische Anpassung der Motorgeschwindigkeit<br />
und des Stromverbrauchs<br />
je nach Last sowie eine genaue Zwischenpositionierung<br />
im geschlossenen Regelkreis mit<br />
Hilfe von analogen 2D-Hall-Effekt-Sensoren.<br />
Kompakte BLDC-Linearaktuatoren<br />
Die Antriebe der Serie 7496 sind mechatronische<br />
Aktuatoren, die eine leichte Elektrifizierung<br />
der Linearbewegungen beim Wärmemanagement<br />
des Motors ermöglichen. Sie sind<br />
umgebung, etwa Temperatur und Schwingungen.<br />
Ihre modulare Bauweise erlaubt außerdem<br />
eine einfache Anpassung an unterschiedliche<br />
Bedürfnisse des Motor-Wärmemanagements.<br />
Technologien zur Minimierung der Energieverluste<br />
Die gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf<br />
den CO2– Ausstoß fordern von den Automobilherstellern<br />
eine Optimierung der Betriebstemperatur<br />
des Motors. Hierzu gibt es unterschiedliche<br />
Technologien, welche vom allgemeinen<br />
und statischen Management der Kühlungsproblematik<br />
zu einem feineren und dynamischeren<br />
Management übergehen. Je nach Nutzungsphase<br />
geht es darum, die Übergänge zu<br />
vorbestimmten Pegelwerten zu beschleunigen,<br />
um die unterschiedlich ermittelten Situationen<br />
Zeitpunkt gekühlt bzw. beheizt werden müssen,<br />
auf dynamische Weise zu optimieren. So<br />
lassen sich die Verluste nach außen minimieren.<br />
Um diesen Austausch zu ermöglichen,<br />
werden folgende Bauteile von der Elektrifizierung<br />
erfasst: variable Wasserpumpen, 2/3-Wege-Wasserventile,<br />
Wärmetauscher, Verteiler,<br />
Ausdehnungsventile, Kompressoren, Verdampfer,<br />
Kondensatoren und weitere Elemente.<br />
IAA: Halle 4.0, Stand C10<br />
Sonceboz SA<br />
Tel: +41 (0) 32 488 11 11<br />
info@sonceboz.com<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 39
ELEKTRONIK + SOFTWARE<br />
Harald Kröger, Leiter Entwicklung Elektrik/Elektronik & E-Drive bei Mercedes-Benz Cars<br />
„Kompetenz bei Batteriesystemen<br />
ist unerlässlich“<br />
Die Elektromobilität hat große Auswirkungen auf<br />
das Bordnetz der Fahrzeuge. Wie Daimler mit dieser<br />
Herausforderung umgeht, erläuterte uns Harald Kröger,<br />
Leiter Entwicklung Elektrik/Elektronik & E-Drive bei<br />
Mercedes-Benz Cars.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Sind im Bereich der Datenbussysteme<br />
zukünftig neue Standards zu erwarten?<br />
Kröger: Wir rechnen mit einem dramatisch steigenden<br />
Bedarf an Bandbreite, denken Sie nur<br />
an die große Zahl neuer Assistenz- und Infotainmentsysteme.<br />
Das erfordert zwangsläufig<br />
neue Bussysteme, um die damit anfallenden<br />
Datenmenge zu verarbeiten. Ethernet ist dafür<br />
prädestiniert und wird sicher massiv Einzug im<br />
Fahrzeug halten.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Wird Ethernet die anderen Bussysteme<br />
ersetzen oder ergänzen?<br />
Kröger: Ethernet wird eine Ergänzung werden,<br />
da der Mix heutiger Bussysteme schon hocheffizient<br />
arbeitet und sehr robust ist. Es wäre<br />
Wahnsinn, diese bewährte Architektur radikal<br />
Das Interview führten Jürgen Goroncy<br />
und Hartmut Hammer<br />
„Ethernet ist prädestiniert,<br />
die zukünftigen<br />
hohen Datenmengen zu<br />
verarbeiten und wird<br />
sicher massiv Einzug ins<br />
Fahrzeug halten.“<br />
Harald Kröger, Leiter Entwicklung<br />
Elektrik/Elektronik & E-Drive bei<br />
Mercedes-Benz Cars<br />
umzukrempeln, da für Funktionen wie die Spiegel-<br />
oder Sitzverstellung ein kostengünstiger<br />
LIN-Datenbus völlig ausreicht. Keep it simple!<br />
Automobil<br />
Konstruktion Welche Implikationen hat der<br />
Einzug von Ethernet im Automobil? Etwa bezüglich<br />
EMV?<br />
Kröger: Hohe Datenraten bedeuten natürlich<br />
mehr Sensibilität und Aufwand bezüglich EMV.<br />
Das Störpotenzial von Ethernet lässt sich mit<br />
Twisted-Pair-Kabeln und anderen Vorsichtsmaßnahmen<br />
aber gut beherrschen.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Wie kann man die teils armdicken<br />
Kabelstränge optimieren? Dünnere Leitungen,<br />
andere Werkstoffe?<br />
Kröger: In diese Richtungen ist vieles im Fluss.<br />
Beispielsweise reduzieren wir bei jedem Modell<br />
konsequent die Kabelquerschnitte und ersetzen<br />
Kupfer- durch Aluminiumkabel. Natür-<br />
lich nur dort, wo das möglich und sinnvoll ist.<br />
Man darf die Miniaturisierung nicht so weit treiben,<br />
dass die Kabel und Steckverbinder bei der<br />
Fertigung oder der Fahrzeugmontage reißen<br />
oder gegen Störeinflüsse zu sensibel werden.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Werden die heutigen Leitungen<br />
mit 0,13-Querschnitt noch häufiger eingesetzt<br />
oder geht man gleich auf noch dünnere Querschnitte?<br />
Kröger: Sowohl als auch. Zunächst wird man bei<br />
weiteren Anwendungsfällen dickere Kabel durch<br />
solche mit 0,13 Quadratmillimeter Querschnittsfläche<br />
ersetzen. Parallel dazu wird aber schon<br />
an noch dünneren Kabeln gearbeitet. Dabei stehen<br />
Aspekte wie das sichere Crimpen, das sichere<br />
Stecken und Lösen der Konnektoren oder<br />
die Reißfestigkeit des Werkstoffs in Fokus.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Wo werden denn schon Aluminiumkabel<br />
eingesetzt?<br />
Kröger: Dieser Wechsel vollzieht sich Top-Down<br />
von großen zu kleineren Querschnitten. Ein<br />
schönes Beispiel sind die dicken Batteriekabel,<br />
die schon häufig in Aluminium ausgeführt werden.<br />
Aktuell werden die ersten Kabel mit 16<br />
Quadratmillimeter Querschnitt in Aluminium<br />
ausgeliefert.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Welche Strategie fährt Mercedes-<br />
Benz bei den Komponenten für Elektroantriebe?<br />
Kröger: Um mit dem Einfachen zu beginnen: die<br />
Leistungselektronik entwickeln wir mit Partnern<br />
und lassen sie von diesen fertigen. Elektromotoren<br />
kaufen wir zum Teil zu. Ergänzend entwickeln<br />
und fertigen wir bei der EM-motive – unserem<br />
50:50-Joint Venture mit Bosch – bestimmte<br />
Elektromotoren selbst. Dieses Mischkonzept<br />
deckt die Anforderungen des Marktes sehr gut<br />
ab, außerdem verfügen wir auf diese Weise über<br />
das nötige Know-how.<br />
Bei Batteriesystemen ist eine entsprechende<br />
Kompetenz für den OEM unerlässlich. Denn sie<br />
sind allein schon aufgrund ihrer Dimensionen<br />
ein wichtiges Element der Fahrzeugstruktur. Batteriezellen<br />
hingegen betrachten wir als lupenreines<br />
Zukaufteil. Dennoch verbleibt mit der Integration<br />
der Zellen in das Batteriemodul und dessen<br />
Integration in das Fahrzeug noch ein erheblicher<br />
Teil der Wertschöpfung im eigenen Haus.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Diese Aufgaben werden am Standort<br />
Kamenz erledigt?<br />
40 AutomobilKonstruktion 3/2015
Die B-Klasse Electric<br />
Drive soll den Daimler-<br />
Kunden die Elektromobilität<br />
schmackhaft machen<br />
Lithium-Ionen-Hochvolt-<br />
Batterie, Ladegerät, Fahrzeugsteckdose<br />
der<br />
B-Klasse Electric Drive<br />
Bilder: Daimler<br />
Kröger: Genau. Die Batteriefertigung in Kamenz<br />
produziert derzeit Energiespeicher für unsere<br />
Hybridmodelle. Für die Zellenfertigung gibt es<br />
inzwischen einen Markt mit genügend und<br />
kompetenten Zulieferern.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Die markenspezifischen Eigenschaften<br />
von Mercedes-Benz werden aktuell<br />
noch stark mit dem Verbrennungsmotor assoziiert.<br />
Wie will Daimler es schaffen, dass in Zukunft<br />
der Kunde bei „Mercedes-Benz“ sofort an<br />
„Elektroantrieb“ denkt?<br />
Kröger: Der Antrieb war schon immer ein ganz<br />
wesentlicher Teil des Automobils, da er vor gut<br />
hundert Jahren aus der Pferdekutsche erst ein<br />
richtiges Automobil machte. Aber seine Bedeutung<br />
schwankt heute je nach Modell. Ein Mercedes-AMG<br />
GT etwa definiert sich im Wesentlichen<br />
über seinen Motor. Eine C- oder E-Klasse<br />
hingegen bietet speziell bei den in diesen Segmenten<br />
häufig gekauften Varianten mit kleinen<br />
Motorisierungen ein Gesamtpaket, bei dem der<br />
Motor wichtig, aber in der Kundenwahrnehmung<br />
nicht unbedingt im Mittelpunkt steht. Für alle<br />
Modelle werden wir passende Elektroantriebe<br />
bereitstellen, die den Fahrzeugcharakter noch<br />
schärfer herausarbeiten. Bei der E-Variante des<br />
Mercedes-AMG SLS ist uns das schon sehr gut<br />
gelungen. Selbst ein ehemaliger Rallyeweltmeister<br />
und Markenbotschafter eines Wettbewerbers<br />
hat begeistert bestätigt, dass dieser Antrieb in<br />
diesem Fahrzeug derzeit das Nonplusultra der<br />
Elektromobilität darstellt. Sprich: Auch Elektroantriebe<br />
können – je nach Zielfahrzeug – sportlich,<br />
effizient, komfortabel und emotional sein.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Wie wird sich die Elektromobilität<br />
generell in den unterschiedlichen Märkten entwickeln?<br />
Kröger: In Deutschland ist der Trend noch verhalten,<br />
kann aber jederzeit an Fahrt gewinnen.<br />
Vor allem, wenn die Elektrofahrzeuge bei der<br />
Gesamtkostenbetrachtung sich den herkömmlichen<br />
Fahrzeugen annähern. Dann sehe ich einen<br />
großen Markt für E-Fahrzeuge als Zweitwagen,<br />
da in diesem Segment die sonstigen Rahmenbedingungen<br />
– wie etwa die durchschnittlich<br />
pro Tag zurückgelegten Kilometer – stimmen.<br />
Auch die aktuell niedrigen Ölpreise werden nicht<br />
dauerhaft so günstig bleiben. Ein dritter Aspekt<br />
sind die Kunden. Wir spüren großes Interesse<br />
an der Elektromobilität, vor allem bei den jüngeren<br />
Altersklassen. Diese Kundenpräferenzen<br />
werden über kurz oder lang zum Durchbruch<br />
führen. Unsere Planungen gehen da über Zeithorizonte<br />
von zehn und mehr Jahren hinaus.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Welches Konzept wird in einem<br />
Jahrzehnt die Nase vorn haben: Mildhybrid,<br />
Plug-in-Hybride oder reine E-Fahrzeuge?<br />
Kröger: Bei Daimler sehe ich Plug-in-Hybride<br />
zumindest für die nächste Dekade vorn: lokal<br />
emissionsfrei, kleine kostengünstige Batterie,<br />
keine Reichweitenangst, hoher Fahrkomfort<br />
und Fahrspaß. Dieses Paket ist einfach ein<br />
ausgewogener Kompromiss für den problemlosen<br />
Alltagsbetrieb.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Und welche Zukunft prophezeien<br />
Sie dem 48-Volt-Bordnetz?<br />
Kröger: Ein (Teil-)Bordnetz mit 48 Volt hat viele<br />
Vorteile. Es kann beispielsweise viel mehr<br />
elektrische Leistung ohne größere Querschnitte<br />
und Leitungsverluste durch das Fahrzeug<br />
transportieren. Alle großen OEMs sind an diesem<br />
Thema dran. Auch Daimler wird sich zu gegebener<br />
Zeit zu seinen 48-Volt-Plänen und<br />
-Produkten äußern.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Sehen Sie die Hybride der Zukunft<br />
eher mit einem 48-Volt- oder einem Hochvolt-Bordnetz<br />
realisiert?<br />
Kröger: Das ist heute noch nicht hundertprozentig<br />
prognostizierbar. Mikro- und Mildhybride<br />
sind sicherlich mit 48-Volt-Bordnetz sinnvoll<br />
und kostengünstig. Etwa, weil die Kosten für<br />
die Sicherheitsvorkehrungen bei diesem Spannungslevel<br />
noch sehr überschaubar sind. Allerdings<br />
ist ein Plug-in-Hybrid, der nicht nur Kraftstoff<br />
sparen, sondern auch hohen Fahrspaß<br />
bieten soll, wohl nur mit Hochvolt-Komponenten<br />
darstellbar. Der Kunde erwartet in diesem<br />
Fall einfach mehr Emotionalität. Vermutlich<br />
werden Volumenmodelle eher ein Fall für 48<br />
Volt, die Premiummodelle für Hochvolt. Vielleicht<br />
werden künftig auch beide (Teil-) Bordnetze<br />
in den Fahrzeugen integriert.<br />
Automobil<br />
Konstruktion Im Zuge von Autosar haben die<br />
Zulieferer vor einigen Jahren die Befürchtung<br />
geäußert, dass der Steuergerätelieferant nicht<br />
mehr automatisch auch die Software dafür mitliefert.<br />
Es war sogar die Rede davon, dass der<br />
OEM als Tier-2-Zulieferer die Software beisteuern<br />
könnte. Hat sich diese Befürchtung bewahrheitet?<br />
Kröger: Da muss man differenzieren. Die mühselige<br />
und fehlersensible Neuprogrammierung<br />
der Software müssen wir dank Autosar nicht<br />
mehr für jedes Modell neu erledigen. Standardisierte<br />
Modelle können jetzt recht problemlos<br />
auch in andere Steuergeräte integriert werden.<br />
Wir sehen das als sehr sinnvoll an, um die Stabilität<br />
des Entwicklungsprozesses zu erhöhen<br />
und die Komplexität zu beherrschen.<br />
IAA: Halle 2.0, Stand A01<br />
www.daimler.com<br />
Zur Person<br />
Harald Kröger, 48, studierte Elektrotechnik und Wirtschaftswissenschaften<br />
an der Universität Hannover.<br />
Nach seinem Abschluss als Master of Science an der<br />
Stanford University begann er 1995 seine Karriere bei<br />
Daimler-Benz im Bereich Radarsensorik. Nach verschiedenen<br />
Stabsfunktionen und Stationen in der Produktion<br />
übernahm er 2003 die Leitung des Elektrik/Elektronik<br />
Einkaufes für Mercedes-Benz Pkw. 2008 wurde er<br />
Qualitätschef von Mercedes-Benz Cars. Seit Mai 2012<br />
leitet Harald Kröger die Direktion Entwicklung Elektrik/<br />
Elektronik & E-Drive Mercedes-Benz Cars.<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 41
ELEKTRONIK + SOFTWARE<br />
Fahreradaption als Brückenschlag<br />
Bertrandt begleitet den Weg zum autonomen Fahren<br />
Bertrandt verknüpfte die<br />
Sensoren einer Oberklasse-<br />
Limousine zu neuen<br />
Systemen<br />
Autonomes Fahren ist aus technischer<br />
Sicht keine Vision mehr.<br />
Ein wichtiger Schritt dorthin ist<br />
es, die Gesellschaft an diese Technologie<br />
zu gewöhnen. Dabei spielen<br />
Fahrerassistenzsysteme eine<br />
wesentliche Rolle. Bertrandt hat<br />
hierfür das Zusammenwirken von<br />
Mensch und Maschine analysiert.<br />
Das Ergebnis zeigt, dass die Erkennung<br />
von Umfeldbedingungen<br />
eines Fahrzeugs ebenso wie dessen<br />
Adaption an den Fahrer zwei<br />
fundamentale Bausteine des vollautomatisierten<br />
Individualverkehrs<br />
bilden.<br />
Die Autoren: Sebastian Schierenberg, Ralf Schoenen,<br />
Bertrandt, Ingolstadt<br />
Was für viele Menschen heutzutage noch unvorstellbar<br />
erscheint, ist aus technischer Sicht<br />
längst möglich: das autonome Fahren, also die<br />
vollautomatische Steuerung eines Autos durch<br />
den Computer. In der Luftfahrt werden bereits<br />
heute Menschenleben in die Hände von computergesteuerten<br />
Systemen gelegt. Im täglichen<br />
Straßenverkehr müsste die Akzeptanz<br />
von vollautomatischen – und bei Fehlern potenziell<br />
lebensbedrohlichen – Transportmitteln<br />
jedoch eine neue Qualität erfahren. Diesen<br />
Fahrzeugen würde vermutlich eine weit geringere<br />
Fehlerquote zugestanden als menschlichen<br />
Fahrern.<br />
Eine schrittweise Gewöhnung wird daher nötig<br />
sein, bis die Gesellschaft in der Breite reif für<br />
selbstfahrende Autos ist. Ein wahrscheinliches<br />
Szenario ist daher die Weiter- und Neuentwicklung<br />
von Fahrerassistenzsystemen, um deren<br />
Einsatzbereiche auszuweiten. Die Fahrer müssen<br />
ihre Kompetenzen freiwillig an die Assistenzsysteme<br />
abgeben und Vertrauen fassen.<br />
So kann ein gradueller Übergang zum autonomen<br />
Fahren erreicht werden. Letztendlich<br />
darf der Fahrer nie das Gefühl haben, eingrei-<br />
fen zu müssen. Ziel ist, dass die Systeme immer<br />
und unter beliebigen Rahmenbedingungen<br />
zuverlässig funktionieren.<br />
Das Fahrzeug und seine Umgebung<br />
Aktuelle Fahrerassistenzsysteme können bereits<br />
viele Standardsituationen im Straßenverkehr<br />
anhand von Sensordaten korrekt einschätzen<br />
und darauf reagieren. Es gibt jedoch<br />
fast immer auch Situationen, die nicht richtig<br />
erkannt werden und mitunter unerwünschte<br />
Verhaltensweisen der jeweiligen Systeme verursachen<br />
– beispielsweise, wenn der Abstandstempomat<br />
keine stehenden Objekte vor<br />
einer Ampel erkennt. Generell ist der Aufgabenbereich<br />
der verschiedenen Assistenzsysteme<br />
relativ begrenzt und der Datenaustausch<br />
zwischen den Systemen gering. Eine zentrale<br />
Verarbeitung und Interpretation aller Sensordaten<br />
könnte daher starke Synergieeffekte erzeugen.<br />
Bertrandt näherte sich diesem Thema zunächst<br />
von einer eher abstrakten Seite. Ingenieure<br />
und Techniker fragen sich: Welche Informationen<br />
über das Umfeld sind für ein Kraftfahrzeug<br />
42 AutomobilKonstruktion 3/2015
eigentlich wichtig? Diese Betrachtung erfolgte<br />
zunächst ganz unabhängig von konkret verwendeter<br />
Sensorik. Ziel war die Erarbeitung einer<br />
möglichst vollständigen Sammlung von relevanten<br />
Umfeldinformationen.<br />
Ein Ansatz war, die tatsächlich für die Regelung<br />
des Fahrzeugs relevanten Faktoren zu identifizieren.<br />
Zur Einordnung kristallisierten sich folgende<br />
Kategorien heraus: physikalische Faktoren,<br />
psychologische Faktoren und die Verkehrssituation:<br />
·Unter den physikalischen Faktoren wurden<br />
all jene zusammengefasst, die das Fahrzeug<br />
tatsächlich physikalisch in seiner Regelung<br />
beeinflussen, wie etwa die Fahrbahnreibung.<br />
·Psychologische Faktoren stellen eine psychische<br />
Belastung für den Fahrer dar, etwa<br />
eine enge Fahrbahn aufgrund einer Baustelle.<br />
Beim komplett computergesteuerten Auto<br />
könnten die psychologischen Faktoren ignoriert<br />
werden.<br />
·Die Verkehrssituation beinhaltet gesetzliche<br />
Einschränkungen, wie Tempolimits, und den<br />
Einfluss anderer Verkehrsteilnehmer.<br />
Vom Konzept zum Prototyp<br />
Nach diesen Vorüberlegungen setzte Bertrandt<br />
das theoretische Konzept als Prototyp um.<br />
Konkret stand hier eine vollausgestattete Oberklasse-Limousine<br />
als Entwicklungsplattform<br />
zur Verfügung. Die gesamte im Fahrzeug verfügbare<br />
Sensorik wurde in Betracht gezogen<br />
und, soweit möglich, auch plausibilisiert. Beispielsweise<br />
wurde eine Tunnelerkennung implementiert,<br />
die sowohl auf Basis der Navigationsdaten<br />
als auch des Helligkeitssensors funktioniert.<br />
Die aktuelle Verkehrsdichte wurde mit<br />
Hilfe von Front- und Heckradarsensoren sowie<br />
der verbauten Kamera ermittelt. Auch konnten<br />
Fahrbahneigenschaften wie Breite und Anzahl<br />
der Fahrspuren sowie bestimmte Wetterbedingungen<br />
detektiert werden. Es ließ sich zudem<br />
eine aus den Umfeldbedingungen resultierende,<br />
psychologische Belastung des Fahrers abschätzen,<br />
die beispielsweise durch schlechte<br />
Sichtverhältnisse zustande kommt. Die Rezeption<br />
dieser Belastung ist jedoch von Fahrer zu<br />
Fahrer verschieden, was eine weitere Herausforderung<br />
aktueller Fahrerassistenzsysteme zu<br />
Tage fördert: die mangelnde Adaption an den<br />
Fahrer.<br />
Testaufbau eines Fahrerassistenzsystems<br />
Bilder: Bertrandt<br />
Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine<br />
Auch wenn bei modernen Assistenzsystemen<br />
oftmals vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten<br />
bestehen, werden diese kaum genutzt. Eine<br />
Fahrstilanalyse und anschließende dynamische<br />
Anpassung an den jeweiligen Fahrer<br />
kann hier helfen.<br />
Bertrandt konzentrierte sich zunächst auf die<br />
Fahrstilanalyse, wobei ein einfaches Fahrermodell<br />
zugrunde gelegt wurde. Es basiert auf der<br />
Charakterisierung des Fahrers durch mehrere<br />
Schlüsseleigenschaften wie Sportlichkeit, Aggressivität<br />
und Energieeffizienz. Die Ermittlung<br />
dieser Eigenschaften erfolgte anhand verschiedener,<br />
vom Fahrer während der Fahrt ausgeführter<br />
Manöver. Auf Basis der Fahrercharakterisierung<br />
könnten in Zukunft verschiedene<br />
Parameter von Fahrerassistenzsystemen dynamisch<br />
angepasst werden.<br />
Konkret wurde die Charakterisierung folgendermaßen<br />
durchgeführt: Immer, wenn ein bestimmtes<br />
Manöver des Fahrers detektiert wurde<br />
– beispielsweise eine Beschleunigung –<br />
wurde diesem Manöver ein bestimmter Wert<br />
für die Sportlichkeit zugewiesen. Der derzeit<br />
für den aktuellen Fahrer gespeicherte Wert der<br />
Sportlichkeit wurde dann einen Teil des Weges<br />
in Richtung des dem Manöver zugewiesenen<br />
Wertes verschoben. Dadurch sollte sichergestellt<br />
werden, dass ein einzelnes Manöver<br />
keinen zu starken Einfluss auf eine Eigenschaft<br />
hat, viele ähnliche Manöver aber schließlich zu<br />
einem stationären Eigenschaftswert führen.<br />
Unabhängig vom konkreten für die Fahreradaption<br />
gewählten Ansatz ist eine enge Verknüpfung<br />
mit der Umfelderkennung sinnvoll. Da jeder<br />
Fahrer seinen Fahrstil dem Umfeld anpasst,<br />
sollte die Interpretation eines Fahrmanövers<br />
immer im Kontext der aktuellen Fahrsituation<br />
erfolgen. Auch ein sportlicher Fahrer<br />
wird sich bei schlechter Sicht eher defensiv<br />
verhalten, was jedoch nicht zu einer weniger<br />
sportlichen Charakterisierung führen darf. Allgemein<br />
sollten beliebige Adaptions-Algorithmen<br />
abstrakt als Abbildung einer Fahrsituation<br />
auf einen bestimmten Parametersatz von Assistenzsystemen<br />
begriffen werden. Für jede Situation<br />
existiert also eine zugeordnete Regelstrategie.<br />
Die Zuordnung selbst stellt das Fahrermodell<br />
dar. Die Erkennung des Fahrzeugumfelds<br />
nimmt auch hier eine zentrale Rolle<br />
ein.<br />
Zweifellos sind die Erkennung aller wichtigen<br />
Umfeldbedingungen eines Fahrzeugs ebenso<br />
wie deren Adaption an den Fahrer zwei fundamentale<br />
Bausteine des vollautomatisierten<br />
Individualverkehrs. Das Auto der Zukunft wird<br />
den menschlichen Fahrer noch mehr unterstützen.<br />
Zudem wird es seine Fahrdynamik präzise<br />
an die Vorlieben seiner Insassen anpassen. Sicherheit<br />
und Fahrkomfort werden erhöht – und<br />
ebnen dem autonomen Fahren früher oder<br />
später den Weg.<br />
IAA: Halle 5.1, Stand B20<br />
Bertrandt AG<br />
Tel.: + 49 7034 656-0<br />
info@bertrandt.com<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 43
ELEKTRONIK + SOFTWARE<br />
Leoni auf der IAA: Formstabile Kabelsätze für schnelleren Einbau im Pkw<br />
Geschäumte Produkte mit höherer Beständigkeit und leichtere Kabel für weniger Gewicht<br />
Bislang hat Leoni formstabile Kabelsätze<br />
vorwiegend für Nutzfahrzeuge<br />
entwickelt und hergestellt.<br />
Nach erfolgreichem Einsatz von<br />
geschäumten Sonderanwendungen<br />
wie etwa Tüllen in ersten Pkw-<br />
Modellen steht die Technologie<br />
jetzt auch für den Motorraum<br />
zur Verfügung. Auf dem IAA-<br />
Stand werden die Vorzüge<br />
der Produkte<br />
dargestellt: Formstabile Kabelsätze<br />
ermöglichen eine platz- und<br />
zeitsparende Montage, insbesondere<br />
an Motorblock und Getriebe.<br />
Auch an Engstellen oder Durchführungen,<br />
etwa vom Motorraum zur<br />
Fahrgastzelle, kann der Einsatz ge-<br />
zeigt. Durch Berührung mit dem<br />
Finger kann der Fahrer einen der<br />
freien Parkplätze anwählen und<br />
das Kommando zum Start des automatisierten<br />
Parkvorgangs geben.<br />
Dabei macht es keinen Unterschied,<br />
ob sich die Parklücke parallel<br />
zur Fahrbahn befindet oder<br />
im rechten Winkel dazu. Gestützt<br />
auf die erzeugte Objektkarte der<br />
Umgebung übernimmt das Fahrzeug<br />
nun den kompletten Parkvorgang<br />
einschließlich Gas geben,<br />
Lenken, Gangwechsel, Anhalten<br />
und Verriegeln der Feststellbremse<br />
in der Endposition. Auf dem<br />
Touchscreen kann der Fahrer die<br />
vorgeschlagene Parkposition verändern.<br />
So kann er auf Besonderheiten<br />
in seinem Umfeld reagieren,<br />
etwa auf ein vor oder hinter<br />
dem eigenen Fahrzeug abgestelltes<br />
Lieferfahrzeug, das mehr Rangierabstand<br />
benötigt als ein Pkw.<br />
Beim automatisierten Parken mit<br />
Der Parkvorgang lässt sich zukünfschäumter<br />
Bauteile eine verbesserte<br />
Formgebung und Passgenauigkeit<br />
gewährleisten – und damit<br />
einen schnelleren Einbau.<br />
Die formstabile Hülle schützt die<br />
Leitungen dank dichter Kabeldurchführungen<br />
vor Schmutz,<br />
Feuchtigkeit, Ölen und Chemikalien.<br />
Trennstellen entfallen, was<br />
potenzielle Fehlerquellen reduziert.<br />
Die Temperaturbeständigkeit<br />
wurde weiter verbessert, so dass<br />
die formstabilen Kabelsätze je<br />
nach Anforderung und Einsatzbereich<br />
im Fahrzeug bis zu 130 °C<br />
im Dauerbetrieb standhalten sollen.<br />
Leoni stattet die Produkte bei<br />
Bedarf mit integrierten Befestigungsteilen<br />
aus, die Bewegungen<br />
und mechanische Belastungen<br />
verhindern.<br />
Leoni hat zudem sein Angebot an<br />
Fahrzeugleitungen durch die Einführung<br />
eines Kupferleiters mit ultradünnem<br />
Mantel weiter ausgebaut.<br />
Er ist derzeit in Querschnitten<br />
von 0,35 mm 2 bis<br />
2,5 mm 2 mit blanker oder verzinnter<br />
Litze erhältlich. Die Fluy-Leitungen<br />
sind mit einem speziellen<br />
PVC-Material isoliert, was eine minimale<br />
Wandstärke von lediglich<br />
0,16 mm zur Folge hat. Das reduziert<br />
den Durchmesser einer Einzelleitung<br />
um 11%.<br />
Fluy reduziert auch das Gewicht<br />
einer Einzelleitung um 7%. Beim<br />
Kabelbaum eines mittelgroßen<br />
Pkw bringe dies eine Gewichtseinsparung<br />
von bis zu 1,5 kg.<br />
Ein externes Labor hat die Validierung<br />
der neuen Leitung nach dem<br />
LV112–1-Standard erfolgreich abgeschlossen.<br />
IAA: Halle 4.1, Stand D08<br />
www.leoni.com<br />
Continental: Wie sich mit Surround View-Kameras ein automatisiertes Einparken umsetzen lässt<br />
Nie wieder Stress bei der Parkplatzsuche<br />
Bereits im Mai hatte Continental<br />
einen Back-up Assist vorgestellt,<br />
der die im Heck befindliche Fischaugenkamera<br />
eines Surround<br />
View-Systems nutzt, um Kollisionen<br />
beim Rückwärtsfahren zu vermeiden.<br />
Ihr großer Öffnungswinkel<br />
erlaubt beispielsweise auch<br />
den Blick in schräge Parklücken.<br />
Außerdem erkennen die Kameras<br />
die weißen Begrenzungslinien von<br />
Parkplätzen, was mit den traditionellen<br />
Ultraschallsensoren nicht<br />
gelingt.<br />
Im Versuchsträger sind vier Fischaugenkameras<br />
verbaut: eine vorne<br />
am Kühlergrill, eine am Heck<br />
und je eine im Fuß der Seitenspiegel.<br />
Jede Kamera hat mehr als<br />
180° Erfassungswinkel, so dass<br />
sie das gesamte Fahrzeugumfeld<br />
in 360° Umkreis erfassen. Dem<br />
Fahrer wird dieses Umfeld auf einem<br />
Touchscreen im Auto dargestellt<br />
und als ausreichend groß<br />
erkannte freie Parkplätze ange-<br />
tig auch aus der Distanz starten.<br />
Dabei wählt der Fahrer im Fahrzeug<br />
den Parkplatz aus und aktiviert<br />
dann den Remote Modus.<br />
Anschließend kann er das Fahrzeug<br />
verlassen und auf dem<br />
Smartphone den Start des Parkvorgangs<br />
anwählen und verfolgen.<br />
Solange er durch Berührung eines<br />
entsprechenden Buttons den Vorgang<br />
aktiv hält, parkt das Fahrzeug<br />
ein. Aktuell wird am Ende<br />
des Parkvorgangs die Parkbremse<br />
gezogen, die Türen bleiben aber<br />
offen und der Motor an. Einem zukünftiges<br />
Seriensystem wird aber<br />
das Fahrzeug verriegeln und den<br />
Motor abstellen.<br />
IAA: Halle 5.1, Stand A02<br />
www.continental-automotive.de<br />
44 AutomobilKonstruktion 3/2015
Preh auf der IAA 2015<br />
Aktives haptisches Feedback im Fahrzeuginterieur<br />
Smartphones haben nicht nur das<br />
mobile Telefonieren, sondern<br />
auch die Fahrzeugbedienung revolutioniert.<br />
Klassische Schalter weichen<br />
daher im Cockpit immer häufiger<br />
alternativen Touch-Anwendungen.<br />
Doch die Auswahl von<br />
Fahrzeugfunktionen auf der Autobahn<br />
oder im dichten Stadtverkehr<br />
ist nicht mit der Smartphone-<br />
Bedienung auf dem heimischen<br />
Sofa oder im Büro vergleichbar.<br />
Die Preh GmbH präsentiert auf der<br />
IAA Lösungen, wie Bediengewohnheiten<br />
von Smartphones mit den<br />
Sicherheitsanforderungen der<br />
Fahrzeugbedienung kombiniert<br />
werden können.<br />
Das Grundproblem klassischer<br />
Touchscreens: Sie geben in der<br />
Regel bislang kein haptisches<br />
Feedback. Der Fahrer muss zur<br />
richtigen Auswahl gewünschter<br />
Funktionen auf das Bediensystem<br />
blicken. Um die Ablenkung<br />
zu minimieren, hat<br />
Preh eine skalierbare<br />
Aktuatoren-Technologie<br />
entwickelt.<br />
Sie ermöglicht<br />
es, Touchscreens<br />
mit einem aktiven<br />
haptischen Feedback<br />
auszustatten. Damit<br />
bekommt der Fahrer gefühlt<br />
eine ähnliche Rückmeldung<br />
wie bei Betätigung einer herkömmlichen<br />
Taste.<br />
Das gemeinsam mit Audi entwickelte<br />
Multi-Media-Interface<br />
(MMI) „all-in-touch“ für die Mittelkonsole<br />
zeigt Preh auf der IAA.<br />
Dreh- und Angelpunkt der im neuen<br />
Audi Q7 eingesetzten Technik<br />
ist ein großes Touchpad aus Glas,<br />
dessen Oberfläche über dreidimensionale<br />
Strukturen als Fühlhilfen<br />
verfügt. Der eigentliche Clou<br />
sind jedoch haptische und akustische<br />
Feedbackfunktionen im Bedienfeld.<br />
Für die konkrete Anwendung<br />
ging es vor allem um zwei<br />
Kompetenzen: Zum einen um die<br />
Auswertung des Drucks, der beim<br />
Bedienen auf eine Oberfläche<br />
ausgeübt wird, zum anderen um<br />
die spezifische Auslegung von<br />
Elektromagneten, die durch gezielte<br />
Beschleunigung der Bedienoberfläche<br />
einen Tastendruck simulieren.<br />
Auf dieser Grundlage<br />
können durch die Verbindung von<br />
aktiver Haptik und einem entsprechendem<br />
Sound-Design alle Bedienoberflächen<br />
im Fahrzeuginterieur<br />
gemäß der kundenspezifischen<br />
Anforderungen identisch<br />
ausgelegt werden.<br />
Zur IAA Frankfurt zeigt<br />
Preh neben der Anwendung<br />
Touchscreen auch Multifunktionsschalter,<br />
deren Oberfläche ohne<br />
Fugen gestaltet werden kann, zum<br />
Beispiel für die Anwendung in<br />
Lenkrädern. Zu den weiteren Highlights<br />
von Preh auf der IAA 2015<br />
gehören Steuergeräte für das Batteriemanagement<br />
von E- und Hybridfahrzeugen<br />
sowie 48-Volt-<br />
Technologie.<br />
IAA: Halle 5.1, Stand A26<br />
www.preh.com<br />
DICHT&<br />
SICHER<br />
LEE BETAPLUG ® Dichtstopfen:<br />
Unser bewährtes Konzept, Kanäle<br />
und Bohrungen zu verschließen<br />
Das rationelle Prinzip: konischer Verschluss-<br />
Stopfen in konischer Aufnahmebohrung.<br />
Im Getriebe- und<br />
Motorenbau, bei<br />
Ölfiltern,<br />
Ölkühlern<br />
und -pumpen<br />
sowie anderen<br />
Anbauaggregaten.<br />
Ø 5 bis 20 mm, für Drücke bis 50 bar<br />
Mit BETAPLUG ® entsteht ein perfekter,<br />
formschlüssiger Sitz – DICHT UND SICHER!<br />
LEE Hydraulische<br />
Miniaturkomponenten GmbH<br />
Am Limespark 2 · 65843 Sulzbach<br />
Telefon 06196 / 773 69-0<br />
E-Mail info@lee.de<br />
www.lee.de
CAD + SIMULATION<br />
Licht und Schatten werden digital<br />
Wie Audi seine Produkte im virtuellen Raum optimiert<br />
Von mehreren Rechnern wird die Simulation<br />
verschiedener Perspektiven<br />
auf das Cockpit gesteuert<br />
3D-Visualisierung ist heute Standard<br />
in der Automotive-Welt. In<br />
Echtzeit generierte Bilder sehen<br />
auf den ersten Blick absolut real<br />
aus – obwohl von den abgebildeten<br />
Fahrzeugen noch nicht einmal<br />
Prototypen existieren. Die einfache<br />
Simulation am Monitor hat<br />
sich zu Virtual-Reality-Räumen<br />
entwickelt. Wir haben uns bei<br />
Audi umgesehen und nachgefragt,<br />
in welchen Bereichen sich die<br />
Visualisierung noch weiter ausbauen<br />
lässt und welche Prozesse<br />
auch heute noch schwierig sind.<br />
Der Autor: Tobias Meyer ist freier Mitarbeiter<br />
der AutomobilKonstruktion<br />
„Heute ist die virtuelle Darstellung von Konzepten,<br />
Detaillösungen und Fahrzeugen in der Automobilentwicklung<br />
etabliert und wird täglich<br />
angewendet. Virtuelle Echtzeitmodelle, Darstellung<br />
und Bewertung von Projektständen,<br />
die Visualisierung von kundenspezifischen<br />
Utensilien und virtuellen VR-Checks ist Standard.<br />
Aber digitale Daten können noch viel<br />
mehr. Die neuen Methoden helfen uns, völlig<br />
neue Wege in der Entwicklung von Produkten<br />
und in der standortübergreifenden Zusammenarbeit<br />
zu gehen“, so Daniel Hauser, Projektleiter<br />
für Virtual Reality Visualisierung in der Interieurentwicklung<br />
bei Audi.<br />
Um in den Audi DesignCheck – eine der geheimsten<br />
Abteilungen der Ingolstädter – zu gelangen,<br />
muss unser Reporter sein Handy beim<br />
Pförtner lassen und mit Herrn Hauser mehrere<br />
Sicherheitsschleusen passieren. Denn prinzipiell<br />
lassen sich dort sämtliche Fahrzeuge visualisieren,<br />
die noch tief in der Entwicklung<br />
stecken, daher der hohe Sicherheitsaufwand.<br />
Der weiße Raum scheint im Stand-by eher unspektakulär,<br />
erst wenn das Licht gedimmt und<br />
die sechs Meter breite Monitorwand zum Leben<br />
erweckt ist, kann erahnt werden, was hier<br />
inzwischen möglich ist.<br />
Hardware für Hochleistung<br />
Wie weit man hier dem Home-<br />
Entertainment voraus ist, spiegelt<br />
sich allein in der Tatsache<br />
wider, dass Audi hier bereits<br />
seit 2006 mit 4K-Auflösung arbeitet.<br />
Bis zu fünf High-End-<br />
Rechner sind dabei für die<br />
3D-Renderings in Echtzeit zuständig:<br />
„Wir bekommen neue<br />
Grafikkarten noch vor allen anderen,<br />
direkt von den Herstellern.<br />
Zwölf Gigabyte Grafikkartenspeicher<br />
sind hier schon<br />
länger Standard“, sagt Hauser.<br />
Sind die Daten aufbereitet, wird daraus eine<br />
virtuelle Echtzeitszene visualisiert, was noch<br />
einmal vier Rechner benötigt, jeder zuständig<br />
für ein Viertel des Beamer-Bildes. Die Übergänge<br />
zwischen den Vierteln sind während unserer<br />
zweistündigen VR-Session nur ein Mal kurz zu<br />
erkennen.<br />
Der hochmoderne Beamer benötigt eine eigene<br />
Klimatisierung, er ist in etwa 10-fach so<br />
lichtstark wie ein aktueller Top-Beamer der<br />
Heimkino-Klasse. Dazu kommt eine spezielle<br />
Glaswand, auf die das Bild von hinten projiziert<br />
wird. Der Vorteil der Rückprojektionstechnik:<br />
Sie ist unabhängig von Personen im<br />
Lichtkegel und besser geeignet für sich ändernde<br />
Lichtstimmung im Raum. Würde der<br />
Beamer wie gewohnt vor der Leinwand stehen,<br />
würde die Deckenbeleuchtung das Bild beeinträchtigen.<br />
Einsparpotenzial durch virtuelle Welten<br />
Steht das neue Modell im virtuellen New York<br />
bei Nacht oder in der Mittagssonne von Dubai?<br />
Kommt die Sonne von vorne oder von der Seite?<br />
Die verschiedenen Deckenleuchten und<br />
Spots im Raum können adaptiv darauf eingestellt<br />
werden. Der Raum wurde zudem mit spe-<br />
46 AutomobilKonstruktion 3/2015
ziellen 360°-Kameras vermessen, wodurch die<br />
Reflexionen auf dem virtuellen Fahrzeuglack<br />
exakt nach der im realen Raum vorherrschenden<br />
Lichtsituation eingestellt werden kann. So<br />
entsteht ein noch realistischeres Bild. Die<br />
Grenzen zwischen realem Prototyp und virtuellem<br />
VR-Modell werden dabei (fast) aufgelöst.<br />
Das alles mutet auf den ersten Blick an wie unnötige<br />
Spielerei. Doch richtig eingesetzt, bergen<br />
solche VR-Studios enormes Einsparpotenzial,<br />
da Prototypen erst nötig werden, wenn<br />
schon vieles entschieden ist. Ab wann wirken<br />
hinterleuchtete Bedienelemente nicht mehr<br />
praktisch-elegant sondern überladen wie ein<br />
Raumschiff-Cockpit? Häufig wirkt auch nicht<br />
die Lichtquelle selbst störend, sondern nur deren<br />
Reflexion. Auch das zeigt Audis VR auf. In<br />
diesem Fall könne man dann auch einfach das<br />
reflektierende Teil etwas neigen oder matter<br />
gestalten, statt die Lichtquelle zu verbannen.<br />
„Der Vorstand kann dann hier im Raum direkt<br />
eine Entscheidung treffen. Im Zweifel rendern<br />
wir über Nacht einige unterschiedliche Varianten<br />
hochauflösend und laden sie auf spezielle<br />
iPads“, so Hauser.<br />
Weltweite Lichtsituationen reproduzieren<br />
Auch wenn bereits die ersten Erlkönige auf den<br />
Straßen unterwegs sind, ist die Arbeit in der<br />
VR-Abteilung nicht vorbei. Sollte beispielsweise<br />
ein Testfahrer in Skandinavien feststellen ,<br />
dass „irgendwo eine Spiegelung blendet“, setzen<br />
sich Hauser und sein Team in den VR-Raum<br />
und stellen die Lichtsituation zu der Zeit des<br />
Tests virtuell nach. Das funktioniere für jeden<br />
Ort der Welt, egal zu welcher Zeit. Ist das Lichtsetting<br />
um das entsprechende virtuelle Fahrzeug<br />
eingerichtet, beginnt die Suche nach dem<br />
Verursacher der Spiegelung, nach Möglichkeit<br />
wird gleich auch korrigiert.<br />
Zudem wird in der 3D-Visualisierung auch<br />
überprüft, ob ein Schalter eventuell vom Lenkrad<br />
verdeckt wird oder die Linienführung des<br />
Armaturenbretts unsauber wirkt. Dafür werden<br />
spezielle Augpunktansichten des Fahrers sowie<br />
48 standardisierte Kamerawinkel simuliert,<br />
die es auch erlauben, auf unterschiedliche<br />
Trends zu reagieren. In den USA möchten beispielsweise<br />
Frauen ihre Premiumfahrzeuge<br />
gerne mit flachen Schuhen fahren, am Ziel<br />
aber in High Heels aussteigen. Daher gibt es<br />
nun ein Staufach unter dem Sitz für das zweite<br />
Paar Schuhe. Ob dort genug Platz ist und wie<br />
das funktioniert, ertüftelt der CAD-Konstrukteur<br />
problemlos auch ohne VR, aber wie gut ist<br />
es einsehbar, wenn ich auf dem Fahrersitz sitze?<br />
Und was passt sonst noch da rein? Hier<br />
kommt der virtuelle Warenkorb zum Einsatz. Er<br />
umfasst all das, was der Fahrer gerne mit in<br />
sein Auto bringen würde und wofür er sich dort<br />
eventuell einen Platz wünschen könnte: Passen<br />
die neuesten Tablets und Smartphones in<br />
Fächer und Ablagen? Finden Golftasche oder<br />
Businessgepäck bequem Platz im Kofferraum?<br />
Für diese Schritte waren früher Prototypen und<br />
Testläufe nötig, heute stimmen die Designer<br />
sämtliche Details – von der Farbe der Sitzbezugnaht<br />
bis zum Grad der Mattierung der Radiosteuerung<br />
– im Vorfeld ab. So sind neben<br />
den klassischen Modell- und Ausstattungsvarianten<br />
auch länderspezifische Abweichungen<br />
einfach zu prüfen, etwa ob die die chinesische<br />
0,6-Liter-Wasserflasche in Vierkantform mit<br />
dem Getränkehalter kompatibel ist.<br />
Zudem kann die virtuelle Welt global aufgerufen<br />
werden, auch gleichzeitig: So stimmen sich<br />
Fahrzeugentwickler in virtuellen Meetings untereinander<br />
ab, während alle die gleiche 3D-Visualisierung<br />
vor sich haben. Dafür werden lediglich<br />
die Bewegungskoordinaten übertragen:<br />
Dreht ein Teilnehmer das Modell, sehen das<br />
die anderen Teilnehmer auf ihren Anlagen in<br />
Echtzeit.<br />
Daniel Hauser ist Projektleiter für Virtual<br />
Reality Visualisierung in der Interieurentwicklung<br />
bei Audi<br />
Was noch nicht geht: Menschen<br />
Gerne würden die VR-Experten auch Menschen<br />
in ihre Simulation einbauen. So könnte nicht<br />
nur überprüft werden, ob etwa die Wasserflasche<br />
in den Cupholder passt, sondern auch,<br />
wie gut sie von dort greifbar ist. Das Problem<br />
ist halb technisch, halb psychologisch bedingt:<br />
„In Zeichentrickfilmen sind animierte, sprechende<br />
Pinguine kein Problem, das Gehirn findet<br />
das so abstrakt, dass es sich einfach<br />
schnell daran gewöhnt. Je näher man aber der<br />
Realität kommt, desto eher fallen kleine Ungenauigkeiten<br />
auf und stören dann unterbewusst“,<br />
erklärt Hauser. Um eine Person perfekt<br />
zu visualisieren, müsste jedes Gelenk sowie<br />
die Elastizität der Haut berücksichtigt werden.<br />
Ein solches Modell – das wie ein VR-Wagen<br />
kaum von einem Foto zu unterscheiden ist –<br />
sei aktuell in Echtzeit noch nicht machbar, man<br />
arbeite aber daran. Die perfekte Simulation eines<br />
Wagens, ergänzt um einen nur annähernd<br />
gut visualisierten Menschen würde den Gesamteindruck<br />
stark beeinträchtigen. Daher verzichtet<br />
man bisher lieber ganz auf Menschen.<br />
Der Raum ist groß genug, um viele Meeting-Teilnehmer<br />
oder auch einen echten Wagen unterzubringen<br />
Bilder: Audi AG<br />
Ebenso will Audi langfristig weg von den Beamern,<br />
denn die matte Scheibe schluckt etwa<br />
50% des darauf projizierten Lichts, weshalb<br />
der Beamer überhaupt erst so stark sein muss.<br />
Künftig könnte man sich hier LED-Walls vorstellen,<br />
wie man sie von Großevents und Konzerten<br />
kennt. Allerdings müssten diese viel präziser<br />
ausgearbeitet sein. Die Technik nährt sich<br />
hier langsam der nötigen Pixelgröße an: „Wir<br />
haben hier derzeit etwa 1,3 Millimeter breite Pixel,<br />
aktuell am Markt verfügbare LED-Walls<br />
schaffen im besten Fall aber nur etwa 1,6 Millimeter“,<br />
so Hauser. Wenn der Pixel-Knackpunkt<br />
aber erreicht ist, könnte man mit einer LED-<br />
Wall brillantere Farben darstellen, da die schluckende<br />
Glasscheibe damit obsolet würde. Zudem<br />
wäre der Betrieb wesentlich stromsparender<br />
und eine neue Anlage einfacher zu installieren,<br />
der Raum hinter der Glaswand samt Klimatisierung<br />
würde dann ebenfalls überflüssig.<br />
IAA: Halle 3.1, Stand B15<br />
Audi AG<br />
Tel.: +49 841 89-762 261<br />
daniel.hauser@audi.de<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 47
CAD + SIMULATION<br />
Funktionale Prototypen aus dem 3D-Drucker<br />
FFF-Drucker aus der Open-Source-Bewegung bieten eine günstige Alternative zu teuren Sinterdruckern<br />
Der 3D-Druck ist in der Automobilindustrie seit Jahrzehnten eine<br />
etablierte Technologie – schon zu Zeiten der ersten Stereolithografieanlagen<br />
wurden Prototypen auf diese Weise hergestellt.<br />
Heute erobern die preiswerten FFF-Drucker die Konstruktionsabteilungen<br />
der Automobilhersteller und ihrer Zulieferer.<br />
Thomas Pazulla fertigt Prototypen in seinem<br />
Unternehmen „TP Technische Dienstleistungen“<br />
, darunter auch viele für die Automobilindustrie.<br />
Die Entscheidung, für die ersten Produktentwürfe<br />
vom Lasersintern auf 3D-Druck<br />
im Schmelzschichtverfahren FFF (Fused Filament<br />
Fabrication) zu wechseln, war nicht nur<br />
eine Kostenbetrachtung. „Die Teile sind verglichen<br />
mit den gesinterten Prototypen viel stabiler“,<br />
so Pazulla. Er druckt ausschließlich im<br />
Biokunststoff PLA, etwa eine komplette Türverkleidung<br />
in Originalgröße. „An dem Objekt befinden<br />
sich Haken, die sind vorher immer abgebrochen.“,<br />
vergleicht Pazulla die Verfahren.<br />
Die 1100 x 650 mm große Türverkleidung<br />
druckte der Unternehmer aus Geretsried in<br />
mehreren Teilen auf einem X400 von German<br />
Der Autor: Ralf Steck, freier Fachjournalist,<br />
für die German RepRap GmbH, Feldkirchen<br />
RepRap und klebte diese anschließend zusammen.<br />
Nach dem Verschleifen lassen sich die<br />
Nähte nur noch erahnen.<br />
„Der X400 arbeitet sehr maßgenau. Ich habe<br />
auf 200 Millimtern maximal vier bis fünf Hundertstel<br />
Millimeter Abweichung. Das genügt<br />
völlig“, so der Konstrukteur. Thomas Pazulla<br />
hat mit einem X400 3D-Drucker angefangen.<br />
Mittlerweile sind die Aufträge so zahlreich geworden,<br />
dass er einen kleinen X400 3D-Drucker-Park<br />
betreibt. Pazulla: „Meine Kunden<br />
wechseln von Lasersinterteilen zu 3D-Druck-<br />
Teilen aus PLA.“<br />
Lasersintern ist teuer<br />
Aktuell kommen zur Erzeugung von Prototypen<br />
aber vor allem noch Sinterdrucker zum Einsatz,<br />
die Pulvermaterial mit einem gezielt aufgesprühten<br />
Bindemittel oder einem Laserstrahl<br />
verfestigen. Diese Drucker erzeugen sehr genaue<br />
Objekte, mit einer – bei geringen Schichtdicken<br />
– sehr glatten Oberfläche. Der Nachteil<br />
dieser Drucker ist ihr Preis, sie sind sehr teuer.<br />
Geräte mit größerem Bauraum können bis über<br />
eine Million Euro kosten. Auch die in den Sin-<br />
terdruckern generierten Teile selbst sind relativ<br />
teuer, der Preis großer Teile kann mehrere tausend<br />
Euro betragen.<br />
Entsprechend begrenzt ist die Anzahl der Geräte<br />
auch bei großen Automotive-OEMs – und<br />
entsprechend lang die Wartezeit, bis ein Auftrag<br />
abgearbeitet werden kann. Das wirkliche<br />
Potential des 3D-Drucks und des Rapid Prototyping<br />
wird oft nicht ausgenutzt, weil die<br />
Wartezeiten zu lange und die Druckkosten zu<br />
hoch sind. Ein Ausweg, die begrenzten Kapazitäten<br />
der im eigenen Unternehmen vorhandenen<br />
3D-Drucker zu erweitern, sind spezialisierte<br />
Druckdienstleister wie Creabis – der Preis<br />
für den Druck der Prototypen liegt jedoch auch<br />
bei dieser Option sehr hoch.<br />
Open Source-Drucker für die Industrie<br />
FFF ist eine 3D-Drucktechnologie, bei der<br />
Kunststoffdraht in einer Düse aufgeschmolzen<br />
und in Lagen abgelegt wird, um so dreidimensionale<br />
Objekte zu erzeugen. Ist eine dieser<br />
Flächen beziehungsweise Schichten fertiggestellt,<br />
wird die Düse um einen vorher festgelegten<br />
Betrag nach oben gefahren und die<br />
nächste Schicht erzeugt. Die Schichten verschmelzen<br />
dabei zu einem Gesamtobjekt.<br />
Diese technisch relativ einfach umzusetzende<br />
Technologie ist heute in Form von Bausätzen<br />
und Fertiggeräten verfügbar, die überwiegend<br />
aus der Open Source-Bewegung RepRap entstanden<br />
sind. Diese Initiative hat zum Ziel, einen<br />
einfach zu bauenden 3D-Drucker zu ent-<br />
48 AutomobilKonstruktion 3/2015
Die im FFF-Verfahren gedruckten<br />
Teile von Thomas Pazulla sind stabiler<br />
und günstiger als Sinterdruckteile.<br />
Der verwendete Biokunststoff<br />
PLA erreicht einen<br />
E-Modul von etwa 4000 MPa<br />
Software – GRR arbeitet hier mit Simplify3D –<br />
geladen. Hier positioniert der Anwender das<br />
Modell im virtuellen Bauraum des Druckers<br />
und legt die Druckparameter fest – Schichtdicke,<br />
Druckgeschwindigkeit, Dichte der inneren<br />
Füllung und anderes. Die Slicer-Software<br />
berechnet auf Wunsch auch Supportstrukturen,<br />
die überhängende Bereiche des Modells<br />
abstützt.<br />
Der Name Slicer verrät es schon: Anschließend<br />
berechnet diese Software die Schichten – Slices<br />
– die der Drucker nacheinander abfährt.<br />
Resultat der Berechnung ist eine Druckdatei,<br />
die je nach Ausstattung des Druckers per USB,<br />
SD-Karte oder Netzwerk an den Drucker übermittelt<br />
wird. Natürlich hat der 3D-Druck wie jede<br />
andere Fertigungstechnik seine Vorteile und<br />
Einschränkungen, so sind sehr dünne Wandungen<br />
zu vermeiden, weil hier die Festigkeit unter<br />
dem schichtweisen Aufbau leidet.<br />
3D-Druckteile aus dem FFF-Drucker haben einen<br />
wichtigen Vorteil gegenüber gesinterten<br />
Teilen: Je nach Material sind die Teile elastischer<br />
und weniger bruchgefährdet. Das am<br />
meisten verbreitete Material im FFF-Druck ist<br />
PLA, ein Biokunststoff, der einen E-Modul von<br />
etwa 4000 MPa erreicht. Ebenfalls weit verbreitet<br />
ist ABS, das eine höhere Temperaturfestigkeit,<br />
aber auch eine größere Schwindung besitzt<br />
– das kann zu Problemen beim Druck oder<br />
bei der Maßhaltigkeit der Teile führen. Daneben<br />
existiert eine ganze Reihe eher exotischer<br />
Materialien von Nylon über metall- oder holzgefüllte<br />
Kunststoffe bis hin zu TPU93, einem<br />
flexiblen Material, oder Carbon 20, einem Filament<br />
mit 20% Kohlefaser-Anteil und entsprechenden<br />
Zugwerten.<br />
wickeln, der aus breit verfügbaren Teilen besteht<br />
und sich quasi selbst repliziert. Diese<br />
Open-Source-Technologie hat sich auch die<br />
German RepRap (GRR) GmbH zunutze gemacht<br />
und darauf aufbauend 3D-Drucker für industrielle<br />
Anwendung entwickelt. Mit seinem X400<br />
ist das Unternehmen in der Industrie zahlreich<br />
vertreten. Mit dem X1000 und seinem 1000 x<br />
800 x 600 mm großen Druckraum reagiert das<br />
Unternehmen auf die Anforderungen der Industriekunden,<br />
noch größere Objekte aus einem<br />
Stück oder mehrere Objekte in Serie zu<br />
drucken. Inzwischen sind FFF-Drucker ernstzunehmende<br />
Alternativen zu den teuren herkömmlichen<br />
Geräten.<br />
Basis des 3D-Druckvorgangs ist das 3D-Modell<br />
aus dem CAD-System. Dieses wird im STL-Format<br />
exportiert und in die sogenannte Slicer-<br />
Mit dem Open-Source-<br />
3D-Drucker X400 ist<br />
German RepRap in der<br />
Industrie bereits zahlreich<br />
vertreten<br />
Bilder: German RepRap<br />
Material für funktionstüchtige Prototypen<br />
Die Flexibilität in der Materialauswahl ist ein<br />
großer Vorteil von FFF 3D Druckern. Oft reicht<br />
ein Austausch des Extruders bzw. der Düse.<br />
Der Materialwechsel bei Lasersinteranlagen ist<br />
wesentlich aufwändiger, die Auswahl deutlich<br />
eingeschränkter. Zudem sind die Materialien<br />
im FFF-Bereich recht günstig, verglichen mit<br />
den Kosten, die in der Regel für das Druckmaterial<br />
im Bereich Lasersintern anfallen.<br />
Grund dafür ist auch, dass viele 3D Drucker<br />
kein proprietäres Filament erfordern, sondern<br />
Filamente verschiedener Anbieter verarbeiten<br />
können.<br />
Materialien wie Carbon-verstärkte Filamente<br />
oder TPU93 zeigen auch schon, dass es sich<br />
bei FFF-Teilen nicht nur um „Ansichtsexemplare“<br />
handeln muss, sondern durchaus auch<br />
funktionale Prototypen gefertigt werden können.<br />
Dichtungen, Gummiprofile oder Strukturteile<br />
lassen sich aus solchen spezialisierten<br />
Materialien fertigen und beispielsweise zu<br />
Funktions- und Passtests in ein Prototypenfahrzeug<br />
oder eine Vorserie einbauen. Auch<br />
die Größe des Bauraums ist keine Begrenzung,<br />
FFF-Teile lassen sich hervorragend verkleben<br />
und schleifen, so dass sich ein größeres Bauteil<br />
in mehreren Abschnitten drucken und dann<br />
zusammenfügen lässt.<br />
German RepRap GmbH<br />
Tel.: +49 89 / 24 88 986-0<br />
info@germanreprap.com<br />
TP Technische Dienstleistungen<br />
Tel.: +49 178 / 19 40 770<br />
thomaspazulla@alice-dsl.net<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 49
CAD + SIMULATION<br />
Perfekt geformt – Zeitersparnis im Formenbau<br />
Warum sich PSA Peugeot Citroën für die CAM-Software Hypermill entschieden hat<br />
Serge Locher (rechts) mit<br />
Jorge de Carvalho von<br />
Open Mind besprechen<br />
Bearbeitungsmöglichkeiten<br />
Allez, allez – für den Werkzeugund<br />
Formenbau des französischen<br />
Automobilherstellers PSA Peugeot<br />
Citroën läuft es rund. Für die Programmierung<br />
nutzt der Konzern<br />
seit Jahren das CAM/CAD-System<br />
Hypermill der Open Mind Technologies<br />
AG.<br />
Im elsässischen Werk in Mulhouse produziert<br />
PSA Aluminiumgießformen sowie Schmiedeund<br />
Tiefziehwerkzeuge. Den 270 Mitarbeitern<br />
steht dazu ein umfangreicher Werkzeugmaschinenpark<br />
zur Verfügung. Die stetig wachsenden<br />
und sich ändernden Anforderungen<br />
lassen sich nur über die kontinuierliche Verbesserung<br />
von Methoden und Werkzeugen erfüllen.<br />
Die Programmierung der Maschinen bildet<br />
da keine Ausnahme: Über Verbesserungen<br />
in der CAD-/CAM-Software lassen sich erhebliche<br />
Produktivitätsfortschritte realisieren.<br />
Der Autor: Michel Pech (Journalist, Machines Production,<br />
Boulogne Billancourt) für Open Mind, Weßling<br />
Test und Einführung einer CAM-Software<br />
PSA führte schon früh eine zentralisierte Programmierung<br />
der Werkzeugmaschinen ein. Eine<br />
wesentliche Aufgabenstellung war dabei<br />
von Anfang an, die Programmierung von sich<br />
wiederholenden Geometrien zu vereinfachen.<br />
„Zu diesem Zweck entwickelten wir eigene Makroanweisungen,<br />
die jedoch unabhängig von<br />
der damals genutzten CAD-/CAM-Software erstellt<br />
wurden“, erklärt Serge Locher, Programmierer<br />
bei PSA. „Mit der Weiterentwicklung der<br />
Software wurde die Integration der Makros<br />
aber immer schwieriger.“ Der eigentliche Nutzen<br />
einer makrobasierten Programmierung, die<br />
automatisierte Erstellung von NC-Programmen<br />
für wiederkehrende Aufgaben, ging schnell verloren.<br />
Das kostete viel Zeit und sehr viel Geld.<br />
Am Ende reichte das bis dahin verwendete<br />
CAM-System nicht mehr aus, um auch zukünftig<br />
eine einfache, flexible und zuverlässige Programmierung<br />
zu gewährleisten.<br />
Bei der Suche nach einer neuen Software kam<br />
Hypermill schnell in die engere Auswahl. Bereits<br />
die erste Testprogrammierung einer Gießform,<br />
die auf dem Bearbeitungszentrum DMG DMU80<br />
gefräst wurde, beeindruckte die CAM-Anwender.<br />
Letztendlich gaben laut PSA die leistungsstarken<br />
Strategien sowie die vielen Möglichkei-<br />
ten für eine automatisierte Programmierung den<br />
Ausschlag zugunsten des CAM/CAD-Systems<br />
von Open Mind. „Die intuitive Bedienerführung,<br />
die einfache und transparente Verwaltung<br />
selbst komplexer Vorgänge sowie die unkomplizierte<br />
Einbindung benutzerdefinierter Makroanweisungen<br />
– und deren Beibehaltung in späteren<br />
Versionen – überzeugten uns“, so Laurent<br />
Sifferlen, in der PSA-Werkgruppe verantwortlich<br />
für Werkzeuge und CAD-/CAM-Qualität. Serge<br />
Locher fügt hinzu: „Uns beeindruckte die hohe<br />
Qualität, mit der die Werkstücke von der Maschine<br />
kamen.“ In der nächsten Zeit fand man<br />
gemeinsam mit Open Mind den Ansatz, die<br />
kompletten NC-Programme mit Hypermill zu erstellen.<br />
„Wir konnten die Übernahme von CAD-<br />
Modellen aus CATIA automatisieren und stellten<br />
dabei fest, dass wir so alle Fehlerquellen bei<br />
der Automatisierung zum Beispiel von Bohrungen<br />
beseitigen konnten“, erklärt Serge Locher<br />
im Rückblick. Darüber hinaus fielen alle bisher<br />
notwendigen manuellen Eingaben weg. Mit diesen<br />
Erfahrungen fiel die Entscheidung für die<br />
ersten beiden Lizenzen leicht.<br />
Schulung und Betrieb<br />
Eine dreitägige Schulung der Programmierer<br />
bei PSA durch Open Mind zeigte, dass die<br />
50 AutomobilKonstruktion 3/2015
Serge Locher bei der<br />
Programmierung<br />
mit Hypermill<br />
Funktionalitäten der Software den erwarteten<br />
Nutzen brachten. „Wir konnten unsere Makroanweisungen<br />
für Bohr- oder Fräsarbeiten wieder<br />
verwenden und daraus direkt neue erstellen“,<br />
erklärt Serge Locher. Für Programmierer<br />
sei dies eine wesentliche Arbeitserleichterung<br />
und Zeitersparnis. Mehr als 150 solcher Makros<br />
wurden bisher mit Hypermill erstellt.<br />
Nach den Verbesserungen bei 2D-Fräsaufgaben<br />
wurde getestet, welche Vorteile Hypermill<br />
in der 3D-Bearbeitung kompletter Formen bieten<br />
könnte. Auch bei diesen Bearbeitungen<br />
übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen. Die<br />
Programmierung sollte daher auf weitere Maschinen<br />
ausgeweitet werden. Insbesondere bei<br />
NC-Programmen für Werkstücke auf Multifunktions-<br />
und Fräsdreh-Maschinen punktete Hypermill<br />
laut PSA unter anderem mit seinen leistungsstarken<br />
Simulationsfunktionen. Die Simulation<br />
wird aktuell schrittweise auf alle fünfachsigen<br />
Maschinen ausgeweitet. Gleichzeitig<br />
wird die Erstellung von Makros für eine automatisierte<br />
Programmierung fortgeführt. Derzeit<br />
tragen 547 Makroanweisungen zu einer reibungslosen<br />
Programmierung bei.<br />
Taschenfräsen mit Hypermaxx<br />
„Durch die Verwendung von Makros können<br />
wir schneller zu den grundlegenden Aufgaben<br />
übergehen und uns darauf konzentrieren, die<br />
Bearbeitung jedes Werkzeugs zu optimieren“,<br />
erklärt Serge Locher. Tatsächlich müssen die<br />
unterschiedlichen Optionen für die Bearbeitung<br />
beim Taschenfräsen getestet und nach<br />
den besten Parametern ausgewählt werden.<br />
Hier kommt mit Hypermaxx das High Performance<br />
Cutting Modul zum Einsatz. Das komplett<br />
in Hypermill integrierte Schruppmodul<br />
vereint optimale Fräswege, maximalen Materialabtrag<br />
und kürzestmögliche Fertigungszeiten.<br />
Ideal verteilte Fräsbahnen und eine dynamische<br />
Vorschubanpassung an die vorhandenen<br />
Schnittbedingungen sorgen dafür, dass<br />
immer mit der höchstmöglichen Vorschubgeschwindigkeit<br />
gefräst wird. „Mit Hypermaxx<br />
erzielen wir hervorragende Ergebnisse: Etwa<br />
30 Prozent Zeitersparnis bei einer gleichzeitig<br />
stark verringerten Abnutzung des Werkzeugs“,<br />
fasst Serge Locher zusammen.<br />
Beeindruckt zeigen sich die Programmierer<br />
bei PSA von der einfachen Umsetzung der<br />
Postprozessoren für jede Maschine. Da Postprozessoren<br />
programmierte Anweisungen in<br />
die richtige Sprache für jede Maschine entsprechend<br />
ihrer Kinematik übersetzen, stellen<br />
sie eine unerlässliche Schnittstelle zwischen<br />
Software und CNC-Maschine dar. „Seitdem<br />
wir mit Hypermill arbeiten sind wir sicher,<br />
dass die Werkstücke so von der Maschine<br />
kommen, wie wir sie programmiert haben“,<br />
betont Serge Locher. „Mittlerweile nutzen wir<br />
in unserem Werk in Mulhouse sechs Hypermill-Lizenzen.“<br />
IAA Peugeot: Halle 8, Stand D26<br />
Open Mind Technologies AG<br />
Tel.: +49 8153 933-500<br />
info@openmind-tech.com<br />
Mit Hypermaxx konnte die Bearbeitungszeit<br />
um 30 % reduziert werden<br />
Bearbeitung einer Form im PSA-Werk in Mulhouse<br />
Bilder: PSA<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 51
CAD + SIMULATION<br />
High Performance Computing On Demand<br />
Für CAE in allen Dimensionen<br />
Ob ein Produkt in Serie geht, entscheidet<br />
sich heute in Hochleistungsrechenzentren.<br />
Als einer der<br />
europaweit wenigen Anbieter von<br />
HPC-On-Demand-Rechenressourcen<br />
für Strömungs-, Struktur- und<br />
Crashsimulation ist sich die CPU<br />
24/7 GmbH sicher, dass der Trend<br />
zur Simulation weiter anhalten<br />
und den klassischen Prototypenbau<br />
in absehbarer Zeit ergänzen<br />
oder sogar verdrängen wird –<br />
denn die meisten Nutzer von On-<br />
Demand-Rechenressourcen müssten<br />
wirtschaftlich denken. Durch<br />
die rasante Entwicklung passender<br />
Technologien, Hardware und<br />
CAE-Software schlage die durch<br />
HPC beschleunigte computergestützte<br />
Entwicklung mittlerweile<br />
alle traditionellen Verfahren in<br />
punkto Ressourceneinsatz, insbesondere<br />
Zeit, Manpower und finanzielles<br />
Kapital.<br />
CPU 24/7 will mit strikt bedarfsorientierten<br />
Programmen nicht nur<br />
für die Großindustrie, sondern<br />
auch für kleine Ingenieurbetriebe<br />
passende und bezahlbare Rechenleistungsmodelle<br />
anbieten: Transparent,<br />
zeitnah, zielgenau und individuell.<br />
Sicherheit stehe dabei<br />
an oberster Stelle.<br />
www.cpu-24-7.com<br />
Bertrandt auf der IAA: Fahrdynamiksimulator und Gestensteuerung<br />
Fahrverhalten live erlebbar<br />
Fahrspaß pur verspricht der von<br />
Bertrandt weiterentwickelte Fahrdynamiksimulator.<br />
IAA-Besucher<br />
können ihr individuelles Fahrverhalten<br />
ganz nach ihren persönlichen<br />
Vorlieben live erleben – Fahrdynamikregel-<br />
und Fahrerassistenzsysteme<br />
inklusive.<br />
Eine Plattform trägt den Fahrersitzplatz<br />
mit Lenkrad und Pedalerie.<br />
Die Fahrumgebung wird auf<br />
drei Monitoren visualisiert. Ein<br />
Quadropod mit vier elektromechanischen<br />
Zylindern simuliert die<br />
Wirkungsweise darzustellen und<br />
die Auswirkungen verschiedener<br />
Abstimmungen und Regelstrategien<br />
subjektiv erlebbar zu machen.<br />
Durch die freie Modellierung<br />
der Fahrzeugumgebung lassen<br />
sich kritische Fahrzustände reproduzierbar<br />
nachstellen. Die Datenfusion<br />
von Fahrstilerkennung und<br />
Sensorik ermöglicht Fahrerassistenzsystemen,<br />
das individuelle<br />
menschliche Verhalten zu adaptieren<br />
und infolge die Akzeptanz des<br />
Anwenders für neue Technologien<br />
CarMaker-Produktfamilie in Version 5.0<br />
Virtuelle Fahrversuche leicht gemacht<br />
Für CarMaker, TruckMaker und MotorcycleMaker<br />
von IPG Automotive<br />
ist nun das Release 5.0 auf dem<br />
Markt. Damit lassen sich Softwarealgorithmen,<br />
Steuergeräte<br />
oder auch Gesamtfahrzeuge hinsichtlich<br />
ihrer Funktionsweise testen<br />
und optimieren. Insbesondere<br />
die Testanforderungen an Fahrerassistenzsysteme<br />
sollen nun einfacher<br />
realisiert werden können.<br />
Aber auch die Bereiche Fahrdynamik<br />
und Antriebsstrang wurden erweitert,<br />
so ist nun auch rekuperatives<br />
Bremsen möglich.<br />
Grundlegend überarbeitet wurde<br />
auch IPGRoad 5.0, etwa um aus<br />
ADAS RP Straßennetze inklusive<br />
Kreuzungen schnell und einfach<br />
zu importieren. Der TestManager<br />
hilft nun dabei, einfache Definition<br />
und Auswertung von Kriterien<br />
sowie bei der Erzeugung von Diagrammen.<br />
Zudem sind Euro NCAP-<br />
TestRuns nun auch in der Standardversion<br />
von CarMaker verfügbar.<br />
Die Reifenauswahl erfolgt mit<br />
dem Tire Data Set Generator. Auch<br />
die Visualisierung in IPGMovie ist<br />
nun noch realistischer und um viele<br />
Elemente ergänzt.<br />
www.ipg.de<br />
Bewegung in vier Freiheitsgraden<br />
– Nicken, Wanken, Huben und<br />
Gieren. Der im Vergleich zur ersten<br />
Version hinzugewonnene Freiheitsgrad<br />
des Gierens intensiviert<br />
das Fahrgefühl in dynamischen<br />
Manövern; die Bewegung um die<br />
Hochachse kann zum Beispiel ein<br />
Übersteuern abbilden. Zudem<br />
werden vier weitere Aktoren eingesetzt,<br />
die Anregungen im Frequenzbereich<br />
>10 Hz darstellen<br />
können. Diese bilden Einflüsse<br />
ab, die über die Fahrbahn, das<br />
Fahrwerk und die Lenkung in das<br />
Fahrzeug eingeleitet werden.<br />
Die Gesamtfahrzeug-Simulation<br />
mithilfe des Echtzeitsystems Car-<br />
Maker und Matlab/Simulink ermöglicht<br />
es, Fahrdynamikregelund<br />
Fahrerassistenzsysteme<br />
schnell zu implementieren, ihre<br />
zu steigern – beispielsweise, um<br />
den Fahrer an das automatisierte<br />
Fahren heranzuführen.<br />
Bertrandt hat zudem ein Bedienkonzept<br />
entwickelt, um die visuelle<br />
und manuelle Ablenkung des<br />
Fahrers zu reduzieren. Das Konzept<br />
b.Motion II basiert auf einem<br />
berührungslosen Gesten- und Anzeigekontrollsystem.<br />
Es ermöglicht<br />
dem Fahrer, Funktionen<br />
durch Handbewegungen zu steuern,<br />
ohne den Blick von der Straße<br />
abzuwenden. Ein Head-Up-Display<br />
(HUD) projiziert die Systemrückmeldungen<br />
auf die Windschutzscheibe.<br />
Ein 3-D-Motion-Sensor erfasst<br />
die Gesten, die dann auf<br />
Plausibilität geprüft und in Steuerbefehle<br />
umgewandelt werden.<br />
IAA: Halle 5.1, B20<br />
www.bertrandt.com<br />
52 AutomobilKonstruktion 3/2015
Das Stellen-Portal für Ihren Erfolg!<br />
DAS<br />
NEUE<br />
KARRIERE-<br />
PORTAL!<br />
Sind Sie auf der Suche<br />
nach …<br />
...einerneuenberuichenHerausforderung?<br />
...qualiziertenFach-undFührungskräften<br />
fürIhrUnternehmen?<br />
Dann nutzen Sie ab sofort die<br />
Vorteile von fachjobs24.de :<br />
Optimale Bewerberansprache und<br />
Jobsuchedurchzielgruppenspezische<br />
Branchen-Channels<br />
Einzigartiges, branchenübergreifendes<br />
Netzwerk<br />
Kompetente Beratung durch erfahrene<br />
Experten in allen Branchen<br />
Das innovative Stellenportal für User, Leser<br />
und Arbeitgeber<br />
37 Online-Partner, 31 Print-Partner, 1 Adresse!<br />
Die 6 Branchen-Channels auf fachjobs24.de<br />
Architektur<br />
und Design<br />
Industrie<br />
Handwerk<br />
Wissen<br />
Augenoptik<br />
Arbeitswelt<br />
Jetzt gleich neue Jobs finden oder inserieren: www.fachjobs24.de
AUS DER FORSCHUNG<br />
Simulationen vernetzen<br />
Co-Simulationen machen genauere Vorhersagen und binden auch reale Prüfstände mit ein<br />
Dank immer stärkerer Rechnerkapazitäten<br />
werden heute auch<br />
sogenannte Co-Simulationen<br />
möglich. Virtuelle Modelle eines<br />
Bauteils werden mit realen Fahrzeugkomponenten<br />
auf Prüfständen<br />
zusammen in Echtzeit getestet.<br />
Im österreichischen Graz entwickelt<br />
das Forschungszentrum<br />
Virtual Vehicle die Plattform Icos<br />
(Independent Co-Simulation). Forschungspartner<br />
AVL List übernimmt<br />
nun die weltweite Industrialisierung.<br />
Tobias Meyer ist freier Mitarbeiter der<br />
AutomobilKonstruktion<br />
Alle relevanten Systeme in einer<br />
Simulation zusammenführen, über Softwaregrenzen<br />
hinweg: Icos soll das möglich machen<br />
Im Automobilmarkt werden die Kombinationen<br />
von Motor- und Getriebevarianten immer vielfältiger,<br />
dazu kommen Sonderausstattungen<br />
und spezielle Karosserievariationen, etwa im<br />
Sportpaket. Für jede mögliche Kombination<br />
vollwertige Prototypen zu testen wäre ein immenser<br />
Aufwand. Im Wettbewerb um die innovativsten<br />
Fahrzeuge bieten Simulationsmodelle<br />
daher eine nicht mehr wegzudenkende Hilfe.<br />
Teils kann in der Konstruktionsphase schon<br />
gänzlich auf den Einsatz teurer Prototypen verzichtet<br />
werden. Denn der erste Prototyp steht<br />
meist erst nach 60% der Entwicklungszeit zur<br />
Verfügung. Bei fünf Jahren Entwicklungszeit<br />
hätte man die ersten drei Jahre so keinerlei Erfahrung,<br />
wie das Zusammenspiel der neuen<br />
Komponenten überhaupt funktioniert.<br />
Genau hier setzen Co-Simulationstechniken<br />
an: Sie führen einzelne Simulationsmodelle<br />
zusammen. Steht dann endlich auch der Prototyp<br />
einer Komponente (z.B. des Generators,<br />
der Wasserpumpe oder der ECU) zur Verfügung,<br />
wird das einzelne virtuelle Modell aus<br />
der Gesamtsimulation entfernt und durch den<br />
Prototypen auf dem Prüfstand ersetzt. Diese<br />
Daten kommen dann vom realen Bauteil, werden<br />
aber in das gleiche System eingespeist<br />
und mit den anderen, noch simulierten Werten<br />
in Beziehung gesetzt. Das Modell wird so<br />
Schritt für Schritt immer realer.<br />
Das Virtual Vehicle, Österreichs größtes K2-Forschungszentrum,<br />
beschäftigt sich seit Jahren<br />
mit virtuellen Modellen und neuen Methoden<br />
der Fahrzeugentwicklung. AVL List und Virtual<br />
Vehicle unterzeichneten nun eine Forschungsund<br />
Entwicklungspartnerschaft: Das Virtual Vehicle<br />
wird Icos (Independent Co-Simulation) in<br />
enger Zusammenarbeit mit AVL<br />
und anderen Industriepartnern<br />
weiter entwickeln, AVL übernimmt<br />
zudem die Industrialisierung<br />
und den weltweiten Vertrieb<br />
im Rahmen seiner Integrated<br />
Open Development Platform<br />
(IODP).<br />
Dabei wollte man OEMs bewusst<br />
nicht darauf drängen, ihre Simulationssoftware<br />
zu wechseln. Vielmehr war der<br />
Ansatz, dass der Kunde bei seinem bewährten<br />
Tools bleiben kann, diese aber besser vernetzt<br />
werden. Zudem können OEMs so auch Modelle<br />
von Zulieferern, die vielleicht wieder andere<br />
Software einsetzen, in die Gesamtsimulation<br />
ihrer Fahrzeuge integrieren.<br />
Am Anfang der Entwicklung stand eben dieses<br />
Problem, dass OEMs häufig unterschiedliche<br />
Software für verschiedene Simulationsfragen<br />
nutzten: Eine für Motorsimulation, eine weitere<br />
für das Thermomanagement und weitere für<br />
Mechanik oder Elektrik. Untereinander waren<br />
deren Schnittstellen häufig aber nicht kompatibel.<br />
Daher kam man auf die Idee, eine Open-<br />
Source-Anwendung zu programmieren, die den<br />
Datenaustausch zwischen unterschiedlichen<br />
Systemen ermöglicht. So kam man dem Gesamtmodell,<br />
das ein Auto in einer einzigen Simulation<br />
komplett virtuell abbildet, einen<br />
Schritt näher.<br />
Die erste Hürde war die Daten auf einen Nenner<br />
zu bringen. Da es hierfür keinen Standard<br />
gab, definierte man sich quasi eine Zentralsprache,<br />
in die alle Datenströme übersetzt werden.<br />
Inzwischen ist daraus der FMI-Standard<br />
(Function mockup interface) geworden, den<br />
heute viele Simulationstools direkt exportieren<br />
und importieren können. „Daher braucht man<br />
sich darüber heute keine Gedanken mehr machen,<br />
wichtiger ist inzwischen die Zeitsynchronisierung<br />
der Daten“, so Wolfgang Puntigam<br />
von AVL List. Denn verschiedene Modelle liefern<br />
zu unterschiedlichen Zeitpunkten Daten,<br />
bedingt durch die Ablaufgeschwindigkeit der<br />
Simulation: Je komplexer das System, desto<br />
träger wird die virtuelle Abbildung. Eine einfachere<br />
Komponente ist dann mit einem zu simulierenden<br />
Zyklus schon fertig, während die<br />
andere noch rechnet. Diese Zeitversätze zwi-<br />
54 AutomobilKonstruktion 3/2015
schen unterschiedlichen Modellen kompensiert<br />
die Icos-Plattform ebenfalls.<br />
Icos im Detail<br />
Icos basiert auf einer flexiblen Client-Server Architektur,<br />
wobei die verwendeten Simulationswerkzeuge auf<br />
beliebigen Rechnern im Netzwerk verteilt werden können.<br />
Über einen Remote Server wird auf dem jeweiligen<br />
Computer ein Rechenkern (Kernel) zur Steuerung des<br />
Datenaustausches und zur Synchronisation der Simulatoren<br />
aufgerufen. Mittels einer simulator-spezifischen<br />
Softwareschnittstelle (Wrapper) werden sowohl die<br />
Fernsteuerung der Werkzeuge als auch die notwendigen<br />
Datenkonversionen durchgeführt. Die Kommunikation<br />
zwischen Benutzerschnittelle (GUI), Remote Server,<br />
Kernel und Wrapper basiert auf TCP/IP.<br />
Komplexe Systeme verstehen<br />
Laut Helmut List, CEO von AVL List, geht an der<br />
Hybridisierung und Elektrifizierung des Antriebsstrangs<br />
in der Zukunft kein Weg vorbei:<br />
„Meiner Einschätzung nach werden im Jahr<br />
2020 bereits zwischen 15 und 20 Prozent aller<br />
Fahrzeuge mit dieser Technologie ausgestattet<br />
sein.“ Damit werden aber auch die Systeme<br />
unter der Haube immer komplexer, die Erfahrungen<br />
mit solchen Kombinationen sind noch<br />
rar. Auf Realtests will heute aber kaum noch jemand<br />
warten. Um etwa die künftigen Verbrauchs-<br />
und Emissionsvorschriften erfüllen zu<br />
können, muss bereits früh im Entwicklungsstadium<br />
erkannt werden, ob dies mit dem neu erdachten<br />
Fahrzeugkonzept überhaupt möglich<br />
ist. Auch hierbei kann die Co-Simulation sehr<br />
hilfreich sein, da auch auf explizite Fragestellungen<br />
hin simuliert werden kann.<br />
Ein Beispiel ist die Verbesserung der Lebensdauer<br />
eines Hybridantrieb-Akkus. Dafür muss<br />
dessen Temperatur durchgehend weniger als<br />
40 °C betragen. Diese Bedingung wird in der<br />
Simulation festgelegt. Ausgehend von der Gesamtsimulation<br />
Serienhybrid wird das Batteriemodell<br />
um das Temperaturverhalten in Abhängigkeit<br />
von Lade-/Entladestrom und –zeit erweitert.<br />
Über Detektion von Spannung, Innenwiderstand,<br />
Kapazität und<br />
Temperatur wird der Zustand<br />
der Batterie mitbetrachtet. Die<br />
Simulation zeigt: Der Lithium-<br />
Ionen-Speicher würde sich im<br />
Alleingang unter bestimmten<br />
Belastungen auf 70 °C erwärmen.<br />
Um einer beschleunigten<br />
Alterung entgegenzuwirken,<br />
wird eine Erweiterung um eine<br />
SuperCap vorgeschlagen. Und<br />
schon bleibt die Temperatur<br />
während des kompletten Real-<br />
Drive-Zykluses im gewünschten<br />
Bereich<br />
Ganz klar ist auch der Trend zu<br />
einer immer stärker werdenden Interaktion und<br />
Kommunikation des Fahrzeuges und damit des<br />
Antriebs mit der Umgebung, also mit anderen<br />
Fahrzeugen und mit der Infrastruktur. Wenn<br />
das Navigationssystem meldet, dass demnächst<br />
eine Bergetappe ansteht, kann der Lüfter<br />
das Kühlsystem bereits im voraus konditionieren<br />
und so einen starkes Kühlen am Ende<br />
der Etappe verhindern. Das kann energieeffizienter<br />
sein, aber welche Einspareffekte ergeben<br />
sich wirklich? Auch auf solche Fragestellungen<br />
kann eine Co-Simulation künftig Antworten<br />
liefern, denn auch die Umgebungsbedingungen<br />
können datentechnisch eingebunden<br />
werden.<br />
Icos im Einsatz<br />
Das klare Ziel des Forschungszentrums ist es,<br />
mit wissenschaftlichen und industriellen Partnern<br />
Systeme für den Markt zu entwickeln. Icos<br />
wurde beispielsweise bereits bei BMW zur Entwicklung<br />
von Assistenzsystemen für automatisiertes<br />
Bremsen eingesetzt. Mittlerweile wird<br />
das neue Bremssystem in Serie produziert. Virtual<br />
Vehicle Geschäftsführer Jost Bernasch:<br />
„Science2Market lautet die Devise, also Forschung<br />
erfolgreich in marktreife Innovationen<br />
umzuwandeln.“<br />
Das EU-Projekt „Configurable and Adaptable<br />
Trucks and Trailers for Optimal Transport“, kurz<br />
TRANSFORMERS, will die Transporteffizienz um<br />
bis zu 25% steigern. Lkw sind heute primär auf<br />
das maximale Ladegewicht ausgelegt. Genau<br />
hier setzt das Forschungsprojekt an: Die Lkw<br />
sollten auf Ihre aktuelle Transport-Anforderung<br />
konfigurierbar sein um deren Effizienz zu erhöhen<br />
und Emissionen zu reduzieren. Das Ziel<br />
sind modulare, hybride Antriebskonzepte einschließlich<br />
einer aerodynamisch angepassten<br />
und beladungsoptimierten Fahrzeugarchitektur.<br />
Geplant ist etwa auch eine Elektrifizierung<br />
Jost Bernasch (2. v. l.) von Virtual Vehicle und Helmut List (Mitte) von AVL<br />
unterzeichnen einen Vertrag zur Weiterentwicklung und Vermarktung von<br />
Icos, die am Forschungszentrum in Graz entstanden ist Bilder: Virtual Vehicle<br />
von Anhängern, die auch mit schon existierenden<br />
Lkw beliebig kombinierbar sind. Somit<br />
können auch „alte“ Lkw mit Verbrennungsmotor<br />
durch Hybrid-on-Demand aufgerüstet<br />
werden. Die Auslegung des Gesamtsystems erfolgt<br />
mit Icos.<br />
Die Forscher des EU-Projekts Epsilon konzentrieren<br />
sich auf die Entwicklung eines perfekt<br />
abgestimmten Antriebsstrangs für elektrische<br />
Leichtfahrzeuge. Es soll eine optimale Architektur<br />
von Komponenten wie E-Motor, Hochspannungsbatterie,<br />
Leistungselektronik, Motorsteuerung,<br />
mechanische Kraftübertragung und<br />
Thermomanagement entworfen werden. Das<br />
Ziel ist, ein möglichst ökologisches, sicheres<br />
und komfortables Elektro-Auto mit großer<br />
Reichweite zu entwickeln.<br />
Einem weiteren Problem widmet sich das vom<br />
Virtual Vehicle geleitete Projekt „iCOMPOSE“<br />
(Integrated Control of Multiple-Motor and Multiple-Storage<br />
Fully Electric Vehicles): In der Automobilindustrie<br />
werden einzelne Fahrzeugkomponenten<br />
und zugehörige Steuergeräte zumeist<br />
gesondert und teile-spezifisch entwickelt.<br />
Um eine optimale Energieeffizienz zu<br />
erreichen, muss jedoch in elektrischen Fahrzeugen<br />
die Integration und Interaktion aller<br />
Bausteine optimiert werden. Die Projektpartner,<br />
darunter die University of Surrey, Lotus<br />
Cars, Skoda, AVL, Infineon und Fraunhofer IVI<br />
entwickeln ein verbessertes Gesamtenergiemanagement,<br />
das erhöhte Reichweiten für<br />
Elektroautos verspricht. Dafür will man Energiemanagement,<br />
thermisches Management,<br />
Steuerung des Fahrverhaltens und der Fahrzeugdynamik<br />
intelligent in einem Überwachungssteuergerät<br />
zusammenlegen.<br />
IAA: Halle 4.1, Stand D07<br />
Virtual Vehicle<br />
Tel.: +43 664 88518030<br />
christian.santner@v2c2.at<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 55
AUS DER FORSCHUNG<br />
Groß in der Stadt<br />
Konzeptfahrzeug von ZF soll zeigen, welche Vorteile vernetzte Komponenten bieten<br />
Vorausschauendes Konzept: Für maximale Reichweite und Fahrsicherheit sorgt die cloudbasierte Fahrerassistenzfunktion<br />
Extrem wendig, lokal emissionsfrei<br />
sowie vernetzt mit Fahrer und<br />
Umwelt: Mit dem Smart Urban<br />
Vehicle zeigt ZF, welches Potenzial<br />
die intelligente Vernetzung einzelner<br />
Fahrwerk-, Antriebs- und<br />
Fahrerassistenzsysteme in sich<br />
trägt.<br />
„Mit dem Smart Urban Vehicle zeigt ZF, welche<br />
konkreten Lösungen für den städtischen Individualverkehr<br />
wir heute schon allein dadurch erzielen<br />
können, wenn bestehende Technologien<br />
und Systeme im Fahrzeug miteinander vernetzt<br />
werden, sie mit dem Fahrer, mit dessen Verhalten<br />
und mit der Umwelt interagieren oder sie<br />
auf Datenmaterial zugreifen lassen, das mittels<br />
Der Autor: Jürgen Goroncy ist freier Mitarbeiter<br />
der AutomobilKonstruktion<br />
Cloud Connectivity an jedem beliebigen Ort zur<br />
Verfügung steht“, erklärt Stefan Sommer, Vorstandsvorsitzender<br />
der ZF Friedrichshafen AG.<br />
„Gleichzeitig markiert diese Studie gewissermaßen<br />
auch einen Startpunkt, von dem aus<br />
sich die Konzepte für die urbane Mobilität der<br />
Zukunft sehr konkret weiterdenken lassen –<br />
auch im Hinblick auf die neuen Kompetenzfelder,<br />
die aus der Übernahme von TRW für den<br />
ZF Konzern erwachsen.“<br />
Komplett neu aufgebaut<br />
Das Smart Urban Vehicle wurde auf Basis eines<br />
Standard-Kleinwagens komplett eigenständig<br />
aufgebaut. Die Traktionsbatterie, die in insgesamt<br />
drei Modulen an der Vorder- und Hinterachse<br />
Platz findet, versorgt die zwei radnahen<br />
Elektromotoren an der Verbundlenker-<br />
Hinterachse mit Strom. Jede der zwei Antriebseinheiten<br />
entwickelt 40 kW Leistung, die Maximaldrehzahl<br />
beträgt 21 000 min -1 . So erreicht<br />
das grundsätzlich auf den innerstädtischen<br />
Verkehr ausgelegte Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit<br />
von 150 km/h.<br />
Wendig durch die Stadt<br />
„An der Vorderachse haben wir ein neues Konzept<br />
mit einem Einschlagwinkeln von bis zu 75<br />
Grad realisiert“, erklärt Harald Naunheimer,<br />
Leiter Forschung und Entwicklung bei ZF. Das<br />
Fahrwerkkonzept reduziert damit den Lenkaufwand<br />
bei Park- und Wendemanövern deutlich<br />
und erhöht damit vor allem die Wendigkeit des<br />
Kleinwagens: Dank des veränderten Radeinschlags<br />
verringert sich der Wendekreis-Durchmesser<br />
auf weniger als sieben Meter. Unterstützt<br />
werden die Lenkbewegungen an der Vorderachse<br />
vom Torque-Vectoring-System des<br />
Hinterachsantriebs, das die Antriebskraft individuell<br />
auf die beiden Hinterräder verteilt und<br />
das Anfahren bei derartig großen Radeinschlägen<br />
erst ermöglicht. Damit lässt sich das Konzeptfahrzeug<br />
auch in äußerst kleine Parklücken<br />
von etwa vier Metern Länge bequem in<br />
meist nur einem Zug manövrieren.<br />
Besonders deutlich werden die Vorzüge des<br />
neuen Vorderachskonzepts im Zusammenspiel<br />
mit der realisierten Fahrerassistenzfunktion<br />
Smart Parking Assist. Das System unterstützt<br />
56 AutomobilKonstruktion 3/2015
den Fahrer nicht nur bei der Erkennung passender<br />
Parkplätze, sondern kann den Wagen<br />
auch vollautomatisch längs oder quer zur<br />
Fahrtrichtung parken. Die Informationen bezieht<br />
der Parkassistent von zwölf Ultraschallsensoren<br />
und zwei Infrarotsensoren an Front-,<br />
Heck- und Längsseiten. Die Steuerelektronik<br />
verarbeitet die Informationen und regelt alle an<br />
der Parkfunktion beteiligten Systeme – beispielsweise<br />
den Elektroantrieb und den benötigten<br />
Lenkeinschlag der Elektrolenkung. Der<br />
Fahrer kann während des Vorgangs über das<br />
Display im Cockpit mit dem Fahrzeug interagieren<br />
oder die Parkfunktion erst nach dem Aussteigen<br />
mittels Applikation auf einem Mobile<br />
Device, z.B. einer Smart Watch, auslösen. Das<br />
Smart Urban Vehicle sucht danach selbständig<br />
in Schrittgeschwindigkeit die Umgebung nach<br />
der passenden Lücke ab und leitet den Parkvorgang<br />
selbstständig ein.<br />
Der Einschlagwinkel der Vorderräder ist die Basis<br />
für das Einpark-Assistenzsystem Bilder: ZF<br />
Fahrerfahrung aus der Cloud<br />
Für maximale Reichweite und Fahrsicherheit<br />
sorgt die cloudbasierte Fahrerassistenzfunktion<br />
PreVision Cloud Assist. Im Gegensatz zu<br />
rein GPS-unterstützten Systemen berücksichtigt<br />
dieses System Geometriedaten und Informationen<br />
zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit<br />
und speichert bei jeder Fahrt zusätzlich<br />
Daten zur Fahrzeugposition, aktuell gefahrenen<br />
Geschwindigkeit sowie Quer- und Längsbeschleunigung<br />
in der Cloud. Wird die Strecke<br />
erneut zurückgelegt, berechnet das System anhand<br />
dieser Erfahrungswerte und Daten die<br />
optimale Geschwindigkeit für eine nahende<br />
Kurve. Die Assistenzfunktion reguliert dann<br />
frühzeitig vor der Kurveneinfahrt das Drehmoment<br />
so, bis die Kurve ohne mechanischen<br />
Bremsvorgang gefahren werden kann. Das<br />
schont nicht nur Batterie und Bremssystem<br />
des Fahrzeugs, sondern sorgt auch für mehr Sicherheit<br />
gerade bei unübersichtlichen Kurven.<br />
Der Fahrer ist zu jeder Zeit über das Eingreifen<br />
von PreVision Cloud Assist informiert: Denn<br />
das multifunktionale Lenkrad verfügt im Lenkradkranz<br />
in der direkten Sichtachse des Fahrers<br />
über ein OLED-Display. Dieses zeigt zum<br />
Beispiel an, wie viel Antriebsmoment das Fahrerassistenzsystem<br />
vor Kurveneinfahrt wegnimmt<br />
– oder nach der Kurve wieder zur Verfügung<br />
stellt.<br />
IAA: Halle 8.0, Stand F20<br />
ZF Friedrichshafen AG<br />
Tel.: +49 7541 77-2488<br />
robert.buchmeier@zf.com<br />
Mehrsprachige<br />
Katalogproduktion<br />
www.konradinheckel.de<br />
Perfektes Projektmanagement bei hochkomplexen Aufträgen<br />
Tools für einen effizienten Workflow<br />
KUNSTSTOFF IN HÖCHSTFORM<br />
Für unsere anspruchsvollen Kunden erweitern wir in unseren<br />
hochmodernen Produktionsstätten Illertissen (D) und Györ<br />
(HU) immer wieder die Grenzen des Machbaren. Wir beraten<br />
Sie in der Werkstoffauswahl und der Optimierung Ihrer Konstruktionen.<br />
Fordern Sie uns! www.weiss-kunststoff.de<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 57
FAHRWERK<br />
Bremsen ohne Quietschen<br />
Magneto-mechanische Dämpfung soll Geräuschentwicklung von Bremsscheiben reduzieren<br />
Eine der häufigsten Mängelproblematiken<br />
für Automobilhersteller<br />
ist Lärm in Form von quietschenden<br />
Bremsen. Dieses Geräusch<br />
entsteht durch hochfrequente<br />
Vibrationen bei der Reibung<br />
von Bremsbelägen und<br />
Bremsscheiben. Eine Dämpfung<br />
der Resonanzfrequenzen der<br />
Bremskomponenten, die sowohl<br />
durch ein aktives Dämpfungssystem<br />
als auch durch eine Materialdämpfung<br />
erreicht werden können,<br />
reduziert oder eliminiert die<br />
Geräusche.<br />
Materialdämpfung betrifft die interne Reibung,<br />
die in Reaktion auf die Vibrationsbelastung<br />
entsteht. Einer der Materialdämpfungsmechanismen,<br />
die interne Reibung durch die Bewegung<br />
magnetischer Domänen erzeugen, ist die<br />
magneto-mechanische Dämpfung (MMD).<br />
Nicht alle Werkstoffe weisen Magneteigenschaften<br />
auf, aber ferromagnetische Materialien<br />
wie Eisen, Kobalt und Nickel sowie paramagnetische<br />
Materialien wie Aluminium und<br />
Titanium tun es. Wenn die magnetische Domänenstruktur<br />
und die Ausrichtung dieser Teile<br />
entsprechend angepasst wird, finden Veränderungen<br />
in den Domänenwänden statt und es<br />
entsteht interne Reibung, die magneto-mechanische<br />
Dämpfung erzeugt. Obwohl MMD sich<br />
gut für Grauguss-Bremsscheiben eignet, wurde<br />
bislang nur wenig Aufwand investiert, dieses<br />
Phänomen weiter zu untersuchen und es für eine<br />
Reduzierung der Bremsgeräusche zu nutzen.<br />
2012 nutzten Rassini und die University of<br />
Windsor diese Forschungslücke für eine Partnerschaft.<br />
Ziel der Zusammenarbeit ist die gemeinsame<br />
Entwicklung von Methoden, um mit<br />
Hilfe von magnetischen und elektrischen Prozessen<br />
die magneto-mechanische Dämpfung<br />
für Bremsscheiben zu verbessern und zu opti-<br />
Der Autor: Mauricio Gonzalez, Engineering Director bei<br />
Rassini, Plymouth, Michigan, USA<br />
mieren. Dabei sollte ein Vergleich aller verfügbaren<br />
Verfahren dabei helfen, die wichtigen<br />
Prozessvariablen zu verstehen und eine möglichst<br />
kostengünstige Dämpfung zu entwickeln.<br />
Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurde 2014<br />
ein Gerät entwickelt, welches ein Signal erzeugt,<br />
das für ein optimales Spektrum der Prozessvariablen<br />
sorgt und so die Dämpfung konstant<br />
verbessert.<br />
Materialeigenschaften und Mikrostruktur<br />
Bisher konnten je nach Werkstoff Verbesserungen<br />
bei der Dämpfung zwischen 10 und 45%<br />
erzielt werden. Zudem stellte sich heraus, dass<br />
die Verbesserung der Dämpfung durch MMD<br />
stark von der Materialmikrostruktur und den<br />
Materialeigenschaften abhängt. Andere Variablen<br />
umfassten die Chemie des Produktes, die<br />
Mikrostruktur, die Graphitgröße und –verteilung,<br />
die Perlitlamellen, die Legierungen und<br />
die eutektische Zellgröße. Jede dieser Variablen<br />
wurde einzeln untersucht, um die beste<br />
Struktur für eine maximale Verbesserung der<br />
Dämpfung zu finden.<br />
Zusätzlich wurden Geräuschtests auf Rollenprüfständen<br />
durchgeführt, bei denen die Fre-<br />
quenz und die Amplitude<br />
des Quietschens<br />
gemessen wurde. So<br />
konnte sichergestellt<br />
werden, dass die Verbesserung<br />
der Dämpfung<br />
auch tatsächlich<br />
in einer Verringerung<br />
des Lärms resultiert.<br />
Die Endergebnisse<br />
zeigen, dass bei Teilen,<br />
mit denen eine<br />
Dämpfungsverbesserung von mehr als 30% erzielt<br />
werden konnte, 95% der auftretenden Geräusche<br />
eliminiert wurden. Selbst bei Teilen<br />
mit geringeren Verbesserungen ließ sich immerhin<br />
eine Lärmreduktion von bis zu 70% erreichen.<br />
Prototyp soll 2016 in Serie gehen<br />
Das Gerät zur Erzeugung des optimalen Signals<br />
ist ein Prototyp, der noch weiterentwickelt und<br />
umfangreichen Labortests unterzogen wird.<br />
Sobald alle Prozessparameter optimiert sind,<br />
soll es Ende 2016 in Produktion gehen. Auch<br />
wenn mit diesen Ergebnissen bereits erhebliche<br />
Fortschritte gemacht wurden, bleiben<br />
Bremsgeräusche ein wichtiger Forschungspunkt<br />
für Automobilhersteller und -zulieferer.<br />
Das gilt sowohl für die Weiterentwicklung bestehender<br />
als auch für die Entwicklung neuer<br />
Technologien, mit dem Ziel, dem Kunden eines<br />
Tages so gut wie geräuschfreie Bremsen zu<br />
präsentieren.<br />
Rassini USA<br />
Tel.: +1 734 454-4904<br />
bfriedrich@rassini.com<br />
Magnetische Domänen,<br />
aufgenommen mit einem<br />
Magnetkraftmikroskop<br />
Bild: Rassini<br />
58 AutomobilKonstruktion 3/2015
Einrohr-Stoßdämpfer im Jaguar XE<br />
Flexibles und dynamisches Fahrwerkskonzept<br />
ENGINEERING<br />
CAMPUS<br />
Jaguar Land Rover setzt die<br />
leistungsfähige Fahrwerks -<br />
technologie von Tenneco in<br />
der Sportlimousine XE ein.<br />
Wie das US-amerikanische Unternehmen Tenneco<br />
mitteilt, sollen die leichten Einrohr-Gasdruckstoßdämpfer<br />
des Fahrzeugs durch eine<br />
innovative Ventiltechnik eine<br />
hervorragende Fahrzeugstabilität<br />
und ein überzeugendes<br />
Fahrverhalten ermöglichen.<br />
Durch das spezielle<br />
Design ergeben sich mehr<br />
Montagemöglichkeiten, ein<br />
stärkeres potenzielles<br />
Dämpfungsniveau und eine<br />
bessere Reaktion im Vergleich<br />
zu Zweirohr-Stoßdämpfern.<br />
Jaguar gibt an, dass das<br />
Fahrwerk des neuen XE 20<br />
% steifer sei als bei früheren<br />
X-Modellen. Dies gebe<br />
den Konstrukteuren mehr<br />
Flexibilität, um die ideale<br />
Balance zwischen Fahrkomfort<br />
und Straßenlage zu<br />
schaffen.<br />
„Wir freuen uns sehr, unsere<br />
Einrohr-Ventiltechnologie<br />
als Fahrweksmerkmal in<br />
den Jaguar XE<br />
mit seiner modernen Advanced-Aluminium-Architektur<br />
integrieren zu können“,<br />
sagte Sandro Paparelli,<br />
Vice President und General<br />
Manager, Fahrwerkstechnik<br />
Europa. „Ebenso wie bei<br />
Jaguar ist es auch unser<br />
Ziel, Leichtbau-Lösungen zu<br />
entwickeln, die sich positiv<br />
auf die Fahrzeugdynamik<br />
und den Fahrkomfort auswirken<br />
und gleichzeitig dazu<br />
beitragen, den Kraftstoffverbrauch<br />
und den<br />
CO2-Ausstoß zu senken.“<br />
Passive Federung<br />
Leichte Einrohr-Stoßdämpfer mit der Ventiltechnologie<br />
von Tenneco bieten verbesserte<br />
Abstimmungsmöglichkeiten, eine direktere Reaktion<br />
sowie eine konsistente und strapazierfähige<br />
Dämpfung. Geringe Dämpfungskräfte<br />
können im Rückfederungs- und Kompressionsmodus<br />
unabhängig voneinander eingestellt<br />
werden. Das System hat zudem im mittleren<br />
bis hohen Geschwindigkeitsbereich eigenständig<br />
den Abblase-Schwellwert<br />
und die Progressionsrate<br />
der Dämpfung angepasst. In<br />
diesem Punkt unterscheidet<br />
sich das Ventildesign von<br />
Standard-Einrohrventilen,<br />
bei denen der Schwellwert<br />
für die Dämpfkraft und die<br />
Progressionsrate voneinander<br />
abhängen. Tenneco verwendet<br />
bei der Herstellung<br />
von Einrohr-Stoßdämpfern<br />
eine hochpräzise Prozesstechnologie<br />
einschließlich<br />
individueller Krafteinstellung<br />
und Laserschweißtechnik.<br />
IAA: Halle 5.1, Stand A20<br />
www.tenneco.com<br />
Leichte Einrohr-Stoßdämpfer<br />
bieten Konstrukteuren mehr<br />
Montagemöglichkeiten<br />
Bild: Tenneco<br />
PERSPEKTIVEN DER<br />
PRODUKTENTWICKLUNG<br />
Fokus:<br />
Wie sieht<br />
erfolgreiches<br />
Systems<br />
Engineering<br />
aus?<br />
22.09.2015,<br />
Mövenpick<br />
Hotel Stuttgart<br />
Alle Informationen zum<br />
1. Fachkongress finden Sie auf<br />
www.engineering-campus.de<br />
Jetzt<br />
anmelden!
FAHRWERK<br />
Elastomer-Fahrwerkslager simulativ ausgelegt<br />
Wie beeinflusst eine Geometrieänderung die Federkonstante?<br />
Links: Zylinderkoordinatensystem mit radial-ausgerichteter Vernetzung<br />
Rechts: Gute Übereinstimmung zwischen Versuch und Simulation<br />
Elastomer-Fahrwerkslager bestimmen<br />
maßgeblich das elastische<br />
Verhalten des Fahrwerks. Weiterhin<br />
halten sie Körperschall von<br />
der Fahrgastzelle fern und dämpfen<br />
Schwingungen. Sie tragen unmittelbar<br />
zum Fahrkomfort und<br />
zur Fahrsicherheit bei. Die TU<br />
Bergakademie Freiberg hat sich<br />
nun in einer Simulation damit beschäftigt,<br />
wie Geometrieänderungen<br />
die Federkonstanten von Fahrwerkslagern<br />
beeinflussen. So sollen<br />
z.B. Querlenkerlager exakt auf<br />
ihre Anforderung hin optimiert<br />
werden können.<br />
Der Autor: Daniel Willenborg, M.Eng.,<br />
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für<br />
Maschinenelemente, Konstruktion und Fertigung<br />
der TU Bergakademie Freiberg<br />
Elastomerwerkstoffe kommen zum Beispiel<br />
dort zum Einsatz, wo eine große Dämpfung<br />
und kleine Steifigkeit benötigt wird. „Die starke<br />
Temperatur-, Frequenz- und Amplitudenabhängigkeit<br />
des Materialverhaltens bedingt<br />
große Komplexität bei der Bauteilauslegung.<br />
Ein passendes Materialmodell sowie sinnvolle<br />
Strategien bei der Parameteridentifikation sind<br />
daher zwingend erforderlich. Die Optimierung<br />
von Elastomer-Fahrwerkslagern bedarf einer<br />
ausgewogenen Kombination von experimentellen<br />
und simulativen Methoden. Ziel der Untersuchungen<br />
ist z.B. gewesen, den Einfluss von<br />
Geometrieänderungen auf die Federratenverhältnisse<br />
zu zeigen. Zudem ließ sich die Frequenz-<br />
und Temperaturabhängigkeit des Materialverhaltens<br />
sehr gut verdeutlichen.<br />
Vorüberlegungen<br />
Am Anfang muss entschieden werden, ob sowohl<br />
Steifigkeits- als auch Dämpfungseigenschaften<br />
optimiert werden sollen. Außerdem<br />
können Versuche an Bauteil- oder Normproben<br />
als Grundlage verwendet werden, um die Materialparameter<br />
zu identifizieren. Das Ziel ist,<br />
durch Geometrievariationen die Federkonstanten<br />
und somit auch die Federkonstanten-Verhältnisse<br />
zu verändern. Die Dämpfungseigenschaften<br />
werden hier vernachlässigt. Die Materialdaten<br />
werden durch Bauteilversuche be-<br />
stimmt und die Materialeigenschaften durch<br />
hyperelastische Modelle angenähert.<br />
Bauteilversuche und Parameteridentifikation<br />
Für den Exzenterprüfstand des Instituts für Maschinenelemente,<br />
Konstruktion und Fertigung<br />
an der TU Freiberg wurden zwei Versuchsaufbauten<br />
entwickelt, die es erlauben, das dargestellte<br />
Elastomer-Fahrwerkslager in einer<br />
Achse axial (Scherschubspannung) und torsional<br />
(Torsionsschubspannung) zu belasten.<br />
Die Grenze für die Versuchsparameter sind seitens<br />
des Prüfstands 25 Hz Versuchsfrequenz<br />
und 10 mm Hub. Mittels Triangulationslaser<br />
und Kraftmessdose werden Weg- und Kraft-<br />
Zeitverläufe aufgenommen. Per Thermoelement<br />
wird die Oberflächentemperatur des Elastomers<br />
erfasst. Aus den sinusförmigen Kraftund<br />
Wegsignalen kann pro Belastungszyklus<br />
eine Hystereseschleife ermittelt werden. Die<br />
Mittelung mehrerer Schleifen über einen Zeitintervall<br />
mit annähernd konstanter Temperatur<br />
ermöglichen eine genaue Ermittlung des Bebzw.<br />
Entlastungszeitverlaufs. So können bei einem<br />
Langzeitversuch durch die Eigenerwärmung<br />
für verschiedene Temperaturen Aussagen<br />
über die mechanischen Eigenschaften<br />
getroffen werden.<br />
Zur Parameteridentifikation wird der obere Teil<br />
der Hysterese, der Belastungszyklus, verwen-<br />
60 AutomobilKonstruktion 3/2015
Durch die unterschiedlich starken<br />
Einflüsse von Gummibreite, -dicke<br />
und Innenradius auf die betrachteten<br />
Federsteifigkeiten lassen sich<br />
die Federsteifigkeitsverhältnisse<br />
unabhängig voneinander einstellen<br />
det. Durch elementare kontinuumsmechanische<br />
Beziehungen lässt sich daraus eine<br />
Spannungs-Dehnungskurve approximieren.<br />
Mit Hilfe der Lösungsmethoden für nichtlineare<br />
Ausgleichsprobleme werden die Parameter des<br />
hyperelastischen Materialmodells angepasst.<br />
Geometrievarianten in der Simulation<br />
In einer kommerziellen Finite-Elemente (FE)-<br />
Software lässt sich ein Kraft-Weg-Verlauf mit<br />
verschiedenen natürlichen Randbedingungen<br />
hinsichtlich der resultierenden Verschiebung<br />
auswerten. Es können mehrere hyperelastische<br />
Materialmodelle erprobt und gute Übereinstimmungen<br />
erzielt werden. Das Neo-Hookean-Materialmodell<br />
bietet einen guten Kompromiss<br />
zwischen Rechenzeit und Genauigkeit,<br />
weswegen es für alle weiteren Berechnungen<br />
Versuchsrandbedingungen: Außen fest eingespannt und Lasteinleitung an der Innenhülse<br />
verwendet wird. Das Lager erhält in der FE-Simulation<br />
an der Außenhülse eine fixierte Lagerung<br />
und alle Belastungen (Axialkraft F A = 1 kN,<br />
Querkraft F Q = 1 kN, Torsionsmoment<br />
M t = 10 Nm) werden an der Innenhülse aufgebracht.<br />
Aufgrund der zylindrischen Bauteilform<br />
ist eine radialausgerichtete Vernetzung<br />
empfehlenswert. Auch wenn das FE-Modell aus<br />
verschiedenen Materialien besteht, sollten Unstetigkeitsstellen<br />
im Netz vermieden werden,<br />
um Konvergenzschwierigkeiten zu entgegenzuwirken.<br />
Durch parametrisierte 3D-CAD-Modelle können<br />
verschiedene Geometrievariationen hinsichtlich<br />
ihres Einflusses auf die Federkonstanten untersucht<br />
werden. Variiert worden sind dabei Gummibreite<br />
und Gummidicke. Weiterhin ist in einer<br />
dritten Variation ein Radius an der Innenhülse<br />
des Lagers angebracht worden. Bezüglich der<br />
Simulation ist der Ausgangszustand der Geometriedaten:<br />
Gummibreite 16 mm, Gummidicke<br />
8 mm, Innenradius 0 mm.<br />
Ergebnisse nach Geometrieänderung<br />
·Die Vergrößerung der Gummibreite bewirkt<br />
einen Anstieg der Federkonstanten in allen<br />
Belastungsrichtungen. Am stärksten ist dabei<br />
die Querfederkonstante beeinflussbar, gefolgt<br />
von der Axial- und Drehfederkonstante.<br />
·Bei Erhöhung der Gummidicke sinken alle Federkonstanten.<br />
Die Querfederrate zeigt die<br />
höchste Sensitivität.<br />
·Alle Federkonstanten sinken mit der Zunahme<br />
des Innenradius ab. Dreh- und Querfederkonstante<br />
zeigen bezüglich dieses Geometrieparameters<br />
die größte Empfindlichkeit.<br />
Die Geometrievariationen haben unterschiedlichen Einfluss auf die Veränderung der Federkonstanten<br />
Bilder: TU Freiberg<br />
TU Bergakademie Freiberg<br />
Tel.: +49 3731 393855<br />
daniel.willenborg@imkf.tu-freiberg.de<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 61
FAHRWERK<br />
Neuentwicklung des Schmiermittels<br />
Reibungsreduziertes Untersetzungsgetriebe für elektrische Servolenkungen<br />
NSK hat ein reibungsreduziertes<br />
Untersetzungsgetriebe für elektrische<br />
Servolenkungen (EPS) entwickelt.<br />
Das Getriebe verbessere<br />
nach Herstelleraussage die Interaktion<br />
zwischen Fahrer und Fahrzeug<br />
und reduziere den Kraftaufwand,<br />
den der Fahrer beim Lenken<br />
aufwenden muss. Es schaffe so die<br />
Voraussetzung für sehr sanfte, präzise<br />
Lenkkorrekturen bei Geradeausfahrt<br />
sowie für erhöhten Komfort<br />
beim Rückstellen der Lenkung<br />
aus großen Einschlagwinkeln, etwa<br />
beim Abbiegen.<br />
Um ein gutes Lenkgefühl mit hohem<br />
Lenkkomfort zu erhalten, sind<br />
aus Sicht des Fahrers ein sanftes<br />
Ansprechen der Lenkung beim Beginn<br />
der Lenkradumdrehung sowie<br />
ein ebenso sanftes Rückstellen des<br />
Lenkrads erwünscht. Die innere<br />
Reibung des EPS – vor allem die<br />
des Untersetzungsgetriebes – sei<br />
laut NSK ein Schlüsselfaktor. Daher<br />
habe man ein neues Schmiermittel<br />
entwickelt, das die Reibung des<br />
Untersetzungsgetriebes weiter reduziert<br />
und damit den nötigen<br />
Kraftaufwand für die Betätigung<br />
des Lenkrades verringert. Die spezielle<br />
Additivierung des neuen<br />
Schmierfettes unterbinde einen<br />
Anstieg der Viskosität. Dies führt<br />
dazu, dass sich der Schmierfilm an<br />
den Eingriffsflächen der Zahnräder<br />
bildet und die Reibung des Untersetzungsgetriebes<br />
um 17% reduziert<br />
wird. Außerdem werde das<br />
Feedback verbessert, das die Lenkung<br />
dem Fahrer vermittelt.<br />
Der Kraftstoffverbrauch werde laut<br />
NSK durch elektrische Servolenkungen<br />
reduziert, da der Servoantrieb<br />
– im Vergleich zur Hydraulik –<br />
nur Energie benötigt, wenn er die<br />
Lenkung tatsächlich unterstützt.<br />
NSK wird diese Technik ab 2017 in<br />
Serien-EPS verwenden.<br />
www.nskeurope.de<br />
Mehrphasenstahl aus der AHSS-Familie<br />
Leichtbaustahl für Fahrwerksanwendungen<br />
Tata Steel hat eine neue Stahlsorte<br />
speziell für den Fahrwerks- und<br />
Aufhängungsbereich entwickelt:<br />
HR CP800-UC, einen warmgewalzten,<br />
hochfesten Komplexphasenstahl.<br />
Die Neuentwicklung basiert<br />
auf der Kundenanforderung nach<br />
einem Stahl, der sowohl hochfest<br />
als auch formbar ist und gleichzeitig<br />
Gewicht im Fahrwerk einspart –<br />
eine Kombination, die herkömmliche<br />
hochfeste Stählen nicht bieten.<br />
Bei herkömmlichen HSS-Stählen<br />
verschlechtert sich bei einer höheren<br />
Festigkeit ihre Umformbarkeit,<br />
was zu Problemen in der Fertigung<br />
komplex geformter<br />
Chassis-Komponenten<br />
führt. Der<br />
neue HR<br />
CP800-UC von Tata<br />
Steel ist daher ein<br />
Mehrphasenstahl aus der<br />
AHSS-Familie, der sich besser<br />
umformen lässt. Der Stahl könne<br />
laut Tata vor allem weiter gedehnt<br />
werden, ohne dass er splittert<br />
oder reißt – bei gleicher Festigkeit.<br />
Die feinkörnige bainitische<br />
Matrix-Mikrostruktur erhöhe laut<br />
Tata die Ermüdungsbeständigkeit<br />
und führt zu einer Zugfestigkeit<br />
von etwa 800 MPa.<br />
HR CP800-UC erfüllt sowohl die<br />
Spezifikationen von Euronorm<br />
(HCT780C) und dem VDA<br />
(HR660Y760T-CP). Der Leichtbau-<br />
Fahrwerksstahl ist zunächst in Abmessungen<br />
von 2,5 bis 4,7 mm Dicke<br />
und in einer Breite von bis zu<br />
1650 mm erhältlich; Tata Steel will<br />
das Abmessungsfenster aber weiter<br />
vergrößern.<br />
www.tatasteel.com<br />
Bis -55 °C elastisch oder +80 °C verschleißfest<br />
Lkw-Luftfedern für extreme Temperaturen<br />
Lastwagen und Sattelzüge kommen<br />
verstärkt in Regionen zum<br />
Einsatz, in denen besonders heiße<br />
oder kalte Umgebungstemperaturen<br />
vorherrschen. Für seine<br />
Kunden in der Nutzfahrzeugerstausrüstung<br />
hat ContiTech deshalb<br />
zwei neue Luftfedertypen auf den<br />
Markt gebracht: Die Serie Arktis<br />
für besonders kalte Gebiete und<br />
Hi-Temp-Luftfedern für hohen Temperaturen.<br />
Die wichtigste Grundlage für die<br />
kältebeständigen Luftfedern ist<br />
die spezielle Kautschukmischung.<br />
Mit der neuen Luftfederung seien<br />
Lkws für Temperaturen bis -55 °C<br />
gewappnet. Kunden können die<br />
neue Luftfeder an dem markanten<br />
Schneeflockensymbol erkennen.<br />
In extrem heißen Regionen sehen<br />
die Anforderungen an Luftfedern<br />
in Nutzfahrzeugen ganz anders<br />
aus. Höhere Umgebungstemperaturen<br />
und extreme Witterungseinflüsse<br />
wie Ozon und UV-Strahlung<br />
beschleunigen den Verschleiß. Die<br />
Einbaubedingungen im Fahrzeug<br />
können diesen Prozess weiter verschärfen:<br />
Besonders die Nähe zur<br />
Abgasanlage des Fahrzeuges sorgt<br />
für eine höhere Temperaturbelastung.<br />
Selbst bei gemäßigten klimatischen<br />
Bedingungen nehme<br />
deshalb die Abnutzung des Kautschuks<br />
enorm zu. Daher hat Conti-<br />
Tech die Hi-Temp-Luftfeder entwickelt.<br />
Sie beruht auf einer Mischung<br />
mit Chloropren-Kautschuk<br />
(CR) als Hauptkomponente und ist<br />
mit dem Symbol einer Sonne gekennzeichnet.<br />
Tests zeigten laut<br />
Conti, dass die neue Luftfeder bei<br />
Temperaturen von 80 °C die doppelte<br />
Lebensdauer gegenüber einem<br />
Standardprodukt aufweist.<br />
IAA: Halle 5.1, Stand A02<br />
www.contitech.de<br />
62 AutomobilKonstruktion 3/2015
SKF im Koenigsegg Regera<br />
Radlagereinheiten für den Hybrid-Herrscher<br />
SKF beliefert die Koenigsegg Automotive<br />
AB mit Radlagereinheiten<br />
für die Vorder- und Hinterräder<br />
des Supersportwagens Regera,<br />
der im März dieses Jahres auf dem<br />
Genfer Autosalon vorgestellt wurde.<br />
Dazu Jean-Sylvain Migliore, Manager<br />
Racing Automotive Market bei<br />
SKF: „Natürlich ist die Entwicklung<br />
von Komponenten für den Motorsport<br />
und rennstreckenorientierte<br />
Serienfahrzeuge eine Herausforderung.<br />
Allerdings macht es auch<br />
riesig Spaß, die Lager so auszulegen,<br />
dass sie den extremen Anforderungen<br />
im Rennsport gewachsen<br />
sind und den Kunden absolut<br />
zufrieden stellen. “<br />
Der Regera bietet eine Kombination<br />
aus Kraft, Fahrverhalten und<br />
Luxus. Trotz moderner Technik<br />
und des hohen Komforts ist der<br />
Regera verhältnismäßig leicht und<br />
sei damit voll für die Rennstrecke<br />
geeignet. Auf der Autobahn dürfte<br />
man den über 1800 PS starken Hybrid-Boliden<br />
eher selten zu Gesicht<br />
bekommen – und das liegt<br />
nicht nur daran, dass von diesem<br />
Auto lediglich 80 Exemplare in<br />
Handarbeit gebaut werden: Da er<br />
in zwölf Sekunden von 0 auf<br />
300 km/h beschleunigt, würde<br />
man den Regera ohnehin schnell<br />
wieder aus den Augen verlieren.<br />
www.skf.com<br />
22. – 24. September 2015<br />
Messe Stuttgart<br />
DISCOVER YOUR VISIONS<br />
Organised by<br />
Parallelveranstaltung COMPOSITES EUROPE<br />
www.hybrid-expo.com<br />
Tickets sind gültig für beide Veranstaltungen.
KAROSSERIE + INTERIEUR<br />
Bedienung, bitte!<br />
Automatisiert fahrende Autos wollen anders bedient sein<br />
Die Bedienflächen im Lenkrad kommunizieren per Bluetooth direkt mit den angeschlossenen externen Geräten. Bilder: Valeo<br />
Die im September 2013 geschlossene<br />
Entwicklungskooperation<br />
zwischen Valeo und Safran bündelt<br />
Kompetenzen wie die Bild -<br />
verarbeitung (Safran) und die<br />
Kameratechnik (Valeo). Ziel sind<br />
bis Ende des Jahrzehnts marktfähige<br />
Techniken für hochautomatisiertes<br />
Fahren samt einem passenden<br />
Bedienkonzept.<br />
Der Autor: Hartmut Hammer, freier Mitarbeiter<br />
der AutomobilKonstruktion<br />
Ein 2015 vorgestellter automatisiert fahrender<br />
Prototyp bietet nach Angaben von Valeo als<br />
weltweit erstes Fahrzeug automatisiertes Fahren<br />
auf Stufe 4. Technische Basis sind ein Lidarsensor,<br />
vier Radarsensoren und fünf Kameras.<br />
Sie füttern diverse Assistenzsysteme, die<br />
das System bereits zu automatisierten Stadtund<br />
Autobahnfahrten befähigen sollen. Da<br />
dann der Fahrer nicht mehr die automatisierte<br />
Fahrt überwachen, bei Störungen aber jederzeit<br />
die Kontrolle übernehmen muss, ist eine<br />
Fahrer-Zustandserkennung integriert. Diese<br />
Software zur Gesichtserkennung stammt von<br />
Safran. Sie ist mit mehr als 200 gängigen Kameras<br />
kombinierbar und überprüft das Gesicht<br />
anhand von mehr als 100 definierten Merkmalen<br />
und Messpunkten.<br />
Schlüsselelement Bedienkonzept<br />
Die Fahrererkennung hat zentrale Bedeutung<br />
bei „Mobius“, einem neuen Bedien- und Ver-<br />
netzungskonzept von Valeo speziell für automatisiert<br />
fahrende Automobile der Level 2 bis<br />
4. Bei diesen automatisierten Fahrstufen muss<br />
der Fahrer am Ende automatisierter Fahrtperioden<br />
wieder das Kommando übernehmen. Damit<br />
dieser sicherheitskritische Übergang sicher<br />
und schnell gelingt, spielt laut Valeo das optimale<br />
„Look&Feel“ der Mensch-Maschine-<br />
Schnittstelle eine große Rolle. Denn man hat<br />
die Gewohnheiten und Vorlieben der Autofahrer<br />
genau analysiert. Beispielsweise wollen sie<br />
in automatisierten Fahrphasen am liebsten<br />
E-Mails abfragen, telefonieren und die gewohnten<br />
internetbasierten Dienste nutzen. Die<br />
Antwort von Mobius lautet: unkomplizierte Integration<br />
des Smartphones oder Tablets mit<br />
drahtlosen Schnittstellen wie WiFi, Chromecast<br />
oder Airplay in die Car-IT. Dies beschleunigt<br />
nicht nur den Zugriff auf die Funktionen, sondern<br />
bietet auch den gewohnten Funktionsumfang.<br />
64 AutomobilKonstruktion 3/2015
2015 wird ein zweiter OEM die dreidimensionale Einparkdarstellung in Serie bringen<br />
System die vier Kameras, den Prozessor und<br />
die dazugehörige Bildverarbeitungs-Software.<br />
Mittelfristig (2017) sollen elektronische Rückspiegel<br />
die außen an der Karosserie angebrachten<br />
Spiegel ersetzen und so durch aerodynamische<br />
Verbesserungen laut Valeo bis zu<br />
1,3 g CO 2 pro Kilometer einsparen. Technisch<br />
entsprechen die kamerabasierten Systeme von<br />
Valeo und Safran der geplanten Neufassung<br />
der ECE R46, die ab 2016 den Ersatz der konventionellen<br />
Spiegel durch elektronische Kamerasysteme<br />
ermöglichen wird.<br />
Nur etwas später (2018) könnte eine Inertial-<br />
Messeinheit in Serie gehen, die Safran aus der<br />
Wehrtechnik und Luftfahrt für das Automobil<br />
adaptiert hat. Sie nutzt neueste mikroelektromechanische<br />
Sensorik (MEMS-Technik) und<br />
soll mit einer Toleranz von wenigen Millimetern<br />
als redundantes System die Position bestimmen,<br />
falls Tunneldurchfahrten oder Häuserschluchten<br />
die GPS-Ortung beeinträchtigen.<br />
Zweitens wünschen sich die Autofahrer eine ergonomisch<br />
optimale Darstellung der<br />
Smartphone-Inhalte. Mobius präsentiert die<br />
Inhalte deshalb auf einem großen, frei konfigurierbaren<br />
Cockpitdisplay direkt vor dem Fahrer.<br />
Dafür hat man das Lenkrad etwas verkleinert<br />
und nach unten gerückt.<br />
Drittens hält es Valeo für vorteilhaft, die Hände<br />
auch bei automatisierten Fahrphasen möglichst<br />
am Lenkrad zu belassen. Folgerichtig<br />
wird bei Mobius die IT mit zwei links und<br />
rechts im Lenkrad angebrachten Bedienflächen<br />
per Touch- und Tasterfunktion gesteuert.<br />
Status optisch angezeigt<br />
Damit der Fahrer immer über den aktuellen<br />
Fahrzustand Bescheid weiß, wechselt die Cockpitgrafik<br />
jeweils komplett. So leuchtet beim<br />
manuellen Fahren eine konventionelle Instrumentenlandschaft<br />
im Cockpit auf. Bei automatisierter<br />
Fahrt hingegen wechselt die Farbe<br />
und die wichtigsten Fahrfunktionen wandern<br />
links und rechts an den Displayrand. Zentral<br />
werden dann die gewünschten Infotainmentfunktionen<br />
angezeigt und per Bedienflächen<br />
im Lenkrad dirigiert.<br />
Sobald das System den Fahrer zur Übernahme<br />
des Fahrzeugs auffordert, wechselt die Cockpitgrafik<br />
wieder und der Fahrer hat optimalerweise<br />
die Hände bereits am Lenkrad. Valeo<br />
verspricht sich dadurch eine minimale Reaktionszeit<br />
und weniger Ablenkung als bei einem<br />
in der Mittelkonsole platzierten Infotainment-<br />
Bildschirm.<br />
Aus Sicherheitsgründen werden die Daten der Rückspiegel-Kameras<br />
mit den Signalen von Radarsensoren fusioniert<br />
Kamera statt Spiegel<br />
Entscheidende Mithilfe bei automatisierten<br />
Fahrten bieten einige Assistenzfunktionen, die<br />
Valeo und Safran entweder schon in Serie gebracht<br />
haben oder bringen werden. Als erstes<br />
Kooperationsprodukt ging 2014 die dreidimensionale<br />
Ansicht des Fahrzeugs beim Einparkvorgang<br />
im VW Passat in Serie. Diese Birdview-<br />
Ansicht stellt den Passat – je nach Wunsch des<br />
Fahrers von vorne, von der Seite oder von hinten<br />
dar. Valeo und Safran liefern für dieses<br />
IAA Valeo: Halle 8.0, Stand A35<br />
Valeo<br />
Tel.: +33 1 40 55 21 75<br />
presse-contact.mailbox@valeo.com<br />
Safran<br />
Tel.: +33 1 40 60 84 40<br />
service-presse.safran@safran.fr<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 65
KAROSSERIE + INTERIEUR<br />
Low-Emission Schaumdichtung für saubere Luft<br />
Wenn es noch keine gesetzlichen Vorschriften gibt, definieren sich die Hersteller eigene Standards<br />
Weil wir heute sehr viel Zeit im Auto verbringen,<br />
legen die Autohersteller besonderen Wert<br />
auf die optimale Ausgestaltung des Fahrzeuginnenraums.<br />
Und das nicht nur in puncto Bequemlichkeit<br />
und Bedienerfreundlichkeit, sondern<br />
auch, was die Luftqualität und Emissionsarmut<br />
und damit die Gesundheit der Autoinsassen<br />
betrifft.<br />
Durch die Verwendung von Materialien mit<br />
möglichst geringen Emissionen können zu hohe<br />
VOC-Belastungen der Luft in Fahrzeuginnenräumen,<br />
die oft Irritationen von Augen, Nase,<br />
Rachen und der Haut oder allergische Wirkungen<br />
erzeugen, vermieden werden. Leichtflüchtige<br />
organische Verbindungen, bekannt unter<br />
dem Sammelbegriff Volatile Organic Compound<br />
(VOC), können langsam an die Oberfläche<br />
von Kunststoffbauteilen diffundieren und<br />
so an die Luft gelangen. Dabei handelt es sich<br />
z.B. um Begleitstoffe wie zum Beispiel Lösemittel,<br />
Weichmacher, Stabilisatoren, Lösungsvermittler,<br />
Antioxidationsmittel oder Additive,<br />
die nicht immer fest in die Molekülstruktur von<br />
Kunststoffen oder Klebern eingebunden sind.<br />
Saubere Luft im Auto: Sonderhoff erfüllt die herstellereigenen Low-Emission-Normen von Daimler (DBL5452-13),<br />
GM/Opel (GMW15634, GMW60326, GMW3235-B, GMW60271), BMW (PA-C 325) und VW/AUDI (VW50180, PV3925,<br />
PV3015)<br />
Die Weiterentwicklung von emissionsarmen<br />
Polyurethanschäumen<br />
ist bei Sonderhoff schon länger<br />
ein Thema. Inzwischen stehen<br />
Schaumdichtungen zur Verfügung,<br />
die den Grenzwertanforderungen<br />
fast aller Automobilhersteller entsprechen.<br />
Daimler etwa bestätigte<br />
dem Dichtungsspezialisten aus<br />
Köln, dass die Dichtung Fermapor<br />
K31-A-45CO-1-G-LE die herstellereigenen<br />
Liefervorschrift DBL<br />
5452-13 zur Einhaltung der Zielwerte<br />
von VOC-Emissionen und für<br />
das Foggingverhalten erfüllt.<br />
Vermehrter Einsatz von Low-Emission Materialien<br />
im Autobau<br />
Beim Einsatz der falschen Werkstoff sind üblicherweise<br />
im Autoinnenraum – gemessen an<br />
der Fläche der verbauten Bauteile – mehr<br />
Emissionen vorhanden als am Arbeitsplatz im<br />
Büro. Und deshalb sollten die Grenzwerte der<br />
Konzentration organisch flüchtiger Substanzen<br />
der Luft im Auto deutlich unter den in Gebäuden<br />
akzeptierten Werten liegen.<br />
So können VOCs in der Luft unter anderem dazu<br />
führen, dass ein von Experten als Fogging<br />
bezeichneter Effekt entsteht. Fogging (Vernebelung)<br />
ist ein physikalischer Effekt, der sich<br />
nicht gänzlich verhindern lässt. Rußpartikel,<br />
Staub- und/oder Aerosolteilchen in der Luft<br />
bewegen sich dabei aus warmen in kältere Zonen<br />
und scheiden sich dort ab. Beim Auto<br />
kann das zu einem Beschlagen der Windschutzscheibe<br />
oder der Innenseite der Scheinwerfer<br />
führen. Im Extremfall könnte dadurch<br />
die Verkehrssicherheit der Autofahrer beeinträchtigt<br />
werden. Weil es aber gesetzliche<br />
Grenzwerte für die Summe der in der Innenraumluft<br />
vorliegenden VOC-Bestandteile derzeit<br />
noch nicht gibt, legen die Autohersteller in<br />
Der Autor: Florian Kampf, Teamleiter Marketing/PR bei<br />
Sonderhoff Chemicals, Köln<br />
Um dem Fogging vorzubeugen, müssen VOCs in der<br />
Innenluft niedrig gehalten werden<br />
66 AutomobilKonstruktion 3/2015
ihren Liefervorschriften werkseigene Low-Emission-Zielwerte<br />
fest.<br />
Fast alle in der Fahrgastzelle verbauten Kunststoffe,<br />
mit denen die Autoinsassen während<br />
der Fahrt in Kontakt kommen, bestehen mittlerweile<br />
aus Low-Emission-Materialien, wie etwa<br />
Sitzausschäumungen, Armaturenbrett- und<br />
Lenkradbeschichtungen, Türinnenverkleidungen,<br />
Sonnenschutzblenden oder Schaltknäufe.<br />
In der letzten Zeit schenken die Autobauer<br />
auch den in Innenräumen von Fahrzeugen verbauten<br />
kleineren Teilen stärkere Beachtung,<br />
wie zum Beispiel den Schaumdichtungen. Da<br />
gerade dort ein sauberes, möglichst allergenfreies<br />
Raumklima ohne Geruchsbelästigung<br />
vorherrschen soll, achtet der Dichtungsspezialist<br />
Sonderhoff Chemicals aus Köln darauf,<br />
dass der Anteil von VOCs und lösemittelhaltigen<br />
Stoffen in den Dichtungsprodukten so gering<br />
wie möglich ist.<br />
Schaumdichtung für Low-Emission Anforderungen<br />
Die Low-Emission Schaumdichtungssysteme<br />
von Sonderhoff erfüllen die in den herstellereigenen<br />
Normen definierten Zielwerte für weichelastische<br />
offenzellige Polyurethanschaumstoffe.<br />
So entspricht zum Beispiel die von Sonderhoff<br />
entwickelte Low-Emission Polyurethanschaumdichtung<br />
Fermapor K31-A-45CO-<br />
1-G-LE den in der Daimler-Liefervorschrift DBL<br />
5452–13 für formgeschäumte weichelastische<br />
Schaumstoffe auf Polyurethanbasis festgelegten<br />
Zielwerten. Sie liegen für die VOC-Emission<br />
bei 100 μg und für das Foggingverhalten bei<br />
250 μg pro Gramm Polyurethan. Damit lässt<br />
sich eine Luftbelastung des Fahrzeuginnenraums<br />
mit VOCs deutlich reduzieren.<br />
Die Emissionswerte werden von unabhängigen<br />
Institutionen nach den Normen VDA 278 im Zusammenhang<br />
mit Thermodesorption (VOC,<br />
Fogging) und VDA 275 betreffend Formaldehyd-<br />
Emission bestimmt. Hierbei wird das Ausdampfen<br />
leichtflüchtiger organischer Bestandteile<br />
bei niedrigen Temperaturen in Form des<br />
VOC-Wertes gemessen als auch das Ausdampfen<br />
schwerflüchtiger Bestandteile bei hohen<br />
Temperaturen, ausgedrückt durch den FOG-<br />
Wert. Kunststoffe und eben auch Dichtungen<br />
dürfen selbst bei extremen Temperaturen, wie<br />
sie im Fahrzeuginneren bei direkter Sonneneinstrahlung<br />
im Sommer oft vorherrschen, kei-<br />
Sonderhoff fertigt z.B. auch Dichtungen für Lüftungsund<br />
Klimasysteme, die für die Umwälzung der Innenluft<br />
verantwortlich sind<br />
Bilder: Sonderhoff<br />
ne Schadstoffe ausstoßen, die ab einer bestimmten<br />
Menge eine Gesundheitsgefährdung<br />
hervorrufen könnten. Die Minimierung von<br />
Emissionen wird über die Auswahl der Materialrohstoffe<br />
erreicht.<br />
Saubere Luft im Auto<br />
Weil die Medizin erkannt hat, dass VOC-Emissionen<br />
häufig die Auslöser von Atembeschwerden<br />
oder Kontaktallergien sein können, werden<br />
auch in Zukunft Produkte aus Low-Emission-Materialien<br />
weiter an Bedeutung gewinnen.<br />
Die wachsende Anzahl an Allergikern in<br />
Deutschland, mittlerweile über 25%, wird deshalb<br />
als potenzielle Käufergruppe gerade von<br />
den Autoherstellern mit Angeboten für ein allergengetestetes<br />
Fahrzeuginneres umworben.<br />
Ford zum Beispiel bewirbt seit 2004 als einer<br />
der ersten Autohersteller das allergengetestete<br />
Fahrzeuginnere seiner Autos mit einem speziellen<br />
TÜV-Zertifikat. Die besonders bei den<br />
Autoherstellern und deren Zulieferern nachgefragten<br />
Low-Emission Dichtungsprodukte<br />
von Sonderhoff leisten ihren Beitrag, den Fogging-Effekt<br />
und VOC-Belastungen der Luft im<br />
Autoinneren zu reduzieren. Saubere Luft im<br />
Fahrzeug wird auch deshalb ein wichtiges Thema<br />
bleiben, da das Auto für die Mobilität von<br />
Morgen seine Bedeutung nicht so schnell verlieren<br />
wird.<br />
Sonderhoff Holding GmbH<br />
Tel.: +49 221 95685-0<br />
f.kampf@sonderhoff.com<br />
Sind Sie auf der Suche<br />
nach einer geeigneten<br />
Befestigung?<br />
Wir sind Ihr<br />
Spezialist!<br />
Wir sind auf Befestigungen aus<br />
Kunststoff, Metall und Federstahl<br />
spezialisiert und beliefern weltweit<br />
die Zulieferer der Automobilindustrie.<br />
Besuchen Sie uns<br />
einfach unter:<br />
www.ims-verbindungstechnik.com<br />
Robert-Bosch-Straße 5<br />
74632 Neuenstein<br />
Telefon: 0049 (0)7942 9131-0<br />
Fax: 0049 (0)7942 9131-52<br />
E-Mail: info@ims-verbindungstechnik.com
KAROSSERIE + INTERIEUR<br />
Diskutierten beim Roundtable in München: Christian Reinhard (Head of HMI, Elektrobit), Manuel Perez Prada (Creative Director, Designagentur Ziba) und<br />
Prof. Dr. Ansgar Meroth (Professor für Informatik und Informationssysteme im Kfz, Hochschule Heilbronn)<br />
Bilder: Elektrobit<br />
„Idiotensicherheit schafft Idioten“<br />
Die größten noch zu lösenden Probleme des autonomen Fahrens liegen<br />
beim Nutzer und sind eher psychologisch bedingt<br />
Selbstfahrende Autos sind derzeit<br />
das heißeste Eisen jeder automobilen<br />
Entwicklungsabteilung,<br />
Probleme bereiten aber nicht<br />
Technik oder Gesetzgebung, sondern<br />
die Akzeptanz des Nutzers.<br />
Auf einem Roundtable von Elektrobit<br />
diskutierten Experten nun,<br />
wie sich das in den Griff bekommen<br />
lassen könnte.<br />
Der Autor: Tobias Meyer, freier Mitarbeiter<br />
der AutomobilKonstruktion<br />
Rein technisch wäre das autonome Fahren<br />
längst möglich: Google hat seine fahrerlosen<br />
Fahrzeuge bereits auf über 1,5 Mio. Kilometer<br />
gebracht, ein von Delphi ausgestatteter Audi<br />
fuhr 5600 Kilometer zu 99 % autonom von San<br />
Francisco nach New York, und Nissan will<br />
nächstes Jahr auf Japans Autobahnen fahrerlos<br />
unterwegs sein, die japanischen Städte will<br />
man bis 2020 erobern.<br />
Eindösen oder den Sitz nach hinten drehen<br />
wird dem Fahrer dennoch so schnell nicht erlaubt<br />
werden: Laut dem Wiener Verkehrsabkommen<br />
von 1968 muss der Fahrer immer<br />
die Kontrolle über das Fahrzeug haben. Bis<br />
dieser Passus fällt, wird es nach Expertenansicht<br />
noch dauern, das autonome Fahren<br />
wird daher nur schrittweise erlaubt werden.<br />
Computer zeigt Mensch, wo er noch üben muss<br />
Wenn dem Fahrer immer mehr Aufgaben im<br />
Wagen abgenommen werden, fehlt ihm irgendwann<br />
die Routine. Bekannt ist das Phänomen<br />
heute bereits in der Luftfahrt, wo der Autopilot<br />
so viel übernommen hat, dass der echte Pilot<br />
zusätzlich in den Simulator muss, um nicht aus<br />
der Übung zu kommen. Manuel Perez Prada,<br />
Kreativdirektor der Designagentur Ziba, beschreibt<br />
diese Problem prägnant: „Idiotensicherheit<br />
schafft Idioten.“ Der Designer hilft Autobauern,<br />
Bedienelemente zu entwickeln, die<br />
dem Problem entgegenwirken. Der Computer<br />
könnte dabei überprüfen, wie fähig der Fahrer<br />
ist, wenn er selbst fährt und so aufzeigen, wo<br />
er Schwächen hat. Augenscanner könnten<br />
überwachen, ob der Fahrer noch wach genug<br />
ist, um im Notfall eingreifen zu können.<br />
Vertrauen durch Information<br />
Ansgar Meroth, Professor für Informatik und Informationssysteme<br />
im Kfz an der Hochschule<br />
Heilbronn, berichtet ebenfalls über neue Ängste,<br />
die im bisherigen Fahrerlebnis nicht vorkamen:<br />
Etwa, dass sich der Fahrer während der<br />
computergesteuerten Fahrt nicht an Radio oder<br />
Klimasteuerung traut, da er fürchtet, dadurch<br />
in die automatische Fahrsteuerung einzugreifen<br />
und dort einen Fehler verursachen könnte.<br />
Zudem muss der Kunde dem System vertrauen,<br />
sonst kauft er es nicht. „Ich habe selbst mehrere<br />
Anläufe gebraucht, um bei einem Test mit<br />
120 km/h auf eine Mauer zuzufahren. Der Kollege<br />
sagte zwar, der Computer kenne die Mauer,<br />
ich habe dennoch mit einer Vollbremsung<br />
eingegriffen“, erzählt Meroth. Ein mögliche Lösung<br />
dafür ist, dem Fahrer mitzuteilen, was<br />
das Auto gerade tut. Das kann z.B. über ein<br />
Head-up-Display erfolgen, auf dem eine erkannte<br />
Gefahr – etwa spielende Kinder – frühzeitig<br />
angezeigt wird. So weiß der Fahrer, dass<br />
sein Wagen die Situation im Griff hat.<br />
Auch wenn das Auto besser reagiert, als das<br />
ein Mensch je könnte – menschliches Versagen<br />
ist die häufigste Unfallursache – und die<br />
Unfallstatistik mit zunehmender Automatisierung<br />
daher nach Ansicht der Experten höchstwahrscheinlich<br />
einen Abwärtstrend einschlagen<br />
würde, stünde nach einem Unfall wohl<br />
dennoch im Gewissen des Fahrers die Frage:<br />
Wäre das vielleicht nicht passiert, wenn ich<br />
das Steuer selbst in der Hand gehabt hätte?<br />
IAA: Halle 4.0, Stand E31<br />
Elektrobit Automotive GmbH<br />
Tel.: +49 9131 / 7701-0<br />
sales.automotive@elektrobit.com<br />
68 AutomobilKonstruktion 3/2015
Brose auf der IAA 2015<br />
Die künftige Generationen multifunktionaler Innenräume<br />
„Competence for Tomorrow’s Mobility“<br />
lautet das Motto von Brose<br />
auf der IAA 2015. So zeigt der Mechatronikspezialist<br />
anhand einer<br />
vollständig elektrifizierten Sitzplattform,<br />
wie er sich künftige Generationen<br />
multifunktionaler Innenräume<br />
vorstellt: komfortabel<br />
und individuell einstellbar, dabei<br />
konsequent dem Leichtbaugedanken<br />
folgend.<br />
Die Vorteile eines Gesamtsystems<br />
im Sitzbereich demonstriert Brose<br />
mit einer innovativen Sitzplattform.<br />
Damit stellt der Zulieferer<br />
erstmals einen Fahrzeuginnenraum<br />
mit vollständig elektrifizierter<br />
erster, zweiter und dritter Sitzreihe<br />
vor: Alle Verstellebenen lassen<br />
sich komplett fernsteuern –<br />
beispielsweise per Smartphone-<br />
App. Der Fahrer kann so den kompletten<br />
Innenraum anpassen – je<br />
nachdem, ob eine halbe Fußballmannschaft<br />
oder Material aus<br />
dem Baumarkt transportiert werden<br />
soll. Einstellungen lassen sich<br />
nach persönlichen Vorlieben vornehmen<br />
und abspeichern, was<br />
nach Aussage von Brose maximale<br />
Individualisierung ermögliche.<br />
Auch der Trend zu übersichtlicheren<br />
Interieurs kommt zum Tragen:<br />
Ein neues Schienenkonzept für<br />
die Sitzlängsverstellung sorge dafür,<br />
dass Fahrzeuginnenräume<br />
hochwertig und aufgeräumt anmuten.<br />
Zudem entsteht so deutlich<br />
mehr Beinfreiheit für die Fondpassagiere.<br />
Brose zeigt mit seinem Seitentürantrieb<br />
zudem eine neue Lösung<br />
für den Fahrzeugzugang. Dieser<br />
öffnet und schließt die Tür selbst<br />
in Hanglagen automatisch und<br />
lässt sich auch durch Mobilgeräte<br />
ansteuern. Durch einen stufenlosen<br />
Türfeststeller macht der Antrieb<br />
das Öffnen und Schließen<br />
von Hand ebenfalls komfortabler,<br />
ohne zusätzlichen Kraftaufwand.<br />
Für die nötige Sicherheit sorgen<br />
dabei Kollisions- und Einklemmschutz.<br />
Des weiteren demonstriert<br />
der Brose auf der IAA seine Kompetenz<br />
für Leichtbau, etwa mit der<br />
Weiterentwicklung seines Türsystems<br />
aus Organoblech. Dieses soll<br />
im Vergleich zu konventionellen<br />
Stahltüren bis zu fünf Kilogramm<br />
pro Fahrzeug einsparen.<br />
Auch im Bereich der<br />
Schließsysteme ist Gewichtsreduktion<br />
ein Muss:<br />
So sorgt Broses Flex-Pol<br />
Aktuator für den<br />
Wegfall von<br />
bis zu drei<br />
Motoren<br />
und Getrieben<br />
je<br />
Schloss,<br />
was dieses<br />
robuster und<br />
leichter macht. Beide<br />
Technologien sind<br />
bereit für den Einsatz in der<br />
Großserie.<br />
Ein Meilenstein für Brose ist die<br />
elektrische Ölpumpe, bestehend<br />
aus einem elektronisch kommutierten<br />
Motor, der Steuerelektronik<br />
und einer Pumpe. Die aufeinander<br />
abgestimmten Komponenten<br />
sollen für Verbesserungen<br />
bei Wirkungsgrad, Akustik<br />
und Gewicht sorgen. Die (Zusatz-)Ölpumpe<br />
ermöglicht die<br />
Start-Stopp-Funktion sowie den<br />
Segelbetrieb, da sie bei ausgeschaltetem<br />
Motor den Druck im<br />
Getriebe aufrechterhält. Dadurch<br />
würden Emissionsreduktionen von<br />
bis zu 10 Gramm CO2/km möglich.<br />
Zudem erlaubt das Nebenaggregat<br />
die Verkleinerung / Substitution<br />
der Hauptgetriebeölpumpe. Weitere<br />
Anwendungsgebiete sind die<br />
Schmierung und Kühlung in Hybridanwendungen.<br />
IAA: Halle 4.0, Stand D01/D02<br />
www.brose.com<br />
Interesse geweckt?<br />
EDELSTAHL<br />
MEBUX<br />
IN CFK<br />
IMS - IMMER MIT SYSTEM<br />
NEU!<br />
Dann melden Sie sich doch bei uns!<br />
Wir sind Ihr Spezialist für Befestigungslösungen.<br />
Bei Fragen zu unserem neuen Angebot sowie all` unseren Befestigungslösungen<br />
stehen Ihnen unsere Fachberater gerne jederzeit zur Verfügung.<br />
IMS Verbindungstechnik GmbH & Co. KG<br />
Robert-Bosch-Str. 5 • 74632 Neuenstein<br />
Telefon: 07942 9131-0 • Fax: 07942 9131-52<br />
E-Mail: info@ims-verbindungstechnik.com<br />
www.ims-verbindungstechnik.com
KAROSSERIE + INTERIEUR<br />
Neuartiges Leichtbaudach im Smart Fortwo<br />
Bienenwabe auf dem Autodach<br />
Mit dem Polyurethan-Schaumsystem<br />
Elastoflex E von BASF ist es<br />
jetzt erstmals gelungen, ein Autoaußenbauteil<br />
in Sandwich-Wabentechnik<br />
mit Class-A-Folie in Großserie<br />
herzustellen. Das Dachmodul<br />
im Standardmodell des neuen<br />
Smart Fortwo besteht aus einer<br />
Papierwabe und zwei umschließenden<br />
Glasfasermatten, die in einem<br />
Sprühimprägnierprozess mit<br />
dem niedrigdichten, thermisch aktivierbaren<br />
Elastoflex E 3532 besprüht<br />
und mit einer durchgefärbten<br />
Class-A-Oberflächenfolie verpresst<br />
werden. In einem Arbeitsschritt<br />
entsteht so ein Dachmodul,<br />
das um 30% leichter ist als das Seriendach<br />
des Vorgängermodells –<br />
bei gleicher Festigkeit und Biegesteifigkeit.<br />
Entwickelt hat das Leichtbaudach<br />
die Firma Fehrer Composite<br />
Components, die es in ihrem<br />
Werk in Großlangheim fertigt.<br />
Bisher wird die Wabentechnologie<br />
im Autoinnenraum verwendet, z.B.<br />
für Ladeböden, Dachhimmel und<br />
Hutablagen. Für den Einsatz in Exterior-Bauteilen<br />
hat die BASF das<br />
Polyurethan-Halbhartsystem in<br />
Viskosität und Reaktivität so eingestellt,<br />
dass es gute Verbundeigenschaften<br />
aufweist und eine<br />
gleichmäßige, dünne Benetzung<br />
der Glasfasermatten gewährleistet,<br />
ohne zu tropfen . Nachdem<br />
das Halbzeug imprägniert wurde,<br />
wird es in einem beheizten Werkzeug<br />
zusammen mit der Class-<br />
A-Folie in Form gepresst. Dabei<br />
schäumt das PU-System am Rand<br />
des Sandwichs leicht auf und<br />
schafft einen festen Materialverbund<br />
zwischen Folie, Verstärkungsmatten<br />
und dem Papierwabenkern.<br />
Elastoflex E ist hinsichtlich<br />
der Reaktivität so eingestellt,<br />
dass lange Sprühzeiten von bis zu<br />
120 s für großflächige Bauteile bei<br />
gleichzeitig kurzen Entformungszeiten<br />
bis 60 s möglich sind. Dekormaterialien<br />
und Folien können<br />
im Werkzeug direkt hinterschäumt<br />
werden.<br />
IAA: Halle 4.1, Stand C41<br />
www.basf.com<br />
TÜV SÜD<br />
certified quality<br />
HIGH-TECH WERKSTOFFE FÜR DEN LEICHTBAU DER ZUKUNFT<br />
Faserverstärkte Kunststoffe ebnen den Weg in die nachhaltige Mobilität der Zukunft: leicht, stabil, robust! Seitenwand, Dach,<br />
Boden – LAMILUX Composites bieten vielseitigste Möglichkeiten im Leichtbau von Aufbauten und Aufliegern.<br />
• Energie- und Kosteneffi zienz durch geringes Gewicht<br />
• robuste Konstruktionen durch hohe Festigkeit und Stabilität<br />
• Einsatz im temperaturgeführten Kühltransport durch gute<br />
Isolationseigenschaften<br />
• Werterhalt durch einfache Verarbeitung und Reparatur<br />
• Farbgebung in allen RAL-, NCS-, Metallic- und<br />
kundenspezifi schen Farbtönen<br />
• hochwertige, versiegelte Oberfl ächen<br />
Der Name LAMILUX steht für höchste TÜV-zertifizierte Qualität! Als weltweit erster Hersteller faserverstärkter Kunststoffe<br />
erfüllen wir selbstverpflichtend höchste Standards bei der Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung.<br />
LAMILUX COMPOSITES GmbH . Postfach 15 40 . 95105 Rehau . Tel.: 0 92 83/5 95-0 . Fax: 0 92 83/5 95-2 90 . information@lamilux.de . www.lamilux.de
Mehr Fahrzeugsicherheit für Menschen mit Behinderungen<br />
Neue Drehsitze aus Schweden<br />
Der sicherste Weg, in einem Fahrzeug zu reisen,<br />
ist im Autositz unter Verwendung eines Sicherheitsgurtes.<br />
Ein Drehsitz ist eine Lösung,<br />
die Rollstuhlfahrern genau dies ermöglicht. Autoadapt,<br />
ein schwedisches Unternehmen für<br />
Fahrzeuganpassungslösungen, führt jetzt eine<br />
neue Version seines Turny Evo ein. Es ist der<br />
erste von zwei neuen Drehsitzen, die dieses<br />
Jahr auf den Markt kommen. Das wichtigste<br />
Merkmal des Turny Evo bleibe dabei bestehen:<br />
Fahrern sowie Beifahrern dabei zu helfen, im<br />
Auto Platz zu nehmen. Zugleich aber wurden<br />
Verbesserungen im Hinblick auf Komfort, Benutzerfreundlichkeit,<br />
Einbau und Sicherheit<br />
vorgenommen.<br />
Ein Drehsitz ist dabei kein eigenständiger Sitz,<br />
sondern eine Vorrichtung unter dem Sitz, mit<br />
dem dieser zur Türöffnung hin gedreht werden<br />
kann. Ein Sitzlift ist eine Drehsitzvariante, bei<br />
der der gesamte Sitz aus dem Fahrzeug und<br />
auf eine für den Benutzer geeignete Höhe gefahren<br />
wird.<br />
Alle Drehsitze von Autoadapt haben<br />
Crashtests durchlaufen und sind nach den<br />
gleichen Standards zugelassen, die für die<br />
Automobilindustrie gelten. Mit dem neuen<br />
Turny Evo und dem bald erscheinenden Turny<br />
Low Vehicle geht das Unternehmen über diesen<br />
Standard von erfolgreichen Crashtests bei<br />
30 G mit einem 102 kg schweren Crashtest-<br />
Dummy noch hinaus.<br />
Ein Autositz und ein Rollstuhl sind zwei sehr<br />
verschiedene Dinge. Der Autositz wurde entwickelt,<br />
um das Reisen in einer statischen Position<br />
bequem zu gestalten. Gewicht und andere<br />
Faktoren müssen dabei jedoch nicht berücksichtigt<br />
werden. Damit ein Sicherheitsgurt effektiv<br />
ist, muss er über die richtige Gurtgeometrie<br />
verfügen. Dies ist sehr viel einfacher, wenn der<br />
Nutzer in einem Autositz so Platz nimmt, wie es<br />
von den Fahrzeugdesignern vorgesehen wurde.<br />
Der Drehsitz ermöglicht das. Ein möglicherweise<br />
eher emotionalerer Grund, den Drehsitz zu verbauen,<br />
ist die größere Auswahl an Fahrzeugtypen<br />
und -modellen. Anpassungen mit abgesenktem<br />
Boden erfordern sehr viel Platz im Innenraum,<br />
während ein Drehsitz in nahezu alle<br />
massenproduzierten Fahrzeuge passt.<br />
Peter Wahlsten, Executive Vice President bei Autoadapt:<br />
„Wir sind der festen Überzeugung,<br />
dass jeder ein gleiches Anrecht auf Sicherheit<br />
hat; wenn man jedoch mit einem Rollstuhl in einem<br />
Fahrzeug unterwegs ist, nimmt man von<br />
Vornherein ein niedrigeres Maß an Sicherheit in<br />
Kauf. Ohne eine geeignete Stütze für Kopf und<br />
Nacken ist die Gefahr praktisch so schwerwiegend,<br />
als ob man keinen Gurt angelegt hätte.“<br />
Darüber hinaus können Drehsitze mit dem<br />
existierenden Lochmuster installiert werden,<br />
und wenn das Fahrzeug verkauft wird, kann<br />
der Sitz vollständig wiederhergestellt werden.<br />
www.autoadapt.com<br />
Intelligente<br />
Wärme spart<br />
Energie und Geld.<br />
Infrarot-Wärme spart Energie,<br />
weil sie die optimale Wärmemenge<br />
immer exakt an die<br />
richtige Stelle bringt. Zum<br />
Beispiel, um Beschichtungen<br />
schnell zu trocknen oder<br />
Kunststoffe gezielt zu erwärmen.<br />
Das spart Zeit und Geld!<br />
Ihr Kontakt zu unserem Infrarot-Team<br />
hng-infrared@heraeus.com<br />
Gut für Ihren<br />
Wettbewerbsvorteil.<br />
Heraeus Noblelight GmbH<br />
www.heraeus-noblelight.com/infrared<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 71
KAROSSERIE + INTERIEUR<br />
Auch bei hybriden Bauteilen<br />
Fotorealistische Eloxaloberflächen<br />
PROCESSING<br />
PLASTICS WITH POWER<br />
Individuelle Lösungen –<br />
höchster Qualitätsanspruch<br />
Technologien für die<br />
Herstellung von<br />
INNEN-<br />
VERKLEIDUNGEN<br />
Besuchen Sie uns:<br />
FAKUMA 2015<br />
Halle: A1, Stand: 1325<br />
Friedrichshafen<br />
13. – 17. Oktober 2015<br />
Kiefel GmbH<br />
Sudetenstraße 3, 83395 Freilassing,<br />
Deutschland<br />
T +49 8654 78 0, kiefel@kiefel.de<br />
Mit den Anodisation Surface Solutions (A.SS)<br />
bietet die Holzapfel Group eloxierte Oberflächen<br />
mit einem neuen Individualisierungsgrad,<br />
auch bei der Beschichtung kompletter Hybridverbundteile.<br />
Die Anodisation Surface Solutions<br />
ermöglichen individuelle metallische Beschichtungen<br />
nicht nur in farblicher Hinsicht,<br />
sondern bezüglich der gesamten optischen Gestaltung.<br />
Integriert in den Anodisierungsprozess<br />
werden Logos, Texte, Bilder, fortlaufende<br />
Nummern, Barcodes etc. detailgetreu wiedergegeben.<br />
Gleichzeitig ist die beschichtete<br />
Oberfläche eloxaltypisch „hart“.<br />
Das Verfahren ist bei flüssigkeitsdichtem Verbund<br />
von Aluminium und Kunststoff auch auf<br />
hybride Werkstoffe applizierbar. Die A.SS machen<br />
sich ein Druckverfahren zunutze, bei dem<br />
das Motiv in der Eloxalschicht des Aluminiums<br />
detailgetreu eingeschlossen wird. Die Farbe ist<br />
somit nicht auf der Oberfläche aufgebracht,<br />
sondern befindet sich geschützt im Material.<br />
Farbverläufe und Fotos können direkt aus einer<br />
Datei heraus in vielen Farben in der Eloxalpore<br />
dargestellt werden. Dank moderner Digitaldrucktechnik<br />
sind selbst fotorealistische Bilder<br />
und Farbverläufe leicht darstellbar – und das<br />
ohne die beim Siebdruck nötige Film- und<br />
Siebherstellung. Auch Wechseltexte, fortlaufende<br />
Nummerierungen und Barcodes können<br />
erstellt werden. Individuelle Oberflächen wie<br />
etwa Schliffbilder, Facetten, sägeschnittraue,<br />
glasperlen- oder korundgestrahlte Oberflächen<br />
sowie Profilierungen behalten ihre Eigenschaften<br />
auch nach der Beschichtung.<br />
Die Holzapfel Group ermöglicht die individuellen<br />
Oberflächen auch für komplette Hybridverbundteile<br />
mit den Vorteilen des One-way-Wertschöpfungsprozesses.<br />
Die Beschichtung erfolgt<br />
durch Eloxieren und zusätzliches individuelles<br />
Einlagern von Farbpigmenten in die<br />
Eloxalpore. Dies wird als letzter Fertigungsschritt<br />
vorgenommen. So wird etwa ein Aufreißen<br />
der Eloxalschicht durch nach der Beschichtung<br />
durchgeführte Hinterspritz- oder Klebevorgänge<br />
vermieden. Laut Holzapfel mache dies<br />
das Verfahren optimal für die Beschichtung<br />
kunststoffhinterspritzter Bauteile mit hohem<br />
optischem Anspruch.<br />
Durch die Einlagerung im Material sind die generierten<br />
Oberflächen sehr widerstandsfähig<br />
und beständig gegen Öle, Fette und Lösungsmittel.<br />
Die Beschichtungen halten mechanischen<br />
Beschädigungen wie Kratzern (Fingernageltest,<br />
Tesatest, Funkenflugtest) in gleichem<br />
Maße stand wie bisherige Eloxalober -<br />
flächen. Laut Holzapfel sei das Verfahren besonders<br />
interessant für flache Bauteile, wobei<br />
Plattengrößen von bis zu 600 mm x 1800 mm<br />
mit möglich sind. Auch auf leicht profilierten<br />
Oberflächen sei eine detailgetreue Darstellung<br />
möglich.<br />
www.holzapfel-group.com<br />
www.kiefel.com
Johnson Controls auf der IAA: Seating Demonstrator SD15<br />
Lösungen für den Autositz von morgen<br />
Auf der IAA präsentiert Johnson Controls den<br />
Seating Demonstrator SD15, der zukünftige<br />
Trends für Autositze aufzeigt. Er bietet in der<br />
vorderen Sitzreihe einen auf geschwungenen<br />
Schienen montierten elektrisch verstellbaren<br />
Fahrersitz, der die separaten und komplexen<br />
Mechanismen konventioneller Sitzeinstellungen<br />
überflüssig machen soll. Der Sitz ist mit einer<br />
direkt an der Sitzstruktur befestigten Bedienkonsole<br />
ausgestattet, die sich mit dem Insassen<br />
bewegt und nicht fest zwischen den Sitzen<br />
angeordnet ist. Zusätzlich bietet die Konsole<br />
Optionen zum drahtlosen Laden mobiler<br />
Geräte. Diese neueste Generation schlanker<br />
Kopfstützen lässt sich außerdem mit einem<br />
Kippmechanismus kombinieren. Das schlanke<br />
Design eigne sich laut Hersteller ideal für Sitzanwendungen<br />
bei begrenztem Platzangebot.<br />
Der Beifahrersitz des SD15 ist auf besonders<br />
langen 'Gemini'-Schienen befestigt, sodass der<br />
Sitz sowohl direkt vor das Armaturenbrett gefahren<br />
und dort verstaut oder auch weit nach<br />
hinten gefahren werden kann, um das Beladen<br />
des Fahrzeugs von der Seite zu vereinfachen.<br />
In der zweiten Reihe kommt ebenfalls das Gemini-Schienensystem<br />
zum Einsatz. Durch die<br />
einzigartige Kinematik der Rücksitzbank besteht<br />
die Möglichkeit, das Fahrzeug mit einer<br />
einfachen Bewegung aus einem Viersitzer in einen<br />
Fünfsitzer zu verwandeln. Die Struktur erlaubt<br />
es, die Sitzbank nach vorne zu bewegen<br />
und so in eine zentrale Sitzposition mit drei<br />
Sitzplätzen zu bringen. Wird sie nach hinten<br />
verschoben, klappt der mittlere Sitz zusammen<br />
und die dadurch schmalere Sitzreihe findet<br />
zwischen den Radkästen Platz. Diese Funktion<br />
maximiert einerseits die Beinfreiheit und erleichtert<br />
andererseits das Beladen des Fahrzeugs.<br />
Darüber hinaus zeigen die im Tintenstrahlverfahren<br />
bedruckten Sitzbezüge des SD15, was<br />
Johnson Controls in Sachen Individualisierung<br />
leisten kann. Die gewichts- und platzsparenden<br />
Multimaterialsitze sind mit ergonomischen<br />
Schaumteilen gepolstert und sollen für die Gewichtseinsparung<br />
bei Automobilsitzen wegweisend<br />
sein. Darüber hinaus wurden die Sitze in<br />
beiden Reihen mit der SuperGroove-Verkleidungstechnologie<br />
von Johnson Controls aufgewertet.<br />
Laut dem Hersteller verleihe sie den<br />
Sitzen ein schlankes Erscheinungsbild und verbessere<br />
so ihre gesamte Qualitätsanmutung.<br />
Alle im Seating Demonstrator präsentierten Lösungen<br />
greifen den Trend autonomens Fahren<br />
in Bezug auf den Multifunktions-Fahrzeugsitz<br />
der Zukunft auf. Des Weiteren besteht die Möglichkeit,<br />
unter dem Sitz eine 48-V-Batterie zu<br />
platzieren.<br />
IAA: Halle 5.1, Stand B24<br />
www.johnsoncontrols.de
TESTEN + PRÜFEN<br />
Der Abgasgesetzgebung einen Schritt voraus<br />
Neue Mess- und Testeinrichtungen für schnellere und bessere Produktvalidierung<br />
Die Steuerzentrale der<br />
modernisierten Motor-Testzelle<br />
erlaubt den Zugriff auf<br />
sämtliche Messsysteme<br />
Neue Testzyklen und immer strengere<br />
Abgasgrenzwerte verlangen<br />
nach intensiveren Komponentenund<br />
Motorenversuchen. Delphi<br />
Powertrain hat deshalb seine<br />
Test- und Prüfeinrichtungen für<br />
Nutzfahrzeug-Dieselmotoren am<br />
Technikzentrum in Gillingham<br />
(England) umfassend modernisiert<br />
und erweitert.<br />
Vorzeigeobjekt des Technikzentrums im Südosten<br />
von England ist eine neue Motor-Testzelle,<br />
die Delphi gemeinsam mit der AVL aus Graz<br />
realisiert hat. Sie beherbergt einen Abgasprüfstand<br />
zur Messung von praktisch allen relevanten<br />
gasförmigen Abgasbestandteilen sowie<br />
Der Autor: Hartmut Hammer, freier Mitarbeiter<br />
der AutomobilKonstruktion<br />
Ruß- und Partikelemissionen. Mit dem Leistungsteil<br />
können Motoren bis 13 Liter Hubraum<br />
und 440 kW Leistung in allen relevanten Testzyklen<br />
gefahren werden – etwa dem NRTC<br />
(non-road transient cycle), ETC (european transient<br />
cycle) und WHTC (world harmonized transient<br />
cycle). Parallel dazu erfasst die Abgasmesstechnik<br />
von AVL sämtliche bei aktuellen<br />
und künftigen Abgasgesetzen definierten<br />
Emissionen.<br />
Gesteuert und versorgt werden die vollautomatisch<br />
ablaufenden Tests von einem benachbarten<br />
Kontrollraum aus. Eine separate Auf- und<br />
Abrüstkammer ermöglicht kurze Rüstzeiten<br />
und Wechsel der Prüflinge. Herzstück des Prüfstands<br />
ist ein AVL-Automatisierungssystem, in<br />
dem unter anderem diverse Prüfprogramme für<br />
verschiedene Motoren und Testzyklen hinterlegt<br />
sind. Es fungiert außerdem als Plattform<br />
für die Bedienung folgender AVL-Teilsysteme:<br />
·Das Abgasmesssystem AMA i60 analysiert<br />
mit verschiedenen Sensoren den Gehalt an<br />
Kohlenwasserstoffen, Stickoxiden, Kohlenmonoxid<br />
und -dioxid, Schwefeldioxid, Sauerstoff,<br />
Ammoniak und Lachgas.<br />
·Zur Erfassung der Rußpartikel, ihrer Masse<br />
und Anzahl kommen eine gravimetrische<br />
Partikelmessung, ein photoakustisches<br />
Spektroskop, ein Rauchmessgerät und ein<br />
Trübungsmessgerät zum Einsatz.<br />
·Die Verbrennungsprozesse dokumentieren<br />
außerdem ein Luftmassenmesser, ein Blowby-Messsystem<br />
sowie ein Kraftstoffmesssystem.<br />
Start für die Umrüstung des Prüfstands war im<br />
Januar 2014. Andrew Fitt, Key Account Manager<br />
bei AVL UK: „Es kommt sehr selten vor, dass<br />
ein Kunde so viel Messtechnik für nur einen<br />
Prüfstand bestellt. Aus diesem Grund ist diese<br />
Anlage für AVL ein besonderes Projekt.“ Anfang<br />
2015 wurde die Testzelle dann in Betrieb<br />
genommen. Delphi plant die Umrüstung von<br />
weiteren der insgesamt zwölf im Technikzentrum<br />
vorhandenen Motor-Testzellen auf die<br />
neue Technik.<br />
„Ein wesentlicher Treiber für die Modernisierung<br />
und Erweiterung unserer Prüfeinrichtungen<br />
in Gillingham ist die bevorstehende Ergänzung<br />
der gängigen Labor-Testzyklen um die<br />
RDE-Zyklen (real driving emissions). Diese auf<br />
der Straße ermittelten Emissionswerte basieren<br />
auf deutlich anspruchsvolleren Lastwech-<br />
74 AutomobilKonstruktion 3/2015
Einspritzsysteme mit bis zu sechs Injektoren<br />
können auf den Prüfständen<br />
präzisen Leistungstests und<br />
Dauerläufen unterzogen werden<br />
John Fuerst, Vizepräsident Antriebs -<br />
entwicklung bei Delphi:<br />
„An den neuen Prüfständen in Gillingham<br />
können wir die anvisierten RDE-<br />
Testzyklen sehr gut simulieren.“<br />
Bilder: Delphi<br />
In den neuen Prüfkammern sind die zu testenden Komponenten auf Vorrichtungen montiert<br />
Die Kammern sind individuell klimatisierbar, eine Vorheizung (rechts) konditioniert den Kraftstoff<br />
seln, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsprofilen“,<br />
erläutert John Fuerst, Vizepräsident<br />
Antriebsentwicklung bei Delphi. Zumal durch<br />
die wachsende Anzahl lokal und regional gültiger<br />
Regelungen und den Einfluss der lokal<br />
herrschenden Umgebungsbedingungen auf<br />
das Emissionsverhalten der Motoren die Anzahl<br />
der länderspezifischen Kalibrationsvarianten<br />
beträchtlich zunehmen wird. John Fuerst:<br />
„Für diese Aufgaben sind schnellere und<br />
effizientere Test- und Validierungsprozeduren<br />
unerlässlich.“<br />
Für alle Fälle gerüstet<br />
Aus diesen Gründen hat Delphi auch in die Testeinrichtungen<br />
für die anderen Phasen der<br />
Produktentwicklung viel Geld investiert. Beispielsweise<br />
wurde fast die Hälfte der 62 Prüfstände<br />
zur Produktvalidierung auf den neuesten<br />
technischen Stand gebracht. Auf ihnen<br />
werden B-Muster der Einspritzkomponenten<br />
und-systeme getestet, die anschließend dann<br />
zu Motorentests beim OEM gehen. Sobald<br />
neue Abgasnormen anstehen oder in Kraft treten,<br />
will Delphi sukzessive weitere Prüfstände<br />
aktualisieren oder neu aufbauen. Ergänzt werden<br />
diese Validierungseinrichtungen von 31<br />
Leistungsprüfständen, an denen beispielsweise<br />
Brennraumuntersuchungen am Einzylindermotor,<br />
Tests kompletter Einspritzsysteme, bis<br />
hin zu Dauerläufen von Nutzfahrzeugmotoren<br />
mit bis zu sechs Zylindern stattfinden. Insgesamt<br />
etwa 60 dieser Testeinrichtungen sind<br />
laut Delphi für Dauerläufe geeignet.<br />
Die Implementierung moderner Testprozesse<br />
verdeutlicht zum Beispiel ein neuer Block mit<br />
acht Prüfkammern für Komponenten- und Systemtests.<br />
Die separaten und individuell klimatisierten<br />
Kammern werden von zwei gemeinsamen<br />
Rüstkammern aus beschickt, in denen<br />
neue Prüflinge und die dazu erforderlichen Testsysteme<br />
parallel zu laufenden Tests vorbereitet<br />
werden. Modulare Hydrauliksysteme ermöglichen<br />
einen raschen Wechsel der Kraftstoffqualitäten.<br />
Von einem zentralen Kontrollraum aus<br />
werden alle acht Kammern kameraüberwacht<br />
und gesteuert. Eine umfangreiche Steuerungssoftware<br />
ermöglicht Tests rund um die Uhr.<br />
IAA: Halle 5.1, Stand B06<br />
Delphi Automotive<br />
Tel.: +49 202 291 2115<br />
thomas.aurich@delphi.com<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 75
TESTEN + PRÜFEN<br />
Radarkomponenten inline prüfen und kalibrieren<br />
Qualitätsprüfung bei Hochfrequenz-Sensorik für Fahrerassistenzsysteme<br />
Einbaubeispiel für die Anzeige im Armaturenbrett<br />
Bilder: Engmatec<br />
Waren Fahrerassistenzsysteme bis<br />
vor kurzer Zeit nur in Autos der<br />
Oberklasse zu finden, so werden sie<br />
zunehmend auch in Mittelklassewagen<br />
eingebaut. Gerade bei Hochfrequenz-Sensorik<br />
ist eine zuverlässige<br />
Funktion solcher Sicherheitsbauteile<br />
nur mit einem fundierten Qualitätsmanagement<br />
sicherzustellen.<br />
Modulare Lösungen bieten eine<br />
wirtschaftliche Prüfmethode. Sie<br />
reichen von Handprüfeinrichtungen<br />
bis zu Inline-Prüfungen und Kalibrierungen,<br />
die alle Schritte automatisch<br />
erledigen. Doch worauf<br />
kommt es dabei an?<br />
Die Autoren: Sabine Vormbaum,<br />
Marketing Manager bei Engmatec, Radolfzell, und<br />
Andreas Zeiff, Redaktionsbüro Stutensee<br />
Moderne Technik macht Autofahren leichter,<br />
entscheidet in Millisekunden über Notbremsungen<br />
und erhöht so die Sicherheit im Auto.<br />
Allerdings müssen die eingesetzten Sensoren<br />
auch allerhöchste Sicherheitskriterien erfüllen.<br />
Der Trend geht zu Radarsensoren, die in unterschiedlichen<br />
Frequenzbereichen den Raum um<br />
den Wagen abtasten. Um solche Hochfrequenzkomponenten<br />
sicher zu kalibrieren und<br />
einer zuverlässigen Endkontrolle zu unterziehen,<br />
ist umfangreiches Know-how bei den Test -<br />
einrichtungen gefragt. Engmatec, ein Spezialist<br />
für Montage- und Prüflinien mit jahrzehntelanger<br />
Erfahrung bietet hier ein interessantes Konzept<br />
an. Ob einzelne Testkammer oder in die<br />
Fertigung integriert, immer müssen die spezifischen<br />
Anforderungen der Hochfrequenzsensorik<br />
berücksichtigt werden, ein nicht immer<br />
leichtes Unterfangen.<br />
Radarsensorik im Kfz<br />
Im Moment setzen Automobilhersteller für<br />
mittlere Entfernungen gerne auf Radarsensoren.<br />
Der Vorteil gegenüber optischen Systemen<br />
ist der „Durchblick“ auch bei Nebel und anderen<br />
optischen Beeinträchtigungen. Die Sensoren<br />
arbeiten meist im Spritzwasserbereich an<br />
Front und Heck des Wagens, also in einer sehr<br />
widrigen Umgebung. Sie sind darum komplett<br />
versiegelt. Je nach Einsatzzweck variiert die Arbeitsfrequenz<br />
zwischen 24 und 70 GHz. Die<br />
Reichweite der Radarsensoren ist ebenfalls unterschiedlich.<br />
Je nach Ausführung gibt es unterschiedliche<br />
Sichtweiten von 2 bis 200 m,<br />
gerne auch als Nahfeld-, Mittelbereichs- und<br />
LongRange-Sensoren bezeichnet. Als sogenannter<br />
Mittelbereich ist eine Entfernung von<br />
ca. 45 m definiert. Die Sensoren werden als<br />
komplette Module eingesetzt, bestehend aus<br />
Sender und Empfänger, können aber auch diskrete<br />
Bauteile sein, also Sender und mehrere<br />
Antennen. So lassen sich fahrzeugbedingte<br />
Anforderungen am besten umsetzen. Da die<br />
Radartechnik im modernen Automobil mit<br />
zahlreichen anderen Komponenten zusammenarbeiten<br />
muss und aus der Umgebung<br />
ebenfalls zahlreiche Beeinträchtigungen einfließen<br />
können, ist eine praxisgerechte Prüfung<br />
76 AutomobilKonstruktion 3/2015
der Sicherheitsbauteile im wahrsten Wortsinn<br />
lebenswichtig.<br />
Einsatzbedingungen<br />
Radartechnik beruht auf dem Aussenden von<br />
Funkimpulsen und dem anschließenden Auffangen<br />
der reflektierten Strahlung. Diese wird<br />
analysiert und ausgewertet; das Ergebnis ist<br />
Grundlage für die Entscheidung des Assistenzsystems.<br />
Je höher die Sendefrequenz, um so<br />
kürzer die Wellenlänge und desto besser die<br />
Auflösung des Sensors. Allgemein gesagt: Je<br />
höher die Frequenz, um so kleinere Einzel-Objekte<br />
kann man erkennen. Unabhängig von der<br />
Frequenz und nur von der fixen Lichtgeschwindigkeit<br />
abhängig ist die Entfernungsmessung.<br />
Klassisch wird die Laufzeit zwischen Sendeimpuls<br />
und aufgefangenem Echo gemessen, halbiert<br />
(Hin- und Rückweg benötigen ja gleiche<br />
Zeit), mit der Lichtgeschwindigkeit multipliziert<br />
und die Entfernung zum Zielobjekt steht fest.<br />
Eine andere Methode ist das Puls-Dopplerprinzip<br />
für Geschwindigkeitsmessung. Sie beruht<br />
darauf, dass die Frequenz der reflektierten<br />
Welle sich ändert, wenn eine Relativgeschwindigkeit<br />
vorhanden ist. Die direkte Relativgeschwindigkeitsmessung<br />
ist ein entscheidender<br />
Vorteil der Radarmessung; dazu ist jedoch<br />
eine Analyse des Frequenzspektrums notwendig.<br />
Allerdings sind Störimpulse wie Funkimpulse<br />
von Handy, WLAN, Funkschlüsseln<br />
usw. dabei sicher auszublenden.<br />
Moderne Bauteile erlauben es heute, die gesamte<br />
Sensorik samt Störfilter etc. auf kleinem<br />
Raum aufzubauen. Schnelle Rechner stellen<br />
dann fertige Signale zur weiteren Auswertung<br />
bereit. Das alles muss aber auch mechanisch<br />
über Jahre sicher funktionieren. Nun ist der<br />
Einsatz im Kfz einer der anspruchsvollsten<br />
überhaupt. Sibirische Kälte bis zur Mittagshitze<br />
über „glühendem“ Asphalt sind ebenso zu<br />
ertragen wie Nässe, Salz, Vibration, Schock,<br />
Staub und vieles mehr. Nur eine ausgefeilte<br />
Prüftechnik, die alle Bereiche der Praxis abbildet,<br />
legt die Grundlage für eine fundierte Qualitätssicherung.<br />
Prinzipschema Dopplereffekt: Radarsensoren messen Relativgeschwindigkeiten sehr genau<br />
Radarsensoren erkennen die Umgebung rund ums Auto<br />
Kalibrieren und Prüfen<br />
Auch die Eigenschaften elektronischer Bauteile<br />
und Baugruppen unterliegen statistischen<br />
Schwankungen. Um Sensoren gleichbleibender<br />
Güte herzustellen, ist daher eine Kalibrierung<br />
auf ein Standardmaß nötig. Sollen beispielsweise<br />
70 m erfasst werden, muss dies selbstverständlich<br />
vorher bei jedem Sensor getestet<br />
und eingestellt werden. 70 m Prüfstrecke ist in<br />
der Praxis kaum zu realisieren. Engmatec bietet<br />
darum Testmodule, die die Strahlungsintensität<br />
messen und das Signal, entsprechend der<br />
zu prüfenden Entfernung, in der Laufzeit verzögern<br />
und dämpfen. Für den Prüfling-Radarsensor<br />
erscheint dies, als tauche ein Hindernis<br />
in 70 m Entfernung auf.<br />
Um bei der Prüfung Störungen auszuschließen,<br />
muss der Testbereich besonders abgeschirmt<br />
werden. Dabei sind externe Einflüsse zu berücksichtigen,<br />
die die Prüfung beeinträchtigen,<br />
z.B. Handyfunk von Mitarbeitern oder Störimpulse<br />
von Frequenzumrichtern. Auch durch<br />
den Parallelbetrieb mehrerer Prüfsysteme entstehen<br />
Störimpulse. Interne Strahlung aus<br />
dem Prüfbetrieb, also vom Radar-Sensor generierte<br />
Strahlung oder eine „Teststörstrahlung“,<br />
um externe Einflüsse zu prüfen, sind ebenfalls<br />
abzuschirmen, um die Umgebung nicht zu beeinträchtigen.<br />
Prüfumgebung und Umwelt dürfen sich für einen<br />
sicheren Betrieb nicht gegenseitig beeinflussen.<br />
Alle Testeinrichtungen können dabei<br />
sowohl als Einzelmodul für teilautomatischen<br />
Betrieb wie auch integriert in eine Fertigungslinie<br />
eingesetzt werden. Nicht zuletzt muss<br />
auch noch die Dichtheit der Baugruppen und<br />
Gehäuse überprüft werden. Dafür wird der<br />
Prüfling im Vakuum mit Druck beaufschlagt.<br />
Wird bei Messung des Drucks ein Druckverlust<br />
festgestellt, so zeigt dies vorhandene Leckagen<br />
des Prüflings an (Closed Components<br />
Test).<br />
Praxisgerecht<br />
Wie sehen solche Prüfeinrichtungen nun aus?<br />
Eine in der Praxis bewährte abgeschirmte Prüfzelle,<br />
in der auch anwenderspezifische Testeinrichtungen<br />
installiert werden können, kann<br />
Baugruppen zwischen 90 mmk x 63 mm x 20<br />
mm und 120 mm x 85 mm x 28 mm aufnehmen.<br />
Für einen abgeschirmten Leiterplattentest<br />
in definierter Prüfumgebung mit vormontierter<br />
Radarleiterplattengruppe bietet eine andere<br />
Prüfbox Raum. Für reine Hochfrequenztests<br />
stehen spezielle Absorber-Materialien,<br />
Radarkammern und programmierbare Frequenzsimulatoren<br />
bereit. Eine gefräste Verzögerungsstrecke,<br />
Delay line genannt, ermöglicht<br />
eine definierte Zeitverzögerung der Signale.<br />
Das Signal wird dabei innerhalb weniger<br />
Nanosekunden zurückgegeben, entsprechend<br />
der echten Laufstrecke in der Praxis.<br />
Engmatec GmbH, Tel.: 07732 9998-0,<br />
info@engmatec.de<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 77
TESTEN + PRÜFEN<br />
Zehn Gänge ohne Leck<br />
Kuka prüft Dichtheit von Automatikgetrieben mit Inficon-Geräten<br />
Fahrzeughersteller wollen Kraftstoffverbrauch und CO 2 -Ausstoß künftig mit modernen Neun- oder<br />
sogar Zehn-Gang-Automatikgetrieben deutlich senken. Hierbei spielt die Dichtheit der Getriebe<br />
ein immer größere Rolle. Die Kuka Assembly and Test Corporation setzt bei Helium-Dichtheitsprüfanlagen<br />
für Hersteller von Automatikgetrieben daher daher auf Lecksuchgeräte von Inficon.<br />
Die Kuka-Dichtheitsprüfanlage identifiziert Lecks direkt nach dem Guss der Getriebegehäuse<br />
Bei der komplexen Funktionsweise moderner<br />
Vielganggetriebe kann eine Leckage der Getriebeflüssigkeit<br />
die Gangwechsel stark beeinflussen.<br />
Wie Steve Kurzava von Kuka betont, wurden<br />
Lecks an Getrieben früher oft erst während<br />
oder nach der Endmontage entdeckt. Heute ist<br />
es dagegen möglich, etwaige Lecks bereits direkt<br />
nach der Fertigung des Getriebegehäuses<br />
zu identifizieren. Durch Prüfstationen von Kuka<br />
mit den Helium-Dichtheitsprüfgeräten von Infi-<br />
Die Autorin: Sandra Seitz, Market Manager Automotive<br />
bei der Inficon GmbH, Köln<br />
con sollen Hersteller auf diese Weise viel Zeit<br />
und Kosten sparen können. Fehlerhafte Getriebe<br />
werden so schon nach dem Guss aussortiert<br />
– und nicht erst nach dem Zusammenbau.<br />
Die Dichtheitsprüfanlagen von Kuka bieten einen<br />
hohen Automatisierungsgrad. Die Getriebe<br />
werden per Roboter von der Bearbeitungsstation<br />
gehoben, in einer Werkzeughalterung arretiert<br />
und anschließend werden die Kanäle für<br />
die Hydraulikflüssigkeit sowie andere Hohlräume<br />
durch prüfteilspezifische Abdichtungen mit<br />
extrem engen Toleranzen versiegelt. Das Getriebe<br />
wird in einer Prüfkammer montiert und<br />
anschließend evakuiert. Schließlich versiegelt<br />
das System auch die Prüfkammer und befüllt<br />
sie mit einem einprozentigen Helium-Luft-Gemisch,<br />
das Ventilatoren in der Prüfkammer<br />
gleichmäßig um das Prüfteil verteilen.<br />
Das Inficon Helium-Dichtheitsprüfgerät, das<br />
über die Werkzeughalterung an das versiegelte<br />
und evakuierte Innere des Getriebes angeschlossen<br />
ist, misst nun, wie viel von der Heliumatmosphäre<br />
von außerhalb des Prüfteils<br />
durch Lecks, Risse, poröse Stellen und andere<br />
Undichtigkeiten in sein Inneres eindringt. Diese<br />
integrale Dichtheitsprüfmethode, die<br />
manchmal auch als Hüllentest bezeichnet<br />
wird, erlaubt dann eine präzise, reproduzier-<br />
78 AutomobilKonstruktion 3/2015
are Ja/Nein-Aussage – und aufgrund der ermittelten<br />
Heliumkonzentration im Innern des<br />
Getriebes auch die Angabe der Leckrate.<br />
Moleküle durchdringen poröse Stellen<br />
Einzigartig an diesem Helium-Verfahren ist,<br />
dass es auch kleine Leckagen zuverlässig ermittelt.<br />
So kann es an einem Aluminiumgussteil<br />
eine Stelle von wenigen Zentimetern Durchmesser<br />
geben, die so porös ist, dass sie buchstäblich<br />
eine Billion Löcher aufweist, die groß<br />
genug sind, um von Helium-Molekülen durch<br />
drungen zu werden. Solch eine Porosität würde<br />
bei herkömmlichen Verfahren wie etwa Differenzdruck-<br />
oder Wasserbadprüfung nie auffallen.<br />
„Leckstellen sehen nicht notwendigerweise<br />
wie Spalten oder kreisrunde Löcher aus“, erklärt<br />
Thomas Parker, Automotive Sales Manager<br />
von Inficon für Nordamerika, „viel öfter ähneln<br />
sie einem höhlenartigen System kleinster<br />
Risse und Falten im Metall. Wollte man Lecks<br />
in Getrieben mit einer Druckabfallprüfung per<br />
Luft ermitteln, brauchte man angesichts der<br />
kleinen Leckraten, auf die Getriebehersteller<br />
heute prüfen, mitunter mehrere Tage.“<br />
Die Helium-Dichtheitsprüfung brauche dagegen<br />
nur Sekunden, bei einer Gesamtzeit von<br />
Prüf- und Rüstzeiten von ungefähr 30 oder 40<br />
Sekunden. Mit einem Intervall dieser Länge ist<br />
die Dichtheitsprüfung im Grunde jedem anderen<br />
Produktionsschritt in der Dauer vergleichbar,<br />
sei es Gewindebohren oder die Installation<br />
eines Magnetventils.<br />
Der aktuelle Branchenstandard für die zulässige<br />
Leckrate von Getrieben liegt bei ungefähr<br />
1 sccm (rund 2x10 –2 mbarl/s). Aber die Getriebetechnologie<br />
macht nach wie vor große Fortschritte.<br />
Die Getriebe werden komplexer, sie<br />
benötigen andere Getriebeflüssigkeiten, die<br />
Leistungsanforderungen steigen – und die zulässigen<br />
Leckraten werden dabei immer geringer.<br />
Testingenieure aus der Automobilbranche<br />
gehen davon aus, dass mit den modernen 9–<br />
und 10-Gang-Getrieben der nahen Zukunft bald<br />
Leckraten von nur noch 0,1 sccm<br />
(2x10 –3 mbarl/s) zulässig sein könnten – eine<br />
Verringerung um den Faktor zehn.<br />
Gegen Ende der Fertigung machen die Getriebehersteller<br />
oft einen zweiten Test, diesmal<br />
wirkt das Helium-Prüfgas allerdings von innen<br />
nach außen. Die Prüfkammer von Kuka wird<br />
dabei zur Vakuumkammer, in der das fertige<br />
und abgedichtete Getriebe getestet wird. Große<br />
Vakuumpumpen entfernen die Luft aus der<br />
Kammer, und ein LDS3000 Helium-Dichtheitsprüfgerät<br />
von Inficon ermittelt, wie viel Heliumgas<br />
aus dem Innern des fertigen Getriebes in<br />
die Kammer austritt. Für die abschließende Vakuumprüfung<br />
werden zunächst die Kammer<br />
und das Getriebeinnere evakuiert, dann wird<br />
das Prüfteil mit 100-prozentigem Heliumgas<br />
bei rund 200 mbar beaufschlagt. Bei einer<br />
Druckdifferenz von mehr als 275 mbar würden<br />
die Dichtungen innerhalb des Getriebes nachgeben,<br />
während mit einem Helium-Druck von<br />
200 mbar eine verlässliche und realistische<br />
Prüfung der Dichtheit möglich ist. Dieser abschließende<br />
Test, bei dem die etwaige Austrittsrichtung<br />
des Prüfgases die tatsächlichen<br />
Betriebsbedingungen nachstellt, sei Herstellern<br />
wichtig. Denn haben sich unter Betriebsdruck<br />
der Hydraulikflüssigkeit Dichtungen oder<br />
Zuleitungen verformt, strömt das Gas an denselben<br />
Stellen aus, an denen auch die Hydraulikflüssigkeit<br />
austreten würde.<br />
Bei Kuka hatte man sich schon vor rund drei<br />
Jahren entschlossen, den Hersteller der Dichtheitsprüfgeräte<br />
zu wechseln. Seitdem sind die<br />
Helium-Prüfgeräte von Inficon im Einsatz. Eine<br />
ähnliche, doppelte Helium-Testmethode – erst<br />
von außen nach innen, dann abschließend von<br />
innen nach außen – setzte Kuka auch schon<br />
vor der Umstellung ein. Wichtige Gründe, die<br />
aus Kuka-Sicht für Inficon sprachen, waren die<br />
bessere Performance und die höhere Zuverlässigkeit.<br />
Als besonders erfreulich erwies es<br />
sich, dass die Installation im Grunde eine Sache<br />
von Plug & Play war. So ließen sich die<br />
Austauschkosten auf ein Minimum reduzieren<br />
– für Kuka selbst und für die Getriebe-Hersteller,<br />
bei denen die Kuka-Dichtheitsprüfanlagen<br />
im Einsatz sind.<br />
Schneller wieder startklar<br />
Alle neuen Anlagen, die Kuka heute installiert,<br />
sind mit Helium-Dichtheitsprüfgeräten von Inficon<br />
ausgestattet. Aber auch alle bestehenden<br />
Kunden hatte Kuka schon bald davon überzeugt,<br />
dass die Umrüstung ihrer Prüfanlagen<br />
auf die Inficon-Geräte sinnvoll ist. Thomas Parker<br />
von Inficon: „Kuka konnte seinen Kunden<br />
mit unseren Geräten bei den Messungen eine<br />
bessere Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit<br />
demonstrieren und eine effizientere Reinigung<br />
der Geräte vom Prüfgas.“ Prüfgasverseuchung<br />
ist ein Thema, das bei Groblecks und<br />
fehlerhaften Dichtungen akut wird. Dann brauchen<br />
viele Dichtheitsprüfgeräte oft mehrere Minuten,<br />
bis die Helium-Übersättigung überwunden,<br />
das Heliumgas entfernt und die Anlage<br />
wieder einsetzbar ist. Aber gerade für Produktionsstraßen,<br />
auf denen Zeit immer Geld bedeutet,<br />
ist solch eine Verzögerung kaum hinnehmbar.<br />
Der große Vorteil von Inficon-Dichtheitsprüfgeräten<br />
bestehe laut Hersteller in solchen<br />
Szenarien darin, dass sie das Heliumgas bis zu<br />
500% schneller abpumpen als andere Geräte.<br />
Inficon GmbH<br />
Tel.: +49 221 / 56788-133<br />
reach.germany@inficon.com<br />
Herzstück der Kuka-Anlage sind die Helium-Prüfgeräte<br />
Inficon LDS3000 für Prüfungen im 40-Sekunden-Takt<br />
Bilder: Kuka Assembly and Test<br />
Kanäle für die Hydraulikflüssigkeit<br />
werden durch<br />
prüfteilspezifische Abdichtungen<br />
mit extrem engen<br />
Toleranzen versiegelt<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 79
TESTEN + PRÜFEN<br />
Durch die BKA-Systeme<br />
wird nicht nur der Messbereich<br />
erweitert, sondern<br />
auch mehr Platz geschaffen<br />
Bild: Faist<br />
Retrofit von Schallmessräumen<br />
Substitution von Keilabsorbersystemen durch Breitband-Kompaktabsorber (BKA)<br />
Steigende Ansprüche von Autokäufern<br />
und -herstellern an die<br />
Reduzierung von Schallemissionen<br />
führen zu höheren Anforderungen<br />
an die Qualität der Messergebnisse<br />
von Schallpegelmessungen.<br />
Dieser Trend ist in der gesamten<br />
Automobilindustrie erkennbar,<br />
und er hat auch Auswirkungen<br />
auf die Konzeption und<br />
Gestaltung der Messräume.<br />
Die Autorin: Renate Gratwohl, Markkom Consulting, für<br />
Faist Anlagenbau GmbH, Krumbach<br />
Aus diesem Grund kommen hier zunehmend<br />
die von der Faist Anlagenbau GmbH – einem<br />
Experten der Schallschutztechnik – in Kooperation<br />
entwickelten reaktiven Breitband-Kompaktabsorber<br />
(BKA) zum Einsatz. Im Unterschied<br />
zu den konventionellen Keilabsorbern<br />
beanspruchen diese Absorber eine deutlich<br />
geringere Einbautiefe (Standard sind 250 und<br />
350 mm). Zugleich erreichen sie eine hohe Absorptionsrate<br />
über den gesamten Frequenzbereich.<br />
Außerdem lassen sich mit diesem System<br />
auf gleichem Raum tiefere Grenzfrequenzen<br />
erfassen.<br />
Die ebene, pulverbeschichtete Oberfläche der<br />
BKA-Module schafft die Voraussetzung dafür,<br />
dass der Messraum attraktiv gestaltet werden<br />
kann. Das gilt auch für kombinierte bzw. praxisnahe<br />
Testverfahren wie z.B. Schallpegelmessungen<br />
im Windkanal.<br />
Die BKA-Technologie kommt nicht nur bei der<br />
Entwicklung und Errichtung neuer Schallmessräume<br />
von Automobilherstellern und –zulieferern<br />
zur Anwendung, sondern auch bei der Anpassung<br />
vorhandener Messräume an die steigenden<br />
Anforderungen.<br />
Zwei aktuelle Beispiele<br />
Ein deutscher Autohersteller ersetzte die Keilabsorber<br />
in einem Messraum durch ein BKA-<br />
System. Faist hatte vor dem Retrofit eine identische<br />
untere Grenzfrequenz von 80 Hz zugesichert.<br />
Messungen zeigten, dass jetzt 50 Hz erreicht<br />
werden.<br />
Bei einem internationalen Motorenhersteller<br />
gestaltete Faist den Schallmessraum um: Aus<br />
einem Vollfreifeldraum mit Keilabsorbern wurde<br />
ein Halbfreifeldraum mit BKA-Modulen. Dadurch<br />
konnte die untere Grenzfrequenz von<br />
100 auf 63 Hz gesenkt werden. Der erweiterte<br />
Messbereich führt dazu, dass typische Resonanzfrequenzen<br />
nun genau untersucht werden<br />
können.<br />
In beiden Fällen profitiert der Betreiber auch<br />
davon, dass die aktiv nutzbare Fläche des<br />
Messraums vergrößert wurde.<br />
Faist Anlagenbau GmbH<br />
Tel.: +49 8282 8880-214<br />
sabine.helms@faist.de<br />
80 AutomobilKonstruktion 3/2015
Fotos bei 100%-Prüfung<br />
Endoskope prüfen Antriebswellen von Hybrid-Fahrzeugen<br />
Mithilfe eines technischen Endoskops<br />
mit einem Öffnungswinkel<br />
von 100°, einer sogenannten<br />
Fischaugen-Perspektive, können<br />
die Grat- und Verschmutzungsfreiheit<br />
des gesamten Rohres sowie<br />
der Bodenfläche schnell und effizient<br />
geprüft werden.<br />
Bei der Überprüfung müssen<br />
feinste Verschmutzungen und Grate<br />
an den Querbohrungen erkannt<br />
werden. Ebenfalls muss die Bodenfläche<br />
der Antriebswelle auf<br />
Gratfreiheit geprüft werden. Der<br />
Vorgang läuft im Schichtbetrieb<br />
vollautomatisiert. Somit muss die<br />
Innenfläche der Antriebswelle auf<br />
einen Blick begutachtet werden<br />
können, was mit einem starren Endoskop<br />
wie dem Elektrotec SKF-D<br />
von Micro Epsilon perfekt funktionieren<br />
soll.<br />
Es werden zwei Prüfaufgaben mit<br />
einem Endoskop in einem Arbeitsgang<br />
erledigt. Mit einer USB-Kamera<br />
werden an drei Stellen Fotos<br />
ausgelöst und gespeichert. Die<br />
Bilder können leicht auf einem<br />
Monitor begutachtet werden. Eine<br />
100%-Prüfung kann nach Aussage<br />
des Herstellers in den Schichtbetrieb<br />
sehr gut integriert werden.<br />
www.micro-epsilon.com<br />
Poppe + Potthoff: Prüfanlage für variierende Druck- und Temperaturbedingungen<br />
Impulsprüfung von minus bis plus<br />
Luftansaugsysteme aus Kunststoff<br />
müssen schnelle und extreme<br />
Temperaturwechsel aushalten,<br />
während sie unter pulsierendem<br />
positivem und negativem Druck<br />
kontinuierlich im Einsatz sind.<br />
Poppe + Potthoff Maschinenbau<br />
ermöglicht Prüfingenieuren nun,<br />
Temperatur- und Druckwechseltests<br />
von der Straße ins Labor zu<br />
verlegen. Der neue Prüfstand<br />
PPM 278–00 soll selbst die härtesten<br />
realen Bedingungen simulieren,<br />
von Arktis bis Sahara. Eine<br />
geräumige Klimakammer ermöglicht<br />
es, die Prüflinge Temperaturen<br />
von –72 bis +180 °C und einer<br />
Luftfeuchtigkeit von bis zu 98%<br />
auszusetzen.<br />
Die Druckanpassung reicht von<br />
–0,8 bis +3,5 bar bei einer Test-<br />
Frequenz von 0,5 Hz und einem<br />
Test-Volumen von 15 dm³. Somit<br />
sind variable Impulsdrucktests im<br />
Überdruck-Überdruck, Überdruck-<br />
Vakuum und Vakuum-Vakuum Bereich<br />
möglich. Drei Testanschlüsse<br />
sind auf jeder Seite der Prüfkammer<br />
eingerichtet und können individuell<br />
mithilfe getrennter Ventile<br />
geschlossen werden. Ein automatischer<br />
Dichtheitstest kann Leckagen<br />
in jedem einzelnen Prüfstück<br />
alle X Zyklen detektieren<br />
und es vom Prüfvorgang ausschließen.<br />
www.potte-potthoff.com<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 81
TESTEN + PRÜFEN<br />
Entwickler realisieren Echtzeitvernetzung von Prüfständen<br />
Virtuelle Verbindung – reale Ergebnisse<br />
Um eine signifikante Zeit- und<br />
Kostenreduktion in der Entwicklung<br />
zu erreichen, haben FEV und<br />
Mitarbeiter des Lehrstuhls für Verbrennungskraftmaschinen<br />
der<br />
RWTH Aachen eine virtuelle Verbindung<br />
zwischen zwei Prüfeinrichtungen<br />
realisiert. Die Testumgebung<br />
besteht aus räumlich<br />
getrennten Prüfständen, die über<br />
eine EtherCAT-Verbindung echtzeitgekoppelt<br />
sind. „Durch die virtuelle<br />
Welle werden die Lastmaschinen<br />
in beiden Komponenten-Prüfständen<br />
so angesteuert,<br />
dass das Systemverhalten einer<br />
realen mechanischen Welle entspricht“,<br />
erklärt Stefan Pischinger,<br />
President und CEO der FEV Group<br />
und Leiter des Lehrstuhls für Verbrennungskraftmaschinen<br />
der<br />
RWTH Aachen. „So lässt sich eine<br />
Interaktion – beispielsweise zwischen<br />
Motor und Getriebe – erzielen<br />
und dies bereits im Prototypenstatus,<br />
also bevor beide Komponenten<br />
physisch adaptierbar<br />
sind. Das spart Entwicklungszeit.“<br />
Weiterhin lassen sich auch Kombinationen<br />
eines Hybridantriebs<br />
testen, welche mechanisch noch<br />
nicht kompatibel sind und erst<br />
umfangreich adaptiert werden<br />
müssten.<br />
IAA: Halle 4.0, Stand E31<br />
www.fev.com<br />
Lasersystem einfacher und kostengünstiger integrieren<br />
Weitere Schnittstellen für Servolaser<br />
Über die neuen Schnittstellen für<br />
Profibus, Profinet, CC-Link und<br />
Modbus/TCP können Reifenhersteller<br />
den Servolaser TireXpert<br />
von LAP jetzt direkt ohne Interfaces<br />
mit mehr Maschinensteuerungen<br />
verbinden und ansteuern<br />
als zuvor. Bisher setzte LAP auf eine<br />
Parallelschnittstelle, RS485<br />
und Ethernet/IP.<br />
Diese Auswahlmöglichkeiten decken<br />
die gängigsten Industriestandards<br />
ab und erlauben eine unkomplizierte<br />
und kostengünstige<br />
Integration der Laser – ganz ohne<br />
zusätzliche Schnittstellenumsetzer<br />
und Gateways, die Fertigungsprozesse<br />
verlangsamen und Kommunikationsprobleme<br />
verursachen<br />
können.<br />
Auf einer bis zu 2,6 m langen Lineareinheit<br />
verfahren ein oder<br />
zwei Lasermodule mit einer Geschwindigkeit<br />
von bis zu einem<br />
Meter pro Sekunde. Zwei Einheiten<br />
sind kombinierbar, wodurch<br />
bis zu vier bewegliche Linien zur<br />
Verfügung stehen. Über die SPS<br />
kann der Anwender den Laser<br />
steuern: Es lassen sich unterschiedliche<br />
Positionen und Bewegungsfolgen<br />
für einzelne Arbeitsschritte<br />
programmieren und die<br />
Helligkeit der projizierten Linien<br />
kann individuell an das jeweilige<br />
Umgebungslicht angepasst werden.<br />
www.lap-laser.com<br />
Mehrkanalmesstechnik im Einsatz bei Volkswagen<br />
Vorspannkraftmessung erreicht neue Dimension<br />
Die von der AMG Intellifast entwickelte<br />
Mehrkanalmesstechnik<br />
für das Messen von Vorspannkräften<br />
in Schraubenverbindungen<br />
mittels Ultraschall wird von Volkswagen<br />
als erstem Automobilhersteller<br />
bereits seit 2013 intensiv<br />
eingesetzt.<br />
Der große Vorteil der Technologie<br />
liege laut Hersteller darin, dass<br />
weder die Schraubenverbindung<br />
im Bauteil (wie beispielsweise bei<br />
der Verwendung von Kraftmessringen)<br />
noch die Schraube selbst<br />
(wie bei der Verwendung von<br />
Dehnmessstreifen) für die Messungen<br />
verändert werden müssen.<br />
Das Aufbringen eines geklebten<br />
oder dauerhaft haltbaren – per<br />
Plasma-Verfahren beschichteten –<br />
Ultraschall-Wandlers (Transducers)<br />
am Kopf oder Ende der<br />
Schraube verändert weder Fit,<br />
Form oder Funktion noch die Materialeigenschaften<br />
der Schraube.<br />
Die neue Messtechnik liefert für<br />
eine gegebene Anzahl von Kanälen<br />
präzise die aktuelle Vorspannkraft<br />
während einer dynamischen<br />
Belastung, gleichermaßen auf<br />
Prüfständen oder Testkursen. Damit<br />
können bisher nicht sichtbare<br />
Zusammenhänge bei Mehrfachschraubverbindungen<br />
festgestellt<br />
und dokumentiert oder Belastungsspitzen<br />
bei hochbeanspruchten<br />
Einzelverbindungen<br />
detektiert werden.<br />
IAA Volkswagen:<br />
Halle 3.0, Stand A01<br />
www.intellifast.de<br />
82 AutomobilKonstruktion 3/2015
Automobil<br />
Konstruktion<br />
Fachwissen für Entwicklungsingenieure<br />
Herausgeberin: Katja Kohlhammer<br />
Verlag:<br />
Konradin-Verlag Robert Kohlhammer GmbH,<br />
Ernst-Mey-Straße 8,<br />
70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany<br />
Geschäftsführer: Peter Dilger<br />
Verlagsleiter: Peter Dilger<br />
REDAKTION<br />
Chefredakteur: Jens-Peter Knauer,<br />
Phone +49 711 7594-407<br />
Redaktion:<br />
Dr.-Ing. Ralf Beck, Phone +49 711 7594-424<br />
Irene Knap, Phone +49 711 7594-446<br />
Bettina Tomppert, Phone +49 711 7594-286<br />
Redaktionelle Mitarbeit:<br />
Dr.-Ing. Rolf Langbein<br />
Dipl.-Ing. Jürgen Goroncy<br />
Tobias Meyer<br />
Hartmut Hammer<br />
Redaktionsassistenz:<br />
Gabriele Rüdenauer, Phone +49 711 7594-257,<br />
Fax +49 711 7594-398<br />
E-Mail: ak.redaktion@konradin.de<br />
Layout:<br />
Matthias Rösiger, Phone +49 711 7594-273<br />
ANZEIGEN<br />
ISSN 1866-9131<br />
Bertrandt AG, Ehningen 9<br />
Böllhoff Produktion GmbH ,<br />
Bielefeld 13<br />
Friedrich Boysen<br />
GmbH & Co.KG,<br />
Altensteig 84<br />
COUTH BUTZBACH<br />
Produktkennzeichnung GmbH,<br />
Solingen 73<br />
Deutsche Edelstahlwerke<br />
GmbH, Witten 23<br />
Federal-Mogul Holding<br />
Deutschland GmbH,<br />
Wiesbaden 2<br />
INSERENTENVERZEICHNIS<br />
Heraeus Noblelight GmbH,<br />
Kleinostheim 71<br />
Igus GmbH, Köln 5<br />
IMS Verbindungstechnik<br />
GmbH & Co.KG,<br />
Neuenstein 67, 69<br />
KACO GmbH + Co.KG<br />
Dichtungswerke, Heilbronn 31<br />
KIEFEL GmbH, Freilassing 72<br />
LAMILUX Composites GmbH,<br />
Rehau 70<br />
Landesmesse Stuttgart GmbH,<br />
Stuttgart 35<br />
LEE-Hydraulische Miniatur-<br />
Komponenten GmbH,<br />
Sulzbach 21, 45<br />
MICRO-EPSILON MESSTECHNIK<br />
GmbH & Co.KG, Ortenburg 3<br />
Preh GmbH, Bad Neustadt 7<br />
Reed Exhibitions Deutschland<br />
GmbH, Düsseldorf 63<br />
Schaeffler Technologies AG &<br />
Co. KG, Herzogenaurach 11<br />
WEISS Kunststoffverarbeitung<br />
GmbH & Co,<br />
Illertissen 57<br />
Carl Zeiss<br />
Industrielle Messtechnik GmbH,<br />
Oberkochen 15<br />
Gesamtanzeigenleitung: Andreas Hugel,<br />
Phone +49 711 7594-472<br />
Auftragsmanagement: Annemarie Olender,<br />
Phone +49 711 7594-319<br />
Zur Zeit gilt die Anzeigenpreisliste vom 1.10.2014<br />
LESERSERVICE<br />
Ute Krämer, Phone +49 711 7594-5850, Fax -15850<br />
E-Mail: ute.kraemer@konradin.de<br />
AutomobilKonstruktion erscheint mit vier Ausgaben pro Jahr.<br />
Bezugspreise Inland 18,40 Euro inkl. Versandkosten und<br />
MwSt.; Ausland: 20,40 Euro inkl. Versandkosten;<br />
Einzelverkaufspreis: 4,80 Euro inkl. MwSt.<br />
zzgl. Versandkosten.<br />
Bezugszeit: Das Abonnement kann erstmals vier Wochen zum<br />
Ende des ersten Bezugsjahres gekündigt werden. Nach Ablauf<br />
des ersten Jahres gilt eine Kündigungsfrist von jeweils vier Wochen<br />
zum Quartalsende.<br />
AUSLANDSVERTRETUNGEN<br />
Schweiz, Italien, Frankreich, Belgien, Luxemburg: IFF media ag,<br />
Frank Stoll, Technoparkstrasse 3, CH-8406 Winterthur<br />
Tel: +41 52 633 08 88, Fax: +41 52 633 08 99,<br />
e-mail: f.stoll@iff-media.ch<br />
Großbritannien: Jens Smith Partnership, The Court, Long Sutton,<br />
GB-Hook, Hampshire RG29 1TA, Phone 01256 862589,<br />
Fax 01256 862182, E-Mail: media@jens.demon.co.uk<br />
USA: Trade Media International Corp., 421 Seventh Avenue/<br />
Suite 607, New York, NY 10001–2002,<br />
Phone 212 564–3380, Fax 212 5943841,<br />
E-Mail: corrie.deGroot@tmicor.com<br />
BANKVERBINDUNGEN<br />
Baden-Württembergische Bank, 2 623 887<br />
(BLZ 600 501 01) BIC: SOLADEST,<br />
IBAN: DE28 6005 0101 0002 6238 87;<br />
Postbank Stuttgart, Konto 44 689–706,<br />
BLZ 600 100 70<br />
Gekennzeichnete Artikel stellen die Meinung des Autors, nicht unbedingt<br />
die der Redaktion dar. Für unverlangt eingesandte Manuskripte<br />
keine Gewähr. Alle in AutomobilKonstruktion erscheinenden<br />
Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch<br />
Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art,<br />
nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.<br />
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Stuttgart.<br />
Druck: Konradin Druck GmbH, Leinfelden-Echterdingen.<br />
Printed in Germany.<br />
© 2015 by Konradin-Verlag Robert Kohlhammer GmbH,<br />
Leinfelden-Echterdingen.<br />
WIR BERICHTEN ÜBER<br />
AMG Intellifast 82<br />
Audi 45, 46, 68<br />
Autoadapt 71<br />
Automotive Simulation<br />
Center 17<br />
AVL List 54<br />
BASF 16, 70<br />
BBA 15<br />
Benecke-Kaliko 16<br />
Bertrandt 42, 52<br />
BMW 8<br />
BMWi 8, 10<br />
Borbet 16<br />
Brose 8, 12, 69<br />
Continental 10, 17, 36, 44<br />
Continental Emitec 12<br />
Contitech 12, 62<br />
CPU 24/7 52<br />
CQFD Composites 14<br />
Daimler 8, 16, 40, 66<br />
Delcotex 14<br />
Delphi 36, 68, 74<br />
Designagentur Ziba 68<br />
Deutz 12<br />
Ebm-Papst 27<br />
Elektrobit 68<br />
EnBW 8<br />
Engmatec 76<br />
Eplan 17<br />
Faist 80<br />
Federal-Mogul 12, 26<br />
Fehrer 70<br />
FEV 12, 82<br />
Findling 12<br />
Ford 66<br />
Fraunhofer 8<br />
Freudenberg 27, 30<br />
German RepRap 48<br />
Getrag 12<br />
Google 68<br />
GSK Protech 6<br />
Gummiwerk Kraiburg 14<br />
Hennecke 14<br />
Hochschule Heilbronn 68<br />
Holzapfel 72<br />
Inficon 78<br />
Infineon 32<br />
IPG Automotive 52<br />
Iprotex 14<br />
Jaguar 59<br />
Johnson Controls 73<br />
Kiekert AG 8<br />
Knorr-Bremse 12<br />
Koenigsegg 63<br />
Krauss-Maffei 14<br />
KSPG 15, 24<br />
KTR 31<br />
Kuka Assembly and Test 78<br />
LAP 82<br />
Leoni 15, 44<br />
Mahle 18, 24<br />
Mann-Filter 17<br />
Mercedes-Benz 40<br />
Messring 6<br />
Micro-Epsilon 81<br />
Moog 16<br />
Netzsch 6<br />
Nissan 68<br />
NSK 30, 62<br />
Open Mind 50<br />
Poppe + Potthoff 81<br />
Porsche 8<br />
Preh 10, 12, 45<br />
PSA Peugeot Citroën 50<br />
Pöppelmann Kapsto 27<br />
Qoros 12<br />
Rassini 16, 58<br />
Reed Exhibitions 14<br />
Renault-Nissan 12<br />
Rhenus Lub 22<br />
RWTH Aachen 82<br />
Safran 64<br />
Schaeffler 6<br />
Schmitz Cargobull 16<br />
Schmolz + Bickenbach 16<br />
Scienlab 8<br />
Scott Bader 14<br />
SKF 26, 28, 63<br />
Smart 70<br />
Sonceboz 38<br />
Sonderhoff Chemicals 66<br />
Steinbichler 8<br />
Tata Steel 62<br />
Tenneco 59<br />
TP Technische<br />
Dienstleistungen 48<br />
TRW 10<br />
TU Bergakademie<br />
Freiberg 60<br />
TU Berlin 17<br />
TU Dresden 6<br />
Valeo 64<br />
VDC Fellbach 17<br />
Virtual Vehicle 54<br />
Volkswagen 8, 82<br />
Weiss 20<br />
Xindebao 16<br />
Yanfeng 14<br />
Zeiss 8<br />
ZF 10, 56<br />
3/2015 AutomobilKonstruktion 83
Wir freuen uns auf Sie!<br />
Eine Abgasreinigung, die alle Emissionsvorgaben erfüllt. Ein Wärme-Management,<br />
das das Energiepotenzial der Abgase bestmöglich nutzt.<br />
Ein Leichtbaukonzept, das Maßstäbe setzt. Und ein aktiv gestalteter Fahrzeugklang,<br />
der jedem Neuwagenkäufer ein Lächeln ins Gesicht zaubert.<br />
Werden diese Vorgaben erfüllt, sind Sie dem perfekten Abgassystem ganz nahe.<br />
Wie nahe, das möchten wir Ihnen zeigen!<br />
Friedrich Boysen GmbH & Co. KG · Friedrich-Boysen-Str. 14-17 · 72213 Altensteig · Tel. 0 74 53/20-0 · Fax 0 74 53/20-227 · friedrich.boysen@boysen-online.de · www.boysen-online.de<br />
Spezialist für Abgastechnik.<br />
Partner für Entwicklung, Produktion und Logistik.