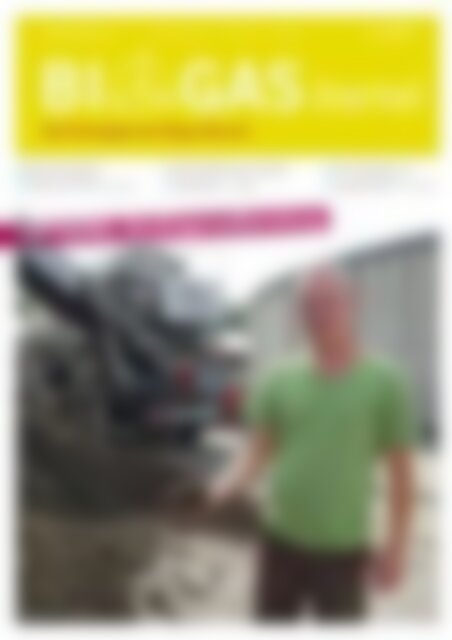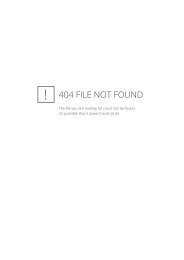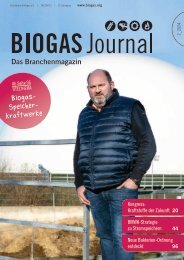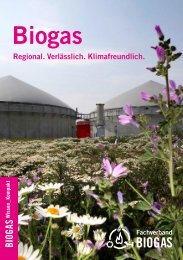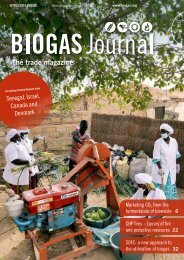5_2019 Leseprobe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
www.biogas.org Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 50073 | 22. Jahrgang 5_<strong>2019</strong><br />
BI<br />
GAS Journal<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche<br />
Branchenzahlen<br />
2018 und <strong>2019</strong> S. 56<br />
Hochlastfaulung reduziert<br />
Verweilzeit S. 86<br />
Der Flexdeckel ist<br />
ausgeschöpft S. 110<br />
TOPTHEMA: Gärdüngeraufbereitung<br />
Fachverband Biogas e.V, Angerbrunnenstr. 12, 85356 Freising<br />
ZKZ 50073, PVSt, DPAG, Entgelt bezahlt 93##<br />
bigbenreklamebureau GmbH<br />
Frau Scho Schomacker<br />
An der Surheide 29<br />
28870 Ottersberg Fischerhude<br />
Adressfeld
INHALT<br />
BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />
12<br />
24<br />
EDITORIAL<br />
3 Heißer Sommer! Heißer Herbst?<br />
Von Dr. Stefan Rauh, Geschäftsführer<br />
des Fachverbandes Biogas e.V.<br />
AKTUELLES<br />
6 Meldungen<br />
8 Bücher & Termine<br />
10 Biogas-Kids<br />
12 „Bunte Biomasse“ soll Mais ersetzen<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
16 Programmübersicht<br />
BIOGAS Convention & Trade Fair vom<br />
10. bis 12. Dezember in Nürnberg<br />
POLITIK<br />
22 Neuer Schwung für Grünes Gas: Eine<br />
Zukunftsoption für die Biogasbranche?!<br />
Von Sandra Rostek und Dr. Guido Ehrhardt<br />
TOPTHEMA<br />
Gärdüngeraufbereitung<br />
24 Separation: Fest-Flüssig-Trennung<br />
in allen Leistungsklassen<br />
Von Thomas Gaul<br />
34 Gärdüngeraufbereitung wird<br />
Dampf gemacht<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
40 Phosphor zurück in den Kreislauf!<br />
Von Dierk Jensen<br />
PRAXIS<br />
48 Noch neuralgische Punkte abarbeiten<br />
Von Dierk Jensen<br />
52 Praxistest: Gasproduktion gezielt<br />
über Fütterung steuern<br />
Von Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
56 Branchenzahlen: aktuelle Entwicklungen<br />
und Prognose für <strong>2019</strong><br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
60 Schrägrinnentest prüft Enzymwirkung<br />
Von Dr. Ing. Matthias Gerhardt<br />
und Vincent Pelenc<br />
64 Elektrobus-Quote kein Allheilmittel<br />
Von Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
Beilagenhinweis:<br />
Das Biogas Journal enthält Beilagen<br />
der Firmen agrikomp, HR Energiemanagement,<br />
IBBK, Pronova, UNION Instruments und<br />
des Fachverbandes Biogas.<br />
4
BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />
INHALT<br />
TITELFOTO: THOMAS GAUL I FOTOS: MARTIN BENSMANN, JÖRG BÖTHLING, GABRIELE HAJOK/HURTIGRUTEN, FACHVERBAND BIOGAS E.V.<br />
68 106<br />
68 Grüne Kreuzfahrt: Biogas statt Schweröl<br />
Von Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
72 Anlagen des Monats Juli & August<br />
74 Öko-Kiez nimmt alle Hürden<br />
Von Christian Dany<br />
82 Neue Lehrkonzepte in der<br />
Schulungssaison <strong>2019</strong>/2020<br />
Von Dipl.-Wirts.-Ing. (FH) Marion Wiesheu<br />
WISSENSCHAFT<br />
86 Mehr Gas bei geringerer Verweilzeit<br />
Von Dipl.-Ing · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
90 Forschung, die ankommt: Wegweisende<br />
Biogas-Projekte in der Zuse-Gemeinschaft<br />
Von Alexander Knebel<br />
INTERNATIONAL<br />
94 Klimawandel- und Energiewendekongress<br />
in der Karibik<br />
Von Frank Hofmann<br />
VERBAND<br />
Aus der Geschäftsstelle<br />
96 Zeit für Entscheidungen<br />
Von Dr. Stefan Rauh und<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
100 Aus den Regionalgruppen<br />
102 Aus den Regionalbüros<br />
104 Sozial gerechte CO 2<br />
-Bepreisung<br />
bald einführen<br />
Von Dr. Simone Peter, BEE<br />
106 Impressionen der Dreharbeiten mit<br />
dem Hackl Schorsch<br />
107 Unser Beitrag<br />
RECHT<br />
108 Biomethan – Anlagen mit ungewisser<br />
Zukunft?<br />
Von Dr. Helmut Loibl<br />
110 Flexibilitätsprämie – der Countdown läuft<br />
Von René Walter und Dr. Andrea Bauer<br />
PRODUKTNEWS<br />
112 Produktnews<br />
114 Impressum<br />
5
PRAXIS / TITEL<br />
BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />
Gärdüngeraufbereitung<br />
wird Dampf gemacht<br />
Das Eindampfen von Gärprodukten bei gleichzeitiger Veredlung eines Teilstroms zu hochwertigem<br />
ASL-Dünger in Vakuum-Verdampfungsanlagen ist eine Option für die Verbesserung<br />
der Anlageneffizienz.<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Betriebsteilleiter<br />
Philipp Berns (links)<br />
im Gespräch mit<br />
Rohstoffmanager<br />
Christian Podritzke vor<br />
der Annahmehalle der<br />
Abfallbiogasanlage.<br />
Für Philipp Berns, Betriebsleiter der Abfallbiogasanlage<br />
im thüringischen Bad Köstritz,<br />
liegen die Vorteile klar auf der Hand. „Jeder<br />
Kubikmeter reines Wasser, den wir durch den<br />
Betrieb des Vakuumverdampfers in die Atmosphäre<br />
abgeben, nutzt der Umwelt und bringt uns 6 bis<br />
7 Euro“, sagt der 38-Jährige. Der Mehrerlös ergebe sich<br />
zum einen durch die Nutzung der Wärme, da dieser Teil<br />
der thermischen Energie sonst heruntergekühlt werden<br />
müsste, zum anderen durch den damit verbundenen<br />
KWK-Bonus bei der Stromeinspeisung nach dem wErneuerbare-Energien-Gesetz<br />
und schließlich durch die<br />
Verringerung der Kosten, die das kooperierende Lohnunternehmen<br />
pro Kubikmeter als Arbeitsleistung für<br />
die Ausbringung flüssiger Gärdünger auf Agrarflächen<br />
in Rechnung stellt.<br />
Nicht von der Hand zu weisen ist wohl auch der Effekt<br />
einer positiven Außenwirkung des Unternehmens.<br />
Schließlich verwertet die Anlage große Mengen Bioabfall<br />
zu erneuerbarer Energie und Dünger für die Landwirtschaft.<br />
Um die verdorbenen Lebensmittel aus den<br />
Verpackungen herauszuwaschen und das Gärsubstrat<br />
aufzubereiten, wird viel Flüssigkeit benötigt. Dennoch<br />
bezieht die Anlage dafür – abgesehen von geringen<br />
Mengen zum Reinigen der gewerblichen Biotonnen –<br />
kein Wasser aus dem Leitungsnetz oder einem offenen<br />
Gewässer. Und es verbleibt auch kein Abwasser. Eine<br />
FOTOS: CARMEN RUDOLPH<br />
wichtige Rolle bei dieser ressourcenschonenden Arbeitsweise<br />
spielt die seit November 2018 betriebene<br />
Vakuumverdampfungsanlage, die, dank eines technologischen<br />
Tricks, selbst sehr energiesparend arbeitet.<br />
Flüssiger Gärdünger dient als<br />
Waschflüssigkeit<br />
Welche Funktion das Verdampfungssystem im Gesamtprozess<br />
hat, wird beim Blick auf die Stoffflüsse<br />
deutlich. Die von der Potsdamer Danpower Gruppe<br />
(100-prozentige Tochter der Stadtwerke Hannover)<br />
betriebene Biogasanlage im Bad Köstritzer Gewerbegebiet<br />
Heinrichshall verarbeitet jährlich bis zu 60.000<br />
Tonnen (t) verpackte und unverpackte Bioabfälle aus<br />
der Lebensmittelindustrie und Gastronomie.<br />
Bedingt durch den meist hohen Feuchtegehalt des<br />
angelieferten Inputs ist auch das ausgegorene Material<br />
nach der Biogasproduktion in einem Pfefferkorn-<br />
Fermenter sehr dünnflüssig. Zwei Separatoren pressen<br />
daraus stündlich 60 Kubikmeter (m³) Flüssigkeit. „Die<br />
Separatoren sind sehr straff eingestellt“, sagt Berns<br />
bei einem Betriebsrundgang. Dies sei zum einen notwendig,<br />
weil die verbleibende feste Fraktion wegen der<br />
darin enthaltenen Verpackungsschnipsel in die Verbrennung<br />
geht und dafür möglichst trocken sein muss.<br />
Zum anderen wird die abgepresste Flüssigkeit als<br />
Prozesswasser zum Auswaschen der organischen Abfälle<br />
aus den zuvor geschredderten Verpackungen gebraucht.<br />
Das dabei entstehende Gemisch aus bioaktivem<br />
Waschwasser und den Verpackungsinhalten bildet<br />
zugleich die „Grundrezeptur“ des flüssigen Gärsubstrats,<br />
dem gegebenenfalls weitere unverpackte Bioabfälle<br />
zugesetzt werden.<br />
Der Bedarf an Waschwasser schwankt je nach Zusammensetzung<br />
des angelieferten Inputs. Was darüber<br />
hinaus an Prozesswasser anfällt, kommt als Flüssigdünger<br />
auf umliegenden Ackerflächen zum Einsatz.<br />
Da der Dünger von der Gütegemeinschaft Gärprodukte<br />
(GGG) zertifiziert ist, findet er in der vieharmen Region<br />
problemlos Abnehmer. Dennoch schlägt die Abholung<br />
und Ausbringung durch ein Lohnunternehmen für den<br />
Anlagenbetreiber wie eingangs beschrieben als Kostenfaktor<br />
zu Buche.<br />
34
BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />
PRAXIS / TITEL<br />
Vom Annahmebunker (rechts unten) gehen die Bioabfälle in die Entpackungsanlage.<br />
Das Auswaschen der geschredderten Kunststoffverpackungen erfolgt mit der abgepressten<br />
Flüssigkeit aus den Separatoren für die Gärprodukte.<br />
Anlieferung flüssiger Rückstände aus der Ernährungswirtschaft zur Einmischung in<br />
das Substrat für die Abfallbiogasanlage. In dieser Halle betankt auch das Lohnunternehmen<br />
seine Fahrzeuge mit flüssigem Gärprodukt, das in der Biogasanlage auch als<br />
Prozesswasser dient.<br />
Blick vom Dach des Pfefferkornfermenters der Abfallbiogasanlage<br />
in Bad Köstritz auf den Nachgärer und die Annahmehalle für<br />
Bioabfälle. In den schwarzen Containern befinden sich Biofilter<br />
für die abgesaugte Hallenluft.<br />
Anlieferung gewerblicher Bioabfälle aus Großküchen und<br />
gastronomischen Einrichtungen in der Annahmehalle der<br />
Biogasanlage.<br />
Die Überwachung der Betriebsparameter<br />
der Biogasanlage einschließlich der<br />
Verdampfungsanlage kann auch über<br />
Smartphone oder Tablet erfolgen.<br />
Alle verwertbaren organischen Komponenten gelangen zunächst<br />
in die Hygienisierung. Die Abtötung der potenziellen Krankheitserreger<br />
über eine Stunde bei 70 Grad Celsius geschieht mit dem<br />
geringstmöglichen Wärmeeinsatz.<br />
Zwei straff eingestellte Separatoren pressen aus dem Gärprodukt stündlich 60 m³ Flüssigkeit,<br />
von dem ein Teil als Prozesswasser zum Einsatz kommt und so in den Kreislauf zurückfließt.<br />
35
PRAXIS / TITEL<br />
BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />
Behälter für den produzierten ASL-Dünger (vorn) und für die Schwefelsäure zur Ammoniakbindung (Mitte)<br />
sowie der Verdunstungskühler neben der Halle, in der sich der Vakuum-Verdampfer befindet.<br />
Um den Geruchsstoff<br />
Skatol (Ebergeruch)<br />
aus dem im Vakuum-<br />
Verdampfer erzeugten<br />
Wasser zu eliminieren,<br />
durchströmt das Destillat<br />
vor der Verdunstung im<br />
Kühlaggregat einen speziellen<br />
Aktivkohlefilter.<br />
Verdampfer ist Teil des<br />
Wassermanagements<br />
Um die bei der Abfallvergärung anfallende Flüssigkeitsmenge<br />
zu reduzieren, entschloss man sich zur<br />
Errichtung einer Vakuum-Verdampfungsanlage. Sie<br />
nimmt pro Tag etwa 20,5 m³ Prozesswasser auf und<br />
produziert daraus in zwei Verfahrensstufen 0,8 m³<br />
Ammoniumsulfat-Lösung (ASL) für den Einsatz im<br />
Pflanzenbau und 12,2 m³ reines Wasser. 7,5 m³ gehen<br />
zurück in den Flüssigkeitskreislauf der Biogasanlage.<br />
Das erzeugte Reinwasser wird mangels Möglichkeit zur<br />
Einleitung in ein Gewässer über einen Verdunstungskühler<br />
an die Atmosphäre abgegeben. Ein Teil der dabei<br />
entstehenden Verdunstungskälte sorgt für die Kühlung<br />
der Rohrschlangen, an denen sich der Brüdendampf<br />
niederschlägt.<br />
Nach Inbetriebnahme des Vakuum-Verdampfungssystems<br />
stellte sich heraus, das über den Verdunstungskühler<br />
Skatol (Ebergeruch) emittiert wird. Dieser Geruchsstoff<br />
ist schon in geringsten Mengen unangenehm<br />
wahrnehmbar. Die Lösung fand sich in Zusammenarbeit<br />
mit dem Leipziger Institut für nichtklassische Chemie<br />
in Form eines Filters mit spezieller Aktivkohle, den<br />
jetzt das Wasser vor der Verdunstung passiert.<br />
„Seitdem arbeitet die Vakuum-Verdampfungsanlage<br />
zuverlässig und erfüllt alle Parameter“, bescheinigt<br />
der Betriebsleiter. Allerdings wird das System nicht<br />
auf Kante gefahren, um Störungen und dadurch mögliche<br />
Geruchsemissionen von Ammoniak oder Skatol im<br />
Sinne einer guten Nachbarschaft im Gewerbegebiet zu<br />
vermeiden. In den nächsten Monaten soll die Leistung<br />
weiter optimiert werden. Geplant ist zudem die Entwicklung<br />
einer Vermarktungsstrategie für den hochwertigen<br />
und ebenfalls GGG-zertifizierten ASL-Dünger. „Wir denken<br />
da an die Abgabe von Kleinstmengen an Gärtnereien<br />
oder Gartenvereine. An unserer Abfüllanlage wären<br />
die Voraussetzungen dafür gegeben“, sagt Berns.<br />
Das modulare Verdampfersystem des Herstellers MKR Metzger lässt sich in zwei Baugrößen<br />
auf bis zu vier Stufen erweitern und kann so mit den Anforderungen mitwachsen.<br />
FOTO: WERKBILD<br />
Schwefelsäure wird erst dem Kondensat<br />
zugegeben<br />
„Bei unserem zweistufigen Verfahren erfolgt der Verdampfungsprozess<br />
im Vakuum bei einer Temperatur<br />
von 40 Grad Celsius bis 70 Grad Celsius“, erläutert<br />
Christoph Kuntze von der Steffen Hartmann Recyclingtechnologien<br />
GmbH (SHR), die das System entwickelt<br />
und gebaut hat. Die Anlage in Bad Köstritz sei für eine<br />
Destillationsleistung von 1.000 Litern Gärdünger pro<br />
Stunde ausgelegt. Nach dem Erhitzen und dem Kondensieren<br />
des Dampfes in der ersten Stufe verbleibt<br />
Düngerkonzentrat und als Zwischenprodukt ammoniakhaltiges<br />
Wasser. „Im Gegensatz zur landläufigen<br />
Praxis, bei der die Gärdünger vor dem Verdampfen angesäuert<br />
werden, um das Ammoniak als Ammoniumsulfat<br />
zu binden, geben wir die Schwefelsäure erst dem<br />
Kondensat zu“, informiert Kuntze.<br />
36
BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />
PRAXIS / TITEL<br />
Dadurch reduziere sich der Verbrauch an Schwefelsäure<br />
erheblich. Denn im Gärdünger wirkten die organischen<br />
Bestandteile als Puffer, was durch Zugabe großer<br />
Säuremengen kompensiert werden müsse. Das Wasser-<br />
Ammoniak-Destillat enthalte dagegen keine Puffer und<br />
der Schwefelsäureverbrauch entspreche der umgesetzten<br />
Ammoniakmenge. „Die aufkonzentrierte flüssige<br />
Phase ist nicht sauer. Auch einer möglichen Bildung<br />
von Schwefelwasserstoff wird mit dem neuen Verfahren<br />
vorgebeugt“, nennt Kuntze einen weiteren Vorteil der<br />
Technologie.<br />
In einem zweiten Verfahrensschritt werde der etwa einprozentigen<br />
Ammoniumsulfatlösung, die durch die Zugabe<br />
von Schwefelsäure entstanden ist, mittels erneuter<br />
Destillation Wasser entzogen und der ASL-Dünger<br />
dadurch zu einer 40-prozentigen Lösung konzentriert.<br />
Als Kondensat verbleibt klares Wasser. Das Besondere:<br />
Die für das Eindampfen der AS-Lösung notwendige<br />
thermische Energie stammt aus der Kondensationsenergie,<br />
die beim Abkühlen des aus dem Gärdünger<br />
aufsteigenden Brüdendampfes abgegeben wird, also<br />
aus der ersten Stufe.<br />
„Das funktioniert, weil der Siedepunkt des Wassers mit<br />
abnehmendem Druck sinkt. Die zweite Phase erfolgt<br />
in einem höheren Vakuum“, beschreibt Kuntze das<br />
Wirkprinzip. Das Wärmepotenzial aus der Biogasanlage<br />
werde somit zwei Mal genutzt, zunächst für die Aufkonzentration<br />
des Gärdüngers und anschließend, um eine<br />
40-prozentige ASL zu erzeugen.<br />
In den vergangenen Jahren sei das Verfahren weiterentwickelt<br />
und dabei fast eine Halbierung des Primärenergieverbrauchs<br />
erreicht worden. Das Einsatzgebiet des<br />
verbesserten Anlagentyps sehen die Entwickler jedoch<br />
eher im Bereich der Abwasseraufbereitung, unter anderem<br />
wegen der relativ komplexen Steuerung für einen<br />
optimalen Betrieb.<br />
Hohe Anforderungen an die<br />
Anlagensteuerung<br />
Höhere Anforderungen an die Qualifikation des Bedienpersonals<br />
bei dieser Methode der Volumenreduzierung<br />
von Gärprodukten bestätigt Dr. Hans Oechsner, der für<br />
die Universität Hohenheim forscht. Der Wissenschaftler<br />
untersuchte im Auftrag der Fachagentur Nachwachsende<br />
Rohstoffe (FNR) verschiedene Technologien zum<br />
Wasserentzug im Zusammenhang mit der Biogasproduktion<br />
und nahm dabei auch drei Vakuumtrockner mit<br />
vorgeschalteten Pressschneckenseparatoren unter die<br />
Lupe. „Diese Technologie macht meiner Einschätzung<br />
nach nur für Betriebe Sinn, die einen dauernden Wärmeüberschuss<br />
haben, auch im Winter“, so Oechsner.<br />
Hinzu kämen spezielle Bedingungen, die eine Verbesserung<br />
der Transportwürdigkeit der Gärprodukte für Anlagenbetreiber<br />
wirtschaftlich interessant machen oder<br />
aber zu entsprechenden Überlegungen zwingen. Dies<br />
sei beispielsweise in Regionen mit zu hoher Viehdichte<br />
und bei Problemen mit der Nährstofffracht der Fall.<br />
Schweizer Verdampfungssystem<br />
Bei einer Biogasanlage in Bersenbrück (Niedersachsen) mit einer installierten Leistung von<br />
1,3 Megawatt installierter elektrischer Leistung fallen übers Jahr 30.000 t Gärprodukt an.<br />
Nach deren mechanischer Separation wird die flüssige Separationsphase im Eindampfsystem<br />
des Schweizer Herstellers Arnold & Partner AG in Wärmetauschern erhitzt und anschließend<br />
unter Vakuum verdampft.<br />
„Die mehrstufige Schaltung des Eindampfers vervielfacht die Verdampfungsleistung bei<br />
gleichbleibendem Heizbedarf“, betont Geschäftsführer Oliver Arnold. Das Prinzip: Die ausgedampften<br />
Brüden der ersten Stufe werden für die Beheizung der zweiten Stufe genutzt.<br />
Die physikalische Grundlage dafür ist eine Absenkung des Druckes mittels Vakuumpumpe<br />
in der jeweils nachfolgenden Verdampferstufe. Der Dampf der letzten Stufe kondensiert am<br />
Luftkühler. Um eine Verflüchtigung des Ammoniaks zu verhindern, werde der pH-Wert der<br />
Gärprodukte vor dem Eindampfen mittels Schwefelsäure gesenkt. Alle im Ausgangsprodukt<br />
enthaltenen Nährstoffe fänden sich im eingedickten Konzentrat wieder. Somit würde eine maximale<br />
Trennung von Flüssigkeit und Nährstoffen erreicht. Das Kondensat leite der Betreiber<br />
ein. Die festen, flüssigen und aufkonzentrierten Gärprodukte kommen als Dünger zum Einsatz.<br />
Eindampfanlage des Herstellers Arnold & Partner AG<br />
in einer Biogasanlage in Bersenbrück.<br />
Ebenso könne sie für Betriebe mit Abfallvergärung ein<br />
Weg sein, um die Düngebilanz im Gleichgewicht zu<br />
halten.<br />
Die Veredlung mittels Vakuumverdampfung zu ASL-<br />
Dünger ermögliche auf der anderen Seite bei erfolgreichem<br />
Marketing eine hohe Wertschöpfung und verbessere<br />
insgesamt die Akzeptanz von Gärprodukten. „Die<br />
meisten Systeme wurden erst in jüngerer Zeit entwickelt<br />
und arbeiten unterschiedlich effizient, insbesondere<br />
hinsichtlich der Stickstofffracht. Betreiber sollten<br />
das Verfahren nach der eigenen Zielsetzung auswählen<br />
und Effizienzgarantien festlegen“, empfiehlt Oechsner.<br />
Zu beachten sei beispielsweise, dass für die Lagerung<br />
der Ammoniumsulfatlösung ein spezieller Lagertank<br />
erforderlich ist. Ein wichtiges Kriterium für die Bewertung<br />
der Arbeitsweise von Vakuumverdampfern<br />
sei die angepasste Zudosierung von Schwefelsäure im<br />
Prozessverlauf, um das freiwerdende Ammonium zu<br />
binden und Stickstoffverluste zu vermeiden. Oft werde<br />
vernachlässigt, dass auch Strom für den Betrieb der<br />
Vakuumerzeuger und Pumpen erforderlich ist. An der<br />
FNR-Studie zur Gärresttrocknung Interessierte können<br />
sich direkt an Dr. Hans Oechsner wenden. (hans.oechsner@uni-hohenheim.de)<br />
FOTO: WERKBILD<br />
37
PRAXIS / TITEL<br />
BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />
Die Verdampfungsanlage<br />
in einer Halle der<br />
Abfallbiogasanlage<br />
Bad Köstritz ging im<br />
November 2018 in den<br />
Regelbetrieb.<br />
Mehrstufige modulare Systeme können<br />
mitwachsen<br />
„Ein guter Richtwert für die Energieeffizienz von Vakuumverdampfern<br />
ist der Energieverbrauch pro Kubikmeter<br />
Wasserentzug aus dem Gärprodukt“, meint<br />
Michael Köhnlechner von der MKR Metzger GmbH.<br />
Das Unternehmen entwickelt und baut seit 1990<br />
Verdampfer, seit 2013 auch für Betriebe, die Biogas<br />
erzeugen. Bislang habe man in diesem Bereich 20<br />
Anlagen errichtet, anfangs eher kleinere für landwirtschaftliche<br />
Biogasanlagen in Veredlungsgebieten, jetzt<br />
zunehmend mehrstufige Verdampfer insbesondere für<br />
Verarbeiter von Bioabfällen. Häufige Beweggründe für<br />
die Errichtung einer Gärproduktverdampfung seien die<br />
Entlastung der Lagerkapazität durch Volumenreduzierung,<br />
eine ganzjährige Wärmenutzung und die damit<br />
einhergehende Sicherung des KWK-Bonus. Darüber hinaus<br />
werde von den Auftraggebern eine Verbesserung<br />
der Transportwürdigkeit, aber auch die Schonung des<br />
Ackerbodens durch größere zeitliche Abstände bei der<br />
Nährstoffausbringung in konzentrierter Form sowie ein<br />
leichteres Nährstoffmanagement im Zusammenhang<br />
mit der Düngeverordnung angestrebt. Als weiteres Motiv<br />
werde die Vorbereitung auf einen wirtschaftlichen<br />
Betrieb nach dem Auslaufen des EEG genannt.<br />
Letztlich gehe es immer darum, mit möglichst geringem<br />
Energieeinsatz möglichst viel Gärprodukt zu reduzieren.<br />
Als Lösung biete MKR Metzger dafür ein auf bis zu vier<br />
Stufen erweiterbares modulares Verdampfersystem in<br />
zwei Baugrößen mit einer Wärmeaufnahme von bis zu<br />
180 Kilowatt (kW th<br />
) thermisch beziehungsweise bis zu<br />
600 kWth und einer Destillaterzeugung von 5.000 bis<br />
20.000 m³ pro Jahr. Der modulare Aufbau ermögliche<br />
ein Mitwachsen der Anlage mit den Gegebenheiten und<br />
Anforderungen, beispielsweise zwei Stufen beim Start<br />
und eine spätere Erweiterung auf vier Stufen.<br />
Je größer das System, desto wirtschaftlicher könne es<br />
im Hinblick auf den Energieeinsatz betrieben werden.<br />
❍ Trockensubstanzgehalt von bis zu 29%<br />
❍ Reduzierung TS-Gehalt der Rohgülle, dadurch:<br />
geringere Stromaufnahmen an Rührwerken und<br />
Pumpen, einfachere Ausbringung und mögliche<br />
Verregnung<br />
Mobile Separation von Gärresten<br />
❍ Hohe Durchsatzleistuns von ca. 25m 3 /h<br />
❍ Reduzierung der Geruchsbelästigung<br />
❍ Geringer lnstandhaltungs- und Wartungsaufwand<br />
❍ Geringer Energieverbrauch<br />
❍ Erhöhung der Kapazität Ihres Gülle- bzw.<br />
Biogasendlagers<br />
❍ Opttmales Preis-Leistungs-Verhältnis<br />
❍ Anschluss Steckdose mit 32Ah<br />
Ernst-Thälmannstr. 27<br />
Telefon: 038848-20349<br />
19260 Vellahn<br />
E-Mail: info@lub-technik.de<br />
www.lub-technik.de<br />
RHS Maschinenund<br />
Anlagenbau GmbH<br />
IDEAL FÜR GÜLLE, GÄRRESTE UND KLÄRSCHLAMM!<br />
Harmate 42 | 48683 Ahaus<br />
Tel. +49 (0)2561 / 95 64 43 - 0<br />
info@rhs-tech.de<br />
www.rhino-rhs.de<br />
38
BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />
PRAXIS / TITEL<br />
„Unsere große dreistufige Verdampferanlage braucht im<br />
Schnitt 500 kW Wärme und 25 kW Strom. Sie produziert<br />
im Jahr aus rund 30.000 m³ Gärprodukt 15.000<br />
m³ einleitungsfähiges Wasser und außerdem neben<br />
eingedicktem Gärprodukt zirka 800 t schwebstofffreien<br />
ASL-Dünger“, nennt Köhnlechner ein Beispiel.<br />
Zu den jüngsten Innovationen des Unternehmens gehöre<br />
die pH-Wert-Anhebung der ASL. Diese sei beim<br />
Verlassen des Verdampfers relativ sauer, was die<br />
Handhabung erschwere und die Pflanzenverträglichkeit<br />
mindere. Manche Hersteller würden dem durch<br />
basisch reagierende Zuschlagstoffe entgegenwirken.<br />
MKR Metzger habe jetzt einen verfahrenstechnischen<br />
Weg gefunden, um den pH-Wert auf ein pflanzenverträgliches<br />
Maß anzuheben. Der ASL-Dünger gewinne<br />
dadurch an Marktwert.<br />
Die neueste Verdampfungsanlage werde gegenwärtig<br />
auf dem Betriebshof der MKR Metzger in Monheim<br />
für den Versand zusammengestellt. Sie sei für einen<br />
Schweinezuchtbetrieb mit Biogasanlage im Landkreis<br />
Rotenburg (Wümme) bestimmt. „Dort wird unser Vakuumverdampfer<br />
einem Bandtrockner vorgeschaltet. Da<br />
der Trockner dann mit bereits eingedicktem Gärprodukt<br />
arbeitet, verdoppelt sich seine Leistung. Und zusätzlich<br />
entsteht marktfähiger ASL-Dünger“, informiert<br />
Köhnlechner.<br />
Die separierte feste Fraktion des Gärprodukts geht wegen der darin<br />
noch enthaltenen Verpackungsschnipsel in die Verbrennung.<br />
Autor<br />
Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Freier Fachjournalist<br />
Rudolph-Reportagen · Landwirtschaft, Umwelt, Erneuerbare Energien<br />
Kirchweg 10 · 04651 Bad Lausick<br />
03 43 45/26 90 40<br />
info@rudolph-reportagen.de<br />
www.rudolph-reportagen.de<br />
Wir machen Ihre Biogasanlage fit für die Zukunft.<br />
Die Schmack Service-Kompetenz:<br />
Lassen Sie sich beraten –<br />
kompetent und unverbindlich!<br />
Technischer<br />
Service<br />
Betriebsführung<br />
Modernisierung<br />
Biogasanlage<br />
Biologischer<br />
Service<br />
Profitieren Sie jetzt von mehr als 20 Jahren<br />
Biogas-Know-how.<br />
Schmack ist der kompetente Service-Partner rund<br />
um Ihre Biogasanlage. Von der Beratung über<br />
Optimierung bis hin zur Betriebsführung sind wir<br />
gerne für Sie da. www.schmack-biogas.de<br />
Schmack Biogas Service GmbH · 24-Stunden-Service-Hotline: Tel. +49 (0) 9431 751-277<br />
info@schmack-biogas.com<br />
39
PRAXIS<br />
BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />
Öko-Kiez<br />
nimmt<br />
alle<br />
Hürden<br />
FOTO: MÖCKERNKIEZ EG<br />
Da war die Freude<br />
groß: Nach über einem<br />
Jahr Stillstand und<br />
Unsicherheit gingen<br />
2016 die Bauarbeiten<br />
wieder weiter!<br />
Deutschlands größtes genossenschaftliches Wohnbauprojekt setzt auf Biogas: Der Berliner<br />
Möckernkiez wird von der Naturstrom AG als Contractor mit Wärme und Mieterstrom aus<br />
einem Biomethan-Blockheizkraftwerk versorgt. In der Bauphase stand das Projekt schon<br />
auf der Kippe und auch das Energiekonzept war nicht leicht umzusetzen.<br />
Von Christian Dany<br />
Wer von der Yorckstraße zum Möckernkiez<br />
in Berlin-Kreuzberg kommt, sieht<br />
auf den ersten Blick einen neuen,<br />
aber irgendwie ganz normalen Großstadt-Häuserblock.<br />
Auf den zweiten<br />
Blick wird das Öko-Ambiente deutlich: Schilder und<br />
Sonnenschirme eines Bio-Supermarktes dominieren<br />
die östliche Seite. Weiter westlich stehen zwei Naturstrom-Ladesäulen<br />
für Elektroautos. Hier geht es eine<br />
„Neue Wohnungsinteressenten müssen<br />
einen Horizont von drei bis fünf Jahren<br />
mitbringen“<br />
Frank Nitzsche<br />
breite Treppe hinauf, durch das Gebäude durch und<br />
man steht im Innenhof; mittendrin im Möckernkiez,<br />
Deutschlands größtem genossenschaftlichen Wohnprojekt.<br />
Der zentrale Platz, die autofreie Erschließungsstraße<br />
und sämtliche Gebäude – das alles gehört hier<br />
der von Bürgern gegründeten „Möckernkiez Genossenschaft<br />
für selbstverwaltetes, soziales und ökologisches<br />
Wohnen eG“.<br />
Im Haus Nr. 4 in der Südwestecke schlägt gewissermaßen<br />
das „Doppelherz“ des Möckernkiezes: Unten im<br />
Keller liegt die Energiezentrale, die den Kiez mit Wärme<br />
und einen Teil davon auch mit Strom versorgt, im<br />
Erdgeschoss die Geschäftsstelle der Genossenschaft.<br />
Hier hat Vorstand Frank Nitzsche sein Büro, der über<br />
das Projekt und dessen Werdegang erzählt: „Seit August<br />
letzten Jahres sind jetzt alle der 471 Wohnungen<br />
bezogen.“<br />
Der Mix reiche von der Einraumwohnung bis zur Sieben-Zimmer-WG.<br />
Dementsprechend bunt gemischt sei<br />
auch die knapp tausendköpfige Bewohnerschaft. Auf<br />
Miteinander und gelebte Nachbarschaft werde großen<br />
Wert gelegt. Es gebe hier eine Kita, eine Werkstatt,<br />
ein Café und einen Veranstaltungsraum, zudem einige<br />
Läden und Praxen. „Neue Wohnungsinteressenten<br />
müssen einen Horizont von drei bis fünf Jahren mitbringen“,<br />
sagt Nitzsche. Die Möckernkiez eG hat jetzt<br />
2.200 Mitglieder. Das zeigt die hohe Nachfrage, die<br />
das Angebot bei weitem übersteigt. Genossen, die<br />
74
FOTOS: CHRISTIAN DANY<br />
BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />
Szene im Kiez: Gelebte<br />
Nachbarschaft! Der<br />
Flachbau vorne dient<br />
der Gemeinschaft,<br />
im Hintergrund ein<br />
Wohngebäude.<br />
PRAXIS<br />
Visuelle<br />
Kontrolle Ihrer<br />
Biogas-Produktion<br />
Lumiglas optimiert Ihren<br />
Biogas-Prozess<br />
• Fernbeobachtung mit dem<br />
Lumiglas Ex-Kamera-System<br />
• Lokale oder globale Paketlösungen<br />
schaffen kostengünstig Sicherheit<br />
eine Wohnung beziehen, zahlen anteilige<br />
Errichtungskosten von 920 Euro pro Quadratmeter<br />
(m²). Die Nettokaltmiete beträgt<br />
zwischen 8,62 und 13,04 Euro je m².<br />
Neubaumieten liegen in Berlin sonst oft<br />
zwischen 16 und 20 Euro. „Ein Genossenschaftsanteil<br />
kostet 500 Euro, zwei<br />
sind Pflicht für die Mitgliedschaft. Die<br />
Obergrenze liegt bei 600.000 Euro“, erläutert<br />
Nitzsche. Gewinnerzielung sei aber<br />
nicht die Motivation der Genossen: In den<br />
nächsten fünf Jahren sei eine Ausschüttung<br />
Tabu.<br />
Die Geschichte des Möckernkiezes liest<br />
sich wie ein Stück aus dem Lehrbuch für<br />
Graswurzelbewegungen: „Anonyme Investoren<br />
oder wir?“ – Flugblätter mit dieser<br />
provokanten Frage machten 2007 beim<br />
Straßenfest in der nahen Hornstraße die<br />
Runde. Die Initiatoren blieben dran und<br />
schon bald ergab sich die Chance, ein<br />
Grundstück beim Park am Gleisdreieck zu<br />
kaufen. Auch das Areal des heutigen Möckernkiezes<br />
gehörte früher zum Anhalter<br />
Güterbahnhof.<br />
Baupause – Finanzierung<br />
wackelte<br />
2009 wurde die Genossenschaft gegründet,<br />
die dann das 30.000 m² große<br />
Grundstück von einer Tochterfirma des<br />
Bundeseisenbahnvermögens erwarb. Den<br />
Grunderwerb finanzierten die Genossen<br />
komplett und auch den Bau noch zu einem<br />
Drittel mit Eigenkapital. Allerdings hatten<br />
sie hart um die Verwirklichung ihres Wohntraumes<br />
zu kämpfen: Ab November 2014<br />
stand der Bau über ein Jahr lang still wegen<br />
nicht gesicherter Finanzierung.<br />
Es mussten ein neuer Vorstand gewählt,<br />
die Mieten erhöht und Mitgliederdarlehn<br />
eingeworben werden, ehe im Juni 2016<br />
die Bauarbeiten wieder aufgenommen<br />
werden konnten. Zwei Teil-Grundstücke<br />
für ein Kultur-Pavillon und ein Hotel wurden<br />
an einen Bauträger weiterverkauft. Als<br />
selbstverwaltete Genossenschaft wollte<br />
sich die Möckernkiez eG mit einer klaren<br />
ökosozialen Ausrichtung abheben: Alle 14<br />
fünfstöckigen Wohnhäuser sind nach KfW-<br />
40-Standard gebaut.<br />
Die Energie sollte möglichst vor Ort mit<br />
erneuerbaren Ressourcen erzeugt werden<br />
und der Primärenergiefaktor (PEF) unter<br />
0,25 liegen. „Wir hatten den Auftrag,<br />
Kosteneinsparungen zu realisieren. So ist<br />
die Idee der Wärmerückgewinnung aus Abwasser<br />
aufgekommen“, schildert Nitzsche.<br />
Hierzu wäre eine teure Wärmepumpe nötig<br />
gewesen und der PEF über das selbst gesteckte<br />
Limit gestiegen, weshalb die Idee<br />
scheiterte.<br />
Energie-Contracting mit<br />
Naturstrom AG<br />
So blieb die Kraft-Wärme-Kopplung unabdingbar.<br />
Die Energieversorgung in Eigenregie<br />
umzusetzen, stellte sich jedoch<br />
als unrealistisch heraus: „Wir haben das<br />
Know-how hierfür nicht. Ein eigener Mitarbeiter<br />
für die Energieversorgung wäre<br />
nötig gewesen. Deshalb sollte das in die<br />
Hände eines Unternehmens gelegt werden,<br />
das sowas alltäglich macht“, so der<br />
Betriebswirt. Bei der Ausschreibung fürs<br />
Contracting bekam die Naturstrom AG den<br />
Zuschlag. Der Ökostromanbieter hat sich<br />
in den vergangenen Jahren mit mehreren<br />
Projekten zu einem Spezialisten für ökologisches<br />
Contracting entwickelt.<br />
„Unser Konzept stimmt gut mit der selbst<br />
auferlegten ökosozialen DNA der Möckern-<br />
75<br />
Info-Material<br />
gleich heute anfordern!<br />
F.H. Papenmeier GmbH & Co.KG<br />
Telefon 0 23 04-205-0<br />
info.lumi@papenmeier.de<br />
www.lumiglas.de
PRAXIS<br />
BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />
Links:<br />
Frank Nitzsche, einer<br />
von zwei Genossenschafts-Vorständen.<br />
Rechts:<br />
Der Möckernkiez von<br />
einer Dachterrasse<br />
gesehen – mit<br />
Photovoltaik auf den<br />
Flachdächern.<br />
kiez eG überein“, sagt Maximilian Seget. Der Projektingenieur<br />
für urbane Quartierskonzepte bei Naturstrom<br />
erklärt im Kellerraum das Energiesystem: „Wenn alle<br />
Wohnungen und Ladenlokale vermietet sind, wird der<br />
Wärmebedarf des Areals laut Planzahlen bei rund 2<br />
Millionen (Mio.) Kilowattstunden (kWh) pro Jahr liegen.<br />
Außerdem werden die Mieter jährlich rund 1,5<br />
Mio. kWh Strom benötigen.“<br />
Die Zahlen zeigten schon den spezifisch sehr niedrigen<br />
Wärmebedarf. Erzeugt werde die Wärme von einem<br />
Biomethan-Blockheizkraftwerk (BHKW) mit 143 Kilowatt<br />
(kW) elektrischer und 215 kW thermischer Leistung<br />
sowie mit einem Gas-Spitzenlastkessel mit 1.300<br />
kW thermischer Leistung. Die Energiezentrale enthalte<br />
noch einen vierteiligen, insgesamt 12 Kubikmeter fassenden<br />
Pufferspeicher. Naturstrom habe auch das 600<br />
Meter lange Nahwärmenetz durch den Kiez verlegt.<br />
Energiezentrale und Wärmenetz würden über Online-<br />
Fernüberwachung betrieben. Das Unternehmen habe<br />
somit ständig alle Daten unter Kontrolle.<br />
Biomethan aus Rest- und Abfallstoffen<br />
Naturstrom bezieht das Biomethan direkt von den<br />
Betreibern der Biogasaufbereitungsanlagen. Seget<br />
zufolge sei das ausschließlich Gas aus Rest- und Abfallstoffen.<br />
Zu den Lieferanten gehörten zum Beispiel<br />
die Klärwerke Hamburg. Weitere zwei Biogasanlagen<br />
lägen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.<br />
Genauer will der Energietechniker aber nicht werden.<br />
Naturstrom bietet deutschlandweit drei Biogas-Tarife<br />
an: mit 10, 20 und 100 Prozent Biomethan. Im Möckernkiez<br />
bekommt der Gaskessel einen 10-Prozent-<br />
Knowledge grows<br />
Wie verringern<br />
Sie Ihren<br />
Substrateinsatz?<br />
Yara Biogas Production Optimizer könnte die Antwort auf Ihre Frage sein. Besuchen<br />
Sie uns auf der BIOGAS Convention & Trade Fair, 10. - 12. Dezember <strong>2019</strong>, Nürnberg,<br />
Halle 09, Stand C 43 – wir beraten Sie gerne.<br />
Ihr Ansprechpartner für telefonische Anfragen ist<br />
Herr Zacharias Mobil: 0151 745 112 86<br />
76<br />
Biogas Production Optimizer<br />
biogas@yara.com
BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />
PRAXIS<br />
anteil. Seget: „Unser Mindestanspruch!“ Das BHKW<br />
wird mit 100 Prozent Biomethan nach EEG betrieben:<br />
Strom, der nicht vor Ort genutzt werden kann, wird ins<br />
öffentliche Netz eingespeist zu einem EEG-Tarif von<br />
zirka 13 Cent/kWh.<br />
Der Biomethanpreis liegt bei knapp über 6 Cent/kWh.<br />
„Der EEG-Tarif stützt sozusagen den Wärmepreis“,<br />
klärt Seget auf. Den genauen Preis pro kWh wollen aber<br />
weder Seget noch Nitzsche nennen. Der Genossenschaftsvorstand<br />
verweist auf eine Verschwiegenheitsklausel<br />
und verrät so viel: „Die Preise sind indexiert mit<br />
zehn Jahren Vertragslaufzeit.“<br />
Kombination: Mieter- und Netzstrom<br />
„Quartierskonzepte, Arealnetze – das geht bei der Wärme<br />
wunderbar, mit dem Strom aber nicht so leicht“,<br />
klagt Seget. Die Naturstrom AG hat sich nämlich mit<br />
ihrem Konzept der großen Herausforderung gestellt,<br />
die Mieter auch mit dem vor Ort erzeugten Strom direkt<br />
zu versorgen: mit Mieterstrom, einer Kombination aus<br />
lokal erzeugtem Ökostrom und Zusatzstrom aus dem<br />
Netz. Bei Letzterem liefert Naturstrom 100 Prozent<br />
Wasserkraftstrom aus Deutschland. „Je höher der Anteil<br />
an Vor-Ort-Strom, desto günstiger“, erläutert der<br />
Möckernkiez-Energiemanager, „und desto planbarer,<br />
denn die Kosten des lokalen Stroms sind auf 20 Jahre<br />
vorhersehbar. Das macht Mieterstrom gleich doppelt<br />
attraktiv.“ Um möglichst viel günstigen Vor-Ort-Strom<br />
nutzen zu können, hat die Naturstrom AG auf fünf Gebäuden<br />
im Möckernkiez Photovoltaikanlagen mit 135<br />
kW Gesamtleistung errichtet. Der Direktlieferung von<br />
lokal erzeugtem Strom sind in der Wohnungswirtschaft<br />
Links:<br />
Plan vom Möckernkiez<br />
Rechts:<br />
Maximilan Seget,<br />
Projektingenieur bei<br />
der Naturstrom AG und<br />
Energiemanager für<br />
den Kiez.<br />
+++ WIEDER VERFÜGBAR +++ WIEDER VERFÜGBAR +++ WIEDER VERFÜGBAR +++<br />
BERU / FEDERAL MOGUL<br />
18GZ47 - FBM80WPNS<br />
77
PRAXIS<br />
BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />
BHKW und Gaskessel: Biomethan-Konsumenten! 100 % für das BHKW<br />
und 10 % für den Gaskessel im Vordergrund.<br />
Pufferspeicher: 4-teilig, 12.000 Liter fassend - mit dem Pufferspeicher-System<br />
können einerseits Wärmelast-Spitzen bedient werden, andererseits muss das<br />
BHKW in Schwachlastzeiten nicht so oft takten.<br />
Kundenanlage und Wettbewerb<br />
Um in begrenztem Umfang und Gebiet dezentrale<br />
Versorgungsstrukturen unabhängig vom öffentlichen<br />
Netz zu ermöglichen, definiert das Energiewirtschaftsgesetz<br />
seit 2011 den Begriff der Kundenanlage.<br />
§3 Nr. 24a EnWG beschreibt diesen von der<br />
schwierigen energierechtlichen Regulierung ausgenommenen<br />
Typus wie folgt:<br />
Energieanlagen zur Abgabe von Energie,<br />
a. die sich auf einem räumlich zusammengehörenden<br />
Gebiet befinden,<br />
b. mit einem Energieversorgungsnetz oder mit<br />
einer Erzeugungsanlage verbunden sind,<br />
c. für die Sicherstellung eines wirksamen und<br />
unverfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung<br />
mit Elektrizität und Gas unbedeutend sind und<br />
d. jedermann zum Zwecke der Belieferung der<br />
angeschlossenen Letztverbraucher im Wege<br />
der Durchleitung unabhängig von der Wahl des<br />
Energielieferanten diskriminierungsfrei und<br />
unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.<br />
§ 3 Nr. 24b EnWG definiert Kundenanlagen zur betrieblichen<br />
Eigenversorgung sehr ähnlich. Der vorgenanne<br />
Punkt c) entspricht einem wichtigen Ziel<br />
des EnWG, das auch in §1 festgehalten ist. Damit<br />
dieses erfüllt ist, muss die Anlage wettbewerblich<br />
unbedeutend sein, was wiederum von den Merkmalen<br />
„räumliche Ausdehnung“, „Menge durchgeleiteter<br />
Energie“ und „Anzahl der angeschlossenen<br />
Letztverbraucher“ abhängt. Bei Letzterem verweist<br />
die Rechtsprechung entweder auf eine Stellungnahme<br />
der Bundesnetzagentur oder die Auffassung<br />
des Kammergerichts Berlin, wonach eine Anzahl von<br />
deutlich über 100 Wohnungen (BNA) respektive bereits<br />
90 Wohnungen (KG Berlin) gegen die Annahme<br />
einer Kundenanlage spricht.<br />
Energierechts-Anwalt Joachim Held von Rödl &<br />
Partner in Nürnberg sieht bei einer Verbreitung autarker<br />
Versorgungsysteme mit Kundenanlagen „die<br />
Gefahr der Entstehung einer Zwei-Klassen-Gesellschaft<br />
in Bezug auf Preise und Versorgungsqualität:<br />
die Verbrauchergruppe der Prosumer mit modernen,<br />
dezentralen Systemen auf der Gewinnerseite und<br />
die Verbrauchergruppe der klassischen Letztverbraucher,<br />
die über das Netz der allgemeinen Versorgung<br />
aus zentralen, großen Erzeugungsanlagen<br />
(Offshore-Wind, Atomkraft, Wasserkraft) versorgt<br />
werden, auf der Verliererseite.“<br />
Biogaskontor<br />
Köberle GmbH<br />
Wir können mit Druck umgehen<br />
Bullaugen für alle Einsatzfälle<br />
Für Kernbohrung Auf Stahlplatte nach In Tauchhülse für Über-/Unterdrucksicherung<br />
oder Futterhülse<br />
Kundenmaß<br />
Blick um die Ecke<br />
ÜU-TT<br />
Ø300 + Ø400 mm<br />
für Folienhauben<br />
Zubehör: Leuchten, Rosetten, Futterhülsen, Sonnenschutzhauben, etc.<br />
Weitere 78 Komponenten: Luftdosierstationen zur Entschwefelung, Füllstandsüberwachung, Messtechnik, Warnschilder<br />
Über-/Unterdrucksicherung<br />
ÜU-GD<br />
für Betondecken<br />
www.biogaskontor.de • info@biogaskontor.de • Germany 89611 Obermarchtal • Tel +49(0)737595038-0
BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />
PRAXIS<br />
aber energierechtlich strenge Grenzen gesetzt: Zwar<br />
können kleine Arealnetze als „Kundenanlagen“ von der<br />
Regulierung ausgenommen werden. Wegen des Arguments<br />
der Wettbewerbssicherung dürfen an diese aber<br />
nicht mehr als 100 Wohnungen angeschlossen sein<br />
(siehe Kasten). „Die Verteilnetzbetreiber sehen das als<br />
Konkurrenz, doch für die dezentrale Energiewende ist<br />
es ´ne echte Hürde“, meint Seget.<br />
Günstiger Strompreis<br />
Naturstrom löste das Problem so: Jedes Haus mit<br />
PV-Anlage wird als eigene Kundenanlage mit einem<br />
Summenzähler ausgestattet. Eine weitere Kundenanlage<br />
sind drei Gebäude, die durch das BHKW versorgt<br />
werden, die mit Stromleitungen verbunden sind und<br />
in denen sich auch Gewerbeeinheiten befinden. Die<br />
restlichen sechs Häuser im Kiez beziehen rein physikalisch<br />
betrachtet Netzstrom. Aus Solidaritätsgründen<br />
bekommen jedoch alle den gleichen Tarif: den „MöckernStrom“.<br />
Dieser kostet 25,45 Cent/kWh plus eine<br />
Grundgebühr von 8,75 Euro pro Monat und liegt damit<br />
preislich rund 15 Prozent unter dem Grundversorgungstarif,<br />
der in Berlin mit circa 30 Cent je kWh zu Buche<br />
schlägt. An Umlagen und Abgaben entfallen beim Mieterstrom<br />
die Konzessionsabgabe an die Kommune, die<br />
Stromsteuer, die Netzentgelte sowie netzseitige Umlagen,<br />
vor allem die Offshore- und die KWK-Gesetz-<br />
Umlage. Allerdings muss die volle EEG-Umlage gezahlt<br />
werden, da bei Stromerzeuger und -verbraucher keine<br />
Personenidentität vorliegt.<br />
Der direkt verbrauchte PV-Strom wird mit dem im<br />
EEG verankerten Mieterstrom-Zuschlag gefördert, der<br />
KWK-Strom dagegen nicht! Mit den Kürzungen der PV-<br />
Einspeisevergütungen wurden zuletzt aber auch diese<br />
Zuschläge zusammengestrichen. Bei weiter sinkender<br />
EEG-Vergütung tendieren die Zuschläge für Anlagen<br />
über 40 kW gegen null. Für kleinere Anlagen liegen sie<br />
jetzt unter 2,0 Cent pro kWh.<br />
Mieterstrom: bundesweit geringe Nachfrage<br />
Der vereinbarte Preis für Mieterstrom darf 90 Prozent<br />
des im jeweiligen Netzgebiet geltenden Grundversor-<br />
Technik in der<br />
Energiezentrale: die<br />
zentrale Trinkwasseraufbereitung<br />
links und<br />
rechts die Wärmeübergabestation<br />
für das<br />
Gebäude.<br />
2Gute Gründe von vielen für BHKW von 2G<br />
Flexibilisierung + Mieten statt kaufen<br />
Flexibilität pur: die Mietlösung für ein BHKW von 2G. Mit dem<br />
Rental-Konzept (4 - 9 Jahre Laufzeit) erhöhen Sie Ihre finanziellen<br />
Handlungsspielräume. Mit dem Vollservicevertrag werden eine<br />
hohe Anlagenverfügbarkeit sowie Planungssicherheit erreicht.<br />
Das vieras-Modell der Betriebsstundenmiete treibt die Flexibilität<br />
dann quasi auf die Spitze.<br />
Wir beraten Sie: 02568 9347-0<br />
oder info@2-g.de<br />
© valentinrussanov | istockphoto.com<br />
79<br />
2G Energy AG | www.2-g.de
PRAXIS<br />
BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />
Energiewende-Generalunternehmer<br />
Auf dem Areal gibt es 2.000 Fahrrad-Stellplätze.<br />
Die Kiezgenossen sind typische Radfahrer!<br />
Als Ökostromanbieter ist die Naturstrom AG einer<br />
der Pioniere in Deutschland. Das Unternehmen, das<br />
im Jahr 1998 gegründet wurde und mittlerweile 320<br />
Mitarbeiter und über 250.000 Kunden hat, ist zur<br />
Naturstrom-Gruppe herangewachsen, denn es ist<br />
noch auf anderen Gebieten der Energiewende aktiv:<br />
Über 25.000 Kunden beziehen Biogas-Produkte<br />
von Naturstrom. Durch den in allen Ökostrom- und<br />
Biogastarifen enthaltenen festen Förderbetrag<br />
werden bundesweit Erneuerbare-Energien-Projekte<br />
geplant, finanziert, gebaut und betrieben.<br />
Als Projektentwickler und Anlagenbetreiber ist das<br />
Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf und zwölf weiteren<br />
Standorten in Deutschland auch auf lokaler<br />
Ebene tätig: In mehreren ländlichen Kommunen<br />
wurden Nahwärmenetze verlegt, um Haushalte,<br />
Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mit<br />
Ökowärme aus Pellets, Holzhackschnitzeln sowie<br />
Solarthermie zu versorgen. In Städten entwickelt<br />
der Öko-Energieversorger urbane Quartierskonzepte.<br />
Unter anderem betreibt er Biomethan-BHKW, die<br />
Wärme und Strom direkt aus dem Heizungskeller an<br />
die Verbraucher im Haus liefern. Rund 40 Mieterstrom-Projekte,<br />
entweder nur mit Photovoltaik oder<br />
mit BHKW kombiniert, wurden schon umgesetzt.<br />
www.naturstrom.de<br />
gungstarifs nicht übersteigen (§ 42a Absatz<br />
4 EnWG). Scharfes Limit hier, marginale<br />
Förderung dort – das hat dazu geführt,<br />
dass der oftmals mit großem Getöse propagierte<br />
Mieterstrom bislang die Erwartungen<br />
nicht erfüllen konnte: In anderthalb<br />
Jahren seit Förderbeginn Mitte 2017 wurden<br />
bei der Bundesnetzagentur nur 430<br />
Mieterstrom-PV-Anlagen gemeldet mit 9,5<br />
Megawatt (MW). Dabei ist ein Fördervolumen<br />
von 500 MW jährlich vorgesehen.<br />
Im Möckernkiez kommt der Möckernstrom<br />
aber sehr gut an: 90 Prozent der Bewohner<br />
beziehen ihn. „Das ist eine Super-Quote“,<br />
sagt Seget. Seit kurzem gebe es den Möckernstrom<br />
auch zum „Tanken“ an zwei<br />
Ladestationen für Elektroautos. „Die Ladesäulen<br />
sind eichrechtskonform, was aktuell<br />
im Markt noch nicht selbstverständlich<br />
ist. Bezahlt werden kann mit der normalen<br />
Girokarte. Wir haben auch Leistung für<br />
Tiefgaragen-Wallboxen vorgehalten, aber<br />
bis jetzt ist da noch keine Nachfrage.“ Die<br />
Kiezgenossen seien typische Fahrradfahrer,<br />
was schon ein Zahlenverhältnis zeige:<br />
„2.000 Fahrrad-Stellplätze gibt es auf<br />
dem Areal. Dagegen hat die Tiefgarage nur<br />
100 Auto-Plätze.“<br />
Für das im Bau befindliche Hotel sei bereits<br />
eine Heizleistung von 260 kW thermisch<br />
angemeldet worden. Das bedeutet,<br />
dass sich die Laufzeit des wärmegeführten<br />
Biomethan-BHKW weiter erhöhen wird.<br />
LPG-Biosupermarkt: Modernes Ökoambiente<br />
durch den Bio-Supermarkt.<br />
Ladestation: „Möckernstrom“ zum Tanken an der<br />
Naturstrom-Ladestation.<br />
80
BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />
INNOVATIVE PRAXIS<br />
EINBRINGTECHNIK<br />
FÜR BIOGAS- UND<br />
RECYCLINGANLAGEN<br />
NEU!<br />
Jetzt auch als BIG-Mix Globe!<br />
Der BIG-Mix im ISO Seecontainer<br />
für den weltweiten Einsatz.<br />
BIG-Mix 35 bis 270m³<br />
Rand des Möckernkiezes: Tolle Lage mit direktem Übergang zum Park am Gleisdreieck.<br />
effektiver Vorschub bei niedrigem<br />
Eigenstromverbrauch<br />
für 100% Mist und Grassilage<br />
mit Misch- und Aufbereitungsbereich<br />
komplett aus Edelstahl<br />
Biomischer 12 bis 80m³<br />
Der Innenhof des Möckernkiezes, u.a. mit einem Lieferwagen. Autos dürfen nicht reinfahren!<br />
Bislang komme es auf 5.500 Vollbetriebsstunden<br />
pro Jahr. „Im Winter läuft es rund<br />
um die Uhr, im Sommer nur wenige Stunden<br />
am Tag“, lässt der Berliner einblicken.<br />
Um die 20 Prozent der Stromerzeugung<br />
aus dem BHKW sowie 70 Prozent des Solarstroms<br />
könnten direkt in den Hausnetzen<br />
verbraucht werden. In den drei versorgten<br />
Gebäuden sorge das BHKW dafür, dass<br />
75 Prozent des Strombedarfs mit Biogasstrom<br />
gedeckt werden.<br />
Der Möckernkiez ist sicherlich ein Pionierund<br />
ein Leuchtturmprojekt. Doch ist er<br />
auch eine Blaupause für die Energiewende<br />
in unseren Städten? Befürworten würde<br />
Seget das auf jeden Fall. Doch er zeigt<br />
auch seine Bedenken: „Generell wäre so<br />
ein Neubau-Projekt heute viel schwieriger<br />
wegen der enorm gestiegenen Grundstückspreise.“<br />
Und im Bestand sei ein<br />
derartiges Energiekonzept auch schwer zu<br />
realisieren: Ein großes Hemmnis sei hier<br />
das „Gebot der Kostenneutralität“, das<br />
laut BGB bei einer Umstellung der Wärmeversorgung<br />
auf Contracting gelte. „Außerdem<br />
ist es im Bestand viel schwieriger,<br />
so eine hohe Mieterstromquote wie im Möckernkiez<br />
zu erreichen. Im Neubau ist das<br />
leichter, weil die neuen Wohnungsbezieher<br />
ohnehin erstmal einen Stromanbieter suchen<br />
müssen.“<br />
Autor<br />
Christian Dany<br />
Freier Journalist<br />
Gablonzer Str. 21<br />
86807 Buchloe<br />
0 82 41/911 403<br />
christian.dany@web.de<br />
81<br />
für 100% Mist und Grassilage<br />
massive Edelstahlkonstruktion<br />
mit Misch- und Aufbereitungsbereich<br />
auf Wunsch komplett aus Edelstahl<br />
KOMBI-Mix 8 und 12m³<br />
speziell für Kleinbiogasanlagen<br />
optional mit Vertikalmischschnecke<br />
für unterschiedlichste Substrate<br />
komplett aus Edelstahl<br />
Konrad Pumpe GmbH<br />
Fon +49 2526 93290<br />
Mail info@pumpegmbh.de<br />
www.pumpegmbh.de
WISSENSCHAFT<br />
BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />
Mehr Gas bei geringerer<br />
Verweilzeit<br />
Biogasanlagen effizienter machen, das war das Ziel des Forschungsprojektes<br />
HoLaflor. Fraunhofer Forscher fanden heraus, dass kürzere<br />
Verweilzeiten und höhere Raumbelastungen die Produktivität<br />
deutlich erhöhen.<br />
Von Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
Wenn die Biomasse und<br />
das Fermentervolumen<br />
möglichst effektiv genutzt<br />
werden, hat das viele Vorteile“,<br />
sagt Dr. Brigitte<br />
Kempter-Regel. Die Abbauleistung würde<br />
gesteigert, die Biogasrate erhöht und die<br />
Methanfreisetzung aus den Gärresten verringert.<br />
Zudem verbessere sich die Wirtschaftlichkeit<br />
der Anlage. „Es heißt, dass<br />
eine Verweilzeit von 40 bis 60 Tagen nötig<br />
ist, sonst drohe Versäuerung, wir hatten<br />
andere Erfahrungen“, verdeutlicht die Wissenschaftlerin<br />
vom Fraunhofer Institut IGB.<br />
Denn: Eine hohe Effizienz und gute Umsatzraten<br />
würden in der Biotechnologie nur<br />
bei hohen Konzentrationen sowohl von Mikroorganismen<br />
als auch vom Substrat erzielt.<br />
„Unsere Erwartung war, dass deutlich kürzere<br />
Verweilzeiten besser sind“, erklärt die<br />
Projektleiterin. „Trotz langer Verweilzeiten<br />
enthalten die Gärreste noch viel Methan“,<br />
so Kempter-Regel. Dieser könne mehr als<br />
Die Anlage der Agro<br />
Energie Hohenlohe<br />
GmbH von Thomas<br />
Karle brachte die<br />
fittesten Mikroorganismen<br />
hervor. Sie wurden<br />
für die Versuchsreihen<br />
verwendet.<br />
25 Prozent der gesamten Biogasausbeute<br />
ausmachen und schmälere den Gewinn der<br />
Biogasanlage. Obwohl es lange Verweilzeiten<br />
für den Abbau gibt, wird trotzdem<br />
eine erhebliche Menge Methan über einen<br />
langen Zeitraum freigesetzt. „Da besteht<br />
Potenzial zur Optimierung“, so die Forscherin.<br />
Aufschluss und Abbau könnten<br />
also noch verbessert werden.<br />
Dieses Wissen brachten die Forscher<br />
aus ihren Erfahrungen im Bereich Klärschlammfaulung<br />
mit. Mit einer sogenannten<br />
Hochlastfaulung verbesserte sich dort<br />
die Ausbeute um bis zu 20 Prozent, im<br />
Einzelfall auch mehr. „Wir haben in Kläranlagen<br />
sehr gute Erfahrungen mit dem<br />
Verfahren gemacht“, erklärt Kempter-Regel.<br />
Zudem vermuteten die Forscher, dass<br />
andere Mikroorganismen an der Hochlastfaulung<br />
beteiligt sind. Sie wollten deshalb<br />
herausfinden, ob das Verfahren auch auf<br />
landwirtschaftliche Biogasanlagen übertragen<br />
werden kann.<br />
Bevor die eigentlichen Versuchsreihen starteten,<br />
machte sich Dr. Brigitte Kempter-Regel daran,<br />
besonders abbaufreudige Mikroorganismen zu<br />
finden. Mittels Batch-Versuchen in 1-Liter-Behältern<br />
wurden die Organismen aus den zehn Anlagen mit<br />
Mais gefüttert und dann der zeitliche Verlauf der<br />
Biogasbildung ermittelt.<br />
Versuchsbedingungen<br />
Technisch ist eine Hochlastfaulung relativ<br />
einfach: „Wir haben einen Reaktor mit geeigneter<br />
Messtechnik und Datenerfassung,<br />
den wir mit hohem Durchsatz, kurzen Verweilzeiten<br />
und mit einer hohen Raumbelastung<br />
betreiben, sonst nichts“, verdeutlicht<br />
die Projektleiterin. Es gab keine Einbauten<br />
für eine Biomasserückhaltung. Es wurde<br />
nicht nachgeimpft, nur gut durchmischt,<br />
konstant temperiert und gleichmäßig gefüttert.<br />
Für ausreichende Versorgung mit<br />
Spurenelementen war gesorgt und die Mikroorganismen<br />
konnten sich auf die Bedingungen<br />
einstellen.<br />
Drei Jahre lang feilte das Institut für Grenzflächen-<br />
und Bioverfahrenstechnik (IGB) an<br />
der Optimierung. Dazu verglichen die Forscher<br />
den Vergärungsprozess von herkömmlichen<br />
Biogasanlagen mit dem Prozess in<br />
einer Hochlastfaulung. Sie fanden heraus,<br />
dass auch bei Biogasanlagen, die Mais als<br />
Monosubstrat nutzen, kürzere Verweilzeiten<br />
deutlich bessere Ergebnisse bringen.<br />
Im Projekt wurde Maissilage als Monosubstrat<br />
verwendet. „Wir wollten wissen, ob<br />
die Anlage auch bei kürzeren Verweilzeiten<br />
erfolgreich und stabil betrieben werden<br />
kann“, denn höhere Raumbelastungen<br />
hätten einen Nachteil: Bei Anlagen, die nur<br />
mit Mais betrieben werden, können sich<br />
schnell Säuren anreichern. Geschieht dies,<br />
kann der Prozess stoppen und die Biogasproduktion<br />
kommt zum Erliegen.<br />
86
BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />
WISSENSCHAFT<br />
ViscoPract®<br />
Enzymatischer<br />
Problemlöser 2.0<br />
FOTOS: MARTINA BRÄSEL<br />
fotolia.com /<br />
© chrisberic<br />
fotolia.com /<br />
© TwilightArtPictures<br />
Die Versuche wurden mit zwei baugleichen<br />
Anlagen durchgeführt. Auf der einen Seite<br />
wurde der maximale Abbau bei kleinstmöglicher<br />
Verweilzeit und höchster Raumbelastung<br />
getestet. Gleich daneben wurde ein Reaktor<br />
mit einer vergleichsweise langen hydraulischen<br />
Verweilzeit von 70 Tagen betrieben.<br />
Für landwirtschaftliche Biogasanlagen ist<br />
eine hydraulische Verweilzeit im gasdichten<br />
geschlossenen System von mindestens<br />
150 Tagen vorgeschrieben. Diese gilt für<br />
die Biogasanlage selbst und den anschließenden<br />
geschlossenen Gärdüngerbehälter.<br />
„Damit soll eine Nachgärung mit signifikanten<br />
Methanemission verhindert werden“,<br />
erklärt die IGB-Forscherin. Deshalb<br />
sind große Fermenter und Gärdüngerbehälter<br />
für die Vergärung notwendig.<br />
Maissilage in 15 Tagen vergoren<br />
Leider kann der Energiebedarf für die<br />
Temperierung sehr hoch sein. Je nach Jahreszeit,<br />
Größe des Fermenters und Stärke<br />
der Isolierung kann sie bis zu 80 Prozent<br />
der produzierten Energie betragen. Die<br />
meisten Biogasanlagen vergären mit einer<br />
Raumbelastung zwischen ein bis drei<br />
Kilogramm organischer Trockenmasse pro<br />
Kubikmeter und Tag (kg oTR/m 3 *d), nur<br />
wenige haben höhere Raumbelastungen.<br />
Die Verweilzeit des Substrates im Behälter<br />
beträgt oft 50 Tage und mehr. „Wir konnten<br />
nachweisen, dass Maissilage mit einer hydraulischen<br />
Verweilzeit von nur 15 Tagen<br />
ohne Versäuerung vergoren werden kann“,<br />
berichtet die Forscherin.<br />
Die Versuche wurden mit zwei baugleichen<br />
Pilotanlagen im Langzeitbetrieb über<br />
550 Tage durchgeführt. Es handelte sich<br />
dabei um ein kontinuierliches Verfahren.<br />
Auf diese Weise konnten die Forscher die<br />
Abbauleistung, die Biogasausbeute und<br />
die Mikroorganismenpopulation der unterschiedlichen<br />
Betriebsweisen (Hochlast und<br />
herkömmlicher Betrieb) vergleichen.<br />
In der einen Anlage wurde der maximale<br />
Abbau bei kleinster Verweilzeit und hoher<br />
Raumbelastung getestet. Parallel dazu<br />
wurde eine baugleiche Biogasanlage mit<br />
einer vergleichsweise langen hydraulischen<br />
Verweilzeit von 70 Tagen betrieben. Während<br />
der Versuchsreihen wurde die Mikroorganismenflora<br />
beider Anlagen analysiert.<br />
Dadurch sollte geklärt werden, ob sich die<br />
Mikroorganismen unterscheiden. Zudem<br />
schauten sich die Forscher die Zusammensetzung<br />
der Gärprodukte und ihre Restgaspotenziale<br />
an. Mit diesen Ergebnissen<br />
berechneten die Wissenschaftler die Energieausbeute<br />
aus dem Substrat (Maissilage)<br />
für beide Verfahrensweisen, dem herkömmlichen<br />
und dem Hochlastverfahren.<br />
Abbaufreudige Mikroorganismen<br />
gesucht<br />
Bevor die eigentlichen Versuchsreihen<br />
starteten, machten sich die Wissenschaftler<br />
daran, besonders abbaufreudige Mikroorganismen<br />
zu finden. Zu diesem Zweck<br />
wurden Gärrückstände aus zehn verschiedenen<br />
Biogas- und Kläranlagen entnommen.<br />
„Es gibt Biogasanlagen, die mit Verweilzeiten<br />
von über 100 Tagen arbeiten,<br />
andere liegen deutlich darunter. Deshalb<br />
liegt die Vermutung nahe, dass Mikroorganismen<br />
unterschiedlich leistungsfähig<br />
sind“, erklärt die Wissenschaftlerin.<br />
Mittels Batch-Versuchen in 1-Liter-Behältern<br />
wurden die Organismen aus den zehn<br />
Anlagen mit Mais gefüttert und dann der<br />
zeitliche Verlauf der Biogasbildung ermittelt.<br />
„Wir wollten herausfinden, welcher<br />
Senkt die Viskosität<br />
und stabilisiert den<br />
Gärprozess!<br />
» Beseitigt Schwimm- und<br />
Sinkschichten<br />
» Löst Substratablagerungen auf<br />
» Schont die Rühr-/Pumptechnik<br />
» Reduziert die Gärrestmenge<br />
87<br />
+49 (0)30 6670 - 2056 » www.biopract-abt.de
WISSENSCHAFT<br />
BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />
Biogasproduktion in Abhängigkeit von der Verweilzeit<br />
Biogasproduktivität (NL / L*d)<br />
3,5<br />
3<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
15 20 25 30 30 35 70 70 70 70<br />
Verweilzeit (d)<br />
Dargestellt ist die Biogasproduktivität für die Verweilzeiten in 15 Tagen (d), 20 d, 25 d, 30 d und 35 d in der<br />
Hochlastfaulung und für die Verweilzeit von 70 d in der Referenzanlage. Zu sehen sind zwei Inbetriebnahmen<br />
S1 (grün) und S2 (blau). Durch die Verkürzung der Verweilzeit konnte die Biogasproduktivität deutlich<br />
erhöht werden. Die geringste Biogasproduktivität wurde in der herkömmlichen Anlage mit der hydraulischen<br />
Verweilzeit von 70 Tagen erreicht.<br />
S1<br />
S2<br />
Gärrest schnell und effizient Biogas bildet,<br />
um die geeignetsten Mikroorganismen zu<br />
finden“, so die Expertin. Die Gärreste der<br />
Anlagen unterschieden sich deutlich. Gute<br />
Ergebnisse brachte zum Beispiel ein Gärrest<br />
aus einer Kläranlage mit Hochlastfaulung,<br />
obwohl die Mikroorganismen niemals<br />
eine Maissilage gesehen hatten.<br />
Eine Biogasanlage mit Mischfütterung und<br />
kurzen Verweilzeiten schnitt am besten<br />
ab. „Diesen Gärdünger haben wir genommen<br />
und zwei Versuchsreaktoren, jeweils<br />
130-Liter-Fermenter, damit gefüllt und<br />
mit Maissilage gefüttert“. Am Ende der<br />
Versuchsreihen unterschied sich die Zusammensetzung<br />
der Organismen in den<br />
beiden Versuchsreaktoren. Brigitte Kempter-Regel<br />
erklärt das so: „Wir erzeugen<br />
durch den hohen Durchsatz einen Selektionsdruck<br />
und die Mikroorganismen stellen<br />
sich darauf ein.“ Es würden sich immer die<br />
Mikroorganismen vermehren und durchsetzen,<br />
die die Bedingungen mögen, die<br />
anderen würden ausselektiert.<br />
Keine Übersäuerung bei der<br />
Hochlastfaulung<br />
„Bis auf die Verweilzeit, die über die Fütterungsintervalle<br />
eingestellt wurde, war<br />
alles gleich“, erklärt die Projektleiterin.<br />
„Wir haben bei beiden Anlagen immer mit<br />
der gleichen Ration gefüttert, bei kürzerer<br />
Verweilzeit allerdings öfter“, denn es sei<br />
bei der Hochlastfaulung notwendig, Stoßbelastungen<br />
zu vermeiden. Dabei gelte die<br />
Regel: je höher der Durchsatz, desto kürzer<br />
das Fütterungsintervall, desto kürzer die<br />
Verweilzeit. Die Mikroorganismen würden<br />
besser auf eine kontinuierliche Fütterung<br />
in kleinen Dosen reagieren, die Projektleiterin<br />
erklärt warum: „Aus anderen Untersuchungen<br />
wussten wir, dass es sonst zu<br />
Versäuerungen kommen kann.“<br />
Die Verweilzeit im Hochlastverfahren wurde<br />
stufenweise von 40 Tage auf 15 Tage<br />
reduziert. Dabei erfolgte eine Erhöhung der<br />
eingestellten organischen Raumbelastung<br />
frühestens nach einer Fermentationsdauer<br />
von 14 Tagen mit konstanter Biogasproduktion.<br />
Der Erfolg der Inbetriebnahme wurde<br />
anhand des Anstiegs der Biogasbildung<br />
nach Erhöhung der Raumbelastung verfolgt.<br />
Dabei stiegen Biogas- und Methanproduktivität<br />
mit kürzer werdender Verweilzeit<br />
an. Die kürzeste Zeit (15 Tage) brachte<br />
die besten Ergebnisse.<br />
„Im Vergleich zur herkömmlichen Vergärung<br />
erzielten wir am Tag pro Liter Reak-<br />
Innovative<br />
Energiegewinnung<br />
aus biogenen<br />
Reststoffen<br />
Das BEKON® Trockenfermentationsverfahren<br />
bietet effiziente und modulare Systeme für die<br />
Biogaserzeugung aus Abfallstoffen.<br />
Die ideale Lösung für Kommunen, private<br />
Entsorger und die Landwirtschaft.<br />
+49 89 9077959-0<br />
kontakt@bekon.eu | bekon.eu<br />
88
BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />
WISSENSCHAFT<br />
Mit einer sogenannten Hochlastfaulung verbesserte sich die Gasausbeute in<br />
Kläranlagen um bis zu 20 Prozent. Beim Hochlast-Faulverfahren übernehmen<br />
zwei Edelstahlbehälter die Aufgabe des herkömmlichen Faulbehälters.<br />
Auf der Suche nach besonders aktiven Mikroorganismen untersuchten die Forscher<br />
zehn Gärreste aus verschiedenen Biogas- und Kläranlagen. Obwohl sie nie<br />
eine Maissilage gesehen hatten, waren die Mikroorganismen aus der Kläranlage<br />
Mittleres Glemstal in Leonberg besonders rege.<br />
torvolumen die vier- bis fünffache Menge“,<br />
so Kempter-Regel: Mit 70 Tagen Verweilzeit<br />
erzeugte die herkömmliche BGA maximal<br />
etwa 100 Liter pro Tag, die Hochlastfaulung<br />
mit einer Verweilzeit von 15 Tagen schaffte<br />
rund 420 Liter in der gleichen Zeit. Auch<br />
die Übersäuerung blieb aus: „Selbst bei<br />
der kurzen Verweilzeit waren keine Säuren<br />
nachweisbar“, so die Mikrobiologin.<br />
Übertragbarkeit auf bestehende<br />
Anlagen<br />
„Die Ergebnisse belegen, dass Biogasanlagen<br />
mit deutlich kürzeren Verweilzeiten<br />
betrieben werden können“, resümiert die<br />
IGB-Expertin. Gegenüber dem herkömmlichen<br />
Betrieb könnte die Methanproduktion<br />
dadurch um das Vier- bis Fünffache steigen.<br />
Wegen der hohen Durchsätze sei die<br />
Hochlastfaulung deutlich produktiver und<br />
Fermenter und Nachgärer könnten kleiner<br />
werden.<br />
„Wenn die Verweilzeit zum Beispiel von 45<br />
auf 15 Tage sinkt, wird auch nur ein Drittel<br />
des Volumens benötigt“, so Kempter-Regel.<br />
Ein höherer Umsatz und eine bessere<br />
Produktivität machen die Anlage deutlich<br />
wirtschaftlicher. Allerdings benötigt<br />
das Verfahren eine etwas umfangreichere<br />
Messtechnik, als in herkömmlichen Biogasanlagen<br />
üblich ist. „Nichts Kompliziertes,<br />
doch die Biogasproduktion sollte sicher<br />
und kontinuierlich erfasst werden“, ergänzt<br />
die Mikrobiologin.<br />
Auch eine Nachrüstung bestehender Anlagen<br />
sei möglich. „Wir würden die Voraussetzungen<br />
im Einzelfall prüfen, auf jeden<br />
Fall sollte es sich um eine Nassvergärung<br />
handeln“, so die Forscherin. Im Bereich<br />
Flexibilisierung würde das Projekt und<br />
würde speziell die Untersuchungen über<br />
die verschiedenen Mikroorganismensysteme<br />
dazu beitragen, die Möglichkeiten der<br />
Prozesssteuerung von Biogasanlagen zu<br />
verbessern.<br />
Autorin<br />
Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
Freie Journalistin<br />
Hohlgraben 27 · 71701 Schwieberdingen<br />
0 71 50/9 21 87 72<br />
braesel@mb-saj.de<br />
www.mb-saj.de<br />
IHR ERFAHRENER ENERGIESPEZIALIST SEIT 1936<br />
PLANUNG - ANLAGENBAU - SERVICE 24/7<br />
BHKW<br />
BLOCKHEIZKRAFTWERKE<br />
ENERGIEVERSORGUNG MIT KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG<br />
USV<br />
UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG<br />
STATIONÄRE USV-ANLAGEN<br />
. Leistungsbereich Erdgas von 50 kW el<br />
bis 2.535 kW el<br />
. Leistungsbereich Biogas von 100 kW el<br />
bis 2.000 kW el<br />
. Containeranlagen, Betonstationen, Komplettmodule<br />
. Leistungsbereich Dreiphasig von 10 kVA - 2.400 kVA<br />
. Leistungsbereich Einphasig von 1 kVA - 10 kVA<br />
. Batterieanlagen<br />
NEA<br />
NETZERSATZANLAGEN<br />
KOMPLETTLÖSUNGEN AUS EINER HAND<br />
. Leistungsbereich von 20 kVA - 3.000 kVA<br />
. BDEW-Aggregate<br />
. Containeranlagen, Betonstationen, Komplettmodule<br />
89<br />
HENKELHAUSEN GmbH & Co. KG Tel.: +49 (0) 21 51 / 574 - 190 E-mail: anfrage@henkelhausen.de