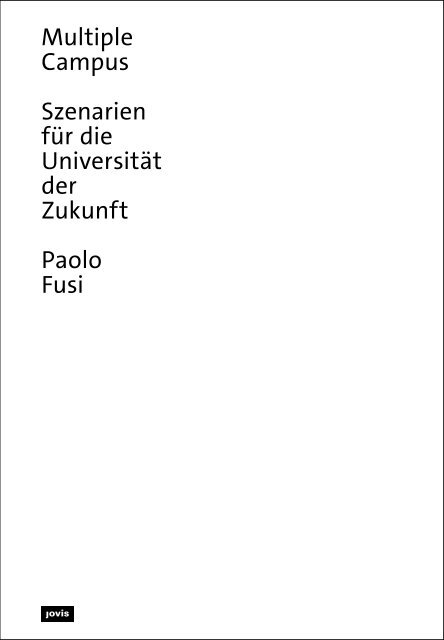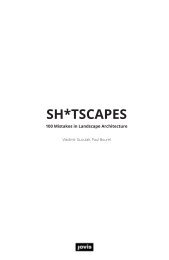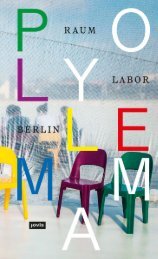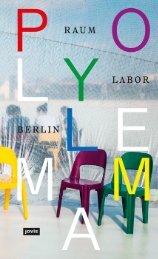Multiple Campus
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Multiple</strong><br />
<strong>Campus</strong><br />
Szenarien<br />
für die<br />
Universität<br />
der<br />
Zukunft<br />
Paolo<br />
Fusi
Einführung<br />
Vorwort des Präsidenten der Universität Hamburg 7<br />
Dieter Lenzen<br />
Vorbemerkung des Kanzlers der Universität Hamburg 9<br />
Martin Hecht<br />
Die Universität und die Zukunft der Stadt 11<br />
Paolo Fusi<br />
Heute & Morgen<br />
Die Universität Hamburg 18<br />
Der historische <strong>Campus</strong> Von-Melle-Park 30<br />
Der MIN-<strong>Campus</strong> Bundesstraße 44<br />
<strong>Campus</strong> Klein Flottbek 56<br />
Science City Bahrenfeld 64<br />
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 74<br />
Internationale Tendenzen<br />
Inspirierende Beispiele für den <strong>Multiple</strong>-<strong>Campus</strong>-Ansatz 86<br />
Übermorgen<br />
<strong>Multiple</strong> <strong>Campus</strong> 148<br />
Die Universität Hamburg übermorgen 172<br />
Stadtcampus Von-Melle-Park & Bundesstraße 173<br />
<strong>Campus</strong> Klein Flottbek 212<br />
Science City Bahrenfeld 232<br />
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 238<br />
Anhang<br />
Bildverzeichnis 247<br />
Autoren & Redaktion 251<br />
Impressum 253
Vorwort<br />
Dieter Lenzen<br />
Präsident der Universität Hamburg<br />
Architektur, die ihren Namen verdient und nicht<br />
bloß Baumeisterei ist, leistet einen Beitrag zur Determination<br />
des sozialen Lebens. Mindestens spiegelt<br />
sie dieses auf der Höhe ihrer Zeit. Das gilt auch<br />
und insbesondere für Universitätsarchitektur. Zahlreiche<br />
Beispiele, spätestens beginnend mit der Bauhausarchitektur,<br />
sind dafür Belege. Eine Architektur,<br />
die wie diese den Menschen in den Mittelpunkt<br />
des Räumlichen stellte, war insofern ein markantes<br />
Beispiel für gelungenes Bauen an der Academia.<br />
Eine Universität, die mehr sein möchte als eine<br />
Fertigungsstätte für Absolventen oder ein Hervorbringungsort<br />
von Innovationen verwertbarer Art,<br />
muss deshalb darauf achten, muss darauf bestehen,<br />
dass der nachwachsenden Generation und ihren<br />
Lehrern und Lehrerinnen ein Raum geschaffen<br />
wird, in dem sie ihre Zukunft und die ihrer Nachfahren<br />
entwerfen können. Dieser Anspruch ist in der<br />
baulichen Vergangenheit der Universität Hamburg<br />
an einigen prominenten Stellen wie der des Auditoriums<br />
Maximum erfüllt worden. Zahlreiche andere<br />
Gebäude sind in den Zeiten beschleunigter und oftmals<br />
unreflektierter Expansion funktionalistisch im<br />
schlechteren Sinne hinzugebaut worden. Deshalb<br />
kommt es heute darauf an, soweit dieses überhaupt<br />
möglich ist, den öffentlichen Raum, der erhebliche<br />
Zufälle aufweist, so ästhetisch zu restrukturieren,<br />
dass er seiner Funktion für die Academia<br />
nachkommen kann.<br />
Diese Aufgabe ist Gegenstand des vorliegenden<br />
Bandes von Paolo Fusi. Unter dem Signet des<br />
„<strong>Multiple</strong> <strong>Campus</strong>“ versucht Fusi, der Multiplizität<br />
gewissermaßen ex post in einem doppelten Sinne<br />
Geltung zu verschaffen: Zum einen gilt es zu registrieren,<br />
dass die bauliche Universitätslandschaft,<br />
dem epochalen Geschehen geschuldet, in erheblichem<br />
Maße „multiple“, divers ist. Fusi versucht<br />
nicht, diesen Umstand historisch zu glätten, sondern<br />
ihn zu akzeptieren und zu verbinden mit einem<br />
zweiten Element der Multiplizität, durch das<br />
unsere, insbesondere akademische, Welt heute<br />
gekennzeichnet ist: die Multiplizität, Diversität der<br />
Menschen, die in der und für die Academia, für die<br />
Universität arbeiten.<br />
Um diesem Gedanken gerecht zu werden, legt<br />
Fusi eine Fülle von stadt- und campusplanerischen<br />
Vorschlägen, Ideen und Entwürfen vor, die eine<br />
längst überfällige Diskussion auslösen können: Wie<br />
will es die Stadt, wie wollen wir es zukünftig mit der<br />
Gestalt des Raumes halten, in dem Zukunft gestaltende<br />
Menschen einen großen Teil ihres Lebens zubringen<br />
und darüber hinaus zahlreiche Menschen<br />
ihr ganzes Leben?<br />
Das verdient und verlangt nach Sorgfalt, nach<br />
sogar mehr Sorgfalt, als wir sie auf unsere eigenen<br />
privaten Wohnumgebungen anzuwenden gewohnt<br />
sind. Unsere Universität prägt unser Leben, prägt<br />
unser Denken und prägt unser Handeln auf Zukunft<br />
hin.<br />
Für diesen Beitrag ist Paolo Fusi, Professor für<br />
städtebaulichen Entwurf/Urban Design an unserer<br />
Schwestereinrichtung, der HafenCity Universität,<br />
nachträglich zu danken. Dies gilt auch für Martin<br />
Hecht als Universitätskanzler, der den Gedanken<br />
angestoßen und die Entstehung in gemeinsamen<br />
Diskussionen begleitet hat.<br />
Nunmehr ist zu wünschen, dass die Öffentlichkeit,<br />
vor allem aber die Politik, den Gedanken<br />
aufnimmt und einen Willen zur konsistenten Gestaltung<br />
der fünf Universitätscampi einer „Exzellenzuniversität“,<br />
was die Universität seit dem 19. Juli<br />
2019 ist, entwickelt und zeigt. Vielleicht werden es<br />
Campi der Multiplizität, die nicht bloß unterläuft,<br />
sondern bewusst und mit Gründen betrieben wird.<br />
6 | 7
Vorbemerkung<br />
Martin Hecht<br />
Kanzler der Universität Hamburg<br />
Prozesse in der Wissenschaft verlaufen in der Regel<br />
multikausal, beispielsweise Kooperationsbeziehungen,<br />
Verfügbarkeit von Forschungsinfrastrukturen<br />
und sozialen Infrastrukturen, Services der Digitalisierung<br />
sowie Möglichkeiten des Ausgleichs in Kultur<br />
und Sport. Auch wenn das Zeitalter der Digitalisierung<br />
die Ortsabhängigkeit relativiert, benötigt Wissenschaft<br />
definierte Räume zum Forschen, Lehren<br />
und zur Begegnung, um das komplexe Zusammenspiel<br />
individueller und systemischer Potenziale zur<br />
Wirkung kommen zu lassen. Derzeit bietet die Universität<br />
Hamburg diese Orte auf etwa 650.000 Quadratmetern<br />
Bruttogeschossfläche in 189 Gebäuden<br />
über die Stadt verteilt an.<br />
„<strong>Multiple</strong> <strong>Campus</strong>“ fokussiert sich auf die funktional<br />
bauliche Standortentwicklung. Es werden<br />
Bestandssituationen dokumentiert und Entwicklungsszenarien<br />
für das Erscheinungsbild der Universität<br />
in der Freien und Hansestadt Hamburg<br />
gezeichnet. Anlass zu dem Projekt war die Ausarbeitung<br />
der „Teilstrategie <strong>Campus</strong>entwicklung“ im<br />
Rahmen der strategischen Ausrichtung der Universität.<br />
<strong>Campus</strong>entwicklung umfasst ergänzend zur<br />
Betrachtung der Liegenschaften in Bezug auf Lage,<br />
Architektur und Funktion strategische Aspekte<br />
des Gebäudebetriebs sowie eines wissenschaftsadäquaten<br />
Liegenschaftsmanagements. Universitätsgebäude<br />
und die zur Bewirtschaftung notwendigen<br />
Strukturen und Prozesse sind in den vergangenen<br />
Jahrzehnten an vielen Standorten in einer<br />
Form vernachlässigt worden, dass professionelle<br />
Betriebskonzepte nicht oder nur teilweise zum Einsatz<br />
kommen können. Beispielsweise scheitert eine<br />
energieeffiziente und nachhaltige Bewirtschaftung<br />
an heterogener Gebäudeleittechnik, für Konzepte<br />
zum Einsatz regenerativer Energien stehen sowohl<br />
bei Nachrüstungen als auch bei der Errichtung von<br />
Gebäuden häufig notwendige Investitionsmittel<br />
nicht zur Verfügung. Instandhaltungsmaßnahmen<br />
zum Substanzerhalt werden weit zurückgestellt<br />
oder fallen aus. Anforderungen an Sicherheit auf<br />
dem <strong>Campus</strong> haben sich grundlegend verändert.<br />
Hamburg hat sich mit dem Mieter-Vermieter-<br />
Modell für öffentliche Bauten entschieden, den<br />
Umgang auch mit Hochschulgebäuden entsprechend<br />
der mit dem Betrieb verbundenen Verantwortung<br />
zu professionalisieren. Dieses Modell<br />
kann für die Hochschulen zu einem Erfolgsmodell<br />
werden, wenn die für die Errichtung und Instandhaltung<br />
notwendigen Mittel bereitgestellt werden<br />
und wenn der Prozess der Errichtung und der Betrieb<br />
der Gebäude zwischen Hochschulen und Vermietern<br />
partnerschaftlich und entsprechend der<br />
Bedürfnisse der Wissenschaft angelegt ist.<br />
Das Liegenschaftsmanagement der Universität<br />
Hamburg hat sich mit dem Ziel neu erfunden,<br />
die Ressource Fläche als integralen Bestandteil<br />
der Prozesse in Forschung und Lehre adäquat<br />
zum Einsatz kommen zu lassen. Ergänzend zu den<br />
technisch-fachlichen Anforderungen ist dabei den<br />
sehr vielfältigen Kommunikationsbedarfen innerhalb<br />
der Universität, mit der Politik sowie mit den<br />
zahlreichen externen Partnern gerecht zu werden.<br />
Erfolgreiches universitäres Liegenschaftsmanagement<br />
benötigt weitreichende Steuerungs- und<br />
Handlungsautonomie.<br />
Das Konzept „<strong>Multiple</strong> <strong>Campus</strong>“ fordert in seiner<br />
Komplexität Offenheit und Zukunftsorientierung<br />
von denjenigen, die es entwickeln und umsetzen.<br />
Ich danke allen, die sich auf diesen Weg<br />
begeben und an dem Projekt „<strong>Multiple</strong> <strong>Campus</strong>“ in<br />
den vergangenen Monaten gearbeitet haben, ganz<br />
besonders Paolo Fusi, Kathrin Schmuck, Johannes<br />
Bouchain, Eva Liesberg und Marita Vietmeyer.<br />
8 | 9
Die Universität und<br />
die Zukunft der Stadt<br />
Paolo Fusi<br />
Geschichte und Zukunft<br />
Die Wissenschaft ist in unserer Kultur und Gesellschaft<br />
eines der größten Güter, über das wir verfügen.<br />
Dieses Kapital zu pflegen und zu bewahren, ist<br />
eine Verantwortung, welcher wir uns nicht entziehen<br />
können. In Zukunft aber wird die Wissenschaft<br />
für die westliche Zivilisation die wichtigste Stärke<br />
und eine konkrete Chance im internationalen Wettbewerb<br />
darstellen. Die Zukunft der Wissenschaft<br />
zu reflektieren und ihre Formen zu gestalten, bildet<br />
eine der größten Herausforderungen unserer<br />
Gegenwart.<br />
Die Universität Hamburg feiert im Jahr 2019 das<br />
hundertjährige Jubiläum ihrer Entstehung. Dabei<br />
ist die Jahrhundertfeier nicht nur rückblickend Anlass,<br />
die eigene Geschichte zu zelebrieren und die<br />
Vergangenheit zu betrachten, sondern vor allem<br />
ein Anstoß dazu, die Zukunft zu planen. Für unsere<br />
disziplinäre Reflektion in Architektur und Städtebau<br />
bildet dieses Ereignis eine hervorragende Gelegenheit,<br />
das Thema der Entwicklung universitärer<br />
<strong>Campus</strong>standorte in Bezug auf die Zukunft der<br />
Stadt zu vertiefen.<br />
Die hier vorgestellten theoretischen Gedanken<br />
sowie Entwurfsszenarien streben nicht danach,<br />
abgeschlossene Projekte zu präsentieren, sondern<br />
wollen vielmehr musterhafte Anwendungen einer<br />
methodischen Arbeit andeuten. Diese sollen Anhaltspunkte<br />
für eine Planungsdiskussion mit allen<br />
Beteiligten, die die Zukunft der <strong>Campus</strong>standorte<br />
mitplanen werden, bieten.<br />
Das zukunftsorientierte Streben der Universität<br />
Hamburg ist geprägt von der Fragestellung „Wohin<br />
geht die Wissenschaft?“, und die planerischen Gedanken<br />
über die Exzellenz der <strong>Campus</strong>standorte<br />
der Zukunft bilden einen Mehrwert für die Stadt<br />
Hamburg als Ganzes. Die Stadt ist seit jeher ein<br />
Beispiel für die komplexesten und faszinierendsten<br />
Ausdrucksformen der Zivilisation. Zudem lebt<br />
sie wesentlich von ihren starken Kulturinstitutionen.<br />
Die Stadt der Zukunft wird jedoch mehr denn<br />
je lebendige, leistungsfähige und sogar exzellente<br />
Universitäten brauchen, um eine adäquate Rolle in<br />
der Entwicklung der Menschheit zu erfüllen. Schon<br />
seit Jahren beobachten wir, auf welche Art sich Universitätsstädte<br />
in einem Wettbewerb profilieren,<br />
um neue Einwohner zu gewinnen. Junge Menschen<br />
ziehen auf der Suche nach einer kulturellen und<br />
beruflichen Ausbildung in die Städte, in denen die<br />
Ausbildungsangebote am attraktivsten sind. Aber<br />
auch andere Menschen, die das vielfältige und kulturelle<br />
Spektrum suchen, das sich am besten durch<br />
Synergieeffekte in den Universitätsstädten entwickelt,<br />
möchten in diesen Orten leben. Jene wachsen<br />
und florieren aber nicht nur bezüglich der Quantität,<br />
sondern auch hinsichtlich der Qualität der Lebensmöglichkeiten.<br />
Die Städte bieten bessere Arbeitschancen und<br />
Selbstverwirklichungsperspektiven: Dynamische<br />
und kreative Unternehmer haben hier bessere<br />
Chancen, geeignete Mitarbeitende zu finden. Umgekehrt<br />
erhalten hier gut ausgebildete und leistungsfähige<br />
Arbeitskräfte bessere Anstellungsangebote.<br />
Gleichzeitig entstehen in diesen Orten<br />
durch die Vielfalt an kulturellen Ereignissen und<br />
Angeboten für Weiterbildung, Freizeit und gesellschaftlichen<br />
Austausch attraktivere Lebensbedingungen.<br />
Auch wenn sich die medialen und virtuellen<br />
Formen der Kommunikation immer mehr<br />
ausweiten, bleibt das menschliche Zusammentreffen<br />
in der realen Welt unumgänglich oder gewinnt<br />
sogar an Bedeutung: als Form der Kompensation<br />
gegenüber der ephemeren Dimension der sozialen<br />
Medien.<br />
10 | 11
Die Universität Hamburg<br />
Rückblick, Einblick und Ausblick<br />
In der Zeit ihres nun hundertjährigen Bestehens hat<br />
sich die Universität Hamburg seit ihrer Gründung<br />
im Jahr 1919 zur größten Hochschuleinrichtung<br />
Norddeutschlands mit über 40.000 Studierenden<br />
entwickelt. Die Fächer der Universität umfassen<br />
Geistes-, Kultur-, Sozial-, Wirtschafts-, Erziehungsund<br />
Rechtswissenschaften, Psychologie, Mathematik,<br />
Informatik, Biologie, Chemie, Physik, Geowissenschaften<br />
sowie Medizin. Entsprechend umfangreich<br />
ist der heutige Bestand an eigenen und angemieteten<br />
Gebäuden an unterschiedlichen Standorten<br />
im Stadtgebiet. Dabei zeigt sich in der aktuellen<br />
architektonischen und städtebaulichen Situation<br />
der Universitätsgebäude, insbesondere an den<br />
Hauptstandorten, wie vielfältig die bisherigen Entwicklungsschritte<br />
der Universität waren und wie<br />
sich die in den unterschiedlichen Phasen vorherrschenden<br />
architektonischen und städtebaulichen<br />
Prinzipien in der Ausgestaltung der maßgeblichen<br />
Universitätserweiterungen in den jeweiligen Epochen<br />
niederschlugen.<br />
Von den Anfängen, die auf erste konkrete Überlegungen<br />
vor dem Ersten Weltkrieg zurückgehen,<br />
bis zur heutigen Situation mit zahlreichen Hauptund<br />
Nebenstandorten unterschiedlichen baulichen<br />
Charakters hat sich die Universität vor allem in<br />
ihren innenstadtnahen Lagen zu einem festen Bestandteil<br />
der jeweiligen Stadtteile und Quartiere<br />
entwickelt. Daran hat die bauliche Manifestation<br />
des universitären Lebens innerhalb der jeweiligen<br />
Stadtbereiche einen entscheidenden Anteil. 2009<br />
gab es konkrete Überlegungen hinsichtlich einer<br />
Komplettverlagerung der Universität auf den Kleinen<br />
Grasbrook vis-à-vis zur HafenCity. Diese wurden<br />
wegen der lauten Stimmen der Befürworter<br />
eines Ausbaus der Hochschule an den über Jahrzehnte<br />
gewachsenen, innenstadtnahen Standorten<br />
jedoch zügig wieder fallen gelassen. Es zeigte sich<br />
einmal mehr in besonders ausgeprägter Weise, wie<br />
stark die Universität im Stadtgewebe verwurzelt<br />
ist und welche Bedeutung dies auch auf baulicher<br />
Ebene hat. Daneben sind wenig später auch die<br />
Standorte Klein Flottbek und insbesondere Bahrenfeld<br />
in den Fokus für eine zukünftige bauliche Erweiterung<br />
gerückt.<br />
Als Universitätsstandort mit Sonderstatus hat<br />
auch das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf<br />
mit seinem umfangreichen Gebäudebestand eine<br />
große Bedeutung. Das 1889 als Neues Allgemeines<br />
Krankenhaus eröffnete Klinikum erhielt 1934 offiziell<br />
den Status eines Universitätsklinikums, nachdem<br />
es in den vorherigen zwei Jahrzehnten intensiv<br />
zu einem Forschungsstandort ausgebaut worden<br />
war.<br />
Weiterentwicklung bestehender Standorte<br />
statt Komplettverlagerung<br />
Die Entscheidung des Hamburgischen Senats<br />
vom Juni 2010, die Universität an den bestehenden,<br />
innenstadtnahen Standorten auszubauen 1<br />
war der Ausgangspunkt für zahlreiche übergeordnete<br />
Überlegungen und Detailplanungen für die<br />
Weiterentwicklung der Universität. Obwohl dieser<br />
Entwicklungsprozess zahlreiche Ebenen umfasst,<br />
unter anderem im strukturellen und administrativen<br />
Bereich, wird mit der Dachmarke „Uni baut<br />
Zukunft“ für den architektonisch-städtebaulichen<br />
Teil des Entwicklungsprozesses mit Fokus auf den<br />
Standort Bundesstraße der Tatsache Rechnung<br />
getragen, dass der baulichen Ebene eine sehr große<br />
Bedeutung zufällt: Die Universität kann an den<br />
bestehenden Standorten nur zukunftsfähig ausgebaut<br />
werden, wenn zumindest in bestimmten<br />
Bereichen maßgebliche Nachverdichtungen durch<br />
Heute & Morgen | Die Universität Hamburg
Neubauten erfolgen, Standorte flächenmäßig erweitert<br />
und Bestandsgebäude umfassend saniert<br />
beziehungsweise durch Neubauten ersetzt und Außenräume<br />
aufgewertet werden.<br />
Die Konzepte vom Anfang der 2010er Jahre sind<br />
inzwischen durch mehrere bereits getroffene und<br />
weitere, in der Schwebe befindliche Entscheidungen<br />
bis hin zur Verlagerung ganzer Fachbereiche an<br />
andere Standorte inhaltlich stark überholt. So steht<br />
inzwischen fest, dass der Fachbereich Chemie komplett<br />
nach Bahrenfeld verlagert wird. Auch für den<br />
Fachbereich Zoologie an der Bundesstraße ist eine<br />
Verlagerung geplant, hier steht eine finale Standortentscheidung<br />
aber noch aus. Der Beschluss,<br />
die entsprechenden Institute und Fachbereiche<br />
dauerhaft und nicht nur provisorisch auszulagern,<br />
führte zu einem Bedeutungsgewinn des Standorts<br />
Bahrenfeld, wo zusätzlich zur Physik mittelfristig<br />
der gesamte Fachbereich Chemie und längerfristig<br />
auch der Fachbereich Biologie konzentriert werden<br />
sollen. Der Standort wird in den nächsten Jahren<br />
und Jahrzehnten stark erweitert und übergreifend<br />
als Science City Bahrenfeld bezeichnet. 2 Dies umfasst<br />
neben dem Ausbau der Universität am Standort<br />
auch den Ausbau und den möglichen Zuzug<br />
weiterer Forschungsinstitute und forschungsnaher<br />
Unternehmen.<br />
Trotz der über unterschiedliche Stadtteile im<br />
westlichen Gründerzeitgürtel der Stadt und im<br />
Hamburger Westen verteilten Hauptstandorte soll<br />
sich die Universität als Ganzes weiterentwickeln. So<br />
sind neben den Besonderheiten der Einzelstandorte<br />
auch verbindende Elemente notwendig. Es wird<br />
also eine architektonisch-städtebauliche Vision<br />
benötigt, die einerseits übergeordnete Leitlinien<br />
für die Universität als Ganzes vorgibt, andererseits<br />
aber genügend Raum für teils nicht vorhersehbare<br />
Einzelentwicklungen lässt. Als Basis für diese Vision<br />
der „Universität Hamburg übermorgen“, die im<br />
folgenden Teil dargestellt wird, wird an dieser Stelle<br />
ein Blick auf die aktuelle Situation und die konkret<br />
geplanten Einzelprojekte geworfen. Dieser kurz- bis<br />
mittelfristige Zeithorizont der baulich-funktionalen<br />
Entwicklung wird hier als das „Morgen“ der Universität<br />
Hamburg bezeichnet und umfasst unter anderem<br />
die noch in Bau befindlichen bzw. noch nicht<br />
umgesetzten Projekte aus dem Programm „Qualitätsoffensive<br />
Universitätsbau 2014–2018“ des Baumanagements<br />
der Universität, aber auch weitere<br />
bereits mehrfach diskutierte Ideen, die noch nicht<br />
in diesem Programm enthalten sind. Innerhalb<br />
dieser Qualitätsoffensive wurden die Ziele für die<br />
bauliche Weiterentwicklung der Universität so formuliert,<br />
wie sie auch für den Kontext dieser Publikation<br />
passend sind. Es gehe dabei darum, „die baulich-funktionale<br />
Qualität sowie Erscheinung der<br />
<strong>Campus</strong>anlagen und der Universitätsgebäude den<br />
aktuellen Bedarfen von internationaler Forschung<br />
und Lehre am Metropolstandort Hamburg anzupassen<br />
und dabei gleichzeitig die Universität an<br />
geeigneten Schnittstellen mit Stadt und Öffentlichkeit<br />
weiter zu verzahnen und weitere Strahlkraft zu<br />
entwickeln.“ 3<br />
Die Standorte der Universität Hamburg<br />
Die Universität Hamburg ist untergliedert in<br />
acht Fakultäten. Hiervon belegt das Universitätsklinikum<br />
Hamburg-Eppendorf (UKE) 497.000 Quadratmeter<br />
Bruttogeschossfläche. Die übrigen sieben<br />
Fakultäten belegen zusammen etwa 650.000 Quadratmeter<br />
Bruttogeschossfläche in 189 Gebäuden<br />
(Stand 2017). Dabei liegen die zur Universität gehörenden<br />
Gebäude fast ausschließlich in den Stadtteilen<br />
westlich der Alster.<br />
Neben dem Hauptgebäude an der Edmund-<br />
Siemers-Allee sind dies die <strong>Campus</strong>bereiche Von-<br />
Melle-Park und Bundesstraße, der Sportcampus<br />
an der Feldbrunnenstraße, der Forschungscampus<br />
Bahrenfeld, Klein Flottbek/Botanischer Garten<br />
und Stellingen (Informatik). Aufgrund der Sanierung<br />
des Gebäudes Von-Melle-Park 6 („Philturm“)<br />
wird derzeit auch ein Gebäudekomplex in der City<br />
Nord (Winterhude) temporär von der Universität<br />
Hamburg genutzt. Wie bei vielen anderen Universitäten<br />
auch führte der steigende Raumbedarf der<br />
Universität und der Mangel an geeigneten Flächen<br />
innerhalb der letzten Jahrzehnte zur Anmietung<br />
zahlreicher Bestandsgebäude, insbesondere<br />
im Stadtteil Rotherbaum im direkten Umfeld der<br />
dortigen Hauptstandorte. Weitere zur Universität<br />
gehörende Gebäude befinden sich unter anderem<br />
im Bereich Jungiusstraße/Alter Botanischer Garten<br />
und am Fischereihafen in Altona. Mit dem Institut<br />
für Holzwissenschaften in Lohbrügge und der Sternwarte<br />
in Bergedorf befinden sich zwei universitäre<br />
Standorte im Osten Hamburgs. 5<br />
Fünf Hauptstandorte<br />
Da sich die Universität Hamburg zukünftig vorrangig<br />
an den vier Hauptstandorten <strong>Campus</strong> Von-<br />
Melle-Park, <strong>Campus</strong> Bundesstraße, Forschungscampus<br />
Bahrenfeld und Klein Flottbek sowie im<br />
medizinischen Bereich am Standort des Universitätsklinikums<br />
Hamburg-Eppendorf konzentrieren<br />
und weiterentwickeln soll, wird im Folgenden das<br />
Augenmerk auch im Bestand auf diese Standorte<br />
gelegt.<br />
(JB)<br />
1 Behörde für Wissenschaft, Forschung und<br />
Gleichstellung (BFW): Metropole des Wissens –<br />
Uni baut Zukunft. Online abgerufen unter: http://<br />
wissenschaft.hamburg.de/zukunft-uni/. Letzter<br />
Zugriff: 27.08.2018. 2 Hamburger Abendblatt:<br />
Bahrenfeld wird zum Wissenschaftszentrum.<br />
Artikel vom 26.10.2018. Online abgerufen unter:<br />
https://www.abendblatt.de/hamburg/elbvororte/<br />
article215653899/Bahrenfeld-wird-zum-<br />
Wissenschaftszentrum.html. Letzter Zugriff:<br />
08.12.2018. 3 Universität Hamburg: Universitätsbau<br />
2014–2018. Broschüre zu aktuellen Bauprojekten<br />
der Universität. Hamburg 2018, S. 2 4 Universität<br />
Hamburg: Jahresbericht 2017. Online<br />
abgerufen unter: https://www.uni-hamburg.de/<br />
uhh/profil/fakten/jahresberichte/jb-2017.pdf.<br />
Letzter Zugriff: 08.12.2018. 5 Universität Hamburg:<br />
<strong>Campus</strong>-Navigator auf den Internetseiten<br />
der Universität. Online abgerunfen unter: https://<br />
www.uni-hamburg.de/onTEAM/campus/. Letzter<br />
Zugriff: 23.08.2018.<br />
18 | 19
1<br />
Karte der Universitätsund<br />
Forschungsstandorte<br />
in Hamburg. Sichtbar ist<br />
eine Verteilung auf unterschiedliche<br />
Stadtbereiche<br />
mit Bündelung in der Innenstadt<br />
und an einigen<br />
weiteren Standorten.<br />
M: 1:150.000<br />
Heute & Morgen | Die Universität Hamburg
Fernbahnhof<br />
Geplanter Fernbahnhof<br />
Flughafen<br />
Untersuchte Universitätsstandorte<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
Öffentliche Hochschulen<br />
Universität Hamburg<br />
Universität Hamburg – Universitätsklinikum Hamburg‐Eppendorf<br />
Technische Universität Hamburg‐Harburg<br />
HafenCity Universität<br />
Hochschule für Angewandte Wissenschaften<br />
Hochschule für bildende Künste<br />
Hochschule für Musik und Theater<br />
Akademie der Polizei Hamburg<br />
Hochschulen des Bundes<br />
Helmut‐Schmidt‐Universität – Universität der Bundeswehr<br />
Private Hochschulen<br />
Brand Academy<br />
Europäische Fernhochschule<br />
Hamburger Fern‐Hochschule<br />
Northern Business School<br />
Bucerius Law School<br />
Hamburg School of Business Administration<br />
EBC Hochschule<br />
Medical School Hamburg<br />
Kühne Logistics University<br />
Berufsakademie Hamburg<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Gemeinschaftsfinanzierte Forschungseinrichtungen<br />
Deutsches Elektronen‐Synchrotron<br />
Anwendungszentr. Leistungselektr. für Regen. Energiesyst. (Fraunhofer ISIT)<br />
Bernhard‐Nocht‐Institut für Tropenmedizin<br />
Climate Service Center (Helmholtz‐Zentrum Geesthacht)<br />
European Screening Port (Fraunhofer IME)<br />
Fraunhofer‐Center für Maritime Logistik und Dienstleistungen (CML)<br />
Heinrich‐Pette‐Institut – Leibniz‐Institut für Experimentelle Virologie<br />
Max‐Planck‐Institut für ausländisches und internationales Privatrecht<br />
Max‐Planck‐Institut für Meteorologie<br />
Max‐Planck‐Institut für Struktur und Dynamik der Materie<br />
30<br />
31<br />
32<br />
33<br />
34<br />
35<br />
36<br />
37<br />
38<br />
39<br />
Forschungseinrichtungen des Bundes<br />
Institut für Holzforschung – Johann Heinrich von Thünen‐Institut<br />
Bundesanstalt für Wasserbau<br />
Weitere technisch ausgerichtete Forschungseinrichtungen<br />
Center for Free‐Electron Laser Science CFEL<br />
Deutsches Klimarechenzentrum<br />
European Molecular Biology Laboratory (EMBL)<br />
European X‐Ray Free‐Electron Laser Facility (European XFEL)<br />
Hamburgische Schiffbau‐Versuchsanstalt<br />
Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung<br />
Zentrum für Angewandte Nanotechnologie CAN (Fraunhofer IAP)<br />
Zentrum für strukturelle Systembiologie (CSSB)<br />
40<br />
41<br />
42<br />
43<br />
44<br />
45<br />
46<br />
47<br />
48<br />
Sonstige Forschungsinstitute<br />
Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg (FZH)<br />
Akademie der Wissenschaften Hamburg<br />
German Institute of Global and Area Studies<br />
Hamburger Institut für Sozialforschung<br />
Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut<br />
Haus Rissen – Institut für Internationale Politik und Wirtschaft<br />
UNESCO‐Institut für Lebenslanges Lernen<br />
Warburg‐Haus mit Forschungsstelle für Politische Ikonografie<br />
Deutsche Gesellschaft für Asienkunde<br />
22 | 23
Der historische <strong>Campus</strong><br />
Von-Melle-Park<br />
Urbaner <strong>Campus</strong><br />
der Nachkriegszeit<br />
5<br />
Heute & Morgen | Der historische <strong>Campus</strong> Von-Melle-Park
5<br />
Luftbild des <strong>Campus</strong> Von-<br />
Melle-Park mit Hervorhebung<br />
der zugehörigen<br />
Universitätsgebäude<br />
Historischer Überblick und heutige Situation<br />
Der Von-Melle-Park ist der Hauptcampus der Universität<br />
Hamburg. Die Gebäude entstanden überwiegend<br />
zwischen Ende der 1950er und Mitte der<br />
1960er Jahre und in einer weiteren Phase Mitte der<br />
1970er Jahre. Der sogenannte Philosophenturm<br />
(auch „Philturm“) stellt als Hochpunkt mit 14 Stockwerken<br />
eine besondere Landmarke in der Stadtsilhouette<br />
dar. Das Audimax wiederum ist durch<br />
seine ikonische Muschelform ein besonderes, typologisches<br />
Wahrzeichen des <strong>Campus</strong>. Die übrigen<br />
Gebäude sind überwiegend drei- bis fünfgeschossig.<br />
Das Konzept von Paul Seitz<br />
Der <strong>Campus</strong> entstammt in seiner städtebaulichen<br />
Konzeption aus den 1950er Jahren der Feder<br />
des Architekten Paul Seitz. Im Vorfeld hatte es mehrere<br />
Anläufe gegeben, die Universität insgesamt<br />
an einen innenstadtfernen Standort (zum Beispiel<br />
Fritz Schumachers Idee aus den 1920er Jahren eines<br />
<strong>Campus</strong> in Groß Borstel nahe dem Eppendorfer<br />
Moor 1 ) zu verlagern. Diese wurden jedoch unter anderem<br />
aus wirtschaftlichen Gründen nicht weiterverfolgt.<br />
In der Nachkriegszeit folgte dann ein klares<br />
Bekenntnis von Politik und Verwaltung zu einer<br />
innenstadtnahen Universität im Stadtteil Rotherbaum.<br />
Seitz nutzte die Gunst der Nachkriegszeit,<br />
um das stark zerstörte Quartier rund um den ehemaligen<br />
Bornplatz nordwestlich des Hauptgebäudes<br />
der Universität grundlegend umzugestalten.<br />
Dabei wurden jedoch in erster Linie Grünflächen<br />
im Verlauf der Niederung des ehemaligen Alsterzulaufs<br />
Hundebek genutzt, die bis dahin unbebaut<br />
geblieben und unter anderem durch die Stadtgärtnerei<br />
und als Quartierspark genutzt worden waren.<br />
Aber auch der im Krieg stark zerstörte Bereich<br />
zwischen diesem Freiraum und der Grindelallee<br />
nordwestlich der Fröbelstraße wurde in die <strong>Campus</strong>neuentwicklung<br />
miteinbezogen. 2 „Es bot sich<br />
die einmalige Gelegenheit, einen sinnvoll strukturierten,<br />
zusammenhängenden <strong>Campus</strong> anzulegen.<br />
Dies war bereits wesentliches Ziel der früheren Pläne<br />
zur Verlagerung der Universität gewesen.“ 3<br />
Mit dem Philosophenturm und dem Audimax<br />
sind den beauftragten Architekten innerhalb des<br />
Seitz’schen Gesamtkonzepts zwei in besonderer<br />
Weise ikonische Gebäude gelungen, die den<br />
<strong>Campus</strong>bereich Von-Melle-Park auch heute noch<br />
stark prägen. Ein weiteres auffallendes Gestaltungselement<br />
stellt der von Seitz entwickelte und<br />
zeittypische Materialkanon, unter anderem mit<br />
Gelbklinker-Fassaden und nach außen sichtbaren<br />
Betonstützen, dar, jeweils kombiniert mit großflächig<br />
verglasten, nach außen transparenten und offen<br />
gestalteten Eingangs- und Foyerbereichen. All<br />
dies war ein starker Kontrast zu den städtebaulichen<br />
Prinzipien der 1930er und 1940er Jahre mit bodenständigen<br />
Rotklinkerbauten und steilen Dächern. 4<br />
Neben dem übergeordneten gestalterischen<br />
Konzept ist aber auch das raumtypologische Gesamtsystem<br />
prägend. Es stellt sich als eine große,<br />
mit einem Wabenmuster versehene Freifläche in<br />
der Mitte des <strong>Campus</strong>bereichs dar. Dabei umringen<br />
die Gebäude die Freifläche wie einzelne Zähne.<br />
Einerseits umschließen die Gebäude also diesen<br />
Freiraum, andererseits sind sie aber auch geschickt<br />
durchlässig zum umgrenzenden Stadtkörper angeordnet.<br />
Damit hat Seitz beispielhaft die für einen<br />
<strong>Campus</strong> im dichten Stadtgefüge wichtige Verzahnung<br />
mit dem städtebaulichen Umfeld und das<br />
für den „Denkraum“ Universität wichtige Maß an<br />
Geschlossenheit miteinander verknüpft. Insgesamt<br />
ist aber auch innerhalb der einzelnen Gebäude ein<br />
hohes Maß an Transparenz sichtbar: „Die Transparenz<br />
vieler Bauten der 1950er und 1960er Jahre,<br />
aber auch die Offenheit und Ungerichtetheit der<br />
Gesamtanlage sind symbolhaft zu verstehen, gerade<br />
weil sie zeitgenössischen Universitätsstrukturen<br />
voraus waren.“ 5<br />
Maßstabssprung und Paradigmenwechsel: die<br />
Ergänzungen der 1970er Jahre<br />
Die Paradigmen in Architektur und Städtebau<br />
änderten sich schnell und bereits in den<br />
1970er Jahren waren introvertierte, massive und<br />
verschlossene Baukörper auch für Universitätsbauten<br />
gang und gäbe. In diese Zeit fallen der<br />
Neubau der Wirtschaftswissenschaften, das sogenannte<br />
Verfügungsgebäude IV, Von-Melle-Park 5<br />
(„WiWi-Bunker“) zwischen Von-Melle-Park und<br />
Grindelallee und der etwas später realisierte, benachbarte<br />
Neubau der Staats- und Universitätsbibliothek.<br />
Für diese Gebäude wurde in großem,<br />
heute in dieser Form kaum noch denkbarem Maßstab<br />
die gründerzeitliche Bebauung an der Fröbelstraße<br />
und in deren Umfeld, die im Gegensatz<br />
zum weiter nordwestlich angrenzenden Bereich im<br />
Zweiten Weltkrieg weitgehend unversehrt geblieben<br />
war, abgebrochen. Keinesfalls sind die Gebäude<br />
der 1970er Jahre jedoch gänzlich als negativ einzuordnen.<br />
Michael Holtmann bezeichnet den sogenannten<br />
„WiWi-Bunker“ sogar als das „am meisten<br />
unterschätzte“ Gebäude des <strong>Campus</strong>. Es ordne sich<br />
den anderen Gebäuden am <strong>Campus</strong> durchaus unter<br />
und habe wegen des offenen Erdgeschosses de facto<br />
keinen Bunkercharakter. 6 Das Problem ist jedoch,<br />
dass die Potenziale der Öffnung nach außen, zum<br />
Beispiel durch öffentliche Erdgeschossnutzungen,<br />
beim derzeitigen Zustand weitgehend ungenutzt<br />
bleiben bzw. der offene Charakter durch nachträgliche<br />
Um- und Erweiterungsbauten in den letzten<br />
Jahren verlorengegangen ist.<br />
Ungenutzte Potenziale: <strong>Campus</strong> als hochwertiger<br />
Freiraum mit einladenden Zugängen?<br />
Nicht nur die Abkehr von Seitz’ Grundidee aus<br />
den 1950er Jahren, sondern auch zahlreiche Umgestaltungen<br />
durch Sanierungen und bauliche Erweiterungen<br />
in den letzten Jahrzehnten führten zu<br />
dem heutigen, in vielen Bereichen eher unklaren<br />
und teilweise wenig einladenden Erscheinungsbild<br />
des <strong>Campus</strong>. Die offene Erdgeschosszone des<br />
aufgeständerten Philosophenturms, ein besonders<br />
prägendes Element der Ursprungsarchitektur,<br />
wurde unter anderem durch einen Mensa-Neubau<br />
umbaut. Eine Fahrradstation an der Nordseite<br />
30 | 31
Der MIN-<strong>Campus</strong><br />
Bundesstraße<br />
Vom funktionalen <strong>Campus</strong><br />
zum modernen Zukunftsstandort<br />
20<br />
Heute & Morgen | Der MIN-<strong>Campus</strong> Bundesstraße
20<br />
Luftbild des <strong>Campus</strong> Bundesstraße<br />
mit Hervorhebung<br />
der dazugehörigen<br />
Universitätsgebäude<br />
Dieser Bereich der Universität Hamburg entstand<br />
überwiegend in den 1960er und 1970er Jahren<br />
aufgrund des starken Wachstums und des damit<br />
verbundenen stark gestiegenen – und weiter ansteigenden<br />
– Raumbedarfs der universitären Einrichtungen<br />
und beherbergt vorrangig Gebäude der<br />
naturwissenschaftlichen Fachbereiche. Innerhalb<br />
kurzer Zeit entstanden hier neue Gebäude mit<br />
83.000 Quadratmetern Nutzfläche, was etwa ein<br />
Drittel des gesamten heutigen Gebäudebestandes<br />
der Universität ausmacht. 1 Der aktuelle Zustand der<br />
Gebäude ist teilweise sehr prekär, sodass in vielen<br />
Fällen eine zeitnahe Komplettsanierung oder ein<br />
Abriss und ein anschließender Neubau unumgänglich<br />
sind. Dabei ist auch eine weitere Verdichtung<br />
des <strong>Campus</strong>bereichs möglich, weshalb dieser Bereich<br />
beim Konzept für den Ausbau der Universität<br />
am Standort Rotherbaum Anfang der 2010er Jahre<br />
im Fokus stand. Es ist vorgesehen, langfristig nahezu<br />
alle Bestandsbauten des <strong>Campus</strong> (mit Ausnahme<br />
unter anderem des Geomatikums) abzureißen<br />
und den Bereich in stark verdichteter Form neu zu<br />
bebauen. Dabei sollen hier in einem ersten Schritt<br />
die Bereiche Klimaforschung, Geowissenschaften,<br />
Mathematik und Informatik konzentriert werden,<br />
langfristig aber auch weitere, teils außeruniversitäre<br />
Nutzungen hinzukommen.<br />
Kasernen weichen der Universität<br />
Das sogenannte Papenland, benannt nach<br />
seinem früheren Pächter, dessen Name sich heute<br />
lediglich im Straßennamen Papendamm 2 wiederfindet,<br />
wurde bis ins 19. Jahrhundert hinein als<br />
landwirtschaftliche Fläche zwischen den nordwestlichen<br />
Wallanlagen der Stadt Hamburg und den<br />
sich stark entwickelnden Vororten Rotherbaum<br />
und Eimsbüttel genutzt. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts<br />
erfolgte, auch verursacht durch den großen<br />
Brand von 1842, eine Verlagerung von Wohnstiften,<br />
die zuvor innerhalb des Wallrings angesiedelt<br />
waren, in diesen Bereich. Zusätzlich wurden hier<br />
Kasernen errichtet und es entstanden eine Feuerwache,<br />
eine Schule und schließlich Anfang des<br />
20. Jahrhunderts ein Verwaltungsgebäude der Militärersatzbehörde.<br />
3 Dieses Ensemble überwiegend<br />
großmaßstäblicher öffentlicher Nutzungen wich in<br />
den 1960er und 1970er Jahren fast vollständig den<br />
Neubauten der Universität. Einzelne Gebäude im<br />
direkten Umfeld des heutigen <strong>Campus</strong>, zum Beispiel<br />
der erhalten gebliebene Teil des Schröderstifts<br />
südlich des Geomatikums oder der verbliebene<br />
Teil des ehemaligen Warburg-Stifts (Bundesstraße,<br />
Ecke Papendamm), zeugen noch heute von der voruniversitären<br />
Ära des Gebiets.<br />
Die heutige Situation des <strong>Campus</strong><br />
Den Kern des <strong>Campus</strong>bereichs Bundesstraße<br />
bilden das 1975 errichtete, 85 Meter hohe Geomatikum<br />
südwestlich der Bundesstraße und die<br />
flachere, im selben Jahrzehnt entstandene Bebauung<br />
mit überwiegend drei bis sieben Stockwerken,<br />
die sich zwischen Grindelallee und Bundesstraße<br />
unter anderem rund um den Martin-Luther-King-<br />
Platz gruppiert und teilweise auch südwestlich der<br />
Bundesstraße mit Begrenzung durch die Straße<br />
Laufgraben und das Schröderstift gelegen ist.<br />
Der Bereich zeichnet sich durch die stringente<br />
Ausrichtung beinahe aller Gebäudegrundrisse parallel<br />
und rechtwinklig zur Achse der Grindelallee<br />
aus. Durch den Winkel zwischen der Grindelallee<br />
und der Bundesstraße, die diesen <strong>Campus</strong>bereich<br />
durchschneidet, sind die Gebäude zu letzterer<br />
schräg ausgerichtet. Dadurch wirkt die Bundesstraße<br />
im Bereich der Universitätsgebäude wenig<br />
räumlich gefasst. Insgesamt ist hier im Gegensatz<br />
zum <strong>Campus</strong> Von-Melle-Park kein klar abgegrenzter,<br />
innen liegender <strong>Campus</strong>freiraum erkennbar.<br />
Der einzige durch die Stellung der umgrenzenden<br />
Gebäude definierte Platzbereich ist der Martin-<br />
Luther-King-Platz. Doch auch dieser entfaltet durch<br />
seine geringe Größe keinen <strong>Campus</strong>charakter, sondern<br />
dient lediglich als Durchgangsraum zwischen<br />
der Grindelallee und den hier sowie an der Bundesstraße<br />
gelegenen Institutsgebäuden. Die Gebäude<br />
bestehen teilweise aus mehreren parallelen<br />
Flügeln, die durch Querriegel miteinander verbunden<br />
sind, oder aus gegeneinander verschobenen,<br />
punktartigen, etwas höheren Gebäudeteilen mit<br />
flacheren, sie verbindenden Zeilen. Die Architektur<br />
ist stark technisch-funktional geprägt. Einige Gebäude<br />
weisen die für die 1970er Jahre typischen,<br />
markant horizontalen Stockwerksbänder auf (wie<br />
im Fall des Geomatikums mit Waschbeton-Verkleidung),<br />
hinter denen die Fensterbänder stark zurücktreten.<br />
Die Gebäude wirken stark introvertiert.<br />
Nachträglich ergänzte bzw. bereits umfassend<br />
sanierte Gebäude sind das Deutsche Klimarechenzentrum<br />
(DKRZ) an der Bundesstraße (1983–1985)<br />
errichtet, 2009 grundlegend umgebaut) und das<br />
Zentrum für Marine und Atmosphärische Wissenschaften,<br />
unter anderem mit dem Max-Planck-Institut<br />
für Meteorologie (2003 erbaut). 4 Das Haus<br />
der Erde nordwestlich des Geomatikums befindet<br />
sich in der finalen Bauphase und soll noch im Jahr<br />
2021 eröffnet werden. Eine umfassende Sanierung<br />
des Geomatikums selbst ist bereits in Vorbereitung.<br />
Im Sommer 2017 mussten zahlreiche Gebäude<br />
am Martin-Luther-King-Platz kurzfristig außer Betrieb<br />
genommen werden. Grund hierfür war der<br />
schlechte bauliche Zustand der Gebäude, insbesondere<br />
der unzureichende Brandschutz. Wissenschaftsgetrieben<br />
und aufgrund des unzureichenden<br />
Gebäudezustands, erfolgte die Entscheidung,<br />
die entsprechenden Nutzungen zu verlagern: Eine<br />
endgültige Verlagerung der Zoologie nach Klein<br />
Flottbek oder Bahrenfeld wird derzeit geprüft. Die<br />
Chemie soll nach Bahrenfeld verlagert werden. 5<br />
In direkter Nachbarschaft der nun teilweise<br />
leerstehenden Gebäude erfolgte bereits ein Freiräumen<br />
für die anstehenden Neubauten MIN-Forum<br />
und Informatik. Zudem ist der Martin-Luther-King-<br />
Platz durch die weggefallene Nutzung einiger angrenzender<br />
Gebäude stark dem Verfall preisgegeben.<br />
Es besteht also dringender Handlungsbedarf<br />
hinsichtlich einer tragfähigen, zukunftsweisenden<br />
Umgestaltung des <strong>Campus</strong> Bundesstraße.<br />
44 | 45
(1) Ne<br />
(2) Ge<br />
Hauptn<br />
Gescho<br />
Höhe: 8<br />
BGF: 37<br />
Baujahr<br />
(3) ZM<br />
Hauptn<br />
Gescho<br />
Höhe: 1<br />
BGF: 10<br />
Baujahr<br />
(5) Zo<br />
Hauptn<br />
Gescho<br />
Höhe: 2<br />
BGF: 28<br />
Baujahr<br />
(6) Bü<br />
VG I<br />
Hauptn<br />
Gescho<br />
Höhe: 2<br />
BGF: 12.<br />
Baujahr<br />
(6) Ver<br />
Hauptnu<br />
Geschos<br />
Höhe: 26<br />
BGF: 19.7<br />
Baujahr:<br />
26<br />
Bautypologien<br />
Bundesstraße<br />
M 1:5000 (S. 50)<br />
M 1:10.000 (S. 51)<br />
Hauptn<br />
Gescho<br />
Höhe: 2<br />
BGF: 42<br />
Baujahr<br />
6<br />
(4) HZ<br />
1<br />
2<br />
7<br />
8<br />
Hauptn<br />
Gescho<br />
Höhe: 2<br />
BGF: 8.8<br />
Baujahr<br />
3<br />
9<br />
(4) Ch<br />
4<br />
5<br />
Hauptn<br />
Gescho<br />
Höhe: 2<br />
BGF: 20<br />
Baujahr<br />
Heute & Morgen | Der MIN-<strong>Campus</strong> Bundesstraße
(9) Angewandte Analytik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,08m<br />
BGF: 2.246m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Biochemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG, 1 DG<br />
Höhe: 7,20m<br />
BGF: 1.985m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Warenannahme<br />
Hauptnutzung: Lagergebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 4,50m<br />
BGF: 1.122m²<br />
Baujahr: 2018<br />
(9) Bibliothek<br />
Hauptnutzung: Bibliotheksgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,08m<br />
BGF: 2.246m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Eingangshalle<br />
Hauptnutzung: Erschließungs- /<br />
Bürogebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 1.202m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) NMR<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 5,10m<br />
BGF: 83m²<br />
Baujahr: 1999<br />
(9) Hörsäle<br />
Hauptnutzung: Hörsaal- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,60m<br />
BGF: 4.278m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(8) Neubau Informatik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 10 VG<br />
Höhe: 42,31m<br />
BGF: 15.024m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(7) Neubau MIN-Forum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaal- /<br />
Bibliotheksgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 26,30m<br />
BGF: 20.038m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(4) Chemie und Pharmazie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 7 VG, 1 DG<br />
Höhe: 29,70m<br />
BGF: 20.321m²<br />
Baujahr: 1983-1985<br />
(4) HZG und DKRZ<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG, 1 DG<br />
Höhe: 23,50m<br />
BGF: 8.860m²<br />
Baujahr: 1983-1985 (Umbau 2009)<br />
(3) ZMAV<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG<br />
Höhe: 14,80m<br />
BGF: 10.248m²<br />
Baujahr: 2003<br />
(2) Geomatikum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaalgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 19 VG, 1 DG<br />
Höhe: 85,70m<br />
BGF: 37.907m²<br />
Baujahr: 1975<br />
(1) Neubau Haus der Erde<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 6 VG, 1 Technik-G<br />
Höhe: 28,90m<br />
BGF: 42.542m²<br />
Baujahr: 2016-2020<br />
(9) Angewandte Analytik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,08m<br />
BGF: 2.246m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Biochemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG, 1 DG<br />
Höhe: 7,20m<br />
BGF: 1.985m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Warenannahme<br />
(9) Bibliothek<br />
Hauptnutzung: Bibliotheksgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,08m<br />
BGF: 2.246m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) NMR<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 5,10m<br />
BGF: 83m²<br />
Baujahr: 1999<br />
(9) Hörsäle<br />
(8) Neubau Informatik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 10 VG<br />
Höhe: 42,31m<br />
BGF: 15.024m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(7) Neubau MIN-Forum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaal- /<br />
Bibliotheksgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 26,30m<br />
BGF: 20.038m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(4) HZG und DKRZ<br />
(3) ZMAV<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG<br />
Höhe: 14,80m<br />
BGF: 10.248m²<br />
Baujahr: 2003<br />
(2) Geomatikum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaalgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 19 VG, 1 DG<br />
Höhe: 85,70m<br />
BGF: 37.907m²<br />
Baujahr: 1975<br />
(1) Neubau Haus der Erde<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 6 VG, 1 Technik-G<br />
Höhe: 28,90m<br />
BGF: 42.542m²<br />
Baujahr: 2016-2020<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
(9) Angewan<br />
Hauptnutzung: Bü<br />
Geschosse: 1 UG,<br />
Höhe: 6,08m<br />
BGF: 2.246m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Biochemie<br />
Hauptnutzung: Bü<br />
Geschosse: 1 UG,<br />
Höhe: 7,20m<br />
BGF: 1.985m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Warenann<br />
Hauptnutzung: La<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 4,50m<br />
BGF: 1.122m²<br />
Baujahr: 2018<br />
(9) Bibliothek<br />
Hauptnutzung: Bib<br />
Geschosse: 1 UG, 2<br />
Höhe: 6,08m<br />
BGF: 2.246m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Verbindungsgang<br />
Hauptnutzung: Erschließungsgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 2.520m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Organische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.563m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Anorganische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.450m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Eingangshalle<br />
Hauptnutzung: Erschließungs- /<br />
Bürogebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 1.202m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) NMR<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 5,10m<br />
BGF: 83m²<br />
Baujahr: 1999<br />
(9) Hörsäle<br />
Hauptnutzung: Hörsaal- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,60m<br />
BGF: 4.278m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(8) Neubau Informatik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 10 VG<br />
Höhe: 42,31m<br />
BGF: 15.024m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(7) Neubau MIN-Forum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaal- /<br />
Bibliotheksgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 26,30m<br />
BGF: 20.038m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(6) Verfügungsgebäude 2<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 26,70m<br />
BGF: 19.735m²<br />
Baujahr: 1973-1974 (teilsaniert)<br />
(6) Büro- und Seminarfläche<br />
VG I<br />
Hauptnutzung: Büro- / Verwaltungsgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 23,82m<br />
BGF: 12.199m²<br />
Baujahr: 1963-1971<br />
(5) Zoologie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 8 VG<br />
Höhe: 28,60m<br />
BGF: 28.834m²<br />
Baujahr: 1969-1975 (im Sanierungszustand)<br />
(4) Chemie und Pharmazie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 7 VG, 1 DG<br />
Höhe: 29,70m<br />
BGF: 20.321m²<br />
Baujahr: 1983-1985<br />
(4) HZG und DKRZ<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG, 1 DG<br />
Höhe: 23,50m<br />
BGF: 8.860m²<br />
Baujahr: 1983-1985 (Umbau 2009)<br />
(3) ZMAV<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG<br />
Höhe: 14,80m<br />
BGF: 10.248m²<br />
Baujahr: 2003<br />
(2) Geomatikum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaalgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 19 VG, 1 DG<br />
Höhe: 85,70m<br />
BGF: 37.907m²<br />
Baujahr: 1975<br />
(1) Neubau Haus der Erde<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 6 VG, 1 Technik-G<br />
Höhe: 28,90m<br />
BGF: 42.542m²<br />
Baujahr: 2016-2020<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
(9) Angewan<br />
Hauptnutzung: Bü<br />
Geschosse: 1 UG,<br />
Höhe: 6,08m<br />
BGF: 2.246m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Biochemi<br />
Hauptnutzung: Bü<br />
Geschosse: 1 UG,<br />
Höhe: 7,20m<br />
BGF: 1.985m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Warenann<br />
Hauptnutzung: La<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 4,50m<br />
BGF: 1.122m²<br />
Baujahr: 2018<br />
(9) Bibliothek<br />
Hauptnutzung: Bi<br />
Geschosse: 1 UG,<br />
Höhe: 6,08m<br />
BGF: 2.246m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Verbindungsgang<br />
Hauptnutzung: Erschließungsgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 2.520m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Organische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.563m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Anorganische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.450m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Eingangshalle<br />
Hauptnutzung: Erschließungs- /<br />
Bürogebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 1.202m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) NMR<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 5,10m<br />
BGF: 83m²<br />
Baujahr: 1999<br />
(9) Hörsäle<br />
Hauptnutzung: Hörsaal- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,60m<br />
BGF: 4.278m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(8) Neubau Informatik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 10 VG<br />
Höhe: 42,31m<br />
BGF: 15.024m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(7) Neubau MIN-Forum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaal- /<br />
Bibliotheksgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 26,30m<br />
BGF: 20.038m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(6) Verfügungsgebäude 2<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 26,70m<br />
BGF: 19.735m²<br />
Baujahr: 1973-1974 (teilsaniert)<br />
(6) Büro- und Seminarfläche<br />
VG I<br />
Hauptnutzung: Büro- / Verwaltungsgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 23,82m<br />
BGF: 12.199m²<br />
Baujahr: 1963-1971<br />
(5) Zoologie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 8 VG<br />
Höhe: 28,60m<br />
BGF: 28.834m²<br />
Baujahr: 1969-1975 (im Sanierungszustand)<br />
(4) Chemie und Pharmazie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 7 VG, 1 DG<br />
Höhe: 29,70m<br />
BGF: 20.321m²<br />
Baujahr: 1983-1985<br />
(4) HZG und DKRZ<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG, 1 DG<br />
Höhe: 23,50m<br />
BGF: 8.860m²<br />
Baujahr: 1983-1985 (Umbau 2009)<br />
(3) ZMAV<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG<br />
Höhe: 14,80m<br />
BGF: 10.248m²<br />
Baujahr: 2003<br />
(2) Geomatikum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaalgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 19 VG, 1 DG<br />
Höhe: 85,70m<br />
BGF: 37.907m²<br />
Baujahr: 1975<br />
(1) Neubau Haus der Erde<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 6 VG, 1 Technik-G<br />
Höhe: 28,90m<br />
BGF: 42.542m²<br />
Baujahr: 2016-2020<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
(9) Angewan<br />
Hauptnutzung: Bü<br />
Geschosse: 1 UG,<br />
Höhe: 6,08m<br />
BGF: 2.246m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Biochemi<br />
Hauptnutzung: Bü<br />
Geschosse: 1 UG,<br />
Höhe: 7,20m<br />
BGF: 1.985m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Warenann<br />
Hauptnutzung: La<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 4,50m<br />
BGF: 1.122m²<br />
Baujahr: 2018<br />
(9) Bibliothek<br />
Hauptnutzung: Bi<br />
Geschosse: 1 UG,<br />
Höhe: 6,08m<br />
BGF: 2.246m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Verbindungsgang<br />
Hauptnutzung: Erschließungsgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 2.520m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Organische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.563m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Anorganische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.450m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Eingangshalle<br />
Hauptnutzung: Erschließungs- /<br />
Bürogebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 1.202m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) NMR<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 5,10m<br />
BGF: 83m²<br />
Baujahr: 1999<br />
(9) Hörsäle<br />
Hauptnutzung: Hörsaal- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,60m<br />
BGF: 4.278m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(8) Neubau Informatik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 10 VG<br />
Höhe: 42,31m<br />
BGF: 15.024m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(7) Neubau MIN-Forum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaal- /<br />
Bibliotheksgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 26,30m<br />
BGF: 20.038m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(6) Verfügungsgebäude 2<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 26,70m<br />
BGF: 19.735m²<br />
Baujahr: 1973-1974 (teilsaniert)<br />
(6) Büro- und Seminarfläche<br />
VG I<br />
Hauptnutzung: Büro- / Verwaltungsgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 23,82m<br />
BGF: 12.199m²<br />
Baujahr: 1963-1971<br />
(5) Zoologie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 8 VG<br />
Höhe: 28,60m<br />
BGF: 28.834m²<br />
Baujahr: 1969-1975 (im Sanierungszustand)<br />
(4) Chemie und Pharmazie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 7 VG, 1 DG<br />
Höhe: 29,70m<br />
BGF: 20.321m²<br />
Baujahr: 1983-1985<br />
(4) HZG und DKRZ<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG, 1 DG<br />
Höhe: 23,50m<br />
BGF: 8.860m²<br />
Baujahr: 1983-1985 (Umbau 2009)<br />
(3) ZMAV<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG<br />
Höhe: 14,80m<br />
BGF: 10.248m²<br />
Baujahr: 2003<br />
(2) Geomatikum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaalgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 19 VG, 1 DG<br />
Höhe: 85,70m<br />
BGF: 37.907m²<br />
Baujahr: 1975<br />
(1) Neubau Haus der Erde<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 6 VG, 1 Technik-G<br />
Höhe: 28,90m<br />
BGF: 42.542m²<br />
Baujahr: 2016-2020<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
(9) Angewand<br />
Hauptnutzung: Büro<br />
Geschosse: 1 UG, 2<br />
Höhe: 6,08m<br />
BGF: 2.246m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Biochemie<br />
Hauptnutzung: Büro<br />
Geschosse: 1 UG, 2<br />
Höhe: 7,20m<br />
BGF: 1.985m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Warenanna<br />
Hauptnutzung: Lag<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 4,50m<br />
BGF: 1.122m²<br />
Baujahr: 2018<br />
(9) Bibliothek<br />
Hauptnutzung: Bibli<br />
Geschosse: 1 UG, 2<br />
Höhe: 6,08m<br />
BGF: 2.246m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Verbindungsgang<br />
Hauptnutzung: Erschließungsgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 2.520m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Organische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.563m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Anorganische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.450m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Eingangshalle<br />
Hauptnutzung: Erschließungs- /<br />
Bürogebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 1.202m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) NMR<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 5,10m<br />
BGF: 83m²<br />
Baujahr: 1999<br />
(9) Hörsäle<br />
Hauptnutzung: Hörsaal- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,60m<br />
BGF: 4.278m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(8) Neubau Informatik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 10 VG<br />
Höhe: 42,31m<br />
BGF: 15.024m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(7) Neubau MIN-Forum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaal- /<br />
Bibliotheksgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 26,30m<br />
BGF: 20.038m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(6) Verfügungsgebäude 2<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 26,70m<br />
BGF: 19.735m²<br />
Baujahr: 1973-1974 (teilsaniert)<br />
(6) Büro- und Seminarfläche<br />
VG I<br />
Hauptnutzung: Büro- / Verwaltungsgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 23,82m<br />
BGF: 12.199m²<br />
Baujahr: 1963-1971<br />
(5) Zoologie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 8 VG<br />
Höhe: 28,60m<br />
BGF: 28.834m²<br />
Baujahr: 1969-1975 (im Sanierungszustand)<br />
(4) Chemie und Pharmazie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 7 VG, 1 DG<br />
Höhe: 29,70m<br />
BGF: 20.321m²<br />
Baujahr: 1983-1985<br />
(4) HZG und DKRZ<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG, 1 DG<br />
Höhe: 23,50m<br />
BGF: 8.860m²<br />
Baujahr: 1983-1985 (Umbau 2009)<br />
(3) ZMAV<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG<br />
Höhe: 14,80m<br />
BGF: 10.248m²<br />
Baujahr: 2003<br />
(2) Geomatikum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaalgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 19 VG, 1 DG<br />
Höhe: 85,70m<br />
BGF: 37.907m²<br />
Baujahr: 1975<br />
(1) Neubau Haus der Erde<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 6 VG, 1 Technik-G<br />
Höhe: 28,90m<br />
BGF: 42.542m²<br />
Baujahr: 2016-2020<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
(9) Ange<br />
Hauptnutz<br />
Geschosse<br />
Höhe: 6,08<br />
BGF: 2.246<br />
Baujahr: 19<br />
(9) Bioc<br />
Hauptnutz<br />
Geschosse<br />
Höhe: 7,20<br />
BGF: 1.985m<br />
Baujahr: 19<br />
(9) Ware<br />
Hauptnutz<br />
Geschosse<br />
Höhe: 4,50<br />
BGF: 1.122m<br />
Baujahr: 20<br />
(9) Bibli<br />
Hauptnutz<br />
Geschosse<br />
Höhe: 6,08<br />
BGF: 2.246<br />
Baujahr: 19<br />
(9) Verbindungsgang<br />
Hauptnutzung: Erschließungsgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 2.520m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Organische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.563m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Anorganische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.450m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Eingangshalle<br />
Hauptnutzung: Erschließungs- /<br />
Bürogebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 1.202m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) NMR<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 5,10m<br />
BGF: 83m²<br />
Baujahr: 1999<br />
(9) Hörsäle<br />
Hauptnutzung: Hörsaal- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,60m<br />
BGF: 4.278m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(8) Neubau Informatik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 10 VG<br />
Höhe: 42,31m<br />
BGF: 15.024m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(7) Neubau MIN-Forum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaal- /<br />
Bibliotheksgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 26,30m<br />
BGF: 20.038m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(6) Verfügungsgebäude 2<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 26,70m<br />
BGF: 19.735m²<br />
Baujahr: 1973-1974 (teilsaniert)<br />
(6) Büro- und Seminarfläche<br />
VG I<br />
Hauptnutzung: Büro- / Verwaltungsgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 23,82m<br />
BGF: 12.199m²<br />
Baujahr: 1963-1971<br />
(5) Zoologie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 8 VG<br />
Höhe: 28,60m<br />
BGF: 28.834m²<br />
Baujahr: 1969-1975 (im Sanierungszustand)<br />
(4) Chemie und Pharmazie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 7 VG, 1 DG<br />
Höhe: 29,70m<br />
BGF: 20.321m²<br />
Baujahr: 1983-1985<br />
(4) HZG und DKRZ<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG, 1 DG<br />
Höhe: 23,50m<br />
BGF: 8.860m²<br />
Baujahr: 1983-1985 (Umbau 2009)<br />
(3) ZMAV<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG<br />
Höhe: 14,80m<br />
BGF: 10.248m²<br />
Baujahr: 2003<br />
(2) Geomatikum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaalgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 19 VG, 1 DG<br />
Höhe: 85,70m<br />
BGF: 37.907m²<br />
Baujahr: 1975<br />
(1) Neubau Haus der Erde<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 6 VG, 1 Technik-G<br />
Höhe: 28,90m<br />
BGF: 42.542m²<br />
Baujahr: 2016-2020<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
(9) An<br />
Hauptnu<br />
Geschos<br />
Höhe: 6<br />
BGF: 2.2<br />
Baujahr<br />
(9) Bio<br />
Hauptnu<br />
Geschos<br />
Höhe: 7<br />
BGF: 1.9<br />
Baujahr<br />
(9) Wa<br />
Hauptnu<br />
Geschos<br />
Höhe: 4<br />
BGF: 1.12<br />
Baujahr<br />
(9) Bib<br />
Hauptnu<br />
Geschos<br />
Höhe: 6<br />
BGF: 2.2<br />
Baujahr<br />
(9) Verbindungsgang<br />
Hauptnutzung: Erschließungsgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 2.520m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Organische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.563m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Anorganische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.450m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Eingangshalle<br />
Hauptnutzung: Erschließungs- /<br />
Bürogebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 1.202m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) NMR<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 5,10m<br />
BGF: 83m²<br />
Baujahr: 1999<br />
(9) Hörsäle<br />
Hauptnutzung: Hörsaal- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,60m<br />
BGF: 4.278m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(8) Neubau Informatik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 10 VG<br />
Höhe: 42,31m<br />
BGF: 15.024m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(7) Neubau MIN-Forum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaal- /<br />
Bibliotheksgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 26,30m<br />
BGF: 20.038m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(6) Verfügungsgebäude 2<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 26,70m<br />
BGF: 19.735m²<br />
Baujahr: 1973-1974 (teilsaniert)<br />
(6) Büro- und Seminarfläche<br />
VG I<br />
Hauptnutzung: Büro- / Verwaltungsgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 23,82m<br />
BGF: 12.199m²<br />
Baujahr: 1963-1971<br />
(5) Zoologie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 8 VG<br />
Höhe: 28,60m<br />
BGF: 28.834m²<br />
Baujahr: 1969-1975 (im Sanierungszustand)<br />
(4) Chemie und Pharmazie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 7 VG, 1 DG<br />
Höhe: 29,70m<br />
BGF: 20.321m²<br />
Baujahr: 1983-1985<br />
(4) HZG und DKRZ<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG, 1 DG<br />
Höhe: 23,50m<br />
BGF: 8.860m²<br />
Baujahr: 1983-1985 (Umbau 2009)<br />
(3) ZMAV<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG<br />
Höhe: 14,80m<br />
BGF: 10.248m²<br />
Baujahr: 2003<br />
(2) Geomatikum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaalgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 19 VG, 1 DG<br />
Höhe: 85,70m<br />
BGF: 37.907m²<br />
Baujahr: 1975<br />
(1) Neubau Haus der Erde<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 6 VG, 1 Technik-G<br />
Höhe: 28,90m<br />
BGF: 42.542m²<br />
Baujahr: 2016-2020<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
(9) An<br />
Hauptnu<br />
Geschos<br />
Höhe: 6<br />
BGF: 2.2<br />
Baujahr:<br />
(9) Bio<br />
Hauptnu<br />
Geschos<br />
Höhe: 7<br />
BGF: 1.9<br />
Baujahr:<br />
(9) Wa<br />
Hauptnu<br />
Geschos<br />
Höhe: 4<br />
BGF: 1.12<br />
Baujahr:<br />
(9) Bib<br />
Hauptnu<br />
Geschos<br />
Höhe: 6,<br />
BGF: 2.2<br />
Baujahr:<br />
(9) Verbindungsgang<br />
Hauptnutzung: Erschließungsgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 2.520m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Organische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.563m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Anorganische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.450m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Eingangshalle<br />
Hauptnutzung: Erschließungs- /<br />
Bürogebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 1.202m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) NMR<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 5,10m<br />
BGF: 83m²<br />
Baujahr: 1999<br />
(9) Hörsäle<br />
Hauptnutzung: Hörsaal- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,60m<br />
BGF: 4.278m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(8) Neubau Informatik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 10 VG<br />
Höhe: 42,31m<br />
BGF: 15.024m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(7) Neubau MIN-Forum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaal- /<br />
Bibliotheksgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 26,30m<br />
BGF: 20.038m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(6) Verfügungsgebäude 2<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 26,70m<br />
BGF: 19.735m²<br />
Baujahr: 1973-1974 (teilsaniert)<br />
(6) Büro- und Seminarfläche<br />
VG I<br />
Hauptnutzung: Büro- / Verwaltungsgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 23,82m<br />
BGF: 12.199m²<br />
Baujahr: 1963-1971<br />
(5) Zoologie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 8 VG<br />
Höhe: 28,60m<br />
BGF: 28.834m²<br />
Baujahr: 1969-1975 (im Sanierungszustand)<br />
(4) Chemie und Pharmazie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 7 VG, 1 DG<br />
Höhe: 29,70m<br />
BGF: 20.321m²<br />
Baujahr: 1983-1985<br />
(4) HZG und DKRZ<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG, 1 DG<br />
Höhe: 23,50m<br />
BGF: 8.860m²<br />
Baujahr: 1983-1985 (Umbau 2009)<br />
(3) ZMAV<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG<br />
Höhe: 14,80m<br />
BGF: 10.248m²<br />
Baujahr: 2003<br />
(2) Geomatikum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaalgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 19 VG, 1 DG<br />
Höhe: 85,70m<br />
BGF: 37.907m²<br />
Baujahr: 1975<br />
(1) Neubau Haus der Erde<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 6 VG, 1 Technik-G<br />
Höhe: 28,90m<br />
BGF: 42.542m²<br />
Baujahr: 2016-2020<br />
(9) Angewandte Analytik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,08m<br />
BGF: 2.246m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Biochemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG, 1 DG<br />
Höhe: 7,20m<br />
BGF: 1.985m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Warenannahme<br />
(9) Bibliothek<br />
Hauptnutzung: Bibliotheksgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,08m<br />
BGF: 2.246m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) NMR<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 5,10m<br />
BGF: 83m²<br />
Baujahr: 1999<br />
(9) Hörsäle<br />
(8) Neubau Informatik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 10 VG<br />
Höhe: 42,31m<br />
BGF: 15.024m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(7) Neubau MIN-Forum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaal- /<br />
Bibliotheksgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 26,30m<br />
BGF: 20.038m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(4) HZG und DKRZ<br />
(3) ZMAV<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG<br />
Höhe: 14,80m<br />
BGF: 10.248m²<br />
Baujahr: 2003<br />
(2) Geomatikum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaalgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 19 VG, 1 DG<br />
Höhe: 85,70m<br />
BGF: 37.907m²<br />
Baujahr: 1975<br />
(1) Neubau Haus der Erde<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 6 VG, 1 Technik-G<br />
Höhe: 28,90m<br />
BGF: 42.542m²<br />
Baujahr: 2016-2020<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
(9) Verbindungsgang<br />
Hauptnutzung: Erschließungsgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 2.520m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Organische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.563m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Anorganische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.450m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Eingangshalle<br />
Hauptnutzung: Erschließungs- /<br />
Bürogebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 1.202m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) NMR<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 5,10m<br />
BGF: 83m²<br />
Baujahr: 1999<br />
(9) Hörsäle<br />
Hauptnutzung: Hörsaal- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,60m<br />
BGF: 4.278m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(8) Neubau Informatik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 10 VG<br />
Höhe: 42,31m<br />
BGF: 15.024m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
Höhe: 26,30m<br />
BGF: 20.038m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(6) Verfügungsgebäude 2<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 26,70m<br />
BGF: 19.735m²<br />
Baujahr: 1973-1974 (teilsaniert)<br />
(6) Büro- und Seminarfläche<br />
VG I<br />
Hauptnutzung: Büro- / Verwaltungsgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 23,82m<br />
BGF: 12.199m²<br />
Baujahr: 1963-1971<br />
(5) Zoologie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 8 VG<br />
Höhe: 28,60m<br />
BGF: 28.834m²<br />
Baujahr: 1969-1975 (im Sanierungszustand)<br />
(4) Chemie und Pharmazie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 7 VG, 1 DG<br />
Höhe: 29,70m<br />
BGF: 20.321m²<br />
Baujahr: 1983-1985<br />
(4) HZG und DKRZ<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG, 1 DG<br />
Höhe: 23,50m<br />
BGF: 8.860m²<br />
Baujahr: 1983-1985 (Umbau 2009)<br />
(3) ZMAV<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG<br />
Höhe: 14,80m<br />
BGF: 10.248m²<br />
Baujahr: 2003<br />
(2) Geomatikum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaalgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 19 VG, 1 DG<br />
Höhe: 85,70m<br />
BGF: 37.907m²<br />
Baujahr: 1975<br />
BGF: 42.542m²<br />
Baujahr: 2016-2020<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
(9) Verbindungsgang<br />
Hauptnutzung: Erschließungsgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 2.520m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Organische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.563m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Anorganische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.450m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Eingangshalle<br />
Hauptnutzung: Erschließungs- /<br />
Bürogebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 1.202m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) NMR<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 5,10m<br />
BGF: 83m²<br />
Baujahr: 1999<br />
(9) Hörsäle<br />
Hauptnutzung: Hörsaal- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,60m<br />
BGF: 4.278m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(8) Neubau Informatik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 10 VG<br />
Höhe: 42,31m<br />
BGF: 15.024m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
BGF: 20.038m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(6) Verfügungsgebäude 2<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 26,70m<br />
BGF: 19.735m²<br />
Baujahr: 1973-1974 (teilsaniert)<br />
(6) Büro- und Seminarfläche<br />
VG I<br />
Hauptnutzung: Büro- / Verwaltungsgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 23,82m<br />
BGF: 12.199m²<br />
Baujahr: 1963-1971<br />
(5) Zoologie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 8 VG<br />
Höhe: 28,60m<br />
BGF: 28.834m²<br />
Baujahr: 1969-1975 (im Sanierungszustand)<br />
(4) Chemie und Pharmazie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 7 VG, 1 DG<br />
Höhe: 29,70m<br />
BGF: 20.321m²<br />
Baujahr: 1983-1985<br />
(4) HZG und DKRZ<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG, 1 DG<br />
Höhe: 23,50m<br />
BGF: 8.860m²<br />
Baujahr: 1983-1985 (Umbau 2009)<br />
(3) ZMAV<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG<br />
Höhe: 14,80m<br />
BGF: 10.248m²<br />
Baujahr: 2003<br />
(2) Geomatikum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaalgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 19 VG, 1 DG<br />
Höhe: 85,70m<br />
BGF: 37.907m²<br />
Baujahr: 1975<br />
Baujahr: 2016-2020<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
(9) Verbindungsgang<br />
Hauptnutzung: Erschließungsgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 2.520m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Organische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.563m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Anorganische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.450m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Eingangshalle<br />
Hauptnutzung: Erschließungs- /<br />
Bürogebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 1.202m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) NMR<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 5,10m<br />
BGF: 83m²<br />
Baujahr: 1999<br />
(9) Hörsäle<br />
Hauptnutzung: Hörsaal- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,60m<br />
BGF: 4.278m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(8) Neubau Informatik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 10 VG<br />
Höhe: 42,31m<br />
BGF: 15.024m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
Höhe: 26,30m<br />
BGF: 20.038m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(6) Verfügungsgebäude 2<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 26,70m<br />
BGF: 19.735m²<br />
Baujahr: 1973-1974 (teilsaniert)<br />
(6) Büro- und Seminarfläche<br />
VG I<br />
Hauptnutzung: Büro- / Verwaltungsgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 23,82m<br />
BGF: 12.199m²<br />
Baujahr: 1963-1971<br />
(5) Zoologie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 8 VG<br />
Höhe: 28,60m<br />
BGF: 28.834m²<br />
Baujahr: 1969-1975 (im Sanierungszustand)<br />
(4) Chemie und Pharmazie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 7 VG, 1 DG<br />
Höhe: 29,70m<br />
BGF: 20.321m²<br />
Baujahr: 1983-1985<br />
(4) HZG und DKRZ<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG, 1 DG<br />
Höhe: 23,50m<br />
BGF: 8.860m²<br />
Baujahr: 1983-1985 (Umbau 2009)<br />
(3) ZMAV<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG<br />
Höhe: 14,80m<br />
BGF: 10.248m²<br />
Baujahr: 2003<br />
(2) Geomatikum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaalgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 19 VG, 1 DG<br />
Höhe: 85,70m<br />
BGF: 37.907m²<br />
Baujahr: 1975<br />
BGF: 42.542m²<br />
Baujahr: 2016-2020<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
(9) Verbindungsgang<br />
Hauptnutzung: Erschließungsgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 2.520m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Organische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.563m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Anorganische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.450m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Eingangshalle<br />
Hauptnutzung: Erschließungs- /<br />
Bürogebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 1.202m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) NMR<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 5,10m<br />
BGF: 83m²<br />
Baujahr: 1999<br />
(9) Hörsäle<br />
Hauptnutzung: Hörsaal- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,60m<br />
BGF: 4.278m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(8) Neubau Informatik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 10 VG<br />
Höhe: 42,31m<br />
BGF: 15.024m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 26,30m<br />
BGF: 20.038m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(6) Verfügungsgebäude 2<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 26,70m<br />
BGF: 19.735m²<br />
Baujahr: 1973-1974 (teilsaniert)<br />
(6) Büro- und Seminarfläche<br />
VG I<br />
Hauptnutzung: Büro- / Verwaltungsgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 23,82m<br />
BGF: 12.199m²<br />
Baujahr: 1963-1971<br />
(5) Zoologie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 8 VG<br />
Höhe: 28,60m<br />
BGF: 28.834m²<br />
Baujahr: 1969-1975 (im Sanierungszustand)<br />
(4) Chemie und Pharmazie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 7 VG, 1 DG<br />
Höhe: 29,70m<br />
BGF: 20.321m²<br />
Baujahr: 1983-1985<br />
(4) HZG und DKRZ<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG, 1 DG<br />
Höhe: 23,50m<br />
BGF: 8.860m²<br />
Baujahr: 1983-1985 (Umbau 2009)<br />
(3) ZMAV<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG<br />
Höhe: 14,80m<br />
BGF: 10.248m²<br />
Baujahr: 2003<br />
(2) Geomatikum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaalgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 19 VG, 1 DG<br />
Höhe: 85,70m<br />
BGF: 37.907m²<br />
Baujahr: 1975<br />
Höhe: 28,90m<br />
BGF: 42.542m²<br />
Baujahr: 2016-2020<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
(9) Verbindungsgang<br />
Hauptnutzung: Erschließungsgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 2.520m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Organische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.563m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Anorganische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.450m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Eingangshalle<br />
Hauptnutzung: Erschließungs- /<br />
Bürogebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 1.202m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) NMR<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 5,10m<br />
BGF: 83m²<br />
Baujahr: 1999<br />
(9) Hörsäle<br />
Hauptnutzung: Hörsaal- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,60m<br />
BGF: 4.278m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(8) Neubau Informatik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 10 VG<br />
Höhe: 42,31m<br />
BGF: 15.024m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
Höhe: 26,30m<br />
BGF: 20.038m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(6) Verfügungsgebäude 2<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 26,70m<br />
BGF: 19.735m²<br />
Baujahr: 1973-1974 (teilsaniert)<br />
(6) Büro- und Seminarfläche<br />
VG I<br />
Hauptnutzung: Büro- / Verwaltungsgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 23,82m<br />
BGF: 12.199m²<br />
Baujahr: 1963-1971<br />
(5) Zoologie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 8 VG<br />
Höhe: 28,60m<br />
BGF: 28.834m²<br />
Baujahr: 1969-1975 (im Sanierungszustand)<br />
(4) Chemie und Pharmazie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 7 VG, 1 DG<br />
Höhe: 29,70m<br />
BGF: 20.321m²<br />
Baujahr: 1983-1985<br />
(4) HZG und DKRZ<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG, 1 DG<br />
Höhe: 23,50m<br />
BGF: 8.860m²<br />
Baujahr: 1983-1985 (Umbau 2009)<br />
(3) ZMAV<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG<br />
Höhe: 14,80m<br />
BGF: 10.248m²<br />
Baujahr: 2003<br />
(2) Geomatikum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaalgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 19 VG, 1 DG<br />
Höhe: 85,70m<br />
BGF: 37.907m²<br />
Baujahr: 1975<br />
BGF: 42.542m²<br />
Baujahr: 2016-2020<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
(9) Verbindungsgang<br />
Hauptnutzung: Erschließungsgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 2.520m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Organische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.563m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Anorganische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.450m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Eingangshalle<br />
Hauptnutzung: Erschließungs- /<br />
Bürogebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 1.202m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) NMR<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 5,10m<br />
BGF: 83m²<br />
Baujahr: 1999<br />
(9) Hörsäle<br />
Hauptnutzung: Hörsaal- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,60m<br />
BGF: 4.278m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(8) Neubau Informatik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 10 VG<br />
Höhe: 42,31m<br />
BGF: 15.024m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
BGF: 20.038m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(6) Verfügungsgebäude 2<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 26,70m<br />
BGF: 19.735m²<br />
Baujahr: 1973-1974 (teilsaniert)<br />
(6) Büro- und Seminarfläche<br />
VG I<br />
Hauptnutzung: Büro- / Verwaltungsgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 23,82m<br />
BGF: 12.199m²<br />
Baujahr: 1963-1971<br />
(5) Zoologie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 8 VG<br />
Höhe: 28,60m<br />
BGF: 28.834m²<br />
Baujahr: 1969-1975 (im Sanierungszustand)<br />
(4) Chemie und Pharmazie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 7 VG, 1 DG<br />
Höhe: 29,70m<br />
BGF: 20.321m²<br />
Baujahr: 1983-1985<br />
(4) HZG und DKRZ<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG, 1 DG<br />
Höhe: 23,50m<br />
BGF: 8.860m²<br />
Baujahr: 1983-1985 (Umbau 2009)<br />
(3) ZMAV<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG<br />
Höhe: 14,80m<br />
BGF: 10.248m²<br />
Baujahr: 2003<br />
(2) Geomatikum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaalgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 19 VG, 1 DG<br />
Höhe: 85,70m<br />
BGF: 37.907m²<br />
Baujahr: 1975<br />
Baujahr: 2016-2020<br />
(9) Angewandte Analytik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,08m<br />
BGF: 2.246m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Biochemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG, 1 DG<br />
Höhe: 7,20m<br />
BGF: 1.985m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Warenannahme<br />
Hauptnutzung: Lagergebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 4,50m<br />
BGF: 1.122m²<br />
Baujahr: 2018<br />
(9) Bibliothek<br />
Hauptnutzung: Bibliotheksgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,08m<br />
BGF: 2.246m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Eingangshalle<br />
Hauptnutzung: Erschließungs- /<br />
Bürogebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 1.202m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) NMR<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 5,10m<br />
BGF: 83m²<br />
Baujahr: 1999<br />
(9) Hörsäle<br />
Hauptnutzung: Hörsaal- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,60m<br />
BGF: 4.278m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(8) Neubau Informatik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 10 VG<br />
Höhe: 42,31m<br />
BGF: 15.024m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(7) Neubau MIN-Forum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaal- /<br />
Bibliotheksgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 26,30m<br />
BGF: 20.038m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(4) Chemie und Pharmazie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 7 VG, 1 DG<br />
Höhe: 29,70m<br />
BGF: 20.321m²<br />
Baujahr: 1983-1985<br />
(4) HZG und DKRZ<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG, 1 DG<br />
Höhe: 23,50m<br />
BGF: 8.860m²<br />
Baujahr: 1983-1985 (Umbau 2009)<br />
(3) ZMAV<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG<br />
Höhe: 14,80m<br />
BGF: 10.248m²<br />
Baujahr: 2003<br />
(2) Geomatikum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaalgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 19 VG, 1 DG<br />
Höhe: 85,70m<br />
BGF: 37.907m²<br />
Baujahr: 1975<br />
(1) Neubau Haus der Erde<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 6 VG, 1 Technik-G<br />
Höhe: 28,90m<br />
BGF: 42.542m²<br />
Baujahr: 2016-2020<br />
(9) Angewandte Analytik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,08m<br />
BGF: 2.246m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Biochemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG, 1 DG<br />
Höhe: 7,20m<br />
BGF: 1.985m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Warenannahme<br />
Hauptnutzung: Lagergebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 4,50m<br />
BGF: 1.122m²<br />
Baujahr: 2018<br />
(9) Bibliothek<br />
Hauptnutzung: Bibliotheksgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,08m<br />
BGF: 2.246m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Anorganische Chemie<br />
(9) Eingangshalle<br />
Hauptnutzung: Erschließungs- /<br />
Bürogebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 1.202m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) NMR<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 5,10m<br />
BGF: 83m²<br />
Baujahr: 1999<br />
(9) Hörsäle<br />
Hauptnutzung: Hörsaal- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,60m<br />
BGF: 4.278m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(8) Neubau Informatik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 10 VG<br />
Höhe: 42,31m<br />
BGF: 15.024m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(7) Neubau MIN-Forum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaal- /<br />
Bibliotheksgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 26,30m<br />
BGF: 20.038m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(5) Zoologie<br />
(4) Chemie und Pharmazie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 7 VG, 1 DG<br />
Höhe: 29,70m<br />
BGF: 20.321m²<br />
Baujahr: 1983-1985<br />
(4) HZG und DKRZ<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG, 1 DG<br />
Höhe: 23,50m<br />
BGF: 8.860m²<br />
Baujahr: 1983-1985 (Umbau 2009)<br />
(3) ZMAV<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG<br />
Höhe: 14,80m<br />
BGF: 10.248m²<br />
Baujahr: 2003<br />
(2) Geomatikum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaalgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 19 VG, 1 DG<br />
Höhe: 85,70m<br />
BGF: 37.907m²<br />
Baujahr: 1975<br />
(1) Neubau Haus der Erde<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 6 VG, 1 Technik-G<br />
Höhe: 28,90m<br />
BGF: 42.542m²<br />
Baujahr: 2016-2020<br />
(9) Angewandte Analytik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,08m<br />
BGF: 2.246m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Biochemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG, 1 DG<br />
Höhe: 7,20m<br />
BGF: 1.985m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Warenannahme<br />
Hauptnutzung: Lagergebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 4,50m<br />
BGF: 1.122m²<br />
Baujahr: 2018<br />
(9) Bibliothek<br />
Hauptnutzung: Bibliotheksgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,08m<br />
BGF: 2.246m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Anorganische Chemie<br />
(9) Eingangshalle<br />
Hauptnutzung: Erschließungs- /<br />
Bürogebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 1.202m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) NMR<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 5,10m<br />
BGF: 83m²<br />
Baujahr: 1999<br />
(9) Hörsäle<br />
Hauptnutzung: Hörsaal- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,60m<br />
BGF: 4.278m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(8) Neubau Informatik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 10 VG<br />
Höhe: 42,31m<br />
BGF: 15.024m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(7) Neubau MIN-Forum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaal- /<br />
Bibliotheksgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 26,30m<br />
BGF: 20.038m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(5) Zoologie<br />
(4) Chemie und Pharmazie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 7 VG, 1 DG<br />
Höhe: 29,70m<br />
BGF: 20.321m²<br />
Baujahr: 1983-1985<br />
(4) HZG und DKRZ<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG, 1 DG<br />
Höhe: 23,50m<br />
BGF: 8.860m²<br />
Baujahr: 1983-1985 (Umbau 2009)<br />
(3) ZMAV<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG<br />
Höhe: 14,80m<br />
BGF: 10.248m²<br />
Baujahr: 2003<br />
(2) Geomatikum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaalgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 19 VG, 1 DG<br />
Höhe: 85,70m<br />
BGF: 37.907m²<br />
Baujahr: 1975<br />
(1) Neubau Haus der Erde<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 6 VG, 1 Technik-G<br />
Höhe: 28,90m<br />
BGF: 42.542m²<br />
Baujahr: 2016-2020<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
(9) Angewand<br />
Hauptnutzung: Büro<br />
Geschosse: 1 UG, 2<br />
Höhe: 6,08m<br />
BGF: 2.246m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Biochemie<br />
Hauptnutzung: Büro<br />
Geschosse: 1 UG, 2<br />
Höhe: 7,20m<br />
BGF: 1.985m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Warenanna<br />
Hauptnutzung: Lag<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 4,50m<br />
BGF: 1.122m²<br />
Baujahr: 2018<br />
(9) Bibliothek<br />
Hauptnutzung: Bibli<br />
Geschosse: 1 UG, 2<br />
Höhe: 6,08m<br />
BGF: 2.246m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Verbindungsgang<br />
Hauptnutzung: Erschließungsgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 2.520m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Organische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.563m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Anorganische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60m<br />
BGF: 8.450m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) Eingangshalle<br />
Hauptnutzung: Erschließungs- /<br />
Bürogebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60m<br />
BGF: 1.202m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(9) NMR<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 5,10m<br />
BGF: 83m²<br />
Baujahr: 1999<br />
(9) Hörsäle<br />
Hauptnutzung: Hörsaal- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,60m<br />
BGF: 4.278m²<br />
Baujahr: 1963<br />
(8) Neubau Informatik<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 10 VG<br />
Höhe: 42,31m<br />
BGF: 15.024m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(7) Neubau MIN-Forum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaal- /<br />
Bibliotheksgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 26,30m<br />
BGF: 20.038m²<br />
Baujahr: 2019 - XXXX<br />
(6) Verfügungsgebäude 2<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 26,70m<br />
BGF: 19.735m²<br />
Baujahr: 1973-1974 (teilsaniert)<br />
(6) Büro- und Seminarfläche<br />
VG I<br />
Hauptnutzung: Büro- / Verwaltungsgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 23,82m<br />
BGF: 12.199m²<br />
Baujahr: 1963-1971<br />
(5) Zoologie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 8 VG<br />
Höhe: 28,60m<br />
BGF: 28.834m²<br />
Baujahr: 1969-1975 (im Sanierungszustand)<br />
(4) Chemie und Pharmazie<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 7 VG, 1 DG<br />
Höhe: 29,70m<br />
BGF: 20.321m²<br />
Baujahr: 1983-1985<br />
(4) HZG und DKRZ<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG, 1 DG<br />
Höhe: 23,50m<br />
BGF: 8.860m²<br />
Baujahr: 1983-1985 (Umbau 2009)<br />
(3) ZMAV<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG<br />
Höhe: 14,80m<br />
BGF: 10.248m²<br />
Baujahr: 2003<br />
(2) Geomatikum<br />
Hauptnutzung: Büro- / Hörsaalgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 19 VG, 1 DG<br />
Höhe: 85,70m<br />
BGF: 37.907m²<br />
Baujahr: 1975<br />
(1) Neubau Haus der Erde<br />
Hauptnutzung: Büro- / Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 6 VG, 1 Technik-G<br />
Höhe: 28,90m<br />
BGF: 42.542m²<br />
Baujahr: 2016-2020<br />
50 | 51<br />
1 Neubau Haus der Erde<br />
Hauptnutzung: Büro-/Laborgebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 6 VG, 1 Technik-G<br />
Höhe: 28,90 Meter<br />
BGF: 42.542 Quadratmeter<br />
Baujahre: 2016–2020<br />
2 Geomatikum<br />
Hauptnutzung: Büro-/Hörsaal-<br />
gebäude<br />
Geschosse: 2 UG, 19 VG, 1 DG<br />
Höhe: 85,70 Meter<br />
BGF: 37.907 Quadratmeter<br />
Baujahr: 1975<br />
3 ZMAV<br />
Hauptnutzung: Büro-/Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG<br />
Höhe: 14,80 Meter<br />
BGF: 10.248 Quadratmeter<br />
Baujahr: 2003<br />
4 HZG und DKRZ<br />
Hauptnutzung: Büro-/Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 5 VG, 1 DG<br />
Höhe: 23,50 Meter<br />
BGF: 8860 Quadratmeter<br />
Baujahre: 1983–1985 (Umbau 2009)<br />
4 Chemie und Pharmazie<br />
Hauptnutzung: Büro-/Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 7 VG, 1 DG<br />
Höhe: 29,70 Meter<br />
BGF: 20.321 Quadratmeter<br />
Baujahre: 1983–1985 (Umbau 2009)<br />
5 Zoologie<br />
Hauptnutzung: Büro-/Laborgebäude,<br />
Museum<br />
Geschosse: 2 UG, 8 VG<br />
Höhe: 28,60 Meter<br />
BGF: 28.834 Quadratmeter<br />
Baujahre: 1969–1975 (im Sanierungszustand)<br />
6 Verfügungsgebäude 1<br />
Hauptnutzung: Büro-/Seminar-<br />
gebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 23,82 Meter<br />
BGF: 12.199 Quadratmeter<br />
Baujahre: 1963–1971<br />
6 Verfügungsgebäude 2<br />
Hauptnutzung: Büro-/Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 26,70 Meter<br />
BGF: 19.735 Quadratmeter<br />
Baujahre: 1973–1974 (teilsaniert)<br />
7 Neubau MIN-Forum<br />
Hauptnutzung: Büro-/Hörsaal-/<br />
Bibliotheksgebäude<br />
Geschosse: 6 VG<br />
Höhe: 26,30 Meter<br />
BGF: 20.038 Quadratmeter<br />
Baujahre: zurzeit in Bau<br />
8 Neubau Informatik<br />
Hauptnutzung: Büro-/Laborgebäude<br />
Geschosse: 10 VG<br />
Höhe: 42,31 Meter<br />
BGF: 15.024 Quadratmeter<br />
Baujahre: zurzeit in Bau<br />
9 NMR<br />
Hauptnutzung: Büro-/Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 5,10 Meter<br />
BGF: 83 Quadratmeter<br />
Baujahr: 1999<br />
9 Hörsäle<br />
Hauptnutzung: Hörsaal-/Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,60 Meter<br />
BGF: 4278 Quadratmeter<br />
Baujahr: 1963<br />
9 Eingangshalle<br />
Hauptnutzung: Erschließungs-/<br />
Bürogebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60 Meter<br />
BGF: 1202 Quadratmeter<br />
Baujahr: 1963<br />
9 Anorganische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro-/Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60 Meter<br />
BGF: 8450 Quadratmeter<br />
Baujahr: 1963<br />
9 Organische Chemie<br />
Hauptnutzung: Büro-/Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 6 VG, 1 DG<br />
Höhe: 21,60 Meter<br />
BGF: 8563 Quadratmeter<br />
Baujahr: 1963<br />
9 Verbindungsgang<br />
Hauptnutzung: Erschließungs-<br />
gebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 1 VG<br />
Höhe: 4,60 Meter<br />
BGF: 2520 Quadratmeter<br />
Baujahr: 1963<br />
9 Bibliothek<br />
Hauptnutzung: Bibliotheksgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,08 Meter<br />
BGF: 2246 Quadratmeter<br />
Baujahr: 1963<br />
9 Angewandte Analytik<br />
Hauptnutzung: Büro-/Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG<br />
Höhe: 6,08 Meter<br />
BGF: 2246 Quadratmeter<br />
Baujahr: 1963<br />
9 Biochemie<br />
Hauptnutzung: Büro-/Laborgebäude<br />
Geschosse: 1 UG, 2 VG, 1 DG<br />
Höhe: 7,20 Meter<br />
BGF: 1985 Quadratmeter<br />
Baujahr: 1963<br />
9 Warenannahme<br />
Hauptnutzung: Lagergebäude<br />
Geschosse: 1 VG<br />
Höhe: 4,50 Meter<br />
BGF: 1122 Quadratmeter<br />
Baujahr: 2018
<strong>Campus</strong> Klein Flottbek<br />
Biozentrum im Wandel<br />
30<br />
Heute & Morgen | <strong>Campus</strong> Klein Flottbek
30<br />
Luftbild des <strong>Campus</strong> Klein<br />
Flottbek mit Hervorhebung<br />
der dazugehörigen<br />
Universitätsgebäude<br />
Der Standort Klein Flottbek ist direkt angegliedert<br />
an den 1979 eröffneten Neuen Botanischen Garten<br />
(2012 in Loki-Schmidt-Garten umbenannt). Der<br />
Standort befindet sich ca. neun Kilometer westlich<br />
des <strong>Campus</strong> Von-Melle-Park, ist allerdings durch<br />
die südlich benachbarte S-Bahn-Station Klein Flottbek<br />
direkt an das Schnellbahnnetz angeschlossen.<br />
Hier ist der botanische Teil des Fachbereichs Biologie<br />
untergebracht.<br />
Von der grünen Lunge zum <strong>Campus</strong> im Park<br />
Der Standort Klein Flottbek entstand auf vormals<br />
von Bebauung freigehaltenen Flächen entlang<br />
der Niederung des ehemaligen Bachlaufs der Flottbek.<br />
In den vorherigen Jahrzehnten hatte es bereits<br />
unterschiedliche Überlegungen gegeben, einzelne<br />
Institute oder sogar die gesamte Universität inklusive<br />
Universitätsklinikum hierher zu verlagern. Die<br />
Entscheidung, in diesem Bereich den Neuen Botanischen<br />
Garten zu errichten, der am Dammtor keinerlei<br />
Entwicklungsmöglichkeiten mehr hatte, und<br />
im Zuge dessen auch einen Teil des Fachbereichs<br />
Biologie hier unterzubringen, fiel 1968. 1<br />
In direkter Nachbarschaft der Betriebsgebäude<br />
und Gewächshäuser des Neuen Botanischen<br />
Gartens, die in der ersten Hälfte der 1970er Jahre<br />
errichtet wurden, entstand etwas später das 1982<br />
eröffnete Botanische Institut. Es ist ein massiver,<br />
fünfgeschossiger Bau in Nord-Süd-Richtung, der<br />
in der typischen Form und Gestalt seiner Entstehungsphase<br />
errichtet wurde und mehrere unterschiedlich<br />
lange Seitenflügel aufweist. Je nach Gebäudebereich<br />
haben ein bis zwei Sockelgeschosse<br />
eine abgesetzte Gestaltung mit hellrotem Verblendmauerwerk.<br />
Die oberen Geschosse sind mit einem<br />
hellbraunen Farbton verkleidet. 2003 erfolgte<br />
im Nordwesten eine Erweiterung des Gebäudes.<br />
2011 wurde ein südlich angrenzender Neubau<br />
fertiggestellt, mit dem Ziel, die Zoologie langfristig<br />
dort unterzubringen. Der Neubau hebt sich<br />
in seiner dunkelgrauen Fassadengestaltung mit<br />
grün eingefassten, auskragenden Elementen und<br />
dem transparenten Sockelgeschoss stark vom Ursprungsbau<br />
ab. Das Gebäude wird derzeit von anderen<br />
Instituten des Fachbereichs Biologie genutzt,<br />
da das vorhandene Altgebäude einen erheblichen<br />
Sanierungsbedarf aufweist. Die letzte bauliche Erweiterung<br />
ist der 2018 fertiggestellte Neubau eines<br />
Forschungsgewächshauses direkt nördlich des<br />
Hauptgebäudes.<br />
Der <strong>Campus</strong> Klein Flottbek morgen<br />
Es ist eine Option, den zoologischen Teil des<br />
Fachbereichs Biologie ebenfalls an diesen Standort<br />
zu verlagern. Allerdings könnte perspektivisch der<br />
Fachbereich Biologie an den Standort Bahrenfeld<br />
verlagert werden. Es gibt erste Überlegungen, den<br />
Standort Klein Flottbek dann universitär nachzunutzen.<br />
Eine Idee hierfür ist die Einrichtung eines<br />
naturwissenschaftlichen didaktischen Zentrums<br />
in Kombination mit der Unterbringung der biologischen<br />
Sammlungen. So wären auch weiterhin<br />
tragfähige Synergien mit dem benachbarten Botanischen<br />
Garten und die Öffnung der Naturwissenschaften<br />
für die Gesellschaft möglich. (JB)<br />
1 Holtmann, Michael: Die Universität Hamburg<br />
in ihrer Stadt. Bauten, Orte und Visionen in Vergangenheit,<br />
Gegenwart und Zukunft. Manuskript,<br />
1. Auflage. Hamburg 2009, S. 236f.<br />
56 | 57
Internationale Tendenzen<br />
Inspirierende Beispiele für<br />
den <strong>Multiple</strong>-<strong>Campus</strong>-Ansatz<br />
1<br />
11<br />
2<br />
1<br />
10<br />
5<br />
13 14<br />
9<br />
12 6/8<br />
3 7<br />
4<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
New York City (Vereinigte Staaten) – CU Manhattanville<br />
Chicago (Vereinigte Staaten) – IIT Main <strong>Campus</strong><br />
Lausanne (Schweiz) – EPFL<br />
Wien (Österreich) – <strong>Campus</strong> WU<br />
Aarhus (Dänemark) – AU Universitetsbyen<br />
Zürich (Schweiz) – ETH <strong>Campus</strong> Hönggerberg<br />
Mailand (Italien) – Milano MIND<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
Zürich (Schweiz) – Hochschulgebiet Zürich Zentrum<br />
Amsterdam (Niederlande) – UvA Roeterseiland-<strong>Campus</strong><br />
London (Vereinigtes Königreich) – Granary Square<br />
Trondheim (Norwegen) – Krankenhaus St. Olav<br />
Basel (Schweiz) – Novartis <strong>Campus</strong><br />
Odense (Dänemark) – <strong>Campus</strong> Kollegiet<br />
Kopenhagen (Dänemark) – Tietgenkollegiet<br />
Tendenzen
1<br />
Weltkarte mit Verortung<br />
der Beispiele<br />
Für das Modell eines zukunftsfähigen Universitätscampus<br />
mit multiplen Nutzungsmöglichkeiten im<br />
Innen- und Außenraum gibt es national und international<br />
bereits zahlreiche gute Beispiele. Dabei<br />
bilden eine diversifizierte Form von Räumen für<br />
Lehre, Lernen, Forschen und Kommunikation sowie<br />
eine Öffnung zum urbanen Umfeld wichtige Kernelemente.<br />
Die Schaffung und Stärkung räumlicher<br />
und nutzungsbezogener Synergien zwischen Universität<br />
und Stadt bzw. zwischen Studierenden,<br />
Wissenschaftlern und Stadtgesellschaft ist hier von<br />
besonderer Bedeutung.<br />
Die Kernthese, die den neuen Raumtypologien<br />
sowohl städtebaulich als auch architektonisch zugrunde<br />
liegt, ist, dass für die Qualität und damit<br />
den Erfolg universitärer Einrichtungen auf dem Niveau<br />
von Lehre, Lernen und Forschung das Bild des<br />
zurückgezogenen Forschers im Elfenbeinturm nicht<br />
mehr zeitgemäß ist. Dies gilt ebenso für das Bild<br />
der Universität als Ort, an dem zwar ein intensiver<br />
interner Austausch innerhalb der akademischen<br />
Mauern ermöglicht wird, der sich aber räumlich<br />
bzw. funktional von seinem städtischen Umfeld abschottet.<br />
Dieses vermeintliche Idealbild liegt auch<br />
den nicht verwirklichten Verlagerungsplänen der<br />
Universität Hamburg von Fritz Schumacher zugrunde,<br />
bei denen er als Begründung unter anderem anführte,<br />
dass die Wissenschaft eine der wenigen zentralen<br />
Angelegenheiten des städtischen Lebens sei,<br />
die ohne Weiteres ins Hinterland verlegt werden<br />
könne und für die die Nähe zum belebten urbanen<br />
Raum eher hinderlich sei. 1 Viele aktuelle Beispiele<br />
zeigen aber, dass die durch die urbane Einbettung<br />
von Universitätscampus ermöglichten vielfältigen<br />
Synergien ein entscheidender Wettbewerbsfaktor<br />
zukunftsfähiger, akademischer Einrichtungen sind.<br />
Gleichzeitig wird deutlich, dass die weiterhin nötigen<br />
Rückzugsräume für die Forschung auch bei<br />
räumlicher Nähe zum lebendigen Stadtraum problemlos<br />
realisiert werden können.<br />
Zwar werden auch weiterhin klassische und abgetrennte<br />
Bereiche für konzentriertes Lehren, Lernen<br />
und Forschen benötigt, sei es in Form ganzer<br />
Gebäude oder definierter Bereiche von Gebäuden.<br />
Unterschiedliche Forschungsergebnisse belegen,<br />
dass sich Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen<br />
dies noch immer als Rückzugsmöglichkeit<br />
wünschen. So zeigt eine Studie von Ninnemann/<br />
Kirschbaum aus dem Jahr 2016, dass sich viele Studierende<br />
und Lehrende eher dauerhafte als provisorische,<br />
eher sichere als überraschende und eher<br />
beruhigende als anregende Lernorte für aktives<br />
Lernen wünschen. Gleichzeitig werden aber, wenngleich<br />
mit geringerer Eindeutigkeit, flexible gegenüber<br />
unflexiblen und kommunikative gegenüber<br />
zurückgezogenen Lernorten bevorzugt. 2 Es wird<br />
also deutlich, dass die Anforderungen an universitäre<br />
Lernorte durchaus vielfältig sind und dass für<br />
unterschiedliche Arbeits- und Lernsituationen unterschiedlichste<br />
Umgebungen geschaffen werden<br />
müssen. Die in diesem Kapitel dargestellten Beispiele<br />
wurden unter anderem ausgewählt, um die<br />
Bandbreite dieser verschiedenen Arbeits- und Lern-<br />
zonen innerhalb universitärer Gebäude anhand<br />
existierender Fälle aufzuzeigen.<br />
Die interdisziplinäre Kommunikation, ein offener<br />
Austausch über Fachbereichsgrenzen hinaus<br />
und allgemein der Austausch zwischen Universitätsangehörigen<br />
und Stadtgesellschaft ist, wie<br />
in Kapitel I dargestellt, in vielerlei Hinsicht für die<br />
Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit einer Universität<br />
von hoher Bedeutung. Dabei erkunden gerade<br />
„[etablierte] innerstädtische Universitäten [...] neue<br />
Wege, wie sie zur Entwicklung ihrer Städte beitragen<br />
und sich selbst profilieren können.“ 3 Ebenso<br />
gibt es den Bedarf, die bereits in der freien Wirtschaft<br />
weit vorangeschrittene Auflösung der Grenzen<br />
zwischen Arbeit und Freizeit auch in bestimmte<br />
Teilbereiche der außen- und innenräumlichen Typologien<br />
von Universitätscampus hineinzutragen und<br />
räumliche, zeitliche und funktionale Aneignungsformen<br />
der betreffenden Universitätsbereiche in<br />
agiler Form zu ermöglichen.<br />
Bestimmte Teilbereiche des Universitätsgeländes<br />
werden aus technischen, formellen oder spezifischen<br />
wissenschaftlichen Gründen auch in Zukunft<br />
nicht für die allgemeine Öffentlichkeit zugänglich<br />
sein können (zum Beispiel technologisch hochsensible<br />
Bereiche in Form von geschütztem Betriebsgelände).<br />
Auch für den kreativen stadt- und landschaftsplanerischen<br />
Umgang mit diesen Abgrenzungen<br />
gibt es bereits gute realisierte Vorbilder.<br />
Die folgenden Beispiele zeigen gewachsene,<br />
kürzlich realisierte oder in Umsetzung bzw. Planung<br />
befindliche Projekte für zukunftsfähige <strong>Campus</strong>anlagen<br />
im nationalen und internationalen<br />
Kontext. Neben einer kurzen Darstellung der Universitäten<br />
insgesamt und des jeweils betrachteten<br />
<strong>Campus</strong> werden insbesondere Einzelgebäude dargestellt,<br />
die räumlich-funktional in anschaulicher<br />
Weise Pate stehen für zukunftsweisende universitäre<br />
Bauten im Sinne eines „<strong>Multiple</strong> <strong>Campus</strong>“. Diese<br />
Ebene der Untersuchung wird hier als Mikroebene<br />
bezeichnet. Auf der Mesoebene wird geschaut,<br />
wie der jeweilige <strong>Campus</strong> intern organisiert ist. Die<br />
Makroebene thematisiert die Einbettung des universitären<br />
<strong>Campus</strong> ins städtische Umfeld. Alle drei<br />
Ebenen werden am Ende der Darstellung des jeweiligen<br />
Beispiels im Hinblick auf ihre prinzipielle Übertragbarkeit<br />
auf die drei zukünftigen Hauptcampusbereiche<br />
der Universität Hamburg bewertet. (PF/JB)<br />
Erläuterung der Standorte-Tabellen<br />
Die Tabellen zu den Beispielen zeigen deren<br />
Übertragbarkeit auf die Standorte der Universität<br />
Hamburg. Dabei werden die drei Ebenen Makro<br />
(städtischer Kontext), Meso (<strong>Campus</strong>ebene) und<br />
Mikro (Gebäudeebene) betrachtet. Dargestellt<br />
werden die drei in dieser Publikation entwerferisch<br />
bearbeiteten Standorte Von-Melle-Park,<br />
Bundesstraße und Klein Flottbek sowie zusätzlich<br />
Bahrenfeld. Der Standort Universitätsklinikum<br />
Hamburg-Eppendorf wurde hier außen vor gelassen,<br />
da er rein nachrichtlich in diese Publikation<br />
übernommen wurde und nur wenige passende<br />
Beispiele vorgestellt werden.<br />
Die Fußnoten zu diesem Kapitel sind gebündelt<br />
auf S. 144f. zu finden.<br />
86 | 87
New York<br />
Manhattanville <strong>Campus</strong><br />
Ein neuer Standort im<br />
historischen urbanen Raster<br />
2<br />
Tendenzen
Makro Meso Mikro<br />
3 4 5<br />
2<br />
Blick auf den Platz im<br />
Süden des neuen Manhattanville<br />
<strong>Campus</strong> mit<br />
dem Lenfest Center for<br />
the Arts im Hintergrund<br />
3<br />
Übersichtsplan der Stadt<br />
New York mit der Lage<br />
des Manhattanville<br />
<strong>Campus</strong> (schwarzer<br />
Punkt) und des Financial<br />
Districts (grauer Punkt)<br />
M 1:50.0000<br />
4<br />
Lageplan des Manhattanville<br />
<strong>Campus</strong> mit bestehenden<br />
und geplanten<br />
Gebäuden<br />
M 1:10.000<br />
5<br />
Tabelle: Übertragbarkeit<br />
der Planungs- und Gestaltungsprinzipen<br />
des<br />
Beispiels Manhattanville<br />
<strong>Campus</strong> auf die Standorte<br />
der Universität Hamburg<br />
Die Columbia University ist eine der großen traditionsreichen<br />
Universitäten der Stadt New York<br />
und eine der ältesten der Vereinigten Staaten. Sie<br />
wurde 1754 gegründet, ist seit jeher an unterschiedlichen<br />
Standorten in Manhattan beheimatet und<br />
hat heute über 32.000 Studierende 1 . Die heutigen<br />
Standorte der Universität liegen im nördlichen Teil<br />
von Manhattan nahe dem Hudson River. Der Hauptcampus<br />
befindet sich im Stadtviertel Morningside<br />
Heights in einem 13 Hektar großen Bereich um die<br />
116th Street. Der zweite, 8,1 Hektar umfassende<br />
<strong>Campus</strong> mit der Medizinischen Fakultät liegt im<br />
Stadtviertel Washington Heights in Höhe der 165th<br />
Street. Die zunehmende urbane Verdichtung von<br />
Manhattan schränkt die räumlichen Erweiterungsmöglichkeiten<br />
der Universität stark ein, weshalb<br />
lange nach geeigneten Flächen für einen weiteren<br />
<strong>Campus</strong> gesucht wurde, bis die Entscheidung fiel,<br />
einen neuen Universitätscampus im Stadtviertel<br />
Manhattanville zu errichten. Inzwischen wurden<br />
die ersten Gebäude fertiggestellt.<br />
Manhattanville: vom industriellen Viertel zum<br />
urbanen Universitätscampus<br />
Im Jahr 2003 begann eine enge Zusammenarbeit<br />
der Universität mit Politik und Verwaltung in<br />
West Harlem für eine Konversion eines Teils von<br />
Manhattanville auf Höhe der 125th Street zu einer<br />
verdichteten universitären Nutzung innerhalb der<br />
bestehenden Blockstrukturen. Historisch gesehen<br />
ein Dorf weit nördlich der Tore des damaligen New<br />
Yorker Stadtgebiets, entwickelte sich der Westen<br />
Manhattanvilles im Laufe des 19. Jahrhunderts zu<br />
einem pulsierenden, stark industriell geprägten<br />
Gebiet. Aber auch akademische Einrichtungen spielen<br />
im Stadtviertel seit dem 19. Jahrhundert eine<br />
wichtige Rolle. So befindet sich dort auch der City<br />
College <strong>Campus</strong> der City University of New York<br />
(CUNY). Topografisch ist Manhattanville insofern<br />
besonders, als dass dieses Viertel zum Teil nicht<br />
erhöht über dem Hudson River liegt, wie die angrenzenden<br />
Viertel, sondern in einem Taleinschnitt<br />
entlang der heutigen 125th Street.<br />
Das nun in Bau befindliche Areal des neuen<br />
Manhattanville <strong>Campus</strong> im Westen des Stadtviertels<br />
war bereits in den 1980er und 1990er Jahren<br />
Bestandteil unterschiedlicher Revitalisierungsprojekte<br />
gewesen. Es liegt in einem bisher durch gewerblich-industrielle<br />
Bauten, Lagerhäuser, Garagen<br />
und große Parkplätze geprägten Gebiet innerhalb<br />
der typischen Blockstruktur Manhattans. Die vernachlässigten<br />
öffentlichen Räume im Viertel und<br />
die fehlende Anbindung an den Hudson-River waren<br />
Anlass für eine enge Zusammenarbeit zwischen<br />
Universität und Stadt, um das Projekt für eine<br />
gleichzeitige urbane Aufwertung des gesamten Gebiets<br />
zu nutzen. Dies manifestierte sich in besonderer<br />
Form 2009 mit dem West Harlem Community<br />
Benefits Agreement (CBA), das zwischen der Universität<br />
und der lokalen Entwicklungsgesellschaft<br />
vereinbart wurde. Zuvor war die nötige Flächenumwidmung<br />
zur universitären Nutzung bereits 2007<br />
von der Stadt genehmigt worden. 2 Trotz weiter<br />
anhaltender Kritik an der rigorosen Umstrukturierung<br />
und urbanen Verdichtung des Viertels und<br />
der Verdrängung der alteingesessenen Gewerbebetriebe<br />
kann diese Entwicklung aus stadtplanerischer<br />
Sicht sehr positiv bewertet werden, gerade<br />
weil der neue <strong>Campus</strong> sich hier sehr weit zur Stadt<br />
öffnen wird und eine introvertierte bzw. simulierte<br />
Urbanität, wie sie in der Vergangenheit bei zahlreichen<br />
<strong>Campus</strong>anlagen geschaffen wurde und – zum<br />
Beispiel beim <strong>Campus</strong> Morningside Heights 3 – vermieden<br />
wird.<br />
88 | 89
Lausanne<br />
EPFL-<strong>Campus</strong><br />
Rolex Learning Center<br />
und weitere Neubauten<br />
17<br />
Tendenzen
Makro Meso Mikro<br />
18 19 20<br />
17<br />
Luftbild des EPFL-<strong>Campus</strong><br />
18<br />
Übersichtsplan der Stadt<br />
Lausanne mit der Lage<br />
des <strong>Campus</strong> der EPFL<br />
und der Altstadt von<br />
Lausanne (grauer Punkt)<br />
M 1:500.000<br />
19<br />
Lageplan des <strong>Campus</strong> der<br />
EPFL in der Gemeinde<br />
Ecublens westlich von<br />
Lausanne (schwarzer<br />
Punkt)<br />
M 1:20.000<br />
20<br />
Tabelle: Übertragbarkeit<br />
der Planungs- und Gestaltungsprinzipen<br />
des<br />
Beispiels <strong>Campus</strong> der EPFL<br />
auf die Standorte der<br />
Universität Hamburg<br />
Die École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)<br />
ist eine staatliche Universität im schweizerischen<br />
Lausanne mit 10.686 Studierenden (2017). 1 Sie ging<br />
1969 als Technische Universität aus ihrer Vorgängerin,<br />
einer bereits 1869 gegründeten, privaten Hochschule<br />
hervor. Die Anlage des heutigen <strong>Campus</strong> in<br />
der Gemeinde Ecublens ca. 5 Kilometer westlich des<br />
Stadtzentrums von Lausanne erfolgte in den 1970er<br />
Jahren. 2 Die dem damaligen Zeitgeist entsprechende<br />
Architektur ist in erster Linie funktional geprägt,<br />
mit orthogonal zueinander ausgerichteten, in weiten<br />
Teilen kettenartig durch flache Bauteile und<br />
brückenartige Strukturen miteinander verbundenen<br />
Gebäuden. Es ist ein typischer Satellitencampus<br />
am Stadtrand, in einigen Punkten vergleichbar<br />
mit dem <strong>Campus</strong> Hönggerberg, jedoch dichter zur<br />
umgebenden Bebauung gelegen und mit einer besseren<br />
Erschließung durch den öffentlichen Nahverkehr.<br />
Zudem zog die Université de Lausanne (UNIL)<br />
in den 1970er Jahren ebenfalls in diesen Stadtbereich<br />
um, sodass hier ein großes universitäres<br />
Cluster entstanden ist, das durch Neubauten seither<br />
kontinuierlich modernisiert und erweitert wird.<br />
Rolex Learning Center: multiple Räume auf<br />
einer geschwungenen Ebene<br />
Insbesondere die Entwicklungen seit dem Ende<br />
der 2000er Jahre tragen dazu bei, den <strong>Campus</strong> zukunftsfähig<br />
auszubauen und weiter für die Öffentlichkeit<br />
zu öffnen. In erster Linie ist hier das Rolex<br />
Learning Center des japanischen Architekturbüros<br />
SANAA zu nennen, das inzwischen durch seine besondere<br />
Architektur und das innovative Raum- und<br />
Nutzungskonzept internationale Berühmtheit erlangt<br />
hat. Das Architekturbüro ging als Sieger aus<br />
dem Wettbewerb von 2004 hervor, die Eröffnung<br />
des Gebäudes erfolgte 2010. Das Gebäude wurde<br />
auf einer großen Freifläche im Südosten des <strong>Campus</strong><br />
errichtet. Die rechteckige, einstöckige Struktur,<br />
wie der überwiegende Teil der <strong>Campus</strong>gebäude in<br />
genauer Ost-West-Richtung ausgerichtet, hat eine<br />
Grundfläche von 166,5 × 121,5 Metern, was in etwa<br />
20.000 Quadratmetern entspricht. 3 Die maximale<br />
Höhe beträgt knapp zehn Meter. 14 unterschiedlich<br />
große, runde Innenhöfe sorgen für eine gute Belichtung<br />
auch der inneren Teile des Gebäudes. Die<br />
Wände nach außen und zu den Innenhöfen bestehen<br />
aus raumhohen Fensterelementen. Besonders<br />
markant sind die Wellenformen des Gebäudes –<br />
parallele Erhebungen von Boden und Dach, die im<br />
Innenbereich zu fließenden Übergängen zwischen<br />
den Gebäudebereichen führen und im Außenbereich<br />
eine Verbindung zwischen dem umgebenden<br />
öffentlichen Raum und den inneren Freiräumen<br />
darstellen, von denen aus auch der Zugang zum Gebäude<br />
erfolgt. Im Inneren gibt es im Hauptbereich<br />
des Gebäudes keine Türen und Zwischenwände,<br />
die Bodenwellen sind die einzigen trennenden Elemente<br />
der unterschiedlichen Bereiche und dienen<br />
gleichzeitig als Ruhezonen in einem besonderen<br />
Ambiente. In den unterschiedlich geformten Bereichen<br />
zwischen bzw. teilweise auf den Bodenwellen<br />
sind als Nutzungen eine große Bibliothek, das Rolex<br />
Forum als Hörsaal, unterschiedliche Arbeitsräume<br />
für Studierende und Wissenschaftler, eine Cafeteria,<br />
ein Restaurant und eine Bank untergebracht.<br />
Die offene innere Raumstruktur des Rolex Learning<br />
Center ist ein prägnantes Symbol für das, was einen<br />
multiplen <strong>Campus</strong> auf Gebäudeebene ausmacht:<br />
aufgehobene Grenzen zwischen den Fakultäten,<br />
zwischen Lern-, Arbeits-, Kommunikations- und Ruhezonen<br />
sowie zwischen inneruniversitären und öffentlichen<br />
öffentlichen Nutzungen. Es ist quasi ein<br />
zukunftsweisendes Gegenmodell zum überholten<br />
96 | 97
Aarhus<br />
Universitetsbyen<br />
Umbau des alten Universitätsklinikums<br />
zum urbanen <strong>Campus</strong><br />
31<br />
Tendenzen
Makro Meso Mikro<br />
32 33 34<br />
31<br />
Vogelperspektive des<br />
Siegerentwurfs<br />
Universitetsbyen mit in<br />
den Bestand des alten<br />
Universitätsklinikums<br />
eingefügten Neubauten<br />
32<br />
Übersichtsplan der Stadt<br />
Aarhus mit der Lage der<br />
Universität (schwarzer<br />
Punkt) und der Innenstadt<br />
(grauer Punkt)<br />
M 1:500.000<br />
33<br />
Lageplan der <strong>Campus</strong>erweiterung<br />
Universitetsbyen<br />
(ehemaliges<br />
Universitätsklinikum)<br />
der Universität Aarhus<br />
(Bestand und Planung)<br />
M 1:10.000<br />
34<br />
Tabelle: Übertragbarkeit<br />
der Planungs- und Gestaltungsprinzipen<br />
des Beispiels<br />
Universität Aarhus<br />
auf die Standorte der<br />
Universität Hamburg<br />
Die Universität Aarhus wurde 1928 1 gegründet, zunächst<br />
als private Hochschule. 1970 wurde sie in<br />
eine staatliche Hochschule umgewandelt. Ab 1931<br />
wurde eine in einen Park eingebettete <strong>Campus</strong>anlage<br />
in einer einheitlichen, von gelben Klinkern<br />
geprägten Architektur nach einem Entwurf von C.F.<br />
Møller, Kay Fisker und Povl Stegmann errichtet. Inzwischen<br />
ist die Universität mit weit über 30.000<br />
Studierenden 2 die zweitgrößte Dänemarks, hat einen<br />
Elite-Status und belegt regelmäßig gute Plätze<br />
in internationalen Rankings. Im Dezember 2017<br />
wurde die neue Straßenbahn in Aarhus eröffnet<br />
(Aarhus Letbane), mit der nun eine direkte Schienenanbindung<br />
ins Stadtzentrum und unter anderem<br />
zum weiter nördlich gelegenen neuen Universitätskrankenhaus<br />
besteht.<br />
Das alte Universitätsklinikum wird zum neuen<br />
<strong>Campus</strong><br />
Die Expansion der Universität führte zu weiteren<br />
Flächenbedarfen, sodass der Beschluss gefasst<br />
wurde, das ehemalige Universitätskrankenhaus<br />
östlich der Nørrebrogade zu einem urbanen Universitätscampus<br />
umzugestalten und damit die Universität<br />
deutlich zu erweitern. In Vorbereitung darauf<br />
erwarb die Immobiliengesellschaft der Universität<br />
im Jahr 2016 das entsprechende Gelände. Die Umgestaltung<br />
und Umnutzung des ehemaligen Krankenhauses<br />
zum neuen Universitätscampus sollen<br />
in mehreren Phasen bis zum Jahr 2025 abgewickelt<br />
werden und stellen nur einen Baustein einer weitreichenden<br />
Umstrukturierungsstrategie der Universität<br />
dar.<br />
Die dichte bauliche Struktur des Erweiterungsgeländes<br />
und der umgebenden Viertel bietet dabei<br />
die Chance, einen urban geprägten <strong>Campus</strong> zu schaffen,<br />
der sich durch seine dichte Bebauung und die<br />
streng orthogonale Struktur klar von der parkähnlichen<br />
Struktur des bestehenden Teils westlich der<br />
Nørrebrogade absetzt.<br />
Masterplan des Büros C.F. Møller<br />
Den übergeordneten Masterplan für diese <strong>Campus</strong>erweiterung<br />
erarbeitete das Büro C.F. Møller in<br />
den Jahren 2012 und 2013. Im Vordergrund steht dabei<br />
die Schaffung von wesentlichen neuen Entwicklungsflächen<br />
für die Universität außerhalb des<br />
<strong>Campus</strong> Universitetsparken, sodass dieser historische<br />
Landschaftscampus erhalten bleiben kann und<br />
die Universität zugleich neue Typologien an Gebäuden<br />
und Nutzungen erhält.<br />
Die Struktur des Krankenhauses soll erhalten<br />
bleiben und der öffentliche Raum sowie die Verbindungen<br />
zum Landschaftscampus werden gestärkt.<br />
Neue Tunnelverbindungen unter der Straßenbahntrasse,<br />
die zugleich als Erschließung der Haltestellen<br />
dienen, wurden eingeplant. Zudem ist eine<br />
Aktivierung der Erdgeschosszonen anhand unterschiedlicher<br />
Nutzungen vorgesehen, die auch der<br />
Stadtöffentlichkeit offenstehen.<br />
Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs:<br />
Verzahnung von Universität und<br />
urbanem Leben<br />
Im Jahr 2016 wurde auf Basis des Masterplans<br />
ein städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt, den<br />
das Architekturbüro AART Architekten aus Aarhus<br />
für sich entscheiden konnte. Der Entwurf greift in<br />
besonderer Weise die Chance auf, mit dem neuen<br />
<strong>Campus</strong> die Verbindung zwischen Universität und<br />
Stadtleben zu forcieren. Im Fokus steht dabei die<br />
Stärkung der ursprünglichen Identität des Ortes als<br />
einheitliches Backsteinensemble aus den 1930er<br />
Jahren. Erweiterungsbauten jüngeren Datums,<br />
104 | 105
Amsterdam<br />
Roeterseiland <strong>Campus</strong><br />
Zukunftsweisender Ausbau eines<br />
innerstädtischen Universitätsstandorts<br />
56<br />
Tendenzen
Makro Meso Mikro<br />
57 58<br />
59<br />
56<br />
Die neu gestalteten Gebäude<br />
am Roeterseiland<br />
<strong>Campus</strong><br />
57<br />
Übersichtsplan der Stadt<br />
Amsterdam mit Lage<br />
der Universität (schwarzer<br />
Punkt) und der Innenstadt<br />
(grauer Punkt)<br />
M 1:500.000<br />
58<br />
Lageplan des Roeterseiland<br />
<strong>Campus</strong> der Universiteit<br />
van Amsterdam<br />
M 1:10.000<br />
59<br />
Tabelle: Übertragbarkeit<br />
der Planungs- und Gestaltungsprinzipen<br />
des<br />
Roeterseiland <strong>Campus</strong><br />
der Universiteit van<br />
Amsterdam auf die<br />
Standorte der Universität<br />
Hamburg<br />
Die Vorgängerinstitution der Universiteit van<br />
Amsterdam (UvA) wurde 1632 als „Athenaeum<br />
Illustre“ gegründet und schließlich 1877 offiziell in<br />
den Status der Universität erhoben. 1 Sie hat aktuell<br />
34.607 Studierende. 2 Die Universität hat vier <strong>Campus</strong>standorte<br />
in verschiedenen Bereichen der Stadt.<br />
Der Humanistische City Centre <strong>Campus</strong> befindet<br />
sich am Südrand der Altstadt am Kloveniersburgwal.<br />
Hier befinden sich auch das Binnengasthuis,<br />
die historische Keimzelle der Universität und zukünftig<br />
die Universitätsbibliothek. Die Wirtschaftsund<br />
Sozialwissenschaften sowie seit 2017 auch<br />
die Rechtswissenschaften sind auf dem Roeterseiland-<strong>Campus</strong><br />
im Stadtteil Weesperbuurt ca. 1,5 Kilometer<br />
südöstlich der Altstadt beheimatet. Technische<br />
Institute befinden sich im Amsterdam Science<br />
Park im Osten der Stadt. Die medizinische Fakultät<br />
befindet sich im Amsterdam Medical Center am<br />
südöstlichen Stadtrand. An allen Hauptstandorten<br />
sind derzeit Ausbauvorhaben in der Umsetzung,<br />
mit denen die Zukunftsfähigkeit der traditionsreichen<br />
Universität sichergestellt werden soll. Im Folgenden<br />
soll der Ausbau des urbanen <strong>Campus</strong> Roeterseiland<br />
beispielhaft dargestellt werden.<br />
Ein neues urbanes Konzept für den <strong>Campus</strong><br />
Roeterseiland<br />
Roeterseiland ist traditionell ein dicht bebautes<br />
Wohnviertel im Osten des inneren Stadtbereichs<br />
von Amsterdam, durchzogen von einigen Grachten.<br />
Die Eröffnung des heute nicht mehr bestehenden<br />
Kopfbahnhofs Weesperpoortstation im Jahr 1843<br />
direkt südlich von Roeterseiland brachte aber auch<br />
eine Reihe von industriellen Ansiedlungen mit sich.<br />
1891 wurde hier mit dem Chemielabor des Architekten<br />
Willem Springer das erste Universitätsgebäude<br />
eröffnet. Der nächste bedeutende Entwicklungsschritt<br />
des Universitätsstandorts erfolgte erst in<br />
den 1960er Jahren, als umfassende Finanzierungsmittel<br />
zum Universitätsausbau zur Verfügung standen.<br />
Die modernistischen Neubauten des damaligen<br />
Stadtarchitekten Norbert Gawronski als Teil<br />
seines Masterplans von 1964 wurden wegen ihres<br />
massiven und introvertierten Charakters nicht<br />
ohne Grund sehr kontrovers diskutiert. Die Erschließungsebene<br />
wurde ins erste Obergeschoss gelegt,<br />
Gebäudebrücken verbanden auf dieser Ebene die<br />
unterschiedlichen Teile des Komplexes. Eine direkte<br />
Verknüpfung der Innenräume zur Straßenebene<br />
war nicht gegeben, und über die Erdgeschosszonen<br />
fand keinerlei Kommunikation mit dem Außenraum<br />
statt. Die Freiflächen des Geländes wurden<br />
weitgehend zu Parkplätzen degradiert. Das Hochhaus<br />
der Fakultät für Chemie war der Kern dieses<br />
Ausbaus: ein L-förmiges, massives, die Achtergracht<br />
überspannendes Gebäude.<br />
Das 1987 abgebrannte Chemielabor war der<br />
Aufhänger für einen 1989 vom Architekturbüro<br />
Pi de Bruin entwickelten Masterplan. Als Teil dessen<br />
wurde unter anderem der dreieckige Gebäudekomplex<br />
an der Roetersstraat als neuer Haupteingang<br />
zum <strong>Campus</strong> realisiert. Neue straßenbegleitende<br />
Gebäude an der Sarphatistraat von Pi de Bruin sowie<br />
von VMX Architects und Claus & Kaan resultieren<br />
ebenfalls aus dem Masterplan. 3<br />
Den Rahmen für die Neugestaltung des Roeterseiland-<strong>Campus</strong><br />
bilden eine Analyse des Stadtplanungsbüros<br />
Palmbout von 2004 4 und der darauf<br />
aufbauende Masterplan von 2006. Zentrales Element<br />
ist hier der neu gestaltete öffentliche Raum<br />
entlang der Nieuwe Achtergracht, von dem aus alle<br />
Gebäudezugänge zu erreichen sind. Die Auflösung<br />
des inneren Erschließungssystems auf der ersten<br />
Etage und die Schaffung von nach außen gerichteten<br />
120 | 121
Basel<br />
Novartis <strong>Campus</strong><br />
Ein vielseitiger<br />
Unternehmenscampus<br />
72<br />
Tendenzen
Makro Meso Mikro<br />
73 74 75<br />
72<br />
Blick über den Rhein auf<br />
den Novartis <strong>Campus</strong> mit<br />
dem Gebäude Asklepios 8<br />
im Vordergrund<br />
73<br />
Übersichtsplan der Stadt<br />
Basel mit der Lage des<br />
Novartis <strong>Campus</strong><br />
(schwarzer Punkt) und<br />
der Altstadt (grauer<br />
Punkt)<br />
M 1:200.000<br />
74<br />
Lageplan des Novartis<br />
<strong>Campus</strong> im Norden<br />
von Basel (Bestand und<br />
geplante Gebäude)<br />
M 1:10.000<br />
75<br />
Tabelle: Übertragbarkeit<br />
der Planungs- und<br />
Gestaltungsprinzipen des<br />
Novartis <strong>Campus</strong> auf die<br />
Standorte der Universität<br />
Hamburg<br />
Der 20 Hektar umfassende <strong>Campus</strong> des internationalen<br />
Biotechnologie- und Pharmakonzerns Novartis<br />
im Norden von Basel, zugleich internationaler<br />
Hauptsitz des Unternehmens, gilt als herausragendes<br />
Beispiel für einen zukunftsweisenden Unternehmenscampus.<br />
Er befindet sich an der Stelle des<br />
ehemaligen Werksgeländes Sankt Johann, das vor<br />
Beginn der Umgestaltung von zahlreichen Industriebauten,<br />
hoher Flächenversiegelung und umfangreichen<br />
Gleisanlagen geprägt war. Der Beschluss,<br />
das Gelände in einen „<strong>Campus</strong> des Wissens“ umzuwandeln,<br />
wurde nach einer Phase umfassender<br />
Vorüberlegungen schließlich im Jahr 2001 gefasst.<br />
Der städtebauliche Masterplan für die Umgestaltung<br />
des Werksgeländes wurde durch den<br />
Architekten Vittorio Magnago Lampugnani ausgearbeitet<br />
und Mitte 2001 von der Geschäftsleitung<br />
angenommen. Rückgrat der orthogonalen Struktur<br />
des Plans ist die 600 Meter lange Fabrikstrasse.<br />
Westlich dieser Achse werden die bestehenden<br />
Hochhäuser durch Neubauten ergänzt. Im Osten<br />
wird die orthogonale Gebäudestruktur in Form einer<br />
kleinteiligen, fünfgeschossigen Struktur aus Einzelgebäuden<br />
realisiert. Die Gebäudehöhe knapp unter<br />
der Hochhausgrenze, kombiniert mit schmalen<br />
Straßenquerschnitten, ist aus Sicht des Architekten<br />
optimal für eine angemessene Bebauungsdichte<br />
bei gleichzeitiger Schaffung ausreichend natürlich<br />
heller Arbeitsräume in allen Teilen der Gebäude.<br />
Die zentralen öffentlichen Räume des <strong>Campus</strong> sind<br />
ebenfalls entlang der Fabrikstrasse angesiedelt. Der<br />
Zugang von Süden von der Voltastrasse aus erfolgt<br />
sequenziell über zwei Plätze, einen weitläufigen<br />
Park und eine Torsituation. 1 Das aus dem Masterplan<br />
abgeleitete landschaftsplanerische Konzept<br />
stammt aus der Feder des Kaliforniers Peter Walker. 2<br />
Ein besonderes freiraumplanerisches Element ist<br />
die je nach Bereich als landschaftlich integrierte<br />
Mauer oder als künstlerisch gestalteter Zaun ausgeformte<br />
Abgrenzung des Betriebsgeländes.<br />
Der Novartis <strong>Campus</strong> wird als Versuchslabor<br />
für innovativen Städtebau betrachtet, bei dem<br />
architektonische, landschaftliche, künstlerische,<br />
grafische und lichttechnische Aspekte mit einbezogen<br />
sind. Die innovative Unternehmensstrategie<br />
von Novartis hinsichtlich vielfältiger und flexibler<br />
Arbeitsumgebungen spielt dabei eine zentrale Rolle.<br />
Der Einfluss, den ein stimulierendes und möglichst<br />
ideales Arbeitsumfeld auf das Wohlbefinden der<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Kreativität<br />
und Innovationskraft hat, ist bekanntermaßen<br />
immens. Die neu geschaffenen Arbeitsplätze<br />
sind demnach hell, funktional und gut belüftet. Sie<br />
sind typologisch abgestuft, von Räumen für unterschiedliche<br />
Formen der Zusammenarbeit bis hin<br />
zu geschlossenen Räumen mit individuellen Rückzugsmöglichkeiten.<br />
3<br />
Inzwischen wurden 17 Neubauten von international<br />
renommierten Architekturbüros auf dem<br />
Novartis <strong>Campus</strong> fertiggestellt. Die ersten neuen<br />
Gebäude von Diener & Diener, SANAA und Peter<br />
Märkli auf dem Novartis <strong>Campus</strong> am südlichen Eingang<br />
der Fabrikstrasse und direkt nördlich des <strong>Campus</strong>parks<br />
wurden 2005 und 2006 fertiggestellt, 2007<br />
gefolgt vom Eingangspavillon von Marco Serra. Der<br />
Großteil der Neubauten säumt fast durchgängig<br />
die Ostseite der zentralen Fabrikstrasse. Die Westseite<br />
der Straßenachse wird teilweise von sanierten<br />
Bestandsgebäuden und ebenfalls von einigen<br />
Neubauten wie dem prägnanten Baukörper Fabrikstrasse<br />
15 von Frank O. Gehry gesäumt. Auch zwischen<br />
Fabrikstrasse und Rheinufer sind bereits einige<br />
Neubauten fertiggestellt worden. Im Folgenden<br />
werden drei Bauten näher vorgestellt.<br />
132 | 133
Kopenhagen<br />
Studierendenwohnhaus Tietgenkollegiet<br />
Ein runder Baukomplex mit<br />
vielschichtigen Raumtypologien<br />
87<br />
Tendenzen
Makro Meso Mikro<br />
88 89 90<br />
87<br />
Luftbild des Südcampus<br />
der Universität Kopenhagen<br />
mit dem kreisförmigen<br />
Tietgenkollegiet<br />
88<br />
Übersichtsplan der Stadt<br />
Kopenhagen mit der<br />
Lage des Südcampus der<br />
Universität Kopenhagen<br />
(schwarzer Punkt) und<br />
der Innenstadt (grauer<br />
Punkt)<br />
M 1:500.000<br />
89<br />
Lageplan des Südcampus<br />
der Universität Kopenhagen<br />
M 1:10.000<br />
90<br />
Tabelle: Übertragbarkeit<br />
der Planungs- und<br />
Gestaltungsprinzipen des<br />
Tietgenkollegiet und des<br />
Südcampus der Universität<br />
Kopenhagen auf die<br />
Standorte der Universität<br />
Hamburg<br />
Das Tietgenkollegiet ist ein architektonisch markantes<br />
Studierendenwohnhaus in direkter Nachbarschaft<br />
des Südcampus der Universität Kopenhagen<br />
(Københavns Universitet), etwa zwei Kilometer<br />
südöstlich der Innenstadt im Norden des Stadtteils<br />
Ørestad auf der Insel Amager.<br />
Das 2006 eröffnete Gebäude ist Teil der umfassenden<br />
Modernisierung des <strong>Campus</strong>, der in den<br />
1970er Jahren zunächst als eine temporäre Lösung<br />
für die Unterbringung der Humanistischen Fakultät<br />
in einer brutalisitischen Architektur errichtet wurde,<br />
sich jedoch zu einem wichtigen und dauerhaften<br />
Standort der Universität entwickelte. Der Modernisierungsprozess<br />
des <strong>Campus</strong> startete in den<br />
späten 1990er Jahren und sieht einen Abriss großer<br />
Teile der Ursprungsarchitektur vor. Gleichzeitig<br />
wird der <strong>Campus</strong> erweitert, sodass hier zukünftig<br />
auch die Theologische und die Rechtswissenschaftliche<br />
Fakultät beheimatet sein werden.<br />
Seit 2002 hat der <strong>Campus</strong> mit den Haltestellen<br />
Islands Brygge und DR Byen eine direkte Anbindung<br />
an das Kopenhagener Metronetz, das damals eröffnet<br />
wurde. Inzwischen ist der Ausbau des <strong>Campus</strong><br />
weit fortgeschritten.<br />
Ein Entwurf mit starkem funktionalen und<br />
gestalterischen Konzept<br />
Das vom Kopenhagener Architekturbüro Lundgaard<br />
& Tranberg entworfene Tietgenkollegiet ist<br />
ein ringförmiger Sichtbeton-Skelettbau, der Platz<br />
für 360 Studierende bietet. Es wurde nach dem<br />
bedeutenden dänischen Financier Carl Frederik<br />
Tietgen benannt, der in Dänemark in der Zeit der<br />
industriellen Revolution im 19. Jahrhundert eine<br />
wichtige Rolle einnahm. 1 Die Architektur wird dem<br />
Austausch zwischen Individuum und Gemeinschaft<br />
als Besonderheit zeitgemäßer studentischer Wohnanlagen<br />
in klarer Form gerecht. Die Wohneinheiten<br />
sind nach außen orientiert und bieten je nach Lage<br />
einen Ausblick auf die Stadt und den <strong>Campus</strong> bzw.<br />
auf den offenen, von Wasserläufen durchzogenen<br />
Grünbereich, an dessen Nordausläufer sich das Gebäude<br />
befindet. Die Gemeinschaftsräume und Flure<br />
liegen an der Gebäudeinnenseite.<br />
Im Erdgeschoss befinden sich unter anderem<br />
Verwaltungs-, Arbeits- und Besprechungsräume,<br />
Werkstätten, ein Fitnessraum, ein schallgedämpfter<br />
Musikraum, Wäscheräume und ein Postbüro.<br />
Die Studierendenwohnungen, die auf 30 Gruppen<br />
mit jeweils zwölf Einheiten verteilt sind, befinden<br />
sich in den sechs Obergeschossen. Jede der Gruppen<br />
ist mit einer Gemeinschaftsküche, einem Gemeinschaftsraum<br />
und einem Hauswirtschaftsraum<br />
ausgestattet. Das zentrale Entwurfsprinzip des Gebäudes<br />
ist „Fælleskab“, das dänische Wort für Gemeinschaft<br />
– etwas, woran „Dänen mehr glauben<br />
als Deutsche“ 2 , was sich dort auch architektonisch<br />
in deutlicher Form zeigt.<br />
Die strenge Kreisform des Gebäudes wird<br />
durch kubenförmige Aus- und Einrückungen an<br />
der Außen- und Innenfassade aufgelockert. Die<br />
Stirnseite dieser Kuben ist durch stockwerkshohe<br />
Fensterfronten gekennzeichnet. An der Innenseite<br />
des Baukörpers sind die Gemeinschaftsräume und<br />
Küchen um bis zu acht Meter aus der Fassade hinausgerückt<br />
und vermitteln den Eindruck, frei zu<br />
schweben. Dunkelbraune, horizontale Messingplatten<br />
mit hohem Kupfergehalt – auch als Tombak<br />
bezeichnet – kombiniert mit hellen Lamellen und<br />
Fensterrahmen aus Eichenholz prägen den äußeren<br />
optischen Eindruck. Das Gebäudeinnere wird<br />
durch Sichtbetonwände, in bestimmten Bereichen<br />
mit Birkensperrholz-Verkleidung, und durch Magnesit-Fußböden<br />
charakterisiert. 3<br />
(PF/JB)<br />
140 | 141
91<br />
Innen- und Außenaufnahmen<br />
und Ostansicht des<br />
Tietgenkollegiet<br />
Tendenzen
Fazit &<br />
Kennzahlen<br />
Die übergeordneten räumlichen und funktionalen<br />
Prinzipien der Architektur des Tietgenkollegiet machen<br />
dieses als Referenz für entsprechende Neubauten<br />
für studentisches Wohnen an den Hamburger<br />
Universitätsstandorten interessant. Wenngleich<br />
eine ebenso quasi-solitäre Lage in direkter<br />
<strong>Campus</strong>nachbarschaft nur für den Standort Bahrenfeld<br />
denkbar ist, können der innere Aufbau des<br />
Gebäudes und das funktionale Angebot gleichwohl<br />
auch für die Standorte Von-Melle-Park und Bundesstraße<br />
als Beispiel dienen.<br />
Gründung der Universität<br />
1479<br />
Anzahl Studierende<br />
38.481 (2017)<br />
Eröffnung des untersuchten Gebäudes<br />
2006<br />
Entfernung zum Stadtzentrum<br />
ca. 2 Kilometer<br />
142 | 143
<strong>Multiple</strong> <strong>Campus</strong><br />
Szenarien für die <strong>Campus</strong>standorte<br />
der Zukunft<br />
1<br />
Übermorgen | Szenarien für die <strong>Campus</strong>standorte der Zukunft
1<br />
Stadtcampus Von-Melle-<br />
Park und Bundesstraße:<br />
3D-Modell,<br />
Szenario Layers<br />
(siehe S. 177)<br />
„<strong>Campus</strong>“ als Begriff für die Architektur und<br />
den Städtebau<br />
Der Begriff „<strong>Campus</strong>“ wird in der Architektur und im<br />
Städtebau immer häufiger benutzt, um sehr unterschiedliche<br />
Orte und Kontexte darzustellen. Durch<br />
diesen Gebrauch in der disziplinären Debatte wird<br />
der Begriff „<strong>Campus</strong>“ immer interessanter, komplexer<br />
und bedeutungsreicher. Die Verwendung in<br />
unterschiedlichen Kontexten und Situationen zeigt<br />
gleichzeitig, welche komplexen Dimensionen und<br />
somit verschiedenen Implikationen dieser Begriff<br />
annehmen kann. Uns interessiert vor allem seine<br />
Bedeutung als Raumtypus und als entwerfendes<br />
Werkzeug für die architektonische und städtebauliche<br />
Disziplin.<br />
Die Reflexion über den <strong>Campus</strong> soll uns helfen,<br />
zu verstehen, welche architektonischen, räumlichen<br />
und urbanen Qualitäten dieser Raumtypus<br />
ermöglichen kann und in welcher Art wir ihn in<br />
unserer entwerfenden Arbeit verwenden können.<br />
Gleichzeitig soll das Ziel dieser Forschung und der<br />
Anwendung des Begriffes „<strong>Campus</strong>“ in Verbindung<br />
mit der Spezifität der Universität Hamburg darin<br />
bestehen, zu erläutern, wie die <strong>Campus</strong>infrastruktur<br />
die Leistungsfähigkeit von Forschung und Lehre<br />
unterstützen kann. Ein weiteres Ziel ist es zudem,<br />
herauszufinden, auf welche Weise der zukünftige<br />
Stadtcampus in Hamburg eine immer wichtigere<br />
Rolle einnehmen kann, um die urbane Qualität zu<br />
bereichern und zu verbessern.<br />
Unser Interesse für diesen Begriff ist nicht neu<br />
und umfasst unterschiedliche Aspekte. In den letzten<br />
Jahren haben wir uns in unseren Forschungsarbeiten<br />
bereits mit dem engen Verhältnis zwischen<br />
Orten der Kultur und dem Städtebau sowie zwischen<br />
Gebäudetypen, die mit Kulturfunktionen verbunden<br />
sind, und Architekturentwürfen beschäftigt.<br />
Unsere Auseinandersetzung mit dem Begriff<br />
„Monument“ und die intensive Arbeit mit Kulturbauten,<br />
die eine monumentale Rolle im städtischen<br />
Kontext spielen, haben uns auch in den Themenbereich<br />
des Universitätscampus geführt. Die Reflexion<br />
über die Geschichte des Raumtypus <strong>Campus</strong>, der<br />
Universität und des <strong>Campus</strong> Von-Melle-Park in der<br />
Stadt Hamburg war eine Voraussetzung, um sich<br />
der allgemeinen Frage des urbanen <strong>Campus</strong> in der<br />
Gegenwart und in der Zukunft zu stellen.<br />
Es ist unsere Überzeugung, dass die Universität<br />
ein enormes Potenzial für die Verbesserung der<br />
urbanen Qualität der Stadt Hamburg darstellt. Um<br />
dieses Potenzial wirklich nutzen zu können, muss<br />
man sich jedoch von der Rhetorik einer universitätsdistanzierten<br />
Stadt Hamburg befreien. Längst<br />
ist es unter allen Fachkennern deutlich geworden,<br />
dass Universitäten ein hervorragender Motor für<br />
die Stadtentwicklung sind. Folglich stellt sich für<br />
uns nicht mehr die Frage, ob und warum, sondern<br />
wie wir mit den Universitätsstandorten in der Stadt<br />
umgehen können.<br />
Im Rahmen einer ständigen Auseinandersetzung<br />
mit den gegenwärtigen Themen der architektonischen<br />
und der städtebaulichen Debatte in Hamburg<br />
– primär mit der Verdichtung, dem Wohnen<br />
und dem öffentlichen Raum – haben wir schon<br />
in den letzten Jahren die konkrete Chance ergriffen,<br />
an dem wichtigsten Stadtcampus Hamburgs<br />
(Von-Melle-Park) zu arbeiten und diesen als Labor<br />
für unsere Reflexionen zu betrachten. 1 Wir werden<br />
in einem ersten Schritt einige wesentliche Gedanken<br />
aus dieser Forschung über den Von-Melle-<br />
Park übernehmen und diese als Voraussetzung für<br />
weitere Gedanken betrachten. Die gegenwärtige<br />
Forschung über den „<strong>Multiple</strong> <strong>Campus</strong>“ bildet nämlich<br />
ein weiteres Moment im Rahmen einer einheitlichen<br />
Forschungsarbeit, das aus der Annahme<br />
hervorgeht, dass das Entwerfen eine Forschungstätigkeit<br />
darstellt, innerhalb derer sich unsere Werkzeuge<br />
immer weiter verfeinern und entwickeln.<br />
Für unsere Arbeit als Architekten und Städtebauer<br />
bildet diese Arbeit eine Chance, uns mit<br />
dem Thema der Zukunft der Stadt auseinanderzusetzen<br />
und einige Reflexionen über die Bedeutung<br />
dieser Zukunft der Stadt für unsere Disziplin zu<br />
entwickeln. Wir unternehmen den methodischen<br />
Versuch, einige strukturalistische Gedanken sowie<br />
poststrukturalistische Betrachtungsweisen zu<br />
integrieren. Auf der einen Seite ist es für uns unumgänglich,<br />
die primäre Rolle von historisch permanenten<br />
Elementen zu erkennen. Diese bilden<br />
wesentliche morphologische Komponenten, die<br />
notwendig sind, um in unserer Arbeit einen Kontinuitätsbezug<br />
zur historischen Stadt, ihrem Genius<br />
Loci und ihrer Identität zu ermöglichen. Auf der anderen<br />
Seite sind wir überzeugt, dass wir diese Elemente<br />
nur mithilfe von zusätzlichen Betrachtungen<br />
weiterer Aspekte, etwa der Dimension der Multiplizität,<br />
der Komplexität und der Widersprüchlichkeit,<br />
neu interpretieren und reaktivieren können. Gleichzeitig<br />
drückt diese Arbeit unsere Erkenntnis aus,<br />
dass Wissenschaft und Kultur auch in einer vorwiegend<br />
konsumorientierteren Gesellschaft eine<br />
wesentliche Rolle spielen werden. Wissenstransfer<br />
und Kulturvermittlung sind für uns unumgängliche<br />
Komponenten, um die Qualität der architektonischen<br />
und räumlichen Ressourcen der Stadt positiv<br />
beeinflussen und ihre urbane Lebensqualität in der<br />
Zukunft entwickeln zu können.<br />
Qualität und Exzellenz des Stadtcampus<br />
Es ist unsere tiefe Überzeugung, dass der Architektur<br />
als Disziplin ein hohes Maß an Qualität und<br />
Bedeutung zukommen muss, da sie in der Lage ist,<br />
das Leben der Menschen zu verbessern. Als besondere<br />
Form der Kunst und auch Technik verfolgt sie<br />
das Ziel, die Lebensentwürfe, konkreten Bedürfnisse<br />
und Träume der Menschen zu erfüllen. Der Begriff<br />
„<strong>Campus</strong>“ ist für uns in dieser Hinsicht besonders<br />
faszinierend und interessant, weil er der Natur eines<br />
Ortes entspricht, der gleichzeitig intellektuelle<br />
sowie emotionelle Lebensvorstellungen erfüllt.<br />
Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist das Entwerfen<br />
und das Reflektieren über die Morphologie der Architektur<br />
und der Stadt. Bei dieser Aufgabe ist es für<br />
uns unumgänglich, die Formen der Stadt sowie das<br />
Verhältnis zwischen Alt und Neu, zwischen historischer<br />
und moderner Architektur zu untersuchen.<br />
148 | 149
Die Universität Hamburg übermorgen<br />
Entwurfsszenarien und Zukunftsplanungen<br />
für die Hauptstandorte<br />
Die Entwurfsszenarien für das Übermorgen der Universität<br />
Hamburg, die zuvor bereits innerhalb der<br />
theoretischen Annäherung im Sinne von Universitätsstandorten<br />
nach dem Prinzip eines <strong>Multiple</strong><br />
<strong>Campus</strong> erwähnt und in Grundzügen beschrieben<br />
wurden, werden hier nun in Form von Plänen und<br />
Axonometrien vorgestellt. Die dargestellten Szenarien<br />
sind dabei als musterhafte Anwendungen der<br />
entwerferischen Themen für einen „<strong>Multiple</strong> <strong>Campus</strong>“<br />
zu verstehen und stellen keine abgeschlossenen<br />
Planungen für die jeweiligen Standorte dar.<br />
Dabei erfolgt eine Beschränkung auf die Standorte<br />
Von-Melle-Park, Bundesstraße und Klein Flottbek.<br />
Die Standorte Science City Bahrenfeld und Universitätsklinikum<br />
Hamburg-Eppendorf werden in diesem<br />
Zusammenhang nicht betrachtet, da zeitgleich<br />
innerhalb anderer Projekte klar definierte Zukunftsszenarien<br />
für diese Standorte entstanden sind, die<br />
von sich aus bereits viele wichtige Aspekte eines<br />
„<strong>Multiple</strong> <strong>Campus</strong>“ enthalten.<br />
Für den historischen <strong>Campus</strong> Von-Melle-Park,<br />
der im Morgen nur geringe Eingriffe auf hochbaulicher<br />
Ebene erfährt, ist der Schritt zur langfristigen<br />
Vision für das Übermorgen besonders groß. Durch<br />
eine grundlegende städtebauliche Umstrukturierung<br />
zwischen dem Innenbereich des <strong>Campus</strong> und<br />
der Grindelallee wird zum einen der <strong>Campus</strong>innenraum<br />
stärker gefasst, zum anderen der Bezug zum<br />
neuen <strong>Campus</strong>boulevard in Form der umgestalteten<br />
Grindelallee hergestellt.<br />
Für den <strong>Campus</strong> Bundesstraße wurde zwar zu<br />
Beginn der 2010er Jahre bereits eine übergeordnete<br />
städtebauliche Vision entwickelt, jedoch haben<br />
sich seitdem insbesondere die nutzungsbezogenen<br />
Rahmenbedingungen sehr stark gewandelt<br />
(siehe Kapitel „Heute & Morgen“). So lag es auch für<br />
diesen Standort nahe, die städtebauliche Grund-<br />
konzeption über die bestehenden Pläne hinaus<br />
weiterzudenken. Dies manifestiert sich in einer<br />
Verstärkung der Ausrichtung auf die Grindelallee,<br />
die zur neuen <strong>Campus</strong>achse des zusammengefassten<br />
Stadtcampus Von-Melle-Park/Bundesstraße<br />
wird, und in einer städtebaulichen Anbindung an<br />
den bedeutenden Verkehrsknotenpunkt an der<br />
U-Bahn-Haltestelle Schlump in Form einer neuen<br />
<strong>Campus</strong>eingangssituation.<br />
Der <strong>Campus</strong> Klein Flottbek wird in der hier dargestellten<br />
Vision als Zentrum der Biodiversität langfristig<br />
Bedeutung haben und in diesem Themenfeld<br />
diverse Nutzungen und Angebote umfassen, die<br />
das Spektrum von Forschung und Lehre ergänzen –<br />
trotz des vorgesehenen Umzugs der zentralen<br />
Funktionen des Fachbereichs Biologie nach Bahrenfeld.<br />
Die wichtigste städtebauliche Geste ist hier<br />
eine Verdichtung entlang der S-Bahn-Achse parallel<br />
zur Ohnhorststraße, die dadurch in den <strong>Campus</strong> integriert<br />
wird.<br />
Für diese drei Standorte – bzw. zwei Standorte<br />
bei der zusammenfassenden Betrachtung von Von-<br />
Melle-Park und Bundesstraße als Stadtcampus –<br />
wurden jeweils drei Entwurfsszenarien nach den<br />
übergeordneten Prinzipien „Layers“, „Mosaik“ und<br />
„Schichten“ ausgearbeitet. Diese werden nachfolgend<br />
im Zusammenhang mit den bildlichen Darstellungen<br />
für die Einzelstandorte erläutert.<br />
Die langfristigen Visionen für die Science City<br />
Bahrenfeld und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf<br />
werden in diesem Kapitel entsprechend<br />
den jeweiligen aktuellen Planungen und<br />
Konzepten beschrieben. Für den Standort Bahrenfeld<br />
wird dabei das Anfang 2019 veröffentlichte<br />
Konzept für die Science City Bahrenfeld vorgestellt.<br />
Für das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf<br />
wird der „Zukunftsplan 2050“ erläutert. (PF/JB)<br />
Übermorgen | Die Universität Hamburg übermorgen
Stadtcampus<br />
Von-Melle-Park & Bundesstraße<br />
Layers – Mosaik – Schichten<br />
Die <strong>Campus</strong>anlagen Von-Melle-Park und Bundesstraße<br />
werden im „Übermorgen“ als ein zusammenhängender<br />
Stadtcampus betrachtet. Das verbindende<br />
Scharnier zwischen beiden Bereichen<br />
ist die Grindelallee, die zum <strong>Campus</strong>boulevard<br />
umgestaltet wird. Nach der Realisierung der geplanten<br />
U-Bahn können die Busspuren entfallen,<br />
der Straßenraum kann zugunsten eines Boulevardcharakters<br />
mit breiten Fußwegen neu aufgeteilt<br />
werden. Zu errichtende und bestehende Gebäude<br />
mit Orientierung auf diese Achse werden im Sinne<br />
einer guten Sichtbarkeit der Universität zur Straße<br />
hin gestaltet, und die Wegeverbindungen zwischen<br />
beiden <strong>Campus</strong>teilen werden verbessert.<br />
Layers<br />
Hier wird die historische gerade Linie zwischen<br />
dem heutigen Allende-Platz und dem südlichen Teil<br />
der Schlüterstraße in ihrem parallelen Verlauf zur<br />
Grindelallee wieder aufgegriffen und als Begrenzung<br />
einer verdichteten Bebauungsstruktur zwischen<br />
diesen beiden Außenkanten ausgeformt. Von<br />
der Ecke Moorweidenstraße bis zur Ecke Grindelhof<br />
wird, abgesehen vom Altbau der Staats- und Universitätsbibliothek,<br />
dem sogenannten Pferdestall,<br />
mit der zu realisierenden Kulturpassage und der<br />
Zeile am Grindelhof eine neue Bebauungsstruktur<br />
in Form von aufgebrochenen Blockgefügen<br />
geschaffen. Am südöstlichen Ende vermittelt der<br />
Neubau der Staats- und Universitätsbibliothek als<br />
polygonaler Quader zwischen der Richtung der<br />
neuen Stabi-Passage und den rechtwinklig zur<br />
Grindelallee ausgerichteten Kubaturen. Am nordwestlichen<br />
Ende wird der Block aus Grindelhof-Bebauung,<br />
Pferdestall und neuer Kulturpassage mit<br />
einer großen Geste geschlossen und mit einem<br />
Hochpunkt versehen, der den Philosophenturm<br />
und den Neubau des Studierendenwerks zu einem<br />
Dreiklang ergänzt. Hier wird der Durchlass zum<br />
<strong>Campus</strong>innenraum von der Orthogonalen zur Grindelallee<br />
deutlich im Uhrzeigersinn gedreht, um die<br />
Funktion als Verbindung zum <strong>Campus</strong> Bundesstraße<br />
anzudeuten. Zwischen den beiden Endpunkten<br />
erfolgt die Bebauung als aufgebrochene Zeile entlang<br />
der Grindelallee und als U- beziehungsweise<br />
E-förmige Bauten entlang des <strong>Campus</strong>innenraumes.<br />
Innerhalb aller Gebäude überlagern sich gemäß<br />
dem Prinzip Layers die Funktionen vertikal,<br />
von öffentlich im Erdgeschoss bis rein universitär in<br />
den Obergeschossen.<br />
Für den <strong>Campus</strong>teil Bundesstraße sind ergänzende<br />
Neubauten im Bereich des U-Bahnhofs<br />
Schlump angedacht. Bei der Variante Layers leitet<br />
sich die Form vertikal nutzungsgemischter Gebäude<br />
aus den Straßenverläufen und den Linien ab, die<br />
die übrigen Neubebauungen des <strong>Campus</strong> vorgeben.<br />
So entsteht zwischen dem Schröderstift und<br />
der Straße Beim Schlump ein neuer Gebäuderiegel,<br />
der die große Blockrandstruktur des Hauses der<br />
Erde quasi zur Kreuzung beim U-Bahnhof hin erweitert.<br />
Die heutigen Flachbauten des U-Bahnhofs<br />
werden durch eine markante Kubatur ersetzt, die<br />
in diesem Fall vom Grundriss her auf die Schäferkampsallee<br />
ausgerichtet ist. Zwei weitere Kubaturen<br />
entstehen an der Schröderstiftstraße zwischen<br />
den beiden Außenflügeln der Stiftsbebauung sowie<br />
in zweiter Reihe zwischen Geomatikum und Schröderstiftweg.<br />
Mosaik<br />
In diesem Szenario werden die Neubauten als<br />
polygonale Mosaiksteine ausgeformt, und die Verteilung<br />
der Nutzungen zwischen extern und intern<br />
erfolgt nicht in vertikaler Abfolge, sondern insge-<br />
172 | 173
55<br />
Bundesstraße: 3D-Modell,<br />
Szenario Mosaik<br />
Blick aus verschiedenen<br />
Himmelsrichtungen<br />
Übermorgen | Stadtcampus Von-Melle-Park & Bundesstraße
198 | 199
61<br />
Bundesstraße: Visualisierung<br />
mit Funktionsbereichen<br />
Szenario Schichten<br />
Öffentlich<br />
Halböffentlich<br />
Interne Bereiche<br />
Übermorgen | Stadtcampus Von-Melle-Park & Bundesstraße
208 | 209
77<br />
Klein Flottbek: Visualisierung<br />
mit Funktionsbereichen,<br />
Szenario Schichten<br />
Öffentlich<br />
Halböffentlich<br />
Interne Bereiche<br />
Übermorgen | <strong>Campus</strong> Klein Flottbek
228 | 229
80<br />
Visualisierungen des<br />
Konzepts „Science City<br />
Bahrenfeld“<br />
Übermorgen | Science City Bahrenfeld
234 | 235
Autoren<br />
& Redaktion<br />
Autor<br />
Redaktion<br />
Paolo Fusi<br />
Univ.-Prof. Dott. Arch. BDA<br />
Lehrstuhl Städtebaulicher Entwurf<br />
HafenCity Universität Hamburg<br />
Einführung<br />
Dieter Lenzen<br />
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c.<br />
Präsident<br />
Universität Hamburg<br />
Martin Hecht<br />
Dr. rer. pol.<br />
Kanzler<br />
Universität Hamburg<br />
Gastbeitrag<br />
Saskia Lemm<br />
Pressesprecherin<br />
Universitätsklinikum Hamburg-<br />
Eppendorf<br />
Johannes Bouchain<br />
Dipl.-Ing. Stadtplaner<br />
Stadtkreation – Urbanes Bewegen<br />
Paolo Fusi<br />
Univ.-Prof. Dott. Arch. BDA<br />
Lehrstuhl Städtebaulicher Entwurf<br />
HafenCity Universität Hamburg<br />
Eva Liesberg<br />
Dipl.-Ing. Architektin (FH)<br />
Universität Hamburg<br />
Abteilung 8 – Liegenschaftsmanagement<br />
Referat 86 – <strong>Campus</strong>planung<br />
Kathrin Schmuck<br />
Bucharchitektur \ Kathrin Schmuck<br />
Marita Vietmeyer<br />
Dipl.-Ing. Architektin<br />
Universität Hamburg<br />
Abteilung 8 – Liegenschaftsmanagement<br />
Referat 86 – <strong>Campus</strong>planung<br />
250 | 251