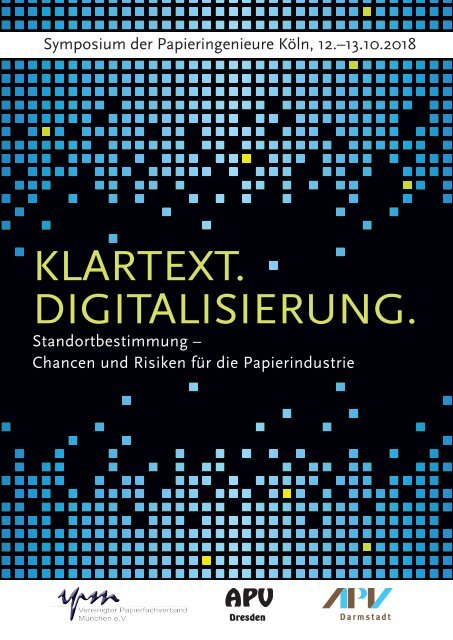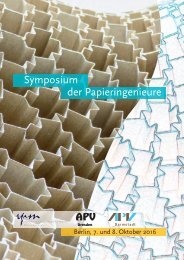Tagungsband Darmstadt 2018
Der Tagungsband für das Symposium der Papieringenieure in Darmstadt, 2018
Der Tagungsband für das Symposium der Papieringenieure in Darmstadt, 2018
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Symposium der Papieringenieure Köln, 12.–13.10.<strong>2018</strong><br />
KLARTEXT.<br />
DIGITALISIERUNG.<br />
Standortbestimmung –<br />
Chancen und Risiken für die Papierindustrie
Symposium<br />
der Papieringenieure <strong>2018</strong> in Köln<br />
KLARTEXT. DIGITALISIERUNG.<br />
Standortbestimmung – Chancen und Risiken für die Papierindustrie<br />
Digital Cologne – Wir grüßen Sie und freuen uns, dass<br />
Sie dabei sind! Das 4. Symposium der Papieringenieure<br />
findet in Köln statt, einem traditionellen Zentrum der<br />
deutschen Papier- und Zulieferindustrie.<br />
Die gemeinsame Veranstaltung des Vereinigten Papierfachverbands<br />
München e.V. (VPM) und der Akademischen<br />
Papieringenieurvereine e.V. (APV) Dresden und<br />
<strong>Darmstadt</strong> verspricht zwei Tage voller spannender<br />
Vorträge, interessanter Exkursionen und viel Gelegenheit<br />
zum gegenseitigen Erfahrungsaustauch mit Fachkollegen.<br />
Das Symposium der Papieringenieure ist längst kein<br />
Geheimtipp mehr, denn der Erfolg dieser Veranstaltung<br />
hat sich mittlerweile herumgesprochen, wodurch es<br />
uns gelungen ist, noch mehr Interessenten für unsere<br />
gemeinsame Tagung zu gewinnen.<br />
Die Vortragsreihe nimmt eine kritische Betrachtung<br />
verschiedener Aspekte der Digitalisierung in der Papierindustrie<br />
und deren Auswirkung auf Märkte/Maschinen/<br />
Menschen vor. Eine Standortbestimmung wird zeigen,<br />
wo wir uns gegenwärtig befinden und wie wir die vor<br />
uns stehenden anspruchsvollen Herausforderungen<br />
angehen können.<br />
Unser besonderes Augenmerk richten wir auf unsere<br />
Studenten, also auf die nächste Generation Papier -<br />
ingenieure. Im Rahmen des Symposiums werden wir<br />
ihnen auch in diesem Jahr ausreichend Gelegenheiten<br />
zur Kontaktpflege für ein erfolgreiches Studium und<br />
einen gelungenen Start ins Berufsleben einräumen.<br />
Das bewährte Mentoring Programm, bei dem die<br />
Studenten von Industrievertretern persönlich in deren<br />
Netzwerk eingeführt werden, findet seine Fortführung.<br />
Damit ist das Symposium für künftige Absolventen eine<br />
Plattform zur Kontaktaufnahme zu Firmen und potenziellen<br />
Arbeitgebern.<br />
Ferner bieten wir am Samstag den Rahmen für Studenten -<br />
vorträge und Präsentationen der Hochschule München<br />
und der Universitäten Dresden und <strong>Darmstadt</strong> und<br />
binden so unseren Nachwuchs für die Papierindustrie<br />
aktiv in den Ablauf des Symposiums ein.<br />
Nicht nur die Studenten unserer drei Ausbildungsstätten,<br />
sondern auch Studenten anderer Hochschulen sind uns<br />
herzlich willkommen, weshalb wir ihnen die Möglichkeit<br />
eingeräumt haben, weitgehend kostenfrei an dem<br />
Symposium teilzunehmen.<br />
Ein Highlight der Veranstaltung wird der gesellige<br />
Abend sein, der in diesem Jahr in der historischen<br />
Wolkenburg in Köln stattfindet. Nutzen Sie das dies -<br />
jährige Symposium zur Erweiterung und Vertiefung<br />
Ihres Netzwerkes in entspannter und angenehmer<br />
Atmosphäre.<br />
Damit die Veranstaltung zu einem unvergesslichen<br />
Höhepunkt wird, sind viele engagierte ehrenamtliche<br />
Helfer, sowie eine großzügige Unterstützung unserer<br />
Sponsoren erforderlich. Für Beides möchten wir uns auf<br />
diesem Weg sehr herzlich bedanken.<br />
Wir freuen uns auf interessante und informative Stunden in Köln!<br />
Ihre Vorsitzenden<br />
Kai Pöhler Ulrich Mallon Claus Raschka
Inhalt<br />
3 .....................<br />
6 .....................<br />
8 .....................<br />
10 ...................<br />
12 ...................<br />
14 ...................<br />
16 ...................<br />
20 ..................<br />
22 ...................<br />
24 ...................<br />
26 ...................<br />
28 ...................<br />
30 ...................<br />
32 ...................<br />
34 ...................<br />
Editorial<br />
Grußwort Armin Laschet<br />
Grußwort Winfried Schaur<br />
Die Absolventenvereine VPM, APV Dresden, APV <strong>Darmstadt</strong><br />
Tagungsprogramm<br />
Der Tagungsort: Hilton Cologne<br />
Statements<br />
Einführung in die Vortragsreihe<br />
Dr. Roland Pelzer<br />
Die Papierindustrie in Nordrhein-Westfalen<br />
Martin Drews, Martin Krengel<br />
Wird die digitale Transformation zur Erfolgsgeschichte für Deutschland?<br />
Thomas Koenen<br />
Digitally Prepared? Prioritäten und Optimierungspotenziale<br />
in der Wertschöpfungskette durch Digitalisierung und Industrie 4.0<br />
Alexander Wirth<br />
Für erfolgreiche Unternehmen steht zwischen analog und digital<br />
kein „oder“!<br />
Robin Huesmann, Dominik Romer<br />
Digitalisierung mit Start-Up-Methoden<br />
Anett Hötzel<br />
Die Schattenseite der Digitalisierung:<br />
Neue Risiken für produzierende Unternehmen<br />
Nicolas Christoph<br />
Die Rolle von Papier und Folien in der vernetzen Welt<br />
Ivica Kolaric
36 ...................<br />
38 ...................<br />
40 ..................<br />
42 ...................<br />
44 ...................<br />
48 ...................<br />
49 ..................<br />
50 ...................<br />
52 ...................<br />
54 ...................<br />
56 ...................<br />
58 ...................<br />
65 ...................<br />
72 ...................<br />
78 ...................<br />
78 ...................<br />
Die digitale Transformation bei Voith<br />
Frank Opletal<br />
Core Competence Shift Happens<br />
Prof. Gunter Dueck<br />
Fortschreitende Digitalisierung!<br />
Bedeutung dieses Wandels für Unternehmen, das berufliche Umfeld<br />
und für SIE persönlich<br />
Andreas Päch<br />
Moderner Rechtsrahmen für eine moderne Arbeitswelt<br />
Julius Jacoby<br />
Papierproduktion im Rheinland – Ein geschichtlicher Abriss<br />
LVR-Industriemuseum Papiermühle Alte Dombach<br />
in Bergisch Gladbach<br />
Stadtplan Tagungsorte in Köln<br />
Exkursion Niederauer Mühle GmbH<br />
Exkursion Richter GmbH & Co. KG<br />
Partnerprogramm: Drachenfels & Burg Drachenburg<br />
Gesellschaftsabend<br />
Hochschule München<br />
Technische Universität Dresden<br />
Technische Universität <strong>Darmstadt</strong><br />
Ankündigung des Symposiums der Papieringenieure 2019<br />
Impressum
Armin Laschet<br />
Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
Grußwort<br />
zum 4. Symposium<br />
der Papieringenieure<br />
Sehr geehrte Ingenieurinnen und Ingenieure,<br />
ich heiße Sie in Köln willkommen. Sie haben einen passenden<br />
Tagungsort gewählt: Köln ist Standort bedeutender<br />
Verlage und Mediengruppen, die Stadt wird auch als „das<br />
rheinische Kommunikationszentrum“ bezeichnet.<br />
Hier hat einer der größten Zeitungsverlage Deutschlands<br />
seinen Sitz. Welcher Ort könnte geeigneter sein für das<br />
Symposium der Papieringenieure? Denn Sie als aktuelle<br />
und als zukünftige Gestalter und Manager der Papier -<br />
industrie sorgen für den Grundstoff der Printmedien:<br />
Für hochtechnische Produkte, auf denen Lektüre gedruckt<br />
wird und mit denen fast alles verpackt wird – und die<br />
mit der gleichen hohen Qualität so manche Träne am<br />
Aschermittwoch trocknen.<br />
In unserer rheinischen Metropole Köln können Sie eine<br />
Fülle an Anregungen erhalten. Das gilt genauso für<br />
das ganze Land, denn Nordrhein-Westfalen bietet eine<br />
Vielfalt, die ihresgleichen sucht. Lassen Sie sich über -<br />
raschen: Vom weitgehend grünen Ruhrgebiet, von der<br />
Exzellenz der Wissensregion um Aachen, von der<br />
starken mittelständischen Industrie in den ländlichen<br />
Regionen Südwestfalens, des Münsterlands oder in<br />
„OWL“ und von den reichen kulturellen Angeboten etwa<br />
hier in Köln. Dabei ist Nordrhein-Westfalen insgesamt<br />
als hoch entwickelter Wirtschaftsraum mit starkem<br />
Mittelstand, mit modernen Industrien und mit innovativen<br />
Dienstleistungen auf der Höhe der Zeit.<br />
Ihr Thema „Klartext.Digitalisierung“ ist gut gewählt.<br />
Auch für die Landesregierung ist die Digitalisierung ein<br />
zentrales Thema: Wir unterstützen den Ausbau des<br />
schnellen Internets im ganzen Land. Wir begleiten die<br />
digitale Transformation der Wirtschaft. Wir haben<br />
digitale Modellregionen eingerichtet, die neue Angebote<br />
für Unternehmen und Bürger entwickeln. In sechs<br />
Digital Hubs in Nordrhein-Westfalen arbeiten Startups,<br />
Gründer und Investoren an zeitgemäßen Geschäfts -<br />
modellen. Wir helfen den Menschen, die digitale<br />
Transformation als Herausforderung, aber vor allem als<br />
Chance zu sehen. Digitalisierung wird bei uns umfassend<br />
gelebt!<br />
Das gilt auch für die Papierindustrie, „digital“ ist für Sie<br />
kein Fremdwort. Es mag erstaunen: Trotz aller Unkenrufe<br />
gibt es das gedruckte Buch immer noch, es gibt<br />
sogar eine unglaubliche Vielfalt an Magazinen und Fachzeitschriften.<br />
Das liegt auch mit daran, dass Sie sich<br />
früher als andere Branchen mit dem digitalen Wandel<br />
auseinandersetzen mussten: Sie haben kontinuierlich<br />
Produktionsprozesse verbessert, neue Geschäftsmodelle<br />
an den Schnittstellen von Print und Online entwickelt<br />
und sind für die Zukunft gerüstet. Der Branche geht es<br />
deshalb heute gut – und sie hat ausgezeichnete Perspektiven.<br />
Machen Sie weiter so!<br />
Ich wünsche Ihnen ein gelungenes Symposium, einen<br />
guten fachlichen und persönlichen Austausch mit vielen<br />
Anregungen für den Alltag – und natürlich einen<br />
offenen Blick für unser schönes Nordrhein-Westfalen!<br />
Armin Laschet
Unser Platin-Sponsor
Winfried Schaur<br />
Executive Vice President UPM Communication<br />
Papers, Präsident des Verbandes Deutscher<br />
Papierfabriken (VDP)<br />
Die Tür finden!<br />
Grußwort von VDP-Präsident<br />
Winfried Schaur<br />
Es kommt nicht darauf an, mit dem Kopf durch die Wand<br />
zu rennen, sondern mit den Augen die Tür zu finden.<br />
Die Worte von Werner von Siemens haben auch heute<br />
noch Gültigkeit. Der Vater der modernen Elektrotechnik<br />
stand an der Schwelle eines neuen technischen Zeitalters,<br />
so wie wir es heute mit der umfassenden Digitalisierung<br />
erleben.<br />
2002 war es der Menschheit erstmals möglich, mehr<br />
Information digital als analog zu speichern, man sprach<br />
vom Beginn des digitalen Zeitalters. Die Papierindustrie<br />
hat sich – mit einigen Verwerfungen in der Medienwelt –<br />
bis heute ganz gut geschlagen. Sie muss sich künftig<br />
jedoch nicht nur mit ihren Produkten, sondern auch mit<br />
ihren eigenen Prozessen der Digitalisierung stellen.<br />
Industrie 4.0 ist keine Zukunftsvision, Industrie 4.0 ist<br />
für die Ingenieure der Papierindustrie bereits heute<br />
Realität.<br />
Die Digitalisierung unserer Branche ist ein evolutionärer<br />
Vorgang, der sich über Jahre oder Jahrzehnte erstrecken<br />
wird. Wie Industrie 4.0 bei uns am Ende wirklich aussieht,<br />
lässt sich nicht voraussagen. Wir müssen jedoch<br />
eine Vorstellung davon entwickeln, wie die Zukunft<br />
aussehen könnte – eine klassische Aufgabenstellung<br />
für Ingenieure, über die auch auf diesem Symposium<br />
der Papieringenieure unter dem Motto „Klartext.Digitalisierung“<br />
diskutiert werden wird.<br />
Dabei geht es nicht nur um die ungeahnten Möglich -<br />
keiten in Produktion und Logistik. Alle Teilnehmer der<br />
Wertschöpfungskette werden miteinander vernetzt sein.<br />
Geschäftsprozesse werden gestrafft und neu belebt<br />
werden können, neue Vertriebskanäle geschaffen und<br />
eine weit tiefere Integration mit dem Kunden wird stattfinden.<br />
Daten werden in nie dagewesenem Ausmaß<br />
genutzt, neue Muster und Zusammenhänge erkannt und<br />
darüber die Effizienz weiter gesteigert werden.<br />
Verstehen Sie die Herausforderungen der digitalen<br />
Transformation als Chance, tauschen Sie sich aus, gehen<br />
Sie das Thema offensiv an, aber versuchen Sie nicht,<br />
mit dem Kopf durch die Wand zu brechen. Mit Köpfchen<br />
werden wir von selbst die Türen in die Zukunft finden.<br />
Winfried Schaur
Unser Platin-Sponsor
Die Absolventenvereine<br />
Die Vereine sind Gemeinschaften<br />
der Absolventen und Studierenden<br />
der Fachrichtung Papiertechnik am<br />
jeweiligen Hochschulstandort.<br />
Der Zweck und das Ziel aller drei<br />
Vereine ist die Unterstützung und<br />
Förderung des Papiertechnik-<br />
Nachwuchses an der jeweiligen<br />
Hochschule. Die Vereine sind<br />
bestrebt, die Verbindungen der Vereinsmitglieder<br />
untereinander sowie<br />
mit der Papierindustrie und ihren<br />
verwandten Zweigen zu fördern.<br />
Auch die Pflege der Beziehung<br />
zwischen den drei Absolventenvereinen<br />
ist ein erklärtes Ziel der Vereine.<br />
Vereinigter Papierfachverband e.V.<br />
(VPM)<br />
Gründung: 1959 in München<br />
Aktuelle Mitglieder:<br />
700 in Deutschland, 60 in Österreich und 118 in<br />
der Schweiz; davon 98 Aktivitas<br />
Organisation:<br />
Landesgruppen in Deutschland, Österreich und<br />
der Schweiz<br />
Aktueller Vorstand:<br />
1. Vorsitzender: Kai Pöhler<br />
2. Vorsitzender: Frank May<br />
Schatzmeister: Cornelius Link<br />
Schriftführer: Alexander Böck<br />
Landesgruppen-Obmann: Andreas Päch<br />
Tagungsorganisator: Jörg Padberg<br />
Beisitzer: Dr.-Ing. Ernst-Ulrich Wittmann,<br />
Holger Baumgartner, Tobias Hain,<br />
Prof. Dr.-Ing. Heinz Ziegler, Andreas Luda<br />
Ehrenvorsitzender: Adolf Falter † 07.08.<strong>2018</strong><br />
Ehrenmitglieder:<br />
Otto Burk, Wolfgang Guder, Wolfgang Moerler<br />
Aktueller Aktivitas Vorstand (Paper / Packaging):<br />
1. Vorsitzende: Marcel Prinz<br />
2. Vorsitzende: Tim Carstens / Felix Hiller<br />
Kassenwart: Ludwig Bauriedl<br />
Schriftführer/-in: Maximilian Krallinger /<br />
Eva-Maria Waltl<br />
Kontakt:<br />
Vereinigter Papierfachverband<br />
Riedstraße 40, 72810 Gomaringen<br />
www.papierfachverband.de
Akademischer Papieringenieurverein<br />
an der TU Dresden e.V.<br />
Gründung: 16.11.1990<br />
Gründungsmitglieder: 28 Senioren, 24 Aktivitas<br />
Aktuelle Mitglieder: 250, davon 24 Aktivitas<br />
Aktueller Vorstand:<br />
1. Vorsitzender Ulrich Mallon<br />
2. Vorsitzender Hagen Pecher<br />
Kassenwartin Ina Greiffenberg<br />
Schriftführerin Franziska Gebauer<br />
Beisitzer:<br />
Dr.-Ing. Kerstin Graf, Dr.-Ing. Sabine Heinemann,<br />
Prof. Dr. Frank Miletzky, Michael Moser,<br />
Prof. Dr.-Ing. André Wagenführ, Dr.-Ing. Roland Zelm<br />
Ehrenvorsitzender: Rüdiger Ocken<br />
Ehrenmitglieder:<br />
Volker Barth, Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen Blechschmidt,<br />
Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus Fischer,<br />
Dr.-Ing. habil. Manhart Schlegel, Dr.-Ing. habil.<br />
Jürgen Tenzer, Prof. Dr.-Ing. habil. Ernst-Wieland<br />
Unger<br />
Aktueller Aktivitas Vorstand:<br />
1. Vorsitzender Julian Schmid<br />
2. Vorsitzender Hermann Plettenberg<br />
Kassenwart Peter Singer<br />
Internetbeauftragter Ruben Pohlent<br />
Kontakt:<br />
Akademischer Papieringenieurverein<br />
an der TU Dresden e.V.<br />
Postfach 200111, 01804 Heidenau<br />
www.apv-dresden.de<br />
Akademischer Papieringenieurverein<br />
an der TU <strong>Darmstadt</strong> e.V.<br />
Gründung: 27.06.1905<br />
Gründungsmitglieder: 25 Alte Herren, 47 Aktivitas<br />
Aktuelle Mitglieder: 345, davon 18 Aktivitas<br />
Aktueller Vorstand:<br />
1. Vorsitzender Claus Raschka<br />
2. Vorsitzender Rui De Amorim Ferreira<br />
Kassenwart Rolf Kayser<br />
Schriftführer Robert Götzinger<br />
Beirat:<br />
Thomas Villforth, Dr.-Ing. Roland Pelzer,<br />
Prof. Dr.-Ing. Samuel Schabel, Rosario Othen,<br />
Philipp Schimmelpfennig,<br />
Prof. em. Dr.-Ing. Dr. h. c. Lothar Göttsching<br />
Ehrenmitglieder:<br />
Dr. Hanns-Lutz Dalpke, Georg Friedrich, Prof. em.<br />
Dr.-Ing. Dr. h.c. Lothar Göttsching, Dr.-Ing. Ulrich<br />
Höke, Dr. Ulrich Kirchner, Prof. Dr. techn. Wilhelm<br />
Kufferath von Kendenich, Dieter Pothmann,<br />
Dr.-Ing. Hans-Joachim Putz<br />
Aktueller Aktivitas Vorstand:<br />
1. Vorsitzender Philipp Schimmelpfennig<br />
2. Vorsitzender Christiane Helbrecht<br />
Kassenwart Colin Wawrik<br />
Bibliothekar Rosario Othen<br />
Kontakt:<br />
Akademischer Papieringenieurverein (APV)<br />
<strong>Darmstadt</strong> e.V.<br />
TU <strong>Darmstadt</strong> – Fachgebiet Papierfabrikation<br />
und Mechanische Verfahrenstechnik (PMV)<br />
Alexanderstr. 8, 64283 <strong>Darmstadt</strong><br />
www.apv-darmstadt.de
Tagungsprogramm<br />
Klartext.<br />
Digitalisierung.<br />
Freitag, 12. Oktober <strong>2018</strong><br />
ab 8:30 Uhr Get Together – Eintreffen der Teilnehmer<br />
9:00 Uhr Begrüßung<br />
Kai Pöhler,<br />
1. Vorsitzender VPM<br />
Ulrich Mallon,<br />
1. Vorsitzender APV Dresden<br />
Claus Raschka,<br />
1. Vorsitzender APV <strong>Darmstadt</strong><br />
9:10 Uhr Die Papierindustrie in Nordrhein-Westfalen<br />
Martin Krengel, WEPA<br />
Martin Drews, Wirtschaftsverband NRW<br />
Herausforderungen der Digitalisierung<br />
für die deutsche Industrie<br />
Dr. Thomas Koenen, BDI<br />
I. Strategien, Märkte und Produkte<br />
Moderation: Prof. Dr. Samuel Schabel<br />
10:00 Uhr Digital vorbereitet? – Ein Blick auf<br />
die Industrie und ihre Bereitschaft<br />
für Industrie 4.0 und die Entwicklungen<br />
seit 2015<br />
Alexander Wirth, Stepchange Consulting<br />
10:20 Uhr Für erfolgreiche Unternehmen steht<br />
zwischen digital und analog kein „oder“!<br />
Robin Huesmann, LEIPA<br />
Dominik Romer, adnymics<br />
10:40 Uhr Digitalisierung mit Start-Up-Methoden<br />
– wie die Felix Schoeller Group neue digitale<br />
Geschäftsmodelle entdeckt und entwickelt<br />
Anett Hötzel, Felix Schoeller Group<br />
11:00 Uhr Diskussion<br />
11:15 Uhr Kaffeepause<br />
II. Technik und Technologie<br />
Moderation: Prof. Dr. Stephan Kleemann<br />
11:45 Uhr Die Schattenseite der Digitalisierung:<br />
Neue Risiken fur produzierende<br />
Unternehmen<br />
Nicolas Christoph, Papierfabrik August<br />
Koehler<br />
12:05 Uhr Die Rolle von Papier und Folien<br />
in der vernetzten Welt<br />
Ivica Kolaric, Fraunhofer Institut<br />
12:25 Uhr Die digitale Transformation bei Voith<br />
Frank Opletal, Voith<br />
12:45 Uhr Diskussion<br />
13:00 Uhr Mittagspause<br />
III. Mensch und Arbeitswelt<br />
Moderation: Prof. Dr. Frank Miletzky<br />
14:30 Uhr Die Digitalisierung verändert die<br />
notwendigen Kernkompetenzen /<br />
Core Competence<br />
Shift Happens<br />
Keynote Speech – Prof. Dr. Gunter Dueck<br />
15:30 Uhr Diskussion<br />
15:45 Uhr Kaffeepause<br />
16:15 Uhr Fortschreitende Digitalisierung! Bedeutung<br />
dieses Wandels für Unternehmen, das<br />
berufliche Umfeld und für SIE persönlich<br />
Andreas Päch, BGH<br />
16:35 Uhr Der Mensch in der digitalen Arbeitswelt<br />
Julius Jacoby, vbw – Vereinigung der<br />
Bayerischen Wirtschaft e.V.<br />
16:55 Uhr Diskussion<br />
17:15 Uhr Ende<br />
ab 19:00 Uhr Gesellschaftsabend<br />
Wolkenburg<br />
Mauritiussteinweg 59<br />
50676 Köln<br />
Partnerprogramm<br />
A) Ausflug zum Drachenfels mit Besichtigung<br />
Schloss Drachenburg<br />
10:00–16:30 Uhr
Samstag, 13. Oktober <strong>2018</strong><br />
8:30–9:30 Uhr<br />
Mitgliederversammlung VPM München<br />
1. Eröffnung und Begrüßung<br />
2. Tätigkeitsbericht des Vorstandes<br />
3. Bericht des Kassenwarts<br />
4. Bericht der Kassenprüfungskommission<br />
5. Bericht aus den Bezirksgruppen<br />
6. Bericht des Aktivitasvorsitzenden (Paper & Packaging)<br />
7. Aussprache zu den Berichten<br />
8. Ehrungen<br />
9. Allfälliges (Verschiedenes)<br />
8:30–9:30 Uhr<br />
Mitgliederversammlung APV Dresden<br />
1. Eröffnung und Begrüßung<br />
2. Bericht des Vorsitzenden<br />
3. Bericht der Aktivitas<br />
4. Bericht der Kassenwartin<br />
5. Revisionsbericht<br />
6. Ehrungen<br />
7. Sonstiges<br />
8:30–9:30 Uhr<br />
Mitgliederversammlung APV <strong>Darmstadt</strong><br />
1. Begrüßung und Eröffnung durch den 2. Vorsitzenden<br />
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung<br />
3. Bericht des Vorsitzenden<br />
4. Änderung der Satzung bzw. Korrekturen zur Satzungsänderung<br />
2017<br />
5. Korrektur der internen Geschäftsordnung<br />
6. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für das nächste<br />
Vereinsjahr<br />
7. Semesterbericht der Vorsitzenden der Aktivitas<br />
8. Jahresbericht des Kassenwarts<br />
9. Bericht der Kassenprüfer<br />
10. Entlastung des Beirats<br />
11. Wahlen für die Amtszeit bis 2020<br />
12. Anträge<br />
13. Verschiedenes<br />
9:30–10:00 Uhr Kaffeepause<br />
10:00–11:30 Uhr<br />
Berichte zum Studium / zur Ausbildung<br />
Prof. Dr. Helga Zollner-Croll & Prof. Dr. Martin<br />
Angerhöfer, Hochschule München<br />
Prof. Dr. Frank Miletzky & Dr. Roland Zelm,<br />
Technische Universität Dresden, Institut für<br />
Naturstofftechnik, HFT<br />
Prof. Dr. Samuel Schabel,<br />
Technische Universität <strong>Darmstadt</strong>, PMV<br />
11:30 Uhr<br />
Studentenvortrag 1<br />
Hochschule München<br />
Studentenvortrag 2<br />
Technische Universität Dresden – HFT<br />
Studentenvortrag 3<br />
Technische Universität <strong>Darmstadt</strong> – PMV<br />
ab 12:30 Uhr Mittagessen<br />
Exkursionen<br />
B) Stadtführung „Köln für Einsteiger“<br />
C) Stadtrundfahrt mit der Bimmelbahn<br />
inkl. Kaffee und Kuchen<br />
D) Besichtigung der Papierfabrik Niederauer Mühle,<br />
Kreuzau<br />
E) Besichtigung der Fa. Richter, Düren
Tagungsort Hilton Cologne<br />
Im Herzen der Kölner Altstadt, nur zwei Minuten Fußweg<br />
von Hauptbahnhof und Dom entfernt, liegt das denkmalgechützte<br />
Hilton Cologne.<br />
Als Wahrzeichen Kölns kombiniert es perfekt Lifestyle<br />
mit Design und Service und bietet moderne Zimmer<br />
und eine Vielzahl an erstklassigen Annehmlichkeiten<br />
wie den Wellnessbereich mit Trainingsgeräten, Sauna<br />
und Dampfbad, Sicheres Parken, High-Speed WLAN<br />
und eine exzellente Verkehrsanbindung.<br />
Internationale Verbindungen bietet der Flughafen<br />
Köln/Bonn, der in 20 Minuten per Taxi erreichbar ist.<br />
Von Frankfurt/Main ist man mit dem ICE in nur<br />
55 Minuten am Hauptbahnhof Köln.<br />
Das Geschäftsviertel der Stadt liegt direkt vor der Tür<br />
und das Kölner Messezentrum ist nur 2 km entfernt.<br />
Die IceBAR ist ein beliebter Treffpunkt für Gäste und Einheimische, mit einer<br />
Theke aus echtem Eis als besondere Attraktion. Genießen Sie einen Cocktail,<br />
ein gutes Kölsch oder wählen Sie aus einer der reichhaltigsten Vodka-Kollektionen<br />
in ganz Köln.<br />
Auf 446 qm erstreckt sich der lichtdurchflutete und klimatisierte Saal Jupiter<br />
im Erdgeschoss des Hotels.
UNDER<br />
CONSTRUCTION<br />
Unser Platin-Sponsor<br />
UNDER CONSTRUCTION:<br />
WIR BAUEN ZUKUNFT<br />
In Sandersdorf-Brehna entsteht bis Ende 2020 die PM3, die dritte Papiermaschine von<br />
Progroup. Mit einer weiteren state-of-the-art Papierfabrik schaffen wir hochmoderne<br />
Arbeitsplätze und stellen, gemeinsam mit unseren zwei weiteren Papierfabriken in Burg<br />
und Eisenhüttenstadt, in einem spezialisierten „Mill System“ den Großteil des Wellpappenrohpapierbedarfs<br />
für unsere derzeit zehn Wellpappformatwerke her. Und das ist nur eines<br />
unserer Wachstums- und Integrationsprojekte. Konsequent investieren wir in die neuesten<br />
Hightech-Verfahren und entwickeln uns permanent weiter. Dadurch erzielen wir profitables<br />
Wachstum – für uns und unsere Kunden.<br />
Progroup ist „under construction“. Bauen Sie mit und machen Sie unseren Erfolg zu Ihrem!<br />
Wir bieten Karrierechancen in allen Unternehmensbereichen und informieren Sie gerne<br />
über die vielfältigen Möglichkeiten, Ihre Zukunft mit uns zu planen.<br />
Alle aktuellen Stellenangebote finden Sie unter WWW.PROGROUP.AG/KARRIERE.<br />
Progroup. Konsequent erfolgreich.<br />
Progroup AG<br />
Horstring 12, 76829 Landau, Deutschland<br />
Tel. +49 (0) 6341/5576-0<br />
info@progroup.ag, www.progroup.ag
Statements zum Symposium<br />
von Diskussionsleitern und ...<br />
»<br />
»<br />
Prof. Dr.<br />
Stephan Kleemann<br />
Hochschule München<br />
Fakultät 05 – Papier und<br />
Verpackung<br />
Ich freue mich auf die 4. gemeinsame Jahres -<br />
tagung der Alumnivereine aus München,<br />
Dresden und <strong>Darmstadt</strong> in Köln, da sie eine<br />
hervorragende Möglichkeit bietet, viele meiner<br />
ehemaligen Studierenden der letzten 30 Jahre<br />
und andere interessante Personen aus unserer<br />
Industrie in entspannter Atmosphäre wieder -<br />
zusehen.<br />
Prof. Dr.<br />
Samuel Schabel<br />
»<br />
Technische Universität<br />
<strong>Darmstadt</strong><br />
Fachgebiet Papierfabrikation und<br />
Mechanische Verfahrenstechnik<br />
(PMV)<br />
Digitalisierung ist ein äußerst spannendes<br />
Thema. Für die meisten von uns ist es noch<br />
kaum einschätzbar, welche Veränderungen im<br />
beruflichen und privaten Umfeld auf uns zu<br />
kommen. Automatisierung, Vernetzung von<br />
Geschäftspartnern, Sensoren in technischen<br />
Systemen sind ja schon lange Themen in der<br />
Papierbranche; Veränderungen in Arbeitsweisen,<br />
Managementmethoden, Anforderungen an<br />
Fach- und Führungskräfte eher weniger.<br />
Auf dem Symposium der Papieringenieure<br />
werden spannende Impulse aus ganz verschiedenen<br />
Blickrichtungen geboten. Die perfekte<br />
Orientierung!<br />
Prof. Dr.<br />
Frank Miletzky<br />
Technische Universität Dresden<br />
Institut für Naturstofftechnik<br />
Professur für Holztechnik und<br />
Faserwerkstofftechnik<br />
Honorarprofessor<br />
Technischer Vorstand und<br />
Sprecher des Vorstandes der PTS<br />
Die Digitalisierung ist dabei, unser Leben in<br />
vielen, wenn nicht gar in allen Bereichen signi -<br />
fikant zu verändern. Ob es sich dabei verbessern<br />
wird, hängt von den Umständen und Rahmenbedingungen<br />
und klugen Akteuren ab. Wir<br />
haben die Chance unsere Arbeitswelt sinn -<br />
stiftend zu verändern und neue, moderne<br />
Tätigkeitsfelder zu entwickeln.<br />
Wir haben aber auch die Chance, einfach Jobs<br />
wegzurationalisieren. Diese Sorge von<br />
Menschen müssen wir ernst nehmen und<br />
gültige Antworten darauf finden. Ob ich meinen<br />
digitalen Zwilling werde leiden können, hängt<br />
auch davon ab, ob er mich mag.
Unser Platin-Sponsor
»<br />
Statements<br />
... von Studenten<br />
Kilian Baumgartner<br />
Hochschule München<br />
Fakultät 05 – Papier und<br />
Verpackung<br />
Das Symposium der Papieringenieure ist<br />
zweifellos eines der Highlights jedes Jahr. Die<br />
Kombination aus Fachvorträgen, die die Viel -<br />
seitigkeit unserer Industrie verdeutlichen und<br />
der freundschaftlichen, fast familiären Atmosphäre,<br />
ist einmalig. Persönlich freue ich mich<br />
dieses Jahr auf einen intensiven Austausch<br />
unter den Studenten der verschiedenen Uni -<br />
versitäten/Hochschulen.<br />
»<br />
Niklas Schäfer<br />
Technische Universität<br />
<strong>Darmstadt</strong><br />
Fachgebiet Papierfabrikation und<br />
Mechanische Verfahrenstechnik<br />
(PMV)<br />
Das Studium Paper Science & Technology<br />
bedeutet nicht nur im Hörsaal zu sitzen,<br />
sondern die Papierindustrie schon während des<br />
Studiums kennenzulernen. Neben Exkursionen<br />
oder der Zellcheming-Expo bietet das Symposium<br />
eine sehr gute Möglichkeit, Kontakte zu<br />
knüpfen und durch die Vorträge neue Eindrücke<br />
über das Thema Digitalisierung zu erhalten und<br />
zu erfahren, an welchen Themenfeldern in<br />
Dresden und München geforscht wird.<br />
Auch das Mentoren-Programm kann ich nur<br />
weiterempfehlen, denn es bietet sowohl den<br />
„jungen Füchsen“ als auch den „alten Hasen“<br />
die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu<br />
kommen und erleichtert uns Studierenden erste<br />
Kontakte zu knüpfen.<br />
»<br />
Ruben Pohlent<br />
Technische Universität<br />
Dresden<br />
HFT<br />
»<br />
Als Student freue ich mich auf das Symposium<br />
der Papieringenieure in Köln. Hier trifft man auf<br />
alte Bekannte und kann neue Bekanntschaften<br />
schließen.<br />
Es macht Spaß, in der freundlichen Atmosphäre<br />
zu netzwerken und Neues aus der Industrie und<br />
der Wissenschaft zu erfahren.<br />
Besonders gespannt bin ich auf Lösungsansätze<br />
bezüglich der Digitalisierung der Papierindustrie.<br />
Philipp<br />
Schimmelpfennig<br />
Technische Universität<br />
<strong>Darmstadt</strong><br />
Fachgebiet Papierfabrikation und<br />
Mechanische Verfahrenstechnik<br />
(PMV)<br />
Dies wird mein erstes Symposium sein, an dem<br />
ich teilnehme. Aus den Erzählungen der anderen<br />
Studenten weiß ich, dass zwei interessante Tage<br />
auf mich zukommen werden. Ich freue mich<br />
darauf, noch mehr über die Papierindustrie zu<br />
erfahren und dabei neue Kontakte zu knüpfen.
Unser Platin-Sponsor
KLARTEXT.<br />
DIGITALISIERUNG.<br />
Standortbestimmung –<br />
Chancen und Risiken für die Papierindustrie<br />
Liebe Teilnehmer der VPM/APV-Tagung und des<br />
Symposium für Papieringenieure <strong>2018</strong> in Köln,<br />
bei unserer Veranstaltung 2017 in <strong>Darmstadt</strong> fand die<br />
Key Note Speech zu Auswirkungen der Digitalisierung<br />
große Beachtung. Unter dem Motto „Klartext. Digitalisierung.“<br />
wollen wir deshalb in diesem Jahr mit einer Standortbestimmung<br />
in acht Beiträgen und auch wieder einer<br />
Key Note Speech die Chancen und Risiken der<br />
Digitalisierung für die Papierindustrie beleuchten.<br />
Die Vorträge werden sich in drei Blöcken mit den<br />
Veränderungen für Märkte/Maschinen(Technologie)/<br />
Menschen beschäftigen. Diese Veränderungen sind<br />
schon längst im Gange, wie man an der Entwicklung der<br />
Papierindustrie der letzten zwei Jahrzehnte ablesen kann.<br />
Umso nötiger scheint es, den Blick weg vom Tages -<br />
geschäft auf die Treiber dieser Entwicklung zu richten,<br />
zu untersuchen, inwieweit unsere Industrie sich der<br />
Entwicklung angepasst hat (sie sich zu eigen gemacht<br />
hat?) und zu erkennen, ob wir für die kommenden Jahre<br />
(schon) richtig aufgestellt sind.<br />
Diese Vortragsreihe weicht erheblich von den Themen<br />
der vorangegangenen Jahre ab. Neben Beiträgen aus<br />
unserer Branche erhielten wir viele Vortragsangebote aus<br />
Randgebieten und außerhalb unserer Industrie. Besonders<br />
zum Block „Märkte“ bekamen wir genug Angebote,<br />
um einen eigenen Tag auszufüllen.<br />
Mit der getroffenen Auswahl und der Key Note Speech<br />
hoffen wir ein interessantes Angebot zusammengestellt<br />
zu haben und Ihnen ein nutzbringendes Symposium der<br />
Papieringenieure bieten zu können.<br />
In jedem Fall mochten wir uns bei allen bedanken, die<br />
mit ihrem Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung<br />
beitragen wollen, auch bei denen, die in der Vortrags -<br />
auswahl nicht berücksichtigt werden konnten.<br />
Allen Teilnehmern wünschen wir einen guten Aufenthalt<br />
in Köln, interessante Gespräche und ein frohes Wiedersehen<br />
mit Ihren Freunden und Geschäftspartnern,<br />
mit Gunst von wegen’s Handwerk<br />
Roland Pelzer<br />
Leiter Vortragsprogramm<br />
Dr. Roland Pelzer<br />
Studium der Chemie und Papierchemie an der<br />
TU <strong>Darmstadt</strong>.<br />
Positionen in Anwendungstechnik, Verkauf und<br />
Marketing für Papierchemikalien für Coating &<br />
Wet End bei verschiedenen Anbietern von chemischen<br />
Additiven zur Papierherstellung, aktuell bei<br />
Dow Coating Materials.<br />
Mitwirkung in verschiedenen technischen Fachgruppen,<br />
im Vorstand des Vereins ZELLCHEMING<br />
und im Vorsitz des Cellulose-Chemiker-Clubs<br />
<strong>Darmstadt</strong> CCCD.<br />
Privat ein begeisterter Radfahrer, Jazzfan und<br />
mehrfacher Großvater mit Neigung zum Neben -<br />
erwerbs-Obstbauer.
Unser Platin-Sponsor<br />
Improving lives,<br />
every day<br />
Join us<br />
and do<br />
work that<br />
matters.<br />
Learn more and apply<br />
at essity.com/careers
Die Papierindustrie<br />
in Nordrhein-Westfalen<br />
Mit Abgeordneten des nordrhein-westfälischen Landtages hat sich der<br />
Vorstand des Wirtschaftsverbandes der rheinisch-westfälischen papier -<br />
erzeugenden Industrie im Juli <strong>2018</strong> bei der Firma Gebr. Grünewald getroffen,<br />
um für die politischen Belange der Branche zu werben.<br />
Im Bild: Martin Krengel (links) WEPA, Vorsitzender des Vorstandes des<br />
Wirtschaftsverbandes, Matthias Simon (2.v.l.), KANZAN Spezialpapiere,<br />
Bernd Scholbrock (3.v.l.), Schoellershammer, Henning Rehbaum (6.v.l.),<br />
wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Patricia Peill<br />
(8.v.l.), CDU-MdL und Dr. Christopher Grünewald (4.v.r.), Gebr. Grünewald<br />
Martin Krengel<br />
Vorstandsvorsitzender der WEPA Industrieholding SE<br />
Martin Krengel, geb. 03.02.1957, trat nach dem<br />
Abschluss des Jura-Studiums im Jahr 1985 in das<br />
elterliche Familienunternehmen ein.<br />
1990 wurde er Geschäftsführer und im Jahr 2001<br />
übernahm er den Vorsitz der Geschäftsführung.<br />
Martin Krengel ist Vorsitzender des Wirtschafts -<br />
verbandes Nordrhein-Westfalen, Mitglied des<br />
Vorstandes des Verbands deutscher Papierfabriken<br />
(VDP), Vorsitzender des Arbeit geberverbandes der<br />
rheinisch-westfälischen Papierindustrie sowie Vorsitzender<br />
der Vereinigung der Arbeitgeberverbände<br />
der Deutschen Papierindustrie e. V. (VAP )<br />
WEPA beschäftigt in 12 Werken in Europa ca. 3.800<br />
Mitarbeiter, hat eine Jahreskapazität von rund<br />
800.000 t Hygienepapieren und erwirtschaftet<br />
europaweit einen Umsatz von rund 1,2 Mrd. Euro.<br />
Das Familienunternehmen ist der drittgrößte<br />
Hersteller von Hygienepapieren in Europa mit<br />
einem Marktanteil von ca. 8 %.<br />
Das Industrieland Nordrhein-Westfalen ist mit einer<br />
Produktion von etwa 4,01 Millionen Tonnen Papier, Karton<br />
und Pappe einer der wichtigsten Standorte der deutschen<br />
Papierindustrie. Über 7.000 Menschen in rund 30<br />
Betrieben produzieren hier Papier, Karton und Pappe für<br />
Industrie, Handel, Verwaltung und privaten Konsum.<br />
Kleine und mittlere, oft familiengeführte Unternehmen<br />
gehören dabei ebenso zum Branchenmix wie große<br />
Standorte internationaler Konzerne; alteingesessene<br />
Traditionsunternehmen ebenso wie erst vor wenigen<br />
Jahren angesiedelte Fabriken. Die nordrhein-westfälischen<br />
Papierhersteller erwirtschaften einen Umsatz von<br />
2,3 Mrd. Euro.<br />
Der Wirtschaftsverband der rheinisch-westfälischen<br />
papiererzeugenden Industrie e.V. ist die wirtschafts -<br />
politische Interessenvertretung der papiererzeugenden<br />
Industrie in Nordrhein-Westfalen. Zweck der Verbandstätigkeit<br />
ist die Wahrnehmung und Förderung der<br />
gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder<br />
mit dem Ziel des Erhalts und der Fortentwicklung<br />
einer möglichst leistungsfähigen Papierindustrie.<br />
Der Verband bündelt dabei die unterschiedlichen<br />
Interessen der Mitgliedsunternehmen in drei Themenbereichen<br />
• Wirtschaft<br />
• Rohstoffe<br />
• Umwelt / Energie / Wasser<br />
um diese z.B. bei Gesetzgebungsvorhaben gegenüber<br />
Regierung und Opposition im Landtag sowie den<br />
Behörden auf unterschiedlichen Ebenen einzubringen.<br />
Die enge Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeberverband<br />
der rheinisch-westfälischen papiererzeugenden Industrie<br />
und der Landesvertretung des BDI in Nordrhein-<br />
Westfalen (unternehmer nrw) ermöglicht zudem eine
Unser Gold-Sponsor<br />
ERFOLG IM TEAM<br />
Die gleichzeitig werte- und erfolgsorientierte Kultur des<br />
Familienunternehmens WEPA ist Grundlage unserer nachhaltigen<br />
Personalpolitik. Wir fühlen uns verantwortlich für<br />
unsere Beschäftigten und fördern ihre Leistungsbereitschaft<br />
und -fähigkeit in einem attraktiven Arbeitsumfeld. Denn<br />
Qualifikation und Motivation des gesamten Teams sind<br />
Basis für unseren gemeinsamen Erfolg in Europa.<br />
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH<br />
www.wepa.de<br />
gebündelte und schlagkräftige Vertretung der Interessen<br />
der nordrhein-westfälischen Papierindustrie in Politik<br />
und Öffentlichkeit. Der Verband wirkt hierzu in zahl -<br />
reichen Fachausschüssen von unternehmer nrw mit –<br />
etwa in den Bereichen Klima-, Wasser- und allgemeiner<br />
Umweltschutz.<br />
Weiterhin ist der Wirtschaftsverband auch in verschiedenen<br />
Ausschüssen und Arbeitskreisen des Verbandes<br />
Deutscher Papierfabriken e.V. (VDP) vertreten, um einen<br />
Informationstransfer bei landespolitischen Bezügen zu<br />
gewährleisten.<br />
RA Martin Drews war nach seinem Studium der<br />
Rechtswissenschaften mit Schwerpunkten u.a. im<br />
Bereich Umweltrecht sowie einem Referendariat<br />
am Landgericht Bonn zunächst als Anwalt tätig.<br />
Seit Januar 2015 ist Herr RA Drews Geschäftsführer<br />
des Wirtschaftsverbandes der rheinisch-west -<br />
fälischen papiererzeugenden Industrie e. V. Im<br />
Rahmen dieser Geschäftsführung hat er die Interessensvertretung<br />
der Mitglieder in NRW durch<br />
Informationen sowie einen Austausch zwischen<br />
den Mitgliedsfirmen und Entscheidungs trägern<br />
aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft intensiviert.<br />
Neben seiner Tätigkeit für den Wirtschaftsverband<br />
NRW ist RA Drews<br />
auch Justiziar des Verbandes Deutscher<br />
Papierfabriken (VDP) und für den<br />
gesamten Rohstoffbereich im VDP<br />
verant wortlich.<br />
Martin Drews
Wird die digitale Transformation<br />
zur Erfolgsgeschichte für Deutschland?<br />
Die Digitalisierung unserer Wertschöpfungsprozesse<br />
und Arbeitsabläufe sowie die Auswirkungen der Digitalisierung<br />
auf unser gesellschaftliches Miteinander sind<br />
seit Jahren ein wichtiges Thema. Bis 2025 kann Europa<br />
durch eine vernetzte, effizientere Wirtschaft und neue<br />
Geschäftsmodelle einen Zuwachs von 1,25 Billionen Euro<br />
an industrieller Bruttowertschöpfung erzielen. Die Digi -<br />
tali sierung ermöglicht der deutschen Industrie, die eigene<br />
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und auszubauen.<br />
Deutschland hat beste Voraussetzungen, diese Potenziale<br />
zu heben. Unser Industrieanteil am Bruttoinlandsprodukt<br />
liegt mit fast 26 Prozent auf einem hohem Niveau. In<br />
den USA sind es zum Beispiel nur etwa 16 Prozent.<br />
In vielen High-Tech-Branchen sind Unternehmen mit<br />
Sitz in Deutschland weltweit führend, zum Beispiel im<br />
Maschinen- und Anlagenbau, im Automobilbau oder in<br />
der Chemie-, Pharma-, Elektro-, Luft- und Raumfahrt-<br />
Industrie. Wenn es gelingt, das Industrie-Know-how mit<br />
den Möglichkeiten der Digitalisierung zu kombinieren,<br />
kann sich die deutsche Industrie enorme Wettbewerbsvorteile<br />
verschaffen.<br />
Die gute Ausgangsposition darf aber kein Ruhekissen<br />
sein. Auf dem Weg hin zur vierten industriellen Revolution<br />
warten zahlreiche Herausforderungen auf uns. Die<br />
Digitalisierung konfrontiert Industrie und Gesellschaft<br />
mit einem Strukturwandel.<br />
Es ist wichtig, dass die Politik diesen Strukturwandel<br />
konstruktiv begleitet. Die Politik kann zwar keine<br />
digitalen Weltmarktführer erschaffen, aber den digitalen<br />
Wandel trotzdem aktiv gestalten, indem sie geeignete<br />
Rahmenbedingungen schafft. Von besonderer Bedeutung<br />
sind dabei eine Stärkung des Forschungsstandorts<br />
Deutschland, die Entwicklung Europas zu einem<br />
führenden Standort für Künstliche Intelligenz sowie<br />
eine innovationsfreundliche Datenpolitik.<br />
Die Politik muss durch entsprechende Rahmenbedingungen<br />
dafür Sorge tragen, dass sich digitale Innovationen<br />
frei entfalten können. Nur dann kann die digitale<br />
Transformation zur erhofften Erfolgs geschichte für<br />
Deutschland werden.
Unser Gold-Sponsor<br />
HAMMER<br />
HART<br />
VERPACKT!<br />
MIT WELLPAPPENROHPAPIEREN<br />
VON SCHOELLERSHAMMER<br />
www.schoellershammer.de<br />
Dr. Thomas Koenen<br />
Leiter der Abteilung Digitalisierung und Innovation<br />
Bundesverband der Deutschen Industrie – BDI<br />
Herr Dr. Koenen leitet seit Juni 2017 im BDI die<br />
Abteilung Digitalisierung und Innovation. In dieser<br />
Funktion verantwortet er für den BDI als Spitzenverband<br />
der Deutschen Industrie insbesondere die<br />
Bereiche Cybersecurity, Künstliche Intelligenz/<br />
Autonome Systeme, Datenökonomie, IT-Infrastruktur,<br />
Gesellschaftliche Akzeptanz von Digitalisierung<br />
sowie den Bereich der Forschungs- und Innovations -<br />
politik. In Personalunion zu seiner Tätigkeit im BDI<br />
ist Herr Dr. Koenen seit 2011 geschäftsführendes<br />
Vorstandsmitglied von econsense – Forum Nachhaltige<br />
Entwicklung der Deutschen Wirtschaft e.V.<br />
Er ist Volljurist und begann seine berufliche<br />
Laufbahn bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht<br />
mit Schwerpunkt illegale Bank -<br />
geschäfte im Internet. Es folgten Tätigkeiten für<br />
die Industrieinitiative für Umweltschutz e.V., für<br />
econsense – Forum Nachhaltige Entwicklung der<br />
Deutschen Wirtschaft e.V., als Leiter der Abteilung<br />
Klima und Nachhaltige Entwicklung im Bundes -<br />
verband der Deutschen Industrie (BDI) sowie als<br />
Stabsstellenleiter des BDI. Herr Dr. Koenen ist<br />
verheiratet, hat eine Tochter und lebt in Berlin.
Digitally Prepared?<br />
Prioritäten und Optimierungspotenziale in der<br />
Wertschöpfungskette durch Digitalisierung und Industrie 4.0<br />
Ziel der aktuell durchgeführten Studie war es, die<br />
Entwicklungen seit 2015 in Bezug auf Bekanntheit,<br />
Priorität, Veränderungsbereitschaft, Umsetzungs -<br />
niveau, Treiber und Barrieren in Zellstoff, Papier und<br />
Verpackung sowie im Vergleich zu anderen Branchen<br />
zu erfassen.<br />
Basis dieser Studie war eine von StepChange Consulting<br />
aktualisierte Umfrage, die erstmals im Jahr 2015 zum<br />
Thema Industrie 4.0/Digitalisierung durchgeführt<br />
wurde. Befragt wurden erneut Manager, Entscheider und<br />
Stakeholder aus der europäischen Zellstoff-, Papier- und<br />
Verpackungsindustrie, um die Prioritäten der Unternehmen<br />
im Hinblick auf Industrie 4.0/Digitalisierung und<br />
deren Entwicklung seit 2015 aufzuzeigen.<br />
Zusätzlich wurden Optimierungspotenziale, die sich<br />
durch Digitalisierung und Industrie 4.0 in der Wertschöpfungskette<br />
für die Marktteilnehmer zukünftig<br />
eröffnen, abgeschätzt. Die durch Digitalisierungsprojekte<br />
zu erschließenden Verbesserungspotenziale werden<br />
alleine für Europa auf rund 5 Milliarden Euro bei Lagerbeständen<br />
und 10 Milliarden Euro bei Kosteneinsparungen<br />
geschätzt.<br />
Darüber hinaus wurde der derzeitige Status von Digitalisierungsbestrebungen<br />
in Unternehmen, sowie die damit<br />
verbundenen, erwarteten Vorteile und etwaige Herausforderungen,<br />
untersucht. Für das Symposium der<br />
Papieringenieure <strong>2018</strong> wurden die Ergebnisse der westeuropäischen<br />
Teilnehmer den weltweiten Ergebnissen<br />
gegenübergestellt.<br />
Das Studienergebnis zeigt, dass das Thema von über<br />
50% der westeuropäischen Teilnehmer nicht als „game<br />
changer“ wahrgenommen wird, obwohl das Bewusstsein<br />
für Industrie 4.0/Digitalisierung seit 2015 signifikant<br />
angestiegen ist. Folglich findet es sich nicht unter den<br />
Top-Prioritäten der Befragten, sondern erst an neunter<br />
Stelle der Rangliste. Die Teilnehmer der Studie erwarten<br />
dennoch einen positiven Effekt von Industrie 4.0/<br />
Digitalisierung bei Kostenreduktion, der Entwicklung<br />
neuer Geschäftsmodelle und der Verbesserung der<br />
Energieeffizienz.<br />
Die Studie zeigt weiter, dass nur 24% der Teilnehmer<br />
eine klare Digitalisierungsstrategie definiert hat. Firmen,<br />
die bereits Erfahrungen im Bereich Industrie 4.0/<br />
Digitalisierung gesammelt haben, haben diese eher<br />
durch einzelne, isolierte Projekte gewonnen. Knapp ein<br />
Drittel der Teilnehmer befindet sich entweder in der<br />
Planungsphase, oder ist bereits in der Umsetzung.
IT Budgets sind ein wichtiger Indikator für die Investitionsbereitschaft<br />
der Unternehmen in Digitalisierung/<br />
Industrie 4.0. 47% der westeuropäischen Teilnehmer<br />
geben an, dass ihr IT Budget im Vergleich zum Vorjahr<br />
unverändert geblieben oder gesunken ist, während die<br />
IT Budgets von 65% aller Studienteilnehmer der übrigen<br />
Teilnehmer erhöht wurden. Dies könnte ein Zukunfts -<br />
risiko für westeuropäische Unternehmen darstellen,<br />
beim Thema Digitalisierung zurückzufallen.<br />
Industrie 4.0/Digitalisierung kann ein wichtiges Werkzeug<br />
für Unternehmen innerhalb der sehr verflochtenen<br />
Faserwertschöpfungskette sein, weitere Wertpotenziale<br />
zu realisieren. Industrie 4.0/Digitalisierung kann in<br />
Echtzeit Interconnectivity und Transparenz herstellen –<br />
zwei grundlegende Voraussetzungen für das Realisieren<br />
der Effizienzpotenziale. Der potenzielle Nutzen ist<br />
erheblich: Eine höhere Auslastung der Anlagen, ein<br />
besserer Service, eine höhere Effektivität bei niedrigeren<br />
Kosten und einem reduzierten Risiko und bei gleich -<br />
zeitig niedrigerem Working Capital.<br />
Um diese vielschichtigen Wertpotenziale zu analysieren<br />
und zu bewerten, stellt StepChange Consulting eine<br />
Methodik vor, die den optimalen Grad der Digitalisierung<br />
je Wertschöpfungsfunktion identifiziert.<br />
Alexander Wirth<br />
Alexander Wirth ist Absolvent der Betriebswirtschaftslehre<br />
der Johannes Kepler Universität Linz<br />
mit 11 Jahren Erfahrung in der Managementberatung.<br />
Bevor Alexander Wirth 2009 ein Teil des Step-<br />
Change Teams wurde, arbeitete er für eine<br />
führende, global tätige Management- und Technologieberatung.<br />
Er verfügt über umfangreiche Branchenerfahrung<br />
und Beratungskompetenz in weiten Bereichen<br />
der Papier-, Verpackungs- und Zellstoffindustrie,<br />
mit besonderem Fokus auf die Themen Supply-<br />
Chain-Management, Working Capital Reduktion,<br />
Produktivitätsverbesserungen, Geschäftsprozessoptimierung<br />
und Projektmanagement.<br />
Unser Gold-Sponsor<br />
KANZAN Spezialpapiere –<br />
6 Richtige zum Glück …<br />
•weil wir der europäische Spezialist für Thermo- und andere Spezialpapiere sind<br />
•und Mitglied der Oji Group sind, dem japanischen Global Player in der Papierindustrie<br />
•weil uns technologische Innovationskraft antreibt<br />
•und unsere Produkte von hoher Qualität sind<br />
•weil wir mit unserem anspruchsvollen Kundenservice punkten<br />
•und wir ein starkes Team mit engagierten Menschen sind.<br />
KANZAN Spezialpapiere GmbH | Nippesstraße 5 | 52349 Düren | Tel. +49 (0) 2421 5924-0 | info@kanzan.de | www.kanzan.de
Für erfolgreiche Unternehmen<br />
steht zwischen analog und digital kein „oder“!<br />
Wie aktuelle Umfragen und professionelle A/B-Tests<br />
aufzeigen, sind Werbebeilagen auch heute noch das<br />
geeignetste Medium, um Informationen zu Ange -<br />
boten und Produkten erfolgreich beim Konsumenten<br />
zu platzieren.<br />
Selbst vom Grundsatz reine Online Player wie Zalando<br />
oder Amazon nutzen intensiv die Macht des Gedruckten,<br />
um mit Ihren Kunden zu kommunizieren. Nicht nur<br />
weil es schön aussieht, sondern weil es wirtschaftlich<br />
erfolgreich ist. Digitale Newsletter, das Internet oder<br />
mobile Lösungen erreichen bei der Zielgruppe – egal<br />
welcher Altersklasse! – nicht die gleiche Glaubwürdigkeit<br />
wie papierbasierte Werbung/Information.<br />
Wir müssen jedoch zur Kenntnis nehmen, dass die Art<br />
und Weise, wie wir Papier heute (noch) nutzen, auch<br />
Nachteile gegenüber der digitalen Welt hat.<br />
Daher benötigen wir verstärkt<br />
π Datenbasierte und individuelle Werbung für Interessierte<br />
und nicht die ungesteuerte Überflutung<br />
des Postkastens mit Werbebeilagen<br />
π<br />
π<br />
Möglichkeiten, das Papier zur Interaktion mit digitalen<br />
Prozessen zu befähigen, um Schnittstellen<br />
abzubauen<br />
Neue Oberflächen für Werbung in der Dienstleistungsökonomie,<br />
da andere Werbeträger (Fernsehen,<br />
Zeitungen) an Werbewirksamkeit verlieren<br />
Seit 2017 ist die Rising Generation – die private Venture-<br />
Capital Gesellschaft der LEIPA Gesellschafter – an<br />
Adnymics beteiligt. Gemeinsam mit der LEIPA wird den<br />
Kunden ein zeitgemäßer und nachweislich erfolgreicher<br />
Weg aufgezeigt, klassischen Versandverpackungen einen<br />
spürbaren Mehrwert zu geben. Aus Sicht eines Papierherstellers<br />
bietet dieses Kooperationsmodell neben den<br />
rein vertrieblichen Aspekten die Möglichkeit, den eigenen<br />
Mitarbeitern die modernen Vorgehensweisen und Tools<br />
eines Startups näher zu bringen und vom Know-how-<br />
Transfer zu profitieren.<br />
Für das Startup öffnen sich neue Möglichkeiten und<br />
Türen in der Kundenansprache, die ohne die Kontakte<br />
und das Renommee eines gestandenen Familienunternehmens<br />
eventuell verschlossen geblieben wären.
Unser Gold-Sponsor<br />
„ICH MACHE ZUKUNFT:<br />
MIT PAPIER UND PLAN.“<br />
Werden auch Sie Teil des LEIPA Teams.<br />
Sabine H.<br />
Leiterin Entwicklung<br />
LEIPA Schwedt<br />
www.leipa.com<br />
Robin Huesmann<br />
Als CIO der LEIPA Group GmbH und Geschäftsführer<br />
des VC risinggeneration.com beschäftigt sich Robin<br />
Huesmann mit der Überschneidung von analogen<br />
Prozessen/Gütern und Rechenleistung, IoT sowie<br />
digitalen Druckverfahren. Ziel ist es, das Familien -<br />
unternehmen weiterzuentwickeln und gemeinsam mit<br />
Partnern neue Geschäftsmodelle voranzutreiben.<br />
Dominik Romer<br />
Durch das Studium der Druck- und Medientechnik und<br />
als Leiter einer Werbeagentur konnte Dominik Romer<br />
Erfahrungen mit der effektiven Verbindung von<br />
On- und Offlinewerbemitteln sammeln. 2014 gründete<br />
Dominik Romer die adnymics GmbH in München und<br />
vertiefte damit die Spezialisierung in Richtung Datadriven-Printmarketing.
Digitalisierung mit Start-Up-Methoden<br />
Wie die Felix Schoeller Group<br />
neue digitale Geschäftsmodelle entdeckt und entwickelt<br />
Die Felix Schoeller Group mit Sitz in Osnabrück ist ein<br />
weltweit tätiges Familienunternehmen, das 1895 gegründet<br />
wurde und Spezialpapiere entwickelt, produziert und<br />
vermarktet. Unser Portfolio umfasst Produkte für fotografische<br />
Anwendungen, für Digitaldrucksysteme, für<br />
den Verpackungsmarkt, für selbstklebende Anwendungen<br />
sowie für die Möbel- und Holzwerkstoff- als auch die<br />
Tapetenindustrie.<br />
Durch den Einsatz von Post-its kann das Team im Innovationsprozess Fragen<br />
und Ideen einfach festhalten, sich in der Gruppe dazu austauschen und<br />
flexibel Cluster bilden.<br />
Innovation und Antworten auf komplexe Fragestellungen entstehen am<br />
besten in einem multidisziplinär zusammengesetzten Team, in dem unterschiedliche<br />
fachliche Hintergründe und Funktionen vertreten sind und die<br />
Teammitglieder Neugier und Offenheit für andere Perspektiven mitbringen.<br />
Digitalisierung ist für uns kein Selbstzweck, sondern soll<br />
unseren Kunden klare Mehrwerte liefern, uns von Wettbewerbern<br />
absetzen und die Geschäftsbeziehung langfristig<br />
stärken.<br />
Daher hat sich die Felix Schoeller Group entschieden, ein<br />
Team aufzubauen, das sich voll darauf konzentriert, neue<br />
digitale Geschäftsmodelle zu entdecken und aufzubauen.<br />
Im Vortrag erläutern wir anhand eines konkreten Projektes,<br />
wie die Digital Unit der Felix Schoeller Group vorgeht,<br />
um Ideen für digitale Geschäftsmodelle zu<br />
generieren, wie diese Ideen weiter ausgearbeitet und validiert<br />
werden und schließlich zu konkreten Business-Modellen<br />
reifen.<br />
Hierbei nutzen wir Methoden wie Design Thinking,<br />
Lean Start-Up und Agile Development, wie sie Start-Ups<br />
erfolgreich anwenden, um in kurzer Zeit mit begrenzten<br />
Mitteln digitale Lösungen zu entwickeln, die Investoren<br />
überzeugen, die Idee weiter zu unterstützen.
Anett Hötzel<br />
Während des internen „Digital Day“ wurden den Mitarbeitern die verschie -<br />
denen Phasen des Innovationsprojektes, die dabei eingesetzten Methoden<br />
und die erzielten Ergebnisse vorgestellt. Zudem konnten sie die Prototypen<br />
selbst ausprobieren, Fragen stellen und Feedback geben.<br />
Nach dem Studium der Angewandten Medien -<br />
wissenschaften an der Technischen Universität<br />
Ilmenau war Anett Hötzel zunächst drei Jahre in<br />
den Niederlanden als Consultant tätig, wo sie B2B-<br />
Unternehmen bei Internationalisierungsprojekten<br />
unterstützte.<br />
Zurück in Deutschland übernahm sie 2008 die<br />
Leitung des SEA-Teams bei Neo@Ogilvy und verantwortete<br />
Accounts wie IBM, Cisco und Intel.<br />
2010 wechselte sie zur Fuchs Gruppe und baute<br />
den Bereich Online-Marketing und E-Commerce auf.<br />
Seit 2013 ist Anett Hötzel für die Felix Schoeller<br />
Group tätig. Als Head of Digitalization verantwortet<br />
sie die Leitung von Digitalisierungsprojekten.<br />
Die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle<br />
bildet den Schwerpunkt ihrer Arbeit.<br />
Unser Gold-Sponsor<br />
Unser Trainingszentrum SICHERWERK:<br />
ehemalige Papierfabrik<br />
rund 1.500 Quadratmeter<br />
Unser Ziel: Menschen, die<br />
gesund nach Hause kommen.<br />
Darum gehen unsere Trainings weit über<br />
die gesetzlichen Anforderungen hinaus:<br />
• Freimessen von Behältern<br />
und engen Räumen<br />
• Sicher Arbeiten mit der Gaswarntechnik<br />
• Befahren von Behältern<br />
und engen Räumen<br />
• Sicher Arbeiten an<br />
hohen Arbeitsplätzen<br />
• Sicher Arbeiten mit der persönlichen<br />
Schutzausrüstung (PSA)<br />
• Sicher Arbeiten mit<br />
Krananlagen, Hubarbeitsbühnen<br />
und Gabelstaplern<br />
Höhen und Tiefen bis 18 Meter<br />
viele realistische Trainingsstationen<br />
größtes Trainingszentrum in NRW<br />
Weil zu Hause jemand wartet.<br />
MAUEL Sicher Arbeiten • Jörg Mauel • Malteserstraße 85 • 52351 Düren • +49 (2421) 6 93 04 70 • sicher@mauel.de • www.mauel.de
Die Schattenseite der Digitalisierung:<br />
Neue Risiken für produzierende Unternehmen<br />
Neben den Vorteilen einer Digitalisierung im<br />
Rahmen einer Industrie 4.0 Strategie werden<br />
auch insbesondere im Produktionsumfeld ganz<br />
neue Fragen aufgeworfen. So entstehen durch die<br />
zunehmende Komplexität und Vernetzung bisher<br />
isolierter Systeme auch neue Risiken. Proble -<br />
matisch ist hier oftmals etwa, dass anders als im<br />
Officeumfeld Kompromisse bei der Sicherheit eingegangen<br />
werden müssen, um die Verfügbarkeit<br />
nicht zu gefährden.<br />
Da die Entwicklungs- und Austauschzyklen in<br />
einem Produktionsumfeld deutlich länger sind als<br />
in der restlichen „IT-Welt“, trifft man in diesem<br />
Umfeld sehr oft auf alte Systeme (z.B. Windows<br />
XP), für die viele Sicherheitslücken gar nicht<br />
mehr geschlossen werden. Zudem werden auch<br />
auf der Seite von Hackern und Angreifern ständig<br />
neue Geschäftsmodelle entwickelt, die sich rasant<br />
weiterentwickeln und ganz neue Bedrohungs -<br />
szenarien auch für die vernetzte Produktion<br />
bedeuten.<br />
In dem Vortrag werden neben diesen Bedrohungen<br />
auch mögliche Lösungswege aufgezeigt.<br />
Neben vielen technischen sind insbesondere auch<br />
organisatorische Maßnahmen entscheidend für<br />
ein erfolgreiches Risikomanagement im Bereich<br />
der Informationssicherheit.
Unser Gold-Sponsor<br />
Nicolas Christoph<br />
Nicolas Christoph (43) ist zweifacher Familienvater<br />
und seit ca. 12 Jahren bei der Koehler Group.<br />
Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre<br />
mit der Ausrichtung Wirtschaftsinformatik an der<br />
Otto-Friedrich-Universität Bamberg und der<br />
Universität Antwerpen, arbeitete er zunächst im<br />
Finanzbereich bei der Fahrzeugentwicklung eines<br />
großen Automobilherstellers.<br />
Seit 2005 ist Herr Christoph bei der Koehler Group<br />
und befasste sich dort zunächst als Assistent des<br />
Finanzvorstands mit verschiedenen IT Projekten.<br />
Danach wechselte er als Abteilungsleiter in die IT<br />
und betreute mit seinem Team den Betrieb der<br />
Microsoft Infrastruktur sowie die SAP Basis. 2007<br />
führte er bei Koehler ein Informationssicherheitsmanagementsystem<br />
ein, welches nach ISO 27001<br />
zertifiziert wurde und war als Leiter des IT Project<br />
Office für die Gesamtkoordination und Projekt -<br />
leitung diverser IT Projekte im Bereich Business<br />
Intelligence, SAP SD und Lagerverwaltung, MES<br />
etc. verantwortlich.<br />
Seit 2012 betreut er als Prokurist und Bereichsleiter<br />
das Business Development und Projektmanagement<br />
der Koehler Renewable Energy GmbH.<br />
Weiterhin ist er seit 2012 Datenschutz- und Informationssicherheitsbeauftragter<br />
(ISO 27001) für die<br />
Unternehmen der Koehler Group.
Die Rolle von Papier und Folien<br />
in der vernetzen Welt<br />
Papier zählt zu den bedeutenden Erfindungen der<br />
Menschheit. Papier ermöglichte es nicht nur Informationen<br />
zu speichern, sondern auch die Verteilung und<br />
Lagerung gestaltete sich wesentlich effizienter als mit<br />
damals üblichen anderen Medien, wie Steinen oder<br />
Tonwaren. Die Erfindung des Buchdrucks stellte einen<br />
weiteren Meilenstein in der Geschichte der Menschheit<br />
dar, führte er, über die Demokratisierung des Wissens,<br />
zu einer aufgeklärten Wissensgesellschaft, welche<br />
letztendlich die Industrialisierung des achtzehnten<br />
Jahr hunderts maßgeblich prägte. Heute wird Papier in<br />
seiner ursprünglichen Funktion als Speicher- und Distri -<br />
butionsmedium von Informationen zunehmend von<br />
digitalen Lösungen ersetzt und verliert an wirtschaftlicher<br />
Bedeutung.<br />
In den Arbeiten um die Prozessierung von Nanomaterialien<br />
entdeckten die Forscher der Fraunhofer Gesellschaft<br />
das Papier als Trägermaterial für elektronische Anwendungen<br />
neu. Im Umgang mit Nanomaterialen gestalten<br />
sich die Dispersion und Herstellung von homogenen<br />
Halbzeugen in der Regel als besonders schwierig. Die<br />
Zellulosefasern des Papiers sind ein nahezu ideales<br />
Hilfsmittel, da sie mit funktionalen Nanomaterialen<br />
beschichtet und in etablierten Industrieprozessen verarbeitet<br />
werden können. Auf diese Weise können in einem<br />
Rolle zu Rolle-Verfahren elektrisch leitfähige Papiere<br />
hergestellt werden, welche sich nicht nur in der Antistatik<br />
sondern auch für die elektromagnetische Abschirmung<br />
einsetzen lassen. Neben diesen „passiven“ Anwendungen<br />
kann das Papier auch als kostengünstiger Näherungs -<br />
sensor oder als Energiespeicher genutzt werden.<br />
Abbildung (Fraunhofer IPA): Carbon Nanotube modifizierte Zellulosefaser<br />
Schirmung-, Sensorik- und Energiespeichereigenschaften<br />
zählen mit zu den Schlüsselkomponenten der Digitalisierung<br />
und Lösungen aus modifizieren Papier können hier<br />
einen wichtigen Beitrag leisten.<br />
Im Rahmen des Vortrags wird die Entwicklungshistorie<br />
des modifizierten Papiers und der aktuelle Entwicklungsstand<br />
vorgestellt.<br />
Die Nutzung der Papiere in Energiespeichersystemen<br />
erlaubt eine Senkung des Ressourcenverbrauchs metallischer<br />
Elektrodenfolien und der daraus resultierenden<br />
Umweltbelastungen. Die Überprüfung der Papiere als<br />
Ersatz von metallischen Elektrodenmaterialen in unterschiedlichen<br />
Zellsystemen und die Charakterisierung der<br />
Papiere werden gezeigt. Speziell die Herstellung und<br />
Trocknung einer homogenen Beschichtung, die<br />
Beschichtungsgeschwindigkeit und die mechanische<br />
Stabilität des trockenen Aktivmaterials beeinflussen die<br />
Qualität der späteren Elektroden maßgeblich. Die Untersuchung<br />
einer produktionstechnischen Machbarkeit der<br />
Beschichtung von nanomodifizierten Papieren auf einer<br />
R2R-Anlage wird gezeigt.<br />
Anhand einer spezifischen Eigenschaft des Papiers<br />
werden verschiedene Anwendungsszenarien vorgestellt<br />
und bewertet. Zum Abschluss der Präsentation werden<br />
zwei Anwendungen, der Papier Sensor und der Papier<br />
Energiespeicher im Detail vorgestellt.
Unser Gold-Sponsor<br />
Die Papier- und Kartonfabrik Varel<br />
produziert mit modernen, umweltfreundlichen<br />
Technologien Karton und<br />
Wellpappenpapiere auf Altpapierbasis.<br />
Sie sind das Herz der Verpackungslösungen<br />
vieler bekannter Produkte.<br />
Unsere Papier- und Kartonqualitäten<br />
zeichnen sich durch hohe spezifische<br />
Festigkeiten und hervorragende Laufund<br />
Bedruckungseigenschaften aus.<br />
Das steigert die Produktivität in der<br />
Weiterverarbeitung deutlich und spart<br />
somit Kosten.<br />
Papier- u. Kartonfabrik<br />
Varel GmbH & Co. KG<br />
Dangaster Str. 38<br />
26316 Varel<br />
Telefon: 04451 / 138-0<br />
Telefax: 04451 / 81046<br />
info@pkvarel.de<br />
www.pkvarel.de<br />
Ivica Kolaric<br />
Abteilungsleiter Funktionale Materialien,<br />
Geschäftsfeldleiter Prozessindustrie<br />
Fraunhofer IPA Stuttgart<br />
Herr Kolaric arbeitet seit Oktober 2000 für die<br />
Fraunhofer Gesellschaft und leitet die Fachabteilung<br />
Funktionale Materialen und das Geschäftsfeld<br />
Prozessindustrie.<br />
Die Abteilung Funktionale Materialen befasst sich<br />
mit der Erforschung und Entwicklung neuer,<br />
materialbasierter Prozess-und Produktinnovationen,<br />
wie beispielsweise transparente und elektrisch<br />
leitfähige Beschichtungen für Anwendungen in der<br />
Unterhaltungselektronik, dehnbare Sensor-Aktorsysteme<br />
für die Mensch-Maschine Interaktion oder<br />
funktionale Beschichtungen für die Verpackungs -<br />
industrie.<br />
Im Rahmen der Forschungsarbeiten wurde auch<br />
Papier modifiziert und um elektronische Funktionen<br />
erweitert.
Die digitale Transformation bei Voith<br />
Voith feierte im letzten Jahr mit dem 150jährigen Firmen -<br />
jubiläum auch eine Geschichte der Innovationen. Voith<br />
hatte schon immer den Anspruch, Entwicklungen in der<br />
Industrie aktiv mitzugestalten und hat bereits in den vorherigen<br />
industriellen Revolutionen einige wegweisende<br />
Meilensteine der Entwicklung in den Kernmärkten<br />
gesetzt, wie zum Beispiel in der Papierherstellung.<br />
Mit dem neuen Geschäftsbereich Voith Digital Solutions<br />
hat Voith im letzten Jahr ein neues Kapitel der Unter -<br />
nehmensgeschichte aufgeschlagen, um im digitalen<br />
Geschäft zukünftig schlagkräftiger und schneller zu<br />
werden und von Synergien für neue Technologien über<br />
alle Geschäftsbereiche und Märkte hinweg zu profitieren.<br />
Die Digitalisierung der Papierindustrie hat nicht mehr<br />
nur begonnen, sie ist schon in vielen Bereichen<br />
angekommen. Moderne Analyse- und Modellierungs -<br />
verfahren, in Verbindung mit scheinbar unbegrenzter<br />
Speicher- und Rechenkapazität, nutzen die bereits<br />
vorhandenen Daten, um einen Mehrwert zu erzeugen.<br />
Ein Beispiel dafür sind Virtuelle Sensoren, die es ermöglichen<br />
vorherzusagen, was das Labor in der Zukunft<br />
messen wird.<br />
Große Datenmengen, Big Data, werden generiert. Das<br />
bedeutet die Wertschöpfung aus ständig wachsenden<br />
Datenmengen, die Zusammenführung verschiedener<br />
Datenquellen sowie die Nutzung neuartiger und kosten -<br />
günstiger Speicher- und Verarbeitungstechnologien wird<br />
nötig. Wichtige Prozessschritte in der Papier herstellung<br />
werden heute durch Sensoren und Software für Echtzeitvorhersage<br />
kontrolliert und gesteuert. Voith spricht von<br />
Papermaking 4.0 und dieser automatisierte und digitalisierte<br />
Blattbildungsprozess minimiert den Einsatz von<br />
Rohstoffen und Energie.<br />
Auch der Service partizipiert stark von den digitalen<br />
Werkzeugen. Die hohe Datentransparenz und deren<br />
jederzeitige Verfügbarkeit sind wichtige Kernelemente<br />
des Voith Servolution-Konzepts. Denn die Daten bilden<br />
zum einen die Basis für die effiziente Arbeit vor Ort,<br />
die digitale Unterstützung liefert aber auch wichtige<br />
Informationen für die vorausschauende Instandhaltung.<br />
Ebenso verändert sich die Arbeitswelt und wie gearbeitet<br />
wird. Neue Arbeitsweisen zielen konsequent auf den<br />
Kundennutzen ab. Neue Methoden wie Design Thinking<br />
in Kombination mit Scrum lassen es zu, Projekte höchst<br />
flexibel und schnell zu bearbeiten. Heterogen aufgestellte,<br />
flexible Teams bearbeiten diese Projekte, um<br />
sich nach der Finalisierung aufzulösen und sich für<br />
kommende Aufgaben wieder neu zu formieren.<br />
Einige dieser Projekte, wie zum Beispiel der Voith Paper<br />
Webshop oder merQbiz, der digitale Marktplatz für Altpapier<br />
sowie DRIVE, der digitale Führerschein, sollen in<br />
diesem Vortrag vorgestellt werden.
Nach einer Ausbildung zum Papiermacher und<br />
seinem Studium der Verfahrenstechnik und Papier -<br />
herstellung arbeitete er ab 1984 als Inbetriebnahme-<br />
Ingenieur im Sulzer-Konzern in Ravensburg. Ab 1992<br />
bekleidete er Führungspositionen im Vertrieb in Hong<br />
Kong, Bangkok und Peking. 2001 übernahm er die<br />
Leitung der Inbetriebnahme und des Projektmanagements<br />
bei Voith Paper in Heidenheim. 2005 kam Frank<br />
Opletal als Operations Manager nach Ipoh, Malaysia.<br />
Anschließend übernahm er die Leitung des Bereichs<br />
Operations für Voith Paper Fabrics in der Region<br />
Asien-Pazifik. Nach der Zusammenführung der<br />
Divisionen Fabrics und Rolls im Jahr 2009 leitete er<br />
den Aufbau eines gemeinsamen Vertriebs.<br />
Seit dem Jahr 2011 ist Frank Opletal Verantwort licher<br />
für die weltweite Forschung und Entwicklung und<br />
Mitglied der Geschäftsführung der Business Line<br />
Fabric & Roll Systems.<br />
Seit April 2014 ist er Chief Technology Officer für<br />
den gesamten Konzernbereich und Mitglied der<br />
Geschäftsführung von Voith Paper.<br />
Frank Opletal<br />
CTO Voith Paper GmbH & Co. KG<br />
Unser Gold-Sponsor<br />
VielmehralsZellstoff<br />
MercerStendal–einedermodernstenundgrößtenZellstofffabrikenEuropas. WirproduzierenLangfaserKraftzellstoff.Zudem<br />
gewinnenwirausdemRohstoffHolzBiochemikalienwieTallölundTerpentin,dieinderchemischenIndustrieanstellefossiler Rohstoffe<br />
eingesetztwerden.Undschließlich,nachumfassenderstofflicherVerwertung,generierenwirausdenrestlichenHolzbestandteilen<br />
Bioenergie.WirbetreibendamitDeutschlandsgrößtesBiomassekraftwerkaufBasisfesterBiomasse.AusdieserProzessvielfaltergeben<br />
sichanspruchvolleundabwechslungsreicheIngenieurstätigkeiten.<br />
WirmachendasBesteausdemHolz.<br />
www.mercerint.com
Core Competence Shift Happens<br />
Die Digitalisierung verändert die notwendigen Kernkompetenzen<br />
Gunter Dueck<br />
Prof. Gunter Dueck, Jahrgang 1951, lebt bei Heidelberg.<br />
Er studierte Mathematik und Betriebswirtschaft<br />
und promovierte 1977 an der Universität Bielefeld in<br />
Mathematik.<br />
Er forschte 10 Jahre mit seinem wissenschaftlichen<br />
Vater Rudolf Ahlswede zusammen, mit dem er 1990<br />
den Prize Paper Award der IEEE Information Theory<br />
Society für eine neue Theorie der Nachrichten-Identi -<br />
fikation gewann. Nach der Habilitation 1981 war er<br />
fünf Jahre Professor für Mathematik an der Universität<br />
Bielefeld und wechselte 1987 an das Wissenschaftliche<br />
Zentrum der IBM in Heidelberg. Dort gründete er eine<br />
große Arbeitsgruppe zur Lösung von industriellen<br />
Optimierungsproblemen und war maßgeblich am<br />
Aufbau des Data-Warehouse-Service-Geschäftes der<br />
IBM Deutschland beteiligt. Er arbeitete an der Strategie<br />
und der technologischen Ausrichtung der IBM mit<br />
und kümmerte sich um Cultural Change. 2009 bis<br />
2010 beteiligte er sich in führender Rolle am Aufbau<br />
eines neuen strategischen Wachstumsfeldes der IBM<br />
Corporation, das auf die wachsende Industrialisierung<br />
der ITInfrastrukturen bis hin zum so genannten Cloud<br />
Computing zielt.<br />
Bis zum August 2011 war er Chief Technology Officer<br />
(CTO) der IBM Deutschland. Seitdem hat es ihn<br />
wegen Erreichens der 60-Jahre-Marke in den Unruhestand<br />
gezogen, er ist derzeit freischaffend als Schriftsteller,<br />
Business-Angel und Speaker tätig und widmet<br />
sich weiterhin unverdrossen der Weltverbesserung.<br />
Zurzeit arbeitet er u.a. dem Ausbau des „Wiki of<br />
Music“, einer Plattform nach der Art der Wikipedia,<br />
auf der möglichst alle Musiknoten der Welt allgemein<br />
zugänglich gemacht werden sollen.<br />
Gunter Dueck war einer der IBM Distinguished Engineers<br />
und Mitglied der IBM Academy of Technology.<br />
Er war lange Jahre Mitglied der Präsidien der Gesellschaft<br />
für Informatik und der deutschen Mathema -<br />
tikervereinigung. Er ist Fellow des amerikanischen<br />
Ingenieursverbandes IEEE, Fellow der Gesellschaft<br />
für Informatik und korrespondierendes Mitglied der<br />
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen.<br />
Die Digitalisierung ist schon ziemlich alt, und doch<br />
wird sie erst seit einigen Jahren oder Monaten<br />
zunehmend als Bedrohung diskutiert. Was soll<br />
aus den Menschen werden, wenn die Roboter<br />
kommen? Was passiert mit den Fahrern, wenn die<br />
Autos alles selbst können?<br />
Wer hinter diese Furcht schaut, sieht, dass sich<br />
Arbeit, Berufe, Entwicklungsfelder und Märkte fast<br />
gleichzeitig in allen Branchen verschieben. Viele<br />
Berufe entfallen, fast alle verlieren ihren einfachen<br />
Routineanteil an „die Cloud“, alles Übrigbleibende<br />
verlangt eine höhere Qualifikation und einen<br />
professionellen Umgang mit Menschen, Projekten<br />
und Prozessen. Autos werden von Maschinenbauern<br />
entwickelt, aber Elektromotoren sind ein anderes<br />
Feld. Wer baut plötzlich Weltklassebatterien?<br />
Energieversorger müssen eine neue IT für das<br />
Ausregeln von Solar- und Windstrom aufbauen.<br />
Die Verwaltungen hängen noch sehr am FAX und<br />
Verlage stehen vor dem Problem, dass ja in eBooks<br />
auch Videos und HD-Bilder eingebunden werden<br />
können – das Papierbuch wird bald sehr dürftig<br />
dagegen ausschauen.<br />
Kurz: Die Kernkompetenzen verändern sich –<br />
das erfordert dringend und sofort neue Geschäfts -<br />
modelle und anders ausgebildete Menschen!<br />
Andererseits aber kostet es eine längere Vorlaufzeit<br />
für diese große Umstellung, die wir „Digitalisierung“<br />
nennen. Ja, warum diskutieren wir immer noch?<br />
Er publizierte satirisch-philosophische Bücher über<br />
das Leben, die Menschen und Manager:<br />
„E-Man“ (2. Aufl. 2002), „Die Beta-Inside Galaxie“ und<br />
„Wild Duck“ (4. Auflage 2006). Seine ganz eigene<br />
Philosophie erschien in drei Bänden: „Omnisophie:<br />
Über richtige, wahre und natürliche Menschen“<br />
(2. Auflage 2004), „Supramanie: Vom Pflichtmenschen<br />
zum Score-Man“ (2. Auflage 2006) und „Topothesie:<br />
Der Mensch in artgerechter Haltung“ (2. Auflage<br />
2011). Der SpringerVerlag publiziert seine Werke unter<br />
der eigenen Rubrik „Dueck’s World“.<br />
Blutleere und Hirnlosigkeit standen im Mittelpunkt<br />
seines Schaffens 2006: In seinem ersten Roman<br />
„Ankhaba“ finden Vampire die Erklärung der Welt.<br />
Das Buch „Lean Brain Management – Erfolg und<br />
Effizienzsteigerung durch Null-Hirn“ warnt satirischsarkastisch<br />
vor einem ökonomischen Horror-Szenario<br />
der Verdummung der Menschen und der Callcenterisierung<br />
der Arbeit. 2008 erschien „Abschied vom<br />
Homo Oeconomicus“ bei Eichborn – ein Buch über<br />
fast zwangsläufige ökonomische Unvernunft. Im Juli<br />
2009 folgt „Direkt-Karriere: Der schnellste Weg nach<br />
ganz oben“, ein satirisches Handbuch über Blitz -
Unser Gold-Sponsor<br />
karrierekunst. Das Buch „Aufbrechen! Warum wir eine<br />
Exzellenzgesellschaft werden müssen“ enthält sein<br />
von ihm gefordertes Zukunftsprogramm, wenn heute<br />
wegen der Automatisierung vieler Dienstleistungen<br />
neue Arbeitsfelder erschlossen werden müssen. Was<br />
soll der Einzelne dazu tun? Das steht im nachfolgenden<br />
Buch „Professionelle Intelligenz – worauf es morgen<br />
ankommt.“ „Das Neue und seine Feinde“ handelt von<br />
den so oft unterschätzten Problemen bei Innovationen.<br />
Eines der Hauptprobleme der Erstarrung wird im<br />
Buch: „Schwarmdumm (einige Monate in der Spiegel-<br />
Wirtschaftsbuch- bzw. Managermagazin-Bestsellerliste,<br />
kam bis auf Platz 6) thematisiert. Neu in 2017:<br />
„Flachsinn“, ein Buch über die Aufmerksamkeitsökonomie,<br />
für die die derzeitigen Twitter-Eskapaden des<br />
US-Präsidenten ein gutes Vorstellungsmodell ergeben.<br />
Auszeichnungen rund um die Bücher und anderes:<br />
2006: „Lean Brain Management“ wurde gleich nach<br />
Erscheinen von der Financial Times und getAbstract<br />
zum „Wirtschaftsbuch des Jahres 2006“ gekürt.<br />
2008: „Abschied vom Homo Oeconomicus“ wurde<br />
als eines von zehn Büchern für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis<br />
2008 nominiert.<br />
2011: Die Computerwoche zählt Gunter Dueck zu den<br />
100 einflussreichsten Persönlichkeiten (exakt auf Platz<br />
57) in der deutschen ITK-Landschaft (Informationstechnologie<br />
und Kommunikation).<br />
2011: Gunter Dueck ist einer von sechs Nominierten<br />
für den „2011 Best of Social Media Award“ in der<br />
Rubrik „Most Influential Social Media Person“.<br />
2011: „Professionelle Intelligenz“ ist auf Platz 3 der<br />
Bücher des Jahres 2011 beim Portal changeX und wird<br />
bei der größten Leserabstimmung im Netz auf Platz 11<br />
bei „Der Leserpreis – die besten Bücher 2011“ (lovelybooks.de)<br />
in der Kategorie Sachbuch gewählt.<br />
2012: „Dueck for President“ – Anfrage der Piraten -<br />
partei, klicken auf: „Dueck for President“<br />
2013: Gewählt auf Platz 5 unter den NEXT100 „Die<br />
wichtigsten 100 Köpfe der europäischen Digital-Industrie“.<br />
2013: „Das Neue und seine Feinde“ wurde als eines<br />
von zehn Büchern für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis<br />
2013 nominiert. Es ist „Karrierebuch des<br />
Jahres“ beim Hamburger Abendblatt und steht auf<br />
Platz 8 der „Bücher des Jahres“ beim Portal changeX.<br />
2014: Der Podcast „Die Welt fragt - Dueck antwortet“<br />
(mit Robert Kindermann) wird Zweiter bei der Wahl<br />
des „Besten Podcasts 2014“<br />
2015: Schwarmdummgleich nach Erscheinen auf Platz<br />
12/11 der Managermagazin-Bestenliste<br />
2017: Auf Nomination der Piratenpartei nimmt Gunter<br />
Dueck an der Bundesversammlung teil.
Fortschreitende Digitalisierung!<br />
Bedeutung dieses Wandels für Unternehmen, das berufliche Umfeld<br />
und für SIE persönlich<br />
Mit fortschreitender Digitalisierung stellen sich alt -<br />
hergebrachte Mitarbeiterführungs-, Berufs- und Arbeitsplatzmodelle<br />
mehr und mehr auf den Kopf.<br />
Vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten hat sich ein<br />
kompletter Paradigmenwechsel ergeben, welcher sowohl<br />
Arbeitgeber, sowie auch Arbeitnehmer als Individuen vor<br />
völlig neue Herausforderungen stellt. Dies gilt sowohl<br />
für den Arbeitsalltag, als auch für nachhaltig wirkende<br />
Stellenbesetzungen.<br />
Neben dem:<br />
„WAS“ – der schulischen und beruflichen Ausbildung,<br />
sowie der getätigten Erfahrungen - und dem<br />
„WIE“ – dem technisch/technologischen Fachwissen –<br />
werden Themen rund um das<br />
„WARUM“ – der menschlichen Komponente – immer<br />
wichtiger.<br />
Gleichzeitig beeinflusst die Digitalisierung alle drei<br />
genannten Verhaltensräume simultan und im bis dato<br />
ungeahnten Ausmaß (z.B. durch den weltweiten Siegeszug<br />
des Smartphones).<br />
Auf Basis grundsätzlich erlernter Kompetenzen können<br />
in sich schnell ändernder Umgebung nur noch schwer<br />
andauernde Höchstleistungen abgerufen werden, da<br />
Entscheidungen ausschließlich einem gelernten und<br />
antrainierten Verhaltensmuster folgen.<br />
Zukünftig wird es stets wichtiger, Kompetenzen wie<br />
Problemlösungs- und Kommunikationsexzellenz, gesteigerte<br />
Fähigkeiten im nach innen und außen gerichteten<br />
Führungsvermögen sowie eine anhaltenden Veränderungsfähigkeit<br />
und -willigkeit eindeutig in den Fokus zu<br />
rücken.<br />
Aus unserer Sicht werden diesbezüglich maßgeschneiderte<br />
Lösungen und Hilfestellungen (z.B. der Personal<br />
Life Driver, PLD ® ) in einer immer spezialisierteren<br />
Umgebung mehr und mehr an Wichtigkeit gewinnen.<br />
Als langjähriger Partner der Papierindustrie möchten wir<br />
anhand einiger Beispiele auf diese Änderungen ein -<br />
gehen. Unser Ziel ist es, zusammen mit unseren Kunden<br />
eine Umgebung mitzugestalten, welche fit für die<br />
Zukunft ist.<br />
Gemeinsam mit Ihnen schauen wir online und in Echtzeit,<br />
was Sie als Individuum wirklich bewegt. Lassen Sie<br />
sich überraschen…
Unser Gold-Sponsor<br />
Ein Radarstrahl, fast so<br />
fokussiert wie ein Laser!<br />
Mit 80 GHz in die Zukunft: Die neue Generation<br />
in der Radar-Füllstandmessung<br />
Die neueste Spitzentechnologie vom Weltmarktführer: Die große<br />
Stärke des VEGAPULS 64 ist seine einzigartige Fokussierung.<br />
Dadurch lässt sich der Radarstrahl fast punktgenau auf die<br />
Flüssigkeit ausrichten, vorbei an Behältereinbauten und<br />
Rührwerken. Diese neue Generation von Füllstandsensoren<br />
ist unempfindlich gegen Kondensat und Anhaftungen<br />
und ausgestattet mit der kleinsten Antenne ihrer Art.<br />
Einfach Weltklasse!<br />
Drahtlose Bedienung per Bluetooth mit<br />
Smartphone, Tablet oder PC. Einfache Nachrüstung<br />
für alle plics ® -Sensoren seit 2002.<br />
www.vega.com/radar<br />
Andreas Päch<br />
BGH Consulting, Starnberg<br />
04/2015–heute<br />
Partner / Senior Berater<br />
Xerium Technologies Inc., Reutlingen / Düren<br />
07/2013–04/2015<br />
Director Rolls Engineering Technology EMEA<br />
04/2012–07/2013<br />
Director Marketing & Engineering Services FF/RC EMEA<br />
10/2011–04/2012<br />
Director Marketing & Engineering Services FF EMEA<br />
Myllykoski Corporation /<br />
Papierfabrik Utzenstorf AG, Utzenstorf (CH)<br />
01/2006–10/2011<br />
Leiter Fabrikation<br />
06/2004–01/2006<br />
Leiter Holzschleiferei /<br />
F&E Ingenieur Halbstoffe (DIP & TGW)<br />
03/2002–06/2004<br />
F&E Ingenieur Halbstoffe (DIP & TGW)<br />
Fachhochschule München<br />
08/1997–06/2001<br />
Verfahrenstechnik Papiererzeugung – Dipl.-Ing. (FH)<br />
Drewsen Spezialpapiere GmbH & Co KG, Lachendorf<br />
08/1991–02/1994<br />
Berufsausbildung / Lehre – Papiermacher
Moderner Rechtsrahmen für eine moderne Arbeitswelt<br />
Die Digitalisierung ist eine Chance für alle. Sie zu<br />
nutzen liegt im Interesse der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer.<br />
Ein moderner Rechtsrahmen muss dazu gesetz -<br />
liche Spielräume schaffen – auch mit Blick auf neue<br />
digitale Geschäftsfelder.<br />
Zusätzliche Möglichkeiten, die Arbeit flexibler zu gestalten,<br />
erfordern auch eine höhere Eigenverantwortlichkeit<br />
der Arbeitnehmer. Die Grenze zwischen der Schutzpflicht<br />
des Staates und der Selbstverantwortung der<br />
Arbeitnehmer muss daher im Interesse der Flexibili -<br />
sierung neu gezogen werden. Ohne diese Anpassungen<br />
des Rechtsrahmens werden Teile unserer arbeitsrecht -<br />
lichen Ordnung von der betrieblichen Realität überholt<br />
oder künftig die Tätigkeiten dort erfolgen, wo bereits ein<br />
entsprechender Rechtsrahmen besteht.<br />
Durch den technischen Fortschritt ergeben sich neue<br />
Möglichkeiten des flexiblen Mitarbeitereinsatzes.<br />
Moderne Kommunikationsmittel ermöglichen zeitlich<br />
flexible Arbeitsleistungen an verschiedenen Orten und in<br />
wechselnden Teams. Die Arbeit in internationalen Teams<br />
über verschiedene Zeitzonen hinweg ist im Zuge der<br />
Globalisierung ein Muss und wird durch die Möglich -<br />
keiten der Digitalisierung erheblich vereinfacht. Auch<br />
die Arbeitnehmer haben durch moderne Kommunikationsmittel<br />
die Möglichkeit, Privatleben und Beruf besser<br />
in Einklang zu bringen. Telearbeit, mobiles Arbeiten und<br />
Arbeit im Home-Office bieten neue, örtlich und zeitlich<br />
flexible Gestaltungsmöglichkeiten, die es den Arbeitnehmern<br />
ermöglichen, berufliche Ziele und Anforderungen<br />
und private Zielsetzungen – sei es die Freizeitgestaltung,<br />
die Betreuung von Kindern oder die Pflege von Angehörigen<br />
– besser unter einen Hut zu bringen. In Zeiten des<br />
zunehmenden Fachkräftemangels ist es für Unternehmen<br />
wichtig, ihren Mitarbeitern genau diese Gestaltungs -<br />
möglichkeiten einzuräumen, um ein attraktiver Arbeitgeber<br />
zu sein. Technisch und organisatorisch ist das alles<br />
machbar, aber der bestehende Rechtsrahmen setzt<br />
Arbeitgebern und Arbeitnehmern viel zu enge Grenzen.<br />
Vor allem benötigen wir eine flexiblere Verteilung der<br />
Arbeitszeit – weg von der täglichen Betrachtung hin zu<br />
einer wöchentlichen Betrachtung mit durchschnittlich<br />
maximal 48 Stunden pro Woche bei einer täglichen<br />
Mindestruhezeit, die betrieblich entsprechend der je -<br />
weiligen Aufgaben und Tätigkeiten festgelegt wird.
Julius Jacoby<br />
war von 2007 bis 2012 als Rechtsanwalt in der Beratung<br />
kleiner und mittlerer Unternehmen tätig. Seit<br />
2012 ist er bei der vbw – Vereinigung der Bayerischen<br />
Wirtschaft e. V. als Referent in der Grundsatzabteilung<br />
Recht tätig.<br />
Die vbw ist die freiwillige, branchenübergreifende und<br />
zentrale Interessenvereinigung der bayerischen<br />
Wirtschaft und vertritt 132 bayerische Arbeitgeber- und<br />
Wirtschaftsverbände sowie 41 Einzelunternehmen. In<br />
den Branchen der vbw Mitgliedsverbände sind bayernweit<br />
etwa 4,7 Millionen sozialversicherungspflichtige<br />
Beschäftigte tätig.<br />
Auch als Landesvertretung der BDA (Bundesvereinigung<br />
der Deutschen Arbeitgeberverbände e. V.) und<br />
des BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.)<br />
vertritt die vbw gemeinsame wirtschaftliche, soziale<br />
sowie gesellschaftspolitische Interessen. So erhält sie<br />
den Freiraum für wirtschaftliches Handeln und sichert<br />
gleichzeitig den sozialen Frieden.<br />
Unser Gold-Sponsor
Papierproduktion im Rheinland<br />
Ein geschichtlicher Abriss<br />
Die Geschichte der Papiermacherei begann vor über<br />
2000 Jahren: Das heute bekannte älteste Papier der<br />
Welt wurde in China gefunden und stammt aus der<br />
Zeit zwischen 140 und 84 v. Chr.<br />
Wer das Papier erfunden hat, weiß man nicht.<br />
Bekannt ist nur der chinesische Hofbeamte Tsai Lun,<br />
der 105 n. Chr. die Papierherstellung beschrieb.<br />
Im Verlauf der folgenden Jahrhunderte verbreitete<br />
sie sich in Ost- und Zentralasien, später auch in<br />
arabische Gebiete und dann nach Südeuropa 1 .<br />
Aber nur allmählich verdrängte Papier das Pergament,<br />
das zuvor den Papyrus abgelöst hatte.<br />
Papiermacher im italienischen Fabriano entwickelten um<br />
1250 die Herstellungsverfahren, die dann in Europa<br />
jahrhundertelang angewandt wurden. Dazu gehörten<br />
Stampfwerke, die durch Wasserkraft angetrieben wurden<br />
und der Zerfaserung des Rohmaterials „Lumpen“ dienten.<br />
Die Schöpfsiebe wurden aus Draht anstatt wie bisher aus<br />
Bambus oder Schilf gefertigt. Dadurch ließ sich das<br />
Schöpfen beschleunigen. Außerdem konnte man<br />
Wasserzeichen zur Kennzeichnung der Bögen aufbringen.<br />
Als dritte wichtige Verbesserung wurde die faserige<br />
Oberfläche des Papiers durch nachträgliches Eintauchen<br />
in ein Knochenleimbad geschlossen, so dass sich das<br />
Papier gut zum Beschreiben mit Feder und Tinte eignete.<br />
Nachgebautes Lumpenstampfwerk<br />
im LVR-Industriemuseum Papiermühle Alte Dombach<br />
Dieses Papier konnte im Verlauf der nächsten zwei bis<br />
drei Jahrhunderte das teurere Pergament nach und nach<br />
verdrängen.<br />
Die ersten Papiermühlen auf deutschem Boden wurden<br />
ab 1390 in den südlich gelegenen Fernhandelsstädten<br />
Nürnberg und Ravensburg gegründet, über die bisher<br />
die Importe von italienischem Papier erfolgt waren. Mit<br />
der Entwicklung der Buchdruckerei seit Johannes Gutenberg<br />
um 1445, der Erfindung des Kupferstiches 1446<br />
sowie der Entwicklung der Städte und der Landesherrschaften<br />
und deren Verwaltungen stieg der Bedarf an<br />
Papier so stark an, dass um 1500 schon etwa 60 Papiermühlen<br />
existierten. Die ersten Papiermühlen im Rheinland<br />
entstanden im 16. Jahrhundert, in Düren (1579),<br />
in Solingen (um 1540) und in Bergisch Gladbach (1582).<br />
Trotz Phasen der Stagnation, vor allem in Folge des Dreißigjährigen<br />
Krieges, stieg die Zahl der Papiermühlen<br />
nahezu kontinuierlich an, so dass um 1700 etwa 500, zu<br />
Beginn der Industrialisierung – also um 1800 – gut<br />
1.000 Papiermühlen in Deutschland liefen.
Und so wurde in einer Papiermühle produziert: Rohstoff<br />
waren Alttextilien aus Leinen. Diese „Hadern“ (vom süddeutschen<br />
Wort für „Lappen“) mussten zunächst sortiert<br />
und in Fetzen geschnitten werden. Die Lumpenkammern<br />
waren ein typischer Arbeitsplatz von Frauen und<br />
Kindern. Häufig ließ man die Hadern einige Tage faulen,<br />
da sie sich dann besser verarbeiten ließen und sich<br />
außerdem Farbstoffe und Verschmutzungen lösten.<br />
Anschließend wurden sie im Lumpenstampfwerk mit<br />
Wasser gemischt und durch 12- bis 36-stündiges Stampfen<br />
zu Papierbrei zerfasert.<br />
Aus diesem Papierbrei wurden dann die Bögen geschöpft<br />
und jeweils auf ein Filztuch abgegautscht. Die Stapel aus<br />
Filzen und nassen Papierbögen wurden in einer großen<br />
Presse so stark entwässert, dass das Papier danach zum<br />
Trocknen aufgehängt werden konnte. An einer Bütte<br />
entstanden 3.000 bis 5.000 Bögen am Tag. 2 Die trockenen<br />
Papiere wurden meist geleimt und nochmals gepresst<br />
und geglättet. Je nach Papierqualität waren für den<br />
Betrieb mit einer Bütte sieben bis zwanzig Personen erforderlich.<br />
3<br />
In der preußischen Rheinprovinz wurden 1836, bevor in<br />
der rheinischen Papierproduktion die Industrialisierung<br />
einsetzte, 77 Papiermühlen betrieben. Zentren waren<br />
Düren und Bergisch Gladbach. 4<br />
Der Übergang zur industriellen Papierproduktion begann<br />
mit der Aufstellung von Papiermaschinen. 1799 hatte<br />
der Franzose Nicolas-Louis Robert ein Patent für eine<br />
einfache, von Hand angetriebene Maschine erhalten. Die<br />
erste Papiermaschine in Deutschland ging 1819 in Berlin<br />
in Betrieb. 1837 – also fast zwanzig Jahre nach der Berliner<br />
Maschine – wurde in Düren die erste Maschine des<br />
Rheinlands aufgestellt, 5 Bergisch Gladbach folgte<br />
1842/43 mit einer Maschine in der Dombach. In den<br />
folgenden Jahrzehnten stieg die Zahl der Papiermaschinen<br />
kontinuierlich an. Die ersten Maschinen wurden noch<br />
von Wasserkraft angetrieben, erst ab der Jahrhundertmitte<br />
ging man zum Antrieb durch Dampfmaschinen<br />
über. Dampfkessel gab es jedoch von Anfang an, denn<br />
die Trockenzylinder der Papiermaschinen wurden mit<br />
Dampf beheizt. Deshalb finden sich in den Archiven<br />
verlässliche Hinweise auf die Maschinenaufstellungen.<br />
Der Übergang zur Maschinenproduktion verlief im<br />
Rheinland durchaus typisch – in den 1840er-Jahren<br />
gingen in vielen Regionen die ersten Papiermaschinen in<br />
Betrieb. In England und Frankreich hatte dieser Schritt<br />
bereits früher stattgefunden. Die Verzögerung in<br />
Deutschland lag unter anderem daran, dass es hier in<br />
den ersten Jahrzehnten nur wenige erfolgreiche Papiermaschinenbauer<br />
gab und gleichzeitig die Einfuhrzölle<br />
für die Maschinen hoch waren. Erst als infolge einer<br />
Krise der französischen Wirtschaft um 1838 billige französische<br />
Maschinenpapiere die Konkurrenzsituation für<br />
die deutschen Fabrikanten verschärften und außerdem<br />
1841 in Preußen die Einfuhr von Papiermaschinen<br />
erleichtert wurde, wuchs ihre Zahl auch hierzulande. 6<br />
Danach ging die Ablösung der Schöpfbütten schnell.<br />
Neben den Papiermaschinen kennzeichnete die Verwendung<br />
von neuen Rohstoffen die industrielle Papier -<br />
produktion. Hadern standen für die steigende Produktion<br />
nicht mehr in ausreichender Menge zur Verfügung. Der<br />
wichtigste neue Rohstoff war Holz, das in zwei verschiedenen<br />
Formen verwendet wurde.<br />
Schöpfen mit einem Sieb mit Wasserzeichen<br />
im LVR-Industriemuseum Papiermühle Alte Dombach<br />
Die einfachere Form war Holzschliff oder Holzstoff.<br />
In Archiven und Bibliotheken machen Papiere mit Holzstoff<br />
heute große Probleme: Das im Holz enthaltene<br />
Lignin lässt die Papiere brüchig werden – ein Grund für<br />
den gefürchteten „Säurefraß“. Hochwertiger ist Papier<br />
aus Zellstoff. Um dessen höhere Qualität hervor -<br />
zuheben, wurde es als „holzfrei“ bezeichnet. Zeitweise<br />
ersetzte auch gekochtes Stroh die Hadern.<br />
Die Papiermaschinen und die neuen Rohstoffe waren die<br />
wichtigsten branchenspezifischen Neuerungen, die die<br />
industrielle Papierproduktion kennzeichneten. Hinzu<br />
kamen dieselben technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen<br />
Umstrukturierungen der Betriebe wie in<br />
anderen Branchen: Die Krafterzeugung wurde auf<br />
Dampfkraft und später auf Motoren umgestellt, immer<br />
mehr Betriebsabläufe wurden mechanisiert, die Produktion,<br />
aber auch die Administration wurden zunehmend<br />
rationell organisiert. Größere Gebäude mussten errichtet<br />
werden, die Zahl der Beschäftigten nahm zu, die Produktionsmengen<br />
stiegen, die Stückkosten sanken.
Mitte des 19. Jahrhunderts ließen sich auf Papiermaschinen<br />
Bahnen von 0,80 bis 1,50 Metern Breite erzeugen;<br />
in 24 Stunden konnten bis zu 2.000 Kilogramm Papier<br />
produziert werden. Um 1920 kam eine Zeitungspapiermaschine<br />
von 3,5 Metern Breite auf eine Tagesproduktion<br />
von 35.000 bis 40.000 Kilogramm. 7<br />
Nur die finanzkräftigeren Papierfabrikanten konnten<br />
ihre Mühlen zu Fabriken umbauen. Viele kleine Mühlen<br />
mussten schließen. Das betraf zum Beispiel das Bergische<br />
Land, wo zahlreiche Papiermühlen aufgegeben wurden.<br />
Ab den 1870er-Jahren bot sich den Besitzern kleiner<br />
Mühlen, die ihren Betrieb so lange hatten halten können,<br />
mit der Rundsiebmaschine zur Pappenherstellung eine<br />
Nische. Nicht nur die Kosten für die Maschine selbst,<br />
sondern die insgesamt erforderlichen Investitionen, aber<br />
auch die Betriebskosten lagen sehr viel niedriger als bei<br />
der industriellen Papiererzeugung.<br />
Hatten sich die vorindustriellen Papiermühlen vor allem<br />
im Hinblick auf die Zahl der Bütten und der Beschäftigten<br />
sowie die Qualität und Menge des produzierten Papiers<br />
unterschieden, bot die Branche um 1920 ein differenzierteres<br />
Bild: Den Papierfabriken mit durchschnittlich<br />
122 Beschäftigten standen die Pappenfabriken mit nur<br />
24 Beschäftigten gegenüber. Jede Fabrik lieferte nur<br />
einen kleinen Ausschnitt aus der inzwischen großen<br />
Sortenpalette. Hinzu kamen Holzschleifereien und<br />
Zellstofffabriken. Die Zahl der Zulieferbetriebe, die<br />
Maschinen, Maschinenteile, Farben und andere Hilfsstoffe<br />
lieferten, wuchs ebenfalls. 8<br />
Papiermaschinen bei der Firma Zanders in Bergisch Gladbach, um 1900.<br />
Foto: Stiftung Zanders – Papiergeschichtliche Sammlung, Bergisch Gladbach<br />
Die nächste grundlegende Neuerung war die Automatisierung,<br />
die in den 1960er-Jahren begann. Immer mehr<br />
einzelne Vorgänge und bald der gesamte Produktions -<br />
ablauf wurden durch elektronische Prozessleitsysteme<br />
gesteuert.<br />
In Nordrhein-Westfalen produzieren heute rund 30<br />
Werke mit ca. 7.000 Beschäftigten rund 4 Millionen<br />
Tonnen Papier, Karton und Pappe für Industrie, Handel,<br />
Verwaltung und privaten Konsum. Darunter sind<br />
Familienunternehmen, aber auch Werke international<br />
operierender Konzerne. 9<br />
Dr. Sabine Schachtner<br />
LVR-Industriemuseum<br />
Papiermühle Alte Dombach<br />
51465 Bergisch Gladbach<br />
www.industriemuseum.lvr.de
Pappenfabrik in Langenberg. Auf der Wiese im Hintergrund werden die Pappendeckel getrocknet.<br />
Reproduktion aus: Wilhelm Ophüls: Alt-Langenberg. Langenberg 1931<br />
1<br />
Aus der großen Fülle der Literatur über die frühe<br />
Papiergeschichte sei hier nur ein Titel genannt:<br />
Peter F. Tschudin: Grundzüge der Papiergeschichte.<br />
Stuttgart 2002<br />
2<br />
Ludwig Fues: Notizen über Leimkochen. Bergisch Gladbach,<br />
handschriftliche Aufzeichnungen zwischen 1811<br />
und 1817, Sammlung LVR-Industriemuseum. K(arl)<br />
Karmarsch: Papierfabrikation. In: Johann Josef Prechtl<br />
(Hrsg.): Technologische Encyklopädie oder alphabetisches<br />
Handbuch der Technologie, der technischen<br />
Chemie und des Maschinenwesens. Band 10. Stuttgart<br />
1840. S. 506<br />
3<br />
Günter Bayerl: Betriebsformen, Betriebstypen und<br />
Betriebsgrößen deutscher Papiermühlen in vorindustrieller<br />
Zeit. In: IPH Jahrbuch 5 (1984), S. 5 31, hier S. 18.<br />
Johann Adolph Engels: Ueber Papier und einige andere<br />
Gegenstände der Technologie und Industrie. Duisburg,<br />
Essen 1808, S. 70<br />
4<br />
Gerhard Adelmann (Hrsg.): Der gewerblich industrielle<br />
Zustand der Rheinprovinz im Jahre 1836. Amtliche<br />
Übersichten. Bonn 1967<br />
5<br />
Ralf Schaumann: Technik und technischer Fortschritt<br />
im Industrialisierungsprozeß. Dargestellt am Beispiel<br />
der Papier , Zucker und chemischen Industrie der nördlichen<br />
Rheinlande (1800 1875). Bonn 1977, S.243. Josef<br />
Geuenich: Geschichte der Papierindustrie im Düren<br />
Jülicher Wirtschaftsraum. Düren 1959, S. 331<br />
6<br />
Wolfgang Schlieder: Zur Einführung der Papiermaschine<br />
in Deutschland. In: Jahrbuch der Deutschen<br />
Bücherei 6 (1970), S. 101–126<br />
7<br />
Karl Theodor Jahn: 150 Jahre Papiermaschine. In:<br />
Die Gohrsmühle. Werkszeitschrift der Feinpapierfabrik<br />
J.W. Zanders Bergisch Gladbach 6/1950, S. 3–4.<br />
Festschrift zum 50jährigen Jubiläum des Vereins Deutscher<br />
Papierfabrikanten. Berlin 1922, S. 202<br />
8<br />
J. Georg Oligmüller, Sabine Schachtner: Papier – Vom<br />
Handwerk zur Massenproduktion, Köln 2001, S. 132.<br />
Friedrich Müller: Die Papierfabrikation und deren<br />
Maschinen. Ein Lehr- und Handbuch. Band 1, 2. Aufl.,<br />
Biberach 1931, S. 4<br />
9<br />
Wirtschaftsverband der rheinisch-westfälischen papiererzeugenden<br />
Industrie e.V.
LVR-Industriemuseum<br />
Alte Dombach<br />
51465 Bergisch Gladbach<br />
Telefon 02202 936680<br />
www.industriemuseum.lvr.de<br />
Besucherinformationen, Anmeldungen:<br />
kulturinfoRheinland 02234 9921555<br />
Öffnungszeiten<br />
Dienstag–Freitag 10–17 Uhr,<br />
Samstag–Sonntag 11–18 Uhr<br />
LVR-Industriemuseum<br />
Papiermühle<br />
Alte Dombach<br />
in Bergisch Gladbach<br />
In Bergisch Gladbach lebt eine fast 400 Jahre alte Papiermühle<br />
als Museum weiter. Die idyllisch gelegenen Fachwerkhäuser<br />
beherbergen eine anschaulich gestaltete<br />
Ausstellung über den Gebrauch und die Herstellung von<br />
Papier in Vergangenheit und Gegenwart. Die Besucher<br />
erleben Mühlrad, Lumpenstampfwerk und Laborpapiermaschine<br />
in Aktion und können selbst ein Blatt Papier<br />
schöpfen.<br />
Ausstellungsstücke wie eine 150 Jahre alte Sammlung<br />
von liebevoll gestalteten Freundschaftsbriefchen, ein<br />
Papiertheater oder historische Verpackungen erzählen<br />
vom Papiergebrauch in früheren Zeiten. Maschinen des<br />
19. Jahrhunderts – zum Beispiel eine Papiermaschine<br />
aus dem Jahr 1889 – demonstrieren den Fortschritt der<br />
Industrialisierung.<br />
Nach dem Rundgang können die Besucher im Museums -<br />
laden mit seinem vielfältigen Angebot stöbern und sich<br />
im gemütlichen Café oder auf der sonnigen Terrasse entspannen,<br />
während die Kinder auf dem großen Spielplatz<br />
toben.
Köln
Exkursion nach Kreuzau zur Niederauer Mühle GmbH<br />
Die Papierfabrik Niederauer Mühle ist einer der führenden<br />
Anbieter von weiß gedecktem Testliner für die Wellpappen-<br />
Produktion. Unser Wellpappenrohpapier besteht zu 100<br />
Prozent aus Recyclingpapier. Dank modernster Technik<br />
erfüllen unsere Papiere die höchsten Qualitätsstandards<br />
bezüglich der Glätte, Verarbeitbarkeit und Zuverlässigkeit.<br />
Die Betriebsorganisation stellt sicher, dass Testliner in<br />
der benötigten Menge, Stärke und Breite termingerecht an<br />
den gewünschten Ort geliefert wird – und das weltweit.<br />
Unsere Produktion entspricht allen aktuellen Umweltund<br />
Effizienzstandards. Als Spezialist für das Recycling<br />
von gebrauchten Getränkekartons leisten wir einen<br />
aktiven Beitrag zum Schutz der Natur. Altpapier ist ein<br />
wertvoller Rohstoff, der in den Wellpappenrohpapieren<br />
der Niederauer Mühle wieder zum Einsatz kommt.<br />
Zwei Papiermaschinen sind das Herz der Produktion der<br />
Niederauer Mühle. Durch kontinuierliche Investitionen<br />
und innovative Techniken hat sich die Niederauer Mühle<br />
zu einem der führenden Anbieter in Europa entwickelt.<br />
2011 wurde die Papiermaschine PM3 mit einer Arbeitsbreite<br />
von 5,30 Metern in Betrieb genommen. Sie ergänzt<br />
die bewährte PM2 der Niederauer Mühle mit einer<br />
Arbeitsbreite von 2,50 Metern. Damit sind alle Standardformate<br />
bis 3,35 Meter lieferbar. Präzise Rollenschneider<br />
mit automatischer Formateinstellung sorgen für Lieferung<br />
in der gewünschten Breite.<br />
Die Produktion wird über ein integriertes Prozess- und<br />
Qualitätsleitsystem gesteuert. Die Online-Verarbeitung<br />
von zahlreichen Mess- und Überwachungsstellen<br />
sichert den hohen Qualitätsanspruch in jeder Phase der<br />
Herstellung.<br />
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch!
Unser Gold-Sponsor<br />
I H R S P E Z I A L I S T F Ü R T E S T L I N E R<br />
Die Papierfabrik Niederauer Mühle ist einer der führenden<br />
Anbieter von Testliner für die Wellpappen-Produktion.<br />
Unser weiß gedecktes Wellpappenrohpapier besteht zu<br />
100 Prozent aus Recyclingpapier. Dank modernster Technik<br />
erfüllen unsere Papiere die höchsten Qualitätsstandards<br />
bezüglich der Glätte, Verarbeitbarkeit und Zuverlässigkeit.<br />
www.niederauer-muehle.de
Exkursion: Richter Werk II – Walzen & WC-Bezüge<br />
Formierzylinder mit WC-Beschichtung von Richter<br />
Kalander-Walze mit WC-Beschichtung von Richter<br />
Das Unternehmen wurde 1971 von Wolfgang Richter<br />
gegründet. Den damaligen Produktionsschwerpunkt<br />
bildete die Entwicklung und Fertigung von Sonder -<br />
maschinen für die Papierindustrie. Exzellenter Kundenservice<br />
in Form von Dienstleistungen, Instandhaltungen,<br />
Planung und Optimierungen von Maschinen sowie deren<br />
Verschleißschutz stand von Anfang an im Mittelpunkt.<br />
Das dadurch erlangte Know-how und die ständige<br />
Bereitschaft in modernste Fertigungsanlagen und neue<br />
Technologien zu investieren, ermöglicht uns heute, uns<br />
als Ingenieurbüro mit eigener Fertigung zu präsentieren.<br />
In Zusammenarbeit mit unseren Kunden analysieren<br />
wir die einzelnen Problemfälle vom Plattenband bis zum<br />
Tambour. Ziel ist es, herstellerunabhängige, funktionale<br />
und dabei möglichst wirtschaftliche Lösungen für vorhandene<br />
Anlagen, Aggregate und Walzen zu finden.<br />
Dies können verfahrenstechnische Verbesserungen,<br />
Maßnahmen zur Standzeitverlängerung oder auch eine<br />
Reduzierung des Energieverbrauches z.B. durch konstruktive<br />
Änderungen oder den Einsatz eigenentwickelter<br />
Werkstoffe sein.<br />
Selbstverständlich konstruieren wir die meisten Produkte<br />
auch selbst und fertigen sie neu.<br />
Saugwalze mit WC-Beschichtung von Richter<br />
Tragwalze mit WC-Beschichtung (Ra 12-13) von Richter<br />
Ständige Einsatzbereitschaft für partnerschaftliche Kunden<br />
(d. h. 24/365) sowie sensibles, am Einzelfall orientiertes<br />
Handeln ist für uns selbstverständlich.<br />
Zurzeit produzieren wir mit ca. 200 Mitarbeitern in<br />
vier Werken in Düren (Deutschland) und Karhula (Finnland)<br />
auf insgesamt über 30.000 m².
Unsere SilberPlus-Sponsoren
Partner-Programm:<br />
Ausflug zum Drachenfels<br />
mit Besichtigung von Schloss Drachenburg<br />
Noch lebt die Sage in den Köpfen der Menschen, dass<br />
hier oben im Siebengebirge Siegfried den Kampf mit<br />
dem Drachen, der die Königstochter bewachte, bestanden,<br />
ihn besiegt, und die Befreite ihren Eltern nach Worms<br />
zurückgebracht habe.<br />
In der Neuzeit ist an diesem Ort eine Event-Location<br />
entstanden, die seinesgleichen sucht. Es ist der Beginn<br />
einer neuen Ära im Bereich der Eventinszenierungen auf<br />
dem Plateau des Drachenfelsen.<br />
Nachdem im Herbst 2011 mit den Neubauarbeiten am<br />
Drachenfelsplateau begonnen wurde, konnte am 2. Juni<br />
2013 die Fertigstellung der Gebäude auf dem Drachenfelsplateau<br />
und der Außenanlagen einschließlich des<br />
neu gestalteten Gipfel-Bahnhofs der Zahnradbahn gefeiert<br />
werden. Seit dem Abbruch des ursprünglichen Gasthauses<br />
hat der bekannteste Berg des Rheinlands sein Erscheinungsbild<br />
verändert. Ein lichtdurchfluteter Glaskubus<br />
ergänzt jetzt das Gebäude aus den 1930er Jahren und<br />
bietet ebenso wie die Sitzstufenanlage ein völlig neues<br />
Erlebnis.<br />
Seit Juli 1883 befördert die Drachenfelsbahn Passagiere<br />
von der Talstation Königswinter bis zum Ausflugslokal<br />
oben an der Drachenfelsruine und ist somit die älteste<br />
Zahnradbahn Deutschlands. Die Strecke ist gut 1,5 Kilometer<br />
lang, hat etwa 220 Meter Höhenunterschied bei<br />
einer maximalen Steigung von 20 % und besitzt eine<br />
Zwischenstation bei Schloss Drachenburg.<br />
Dort wo Siegfried den Drachen besiegt hat, erleben Sie<br />
heute den schönsten Blick auf das Rheintal. An diesem<br />
mystischen Logenplatz können Sie bei einem Tässchen<br />
Kaffee oder einem Glas Wein die Seele baumeln lassen.
Unsere Silber-Sponsoren
Gesellschaftsabend in der Wolkenburg<br />
Freitag, 12. Oktober 19:00 Uhr<br />
Die denkmalgeschützte Wolkenburg ist ein historisches<br />
Gebäude im Kölner Stadtteil Altstadt-Süd. Ihre barocken<br />
Gebäude entstanden am Ort einer mittelalterlichen<br />
Klosteranlage der Benediktinerinnen von Rolandswerth<br />
(heute Nonnenwerth) und wurden 1734 erbaut.<br />
Der Name geht auf die Gründungsgeschichte des Kölner<br />
Männergesangvereines Cäcilia Wolkenburg zurück, der<br />
die Restanlage des ehemaligen Klosters zu seinem neuen<br />
Sitz wählte.<br />
Heute stehen in der zum Veranstaltungszentrum umgebauten<br />
Wolkenburg vier unterschiedlich große Räume<br />
in verschiedenen Stilrichtungen für bis zu 450 Gäste zur<br />
Verfügung. Ein Highlight ist der stimmungsvolle Innenhof<br />
mitsamt originalen Säulenkapitellen vom Kölner Dom.<br />
Die Küche der Wolkenburg arbeitet nach dem Motto<br />
„Vom Einfachen nur das Beste“. Das Küchenteam stellt<br />
internationale Speisen mit ebenso kreativer Sorgfalt<br />
zusammen wie solche aus heimischen Regionen.<br />
Ganz unabhängig von der Herkunft der Küche wird Wert<br />
auf die transparente Herkunft der stets frischen Zutaten<br />
gelegt, die größtenteils aus kontrolliert biologischem<br />
Anbau stammen.
Unsere Bronze-Sponsoren<br />
Bogner Gottschalk Heine<br />
Unternehmensberater GmbH<br />
CHT Germany GmbH<br />
econovation GmbH<br />
emtec Electronic GmbH<br />
Gebr. Bellmer GmbH Maschinenfabrik<br />
Glatfelter Dresden GmbH<br />
Hamburger Rieger GmbH<br />
Heimbach GmbH & Co. KG<br />
Kadant Johnson Deutschland GmbH<br />
Kapp-Chemie GmbH & Co. KG<br />
Münzing Chemie GmbH<br />
PAMA paper machinery GmbH<br />
Papierfabrik August Koehler SE<br />
Pöyry Deutschland GmbH<br />
Schönfelder Papierfabrik GmbH<br />
Schumacher Packaging GmbH<br />
Simto Consulting Sarl<br />
Zwick GmbH & Co. KG
Informationen<br />
Herr Prof. Dr. Stephan Kleemann<br />
Frau Prof. Dr. Helga Zollner-Croll<br />
Hochschule München, Fakultät 05, Lothstraße 34<br />
80335 München, www.pp.hm.edu<br />
Hochschule München<br />
Neuausrichtung des Studiengangs<br />
Verpackungstechnik und<br />
Verfahrenstechnik Papier<br />
Biofasern bilden zusätzlichen Schwerpunkt<br />
in der Studienrichtung Verfahrenstechnik Papier<br />
Der Studiengang Verpackungstechnik und Verfahrens -<br />
technik Papier an der Hochschule München hat sich<br />
neu aufgestellt. Ab Oktober <strong>2018</strong> werden die Studien -<br />
gruppen Verpackungstechnik und Kunststoff -<br />
technologie sowie Verfahrenstechnik und Biofasern<br />
getrennt ein intensiviertes Grundlagenmodul mit<br />
einer Einführung in die jeweilige Studienrichtung<br />
anbieten.<br />
So sollen die Studierenden motiviert auf die<br />
kommenden Themen aus der Verpackungs- und<br />
Papierindustrie vorbereitet werden. Die Studienrichtung<br />
Verfahrenstechnik Papier wurde inhaltlich um<br />
den zukunftsträchtigen Bereich der Biofasern erweitert.<br />
Durch die Fokussierung auf Nachhaltigkeit,<br />
wie Biofasern, Biopolymere oder Umwelttechnologie<br />
soll das Studium attraktiver werden und seinen<br />
zukünftigen Absolventen zusätzliche Chancen bei<br />
der späteren Berufswahl anbieten.<br />
Die Hochschule München in Zahlen<br />
Die Hochschule München ist Bayerns größte Hochschule<br />
für angewandte Wissenschaften und die zweitgrößte<br />
Deutschlands. In 14 Fakultäten bietet sie ein weites<br />
Spektrum an möglichen Vorlesungen und Aktivitäten<br />
und ist der konsequenten Ausrichtung auf die Praxis<br />
verpflichtet – in der Lehre und in der Forschung. Zurzeit<br />
gibt es an der Hochschule insgesamt 85 Bachelor- und<br />
Masterstudiengänge. Neben traditionsreichen Studiengängen<br />
bietet die Hochschule München auch eine Reihe<br />
einzigartiger, auf die Bedürfnisse einer sich wandelnden<br />
Gesellschaft neu zugeschnittener Studiengänge. Auch<br />
für Berufstätige gibt es ein wachsendes Angebot an<br />
Weiterbildungs- und flexiblen Studienmöglichkeiten.<br />
Rund 470 ProfessorInnen unterstützt von 750 Lehrbeauftragten<br />
bilden an der Hochschule München über<br />
17.000 Studierende aus. 515 MitarbeiterInnen in der<br />
Verwaltung helfen bei den Ablaufprozessen rund um<br />
das Studium. 140 wissenschaftliche MitarbeiterInnen<br />
runden zusammen mit 99 DoktorandInnen den Bereich<br />
Forschung ab.
Hochschule München<br />
Der Bereich Forschung und Entwicklung wurde in den<br />
vergangenen Jahren weiter ausgebaut. In über 180<br />
Laboren werden fachliche Kompetenzen in Competence<br />
Centern und Forschungsschwerpunkten gebündelt. Des<br />
Weiteren wird intensive Forschung an acht An-Instituten<br />
der Hochschule München betrieben. Ein An-Institut, das<br />
Institut für Verfahrenstechnik Papier e.V., ermöglicht<br />
durch diverse Forschungsarbeiten die Kompetenzerweiterung<br />
für Papiertechnik-Studierende sowohl aus dem<br />
Bachelor also auch aus dem Masterstudiengang.<br />
Bachelor Studiengang<br />
Verpackungstechnik und<br />
Verfahrenstechnik Papier<br />
Das 7-semestrige Bachelorstudium Verpackungstechnik<br />
und Verfahrenstechnik Papier (B. Eng.) wird in Deutschland<br />
nur an dieser Hochschule angeboten, wodurch sich<br />
eine über ganz Deutschland und auch angrenzende Länder<br />
verteilte Studentenschaft ergibt. Auch alters mäßig ist<br />
stets eine interessante Bandbreite festzustellen, da manche<br />
Studierende direkt nach der Schule, andere wiederum<br />
erst nach abgeschlossener Lehre das Studium beginnen.<br />
Alles in allem führt dies zu bunt gemischten Semestern<br />
von normalerweise circa 80 Studienanfänger Innen.<br />
Das Bachelor Studium beginnt immer zum Winter -<br />
semester, d. h. zum 1. Oktober des Jahres. Mit einer<br />
Regelstudienzeit von sieben Semestern ist es ein sehr<br />
kompaktes Studium. Die Studienordnung legt pro<br />
Semester eine sogenannte Arbeitsbelastung von 30 ECTS<br />
Punkten fest. Dies umfasst wöchentlich 24–30 Unterrichtsstunden<br />
und die Vor- und Nachbearbeitung von<br />
Lehrveranstaltungen, Bearbeiten von Übungsaufgaben,<br />
das Erstellen von Praktikumsberichten oder die Erstellung<br />
von Referaten oder Studienarbeiten.<br />
Mit der Erweiterung der Studienrichtung Verfahrenstechnik<br />
Papier um den Bereich der Biofasern ist der<br />
Münchner Studiengang für seine Studierenden noch<br />
interessanter geworden. So werten unter anderem neue<br />
Fächer wie Biopolymerchemie, Verfahrenstechnik Alt -<br />
papier und Recycling, Verfahrenstechnik biogene Fasern,<br />
faserbasierte Verpackungen und Hygienepapiere den<br />
Studiengang auf. Weitere Schwerpunkte bei den Wahlpflichtmodulen<br />
innovative Faserprodukte aus Faser-Kunst -<br />
stoff, Kombinationen, Verbundwerkstoffe, Thermoplaste<br />
und Elastomere erschließen lukrative Zukunftsfelder.<br />
Den Absolventen eröffnen sich dadurch zusätzliche<br />
berufliche Potenziale unter anderem in den Bereichen<br />
Automobil, Luft- und Raumfahrt sowie Leichtbau.<br />
Die Studienrichtung Verpackungstechnik und Kunststofftechnologie<br />
intensiviert ihre Ausbildung im Bereich<br />
der Kunststoffchemie, Packstoffe und Packmittel, sowie<br />
den Verpackungsdruck.<br />
Eine Besonderheit ist das 18-wöchige Praxissemester in<br />
der Papierindustrie. Diese Praxiserfahrung ist ausgesprochen<br />
lehrreich und hilft aufgrund der guten Bezahlung<br />
auch bei der Finanzierung des gesamten Studiums. Viele<br />
Studierende verbringen das Praxissemester in interessanten<br />
Firmen sowohl im europäischen Ausland also<br />
auch in Nord- und Südamerika oder in Australien.<br />
Mindestens einmal pro Semester findet eine Exkursion<br />
zu diversen Papierfabriken statt. Das Highlight ist hierbei<br />
sicher die 8-tägige Abschlussexkursion am Studienende,<br />
oft auch im europäischen Ausland. Eine große<br />
praktische Hilfe ist die nur von „unseren“ Studierenden<br />
betriebene Studentenvereinigung „Aktivitas“, welche die<br />
Studierenden finanziell unterstützt und Vorträge, Reisen<br />
und viele studentische Ereignisse organisiert.<br />
Finnland-Exkursion: Besuch der Partnerhochschule JAMK in Jyväskylä
Hochschule München<br />
Das Duale Bachelorstudium<br />
an der Hochschule München<br />
Die Hochschule München bietet in Kooperation mit<br />
der Initiative Hochschule Dual und zahlreichen Partner -<br />
unternehmen eine Vielzahl von dualen Studienmöglichkeiten<br />
an. Beide Bachelor Studienrichtungen, Verpackungstechnik<br />
und Verfahrenstechnik Papiertechnik,<br />
werden als Verbundstudium, also in Kombination mit<br />
einer Berufsausbildung, angeboten. Die Vorteile dieses<br />
dualen Studiums liegen in der engen Verzahnung von<br />
Wissenschaft und Praxis. Die Studierenden können<br />
das an der Hochschule München erworbene Wissen un -<br />
mittelbar im Berufsleben einsetzen bzw. in der Arbeitswelt<br />
erfahrene Vorgänge in Vorlesungen und Seminaren<br />
vertiefen.<br />
Für die Industrie ist deshalb sicherlich das Duale<br />
Bachelorstudium interessant. So können sich die Unternehmen<br />
frühzeitig hochqualifizierte, leistungsmotivierte<br />
Nachwuchskräfte sichern, die fundiertes praktisches und<br />
akademisches Wissen gewinnbringend für das jeweilige<br />
Unternehmen einsetzen. In nur 4,5 Jahren werden<br />
die jungen Leute dual ausgebildet, d.h. sie bekommen<br />
sowohl den gewerblichen Abschluss mit einer IHK-<br />
Abschlussprüfung als auch den akademischen Abschluss<br />
B.eng.<br />
Versuchspapiermaschine der Hochschule München<br />
Darüber hinaus gibt es zwei Masterstudiengänge (konsekutiv<br />
und weiterbildend) zum Master of Engineering in<br />
Paper Technology sowie den deutschsprachigen Masterstudiengang<br />
Verpackungstechnik.<br />
Internationaler Master<br />
Studiengang Paper Technology<br />
Studierende aus dem In- und Ausland stellen sich der<br />
Herausforderung des englischsprachigen Master Studienganges<br />
„Paper Technology“ an der Hochschule<br />
München. Momentan sind im englischsprachigen Master<br />
Studiengang ca. 30 Studierende aus 15 verschiedenen<br />
Ländern immatrikuliert.<br />
Das internationale Masterstudium (Master of Engineering)<br />
bereitet die Absolventinnen und Absolventen auf<br />
anspruchsvolle Tätigkeiten und einen schnellen Einstieg<br />
in Führungspositionen in der weltweit stark vernetzten<br />
Papierindustrie vor.<br />
Besonders befähigten Studierenden eröffnet das Masterstudium<br />
die Möglichkeit, ihre vorhandenen Kenntnisse<br />
und Qualifikationen im internationalen Rahmen auszubauen.<br />
Wer bereits auf einem Hochschulstudium im<br />
Bereich Papier aufbaut, kann das Masterstudium in drei<br />
Semestern konsekutiv und gebührenfrei absolvieren.<br />
Interessenten/innen, die sich ausgehend von einem<br />
anderen Hochschulstudium spezifisch weiterbilden<br />
wollen, haben die Möglichkeit, das 4 Semester dauernde<br />
kostenpflichtige Weiterbildungsstudium zu wählen.<br />
Der Beginn im Masterstudium wird in jedem Semester<br />
ermöglicht und ist sowohl als Vollzeit- als auch als Teilzeitstudiengang<br />
zu bewältigen. Wie international üblich,<br />
sind für den Masterabschluss insgesamt 300 anrechenbare<br />
Kreditpunkte erforderlich. Die englischsprachigen<br />
Lehrveranstaltungen befähigen ausländische Studierende<br />
zum Studium in Deutschland und erhöhen bei<br />
deutschsprachigen Studierenden die internationale<br />
Sprachkompetenz. Die angebotenen Fächer sind sowohl<br />
wissenschaftlich ausgerichtet als auch mit starkem<br />
Praxisbezug versehen. Neben einer Vertiefung der fachlichen<br />
Kenntnisse werden dabei auch darüber hinaus -<br />
gehende wichtige Qualifikationen wie Sozialkompetenz,<br />
Teamarbeit und Kooperationsbereitschaft sowie Kommunikationsfähigkeit<br />
gefördert.<br />
Seit dem WS 2011/2012 bietet die Hochschule München<br />
den Masterstudiengang Verpackungstechnik an. Er<br />
richtet sich an besonders qualifizierte Absolventinnen<br />
und Absolventen der Bachelor-Verpackungsstudiengänge<br />
und aus thematisch verwandten Studienrichtungen wie<br />
Drucktechnik, Ernährungswissenschaften, Chemie. Die<br />
Masterausbildung zielt darauf ab, dass die Masterabsolventen<br />
in einem Betrieb besonders schnell Aufgaben in<br />
der Produktentwicklung und Anwendungstechnik übernehmen<br />
können und für spätere Leitungs- und Managementaufgaben<br />
vorbereitet sind.<br />
Insgesamt gibt es an der Hochschule München mit dem<br />
Studiengang Papier- und Verpackungstechnik ein hochinteressantes<br />
Spektrum von Studienmöglichkeiten im<br />
Bereich der biobasierten Fasermaterialien mit stark<br />
internationaler Ausrichtung und Betonung der künftigen<br />
Managementfähigkeiten.<br />
Möglichkeiten zur Promotion<br />
Der Abschluss „Master of Engineering“ ermöglicht den<br />
Studierenden den direkten Zugang zur Promotion. In<br />
der Studienrichtung „Papiertechnik“ gibt es aktuell einen<br />
Wechsel. Hr. Michael Jocher, betreut von Prof. Dr. Kleemann<br />
in Kooperation mit Prof. Dr. Biesalski, TU <strong>Darmstadt</strong>,<br />
hat seine Dissertation erfolgreich verteidigt. Die<br />
beiden anderen Doktoranden sind im Endspurt der Abgabe<br />
ihrer Arbeiten. Inzwischen steht schon der nächste<br />
Kandidat für eine Promotion fest. Hr. Marcel Prinz wird<br />
von Prof. Dr. Zollner-Croll in Kooperation mit Prof. Dr.<br />
Bauer, TU Graz, betreut und wird sich mit dem Thema<br />
Weichheit in Hygienepapieren beschäftigen.
Neues Wahlpflichtmodul: Innovative Faserprodukte<br />
Praktikum im Nonwoven Technology Center von Voith Paper in Düren<br />
Hochschule München<br />
Semester: Sommersemester <strong>2018</strong><br />
Modul: Innovative Faserprodukte (Bachelor Papiertechnik)<br />
Hochschule München: Prof. Dr. Helga Zollner-Croll<br />
Voith: Kai Pöhler<br />
Im Sommersemester <strong>2018</strong> wurde das erste Mal das Wahlpflichtmodul<br />
„Innovative Faserprodukte“ von Fr. Prof. Dr.<br />
Helga Zollner-Croll für das 6. Semester Papiertechnik und<br />
Verpackungstechnik angeboten. Dieses Modul fokussierte<br />
sich auf die neuesten Entwicklungen auf der Basis von<br />
biogenen Faserstoffen. Neben den unterschiedlichen<br />
Herstellungsverfahren und Einsatz gebieten von micro -<br />
fibrillierter Cellulose wurden auch Themen wie Leichtbaukonstruktionen<br />
und Bioökonomie behandelt.<br />
Ein detaillierter Einblick in die Herstellung von Nonwoven<br />
Materialien wurde bei einer Exkursion zu Voith nach<br />
Düren vermittelt. In Form eines zweitägigen Workshops<br />
vom 7. bis 8. Mai <strong>2018</strong> durften die Studierenden sich<br />
näher mit dem Thema der Schrägsiebtechnologie und<br />
deren Anwendung für die Produktion von Fließstoffen<br />
beschäftigen. Vertreter der Firma Voith, Kai Pöhler,<br />
Thomas Wolff und Egon Friesenhahn präsentieren<br />
zunächst die Firmenvorstellung von Voith.<br />
Anschließend ging es in die Tiefen der unterschiedlichen<br />
Herstellungsverfahren von Nonwoven Materialien. Der<br />
dritte Teil befasste sich mit dem Technology Center in<br />
Düren, speziell dem HydroFormer. Für alle Studierenden<br />
war dies hoch interessant, da, trotz des vorhandenen<br />
Wissens über die Papierindustrie, nur sehr wenig über<br />
Nonwoven oder die Herstellung durch das sogenannte<br />
Wet-laid-Verfahren bekannt war. Die Möglichkeit der<br />
Produktion von sogenannten Flushable Whipes sollte<br />
dann am nächsten Tag verdeutlicht werden. Besonders<br />
sollte dabei die Verfestigung mit Wasserstrahlen, dem sogenannten<br />
Spunlacing, hervorgehoben werden.<br />
Im Anschluss an die Vorträge wurde den Studenten die<br />
Aufgabe gestellt, für den Versuch am Folgetag die<br />
notwendigen Prozessparameter zu berechnen. Dies war<br />
für die Studenten eine gute Möglichkeit, bereits gelernte<br />
Theorie in der Praxis anzuwenden.<br />
Beim eigentlichen Papiermaschinenversuch bediente<br />
zunächst eine der beiden Gruppen den HydroFormer.<br />
Dabei stellten die Studierenden unter der Aufsicht von<br />
Egon Friesenhahn Nonwoven aus NBSK und Lyocell mit<br />
verschiedenen Graden der Wasserstrahlverfestigung her.<br />
Diese hergestellten Produkte wurden dann später im<br />
Labor untersucht und ausgewertet.<br />
Die zweite Gruppe führte unterdessen im Labor<br />
Messungen unter Aufsicht von Thomas Wolf an Produkten<br />
aus dem freien Handel durch. Vor allem die sogenannte<br />
Flushability war ein wichtiger Messpunkt, welche eine<br />
Besonderheit des Wet-laid-Verfahrens mit Wasserstrahlverfestigung<br />
darstellt. Dabei beurteilt man das Zerfaserungsverhalten<br />
von Produkten in Wasser unter<br />
Einwirkung von Scherkräften.<br />
Nach dem ersten Maschinenversuch wechselten die<br />
Gruppen und die zweite Gruppe produzierte an der<br />
Maschine Nonwoven mit einer anderen Mischung aus<br />
Fachgespräche zur Herstellung von Nonwoven Materialien<br />
Frischfasern und Lyocell. Die erste Gruppe untersuchte<br />
währenddessen das zuvor produzierte Nonwoven. Nach<br />
dem zweiten Maschinenversuch wurde auch das weitere<br />
produzierte Papier geprüft.<br />
Im Anschluss an den Versuchstag wurden die Ergebnisse<br />
der Laborprüfung zusammengetragen und besprochen.<br />
Hierbei zeigte sich den Studenten das Potential des<br />
Wet-laid-Verfahrens mit Nassverfestigung hinsichtlich<br />
der Herstellung von Flushable Whipes. Dazu zeigten<br />
sich auch die Gefahren handelsüblicher Produkte, die<br />
trotz anderslautender Markierungen auf den Verpackungen<br />
oft nur sehr schlecht bis gar nicht zerfasert werden<br />
konnten und so eine Gefahr für Abwasser-Systeme<br />
darstellen würden.<br />
Alles in Allem konnten die Studenten durch den Workshop<br />
sehr gute Einblicke in die Thematik des Wet-laid-<br />
Verfahrens erlangen. Sie zeigten sich auch sehr begeistert<br />
von der Planung, der Durchführung und den Ergebnissen<br />
der Tage.<br />
Text:<br />
Pascal Prinz, Prof. Helga Zollner-Croll,<br />
Hochschule München
Hochschule München<br />
Neubesetzung der Fachgebiete Elektrotechnik und Messen-<br />
Steuern-Regeln durch Prof. Dr. Andreas Poschinger –<br />
ein Interview nach einem Jahr Professorenerfahrung<br />
Könnten Sie sich bitte kurz persönlich verstellen?<br />
Meine besondere Schwäche sind Kameras: sie sind nicht<br />
nur schöne technische Spielzeuge; mich fasziniert auch<br />
diese besondere Art des bewussten Sehens mit Schärfe<br />
und Unschärfe.<br />
Was haben Sie vorher beruflich gemacht?<br />
Vor meiner Berufung an die Hochschule München war<br />
ich gut 17 Jahre bei der Siemens AG im Bereich der Straßenverkehrstechnik<br />
tätig. Dort war ich für die Entwicklung<br />
von Steuerungs- und Optimierungsalgorithmen,<br />
zuletzt vor allem für Lichtsignalanlagen, verantwortlich.<br />
Seit wann sind Sie an der Hochschule München und welche<br />
Fächer unterrichten Sie?<br />
Ich bin seit Oktober 2017 an der HM und unterrichte in<br />
der Nachfolge von Herrn Prof. Weber Elektrotechnik<br />
sowie Messen/Steuern/Regeln.<br />
Welches Erlebnis hat Sie in den letzten beiden<br />
Semestern am meisten beeindruckt?<br />
Ein einzelnes kann ich da gar nicht nennen. Zunächst<br />
fallen mir die vielen Exkursionen ein, die mich alle beeindruckt<br />
haben. Zwei Erlebnisse gingen über mehrere<br />
Tage und wirken von daher vielleicht auch am stärksten<br />
nach: in der Papiertechnik durfte ich die Studenten zum<br />
papiertechnischen Praktikum nach Heidenau begleiten<br />
und in der Verpackungstechnik konnte ich mir die<br />
Vorträge des Praxisunterrichts anhören. In beiden Fällen<br />
habe ich die jeweiligen Studierenden extrem motiviert<br />
und engagiert wahrgenommen. Bei diesen beiden<br />
Gelegenheiten haben sie mir auch einiges beigebracht.<br />
So konnte ich in Heidenau zum Beispiel auch einen SR-<br />
Wert bestimmen und am Klassierer mitwerken.<br />
Wie würden Sie Ihre Studierenden beschreiben?<br />
Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. In Heidenau<br />
und auch beim Praxisunterricht habe ich sie ja im jeweiligen<br />
Fachgebiet als sehr engagiert kennengelernt. Viele<br />
Studierende haben zumindest scheinbar eine angeborene<br />
Abneigung gegen Elektrotechnik.<br />
Welche Empfehlungen würden Sie den Absolventinnen<br />
und Absolventen mit auf dem beruflichen Weg geben?<br />
Ich gebe einige kleine praktische fachliche Empfehlungen<br />
beim jeweiligen Stoff. Bei den großen Empfehlungen<br />
halte ich mich noch zurück; da brauche ich erst noch<br />
mehr Einblick. Ansonsten empfehle ich natürlich immer<br />
ein Herz für die E-Techniker in der Firma zu haben.<br />
Wenn Sie durch Ihr Labor gehen, welche Geräte<br />
würden Sie gerne anschaffen?<br />
Das E-Technik Labor ist mir derzeit eher zu vollgepackt;<br />
daher geht es für mich im Augenblick eher um Sichten,<br />
Aussortieren und Austausch. Die vorhandenen Rechner<br />
sollten bald gegen neue getauscht werden, was allerdings<br />
auch Auswirkung auf Versuchsaufbauten hat, die Hardware<br />
und Betriebssysteme benötigen, die mit neuen<br />
Rechnern nicht mehr kompatibel sind. Ansonsten hoffe<br />
Andreas Poschinger<br />
ich, dass sich Gelegenheiten<br />
ergeben, mich an den<br />
eigentlichen fachbezogenen<br />
Maschinen einzubringen,<br />
z.B. bei der Antriebs- und<br />
Regelungstechnik der Versuchspapiermaschine.<br />
Eine erste Gelegenheit hat sich in<br />
der Verpackungstechnik ergeben: Ein Kollege hat mich<br />
eingebunden, die Anschlüsse für die Heizung und<br />
Steuerung sowie den Temperatursensor einer Klebedüse<br />
zu tauschen. Das ist zwar nichts großes, aber für mich<br />
doch das erste Mal, dass ich sehe, wie so eine Klebedüse<br />
von innen ausschaut.<br />
Welche Forschungsthemen würden Sie gerne bearbeiten?<br />
Grundsätzlich interessiert mich alles, was mit optimaler<br />
Steuerung und Regelung zu tun hat. In der Straßen -<br />
verkehrstechnik arbeite ich im Rahmen eines kleinen<br />
Forschungsprojektes an meinem alten Thema und ich<br />
betreue eine entsprechende Masterarbeit. Ich würde<br />
mich freuen, wenn sich auch in der Papiertechnik<br />
entsprechende Themen finden.<br />
Haben Sie bereits Ideen für Abschlussarbeiten?<br />
Neben meinen Ideen wäre es am Anfang durchaus auch<br />
günstig, wenn die Aufgabenstellungen an mich heran -<br />
getragen werden, damit ich Einblick bekomme, was für<br />
die Papierindustrie aus deren Sicht überhaupt relevant<br />
ist. Durch den Kontakt über den Praxisunterricht<br />
betreue ich eine erste Bachelorarbeit, in der es um<br />
Optimierung von Sekundärverpackungen geht; das finde<br />
ich natürlich sehr spannend. Könnte ich mir das Thema<br />
aussuchen, dann würde mich zum Beispiel interessieren,<br />
warum in Papierwerken Regler abgeschaltet werden.<br />
Offensichtlich gibt es regelungstechnisch viel Potential,<br />
sei es, dass die vorhandenen Regler besser, robuster,<br />
transparenter oder was auch immer werden müssen. Ich<br />
finde dabei den Aspekt der Akzeptanz sehr interessant,<br />
der bei rein technischen Betrachtungen gern vernach -<br />
lässigt wird. Gerade für eine solche Verbesserung der<br />
Regler braucht es sowohl regelungstechnisches als auch<br />
papiertechnisches Know-How, das in solchen Arbeiten<br />
zusammenfließen könnte.<br />
Haben Sie Interesse an Kooperationen mit der Industrie?<br />
Ja, natürlich gern; sowohl mit der eigentlichen Papier -<br />
industrie, als auch Maschinen- beziehungsweise Anlagenherstellern.<br />
Neben den Bachelor- und Masterarbeiten<br />
sowie Forschungsaufträgen habe ich gelernt, dass es<br />
auch Industriesemester gibt: Im Sommersemester 2019<br />
hätte ich wegen der Umstellung des Studienplans Zeit für<br />
ein solches Industriesemester. Vielleicht ergibt sich da was.
Exkursion zur Siemens AG in Nürnberg und Erlangen<br />
20.–22. Juni <strong>2018</strong><br />
Hochschule München<br />
Semester: Sommersemester <strong>2018</strong><br />
Modul: Automation-1 (Master Papiertechnologie)<br />
Hochschule München: Dr. Tobias Kleemann<br />
Siemens AG: Dr. Hermann Schwarz<br />
Das Master Programm der Papiertechnologie an der<br />
Hochschule München (HM) beinhaltet Kurse mit<br />
Schwerpunkt auf industrieller Prozessautomatisierung<br />
und Steuerung. Die Siemens AG ist ein Technologie -<br />
führer in Deutschland mit weltweit über 370.000 Mit -<br />
arbeitern und einer Abteilung, die sich vollständig auf<br />
die Faserindustrie konzentriert. Rund 90% der Aktivitäten<br />
von Siemens in der Biofaserindustrie betreffen die Zellstoff-,<br />
Papier-, Karton- und Tissueherstellung. Teil der<br />
engen Beziehung zwischen dem Papiertechnologie -<br />
studium an der Hochschule München und der Siemens<br />
AG ist der gemeinsame Wunsch, Studenten sowohl im<br />
Technikum der Hochschule als auch bei Siemens mit<br />
den neuesten Prozessleitsystemen vertraut zu machen.<br />
Der exklusiv auf die Studenten im Master der Papiertechnologie<br />
zugeschnittene Kurs ermöglicht den Studierenden<br />
der Automatisierungsvorlesung von Dr. Tobias Kleemann<br />
im Rahmen eines exklusiven Workshops persönlich mit<br />
der neuesten Version des dezentralen Prozessleitsystems<br />
von Siemens, SIMATIC PCS 7, zu arbeiten.<br />
Dieser Workshop, der von erfahrenen Branchenexperten<br />
von Siemens geleitet wird, vermittelt das Verständnis für<br />
die Zukunft der Prozesssteuerung und Prozessautomatisierung<br />
in der Zellstoff-, Papier-, Karton- und Tissue -<br />
industrie sowie einen Überblick der Servicebereiche von<br />
Siemens für diese Industrien. Dazu gehören Antriebssysteme,<br />
industrielle Automatisierung, Energieverteilung,<br />
Betrieb und Wartung. Die Zukunft der Prozesssteuerung<br />
und -automatisierung, nicht nur in der Faserindustrie,<br />
liegt in der Digitalisierung der Prozess- und Qualitätskontrolle<br />
für eine optimale Wertschöpfung für den<br />
Kunden.<br />
Gruppenbild am Siemens Werk Nürnberg<br />
Der Workshop zum Prozessleitsystem umfasst die<br />
Analyse von Möglichkeiten mit dem Siemens SIPAPER<br />
DCS APL Standard auf dem PCS 7 System der auf die<br />
Faserindustrien zugeschnittenen erweiterten Prozess -<br />
bibliothek (APL, advanced process library) von Siemens<br />
für das Prozessleitsystem (DCS, distributed control<br />
system). Damit ist die Steuerung von Ventilen, Motoren<br />
und Instrumenten fabrikweit möglich. Praktische Erfahrungen<br />
mit der neuesten Version der PCS 7-Software von<br />
Siemens bilden den Schwerpunkt des Workshops. Dazu<br />
gehören eine grundlegende Systemübersicht, das Hinzufügen<br />
neuer Signale und Regelkreise sowie die Analyse<br />
der Bedeutung von MMS (Mensch-Maschine-Schnittstelle).<br />
Die Aspekte dieses Workshops sind ein wesent -<br />
licher Bestandteil der Vorlesung und der Vision von<br />
Siemens für die Zukunft der gesamten Biofaserindustrien.<br />
Die Studenten verlassen den Kurs mit dem entsprechenden<br />
Wissen für ihre zukünftige Ingenieurskarriere.<br />
Das Engagement bei Siemens ist nicht nur auf den lehrreichen<br />
Workshop beschränkt. Siemens lädt die Studenten<br />
auch zu einer spannenden Werksbesichtigung ein, die<br />
dieses Jahr in Nürnberg stattfand und sich auf die<br />
Produktion von Motoren und Antrieben konzentrierte.<br />
Sowohl Niederspannungs- als auch Hochspannungs-<br />
Wechselstrommotoren werden hier für verschiedene<br />
Industrien auf der ganzen Welt produziert. Dies gab den<br />
Studenten einen Einblick in die Prinzipien der Produktion<br />
von Motoren und Antrieben.<br />
Die Interaktion der Studenten mit Siemens wird durch<br />
ein abwechslungsreiches Abendprogramm abgerundet,<br />
das den Studenten ermöglicht, das Beste aus dem<br />
Erlanger Raum zu erleben und gleichzeitig eine engere<br />
persönliche und berufliche Beziehung aufzubauen.
Hochschule München<br />
Hochschule München Down Under!<br />
Überbrückung der Zeit zwischen Masterstudium und Promotion<br />
Zum Ende meines Masterstudiums habe ich die einmalige<br />
Möglichkeit bekommen ein halbes Jahr in Australien zu<br />
verbringen. Dort absolvierte ich ein freiwilliges Praktikum<br />
bei encore Tissue in Melbourne, wodurch ich nicht<br />
nur wertvolle Erfahrungen in einem sehr beweglichen<br />
Unternehmen sammeln konnte, sondern auch meine<br />
Sprachkenntnisse verbessern konnte.<br />
Besonders spannend war dieses Praktikum aufgrund<br />
eines umfangreichen Umbaus der Papiermaschine. In<br />
kurzer Zeit wurde der Yankee-Gusszylinder, das Herzstück<br />
der Tissue Maschine, durch einen modernen Stahl-<br />
Zylinder ersetzt. Dadurch konnten Geschwindigkeit,<br />
Effizienz und Qualität erheblich gesteigert werden.<br />
Außerdem konnte ich das Team von encore tissue bei<br />
einigen den Umbau begleitenden Aufgaben unterstützen.<br />
Natürlich blieb neben dem Praktikum auch noch etwas<br />
Zeit, das Land und seine unvergleichbare Natur zu<br />
bereisen. Heute bin ich außerordentlich dankbar für die<br />
wertvollen Erinnerungen und auch ein bisschen stolz,<br />
das Abenteuer Australien so erlebt zu haben.<br />
Marcel Prinz, Hochschule München
Technische Universität Dresden<br />
Technische Universität Dresden<br />
Auf dem Weg in die Naturstofftechnik<br />
Nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Energie<br />
nehmen in der heutigen und künftigen Gesellschaft<br />
einen immer höheren Stellenwert ein.<br />
Dabei hat Nachhaltigkeit in Sachsen eine über 300jährige<br />
Tradition. Der Oberberghauptmann Hans Carl von<br />
Carlowitz begründete 1713 mit seinem Werk den forstwirtschaftlichen<br />
Nachhaltigkeitsbegriff in Freiberg/Sachsen.<br />
Dorthinein gliedert sich die Naturstofftechnik. Sie beinhaltet<br />
die Gewinnung, Aufbereitung und Verarbeitung<br />
von nachwachsenden (regenerierbaren) Naturstoffen.<br />
Nachhaltige Bioproduktion unter Einbeziehung aller Produktionsphasen<br />
und verantwortungsvoller Umgang mit<br />
der Biosphäre: Regenerationsfähigkeit und nachhaltige<br />
Nutzung stehen an zentraler Stelle.<br />
Verfahrenstechnik und Naturstofftechnik ist die Ingenieurwissenschaft<br />
von der physikalischen, chemischen<br />
und biologischen Stoffwandlung unter besonderer<br />
Beachtung von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.<br />
Sie nimmt eine Schlüsselstellung bei der Entwicklung<br />
und Realisierung innovativer ökonomischer und ökologischer<br />
Prozesse und Produkte ein, wie auch in der Holzund<br />
Papiertechnik. Auf der Basis der verwendeten<br />
Rohstoffe sind die Holz- und Papiertechnik der Biotechnologie<br />
zuzuordnen, die selbst als eine interdisziplinäre<br />
Wissenschaft verstanden wird, die sich mit der Nutzung<br />
von Enzymen, Zellen und ganzen Organismen in<br />
technischen Anwendungen beschäftigt.<br />
Einzigartig in Deutschland ist die Kompetenz in der<br />
gesamten Holzwertschöpfungskette, beginnend bei der<br />
Erzeugung der forstlichen Biomasse über den Holzbau,<br />
die Holzwerkstoffindustrie, die Zellstoff- und Papier -<br />
industrie, das Recycling des verarbeiteten Holzes bis<br />
hin zur energetischen Holznutzung gebündelt im<br />
Kompetenz zentrum LIGNOSAX, der auch die Professur<br />
für Holztechnik und Faserwerkstofftechnik angehört.<br />
Informationen<br />
Technische Universität Dresden<br />
Prof. Institut Dr.-Ing. für André Naturstofftechnik Wagenführ Prof. Dr. rer. nat. Frank<br />
Miletzky Professur für Holztechnik<br />
und Faserwerkstofftechnik<br />
Prof. Dr.-Ing. André Wagenführ<br />
Technische 01062 Dresden Universität Dresden<br />
Telefon: +49 (0)351 463 38101<br />
Institut für Naturstofftechnik<br />
E-Mail: andre.wagenfuehr@tu-dresden.de<br />
Professur www.tu-dresden/hft<br />
für Holztechnik und Faserwerkstofftechnik<br />
Prof. Dr.-Ing. André Wagenführ<br />
01062 Dresden<br />
Telefon: +49 (0)351 463 38101<br />
E-Mail: andre.wagenfuehr@tu-dresden.de<br />
www.tu-dresden/hft<br />
Wissenschaftsstandort Dresden<br />
Prof. Dr.-Ing. André Wagenführ Prof. Dr. rer.nat. Frank Miletzky
Technische Universität Dresden<br />
Wissenschaftsstandort Dresden<br />
Die sächsische Landeshauptstadt Dresden ist als Kunstund<br />
Kulturstadt ebenso bekannt wie durch ihre faszinierende<br />
Lage im oberen Elbtal. Hier sind seit langem<br />
Wissenschaft und Bildung, Technik und industrieller<br />
Fortschritt zu Hause.<br />
Als eine der ältesten technischen Hochschulen Deutschlands<br />
hat die Technische Universität Dresden (TUD)<br />
traditionell großen Anteil an der Anziehungskraft des<br />
Industrie- und Forschungsstandortes Dresden.<br />
Dresden ist Deutschlands Stadt mit der größten<br />
Forschungsdichte. Sowohl was die Anzahl des wissenschaftlichen<br />
Personals als auch die der Forschungsein -<br />
richtungen angeht, erreicht Dresden Spitzenwerte unter<br />
den deutschen Großstädten: 46 Forschungseinrichtungen<br />
sind lt. DFG-Erhebung in Dresden angesiedelt,<br />
Struktur des Instituts für Naturstofftechnik der Fakultät Maschinenwesen der<br />
TU Dresden ab 2017<br />
darunter 12 Fraunhofer-Institute bzw. Applikationszentren,<br />
3 Max-Planck-Institute, 3 Leibniz-Institute sowie ein<br />
Helmholtz-Center. Neben der TUD gibt es 5 weitere<br />
Hochschulen, 5 Fachhochschulen und 3 Berufsakademien<br />
sowie auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen,<br />
wie z. B. IHD.<br />
Die TUD ist seit 1994 eine Volluniversität mit 14 Fakul -<br />
täten und umfasst als größte Universität Sachsens alle<br />
Bereiche der Ingenieur-, Geistes-, Sozial- und Natur -<br />
wissenschaften sowie der Medizin. Besonders heraushebenswerte<br />
Disziplinen sind die Ingenieurwissenschaften<br />
mit Schwerpunkten im Maschinenbau, der Verfahrenstechnik,<br />
der Naturstofftechnik und dem Leichtbau.<br />
Gegenwärtig studieren hier mehr als 33.500 Studenten,<br />
davon über 4.300 Ausländer aus etwa 100 Ländern. Über<br />
9700 Studenten (ca. 29 %) sind in den Ingenieurwissenschaften<br />
eingeschrieben. Insgesamt über 7.600 Mitarbeiter<br />
(inkl. Medizin), darunter über 530 Professoren<br />
und Dozenten, gewährleisten in mehr als 100 Studienrichtungen<br />
günstige Studien- und Forschungsbedingungen<br />
für die Studierenden. Seit 2012 ist die TU Dresden<br />
eine von 11 deutschen Exzellenzuniversitäten.<br />
Das Institut für Naturstofftechnik setzt sich zusammen<br />
aus den Professuren für Holztechnik und Faserwerkstofftechnik,<br />
inklusive der Arbeitsgruppe Papiertechnik,<br />
der Professur für Lebensmitteltechnik, der Professur für<br />
Bioverfahrenstechnik, der Professur für Agrarsystemtechnik<br />
sowie der Professur für Verarbeitungsmaschinen/<br />
Verarbeitungstechnik.<br />
Im Institut bündeln sich Kompetenzen auf dem Gebiet<br />
der Gewinnung, Verarbeitung und Veredlung von Naturstoffen<br />
entlang der Wertschöpfungskette z. B. für<br />
Lebensmittel, biotechnologische Produkte oder Holzund<br />
Faserwerkstoffe im Sinne einer Kreislaufwirtschaft.<br />
Die gemeinsam mit dem Helmholtzzentrum für Umweltforschung<br />
Leipzig (UFZ) erfolgte Etablierung einer<br />
neuen Professur „Technologie produktiver Biofilme“ und<br />
die Ernennung des Vorstandes der Papiertechnischen<br />
Stiftung zum Honorarprofessor für Papiertechnik stärken<br />
das Institut für Naturstofftechnik inhaltlich weiter<br />
und unterstreichen die Vernetzung in der Region. Damit<br />
werden universitäre Ausbildung und Forschung mit<br />
industrie naher Forschung und Entwicklung noch besser<br />
verknüpft, wie sich dies auch in einer intensiven<br />
Beziehung zur Außenstelle des Fraunhofer IVV für<br />
Verarbeitungs maschinen und Verpackungstechnik<br />
manifestiert.<br />
Am noch jungen Institut forschen und lehren rund 160<br />
Mitarbeiter. Diese werben jährlich ca. 6 Mio. Euro Drittmittel<br />
ein und entlassen etwa 100 Diplomanden und<br />
10 Doktorranden in die Praxis. Zum Institutssprecher<br />
wurde Prof. Dr. Thomas Herlitzius gewählt.<br />
Die Mitarbeiter des Institutes für Naturstofftechnik sind<br />
auf folgenden Handlungsfeldern aktiv:<br />
π<br />
π<br />
π<br />
π<br />
π<br />
Sicherung der weltweiten Ernährung,<br />
Nachhaltige Gestaltung der Agrarproduktion,<br />
Produktion gesunder und sicherer Lebensmittel,<br />
Industrielle Nutzung nachwachsender Rohstoffe,<br />
Entwicklung von Energieträgern auf Basis von<br />
Biomasse.
Technische Universität Dresden<br />
Studium der Verfahrenstechnik<br />
und Naturstofftechnik –<br />
eine sinnvolle Klammer<br />
für die Papiertechnik<br />
Interdisziplinarität ist ein wesentliches Merkmal im<br />
Studiengang Verfahrenstechnik und Naturstofftechnik,<br />
der viele Berührungspunkte zu den Naturwissenschaften,<br />
zum Anlagenbau sowie zur Mess- und Automatisierungstechnik<br />
hat. Über die Teilgebiete Konstruktion und<br />
Fertigungstechnik besteht eine enge Verbindung zum<br />
Maschinenbau. Das Studium im Studiengang Verfahrenstechnik<br />
und Naturstofftechnik an der TU Dresden<br />
verknüpft Theorie und Praxis, indem es die natur- und<br />
ingenieurwissenschaftliche Grundlagenausbildung mit<br />
der anwendungsorientierten Wissensvermittlung im<br />
Rahmen umfangreicher Spezialisierungsmöglichkeiten<br />
verbindet.<br />
Holztechnik<br />
Die technische Nutzung des Rohstoffes Holz ist Gegenstand<br />
der Holztechnik: Sowohl der anatomische und chemische<br />
Aufbau als auch die mechanisch-physikalischen<br />
Eigenschaften sind dafür von grundlegender Bedeutung.<br />
Vor allem die Möglichkeit der Verarbeitung des Rohstoffes<br />
zu Halbwaren (z. B. Schnittholz, Holzwerkstoffe und<br />
Verbundwerkstoffe mit innovativen Papierwaben -<br />
konstruktionen oder Endprodukten (z. B. Bauelemente)<br />
stehen im Mittelpunkt der betrachteten Technologien.<br />
Dazu gehören die notwendigen Maschinen und Anlagen<br />
genauso wie z. B. Beschichtungsmittel oder Klebstoffe.<br />
Faserwerkstofftechnik<br />
Die Gewinnung, Modifizierung und Verarbeitung pflanz -<br />
licher Fasern allgemein zu Naturfaser-Dämmstoffen,<br />
Faser-Kunststoff-Verbunden bis hin zu Biocompositen<br />
stehen hier im Fokus. Umweltverträglicher Leichtbau ist<br />
dabei eine mögliche Anwendung.
Technische Universität Dresden<br />
Papiertechnik<br />
Die Erzeugung und Aufbereitung von Papierfaserstoffen,<br />
meist aus pflanzlichen Fasern, sowie die Erzeugung,<br />
Veredlung und Verarbeitung von Papier, Karton und<br />
Pappe beinhaltet die Papiertechnik. Dabei sind die Ein -<br />
sparung von Energie und Material sowie die Entwicklung<br />
von Verbunden (cellulose-basiert und auch aus Reststoffen<br />
der Papierindustrie) wesentliche Forschungsaspekte<br />
für ein auch in Zukunft nachhaltiges Material.<br />
Studium<br />
Die Studienrichtung „Holztechnik und Faserwerkstofftechnik“<br />
bietet das einzige ingenieurtechnische Diplom-<br />
Studium der Holzwissenschaften und Holztechnologie<br />
an einer deutschen Universität an und ist im o. g. Studiengang<br />
„Verfahrenstechnik und Naturstofftechnik<br />
(VNT)“ integriert. Seit 2012 ist die bisher separate<br />
Studienrichtung „Papiertechnik“ integraler Bestandteil<br />
der Studienrichtung.<br />
Neben dem grundständigen Studiengang existiert ein<br />
Diplom-Aufbaustudiengang VNT, der eine Fortsetzung<br />
des Studiums in der Studienrichtung „Holztechnik und<br />
Faserwerkstofftechnik“ für Absolventen mit anerkanntem<br />
berufsqualifiziertem Hochschulabschluss (BA, FH,<br />
Uni) Verfahrenstechnik (Holztechnik, Papiertechnik<br />
oder vergleichbar) – ebenfalls mit dem Abschluss<br />
Diplom ingenieur – ermöglicht.<br />
Weiterhin werden die Module im Rahmen der ingenieurtechnischen<br />
Vertiefung im Wirtschaftsingenieurstudium<br />
der TU Dresden angeboten.<br />
Die Inhalte des Grundfachstudiums sind fachübergreifend:<br />
π Physikalische Grundlagen der Holztechnik und<br />
Faserwerkstofftechnik<br />
π Chemische Grundlagen der Holztechnik und<br />
Faserwerkstofftechnik<br />
π Grundlagen der Holzanatomie<br />
π Grundlagen der Holztechnik und Faserwerkstoff -<br />
erzeugung<br />
π Grundlagen der Holztechnik und Faserwerkstoff -<br />
verarbeitung<br />
Anschließend werden sowohl holztechnische als auch<br />
papiertechnische Vertiefungsmodule mit folgenden<br />
Inhalten angeboten:<br />
π Möbel- und Bauelementeentwicklung<br />
π Holzschutz<br />
π Holztrocknung und -modifikation<br />
π Praxis der Holztechnologie<br />
π Produktfertigung<br />
π Füge- und Beschichtungstechnik<br />
π Trenntechnik<br />
π Holzbau<br />
π Technisches Design<br />
π Design-Grundlagen<br />
π Fertigung von Faserverbundstrukturen<br />
π Kunststofftechnologien<br />
π Maschinen und Prozesse der Papierherstellung<br />
π Maschinen und Prozesse der Papierverarbeitung<br />
π Papierphysik und Papierprüfung<br />
π Papier- und Zellstoffchemie<br />
π Innovative naturfaserbasierte Produkte<br />
π Spezielle Prozess- und Regelungsstrategien der<br />
Papiertechnik<br />
π Papierkreisläufe und Altpapieraufbereitung<br />
Praxis steht Pate<br />
Die Vorteile des integrierten Studienganges liegen auf<br />
der Hand: branchenübergreifende Vermittlung von<br />
Kenntnissen, die sich aus den Stärken und Spezifika der<br />
jeweiligen Bereiche ableiten; dadurch fachübergreifende<br />
Methodik und stärkere Festigung der gemeinsamen<br />
Grundlagen.<br />
Im Studienverlauf ergeben sich für die Studierenden<br />
vielfältige Möglichkeiten, das gesamte Holz basierte<br />
wirtschaftliche Umfeld kennen zu lernen und sich<br />
praxisorientiert zu vertiefen. Dazu tragen neben einigen
Technische Universität Dresden<br />
Vertiefungsmodulen auch die gemeinsamen Exkursionen<br />
zu Unternehmen und Einrichtungen sowohl der Holzund<br />
Holzwerkstofftechnik als auch der Papierindustrie<br />
sowie Praktika an der Papiertechnischen Stiftung (PTS)<br />
in Heidenau bei.<br />
Förderung durch die Wirtschaft<br />
Das vielseitige, praxisnahe Studium bietet tiefe Einblicke<br />
in die Holz-, Holzwerkstoff-, Papier- und Zulieferindustrie,<br />
weiterverarbeitenden Industrien sowie in weitere<br />
Branchen. Im fünfjährigen Studium werden neben den<br />
naturwissenschaftlichen und verfahrenstechnischen<br />
Kenntnissen auch interdisziplinäre Denkweisen vermittelt,<br />
die für den späteren beruflichen Erfolg notwendig<br />
sind.<br />
Dabei zeichnet sich das Studium durch:<br />
π Eine zielgerichtete Qualifikation für zukünftige<br />
Nachwuchskräfte, z. B. durch geförderte Tagungsbesuche<br />
und Einbindung in Netzwerke der Holzund<br />
Papierindustrie<br />
π Eine international anerkannte Ausbildung<br />
π Hervorragende Möglichkeiten, während des<br />
Studiums Erfahrungen im Ausland zu sammeln<br />
(entweder im Studium durch das Belegen von<br />
Auslandssemestern und/oder während des<br />
Praktikums)<br />
π Eine breite Unterstützung aus der Industrie sowie<br />
durch die Verbände (Vielzahl von Stipendien)<br />
π Frühzeitige Kontakte zu Industrieunternehmen<br />
durch Exkursionen und Firmenpräsentationen<br />
sowie<br />
π Keine Studiengebühren für das Erststudium an der<br />
TU Dresden<br />
aus.<br />
Studienvoraussetzungen<br />
Folgende in Deutschland erworbene Hochschulzugangsberechtigungen<br />
ermöglichen die Zulassung für ein<br />
grundständiges Studium an der TU Dresden:<br />
π Die allgemeine Hochschulreife (Abitur).<br />
π Die fachgebundene Hochschulreife berechtigt zum<br />
Studium bestimmter Studiengänge.<br />
π Ein bereits in Deutschland erfolgreich abgeschlossenes<br />
Hochschulstudium.<br />
π<br />
π<br />
π<br />
Der Abschluss einer bestimmten beruflichen Aufstiegsfortbildung<br />
(z. B. Meisterabschluss) nach<br />
einem Beratungsgespräch an der TU Dresden.<br />
Eine abgeschlossenen Berufsausbildung und<br />
mindestens dreijährige Berufserfahrung und<br />
eine erfolgreich an der TU Dresden absolvierte<br />
Zugangsprüfung.<br />
Eine abgeschlossenen Berufsausbildung und ein<br />
Studium von 2 Semestern an einer staatlichen oder<br />
staatlich anerkannten Hochschule.<br />
Nähere Informationen zu den Studienvoraussetzungen<br />
sind unter https://tu-dresden.de/studium/organisation/<br />
studienvoraussetzungen/stdv_grundstaendig nachzulesen.<br />
Promotionen<br />
Der Abschluss Diplomingenieur ermöglicht nach wie vor<br />
den Anschluss einer Promotion zum Doktor-Ingenieur.<br />
2017 wurden drei Promotionen an der Professur für<br />
Holztechnik und Faserwerkstofftechnik abgeschlossen:<br />
Herr Jan Herold beendete seine Arbeit mit dem Titel<br />
„Neue Verfahrensansätze zur Beschlagbefestigung an<br />
Möbelbauteilen in Sandwichbauweise“. Das Thema der<br />
Arbeit von Herrn Frank Jornitz lautete „Entwicklung<br />
eines Verfahrens zur Aufbereitung von lignocellulosen<br />
Reststoffen aus der Altpapieraufbereitung für den<br />
Einsatz in faserverstärkten Kunststoffen“. Herr Dirk<br />
Siebrecht befasste sich in seiner Promotion mit einem<br />
„Beitrag zur Abbildung möglicher Konstruktionsprozesse<br />
im Polstermöbelbau im Kontext moderner<br />
computergestützter Entwicklungsumgebungen“.<br />
Auf dem papiertechnischen Gebiet beendet Uwe Müller<br />
<strong>2018</strong> seine Promotion zu dem Thema „Neue Ansätze<br />
für das Konzept Demand-Response unter Verwendung<br />
papiersortenspezifischer Kennzahlen“. Alexandra Hodes<br />
von der Hochschule Leipzig, promoviert zum Themas<br />
„Charakterisierung der Oberflächeneigenschaften von<br />
Bedruckstoffen hinsichtlich der Verarbeitbarkeit im<br />
Druck- und Verpackungsprozess mit spektroskopischen<br />
Methoden und dynamischen Penetrationsmessungen“<br />
in Kooperation mit Prof. Lutz Engisch (HTWK Leipzig).<br />
Herr Michael Vogel erforscht die „Anforderungsgerechte<br />
Gestaltung der mechanischen und dielektrischen Eigenschaften<br />
von Papier“. René Kleinert arbeitet im Rahmen<br />
seiner Promotion am Thema „Elektronenstrahlvorbehandlung<br />
zur energieeffizienten Gewinnung von<br />
biogenen Rohstoffen“. Thomas Schrinner schreibt eine
Technische Universität Dresden<br />
Promotion zum Thema „Energetische Prozessoptimierung<br />
und nachhaltiger Ressourceneinsatz in der Alt -<br />
papierstoffaufbereitung.“<br />
Weitere Arbeiten auf dem Gebiet der Papiertechnik<br />
werden durch Prof. Frank Miletzky betreut. Frau Anke<br />
Steinberg arbeitet an dem Thema „Entwicklung einer<br />
verfahrenstechnischen Vorgehensweise zur Funktionalisierung<br />
von Papieroberflächen am Beispiel antimikrobieller<br />
Ausrüstung“. Frau Birgit Lutsch promoviert zum<br />
Thema „Herstellung von Nanocompositen aus Cellulose<br />
und präzipitiertem Calciumcarbonat zur Festigkeitssteuerung<br />
in Papier“.<br />
Herr Gerrit Roosen bearbeitet das Thema „Untersuchungen<br />
zur Ursächlichkeit fingerrilliger Planlageabweichungen<br />
in der Papierherstellung“. Frau Marie Kühne arbeitet<br />
auf dem Gebiet des 3D-Umformens von Papier und<br />
Karton.<br />
Auszeichnungen<br />
Auf der letzten APV-Hauptversammlung wurde Frau<br />
Inga Regir mit dem VNOP-Preis ausgezeichnet. Diese<br />
Auszeichnung wurde in Vertretung für RA Christian<br />
Prinz, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Nord- und<br />
Ostdeutscher Papierfabriken (VNOP), durch Prof. Dr.<br />
Frank Miletzky vorgenommen. Inga Regir erhielt diesen<br />
Preis für die beste Diplomarbeit, die sie zum Thema<br />
„Evaluierung geeigneter Prozessparameter für die<br />
Herstellung eines Kartons im Trockenverfahren unter<br />
Berücksichtigung des notwendigen Bindemittel- und<br />
Wassereinsatzes“ geschrieben hat.<br />
Herr Prof. Dr. rer. nat. Frank Miletzky wurde auf der<br />
diesjährigen Jahreshauptversammlung des Vereins der<br />
Zellstoff- und Papier-Chemiker und -ingenieure mit der<br />
Hans-Clemm-Denkmünze ausgezeichnet. Hans Clemm<br />
hat die Denkmünze für herausragende, besondere wissenschaftstechnische,<br />
literarische oder organisatorische<br />
Arbeiten gestiftet. Die Laudatio wurde von Herrn Prof.<br />
Dr.-Ing. Samuel Schabel gehalten. Er würdigte in der<br />
Laudatio die tiefe Verbundenheit von Frank Miletzky zur<br />
Cellulosechemie und zur Papiertechnik. Frank Miletzky<br />
widmet sein ganzes Berufsleben der Forschung, einem<br />
der wesentlichen Aktivitätsbereiche des Vereins Zellcheming.<br />
Neue Prüfgeräte an der<br />
TU Dresden<br />
Fibertester von ABB Lorentzen&Wettre<br />
Die Faserdimensionsanalyse bildet die Basis für eine<br />
moderne materialtechnische Charakterisierung von<br />
Faserstoffen für die Papierfabrikation. Mit dem Fibertester<br />
FT 912 von ABB Lorentzen&Wettre können prozess -<br />
bedingte Materialveränderungen z. B. durch Mahlung<br />
oder Versuche zur Analyse faserbasierter Rohstoffe einfach<br />
ermittelt werden. Besondere Beachtung verdient die<br />
erweiterte Charakterisierung des Feinstoffanteils und des<br />
Fibrillierungsgrads. Die Aufteilung des Feinstoffs in sogenannten<br />
Primärfeinstoff (P) und Sekundärfeinstoff (S)<br />
ermöglicht Aussagen über die Entwicklung des Feinstoffcharakters;<br />
der Fibrillenanteil bezogen auf den Umfang<br />
der projizierten Faserfläche ist ein sensibler Parameter<br />
zur Beschreibung der äußeren Fibrillierung des Faserstoffs.<br />
Zwischen der Zunahme des Sekundärfeinstoffs (S),<br />
der auch als Fibrillenstoff bezeichnet wird, und der<br />
Zunahme des umfangbezogenen Fibrillenanteils besteht<br />
ein logarithmischer Zusammenhang.<br />
Faserstoffverspinnungen (oben links), Holzstoffsplitter (oben rechts) und<br />
Laubholz-Gefäß zel len in verschiedenen Bearbeitungsstadien (unten), wie sie<br />
vom Fibertester im „Objekte“ genannten Modul erkannt und als nicht zu<br />
„Fasern“ gehörig identifiziert werden.<br />
Informationen<br />
Sie finden nähere Informationen auf der unserer<br />
Homepage und der Homepage der TU Dresden.<br />
http://tu-dresden.de/hft bzw. http://tu-dresden.de<br />
Gerne können Sie sich mit Ihren Fragen auch<br />
persönlich an uns wenden.<br />
Entwicklung des Feinstoffanteils während einer JOKRO-Mahlreihe von<br />
Eukalyptuszellstoff, gemessen mit dem Fibertester (linke Ordinate). Der<br />
Zusammenhang zum faserumfangsbezogenen Fibrillenanteil (rechte Ordinate)<br />
wird deutlich.
Technische Universität Dresden<br />
Dynamic Drainage Analyzer DDA5 von PulpEye<br />
DDA5-Entwässerungskurven einer JOKRO-Mahlreihe von Eukalyptuszellstoff<br />
Die Messung und Verfolgung der Entwässerungsfähigkeit<br />
von Faserstoffsuspensionen in Abhängigkeit verschiedenster<br />
Prozessstufen, wie z. B. der Mahlung, der<br />
Mischung verschiedener Faserstoffkomponenten, aber<br />
auch das Zusammenwirken mit chemischen Additiven<br />
und deren Einfluss sowohl auf die Entwässerungsgeschwindigkeit<br />
als auch auf das Retentionsverhalten von<br />
beispielsweise Füllstoffen gehört zu den Grundvoraus -<br />
setzungen für eine moderne materialtechnische Charakterisierung<br />
von Faserstoffen für die Papierfabrikation.<br />
Der Dynamic Drainage Analyzer DDA5 von PulpEye<br />
zeichnet sich durch einfache Bedienung aus und kann<br />
über eine Vakuum-Entwässerung die Bedingungen auf<br />
einer Papiermaschine simulieren. Über gesteuerte<br />
Scherkräfte lassen sich Pumpen und andere Maschinen<br />
nachstellen. Neben klassischen Entwässerungskurven<br />
werden Kennwerte für die initiale Entwässerung und die<br />
Entwässerungsgeschwindigkeit bereitgestellt. Neu sind<br />
in dieser Gerätegeneration ein Trübungssensor zur<br />
Beschreibung des Retentionsverhaltens und ein Temperatursensor.<br />
Der Trübungskennwert steht nachweislich<br />
in engem Zusammenhang mit dem am Fibertester<br />
bestimmten Anteil an Feinstoff (S). Die entwässerten<br />
Faserstoffkuchen lassen sich einfach entnehmen und<br />
stehen für weitere Untersuchungen, wie z. B. einer<br />
Bestimmung des End-Trockengehalts mit der Wärmeschrankmethode<br />
zur Verfügung. Mit dem zur Verfügung<br />
stehenden vollständigen Sortiment an 8 Sieben zwischen<br />
500 µm und 25 µm lichte Maschenweite kann auch der<br />
Erweiterung des Faserspektrums hin zu naturfaser -<br />
basierten Produkten und damit verbundenen Fasermodifizierungen<br />
bis in den Bereich mikro- und nanoskaliger<br />
Faserstoffe entsprochen werden.<br />
Somerville-Fraktionator von Xell<br />
Stippengehalt über einer Schlitzplatte von<br />
150 µm Schlitzweite nach verschiedenen<br />
Zerfaserungsdauern für eine 1:1-Mischung<br />
aus Zeitungen und Zeitschriften<br />
Die Messung und Verfolgung der Zusammensetzung<br />
von Faserstoffsuspensionen hinsichtlich ihrer Anteile an<br />
Fasern und Feinstoff, besonders aber an Stippen und<br />
Splittern in Abhängigkeit verschiedenster Prozessstufen<br />
gewinnt mit steigendem Einsatz alternativer Faserstoffe<br />
bzw. alternativer Faserstoffaufbereitungsprozesse wie der<br />
Trockenzerfaserung zunehmend an Interesse. Der<br />
Somerville-Fraktionator wurde zwar ursprünglich für die<br />
Bestimmung von Splittern in Holzschliffen entworfen,<br />
wird aber inzwischen für die Bewertung von Splittern<br />
und Faserbündeln auf alle Holzstoffe und Zellstoffe angewendet<br />
und ist weit verbreitet für die Bestimmung des<br />
Sticky-Anteils in Altpapierfaserstoffen. Mit dem kompletten<br />
Schlitzplatten-Satz (Schlitzweiten 80 µm, 100 µm,<br />
150 µm und 200 µm) lässt sich diese gesamte Faserstoffpalette<br />
mit unterschiedlichsten Ansprüchen an das<br />
Sortierergebnis bearbeiten.<br />
Die Arbeitsgruppe Papiertechnik in der Professur für<br />
Holztechnik und Faserwerkstofftechnik dankt der Vereinigung<br />
der Arbeitgeberverbände der Deutschen Papierindustrie<br />
e. V. (VAP) und der Fritz-Landmann-Stiftung<br />
Hamburg für die Finanzierung dieser Prüfgeräte.
Technische Universität <strong>Darmstadt</strong><br />
Papiertechnik und<br />
biobasierte Faserwerkstoffe<br />
Nachhaltig Zukunft sichern –<br />
auf dem Weg<br />
in eine Bio-Ökonomie<br />
Künftig wird unsere Gesellschaft ihre Bedürfnisse<br />
aus nachwachsenden Rohstoffen und erneuerbaren<br />
Energiequellen decken. Produkte werden rezyklierbar<br />
und kompostierbar sein.<br />
Die Zukunft der Papiertechnik nutzt die von der Natur<br />
sehr hoch entwickelten Fasern aus Holz und Pflanzen<br />
und liefert eine Vielzahl von Produkten für alltägliche<br />
Anwendungen (Zeitschriften, Verpackungen, Filter,<br />
Elektronikbauteile, usw.).<br />
Deutschland ist weltweit führend auf dem Gebiet der<br />
Papiertechnik, die Nummer eins in Europa bei der<br />
Papierproduktion. Viele Weltmarktführer aus dem<br />
Anlagen- und Maschinenbau und der chemischen<br />
Industrie befinden sich hier. Diese Branchen machen<br />
sich mit besten Voraussetzungen auf den Weg in die<br />
Bio-Ökonomie und entwickeln Leichtbaulösungen für<br />
Fahrzeuge und Mobilität auf Faserbasis, Werkstoffe für<br />
intelligente Baumaterialien aus nachwachsenden<br />
Rohstoffen, funktionale Lösungen für die medizinische<br />
Diagnostik und vieles mehr. Diese interdisziplinäre<br />
Branche freut sich auf kreativen Nachwuchs, der die<br />
Zukunft gestalten möchte.<br />
Inbetriebnahme unserer neuen Papiermaschine „Athene“
In ausgezeichnetem Umfeld<br />
studieren<br />
Technische Universität <strong>Darmstadt</strong><br />
Die Studiengänge im Fachbereich Maschinenbau<br />
an der TU <strong>Darmstadt</strong>, zu denen auch der Master-<br />
Studiengang Papiertechnik und biobasierte<br />
Faserwerkstoffe gehört, zählen zu den besten in<br />
Deutschland und wurden in den letzten Jahren<br />
regelmäßig ausgezeichnet.<br />
Sie sind z. B. stets unter den besten drei Studiengängen<br />
in verschiedenen Rankings zu finden. Unerreicht sind<br />
die äußerst hohen Erfolgsquoten im Fachbereich Maschinenbau.<br />
Mindestens 80 Prozent der Studienanfänger<br />
schaffen einen erfolgreichen Abschluss.<br />
Wer diesen Studiengang absolviert hat, ist zu wissenschaftlich<br />
ausgerichteter, selbstständiger Berufstätigkeit<br />
auf dem gesamten Gebiet der Papierfabrikation, der<br />
Entwicklung von Maschinen zur Herstellung und Veredlung<br />
von Papier und der Drucktechnik befähigt. Für den<br />
Masterstudiengang Papiertechnik und biobasierte Faserwerkstoffe<br />
mit etwa fünf Studierenden pro Jahrgang ist<br />
eine sehr persönliche Betreuung charakteristisch.<br />
Teamarbeit wird bei uns groß geschrieben! Die unter den<br />
Oberbegriffen Advanced Design Project und Advanced<br />
Research Project angebotenen Projektkurse bereiten auf<br />
ingenieurtypisches Arbeiten in Teams vor und haben<br />
den Anspruch eines gemeinsamen Forschens und<br />
Lernens von Studierenden und Lehrenden. Dies wird<br />
auch durch eine Vielzahl von Abschlussarbeiten und<br />
HiWi-Jobs im Rahmen von aktuellen Forschungsprojekten<br />
untermauert. So erfolgte beispielsweise die Inbetriebnahme<br />
der Pilot-Papiermaschine Hand in Hand<br />
zwischen studentischen Hilfskräften und wissenschaftlichen<br />
Mitarbeitern des Fachgebietes. Vielfältige Veranstaltungen<br />
außerhalb des Studiums, wie z. B. Firmenbesuche<br />
und Exkursionen im In- und Ausland sind ebenfalls<br />
wert voller Bestandteil des Studiums und ermöglichen<br />
den Blick über den Tellerrand hinaus. Der Alumni-Verein<br />
(APV <strong>Darmstadt</strong>) hat über 350 Mitglieder und bietet<br />
eine tolle Möglichkeit, Kontakte in Industrie und Forschung<br />
zu knüpfen.<br />
Bei der APV Sommerexkursion im Mai 2017 besuchten wir die Papierfabriken<br />
Scheufelen in Lenningen und Koehler in Kehl am Rhein. Die Exkursion klang<br />
mit einer Stadtbesichtigung von Straßburg aus (2. von oben).<br />
Die APV Wanderung (3. von oben) mit Sommerfest fand am 24. Juni statt.<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachgebiets (rechts)
Technische Universität <strong>Darmstadt</strong><br />
Interdisziplinärer Studiengang<br />
mit breiter ingenieurwissenschaftlicher Basis<br />
Voraussetzung für ein Studium im Masterprogramm<br />
Papiertechnik und biobasierte Faserwerkstoffe ist ein<br />
Bachelor-Abschluss in einer Natur- und Ingenieurwissenschaft.<br />
Auch Absolventen von Hochschulen<br />
und dualen Hochschulen haben Zugang zu diesem<br />
Studiengang. Hier sind jedoch ggf. Übergangsregelungen<br />
zu beachten, über die das Fachgebiet gerne<br />
persönlich informiert.<br />
Der Masterstudiengang ist interdisziplinär angelegt und<br />
hat folgende übergeordnete Ziele:<br />
π<br />
π<br />
π<br />
π<br />
π<br />
π<br />
π<br />
π<br />
Ausbau von Kompetenzen zur Lösung technischer<br />
Probleme<br />
Entwicklung innovativer Produkte, Prozesse und<br />
Methoden<br />
Strukturierung komplexer Probleme unter Berücksichtigung<br />
der relevanten technologischen, ökono -<br />
mischen und ökologischen Kriterien<br />
Kooperationen mit anderen Disziplinen, gemeinsame<br />
Erarbeitung von Lösungen mit anderen Wissensbereichen<br />
Auseinandersetzung mit betriebswirtschaftlichen<br />
Auswirkungen neugeschaffener Produkte, Prozesse<br />
oder Methoden<br />
Schaffung einer Basis für unternehmerisches Denken<br />
Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen<br />
Herausforderungen und Folgen der Ingenieursarbeit<br />
Motivation zur Übernahme von Verantwortung in<br />
Technik und Gesellschaft<br />
π Grundlegendes Verständnis der Prozesse zur Herstellung<br />
und zum Recycling von Papier- und Faserwerkstoffen.<br />
Während des viersemestrigen Studiengangs beschäftigen<br />
sich die Studierenden mit den Grundlagen der Makromolekularen<br />
Chemie, mit verfahrenstechnischen<br />
Grundlagen und Anwendungen zum Recycling, zur<br />
Herstellung und Aufbereitung von Papier und anderen<br />
faserbasierten Werkstoffen und mit einer Einführung in<br />
die Biologie der Pflanzen. Der Studiengang ist geprägt<br />
von einem breiten Wahlpflichtbereich, in dem Studierende<br />
ihren eigenen Schwerpunkt bilden können.<br />
Informationen<br />
Nähere Informationen zum Studiengang und den<br />
Studieninhalten finden sich unter<br />
www.pmv.tu-darmstadt.de
Innovationen<br />
aus nachwachsenden Rohstoffen gestalten<br />
Technische Universität <strong>Darmstadt</strong><br />
Am Fachgebiet Papierfabrikation und Mechanische<br />
Verfahrenstechnik, welches den Studiengang Papiertechnik<br />
und biobasierte Faserwerkstoffe verantwortet, laufen<br />
ständig etwa 20 Forschungsprojekte unterschiedlicher<br />
Ausprägung. Studierende haben von Anfang an die<br />
Möglichkeit, aktiv in der Forschung mitzuwirken, z. B.<br />
als wissenschaftliche Hilfskraft oder im Rahmen von<br />
Projekt- oder Abschlussarbeiten.<br />
Im Fokus der Forschung stehen Wertstoffkreisläufe,<br />
Umwelt- und Verbraucherschutz, sowie neue und<br />
innovative Lösungen auf Faserbasis. Hier bieten das<br />
Fachwissen und die Erfahrungen aus dem Bereich der<br />
Papiertechnik sehr gute Chancen, Beiträge zur Entwicklung<br />
neuer nachhaltiger und biobasierter Werkstoffe für<br />
verschiedenste Anwendungen zu leisten.<br />
Das kreative Umfeld der Technischen Universität<br />
<strong>Darmstadt</strong>, die zu den besten in Deutschland gehört<br />
und an der insbesondere auch interdisziplinäre Arbeiten<br />
und Projektansätze gefördert werden, bietet hierfür eine<br />
nahezu unerschöpfliche Inspirationsquelle.<br />
Aktuelle Forschungsthemen<br />
sind z.B.<br />
π<br />
π<br />
π<br />
Die Entfernung von umwelt- oder gesundheitsgefährdenden<br />
Stoffen aus Altpapier mit Hilfe der Extraktion<br />
mit überkritischem CO2<br />
3D-Drucken mit faserbasierten Pasten, so dass vollständig<br />
kompostierbare Druckprodukte entstehen<br />
Entwicklung von Baustoffen und Komponenten auf<br />
Papierbasis für energieeffizienten, lastpfadoptimierten<br />
und umweltgerechten Leichtbau<br />
π Modellierung und Simulation der trockenen Altpapier -<br />
sortierung und Weiterentwicklung einer automa tischen<br />
Messanlage zur Bestimmung der Altpapierzusammen -<br />
setzung<br />
π<br />
π<br />
Optimierung von Trennprozessen in Stoffaufbereitungsanlagen<br />
unter Anwendung von Methoden aus<br />
dem Operations Research<br />
Entwicklung von biobasierten Faserschäumen als<br />
Ersatz für konventionelle Dämmstoffe
Technische Universität <strong>Darmstadt</strong><br />
Forschungsprojekt BAMP! –<br />
Bauen mit Papier<br />
Der vom LOEWE-Programm des Landes Hessen<br />
geförderte Schwerpunkt soll langfristig dazu beitragen,<br />
die Vorteile des Werkstoffes Papier für das Bauwesen<br />
systematisch zu erschließen, Voraussetzungen für ein<br />
neues Wirtschaftsfeld mit einem international sichtbaren<br />
Schwerpunkt in Hessen zu etablieren und an den<br />
beteiligten Universitäten und Hochschulen langfristig zu<br />
verankern.<br />
Modellhaft sollen Stab- und Flächenelemente auf Papierbasis<br />
entwickelt werden.<br />
Der Fokus liegt dabei auf Bauwerken für temporäre<br />
Nutzung. Technologien und Systeme zur Herstellung<br />
solcher Bauwerke für Einsatzbereiche, wie Übergangsbauten<br />
für gewerbliche Zwecke oder Schulen, Notunterkünfte<br />
oder einmalige Großveranstaltungen sowie für<br />
so genannte „Microhomes“ oder im Messebau, wurden<br />
bisher in Deutschland nur wenig entwickelt.<br />
Sie stellen aber ein größeres Potential dar, sowohl für<br />
Material, Konstruktion als auch den optimierten Einsatz<br />
von Ressourcen und Finanzmitteln, da gerade bei temporär<br />
genutzten Bauwerken die Verwendung nachhaltiger<br />
Materialien und effizienter Prozesse eine große Rolle<br />
spielt.<br />
Das von Professor Samuel Schabel, Fachgebiet Papierfabrikation und<br />
Mechanische Verfahrenstechnik, Professor Ariel Auslender, Fachbereich<br />
Architektur und Professor Markus Biesalski, Fachbereich Chemie gemeinsam<br />
entwickelte „Instant Home“ aus Papier
Technische Universität <strong>Darmstadt</strong><br />
Im April 2017 wurden die Umbaumaßnahmen am<br />
Fachgebiet Papierfabrikation und Mechanische Verfahrenstechnik<br />
der Technischen Universität <strong>Darmstadt</strong><br />
abgeschlossen und der BAMP!-Raum mit Leben gefüllt.<br />
Die Schleiferei musste dem Fortschritt weichen.<br />
Den frei gewordenen und neu renovierten Raum mit<br />
altem Industriecharme nehmen nun Architekten,<br />
Bauingenieure, Chemiker, Maschinenbauer und<br />
Papieringenieure gleichermaßen gemeinsam ein und<br />
nutzen ihn für interdisziplinäres Arbeiten.
VPM/APV Vortragsreihe 25. und 26. Oktober 2019 in Salzburg<br />
Symposium 2017<br />
KLARTEXT. BIOÖKONOMIE.<br />
Standortbestimmung – Herausforderungen und Chancen<br />
für die Zellstoff- und Papierindustrie<br />
In unserer Vortragsreihe hinterfragen wir kritisch: Wie gestaltet die Zellstoff- und Papierindustrie den Prozess der<br />
Transformation in eine biobasierte Wirtschaft? Wie ermöglicht sie Innovationen für neue Geschäftsfelder?<br />
Wie nutzt sie Chancen für die Einführung neuer Technologien zur Herstellung erneuerbarer und recyclingfähiger<br />
Produkte um damit einen Beitrag zur Maximierung der Wertschöpfung von Produkten aus Holz zu leisten?<br />
Vortragsangebote zum Programm der Tagung 2019 sind uns willkommen.<br />
Wir bitten diese bis zum 31.12.<strong>2018</strong> mit Titel, Autor und einem kurzen Abstract (max. 300 Wörter) einzusenden<br />
an helga.zollner-croll@hm.edu<br />
Impressum<br />
<strong>Tagungsband</strong> zum Symposium der Papieringenieure <strong>2018</strong>, Köln, 12. und 13. Oktober <strong>2018</strong><br />
Herausgeber:<br />
Vereinigter Papierfachverband München e.V., Riedstraße 40, 72810 Gomaringen,<br />
vertreten durch den 1. Vorsitzenden Kai Pöhler<br />
Akademischer Papieringenieurverein an der TU Dresden e.V. (APV), Postfach 200111, 01804 Heidenau,<br />
vertreten durch den 1. Vorsitzenden Ulrich Mallon<br />
Akademischer Papieringenieurverein (APV) <strong>Darmstadt</strong> e.V., TU <strong>Darmstadt</strong> –<br />
Fachgebiet Papierfabrikation und Mechanische Verfahrenstechnik (PMV), Alexanderstraße 8, 64283 <strong>Darmstadt</strong>,<br />
vertreten durch den 1. Vorsitzenden Claus Raschka<br />
Redaktion:<br />
Dr.-Ing. Kerstin Graf, Ina Greiffenberg<br />
Gestaltung:<br />
Müller-Stoiber+Reuss, <strong>Darmstadt</strong><br />
Copyright © <strong>2018</strong><br />
Nachdruck, auch auszugsweise, und Veröffentlichung der Texte und Bilder nur mit schriftlicher Genehmigung<br />
der Herausgeber
KLARTEXT. DIGITALISIERUNG | Symposium der Papieringenieure <strong>2018</strong>