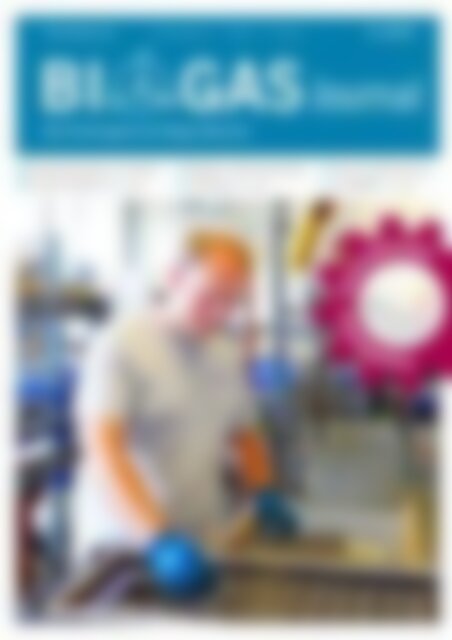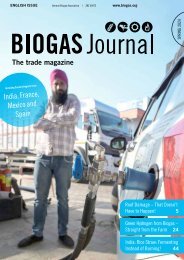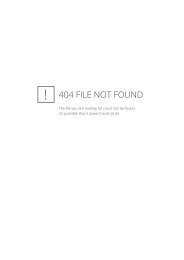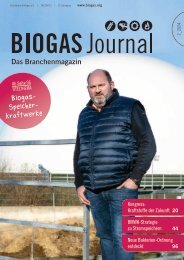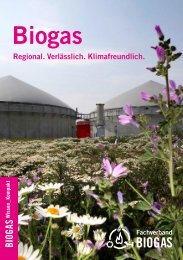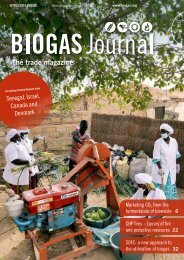6_2019 Leseprobe
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
www.biogas.org Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 50073 | 22. Jahrgang 6_<strong>2019</strong><br />
BI<br />
GAS Journal<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche<br />
Riesenweizengras: ein ökonomischer<br />
Vergleich S. 66<br />
Malaysia: Gute Aussichten<br />
für Biogas S. 98<br />
Recht: Flexibilisierung<br />
von BHKW S. 124<br />
Innovationen<br />
Titelthema:<br />
Adressfeld
Titelthema: Innovationen<br />
INHALT<br />
BIOGAS JOURNAL | 6_<strong>2019</strong><br />
46<br />
TITELFOTO: DIERK JENSEN I FOTOS: WELTEC-BIOPOWER GMBH, CARMEN RUDOLPH, FACHVERBAND BIOGAS E.V.<br />
EDITORIAL<br />
3 Bio-Gas, nie war es so wertvoll wie heute<br />
Von Dr. Claudius da Costa Gomez,<br />
Hauptgeschäftsführer des<br />
Fachverbandes Biogas e.V.<br />
26 Messeneuheiten<br />
42 „Wir kochen nicht!“<br />
Von Dierk Jensen<br />
46 Problemlöser für Nährstoffüberschüsse<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH)<br />
Martin Bensmann<br />
AKTUELLES<br />
6 Meldungen<br />
8 Termine<br />
10 Biogas-Kids<br />
12 Klimaschutz durch CO 2<br />
-Bepreisung<br />
monetarisieren<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
18 Modell einer Strohauktion entwickeln<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
22 Flexibler Betrieb fordert Biogas-BHKW<br />
Von Thomas Gaul<br />
POLITIK<br />
36 Biogas wieder auf dem Vormarsch:<br />
Erste Schritte im Klimapaket der<br />
Bundesregierung geschafft<br />
Von Sandra Rostek und Dr. Guido Ehrhardt<br />
40 CDU-Initiative zu Infrastrukturbeschleunigung<br />
– geplanter Angriff<br />
aufs Völkerrecht?<br />
Von Heinz Wraneschitz<br />
50 Kohlenstoffspeicherung generiert<br />
Einnahmen durch Humusbildung<br />
Von Bernward Janzing<br />
PRAXIS<br />
56 Kiestrocknung mit Plus fürs Klima<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
62 Gezielte Fütterung: Gesammelte<br />
Erfahrungen<br />
Von Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
66 Riesenweizengras – ein interessantes<br />
Substrat<br />
Von Dr. Michael Dickeduisberg<br />
70 Strom und Wärme aus der Kloschüssel<br />
Von Klaus Sieg<br />
74 Anlagen des Monats: September & Oktober<br />
4
BIOGAS JOURNAL | 6_<strong>2019</strong><br />
INHALT<br />
56 74<br />
INTERNATIONAL<br />
75 AK Sicherheit<br />
Vorsicht beim Umgang mit<br />
Ammoniumsulfatlösung (ASL)<br />
Von Phillip Berns<br />
76 Von Wangen in die Welt<br />
Von Christian Dany<br />
WISSENSCHAFT<br />
80 Mikroplastik drastisch reduzieren<br />
Von Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
84 Biogas und hochwertige Extraktstoffe<br />
aus Reststoffen der Gemüse- und<br />
Obstproduktion<br />
Von Dr. Stefan Dröge<br />
und Marie-Caroline Jonville<br />
Beilagenhinweis: Das Biogas Journal enthält<br />
Beilagen der Firmen agrikomp, CarboTech AC,<br />
greentec, Oesterle, ONERGYS, SaM-Power<br />
und UNION Instruments.<br />
Frankreich<br />
92 Biogasbranche in Unruhe<br />
Von Dipl.-Ing · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
Malaysia<br />
98 Gute Aussichten für Biogas<br />
Interviewer: Dipl.-Ing. agr. (FH)<br />
Martin Bensmann<br />
China<br />
102 Analyse der Strategien und Normen<br />
hinsichtlich Biomethan in China<br />
Von Jingyue Hou<br />
VERBAND<br />
Aus der Geschäftsstelle<br />
106 Das „Klimapäckchen“ und seine Folgen<br />
Von Dr. Stefan Rauh und<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
110 Was macht eigentlich die Task Force<br />
Verbändeintegration?<br />
Von Dr. Claudius da Costa Gomez<br />
112 Aus den Regionalbüros<br />
116 Dialogprozess Gas 2030<br />
Von Dr. Simone Peter, BEE<br />
118 EU-Düngeprodukt-Verordnung<br />
Prinzipien für die CE-Kennzeichnung<br />
festgelegt<br />
Von Dipl.-Ing. Mathias Hartel<br />
120 TRAS 120 den Betreibern nicht<br />
„überstülpen“!<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
RECHT<br />
124 Flexibilisierung von Satelliten-Standorten<br />
und Biomethan-BHKW<br />
Von Dr. Hartwig von Bredow<br />
und Burkhard Hoffmann<br />
128 Schiedsspruch zum Flex-Zubau bei<br />
Satelliten-BHKW und Votum zur Aufspaltung<br />
einer Anlage veröffentlicht<br />
Von Elena Richter<br />
130 Impressum<br />
5
AKTUELLES<br />
BIOGAS JOURNAL | 6_<strong>2019</strong><br />
Modell einer Strohauktion<br />
entwickeln<br />
FOTO: ADOBE STOCK_ZHAO JIANKANG<br />
Ende August fand im nordrhein-westfälischen Heiden bereits zum vierten Mal die sogenannte<br />
Strohtagung statt. Dabei ging es nicht ausschließlich um diesen Reststoff als<br />
Energiequelle. In zwei Highlight-Vorträgen ging es beispielsweise um die Spurenelementversorgung<br />
mit Nickel und Wolfram sowie um die Optimierung von Membranen in der<br />
Ultrafiltration.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Mit der Frage, ob die Einführung einer<br />
Strohmarktplattform in Deutschland<br />
sinnvoll ist, beschäftigen sich Anja Mertens<br />
und Alexandra Pfeiffer vom Deutschen<br />
Biomasseforschungszentrum<br />
(DBFZ) in Leipzig. Dabei schauen sie auch auf andere<br />
Länder, wie zum Beispiel Dänemark, und untersuchen<br />
die Frage, ob deren Marktmodell auf Deutschland übertragbar<br />
ist. In dem skandinavischen Land wird Stroh<br />
seit Mitte der 1980er Jahre in großen Mengen als<br />
Energieressource genutzt. „Für die Strohbeschaffung<br />
für große Strohkraftwerke wurde Anfang der 2000er<br />
Jahre ein Strohauktionsmodell eingeführt“, berichtete<br />
Mertens.<br />
Das dänische Strohauktionsmodell sei eine modifizierte<br />
Version des bekannten Beschaffungsinstruments<br />
„Electronic Reverse Auction“ (eRA). Dabei handele es<br />
sich um eine Methode des strategischen Einkaufs, der<br />
in den 1990er Jahren in den USA entwickelt wurde.<br />
Die Auktion sei internetbasiert und beschaffungsseitig<br />
initiiert. Sie findet in Echtzeit statt. „Im dänischen<br />
Auktionsmodell definiert der Käufer die Qualitätsanforderungen<br />
in der eRA. Die Lieferanten reagieren auf eine<br />
Ausschreibung und bieten das Produkt Stroh zu einem<br />
möglichst niedrigen Preis an. Dabei fällt der Preis im<br />
Laufe der Auktion. In der Theorie schafft dies eine neutrale,<br />
anonymisierte und distanzierte Beziehung zwischen<br />
Käufer und Verkäufer“, verdeutlichte Mertens.<br />
Der Strohmarkt in Deutschland sei eine Nische und<br />
eher regional definiert sowie durch schwankende<br />
Marktpreise gekennzeichnet. Pfeiffer: „Basierend<br />
auf den gewonnenen Daten in Deutschland würde die<br />
Mehrheit der wirtschaftlichen Akteure mit einem hohen<br />
Strohbedarf ein zentralisiertes anstatt eines dezentralen<br />
Einkaufsmodells bevorzugen. Darüber hinaus wünschen<br />
sich die Shareholder, dass ein Auktionsmodell<br />
von einem unabhängigen Dritten verwaltet wird, wie<br />
zum Beispiel einem Handelsverband.“ Das ermögliche<br />
einer breiteren Vielfalt an Käufern und Verkäufern den<br />
Zugang zum Strohmarkt.<br />
Fazit der beiden Wissenschaftlerinnen: Eine direkte<br />
Übertragung des dänischen Auktionsmodells auf<br />
Deutschland ist nicht möglich. Jedoch könne ein<br />
geeignetes Auktionsmodell den zugrundeliegenden<br />
18
BIOGAS JOURNAL | 6_<strong>2019</strong><br />
AKTUELLES<br />
„Spurenelemente, die nicht komplexiert<br />
sind, können leicht als homöopathische<br />
Dosen im Fermenter verbleiben“<br />
Mechanismus eines zentralisierten eRA nutzen. Sie<br />
empfehlen, in einem nächsten Schritt ausgewählte<br />
Strohkäufer und -verkäufer in einer Modellregion in<br />
Deutschland einzubinden, um eine Beta-Version eines<br />
zentralen Auktionsmodells zu entwicklen.<br />
„Wer Biogas nicht erzeugt, der handelt ökologisch fahrlässig“,<br />
sagte Prof. Dr. Paul Scherer von der Hochschule<br />
für Angewandte Wissenschaften in Hamburg zu Beginn<br />
seines Vortrages. Er referierte auf der Tagung über die<br />
Dosierung von Spurenelementen wie Nickel und Wolfram<br />
in Gärprozessen. „Spurenelemente, die nicht komplexiert<br />
sind, können leicht als homöopathische Dosen<br />
im Fermenter verbleiben, da sie ausgefällt werden und<br />
Mikroorganismen nur die gelösten, aktiven Ionen aufnehmen<br />
können“, betonte der Wissenschaftler.<br />
Zur Ermittlung des Spurenelementbedarfs werde in der<br />
Regel der gesamte Inhalt einer Substratprobe per Säureaufschluss<br />
analysiert. Egal, ob es bioverfügbare oder<br />
gebundene Ionen sind, sodass diese meist limitiert<br />
oder gar nicht verfügbar sind. Das neue sowohl im Labor<br />
als auch im Großmaßstab getestete Konzept ergebe<br />
per Direktanalysen der gelösten und damit bioverfügbaren<br />
Ionen ein sofortiges Bild über die für die Mikroorganismen<br />
bioverfügbare, aktive Ionenkonzentration.<br />
Als Messinstrument kann grundsätzlich eine hochauflösende<br />
Variante der gängigen Spektroskopie mit induktiv<br />
gekoppeltem Plasma und Massenspektrometer<br />
(ICP-MS-Analytik) sowie die an der HAW adaptierte<br />
Röntgen-Fluoreszenz-Spektroskopie (TXRF) zum Einsatz<br />
kommen. In den über drei Jahre laufenden Konti-<br />
Laborreaktoren mit Stroh stellten Scherer und Doktorand<br />
Sebastian Antonczyk fest, dass sehr niedrige, sich<br />
an der Nachweisgrenze befindende Nickelmengen (< 1<br />
Mikrogramm/L) in Abhängigkeit von der Verweilzeit und<br />
der organischen Raumbelastung mit bis zu 6.000 Milligramm<br />
pro Liter hohe organische Fettsäurewerte einstellten.<br />
Die sukzessive Zugabe von Nickel reduzierte<br />
laut Scherer die Fettsäuren nicht. Erst eine zusätzliche<br />
Wolframzugabe im gleichen Konzentrationsbereich wie<br />
Nickel habe eine drastische Abnahme der Fettsäuren<br />
und eine drastische Zunahme der Zellzahlen für Methanbildner<br />
bewirkt.<br />
Die Zuführung von Spurenelementen und die Direktanalyse<br />
der gelösten Ionen wurden ferner in einer konventionellen<br />
Hofbiogasanlage in Seth (Biogas Seth GmbH<br />
& Co.KG, Schleswig-Holstein) mit einer installierten<br />
elektrischen Leistung von 190 Kilowatt mit drei par-<br />
Prof. Dr. Paul Scherer<br />
Wir machen Ihre Biogasanlage fit für die Zukunft.<br />
Besuchen Sie unseren<br />
Messestand:<br />
Halle 09, Stand D28<br />
Die Schmack Service-Kompetenz:<br />
10.–12. Dezember <strong>2019</strong>, Nürnberg<br />
Betriebsführung<br />
Modernisierung<br />
Technischer<br />
Service<br />
Biogasanlage<br />
Biologischer<br />
Service<br />
Profitieren Sie jetzt von mehr als 20 Jahren<br />
Biogas-Know-how.<br />
Schmack ist der kompetente Service-Partner rund<br />
um Ihre Biogasanlage. Von der Beratung über<br />
Optimierung bis hin zur Betriebsführung sind wir<br />
gerne für Sie da. www.schmack-biogas.de<br />
Schmack Biogas Service GmbH · 24-Stunden-Service-Hotline: Tel. +49 (0) 9431 751-277<br />
info@schmack-biogas.com<br />
19
AKTUELLES<br />
BIOGAS JOURNAL | 6_<strong>2019</strong><br />
allel betriebenen Fermentern im Rahmen eines FNRgeförderten<br />
Forschungsprojektes über drei Jahre mittels<br />
TXRF an der HAW erfolgreich überwacht (FNR-FKZ<br />
22011710). Im 115 m³ Testfermenter wurde im laufenden<br />
Betrieb die Temperatur ohne Leistungseinbußen<br />
bis auf 59 Grad Celsius (Optimum 56 bis 57 °C) erhöht.<br />
Gleichzeitig wurde eine Pasteurisierung des Inputmaterials<br />
und sogar eine Trocknung der Gärreste erreicht.<br />
Extrem kurze Verweilzeiten von 11,5 Tagen und eine<br />
extrem hohe Raumbelastung von 14 Kilogramm organische<br />
Trockensubstanz pro Kubikmeter Fermentervolumen<br />
und Tag konnten im Dauerbetrieb bei voller<br />
Leistung realisiert werden. Es wurden jede Woche die<br />
kurzkettigen Fettsäuren quantifiziert, die immer wieder<br />
in Richtung 4.000 bis 7.000 Milligramm pro Liter<br />
pendelten. Der 115 Kubikmeter Referenzfermenter<br />
wurde mit 53 Grad Celsius gefahren. Bei der Futterzusammensetzung<br />
von 70 Prozent Gülle sowie 30 Prozent<br />
Mais- und Grassilage wurde für gelöstes Nickel die<br />
Schwellenkonzentration im Bereich von 0,05 bis 0,1<br />
Milligramm pro Liter ermittelt.<br />
Nickel senkt Fettsäurekonzentration<br />
„Da über die Milchviehfütterung kein Nickel (da im<br />
Futter nicht enthalten, weil nicht zugelassen) über den<br />
Verdauungstrakt in die Gülle gelangen konnte, war dieses<br />
Spurenelement im Gärsubstrat auch nur schwach<br />
vorhanden. Aufgrund der Zugabe von Nickel ging die<br />
Fettsäurekonzentration wegen der kurzen Verweilzeit<br />
bereits innerhalb einer Woche nachhaltig zurück“, erklärte<br />
Scherer.<br />
Der Zusatz von Wolfram mag, nach Scherers Worten,<br />
überraschen, da die meisten Biogasanlagen bei Raumbelastungen<br />
von 3 bis 5 gefahren werden. Bei diesen<br />
Belastungen und bei mesophil (bis 41 °C) etabliert sich<br />
eine völlig andere Methanflora mit Acetatverwertung,<br />
die kein Wolfram benötigt. Bei höheren Raumbelastungen<br />
und thermophil müssen H 2<br />
-CO 2<br />
-verwertende<br />
Methanbildner das CO 2<br />
erst durch ein Wolfram-Molybdänenzym<br />
in Ameisensäure einbinden und benötigen<br />
daher dieses Spurenelement.<br />
Die Kontifermentation von Stroh im Laborfermenter<br />
mit einer praxisnahen Mischkultur habe zum ersten<br />
Mal offenbart, dass eine hohe Beladungsrate für eine<br />
mesophile als auch eine thermophile Betriebsweise<br />
gelöste Wolframionen von >100 Mikrogramm pro Liter<br />
erfordere, ebenso wie >100 Mikrogramm pro Liter gelöste<br />
Nickelionen, wenn die Fettsäuren sinnvollerweise<br />
Titelthema: Innovationen<br />
PRAXIS / TITEL<br />
BIOGAS JOURNAL | 6_<strong>2019</strong><br />
Problemlöser für Nährstoffüberschüsse<br />
FOTOS: WELTEC-BIOPOWER GMBH<br />
Nebeneinander aufgereiht,<br />
von links: unbehandelte<br />
Schweinegülle,<br />
abgetrennte Feststoffe,<br />
Filtrat nach dem Siebband<br />
und schließlich<br />
klares Wasser, das nach<br />
der letzten Reinigungsstufe,<br />
der Umkehrosmose,<br />
entsteht und in<br />
den Vorfluter eingeleitet<br />
werden darf.<br />
Die stationäre Wirtschaftsdüngeraufbereitung kann unter bestimmten Voraussetzungen<br />
ökonomisch eine interessante Alternative zum Transport von unbehandeltem Dünger sein.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
In Ysselsteyn, nur wenige Kilometer nordwestlich<br />
von Venlo (Niederlande) wurde 2016 auf der „grünen<br />
Wiese“ eine Anlage zur Komplettaufbereitung<br />
von Wirtschaftsdünger errichtet. Eine Kooperation<br />
von Landwirten, die unter dem Namen Merensteyn<br />
B.V. firmiert, hat dort in die Errichtung einer sogenannten<br />
„Kumac-Anlage“ investiert. Geliefert hat die Anlage<br />
die deutsche Weltec-Biopower GmbH aus Vechta,<br />
die auch als Hersteller von Biogasanlagen bekannt ist.<br />
„Entwickelt wurde diese Art der Wirtschaftsdünger-<br />
Aufbereitung in 2007 von einem ehemaligen Mitarbeiter<br />
unserer Muttergesellschaft WEDA Dammann & Westerkamp<br />
GmbH. Ende 2016 hat Weltec-Biopower die<br />
Lizenz übernommen und baut und vertreibt seitdem die<br />
Kumac-Anlagen“, erläutert Produktmanager Thomas<br />
Sextro. Der Entwickler betreut inzwischen die Anlagen<br />
in den Niederlanden. Insgesamt sind dort zwölf Kumac-<br />
Anlagen in Betrieb, eine davon auf einer Biogasanlage.<br />
In Belgien sind es drei, wovon zwei an Biogasanlagen<br />
Gärdünger aufbereiten.<br />
„Hier in Ysselsteyn wird nur Schweinegülle verarbeitet.<br />
An zwei Tagen pro Woche darf der Standort nicht beliefert<br />
oder Dünger abgeholt werden, da sich in der Nachbarschaft<br />
ein Pilzzuchtbetrieb befindet. Die komplette<br />
Güllelogistik wird per Lkw erledigt“, erklärt Sextro. Die<br />
anliefernden Tankwagen werden gewogen und pumpen<br />
anschließend in eines der drei gasdicht verschlossenen<br />
Erdbecken, die als aufnehmende Lagerbehältnisse fungieren.<br />
Ein runder Lagerbehälter dient als Speicher für<br />
das flüssige Düngerkonzentrat.<br />
180.000 Tonnen Schweinegülle pro Jahr mit einem<br />
durchschnittlichen Trockensubstanzgehalt von 6 Prozent<br />
verarbeitet die Kumac-Anlage an dem Standort.<br />
Übrig bleiben 55 Prozent reines Wasser, dass in einen<br />
Graben eingeleitet wird. Außerdem produziert die Anlagen<br />
aus der Ausgangsmenge einen Anteil von 25 Prozent<br />
an Feststoffen und etwa 20 Prozent an flüssigem<br />
Nährstoffkonzentrat. Ab 70.000 Tonnen Jahresdurchsatzmenge<br />
lohnt sich eine Kumac-Linie.<br />
Funktionsweise<br />
Und so funktioniert es: Die Schweinegülle wird aus den<br />
Erdbecken über einen sogenannten Mazerator, der zur<br />
Zerkleinerung des Materials und zur Störstoffabtrennung<br />
dient, in einen 25 Kubikmeter fassenden Mischbehälter<br />
in der Technikhalle (20 x 45 Meter) gepumpt.<br />
In diesem Mischbehälter werden Schwefelsäure und<br />
Eisensulfat in einer bestimmten Menge in die Schweinegülle<br />
eindosiert. Mit der Schwefelsäure wird der pH-<br />
Wert eingestellt und mit dem Eisensulfat der Phosphor<br />
ausgefällt. Von der fertigen Mischung werden in regelmäßigen<br />
Intervallen die Turmmischer vor den Siebbandpressen<br />
befüllt. In das Substrat im Turmmischer<br />
wird ein Flockungsmittel (Polymer) dosiert. Das Polymer<br />
wird als Pulver angeliefert. Auf der Anlage wird es<br />
mit Prozesswasser verflüssigt. „Durch die Zugabe des<br />
Polymers flocken die feinsten Bestandteile und lassen<br />
sich so leichter von der Flüssigkeit abscheiden. Ein alternatives<br />
Flockungsmittel auf Kartoffelstärkebasis haben<br />
wir erfolgreich getestet. Jedoch ist dessen Einsatz<br />
derzeit wirtschaftlich leider noch nicht darstellbar“,<br />
macht Sextro aufmerksam. Die fertige Mixtur verlässt<br />
die Turmmischer und gelangt auf die Siebbandpressen,<br />
wo ihr die Flüssigkeit entzogen wird. Die beiden<br />
46
BIOGAS JOURNAL | 6_<strong>2019</strong><br />
PRAXIS / TITEL<br />
Thomas Sextro, Produktmanager<br />
bei der Weltec-Biopower GmbH,<br />
vor einer von drei Umkehrosmoseanlagen.<br />
FOTO: MARTIN BENSMANN<br />
umlaufenden Siebbänder werden<br />
über Rollen und Walzen<br />
geführt. Das Substrat wird zwischen<br />
den beiden Bändern, die<br />
flüssigkeitsdurchlässig sind,<br />
eingeschlossen. Während der<br />
Führung über die Walzen und<br />
Rollen nimmt der Druck auf die<br />
Siebbänder stetig zu, was die<br />
Entwässerung erhöht. Die Siebbänder<br />
werden an einer Stelle<br />
regelmäßig mit Prozesswasser<br />
gespült. Das Filtrat wird unter<br />
der Presse in einer offenen Bodenwanne<br />
aufgefangen.<br />
Hygienisierung des Feststoffs<br />
Der Feststoff verlässt mit etwa 30 Prozent TS-Gehalt an einem<br />
Ende die Presse. Er wird thermisch per Strahlungswärme mittels<br />
Infrarotstrahlern in offenen Förderschneckenwannen behandelt,<br />
dabei hygienisiert und anschließend dem Lagerraum zugeführt.<br />
Pro Stunde kann jede Siebbandpresse etwa 12,5 Kubikmeter<br />
Schweinegülle entwässern. Die Standzeit der Siebbänder gibt<br />
Sextro mit einem Jahr an. Zweite Reinigungsstufe nach den Siebbandpressen<br />
ist das Flotationsbecken. Es wird gespeist mit dem<br />
Filtrat aus den offenen Bodenwannen.<br />
„Das Filtrat wird in das Flotationsbecken gepumpt. Das Prozesswasser<br />
wird mit Druckluft versetzt und anschließend von unten in<br />
das Flotationsbecken eingebracht. Durch die Entspannung steigen<br />
Luftbläschen auf, an denen sich Schwebeteilchen anlagern, die an<br />
der Oberfläche mit einem kontinuierlich laufenden Schiebesystem<br />
abgetragen werden können. Schwimm- und Sinkschichten werden<br />
in den Mischbehälter gepumpt. Am Ende der Flotationsstufe<br />
nimmt ein Speichertank das Filtrat aus dieser Reinigungsstufe<br />
auf“, beschreibt Sextro das Verfahren weiter.<br />
Die dritte Reinigungsstufe stellt ein Papierbandfilter dar, wovon<br />
hier vier parallel in Betrieb sind. Die Filter arbeiten vollautomatisch<br />
mit Durchflussmessung. Sie reinigen das Filtrat, das die<br />
Flotationsstufe verlässt. Das Filterband ist zu einer Rolle aufgerollt,<br />
die an einer Seite des Geräts eingesetzt ist. Es wird von dort<br />
durch das Gerät durchgeführt und nimmt dabei feinste Partikel<br />
aus dem Filtrat auf. Am anderen Ende des Papierbandfilters wird<br />
der beaufschlagte Papierfilter aufgerollt. Je nach Beschaffenheit<br />
des Filtrats reicht eine Papierrolle für acht bis zehn Tage. Es ist der<br />
einzige Abfallstoff, der anfällt.<br />
Viel Phosphor und Stickstoff im Feststoff<br />
Als letzter Verfahrensschritt folgt die dreistufige Umkehrosmose<br />
mit sich anschließendem Ionentauscher. „In der ersten Stufe der<br />
Umkehrosmose gewinnen wir das Nährstoffkonzentrat. Alles was<br />
in der zweiten und dritten Stufe abgetrennt wird, führen wir noch<br />
einmal der ersten Stufe zur Behandlung zu. Nahezu 100 Prozent<br />
der Phosphors befindet sich im Feststoff. Das Nährstoffkonzentrat<br />
47
PRAXIS / TITEL<br />
BIOGAS JOURNAL | 6_<strong>2019</strong><br />
Blick auf die beiden Siebbandpressen.<br />
Davor stehen die blauen Turmmischer.<br />
Siebbandpresse in der Seitenansicht. Sehr gut sind die Rollen und Walzen<br />
zu sehen, über die die beiden Bänder geführt werden. Dabei wird der Dung<br />
mit steigendem Druck entwässert. In der Wanne unter der Presse sammelt<br />
sich die abgepresste Flüssigkeit.<br />
Am Ende der beiden Siebbandpressen<br />
wird der Feststoff ausgetragen.<br />
Zweite Reinigungsstufe nach den Siebbandpressen<br />
ist das Flotationsbecken.<br />
Es wird gespeist mit dem Filtrat aus den<br />
offenen Bodenwannen.<br />
Vier solcher Papierfilteranlagen kommen auf<br />
der Anlage in Ysselsteyn zum Einsatz.<br />
Die Umkehrosmose arbeitet dreistufig. Hiervon<br />
sind insgesamt drei in Betrieb.<br />
Die getrockneten und hygienisierten Feststoffe<br />
werden in einer Halle bis zum Abtransport gelagert.<br />
ist somit frei von Phosphor. Und 70 Prozent<br />
des Stickstoffs sind ebenfalls im Feststoff<br />
gebunden“, betont Sexto. Die Membranen<br />
in der Umkehrosmose müssen nach einem<br />
Jahr Betriebseinsatz ausgetauscht werden.<br />
Der Ionentauscher nimmt die klare, gereinigte<br />
Flüssigkeit der Umkehrosmose auf<br />
und entmineralisiert sie sozusagen. In der<br />
Sauberes Wasser wird in die Natur entlassen.<br />
Umkehrosmose und beim Ionentauscher<br />
finden mehrere kontinuierliche Leitfähigkeitsmessungen<br />
statt, um die Reinheit<br />
des abzuscheidenden klaren Wassers gewährleisten<br />
zu können. Denn es ist ganz<br />
wichtig, dass die Einleitwerte eingehalten<br />
werden. Am Ende bleibt reines Wasser<br />
übrig, das zum Beispiel in den Vorfluter<br />
FOTOS: WELTEC-BIOPOWER GMBH<br />
eingeleitet werden kann. Das gewonnene<br />
Nährstoffkonzentrat verlässt die Anlage als<br />
Flüssigdünger, der in der Landwirtschaft<br />
eingesetzt wird.<br />
Die gesamte Kumac-Anlage wird mit elektrischer<br />
Energie betrieben. Sie hat einen<br />
Strombedarf von 12 Kilowattstunden pro<br />
Kubikmeter. Wärme muss nicht separat bereitgestellt<br />
werden. Die Betriebskosten für<br />
diese Anlage inklusive Polymer, Stromkosten,<br />
Wartung und Instandhaltung gibt Sextro<br />
mit 6 bis 7 Euro pro Kubikmeter an. Am<br />
Wochenende läuft die Anlage auch ohne<br />
Personal. Ein bis eineinhalb Vollzeitarbeitskräfte<br />
seien für diese Anlagengröße einzuplanen.<br />
In Kürze soll auch in Deutschland<br />
die erste Kumac-Anlage in Betrieb gehen.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
0 54 09/90 69 426<br />
martin.bensmann@biogas.org<br />
48
INTERNATIONAL<br />
BIOGAS JOURNAL | 6_<strong>2019</strong><br />
Den französischen Betreibern Vincent<br />
(links) und Yannick Utard bereitet vor<br />
allem die Verwendung von Maisstroh<br />
immer wieder auch Anlagenprobleme.<br />
FRANKREICH<br />
Biogasbranche in Unruhe<br />
Paris<br />
Frankreich fördert seit einigen Jahren verstärkt den Ausbau Erneuerbarer<br />
Energien. Ein neuer Gesetzentwurf will die ambitionierten<br />
Zielvorgaben nun deutlich nach unten revidieren. Vor allem die<br />
Kosten für Biomethananlagen sollen drastisch sinken.<br />
Von Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
Deutsche Biogasanlagenbauer konzentrieren<br />
sich auf ausländische Märkte und versuchen,<br />
durch die Internationalisierung ihrer<br />
Geschäfte neue Absatzmärkte zu gewinnen.<br />
Vor allem Frankreich ist als Absatzmarkt interessant,<br />
denn La Grande Nation arbeitet forciert am<br />
Ausbau Erneuerbarer Energien. Allerdings gibt es einige<br />
Besonderheiten, die den deutschen Energiemarkt<br />
vom französischen unterscheiden.<br />
Bislang ist im Nachbarland die Energiegewinnung aus<br />
Biogas noch nicht sehr verbreitet. Um das zu ändern,<br />
wurde im Jahr 2015 im Rahmen einer neuen Energiewendegesetzgebung<br />
die Förderung ausgebaut, die<br />
Einspeisevergütung angehoben und ein zusätzliches<br />
Auktionssystem eingeführt. Die seitdem sehr attraktiven<br />
Rahmenbedingungen könnten sich allerdings bald<br />
verschlechtern. Der aktuelle Entwurf der Programmplanung<br />
für Energie (programmation pluriannuelle de<br />
l’énergie, PPE) sorgt für Unruhe in der Branche, denn<br />
drastische Einsparungen sind vorgesehen.<br />
Deutlicher Unterschied beim Energiemix<br />
„Der Stand der Energieversorgung ist in beiden Ländern<br />
sehr unterschiedlich“, erklärt Lena Müller-Lohse.<br />
In Deutschland würde Biogas vor allem für die Stromproduktion<br />
genutzt, in Frankreich hingegen präferiert<br />
zu Biomethan umgewandelt und ins Erdgasnetz eingespeist.<br />
Die DFBEW-Referentin für Bioenergien (siehe<br />
Kasten) erklärt warum: „Der französische Strom<br />
wird vorwiegend aus Atomenergie erzeugt, während in<br />
Deutschland der Anteil der Kernenergie an der Stromerzeugung<br />
nur bei 11,7 Prozent liegt und bis 2022 auf<br />
null sinken soll“, so die Fachfrau.<br />
Im Nachbarland beträgt der Anteil der Kernkraft an der<br />
Stromerzeugung hingegen stattliche 72 Prozent. Im internationalen<br />
Vergleich führte Frankreich 2018 vor der<br />
Slowakei (55 Prozent) die Spitze in diesem Segment<br />
an. Die französische Bruttostromerzeugung belief sich<br />
im Jahr 2017 insgesamt auf etwa 530 Terawattstunden<br />
(TWh), 18,1 Prozent davon wurden aus Erneuerbaren<br />
Energien produziert.<br />
92
BIOGAS JOURNAL | 6_<strong>2019</strong><br />
INTERNATIONAL<br />
Biogasfördertechnik<br />
60m³ Feststoffeintrag<br />
FOTOS: MARTINA BRÄSEL<br />
In Frankreich, wie hier in Scherwiller, wird Biogas zum größten Teil zu Biomethan aufbereitet.<br />
Derzeit liegt der Biomethananteil im Netz bei unter 0,1 Prozent. Vorgesehen war, den französischen<br />
Gaskonsum bis 2030 zu 10 Prozent mit „grünem Gas“ zu decken.<br />
Feststoffeintrag in Edelstahlbauweise,<br />
die neue Schubboden-Generation:<br />
• echte wasserdichte Bodenwanne<br />
• geringer Stromverbrauch<br />
• einfacher Aufbau / geringe Ladehöhe<br />
• für alle stapelbaren Biomassen (bis 100% Mist)<br />
• effi zienter Vorschub bei schwierigen Substraten<br />
• hohe Austragsleistung auch bei Restmengen<br />
• Standardgrößen: 40m³, 60m³, 75m³, 100m³<br />
Die Stromproduktion aus Biogas betrug<br />
knapp 2 TWh. „Das ist ein Anteil von<br />
nicht einmal 0,5 Prozent an der gesamten<br />
Stromproduktion“, so Müller-Lohse.<br />
In Deutschland wurden im gleichen Jahr<br />
rund 650 TWh Strom erzeugt. 33 Prozent<br />
davon stammten aus Erneuerbaren Energien.<br />
Biogas hatte 2017 einen Anteil von 4,5<br />
Prozent an der gesamten Stromproduktion.<br />
Andere Voraussetzungen<br />
Während in Frankreich der Zubau von<br />
Biogasanlagen stetig zunimmt, werden in<br />
Das DFBEW<br />
Das Deutsch-französische Büro für die Energiewende<br />
(DFBEW) wurde 2006 auf Initiative der Regierungen<br />
beider Länder gegründet. Die Aufgabe<br />
der unabhängigen Informationsplattform ist,<br />
den Informationsfluss zwischen den Stakeholdern<br />
der Energiewende zu vereinfachen und zu<br />
intensivieren.<br />
Es gibt jeweils ein Büro in Berlin und Paris. Die<br />
Arbeit des 14-köpfigen Teams wird zur einen<br />
Hälfte aus öffentlichen Geldern und zum anderen<br />
aus Mitgliedsbeiträgen bezahlt. Zu den rund 200<br />
Mitgliedern zählen zum Beispiel Projektentwickler,<br />
Anlagenhersteller, Gutachterbüros, Direktvermarkter,<br />
Energieversorger, Netzbetreiber, Banken<br />
und Forschungseinrichtungen.<br />
Deutschland kaum Neuanlagen installiert.<br />
Der Fokus liegt vielmehr auf dem Leistungszubau<br />
bestehender Anlagen, mithilfe<br />
dessen Biogasanlagen flexibel genutzt<br />
werden können. Biogasanlagen werden<br />
in Deutschland bereits seit rund 30 Jahren<br />
gebaut. Ende 2018 gab es insgesamt<br />
mehr als 9.400 von ihnen im Land. Die<br />
gesamte elektrische Leistung der meist<br />
landwirtschaftlichen Anlagen beträgt mehr<br />
als 4.900 Megawatt installierte elektrische<br />
Leistung (MW el<br />
).<br />
Dies entspricht einem Anstieg der installierten<br />
elektrischen Leistung um 403 MW<br />
im Vergleich zum Vorjahr. Sieben Anlagen<br />
gingen 2018 vom Netz. Gerade einmal 113<br />
Biogasanlagen wurden im vergangenen Jahr<br />
in Deutschland gebaut. Zu Spitzenzeiten<br />
waren es deutlich mehr, 2011 entstanden<br />
über 1.500 Neuanlagen. Der Fachverband<br />
Biogas geht von einem weiteren Rückgang<br />
des Neubaus um 20 Prozent aus.<br />
Ende 2017 waren bei unserem französischen<br />
Nachbarn rund 600 Biogasanlagen<br />
installiert, bis zum Jahr 2020 sollen<br />
es 1.000 Anlagen werden. „Französische<br />
Biogasanlagen teilen sich in drei Kategorien<br />
auf: Methanisierungs-, Hausmüllverwertungs-<br />
und Klärgasanlagen“, erklärt<br />
die Referentin. Rund 70 Prozent von ihnen<br />
seien Methanisierungsanlagen. Ab<br />
einer installierten Leistung von über 300<br />
Kilowatt müssten die Anlagen in der Regel<br />
Biomethan erzeugen und anschließend in<br />
93<br />
FSE Pico<br />
Den Pico bieten wir in den Größen<br />
12m³ bis 16m³ an.<br />
Er verfügt über eine Austragsschnecke, zwei Auflockerungsschnecken<br />
und überzeugt damit durch<br />
die gering benötigte Gesamtantriebskraft von nur<br />
11,5 KW.<br />
MaCBox<br />
MaCBox Flüssigeintrag:<br />
Mix and Cut in a Box<br />
Dieses reduziert die Bildung von Schwimm- und<br />
Sinkschichten im Fermenter. Selbst schwierige<br />
Feststoffe wie Putenkot, Rindermist und langfaserige<br />
Stoffe sind für die MaCBox kein Problem.<br />
Ostereistedter Straße 6 | 27404 Rockstedt<br />
Telefon: +49 (0) 42 85 - 9 24 99-0 | Fax: 9 24 99-20<br />
info@metallbaubrandt.de<br />
www.metallbaubrandt.de
INTERNATIONAL<br />
BIOGAS JOURNAL | 6_<strong>2019</strong><br />
Das Potenzial für die Biomethanerzeugung ist in Frankreich wegen der zahlreichen biologischen Abfallstoffe<br />
sehr hoch. Mit einem Gesamtwert der landwirtschaftlichen Produktion von 72,6 Milliarden Euro (2017) ist<br />
La Grande Nation der größte Agrarproduzent der EU.<br />
das Erdgasnetz einspeisen. „Daher ist der Zuwachs im<br />
Bereich der Biomethan-Einspeisung in das Erdgasnetz<br />
wesentlich größer als die Nutzung von Biogas für die<br />
Stromerzeugung“, verdeutlicht die Fachfrau.<br />
Biomethan bevorzugt<br />
In Deutschland wurden 2017 nur drei Biomethan-<br />
Anlagen neu installiert. „Ende 2017 speisten 196<br />
Anlagen insgesamt etwa 9,3 TWh Biomethan in das<br />
Erdgasnetz ein“, weiß die Expertin. Der Anteil am<br />
Erdgasverbrauch liege bei knapp einem Prozent. „Anders<br />
als in Frankreich gibt es in Deutschland keinen<br />
Anspruch auf eine Förderung, wenn Biomethan in das<br />
Gasnetz eingespeist wird“, erklärt Müller Lohse. Stattdessen<br />
müssten Erzeuger dieses<br />
selbst vermarkten. Das Potenzial für<br />
die Biomethanerzeugung ist in unserem<br />
Nachbarland, dank der zahlreichen<br />
biologischen Abfallstoffe,<br />
sehr hoch. Mit einem Gesamtwert<br />
der landwirtschaftlichen Produktion<br />
von 72,6 Milliarden Euro (2017) ist<br />
La Grande Nation der größte Agrarproduzent<br />
der EU. Mit deutlichem<br />
Abstand folgt Deutschland mit einem<br />
Produktionswert von 56,2 Milliarden<br />
Euro.<br />
Die biologischen Abfälle werden bisher<br />
aber nur zu einem Teil genutzt.<br />
Um dies zu ändern, werden als<br />
Substrate hauptsächlich tierische<br />
Exkremente und Abfälle verwendet.<br />
Um die erste Hürde, den Subventionszuschlag,<br />
für den Bau der Anlage<br />
zu meistern, darf der Einsatz<br />
von nachwachsenden Rohstoffen<br />
15 Prozent nicht überschreiten. Der Nachteil ist, dass<br />
faserige Rohstoffe, wie Grassilage und Strohmist, eine<br />
geringere Energieausbeute haben und eine ausgeklügelte,<br />
oft teurere Anlagentechnik verlangen.<br />
„Dies ist mit hohen Kosten verbunden und französische<br />
Banken investieren derzeit noch zögerlich in die<br />
Biogasbranche“, weiß die Referentin. Der Zeitrahmen<br />
der Projektabwicklung würde momentan aufgrund der<br />
Komplexität des Verfahrens zwischen eineinhalb und<br />
sechs Jahren dauern.<br />
Planungsunsicherheiten<br />
„Viele französische Landwirte zeigen Interesse an<br />
einer Biogasanlage“, weiß Simone Besgen von der<br />
94
BIOGAS JOURNAL | 6_<strong>2019</strong><br />
INTERNATIONAL<br />
Firma Rytec. Ein Problem sei<br />
aber die Planungsunsicherheit<br />
bezüglich der Einspeisevergütung,<br />
Genehmigung und Förderung,<br />
die sich ständig ändern<br />
könnten. Das deutsche Unternehmen<br />
ist auf den französischen<br />
Markt ausgerichtet und<br />
vor allem in Lothringen und im<br />
Elsass aktiv. Eine BGA realisierte<br />
die Firma Rytec im Mai<br />
2018 in Scherwiller für die Gesellschaft<br />
„SAS Méthaniseur<br />
de deux Vallées“.<br />
„Es ist nicht klar, wie hoch die<br />
Vergütung in der Zukunft sein<br />
wird“, bestätigt auch Anlagenbetreiber<br />
Bernhard Winterhalter,<br />
Präsident der Gesellschaft,<br />
doch er ist sich sicher: „Die<br />
Landwirte hier sind begeistert<br />
von Biogasanlagen und würden<br />
gerne welche bauen“. Die aktuelle Planungsunsicherheit<br />
beruht vor allem auf der Überarbeitung der zuständigen<br />
Gesetze: „Das französische Energiewendegesetz<br />
dient als Rahmengesetz für die französische Energiewende<br />
und enthält verbindliche Ziele und Vorgaben“,<br />
erklärt Müller-Lohse.<br />
In der mehrjährigen Programmplanung für Energie<br />
(PPE) seien für jede Branche spezifische Ausbauvolumen<br />
festgeschrieben. Weil das französische Energiewendegesetz<br />
alle fünf Jahre eine Überarbeitung<br />
der PPE vorsieht, erschien im Januar <strong>2019</strong> ein neuer<br />
Entwurf. Er will die ambitionierten Zielvorgaben nun<br />
deutlich nach unten revidieren. Vor allem die Kosten<br />
für Biomethananlagen sollen drastisch sinken.<br />
Anders als in Frankreich gibt es in Deutschland keinen Anspruch auf eine Förderung, wenn<br />
Biomethan in das Gasnetz eingespeist wird. Nur wenige Anlagen kommen deshalb jährlich<br />
hinzu. Eine der rund 200 Biomethan-Anlagen gehört zum Bioenergiedorf Müden (Aller).<br />
Ziele reduziert<br />
Das erklärte Ziel war eigentlich, den französischen<br />
Gaskonsum bis 2030 zu 10 Prozent mit „grünem<br />
Gas“ zu decken. „Derzeit liegt der Biomethananteil<br />
im Netz bei unter 0,1 Prozent“, verdeutlicht Müller-<br />
Lohse. Die 2016 verabschiedete PPE hatte als Ziel<br />
für das Jahr 2018 eine Biomethanproduktion in<br />
Höhe von 1,7 TWh vorgesehen. Für das Jahr 2023<br />
sollte eine Steigerung auf 8 TWh erfolgen. „Dieses<br />
zweite Ziel wurde im aktuellen Entwurf der PPE, der<br />
Anfang <strong>2019</strong> veröffentlicht wurde, auf 6 TWh reduziert“,<br />
weiß die Referentin. Die Gesamtleistung der<br />
Biogasanlagen soll laut PPE 2016 im Jahr 2023 mindestens<br />
237 MW betragen. Ende September 2018<br />
IHR ERFAHRENER ENERGIESPEZIALIST SEIT 1936<br />
PLANUNG - ANLAGENBAU - SERVICE 24/7<br />
BHKW<br />
BLOCKHEIZKRAFTWERKE<br />
ENERGIEVERSORGUNG MIT KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG<br />
USV<br />
UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG<br />
STATIONÄRE USV-ANLAGEN<br />
. Leistungsbereich Erdgas von 50 kW el<br />
bis 2.535 kW el<br />
. Leistungsbereich Biogas von 100 kW el<br />
bis 2.000 kW el<br />
. Containeranlagen, Betonstationen, Komplettmodule<br />
. Leistungsbereich Dreiphasig von 10 kVA - 2.400 kVA<br />
. Leistungsbereich Einphasig von 1 kVA - 10 kVA<br />
. Batterieanlagen<br />
NEA<br />
NETZERSATZANLAGEN<br />
KOMPLETTLÖSUNGEN AUS EINER HAND<br />
. Leistungsbereich von 20 kVA - 3.000 kVA<br />
. BDEW-Aggregate<br />
. Containeranlagen, Betonstationen, Komplettmodule<br />
95<br />
HENKELHAUSEN GmbH & Co. KG Tel.: +49 (0) 21 51 / 574 - 190 E-mail: anfrage@henkelhausen.de
INTERNATIONAL<br />
BIOGAS JOURNAL | 6_<strong>2019</strong><br />
speisten 67 Anlagen Biomethan in das Erdgasnetz<br />
ein. Gemeinsam haben diese Anlagen eine jährliche<br />
Produktionskapazität von 1.048 Gigawattstunden<br />
(GWh). „Es gibt zudem viele Projekte, die nur darauf<br />
warten, zu starten“, so Müller-Lohse. Die Kapazität<br />
der 556 Projekte, die sich zum gleichen Zeitpunkt<br />
in der Warteschleife befanden, belief sich auf mehr<br />
als 12 TWh/Jahr. „Wenn die Produktionskosten nicht<br />
gesenkt werden können, wird das Ziel für 2030 von<br />
10 Prozent laut aktuellem Entwurf auf 7 Prozent abgesenkt“,<br />
betont Müller-Lohse.<br />
In Frankreich werden als Substrate hauptsächlich tierische Exkremente und Abfälle verwendet.<br />
Um die erste Hürde, den Subventionszuschlag, für den Bau der Anlage zu meistern, darf der<br />
Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen 15 Prozent nicht überschreiten.<br />
Biomethanproduktion: Realisierte Erzeugung und Zielsetzung<br />
für 2018 und 2023<br />
Quelle: SDES Darstellung: DFBEW<br />
Drastische Kosteneinsparung vorgesehen<br />
„Die Branche ist in Aufregung, weil eigentlich eine<br />
Erhöhung der Ziele und keine Absenkung erwartet<br />
wurde“, ergänzt die Kennerin der Branche. Die<br />
Förderung sehe zwar noch immer sehr gut aus, die<br />
Kosten für die Biomethan-Produktion müssten zukünftig<br />
aber enorm gesenkt werden. Derzeit würden<br />
die Gestehungskosten bei etwa 100 Euro pro Megawattstunde<br />
liegen. Laut Entwurf soll der maximale<br />
Einspeisetarif bis zum Jahr 2023 auf 87 Euro pro<br />
Megawattstunde (EUR/MWh) und bis 2028 sogar auf<br />
80 EUR/MWh sinken.<br />
„Das Volumen der Ausschreibungsrunden, das bald<br />
ebenfalls für Anlagen, die Biomethan in das Erdgasnetz<br />
einspeisen, eingeführt werden soll, wird dementsprechend<br />
angepasst“, so die Expertin. Gelänge<br />
es, die Kosten zu senken, stünde ein größeres Ausschreibungsvolumen<br />
zur Verfügung als ohne Einsparungen.<br />
„Es wird gerade viel darüber diskutiert, ob<br />
diese drastische Reduzierung überhaupt möglich<br />
ist“, so die Expertin.<br />
Die Kritiker mahnen, dass die Vorteile der Technologie<br />
ebenfalls zu Buche schlagen müssten. So wird<br />
das französische Biogas im Sinne der Kreislaufwirtschaft<br />
ausschließlich aus Reststoffen gewonnen, ist<br />
also auch eine nachhaltige Müllverarbeitung. Auch<br />
die Senkung der Nitratbelastung in den Böden, die<br />
Klimaentlastung und die Verwertung des Gärproduktes<br />
als Dünger blieben bislang unberücksichtigt. Es<br />
bleibt also spannend. Die endgültige Version der<br />
PPE wird voraussichtlich Ende des Jahres veröffentlicht.<br />
Faserige Rohstoffe, wie Grassilage und Mist, haben eine geringere Energieausbeute<br />
und verlangen eine ausgeklügelte, oft teurere Anlagentechnik.<br />
Autorin<br />
Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
Freie Journalistin<br />
Hohlgraben 27 · 71701 Schwieberdingen<br />
0 71 50/9 21 87 72<br />
braesel@mb-saj.de<br />
www.mb-saj.de<br />
96