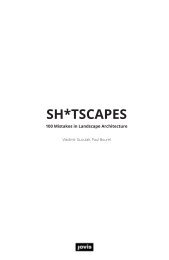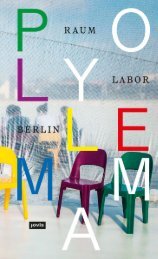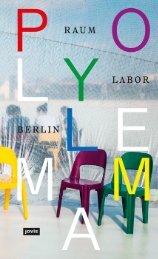Funktionen der Architektur
ISBN 978-3-86859-585-7
ISBN 978-3-86859-585-7
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Funktionen</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>Architektur</strong>
<strong>Funktionen</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>Architektur</strong><br />
KATHARINA WERESCH
Inhalt<br />
Einleitung13<br />
Kin<strong>der</strong>tagesstätten und die<br />
Verhäuslichung <strong>der</strong> Kindheit 17<br />
Wohnungsbau im Wandel<br />
<strong>der</strong> Familienstrukturen 135<br />
Bauten für Wohnen und<br />
Leben im Alter im Kontext<br />
demografischer Verän<strong>der</strong>ungen 243<br />
Schlussbetrachtung351<br />
Anhang<br />
Anmerkungen354<br />
Bildnachweis360<br />
Literaturverzeichnis364<br />
Inhalt
Einleitung<br />
Diese Publikation verfolgt das Ziel, <strong>Funktionen</strong> <strong>der</strong> <strong>Architektur</strong> aus mehreren<br />
Perspektiven und Dimensionen zu erforschen. 1 Sie legt zugrunde, dass <strong>Architektur</strong><br />
die gesellschaftlichen Verhältnisse in <strong>der</strong> jeweiligen Zeit in gebauten<br />
Raum transformiert. Als Transformation wird die gestalterische Umformung<br />
von Wissen, Bauprogrammen, bautechnischen und sozialwissenschaftlichen<br />
Erkenntnissen in architektonischen Raum definiert. <strong>Architektur</strong> ist demzufolge<br />
ein symbolischer Ausdruck <strong>der</strong> Gesellschaft, da sie <strong>der</strong>en <strong>Funktionen</strong> in<br />
Materie, Raum und Orte umsetzt. 2<br />
Die Wahrnehmung und das Erkennen <strong>der</strong> räumlichen Symbole erlernen<br />
die Gesellschaftsmitglie<strong>der</strong> in ihrer individuellen Zivilisierung. Eine Kirche,<br />
eine Synagoge o<strong>der</strong> eine Moschee beispielsweise rufen im 16. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
an<strong>der</strong>e Empfindungen hervor als im 21. Jahrhun<strong>der</strong>t, bei Katholiken an<strong>der</strong>e<br />
als bei Protestanten, Juden o<strong>der</strong> Muslimen, und bei Achtzigjährigen an<strong>der</strong>e<br />
als bei Zwanzigjährigen.<br />
Jede architektonische Form, jedes architektonische Merkmal löst<br />
erlernte Reaktionen beim Wahrnehmenden aus, die wie<strong>der</strong>um sein Verhalten<br />
beeinflussen. Die vorliegende Forschungsarbeit untersucht die genannten<br />
Prozesse anhand dreier Nutzungstypen und Lebensbereiche: Der erste Teil<br />
behandelt die Kindheit und skizziert <strong>der</strong>en gesellschaftliche Wandlung seit<br />
über 100 Jahren sowie ihre architektonische Verräumlichung und analysiert<br />
die heutigen Kin<strong>der</strong>tagesstätten. Im zweiten Teil werden die Entwicklung<br />
des Wohnens und des Wohnungsbaus bis zum neuen Mehrgenerationenwohnen<br />
im jahrhun<strong>der</strong>telangen Wandel <strong>der</strong> Familienstrukturen und <strong>der</strong>en<br />
Materialisierung in <strong>Architektur</strong> dargestellt sowie gegenwärtige Wohnanlagen<br />
untersucht. Der dritte Teil skizziert die Wandlung <strong>der</strong> Verhaltens- und Empfindungsstandards<br />
gegenüber dem Alter seit dem Mittelalter, zeigt <strong>der</strong>en architektonische<br />
Transformation und stellt Altenwohnanlagen und institutionalisierte<br />
Pflegeheime im 21. Jahrhun<strong>der</strong>t vor.<br />
Die gegenwärtige <strong>Architektur</strong> <strong>der</strong> drei Lebensbereiche wird anhand <strong>der</strong><br />
Fachliteratur analysiert. Zur Überprüfung ihrer Funktionalität führten Studierende<br />
unter <strong>der</strong> Leitung <strong>der</strong> Verfasserin in Hun<strong>der</strong>ten von Gebäuden teilnehmende<br />
Beobachtungen und Nutzerbefragungen durch.<br />
Kritik<br />
Die <strong>Architektur</strong> leistet die notwendige Transformation häufig nicht in dem<br />
erfor<strong>der</strong>lichen Maße. Sie bietet nicht selten funktional ungeeignete Umgebungen<br />
für die motorische und kognitive Entwicklung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>, die individualisierten<br />
familiären Wohnverhältnisse o<strong>der</strong> die kommunikations- und<br />
bewegungsorientierten Bedürfnisse im Alter. Die Untersuchung dokumentiert<br />
in den folgenden Kapiteln, dass sich zwischen <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> <strong>Architektur</strong><br />
und den wissenschaftlichen Erkenntnissen verschiedener Disziplinen eine<br />
Einleitung<br />
13
Kin<strong>der</strong>tagesstätten und die<br />
Verhäuslichung <strong>der</strong> Kindheit<br />
18<br />
Die heutigen Bautypen für Kin<strong>der</strong>tagesstätten entstehen<br />
als architektonischer Ausdruck langfristiger Zivilisationsprozesse.<br />
Die Lebensphase <strong>der</strong> Kindheit ist seit ungefähr<br />
100 Jahren zunehmend einem gesellschaftlich bedingten,<br />
sozialen und räumlichen Wandel unterworfen, den<br />
die Verfasserin als Prozess <strong>der</strong> Verhäuslichung <strong>der</strong> Kindheit<br />
bezeichnet. Der Begriff Verhäuslichung, ursprünglich<br />
von Peter R. Gleichmann 1 geprägt, bezeichnet den über<br />
Jahrhun<strong>der</strong>te andauernden Prozess <strong>der</strong> allmählichen Verlagerung<br />
von Lebensvollzügen in Gebäude, in denen sich<br />
die Nutzungen unter zunehmen<strong>der</strong> gesellschaftlicher Kontrolle<br />
und Steuerung immer weiter ausdifferenzieren. Die<br />
<strong>Architektur</strong> <strong>der</strong> Bauten beziehungsweise <strong>der</strong> Freiräume für<br />
Kin<strong>der</strong> symbolisiert diesen gesellschaftlichen Wandel. Die<br />
räumlichen Symbole werden von den Gesellschaftsmitglie<strong>der</strong>n<br />
verstanden und lösen Wahrnehmungs- und Verhaltensreaktionen<br />
bei jedem einzelnen von ihnen aus. Sie<br />
unterscheiden sich schichten-, alters- und geschlechtsspezifisch.<br />
Für Architekten bedeutet <strong>der</strong> Prozess <strong>der</strong> Verhäuslichung<br />
<strong>der</strong> Kindheit, dass die Bauaufgabe Kin<strong>der</strong>tagesstätte<br />
zunehmend vom dynamischen gesellschaftlichen<br />
Wandel <strong>der</strong> Kindheit geprägt und die architektonische<br />
Kreativität mit ebendiesem Wandel konfrontiert wird. Sie<br />
transformieren ihn in symbolische Formen <strong>der</strong> <strong>Architektur</strong>.<br />
Der erste Teil dieses Kapitels stellt einleitend die Wandlung<br />
<strong>der</strong> Verhaltens- und Empfindungsstandards hinsichtlich <strong>der</strong><br />
Kindheit im Verlauf des Zivilisationsprozesses skizzenartig<br />
vor. Im Hauptteil, <strong>der</strong> die Entwicklung des 20. und 21. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
behandelt, wird anhand von Kin<strong>der</strong>tagesstätten
gezeigt, wie die gesellschaftlichen Wandlungen in Bautypen,<br />
<strong>Architektur</strong>formen, Grundrissen, Materialien sowie<br />
<strong>Funktionen</strong> und Gestaltungen zum Ausdruck kommen. Die<br />
Bedürfnisse von Kin<strong>der</strong>n von <strong>der</strong> Geburt bis zum Alter von<br />
6 Jahren werden als Grundlagen <strong>der</strong> Planung anhand verschiedener<br />
Wissenschaftsdisziplinen erarbeitet.<br />
Kin<strong>der</strong>tagesstätten und die<br />
Verhäuslichung <strong>der</strong> Kindheit<br />
Zur Erforschung <strong>der</strong> Geschichte zieht die Verfasserin zeitgenössische<br />
Quellen heran. Für die Gegenwart wendet<br />
sie verschiedene Methoden an, die sowohl architektonische<br />
und soziologische Fachliteratur, demografische Statistiken<br />
als auch empirische Untersuchungen von Kin<strong>der</strong>tagesstätten<br />
zugrunde legen. Zu diesem Zweck hat die<br />
Autorin im Verlauf <strong>der</strong> vergangenen 20 Jahre zusammen<br />
mit Studierenden Dutzende von Kin<strong>der</strong>tagesstätten empirisch<br />
untersucht, indem teilnehmende Beobachtungen<br />
<strong>der</strong> Raumnutzungen und <strong>der</strong> Verhaltensweisen stattfanden<br />
und Interviews mit den Kin<strong>der</strong>n, den Betreuern, <strong>der</strong><br />
Leitung und den Eltern durchgeführt wurden. Die Erkenntnisse<br />
dieser empirischen Untersuchung fließen an den entsprechenden<br />
Stellen zusammengefasst ein. Gebäude- und<br />
Freiraumangebote sollten die am gesellschaftlichen Wandel<br />
reflektierten kindlichen Bedürfnisse erfüllen und <strong>der</strong><br />
Entwicklung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> för<strong>der</strong>lich sein. Das Ziel besteht<br />
darin, ein neues gesellschaftliches Verständnis für das kindgerechte<br />
Bauen zu ermöglichen und Orientierungswissen<br />
zur Verfügung zu stellen.<br />
19
Kin<strong>der</strong>tagesstätten und die<br />
Verhäuslichung <strong>der</strong> Kindheit<br />
Die Entwicklung <strong>der</strong> Kindheit<br />
und <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>räume bis<br />
in die 1950er Jahre –<br />
eine zivilisatorische Skizze<br />
Kindheit und Kin<strong>der</strong>räume in <strong>der</strong> bäuerlichen<br />
Gesellschaft<br />
20<br />
Bis ins 19. Jahrhun<strong>der</strong>t existiert für die große Mehrheit <strong>der</strong> Bevölkerung<br />
keine Kindheit im heutigen Sinne. Die Kin<strong>der</strong> <strong>der</strong> Bauern und Handwerker<br />
sind vollkommen in das Leben <strong>der</strong> Erwachsenen eingeglie<strong>der</strong>t, bei nahezu<br />
allen Lebensvorgängen gegenwärtig und in die Produktionsgemeinschaft<br />
integriert. Die Kin<strong>der</strong> in bescheideneren ländlichen Verhältnissen verrichten<br />
von klein auf eine Fülle von Arbeiten und stellen Erzeugnisse her, wodurch<br />
ihnen kindliches Spiel und regelmäßiger Schulbesuch versagt bleiben. 2 Das<br />
gemeinschaftliche Zusammenleben in großen bäuerlichen Produktionsfamilien<br />
bietet den Kin<strong>der</strong>n kein Zuhause, wie wir es heute kennen. Ein Haushalt<br />
umfasst bei Bauern, Handwerkern o<strong>der</strong> Gewerbetreibenden viele Personen:<br />
Hauseltern, Verwandte, Gesellen, Knechte und Mägde. Der Schweizer Schriftsteller<br />
Ulrich Bräker (1735–1798) beschreibt in seiner Autobiografie als einer<br />
<strong>der</strong> wenigen schreibenden Menschen aus <strong>der</strong> Schicht <strong>der</strong> einfachen Bauern<br />
diese Verhältnisse in seiner Lebensgeschichte des Armen Mannes im Tockenburg<br />
(1789):<br />
„Es kam alle zwei Jahre geflissentlich ein Kind: Tischgänger genug,<br />
aber darum noch keine Arbeiter […]. Wir sollten anfangen, Winterszeit<br />
etwas zu verdienen. Mein Vater probierte aller Gattung Gespunst:<br />
Flachs, Hanf, Seiden, Wollen, Baumwollen; auch lehrte er uns letztre<br />
kämbeln, Strümpfstricken und <strong>der</strong>gleichen. Aber keins warf damals viel<br />
Lohn ab. Man schmälerte uns den Tisch, meist Milch und Milch, ließ uns<br />
lumpen und lempen, um zu sparen […].“ 3<br />
Die Worte „Tischgänger“ und „Arbeiter“ und die sich daraus abzuleitende<br />
Bedeutung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> kann man an <strong>der</strong> Tischordnung in <strong>der</strong> damaligen bäuerlichen<br />
Gesellschaft ablesen: An <strong>der</strong> Fensterseite sitzen <strong>der</strong> Reihe nach <strong>der</strong><br />
Großknecht, <strong>der</strong> Pferdeknecht, zweiter und dritter Ochsenknecht, Kleinknecht,<br />
Schulte und Junge, ihnen gegenüber die Großdirn und die Lüttdirn. 4<br />
Mädchen und Kin<strong>der</strong> müssen bei Tisch stehen: „Die zwischenmenschlichen<br />
Beziehungen waren weitgehend auf den Nutzen reduziert, den die Mitglie<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Hausgemeinschaft für die Wirtschaft besaßen. Als nutzlose Esser wurden<br />
nur die Kleinkin<strong>der</strong> und die ganz Alten geduldet.“ 5 Das Leben <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> ist
geprägt von <strong>der</strong> Arbeit in Haus, Hof, Stall und auf dem Feld. Kaum jemand<br />
kümmert sich um sie und sie verfügen selten über eigene Räume o<strong>der</strong> Raumanteile.<br />
Herrscht Mangel an Essen, schicken die Eltern sie teils schon mit unter<br />
10 Jahren als Knechte und Mägde auf an<strong>der</strong>e Höfe. Die Hausgemeinschaft<br />
nutzt die zur Verfügung stehenden Menschen und Güter maximal aus. Die<br />
Einführung <strong>der</strong> allgemeinen Schulpflicht in Deutschland seit Anfang des 19.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>ts än<strong>der</strong>t daran wenig. „Zu wichtig war für die Eltern ihre Mitarbeit<br />
in <strong>der</strong> Bauernwirtschaft und <strong>der</strong> Wert des Lernens und Lesens kaum verstehbar.“<br />
6 Bis zur Industrialisierung gehören rund 80 Prozent <strong>der</strong> Familien dem<br />
Bauernstand an. Neben ihrer Funktion als Arbeitskräfte dienen die Kin<strong>der</strong> den<br />
Eltern bis zum Ersten Weltkrieg zudem als finanzielle Absicherung im Alter.<br />
Für das eigene ökonomische Überleben im Alter bedarf es möglichst vieler<br />
gesun<strong>der</strong> und arbeitstüchtiger Nachkommen. Infolgedessen genießen nur die<br />
ältesten Söhne als Erben des Hofes o<strong>der</strong> Betriebes einen hohen Stellenwert.<br />
Die Kindheit erfährt bis zum 20. Jahrhun<strong>der</strong>t keine Wertschätzung als<br />
eigener Entwicklungsstatus. Die kurze Charakterisierung <strong>der</strong> Kindheit in<br />
<strong>der</strong> bäuerlichen Gesellschaft stellt die langfristig erworbenen Verhaltensund<br />
Empfindungsstandards im Verhältnis von Eltern und Kin<strong>der</strong>n und <strong>der</strong>en<br />
Raumzuordnungen dar. Unsere gegenwärtigen Gefühle und Verhaltensweisen<br />
gegenüber Kin<strong>der</strong>n, die wir als so selbstverständlich o<strong>der</strong> gar als biologisch<br />
angeboren empfinden, sind ein Ergebnis des Zivilisierungsprozesses<br />
zwischen Eltern und Kin<strong>der</strong>n seit dem Ersten Weltkrieg. Unsere Fähigkeit zu<br />
Empathie und Einfühlung in die kindliche Welt ist weniger als 100 Jahre alt.<br />
Diese Erkenntnis ist aus <strong>der</strong> gegenwärtigen psychogenetischen Strukturierung<br />
<strong>der</strong> Menschen in Deutschland schwer zu erfassen und nachzuvollziehen.<br />
Kin<strong>der</strong>tagesstätten und die<br />
Verhäuslichung <strong>der</strong> Kindheit<br />
Kindheit und Kin<strong>der</strong>räume in <strong>der</strong><br />
Industriearbeiterschaft<br />
Die Industrialisierung, die in Deutschland im frühen 19. Jahrhun<strong>der</strong>t beginnt,<br />
verän<strong>der</strong>t die Organisation <strong>der</strong> Arbeit und entsprechend <strong>der</strong> Familien sowie<br />
<strong>der</strong> Kindheit grundlegend. Die ärmeren Landbewohner wan<strong>der</strong>n aufgrund<br />
erhoffter Arbeits- und Verdienstchancen in Massen in die Städte, wodurch<br />
die Arbeiterschaft Ende des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts in Deutschland die bei Weitem<br />
größte Bevölkerungsgruppe bildet. Die Arbeit verlagert sich aus den bäuerlichen<br />
Höfen und <strong>der</strong>en großfamiliärer Einheit in die städtischen industriellen<br />
Produktionsstätten, die häufig weit entfernt von den Wohngebieten liegen<br />
und deshalb mit <strong>der</strong> weitgehenden räumlichen Trennung <strong>der</strong> Eltern von ihren<br />
Kin<strong>der</strong>n einhergehen. 7<br />
Verhaltensstandards und Familienräume in den ersten Mietskasernen<br />
Als Folge <strong>der</strong> massiven Stadtwan<strong>der</strong>ung ländlicher Bevölkerungsgruppen<br />
wächst beispielsweise die Berliner Bevölkerung im Zeitraum von 1862 bis<br />
1900 von 568.000 auf 1,9 Millionen Einwohner, 8 mit dem Ergebnis dramatischer<br />
Verknappung des Wohnraumes für Arbeiter. Die Menschen hausen<br />
unter „unmenschlichen Bedingungen“ in unhygienischen Wohnungen, teilweise<br />
leben bis zu 20 Personen in einem Raum. 9 Die Stuben <strong>der</strong> ersten Miets- 21
Kin<strong>der</strong>tagesstätten und die<br />
Verhäuslichung <strong>der</strong> Kindheit<br />
4 Galerie in <strong>der</strong><br />
Wil<strong>der</strong>spin Infant School,<br />
England, um 1835<br />
24<br />
Alkohol o<strong>der</strong> Drogen ruhiggestellt o<strong>der</strong> als sogenannte Halte-, Zieh- o<strong>der</strong><br />
Kostkin<strong>der</strong> gegen Geld bei an<strong>der</strong>en Arbeiterinnen, häufig alten Frauen, untergebracht.<br />
Die Nutzung von Kin<strong>der</strong>gärten wäre für Arbeiterfamilien we<strong>der</strong><br />
erschwinglich noch verständlich gewesen. Etwas ältere Kin<strong>der</strong> verbringen –<br />
soweit sie nicht arbeiten o<strong>der</strong> zur Schule gehen – ihre Tage unbeaufsichtigt<br />
mit Gleichaltrigen auf den Straßen <strong>der</strong> Arbeiterwohngebiete. 14<br />
Die ganztägige Arbeit <strong>der</strong> Mütter und <strong>der</strong> Zwang, bis zu 15 Kin<strong>der</strong> gebären<br />
zu müssen, erzeugen keine günstigen Voraussetzungen für die Herausbildung<br />
einer angenehmen Familienatmosphäre o<strong>der</strong> gar einer umsorgten<br />
Kindheit. Die Eltern bringen den Kin<strong>der</strong>n wenig Empathie entgegen, eine<br />
enge gefühlsmäßige Bindung zwischen ihnen, und vor allem zwischen Kind<br />
und Vater, kommt selten zustande. 15 Philippe Ariès behauptet in seiner groß<br />
angelegten Studie über die Kindheit, man habe in den ersten Jahren keine<br />
emotionale Beziehung zu den Kin<strong>der</strong>n aufgebaut, weil man täglich mit ihrem<br />
Tode rechnen musste. 16 Tatsächlich war die Kin<strong>der</strong>sterblichkeit hoch, bis zu<br />
30 Prozent sterben im ersten Lebensjahr an Unterernährung. 17 Diese Empfindungsstandards<br />
sind heutzutage kaum vorstellbar.<br />
Zum Vergleich lohnt ein Blick auf das Mutterland <strong>der</strong> Industrialisierung:<br />
In England entstehen bereits ab Ende des 18. und verstärkt zu Beginn des<br />
19. Jahrhun<strong>der</strong>ts Bewahranstalten für kleine Kin<strong>der</strong> erwerbsarbeiten<strong>der</strong> Mütter,<br />
die von den Betrieben selbst, von kirchlichen o<strong>der</strong> wohltätigen Institutionen<br />
eingerichtet werden. Das Personal ist unausgebildet, die Räume sind<br />
in <strong>der</strong> Regel beengt und dürftig. Es handelt sich häufig um ein Schulzimmer<br />
mit Lehrerpult, Tischen und Bänken für 150 Zöglinge im Kleinkindalter, denen<br />
Benehmen, Stillsitzen und etwas Wissen beigebracht werden soll, während<br />
es jedoch primär um ihre Aufbewahrung geht. Einen Garten gibt es nicht.<br />
In Deutschland entstehen Bewahranstalten ab etwa 1830. 1835 entwickelt<br />
<strong>der</strong> Sozialreformer Theodor Fliedner (1800–1864) die Kleinkin<strong>der</strong>schulen, die<br />
neben <strong>der</strong> körperlichen und geistigen Entwicklung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> vor allem ihre<br />
sittlich-religiöse Erziehung in den Mittelpunkt stellen, für die große Masse <strong>der</strong><br />
Arbeiterkin<strong>der</strong> stehen sie nicht zur Verfügung.
5 Adlige Familie<br />
Landgraf Moritz von<br />
Hessen-Kassel<br />
(1572–1632) mit<br />
seiner Familie<br />
Kin<strong>der</strong>tagesstätten und die<br />
Verhäuslichung <strong>der</strong> Kindheit<br />
Kindheit und Kin<strong>der</strong>räume des Adels<br />
und des Bürgertums<br />
Der Adel behandelt Kin<strong>der</strong> wie kleine Erwachsene – in Kleidung und Frisur, in<br />
<strong>der</strong> Einübung <strong>der</strong> zukünftigen Rolle sowie dem Verhalten. Sie leben räumlich<br />
getrennt von den Eltern, bewohnen eigene Trakte im Schloss, nutzen Möbel<br />
für Erwachsene, werden von Ammen und Gouvernanten betreut und pflegen<br />
wenig Kontakt zu ihren Eltern. Die Orte und Räume <strong>der</strong> Erziehung sind je<br />
nach Reichtum und Prestige in separaten Schlosstrakten o<strong>der</strong> gar eigenen<br />
Bauten untergebracht und weisen in <strong>der</strong> Regel eine räumliche Distanz zu den<br />
Räumen <strong>der</strong> Eltern auf.<br />
Verhaltens- und Empfindungsstandards in Bezug auf die Kin<strong>der</strong><br />
Die adlige Mutter entwickelt ihren Kin<strong>der</strong>n gegenüber eine psychische Distanz,<br />
die in <strong>der</strong> räumlichen Distanz ihren Ausdruck findet. Die höfischen Empfindungsstandards<br />
entsprechen nicht dem bürgerlichen Familienideal mit<br />
seiner Vorstellung von mütterlicher Erziehung, das uns heute so selbstverständlich<br />
erscheint. Im Bürgertum und Großbürgertum des 18. und 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
lebt <strong>der</strong> Nachwuchs auch in räumlicher und psychischer Distanz zu<br />
seinen Eltern, weil diese die machthabende adlige Gesellschaft nachahmen.<br />
Da ihre Gebäude kleiner sind, reduzieren sich die Entfernungen: Kin<strong>der</strong> halten<br />
sich mit den Erzieherinnen im Obergeschoss auf, <strong>der</strong>en Räume neben<br />
den Kin<strong>der</strong>zimmern liegen. Kleine Kin<strong>der</strong> dürfen die Gesellschaftsräume nur<br />
nach Auffor<strong>der</strong>ung betreten. Im Großbürgertum, das seine Verhaltensstandards<br />
dem adligen Vorbild nachempfindet, hält sich diese psychische und<br />
räumliche Distanz bis weit ins 20. Jahrhun<strong>der</strong>t.<br />
Unsere heutigen Erwartungen an mütterliche Fürsorge und Zuneigung,<br />
die wir inzwischen als normal und unerlässlich – gewissermaßen angeboren<br />
– betrachten, ist ein Ergebnis des im 19. und 20. Jahrhun<strong>der</strong>t stattfindenden<br />
gesellschaftlichen Wandels im Bürgertum. Der Prozess wird durch<br />
25
Kin<strong>der</strong>tagesstätten und die<br />
Verhäuslichung <strong>der</strong> Kindheit<br />
Waldkin<strong>der</strong>garten<br />
Buxtehude e.V.,<br />
Wald Ottensen<br />
67 Auf einem Hügel<br />
verweilen<br />
68 Steinwerkzeug<br />
benutzen<br />
69 Blumen entdecken<br />
70 Sehen und ertasten<br />
von Blättern<br />
71 Balancieren<br />
Wald hinein. 107 In den Regelkin<strong>der</strong>gärten haben wir solcherlei Ruhe und Entspannung<br />
kaum wahrnehmen können, dort sind fast immer Aktionen zu verzeichnen,<br />
die ganz bewusst angeregt und geför<strong>der</strong>t werden. Jedes Kind ist<br />
aufgefor<strong>der</strong>t, sich für eine Aktion zu entschieden und sie mit den entsprechenden<br />
Werkzeugen und Objekten durchzuführen. Im Wald hingegen muss<br />
nichts im Vorfeld entschieden werden. We<strong>der</strong> müssen vorgefertigte Werkzeuge<br />
o<strong>der</strong> Objekte benutzt noch in entsprechend „funktional“ gestalteten<br />
und eingerichteten Räumen, wie Ateliers o<strong>der</strong> Werkräumen, tagtäglich ähnliche<br />
Aktionen vollführt werden.<br />
72
Lernen vom Waldkin<strong>der</strong>garten –<br />
zusammenfassende Erkenntnisse<br />
Die Betreuung und Erziehung innerhalb eines Waldgebietes zeigen einen Prozess<br />
<strong>der</strong> Enthäuslichung in einer fortschreitend verhäuslichten Kindheit. Der<br />
Waldkin<strong>der</strong>garten stellt einen neuen „anti-architektonischen“ Ort 108 als Erziehungsangebot<br />
für Kin<strong>der</strong> im Alter von 3 bis 6 Jahren dar. Er materialisiert und<br />
symbolisiert die Erkenntnisse über motorische, psychosoziale und kognitive<br />
kindliche Entwicklung in einem eigenständigen räumlichen Experiment, das<br />
einen Ort, nicht aber ein festes Bauwerk markiert. In Städten gibt es naturgemäß<br />
nicht viele Waldstücke, zudem reicht eine auf wenige Stunden am Vormittag<br />
reduzierte Betreuung für berufstätige Männer und Frauen nicht aus.<br />
Dennoch sind auch in Großstädten wie Hamburg in immer stärkeren Ausmaß<br />
Waldkin<strong>der</strong>gärten zu finden, die Waldstücke in <strong>der</strong> Stadt o<strong>der</strong> am Rand nutzen,<br />
teils mit und teils ohne Bauwagen.<br />
Im Verlaufe <strong>der</strong> letzten Jahre führten Studierende <strong>der</strong> HafenCity Universität<br />
unter Leitung <strong>der</strong> Verfasserin in mindestens 30 Waldkin<strong>der</strong>gärten empirische<br />
Analysen, Beobachtungen und Befragungen durch. Als Ergebnis lässt<br />
sich feststellen, dass <strong>der</strong> Wald eine positive Wirkung auf die Kin<strong>der</strong> ausübt.<br />
Die traditionellen Kin<strong>der</strong>tagesstätten sollten entsprechend <strong>der</strong> gegenwärtigen<br />
Erkenntnisse zur kindlichen Entwicklung folglich eine große und naturorientierte<br />
Fläche mit waldähnlicher Gestaltung erhalten. Das ist wesentlich<br />
bedeutsamer, als Mittel in künstlerisch gestaltete Objekte und Materialien<br />
zu investieren. Bisher reagieren die Kin<strong>der</strong>tagesstätten auf die Bewegungsarmut<br />
<strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> jedoch, indem sie in nahezu allen Neubauten sogenannte<br />
Bewegungsräume schaffen. Die seit den 1980er Jahren üblichen Mehrzweckräume,<br />
die verschiedene <strong>Funktionen</strong> beinhalteten, wandeln sich nunmehr in<br />
Raumstrukturen mit spezieller Ausrichtung auf Bewegung und sind dementsprechend<br />
mit vielfältigen Objekten ausgestattet, die Bewegung anregen<br />
sollen – wie Klettergerüste, Lianen o<strong>der</strong> Rutschen.<br />
Kin<strong>der</strong>-Kulturzentrum<br />
Nicolai, Dörte Mandrup,<br />
Kolding,<br />
Dänemark, 2008<br />
72 Erschließungsraum<br />
mit Rutsche, Beispiel<br />
eines Bewegungsobjektes<br />
73 Dschungel mit Lianen<br />
74 Spielraum Wolke mit<br />
Bällen<br />
Kin<strong>der</strong>tagesstätten und die<br />
Verhäuslichung <strong>der</strong> Kindheit<br />
73
Kin<strong>der</strong>tagesstätten und die<br />
Verhäuslichung <strong>der</strong> Kindheit<br />
cken, nicht nur auf <strong>der</strong> Straße o<strong>der</strong> in den Gruppen, son<strong>der</strong>n auch im<br />
Kükelhausgarten, Erlebnisfeld <strong>der</strong> Sinne im Kieselgarten, an <strong>der</strong> Sandbucht,<br />
im Affengehege, im dem Sonnenblumengarten <strong>der</strong> Molchwiese,<br />
unterm Kirschbaum im Schaukelwald, am Hasenstall, im Rutschen Hof,<br />
am Brunnenhof, auf dem Matschplatz, am Backhaus, unter <strong>der</strong> Windmühle,<br />
beim Sonnensegel und Mondplatz.“ 221<br />
Der ästhetisch-gestalterische Anspruch des Gebäudes und <strong>der</strong> Räume ist<br />
sehr hoch. Die Räume sind nicht schlicht rechteckig, nicht schlicht aneinan<strong>der</strong>gereiht<br />
und liegen nicht an einem schlichten schmalen Flur. Die Materialität<br />
und die Raumatmosphären sind vielfältig und anregend.<br />
Die Grundrissanlage transformiert die traditionellen Vorstellungen und<br />
Empfindungen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>gartenkin<strong>der</strong> von 3 bis 6 Jahren und fügt im hinteren<br />
Bereich zwei Räume für die Krippenkin<strong>der</strong> hinzu. Das Gebäude richtet<br />
sich gedanklich auf die Elementarkin<strong>der</strong>, also die ehemaligen Kin<strong>der</strong>gartenkin<strong>der</strong>,<br />
aus, die sich immer mehr raumbezogene Fähigkeiten und damit körperliche<br />
und geistige Entfaltungsfreiheit aneignen können und sollten.<br />
Der Grundriss enthält – wie im Kin<strong>der</strong>gartenbau üblich – sechs vergleichbar<br />
große Gruppenräume, die im Erdgeschoss liegen und die jeweils<br />
mit Sitzgruppen, Tischen, Spiel- und Kuschelecken und Sofas ausgestattet<br />
94<br />
83 Entdeckerhaus, plus+<br />
bauplanung GmbH –<br />
Hübner – Forster –<br />
Remes – Hiller, Bremen,<br />
2006, Lageplan
sind. Sie beinhalten Differenzierungs- o<strong>der</strong> Ruheräume sowie Waschbereiche.<br />
Vor den Zugängen befinden sich Gar<strong>der</strong>obennischen und gegenüber<br />
sind an <strong>der</strong> Süd- und Ostseite die Küche, das Büro sowie die Personal-, Lagerund<br />
Technikräume gelegen.<br />
Alle Gruppenräume verfügen über einen direkten Zugang zum Außengelände.<br />
Ein zusätzlicher Raum zwischen Außengelände und Eingangshalle fungiert<br />
als Schmutzschleuse und erleichtert den Schuhwechsel. Der Erschließungsgang<br />
zwischen Gruppenräumen und Dienstleistungsräumen weitet sich<br />
im Zentrum <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>tagesstätte zu einer großen Eingangs- und Spielhalle<br />
aus, von <strong>der</strong> man über eine Treppe auf die Galerie gelangt, die die Hochebenen<br />
<strong>der</strong> vier für die Elementarkin<strong>der</strong> geplanten Gruppenräume erschließt.<br />
Von diesen kann man dann wie<strong>der</strong>um in die Türme gelangen, sodass prinzipiell<br />
alle Türme allen Gruppen zur Verfügung stehen. Ein Rundlaufprinzip<br />
führt also vom Gruppenraum über die Hochebene und die Galerie durch die<br />
Halle zurück zum Gruppenraum. Die Architekten intendierten jedoch keinen<br />
„freien“, unkontrollierten Zugang von <strong>der</strong> Galerie zu den Gruppenräumen,<br />
son<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Rundlauf sollte nur unter Aufsicht freigegeben werden. 222 Für<br />
die Elementarkin<strong>der</strong> ist dieser intendierte Bewegungsablauf funktional und<br />
räumlich interessant ausgeführt.<br />
Kin<strong>der</strong>tagesstätten und die<br />
Verhäuslichung <strong>der</strong> Kindheit<br />
84 Entdeckerhaus, plus+<br />
bauplanung GmbH –<br />
Hübner – Forster –<br />
Remes – Hiller, Bremen,<br />
2006, Grundriss, eigene<br />
Bearbeitung<br />
95
Kin<strong>der</strong>tagesstätten und die<br />
Verhäuslichung <strong>der</strong> Kindheit<br />
Aktivitäten beobachten und so zur Nachahmung anreget werden können. So<br />
besteht auch die Möglichkeit, dass die Elementarkin<strong>der</strong> Interesse an ihnen<br />
entwickeln, in ihre Raumbereiche gehen und mit ihnen spielen. Sehr gelungene<br />
Beispiele dafür stellen das Kreiselnest und das Entdeckerhaus dar.<br />
In den Großstädten stehen die Betreiber nicht selten vor dem Problem,<br />
keine geeignet großen und bezahlbaren Grundstücke zu finden. Die<br />
städtischen Organe selbst bauen Kin<strong>der</strong>tagesstätten mit Freibereichen auf<br />
Dächern o<strong>der</strong> Terrassen in Obergeschossen, die sehr begrenzt sind und auf<br />
denen mittels grüner, brauner o<strong>der</strong> blauer Kunststoffbeläge Gras, Erde o<strong>der</strong><br />
Wasser nachgeahmt werden soll. An dieser Stelle bedarf es einer generellen<br />
Festlegung durch die Gemeinden o<strong>der</strong> auch durch höhere Instanzen von<br />
klaren Größen- und Ortsvorgaben für einen Garten von mindestens 15 Quadratmetern<br />
pro Kind. Städte sollten Grundstücke für Kin<strong>der</strong>tagesstätten an<br />
den Rän<strong>der</strong>n von Parks und Spielplätzen ausweisen, die von den Betreibern<br />
erworben werden können. Hamburg beispielsweise verfügt über einen rund<br />
150 Hektar großen, 261 zentral gelegenen Stadtpark sowie einen circa 205<br />
Hektar großen, ebenfalls innerstädtisch gelegenen Volkspark, 262 an <strong>der</strong>en<br />
Rän<strong>der</strong>n Grundstücke für Kin<strong>der</strong>tagesstätten vorgesehen werden könnten,<br />
die auch in die Parkfläche selbst hineinragen.<br />
Die institutionalisierte Kindheit benötigt insgesamt mehr gesellschaftliche<br />
Empathie. In den Freiflächen lassen sich weitergehende Nutzungskonzepte<br />
für verschiedene gesellschaftliche Gruppen entwickeln. Beispielsweise<br />
könnten auch Menschen aus Pflegeheimen diese Frei- und Übergangsräume<br />
abwechselnd o<strong>der</strong> gemeinsam nutzen. Zu dieser Art von Freiraumnutzung<br />
haben wir einige gebaute Beispiele empirisch untersucht. Es hat sich gezeigt,<br />
dass Kin<strong>der</strong> und alte Menschen sich zunächst gegenseitig beobachten, allmähliches<br />
Interesse an gemeinsamen Aktivitäten entwickeln und schließlich<br />
gemeinsame Handlungen stattfinden. Für beide Gruppen ergeben sich Vorteile,<br />
die differenziert im zweiten Teil zum Mehrgenerationenwohnen vorgestellt<br />
werden.<br />
Schlussbemerkung<br />
Kin<strong>der</strong>tagesstätten bilden nicht zuletzt auch einen sozialen Ort im Quartier.<br />
Sie verkörpern die Existenz <strong>der</strong> Kindheit und materialisieren das Kindsein.<br />
Der Übergang vom geborgenen Ort des „Innen“ zu <strong>der</strong> öffentlichen Welt des<br />
„Draußen“ erfor<strong>der</strong>t einen räumlichen Schutz durch Abgeschlossenheit. Die<br />
künstlerische Gestaltung <strong>der</strong> <strong>Architektur</strong> und Freibereiche sollte die transformierten<br />
Antworten auf die Bedürfnisse <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Gegenwart in neuen<br />
architektonischen Symbolen zum Ausdruck bringen.<br />
134
Wohnungsbau<br />
im Wandel <strong>der</strong><br />
Familienstrukturen
Wohnungsbau im Wandel<br />
<strong>der</strong> Familienstrukturen<br />
Haus Tugendhat, Mies van<br />
<strong>der</strong> Rohe, Brünn, 1929<br />
11 Ansicht Straßenseite<br />
12 Gartenansicht<br />
sterben im ersten Lebensjahr an Unterernährung. Diesem Wert <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>,<br />
o<strong>der</strong> besser gesagt Unwert, entspricht <strong>der</strong> Raum, er existiert nicht. Kin<strong>der</strong><br />
schlafen, wo sie einen Platz finden, zumeist auf Strohsäcken.<br />
Das gesamte Leben <strong>der</strong> Familie, die eine weit größere Anzahl von Mitglie<strong>der</strong>n<br />
umfasst als die bürgerliche Kernfamilie, findet in den Arbeits- Küchen-<br />
Wohn-Schlafstuben statt und ist Ausdruck <strong>der</strong> „arbeiterlichen″ Familienorganisation.<br />
Sie besteht aus Mann, Frau, Kin<strong>der</strong>n, Großeltern, weiteren Verwandten<br />
und fremden Schlafburschen, an die Bettstellen vermietet werden. Da eine Differenzierung<br />
des Raumes kaum möglich ist, werden sämtliche Lebensbedürfnisse<br />
vor aller Augen verrichtet: die Heimarbeiten <strong>der</strong> Männer, Frauen und Kin<strong>der</strong>,<br />
das Kochen, das Schlafen, <strong>der</strong> Geschlechtsverkehr, das Gebären <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> und<br />
das Sterben. Es gibt kaum eine Tabuisierung von Tätigkeiten und wenig auf den<br />
Körper bezogene Scham- o<strong>der</strong> Peinlichkeitsschwellen. Die einzelnen Bewohner<br />
verfügen nicht über eigene Orte o<strong>der</strong> Teilorte.<br />
Wohnen und <strong>Architektur</strong> des Bürgertums und<br />
Kleinhaussiedlungen in den 1920er Jahren<br />
Die Nie<strong>der</strong>lage im Ersten Weltkrieg bringt in Deutschland einen tief greifenden<br />
politischen und gesellschaftlichen Strukturwandel in Gang. Der Sturz des<br />
Kaisers führt zur Entmachtung des herrschenden Adels und zum gesellschaftlichen<br />
Aufrücken von Bürgertum und Arbeiterschicht. Das Bürgertum erfährt<br />
einen unerwarteten und kometenhaften Aufstieg, eine unvorstellbare Ausweitung<br />
seiner Macht und damit auch seiner Empfindungs-, Verhaltens- und<br />
architektonischen Standards. Im Zuge dessen verschärft sich die geschlechterspezifische<br />
Trennung zwischen dem geldverdienenden Mann außer Haus<br />
und <strong>der</strong> haushaltsführenden und kin<strong>der</strong>erziehenden Frau innerhalb des Hauses.<br />
Dementsprechend wandelt sich auch die <strong>Architektur</strong> des Wohnens in<br />
Richtung bürgerlicher Standards. Die Dame repräsentiert in den dafür vorgesehenen<br />
Räumen den Status und das Prestige des arbeitenden Mannes. Die<br />
Villa Tugendhat in Brünn, entworfen 1929 von Ludwig Mies van <strong>der</strong> Rohe, ist in<br />
<strong>der</strong> Baugeschichte als Leuchtturm mo<strong>der</strong>ner bürgerlicher <strong>Architektur</strong> bekannt<br />
geworden und symbolisiert unter an<strong>der</strong>em diese Entwicklung.<br />
In <strong>der</strong> gesamten Repräsentationsetage löst <strong>der</strong> Architekt bislang gültige<br />
Raumstrukturen auf und überführt sie in offene Nutzungsbereiche zum Woh-<br />
144
Haus Tugendhat, Mies<br />
van <strong>der</strong> Rohe, Brünn,<br />
1929<br />
13 Grundriss<br />
Erdgeschoss<br />
14 Wohnraum<br />
15 Wohnbereich<br />
Grundriss Erdgeschoss,<br />
eigene Bearbeitung<br />
Wohnungsbau im Wandel<br />
<strong>der</strong> Familienstrukturen<br />
Haus Tugendhat, Mies van<br />
<strong>der</strong> Rohe, Brünn, 1929<br />
16 Arbeitsplatz des<br />
Hausherrn<br />
17 Arbeitsbereich des<br />
Hausherrn, Grundriss<br />
Erdgeschoss, eigene<br />
Bearbeitung<br />
18 Blick auf Klavier,<br />
Herrenschreibtisch und<br />
Wohntrennwand<br />
145
Europa<br />
Amerika<br />
Asien<br />
Afrika<br />
Australien<br />
Wohnungsbau im Wandel<br />
<strong>der</strong> Familienstrukturen<br />
106 Wohnanlage wagnis-<br />
ART, Domagkpark, bogevischs<br />
buero architekten<br />
& stadtplaner gmbH /<br />
Schindler Hable Architekten<br />
GbR / Auböck +<br />
Karasz Landscape Architects<br />
/ bauchplan GbR,<br />
München, 2016, Lageplan,<br />
eigene Bearbeitung<br />
Hable Architekten, Udo Schindler und Walter Hable, realisiert, die Freianlagen<br />
durch Auböck + Kárász Landscape Architects zusammen mit Bauchplan, Wien.<br />
Bereits 2006 begann <strong>der</strong> partizipative Planungsprozess mit den Bewohnern<br />
in Workshops, in denen bereits in <strong>der</strong> Leistungsphase 0 ein Konzept für das<br />
12.900 Quadratmeter große Grundstück entwickelt wurde. 195 „Das Projekt geht<br />
über die herkömmlichen partizipativen Planungsprozesse im Geschosswohnungsbau<br />
hinaus.“ 196 Die Gruppe plante eine Anlage aus fünf polygonalen, frei<br />
stehenden und unregelmäßig geformten Einzelgebäuden, die sich locker um<br />
zwei Innenhöfe gruppieren. 197 Die fünf Gebäude beinhalten 10.610 Quadratmeter<br />
Wohnfläche, 683 Quadratmeter Gewerbe- und 307 Quadratmeter Gemeinschaftsflächen.<br />
198 Das Ziel besteht auch hier im Schaffen hybri<strong>der</strong> Strukturen,<br />
die Wohnen mit Arbeiten und Freizeit verbinden. Die Häuser sind nach den<br />
fünf Kontinenten benannt und unterscheiden sich farbig: Australien ist orange,<br />
Afrika dunkelblau, Amerika hellblau, Europa grün und Asien gelb gestaltet. 199<br />
220<br />
Gemeinschaftliche Räume und Orte <strong>der</strong> Bewegung<br />
Die Architekten und die am Planungsprozess beteiligten zukünftigen Nutzer<br />
konzipierten vielfältige Orte <strong>der</strong> Kommunikation und Begegnung mit jeweils<br />
unterschiedlichem Öffentlichkeitscharakter. Einige Bereiche sind ausschließlich<br />
den Bewohnern vorbehalten, an<strong>der</strong>e stehen dem gesamten Quartier<br />
offen. Im dritten und vierten Obergeschoss verbinden bis zu 6 Meter breite<br />
Luftbrücken die Gebäude und münden in gemeinschaftliche Terrassen. 200<br />
Die Bewohner <strong>der</strong> Häuser können sich über diese Verbindungen gegenseitig<br />
besuchen. 201 Die Idee zu den Brücken und <strong>der</strong>en terrassenartigen Erweiterungen<br />
sind in den Workshops entstanden und verkörpern für das Projekt und<br />
das Mehrgenerationenwohnen eine beson<strong>der</strong>e Bedeutung. Sie binden die<br />
Wohnanlage visuell und räumlich zusammen und signalisieren die Gemeinschaftlichkeit<br />
<strong>der</strong> Bewohner, gleichzeitig ermöglichen sie kommunikationserzeugende<br />
Bewegung, erlauben verschiedene Durchblicke, öffnen sich zum
Wohnanlage wagnisART,<br />
Domagkpark, bogevischs<br />
buero architekten &<br />
stadtplaner GmbH /<br />
Schindler Hable Architekten<br />
GbR / Auböck +<br />
Karasz Landscape Architects<br />
/ bauchplan GbR,<br />
München, 2016<br />
107 Fassaden und<br />
Dorfplatz<br />
108 Fassaden und<br />
Dorfplatz<br />
109 Luftbrücken<br />
110 Luftbrücken und<br />
Terrasse<br />
Wohnungsbau im Wandel<br />
<strong>der</strong> Familienstrukturen<br />
221
Die sechs Einpersonenapartments verfügen über je zwei Zimmer, einen<br />
Wohnbereich und eine Essecke, einen Schlafbereich mit Bett und Schrank<br />
sowie ein Bad. In allen Apartments erreicht man das Schlafzimmer über den<br />
Wohnraum, was Flurfläche einspart. Wir haben solche Wohntypologien bei<br />
älteren alleinlebenden Menschen und Singles öfter untersucht und die Menschen<br />
dazu befragt. In <strong>der</strong> Regel verzichten diese lieber auf einen Flur und<br />
streben die hier umgesetzte Grundrisslösung an. Die Zweizimmerwohnungen<br />
verfügen über einen Wohnbereich, eine Essecke, einen Schlafbereich mit<br />
Bett und Schrank sowie ein Bad. Die Pantrys in allen Apartments sind nach<br />
Plan sehr klein und liegen teilweise im Flur o<strong>der</strong> Wohnbereich, werden aber<br />
nach Aussage <strong>der</strong> Architekten nicht von allen genutzt, weil die Bewohner<br />
nicht unbedingt eine eigene Küche benötigen.<br />
Wohnungsbau im Wandel<br />
<strong>der</strong> Familienstrukturen<br />
115 Wohnanlage wagnis-<br />
ART, Domagkpark, bogevischs<br />
buero architekten<br />
& stadtplaner gmbH /<br />
Schindler Hable Architekten<br />
GbR / Auböck +<br />
Karasz Landscape Architects<br />
/ bauchplan GbR,<br />
München, 2016, Strukturplan<br />
Anlage mit Luftbrücken,<br />
Afrika umrandet<br />
230<br />
Das Haus Afrika beinhaltet nach dem Vorabzugsplan von 2013 vier Cluster,<br />
die zwischen 273 und 280 Quadratmeter groß sind und alle auf einer<br />
Ebene liegen. Im ersten Obergeschoss befinden sich fünf Apartments für<br />
acht Personen mit drei Zwei- und zwei Einpersonenwohnungen. Die gemeinschaftliche<br />
Wohnküche weist eine Dreiecksform auf und liegt inmitten <strong>der</strong><br />
Erschließung <strong>der</strong> drei hinteren Wohnungen, was sich ebenfalls als ungünstig<br />
erweist und aus <strong>der</strong> im Partizipationsprozess entwickelten Gebäudeform<br />
resultiert. Im zweiten, dritten und vierten Obergeschoss befinden sich<br />
jeweils fünf Apartments für acht Personen mit einer Drei-, einer Zwei- und<br />
drei größeren Einpersonenwohnungen, <strong>der</strong>en Schlafbereich abgetrennt ist,<br />
sowie eine gemeinschaftliche Essküche und ein Gemeinschaftsraum. Dieser<br />
liegt am an<strong>der</strong>en Ende des Clusters, weist genügend Platz für alle Mitglie<strong>der</strong><br />
auf und ist zum Dorfplatz ausgerichtet. Beim Kommen und Gehen können die<br />
Bewohner einen Blick hineinwerfen und entscheiden, ob sie Kontakt aufnehmen<br />
wollen o<strong>der</strong> nicht. Zudem bietet er die notwendige Ruhe und akustische<br />
Abgeschlossenheit für ein Beisammensein <strong>der</strong> Gemeinschaft.
Wohnanlage wagnisART,<br />
Domagkpark, bogevischs<br />
buero architekten<br />
& stadtplaner gmbH /<br />
Schindler Hable Architekten<br />
GbR / Auböck +<br />
Karasz Landscape Architects<br />
/ bauchplan GbR,<br />
München, 2016<br />
116 Grundriss erstes<br />
Obergeschoss, Afrika<br />
117 Grundriss viertes<br />
Obergeschoss, Afrika<br />
Wohnungsbau im Wandel<br />
<strong>der</strong> Familienstrukturen<br />
231
Wohnungsbau im Wandel<br />
<strong>der</strong> Familienstrukturen<br />
nur die Küche, <strong>der</strong> Essbereich o<strong>der</strong> das Badezimmer liegen. Der Planungsgedanke<br />
bei Laubengängen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Gemeinschaftsräumen besteht darin,<br />
Kommunikation durch zufällige Begegnung zu erzeugen, demzufolge wird die<br />
gesamte Erschließungs- und Zugangsstruktur fast ausnahmslos diesem Prinzip<br />
untergeordnet.<br />
Das verhin<strong>der</strong>t jedoch individuellere Verhaltensformen, die nicht für die<br />
Öffentlichkeit vorgesehen sind, wenn beispielsweise ein Jugendlicher eine<br />
neue Freundschaft nicht den Nachbarn vorführen will. Aber auch Erwachsene<br />
fühlen sich nach unseren empirischen Befragungen nicht immer wohl dabei,<br />
von vielen Augen beobachtet werden zu können. Beim Aufsuchen o<strong>der</strong> Verlassen<br />
ihrer Wohnung sind sie aufgefor<strong>der</strong>t, an mehreren Küchen vorbeizugehen<br />
und zu grüßen, was nicht immer ihren Empfindungen entspricht. Teilnehmende<br />
Beobachtungen zeigen, das Bewohner mehrfach umziehen, bis sie<br />
das Ende des Laubenganges erreichen. Die neuen Kommunikationselemente,<br />
die in dieser Abhandlung am Beispiel <strong>der</strong> Wohnprojekte vorgestellt wurden,<br />
sollten Zwänge vermeiden und immer auch die Möglichkeit bieten, sich bei<br />
Bedarf individuell zu verhalten und seine Wohnung weniger beobachtet o<strong>der</strong><br />
bestenfalls sogar unbeobachtet betreten zu können o<strong>der</strong> in seinem Wohnzimmer<br />
Kommunikationsansprüchen vorbeigehen<strong>der</strong> Mitbewohner nicht<br />
ausgesetzt zu sein. Eine <strong>Architektur</strong>, die <strong>der</strong> gegenwärtigen Individualisierung<br />
zuwi<strong>der</strong> handelt, ist nicht funktional.<br />
Schlussbemerkung<br />
242<br />
Der demografische und familienstrukturelle Wandel führte im Verlauf <strong>der</strong> vergangenen<br />
20 Jahre zu vielfältigen Kombinationen verschiedener Wohnungstypen<br />
unterschiedlicher Größen in einem Gebäude. Diese neue Differenzierung<br />
erzeugt eine Mischung <strong>der</strong> Haushaltsformen, <strong>der</strong> Generationen und <strong>der</strong><br />
Milieus. Die Wohnmodelle sollten aber hinsichtlich <strong>der</strong> neuen Gruppe <strong>der</strong><br />
Alleinerziehenden verbessert und insgesamt weiterentwickelt werden. Funktionsgerechte<br />
Grundrisse für Alleinerziehende mit kleinem Einkommen waren<br />
kaum zu finden.<br />
Für die beson<strong>der</strong>s wichtige körperliche Bewegung sowohl für Kin<strong>der</strong><br />
als auch für ältere Menschen sollte ein interessanter Freiraum für vielfältige<br />
Aktionen angelegt sein. Die Möglichkeit gärtnerischer Tätigkeiten im Garten<br />
o<strong>der</strong> auf erweiterten grünen Terrassen können Kommunikation und Bewegung<br />
zusätzlich för<strong>der</strong>n. Darüber hinaus sollten in <strong>der</strong> näheren Umgebung<br />
Grünflächen und Parks mit großen Spielplätzen Bewegungsräume anbieten.<br />
Die gegenwärtige gesellschaftliche Diskussion über neue Wohnformen für<br />
Jung und Alt, die <strong>der</strong> Bewältigung <strong>der</strong> aus dem demografischen Wandel<br />
resultierenden Problemen dienen, weist insgesamt in die richtige Richtung.<br />
Gemischte Wohnformen bedeuten eine Weiterentwicklung <strong>der</strong> Akzeptanz<br />
und Empathie zwischen den Generationen und begünstigen eine bewusste<br />
gegenseitige Wahrnehmung in gemeinschaftlich genutzten Räumen. Die<br />
generationsübergreifenden Wohnmodelle deuten auf sich entwickelnde<br />
Fähigkeiten von Teilen <strong>der</strong> Bevölkerung zur gegenseitigen Wahrnehmung<br />
und Empathie mit an<strong>der</strong>en Gruppen hin, was Norbert Elias als Kennzeichen<br />
<strong>der</strong> Zivilisierung bezeichnet.
Bauten für<br />
Wohnen und<br />
Leben im Alter im<br />
Kontext demografischer<br />
Verän<strong>der</strong>ungen
Bauten für Wohnen und Leben im Alter im<br />
Kontext demografischer Verän<strong>der</strong>ungen<br />
Die <strong>Architektur</strong> vermeidet durch ihre Grundform einer klassischen italienischen<br />
Villa jede Assoziation mit einem Pflegeheim und symbolisiert vielmehr<br />
ein ganz normales Wohnhaus mit zwei Stockwerken. Die Pflegehausgemeinschaft<br />
in Dießen ist, im Gegensatz zu Altenpflegeheimen, die nach<br />
dem Krankenhaustypus konzipiert und mit Preisen ausgezeichnet sind, nicht<br />
in <strong>der</strong> architektonischen Fachliteratur veröffentlicht. In den traditionellen<br />
Gebäuden erfüllen die Aufenthaltsbereiche nur selten die dringend notwendige<br />
Kommunikationsfunktion. Die Räume bestehen teilweise aus Durchgangsbereichen,<br />
in denen es zieht und <strong>der</strong>en Wände aus schallreflektierenden<br />
Materialien wie Glas bestehen, was angesichts <strong>der</strong> sich reduzierenden<br />
Hörfähigkeit <strong>der</strong> Bewohner Probleme erzeugt. Auch das übliche Parkett o<strong>der</strong><br />
Linoleum bietet in akustischer Dimension weniger gute Bedingungen als Teppich.<br />
Körperlich gebrechliche Menschen, die in Rollstühlen sitzen o<strong>der</strong> sich<br />
nur mühsam bewegen können, benötigen hingegen Aufenthaltsräume mit<br />
geschlossenen, schützenden Wänden im Rücken, vor denen sie in bequemen<br />
Sesseln gemütlich sitzen, mit an<strong>der</strong>en Menschen sprechen o<strong>der</strong> ihre Umgebung<br />
beobachten können. Räume mit Blick auf ein Aktionsfeld, in dem etwas<br />
geschieht, werden nach unseren Untersuchungen am meisten frequentiert,<br />
auch wenn sie architektonisch wenig gestaltet sind. Als unerlässlich erweist<br />
sich eine gute Akustik zur Verständigung untereinan<strong>der</strong>, die Vermeidung von<br />
Zugluft, zu großer Hitzeeinstrahlung sowie spiegelnden Flächen.<br />
Auch das medizinische und gerontologische Wissen über die Demenzkrankheit,<br />
die sich mit <strong>der</strong> steigenden Lebenserwartung in den Industrienationen<br />
ausweitet, materialisiert sich bislang nur selten in <strong>Architektur</strong> und<br />
Freiräumen (vgl. Exkurs zur Demenz ⟶ S. 281–284). Nur wenige Architekten<br />
und Träger beginnen nach <strong>der</strong> Jahrtausendwende spezifische Demenzpflegeheime<br />
zu bauen und diese Krankheit des „hohen“ Alters in <strong>Architektur</strong> und<br />
Freiraum zu transformieren. Die Bedürfnisse Demenzkranker unterscheiden<br />
sich fundamental von denen körperlich Pflegebedürftiger. Sie benötigen<br />
gänzlich an<strong>der</strong>e architektonische Räume, wie im folgenden Kapitel zu Bauten<br />
für Menschen mit Demenz (⟶ S. 281–303) ausführlicher dargestellt.<br />
280
Bauten für Menschen<br />
mit Demenz – ein generelles<br />
Modell für Pflegeheime<br />
Die Wohn- und Lebensformen für Demenzkranke erfor<strong>der</strong>n eine geson<strong>der</strong>te<br />
Erörterung, weil sich die Gruppe mit steigen<strong>der</strong> Lebenserwartung<br />
einer Gesellschaft vergrößert. Ihre architektonischen Bedürfnisse sind bislang<br />
wenig reflektiert und transformieren sich dementsprechend auch nicht<br />
in Raum. Speziell für sie konzipierte Gebäude eignen sich auch bestens für<br />
an<strong>der</strong>e Pflegebedürftige gleich welchen Alters. Umgekehrt sind Pflegeheime,<br />
die nach dem üblichen Stationsprinzip konzipiert sind, für Demenzkranke<br />
vollkommen unfunktional und verursachen große Probleme.<br />
Ab <strong>der</strong> Jahrtausendwende beginnt sich in <strong>der</strong> Gesellschaft die Erkenntnis<br />
durchzusetzen, dass Demenz an<strong>der</strong>e Verlaufsformen und Symptome aufweist<br />
als an<strong>der</strong>e Krankheiten, die im Alter zu Pflegebedürftigkeit führen. Infolgedessen<br />
befassen sich seither einige wenige Architekten und Betreiber mit<br />
<strong>der</strong> Frage, wie eine <strong>Architektur</strong> für diese Erkrankten konzipiert sein müsste;<br />
seit ungefähr 2005 entstehen einzelne spezielle Gebäude, die im Folgenden<br />
als zukünftige <strong>Architektur</strong> für alle Pflegeeinrichtungen vorgestellt und erörtert<br />
werden.<br />
Exkurs: Demenz – Daten und Symptome<br />
Der Begriff Demenz leitet sich von dem lateinischen mens für das Denkvermögen<br />
ab und bedeutet im Sinne von de-mens ohne Verstand. 104 Demenz<br />
ist die häufigste neurologische Erkrankung im Alter, an <strong>der</strong> im Jahr 2016 in<br />
Deutschland sowie in Europa circa 40 Prozent aller über Neunzigjährigen leiden.<br />
105 Die Krankheit führt durch den fortschreitenden Abbau von Neuronen<br />
und Synapsen zu Verän<strong>der</strong>ungen im Gehirn. Sie beginnt im zerebralen Kortex,<br />
von dem aus sie sich später auf große Teile des Gehirns ausweitet. Die für<br />
die Datenübertragung notwendigen Neurotransmitter, werden nicht mehr<br />
ausreichend hergestellt. 106 Das Gehirn verarbeitet die Informationen unzulänglich<br />
und unterliegt einem Vorgang <strong>der</strong> Vereiweißung. Das äußert sich<br />
in einem komplexen Symptombild, das durch einen fortschreitenden Verlust<br />
geistiger Fähigkeiten, Gedächtnis-, Wahrnehmungs- und Denkstörungen,<br />
Desorientiertheit, Persönlichkeitsverän<strong>der</strong>ungen und in <strong>der</strong> Folge all dessen<br />
auch mit körperlichem Abbau geprägt ist. 107 Weitere begleitende Symptome<br />
zeigen sich in Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> emotionalen Kontrolle, des Sozialverhaltens<br />
und <strong>der</strong> Motivation. Die kognitiven Beeinträchtigungen reduzieren die<br />
Alltagskompetenz <strong>der</strong> Betroffenen. 108 Die Pflegebedürftigkeit steigt mit dem<br />
Voranschreiten <strong>der</strong> Erkrankung an. Im Schnitt ziehen die Patienten 2,9 Jahre<br />
Bauten für Wohnen und Leben im Alter im<br />
Kontext demografischer Verän<strong>der</strong>ungen<br />
281
Bauten für Wohnen und Leben im Alter im<br />
Kontext demografischer Verän<strong>der</strong>ungen<br />
70 Multisensorische<br />
Gestaltung, taktile<br />
Wandelemente, Holz<br />
blemen vorbeugt. Wandoberflächen aus unterschiedlichen Materialien wie<br />
Holz, Stein, Stoff, Fliesen, Lehm, Moos o<strong>der</strong> Anteilen aus Stroh weisen eine<br />
angenehme taktile Oberfläche auf, for<strong>der</strong>n zum Anfassen auf und stimulieren<br />
den Tast-, Geruchs- und Sehsinn. Ein Bodenbelag mit warmen o<strong>der</strong> dunkleren<br />
Farbtönen vermittelt zudem ein sicheres Gefühl und suggeriert Trittfestigkeit.<br />
225 Leichte farbliche Unterschiede o<strong>der</strong> materialdifferenzierte Fel<strong>der</strong><br />
im Fußboden können verschiedenartige Wahrnehmungen und Emotionen<br />
beim Gehen erzeugen. Spiegelnde Bodenbeläge lösen hingegen Gefühle von<br />
Glätte und Rutschgefahr aus, schwarze o<strong>der</strong> dunkelgraue Angst vor Tiefen<br />
und Abgründen und auch zu starke Kontraste im Boden können die Menschen<br />
erschrecken und verunsichern. 226<br />
In einigen neueren Pflegeheimen materialisieren sich die Erkenntnisse<br />
und Vorschläge zur Anregung aller Sinne und zu gleichzeitiger Entspannung<br />
in einem sogenannten Snoezelraum. Wie im ersten Teil zu Kin<strong>der</strong>tagesstätten<br />
bereits dargestellt, setzt sich das Kunstwort Snoezelen aus den beiden<br />
nie<strong>der</strong>ländischen Verben snuffelen und doezelen zusammen und bedeutet<br />
dösen, schlummern, schnüffeln o<strong>der</strong> schnuppern. 227 Die entsprechend gestalteten<br />
Räume stimulieren die basalen Sinne, indem unterschiedliche sensorische<br />
Wahrnehmungen erfahren werden. 228 Die Umgebung soll Wohlbefinden<br />
durch „steuerbare multisensorische Reize“ auslösen. 229 Die Räume bestehen<br />
in <strong>der</strong> Regel aus einer Sitz- o<strong>der</strong> Liegelandschaft, beinhalten Grünpflanzen,<br />
„wassergefüllte farbige Glasröhren mit einem Luftperlenspiel o<strong>der</strong> rotierende<br />
Lichtkugeln mit Farbeffekten, Hintergrundmusik und eine Öllampe zum Erzeugen<br />
aromatischer Düfte.“ 230 Die Verfasserin sieht einzelne dieser Maßnahmen<br />
jedoch kritisch, da sie künstlich in einem speziellen Raum erzeugt werden,<br />
den die Pflegeheime in <strong>der</strong> Regel selbst ausstatten.<br />
Die Veröffentlichungen über Pflegeheime in den <strong>Architektur</strong>zeitschriften<br />
zeigen, dass Materialkargheit wie Sichtbeton und Reduktion in <strong>der</strong> <strong>Architektur</strong>welt<br />
als ästhetische Maxime gelten. Für die Zukunft bedarf es einer Wahrnehmungserweiterung<br />
im Hinblick auf die räumlichen <strong>Funktionen</strong> des Altwerdens.<br />
Die <strong>Architektur</strong> des gesamten Gebäudes sollte in allen Einzelteilen die<br />
Anregung sich reduzieren<strong>der</strong> körperlicher und geistiger Fähigkeiten durch<br />
Raum erzeugen.<br />
314
Wasser, Licht und Farbe<br />
Wasser stellt ein beson<strong>der</strong>es Element zur Anregung <strong>der</strong> Sinne und <strong>der</strong> Bewegung<br />
dar, das bei Wohnungsplanungen im nördlichen Europa üblicherweise<br />
nicht verwendet wird. Wasser symbolisiert Bewegung, die man sehen,<br />
hören, spüren und fühlen kann, die beruhigt und besänftigt. Einige Pflegeeinrichtungen<br />
behelfen sich mit Fischaquarien in den Eingangshallen. Natursteine<br />
mit einem Quellbereich o<strong>der</strong> kleine Wasserarkaden in <strong>der</strong> Mitte <strong>der</strong><br />
Gemeinschafträume erzeugen Entspannung und verbessern das Raumklima.<br />
In Pflegeheimen, Wohn- und Quartiergrünanlagen benötigen insbeson<strong>der</strong>e<br />
die Gärten Wasserelemente; Beispiele dazu werden im folgenden Kapitel<br />
über Freibereiche und Gärten vorgestellt (⟶ S. 317–325).<br />
Licht und Helligkeit tragen zur Orientierung und damit zur Stressreduktion<br />
bei. Der Lichtbedarf erhöht sich bei älteren Menschen infolge <strong>der</strong> Verschlechterung<br />
<strong>der</strong> Sehleistung. 231 „Ein 60-Jähriger verfügt noch über 74 %,<br />
ein 80-Jähriger nur noch über 47 % <strong>der</strong> Sehschärfe eines 20-Jährigen.“ Da die<br />
Sehschärfe abhängig ist von <strong>der</strong> Beleuchtungsstärke und den vorhandenen<br />
Kontrasten, benötigt ein Siebzigjähriger eine dreifach hellere Leuchtdichte<br />
als ein Zwanzigjähriger, um einen Reiz wahrzunehmen. 232 Licht – im Beson<strong>der</strong>en<br />
das Tageslicht – weist darüber hinaus auch eine biologische Wirkung<br />
auf, indem es den Tag-Nacht-Rhythmus steuert und beispielsweise Depressionen<br />
und Orientierungsstörungen entgegenwirkt. 233 Die Pflegeheime und<br />
Wohnungen benötigen demnach möglichst viel Tageslicht. Dazu bieten sich<br />
auch Lichtlenksysteme an, wobei abends und nachts das gleiche Prinzip gilt:<br />
Die Räume müssen durch sehr viel helles, blendfreies Kunstlicht gleichmäßig<br />
zu erleuchten sein. Eine individuelle Helligkeitssteuerung erlaubt je nach<br />
fortschreitendem Alter bedürfnisgerechte Akzentsetzungen. Die Simulation<br />
des Tageslichtverlaufes beeinflusst beispielsweise den Schlaf-wach-Rhythmus<br />
und das Wohlbefinden <strong>der</strong> Patienten mit Demenz positiv. 234 Architekten<br />
setzen in <strong>der</strong> Regel Kunstlicht in Wohnungen eher sparsam ein und erzeugen<br />
für den Abend unterschiedliche Hell-dunkel-Atmosphären. Dies entspricht<br />
vornehmlich <strong>der</strong> Wahrnehmung <strong>der</strong> Planenden, die meist in einem jüngeren<br />
Alter sind. Die Erfüllung <strong>der</strong> <strong>Funktionen</strong> einer alternden Gesellschaft erfor<strong>der</strong>t<br />
eine Umorientierung.<br />
Farben unterstützen die Orientierung und vermitteln dadurch Sicherheit<br />
und Geborgenheit. Forschungsergebnisse aus <strong>der</strong> Farbpsychologie und Kommunikationstheorie<br />
weisen nach, dass die Vorliebe für dunkle Farben und insbeson<strong>der</strong>e<br />
für Schwarz mit dem Alter abnimmt. 235 Ganz generell sprechen<br />
sich die älteren Menschen in unseren empirischen Untersuchungen eher für<br />
helle, sanfte und unaufgeregte Farben aus. Fast alle Pflegeheime, Wohnungen<br />
und Wohnanlagen sind im Innenbereich in hellen Tönen ausgeführt und<br />
entsprechen damit den Vorstellungen. Die Fassaden <strong>der</strong> Wohnanlagen sind<br />
hingegen teilweise in kräftigen Rottönen gestaltet, was von den befragten<br />
Bewohnern ebenfalls als angenehm empfunden wird und auf eine Unterscheidung<br />
von Außen- und Innenraum schließen lässt. In <strong>der</strong> wenigen Literatur zum<br />
Thema „Farben im Alter“ finden sich keine an<strong>der</strong>sgearteten Erkenntnisse.<br />
Das Zusammenwirken von Farbe, Beleuchtung, bildgeben<strong>der</strong> Information<br />
und Wandgestaltung dient als Markierungen und wirkt sich positiv auf 315<br />
Bauten für Wohnen und Leben im Alter im<br />
Kontext demografischer Verän<strong>der</strong>ungen
Pflegeheim Alcácer do<br />
Sal, Aires Mateus<br />
Arquitectos, Lissabon,<br />
Portugal, 2010<br />
71 Außenansicht<br />
72 Innenbereich<br />
Bauten für Wohnen und Leben im Alter im<br />
Kontext demografischer Verän<strong>der</strong>ungen<br />
316<br />
die Stimmung aus. 236 Material, Licht und Farbe sind im Raum untrennbar miteinan<strong>der</strong><br />
verbunden und sollten als fester Bestandteil <strong>der</strong> architektonischen<br />
Komposition geplant und eingesetzt werden, wobei sich die Entwurfsqualität<br />
an <strong>der</strong> integrativen und alle Sinne stimulierenden Gesamtwirkung bemisst. Es<br />
bedarf <strong>der</strong> Entwicklung neuer ästhetischer Empfindungsstandards, um biografische,<br />
sinnesanregende Materialienvielfalt in horizontalen und vertikalen<br />
Elementen und Objekten an verschiedenen Orten in gestaltete Formen zu<br />
bringen und damit eine neue, bislang unbekannte Raumqualität zu erzeugen.<br />
Preisgekrönte und in <strong>der</strong> Fachliteratur veröffentlichte <strong>Architektur</strong>en wie<br />
das Pflegeheim Alcácer do Sal in Portugal materialisieren exakt das Gegenteil<br />
(Abb. 71, 72). Die Architektenwelt befasst sich kaum mit einer funktionalen<br />
Ästhetik für die alternde Gesellschaft. Der Prozess des Alterns scheint im<br />
Sinne von Elias vollständig verdrängt zu sein. Die weiße, reduktionistische<br />
Mo<strong>der</strong>ne dominiert diesen Bautyp noch immer und in immer neuen Variationen,<br />
vollkommen unabhängig von den Nutzungsinhalten. Das Pflegeheim<br />
Alcácer do Sal könnte auch ein Krankenhaus, ein Studentenwohnheim o<strong>der</strong><br />
sogar ein Museum sein; die Raumsymbolik vermittelt vieles. Aus einer rein<br />
kubischen Perspektive sieht es interessant aus, für demenzkranke alte Menschen,<br />
die auch in Portugal einen erheblichen Teil <strong>der</strong> Bewohner von Pflegeheimen<br />
ausmachen, funktioniert die Alltagsnutzung jedoch nicht und dementsprechend<br />
transformiert das Gebäude auch seinen Inhalt nicht adäquat.
Freibereiche und Gärten<br />
In den letzten Jahrzehnten nimmt die Forschung zu den positiven Auswirkungen<br />
von Sinnesanregung und Bewegung in <strong>der</strong> Natur zu, ohne dass diese<br />
Erkenntnisse in den Pflegeheimen o<strong>der</strong> Seniorenwohnanlagen bislang angemessen<br />
berücksichtigt wurden. Der Aufenthalt im Freien führt zur Verbesserung<br />
<strong>der</strong> zeitlichen und räumlichen Orientierung, des Gleichgewichtes, <strong>der</strong><br />
Beweglichkeit, <strong>der</strong> Aufmerksamkeit, <strong>der</strong> Konzentration, <strong>der</strong> Kommunikation,<br />
des Erinnerungsvermögens, des Schlafrhythmus sowie <strong>der</strong> Stimmung und<br />
senkt den Blutdruck. Die Bewegung in <strong>der</strong> Natur erhöht die sozialen Kontakte<br />
und för<strong>der</strong>t die kommunikative Aktivität. Das Gehirn kann im Freien durch<br />
verschiedene Anregungen wachsen, <strong>der</strong> Krankheitsverlauf bei Demenzkranken<br />
sich verlangsamen und das für die Bildung von Vitamin D verantwortliche<br />
Sonnenlicht die kognitiven Fähigkeiten verbessern. 237 Die Wahrnehmung<br />
einer natürlichen Umwelt mit viel Grün und Wasser beeinflusst zudem das<br />
parasympathische Nervensystem, welches organische <strong>Funktionen</strong> wie den<br />
Herz-Kreislauf, die Atmung, die Körpertemperatur sowie die Nieren-, Lungenund<br />
Magenfunktion steuert. Die Natur wirkt sich somit beruhigend auf den<br />
ganzen Organismus aus und stärkt dessen Immunfunktion. Die Verbundenheit<br />
zwischen Mensch und Natur wird deutlich, wenn man den Einfluss <strong>der</strong> Jahreszeiten<br />
auf unsere physiologischen <strong>Funktionen</strong> wie Blutdruck, Herzfrequenz,<br />
Stoffwechsel und Schlafdauer betrachtet. Auch das seelische Erleben kann<br />
sich durch die körperlichen Reaktionen auf die Jahreszeiten verän<strong>der</strong>n und<br />
zeigt sich in Form von Depressionen im Herbst o<strong>der</strong> angenehmen Frühlingsgefühlen.<br />
238 Diese Zusammenhänge dringen allmählich ins Bewusstsein einzelner<br />
gesellschaftlicher Gruppen und führen zur Entstehung erster Sinnesgärten.<br />
Sinnespark Haus Kannen, Gabriele Andreae, Münster, 1994<br />
Den ersten öffentlichen Sinnespark in Deutschland plant die Architektin<br />
Gabriele Andreae 1994 unter Leitung <strong>der</strong> Landschaftsplanerin Ilse Copak.<br />
Der Park umfasst etwa 2 Hektar und ist in Rundlaufflächen angelegt. Er bietet<br />
Erfahrungsstationen, Wahrnehmungen und sinnliches Erleben für jedes<br />
73 Sinnespark Haus<br />
Kannen, Gabriele<br />
Andreae, Münster, 1994,<br />
Gartenplan<br />
Bauten für Wohnen und Leben im Alter im<br />
Kontext demografischer Verän<strong>der</strong>ungen<br />
317
93 Wohnbebauung, f64<br />
architekten, Kempten,<br />
2017, positive klimatische<br />
Ausrichtung: Balkon halb<br />
drinnen, halb draußen<br />
Bauten für Wohnen und Leben im Alter im<br />
Kontext demografischer Verän<strong>der</strong>ungen<br />
Zum Freibereich Balkon<br />
336<br />
Für alte und kranke Menschen, die nicht mehr gut genug gehen können, um<br />
das Haus regelmäßig zu verlassen, stellt <strong>der</strong> Balkon gegen Ende des Lebens<br />
nicht selten den einzig verfügbaren Freibereich dar. Er ist im planerischen<br />
Gedankenschema bei Einpersonen-Altenwohnungen oftmals nur für eine Person<br />
ausgelegt, muss jedoch die Funktion erfüllen, Besuch zum Kaffeetrinken<br />
o<strong>der</strong> Essen empfangen zu können, wofür er fast immer zu klein ist.<br />
Der Balkon erfor<strong>der</strong>t darüber hinaus zwei Klimazonen: eine, die von<br />
Wänden geschützt ist, und eine, die über das Gebäude hinausragt, weil zu<br />
viel Sonneneinstrahlung den Kreislauf belastet und zu viel Wind als unan-
94 Wohnbebauung, f64<br />
architekten, Kempten,<br />
2017, positive klimatische<br />
Ausrichtung: Balkon halb<br />
drinnen, halb draußen<br />
genehm empfunden wird. Obgleich die Alterswohnforscherin Narten diese<br />
Zusammenhänge bereits 1991 nachwies, liegen die Balkone heutzutage fast<br />
ausschließlich als Ganze vor <strong>der</strong> Fassade, sind zumeist nach Süden ohne Sonnenschutz<br />
ausgerichtet und damit ungeeignet.<br />
Die Bewohner nutzen unseren Untersuchungen zufolge solche Balkone<br />
nicht, wodurch ihnen mit steigen<strong>der</strong> Bewegungsunfähigkeit die Möglichkeit<br />
zum Aufenthalt an <strong>der</strong> frischen Luft genommen wird.<br />
Abschließende Bemerkungen<br />
Die optimale Zweizimmerwohnung benötigt für zwei Personen eine Größe<br />
von 59 bis 63 Quadratmetern. Die in <strong>der</strong> Literatur veröffentlichten und von<br />
uns untersuchten Wohnungen in Seniorenwohnanlagen weisen keinen altengerechten<br />
Grundriss auf, <strong>der</strong> alle Bedürfnisse, insbeson<strong>der</strong>e bei steigen<strong>der</strong><br />
Gebrechlichkeit o<strong>der</strong> beginnen<strong>der</strong> Demenz, erfüllt. Ein funktionaler Grundriss<br />
für die Bedürfnisse einer immer älter werdenden Gesellschaft würde kaum<br />
mehr Quadratmeter Grundfläche benötigen und kaum mehr Kosten erzeugen.<br />
Bereits kleine Funktionsverän<strong>der</strong>ungen, neue Raumzuordnungen, Öffnungen<br />
von Wänden o<strong>der</strong> neue Nutzungselemente könnten zur erheblichen<br />
Verbesserung <strong>der</strong> Lebensqualität beitragen und Gesundheitskosten einsparen.<br />
Die vorgestellte idealtypische Grundrissvariante und Elemente (Abb. 87,<br />
90–94) würde die Befriedigung aller genannten Bedürfnisse beim Altwerden<br />
ermöglichen. Sie kann darüber hinaus körperlichen und geistigen Krankheiten<br />
vorbeugen und die Kommunikation för<strong>der</strong>n.<br />
Die gedanklichen Grundlagen des Planens für die Generation 80plus<br />
fehlt. Die Veröffentlichungen in den <strong>Architektur</strong>zeitschriften über das Bauen<br />
von Seniorenwohnanlagen o<strong>der</strong> betreute Wohnungen reflektieren über Bar-<br />
Bauten für Wohnen und Leben im Alter im<br />
Kontext demografischer Verän<strong>der</strong>ungen<br />
337
Bildnachweis<br />
360<br />
Bildnachweis<br />
Kin<strong>der</strong>tagesstätten<br />
und die Verhäuslichung<br />
<strong>der</strong> Kindheit<br />
1 Geist / Kürvers 1980, S. 104,<br />
Abb. B 32<br />
2 Geist / Kürvers 1980, S. 96,<br />
Abb. B 22<br />
3 Weber-Kellermann 1976,<br />
S. 192, Abb. 207, Foto: Staatsbibliothek<br />
Berlin, St-B 736<br />
4 Cuadra 1996, S. 18; Hemmer<br />
1967, S. 34<br />
5 Weber-Kellermann 1976,<br />
S. 45, Abb. 34<br />
6 Andritzky / Selle 1979, S. 300<br />
7 Aden-Grossmann 2011, S.<br />
30, verän<strong>der</strong>tes Bild; siehe auch<br />
Köhler 2006, S. 35 sowie https://<br />
kin<strong>der</strong>gartenmuseum.de/files/<br />
kin<strong>der</strong>garten<br />
museum/images/geschichte/<br />
Bad_Blankenburg_Kin<strong>der</strong>garten.<br />
jpeg (Aufruf am 27.02.2019)<br />
8 Hemmer 1967, S. 40<br />
9 Voigt et al. 2015, S. 120, Abb. 3<br />
10 Cuadra 1996, S. 20, Abb. 19<br />
11 Dezernat für Kultur und Freizeit<br />
/ Amt für Wissenschaft und<br />
Kunst <strong>der</strong> Stadt Frankfurt am Main<br />
1986, S. 139<br />
12 Dezernat für Kultur und Freizeit<br />
/ Amt für Wissenschaft und<br />
Kunst <strong>der</strong> Stadt Frankfurt am Main<br />
1986, S. 139<br />
13 Dezernat für Kultur und Freizeit<br />
/ Amt für Wissenschaft und<br />
Kunst <strong>der</strong> Stadt Frankfurt am Main<br />
1986, S. 139<br />
14 Dreysse 1987, S. 38<br />
15 Voigt et al. 2015, S. 121,<br />
Abb. 6<br />
16 Hoffmann 1931, S. 123<br />
17 Hoffmann 1931, S. 123<br />
18 Hierl 1992, S. 86<br />
19 Hierl 1992, S. 97<br />
20 Wild 1971, S. 25<br />
21 Wild 1971, S. 16<br />
22 Wild 1971, S. 26<br />
23 Behnisch Architekten<br />
24 Behnisch Architekten<br />
25 Behnisch Architekten<br />
26 Behnisch Architekten<br />
27 Behnisch Architekten<br />
28 Cuadra 1996, S. 37<br />
29 Cuadra 1996, S. 37<br />
30 Funk & Schrö<strong>der</strong><br />
31 Funk & Schrö<strong>der</strong><br />
32 Funk & Schrö<strong>der</strong><br />
33 Funk & Schrö<strong>der</strong><br />
34 Funk & Schrö<strong>der</strong><br />
35 Cuadra 1996, S. 37<br />
36 Funk & Schrö<strong>der</strong><br />
37 Bolles+Wilson<br />
38 Bolles+Wilson<br />
39 Fotografie: Waltraud Krase<br />
40 Bolles+Wilson<br />
41 Bolles+Wilson<br />
42 Bolles+Wilson<br />
43 Fotografie: Waltraud Krase<br />
44 Fotografie: Waltraud Krase<br />
45 Eigene Fotografie<br />
46 Eigene Fotografie<br />
47 Eigene Fotografie<br />
48 Cuadra 1996, S. 65, Abb. 97<br />
49 Cuadra 1996, S. 65, Abb. 96<br />
50 Eigene Fotografie<br />
51 Taschen 2006, S. 233<br />
52 Eigene Fotografie<br />
53 Taschen 2006, S. 243<br />
54 Knaack&Prell Architekten<br />
55 Knaack&Prell Architekten<br />
56 Knaack&Prell Architekten<br />
57 Eigene Fotografie<br />
58 Eigene Fotografie<br />
59 http://www.rki.de/DE/<br />
Content/Gesundheitsmonitoring/<br />
Gesundheitsberichterstattung/<br />
GBEDownloadsF/KiGGS_W1/<br />
kiggs1_fakten_koerp_aktivitaet.<br />
pdf?__blob=publicationFile (Aufruf<br />
am 14.03.2019)<br />
60 http://www.rki.de/DE/<br />
Content/Gesundheitsmonitoring/<br />
Gesundheitsberichterstattung/<br />
GBEDownloadsF/KiGGS_W1/<br />
kiggs1_fakten_koerp_aktivitaet.<br />
pdf?__blob=publicationFile<br />
(Aufruf am 14.03.2019)<br />
61 https://www.forst-sh.de/<br />
einblicke/ansprechpartner/?L=0<br />
(Aufruf am 01.04.2019)<br />
62 Eigene Fotografie<br />
63 Eigene Darstellung von Google<br />
Maps: https://www.google.<br />
com/maps/search/<br />
Waldkin<strong>der</strong>garten+Buxtehude/<br />
@53.451674,9.6756354,796m/<br />
data=!3m1!1e3 (Aufruf am<br />
30.05.2018)<br />
64 Fotografie: Sarah Schönherr<br />
65 Fotografie: Sarah Schönherr<br />
66 Fotografie: Sarah Schönherr<br />
67 Fotografie: Sarah Schönherr<br />
68 Fotografie: Sarah Schönherr<br />
69 Fotografie: Sarah Schönherr<br />
70 Fotografie: Sarah Schönherr<br />
71 Fotografie: Sarah Schönherr<br />
72 Deutsche Bauzeitung<br />
9/2009 S. 40<br />
73 Deutsche Bauzeitung<br />
9/2009 S. 41, Abb. 8<br />
74 Deutsche Bauzeitung<br />
9/2009, S. 39, Abb. 6<br />
75 Fotografie: Frie<strong>der</strong>ike<br />
Grünfeld<br />
76 Statistisches Bundesamt,<br />
https://www.destatis.de/DE/<br />
ZahlenFakten/GesellschaftStaat/<br />
Bevoelkerung/_Grafik/<br />
Zusammengefasste_Geburtenziffer.<br />
png?__blob=poster (Aufruf am<br />
14.03.2019)<br />
77 Statistisches Bundesamt,<br />
https://www.destatis.de/DE/<br />
ZahlenFakten/GesellschaftStaat/<br />
Bevoelkerung/Haushalte<br />
Familien/Tabellen/2_5_Familien.<br />
html (Aufruf am 14.03.2019)<br />
78 BMFSJ 2017, https://<br />
www.bmfsfj.de/blob/119524/<br />
f51728a14e3c91c3d8ea657bb01b<br />
bab0/familienreport-2017-data.<br />
pdf (Aufruf am 14.03.2019)<br />
79 Statistisches Bundesamt,<br />
https://www.destatis.de/DE/<br />
ZahlenFakten/GesellschaftStaat/<br />
Bevoelkerung/Haushalte<br />
Familien/Tabellen/2_5_Familien.<br />
html (Aufruf am 14.03.2019<br />
80 https://www.destatis.de/<br />
DE/ZahlenFakten/Gesellschaft<br />
Staat/Bevoelkerung/Haushalte<br />
Familien/Tabellen/2_5_Familien.<br />
html (Aufruf am 14.03.2019)<br />
81 Statistisches Bundesamt<br />
2018, S. 64, https://www.destatis.<br />
de/DE/Publikationen/<br />
Datenreport/Downloads/<br />
Datenreport2018.pdf?__blob=publicationFile<br />
(Aufruf am<br />
14.03.2019)<br />
82 plus+ bauplanung GmbH –<br />
Hübner – Forster – Remes – Hiller<br />
83 plus+ bauplanung GmbH –<br />
Hübner – Forster – Remes – Hiller<br />
84 plus+ bauplanung GmbH –<br />
Hübner – Forster – Remes – Hiller<br />
85 plus+ bauplanung GmbH –<br />
Hübner – Forster – Remes – Hiller<br />
86 plus+ bauplanung GmbH –<br />
Hübner – Forster – Remes – Hiller<br />
87 plus+ bauplanung GmbH –<br />
Hübner – Forster – Remes – Hiller<br />
88 plus+ bauplanung GmbH –<br />
Hübner – Forster – Remes – Hiller<br />
89 plus+ bauplanung GmbH –<br />
Hübner – Forster – Remes – Hiller<br />
90 https://www.baunetzwissen.<br />
de/mauerwerk/objekte/soziale-einrichtungen/umnutzung<strong>der</strong>-kirche-st-sebastian-inmuenster-zur-kita-3236637/<br />
gallery-1/4 (Aufruf am: 14.03.20.19)<br />
91 https://www.hydroflora.de/<br />
produkte/vertikalebegruenung/mooswaende/<br />
(Aufruf am: 14.03.2019)<br />
92 https://www.competitionline.com/de/projekte/57238<br />
(Aufruf am 14.03.2019)<br />
93 Corporate Communications<br />
bei Beiersdorf<br />
94 kadawittfeldarchitektur,<br />
Hamburg, 2014, https://www.<br />
competitionline.com/de/<br />
projekte/57238 (Aufruf am<br />
14.03.2019)<br />
95 kadawittfeldarchitektur,<br />
https://www.competitionline.<br />
com/de/projekte/57238 (Aufruf<br />
am 14.03.2019)<br />
96 http://www.gat.st/sites/<br />
default/files/Kin<strong>der</strong>tagesstättetroplo-kidsbeiersdorf<br />
lowresde.pdf (Aufruf am<br />
14.03.2019)<br />
97 https://www.competitionline.com/de/projekte/57238<br />
(Aufruf am 14.03.2019)<br />
98 Fotografie: Anna-Lena Albers<br />
99 Fotografie: Anna-Lena Albers<br />
100 kadawittfeldarchitektur,<br />
https://www.competitionline.<br />
com/de/projekte/57238 (Aufruf<br />
am 14.03.2019)<br />
101 Fotografie: Anna-Lena<br />
Albers<br />
102 Fotografie: Anna-Lena<br />
Albers<br />
103 Eigene Fotografie<br />
104 Eigene Fotografie<br />
105 Kraus Schönberg<br />
Architekten<br />
106 Fotografie: Jana Kowitzki<br />
107 Kraus Schönberg<br />
Architekten<br />
108 Fotografie: Jana Kowitzki<br />
109 Kraus Schönberg<br />
Architekten<br />
110 Kraus Schönberg<br />
Architekten<br />
111 Kraus Schönberg<br />
Architekten<br />
112 Fotografie: Jana Kowitzki<br />
113 Fotografie: Jana Kowitzki<br />
114 Fotografie: Jana Kowitzki<br />
115 Fotografie: Jana Kowitzki<br />
116 Fotografie: Jana Kowitzki<br />
117 Fotografie: Jana Kowitzki
Wohnungsbau<br />
im Wandel <strong>der</strong><br />
Familienstrukturen<br />
1 Montclos / Polidori 1996, S. 11;<br />
Fotografie: Robert Polidori<br />
2 Grassnick / Hofrichter 1982,<br />
Bildteil NZ 85, eigene Bearbeitung<br />
3 Peschken et al. 1991, S. 108<br />
4 Barta-Fliedl 2001, Farbtafel<br />
4, 23; Kunsthistorisches Museum<br />
Wien, Inv.-Nr. GG 8785<br />
5 Fröhlich 1974, S. 44, Abb. 59;<br />
Fotografie: Unbekannt<br />
6 Brönner 1994, Abb. 400,<br />
eigene Bearbeitung<br />
7 Asmus 1982, S. 168; Fotografie:<br />
Archiv für Kunst und Geschichte,<br />
Berlin<br />
8 Asmus 1982, S. 153; Fotografie:<br />
Archiv für Kunst und Geschichte,<br />
Berlin<br />
9 Asmus 1982, S. 122; Bildvorlage:<br />
Archiv für Kunst und<br />
Geschichte, Berlin<br />
10 Asmus 1982, S. 88; Bildvorlage:<br />
Archiv für Kunst und<br />
Geschichte, Berlin<br />
11 Schulze 1986, S. 171, Abb. 117;<br />
Fotografie: Mies van <strong>der</strong> Rohe-Archiv<br />
im Museum of Mo<strong>der</strong>n Art,<br />
New York<br />
12 Hammer-Tugendhat /<br />
Tegethoff 1998, S. 77, Abb. 79;<br />
Fotografie: de Sandalo, 1931, im<br />
Besitz <strong>der</strong> Familie<br />
13 Global Architecture 75, EDITA<br />
Tokyo co. Ltd., 1995, S. 46<br />
14 Hammer-Tugendhat / Tegethoff<br />
1998, S. 18, Abb. 27; Fotografie:<br />
Fritz Tugendhat, 1930–1938, im<br />
Besitz <strong>der</strong> Familie<br />
15 Global Architecture 75, EDITA<br />
Tokyo co. Ltd., 1995, S. 46, eigene<br />
Bearbeitung<br />
16 Hammer-Tugendhat /<br />
Tegethoff 1998, S. 17, Abb. 24;<br />
Fotografie: Fritz Tugendhat,<br />
1930–1938, im Besitz <strong>der</strong><br />
Familie<br />
17 Global Architecture 75, EDITA<br />
Tokyo co. Ltd., 1995, S. 46, eigene<br />
Markierung<br />
18 Hammer-Tugendhat / Tegethoff<br />
1998, S. 58, Abb. 62; Foto:<br />
Fritz Tugendhat, 1930–1938, im<br />
Besitz <strong>der</strong> Familie<br />
19 Hammer-Tugendhat / Tegethoff<br />
1998, S. 58, 27; Fotografie:<br />
Fritz Tugendhat, 1930–1938, im<br />
Besitz <strong>der</strong> Familie<br />
20 Global Architecture 57, EDITA<br />
Tokyo co. Ltd., 1995, S. 46, eigene<br />
Bearbeitung<br />
21 Global Architecture 75, EDITA<br />
Tokyo co. Ltd., S. 46, eigene<br />
Bearbeitung<br />
22 Global Architecture 75, EDITA<br />
Tokyo co. Ltd., 1995, S. 47, eigene<br />
Bearbeitung<br />
23 Müller-Wulckow 1929, S. 78;<br />
Fotografie: Unbekannt<br />
24 Müller-Wulckow 1929, S. 121<br />
25 Asmus 1982, S. 145; Bildvorlage:<br />
Archiv für Kunst und<br />
Geschichte, Berlin<br />
26 Ungers 1983, S. 70<br />
27 Kähler 1996, S. 278; Fotografie:<br />
Peter Noever (Hg.): Die Frankfurter<br />
Küche von Grete Schütte<br />
Lihotzky, Berlin 1992<br />
28 Harlan<strong>der</strong> / Fehl 1986, S. 45;<br />
Fotografie: Unbekannt<br />
29 Harlan<strong>der</strong> / Fehl 1986, S. 206<br />
30 Neufert 1936, S. 97, Abb. 7, 8;<br />
S. 99, Abb. 2, 3, 4<br />
31 Neufert 1936, S. 182, Abb. 7;<br />
S. 269, Abb. 1, 2<br />
32 Neufert 1936, S. 161, Abb.<br />
1; S. 168, Abb. 10, 11, 12; S. 178,<br />
Abb. 1, 2<br />
33 Neufert 1936, S. 120, Abb.<br />
11, 12<br />
34 Neufert 1936, S. 161, Abb. 1; S.<br />
160, Abb. 7, 8; S. 215, Abb. 1<br />
35 Pook 1961, S. 75, Abb. 57; Fotografie:<br />
Aenne Heise, Isernhagen<br />
36 Universität Hannover<br />
Diasammlung Lehrstuhl für Wohnungsbau<br />
37 Hafner / Wohn / Rebholz-<br />
Cheves 1998, S. 65, eigene<br />
Bearbeitung<br />
38 Landesarchiv Berlin, Foto<br />
195, 656; Fotografie: Karl Heinz<br />
Schubert<br />
39 Hafner / Wohn / Rebholz-<br />
Chaves 1998, S. 65; Fotografie:<br />
Behörde für Stadtentwicklung<br />
und Wohnen <strong>der</strong> Freien und<br />
Hansestadt Hamburg<br />
40 Ingrid + Peter Hense<br />
41 Ingrid + Peter Hense, eigene<br />
Bearbeitung<br />
42 Ingrid + Peter Hense, eigene<br />
Bearbeitung<br />
43 https://de.statista.com/<br />
statistik/daten/studie/249318/<br />
umfrage/frauenanteile-anhochschulen-in-deutschland/<br />
(Aufruf am 12.02.2019)<br />
44 Fotos aus dem Bestand von<br />
Rob Krier<br />
45 Landesarchiv Berlin, IBA-<br />
Archiv; Fotografie: Reinhard<br />
Görner<br />
46 Eigene Fotografie<br />
47 Eigene Fotografie<br />
48 Bauwelt 11/1983, Heft 42,<br />
S. 1685<br />
49 Bauwelt 11/1983, Heft 42,<br />
S. 1688<br />
50 https://www.destatis.de/<br />
DE/Publikationen/<br />
Datenreport/Downloads/<br />
Datenreport1999.pdf?__blob=<br />
publicationFile (Aufruf am<br />
08.01.2019); https://www.<br />
destatis.de/DE/ZahlenFakten/<br />
Indikatoren/LangeReihen/<br />
Bevoelkerung/lrbev05.html<br />
(Aufruf am 08.01.2019)<br />
51 https://www.destatis.de/<br />
DE/ZahlenFakten/Gesellschaft<br />
Staat/Bevoelkerung/Haushalte<br />
Familien/Tabellen/2_5 Familien.<br />
html, eigene Berechnung (Aufruf<br />
am 08.01.2019)<br />
52 https://www.destatis.de/<br />
DE/ZahlenFakten/Gesellschaft<br />
Staat/Bevoelkerung/Haushalte<br />
Familien/Tabellen/2_5_Familien.<br />
html, eigene Darstellung (Aufruf<br />
am 08.01.2019)<br />
53 https://www-genesis.<br />
destatis.de/genesis/online/<br />
data;sid=D15B108F0B982<br />
56079CE2A6DB129A719.<br />
GO_2_2?levelindex=2&levelid=<br />
1515154695330&downloadname=<br />
12612-0009&operation=<br />
ergebnistabelleDiagramm&<br />
option=diagramm www-genesis.<br />
destatis.de, Tabellencode 12612<br />
(Aufruf am 08.01.2019)<br />
54 https://www.destatis.de/<br />
DE/ZahlenFakten/Gesellschaft<br />
Staat/Bevoelkerung/Haushalte<br />
Familien/Tabellen/2_8_LR_<br />
Familien.html (Aufruf am<br />
22.01.2019)<br />
55 Statistisches Bundesamt,<br />
Datenreport 2018, S. 55<br />
56 Statistisches Bundesamt<br />
2017, Ergebnisse des Mikrozensus,<br />
https://www.destatis.de/DE/<br />
ZahlenFakten/GesellschaftStaat/<br />
Bevoelkerung/Haushalte<br />
Familien/Tabellen/2_5_Familien.<br />
html (Aufruf am 21.01.2019)<br />
57 Sinus Institut<br />
58 Deutsche Bauzeitung<br />
4/2009, S. 42<br />
59 Huke-Schubert Berge Architekten<br />
60 Landeshauptstadt Hannover<br />
2000, S. 8; Fotografie: Karl<br />
Johaentges<br />
61 Landeshauptstadt Hannover.<br />
Expo 2000, Hannover-Kronsberg,<br />
Mensch Natur Technik, S. 114;<br />
Fotografie: Karl Johaentges<br />
62 Landeshauptstadt Hannover.<br />
Expo 2000, Hannover-Kronsberg,<br />
Mensch Natur Technik, S. 119;<br />
Fotografie: Karl Johaentges<br />
63 Wohnungsunternehmen<br />
Gundlach, Hannover<br />
64 Fotografie: Karl Johaentges<br />
65 Hafencity Hamburg GmbH<br />
66 Meyhöfer / Schwarz 2005, S.<br />
12; Fotografie: Unbekannt<br />
67 Meyhöfer / Schwarz 2005, S.<br />
12; Fotografie: Unbekannt<br />
68 Feuerstein / Leeb 2015, S.<br />
120; Fotografie: Unbekannt<br />
69 Meyhöfer / Schwarz 2005<br />
Gesamtanlage Grundriss, S. 21;<br />
Grundriss Wohnung<br />
70 Böge Lindner K2 Architekten<br />
71 Fotografie: Ralf Buscher<br />
72 Fotografie: Ralf Buscher<br />
73 Böge Lindner K2 Architekten<br />
74 Böge Lindner K2 Architekten<br />
75 Böge Lindner K2 Architekten<br />
76 https://www.ibahamburg.de/projekte/<br />
klimaschutzkonzepterneuerbares-wilhelmsburg/<br />
projekt/klimaschutzkonzepterneuerbares-wilhelmsburg.<br />
html (Aufruf am 05.01.2019)<br />
77 hauschild + siegel<br />
architecture<br />
78 hauschild + siegel<br />
architecture<br />
79 hauschild + siegel<br />
architecture<br />
80 hauschild + siegel<br />
architecture<br />
81 hauschild + siegel<br />
architecture<br />
82 hauschild + siegel<br />
architecture<br />
83 hauschild + siegel<br />
architecture<br />
84 hauschild + siegel<br />
architecture<br />
85 hauschild + siegel<br />
architecture<br />
86 hauschild + siegel<br />
architecture<br />
87 hauschild + siegel<br />
architecture<br />
88 Statistisches Bundesamt<br />
2016c<br />
89 Statistisches Bundesamt<br />
2016d, S. 62<br />
90 czerner göttsch architekten<br />
91 czerner göttsch architekten<br />
92 czerner göttsch architekten<br />
93 czerner göttsch architekten<br />
94 https://www.xn--psten<br />
hof-n4a.de/<strong>der</strong>-poestenhof.html<br />
(Aufruf am 29.03.2019); Fotografie:<br />
Unbekannt<br />
95 https://www.dbz.de/artikel/<br />
dbz_Unter_einem_Dach_Mehrgenerationen-wohnen_<br />
Poestenhof_Lemgo_1721649.html<br />
(Aufruf am 29.03.2019);<br />
Fotografie: Christian Eblenkamp<br />
96 http://<strong>der</strong>architektbda.<br />
de/wp-contentuploads/2015/09/<br />
hsd-architekten_Poestenhof_01_<br />
Foto-Christian-Eblenkamp.jpg<br />
(Aufruf am 29.03.2019);<br />
Fotografie: Christian Eblenkamp<br />
97 Deutsche Bauzeitschrift<br />
05/2013, S. 45; Fotografie:<br />
Unbekannt<br />
98 Deutsche Bauzeitschrift<br />
05/2013, S. 40<br />
99 http://www.muellersigrist.ch/arbeiten/bauten/<br />
wohn-und-gewerbesiedlungkalkbreite-zuerich/<br />
(Aufruf am 29.03.2019;<br />
Fotografie: Unbekannt<br />
100 Bauwelt 39/2014, S. 26/27;<br />
Fotografie: Volker Schopp<br />
101 Detail 09/2015, S. 873<br />
102 Bauwelt 39/2014, S. 28/29<br />
103 Bauwelt 39/2014, S. 31<br />
104 Landeshauptstadt<br />
München / Referat für Stadtplanung<br />
und Bauordnungen<br />
2013b, S. 45<br />
105 bogevischs buero<br />
architekten & stadtplaner gmbH<br />
106 bogevischs buero<br />
architekten & stadtplaner gmbH<br />
107 Fotografie: Julia Knop<br />
108 Fotografie: Julia Knop<br />
109 Fotografie: Julia Knop<br />
Anhang<br />
Bildnachweis<br />
361
Dank<br />
Ich bedanke mich bei meinen wissenschaftlichen Mitarbeitern Atilla Cinar (2009–2014)<br />
und Florian Siegert (2010–2015), die an dieser Publikation mitgewirkt haben, für Ihre weitreichenden<br />
Recherchen, Ihre Anregungen und die gemeinsamen inhaltlichen Diskussionen.<br />
Impressum<br />
© 2020 by jovis Verlag GmbH<br />
Das Copyright für die Texte liegt bei <strong>der</strong> Autorin.<br />
Das Copyright für die Abbildungen liegt bei den Fotografen/Inhabern <strong>der</strong> Bildrechte.<br />
Alle Rechte vorbehalten.<br />
Umschlagmotive: Entdeckerhaus, plus+ bauplanung GmbH – Hübner – Forster – Remes – Hiller,<br />
Bremen, 2006, Ausschnitt Lageplan mit Grundriss<br />
Wohnanlage wagnisART, Domagkpark, bogevischs buero architekten & stadtplaner gmbH /<br />
Schindler Hable Architekten GbR / Aub.ck + Karasz Landscape Architects / bauchplan GbR,<br />
München, 2016, Ausschnitt Grundriss<br />
Kompetenzzentrum für Menschen mit Demenz, Fed<strong>der</strong>sen Architekten, Nürnberg, 2006,<br />
Ausschnitt Grundriss<br />
Lektorat: Nina Kathalin Bergeest, jovis<br />
Lithografie: Bild1Druck, Berlin<br />
Gedruckt in <strong>der</strong> Europäischen Union<br />
Bibliografische Information <strong>der</strong> Deutschen Nationalbibliothek<br />
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in <strong>der</strong> Deutschen Nationalbibliografie;<br />
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.<br />
jovis Verlag GmbH<br />
Kurfürstenstraße 15/16<br />
10785 Berlin<br />
www.jovis.de<br />
jovis-Bücher sind weltweit im ausgewählten Buchhandel erhältlich. Informationen zu unserem<br />
internationalen Vertrieb erhalten Sie von Ihrem Buchhändler o<strong>der</strong> unter www.jovis.de.<br />
ISBN 978-3-86859-585-7