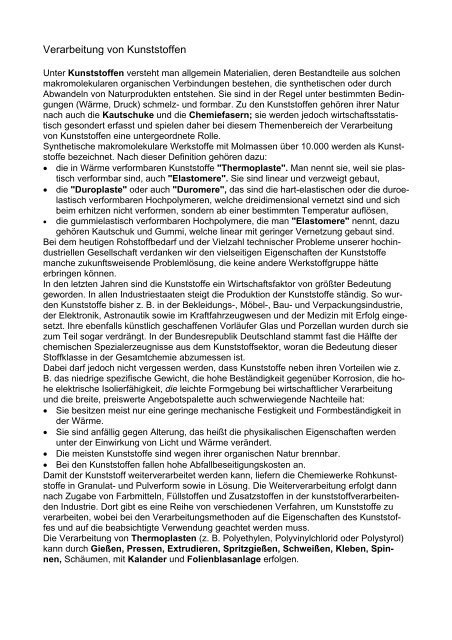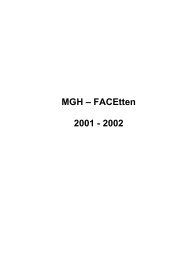Verarbeitung von Kunststoffen.pdf
Verarbeitung von Kunststoffen.pdf
Verarbeitung von Kunststoffen.pdf
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Verarbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kunststoffen</strong><br />
Unter <strong>Kunststoffen</strong> versteht man allgemein Materialien, deren Bestandteile aus solchen<br />
makromolekularen organischen Verbindungen bestehen, die synthetischen oder durch<br />
Abwandeln <strong>von</strong> Naturprodukten entstehen. Sie sind in der Regel unter bestimmten Bedingungen<br />
(Wärme, Druck) schmelz- und formbar. Zu den <strong>Kunststoffen</strong> gehören ihrer Natur<br />
nach auch die Kautschuke und die Chemiefasern; sie werden jedoch wirtschaftsstatistisch<br />
gesondert erfasst und spielen daher bei diesem Themenbereich der <strong>Verarbeitung</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Kunststoffen</strong> eine untergeordnete Rolle.<br />
Synthetische makromolekulare Werkstoffe mit Molmassen über 10.000 werden als Kunststoffe<br />
bezeichnet. Nach dieser Definition gehören dazu:<br />
• die in Wärme verformbaren Kunststoffe "Thermoplaste". Man nennt sie, weil sie plastisch<br />
verformbar sind, auch "Elastomere". Sie sind linear und verzweigt gebaut,<br />
• die "Duroplaste" oder auch "Duromere", das sind die hart-elastischen oder die duroelastisch<br />
verformbaren Hochpolymeren, welche dreidimensional vernetzt sind und sich<br />
beim erhitzen nicht verformen, sondern ab einer bestimmten Temperatur auflösen,<br />
• die gummielastisch verformbaren Hochpolymere, die man "Elastomere" nennt, dazu<br />
gehören Kautschuk und Gummi, welche linear mit geringer Vernetzung gebaut sind.<br />
Bei dem heutigen Rohstoffbedarf und der Vielzahl technischer Probleme unserer hochindustriellen<br />
Gesellschaft verdanken wir den vielseitigen Eigenschaften der Kunststoffe<br />
manche zukunftsweisende Problemlösung, die keine andere Werkstoffgruppe hätte<br />
erbringen können.<br />
In den letzten Jahren sind die Kunststoffe ein Wirtschaftsfaktor <strong>von</strong> größter Bedeutung<br />
geworden. In allen Industriestaaten steigt die Produktion der Kunststoffe ständig. So wurden<br />
Kunststoffe bisher z. B. in der Bekleidungs-, Möbel-, Bau- und Verpackungsindustrie,<br />
der Elektronik, Astronautik sowie im Kraftfahrzeugwesen und der Medizin mit Erfolg eingesetzt.<br />
Ihre ebenfalls künstlich geschaffenen Vorläufer Glas und Porzellan wurden durch sie<br />
zum Teil sogar verdrängt. In der Bundesrepublik Deutschland stammt fast die Hälfte der<br />
chemischen Spezialerzeugnisse aus dem Kunststoffsektor, woran die Bedeutung dieser<br />
Stoffklasse in der Gesamtchemie abzumessen ist.<br />
Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass Kunststoffe neben ihren Vorteilen wie z.<br />
B. das niedrige spezifische Gewicht, die hohe Beständigkeit gegenüber Korrosion, die hohe<br />
elektrische Isolierfähigkeit, die leichte Formgebung bei wirtschaftlicher <strong>Verarbeitung</strong><br />
und die breite, preiswerte Angebotspalette auch schwerwiegende Nachteile hat:<br />
• Sie besitzen meist nur eine geringe mechanische Festigkeit und Formbeständigkeit in<br />
der Wärme.<br />
• Sie sind anfällig gegen Alterung, das heißt die physikalischen Eigenschaften werden<br />
unter der Einwirkung <strong>von</strong> Licht und Wärme verändert.<br />
• Die meisten Kunststoffe sind wegen ihrer organischen Natur brennbar.<br />
• Bei den <strong>Kunststoffen</strong> fallen hohe Abfallbeseitigungskosten an.<br />
Damit der Kunststoff weiterverarbeitet werden kann, liefern die Chemiewerke Rohkunststoffe<br />
in Granulat- und Pulverform sowie in Lösung. Die Weiterverarbeitung erfolgt dann<br />
nach Zugabe <strong>von</strong> Farbmitteln, Füllstoffen und Zusatzstoffen in der kunststoffverarbeitenden<br />
Industrie. Dort gibt es eine Reihe <strong>von</strong> verschiedenen Verfahren, um Kunststoffe zu<br />
verarbeiten, wobei bei den <strong>Verarbeitung</strong>smethoden auf die Eigenschaften des Kunststoffes<br />
und auf die beabsichtigte Verwendung geachtet werden muss.<br />
Die <strong>Verarbeitung</strong> <strong>von</strong> Thermoplasten (z. B. Polyethylen, Polyvinylchlorid oder Polystyrol)<br />
kann durch Gießen, Pressen, Extrudieren, Spritzgießen, Schweißen, Kleben, Spinnen,<br />
Schäumen, mit Kalander und Folienblasanlage erfolgen.
Duroplaste hingegen entstehen durch das Pressen <strong>von</strong> Polymeren in eine Form unter Zugabe<br />
eines Härters.<br />
Die Elastomere wie z. B. Gummi haben ihren Ursprung in verschiedenen Monomeren, die<br />
durch die künstliche Kautschuksynthese oder die natürliche Biosynthese zu Kautschuk<br />
werden, woraufhin Kautschuk dann durch den Vorgang der Vulkanisation zu Gummi verarbeitet<br />
wird.<br />
Ein anderer <strong>Verarbeitung</strong>sbereich ist die Kunststoffbeschichtung bzw. -metallisierung, wobei<br />
bei der Beschichtung das Metallstück mit einer dünnen Kunststoffschicht überzogen<br />
wird und umgekehrt bei der Metallisierung.<br />
Die einzelnen Verfahren lassen sich nun wie folgt darstellen:<br />
a) Spritzgießen (Gießen und Pressen)<br />
Beim Gießen werden die Hochpolymere meist Thermoplaste bis über den Erweichungspunkt<br />
erhitzt, so dass eine fließfähige Kunststoffmasse entsteht. Diese wird in eine vorgegebene<br />
Form mit Hilfe einer Schnecke gegossen, die die Kunststoffmasse vollständig ausfüllen<br />
muss. Beim Erkalten erstarrt die Kunststoffmasse zu festen Körpern, die dann entformt<br />
werden können. Da in vielen Fällen die Kunststoffe jedoch nicht so dünnflüssig werden,<br />
dass sie beim Gießen die Formen richtig ausfüllen, verwendet man den Spritzguss,<br />
bei dem die Masse in einem Düsenrohr erweicht und dann in die Formen gespritzt wird.<br />
Beispiele für Spritzgussfertigteile sind Bierkästen, Waschkörbe, Becher, Eimer sowie Mülltonnen.<br />
Aber auch komplizierte Fertigteile lassen sich durch das Spritzgussverfahren einfach<br />
und preiswert herstellen.<br />
b) Extrudieren (Stangpressen)<br />
Der Vorgang des Extrudierens ist dem Mechanismus des Spritzgießens sehr ähnlich.<br />
Auch hier wird das Material <strong>von</strong> einer Schnecke transportiert, jedoch kann sich die Schnecke<br />
nicht schubweise vor- und zurückbewegen. Dadurch kann der Kunststoff nicht schubweise<br />
in eine Form gepresst werden, sondern der Vorgang des Extrudierens eignet sich<br />
ausschließlich für den kontinuierlichen Gebrauch z. B. zum extrudieren <strong>von</strong> Rohren. Bei<br />
der Herstellung <strong>von</strong> Kunststoffrohren wird der Kunststoff in seinem Rohzustand in dem<br />
Extruder (Schneckenpresse) erwärmt und plastifiziert. Am Kopf des Extruders tritt der<br />
Kunststoff als zähe Schmelze aus und erhält dabei seine endgültige Form, wobei in das<br />
noch weiche Rohr <strong>von</strong> innen ständig Luft geblasen wird, damit es nicht mehr zusammenfällt.<br />
c) Folienblasen<br />
Die Entstehung einer Folie (Polyethylen) in einer Folienblasanlage ist nur eine Weiterentwicklung<br />
des Vorgangs beim Extrudieren. Die beim Extrudieren entstandenen Schläuche<br />
werden mit Luft aufgebläht, so dass Folien entstehen. Diese werden dann aufgerollt oder<br />
aufgefaltet woraufhin sie auf die jeweilige richtige Größe zugeschnitten werden.<br />
d) Kalandrieren<br />
Eine Kalandrier-Einrichtung dient der Herstellung <strong>von</strong> Kunststofftafeln. Der erweichte<br />
Thermoplast wird direkt aus dem Extruder durch eine größere Zahl <strong>von</strong> Quetschwalzen im<br />
Kalander glattgewalzt. Ein wichtiges Verfahren ist in diesem Zusammenhang das Tiefziehen.<br />
Dabei wird eine erweichte kalandrierte oder extrudierte Platte durch Über- oder Unterdruck<br />
an eine Matrize gepresst. Auf diesem Wege entstehen z. B. Kühlschrankeinsätze.
e) Schweißen und Kleben<br />
Unter Kunststoff schweißen versteht man die Vereinigung <strong>von</strong> thermoplastischen, das<br />
heißt nicht härtbaren <strong>Kunststoffen</strong> gleicher oder verschiedener Art unter Anwendung <strong>von</strong><br />
Wärme und Druck sowie mit oder ohne Zusetzen <strong>von</strong> artgleichem Kunststoff. Das<br />
Schweißen z. B. <strong>von</strong> PVC-Folien geschieht sehr häufig mit einem Heißluftstrahl. Die Berührungsflächen<br />
der Kunststoffe werden dabei flüssig und fließen ineinander. Oft müssen<br />
jedoch die Flächen verklebt werden. Dazu hat man eine Vielzahl <strong>von</strong> Klebern entwickelt.<br />
Es sind hochviskose Substanzen, die oft erst durch Einwirken <strong>von</strong> Wanne in höhermolekulare<br />
Produkte übergehen und dadurch fest werden. Man unterscheidet:<br />
• Haftkleber: Ihre Klebewirkung beruht auf hoher Adhäsion<br />
(Haftung auf der Grenzoberfläche durch molekulare Wechselwirkung) und geringer Kohäsion<br />
(innerer Zusammenhalt der Klebstoffmoleküle). Sie ergeben schmiegsame, weiche<br />
Verklebungen.<br />
• Festkleber: Sie besitzen hohe Adhäsions- und Kohäsionskräfte.<br />
Festkleber sind geeignet für feste und starre Verklebungen.<br />
f) Spinnen und Schäumen (Textilfasern)<br />
Wenn gelöster Kunststoff zur Herstellung <strong>von</strong> Faserstoffen durch eine Düse in ein Fällbad<br />
gedrückt wird, wo er zu einem Faden ausgezogen werden kann, spricht man <strong>von</strong> Spinnen.<br />
Das Verfahren ist auch als Schmelzspinnverfahren bekannt. Dabei wird das geschmolzene<br />
Rohprodukt durch Spinndüsen gepresst woraufhin die dabei gebildete Faser<br />
erkaltet und aufgewickelt werden kann. Hierbei unterscheidet man einmal das Trockenspinnen,<br />
bei dem das Lösungsmittel nach dem Austreten aus der Spinndüse verdampft,<br />
während beim Nassspinnen die Faser erst in einem Fällbad ausgefällt wird.<br />
Schaumstoffe können praktisch aus jedem Kunststoff hergestellt werden; dazu gibt es<br />
vier Möglichkeiten:<br />
• Chemische Treibverfahren<br />
Durch Zusatz <strong>von</strong> Treibmitteln erreicht man bei einer chemischen Reaktion Gasentwicklung,<br />
welche zur Bildung des Schaumstoffes ausreicht.<br />
• Physikalische Treibverfahren<br />
In einer sich verfestigenden Masse wird z. B. Gas, das sich unter hohem Druck in der Mischung<br />
gelöst hat, zur Expansion gebracht. Dadurch entstehen viele Gasblasen im Inneren<br />
des Endproduktes.<br />
• Mischverfahren<br />
Dabei werden Schäumungsmittel zugesetzt und der entstehende Schaum verfestigt.<br />
• Lösungsmethode<br />
Hierbei erreicht man Hohlräume durch Herauslösen verschiedener Salze (z. B. Viskoseschwämmen)<br />
aus dem Endprodukt.<br />
g) Beschichtung<br />
Bei der Kunststoffbeschichtung sind vier verschiedene Verfahren gebräuchlich:<br />
• Kunststoff-Flammspritzen<br />
• Wirbelsinterverfahren<br />
• Elektrostatische Pulverspritzen<br />
• Tauchverfahren<br />
Beim Kunststoff-Flammspritzen wird ein thermoplastischer Kunststoff in Schichten <strong>von</strong><br />
0,8-1,0 mm Dicke festhaftend auf Metall, Glas und dgl. aufgespritzt.<br />
Beim Wirbelsinterverfahren wird das erwärmte Werkstück in die Wirbelschicht des<br />
Kunststoffpulvers getaucht.
Beim Elektrostatischen Pulverspritzen der elektrostatische aufgebrachte Kunststoff im<br />
Ofen auf das Werkstück aufgeschmolzen. Beim Tauchverfahren wird das Werkstück in<br />
Plastisole oder Kunststofflösung bzw. -dispersionen eingetaucht.<br />
Umgekehrt verhält es sich bei der Kunststoffmetallisierung. Man gibt ein Werkstück aus<br />
Kunststoff vor und überzieht dieses mit einer dünnen Metallschicht.<br />
Dabei können Metalldämpfe im Vakuum auf den Kunststoff aufgedampft werden, sowie<br />
bei der Spritztechnik Spritzpistolen, in denen ein Gemisch <strong>von</strong> Silbersalzlösung und<br />
Reduktionsmitteln ist verwendet werden, um auf den Kunststoffgegenstand einen glänzenden<br />
Silberspiegel zu erzeugen.<br />
h) Hilfsstoffe für die <strong>Verarbeitung</strong><br />
Um die verschiedenen Eigenschaften für die beabsichtigte Verwendung des Kunststoffes<br />
zu erreichen, werden diverse Zusätze hinzu gegeben, denn viele Kunststoffe werden erst<br />
durch Zusatz verschiedener Hilfsstoffe technisch verwendbar.<br />
Zu diesen Hilfsstoffen gehören die Stabilisatoren, Weichmacher und Füllstoffe.<br />
Stabilisatoren spielen eine wichtige Rolle zur Schaffung technisch verwendbarer Kunststoffe.<br />
Stabilisatoren sind Alterungsschutzmittel, die strukturelle Veränderungen der Makromoleküle<br />
infolge <strong>von</strong> Umwelteinflüssen (Licht, Wärme, UV-Strahlung und Wasser) oder<br />
durch Überbeanspruchung im praktischen Gebrauch verhindern.<br />
Manche Kunststoffe sind für die gewünschten Verwendungszwecke zu spröde und zu hart.<br />
Durch Zusätze <strong>von</strong> Weichmachern lässt sich ihre Härte jedoch gut variieren. Weichmacher<br />
setzen speziell die Einfrier- bzw. die Erweichungstemperatur hochpolymerer Kunststoffe<br />
herab. Weichmacher sollen möglichst die gleiche thermische und chemische Beständigkeit<br />
wie die Kunststoffe besitzen, für die sie verwendet werden. In der Praxis werden<br />
sehr häufig Ester (z. B. Phosphorsäureester oder Phthalester) mit hohem Siedepunkt<br />
als Weichmacher verwendet.<br />
Füllstoffe sind Zusätze in fester Form, die sich in ihrer Struktur und ihren Eigenschaften<br />
wesentlich <strong>von</strong> den <strong>Kunststoffen</strong> unterscheiden. Sie dienen vor allem der Erhöhung der<br />
Zugfestigkeit. Daneben wendet man sie auch an, um eine Gewichts- oder Volumenerhöhung<br />
zu erzielen. Anorganische Füllstoffe sind z. B. Gesteinsmehl, Kaolin, feinfaseriger<br />
Asbest, Kreide, Kieselgur und Glasfasern. Asbest z. B. dient der Chemikalienbeständigkeit,<br />
Formbeständigkeit in der Wärme, die elektrische Isoliereigenschaften, Schlagzähigkeit,<br />
Maßbeständigkeit, Steifheit und Härte. Glasfasern zeigen die gleichen verbesserten<br />
Eigenschaften und weist zusätzlich noch die Eigenschaft der Zugfestigkeit auf. Organische<br />
Füllstoffe sind z. B. Holzmehl, Cellulose, Papier- und Textilfasern. Holzmehl verbessert<br />
die elektrische Isoliereigenschaften, Zugfestigkeit und Maßbeständigkeit. Cellulose<br />
weist eine verbesserte Schlagzähigkeit, Zugfestigkeit und Steifheit auf.