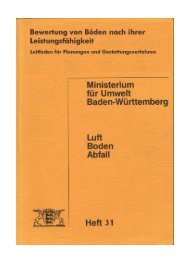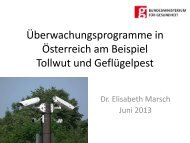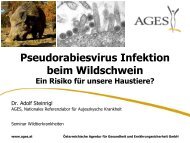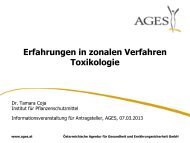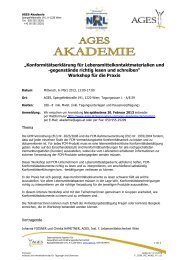KONTROLLIERTE FUTTERMITTEL GESUNDE TIERE ... - AGES
KONTROLLIERTE FUTTERMITTEL GESUNDE TIERE ... - AGES
KONTROLLIERTE FUTTERMITTEL GESUNDE TIERE ... - AGES
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kontrollierte futtermittel<br />
gesunde tiere<br />
sichere lebensmittel ‒ 2009<br />
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft<br />
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
vor
Futtermittel stehen am Anfang der Nahrungsmittelkette<br />
und nehmen daher eine zentrale Rolle bei der<br />
Erzeugung von Lebensmitteln tierischer Herkunft ein.<br />
Einwandfreie Futtermittel sind nicht nur Voraussetzung<br />
für einen gesunden und leistungsfähigen Tierbestand,<br />
sondern auch Voraussetzung für sichere und qualitativ<br />
hochwertige Lebensmittel tierischen Ursprungs unter<br />
Einhaltung ökologischer und ökonomischer Rahmenbedingungen.<br />
Das in der <strong>AGES</strong>, der Österreichischen<br />
Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit<br />
GmbH, installierte Bundesamt für Ernährungssicherheit<br />
(BAES) vollzieht im Rahmen der Betriebsmittelgesetze<br />
als Behörde erster Instanz wichtige Kontrollund<br />
Untersuchungsaufgaben.<br />
Die <strong>AGES</strong> und das Bundesamt für Ernährungssicherheit<br />
nehmen im Auftrag der Republik Österreich<br />
vielfältige Aufgaben auf dem Gebiet der Ernährungssicherheit<br />
und Ernährungssicherung wahr. Durch die<br />
Gründung der <strong>AGES</strong> wurden in Österreich – erstmalig<br />
in Europa – die Bundeskompetenzen in verschiedensten<br />
Fachbereichen entlang der gesamten Nahrungsmittelkette<br />
in einem einzigen Unternehmen<br />
zusammengefasst. Zweck dieser zentralen Institution<br />
ist es, durch Überwachung und Untersuchung den<br />
Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und<br />
Pflanzen sowie Sicherheit und Qualität der Ernährung<br />
Niki Berlakovich<br />
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft,<br />
Umwelt und Wasserwirtschaft<br />
zu gewährleisten. Durch Vorsorgeprinzip, Risikobewertung<br />
und Risikomanagement wird die Gesundheit von<br />
Mensch, Tier und Pflanze von Beginn der Lebensmittelkette<br />
an berücksichtigt.<br />
Die Aufgabe des Bereichs Landwirtschaft in der<br />
<strong>AGES</strong> ist es, die Versorgung mit sicheren, hochwertigen<br />
und gesunden Lebens- und Futtermitteln in<br />
ausreichender Menge unter Berücksichtigung ökologischer<br />
und ökonomischer Rahmenbedingungen zu<br />
sichern und gleichzeitig eine nachhaltige Ernährungsund<br />
Rohstoffsicherung in Österreich zu garantieren.<br />
Der Bereich Landwirtschaft ist mit seinen etwa 300<br />
Expertinnen und Experten Dienstleister und Netzwerkpartner<br />
zur Umsetzung landwirtschaftlicher Materiengesetze<br />
(wie z. B. des Futtermittelgesetzes) sowie<br />
einschlägiger internationaler Normen.<br />
Die vorliegende Futtermittelbroschüre, heuer in<br />
Form einer pdf-Datei auf der <strong>AGES</strong>-Website, soll einer<br />
interessierten Öffentlichkeit einige Zahlen, Daten und<br />
Fakten über die amtliche Futtermittelüberwachung aus<br />
den vergangenen Jahren – im Speziellen aus dem Jahr<br />
2008 – in Österreich liefern. Als Landwirtschaftsminister<br />
möchte ich mich bei allen bedanken, die in der<br />
<strong>AGES</strong> zur Futtermittelsicherheit – als Grundlage für<br />
die Produktion sicherer Lebensmittel – und damit zur<br />
Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt beitragen.<br />
wort<br />
1
2<br />
inhalt<br />
Vorwort 1<br />
Inhalt 2<br />
Einleitung 3<br />
Der mehrjährige integrierte Kontrollplan (MIK) ‒ Amtliche Kontrolle<br />
der Herstellung und Inverkehrbringung von Futtermitteln in Österreich 4<br />
Mehrjähriger integrierter Kontrollplan 4<br />
Amtliche Futtermittelkontrolle in Österreich 10<br />
Das Europäische Schnellwarnsystem (RASFF) 12<br />
Erwünschte Komponenten – Inhaltsstoffe und Zusatzstoffe 14<br />
Unerwünschte und verbotene Stoffe 20<br />
Schwermetalle 22<br />
Mykotoxine 24<br />
Pflanzenschutzmittelrückstände 27<br />
Salmonellen 29<br />
Gentechnisch veränderte Organismen (GVO) 32<br />
Tierarzneimittel und Hormone 35<br />
Tierische Bestandteile 37<br />
Dioxine und PCB 39<br />
Ansprechpartner für Futtermittelanalysen und Nationale Referenzlaboratorien 41<br />
Zusammenfassung 42<br />
Gesetzliche Grundlagen 44<br />
Autoren 45<br />
Redaktion 45<br />
Bildnachweise 45
einleitung<br />
Die Landwirtschaft bildet die Grundlage für unsere<br />
Lebens- und Futtermittel. Die Futtermittel stehen am<br />
Anfang der Nahrungsmittelkette und haben daher<br />
einen großen Einfluss auf die Lebensmittelsicherheit.<br />
Sie decken einerseits den Ernährungsbedarf unserer<br />
landwirtschaftlichen Nutztiere (Rind, Schaf, Schwein,<br />
Geflügel, etc.), damit diese sichere Lebensmittel<br />
(Milch, Fleisch, Eier) von höchster Qualität liefern,<br />
andererseits entwickelt sich ein ständig größer werdender<br />
Markt für Heimtiere mit dem Anspruch auf eine<br />
bedarfsgerechte und gesunde Ernährung.<br />
Futtermittel werden unterteilt in Einzelfuttermittel<br />
(Heu, Getreide usw.) und daraus hergestellte Mischungen<br />
(Mischfuttermittel), die wiederum mit verschiedenen<br />
Zusatzstoffen wie Vitaminen, Spurenelementen,<br />
Aminosäuren, Milchsäurebakterien, Konservierungsmittel<br />
usw. angereichert werden können.<br />
Neben den Hauptnährstoffen wie Proteine, Fette und<br />
Kohlenhydrate können Futtermittel auch unerwünschte<br />
und verbotene Stoffe wie Schwermetalle, Mykotoxine,<br />
Dioxine und PCB, gentechnisch veränderte<br />
Organismen (GVO), Rückstände von Tierarznei- oder<br />
Pflanzenschutzmitteln sowie Salmonellen enthalten,<br />
die nicht immer vermieden werden können, jedenfalls<br />
aber zu minimieren sind.<br />
Ein Höchstmaß an Futtermittelqualität und -sicherheit<br />
kann nur durch verpflichtende Eigenkontrollsysteme<br />
bei den Futtermittelunternehmern und durch eine<br />
staatliche Überwachung und Kontrolle gewährleistet<br />
werden. Ziel aller Qualitätssicherungssysteme von<br />
staatlichen Einrichtungen und Wirtschaft sind gesunde<br />
Tierbestände, durch die hochqualitative und sichere<br />
Lebensmittel für den Menschen produziert werden.<br />
Die Lebens- und Futtermittelskandale der letzten Jahre<br />
(z. B. Melamin, Dioxin, BSE) haben zur Verunsicherung<br />
der Konsumenten beigetragen. Ein auf Wissenschaft<br />
basierendes, auf Vorsorge und Vermeidung ausgerichtetes<br />
staatliches Kontrollsystem konnte in Österreich<br />
bisher die Gefahren für die Gesundheit von Tieren und<br />
Menschen abwenden. Österreich hat die in den letzten<br />
Jahren von der EU eingeleiteten, strengen und transparenten<br />
Maßnahmen maßgeblich unterstützt und<br />
auch vorbildlich umgesetzt.<br />
Mit der Gründung der <strong>AGES</strong> aus dem Zusammenschluss<br />
der Bundesanstalten des Landwirtschafts-,<br />
Lebensmittel-, Humanmedizin-, Veterinärmedizin- und<br />
Arzneimittelbereiches vor nunmehr 7 Jahren wurden<br />
alle Institute, die zur Ernährungssicherheit, Ernährungssicherung<br />
und Gesundheit von Mensch, Tier und<br />
Pflanzen beitragen, vereint.<br />
Die Qualität und die Sicherheit der eingesetzten<br />
Futtermittel in Österreich können nur durch eine<br />
ständige Überprüfung und Anpassung der Maßnahmensetzungen<br />
in der Zulassung und der Kontrolle<br />
von Futtermitteln erreicht werden. Die Mitarbeiter<br />
der <strong>AGES</strong>, insbesonders die Mitarbeiter des Instituts<br />
für Futtermittel, sind darum bemüht, dass das in sie<br />
gesetzte Vertrauen gerechtfertigt ist.<br />
3
4<br />
der mehrjährige integrierte<br />
Kontrollplan (miK) —<br />
amtliche Kontrolle der<br />
herstellung und inVerKehrbringung<br />
Von futtermitteln<br />
in Österreich<br />
Die Verordnung VO (EG) 882/2004 „über amtliche<br />
Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Le-<br />
bensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestim-<br />
mungen über Tiergesundheit und Tierschutz“ bildet<br />
in Verbindung mit den nationalen Rechtsvorschriften<br />
sowie den Verordnungen VO (EG) 178/2002 „zur<br />
Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anfor-<br />
derungen des Lebensmittelrechts“ und VO (EG)<br />
183/2005 „mit Vorschriften für die Futtermittelhygi-<br />
ene“ die Grundlage für die Durchführung der Kontrol-<br />
le von Futtermitteln.<br />
In Österreich ist das Bundesamt für Ernäh-<br />
rungssicherheit (BAES) gemäß Futtermittelgesetz<br />
die zuständige Behörde für die Durchführung der<br />
Kontrolle der Inverkehrbringung von Futtermitteln<br />
und für die Koordination mit den Bundesländern,<br />
welche für die Kontrollen der Verfütterung zuständig<br />
sind.<br />
Abb. 1: Zusammenspiel der Kontrollziele entlang des Ernährungskreises<br />
Die Mittel zur Wahrnehmung der Aufgaben des BAES<br />
werden von der Österreichischen Agentur für Gesundheit<br />
und Ernährungssicherheit (<strong>AGES</strong>) zur<br />
Verfügung gestellt.<br />
Die <strong>AGES</strong> ist wissenschaftliche Beraterin der Länder<br />
und der beiden Ministerien für Landwirtschaft und<br />
Gesundheit in allen Fragen im Bereich Futtermittel.<br />
Sie koordiniert alle technischen Maßnahmen in<br />
Österreich (Überwachung, Erhebungen usw.), erstellt<br />
Risikobewertungsstudien, führt Laboranalysen durch<br />
und veranstaltet Weiterbildungskurse für Aufsichtsorgane<br />
und Unternehmer des Futtermittelsektors.
mehrjähriger integrierter<br />
Kontrollplan (miK)<br />
Die eingangs angeführte „EG-Kontroll-Verordnung“<br />
schreibt vor, dass jedes Land einen mehrjährigen<br />
Plan für die gesamte Lebensmittelkette als Basis<br />
für die amtlichen Kontrollen erstellen muss. Die-<br />
ser Plan hat alle relevanten Kontrollbereiche, das<br />
Lebensmittelrecht, das Futtermittelrecht, die<br />
Kontrolle der Tiergesundheit und des Tierschutzes<br />
sowie bestimmte Aspekte der Pflanzengesundheit zu<br />
umfassen.<br />
Der MIK beschreibt die behördlichen Strukturen,<br />
Verantwortlichkeiten und Vorgangsweisen sowie<br />
Kriterien, die die Behörden bei ihrer Tätigkeit erfüllen<br />
müssen. Ausgehend von Strategie und Zielen werden<br />
die Schwerpunkte einer risikobasierten, amtlichen<br />
Kontrolle abgeleitet. Dieser MIK erfüllt somit auch<br />
den Wunsch nach erhöhter Transparenz der behördlichen<br />
Tätigkeit und ergänzt jene Informationen, die<br />
über die Jahresberichte als Ergebnisse der amtlichen<br />
Kontrollen bereits veröffentlicht werden.<br />
Der MIK wird kontinuierlich, entsprechend den<br />
jeweiligen aktuellen Erkenntnissen, weiterentwickelt.<br />
Er soll die unabhängige, risikobasierte und nachvollziehbare<br />
Auswahl der zu kontrollierenden Betriebe<br />
garantieren.<br />
Basis für die Ausarbeitung des MIK stellte der<br />
„Risikobasierte Integrierte Kontrollplan (RIK)“<br />
dar, welcher in einem zweijährigen Projekt (2005-<br />
2006) erstellt wurde. Ziel des RIK ist die Sicherstellung,<br />
dass<br />
➔ regelmäßig,<br />
➔ auf Risikobasis und<br />
➔ mit angemessener,<br />
statistisch abgesicherter Häufigkeit<br />
Kontrollen durchgeführt werden, damit die definierten<br />
Kontrollziele unter Berücksichtigung<br />
• festgestellter Risiken,<br />
• des bisherigen Verhaltens der Unternehmer,<br />
• der Verlässlichkeit der durchgeführten<br />
Eigenkontrollen und<br />
• von Informationen, die auf einen<br />
Verstoß hinweisen könnten, erreicht werden.<br />
Die definierten Kontrollziele ergeben sich aus den<br />
futtermittelrechtlich relevanten Vorgaben und sind in<br />
folgende Kategorien zusammenzufassen:<br />
• Lebensmittelsicherheit<br />
• Anwenderschutz<br />
• Umweltschutz<br />
• Produktionsrisiko<br />
• Tiergesundheit<br />
• Täuschungsschutz<br />
Die Abbildung 1 stellt das Zusammenspiel der<br />
einzelnen Ziele entlang des Ernährungskreises dar.<br />
5
6<br />
Entwicklung des risikobasierten integrierten Kontrollplans (RIK)<br />
Primärfaktoren:<br />
Nach Definition der Ziele wurden vorerst anhand von<br />
3 Leitlinien Primärfaktoren zur allgemeinen Risi-<br />
koeinteilung für die jeweiligen Betriebe erarbeitet.<br />
Leitlinie 1:<br />
Auf Grundlage der unterschiedlichen Rechtsnormen<br />
und der Kontrollpraxis werden die verschiedenen<br />
Betriebsarten vielfach unterschiedlich bezeichnet.<br />
Hierdurch ergeben sich häufig Unklarheiten, welche<br />
Betriebsarten bzw. Betriebsbereiche tatsächlich<br />
gemeint sind.<br />
Die eindeutige Festlegung der Betriebsarten ist jedoch<br />
bei der ‚Belegung‘ der verschiedenen Betriebsarten<br />
mit einer Risikokennzahl unabdingbare Voraussetzung.<br />
Im ungünstigsten Fall könnten ansonsten<br />
Betriebsarten mit zu geringen Risikokennzahlen<br />
bewertet werden, da einzelne Betriebsbereiche nicht<br />
in die Definition eingeschlossen wurden.<br />
Durch die Bestimmung der Eingangs- und Ausgangsprodukte<br />
sowie der vor- und nachgelagerten<br />
Betriebe wird zudem die Grundlage geschaffen,<br />
hintereinander geschaltete Betriebe bestimmen zu<br />
können. Dies ist besonders bei der Übertragung von<br />
Risiken über mehrere Betriebe hinweg relevant.<br />
Leitlinie 2:<br />
Diese Leitlinie stellt den zweiten Schritt auf dem Weg<br />
zur Risikobewertung von Betrieben dar, indem die<br />
in den Betriebsarten auftretenden Gefahren identifiziert<br />
und bewertet werden. Darauf aufbauend<br />
können in den weiteren Schritten die Risiken für die<br />
jeweilige Betriebsart sowie später der Einzelbetriebe<br />
bestimmt werden. Dieses schrittweise Verfahren ist<br />
darauf ausgerichtet, die einzelnen Parameter für die<br />
Risikobewertung nachvollziehbar bzw. zum späteren<br />
Zeitpunkt an neue Erkenntnisse anpassbar zu gestalten.<br />
Die Gefahrenidentifikation und –bewertung<br />
wird für jeden einzelnen Prozess, der im Rahmen<br />
der Leitlinie 1 definiert wurde, eigens durchgeführt.<br />
Dies mag anfangs als zu aufwändig anmuten, bietet<br />
jedoch folgende wesentlichen Vorteile:<br />
• Die an den Produkten durchgeführten Prozesse<br />
stellen gewissermaßen eine Landkarte für die Strukturierung<br />
der einzelnen Betriebsarten dar, die eine<br />
hilfreiche Grundlage für die systematische Erfassung<br />
aller Gefahren ermöglicht.<br />
• Die in vielen Betriebsarten ähnlichen Prozesse<br />
können leicht verglichen werden und vielfach sogar<br />
sehr ähnlich bezüglich der Gefahrenidentifikation<br />
gestaltet werden. Denn viele Betriebe, die mit<br />
den gleichen Produkten befasst sind, unterscheiden<br />
sich häufig nur durch Kernprozesse der Herstellung,<br />
während andere vielfach sehr ähnliche Hilfsprozesse<br />
sind (z. B. Lagerung, Verpackung, Kennzeichnung).<br />
Auch über die Produktgruppen hinweg können<br />
durch dieses Verfahren Analogien hergestellt<br />
und dadurch wertvolle Informationen gewonnen<br />
werden.<br />
• Nicht zuletzt besteht die Möglichkeit, neue Betriebsarten<br />
einfacher zu erfassen, vor allem wenn es sich<br />
um die Aufteilung oder Zusammenführung bestehender<br />
Betriebsarten handelt. Ein Spezifikum liegt<br />
weiters darin, dass die Bewertung der Gefahren<br />
immer gegenüber den vorab, auf das einzelne<br />
Materienrecht abgestimmten, definierten Zielen<br />
(Schadensausmaß) durchgeführt wird.
Das Verfahren erfolgt jeweils pro Betriebsart in zwei<br />
Schritten.<br />
Für jeden Prozess werden folgende Gefahren bestimmt:<br />
• Die wichtigsten Gefahren, die in diesem Prozess<br />
auftreten oder hinzukommen können.<br />
• Die wichtigsten Gefahren, die in diesem Prozess<br />
beseitigt werden können.<br />
Unter den ‚wichtigsten Gefahren‘ werden diejenigen<br />
Gefahren verstanden, denen in der aktuellen Kontrollpraxis<br />
sowie von Experten die größte Aufmerksamkeit<br />
beigemessen wird. Dies sind somit besonders die<br />
Gefahren, die im Rahmen der Betriebskontrolle durch<br />
eigene Kontrollpunkte berücksichtigt werden.<br />
Mit dem ‚Auftreten‘ und ‚Beseitigen‘ wird immer<br />
darauf Bezug genommen, ob die Gefahr unter allgemeinüblichen<br />
Bedingungen in Verarbeitung, Handel<br />
und Verzehr zum Tragen kommen kann. So können<br />
z. B. Mikroorganismen als Gefahr bei der Kühllagerung<br />
auftreten, obwohl vorher bereits in relativ<br />
geringer Anzahl Mikroorganismen vorhanden waren.<br />
Alle identifizierten Gefahren werden bewertet, indem<br />
das Ausmaß des größtmöglichen Schadens für die<br />
unterschiedlichen Ziele bewertet wird.<br />
Leitlinie 3:<br />
In Leitlinie 3 wird die Bestimmung der Schadenswahrscheinlichkeit<br />
und des Betriebsartenrisikos<br />
erarbeitet.<br />
Hintergrund: Für alle definierten Betriebsarten werden<br />
die Schadenswahrscheinlichkeiten der identifizierten<br />
Gefahren festgelegt und entsprechend den Schadensausmaßen<br />
das Betriebsartenrisiko berechnet.<br />
Die Schadenswahrscheinlichkeiten werden mittels der<br />
Anzahl von Schadensfällen bestimmt. Es werden nur<br />
diejenigen Gefahren bewertet, die in der jeweiligen<br />
Betriebsart auftreten oder beseitigt werden können.<br />
Für die Bemessung wird im Detail folgender Ansatz<br />
gewählt:<br />
In erster Linie sind für die Beurteilung wissenschaftliche<br />
bzw. behördliche Untersuchungsergebnisse zu<br />
berücksichtigen. Stehen hierfür nicht ausreichend<br />
Informationen zur Verfügung, ist es auf Grund des<br />
anzuwendenden Vorsorgeprinzips erforderlich, vorerst<br />
Schätzwerte erfahrener Fachleute anzusetzen.<br />
Wenn für eine Gefahr eine ausgeprägte öffentliche<br />
Risikowahrnehmung besteht, die von vorliegenden<br />
wissenschaftlichen Bewertungen stark abweicht<br />
(z. B.: BSE, GVO), so wird diese öffentliche Risikowahrnehmung<br />
an dieser Stelle noch nicht berücksichtigt.<br />
Das Betriebsartenrisiko wird mittels des erwarteten<br />
Gesamtschadens je Ziel berechnet, der durch<br />
alle Gefahren einer Betriebsart verursacht wird.<br />
Für die Berechung werden, getrennt für jedes Ziel,<br />
für jede Gefahr die Produkte aus der Schadenswahrscheinlichkeit<br />
und den Werten für die unterschiedlichen<br />
Schadensausmaße summiert. Abschließend<br />
wird die Summe aus den für alle Gefahren erhaltenen<br />
Werten gebildet. Die somit erhaltenen Werte werden<br />
abschließend je Ziel einer Betriebsartenrisikokategorie<br />
zugeordnet. Zuletzt wird mittels der oben<br />
dargestellten Formel der erwartete Gesamtschaden<br />
berechnet sowie daraus die Betriebsartenrisikokategorie<br />
abgeleitet.<br />
7
8<br />
Sekundärfaktoren:<br />
Neben der Bestimmung der Primärfaktoren und somit<br />
des allgemeinen Betriebsartenrisikos werden mit Hilfe<br />
einer Datenerhebung Sekundärfaktoren ermittelt und<br />
somit das Einzelbetriebsrisiko dargestellt. Sekun-<br />
därfaktoren beziehen sich unter anderem auf die<br />
Größe eines Betriebes oder beschreiben die Teilnah-<br />
me an einem QM-Programm. Somit können zusätzlich<br />
zum Risiko der einzelnen Betriebsart (z. B.: Mischfut-<br />
terhersteller) betriebsspezifische Gegebenheiten<br />
(z. B.: Fa. XY erzeugt 100.000 t Mischfutter im Jahr)<br />
in die Risikoermittlung miteinbezogen werden. Basie-<br />
rend auf diesen Berechnungen erhalten wir eine Be-<br />
triebsliste, welche die einzelnen Betriebe mit jeweils<br />
einem Primär- bzw. Sekundärfaktor abbildet.<br />
Neben diesen grundlegenden Berechnungen auf<br />
Betriebsebene werden zusätzlich Erhebungen auf<br />
Produktebene durchgeführt. Als Basis dient das<br />
„harmonized model“ der EU-Kommission, welches<br />
eine Übersicht von Futtermittel-Produktkategorien<br />
und zu untersuchenden Parametern liefert. Zur Be-<br />
rechnung des notwendigen Stichprobenumfanges<br />
auf Basis parametrischer Methoden sind umfang-<br />
reiche Vorkenntnisse über die Verteilung des zu<br />
untersuchenden Merkmals Vorraussetzung, die nicht<br />
für alle Untersuchungsparameter in der gleichen<br />
Qualität vorliegen. Daher wurde der Anwendung<br />
nichtparametrischer Methoden, die keinerlei Vertei-<br />
lungsannahmen benötigen, der Vorzug gegeben. Die<br />
tatsächliche Bestimmung des Stichprobenumfanges<br />
erfolgte anhand der Analysedaten aus den Vorjahren,<br />
wobei bereits durchgeführte Einzelbestimmungen<br />
und die dabei festgestellte Beanstandungsquote be-<br />
rücksichtigt wurde. Die Ergebnisse der letzten Jahre<br />
wurden jeweils berücksichtigt und der Umfang der<br />
Einzelbestimmungen angepasst. In den Fällen, wo<br />
ausreichende Informationen aus den vergangenen<br />
Jahren vorlagen, wurden parametrische Verfahren<br />
zur Stichprobenumfangsbestimmung verwendet. Im<br />
Anschluss an die statistische Auswertung wird der<br />
errechnete Prüfplan vom Fachinstitut durch die jewei-<br />
ligen Experten geprüft.<br />
Der errechnete Mindeststichprobenumfang auf<br />
Produktebene dient in weiterer Folge als Basis für<br />
die Anzahl bzw. Aufteilung der einzelnen Kontrollen<br />
auf die Betriebe. Die detaillierte Zuteilung auf die<br />
einzelnen Kontrollbetriebe wird anhand der jeweiligen<br />
Primär- bzw. Sekundärfaktoren durchgeführt.<br />
Zusätzlich werden von der Futtermittelkontrolle<br />
nachfassende und ad-hoc-Kontrollen umgesetzt,<br />
welche ebenfalls im gesamten Kontrollplan abgebildet<br />
sind.<br />
Die nachfassenden Kontrollen erfassen Betriebe mit<br />
Beanstandungen aus dem Vorjahr bzw. Missstände<br />
aus Vorperioden, welche erneut im Kontrollplan<br />
berücksichtigt werden. Schwerpunkte bei diesen<br />
Kontrollen bilden die Abschaffung der damalig festgestellten<br />
Mängel bzw. die korrekte Umsetzung der<br />
erteilten Auflagen.<br />
Informationen aus dem Europäischen Schnellwarnsystem,<br />
Zollmeldungen sowie Informationen aus<br />
laufenden Kontrollen bzw. zu futtermittelrechtlichen<br />
Aspekten finden als ad-hoc-Kontrollen ihren Eingang<br />
in den Kontrollplan. Hierbei werden aktuelle Probleme<br />
vor Ort bei den Betrieben kontrolliert mit dem<br />
Ziel, Abweichungen umgehend abzustellen.<br />
Die Abbildung 2 stellt eine zusammenfassende Übersicht<br />
des MIK dar und gibt Hinweis auf die bei der<br />
Umsetzung jeweils zu berücksichtigenden Bereiche.
Risikobasierte<br />
Umsetzung<br />
RIK<br />
=<br />
Risikobasierter<br />
Integrierter<br />
Kontrollplan<br />
(Stichproben- und<br />
Inspektionsplan)<br />
Abb. 2 : Übersicht MIK<br />
übersicht miK<br />
Mehrjähriger Integrierter Kontrollplan<br />
Strategische<br />
Umsetzung<br />
• strategische Zielsetzungen<br />
• Organisation & Management<br />
• Dokumentierte Kontroll- und<br />
Verifizierungsverfahren<br />
• interne und externe<br />
Supervision<br />
• Unabhängigkeit<br />
(Akkreditierung)<br />
Integrierte Umsetzung<br />
• Unparteilichkeit und Einheitlichkeit, Transparenz und Vertraulichkeit<br />
• Koordination, Informationsaustausch und Zusammenarbeit<br />
• Amtshilfe und gegenseitige Unterstützung<br />
• Krisenmanagement<br />
Operative<br />
Umsetzung<br />
• ausreichendes Personal<br />
(Qualifikation, Erfahrung, etc.)<br />
• adäquate Einrichtung<br />
und Ausrüstung<br />
• Anwendung geeigneter<br />
„Methoden“ (Routinekontrollen,<br />
Inspektionen, HACCP, etc.)<br />
• Infrastruktur (Labors, etc.)<br />
• Reporting<br />
9
10<br />
amtliche futtermittelkontrolle<br />
in Österreich<br />
Die amtlichen Kontrollen durch das BAES<br />
umfassen<br />
• Inspektionen und Probeziehungen beim<br />
Inverkehrbringen von Rohstoffen und<br />
Fertigprodukten<br />
(Herstellung, Lagerung, Einfuhr),<br />
• die Untersuchung aller Futtermittelproben einschließlich<br />
Beurteilung der Ergebnisse, Beanstandungen,<br />
Anordnung von Maßnahmen, Erstattung<br />
einer Anzeige bei den Strafbehörden und<br />
• Zulassung und Registrierung der Betriebe.<br />
Der Kontrollplan schätzt sämtliche auftretende Risken<br />
ab und gibt vor, welche Betriebe und wie viele und<br />
welche Futtermittel überprüft werden sollen. In<br />
Österreich werden jährlich etwa 2.200 Futtermittelproben<br />
in Zusammenarbeit mit den Ländern gezogen<br />
und auf Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe, unerwünschte<br />
und verbotene Stoffe sowie Tierarzneimittelrückstände<br />
untersucht.<br />
Betriebskontrollen (Inspektionen)<br />
Dabei werden Dokumente und Aufzeichnungen sowie<br />
verschiedene Prozessabläufe bei der Produktion, die<br />
Einhaltung von Hygienestandards und die Umsetzung<br />
des Prinzips der Gefahrenanalyse und kritischer<br />
Kontrollpunkte (hazard analysis and critical control<br />
points, HACCP) geprüft. Außerdem wird bei einer<br />
Inspektion auf die Durchführung von Eigenkontrollen,<br />
wozu die Betriebe gesetzlich verpflichtet sind, geachtet.<br />
Futtermittelbetriebe, die bestimmte Zusatzstoffe<br />
oder Vormischungen daraus verwenden, müssen<br />
beim BAES eine Zulassung beantragen. Alle sonstigen<br />
Betriebe (Händler, Transporteure, Lagerhalter, mobile<br />
Mischer usw.) müssen gemäß Futtermittelhygieneverordnung<br />
(EG) 183/2005 beim BAES registriert<br />
sein. Futtermittel dürfen nur von zugelassenen oder<br />
registrierten Betrieben bezogen werden.<br />
Kennzeichnung<br />
Eine weitere wichtige Aufgabe im Rahmen der<br />
Futtermittelkontrolle ist die formale Überprüfung der<br />
Kennzeichnung von Futtermitteln auf ihre Rechtskonformität<br />
sowie auf irreführende oder andere unzulässige<br />
Angaben. Auf dem Etikett oder Sackanhänger<br />
bzw. dem Warenbegleitpapier bei loser Ware dürfen<br />
sich keine Angaben zur Behandlung, Vorbeugung<br />
oder Heilung von Krankheiten finden. Besonders am<br />
immer größer werdenden Heimtierfutter- und Pferdefuttermarkt<br />
ist die Grenze zwischen Arzneimittel und<br />
Futtermittel infolge unerlaubter, meist gesundheitsbezogener<br />
Behauptungen (Werbeaussagen) nicht<br />
immer klar zu erkennen. Die Futtermittelkontrolle<br />
soll hier den Käufer vor Täuschung und irreführender<br />
Werbung schützen.<br />
Rückverfolgbarkeit<br />
Futtermittel dürfen weder die Gesundheit von Mensch<br />
und Tier noch die Umwelt schädigen. In manchen<br />
Fällen muss ein bereits am Markt befindliches Futtermittel<br />
zurückgeholt werden. Futtermittelunternehmer<br />
sind verpflichtet, Aufzeichnungen über die Warenströme<br />
in ihrem Betrieb zu führen, um im Fall eines<br />
Risikos die Rückverfolgbarkeit in allen Produktions-,<br />
Verarbeitungs- und Vertriebsstufen sicherzustellen.
Mischerprüfungen<br />
Seit 2003 bietet das Institut für Futtermittel Über-<br />
prüfungen von Mischanlagen an. Mithilfe von Micro-<br />
tracern wird geprüft, ob eine Mischanlage für eine<br />
gleichmäßige Verteilung (Homogenität) von Zusatz-<br />
stoffen in einem Mischfuttermittel geeignet ist.<br />
Beurteilung der Ergebnisse<br />
Im Anschluss an die Untersuchung einer Futtermittel-<br />
probe erfolgt am Institut für Futtermittel die Bewer-<br />
tung und Interpretation des Ergebnisses. Gesetzes-<br />
verstöße werden beanstandet, und in Fällen grober<br />
Abweichungen wird eine Anzeige bei der Bezirksver-<br />
waltungsbehörde erstattet, die ein Strafverfahren<br />
einleitet. Bei Gefahr für die Gesundheit von Mensch<br />
und/oder Tier werden dem Unternehmen entspre-<br />
chende Maßnahmen vorgeschrieben, z. B. Sperre<br />
der Ware, Rückholung vom Markt, Information der<br />
Abnehmer und Rückbeförderung an den Ursprungs-<br />
ort. Weiters kann die Verwendung zu anderen als<br />
Futterzwecken oder auch eine unschädliche Beseiti-<br />
gung angeordnet werden. Ergebnisse von amtlichen<br />
Futtermittelproben, die für in Ordnung befunden<br />
wurden, können vom jeweiligen Betrieb zur eigenen<br />
Verwendung von der <strong>AGES</strong> verbilligt gekauft werden.<br />
Kennzeichnungsprüfung<br />
Transparenz der Kontrollen<br />
Um höchstmögliche Transparenz sicherzustellen,<br />
werden vom BAES Berichte über die durchgeführten<br />
Kontrollen angefertigt und den kontrollierten Betrie-<br />
ben ausgehändigt.<br />
Diese Berichte umfassen eine Beschreibung des<br />
Zwecks der amtlichen Kontrollen, der angewandten<br />
Kontrollverfahren, der Kontrollergebnisse und gege-<br />
benenfalls der vom betroffenen Unternehmer zu er-<br />
greifenden Maßnahmen. Darüber hinaus wird jährlich<br />
ein Jahresbericht über die Ergebnisse der Kontrollen<br />
verfasst und auf der website des BAES veröffentlicht:<br />
http://www.baes.gv.at/futtermittel/ueberwa-<br />
chung-und-kontrolle/<br />
Anforderungen an die Ausbildung<br />
und Schulungen<br />
Ein neu implementierter, modulartig aufgebauter<br />
Lehrgang für amtliche Futtermittelkontrollorgane soll<br />
die Durchführung der Kontrollen auf höchstem Niveau<br />
gewährleisten. Die Wissensdarbietung erstreckt<br />
sich, wie in der VO (EG) 882/2004 vorgesehen, vom<br />
Futtermittelrecht über Warenkunde und Tierernährung<br />
bis hin zur Vermittlung von Kenntnissen über<br />
Produktions- und QM-Systeme. Alle Futtermittel-Kontrollorgane<br />
des Bundesamtes ebenso wie die Koordinatoren<br />
in den Landesregierungen haben diesen<br />
Lehrgang bereits im März bzw. April 2008 erfolgreich<br />
absolviert. Zusätzlich wurden für die Kontrollorgane<br />
der Länder (meist Amtstierärzte und -ärztinnen)<br />
Schulungen in den Bundesländern durch die <strong>AGES</strong><br />
abgehalten.<br />
11
12<br />
das europäische schnellwarnsystem<br />
– rapid alert<br />
system for food and feed<br />
(rasff)<br />
Das Europäische Schnellwarnsystem für Lebensmit-<br />
tel und Futtermittel (RASFF) wurde im Jahr 1999<br />
eingerichtet, um die nationalen Kontrollbehörden<br />
mit einem effektiven Informationswerkzeug über<br />
getroffene Maßnahmen zur Gewährleistung der<br />
Lebensmittelsicherheit auszustatten. Das Institut<br />
für Futtermittel der <strong>AGES</strong> ist bereits seit Februar<br />
2002 Kontaktstelle für Futtermittel, das Institut für<br />
Lebensmitteluntersuchung der <strong>AGES</strong> in Salzburg ist<br />
seit März 2007 für Lebensmittel und gleichzeitig als<br />
zentrale Kontaktstelle für das Schnellwarnsystem in<br />
Österreich zuständig. Die beiden nationalen Kon-<br />
taktpunkte sind direkt via Internet mit der Zentrale<br />
in Brüssel verbunden und werden im Fall plötzlich<br />
auftretender Krisensituationen direkt mit den Ent-<br />
scheidungsträgern, dem Bundesministerium für<br />
Gesundheit (BMG) und dem Bundesministerium für<br />
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-<br />
schaft (BMLFUW), kurzgeschlossen.<br />
Gesetzlicher Hintergrund<br />
Die Errichtung eines europäischen Schnellwarnsy-<br />
stems ist in der Verordnung (EG) 178/2002 („General<br />
food law“) verankert.<br />
Folgende Arten von Meldungen werden<br />
elektronisch übermittelt:<br />
1. Warnmeldungen (Alert notifications)<br />
2. Informationsmeldungen (Information notifications)<br />
3. Neues (News)<br />
4. sowie den Originalmeldungen nachfolgende<br />
Meldungen (Follow-ups)<br />
Alert notifications<br />
Alert-Meldungen werden versendet, wenn risikobehaftete<br />
Lebensmittel oder Futtermittel bereits auf<br />
den Markt gekommen sind und sofortiger Handlungsbedarf<br />
besteht. Solche Warnmeldungen werden von<br />
jenem Mitgliedstaat ausgesandt, der das Risiko entdeckt<br />
und entsprechende Maßnahmen veranlasst hat,<br />
wie zum Beispiel eine Sperre oder Rückholung der<br />
Ware. Ziel ist es, dass alle Mitgliedstaaten rasch und<br />
gleichzeitig dieselbe Information erhalten und somit<br />
prüfen können, ob sich das betreffende Produkt auch<br />
auf ihrem Markt befindet und damit notwendige<br />
Schritte zur Futtermittel- und Lebensmittelsicherheit<br />
veranlassen können. Der Konsument kann darauf<br />
vertrauen, dass Produkte aus einer veröffentlichten<br />
Alert-Meldung bereits vom Markt entfernt worden<br />
sind oder zurückgeholt werden. Wie solche Maßnahmen<br />
auf nationaler Ebene ausgeführt werden, entscheiden<br />
die Mitgliedstaaten selbst einschließlich der<br />
Vorgabe, ob detaillierte Informationen an die Medien<br />
weitergegeben werden.<br />
Information notifications<br />
Informationsmeldungen werden gesendet, wenn<br />
für Lebensmittel oder Futtermittel zwar ein Risiko<br />
besteht, jedoch das Produkt nicht auf den Markt<br />
gekommen ist und die anderen Mitgliedstaaten daher<br />
noch keine Sofortmaßnahmen treffen müssen. Diese<br />
Meldungen betreffen meistens Lieferungen, die nach<br />
einer Kontrolle an einer Außengrenzstelle der Europäischen<br />
Gemeinschaft abgewiesen wurden.<br />
News<br />
Diese Meldungen, die weder als Warnung noch zur<br />
Information dienen aber für die Kontrollbehörden<br />
relevant sein könnten, werden von der Kommission<br />
für die Mitglieder des RASFF zur Verfügung gestellt.<br />
Es handelt hierbei sich zumeist um Meldungen über<br />
diverse Vorkommnisse in Drittländern.<br />
Wochenmeldungen<br />
Die Kommission veröffentlicht einmal wöchentlich eine<br />
Übersicht über alle Food und Feed-Meldungen (alert,<br />
information, border rejections) im Internet. Meldungen,<br />
die dem Futtermittelsektor zuzuordnen sind, sind in<br />
blau gedruckt. Handelsnamen und Identität der betroffenen<br />
Firmen werden hier nicht bekannt gegeben.<br />
Detaillierte Informationen werden nur an die monatlich<br />
aktualisierten Kontaktpunkte der nationalen Behörden<br />
und an die Zentrale in Brüssel weitergegeben.<br />
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/<br />
index_en.htm
Information von Drittstaaten<br />
Die Europäische Kommission übernimmt die Aufgabe<br />
der Drittstaaten, wenn diese durch Export oder Import<br />
von Futtermitteln, die beanstandet wurden, betroffen<br />
sind. Dadurch sollen im Ursprungsland durch geeignete<br />
Gegenmaßnahmen Wiederholungsfälle verhindert<br />
werden. EU-Antragsländer (derzeit Türkei, Kroatien<br />
und Mazedonien), aber auch andere Drittstaaten oder<br />
internationale Organisationen können sich im Einvernehmen<br />
und unter Einhaltung bestimmter Abmachungen<br />
(z. B. Vertraulichkeitsregeln) am Schnellwarnsystem<br />
beteiligen.<br />
RASFF-Meldungen aus Österreich<br />
(inkl. Follow-up´s)<br />
2002: Dioxin in Ferkeltorf, Salmonellen in Fischmehl<br />
2003: Kokzidiostatika in Legehennenfutter, Dioxin in<br />
Grünmehlpellets und Zinkoxid, Salmonellen in Fischmehl<br />
und Sonnenblumenschrot, erhöhter Fluorgehalt<br />
in einem Ergänzungsfuttermittel, tierisches Protein in<br />
Sauenfutter<br />
2004: Knochenfragmente in Säurepremix und Rübenschnitzel,<br />
Salinomycin in Mineralfutter, Polycyclische<br />
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH) in Graspellets<br />
Tab. 1: RASFF-Meldungen (2002 - 2008)<br />
Über 97 % aller Meldungen betreffen den Lebensmittelsektor.<br />
Auffallend ist, dass etwa ein Drittel aller<br />
„Alert notifications“ sowie über 70 % der „Information<br />
notifications“ Produkte aus Drittländern (Nicht EU-<br />
Mitgliedsstaaten) betreffen.<br />
In den letzten beiden Jahren sorgte eine Substanz<br />
aus der Gruppe der Kunststoffe/Duroplaste zuerst am<br />
Futtermittelmarkt, dann auch bei Lebensmitteln, für<br />
besonders negative Schlagzeilen, die im August 2008<br />
mit Berichten über einige Todesfälle sowie schwere<br />
Nierenerkrankungen tausender Babies und Kleinkinder<br />
in China durch Beimengung von Melamin in<br />
Milchpulver gipfelten. Melamin (eine heterocyclische<br />
aromatische Stickstoffverbindung) war zur Vortäuschung<br />
eines höheren Proteingehaltes verschiedensten<br />
2005: Salmonellen in Hundekauknochen (6x), Leinsamenschrot<br />
(2x) und Fischmehl (2x)<br />
2006: Selen- und Chromhefe in Hunde- und Katzenfutter,<br />
Superoxiddismutase in Pferdefutter, dioxinähnliche<br />
PCB in Kupfersulfat, Blei in Manganoxid, Arsen<br />
in Pferdefutter, Salmonellen in Proteinkonzentrat für<br />
Masthühner (2x), in Hundefutter, Rapsschrot und<br />
Fischmehl<br />
2007: Selen-Überschreitung in Ferkelfutter, Botulinumtoxin<br />
in Katzenfutter (2x), Cumarin in Hundekeksen,<br />
Fremdkörper in Welpenfutter, Alflatoxine in<br />
Erdnüssen, dioxinähnliche PCB in Kupfersulfat, Salmonellen<br />
in Hundekauknochen, Cadmium in Zinksulfat,<br />
Enterobakterien in Hundefutter<br />
2008: Salmonellen in Sojaschrot (4x), in Geflügelmehl,<br />
in Rapskuchen und in Weizenprotein, Cadmium<br />
in Dicalciumphosphat, Blei in Reisproteinkonzentrat,<br />
DDT in Kräuter-Ergänzungsfuttermittel (2), Cyanursäure<br />
in Süßmolkepulver, Cyanide in Leinschrot,<br />
dioxinähnliche PCP in Kupferchelat und Tierknochensplitter<br />
in Kräuterzusatzstoff. Von den insgesamt<br />
15 aus Österreich gemeldeten Fällen waren 5 Original-<br />
Meldungen und 10 Follow-up-Meldungen.<br />
Jahr RASFF-Gesamtmeldungen Feed-Gesamtmeldungen Feed-Meldungen aus<br />
inkl. Follow-up exkl. Follow-up Österreich inkl. Follow-up<br />
2002 3.024 100 2<br />
2003 4.286 71 7<br />
2004 5.367 65 4<br />
2005 6.897 85 10<br />
2006 6.594 129 10<br />
2007 7.354 163 10<br />
2008 7.018 181 15<br />
Futtermitteln und Milchpulver in krimineller Absicht<br />
zugesetzt worden. Seit Oktober 2008 sind alle aus<br />
China importierten milchpulverhältigen und/oder proteinreichen<br />
Lebens- und/oder Futtermittellieferungen<br />
gemäß Entscheidung der Kommission 2008/798/EG<br />
auf Melamin zu untersuchen, wobei ein Maximalgehalt<br />
für Melamin von 2,5 mg pro kg Erzeugnis festgesetzt<br />
wurde. Der Lebensmittelhandel war weltweit durch<br />
den Melaminskandal stark betroffen, in Österreich<br />
wurde trotz umfangreicher Untersuchungen in nur<br />
ganz wenigen Lebensmitteln (ein Milch-Drink und<br />
einige wenige Süßigkeiten aus Asiashops) Melamin<br />
nachgewiesen und sofort vom Markt genommen. Die<br />
Untersuchungen von insgesamt 34 Futtermitteln (ab<br />
Oktober 2008) ergaben immer Werte unter 2,5 mg/kg<br />
bzw. ein negatives Ergebnis für Melamin.<br />
13
14<br />
100 %<br />
90 %<br />
80 %<br />
70 %<br />
60 %<br />
50 %<br />
40 %<br />
30 %<br />
20 %<br />
10 %<br />
0 %<br />
erwünschte Komponenten –<br />
inhaltsstoffe und zusatzstoffe<br />
Mischfuttermittel sind Mischungen aus Einzelfutter-<br />
mitteln, mit oder ohne Zusatzstoffe, welche als<br />
Allein- oder als Ergänzungsfuttermittel zur Tierer-<br />
nährung bestimmt sind. Die Qualität eines Misch-<br />
futtermittels resultiert aus den verwendeten Einzel-<br />
futtermitteln und seiner Fähigkeit, den Energie und<br />
Nährstoffbedarf des Tieres zu decken.<br />
Nährstoffzusammensetzung<br />
Die Inhaltsstoffe der in einem Mischfuttermittel<br />
verwendeten Einzelfuttermittel tragen unterschiedlich<br />
zur Nährstoffzusammensetzung bei. Als Einzelfutter-<br />
mittel gelangen Getreide, Ölsaaten, Leguminosen,<br />
Milch, Fischmehl, Knollen und Wurzeln, alle ihre<br />
Nebenprodukte sowie Mineralstoffe zur Verwendung.<br />
Folgende Nährstoffgruppen sind in einem Futtermit-<br />
tel enthalten und werden mittels Weenderanalyse<br />
ermittelt (siehe Abb. 3).<br />
Nährstoffgruppen eines Futtermittels<br />
Feuchte<br />
Rohasche (XA)<br />
Rohfaser (XF)<br />
N-freie<br />
Extraktstoffe<br />
(NIE)<br />
Rohprotein (XP)<br />
Rohfett (XL)<br />
Abb. 3: Die Zusammensetzung eines Futtermittels,<br />
durch Weenderanalyse ermittelt<br />
Rohprotein (XP)<br />
Rohprotein umfasst die Aminosäuren und andere<br />
stickstoffhältige Verbindungen. Es ist Quelle für den<br />
Aufbau von körpereigenem Eiweiß (Fleisch, Milch<br />
usw.) und kann in dieser Funktion durch keinen<br />
anderen Nährstoff ersetzt werden. Die Qualität des<br />
Rohproteins wird wesentlich durch seine Bausteine,<br />
die Aminosäuren, bestimmt. Einige davon sind für<br />
den tierischen Organismus essentiell. Sind Aminosäu-<br />
ren aus natürlichen Quellen nicht ausreichend verfüg-<br />
bar, werden sie in Form von Zusatzstoffen ergänzt.<br />
Rohfaser (XF)<br />
Als Rohfaser werden die im Futter enthaltenen<br />
Ballaststoffe bezeichnet. Diese pflanzlichen Gerüst-<br />
substanzen setzen sich aus Zellulose und Hemizellu-<br />
losen sowie unverdaulichen Stoffen, vor allem Lignin,<br />
zusammen. Mit Ausnahme der Wiederkäuer (Pansen-<br />
bakterien) können diese Stoffe von den Tieren nur<br />
schwer verdaut werden, jedoch ist ein bestimmter<br />
Mindestanteil Rohfaser im Futter notwendig. Ein<br />
Zuviel führt zu einer Beeinträchtigung der Nährstoff-<br />
aufnahme und somit zu geringerer Futterverwertung.<br />
Abhilfe kann hier der Zusatz von Enzymen schaffen.<br />
Rohasche (XA)<br />
Die Rohasche stellt die mineralische Komponente<br />
eines Futtermittels dar. Dazu zählen die Elemente<br />
Phosphor (P), Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Natri-<br />
um (Na) und Kalium (K). Futtermittel pflanzlichen Ur-<br />
sprungs enthalten gewisse Anteile an Mineralstoffen,<br />
oft ist dieser jedoch für eine optimale Versorgung der<br />
Tiere nicht ausreichend.<br />
Man denke hier z. B. nur an den hohen Ca-Bedarf<br />
laktierender Kühe bzw. Legehennen. In Mischfutter-<br />
mitteln werden diese Mängel durch Einmischung von<br />
Mineralien wie z. B. Calciumcarbonat, Calciummagne-<br />
siumphosphat und ähnlichen Verbindungen behoben.<br />
Für den Landwirt, der wirtschaftseigenes Futter ver-<br />
wendet bzw. selbst mischt, stehen Mineralfuttermittel<br />
als Ergänzung zur Verfügung. Diese enthalten meist<br />
neben den eigentlichen Mineralstoffen auch Zusatz-<br />
stoffe wie Spurenelemente, Vitamine, Enzyme oder<br />
probiotisch wirksame Mikroorganismen.
Rohfett (XL)<br />
Futtermittel weisen einen sehr unterschiedlichen<br />
Fettgehalt auf. In besonders energiereichen Misch-<br />
futtermitteln (z. B. Hühnermastfutter) wird auch<br />
reines pflanzliches Fett oder Öl zugesetzt. Neben<br />
den Kohlenhydraten ist Fett nämlich der wichtigste<br />
Energielieferant in der Nahrung.<br />
Fett besteht rein chemisch aus Glycerin und Fett-<br />
säuren. Einige dieser Fettsäuren zählen für das Tier<br />
zu den essentiellen, also lebensnotwendigen Nah-<br />
rungsfaktoren. Dies sind die mehrfach ungesättigten<br />
Fettsäuren wie Linol-, Linolen- und Arachidonsäure,<br />
die dem Tier in einer bestimmten Menge täglich mit<br />
der Nahrung zugeführt werden müssen. Fett ist auch<br />
als Träger der fettlöslichen Vitamine von Bedeutung.<br />
Seine Qualität beeinflusst zum Teil direkt die Qualität<br />
tierischer Lebensmittel.<br />
Stickstofffreie Extraktstoffe (NfE)<br />
Sie stellen den rechnerisch ermittelten Rest nach<br />
Abzug von Feuchte, Rohasche, Rohfett, Rohfaser und<br />
Rohprotein dar. Die NfE enthalten Polysaccharide<br />
(Stärke), lösliche Zucker (Glucose, Fructose, Saccha-<br />
rose, Lactose, Maltose und Oligosaccharide) sowie<br />
lösliche Teile von Zellulose, Hemizellulosen, Lignin<br />
und Pektinen. In der Summe umfassen die NfE also<br />
die Kohlenhydrate, neben Fett die Hauptenergiesubs-<br />
tanzen eines Futtermittels.<br />
Zusatzstoffe<br />
Die Zusammensetzung der Mischfuttermittel soll für<br />
die Tiere ein gesundes Wachstum, für den Landwirt<br />
– im Hinblick auf den wirtschaftlichen Erfolg – eine<br />
entsprechende Tierleistung sicherstellen. Ist dies<br />
aufgrund der natürlich vorhandenen Inhaltsstoffe<br />
nicht gewährleistet, können Zusatzstoffe zum Einsatz<br />
kommen. Zusatzstoffe dürfen sich nicht schädlich auf<br />
die Gesundheit von Mensch und Tier oder auf die<br />
Umwelt auswirken, sie dürfen keinen Nachteil oder<br />
Irreführung für den Verbraucher im Hinblick auf die<br />
Beschaffenheit der tierischen Erzeugnisse mit sich<br />
bringen. Antibiotika und Hormone sind als Zusatz-<br />
stoffe verboten.<br />
Um gesetzlich EU-weit zugelassen zu werden,<br />
müssen Zusatzstoffe u. a. eine der folgenden<br />
Eigenschaften aufweisen (VO (EG) 1831/2003):<br />
• die Beschaffenheit des Futtermittels positiv be-<br />
einflussen (z. B. Konservierungsmittel oder Anti-<br />
oxidantien, Säureregulatoren,...)<br />
• die Beschaffenheit des tierischen Erzeugnisses<br />
positiv beeinflussen (z. B. Farbstoffe)<br />
• die Farbe von Zierfischen und -vögeln positiv<br />
beeinflussen<br />
• den Ernährungsbedarf der Tiere decken<br />
(Vitamine, Spurenelemente, Aminosäuren)<br />
• die ökologischen Folgen der Tierproduktion<br />
positiv beeinflussen (z. B. Benzoesäure)<br />
• die Leistung oder das Wohlbefinden der Tiere<br />
insbesondere durch Einwirkung auf die Magen- und<br />
Darmflora oder die Verdaulichkeit der Futtermittel<br />
positiv beeinflussen (z. B. organische Säuren,<br />
Enzyme, probiotische Mikroorganismen, sensorische<br />
Zusatzstoffe)<br />
Zusatzstoffe unterliegen innerhalb der EU einem<br />
strengen Zulassungsverfahren, im Zuge dessen neben<br />
der Prüfung der Wirksamkeit auch toxikologische<br />
Aspekte, Auswirkungen auf die Umwelt sowie die<br />
Rückstände des Zusatzstoffes oder seiner Metaboliten<br />
in den Lebensmitteln überprüft werden. Diese Daten<br />
werden von der EFSA, der Europäischen Behörde für<br />
Lebensmittelsicherheit, bewertet. Zusatzstoffe werden<br />
jeweils durch Verordnung der EU für bestimmte Tierarten/Kategorien<br />
zugelassen, wobei auch eventuelle<br />
Maximal- bzw. Minimalwerte im Futtermittel festgelegt<br />
werden. Zugelassene Zusatzstoffe werden in<br />
einem Register veröffentlicht.<br />
15
16<br />
Spurenelemente<br />
Spurenelemente werden von den Tieren nur in<br />
geringsten Konzentrationen (mg/kg Futter) benötigt.<br />
Dazu zählen in erster Linie Eisen (Fe), Kupfer (Cu),<br />
Zink (Zn), Mangan (Mn), Selen (Se), Jod (J), Cobalt<br />
(Co) und Molybdän (Mo). Spurenelemente sind am<br />
Aufbau und der Funktion körpereigener Wirkstoffe wie<br />
Enzyme und Hormone beteiligt und katalysieren somit<br />
wesentliche Stoffwechselvorgänge und Steuerungsmechanismen<br />
im Organismus. Unterversorgung kann von<br />
Mangelerscheinungen bis zu Fruchtbarkeits-<br />
Probenanzahl<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
•<br />
•<br />
Probiotika und Prebiotika<br />
Probiotisch wirkende Mikroorganismen (Milchsäurebakterien,<br />
Bacillussporen und Hefen) siedeln sich in<br />
der Darmflora der Tiere an und unterstützen dort das<br />
natürliche Gleichgewicht. Neben den „PRObiotika“<br />
gewinnen zunehmend „PREbiotika“ an Bedeutung.<br />
störungen führen. Die Versorgung muss die Leistungsansprüche<br />
berücksichtigen; aber auch ein Überangebot<br />
kann schädliche Folgen haben. Deshalb sind<br />
für alle Spurenelemente gesetzliche Höchstwerte<br />
festgelegt, deren Einhaltung laufend durch die <strong>AGES</strong><br />
überprüft wird.<br />
Jährlich werden in der <strong>AGES</strong> durchschnittlich 3.500-<br />
4.000 Spurenelementanalysen in Futtermitteln durchgeführt.<br />
Abb. 4: Anzahl untersuchter Inhaltsstoffe, Mengen- und Spurenelemente in Futtermitteln (2008)<br />
sowie Anzahl der nicht entsprechenden Proben<br />
Tab. 2: Wirkungsweisen von Pre- und Probiotika<br />
Förderung von<br />
Bifido- und Milch-<br />
säurebakterien<br />
Nahrungskonkurrenz<br />
zu Gunsten der erwünschten<br />
•<br />
Keime<br />
• •<br />
•<br />
Rohprotein<br />
Rohasche<br />
Rohfaser<br />
Rohfett<br />
Kalzium<br />
Magnesium<br />
Natrium<br />
Phosphor<br />
Kupfer<br />
Eisen<br />
erwünschte<br />
pH-Absenkung<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Wirkungsweise der Prebiotika<br />
Verdrängung<br />
Zink<br />
Mangan<br />
pathogener Keime<br />
Wirkungsweise der Probiotika<br />
Stimulierung der Bildung<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
körpereigener Enzyme und des<br />
darmassoziierten Immunsystems<br />
•<br />
•<br />
Anzahl Beanstandungen<br />
Probenanzahl<br />
•<br />
Beanstandungen<br />
Prebiotika sind für das Tier unverdauliche Zucker (Oligosaccharide),<br />
die im hinteren Darmtrakt als Nahrung<br />
für die erwünschten Mikroorganismen dienen. Der<br />
Zusatz dieser Stoffe zum Futter bewirkt eine verbesserte<br />
Nährstoffverdauung und steigert die Vitalität und<br />
das Wohlbefinden der Tiere.<br />
verbesserte<br />
Mineralstoff-<br />
aufnahme<br />
Stimulation der<br />
Immunabwehr<br />
Wachstumshemmung<br />
pathogener Keime durch<br />
Blockierung der Plätze an der<br />
Darmwand und durch Stoff-<br />
wechselprodukte der Probiotika
Konservierungsmittel<br />
und Säureregulatoren<br />
Ameisen-, Propion-, Milch- und Citronensäure, aber<br />
auch Benzoe- und Sorbinsäure haben die Aufgabe,<br />
den pH-Wert im Futter und in weiterer Folge auch im<br />
Verdauungstrakt der Tiere zu erniedrigen. Eine schnelle<br />
Absenkung des pH-Wertes im Magen ist Voraussetzung<br />
für eine optimale Proteinverdaulichkeit. Ein<br />
weiterer Effekt besteht in ihrer antimikrobiellen Wirkung<br />
v. a. im Futtermittel selbst, was zu einer verbesserten<br />
hygienischen Futterqualität führt. In feuchten<br />
Futtermitteln wirken sie als Konservierungsmittel.<br />
Tab. 3: Wirkungsweisen von Phytase<br />
bessere<br />
Ausnutzung des<br />
Futters<br />
Einsparung<br />
von zugesetztem<br />
Phosphor<br />
Entscheidend bei der Bestimmung von Enzymen ist<br />
nicht die Menge im Futtermittel, sondern die katalytische<br />
Aktivität (wie viel kann ein Enzym in einer Minute<br />
an Substrat umsetzen bzw. wie viele Spaltprodukte<br />
kann es bilden). Mit einer Farbreaktion ist es möglich,<br />
diese Reaktion zu messen. Österreichweit ist die <strong>AGES</strong><br />
derzeit führend in der Enzymanalytik in Futtermitteln.<br />
Phytase<br />
verbesserte<br />
Knochenkonsistenz<br />
der Tiere, erhöhte<br />
Bruchfestigkeit der<br />
Eierschalen<br />
Enzyme<br />
Enzyme sind Eiweißverbindungen, die chemische<br />
Reaktionen unterstützen und beschleunigen können.<br />
Diese Verbindungen werden zur Verbesserung der<br />
Verdauung eingesetzt. Einerseits zur Unterstützung<br />
körpereigener Enzyme (z. B. Proteasen, Lipasen, ...),<br />
um das z. T. noch suboptimale Verdauungssystem<br />
beim Jungtier zu kompensieren, andererseits durch<br />
Zufuhr nicht oder zuwenig vorhandener Enzyme (z. B.<br />
Phytasen, Xylanasen, Glucanasen, ...), um komplexe,<br />
bislang unverdauliche Futterbestandteile resorbierbar<br />
zu machen. Der Einsatz erstreckt sich auf Jungtiere,<br />
Schweine und Hühner.<br />
In österreichischen Futtermitteln ist das Enzym<br />
„Phytase“ weit verbreitet. Es setzt aus Phytat<br />
Phosphor frei und bewirkt eine Reihe von positiven<br />
Effekten (siehe Tab. 3).<br />
geringere<br />
Phosphorausscheidung<br />
(Schonung der<br />
Umwelt)<br />
Verwertung<br />
gebundener<br />
Spurenelemente<br />
und Proteine<br />
Seit kurzem hat das Institut für Futtermittel als nationales<br />
Referenzlabor (NRL) seine Evaluierungstätigkeit<br />
im EU-Zulassungsverfahren für Zusatzstoffe (v. a.<br />
Enzyme) aufgenommen. Gemeinsam mit dem gemeinschaftlichen<br />
Referenzlabor (CRL) in Geel wird die<br />
Eignung der Nachweismethoden für den Zusatzstoff,<br />
der zur Zulassung eingereicht wurde, beurteilt und<br />
das Ergebnis an die europäische Lebensmittelbehörde<br />
(EFSA) übermittelt.<br />
17
18<br />
Vitamine<br />
Vitamine zählen, wie auch die Mineralstoffe und<br />
Spurenelemente, zu den nicht energieliefernden<br />
Wirkstoffen, die der Mensch und das Tier zur Erhal-<br />
tung seines Lebens und seiner Leistungsfähigkeit<br />
unbedingt benötigen. Sie sorgen grundsätzlich für<br />
das Funktionieren des Stoffwechsels. Ihre vielseitigen<br />
Aufgaben und Funktionen werden in der Tab. 4<br />
Tab. 4: Aufgaben und Funktionen von Vitaminen bei Tieren<br />
dargestellt. In der <strong>AGES</strong> werden pro Jahr durch-<br />
schnittlich 1.450 Vitaminanalysen zur Überprüfung<br />
auf ihren deklarierten Sollgehalt bzw. auf gesetzliche<br />
Höchstgehalte durchgeführt. Die Analytik erfolgt nach<br />
akkreditierter wissenschaftlicher Methodik mittels<br />
HPLC (Hochdruckflüssigkeitschromatographie).<br />
Fettlösliche Vitamine klassische Funktion zusätzlicher Nutzen<br />
A Retinol Epithelschutz Immunität, Genexpression<br />
D3 Calciferol Ca- und P-Stoffwechsel Immunität<br />
E Tocopherol Biologisches Antioxidans Gesundheit, Immunität,<br />
K1 Phyllochinon Blutgerinnung, Knochenstoffwechsel<br />
K3 Menadion Blutgerinnung<br />
Qualität von Fleisch, Milch<br />
und Eiern<br />
-Carotin Provitamin A, Antioxidans Fruchtbarkeit, Immunität<br />
Wasserlösliche Vitamine<br />
B1 Thiamin Kohlenhydratstoffwechsel<br />
B2 Riboflavin Energiestoffwechsel<br />
B6 Pyridoxin Eiweißstoffwechsel Immunität<br />
B12 Cobalamin Blutbildung u. Eiweißstoffwechsel<br />
B3 Niacin (Nikotinsäure) Energiestoffwechsel Stoffwechselstörungen<br />
B5 Pantothensäure Fettstoffwechsel<br />
B7 Biotin Kohlenhydrat- u. Fettstoffwechsel Haut-, Haar- und<br />
Hornqualität<br />
B9 Folsäure Eiweiß- u. Nucleinsäurestoffwechsel Fruchtbarkeit<br />
C Ascorbinsäure Antioxidans Gesundheit, Immunität<br />
Cholin Nervenstystem
Aminosäuren<br />
Aminosäuren sind die wichtigsten Bausteine für das<br />
Körpereiweiß. Der tierische Organismus kann al-<br />
lerdings einige der Aminosäuren nicht selbst syn-<br />
thetisieren und ist auf die Zufuhr über die Nahrung<br />
angewiesen; diese nennt man essentielle Aminosäu-<br />
ren. Sind diese nicht in der erforderlichen Menge im<br />
Futter vorhanden, wirken sie limitierend und werden<br />
deshalb in der Regel handelsüblichen Mischfuttermit-<br />
teln zugesetzt. Das sind v. a. Methionin, Lysin, Threo-<br />
nin und Tryptophan, die industriell (fermentativ durch<br />
Mikroorganismen oder chemisch) hergestellt werden.<br />
Zur Aminosäurenbestimmung werden die Proteine<br />
in Futtermitteln durch Hydrolyse aufgeschlossen (zer-<br />
legt) und die einzelnen Aminosäuren im Aminosäu-<br />
renanalysator gemessen. Die <strong>AGES</strong> ist österreichweit<br />
führend in der Aminosäureanalytik in Futtermitteln,<br />
jährlich werden durchschnittlich 300 Aminosäure-<br />
untersuchungen zur Überprüfung auf deklarierte<br />
Sollgehalte durchgeführt.<br />
Tab. 5: Übersicht über wichtige essentielle Aminosäuren, ihre Funktion bei Tieren und Herstellungsart<br />
Aminosäure physiologische besonders für Herstellung<br />
Bedeutung Herstellung<br />
L-Lysin Enzyme, kollagene Gewebe, wachsende Tiere fermentativ<br />
Verknöcherung<br />
DL-Methionin Enzyme, Peptide, Federprotein, Geflügel, Ferkel synthetisch<br />
Vorstufe für Cystein und Cystin und Kaninchen<br />
L-Threonin Verdauungsenzyme, junge, wachsende fermentativ<br />
Immunsubstanzen, Monogastrier (z. B. Ferkel)<br />
Energiestoffwechsel<br />
L-Tryptophan verschiedenste junge, wachsende fermentativ<br />
Stoffwechselprozesse Monogastrier (z. B. Ferkel)<br />
19
20<br />
unerwünschte<br />
und Verbotene stoffe<br />
Futtermittel können unerwünschte Stoffe ent-<br />
halten, die der Gesundheit der Tiere — oder wegen<br />
ihres Vorhandenseins in tierischen Erzeugnissen – der<br />
menschlichen Gesundheit oder der Umwelt abträglich<br />
sein können. Das Vorkommen unerwünschter Stoffe<br />
in Futtermitteln lässt sich jedoch nicht vollständig<br />
ausschließen, aber es ist wichtig, ihren Gehalt in<br />
Futtermitteln unter Berücksichtigung der akuten To-<br />
xizität, ihrer Fähigkeit zur Bioakkumulation und ihrer<br />
Abbaubarkeit zu bestimmen und soweit herabzu-<br />
setzen, dass keine unerwünschten oder schädlichen<br />
Folgen eintreten. Daher wurden in der Europäischen<br />
Gemeinschaft für die wichtigsten bekannten Stoffe<br />
Grenzwerte (in mehreren Richtlinien) festgelegt,<br />
ab deren Überschreitung Futtermittel nicht mehr<br />
in Verkehr gebracht und verwendet werden dürfen<br />
(Verdünnungsverbot).<br />
Weiters gibt es für Rückstände von Pflanzenschutz-<br />
und Tierarzneimitteln zulässige Höchstwerte in Fut-<br />
termitteln, die garantieren sollen, dass keine dieser<br />
Stoffe in Lebensmittel tierischer Herkunft gelangen<br />
können.<br />
Um die Grundbelastung zukünftig herabzusetzen,<br />
wurden für einige Stoffe (z. B. Dioxin) sogenannte<br />
Aktionswerte festgesetzt, die zwar noch weit unter<br />
den Grenzwerten liegen, ab deren Überschreitung<br />
jedoch umfangreiche Ursachenforschung vorgenommen<br />
werden müssen.<br />
Unter verbotenen Stoffen versteht man bestimmte<br />
Ausgangserzeugnisse, deren Verkehr und Verwendung<br />
als Futtermittel verboten ist. Dazu gehören gemäß<br />
Entscheidung der Kommission Nr. 217/2004/EG:<br />
• Kot, Urin, Inhalte von Verdauungstrakten<br />
• mit Gerbstoffen behandelte Häute und<br />
deren Abfälle<br />
• mit Pflanzenschutzmitteln gebeiztes Saatgut<br />
und Pflanzenvermehrungsmaterial<br />
• mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz<br />
sowie Sägemehl<br />
• Abfallwasser aus Gemeinden, privaten<br />
Haushalten und Industrie<br />
• fester Siedlungsmüll (Hausmüll)<br />
• Verpackung und Verpackungsteile aus<br />
der Agro-Lebensmittelindustrie.<br />
Unbeschadet dieser Regelung gelten andere Gemeinschaftsvorschriften<br />
aus dem Veterinärrecht, insbesondere<br />
das Verbot von tierischen Nebenprodukten<br />
(„Tiermehl“) zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung<br />
von TSE sowie von nicht in der EU zugelassenen<br />
GVO.<br />
In den anschließenden Unterkapiteln werden die<br />
wichtigsten unerwünschten und verbotenen Stoffe in<br />
der Tierernährung abgehandelt.
22<br />
schwermetalle<br />
Zu den Schwermetallen zählt man chemisch alle<br />
Elemente mit einem spezifischen Gewicht von über<br />
5 g/cm 3 . In der Umwelt kommen sie in meist nur<br />
sehr geringen Spuren vor. Gemeinsam ist allen, dass<br />
sie in zu hohen Konzentrationen toxisch wirken.<br />
Einige Schwermetalle (Blei, Quecksilber, Cadmium,<br />
Arsen) gehören in der Tierernährung und futtermit-<br />
telrechtlich in die Gruppe der unerwünschten Stoffe,<br />
da keine essentielle Wirkung für den Stoffwechsel<br />
bekannt ist und höhere Gehalte für Mensch, Tier und<br />
Umwelt schädlich sein können. Im Gegensatz dazu<br />
zählen Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Zink (Zn), Mangan<br />
(Mn), Selen (Se), Kobalt (Co) und Molybdän zu den<br />
essentiellen Spurenelementen, die meist in geringen<br />
Mengen Futtermitteln zugesetzt werden, jedoch alle<br />
mit einem gesetzlichen Höchstwert und unter be-<br />
stimmten Bedingungen zugelassen sind.<br />
Vorkommen im landwirtschaftlichen<br />
Stoffkreislauf<br />
In Futtermittel gelangen die Schwermetalle einerseits<br />
über den landwirtschaftlichen Stoffkreislauf (Boden,<br />
Düngung, etc.), andererseits bei der Herstellung<br />
von Mischfuttermitteln durch die Auswahl der Rohstoffe<br />
und durch die Dosierung von mineralischen<br />
Zusatzstoffen. In Abhängigkeit von Boden und Klima<br />
werden durch die Verwitterung Elemente aus dem<br />
Boden bzw. dem Muttergestein freigesetzt, wo sie<br />
von Pflanzen aufgenommen oder ins Grundwasser<br />
ausgewaschen werden können. Neben den natürlichen<br />
geologisch bedingten Schwermetallgehalten<br />
im Boden ist der Eintrag über die Luft sowie über<br />
Düngemittel, Pflanzenschutzmittel und Abfallstoffe<br />
von wesentlicher Bedeutung für die Gehalte in<br />
pflanzlichen Futtermittel-Ausgangsstoffen. Werden<br />
die Richt- und Grenzwertregelungen für diese Stoffe<br />
nicht eingehalten und belastete Siedlungsabfälle zur<br />
Düngung verwendet, kann der Boden in relativ kurzer<br />
Zeit mit Schwermetallen angereichert werden. Die<br />
Aufnahme von Schwermetallen aus dem Boden in die<br />
Pflanzen ist der bei weitem häufigste Eintritt in die<br />
Nahrungskette. Für die Aufnahme von Schwermetallen<br />
in Pflanzen spielen der Gehalt im Boden sowie die<br />
Bodeneigenschaften pH-Wert, Humus- und Tongehalt<br />
eine maßgebliche Rolle.<br />
Rechtliche Rahmenbedingungen<br />
Um schädliche Wirkungen auf die Gesundheit von<br />
Tier und Mensch zu minimieren, sieht die einschlägige<br />
Gesetzgebung für unerwünschte Elemente wie<br />
Blei (Pb), Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg), Arsen<br />
(As) und Fluor (F) Höchstgehalte in Futtermitteln,<br />
Zusatzstoffen und Vormischungen vor. Die zulässigen<br />
Höchstgehalte werden in der Richtlinie 2002/32/EG<br />
für unerwünschte Stoffe in der Tierernährung geregelt<br />
und sind dort nach dem Verwendungszweck des<br />
Futters und der vorgesehenen Tierart abgestuft.<br />
Tab. 6: Höchstgehalte für unerwünschte Elemente in Futtermitteln (mg/kg) inkl. gesetzlicher Quellenangabe<br />
Alleinfuttermittel Ergänzungs- Mineral- Gesetzliche<br />
futtermittel futtermittel Grundlage<br />
Blei 5 10 15 RL 2005/87/EG<br />
Cadmium 0,5 - 2 0,5 - 2 5 - 7,5 RL 2005/87/EG<br />
Quecksilber 0,1 - 0,4 0,2 - RL 2005/8/EG<br />
Arsen 2 - 4 4 12 RL 2002/32/EG<br />
Fluor 150 bis inkl. 4 %<br />
Phoshor: 500<br />
über 4 % Phosphor:<br />
125 je % P<br />
- RL 2008/76/EG
Untersuchungsmethoden<br />
Üblicherweise werden die unerwünschten Elemente<br />
nach Säureaufschluss oder Druckaufschluss der Pro-<br />
ben im Mikrowellenapparat elementspezifisch durch<br />
verschiedene spektrophotometrische Messverfahren<br />
wie Flammen-AAS, Plasmaemission, Hydridtechnik<br />
und Graphitrohr-AAS bestimmt. Neuerdings verweist<br />
die EU-Richtlinie 2005/87/EG auf Extraktionsverfah-<br />
ren mit verdünnter Salpetersäure (für Pb und Cd)<br />
und verdünnter Salzsäure (für F), die zur Lösung<br />
dieser Elemente in der Matrix Futtermittel anzuwen-<br />
den sind.<br />
Situation in Österreich<br />
Nach dem Futtermittelkontrollplan sind derzeit jähr-<br />
lich rund 600 Proben zur Untersuchung auf Schwer-<br />
metalle und etwa 50 auf Fluor vorgesehen.<br />
Im vorliegenden Bericht werden speziell die Analy-<br />
senergebnisse der unerwünschten Elemente Pb, Cd,<br />
Hg, As und Fluor der letzten Jahre beleuchtet. Bei<br />
allen fünf Schadelementen zeigen die Datensätze<br />
eine stark asymmetrische Verteilung, was bedeutet,<br />
dass der überwiegende Anteil an Kontrollproben<br />
niedrige oder sehr niedrige Schwermetallwerte<br />
aufweist und nur wenige Proben durch höhere Kon-<br />
zentrationen bzw. Höchstgehaltüberschreitungen<br />
auffallen. Viele Gehalte liegen im Bereich der metho-<br />
dischen Nachweisgrenze, und die Medianwerte sind<br />
speziell bei Allein- und Ergänzungsfuttermitteln mit<br />
den Gehalten von unbelastetem Getreide, Obst und<br />
Gemüse vergleichbar. Generell ist festzustellen, dass<br />
die Schwermetallkonzentrationen in Abhängigkeit<br />
vom Futtermitteltyp variieren und in der Reihenfolge<br />
Alleinfuttermittel < Ergänzungsfutter < Mineralfutter<br />
< Vormischungen ansteigen. Die höheren Pb-, Cd-<br />
und As-Gehalte in Mineralfutter und Vormischungen<br />
sind auf die eingesetzten Rohphosphate, Futterkalke<br />
oder sonstigen zugesetzten Mineralstoffe und Spu-<br />
renelemente zurückzuführen. Die vorgeschriebenen<br />
Höchstgehalte werden bei Arsen, Blei und Cadmium<br />
nur in Ausnahmefällen überschritten. Aus den Ergeb-<br />
nissen der Futtermittelkontrolle ist zu schließen, dass<br />
Futtermittel im allgemeinen sehr gering mit Schwer-<br />
metallen belastet sind und die vorgeschriebenen<br />
Höchstgehalte weitgehend eingehalten werden.<br />
Tab. 7: Anzahl der Untersuchungen auf Arsen, Blei, Quecksilber, Cadmium und Fluor (2004 - 2008).<br />
Die in Klammer gesetzten Werte zeigen die Anzahl der Beanstandungen.<br />
Jahr As Pb Hg Cd F<br />
2004 384 (0) 408 (0) 116 (0) 534 (0) 33 (0)<br />
2005 283 (1) 434 (0) 107 (0) 434 (0) 109 (0)<br />
2006 198 (0) 353 (1) 88 (0) 353 (0) 33 (0)<br />
2007 341 (0) 396 (0) 160 (0) 280 (0) 50 (0)<br />
2008 741 (2) 608 (0) 320 (0) 608 (1) 59 (0)<br />
Im Jahr 2005 und 2006 gab es nur je eine einzige<br />
Überschreitung der gesetzlichen Höchstgehalte von<br />
Arsen in Pferdefutter und Blei in Manganoxid. Im<br />
Jahr 2007 gab es keine Überschreitungen. 2008<br />
ergaben sich insgesamt 3 Überschreitungen, einmal<br />
in Form von Cadmium in Dicalciumphosphat sowie<br />
Arsen jeweils einmal in Calciumcarbonat und in<br />
einem Ergänzungsfuttermittel für Schweine.<br />
23
24<br />
mykotoxine<br />
Mykotoxine sind von Pilzen (Feld- und Lagerpilze)<br />
produzierte Stoffwechselprodukte mit unterschied-<br />
licher Human- und Tiertoxizität. Bisher sind über<br />
400 dieser Stoffe bekannt, wobei allerdings nur ein<br />
kleiner Teil in Nahrungs- und Futtermitteln Bedeu-<br />
tung hat. Fast alle Mykotoxine sind weitgehend hitze-<br />
und säurestabil und werden bei der Nahrungs- und<br />
Futtermittelverarbeitung in der Regel nicht zerstört.<br />
Vorkommen und Bedeutung<br />
Etwa 20 % der Getreideernte der EU enthalten mess-<br />
bare Mengen von Mykotoxinen. Besonders Getreide<br />
und Mais werden bereits am Feld von Schimmelpilzen<br />
der Gattung Fusarium befallen, wodurch das Erntegut<br />
in Folge mit Mykotoxinen kontaminiert sein kann.<br />
Bei Verfütterung von solchem Getreide sind Nutztiere<br />
(Schwein, Geflügel und Pferd), insbesonders Jung-<br />
tiere gefährdet. Kontaminiertes Futter ist für eine<br />
Reihe von Erkrankungen verantwortlich, wie z. B.<br />
das Östrogensyndrom bei Schweinen sowie Futter-<br />
verweigerung oder Erkrankung von Geflügel. Die<br />
Wirkung der Mykotoxine kann dabei, abhängig<br />
von der Toxinart, akut oder chronisch toxisch sein.<br />
Symptome der akuten Vergiftung bei Tieren sind<br />
z. B. Leber- und Nierenschädigungen, Angriffe auf<br />
das zentrale Nervensystem, Haut- und Schleimhaut-<br />
schäden, Beeinträchtigung des Immunsystems oder<br />
hormonähnliche Effekte. Auch können bereits kleine<br />
Toxinmengen, die noch keine oder geringe Krank-<br />
heitssymptome auslösen, krebserzeugend (karzi-<br />
nogen) sein, Erbschäden bewirken (mutagen) oder<br />
zu Missbildungen beim Embryo führen (teratogen).<br />
Während Mykotoxinvergiftungen früher bei Mensch<br />
und Tier eine häufige Krankheitsursache waren, die<br />
nicht selten sogar zum Tode führte (z. B. Mutterkorn-<br />
vergiftungen), stellen Mykotoxine heute aufgrund<br />
einer hochwertigen Lebensmittel- und Futtermittel-<br />
herstellung keine akute Bedrohung mehr für Mensch<br />
und Tier dar. Heute steht die Minimierung des Myko-<br />
toxinrisikos, welches auch nicht akute Auswirkungen<br />
berücksichtigt, im Vordergrund. Sie wird sowohl<br />
durch Höchst- und Richtwerteregelungen als auch<br />
durch Vermeidungsstrategien bei der Erzeugung von<br />
Futter- und Nahrungsmitteln angestrebt.<br />
Gesetzliche Regelungen für Futtermittel<br />
In Futtermitteln sind gegenwärtig Aflatoxin B1<br />
durch Grenzwerte sowie Deoxynivalenol (Vomitoxin),<br />
Zearalenon, Ochratoxin A und die Fumonisine durch<br />
Richtwerte geregelt. Generell ist zwischen Höchst-<br />
wert und Richtwert zu unterscheiden.<br />
Während die Überschreitung eines Höchstwertes<br />
u.a. ein Vermischungsverbot nach sich zieht, ist bei<br />
Überschreitung eines Richtwertes eine Verdünnung<br />
(Vermischung) mit weniger kontaminiertem Material<br />
erlaubt (Empfehlung der Kommission 2006/ 576/EG<br />
und Richtlinien 2002/32/EG und 2003/100/EG). Wei-<br />
ters sollen durch den Höchstwert für einen Mutter-<br />
kornanteil bei ungemahlenem Getreide indirekt das<br />
Vorkommen von Ergotalkaloiden in Futtermitteln<br />
minimiert bzw. verhindert werden.<br />
Situation in Österreich<br />
In Österreich tritt die Mykotoxinproblematik –<br />
wetterabhängig – vor allem am Feld auf. Besonders<br />
betroffen sind Getreide (Weizen, Triticale, Hafer) und<br />
Mais, welche hauptsächlich durch den Befall mit den<br />
Feldpilzen der Gattung Fusarium mit Mykotoxinen<br />
kontaminiert werden. Deoxynivalenol und Zearalenon<br />
waren in den letzten 3 Jahren die am häufigsten<br />
nachweisbaren Mykotoxine in unverarbeitetem Ge-<br />
treide (inkl. Mais).<br />
Im vergangenen Jahr gab es nur 1 Überschreitung<br />
des empfohlenen Richtwertes von Deoxynivalenol in<br />
einer Mais-Probe (Futtermittelausgangserzeugnis).<br />
Deoxynivalenol (DON)<br />
DON war in den letzten Jahren in unverarbeitetem<br />
Getreide (exkl. Mais) im Durchschnitt bei 60 % und<br />
bei unverarbeitetem Mais (Körner) bei ca. 95 % der<br />
Proben quantifizierbar.<br />
Die untersuchten Getreidearten können bezüglich des<br />
Auftretens einer quantifizierbaren DON Kontaminati-<br />
on folgendermaßen gereiht werden: Mais > Weizen,<br />
Triticale > Gerste, Roggen, Hafer. Im Rahmen der<br />
Futtermittelproduktion können durch Vermischung<br />
von belasteter mit unbelasteter Ware oder durch<br />
Einsatz von wenig kontaminierten Ausgangsstoffen<br />
akzeptable Futtermittel erzeugt werden.
Verpilzter Weizen<br />
Abbildung 4 gibt einen allgemeinen Überblick über<br />
DON-Bereiche in Einzel- und Mischfuttermitteln auf<br />
Getreide- oder Maisbasis, ohne dabei die tierspezi-<br />
fische Verwendung zu berücksichtigen. So würden<br />
nahezu 100 % der Mischfuttermittel unter dem Richt-<br />
wert für Kälber, Lämmer und Ziegenlämmer (
26<br />
Zearalenon (ZON)<br />
In unverarbeitetem Getreide (exkl. Mais) war ZON in<br />
den letzten Jahren kaum quantifizierbar. Unverarbei-<br />
tete Maiskörner enthielten hingegen in den letzten 5<br />
Jahren häufig ZON (im Durchschnitt bei rund 70 %<br />
der Proben nachweisbar). Eine direkte Verwendung<br />
der unverarbeiteten Maiskörner als Alleinfuttermittel<br />
für Ferkel und Jungsauen kann problematisch sein,<br />
da jahrabhängig eine deutliche Anzahl zur Verfütte-<br />
rung nicht geeignet sein kann (Schwankungsbereich<br />
der letzten 5 Jahre: 8 bis 60 %). Der Richtwert für<br />
Futtermittel-Ausgangsstoffe (2000 ppb) wurde hinge-<br />
gen von keiner Probe erreicht.<br />
Abb. 5 gibt einen allgemeinen Überblick über<br />
ZON-Bereiche in Futtermitteln auf Getreide- oder<br />
Maisbasis, ohne dabei die tierspezifische Verwendung<br />
zu berücksichtigen. Danach liegen nahezu 100 %<br />
unter dem Richtwert (< 500 ppb) für Kälber, Schafe<br />
und Ziegen, mehr als 97 % unter jenem für Sauen<br />
und Mastschweine (< 250 ppb) und ca. 91 % unter<br />
ZON in Futtermitteln (2008, n = 439)<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
< 20 < 100 < 250 < 500 < 2000<br />
µg/kg<br />
Abb. 5: ZON in Futtermitteln<br />
%<br />
Einzel FM<br />
Misch FM<br />
dem Richtwert (< 100 ppb) für Ferkel und Jungsauen<br />
(empfindlichste Tierkategorie).<br />
Zwischen Einzelfuttermitteln und Mischfuttermitteln<br />
besteht nach dieser Betrachtungsweise kein signifi-<br />
kanter Unterschied.<br />
Fumonisine, Aflatoxine und Ochratoxin A<br />
Fumonisine werden jahrabhängig in sehr unter-<br />
schiedlichem Maße in unverarbeiteten heimischen<br />
Maiskörnern nachgewiesen. Die Quantifizierungsrate<br />
der letzten Jahre liegt zwischen 10 und 30 %. Die<br />
Gehalte liegen in allen Fällen meist weit unter den<br />
vorgesehenen Höchst- bzw. Richtwerten.<br />
Prävention und Ausblick<br />
Grundlage einer guten Futterqualität im Hinblick auf<br />
unbedenkliche Mykotoxingehalte sind sowohl eine<br />
gute landwirtschaftliche Praxis bei der Produktion der<br />
Ausgangserzeugnisse (Getreide und Mais) als auch<br />
eine qualitätskontrollierte Produktion von Futtermit-<br />
teln. Während es für die Produktion von Getreide<br />
(exkl. Mais) bereits zielführende Strategien zur Ver-<br />
minderung des Mykotoxinproblems gibt, bedarf es für<br />
Mais noch näherer Untersuchungen, um weitgehend<br />
unbedenkliche Futtermittel-Ausgangserzeugnisse zu<br />
produzieren. Die Futtermittelerzeuger und -händler<br />
müssen in weiterer Folge durch Anwendung von Qua-<br />
litätssicherungsprogrammen für zumindest mykoto-<br />
xinarme und gesetzeskonforme Futtermittel sorgen.
pflanzenschutzmittelrückstände<br />
Pflanzenschutzmittel sind chemische oder biologische<br />
Wirkstoffe und Zubereitungen, die dazu bestimmt sind,<br />
• Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse vor Schadorga-<br />
nismen (z. B. Schadinsekten, phytopathogene Pilze)<br />
zu schützen oder deren Einwirkungen vorzubeugen,<br />
• in einer anderen Weise als ein Wirkstoff die Lebensvorgänge<br />
von Pflanzen zu beeinflussen (z. B. Wachstumsregler),<br />
• unerwünschte Pflanzen oder Pflanzenteile zu<br />
vernichten oder ein unerwünschtes Wachstum<br />
von Pflanzen zu hemmen oder einem solchen<br />
Wachstum vorzubeugen (z. B. Unkraut).<br />
Sie erfüllen im Pflanzenbereich im weitesten Sinne<br />
eine vergleichbare Aufgabe wie Medikamente in der<br />
Medizin. Gemeinsam mit Vorratsschutzmitteln werden<br />
sie auch als Pestizide bezeichnet.<br />
Gesetzliche Aspekte/Regelungen<br />
Pflanzenschutzmittelrückstände sind in Lebens- und<br />
Futtermitteln grundsätzlich unerwünscht, sie sind aber<br />
trotz guter landwirtschaftlicher Praxis nicht ganz vermeidbar.<br />
Daher ist ihre maximal zulässige Konzentration<br />
in Lebens- und Futtermitteln durch die Verordnung<br />
(EG) Nr. 396/2005 und ihre Anhänge geregelt. Die<br />
Anhänge, die die einzelnen Höchstmengen im Detail<br />
anführen, sind ab 1.9.2008 EU-weit gültig.<br />
Ist die Datenlage bezüglich des Verhaltens der Wirksubstanz<br />
des Pflanzenschutzmittels in der Pflanze, im<br />
tierischen Organismus, in der Umwelt und bezüglich<br />
seiner möglichen Auswirkung auf die Gesundheit<br />
von Mensch und Tier vollständig und ausreichend,<br />
wird auf europäischer oder nationaler Ebene ein<br />
zulässiger Höchstwert festgelegt. Dieser Höchstwert<br />
gewährleistet die „Verzehrs-Sicherheit“ der erzeugten<br />
pflanzlichen oder tierischen Produkte. Bei nicht ausreichender<br />
Datenlage wird der Höchstwert mit der<br />
„Bestimmungsgrenze“ von Kontrolllaboratorien im<br />
Routinebetrieb gleichgesetzt (niedrigste messbare<br />
Konzentration). Bei Futtermitteln geht es primär um<br />
die Gesundheit der Tiere, aber in Folge auch um die<br />
Sicherheit tierischer Lebensmittel wie z. B. Fleisch,<br />
Eier, Milch.<br />
Bestimmte Pflanzenschutzmittelrückstände sind<br />
besonders „unerwünschte“ Stoffe, vor allem solche,<br />
deren Persistenz gegen biologische Abbauvorgänge im<br />
Verein mit einer guten Fettlöslichkeit eine verstärkte<br />
so genannte „Bioakkumulierbarkeit“ bewirken, sodass<br />
eine Anreicherung in der Nahrungskette die Folge ist.<br />
Dazu zählen die schon lang verbotenen Alt-Pestizide<br />
wie zum Beispiel DDT, Chlordane, Dieldrin oder Endrin.<br />
Diese Substanzen wurden wegen ihrer geringen akuten<br />
Giftigkeit jahrelang erfolgreich und daher massiv<br />
eingesetzt. Auch auf Rückstände der Klasse der<br />
Polychlorierten Biphenyle (PCB), die z. B. als Trafoöle<br />
verwendet wurden, und bestimmter Vorratsschutzmittel<br />
werden unsere Futtermittel untersucht.<br />
Geringfügige, jedoch messbare Rückstände (unter 0,1<br />
mg/kg) von Vorratsschutzmitteln lassen sich zum Unterschied<br />
von anderen Rückständen immer wieder vor<br />
allem in Getreide und getreidehaltigen Futtermitteln<br />
finden. Vorratsschutzmittel werden ja erst nach der<br />
Ernte angewendet, im Unterschied zu den „Altpestiziden“<br />
reichern sich die heutigen Vorratsschutzmittel<br />
NICHT in der Nahrungskette an, sondern werden im<br />
tierischen Körper um- und abgebaut oder so rasch<br />
ausgeschieden, dass zum Beispiel im Fleisch oder in<br />
der Milch keine Rückstände mehr zu finden sind. In<br />
Biobetrieben ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln<br />
bis auf ganz wenige Wirkstoffe natürlichen Ursprungs<br />
verboten, und es gelten für alle Ernteprodukte,<br />
Lebens- und Futtermittel Grenzwerte bei 0,01 mg/kg<br />
oder darunter.<br />
Das Kompetenzentrum für Rückstandsanalytik der<br />
<strong>AGES</strong> ist nationales Referenzlabor für Getreide und<br />
Futtermittel. Eine europaweite Vernetzung mit allen<br />
anderen vergleichbaren Labors der EU und mit dem<br />
zentralen EU-Referenzlabor in Dänemark sowie permanenter<br />
Wissens- und Erfahrungsaustausch garantieren<br />
europaweit ein hohes Maß an Futtermittelsicherheit<br />
auf dem Gebiet der Pestizidrückstände.<br />
27
28<br />
Rückstandsanalytik<br />
Futtermittel sind vielseitig und unterschiedlich und<br />
reichen vom Futterfett über Mineral- und Heimtierfut-<br />
ter bis zum Heu. Meist erfolgt zuerst eine Extraktion<br />
des Futtermittels mit einem organischen Lösungsmit-<br />
telgemisch, um möglichst viele der gesuchten Verbin-<br />
dungen in eine Lösung zu bekommen.<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
Abb. 6: Kontrollproben Pestizidrückstände 1997 - 2008<br />
Situation in Österreich<br />
Seit 1997 wurden insgesamt 2.052 stichprobenartig<br />
gezogene Futtermittelkontrollproben auf Pestizidrückstände<br />
untersucht, davon allein 541 im Jahr 2008.<br />
In keinem einzigen Fall konnten bedenkliche Rückstände<br />
bzw. Überschreitungen von Höchstwerten festgestellt<br />
werden. Die hohe Anzahl der Proben im Jahr<br />
2002 wurde durch den „Nitrofen-Skandal“ in Deutschland<br />
verursacht. Die Ausweitung des Stichprobenumfanges<br />
im Jahr 2008 erfolgte risikobasiert und wurde<br />
gemäß dem mehrjährigen integrierten Kontrollplan<br />
mit dem Bereich Daten, Statistik und Risikobewertung<br />
(DSR) abgestimmt.<br />
Nach einer Reinigung und Konzentrierung des Ex-<br />
traktes erfolgt die Bestimmung mit der Massenspek-<br />
trometrie. Die ausgewerteten Messergebnisse werden<br />
mit gesetzlichen Grenzwerten oder sonstigen Richt-<br />
werten verglichen.<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008<br />
Probenzahl<br />
Zusätzlich wurden im Jahr 2008 am Kompetenzzentrum<br />
für Rückstandsanalytik in Wien aufgrund des<br />
Melaminskandals in China insgesamt 34 Futtermittel<br />
(v. a. milchpulver- oder sojahältige sowie proteinreiche<br />
Futtermittel) auf Melamin untersucht. Alle Ergebnisse<br />
lagen unter dem per Entscheidung der Europäischen<br />
Kommission 2008/798/EG festgesetzten Grenzwert<br />
von 2,5 mg/kg. In einer Futtermittelprobe (Süßmolkepulver<br />
aus Kroatien) konnten Spuren von Cyanursäure<br />
‒ ein mögliches Melamin-Derivat ‒ entdeckt werden.<br />
Nach umfangreichen Recherchen im Herkunftsland<br />
konnten Reste von Desinfektionsmitteln als Ursache<br />
für die Kontamination gefunden werden.
salmonellen<br />
Salmonellen sind bewegliche, stäbchenförmige Bak-<br />
terien aus der Familie der Enterobacteriaceae. Sal-<br />
monella (S.) spp. ist der Erreger einer Krankheit, der<br />
Salmonellose, die sowohl Tiere als auch Menschen<br />
betreffen kann.<br />
Vorkommen<br />
Salmonellen sind Keime mit vielfältigen Übertragungs-<br />
wegen. Die Einschleppung in einen Betrieb geschieht<br />
meist über Trägertiere oder Futtermittel, ist aber auch<br />
über Menschen, Schadnager und Vögel (Möwen!) oder<br />
Überschwemmungen einer Weide möglich. Heu von<br />
Wiesen, die mit kontaminierter Gülle gedüngt wur-<br />
den, ist ungefährlich, nicht aber das Grünfutter. Den<br />
Silierprozess überleben Salmonellen dagegen nicht.<br />
Salmonellen wachsen generell in einem Temperaturbe-<br />
reich von 10 - 47° C und werden durch Einfrieren nicht<br />
abgetötet. Als weitgehend gesicherte Keimabtötung<br />
gilt ein Erhitzen auf über 70° C für mindestens 15 sec.<br />
Ordnungsgemäßes Pelletieren unter der Verwendung<br />
von Heißdampf führt somit zu einer Abtötung von<br />
Salmonellen und damit zu einer Hygienisierung von<br />
Futtermitteln. Bei Hühnern bleibt die Salmonellenbe-<br />
siedelung oft verborgen, sodass mitunter ganze<br />
Herden von Legehennen zu unbemerkten Daueraus-<br />
scheidern werden.<br />
Gesetzliche Rahmenbedingungen<br />
Im Rahmen des bundesweit einheitlichen risikoba-<br />
sierten Stichprobenplanes werden am Bauernhof, bei<br />
Futtermittelproduzenten und in Handelsbetrieben Pro-<br />
ben gezogen. Auf Salmonellen werden sowohl fertige<br />
Futtermittelmischungen (z. B. Geflügelfutter) als auch<br />
ausgewählte Einzelfuttermittel (z. B. Soja- und Raps-<br />
schrot, Fischmehl) amtlich untersucht.<br />
Untersuchungsmethode, Diagnostik<br />
Futtermittelproben werden zur Voranreicherung von<br />
Salmonellen mit gepuffertem Peptonwasser versetzt<br />
und bebrütet. Daraus werden zur selektiven Anrei-<br />
cherung der Salmonellen zwei Selektivnährlösungen<br />
beimpft. Nach entsprechender Bebrütung werden von<br />
jeder Selektivanreicherung Verdünnungsausstriche auf<br />
Selektivagar angelegt. Die Ausstrichplatten werden<br />
bebrütet und auf salmonellenverdächtige Kolonien<br />
untersucht. Typische oder verdächtig aussehende<br />
Kolonien sind durch nachfolgende biochemische und<br />
serologische Tests zu bestätigen.<br />
Serotypisierung und Phagentypisierung<br />
Die Typisierungen aller Salmonellen erfolgen im Natio-<br />
nalen Referenzlabor der <strong>AGES</strong> für Salmonellen in Graz<br />
mittels Serotypisierung nach dem Kaufmann-White-<br />
Schema, eine weitere Differenzierung wird mittels<br />
Bakteriophagen in Phagentypen (PT) bei S. Enteriti-<br />
dis und in definitive Typen (DT) bei S. Typhimurium<br />
durchgeführt.<br />
Situation in Österreich<br />
In den Jahren 2003 bis 2008 wurden insgesamt<br />
2.090 Futtermittelproben für Nutztiere auf Salmonellen<br />
untersucht (siehe Tab. 8). Im Jahr 2008 wurden bei<br />
458 amtlich untersuchten Futtermittelproben 7 positive<br />
Ergebnisse ermittelt (4x Sojaschrot, 1x Tiermehl,<br />
1x Schweinefutter, 1x Geflügelfutter). Im Zeitraum<br />
2003 bis 2008 wurden S. Montevideo, S. Senftenberg,<br />
S. Agona, S. Mbandaka und S. Tennessee als häufigste<br />
Salmonellen-Serotypen in Futtermitteln festgestellt.<br />
Situation im europäischen Vergleich<br />
Der für Österreich ermittelte Anteil salmonellenposi-<br />
tiver Futtermittel entspricht somit in groben Zügen<br />
etwa dem EU-Durchschnitt (Europäischer Zoonosen-<br />
trendbericht 2006 der EFSA; Daten bezogen auf<br />
EU-23). Verglichen mit einer deutlich geringeren<br />
Nachweisrate einiger anderer Mitgliedsstaaten, die bei<br />
vergleichbarem Probenumfang für das Jahr 2006 bei<br />
Mischfutter keinen einzigen positiven Nachweis berich-<br />
ten, scheint allerdings die Salmonellensituation bei<br />
Futtermitteln auch in Österreich noch weiter opti-<br />
mierbar. Europaweit hat sich Heimtierfutter als ein<br />
mögliches Problemfeld im Futtermittelbereich heraus-<br />
gestellt, wobei sich in Österreich im Untersuchungs-<br />
zeitraum 2004 bis 2008 für Mischfuttermittel 10,5 %<br />
(10 von 95 Proben) und für Kauspielzeug 17,6 % (18<br />
von 102 Proben) der untersuchten Chargen als salmo-<br />
nellenpositiv erwiesen. Die häufigsten Salmonellen-<br />
Serotypen waren für diese Futterkategorien S. Infantis<br />
und S. Typhimurium.<br />
Im Berichtsjahr 2008 ist in Österreich die Kontami-<br />
nationsrate bei allen Futterkategorien mit relevanten<br />
Probenzahlen, verglichen mit Untersuchungen der ver-<br />
gangenen Jahre (zusammengefasst nach Perioden von<br />
1998 bis 2002 bzw. von 2003 bis 2007) ganz erheblich<br />
zurückgegangen (siehe Tab. 8 und Abb. 7).<br />
29
30<br />
Diese für Österreich positive Entwicklung steht<br />
bezüglich Cerealien und Ölsaaten sowie den daraus<br />
gewonnenen Nachprodukten im Einklang mit dem<br />
Europäischen Zoonosentrendbericht, der für diese<br />
Produkte ebenfalls einen Rückgang salmonellenpo-<br />
sitiver Chargen feststellt. Die Kontaminationsrate<br />
von Mischfutter zeigt im europäischen Durchschnitt<br />
dagegen keine relevante Veränderung gegenüber den<br />
Vorjahren.<br />
Tab 8: Untersuchung von Nutztierfutter im Rahmen der amtlichen Futtermittelkontrolle,<br />
Ergebnisvergleich 1998 - 2002 vs. 2003 - 2007 und 2008<br />
Probenanzahl<br />
Amtliche Untersuchungen Untersuchungen Untersuchungen<br />
Kontrolle 1998 - 2002 2003 - 2007 2008<br />
Proben<br />
Einzelfutter<br />
tier.<br />
Ursprungs<br />
getestet positiv % getestet positiv % getestet positiv %<br />
Fischmehl 94 14 14,9 % 41 4 9,8 % 10 0<br />
Tiermehl<br />
Einzelfutter<br />
pflanzl.<br />
Ursprungs<br />
1 1 100 %<br />
Getreide 57 1 1,8 % 87 1 1,1 % 7 0<br />
Ölsaaten<br />
Mischfutter<br />
Tierkategorie<br />
222 24 10,8 % 316 15 4,7 % 121 4 3,3 %<br />
Rinder 17 0 75 0 30 0<br />
Schweine 46 2 4,3 % 90 2 2,2 % 63 1 1,6 %<br />
Geflügel 622 26 4,2 % 1.023 6 0,6 % 204 1 0,5 %<br />
andere<br />
Nutztiere<br />
22 0<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
•<br />
14<br />
12<br />
10<br />
•<br />
8<br />
• •<br />
•<br />
•<br />
6<br />
4<br />
• •<br />
• • •<br />
2<br />
0<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008<br />
Abb. 7: Anzahl getesteter Futtermittelproben in Österreich von 1998 bis 2008<br />
und prozentualer Nachweis von Salmonella spp.<br />
Positive Proben<br />
Probenanzahl<br />
• Proben positiv
Vermeidungsstrategien<br />
und Kontrollmaßnahmen<br />
Verschiedene Faktoren dürften zu der zuletzt für<br />
Österreich beobachteten starken Reduktion der Nachweisrate<br />
von Salmonellen in allen Futterkategorien<br />
beigetragen haben. Gesetzliche Vorgaben brachten<br />
eine höhere Eigenverantwortung der Futtermittelwirtschaft<br />
mit sich und verpflichten die Unternehmen unter<br />
anderem zu verstärkter Eigenkontrolle, Aufbewahrung<br />
von Rückstellmustern, Rückverfolgbarkeit, Anwendung<br />
der HACCP-Grundsätze und zur Durchführung grundlegender<br />
Hygienemaßnahmen.<br />
Salmonellen-Vorsorge, Prophylaxe<br />
Eiweißreiche Futtermittel bieten Salmonellen bei<br />
mangelhaften hygienischen Bedingungen ausgezeichnete<br />
Vermehrungsbedingungen und sind somit ein<br />
möglicher Risikofaktor für Salmonelleninfektionen von<br />
Heim- und Nutztieren. Die Senkung von Salmonellosen<br />
erfordert ein konzertiertes Vorgehen und geeignete Bekämpfungsmaßnahmen<br />
auf allen Stufen der Nahrungsmittelkette,<br />
d. h. sowohl bei der Produktion und Verarbeitung<br />
von Futtermitteln, in den landwirtschaftlichen<br />
Betrieben, als auch bei der Lebensmittelherstellung<br />
und im Handel sowie auf Verbraucherebene. Kontrollen<br />
zum Schutz von Verbrauchern sind notwendig,<br />
da grundsätzlich alle Salmonella-Serovare auch auf<br />
den Menschen übertragen werden und Erkrankungen<br />
auslösen können.<br />
Grundsätzlich sollten zumindest folgende Maßnahmen<br />
am landwirtschaftlichen Betrieb bzw.<br />
bei der gewerblichen Futterproduktion zur Vermeidung<br />
von Salmonellen durchgeführt werden:<br />
• Schädlingsbekämpfung (einschließlich Vorratsschädlinge,<br />
Vögel, Schadnager)<br />
• Optimierung der Betriebs-, Stall- bzw. Futterhygiene<br />
bei der Herstellung und Fütterung<br />
• Vermeidung des vertikalen Eintrags (Mutter auf<br />
Jungtiere), wie kein Mischen von Gruppen,<br />
konsequente Rein-Raus-Belegung<br />
• regelmäßige Entnahme von Futterproben, ev. der<br />
Einsatz von Futtersäuren und eine Kontrolle von<br />
Vermahlungsgrad bzw. Struktur des Futters<br />
• Analyse des möglichen Eintrags durch Rohstoffmonitoring,<br />
Nachvollziehbarkeit der Warenströme<br />
über alle Produktions- und Verarbeitungsstufen<br />
• Chargenbildung bei Fertigfutter; ordnungsgemäße<br />
Lagerung unter Vermeidung von Verschleppungen<br />
und Verhinderung von Kreuz- bzw. Rekontaminationen<br />
• Endproduktkontrolle und Entnahme von<br />
Rückstellmustern<br />
• möglichst eine thermische Behandlung<br />
(wie etwa Heißpelletierung, Expander- oder<br />
Extrudertechnologien) von Geflügelfutter und/oder<br />
Einsatz von organischen Säuren.<br />
Mindestmaßnahmen im Fall<br />
festgestellter Kontamination<br />
• Durchführung von Reinigungs- und Dekontaminationsmaßnahmen<br />
nach einem Reinigungsplan<br />
• Entsorgung oder andere Verwendung kontaminierter<br />
Produkte<br />
• betriebliche Maßnahmen zur künftigen Vermeidung<br />
von Kontaminationen<br />
• Verständigung der Abnehmer und gegebenenfalls<br />
Rückholaktion<br />
• Ursachenforschung und Eliminierung der Quelle<br />
31
32<br />
gentechnisch veränderte<br />
organismen (gVo)<br />
Pflanzen, Tiere oder Mikroorganismen, deren Erb-<br />
material mittels Gentechnik verändert wurde, nennt<br />
man gentechnisch veränderte Organismen (GVO).<br />
Vorkommen<br />
Ein Großteil unserer Lebens- und Futtermittel wird<br />
aus Pflanzen und Tieren gewonnen, die seit Hun-<br />
derten von Jahren von Menschen gezüchtet werden.<br />
Nur jene mit erwünschten Merkmalen wurden zur<br />
Züchtung der nächsten Generation ausgewählt.<br />
Dadurch hat sich das Erbmaterial von Pflanzen und<br />
Tieren stark verändert. Die gewünschten Merkmale<br />
wurden allerdings durch eine natürlich auftretende<br />
genetische Variation erzielt. Seit einigen Jahren<br />
kann genetisches Material (DNA) lebender Zellen<br />
und Organismen mit Hilfe der Gentechnik verändert<br />
werden. Durch die „grüne Gentechnik“ wurden vor<br />
allem Pflanzensorten gezüchtet, die wesentlich wider-<br />
standsfähiger gegen bestimmte Pflanzenkrankheiten<br />
oder Schädlinge, oder die auch ertragreicher (ver-<br />
glichen mit konventionellen Sorten) sind. In der Fut-<br />
termittelproduktion nimmt v. a. Sojaschrot aufgrund<br />
des hohen Proteingehalts (44 - 48 %) eine wichtige<br />
Rolle ein, wobei derzeit ca. 90 % aus gentechnisch<br />
veränderten Sojabohnen stammt.<br />
Sojaschrot ist wichtigstes Eiweißfuttermittel der EU<br />
und deckt damit 50 bis 55 Prozent des Gesamtver-<br />
brauchs an eiweißhaltigen Futtermitteln. Ohne die<br />
Einfuhr von Sojaschrot könnte Europa die Produktion<br />
tierischer Lebensmittel wie Fleisch, Eier oder Milch<br />
auf dem derzeitigen Niveau nicht beibehalten. Die<br />
Abhängigkeit von Futtermittelimporten verschärfte<br />
sich noch, als 2001 die Verfütterung von Tiermehl<br />
aufgrund der BSE-Krise für alle Tierarten verboten<br />
wurde. Weitere Pflanzenarten, die als GVO in Futter-<br />
mitteln vorkommen können, sind vor allem Mais und<br />
Raps, aber auch Baumwollsaat, Reis und Pressschnit-<br />
zel aus Zuckerrüben.<br />
Aber auch verschiedene Zusatzstoffe in Futtermitteln<br />
können mit Hilfe gentechnisch veränderter Mikro-<br />
organismen erzeugt werden, etwa Vitamine<br />
(z. B. Vitamin B2, B12), Aminosäuren (z. B. Lysin,<br />
Threonin, Tryptophan) und Enzyme (z. B. Phytasen).<br />
Gesetzliche Basis<br />
Die Europäische Gemeinschaft hat sich dafür ausge-<br />
sprochen, GVO in der Landwirtschaft und Lebens-<br />
mittelerzeugung unter bestimmten Bedingungen<br />
grundsätzlich zu erlauben. Damit jedoch die höchst-<br />
mögliche Sicherheit bei Verwendung von GVO gege-<br />
ben ist, bedarf jedes Produkt einer eigenen Geneh-<br />
migung. Der Anbau von gentechnisch veränderten<br />
Pflanzen nimmt derzeit weltweit weiter zu. Die Anzahl<br />
an zugelassenen gv-Pflanzen hat die 100 längst<br />
überschritten, ein Großteil davon kann für Lebensmit-<br />
tel- und/oder Futtermittelzwecke verwendet werden.<br />
Neben der steigenden Anbaufläche ist weiterhin auch<br />
mit einer deutlichen Zunahme an Zulassungsanträgen<br />
zu rechnen. Seit April 2004 wurden ca. 75 Zulas-<br />
sungsanträge nach VO (EG) 1829/2003 gestellt. Eine<br />
Zulassung wird nur dann erteilt, wenn das Produkt<br />
sicher ist und der Gebrauch weder schädliche Aus-<br />
wirkungen für die Gesundheit von Menschen und<br />
Tieren noch für die Umwelt mit sich bringt. Anbau<br />
und Umgang mit gv-Pflanzen dürfen nicht zu einer<br />
unkontrollierten Vermischung mit der konventionellen<br />
Produktion führen. Für Futtermittel gilt, dass ab einer<br />
Überschreitung des Schwellenwertes von 0,9 %<br />
mit zufälligen und technisch nicht vermeidbaren<br />
GVO dies auf der Kennzeichnung des betreffenden<br />
Futtermittels gemäß VO (EG) 1829/2003 eindeutig zu<br />
deklarieren ist. Bis jetzt konnte ein Anbau von GVO in<br />
Österreich durch die bestehenden Import- bzw. An-<br />
bauverbote für gv-Maislinien rechtlich hintan gehal-<br />
ten werden. Auch wenn die Europäische Kommission<br />
nun im Mai 2008 das österreichische Importverbot<br />
von gentechnisch veränderten Mais MON 810 und<br />
T25 für die Verarbeitung zu Lebens- und/oder Fut-<br />
termitteln aufgehoben hat, konnte das Importverbot<br />
für den Anbau in Österreich aufrecht erhalten werden<br />
(Stand 02.03.2009).<br />
Das Inverkehrbringen von gentechnisch verändertem<br />
Raps aus den Ölrapslinien Ms8, Rf3 und Ms8xRf3<br />
und gentechnisch verändertem Mais der Linie MON<br />
863 wurde im Juli 2008 per Verordnung in Österreich<br />
verboten, gleichzeitig wurde aber das Verbot des In-<br />
verkehrbringens von gentechnisch verändertem Mais<br />
Bt176 aufgehoben (246. und 247. Verordnung).
Tab. 9: Derzeit in der EU zugelassene GVO (Stand März 2009)<br />
Zulassungen<br />
Mais (12) Baumwolle (6) Raps (3) Sojabohne (3)<br />
59122 LL Cotton 25 T45 MON40-3-2<br />
Bt11 MON1445 MS8xRF3 (=RR Soja)*<br />
GA21 MON15985 GT73 A2704-12 (LL-Soja)**<br />
MON810 MON1445 x MON15985 MON89788<br />
MON863 MON531<br />
NK603 MON531 x MON1445 *Roundup Ready<br />
T25<br />
1507<br />
1507 x NK603<br />
NK603 x MON810<br />
MON863 x MON810<br />
MON863 x NK603<br />
**Liberty Link<br />
Tab. 10: Inverkehrbringung, Verbot der Inverkehrbringung und Anbauverbot von in der<br />
EU zugelassenen GVO ‒ Situation in Österreich<br />
Situation in Österreich<br />
(Stand 02.03.2009)<br />
Inverkehrbringung (IVB) Verbot der IVB Generelles<br />
und Verwendung mit Deklaration<br />
ab 0,9 % GVO<br />
und Verwendung Importverbot f. Anbau<br />
MON40-3-2 (RR Soja) MON40-3-2<br />
MON810 (Mais) MON810<br />
T25 (Mais) T25<br />
Bt176 (Mais) Bt176<br />
A2704-12 (LL-Soja) A2704-12<br />
MON89788 (Soja) MON89788<br />
MON863 (Mais) MON863<br />
Ms8 (Ölraps) Ms8<br />
Rf3 (Ölraps) Rf3<br />
Ms8xRf3 (Ölraps) Ms8xRf3<br />
GT73 (Raps) GT73<br />
33
34<br />
Diagnostik<br />
„Gentechnikfreiheit“ bei Futtermitteln muss auch durch<br />
entsprechende Untersuchungen überprüft werden. Die<br />
Methode der Wahl zum GVO-Nachweis ist die real-time<br />
PCR (Polymerase Chain Reaction). Als Voraussetzung<br />
für den PCR-Nachweis muss DNA in ausreichender<br />
Menge und Qualität aus der Probe isoliert werden.<br />
Dazu wird ein für die gentechnische Veränderung<br />
charakteristischer DNA-Abschnitt vervielfältigt und<br />
identifiziert. Beim Screening werden bestimmte DNA-<br />
Abschnitte (z. B. Promotoren, Terminatoren, Resistenz-<br />
gene) nachgewiesen, die in einer Vielzahl von gen-<br />
technisch veränderten Organismen vorkommen. Dem<br />
Screening kommt dabei eine immer wichtigere Rolle<br />
zu. Durch geeignete Auswahl von verschiedenen<br />
Screeningelementen können nahezu alle EU-weit zuge-<br />
lassenen und nicht zugelassenen GVO erfasst werden.<br />
Die Notwendigkeit zur Etablierung von Screeningme-<br />
thoden in der GVO-Analytik wurde durch das unbeab-<br />
sichtigte Auftreten nicht zugelassener gv-Linien (z. B.<br />
Reis Bt63) unterstrichen, vor allem da für diese neuen<br />
gv-Linien noch keine spezifischen Methoden bekannt<br />
waren. Zur weiteren Identifizierung und Quantifizie-<br />
rung werden vermehrt ready-to-use Systeme (Microar-<br />
ray-Verfahren, Chiptechnologien) Anwendung finden,<br />
um durch steigende Automatisierung die aufwendige<br />
GVO-Analytik zu unterstützen. Mit einem spezifischen<br />
Nachweisverfahren wird die GV-Linie eindeutig identifi-<br />
ziert, und mit Hilfe geeigneter Standards ist auch eine<br />
absolute Quantifizierung möglich.<br />
Prävention<br />
Ausgangspunkt für die Vermeidung von GVO in<br />
Futtermitteln sollte die Verwendung von „gentechnik-<br />
freien“ Rohstoffen sein. Nur getrennte und geschlos-<br />
sene Produktionsprozesse (Trennung von konven-<br />
tioneller und gentechnikfreier Ware) gewährleisten<br />
in Futtermittelwerken und am landwirtschaftlichen<br />
Betrieb die Einhaltung der Anforderungen für „gen-<br />
technikfreie“ Futtermittel und die Vermeidung von<br />
Kreuzkontaminationen oder Verschleppungen. Auf<br />
allen Stufen der Wertschöpfungskette wie Transport,<br />
Lagerung und Verarbeitung kommt der Schulung<br />
und Information des Personals eine Schlüsselrolle<br />
zu. Nur wenn das Bewusstsein für Verunreinigungs-<br />
und Verschleppungsrisiken entsprechend ausgeprägt<br />
ist, können Verunreinigungen nachhaltig verhindert<br />
werden.<br />
Situation in Österreich<br />
Gentechnikfreie Sojabohnen werden derzeit über-<br />
wiegend aus bestimmten Regionen Brasiliens und<br />
in kleinen Mengen über die heimische Produktion<br />
bezogen. Österreich importierte im Jahr 2008 zirka<br />
540.000 t Sojaschrot und andere Sojaprodukte in<br />
Form von ganzen Bohnen oder Mehl (Stand: 3/2009<br />
Statistik Austria). Etwa 90 % der eingeführten Ware<br />
war als GVO deklariert, ca. 10 % (rund 58.500 t)<br />
davon war nicht deklarationspflichtig, d. h. unter<br />
0,9 % GVO. Durch private Gütesiegelprogramme<br />
in der Milchproduktion aber auch für die Schweine-<br />
und Geflügelproduktion hat sich die Nachfrage seit<br />
2005 nach gentechnikfreien Futtermitteln leicht<br />
erhöht (vergleiche Machbarkeitsstudie zur Auslo-<br />
bung „gentechnikfrei“und Vermeidung von GVO in<br />
Lebensmitteln aus tierischer Erzeugung). Der Futter-<br />
mittelsektor in Österreich war bisher von LL 601 Reis,<br />
eine in der EU nicht zugelassene Reissorte, nicht<br />
betroffen.<br />
Erwähnenswert ist, dass in korrekt als GVO deklarierter<br />
Ware (z. B. Roundup Ready-Soja) häufig auch<br />
andere GV- Linien „versteckt“ sein können, wobei<br />
hier die technische Unvermeidbarkeit (Schwellenwert<br />
für zufällige und technisch unvermeidbare GVO Kontaminationen:<br />
0,9 %) hinterfragt werden müsste. Bis<br />
auf zwei Fälle (1x MON88017 und 1x Raps Ms8) sind<br />
diese Vorkommen jedoch im Rahmen der vorgegebenen<br />
Grenzen gewesen.<br />
Tab. 11: Die Tabelle zeigt die Anzahl der Untersuchungen von Futtermittelkontrollproben auf GVO<br />
der letzten Jahre (2004 - 2008) sowie das Vorkommen von GVO in GVO-frei deklariertem Futter<br />
Jahr Anzahl der Beanstandung<br />
untersuchten<br />
Futtermittelproben<br />
der Kennzeichnung<br />
2004 196 15<br />
2005 164 10<br />
2006 197 14<br />
2007 292 15<br />
2008 277 15
tierarzneimittel<br />
und hormone<br />
Tierarzneimittel und bestimmte Futtermittelzusatz-<br />
stoffe (z. B. Kokzidiostatika und Histomonostatika)<br />
sind unverzichtbare Instrumente, um Erkrankungen<br />
von Tieren vorzubeugen bzw. um Krankheiten zu<br />
behandeln. Ein auch noch so kritischer Konsument<br />
wird kaum Einwände dagegen haben, dass Tiere im<br />
Krankheitsfall behandelt werden müssen, vorausge-<br />
setzt eine Therapie ist überhaupt möglich oder seu-<br />
chenhygienisch erlaubt. Gleichzeitig allerdings gilt die<br />
berechtigte Forderung, dass gesetzlich festgelegte<br />
Grenzwerte eingehalten werden bzw. die Verwen-<br />
dung illegaler „Wachstumsförderer“ durch regelmä-<br />
ßige Kontrollen und gegebenenfalls durch strenge<br />
Bestrafung möglichst verhindert wird.<br />
Vorkommen<br />
Die unkontrollierte Verwendung von Arzneimitteln<br />
und illegalen Hormonen sowie Antibiotika als Wachs-<br />
tumsförderer in der Tierhaltung birgt im Wesent-<br />
lichen die Risiken von toxikologischen Wirkungen der<br />
Rückstände und die Ausbildung von Keimresistenzen.<br />
Diese Resistenzen führen im zunehmenden Ausmaß<br />
zu Problemen bei der Behandlung bakterieller Infek-<br />
tionskrankheiten beim Menschen.<br />
Gesetzliche Basis<br />
Nationale Gesetze – Lebensmittelsicherheits- und<br />
Verbraucherschutzgesetz sowie Futtermittelgesetz –<br />
und Vorgaben der Europäischen Kommission bilden<br />
die Rahmenbedingungen für die Überwachung im<br />
Sinne des Konsumentenschutzes. Fütterungsarznei-<br />
mittel und deren Vormischungen zur Behandlung<br />
erkrankter Tiere/Tierbestände dürfen nur nach Ver-<br />
schreibung durch einen Tierarzt angewendet werden<br />
und unterliegen dem Tierarzneimittelkontrollgesetz.<br />
Mit 1.1.2006 wurde die Verwendung der letzten<br />
vier Antibiotika als Futtermittelzusatzstoff verboten<br />
(Avilamycin, Salinomycin, Flavomycin und Monensin).<br />
Derzeit sind noch 11 Kokzidiostatika (Arzneimittel zur<br />
Vorbeugung von Kokzidiose bei Hühnern, Puten und<br />
Kaninchen) als Futtermittelzusatzstoffe zugelassen.<br />
Da in der Praxis in Mischfuttermittelwerken Ver-<br />
schleppungen (Kreuzkontaminationen) technisch<br />
nicht immer ganz vermeidbar sind, wurden von der<br />
Europäischen Kommission für diese Kokzidiostatika<br />
Höchstwerte für Nichtzieltierarten eingeführt (Richtli-<br />
nie 2009/8/EG).<br />
Analytik<br />
Screeningmethoden wie z. B. Hemmstofftest, Dünn-<br />
schichtchromatographie, ELISA ermöglichen eine<br />
rasche Sichtung einer großen Anzahl von Proben auf<br />
unerwünschte Substanzen oder Substanzgruppen,<br />
haben aber den Nachteil, aufgrund unspezifischer<br />
Reaktionen falsch positive Ergebnisse zu liefern.<br />
Daher ist die Untersuchung von Proben, die im<br />
Screening als verdächtig eingestuft wurden, mittels<br />
einer spezifischen Bestätigungsanalyse unerläss-<br />
lich. Diese hochapparativen und personalintensiven<br />
Analysen beruhen auf einer chromatographischen<br />
Trennung mit anschließender Dioden-Array- oder<br />
massenspektrometrischer Detektion und werden auch<br />
zur direkten Untersuchung bestimmter Substanzklas-<br />
sen eingesetzt.<br />
35
36<br />
Aufgaben im Rahmen der amtlichen<br />
Futtermittelkontrolle<br />
Die Proben für die amtliche Futtermittelkontrolle werden<br />
gemäß risikobasiertem Stichprobenplan gezogen.<br />
Die Vorgaben für diesen Kontrollplan über die Anzahl<br />
und Art der Proben sowie die zu untersuchenden<br />
Substanzen sind in der Verordnung (EG) 822/2004<br />
geregelt. Zusätzlich gelangen noch so genannte Verdachtsproben<br />
zur Untersuchung, die auf Grund eines<br />
vorangegangenen, nicht den gesetzlichen Vorgaben<br />
entsprechenden Ergebnisses eingesendet werden.<br />
Weiters erfolgt die Überprüfung von erlaubten<br />
Futtermittelzusatzstoffen (z. B. Kokzidiostatika), wobei<br />
das Ziel dieser Untersuchungen die Kontrolle der<br />
Einhaltung festgelegter Mindest- und Höchstgehalte<br />
unter Verwendung gesetzlich vorgegebener Methoden<br />
ist. Diese Analysen umfassen die quantitative<br />
Bestimmung der Zusatzstoffe Diclazuril, Halofuginon,<br />
Maduramycin, Monensin, Narasin, Salinomycin u. a.<br />
Außerdem werden Futtermittel auf verbotene bzw.<br />
nicht zugelassene Substanzen (Antibiotika, Hormone)<br />
untersucht. Ziel dieser Untersuchungen ist in erster<br />
Linie die Aufdeckung einer vorsätzlichen Verwendung<br />
verbotener Substanzen (z. B. Nifursol, Chloramphenicol,<br />
Medroxy-Progesteron-Acetat (MPA)). Durch Konzentration<br />
aller Untersuchungen auf Tierarzneimittel<br />
und Hormone in einem Kompetenzzentrum ist es<br />
Tab. 12: Anzahl der auf Arzneimittel- u. Hormonrückstände untersuchten<br />
Proben und die Anzahl der Beanstandungen<br />
darüber hinaus möglich, von Ergebnissen der Lebensmittelkontrolle<br />
Rückschlüsse auf etwaige Fehler in<br />
der Futtermittelproduktion, so genannte Verschleppungen<br />
in Nicht-Zieltier-Futtermittel („carry-over“),<br />
zu ziehen. Die Proben werden entweder direkt auf<br />
bestimmte Substanzen wie Chloramphenicol, Gestagene<br />
(wachstumsfördernde Steroidhormone, z. B.<br />
MPA) und Thyreostatika untersucht oder auf Grund<br />
eines positiven Ergebnisses im Hemmstofftest zur<br />
Untersuchung an das Kompetenzzentrum weitergeleitet.<br />
Proben privater Einreicher<br />
Neben den Proben der amtlichen Futtermittelkontrolle<br />
werden auch Proben privater Kunden, die<br />
Exportzertifikate für Drittstaaten (Nicht EU-Länder)<br />
benötigen, analysiert.<br />
Situation in Österreich<br />
Jährlich werden gemäß Stichprobenkontrollplan<br />
in Österreich ca. 800 - 1.200 Futtermittelproben<br />
auf Arzneimittel- und Hormonrückstande inklusive<br />
Hemmstofftest untersucht. Die Tabelle zeigt die<br />
Anzahl der Beanstandungen von Futtermittelproben<br />
bzw. einen deutlichen Rückgang in den letzten<br />
Jahren.<br />
Jahr Anzahl auf Arzneimittelu.<br />
Hormonrückstände<br />
untersuchter Proben<br />
Beanstandungen<br />
2002 1.091 19<br />
2003 1.224 44<br />
2004 1.163 6<br />
2005 1.107 4<br />
2006 1.091 1<br />
2007 839 1<br />
2008 1.129 2
tierische bestandteile<br />
Tiermehl wird aus gefallenen Tieren oder Schlachtab-<br />
fällen in Tierkörperverwertungsanstalten (TKV) mit<br />
einem speziell vorgeschriebenen Verfahren (20 Minu-<br />
ten bei einem Druck von 3 bar und 133° C), Fisch-<br />
mehl aus getrockneten und gemahlenen Fischen,<br />
Fischteilen oder Fischbeifang hergestellt. Weitere<br />
Nachprodukte aus Tieren sind Geflügelmehl, Feder-<br />
mehl und Blutmehl.<br />
Gesetzliche Basis<br />
Im Jahr 2000 wurde Europa ausgehend von Groß-<br />
britannien von der BSE-Krise (Bovine Spongiforme<br />
Encephalopathie) befallen. Als Ursache für den<br />
Ausbruch von BSE wird die Verfütterung von nicht<br />
ausreichend erhitztem, infektiösem Tiermaterial<br />
angenommen, nachdem zuvor in Großbritannien das<br />
Erhitzungsverfahren bei der Verarbeitung gelockert<br />
wurde. Daraufhin wurde 2001 die Verfütterung von<br />
Tiermehl an alle landwirtschaftlichen Nutztiere sowie<br />
Fischmehl an Wiederkäuer in der Europäischen<br />
Gemeinschaft verboten (VO (EG) 999/2001 und VO<br />
(EG) 1774/2002). Seit kurzem sind Fischmehlbei-<br />
mengungen in Milchaustauschfuttermitteln für junge<br />
Wiederkäuer (z. B. Kälber) mit Inkrafttreten der<br />
VO (EG) Nr. 956/2008 wieder erlaubt. Eine weitere<br />
Erleichterung ergab sich mit Inkrafttreten der Ver-<br />
ordnung (EG) Nr. 163/2009, die eine Verfütterung<br />
von Futtermitteln pflanzlichen Ursprungs und daraus<br />
produzierten Mischfuttermitteln, die mit nur uner-<br />
heblichen Knochensplitterbeimengungen kontami-<br />
niert sind, wieder zulässt, wenn eine befürwortende<br />
Risikobewertung vorliegt.<br />
Bedeutung in Futtermitteln<br />
Tiermehl zeichnet sich durch einen sehr hohen Pro-<br />
teingehalt (60–65 %) aus, daher wurde es jahrelang<br />
als preiswerter Ersatz für Sojaschrot (in Österreich<br />
nur in Schweine- und Geflügelfutter) eingesetzt. Pro-<br />
teine sind mit ihren Aminosäuren sehr wichtige Nah-<br />
rungsbestandteile, die für den Aufbau von Körper-<br />
eiweiß (Fleischansatz) und für viele andere wichtige<br />
Körperprozesse über die Nahrung zugeführt werden<br />
müssen. Durch das Tiermehlverbot entstand in der<br />
gesamten EG eine große „Eiweißlücke“, die nur<br />
durch teure Substitute (Ersatz), z. B. Sojaschrot oder<br />
Fischmehl, gefüllt werden konnte. Sojabohne wird<br />
zum größten Teil aus den USA oder Südamerika nach<br />
Europa importiert. Die Hauptlieferanten für Fischmehl<br />
sind Chile, Peru, Norwegen, Dänemark.<br />
Präventivmaßnahmen<br />
Die Herstellung von Mischfutter für Schweine und<br />
Geflügel mit Fischmehl ist seit 2001 mit einem Ver-<br />
zicht auf die Produktion von Wiederkäuerfutter<br />
verbunden, außer es wird auf zwei getrennten<br />
Produktionslinien erzeugt. Durch regelmäßige stich-<br />
probenartige Untersuchungen werden Futtermittel<br />
(v. a. für Wiederkäuer) auf das Vorhandensein von<br />
tierischen Bestandteilen in der <strong>AGES</strong> untersucht. Ge-<br />
mäß Kontrollplan werden jährlich etwa 1.000 - 1.200<br />
Futtermittelproben auf Tiermehl bzw. tierische Protei-<br />
ne geprüft. Fischmehl wird bereits beim Eintritt in die<br />
EU an deren Grenzen auf unerlaubte Beimengungen,<br />
insbesondere von Tier-, Feder- oder Fleischmehl, un-<br />
tersucht. Auch fischmehlhältiges Mischfutter wird auf<br />
Beimengungen von Tiermehl überprüft. Als weitere<br />
Präventivmaßnahme müssen sich in Österreich<br />
gemischte Betriebe (d. h. gemeinsame Haltung von<br />
Rindern und Schweinen oder Geflügel), die Fischmehl<br />
zur Fütterung ihrer Schweine oder Hühner verwen-<br />
den, von der Veterinärbehörde registrieren und über-<br />
wachen lassen. Nur durch getrennte Lagerung<br />
kann erreicht werden, dass es zu keiner Kontamina-<br />
tion von Wiederkäuerfutter mit Fischmehl kommt.<br />
37
38<br />
Diagnostik<br />
Die Mikroskopie ist die einzig anerkannte Methode in<br />
der EU zur Untersuchung auf tierische Bestandteile.<br />
Hierbei werden vorhandene tierische Bestandteile in<br />
der durch Siebfraktionen aufbereiteten Futterprobe<br />
identifiziert sowie eine quantitative Schätzung des<br />
Anteils im Absatz der vermahlenen Probe durchge-<br />
führt. Mit dieser Methode können kleinste Spuren von<br />
Knochenfragmenten, Muskelfasern, Haare, Horn und<br />
Schuppen im Futter erfasst werden. Die Mikroskopie<br />
kann charakteristische, mikroskopisch erfassbare<br />
Strukturen oder Bestandteile von Fischen von denen<br />
warmblütiger Landtiere unterscheiden. Aber auch<br />
Überprüfungen der angegebenen Herstellungsrezep-<br />
tur auf verwendete Futtermittel-Ausgangserzeugnisse<br />
(Getreide, Mais, etc.) sowie auf Insekten oder bota-<br />
nische Verunreinigungen (z. B. Mutterkorn) werden<br />
mittels Mikroskopie durchgeführt.<br />
Situation in Österreich in Futtermitteln<br />
Jährlich fallen in Österreich zirka 90.000 t Tiermehl<br />
an. Das Tiermehl der Kategorie 1 und 2 wird in<br />
bestimmten Kraftwerksanlagen als Energieträger<br />
verbrannt, Tiermehl aus Kategorie 3 (aus Schlachtab-<br />
fällen) darf als Düngemittel oder Heimtierfutter<br />
eingesetzt werden (VO (EG) 1774/2002). In Öster-<br />
reich wurde Tiermehl üblicherweise nie an Wieder-<br />
käuer verfüttert, ein Fütterungsverbot besteht bereits<br />
seit 1990. Da bis 2000 Futter für Wiederkäuer und<br />
Nicht-Wiederkäuer in Mischfutterwerken auf einer<br />
gleichen Produktionslinie hergestellt wurde, gab es<br />
vereinzelt Kreuzkontaminationen von Tiermehlspuren<br />
im Wiederkäuerfutter. In den Jahren 2002 - 2008<br />
wurden ca. 9.200 Proben auf tierische Proteine<br />
(Tiermehl und Fischmehl) untersucht. Dabei wur-<br />
den in den letzten Jahren häufiger Futtermittel mit<br />
tierischen Bestandteilen erfasst, von denen aber<br />
nicht jedes einzelne beanstandet werden musste:<br />
Zuckerrübenschnitzel, ein beliebtes energiereiches<br />
Futtermittel für Rinder, sind häufig mit Spuren,<br />
wahrscheinlich Knochenreste von Tieren vom Acker,<br />
verunreinigt, aber auch wenn Tiermehl als Verbren-<br />
nungsmaterial zur Trocknung von verschiedenen Fut-<br />
termitteln (z. B. ein Säurepremix) verwendet wurde.<br />
Gelegentlich fand man auch Knochensplitter und/<br />
oder Muskelfasern, deren Herkunft meist auf Klein-<br />
nager (z. B. Mäuse) oder andere Tiere vom Acker<br />
zurückzuführen war. Im Jahr 2008 wurden insgesamt<br />
1.275 Proben auf tierische Proteine untersucht, in 15<br />
Proben wurden Spuren von tierischen Proteinen oder<br />
Fischmehl ermittelt, davon mussten aber nur zwei<br />
Proben beanstandet werden.<br />
Tab. 13: Anzahl der pro Jahr auf tierische Bestandteile untersuchten Proben, davon mit<br />
einem positiven Ergebnis (2002 - 2008)<br />
Jahr Anzahl der Anzahl der<br />
untersuchten Proben untersuchten Proben<br />
mit einem positiven<br />
Ergebnis<br />
2002 1.587 1<br />
2003 915 1<br />
2004 1.226 17<br />
2005 1.483 2<br />
2006 1.315 7<br />
2007 1.393 10<br />
2008 1.275 15<br />
Gesamt 9.194 53
dioxine und pcb<br />
Dioxine gehören zu den langlebigen, schwer ab-<br />
baubaren, organischen Schadstoffen, die sich in der<br />
Umwelt anreichern. Man versteht chemisch darunter<br />
eine Gruppe von chlorierten Kohlenwasserstoff-<br />
Verbindungen. Traurige Bekanntheit erreichte Dioxin<br />
bereits Ende der 1960er Jahre als „Agent Orange“,<br />
das im Vietnamkrieg als Entlaubungsmittel eingesetzt<br />
wurde, weiters 1976 durch einen Chemieunfall in<br />
Seveso (Italien) und im Jahr 2004 durch eine Ver-<br />
giftung des ukrainischen Oppositionsführers Viktor<br />
Juschtschenko.<br />
Polychlorierte Biphenyle (PCB) sind ebenfalls giftige<br />
und krebsauslösende Chlorverbindungen, die als<br />
Industriechemikalien in Transformatoren, Kondensatoren<br />
oder Hydraulikanlagen (Hydraulikflüssigkeiten)<br />
sowie in Lacken und Kunststoffen (Weichmacher)<br />
verwendet werden.<br />
Entstehung und Verbreitung<br />
Dioxine werden nicht industriell hergestellt, sondern<br />
fallen bei einer großen Anzahl von thermischen<br />
Prozessen als Nebenprodukte an, für die es keine<br />
technische Verwendung gibt.<br />
Auch bei der Verbrennung oder Trocknung von<br />
organischen kohlenstoffhältigen Verbindungen (Holz,<br />
Pflanzen) können sich in einem Temperaturbereich<br />
von 300 - 600° C („Dioxinfenster“) in Gegenwart von<br />
Chlor Dioxine bilden, wie z. B. in der Müllverbrennung,<br />
bei der Papierherstellung (Bleichprozesse mit<br />
Chlor), bei der Herstellung von Pflanzenschutzmitteln<br />
oder bei metallurgischen Prozessen (Eisen-, Stahlund<br />
Kupfererzeugung). Aber auch natürliche Ereignisse,<br />
z. B. Wald- oder Steppenbrände oder Vulkanausbrüche,<br />
können zur Bildung von Dioxinen führen.<br />
Weltweit treten sie auch als Begleitsubstanzen von<br />
Erzen und Mineralien auf, wie Fälle in Kaolinit-Ton<br />
und Zinkoxyd zeigen, meistens als komplexe Gemische,<br />
oft zusammen mit anderen, chemisch und<br />
toxikologisch ähnlichen Stoffen wie z. B. PCB.<br />
Bedeutung in Futtermitteln<br />
Dioxine sind ubiquitär, d. h. überall, in Böden, Gewässern,<br />
Sedimenten, Pflanzen, Tieren anzutreffen.<br />
Tiere können Dioxine aus der Umgebung, über das<br />
Futter, auch über die Weide oder in der Freilandhaltung<br />
aufnehmen. Nennenswerte Grenzwertüberschreitungen<br />
kamen in den letzten Jahren in Europa<br />
in einigen Futterzusatzstoffen wie Spurenelementen,<br />
Kaolinit-Tonen sowie in einigen Fetten vor. Vor allem<br />
Fische aus Meeren, wo nach Erdöl gebohrt wird,<br />
weisen allgemein höhere Dioxingehalte auf. Seit dem<br />
Dioxinskandal in Belgien im Jahr 1999, wo Transformatorenöl<br />
durch unsachgemäße Entsorgung ins<br />
Futtermittel gelangte, werden Futtermittel regelmäßig<br />
auf Dioxin untersucht. PCB können sich durch<br />
Industrieunfälle oder unsachgemäße Abfallentsorgung<br />
in der Umwelt anreichern und so auch in die<br />
Futtermittelkette gelangen.<br />
Gesetzliche Basis für Futtermittel<br />
Dioxine und PCB gehören futtermittelrechtlich in die<br />
Gruppe der unerwünschten Stoffe. Die Verwendung<br />
und Inverkehrbringung von Futtermitteln ist verboten,<br />
sobald die in den Richtlinien 2002/32/EG und<br />
2006/13/EG vorgesehenen Höchstwerte überschritten<br />
werden. Bei Überschreitung von Auslösewerten<br />
(niedriger als Höchstwerte) muss eine Ursachenforschung<br />
eingeleitet werden („Aktionswerte“).<br />
Diagnostik<br />
Die Diagnostik erfolgt mit der Gaschromatographie<br />
gekoppelt an die Massenspektrometrie (GC/MS).<br />
Nachteil dieser sehr genauen Untersuchung sind die<br />
enorm hohen Kosten.<br />
39
40<br />
Prävention<br />
Grundsätzlich ist die Belastung mit unerwünschten<br />
Stoffen, somit auch mit Dioxin und PCB, in Fut-<br />
termitteln sehr gering. Trotzdem wurden EU-weit<br />
Grenzwerte für Dioxine und PCB festgelegt, um in<br />
Einzelfällen gesetzlich klar vorgehen zu können. Zur<br />
Prävention von Dioxinen und PCB in Lebens- und<br />
Futtermitteln wurden sogenannte Auslösewerte fest-<br />
gesetzt. Sobald ein Auslösewert überschritten wird,<br />
muss zielgerichtet nach der Ursache der Kontamina-<br />
tion gesucht (Ursachenforschung) und für ihre Besei-<br />
tigung gesorgt werden.<br />
Situation in Europa<br />
In den letzten 10 Jahren hat die Futtermittelkon-<br />
trolle in Europa mehrere Dioxin-Fälle aufgedeckt:<br />
Zitrustrester aus Brasilien (1998), Transformatorenöl<br />
im Futterfett in Belgien (1999), Kaolinit-Ton aus<br />
Deutschland (1999). Beim Fall mit Kaolinit-Ton war<br />
auch Österreich betroffen, wobei die Gesundheit von<br />
Mensch und Tier jedoch nie gefährdet war. Das im<br />
Jahr 2006 kontaminierte Futterfett in Belgien wurde<br />
durch Ausfall zweier Filter bei der Herstellung von<br />
Salzsäure, die zur Fettextraktion bei der Gelatine-<br />
herstellung verwendet wurde, verursacht. Im Jahr<br />
2007 sorgte Dioxin gemeinsam mit Pentachlorphenol<br />
(Fungizid und Holzschutzmittel) in Guarkernmehl aus<br />
Indien europaweit vor allem am Lebensmittelsektor,<br />
vereinzelt auch am Futtermittelsektor, für umfang-<br />
reichere Rückholaktionen; der österreichische Futter-<br />
mittelmarkt war davon jedoch nicht betroffen. Letztes<br />
Jahr mussten in der gesamten Europäischen Union<br />
aufgrund erhöhter Werte von Dioxin und dioxinähn-<br />
lichen PCB tonnenweise Rind- und Schweinefleisch<br />
aus Irland zurückgeholt bzw. vernichtet werden.<br />
Die Ursachenforschung brachte zutage, dass bei der<br />
Wiederverwertung von Bäckereiabfällen durch einen<br />
unsachgemäßen Trocknungsprozess Dioxine entstan-<br />
den waren und so übers Futter in den Lebensmittel-<br />
kreislauf gekommen waren.<br />
Situation in Österreich<br />
In Österreich werden laut risikobasiertem Stichpro-<br />
benplan jährlich mind. 50 ausgewählte Futtermittel<br />
auf dioxinähnliche PCB und Dioxin untersucht, wobei<br />
in den letzten sieben Jahren (2002 - 2008) insgesamt<br />
nur 2** bzw. 5* mal erhöhte Werte bei insgesamt<br />
398 bzw. 464 untersuchten Proben auftraten. Die Ur-<br />
sache für diese Überschreitungen in Österreich waren<br />
2002 importierte Spurenelementvormischungen und<br />
2003 ein Fall mit belastetem Zinkoxyd.<br />
Seit vier Jahren beteiligen sich viele österreichische<br />
Firmen freiwillig an einem Rohstoffmonitoring, in<br />
dessen Rahmen 2005 auch eine Überschreitung bei<br />
einer Lignozellulose festgestellt und dieses Produkt<br />
rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen werden konnte.<br />
Im Jahr 2008 wurden erstmals zwei Überschrei-<br />
tungen von Auslösewerten bei dioxinähnlichen PCB<br />
gefunden, einmal in einem Ergänzungsfuttermittel<br />
für Pferde und einmal in einem Kräuter-Ergänzungs-<br />
futtermittel für Geflügel. Ursache war einmal eine<br />
Kräutermischung aus Fernost, das zweite Mal wurde<br />
der Fall an die zuständige deutsche Behörde weiter-<br />
geleitet.<br />
Tab. 14: Anzahl und Ergebnisse der Untersuchungen aus der amtlichen Futtermittelkontrolle (seit 2006 inkl.<br />
Rohstoffmonitoring) in Österreich (2002 - 2008) auf Dioxin und dioxinähnliche PCB<br />
Jahr Untersuchungen Untersuchungen Überschreitungen Überschreitungen<br />
auf Dioxin auf dioxinähnliche Dioxin dioxinähnliche<br />
PCB PCB<br />
2002 52 0 4 0<br />
2003 56 42 1 0<br />
2004 43 43 0 0<br />
2005 44 44 0 0<br />
2006 87 87 0 0<br />
2007 69 69 0 0<br />
2008 113 113 0 2<br />
Gesamt 464 398 5* 2**
ansprechpartner für<br />
futtermittelanalysen<br />
und nationale referenzlaboratorien<br />
Die Verordnung (EG) Nr. 882/2004 vom 29. April<br />
2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der<br />
Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts<br />
sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und<br />
Tierschutz ist mit 1. Jänner 2006 in Kraft getreten.<br />
Zur Erreichung einer hohen Qualität und Einheitlich-<br />
keit der Untersuchungsergebnisse wurden speziell für<br />
die Untersuchung jener Analyten, die für die Futter-<br />
mittel- und Lebensmittelsicherheit von Bedeutung<br />
sind, gemeinschaftliche (CRL) und nationale (NRL)<br />
Referenzlaboratorien eingerichtet.<br />
Analytengruppe Organisationseinheit Kontakt Adresse<br />
Inhaltsstoffe, Enzyme, Institut für Futtermittel, Dr. Karl Walter Wagner A-1220 Wien<br />
Fettkennzahlen Abt. Futtermittelanalytik Spargelfeldstraße 191<br />
Aminosäuren, Antioxidantien, Institut für Futtermittel, Dr. Renate Oeschlmüller A-1220 Wien<br />
Carotinoide Abt. Zusatzstoffanalytik, NRL Spargelfeldstraße 191<br />
für Futtermittelzusatzstoffe<br />
Tierarzneimittel (Anhang 1, CC Tierarzneimittel und Dipl. Ing. Thomas Kuhn A-1220 Wien<br />
EU-RL 96/23 Gruppen A, B1 Hormone, NRL für Rück- Spargelfeldstraße 191<br />
und B2) als Zusatzstoffe und stände von Tierarzneimitteln<br />
Rückstandsanalytik<br />
Pflanzenschutzmittel- CC Rückstandsanalytik Wien, Dr. Friedrich Fila A-1220 Wien<br />
rückstände und PCB NRL für Pestizidrückstände<br />
in Futtermitteln<br />
Spargelfeldstraße 191<br />
Spurenelemente, Zentrum für Analytik und Dr. Karl Aichberger A-4020 Linz<br />
Schwermetalle Mikrobiologie, NRL für<br />
Schwermetalle in Futtermitteln<br />
Wieningerstraße 8<br />
Mykotoxine, Polyzyklische CC Cluster Chemie, Dr. Richard Öhlinger A-4020 Linz<br />
Kohlenwasserstoffe, Vitamine NRL für Mykotoxine und<br />
polyzyklische aromatische<br />
Kohlenwasserstoffe,<br />
Wieningerstraße 8<br />
Probiotika, Salmonellen, Zentrum für Analytik und Dr. Andreas Adler A-4020 Linz<br />
Bakterien-, Hefe- und<br />
Schimmelpilzkeimzahlen<br />
Mikrobiologie Wieningerstraße 8<br />
Mikroskopie (tierische Institut für Bodengesundheit Dr. Franz Wernitznig A-1220 Wien<br />
Bestandteile, Rezeptur, & Pflanzenernährung, Abt. Spargelfeldstraße 191<br />
botanische Verunreinigungen Düngemittelüberwachung<br />
und Mikroskopie, NRL für<br />
tierische Proteine in Futtermitteln<br />
GVO-Untersuchungen CC Biochemie Wien, NRL für Mag. Rupert Hochegger A-1220 Wien<br />
genetisch veränderte<br />
Organismen<br />
Spargelfeldstraße 191<br />
Abkürzungen: CC = Kompetenzzentrum, CRL = gemeinschaftliches Referenzlabor, NRL = Nationales Referenzlabor<br />
41
42<br />
zusammenfassung<br />
Der Einsatz von hochwertigen Futtermitteln, die<br />
Vermeidung von Risiken für Tier und Mensch und die<br />
Futtermittelüberwachung sind Gegenstand dieser<br />
Broschüre. Seit Gründung der Agentur für Gesundheit<br />
und Ernährungssicherheit vor 7 Jahren hat sich in der<br />
Bewertung und Vermeidung von Risiken entlang der<br />
Lebensmittelkette in Österreich und Europa viel<br />
verändert. Ein wissenschaftlich fundierter, risikobasierter<br />
und mehrjähriger integrierter Kontrollplan wurde<br />
der Futtermittelüberwachung zu Grunde gelegt.<br />
Im Jahr 2008 fand erstmals ein umfangreicher und in<br />
mehreren Modulen zusammengestellter Ausbildungslehrgang<br />
für Futtermittelkontrollorgane statt. Damit<br />
kann den Anforderungen des mehrjährigen, inte-<br />
grierten Kontrollplans nach qualitativ hochwertigen<br />
und einheitlichen Kontrollen bzw. Betriebsinspektionen<br />
entsprochen werden.<br />
Jährlich werden nach dem amtlichen Stichprobenplan<br />
etwa 3.000 Futtermittelproben in den Futtermittelwerken,<br />
im Futtermittelhandel und bei Landwirten gezogen<br />
und insgesamt ca. 20.000 Analysen durchgeführt.<br />
Zudem wird bei Betriebsinspektionen bei Futtermittelerzeugern<br />
und -händlern die Einhaltung der vorgeschriebenen<br />
betriebseigenen Prozesse und Kontrollsysteme<br />
überprüft. Die Maßnahmensetzungen haben in<br />
den letzten Jahren gemeinsam mit den Wirtschaftsbeteiligten<br />
zu mehr Futtermittelsicherheit beigetragen:
• Kontaminationen mit Schwermetallen werden nur<br />
vereinzelt festgestellt.<br />
• Zu Dioxin gab es in den letzten fünf Jahren keine<br />
Beanstandungen, bei dioxinähnlichen PCB gab es<br />
2008 erstmals 2 Beanstandungen.<br />
• Seit 1998 gab es keine Höchstwert-Überschreitungen<br />
von Pflanzenschutzmittelrückständen.<br />
• Bei Mykotoxinen liegt verbesserte Erfahrung zu den<br />
Kontaminationen vor, zusätzliche Forschung, Strategien<br />
und Maßnahmen zur Vermeidung wurden<br />
eingeleitet.<br />
• Bei Salmonellen kam es zu einem deutlichen<br />
Rückgang von Beanstandungen.<br />
• Die Anzahl der beanstandeten kennzeichnungspflichtigen<br />
GVO-Proben stagnierte.<br />
• Bei Hormonen und Arzneimitteln kam es zu einem<br />
deutlichen Rückgang von Beanstandungen.<br />
• Bei der Untersuchung auf tierische Bestandteile<br />
kam es zwischen 2006 und 2008 zwar zu einer<br />
geringfügig erhöhten Anzahl positiver Proben, wobei<br />
jedoch nur eine sehr geringe Anzahl von Proben<br />
beanstandet werden musste.<br />
Insgesamt konnte bei allen Substanzen oder Stoffgruppen<br />
mit Ausnahme tierischer Bestandteile zumindest<br />
eine Stagnation, zumeist ein deutlicher Rückgang<br />
von Beanstandungen festgestellt werden. Bei den<br />
Mykotoxinbelastungen liegt auf nationaler und europäischer<br />
Ebene noch Verbesserungspotenzial vor. Von<br />
der <strong>AGES</strong> durchgeführte umfassende Forschungs- und<br />
Monitoringprogramme sollen letztlich zu verbesserten<br />
Vorsorge- und Vermeidungsstrategien bei Mykotoxinen<br />
führen. Schnellere und gezieltere Risikobewertung<br />
sowie Maßnahmensetzung wurden bei Kontaminationen<br />
von Futtermitteln durch die Beteiligung der<br />
<strong>AGES</strong> am europäischen Schnellwarnsystem erreicht.<br />
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass in den letzten<br />
sieben Jahren (seit Gründung der <strong>AGES</strong>) die Futtermittelsicherheit<br />
in Österreich signifikant verbessert wurde<br />
und ein substantieller Beitrag zu mehr Gesundheit der<br />
Tiere und Menschen geleistet wurde.<br />
Die <strong>AGES</strong> wird sich auch in Zukunft den zahlreichen<br />
neuen Herausforderungen, die sich zum Beispiel durch<br />
die Veränderung der Biomassenutzung für Energie<br />
und industrielle Rohstoffe ergeben, mit Engagement<br />
stellen.<br />
43
44<br />
gesetzliche grundlagen<br />
Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzge-<br />
setz (LMSVG)<br />
Futtermittelgesetz (FMG) 1999 i.d.g.F.<br />
Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen<br />
Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 mit<br />
Vorschriften zu Verhütung, Kontrolle und Tilgung<br />
bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalo-<br />
pathien<br />
Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments<br />
und des Rates vom 7. Mai 2002 über unerwünschte<br />
Stoffe in der Tierernährung<br />
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen<br />
Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur<br />
Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen<br />
des Lebensmittelrechtes, zur Errichtung<br />
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit<br />
und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit<br />
Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen<br />
Parlaments und des Rates vom 3. Oktober 2002 mit<br />
Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen<br />
Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte<br />
Richtlinie 2003/100/EG der Kommission vom 31. Oktober<br />
2003 zur Änderung von Anhang I zur Richtlinie<br />
2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des<br />
Rates über unerwünschte Stoffe in der Tierernährung<br />
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen<br />
Parlaments und des Rates vom 22. September 2003<br />
über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel<br />
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen<br />
Parlaments und des Rates vom 22. September 2003<br />
über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung<br />
Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen<br />
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über<br />
amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung<br />
des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der<br />
Bestimmung über Tiergesundheit und Tierschutz<br />
(ABl. L 165 vom 30.4.2004)<br />
Machbarkeitsstudie zur Auslobung „gentechnikfrei“<br />
und Vermeidung von GVO bei Lebensmitteln aus<br />
tierischer Erzeugung, www.ages.at<br />
Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des Europäischen<br />
Parlaments und des Rates vom 12. Januar 2005 mit<br />
Vorschriften für die Futtermittelhygiene<br />
Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments<br />
und des Rates vom 23. Februar 2005 über<br />
Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf<br />
Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen<br />
Ursprungs und zur Änderung der Richtlinie 91/414/<br />
EWG des Rates<br />
Richtlinie 2006/13/EG der Kommission vom 3. Februar<br />
2006 zur Änderung der Anhänge I und II der<br />
Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments<br />
und des Rates vom 7. Mai 2002 über unerwünschte<br />
Stoffe in der Tierernährung in Bezug auf Dioxine und<br />
dioxinähnliche PCB<br />
Empfehlung der Kommission Nr. 576/2006/EG vom<br />
17. August 2006 betreffend das Vorhandensein von<br />
Deoxynivalenol, Zearalenon, Ochratoxin A, T-2- und<br />
HT-2-Toxin sowie von Fumonisinen in zur Verfütterung<br />
an Tiere bestimmten Erzeugnissen<br />
Entscheidung der Kommission (2008/798/EG) vom<br />
14. Oktober 2008 zum Erlass von Sondervorschriften<br />
für die Einfuhr von Milch enthaltenden Erzeugnissen<br />
oder Milcherzeugnissen, deren Ursprung oder Herkunft<br />
China ist, und zur Aufhebung der Entscheidung<br />
2008/757/EG der Kommission
Verordnung (EG) Nr. 956/2008 der Kommission vom<br />
29. September 2008 zur Änderung von Anhang IV<br />
der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen<br />
Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur<br />
Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter trans-<br />
missibler spongiformer Enzephalopathien<br />
Richtlinie 2009/8/EG der Kommission vom 10. Febru-<br />
ar 2009 zur Änderung von Anhang I der Richtlinie<br />
2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des<br />
Rates hinsichtlich Höchstgehalten an Kokzidiostatika<br />
autoren<br />
Ein besonderer Dank gilt allen Autoren, die bei der<br />
Erstellung der Futtermittelbroschüre mitgewirkt haben.<br />
Dr. Andreas Adler<br />
andreas.adler@ages.at<br />
Dr. Karl Aichberger<br />
karl.aichberger@ages.at<br />
Mag. Rupert Hochegger<br />
rupert.hochegger@ages.at<br />
Dr. Friedrich Fila<br />
friedrich.fila@ages.at<br />
Dipl. Ing. Thomas Kickinger<br />
thomas.kickinger@ages.at<br />
Dipl. Ing. Mag. Veronika Kolar<br />
veronika.kolar@ages.at<br />
redaKtion<br />
Dipl. Ing. Mag. Veronika Kolar<br />
veronika.kolar@ages.at<br />
bildnachweise<br />
Bilder <strong>AGES</strong><br />
Ein besonderer Dank geht an alle mitwirkenden<br />
Kolleginnen und Kollegen aus den Instituten des<br />
Bereichs Landwirtschaft und aus den Kompetenzzentren<br />
für die Mithilfe und Bereitstellung von Bildmaterial:<br />
und Histomonostatika, die aufgrund von unvermeid-<br />
barer Verschleppung in Futtermittel für Nichtzieltier-<br />
arten vorhanden sind<br />
Verordnung (EG) 163/2009 der Kommission vom 26.<br />
Februar 2009 zur Änderung des Anhangs IV der Ver-<br />
ordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parla-<br />
ments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung,<br />
Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler<br />
spongiformer Enzephalopathien<br />
Dipl. Ing. Thomas Kuhn<br />
thomas.kuhn@ages.at<br />
Dr. Richard Öhlinger<br />
richard.oehlinger@ages.at<br />
Dr. Renate Oeschlmüller<br />
renate.oeschlmueller@ages.at<br />
Dipl. Ing. Irmengard Strnad<br />
irmengard.strnad@ages.at<br />
Dr. Karl Walter Wagner<br />
karl-walter.wagner@ages.at<br />
Univ.-Doz. Dr. Herbert Würzner<br />
herbert.wuerzner@ages.at<br />
Institut für Futtermittel<br />
Abteilung Düngemittelüberwachung und Mikroskopie<br />
Kompetenzzentrum für Tierarzneimittel<br />
und Hormone Wien<br />
45
gesundheit für mensch,<br />
tier und pflanze<br />
daten, statistik<br />
und risikobewertung<br />
landwirtschaft<br />
Impressum<br />
Herausgeber:<br />
<strong>AGES</strong> - Österreichische Agentur für<br />
Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH<br />
Spargelfeldstr. 191, 1220 Wien<br />
www.ages.at<br />
Fotos: bmlfuw, ages, agrarfoto, fotolia<br />
Graphische Gestaltung: Agentur WIRZ<br />
© <strong>AGES</strong>, Oktober 2009<br />
lebensmittel<br />
analytik-Kompetenzzentren Veterinärmedizin<br />
eterinärmedizin<br />
pharmmed —<br />
arzneimittel und<br />
medizinprodukte<br />
humanmedizin