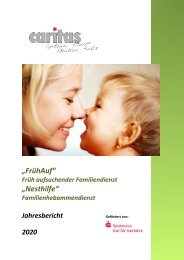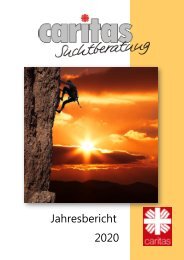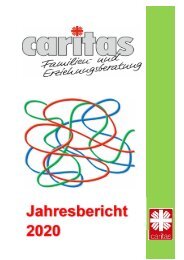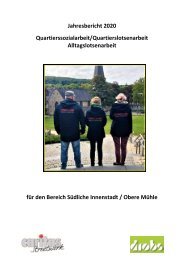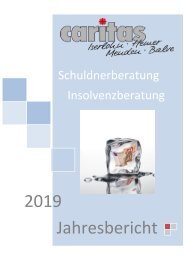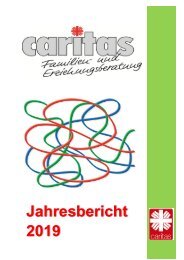SuchtberatungJahresbericht 2019
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
B<br />
Jahresbericht<br />
<strong>2019</strong>
INHALTSVERZEICHNIS<br />
1. Einleitung<br />
2. Zielsetzung/Konzeption<br />
3. Strukturdaten<br />
4. Klientenstruktur/Statistische Daten und Auswertung<br />
4.1 Einmalkontakte<br />
4.2 Längerfristige Betreuungen<br />
4.3 Nationalität<br />
4.4 Vermittlung/Zugangswege<br />
4.5 Altersstruktur<br />
4.6 Familienstand<br />
4.7 Wohnsituation<br />
4.8 Schulabschluss/Erwerbsstatus/Arbeitslosigkeit<br />
4.9 Suchtproblematik bei Beginn der Betreuung<br />
4.10 Psychiatrische Zusatzdiagnosen<br />
4.11 Maßnahmen während der Betreuungen<br />
4.12 Betreuungsbeendigungen<br />
5. Kooperation und Vernetzung<br />
5.1 Intern / Caritas-Netzwerk<br />
5.2 Extern / Kooperationen<br />
5.3 Arbeitskreise<br />
6. Bildungsmaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit<br />
6.1 Fortbildungen<br />
6.2 Informationsveranstaltungen<br />
7. Schwerpunktthemen <strong>2019</strong><br />
7.1 CHAMÄLEON - Kinder aus sucht- und seelisch belasteten Familien<br />
7.2 Glücksspielsucht<br />
7.3 Online-Beratung<br />
7.4 Medienabhängigkeit / Internetsucht<br />
7.5 Cari-Point – Selbsthilfegruppe<br />
8. Qualitätssicherung<br />
8.1 Qualitätssicherungssystem EFQM<br />
8.2 PATFAK Light / Computergestützte Dokumentation und Auswertung<br />
8.3 Unabhängige Beschwerdestelle im Märkischen Kreis<br />
9. Resümee/Ausblick<br />
10. Dank<br />
Zur besseren Lesbarkeit wurden in<br />
diesem Jahresbericht Fallbeispiele<br />
und Zitate farblich hinterlegt<br />
Bild Vorderseite: Fotolia<br />
- 2 -
1. Einleitung<br />
„In den letzten 25 Jahren gehörte mein Glas Wein zum Feierabend einfach dazu, ich fand<br />
das völlig normal, bis es im Laufe der Jahre immer mehr wurde. Aus dem Glas wurden<br />
schließlich zwei Flaschen. Als ich eines Morgens mit Restalkohol meinen Führerschein<br />
verlor, wurde mir klar, dass ich ein Problem habe.“<br />
Herr H. (54 Jahre)<br />
Nach aktuellen Schätzungen der Diözesan-Caritasverbände in NRW<br />
gibt es in Nordrhein-Westfalen etwa 550 000 behandlungsbedürftige<br />
Alkoholkranke und etwa 1,6 Millionen Mitbetroffene. Die Zahl<br />
der behandlungsbedürftigen Medikamentenabhängigen liegt bei<br />
etwa 350 000 Menschen. Zu den ca. 40 000 Glücksspielabhängigen<br />
kommen Menschen hinzu, die von weiteren nichtstoffgebundenen<br />
Süchten abhängig sind, wie z.B. der Arbeits-, Internet-, Kaufsucht<br />
oder mit Essstörungen. Die für Iserlohn zuständige Psychosoziale<br />
Suchtberatung des Caritasverbandes Iserlohn, Hemer, Menden,<br />
Balve e. V. ist Teil des Suchthilfesystems im Märkischen Kreis, das<br />
den individuellen somatischen, psychischen und sozialen Folgen der<br />
Abhängigkeitserkrankung mit ihren unterschiedlichen Indikationen<br />
und Problemstellungen angemessene Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten<br />
entgegenstellt.<br />
Wie in den Vorjahren befand sich auch im letzten Jahr der<br />
durchschnittliche Suchtmittelkonsum in Deutschland auf einem<br />
sehr hohen Niveau. Gemäß Drogen- und Suchtbericht <strong>2019</strong> stellt<br />
Alkohol bis heute ein Kernproblem in der deutschen Suchtpolitik<br />
dar. Etwa 9,5 Millionen Bundesbürger trinken Alkohol in gesundheitlich<br />
riskanter Menge. Etwa 1,77 Millionen gelten als alkoholabhängig,<br />
rund 74.000 sterben jedes Jahr an den Folgen.<br />
Rein statistisch trinkt jeder Deutsche im Schnitt 9,5 Liter<br />
Reinalkohol pro Jahr. Das entspricht einer Badewanne voll Bier,<br />
Wein und Spirituosen. Damit zählt Deutschland laut einer<br />
Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit<br />
und Entwicklung (OECD) zu den Hochkonsumländern. Nur in<br />
wenigen Ländern der 34 Mitgliedstaaten wird noch mehr<br />
getrunken. Hinter Luxemburg, Frankreich, Österreich und<br />
Estland liegt Deutschland auf Platz 5. Obwohl in Deutschland<br />
der durchschnittliche tägliche Alkoholkonsum rückläufig ist wächst<br />
gleichzeitig aber die Zahl der Abhängigen.<br />
Auch im vergangenen Jahr fanden viele Hilfesuchende den Weg in<br />
unsere Suchtberatungsstelle, die mit einer hohen Anzahl an<br />
kurzfristigen Beratungen und längerfristigen Betreuungen wieder<br />
ausgelastet war (Kap. 4.2).<br />
Im Berichtsjahr konnten wir unser Gruppenangebot der<br />
Nachsorgebehandlung im Rahmen des Kooperationsverbundes<br />
- 3 -
„Ambulante Rehabilitation Sucht Märkischer Kreis“ (ARS-MK)<br />
fortführen.<br />
Im vergangenen Jahr beschäftigte uns besonders die<br />
bemerkenswerte Benefiztour „Chamäleon durch Europa“, welche<br />
von Dennis Breiser initiiert wurde. Vom 21.04.2018 bis zum<br />
31.08.<strong>2019</strong> fuhr er 16.540 km mit seinem Fahrrad quer durch<br />
Europa, um auf die vergessenen Kinder aus sucht- und seelisch<br />
belasteten Familien aufmerksam zu machen und unsere<br />
CHAMÄLEON-Gruppen in Iserlohn und Menden zu unterstützen<br />
(Kap. 7.1).<br />
Die Zahl der Teilnehmer an Automatenspielen und Sportwetten<br />
steigt seit Jahren stetig an. Einer Studie der Bundesregierung<br />
zufolge finden sich aber gerade unter dieser Gruppe besonders<br />
häufig sogenannte Problemspieler, die als spielsüchtig gelten<br />
müssen oder durch das regelmäßige Glücksspiel massive<br />
Schwierigkeiten im Alltag haben. Mittlerweile bitten auch in unserer<br />
Beratung immer mehr Klienten mit Suchtproblemen im Online-<br />
Glücksspielbereich um Hilfe. Nach Experteneinschätzung ist bei<br />
diesen Angeboten im unregulierten und größtenteils illegalen Markt<br />
die Suchtgefahr nochmals deutlich erhöht.<br />
Aufmerksamen Fernsehzuschauern wird nicht entgangen sein, dass<br />
besonders im vergangenen Jahr die Werbung für Onlinecasinos und<br />
Online-Sportwetten massiv zugenommen hat. Auch diese aus<br />
- 4 -
unserer Sicht Besorgnis erregende Entwicklung weist auf massive<br />
Veränderungen auf dem Glücksspielmarkt hin mit neuen Zugangswegen<br />
und oftmals stark unterschätzten Gefahren (Kap. 7.2).<br />
Im Frühjahr <strong>2019</strong> wurde schließlich die Computerspielsucht<br />
(Gaming disorder) von der WHO als diagnostizierbares Störungsbild<br />
und somit als Erkrankung anerkannt (Kap. 7.4). Hiermit ist die<br />
Grundlage für eine bessere Versorgung für die Betroffenen und<br />
Angehörigen geschaffen.<br />
Leider verstarben im Jahr <strong>2019</strong> auch zwei sehr wichtige und<br />
engagierte Personen in Iserlohn und Hemer, die die Sucht-<br />
Selbsthilfe im nördlichen Märkischen Kreis nachhaltig geprägt<br />
haben und deren Tod wir zutiefst bedauern:<br />
Esther Vogt, als Mitbegründerin des AK Sucht nördlicher<br />
Märkischer Kreis, Leiterin der Selbsthilfegruppe Blaues Kreuz in<br />
Hemer und Leiterin der Frauenseminare des Blauen Kreuz<br />
Deutschland haben wir eine couragierte und beherzte Persönlichkeit<br />
verloren. Sie verstarb am 18.09.<strong>2019</strong>. Sie wird uns mit ihrer<br />
unermüdlichen Art und ihrem Engagement im Suchthilfesystem in<br />
Iserlohn und Umgebung fehlen.<br />
Mit Hans Stumm, Gründer der AA’s in Iserlohn, Gründer der<br />
„Flaschenkinder“ und Autor verschiedener Bücher haben wir<br />
ebenfalls eine starke Persönlichkeit aus Iserlohn verloren. Er war<br />
bis zu seinem Tod immer unermüdlich für Kinder aus<br />
suchtbelasteten Familien im Einsatz. Mit seinem beharrlichen<br />
Engagement hat er immer wieder dafür gesorgt, dass diese Kinder<br />
Unterstützung erhalten und nicht in Vergessenheit geraten. Hans<br />
Stumm verstarb am 18.01.<strong>2019</strong>.<br />
- 5 -
2. Zielsetzung/Konzeption<br />
Jährlich werden in Deutschland mehr als eine halbe Millionen<br />
suchtkranke Menschen und deren Angehörige jährlich in ca. 1.500<br />
Suchtberatungsstellen erreicht, betreut und in weiterführende<br />
Behandlungen vermittelt. Mit ihrer Brückenfunktion zwischen den<br />
hilfesuchenden Menschen und dem Gesundheitssystem trägt die<br />
Suchtberatung nachweislich dazu bei, die Not und Erkrankung der<br />
Klienten und Klientinnen zu verringern oder sogar zu verhindern<br />
und so die Folgekosten der Suchterkrankung zu verringern.<br />
Suchtberatung in dieser Form angeboten, hat ein Alleinstellungsmerkmal,<br />
das nicht von anderen Leistungserbringern im<br />
Gesundheitswesen erbracht werden kann, nicht von Ärzten und<br />
Ärztinnen, auch nicht von niedergelassenen Therapeuten und<br />
Therapeutinnen.<br />
Eine gut ausgebaute kommunale Suchthilfe und frühere Hilfen<br />
können Leben retten! Sie stehen für:<br />
• niedrigschwellige Zugangsmöglichkeiten zu einem qualifizierten<br />
Hilfeangebot, auch digital,<br />
• Raum zur Entwicklung einer vertrauensvollen Beziehung, um<br />
weitergehende Hilfeleistungen wie Beratung, Vermittlung oder<br />
Behandlung erst zu ermöglichen,<br />
• Vermittlung in weiterführende Hilfen bzw. Rehabilitation und in<br />
Sucht-Selbsthilfe,<br />
• bedarfsgerechte Beratung und Begleitung in Bezug auf die<br />
Anliegen und Problematiken von Klienten und Klientinnen, auch<br />
über den Suchtmittelkonsum hinaus,<br />
• Erschließung des Zugangs zu einem regionalen Hilfenetzwerk für<br />
Betroffene.<br />
- 6 -
Seit 1993 leistet die Psychosoziale Suchtberatung des<br />
Caritasverbandes Iserlohn, Hemer, Menden, Balve e. V. im Verbund<br />
der Iserlohner Beratungsstellen ihren Dienst im Suchthilfesystem<br />
des Märkischen Kreises mit den Schwerpunkten Alkohol und<br />
Glücksspielsucht wie auch in der Beratung bei weiteren legalen<br />
stoffgebundenen (Medikamente) und nicht substanzbezogenen<br />
Süchten (z.B. pathologisches Kaufen) und komplettiert das<br />
Beratungsangebot Iserlohns. In den von uns erbrachten<br />
Dienstleistungen steht der Mensch mit seiner seelischen, sozialen,<br />
geistigen und körperlichen Gesundheit im Mittelpunkt.<br />
Die Angebote der Beratungsstelle richten sich an Konsumenten,<br />
Angehörige und Interessierte, die umfassende Beratung,<br />
Begleitung und Unterstützung suchen und eine Veränderung ihrer<br />
aktuellen Lebenssituation anstreben. Im Rahmen ihrer auf den<br />
individuellen Einzelfall ausgerichteten Tätigkeiten übernimmt die<br />
Suchtberatungsstelle folgende Aufgaben:<br />
• Umfassende Information und Beratung<br />
• Einbeziehung von Selbsthilfeaktivitäten und ihre Vermittlung<br />
• Einbeziehung von Angehörigen und weiteren Bezugspersonen<br />
• Begleitende Hilfen im sozialen Umfeld<br />
• Sozialberatung<br />
• Vorbereitung und Vermittlung in Entgiftungs- und<br />
Entwöhnungsmaßnahmen<br />
• Durchführung einer Nachsorgebehandlung<br />
• Kriseninterventionen<br />
• Prävention<br />
Das Thema Glücksspiel nimmt einen besonderen Schwerpunkt in<br />
unserer Arbeit ein. Das Angebot in diesem Bereich wird ergänzt<br />
durch eine angeleitete Gruppe für pathologische Glücksspieler und<br />
deren Angehörige (Kap. 7.2).<br />
Die Suchtberatung unterstützt die um Rat suchenden Menschen in<br />
ihrer Motivation zur möglichst abstinenten Lebensführung und<br />
fördert ihre Veränderungsbereitschaft. Unser Angebot trägt dazu<br />
bei, deren gesundheitliche, psychische und soziale Lebenssituation<br />
schrittweise zu stabilisieren und nachhaltig zu verbessern.<br />
In unserer Arbeit orientieren wir uns an der Rahmenkonzeption für<br />
ambulante Beratungs- und Behandlungsstellen der Suchthilfe der<br />
Caritas und ihrer Fachverbände in NRW.<br />
Die chronische Krankheit Sucht erfolgreich zu behandeln bedeutet<br />
in der Regel, das manifeste Stadium der Sucht zu überwinden und<br />
den Widerausbruch zu verhindern. Dabei beraten wir vorrangig<br />
nach dem integrativen und systemischen und verhaltenstherapeutischen<br />
Ansatz. Da eine sinnvolle Beratung und Betreuung<br />
- 7 -
nur Erfolg versprechend ist, wenn die Befriedigung der<br />
Grundbedürfnisse weitestgehend sichergestellt ist, berücksichtigen<br />
wir in unseren Gesprächen auch die Bereiche der allgemeinen<br />
Sozialberatung, wie Wohnen, Arbeit, soziale Beziehungen und die<br />
finanzielle Situation.<br />
Die Angebote der Beratungsstelle orientieren sich am individuellen<br />
Hilfebedarf und an den persönlichen Fähigkeiten und Ressourcen<br />
der Betroffenen, wobei der Blick nicht nur auf die suchtgefährdeten<br />
und suchtkranken Menschen, sondern auch auf die mit betroffenen<br />
Menschen im sozialen Umfeld gerichtet ist.<br />
Die jeweils konkreten Ziele werden zusammen mit dem<br />
Hilfesuchenden im Rahmen der Beratung erarbeitet. Diese Ziele<br />
können sehr unterschiedlich sein: Angefangen bei der Sicherung<br />
des Überlebens über die Reduzierung der Trinkmenge bis zur<br />
dauerhaften Abstinenz. Diese Ziele sind nicht statisch sondern in<br />
Absprache, entsprechend der jeweiligen Lebenssituation,<br />
veränderbar.<br />
- 8 -
3. Strukturdaten<br />
Die Suchtberatung arbeitet mit zwei Fachkräften und einer<br />
Verwaltungskraft und ist zuständig für die Versorgung der etwa<br />
95.000 Iserlohner Bürger. Durch die Lage im innerstädtischen<br />
Bereich in unmittelbarer Nähe der Iserlohner Fußgängerzone ist<br />
eine verkehrsgünstige Erreichbarkeit, insbesondere mit dem<br />
öffentlichen Nahverkehr gegeben.<br />
Der Beratungsstelle stehen zwei Büros und ein Gruppenraum zur<br />
Verfügung. Sie ist mit einem Faxgerät und einer Telefonanlage mit<br />
Anrufbeantwortern ausgestattet. Während der Öffnungszeiten sind<br />
wir telefonisch erreichbar. In der Regel erfolgen Beratungsgespräche<br />
nach Terminvereinbarung. Für Berufstätige werden auch<br />
Termine nach 17.00 Uhr angeboten.<br />
Zeitliche Erreichbarkeit :<br />
montags und dienstags<br />
mittwochs<br />
donnerstags<br />
freitags<br />
8:00 – 16:30 Uhr<br />
8:00 – 18:30 Uhr<br />
8:00 – 17:00 Uhr<br />
8:00 – 14:00 Uhr<br />
Offene Angebote:<br />
Offene Sprechstunde<br />
montags (wöchentlich)<br />
13:30 – 16:00 Uhr<br />
Gruppenangebot:<br />
Angeleitete Selbsthilfegruppe<br />
Glücksspiel<br />
mittwochs (zweiwöchentlich)<br />
Nachsorgegruppe<br />
montags (wöchentlich)<br />
17:30 – 19:00 Uhr<br />
17:30 – 19:30 Uhr<br />
Die Suchtberatung verfügt über zwei im Netzwerk verbundene<br />
Computerarbeitsplätze. Die Klientenerfassung und –verwaltung<br />
erfolgt mit dem Programm PATFAK Light (Kap. 8.2).<br />
- 9 -
4. Statistische Daten und Auswertung<br />
Im Jahr <strong>2019</strong> nahmen insgesamt 451 Hilfesuchende Kontakt zu<br />
unserer Beratungsstelle auf. In 300 Fällen handelte es sich dabei<br />
um Einmalkontakte, bei 151 Klienten kam es zu längerfristigen<br />
Betreuungen.<br />
4.1 Einmalkontakte<br />
„Unser 24-jähriger Sohn ist seit ein paar Jahren glücksspielabhängiger Automatenspieler.<br />
Wir haben ihn vor einem Jahr aus unserem Haus geschmissen, weil er zum wiederholten<br />
Male Geld und Wertgegenstände geklaut hat. Wir fühlten uns in unserem eigenen Haus<br />
nicht sicher. Wir sind Selbstständig und arbeiten sehr hart für unser Geld. Unser Sohn hat<br />
erst Fachabitur gemacht und dann eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Bis vor 2 Jahren lief<br />
alles gut, dann veränderte sich unser Sohn zunehmend. Er log, betrog und stahl, seit einem<br />
Jahr hat er jetzt eine eigene Wohnung, die jetzt wegen Mietschulden gekündigt wurde. Jetzt<br />
wollte er zurück zu uns, eine Behandlung wegen seiner Spielsucht lehnt er kategorisch ab.<br />
Wir wollen nur wissen, ob es wirklich richtig ist, dass wir ihn jetzt nicht wieder zu Hause<br />
aufnehmen. Es fällt uns unendlich schwer, aber ohne Krankheitseinsicht sehen wir einfach<br />
keine Möglichkeit mehr, ihm zu helfen.“<br />
Ehepaar U. (beide Anfang 50)<br />
Im Jahr <strong>2019</strong> fanden 300 Einmalkontakte statt (160 Männer und<br />
140 Frauen). Dabei kam es jeweils zu einem telefonischen oder<br />
persönlichen Gesprächstermin im Berichtsjahr. Bei den Einmalkontakten<br />
hatten 185 Personen eine eigene Suchtproblematik,<br />
weitere 115 Personen kamen aus dem familiären Umfeld von<br />
suchterkrankten Personen oder aus dem sonstigen Umfeld.<br />
Einmalkontakte<br />
115<br />
Eigene Problematik<br />
Personen im sozialen Umfeld<br />
185<br />
Personen im sozialen Umfeld sind häufig professionelle Helfer aus<br />
dem ambulant betreuten Wohnen (ABW), aber auch<br />
Berufsbetreuer, Freunde, Nachbarn oder Arbeitskollegen. Auffällig<br />
ist, dass überwiegend weibliche Angehörige um Hilfe im Umgang<br />
mit einem suchterkranken Angehörigen baten.<br />
- 10 -
4.2. Längerfristige Betreuungen<br />
Geschlechterverteilung<br />
91<br />
männlich<br />
weiblich<br />
60<br />
In 151 Fällen kam es zu längerfristigen Betreuungen (91<br />
Männer und 60 Frauen). Bei diesen Kontakten fanden jeweils<br />
mindestens zwei Gesprächstermine im Berichtsjahr statt.<br />
Mit 40% ist die Gewichtung des Frauenanteils im Vergleich zu den<br />
Vorjahren gleich geblieben.<br />
- 11 -
Fallbeispiel: Herr A (35 Jahre):<br />
“Ich habe schon mein Leben lang mit dem Saufen zu tun. Mein Vater war auch Alkoholiker.<br />
Er war auf Montage und meistens nicht da. Wenn es Geld gab, versoff er es in der Kneipe<br />
und kam dann betrunken nach Hause. Häufig schlug er uns und meine Mutter. Nicht selten<br />
haben wir gehungert und es fehlte an den einfachsten Sachen, wie z. B. Klopapier. Später<br />
haben sich meine Eltern dann getrennt, von da an hatte ich gar keinen Kontakt mehr zu<br />
meinem Vater. Ich weiß nur dass er irgendwann obdachlos gewesen sein soll und sich wohl<br />
tot gesoffen hat.<br />
Lügen und verheimlichen gehörte in meinem Alltag dazu. In der Schule durfte niemand<br />
etwas mitbekommen. Ich habe mir geschworen, niemals so zu werden wie mein Alter, aber<br />
irgendwie ist es dann doch anders gekommen. Mit 12 Jahren habe ich dann das erste Mal<br />
Alkohol probiert. Ich spürte die entspannende und auch euphorisierende Wirkung von<br />
Alkohol, von da an trank ich regelmäßig mit meinen Freunden. Mit 16 Jahren kam dann das<br />
Kiffen dazu und ich später zog ich sporadisch Amphetamine. Ich glaubte immer alles im Griff<br />
zu haben.<br />
Als ich dann mit 18 Jahren meine Freundin kennenlernte, schraubte ich meinen Konsum<br />
runter, illegale Drogen nahm ich überhaupt nicht mehr. Als sie mit 20 Jahren schwanger<br />
wurde, heirateten wir. Jetzt hatte ich eine eigene richtige kleine Familie! Ich bekam einen<br />
Job in einer Gießerei und konnte meine Familie ernähren. Das Feierabendbier gehörte<br />
selbstverständlich dazu, am Wochenende konsumierte ich mit ein paar Freunden auch mal<br />
mehr. Irgendwie lief in den nächsten Jahren alles gut, bis zu dem Tag, als ich meine Frau<br />
mit meinem besten Freund in unserem Ehebett erwischte. Da brach für mich eine Welt<br />
zusammen. Ich nahm ein paar Sachen, einen Schlafsack und kehrte nicht mehr nach Hause<br />
zurück. Ich betrank mich tagelang bis zur Besinnungslosigkeit. Ich hob soviel Geld von<br />
meinem Konto ab, wie ich bekommen konnte. Sollte sie doch sehen wo sie blieb. Mir war<br />
eigentlich alles egal. Ich verlor meinen Job, weil ich einfach nicht mehr hinging, wozu? Es<br />
war doch sowieso alles vorbei. Mein Leben war ein einziger Scherbenhaufen. Ich lebte bei<br />
wechselnden Saufkumpanen, war obdachlos, hatte keine Familie mehr und war völlig allein.<br />
Alkohol bestimmte mein Leben. Inzwischen benötigte ich schon morgens meinen Schnaps<br />
um meinen körperlichen Entzug kontrollieren zu können.<br />
Irgendwann trank ich mich ins Koma und wachte in der Hans-Prinzhorn-Klinik wieder auf. Ich<br />
hatte Glück und die behandelnde Ärztin führte ein Gespräch mit mir, sie wollte wissen, wie<br />
es zu meiner jetzigen Situation gekommen sei. Hier hörte mir zum ersten Mal jemand zu und<br />
ich merkte, dass es so nicht weiter gehen konnte. Sie bot mir eine qualifizierte Entgiftung für<br />
3 Wochen an und eine Vermittlung in eine Langzeitentwöhnungs-behandlung. Da der<br />
Sozialdienst in der Hans-Prinzhorn-Klinik überlastet war, legte man mir einen Besuch in der<br />
Suchtberatung in Iserlohn nahe. Die dortige Mitarbeiterin Frau von Holten vermittelte mich<br />
dann in eine Langzeittherapie. Insgesamt durfte ich 5 Wochen in der Hans-Prinzhorn-Klinik<br />
bleiben, damit meine Therapie nahtlos beginnen konnte. Während der Therapie in Dortmund<br />
suchte ich mir eine neue Wohnung in Iserlohn und beantragte ALG II. Nach der Therapie<br />
vermittelte mich Frau von Holten noch ins ambulant betreute Wohnen und zeitgleich<br />
besuchte ich regelmäßig die Nachsorgegruppe der Suchtberatung.<br />
Ich bin jetzt seit einigen Monaten trocken. Rückblickend hätte ich nie gedacht, dass mir in<br />
meinem Leben so was passiert. Für mich waren Obdachlose immer Leute die selber Schuld<br />
waren an ihrer Misere, weil sie nicht arbeiten wollten. Dass ich selber da mal rein gerate<br />
hätte ich nicht gedacht. In der Therapie habe ich gelernt über Probleme zu reden, das<br />
möchte ich auch jetzt weiter machen. Aus der Zeit der Obdachlosigkeit habe ich noch viele<br />
Schulden und meine Ex-Frau verweigert mir zur Zeit noch den Kontakt zu meiner Tochter.<br />
Hier muss ich vermutlich einen Rechtsanwalt einschalten. Ein Job ist auch noch nicht in<br />
Aussicht, eine Lücke von zwei Jahren im Lebenslauf macht sich nicht so gut. Die Leute<br />
fragen halt, was man in dieser Zeit gemacht hat, wenn man dann ehrlich ist, hat man<br />
meistens sowieso keine Chance mehr. Trotz der vielen Probleme, hoffe ich trotzdem, dass<br />
ich abstinent bleibe. Deshalb ist mir der regelmäßige längerfristige Kontakt zur<br />
Suchtberatung wichtig.“<br />
- 12 -
4.3 Nationalität<br />
In <strong>2019</strong> waren 139 der langfristig betreuten Personen deutsche<br />
Staatsangehörige, 7 Personen hatten die polnische Staatsbürgerschaft.<br />
Bei 5 Personen lag eine andere Staatsbürgerschaft<br />
vor.<br />
Staatsangehörigkeit<br />
139<br />
Deutschland<br />
Polen<br />
Libanon<br />
Bosnien-Herzegowina<br />
Kasachstan<br />
Italien<br />
1<br />
1<br />
2<br />
1<br />
7<br />
Die Kommunikation mit fremdsprachigen Klienten verlief<br />
größtenteils zufrieden stellend, da diese über ausreichende<br />
Deutschkenntnisse verfügten oder im Einzelfall in Begleitung von<br />
Personen waren, die übersetzten.<br />
- 13 -
4.4 Vermittlung / Zugangswege<br />
Vermittlung durch ...<br />
ohne Vermittlung<br />
80 75<br />
70<br />
Familie/Freunde<br />
Arbeitgeber/Schule<br />
Agentur für Arbeit/Jobcenter<br />
60<br />
Justizbehörde/Bewährungshilfe/JVA<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
21<br />
2<br />
2 2<br />
4 6<br />
14<br />
6<br />
3 1<br />
11<br />
5<br />
Kosten-/Leistungsträger<br />
Arzt/Psychotherapeut<br />
Krankenhaus<br />
stat. / teilstat. Suchteinrichtung<br />
andere Beratungsdienste<br />
Betreute Wohnangebote<br />
Sonstige<br />
Wie in den vergangenen Jahren kamen auch im Berichtsjahr mit 75<br />
Personen vergleichsweise viele unserer Klienten aus eigenem<br />
Antrieb ohne fremde Vermittlung zu uns, 21 kamen auf Anraten<br />
und Drängen von Familienangehörigen.11 Personen wurden durch<br />
Angebote des ambulant betreuten Wohnens zu uns vermittelt. Die<br />
Zahl der vom Arbeitgeber vermittelten Klienten hat mit 2 Personen<br />
im Vergleich zum Vorjahr abgenommen.<br />
Im Jahr <strong>2019</strong> wurden 2 Klienten betreut, die direkt von der<br />
Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter an uns übermittelt wurden<br />
(Kap. 4.8). Dieser hatte jedoch zu Beginn der Beratung keine<br />
Eingliederungsvereinbarung unterzeichnet. Somit handelte es sich<br />
hierbei um ein freiwillig wahrgenommenes Angebot ohne<br />
entsprechende Auflagen.<br />
- 14 -
4.5 Altersstruktur<br />
Altersstruktur<br />
über 60<br />
51 - 60<br />
6<br />
10<br />
21<br />
30<br />
weiblich<br />
männlich<br />
41 - 50<br />
23<br />
24<br />
31 - 40<br />
9<br />
17<br />
21 - 30<br />
1<br />
8<br />
unter 21<br />
0<br />
2<br />
0 5 10 15 20 25 30 35<br />
Der Hauptanteil der Ratsuchenden kam auch in diesem Jahr sowohl<br />
bei Männern (54) wie auch bei Frauen (44) aus der Altersgruppe<br />
der 41 - 60jährigen. Im Vergleich zu den Vorjahren ist hier der<br />
Anteil der Männer und Frauen annähernd gleich geblieben.<br />
Die Zahl der Ratsuchenden im Alter von 31 - 40 Jahren ist mit 26<br />
Personen im Vergleich zu den Vorjahren gleich geblieben.<br />
Der Anteil der über 60-jährigen Klienten hat mit 16 Personen im<br />
Vergleich zum Vorjahr etwas abgenommen.<br />
Die Anzahl von 11 Personen in der Altersgruppe der bis 30-jährigen<br />
lässt sich unter anderem durch den Anteil von Glücksspielabhängigen<br />
erklären, deren Suchtproblematik im Vergleich zum<br />
Alkohol in der Regel sehr viel früher auffällig wird (Kap. 7.2). Hier<br />
zeigen sich auch die ersten jungen Menschen mit ausgeprägten<br />
Problemen beim Computergebrauch (Spielen, Chatten und Surfen<br />
im Internet, Kap. 7.4). Aber auch die Klienten mit Alkoholproblemen<br />
werden mittlerweile beispielsweise durch wiederholte<br />
Straftaten oder Krankenhauseinlieferungen mit Alkoholvergiftungen<br />
früher auffällig und finden mittlerweile darüber den Weg in unsere<br />
Beratungsstelle.<br />
- 15 -
4.6 Partnerschaft<br />
Partnerschaft<br />
Allein lebend<br />
22<br />
39<br />
weiblich<br />
männlich<br />
Partnerschaft<br />
36<br />
51<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
Im vergangenen Jahr befanden sich 57 % unserer Klienten (87<br />
Personen) in einer Partnerschaft. In diesen Fällen wurde auch die<br />
eventuelle Co-Abhängigkeit von den Angehörigen thematisiert und<br />
weiterführende Hilfe empfohlen und angeboten.<br />
„Meine Kinder sind erwachsen und haben nach der Trennung von meiner Frau vor einigen<br />
Jahren den Kontakt zu mir abgebrochen. Ich lebe jetzt alleine in meinem Haus. Bis vor zwei<br />
Jahren habe ich 41 Jahre immer nur gearbeitet, durch Krankheit bin ich arbeitslos geworden.<br />
Ich habe keine Freunde und auch keine Hobbys. Wenn ich trinke, brauche ich die Stille und<br />
die Einsamkeit nicht mehr aushalten, dann vergehen die Tage schneller. “<br />
Herr W. (57 Jahre)<br />
Auffällig ist, dass mit 40 % ein Großteil unserer Hilfesuchenden<br />
(61 Personen) ohne feste Partnerschaft lebt. In diesem Trend<br />
zeigt sich ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, in dem immer<br />
weniger Betroffene über einen starken familiären Rückhalt<br />
verfügen, der sie in Krisensituationen auffangen kann. Einen<br />
Schwerpunkt in der Beratung nimmt demzufolge die<br />
Aufrechterhaltung und Schaffung von sozialen Netzwerken unserer<br />
Klienten ein.<br />
- 16 -
4.7 Wohnsituation<br />
Von 151 Klienten wohnten 125 (74 männliche und 51 weibliche)<br />
Personen selbständig, allein oder mit Partner. 5 Personen gaben als<br />
Adresse Freunde oder Verwandte an, in einer ambulanten oder<br />
stationär betreuten Wohnform lebten 18 Personen, 3 Personen<br />
lebten in einer Notunterkunft oder waren Wohnungslos.<br />
Wohnsituation<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
74<br />
männlich<br />
weiblich<br />
51<br />
12<br />
6<br />
3<br />
2<br />
2<br />
1<br />
selbständiges Wohnen mit anderen Personen ABW Wohnungslos/Notunterkunft<br />
- 17 -
4.8 Schulabschluss / Erwerbsstatus / Arbeitslosigkeit<br />
Ein hoher Anteil der in <strong>2019</strong> betreuten Klienten besaß eine<br />
vergleichsweise niedrige Schulbildung: 10 Betreute verließen die<br />
Schule ohne Abschluss, 66 Personen hatten einen<br />
Hauptschulabschluss, 6 Personen hatten einen anderen<br />
Schulabschluss, wobei es sich hier in der Mehrzahl um Abschlüsse<br />
von Förderschulen handelte. 40 Personen beendeten ihre<br />
Schullaufbahn mit einem Realschulabschluss, 29 hatten Abitur.<br />
6<br />
10<br />
Höchster Schulabschluss<br />
Hauptschulabschluss<br />
Realschulabschluss<br />
29<br />
(Fach)Abitur<br />
Sonstiger Abschluss<br />
ohne Schulabschluss<br />
40<br />
66<br />
Arbeitslosigkeit war wie in den Vorjahren ein zentrales Problem,<br />
von dem 33 % unserer Kunden (50) betroffen waren. Von den 50<br />
arbeitslos gemeldeten Klienten bezogen 44 Personen ALG II. 6<br />
Personen bezogen Arbeitslosengeld I. Der hohe Anteil der ALG-II-<br />
Erwerbsstatus<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
46<br />
8<br />
5<br />
0<br />
4<br />
16<br />
44<br />
6<br />
17<br />
1<br />
Arbeiter/Angestellte/Beamte/in<br />
Selbständige/r<br />
Sonstiger Erwerb, Elternzeit<br />
Schüler/Student/in<br />
Hausfrau/mann<br />
Rentner/in<br />
Arbeitslos ALG II<br />
Arbeitslos ALG I<br />
Grundsicherung SGB XII<br />
In beruflicher Ausbildung<br />
0<br />
- 18 -
Empfänger in unserer Jahresstatistik zeigt deutlich, dass Sucht ein<br />
großes Vermittlungshemmnis darstellt und zu längerfristiger<br />
Arbeitslosigkeit führt. In dieser Zahl sind EU-Rentner und<br />
Grundsicherungsempfänger oder andere nicht erwerbstätige<br />
Personengruppen noch nicht berücksichtigt.<br />
In den letzten Jahren fällt bei unseren Klienten ein immer stärker<br />
zunehmender Anteil erwerbsunfähiger Personen auf, die<br />
Grundsicherung nach dem SGB XII und/oder eine<br />
Erwerbsunfähigkeitsrente erhalten. Mit 13% hat sich dieser<br />
Anteil im Vergleich zu den Vorjahren nicht wesentlich verändert.<br />
Hierbei handelt es sich um Menschen, welche längerfristig nicht<br />
mehr in der Lage sind, für mindestens 3 Stunden pro Tag einer<br />
Erwerbstätigkeit nachzugehen. Ein Teil der langzeitarbeitslosen<br />
Menschen sind psychisch und physisch so schwer erkrankt, dass sie<br />
von dem medizinischen Dienst des Jobcenters in die<br />
Grundsicherung überführt werden. Leistungen nach dem SGB XII<br />
werden erst gezahlt, wenn der eigene Lebensunterhalt nicht aus<br />
einer ausreichenden Erwerbsunfähigkeitsrente bestritten werden<br />
kann, weil der Empfänger zu geringe Beiträge oder zu kurze<br />
Beitragszeiten bei der Deutschen Rentenversicherung vorweisen<br />
kann, oder weil ein Antrag auf eine Erwerbsunfähigkeitsrente<br />
abgelehnt wurde. Die Grundsicherung und auch die<br />
Erwerbsunfähigkeitsrente werden in der Regel erst einmal für zwei<br />
Jahre gezahlt. Danach wird durch eine erneute medizinische<br />
Überprüfung festgestellt, ob sich der gesundheitliche Zustand<br />
wieder verbessert hat und der Betroffene wieder dem Arbeitsmarkt<br />
zur Verfügung stehen kann. In diesem Fall erhält er dann wieder<br />
Leistungen vom Jobcenter.<br />
„Als ich vor einigen Jahren noch einen 1-€-Job in der Stadtreinigung hatte, war es für mich<br />
kein Problem, abstinent zu bleiben. Die Maßnahme wurde insgesamt vier Mal verlängert, so<br />
dass ich insgesamt zwei Jahre beschäftigt war. In dieser ganzen Zeit fühlte ich mich<br />
gebraucht und wertgeschätzt. Ich habe mich mit meinen Kollegen gut verstanden und hatte<br />
eine Tagesstruktur. Das war die beste Zeit in meinem Leben! Seither bin ich wieder auf der<br />
Arbeitssuche, aber mit 50 stellt einen sowieso keiner mehr ein. Das Jobcenter sagt mir, dass<br />
es so gut wie keine 1,50-€-Maßnahmen mehr gibt und wenn höchstens für 3 Monate. Das<br />
bringt ja dann für mich auch nichts mehr! Ich würde auch umsonst arbeiten, aber auch das<br />
geht wohl nicht, wegen der Versicherung. Seit einiger Zeit trinke ich wieder!“<br />
Herr K. (52 Jahre)<br />
Trotz der wirtschaftlich stabilen Lage in <strong>2019</strong> erhöhte sich das<br />
Angebot an Arbeitsplätzen für unsere langzeitarbeitslosen<br />
Betreuten nicht spürbar. Die Zahl der arbeitslosen Klienten in der<br />
Suchtberatung ist <strong>2019</strong> gleich geblieben. Leider kommen die<br />
meisten unserer Klienten nicht mehr aus der Armutsspirale heraus.<br />
Dieses Phänomen wird auch von einer Studie der Bertelsmann<br />
Stiftung bestätigt.<br />
- 19 -
5. Dezember <strong>2019</strong>, 8:04 Uhr<br />
Hohes Armutsrisiko trotz gesunkener Arbeitslosenzahlen<br />
Zehn Jahre nach der Finanzkrise haben sich die Arbeitsmärkte in vielen Industriestaaten<br />
erholt. Auf die Zahl der von Armut bedrohten Menschen hat dies aber keinen Effekt.<br />
Trotz eines Aufschwungs am Arbeitsmarkt ist in vielen westlichen Staaten die Armut nicht<br />
zurückgegangen. Dies geht aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor. Demnach<br />
stagniert das Armutsrisiko in 25 von 41 Staaten der Europäischen Union und der<br />
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) – oder sei<br />
sogar gestiegen. Dabei sind Minderjährige oftmals häufiger von Armut bedroht als alte<br />
Menschen.<br />
Mit ihrem sogenannten Social Justice Index untersucht die Bertelsmann-Stiftung jährlich<br />
die Teilhabechancen in den Mitgliedstaaten der EU und OECD anhand der sechs<br />
Dimensionen Armutsvermeidung, Arbeitsmarkt, Bildung, Gesundheit,<br />
Nichtdiskriminierung und Generationengerechtigkeit. An der Spitze liegen dabei dieses<br />
Jahr Island und Norwegen. Deutschland kommt auf Platz zehn. Die USA gehören<br />
demnach mit dem 36. Platz zu den Schlusslichtern…<br />
Fehlende Ausbildungsmöglichkeiten für über 25-jährige<br />
Suchtmittelabhängige und fast keine Umschulungs- und<br />
Qualifizierungsmaßnahmen führen zu Perspektivlosigkeit und<br />
verschlechtern den psychischen Gesundheitszustand unserer<br />
Klienten nachhaltig und machen eine Integration in den<br />
Arbeitsmarkt schwierig.<br />
In diesem Zusammenhang weisen wir auf die Forderung der Freien<br />
Wohlfahrtspflege hin, einen „Dritten Arbeitsmarkt“ einzurichten um<br />
unseren langzeitarbeitslosen Klienten eine sinnvolle und<br />
stabilisierende Beschäftigungsmöglichkeit und damit eine<br />
Zukunftsperspektive vermitteln zu können. Wir halten diese<br />
Forderung für sinnvoll und möchten sie an dieser Stelle unbedingt<br />
unterstützen.<br />
- 20 -
Pressemitteilung<br />
17. September <strong>2019</strong><br />
Endstation Hartz IV?<br />
Freie Wohlfahrtspflege NRW kritisiert, dass Ausstieg zu selten gelingt<br />
Düsseldorf, 17. September <strong>2019</strong>. Nur eine Minderheit schafft den Ausstieg aus Hartz<br />
IV und eine Rückkehr ins normale Berufsleben. Dies zeigt der aktuelle<br />
Arbeitslosenreport der Freien Wohlfahrtspflege NRW. Jeden Monat schaffen es<br />
lediglich knapp zwei Prozent der 1,16 Millionen erwerbsfähigen Hartz-IV-Bezieher in<br />
NRW, einen sozialversicherungspflichtigen Job zu bekommen. Die Hälfte kann davon<br />
nicht leben.<br />
Langzeitarbeitslose haben es schwer, der Armutsfalle zu entrinnen. Im vergangenen Jahr<br />
gab es in NRW monatlich nur knapp 20.000 Integrationen von Hartz-IV-Empfängern in eine<br />
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Hinzu kommt, dass diese nicht einmal in jedem<br />
zweiten Fall zu einem Ende des Hartz-IV-Bezugs führten. „Es kann nicht sein, dass<br />
Menschen, die in Vollzeit arbeiten, weiterhin auf staatliche Leistungen angewiesen sind“,<br />
kritisiert der Vorsitzende der Freien Wohlfahrtspflege NRW, Christian Heine-Göttelmann.<br />
„Und auch diejenigen, die etwa aus gesundheitlichen oder familiären Gründen nur in Teilzeit<br />
arbeiten können, dürfen nicht schief dafür angesehen werden, dass sie ihren Lohn noch mit<br />
Sozialleistungen aufstocken müssen.“<br />
Zudem befinden sich viele spätestens nach einem Jahr wieder in Hartz IV. Laut<br />
Arbeitslosenreport waren weniger als 11.000 Hartz-IV-Empfänger, die die Jobcenter im<br />
Dezember 2017 in sozialversicherungspflichtige Jobs vermittelt hatten, auch noch im<br />
Dezember 2018 beschäftigt. Mehr als jedes vierte sozialversicherungspflichtige<br />
Arbeitsverhältnis endete bereits innerhalb der ersten drei Monate nach der Integration. „Es<br />
genügt nicht, Menschen kurzfristig in Arbeit zu bringen“, betont Christian Heine-Göttelmann.<br />
„Sie müssen dauerhaft in Arbeit bleiben, denn nur so wird sich auch ihre soziale Situation<br />
langfristig stabilisieren.“<br />
Um die Chance auf nachhaltige Beschäftigung zu erhöhen, sollten Arbeitsplätze und<br />
Arbeitslose gut zueinander passen. Viel zu oft werden Arbeitslose in Jobs gedrängt, die nicht<br />
ihren persönlichen Fähigkeiten und Interessen entsprechen, beobachten die Verbände. „Die<br />
Betroffenen müssen mehr als bisher aktiv in den Vermittlungsprozess einbezogen werden“,<br />
fordert Heine-Göttelmann. „Die Jobcenter sollten sie dabei unterstützen, ihre gesamte<br />
berufliche und persönliche Situation realistisch einzuschätzen und individuelle Lösungswege<br />
zu finden.“<br />
Auch nach der Aufnahme einer Beschäftigung brauchen sie nach Ansicht des Vorsitzenden<br />
noch aktive Unterstützung und fachliche Beratung. „Ein unterstützendes Coaching ist<br />
wichtig, damit Menschen der Weg aus dem Hartz-IV-Bezug in den Arbeitsmarkt gelingt“, so<br />
Heine-Göttelmann. Solche Leistungen müssten aus Sicht der Freien Wohlfahrtspflege<br />
standardmäßig zu den Angeboten des Jobcenters für Langzeitarbeitslose gehören.<br />
Das im Januar gestartete Teilhabechancengesetz, von dem in NRW rund 15.000 besonders<br />
benachteiligte Langzeitarbeitslose profitieren sollen, beinhaltet bereits ein begleitendes<br />
Coaching. Die Beschäftigung wird in den ersten beiden Jahren zu 100 Prozent vom Staat<br />
gefördert, in den Jahren danach zu 90 bis 70 Prozent. Die Wohlfahrtsverbände begrüßen die<br />
neuen gesetzlichen Möglichkeiten. Sie wünschen sich aber in begründeten Fällen die<br />
Entfristung einer öffentlich geförderten Beschäftigung. Sie ist derzeit auf maximal fünf Jahre<br />
begrenzt. „Es gibt Menschen, die werden wir nie ohne ergänzenden Lohnkostenzuschuss in<br />
sozialversicherungspflichtige Jobs integrieren können. Doch auch sie haben ein Recht auf<br />
Arbeit, denn das gibt ihnen Perspektive und Würde“, betont Heine-Göttelmann.<br />
- 21 -
4.9 Suchtproblematik bei Beginn der Betreuung<br />
Von den 151 Personen, die sich <strong>2019</strong> längerfristig in unserer<br />
Betreuung befanden, lag bei 124 Personen der deutliche<br />
Schwerpunkt in einer Alkoholproblematik, gefolgt von der Gruppe<br />
der Pathologischen Glücksspieler (Kap. 7.2) mit 23 Personen. Bei 4<br />
Personen lag eine Problematik beim Medien- und Internetgebrauch<br />
vor. Mit 13 Personen ist die Zahl der zusätzlich betreuten<br />
Angehörigen im Vergleich zum Vorjahr fast gleich geblieben.<br />
Primärsymptome<br />
124<br />
Angehörige<br />
Alkohol<br />
13<br />
5<br />
23<br />
Glücksspiel<br />
Medien- und<br />
Internetsucht<br />
Von den in <strong>2019</strong> Betreuten gaben 55 Personen an, täglich zu<br />
rauchen, somit wiesen 36 % unserer Klienten eine zusätzliche<br />
Tabakabhängigkeit auf. 14 Klienten konsumierten zusätzlich<br />
regelmäßig Cannabisprodukte. 24 Personen nahmen neben Alkohol<br />
auch episodisch oder unregelmäßig andere Substanzen zu sich.<br />
Hilfesuchende, die ein Suchtproblem mit vorrangig illegalen Drogen<br />
hatten, verwiesen wir in der Regel an die Anonyme Drogenberatung<br />
e.V. in Iserlohn (DROBS).<br />
- 22 -
4.10 Psychiatrische Zusatzdiagnosen<br />
Bei unseren Betreuten werden seit einigen Jahren immer häufiger<br />
zusätzliche psychische Erkrankungen (Komorbiditäten) diagnostiziert<br />
und müssen oftmals fachärztlich behandelt werden. Der<br />
Anteil der Klienten mit psychischen Erkrankungen liegt seit<br />
einigen Jahren bei rund 80 %. Unsere Klienten leiden häufig unter<br />
Depressionen. Die nächst größere Gruppe unserer Klienten leidet<br />
unter Angststörungen, gefolgt von posttraumatischen Belastungsstörungen<br />
(PTBS), aber auch Impulskontrollstörungen<br />
(ADHS) und allgemeine Persönlichkeitsstörungen sind anzutreffen.<br />
Seit einigen Jahren spiegelt sich damit der Trend einer<br />
deutlichen Zunahme psychischer Erkrankungen in unserer<br />
Gesellschaft auch in unserer Beratungsstelle wider.<br />
„Ich habe in meinem Leben viel erreicht. Ich war beruflich im oberen Management tätig, war<br />
international unterwegs, spreche 5 Sprachen fließend, darunter Chinesisch und in den<br />
letzten 20 Jahren war die Welt mein zu Hause. Doch dann starb meine 23-jährige Tochter<br />
bei einem Unfall, das hat mich völlig aus der Bahn gehauen. Meine Ehe zerbrach, unsere<br />
Immobilien wurden verkauft und mir wurde zunehmend alles egal. Wofür lohnte es sich jetzt<br />
noch 60 Stunden in der Woche zu arbeiten. Erst versuchte ich normal weiterzuarbeiten, zum<br />
Vergessen konsumierte ich am Abend Wein. Schnell wurden daraus 2 Flaschen pro Tag.<br />
Irgendwann ging dann auf der Arbeit gar nichts mehr und ich wurde gefeuert. Von da an<br />
lebte ich von meinem Ersparten und trank täglich bereits am Vormittag Wein. Eines Tages<br />
knüpfte ich mir einen Strick. Ich wollte nicht mehr leben. Zum Glück hielt dieser aber nicht,<br />
so dass ich mir bei dem Sturz einen Wirbel anbrach. Ich hatte so starke Schmerzen, dass<br />
ich meinen Bruder anrief, er alarmierte den Krankenwagen, der mich in ein normales<br />
Krankenhaus einlieferte. Dort wurde mir die Suchtberatung empfohlen, die mich im<br />
Beratungsprozess dann schließlich in die Hans-Prinzhorn-Klinik vermittelte. Dort wurden die<br />
Diagnose Depression gestellt. Seither bekomme ich Medikamente und bin regelmäßig in der<br />
Suchtberatung.<br />
Langfristig möchte ich noch eine ganztägig ambulante Langzeitentwöhnungsbehandlung<br />
beantragen und eine ambulante Psychotherapie machen, um den Tod meiner Tochter zu<br />
verarbeiten.“<br />
Herr L. (54 Jahre)<br />
Für unsere Arbeit in der Suchtberatung bedeutet das konkret nicht<br />
nur, dass mehr als jeder zweite Klient einen erhöhten<br />
Behandlungs- und Beratungsbedarf aufweist, sondern auch,<br />
dass sich der Umgang mit diesen belasteten Menschen als<br />
schwieriger und komplizierter erweist. Klienten mit Zusatzdiagnosen<br />
benötigen eine besonders engmaschige und<br />
zeitaufwendigere Betreuung, ihre Behandlung erfordert eine gute<br />
Kooperation und Vernetzung mit dem Hilfesystem in Iserlohn (Kap.<br />
5). Im Fokus der Beratung steht in diesen Fällen daher nicht immer<br />
unbedingt die Suchtmittelabstinenz, sondern eher die Stabilisierung<br />
der gesamten Lebenssituation, wobei bereits kleine Veränderungen<br />
als Erfolge angesehen werden müssen.<br />
- 23 -
“Einer Doppelproblematik geht insbesondere bei schweren<br />
Störungen meist eine langjährige und individuelle spezifische<br />
Entwicklung voraus, die sich anamnestisch wie aktuell durch das<br />
Auftreten von Symptomen mit wechselnder Ausprägung und<br />
chronischem Verlauf charakterisiert. In einem<br />
Behandlungszeitraum, der sich oft über mehrere Jahre und häufig<br />
auch stationäre Aufenthalte hinziehen wird, ist langfristig eher eine<br />
Stabilisierung des Zustandsbildes im Sinne einer<br />
Schadensbegrenzung als Heilung anzustreben. Als Erfolg einer über<br />
Krisenintervention hinausgehenden Erstbehandlung gilt bereits die<br />
Bereitschaft der PatientInnen, sich in einer weiterführenden<br />
Rehabilitationseinrichtung behandeln zu lassen. In der Literatur<br />
wird hervorgehoben, dass DDP (Doppeldiagnosepatienten) ein<br />
niederschwelliger Zugang zu Behandlungseinrichtungen anzubieten<br />
sei. Nur unter konsequenter therapeutischer Behandlung der<br />
Doppelproblematik, insbesondere der Wechselwirkungen zwischen<br />
Sucht und der anderen psychischen Störung (z. B. Verringerung,<br />
evtl. Abstinenz von Cannabiskonsum, weil dieser psychotische<br />
Symptome fördert) wird eine Zustandsverbesserung erreicht.<br />
Therapeutische Ziele sind als vorläufig zu betrachten und den<br />
Erfordernissen wechselnder Psychopathologie sowie den<br />
individuellen Ressourcen und Bedürfnissen anzupassen“, erklärt in<br />
diesem Zusammenhang Prof. Dr. phil. Franz Moggi im<br />
Suchtmagazin 01/2013.<br />
- 24 -
„Von meinem alkoholabhängigen Vater und dessen Freunden wurde ich schon als Kind<br />
regelmäßig sexuell missbraucht. Mit 16 J. lernte ich meinen Ex-Partner kennen und wurde<br />
schwanger. Die Schwangerschaft war die Möglichkeit für mich, von zu Hause raus zu<br />
kommen und eine eigene Familie zu gründen. Doch mein Freund schlug mich schon<br />
während der Schwangerschaft. Nach der Geburt des Kindes setzte sich die Gewalt fort,<br />
auch sexuell. Ich entwickelte Schlaflosigkeit, Ängste, Depressionen und fand schließlich<br />
Zuflucht im Frauenhaus. Doch Aufgrund der psychischen Symptome fühlte ich mich mit<br />
meiner Tochter total überfordert, so dass ich schließlich einwilligte sie erst in eine<br />
Pflegefamilie zu geben und später zur Adoption frei zu geben. Um den Schmerz über den<br />
Verlust meiner Tochter und die Erinnerungen an meine traumatischen Erlebnisse zu<br />
betäuben, begann ich regelmäßig Alkohol zu trinken. Es folgten zahlreiche Aufenthalte in der<br />
Psychiatrie, einige Therapieversuche, doch immer wenn ich längerfristig abstinent bin,<br />
stellen sich Schlaflosigkeit, Ängste, Panikattacken und die Erinnerungen an die<br />
traumatischen Erlebnisse mit den dazugehörigen Gefühlen wieder ein. Ich halte das dann<br />
nicht mehr aus und trinke Alkohol oder beginne mich zu ritzen. Zusätzlich habe ich jetzt auch<br />
starke körperliche Schmerzen ohne erkennbare Ursache entwickelt, so dass ich vor kurzem<br />
als Erwerbsunfähig eingestuft wurde. Ich erhalte jetzt Grundsicherung, da ich mich bisher<br />
noch nie in der Lage sah, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Ich habe ein paar Mal einen<br />
1,50-€-Job vom Arbeitsamt angefangen, musste ihn aber jedes Mal abbrechen, weil ich<br />
einfach durch meine Traumatisierung nicht leistungsfähig bin. Die Suchtberatung nutze ich,<br />
um entlastende Gespräche führen zu können.“<br />
Frau M. (48 Jahre)<br />
Bei dem Verdacht auf zusätzliche psychische Erkrankungen<br />
motivierten wir zur Aufnahme einer begleitenden psychologisch /<br />
psychiatrischen Behandlung, sofern diese nicht bereits schon<br />
vorher erfolgt war. Problematisch gestalten sich die Wartezeiten bei<br />
ortsansässigen Psychologen und bei den psychiatrischen<br />
Fachärzten. Wie im gesamten Märkischen Kreis sind auch in<br />
Iserlohn die Wartezeiten für eine psychologische Psychotherapie<br />
von 6 – 12 Monaten keine Seltenheit. Viele Praxen in Iserlohn<br />
führen nicht einmal mehr Wartelisten, weil selbst diese völlig<br />
überlaufen sind und die Psychologen die Wartezeiten ethisch nicht<br />
mehr vertreten können. Bei den psychiatrischen Fachärzten ist die<br />
Lage ähnlich dramatisch, auch hier sind Wartezeiten von 3 – 6<br />
Monaten zu erwarten. Für Menschen mit psychischen Problemen<br />
und Erkrankungen sind diese Wartezeiten aus unserer Sicht eine<br />
Zumutung. Leider ist dieses Phänomen kein Einzelfall, sondern<br />
bundesweit, insbesondere in den Ballungsgebieten in NRW,<br />
inzwischen trauriger Alltag.<br />
- 25 -
Donnerstag, 25. Juli <strong>2019</strong><br />
Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen nehmen zu<br />
Berlin – Die Zahl der Krankheitstage aufgrund psychischer Probleme hat nach Einschätzung der DAK-<br />
Gesundheit stark zugenommen. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Zahl der Fehltage von<br />
Arbeitnehmer aus diesem Grund mehr als verdreifacht, wie aus dem heute veröffentlichten DAK-<br />
Psychoreport <strong>2019</strong> hervorgeht. Allein im vergangenen Jahr waren davon 2,2 Millionen Menschen<br />
betroffen.<br />
Der DAK-Psychoreport ist nach eigenen Angaben eine Langzeitanalyse, für die das IGES Institut die<br />
anonymisierten Daten von rund 2,5 Millionen erwerbstätigen Versicherten ausgewertet hat. Demnach<br />
erreichten die Krankschreibungen von Arbeitnehmern aufgrund von psychischen Leiden im Jahr 2017<br />
mit 250 Fehltagen pro 100 Versicherte einen Höchststand. 2018 gingen sie erstmals leicht um 5,6<br />
Prozent auf 236 Fehltage pro 100 Versicherte zurück. Psychische Störungen lagen damit im<br />
vergangenen Jahr bundesweit auf dem dritten Platz der Krankheitsarten.<br />
Am häufigsten fehlen Arbeitnehmer mit der Diagnose Depression. 2018 gingen demnach 93 Fehltage<br />
je 100 Versicherte auf das Konto von Depressionen, bei den Anpassungsstörungen waren es 51. Auf<br />
Platz drei rangierten neurotische Störungen mit 23 Fehltagen je 100 Versicherte. Angststörungen<br />
kommen auf 16 Fehltage.<br />
Dagegen verlor laut der Studie die Zusatzdiagnose Burnout im Krankheitsgeschehen seit 2012 deutlich<br />
an Bedeutung. So halbierte sich die Anzahl der Fehltage in den vergangenen sechs Jahren nahezu.<br />
Frauen waren 2018 knapp doppelt so oft wegen psychischer Probleme krankgeschrieben wie ihre<br />
männlichen Kollegen (298 Fehltage je 100 Versicherte gegenüber 183 Fehltagen bei Männern).<br />
Unterschiede nach Regionen<br />
Bei den Fehltagen durch psychische Erkrankungen gibt es laut der Studie deutliche regionale<br />
Unterschiede: Während im Saarland im vergangenen Jahr 312 Fehltage je 100 Versicherte mit den<br />
entsprechenden Diagnosen begründet wurden, waren es in Bayern lediglich 193. Auch die Baden-<br />
Württemberger blieben mit 214 Fehltagen je 100 Versicherte vergleichsweise selten wegen<br />
psychischer Probleme der Arbeit fern.<br />
Bremen und Berlin belegen mit 218 und 279 Fehltagen je 100 Versicherte die Plätze zwei und drei der<br />
Statistik. Die ostdeutschen Bundesländer bewegen sich bei den Ausfalltagen aufgrund von<br />
psychischen Erkrankungen im Mittelfeld.<br />
Zur Aussagekraft der Daten gibt es verschiedene Bewertungen. „Vor allem beim Arzt-Patienten-<br />
Gespräch sind psychische Probleme heutzutage kein Tabu mehr“, sagte der DAK-Vorstandschef<br />
Andreas Storm. Deshalb werde auch bei Krankschreibungen offener damit umgegangen.<br />
Diese Einschätzung wird von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,<br />
Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) geteilt. Unumstritten sei, dass die Enttabuisierung<br />
psychischer Erkrankungen einen wesentlichen Anteil am Anstieg der Krankmeldungen habe, sagte<br />
eine DGPPN-Sprecherin. „Dass heutzutage offen über psychische Erkrankungen gesprochen werden<br />
kann, ist aus Sicht der DGPPN sehr zu begrüßen.“ Der Verband fordert allerdings mehr<br />
Früherkennung und Prävention, denn die meisten psychischen Erkrankungen manifestierten sich<br />
bereits in den ersten Lebensjahrzehnten.<br />
Dass es nur daran liegt, dass die Leute heute psychische Probleme eher zugeben, glaubt Jutta<br />
Krellmann, die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linksfraktion, nicht. Ihrer Ansicht nach ist das<br />
Berufsleben stressiger geworden. „Viele Beschäftigte können ein trauriges Lied davon singen. Das darf<br />
nicht heruntergespielt werden“, sagte sie. Krellmann forderte eine Anti-Stress-Verordnung und<br />
entsprechende Arbeitsschutzkontrollen in den Unternehmen.<br />
So eine Verordnung fordert auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). Vorstandsmitglied Annelie<br />
Buntenbach sagte: „Der Gesetzgeber muss endlich handeln und darf nicht weiter tatenlos zuzusehen,<br />
wie Millionen Beschäftigte durch schlechte Arbeitsbedingungen einem Gesundheitsrisiko ausgesetzt<br />
sind.“<br />
Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Maria Klein-Schmeink,<br />
betonte, es müssten Rahmenbedingungen geschaffen werden, die eine gesunde Lebensweise und<br />
Zeiten des Miteinanders ermöglichten und Arbeitsprozesse entschleunigten. Hier seien besonders die<br />
Arbeitgeber gefragt. Nicht hinnehmbar seien außerdem Wartezeiten von mehr als drei Monaten für ein<br />
Erstgespräch beim Psychotherapeuten und fehlende Anlaufstellen bei akuten Krisen. ©<br />
dpa/kna/may/aerzteblatt.de<br />
- 26 -
Um diese Wartezeiten nach einer erfolgten stationären Langzeitentwöhnungsbehandlung<br />
zu überbrücken, haben wir in den letzten<br />
Jahren unsere Klienten motiviert, sich bereits vor Beginn einer<br />
Alkoholentwöhnungsbehandlung auf die Warteliste bei einem<br />
Facharzt und eventuell auch auf die Warteliste bei einem<br />
psychologischen Psychotherapeuten setzen zu lassen.<br />
Im Beratungs- und Vermittlungsprozess wählen wir gemeinsam mit<br />
den Hilfesuchenden eine passende Rehabilitationsklinik für<br />
Suchterkrankte aus, die den besonderen Bedürfnissen gerecht<br />
wird. Inzwischen haben sich eine Reihe von Kliniken auf die<br />
Behandlung von Doppeldiagnosen spezialisiert.<br />
- 27 -
4.11 Maßnahmen während der Betreuungen<br />
Wie bereits in Kap. 4.1 erwähnt, kam es im Berichtsjahr zu 151<br />
längerfristigen Betreuungen (mindestens zwei Beratungskontakte).<br />
Auch in <strong>2019</strong> war unser Bestreben, neben den<br />
Symptomträgern auch das soziale Umfeld in die Beratung mit ein<br />
zu beziehen. Die Entscheidung hierüber lag aber vorrangig bei den<br />
Auftrag gebenden Personen und orientierte sich am<br />
Beratungsverlauf. Weiterhin fanden 300 Einmalkontakte statt.<br />
In den Beratungen wurde schwerpunktmäßig auf suchtbezogene<br />
Anfragen eingegangen. Hier wurden zum Beispiel Auskünfte über<br />
die Modalitäten zur Entgiftungs- und Entwöhnungsbehandlung<br />
erfragt. In vielen Fällen konnten wir Informationen über weitere<br />
Angebote im Suchthilfesystem der Stadt Iserlohn geben und erste<br />
Kontakte herstellen. Zur Ergänzung unserer Beratung erwiesen sich<br />
unsere Broschüren zu suchtbezogenen Themen als hilfreich.<br />
Im Jahr <strong>2019</strong> führten wir 741 Einzelberatungen mit Betroffenen<br />
durch. Zusätzlich führten wir 124 Angehörigengespräche und in<br />
weiteren 29 Fällen kam es zu gemeinsamen Gesprächen mit dem<br />
Betroffenen und einer Bezugsperson (zumeist Lebenspartner). Bei<br />
16 Beratungskontakten kamen Personen aus dem weiteren<br />
sozialen Umfeld der Betroffenen hinzu, zumeist professionelle<br />
Helfer von Anbietern des ambulant betreuten Wohnens (ABW).<br />
Zum weiteren sozialen Umfeld zählen auch Ärzte, Betreuer,<br />
Bewährungshelfer, Lehrer, Arbeitgeber, Mitarbeiter des<br />
Psychosozialen Fachdienstes, Vertreter anderer Behörden und<br />
Institutionen und Kollegen der stationären und teilstationären<br />
Therapie- sowie soziotherapeutischen Einrichtungen.<br />
Im Rahmen unseres angeleiteten Gruppenangebotes für<br />
pathologische Glücksspieler und Angehörige kam es im Berichtsjahr<br />
zu 115 Kontakten mit insgesamt 19 Personen (Näheres hierzu im<br />
Kapitel 7.2).<br />
Am Nachsorgeangebot im Rahmen der „ambulanten Rehabilitation<br />
Sucht im Märkischen Kreis“ nahmen 14 Personen teil, hier kam es<br />
zu 189 Kontakten.<br />
Die in Kap. 4.2 beschriebene gute Verknüpfung und Integration<br />
unserer Klienten im Suchthilfesystem wird durch die nachfolgenden<br />
Zahlen unterlegt:<br />
29 Klientinnen und Klienten besuchten im Berichtsjahr eine<br />
Selbsthilfegruppe; 15 Personen konnten wir - teilweise auch<br />
mehrfach - in Entgiftungen, Krankenhäuser und Kliniken einweisen.<br />
11 Personen wurden von uns ebenfalls teilweise mehrfach in<br />
stationäre Entwöhnungsbehandlungen vermittelt. 10 Betreute<br />
- 28 -
vermittelten wir in eine ambulante oder ganztägig ambulante<br />
Rehabilitationsbehandlung. Auch hier kam es teilweise zu einer<br />
mehrfachen Vermittlung. 15 Personen erhielten ambulant<br />
betreutes Wohnen.<br />
Weitere Maßnahmen während der Betreuungen waren zum Beispiel<br />
Kriseninterventionen, sowie Hilfen und Unterstützungen in den<br />
Bereichen Arbeit und Ausbildung, Finanzen, Wohnen, Behörden.<br />
- 29 -
4.12 Betreuungsbeendigungen<br />
Im Jahr <strong>2019</strong> wurden 95 Betreuungen beendet. Davon konnte bei<br />
61 Klienten die Betreuung planmäßig gemäß der Beratungsabsprachen<br />
zum Abschluss gebracht werden. 17 Betreuungen<br />
gingen über in Angebote von stationären (z.B. Entwöhnungseinrichtungen,<br />
Betreute Wohnformen) oder ambulanten Einrichtungen<br />
(z.B. ambulante Rehabilitation, Suchtambulanz der Hans-<br />
Prinzhorn-Klinik), andere Fachdienste oder Beratungs- bzw.<br />
Behandlungsangebote. Bei 1 Person wurde das Betreuungsverhältnis<br />
vorzeitig, aber im gegenseitigen Einverständnis,<br />
beendet. In 15 Fällen kam es zum Betreuungsabbruch durch die<br />
Klienten. In 1 Fall kam es zu einem außerplanmäßigen Wechsel,<br />
z. B. durch eine kurzfristige Verlegung in die JVA.<br />
Symptomatik bei Beendigung<br />
unverändert<br />
34%<br />
gebessert<br />
52%<br />
verschlechtert<br />
14%<br />
Bei Beendigung der Betreuung hatte sich bei 50 Personen die<br />
Suchtproblematik deutlich verbessert, 32 wiesen bei Beendigung<br />
keine Veränderungen in ihrem Suchtverhalten auf und bei 13<br />
Klienten kam es zu einer Verschlechterung der Problematik.<br />
Bei insgesamt 52 % der beendeten Fälle konnte somit eine<br />
positive Veränderung der Symptomatik verzeichnet werden.<br />
Dieses gute Ergebnis darf nicht darüber hinweg täuschen, dass<br />
unter anderem durch die in den Kapiteln 4.6, 4.7, 4.8 und 4.10<br />
beschriebenen erschwerten sozialen und persönlichen<br />
Lebensumstände eine zufriedene abstinente Lebensführung für<br />
unsere Klienten immer mehr erschwert wird.<br />
- 30 -
5. Kooperation und Vernetzung<br />
Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V. (DHS) hebt die effiziente<br />
und hoch entwickelte Vernetzung innerhalb des suchtspezifischen<br />
Behandlungssystems als besonders wichtig hervor.<br />
Wir können sowohl auf unser internes gut ausgebautes Netz wie<br />
auch auf externe Hilfsangebote zurückgreifen.<br />
Wie bisher bestimmte die Individualität des Einzelfalls die Arbeit<br />
und somit die Kooperation mit diesen weiteren Bausteinen in der<br />
sozialpsychiatrischen und weitergehenden Versorgung Suchtkranker.<br />
5.1 Intern / Caritas - Netzwerk<br />
Die konstruktive Zusammenarbeit mit den Abteilungen<br />
Migrationsdienst und der Familienberatung konnten wir in<br />
<strong>2019</strong> fortsetzen. Weitervermittelt und –empfohlen haben wir auch<br />
die Beratung durch unsere Sozialstation/Ambulante Pflege. Bei<br />
Bedarf vermittelten wir Eltern an unser Familienzentrum Am<br />
Dördelweg 35 in Iserlohn.<br />
Die Angebote unserer CariTasche im Rahmen der Iserlohner Tafel<br />
und unserer Familien-Boutique CariChic wurden dankbar von<br />
unseren bedürftigen Klienten angenommen.<br />
Die Kooperation mit der Schuldnerberatung unseres Caritasverbandes<br />
ermöglichte im Jahr <strong>2019</strong> eine umfassende Hilfestellung bei<br />
zusätzlich belastenden und Sucht fördernden Faktoren im Bereich<br />
der Überschuldung. Dies führte zur Entlastung unserer<br />
Ratsuchenden und ermöglichte die Konzentration auf das<br />
Suchtproblem.<br />
In Zusammenarbeit mit der Familien- und Erziehungsberatung<br />
unseres Caritasverbandes begleiteten wir auch <strong>2019</strong> das<br />
therapeutische Gruppenangebot für Kinder aus sucht- und seelisch<br />
belasteten Familien CHAMÄLEON (Kap. 7.1).<br />
Auch im vergangenen Jahr fand eine gute Zusammenarbeit mit<br />
dem mittlerweile fest installierten Angebot der Quartiers-<br />
Sozialarbeit in der Südlichen Innenstadt statt.<br />
- 31 -
5.2. Extern / Kooperationen<br />
Die bereits bestehende Zusammenarbeit mit anderen Hilfeanbietern<br />
im Bereich der Suchtkrankenhilfe des Raumes Iserlohn<br />
konnten wir im Jahr <strong>2019</strong> weiter aufrechterhalten.<br />
Hervorzuheben ist ebenfalls die Zusammenarbeit mit dem<br />
Suchtbehandlungszentrum des Katholischen Krankenhauses<br />
Hagen-Elsey, der Suchtambulanz und der Entgiftungsstation der<br />
Hans-Prinzhorn-Klinik (Hemer), und dem Karl-Otto-Stoffer-<br />
Haus in Hemer und dem Haus Neuer Kronocken in Hagen-<br />
Hohenlimburg. Außerdem fand eine Kooperation mit der<br />
stationären Entwöhnungsstation (Dortmund) und der ganztägig<br />
ambulanten und ambulanten Entwöhnungsstation (Iserlohn) des<br />
LWL-Rehabilitationszentrums Ruhrgebiet - FörderTurm statt.<br />
Wir kooperierten mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst des<br />
Märkischen Kreises und den Sozialen Diensten der umliegenden<br />
Krankenhäuser, insbesondere dem St. Elisabeth Hospital, dem<br />
Agaplesion Ev. Krankenhaus Bethanien und dem<br />
Marienhospital. Gemeinsam betreute Kunden konnten beraten<br />
und begleitet werden.<br />
Eine weitergehende Versorgung unserer Kunden konnten wir<br />
weiterhin sicherstellen durch die Empfehlung von und Vermittlung<br />
in die Angebote des Psychosozialen Fachdienstes des<br />
Sozialamts und dem Sozialen Dienst der Stadt Iserlohn.<br />
Seit einigen Jahren sind wir Kooperationsmitglied im<br />
Therapieverbund (ARS-MK). Neben unserer bisherigen<br />
Beratungsarbeit bieten wir ein Angebot für die ambulante<br />
medizinische Rehabilitation von alkohol-, medikamenten- und<br />
drogenabhängigen Menschen im Märkischen Kreis an. Durch diese<br />
bisher einzigartige Kooperation ist eine Versorgungslücke für<br />
diejenigen suchterkrankten Patienten geschlossen worden, die auf<br />
ein stabileres soziales Umfeld zurückgreifen können und deren<br />
psychische Belastbarkeit die Teilnahme an einem Therapieangebot<br />
im ambulanten Rahmen zulässt. Durch den ambulanten Rahmen<br />
kann das vertraute Umfeld erhalten bleiben, eine Berufstätigkeit<br />
fortgeführt werden und die Familie bei Bedarf umfassend in den<br />
Therapieprozess mit einbezogen werden. Nähere Informationen zu<br />
unserem Angebot erhalten Sie unter www.ars-mk.de. Für die enge<br />
Zusammenarbeit möchten wir uns bei allen Kooperationspartnern<br />
bedanken.<br />
Wie im vergangenen Jahr arbeiteten wir verstärkt mit<br />
Einrichtungen des ambulant betreuten Wohnens aus Iserlohn<br />
zusammen, wobei besonders das Netzwerk Diakonie, der LWL<br />
Wohnverbund Hemer und der Psychosoziale Trägerverein<br />
(PST) hervorzuheben ist. Zur Unterstützung und möglichst<br />
- 32 -
effektiven Hilfeplanerstellung nahmen im Bedarfsfall die Betreuer<br />
an den Gesprächen teil und es wurden gemeinsame Strategien mit<br />
und für den Betroffenen erarbeitet.<br />
Wie im letzten Jahr verlief auch die Zusammenarbeit mit der<br />
DROBS (Anonyme Drogenberatung e. V.) in Iserlohn sehr gut.<br />
Im Rahmen der gemeinsamen Durchführung der Iserlohner<br />
Nachsorgegruppe ARS-MK und der gemeinsamen Präsentation auf<br />
dem Iserlohner Gesundheitstag <strong>2019</strong> (Kap. 6.2) konnte sich<br />
auch im vergangenen Jahr die vorbildliche Vernetzung weiter<br />
festigen.<br />
- 33 -
5.3 Arbeitskreise<br />
Weitere wichtige Vernetzungs- und Kooperationsmöglichkeiten<br />
ergaben sich durch unsere Teilnahme an verschiedenen lokalen,<br />
regionalen und überregionalen Arbeitskreisen.<br />
Die Suchtberatungsstelle des Caritasverbandes Iserlohn e.V. ist in<br />
folgenden Arbeitskreisen vertreten:<br />
• Verbund der Psychosozialen Beratungs- und Behandlungsstellen<br />
der Erzdiözese Paderborn<br />
• Arbeitskreis Sucht Nördlicher Märkischer Kreis<br />
• AK Glücksspielsucht, Ost-Westfalen-Lippe<br />
• AK Frauen und Sucht (HA, WIT, UN, MK)<br />
• Arbeitskreis „Männer und Sucht“ (LWL)<br />
• Qualitätszirkel EFQM für NRW<br />
• Netzwerktreffen Frauen + Sucht NRW<br />
In diesen Kreisen und Gremien findet eine intensive Vernetzung der<br />
Suchtarbeit statt. Der gegenseitige Informations- und Erfahrungsaustausch<br />
führt zu einer Erweiterung der fachlichen Kompetenz der<br />
Mitarbeiter der Beratungsstelle. Hier besteht die Möglichkeit der<br />
politischen Einflussnahme auf lokaler und regionaler Ebene und die<br />
Abstimmung der Angebote im Suchtsektor. Nicht abgedeckter<br />
Bedarf wird eruiert und gegebenenfalls ergänzt.<br />
- 34 -
6. Bildungsmaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit<br />
6.1 Fort- und Weiterbildungen<br />
Die Mitarbeiter nahmen an Seminaren, Infoveranstaltungen,<br />
Fachtagungen und Fortbildungen zu folgenden Themen teil:<br />
• Studientag „SGB II Aktuelle Änderungen, neue<br />
Gerichtsurteile“<br />
• Fachtag „Biografiearbeit und Sucht“<br />
• Seminar „Training der Emotionsregulation für pathologische<br />
Glücksspieler“<br />
• Seminar „Neuartige Spielformen“<br />
• Fachtagung „Grundbedürfnisse der Seele“<br />
• Studientag „Wohnen mit SGB XII und SGB II“<br />
Die Suchtberatungsstelle verfügt über eine fundierte Sammlung<br />
von Fachliteratur, die fortlaufend auf den aktuellen Stand gebracht<br />
wird.<br />
- 35 -
6.2. Öffentlichkeitsarbeit/Informationsveranstaltungen<br />
Als Mitarbeiter der Suchtberatung des Caritasverbandes standen<br />
wir auch in <strong>2019</strong> bei Fragestellungen zu Suchterkrankungen und<br />
Auswirkungen in den entsprechenden Lebensbereichen den<br />
Kollegen der weiteren Fachbereiche unseres Verbandes zur<br />
Verfügung.<br />
Während der Anti-Sucht-Woche der Gesamtschule Iserlohn im<br />
Dezember <strong>2019</strong> hielten wir Vorträge zum Thema „Kenn Dein Limit“.<br />
Darüber hinaus stellten wir auch im Jahr <strong>2019</strong> in Gremien und<br />
Arbeitskreisen unsere Arbeit dar und berichteten über lokale und<br />
regionale suchtbezogene Veränderungen und Planungen.<br />
Im November <strong>2019</strong> präsentierten wir uns gemeinsam mit der<br />
DROBS mit einem Informationsstand auf dem 14. Iserlohner<br />
Gesundheitstag.<br />
- 36 -
Außerdem stellten wir im Mai <strong>2019</strong> gemeinsam mit unserer<br />
Familien- und Erziehungsberatung unsere CHAMÄLEON-Gruppen<br />
und Dennis Breisers Benefiztour „Chamäleon durch Europa“ (s.<br />
Kap. 7.1) mit einem Informationsstand auf dem Iserlohner<br />
Fahrradfrühling vor.<br />
- 37 -
Bei der Vorbereitung und Durchführung der jährlich zu einem<br />
aktuellen Thema stattfindenden Informationsveranstaltung des<br />
Arbeitskreises Sucht Nördlicher Märkischer Kreis am 14.11.<strong>2019</strong> im<br />
Gemeindesaal in der Erlöserkirche im Wiesengrund wirkte unsere<br />
Suchtberatung im Rahmen des Arbeitskreises Sucht mit. Dieser<br />
vertritt alle Selbsthilfegruppen, Beratungs- und Behandlungseinrichtungen<br />
im nördlichen Märkischen Kreis.<br />
Dieses Jahr lud der Arbeitskreis Sucht zu folgendem Thema ein:<br />
„ Deutschland- Das Land der Dichter,<br />
Denker ….und Säufer? “<br />
Als Vortragenden konnten wir mit Herrn Fredric Schulz den stellvertretenden<br />
Bundesvorsitzenden der Guttempler in Deutschland<br />
gewinnen.<br />
Zu der kostenlosen öffentlichen Veranstaltung waren alle Betroffenen,<br />
Mitbetroffenen, Selbsthilfegruppen, ehren- und hauptamtlichen<br />
Helfer und Interessierten herzlich eingeladen.<br />
Etwa 60 Zuhörer verfolgten interessiert diesen sehr informativen<br />
Fachvortrag, bei dem es wie immer noch Raum für Fragen und<br />
ausgiebige Diskussionen gab.<br />
Die Sprecher des Arbeitskreises, Sylvia Schulte und Kurt<br />
Rothenpieler, waren mit dem Verlauf der Veranstaltung sehr<br />
zufrieden und erfreut über das rege Interesse.<br />
- 38 -
7. Schwerpunktthemen <strong>2019</strong><br />
7.1 CHAMÄLEON<br />
Kinder aus sucht- und seelisch belasteten Familien<br />
Bei der Vorlage des Drogen- und Suchtberichtes aus 2017 hat die<br />
Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler (CDU) eindringlich auf<br />
die bisher nicht genügend beachteten Kinder aus suchtbelasteten<br />
Familien hingewiesen. Sie fordert Bund, Länder und Kommunen auf<br />
durch flächendeckende Netzwerke mit festen Ansprechpartnern in<br />
den Städten und Gemeinden eine bessere Versorgung und<br />
Betreuung der Kinder zu schaffen und erklärt „Suchtpolitik darf<br />
nicht bei den Suchtkranken selbst enden. Wir müssen uns viel<br />
mehr als bisher um die Kinder suchtkranker Menschen kümmern“.<br />
Dieser Forderung kommt der Caritasverband in Iserlohn, Hemer<br />
und Menden schon seit langem nach und hat mit den Gruppen für<br />
Kinder aus sucht- und seelisch belasteten Familien ein Hilfsangebot<br />
geschaffen, das nun schon seit über 11 Jahren besteht.<br />
Die Atmosphäre in sucht- und seelisch belasteten Familien ist<br />
oftmals geprägt von emotionaler Unsicherheit, Instabilität und<br />
Angst. Erfahrungen von massiver Aggression, Verwahrlosung,<br />
sexuellen Missbrauchs bis hin zur physischen Lebensbedrohung<br />
sind nicht selten Teil des Familienalltags. Die hier aufwachsenden<br />
Kinder werden oft allein gelassen.<br />
„Rede nicht!“<br />
Weder innerhalb noch außerhalb der Familie darf über Probleme gesprochen werden.<br />
Am besten, man nimmt sie nicht wahr. „Du darfst nach außen hin nicht sagen, was los<br />
ist. Musst das immer geheim halten“ (Ben, 12).<br />
Zum Teil werden Schwierigkeiten zugegeben, aber die Ursache dafür wird auf andere<br />
projiziert. Der Alkoholmissbrauch wird verleugnet, geheim gehalten und der abhängige<br />
Elternteil für sein Verhalten verteidigt. Die Erfahrung, nicht darüber reden zu dürfen,<br />
vermittelt den Kindern das Gefühl, dass es keine Hilfe und keinen Ausweg gibt.<br />
(Regeln für suchtbelastete Familien<br />
aus „Mir kann das nicht passieren“<br />
von Claudia Black, 1988)<br />
Die Kinder aus solchen Familien sind oft "auffällig unauffällig". Sie<br />
sind ihren Eltern loyal verbunden und finden sich im Zwiespalt<br />
zwischen der "familiären" und der "äußeren" Welt, den<br />
Bedürfnissen ihrer Eltern und ihren eigenen. Sie fühlen sich<br />
verantwortlich für die Familie. Gleichzeitig versuchen sie ihr Leid<br />
und ihre Belastungen so gut es geht zu verstecken. Nach außen hin<br />
müssen die Kinder die Problematik eines oder beider Elternteile als<br />
Familiengeheimnis wahren. Ein großer Teil der betroffenen Kinder<br />
leidet unter Ängsten, Depressionen und schizophrenen Störungen.<br />
Die sich daraus ergebenden Auswirkungen werden zumeist erst<br />
- 39 -
später im Leben im Versuch einer selbstständigen Lebensgestaltung<br />
offenbar.<br />
Die in diesen Familien aufwachsenden Kinder sind durch vielfältige<br />
soziale und psychische Probleme besonders belastet und haben ein<br />
besonders hohes Risiko, selbst sucht- oder seelisch krank zu<br />
werden. Kinder aus Sucht belasteten Familien weisen ein bis<br />
zu sechsfach erhöhtes Risiko auf, selbst suchtkrank zu<br />
werden (s. NRW-Landesprogramm gegen Sucht).<br />
Mehr als 30 % der Kinder aus suchtbelasteten Familien werden<br />
selbst suchtkrank – meistens sehr früh in ihrem Leben. Etwa 70 %<br />
der Menschen mit Suchtproblemen stammen aus suchtbelasteten<br />
Familien. Kinder aus seelisch belasteten Familien tragen ein<br />
Risiko von 40 - 70 %, selbst psychisch zu erkranken.<br />
In Deutschland haben 2,65 Millionen Kinder und Jugendliche<br />
unter 18 Jahren mindestens einen alkoholkranken Elternteil (DHS<br />
2006). Heruntergerechnet auf die Zahlen des nördlichen<br />
Märkischen Kreises haben wir es mit einer potentiellen Zahl von<br />
ca. 6.500 Kindern zu tun.<br />
Es wird geschätzt, dass etwa 2 - 3 Millionen Kinder in psychisch<br />
belasteten Familien aufwachsen. Demnach sind in Iserlohn, Hemer,<br />
Menden und Balve mehrere Tausend Kinder betroffen! Erfahrungsgemäß<br />
liegt die Dunkelziffer sicherlich viel höher.<br />
„Fühle nicht!“<br />
Das erleichtert das Leben, vermeidet Schmerzen und bürdet den Eltern nicht noch<br />
das eigene Leid auf. Dahinter steht aber auch die Ansicht, dass man Gefühlen nur<br />
bedingt trauen sollte. Durch das Leugnen der Gefühle wird der Zugang zum<br />
emotionalen Erleben verlernt, wodurch auch angenehme Gefühle nicht mehr<br />
wahrzunehmen sind oder fremd werden – es sei denn, sie benutzen sie als Maske,<br />
um sich dahinter zu verstecken. Für die Kinder heißt das, sie müssen schnell<br />
erwachsen werden, viel Verantwortung übernehmen, viel Helfen und wenig<br />
Anforderungen an die Eltern stellen. Die Forderung an sie lautet: Sei stark, gut,<br />
perfekt. Mach immer alles richtig. Mach uns stolz.<br />
Seit 2007 besteht nun schon die Kindergruppe CHAMÄLEON.<br />
Dieses Angebot für Kinder aus suchtbelasteten Familien wurde<br />
gemeinsam mit der Suchtberatung und der Familien- und<br />
Erziehungsberatungsstelle unseres Caritasverbandes entwickelt und<br />
umgesetzt, wobei die suchtbezogene Beratung und Begleitung der<br />
Eltern durch uns sicher gestellt wird.<br />
Der Gruppenname CHAMÄLEON spiegelt in sehr passender Weise<br />
die Situation und Eigenschaften der Kinder aus suchtbelasteten<br />
Familien wider. Zum einen müssen sie sich oftmals den schwierigen<br />
und belastenden Situationen in ihrer Familie anpassen, sich<br />
manchmal vielleicht sogar unsichtbar machen, und zum anderen<br />
- 40 -
tragen diese Kinder viele wunderbare Fähigkeiten und Ressourcen<br />
in sich, von denen hoffentlich durch die Arbeit der Gruppe immer<br />
mehr zum Vorschein kommen werden.<br />
Aufbauend auf den Erfahrungen mit unserer CHAMÄLEON-Gruppe<br />
für Kinder aus suchtbelasteten Familien hatte der Caritasverband<br />
Iserlohn im September 2011 das Hilfsangebot erweitert und eine<br />
Gruppe für Kinder aus sucht- und seelisch belasteten Familien ins<br />
Leben gerufen, die mittlerweile ebenfalls gut etabliert ist.<br />
„Traue nicht!“<br />
Durch die Botschaft der Familie, dass alles normal sei, und der gegenteiligen<br />
Wahrnehmung der Kinder, lernen diese, weder sich noch anderen zu trauen..<br />
Suchterkrankungen machen Abhängige und Angehörige zu Lügnern. Alkoholiker<br />
lügen zum Beispiel, um ihr Trinken zu vertuschen. Die Partner/innen lügen, damit der<br />
Betroffene nicht seinen Arbeitsplatz und/oder seinen guten Ruf verliert. Die Kinder<br />
lügen, um sich selbst zu schützen. Wenn in einer Familie Lügen „normal“ geworden<br />
sind, dann kann man sich auf nichts und niemanden mehr verlassen. Daraus lernen<br />
sie: Ich bin der einzige Mensch, dem ich trauen kann!<br />
Primäres Ziel der CHAMÄLEON-Gruppen ist, die Kinder in ihrer<br />
Bedürftigkeit wahrzunehmen, sie in ihren Kompetenzen zu<br />
unterstützen und vorhandene Ressourcen zu aktivieren und den<br />
Kindern zu ermöglichen, diese anzuwenden. Hier sollen sie auch<br />
lernen, sich um sich zu kümmern, und nicht um ihre Eltern.<br />
Weitere wichtige Ziele sind:<br />
Persönlichkeitsstärkung<br />
Ressourcenfindung und -aktivierung<br />
Entlastung der Kinder von Schuld – und Schamgefühlen<br />
Entwicklung und Stärkung von Selbstwertgefühl und<br />
Selbstbewusstsein<br />
Erlernen von Wahrnehmung, Ausdruck und Annahme<br />
eigener Gefühle<br />
Wahrnehmung und Formulierung eigener Bedürfnisse<br />
Erleben von Zuverlässigkeit , Klarheit, Grenzen, Struktur<br />
und Sicherheit in der Gruppe und durch die<br />
Gruppenleitung<br />
Über Familiensituationen reden lernen<br />
Auflösung der Tabuthemen Sucht oder psychische<br />
Erkrankung<br />
Suchtprävention<br />
Neben diesen inhaltlichen Auseinandersetzungen benötigen die<br />
Kinder für eine gute Entwicklung vor allem schöne Erlebnisse als<br />
Gegengewicht zu den problematischen Familienverhältnissen.<br />
Dementsprechend liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Arbeit bei<br />
gemeinsamen Unternehmungen, die den Kindern Spaß machen,<br />
- 41 -
wie Malaktionen, Kinobesuche, Minigolf oder regelmäßige Ausflüge<br />
in die Natur.<br />
Für die Entwicklung und Festigung von tragfähigen Beziehungen<br />
zwischen den Gruppenleitern und jedem einzelnen Kind sowie<br />
zwischen den Kindern untereinander muss nach wie vor viel Zeit<br />
investiert werden.<br />
Im Dezember 2017 erhielten wir eine E-Mail von einem jungen<br />
Mann, der sich im Frühjahr 2018 mit dem Rad auf dem Weg durch<br />
Europa machen und sich in diesem Zusammenhang auch für unser<br />
CHAMÄLEON-Projekt einsetzen wollte. Und das tat er dann auch!<br />
Dennis Breiser startete am 21.04.2018, setzte seine<br />
bemerkenswerte Idee in die Praxis um, begeisterte auf seinem Weg<br />
unzählige Menschen, gewann viele für seine Sache und fuhr auf<br />
seiner insgesamt 16.540 Kilometer langen Benefiztour quer durch<br />
Europa und bereiste 19 Länder.<br />
Von Ihmert aus fuhr er über Polen, die baltischen Staaten, durch<br />
Finnland und Norwegen bis zum Nordkap. Anschließend ging es<br />
durch Schweden, Dänemark, die Beneluxländer, Frankreich und<br />
Spanien bis zur Straße von Gibraltar. Am westlichsten Punkt<br />
Europas, dem Cabo da Roca in Portugal machte er sich dann auf<br />
den Heimweg und kam am 31.08.<strong>2019</strong> an dem Ort an, wo vor<br />
über einem Jahr alles begann, dem ihmerter Grundschulhof!<br />
- 42 -
Überall dort berichtete er vom CHAMÄLEON-Projekt und seiner<br />
Reise. Damit schaffte er Aufmerksamkeit und fand europaweit<br />
potenzielle Unterstützer. Seine Reise stand unter dem Motto: „Mit<br />
dem Rad auf Tour, um den vergessenen Kindern eine<br />
Stimme zu geben“. Auf seinem Weg durch Europa besuchte<br />
Dennis immer wieder verschiedener Caritas-Einrichtungen und<br />
konnte sogar im Radio und Fernsehen über sich und sein Anliegen<br />
berichten „Die Gastfreundschaft und die Herzlichkeit, die mir<br />
entgegengebracht werden, ist unglaublich herzlich. Vor allem,<br />
wenn ich mein Chamäleon LEO, das Maskottchen vorstelle und von<br />
der Geschichte, die dahinter steckt, erzähle“ berichtete er über das<br />
Plüsch-Chamäleon, das ihn auf der gesamten Reise stets treu<br />
begleitete.<br />
Neben vielen eindrücklichen Erlebnissen, Begegnungen und<br />
sportlichen Herausforderungen war nach seiner Aussage die<br />
spontane erfolgreiche Teilnahme am IRONMAN-Triathlon in Nizza<br />
das persönliche Highlight, von dem Dennis Breiser sicherlich immer<br />
noch zehren kann.<br />
16 Monate und zehn Tage war er unterwegs – auf einer Reise zu<br />
sich selbst und im Einsatz für Kinder, die in sucht- und seelisch<br />
belasteten Familien aufwachsen. Dabei ist es Dennis nach eigenen<br />
Worten auf wunderbare Weise gelungen, „die Botschaft, die diesem<br />
Projekt inne liegt, in der Welt und hier bei uns vor Ort zu<br />
verbreiten“.<br />
- 43 -
- 44 -
Und so blickt Dennis Breiser stolz, entschieden und hoffnungsvoll in<br />
die Zukunft, wenn er sagt:<br />
„Es ist eine Menge geschehen und ins Rollen gebracht worden seit<br />
dem Tag der Abfahrt. Die Intention 'LEO' auch hier zu Hause bei<br />
uns ganz nah und vor Ort weiter reisen zu lassen, entspringt dem<br />
Punkt, mit diesem ganzen Aufwind der Europareise auch<br />
fortfolgend in der kommenden Zeit weiter Gutes zu tun. Die<br />
Botschaft soll noch weiter in den Raum gerückt werden, um<br />
vielleicht auch sogar bald politische Aufmerksamkeit zu bekommen<br />
und um weiterhin die Chamäleon Gruppen durch sozial engagierte<br />
Spendenprojekte finanziell zu unterstützen. Und das alles mit Hilfe<br />
des Sports und der Freude zur gesunden Bewegung als Medium der<br />
Übermittlung.“<br />
Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei Dennis Breiser für sein<br />
bemerkenswertes und gewinnendes Engagement, freuen uns auf<br />
weitere Aktionen und wünschen ihm in seinem sozialen und vor<br />
allem in seinem sportlichen Tun weiterhin soviel Energie und für<br />
seine weitere Reise durchs Leben alles erdenkliche Gute.<br />
- 45 -
7.2 Glücksspielsucht<br />
Glücksspielsucht ist eine schwerwiegende Suchterkrankung, die<br />
gravierende Folgen haben kann, wenn sie nicht frühzeitig behandelt<br />
wird. Seit 2001 haben die Renten- und Krankenversicherungen<br />
das pathologische Glücksspielen als Krankheit anerkannt. Die<br />
Klienten haben seitdem einen Anspruch auf ambulante und<br />
stationäre Rehabilitation.<br />
„Mein Pech war, dass ich am Anfang Glück hatte“<br />
(Zitat eines Glücksspielabhängigen)<br />
Das Spiel beherrscht den kompletten Tagesablauf der Betroffenen.<br />
Freunde, Familie und andere Freizeitgestaltungen werden mit der<br />
Zeit immer unwichtiger. Die Sucht können die Erkrankten lange<br />
verheimlichen. Selbst für die nächsten Freunde und Verwandten ist<br />
sie meist jahrelang nicht erkennbar. Oft erfahren die Angehörigen<br />
des Spielers erst davon, wenn alles Geld und Gut verspielt wurde.<br />
Nicht selten führt Glücksspielsucht zu massiven finanziellen<br />
Problemen der Betroffenen und belastet die Beziehungen zum<br />
Partner und zur Familie schwer. Selbst Jugendliche nehmen mehr<br />
und mehr an Glücksspielen teil.<br />
Experten gehen davon aus, dass in Nordrhein-Westfalen etwa<br />
40.000 behandlungsbedürftige Glücksspieler leben. Sie<br />
zerstören nicht nur sich selbst, sondern auch das Leben ihrer<br />
nächsten Angehörigen. Besonders betroffen sind die Ehefrauen und<br />
Kinder. Sie leiden nicht nur unter der ständigen Abwesenheit und<br />
den Lügen des Vaters, sondern auch dem Geldmangel durch die<br />
Spielschulden. Angehörige können dem Süchtigen nur bedingt<br />
helfen. Geht er nicht selbst den Weg in eine Suchtberatungsstelle,<br />
gibt es kaum mehr Hoffnung auf ein normales Leben.<br />
Unsere Suchtberatung bietet bereits seit Jahren Einzel-, Paar- und<br />
Familienberatungen für Iserlohner Bürger mit einer Glücksspielproblematik<br />
an. Im Jahr <strong>2019</strong> wurden 23 betroffene Personen<br />
intensiver durch unsere Beratungsstelle beraten und betreut (s.<br />
Kap. 4.8). Die Selbsthilfegruppe Glücksspiel wurde im<br />
Berichtsjahr von insgesamt 8 Betroffenen und Angehörigen<br />
besucht. Dieses Angebot ist offen für Hilfesuchende aus dem<br />
gesamten nördlichen Märkischen Kreis.<br />
Als Glücksspiele mit besonders hoher Suchtgefahr haben sich<br />
Geldautomatenspiele und Sportwetten herauskristallisiert.<br />
Seitens des Gesetzgebers wird leider sehr wenig unternommen, um<br />
die betroffenen Spieler vor den Gefahren dieser Angebote zu<br />
schützen.<br />
- 46 -
Die Erfahrung aus den letzten Jahren zeigt, dass die gesetzlichen<br />
Regelungen auf dem Glücksspielmarkt meistens zu Gunsten der<br />
Glücksspielbranche novelliert wurden. So durften beispielsweise in<br />
der Vergangenheit immer mehr und schnellere Geldspielautomaten<br />
aufgestellt werden, was zu Folge hatte, dass Umsätze und Gewinne<br />
vor allem für die Betreiber in die Höhe schossen. Diese drastische<br />
Entwicklung zeichnet sich besonders seit der Novellierung der<br />
Spielverordnung im Jahr 2006 ab, die die Zulassung und<br />
Aufstellung der Glücksspielgeräte regelt. Erwiesenermaßen<br />
nimmt die Suchtgefahr mit diesen neuen und schnelleren Geräten<br />
und ihren erhöhten Gewinn- und Verlustchancen rasant zu.<br />
„Groschengräber hatte ich schon als Kind kennengelernt. Mein Opa schmiss ab und zu zehn<br />
Groschen in diese Kästen. Ich weiß noch, wie ich in der Gastwirtschaft auf seinem Arm saß<br />
und das beobachtet habe. Richtig losgegangen ist es Mitte der 90er Jahre, da war ich 19. In<br />
meinem Wohnort machte die erste Spielhalle auf, aus Neugier bin ich rein. Ein Spiel kostete<br />
zwanzig Pfennig. Zwei Mark habe ich reingesteckt und 40 gewonnen. Es gab die ersten<br />
Geräte mit hundert Sonderspielen. Man spielte noch nicht so exzessiv, und es kam einem<br />
vor, als ob man gewinnt. Aber unter dem Strich war es Selbstbetrug. Man gaukelt sich vor,<br />
dass man den Automaten bezwingen kann. Also ich, ich erzähle ja über mich.<br />
Zuerst lief es nebenher, zwei-, dreimal im Monat. Nach einem halben Jahr wurde es öfter.<br />
Das ging vier, fünf Jahre so. Als das Geld knapp wurde, flog auf, dass ich gespielt hatte. Das<br />
führte zur ersten Krise in der Partnerschaft. Ich hatte mich verändert. Ich selbst habe das gar<br />
nicht gemerkt. Meine Frau sagte, ich will das nicht. Aber da war es schon zu spät. Es hatte<br />
sich verselbständigt, und ich musste dahin. Warum ich spielen gegangen bin, habe ich erst<br />
viel später in der Therapie begriffen.“<br />
Peter H. (46 Jahre)<br />
Die Situation auf dem Sportwettenmarkt ist verworren und<br />
unübersichtlich. Neben den Wettbüros finden sich immer mehr<br />
Anbieter im Internet. Alle Anbieter bewegen sich in einer<br />
rechtlichen Grauzone am Rande der Illegalität. Vor acht Jahren<br />
herrschte in Deutschland noch ein staatliches Glücksspielmonopol,<br />
begründet in einer damit verbundenen staatlichen Suchtbekämpfung.<br />
Allerdings sah der Europäische Gerichtshof anlässlich<br />
der Glücksspiel-Werbung diesen Schutz für die Bevölkerung nicht<br />
gegeben und kippte 2010 mit einem Urteil den zwei Jahre zuvor<br />
abgeschlossenen Glücksspielstaatsvertrag. Seitdem sollen nun<br />
neben den staatlichen Lotteriegesellschaften auch private Anbieter<br />
zugelassen werden. Am 01.01.2018 sollte der Zweite<br />
Glücksspieländerungsstaatsvertrag in Kraft treten. Dies ist<br />
gescheitert, da die Bundesländer sich nicht auf eine Ratifizierung<br />
einigen konnten. Der Geltungszeitraum des aktuellen Vertrages<br />
endet nun im Jahr 2021. Um den Bereich des Glücksspiels nicht in<br />
einen rechtsfreien Raum zu entlassen, sollten sich die 16<br />
Bundesländer auf einheitliche Regeln verständigen.<br />
Eine der Hauptschwierigkeiten ist dabei der zukünftige Umgang mit<br />
dem Bereich des Online-Glücksspiels. Dazu zählt neben Online-<br />
Lotterien, Online-Poker und Online-Sportwetten vor allem der<br />
Bereich der sogenannten Online-Casinos. Diese gelten als<br />
Glücksspiele mit sehr hohem Suchtgefährdungspotenzial.<br />
- 47 -
Insbesondere die sehr kurze Spieldauer, die schnelle Spielabfolge,<br />
multiple Spiel- und Einsatzgelegenheiten, spannungserzeugende<br />
Effekte und die ständige Verfügbarkeit über Smartphone und<br />
Computer sind diesbezüglich schwerwiegende Merkmale.<br />
Letztendlich werden die hoch gefährlichen Automatenspiele aus den<br />
Spielhallen und Kneipen in die heimischen Wohnzimmer und an die<br />
Arbeitsplätze der Bevölkerung transportiert.<br />
Für Glücksspielanbieter erweisen sich die Internetangebote als<br />
zunehmend attraktiv. Gültige Lizenzen gab es bisher ausschließlich<br />
in Schleswig-Holstein. Aber auch Anbieter aus dem Ausland<br />
mischen bei dem Geschäft kräftig mit.<br />
Von den rund 14,2 Milliarden Euro Umsatz der Glücksspielanbieter<br />
2017 in Deutschland wurden 22 Prozent im nichtregulierten<br />
Bereich gemacht, in den auch Sportwetten im Internet<br />
fallen. Die Zahlen stammen aus dem Jahresreport der Glücksspiel-<br />
Aufsichtsbehörden der Länder.<br />
Derzeit debattieren die Bundesländer über eine Reform des<br />
Glücksspiel-Staatsvertrags. Vorgesehen ist eine Öffnung des<br />
Sportwettenmarktes. Das Online-Glücksspiel (Online-Automatenspiel,<br />
-Poker, -Casinos etc.) soll nach jetzigem Stand aber weiter<br />
verboten bleiben. Bis heute gehören Online-Casinos und Online-<br />
Poker zum nicht regulierten Glücksspielmarkt – sind nach<br />
deutschem Recht illegal. Zu diesem Schwarzmarkt zählen<br />
Glücksspielangebote, die nicht über deutsche Konzessionen, wohl<br />
aber über eine aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat (meistens<br />
Malta, Gibraltar oder auch Großbritannien) verfügen. Aufgrund der<br />
ungeklärten Rechtslage wird ein Großteil davon faktisch geduldet.<br />
Dagegen hat das Ringen um die Regulierung des deutschen<br />
Sportwettenmarkts ein Ende gefunden – zumindest vorerst. Am<br />
21. März <strong>2019</strong> einigten sich die Bundesländer auf eine zeitlich<br />
begrenzte Öffnung des Marktes für private Anbieter von<br />
Sportwetten. Die neue Regelung des mittlerweile Dritten<br />
Glücksspielstaatsvertrages gilt ab dem 1. Januar 2020, befindet<br />
sich aktuell in der Experimentierphase und endet im Juni 2021.<br />
Bis dahin sind private Sportwettangebote in Deutschland<br />
zugelassen. Demnach sollen Anbieter, die Mindeststandards<br />
erfüllen, um die Jugend zu schützen und Spielsucht einzudämmen,<br />
ab 2020 eine bundesweit gültige Lizenz erhalten.<br />
Die Erfahrung zeigt, dass in diesem grauen Markt, in dem es um<br />
Geschäfte im Milliardenbereich geht, die Sensibilität für<br />
schutzbedürftige Teilnehmer auf der Strecke zu bleiben droht. Da,<br />
wo es möglichst um hohe Profite geht ist von Freiwilligkeit und<br />
ehrlichem Bemühen um den Spielerschutz eher nicht auszugehen.<br />
Aus unserer Sicht ist daher hier besonders die Politik gefragt, klare<br />
und harte Regeln hinsichtlich des Spielerschutzes zu setzen. Dazu<br />
- 48 -
edarf es auch einer gut aufgestellten, aufmerksamen und starken<br />
Kontrollinstanz, die die Einhaltung der Vorgaben überprüft und<br />
konsequent ahndet und nachhaltig das Suchtpotential und den<br />
Spielerschutz und nicht das Gewinnpotential und die Steuereinnahmen<br />
der Länder im Fokus behält.<br />
SPORTWETTEN 26.11.<strong>2019</strong><br />
Geschäfte im halblegalen Bereich<br />
Von Anja Schrum<br />
Ob Deutscher Fußballbund, deutsche Nationalmannschaft oder die Frauen Bundesliga – alle lassen sich von<br />
Sportwetten-Anbietern sponsern. (imago/Norbert Schmidt)<br />
Der Markt für Sportwetten wächst seit Jahren. Und nicht nur für Werbeträger wie Oliver Kahn<br />
sind sie ein lukratives Geschäft, auch Fußballvereine und Verbände kassieren mit. Dabei sind<br />
fast alle Angebote für Sportwetten eigentlich illegal.<br />
"Wenn ihr denkt, ihr kennt alle meine Sprüche – dann tippt doch drauf.“<br />
„Ihre Wette in sicheren Händen."<br />
"Nee, näh, sag mal, was tippst du denn da für'n Quatsch?"<br />
"Braucht man da eigentlich ein Parkticket?"<br />
"Natürlich geht es immer um gewinnen oder verlieren."<br />
Oliver Kahn, Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger dürften sich zu den Gewinnern zählen,<br />
zumindest monetär. Die Ex-Bundesliga-Profis werben für Sportwetten-Anbieter beziehungsweise die<br />
Spiel-Automatenwirtschaft. Und nicht nur sie: Bei jedem Bundesliga-Spiel taucht irgendwo das Logo<br />
eines Wett-Anbieters auf. So gut wie jeder Bundesliga-Verein hat einen entsprechenden Sponsor.<br />
Tipico, eines der führenden Unternehmen in Sachen Sportwetten, fungiert seit 2018 als<br />
Premiumpartner der Deutschen Fußballliga, DFL.<br />
Überall Werbung für die Wettanbieter<br />
Konkurrent bwin sponsort den Deutschen Fußballbund, DFB, die deutsche Nationalmannschaft, den<br />
DFB-Pokal, die Frauen Bundesliga und – seit 2017 – die 3. Liga. Nach Angaben des Deutschen<br />
Sportwettenverbandes investiert die Wettbranche jährlich 50 Millionen Euro ins Sportsponsoring in<br />
Deutschland. Sebastian Buchholz, der für die SPD im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt, beobachtet<br />
dieses Engagement seit Jahren mit Skepsis.<br />
- 49 -
"Ich glaube, dass das Ausbreiten der Wettbüros wie auch des Wettens im Internet über die ganzen<br />
Angebote damit zu tun hat, dass wir sehr viel Werbung für Wetten erleben. Also sowohl auf den T-<br />
Shirts der Fußallspieler als auch die Bandenwerbung, man sieht ja regelmäßig sehr, sehr viel Werbung<br />
für Wettbüros. Und da sagt sich natürlich der Normalsterbliche: Ja, wenn dafür so umfangreich<br />
geworben wird, kann das doch nichts Schlimmes sein!" Das Ziel der Werbeoffensive ist klar: Die<br />
Anbieter wollen Sportwetten als Teil der "Fußball-Kultur" verankern. Raus aus der "Schmuddel-Ecke"<br />
des Glücksspiels, rein in die vermeintlich saubere Welt des Sports. Oder wie es Oliver Kahn in einem<br />
Werbespot beschreibt:<br />
"Wenn man nach England schaut, dort gehören Sportwetten ja wie selbstverständlich letztlich zur<br />
Kultur des Spiels und ich habe sogar gehört, dass die königliche Familie ihre Wette vom Buckingham<br />
Palace aus platziert, also das zeigt schon, wie gesellschaftsfähig Sportwetten insbesondere auch in<br />
England sind."<br />
Neun Milliarden Euro Jahresumsatz<br />
Auch ohne zockendes Staatsoberhaupt wächst der Sportwetten-Markt in Deutschland rasant. Nach<br />
Angaben des Branchenverbandes setzten Wettbüro-Besucher und Online-Wetter im WM-Jahr 2018<br />
rund 7,7 Milliarden Euro auf Sportereignisse, zumeist Fußballspiele. Für das laufende Jahr peilt man<br />
einen neuen Rekord an: neun Milliarden Euro. Und auch der deutsche Fiskus verdient prächtig mit.<br />
Denn seit 2012 sind fünf Prozent des Umsatzes als Wettsteuer fällig.<br />
"Der Glücksspielmarkt ist ein Milliardengeschäft. Das müssen wir uns immer vergegenwärtigen, das ist<br />
auch der Grund, warum erst die Spielhallen, dann die Wettbüros so in die Kieze drängen. Und warum<br />
natürlich auch wahnsinnig viel online, national wie auch international angeboten wird, weil da richtig,<br />
richtig viel Geld mit zu verdienen ist."<br />
Die Branche boomt, auch weil der Zugang so leicht ist. Daniel Buchholz kämpft in Berlin seit über<br />
zehn Jahren gegen das Glücksspiel, erst gegen Spielhallen, nun verstärkt gegen Wettbüros. Die<br />
Hauptstadt hat eines der bundesweit strengsten Spielhallen-Gesetze. Es setzt neuen Anbietern enge<br />
Grenzen und auch die alten verschwinden langsam.<br />
"Allein im letzten Jahr 2018 um die hundert, also wirklich sehr deutliche Abnahme, das haben wir<br />
erreicht. Wir erleben aber gleichzeitig die gegenläufige Entwicklung bei den Wettbüros, auf die wir aber<br />
leider als Landesparlament keinen Einfluss haben, dass wir inzwischen schon bei 400 Wettbüro-<br />
Stellen sind und es werden offensichtlich immer noch mehr."<br />
Jahrelanger Streit über einheitliche Regeln<br />
Denn für Sportwetten fehlt bislang eine rechtliche Grundlage, gewettet wird im Graubereich. Die 16<br />
Bundesländer konnten sich jahrelang nicht auf einheitliche Regeln einigen. Schleswig-Holstein schoss<br />
immer wieder quer, auch die EU meldete Bedenken an. 2011 verabredeten die Bundesländer in einer<br />
ersten Reform des Glücksspielstaatsvertrages eine Experimentierphase. 20 Wett-Anbieter sollten für<br />
sieben Jahre eine Lizenz erhalten.<br />
80 bewarben sich, nach einer Vorauswahl blieben 35 übrig. Die Verlierer des Verfahrens zogen vor<br />
Gericht, beklagten die intransparente Auswahl und bekamen Recht. Damit scheiterte die<br />
Lizenzvergabe. So sind bis heute fast alle Angebote für Sportwetten eigentlich illegal, werden aber<br />
geduldet. Die Sportwetten-Anbieter richteten sich in dem unregulierten Markt prächtig ein.<br />
Der Hamburger Präventionsforscher Jens Kalke: "Das war ja ein Paradies für die in den letzten Jahren.<br />
Die haben sich ja auch an die ganzen weiteren Regeln des Glücksspielstaatsvertrages nicht gehalten,<br />
zum Beispiel: Verbot von Live-Wetten. Da hat sich kein Sportwetten-Anbieter dran gehalten. Das<br />
waren paradiesische Zustände – und sind es noch. Ich bin ja mal gespannt, was ab Januar nächsten<br />
Jahres passiert."<br />
Ereignis-Wetten sollen verboten werden<br />
Nach jahrelangem Streit haben sich die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer geeinigt: Am 1.<br />
Januar 2020 soll der sogenannte "3. Glücksspieländerungsstaatsvertrag" in Kraft treten. Dann müssen<br />
sich die Sportwetten-Anbieter wieder um Konzessionen bewerben. Diesmal wird die Anzahl nicht<br />
beschränkt.<br />
Der Staatsvertrag enthält aber auch Regelungen, die den Sportwetten-Anbietern nicht gefallen werden.<br />
Ein Verbot von sogenannten Ereignis-Wetten etwa. Dabei kann live auf das nächste Tor, die nächste<br />
gelbe Karte, die nächste Ecke gesetzt werden. Solche Live- bzw. Ereigniswetten haben ein hohes<br />
Suchtpotential, gelten aber gleichzeitig als besonders umsatzstarkes Angebot.<br />
Auch das sogenannte Dachmarken-Sponsoring ist im Visier der Aufsichtsbehörden: Baden-<br />
Württemberg hat bereits den DFB wegen seines Sponsors Bwin ermahnt. Wie die meisten<br />
Sportwetten-Anbieter betreibt auch Bwin Online-Kasinos mit virtuellen Roulettetischen und<br />
Spielautomaten. Diese aber sind in Deutschland illegal, genauso die Werbung dafür.<br />
Daniel Buchholz: "Man muss eben sehen, wenn jetzt unter dem Obernamen geworben wird, dass auch<br />
der illegale Betrieb mitbeworben wird und dass dagegen jetzt an einigen Stellen konsequenter<br />
vorangegangen wird, das ist sehr richtig so, das ist auch absolut notwendig."<br />
- 50 -
Der DFB schreibt auf Anfrage: Man stelle jetzt – deutlicher als bisher – heraus, dass es sich bei der<br />
Kooperation mit Bwin ausschließlich um eine Partnerschaft für den Bereich Sportwetten handele. So<br />
wurden Bwin-Werbeschilder mit dem Zusatz "Sportwetten" versehen.<br />
Glücksspieländerungsstaatsvertrag mit Experimentierphase<br />
Ansonsten hofft auch der DFB, dass mit der Lizenz-Vergabe eine Grundlage geschaffen wird, die allen<br />
Beteiligten mehr Rechtssicherheit bietet. Man hat – so scheint es – vor allem das Gewinnpotential der<br />
Sportwetten im Blick, weniger das Suchtpotential. Auch der Berliner Abgeordnete Daniel Buchholz hofft<br />
auf Rechtssicherheit – aber nicht um Geschäfte zu machen: "Dann haben wir hoffentlich die<br />
Möglichkeit, sehr koordiniert gegen illegales Glückspiel - und das heißt in diesem Fall illegale<br />
Wettangebote - vorzugehen und ich erhoffe mir auch ein Stück weit einen Rückgang der Wettbüros,<br />
des Überangebotes an Wettbüros in unseren Städten."<br />
Man kann allerdings darauf wetten, dass das Gezerre um die Regulierung der Sportwetten<br />
weitergehen wird. Denn der "3. Glücksspieländerungsstaatsvertrag" sieht eine Experimentierphase vor.<br />
Und die endet am 30. Juni 2021.<br />
Auch das sogenannte Dachmarken-Sponsoring ist im Visier der Aufsichtsbehörden: Baden-<br />
Württemberg hat bereits den DFB wegen seines Sponsors Bwin ermahnt. Wie die meisten<br />
Sportwetten-Anbieter betreibt auch Bwin Online-Kasinos mit virtuellen Roulettetischen und<br />
Spielautomaten. Diese aber sind in Deutschland illegal, genauso die Werbung dafür.<br />
Daniel Buchholz: "Man muss eben sehen, wenn jetzt unter dem Obernamen geworben wird, dass auch<br />
der illegale Betrieb mitbeworben wird und dass dagegen jetzt an einigen Stellen konsequenter<br />
vorangegangen wird, das ist sehr richtig so, das ist auch absolut notwendig."<br />
Der DFB schreibt auf Anfrage: Man stelle jetzt – deutlicher als bisher – heraus, dass es sich bei der<br />
Kooperation mit Bwin ausschließlich um eine Partnerschaft für den Bereich Sportwetten handele. So<br />
wurden Bwin-Werbeschilder mit dem Zusatz "Sportwetten" versehen.<br />
Glücksspieländerungsstaatsvertrag mit Experimentierphase<br />
Ansonsten hofft auch der DFB, dass mit der Lizenz-Vergabe eine Grundlage geschaffen wird, die allen<br />
Beteiligten mehr Rechtssicherheit bietet. Man hat – so scheint es – vor allem das Gewinnpotential der<br />
Sportwetten im Blick, weniger das Suchtpotential. Auch der Berliner Abgeordnete Daniel Buchholz hofft<br />
auf Rechtssicherheit – aber nicht um Geschäfte zu machen: "Dann haben wir hoffentlich die<br />
Möglichkeit, sehr koordiniert gegen illegales Glückspiel - und das heißt in diesem Fall illegale<br />
Wettangebote - vorzugehen und ich erhoffe mir auch ein Stück weit einen Rückgang der Wettbüros,<br />
des Überangebotes an Wettbüros in unseren Städten."<br />
Man kann allerdings darauf wetten, dass das Gezerre um die Regulierung der Sportwetten<br />
weitergehen wird. Denn der "3. Glücksspieländerungsstaatsvertrag" sieht eine Experimentierphase vor.<br />
Und die endet am 30. Juni 2021.<br />
Vor Ort haben die Kommunen nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten,<br />
gegen Spielhallen und Wettbüros vorzugehen. So sieht<br />
beispielsweise der Glücksspielstaatsvertrag von 2012 vor, dass<br />
der Abstand zwischen zwei Spielhallen 350 m betragen muss.<br />
Gleiches gilt für den Abstand zur nächsten Schule oder Kita.<br />
Großbetriebe mit Mehrfachkonzessionen sind demnach auch nicht<br />
länger erlaubt. Für Wettbüros gilt ein Mindestabstand von 200 m.<br />
Allerdings müssen bestehende Büros nicht schließen. Durch diese<br />
Maßnahmen soll die seit 2004 steigende Anzahl neuer Spielhallen<br />
eingedämmt und Süchtige besser geschützt werden. Im November<br />
2017 endete die fünfjährige Schonfrist für ältere Spielhallen, die<br />
der Gesetzgeber den Betreibern eingeräumt hat. Wie in anderen<br />
größeren Städten sind auch in Iserlohn eine Vielzahl der Spielhallen<br />
von einer Schließung betroffen. Endgültig ist bis heute nicht<br />
darüber entschlossen worden, weil viele Betreiber Ausnahme- und<br />
Härtefallanträge gestellt haben. Auch im Falle von Schließungen<br />
wird die Stadt mit zahlreichen Klagen konfrontiert sein, wobei die<br />
Hallen bis zur rechtkräftigen Ablehnung weiter betrieben werden<br />
können.<br />
- 51 -
Eine weitere sinnvolle und hilfreiche Maßnahme im Rahmen des<br />
Spielerschutzes hat sich bereits in Hessen bewährt. Wie schon<br />
seit Jahren für staatlichen Spielcasinos praktiziert können sich<br />
Spielsüchtige dort selbstständig für Spielhallen in einer<br />
verbindlichen zentralen Sperrdatei sperren lassen. In kurzer Zeit<br />
haben dies über 13.000 Menschen getan.<br />
Leider gilt diese Regelung bisher nur in einigen Bundesländern. In<br />
NRW zeigen sich Gesetzgeber und Automatenbranche diesbezüglich<br />
wenig kooperativ und hilfreich. Hier fehlt es bisher an einem<br />
Rechtsanspruch auf eine Spielersperre und eine derartige zentrale<br />
Sperrdatei. Es gibt hier keine entsprechende Verpflichtung für die<br />
Spielhallenbetreiber. Einige Anbieter sprechen auf Wunsch und mit<br />
der Begründung einer Glücksspielsucht jedoch freiwillige<br />
Selbstsperren mittels Hausverboten aus.<br />
„Man kann alles vergessen, wenn man spielt. Der Automat spricht nicht mit mir, er macht<br />
nichts mit mir. Er lässt mich nur vergessen und abschalten. Ich wollte mit mir alleine sein.<br />
Nur für mich. Keine Probleme haben. Überhaupt keine.<br />
Es war immer nur der Automat, bei dem ich alles vergessen konnte. Schrecklich,<br />
denke ich immer, all diese verlorenen Jahre“.<br />
Andreas M. (37 Jahre)<br />
Inwieweit die Gesetzgebung mit neuen Spielverordnungen und dem<br />
neu überarbeiteten Glücksspieländerungsstaatsvertrag eine<br />
hilfreiche Unterstützung bei der Eindämmung der Glücksspielsucht<br />
sein kann, bleibt abzuwarten. Wir befürchten, dass sich die<br />
Maßnahmen der Gesetzgebung auf dem sich rasant anwachsendem<br />
Glücksspielmarkt (mit einer stetigen Zunahme der Angebote auf<br />
dem Wett- und Glücksspielautomatenmarkt mit einer lobbystarken<br />
Automatenwirtschaft und entsprechenden Angeboten im Internet)<br />
weiterhin als unzureichend und eher halbherzig angegangen<br />
herausstellen werden.<br />
Wir sehen der Zukunft daher mit großer Sorge entgegen und teilen<br />
die Einschätzung renommierter Einrichtungen, wie dem<br />
Fachverband Glücksspielsucht e. V. und der Deutschen Hauptstelle<br />
für Suchtfragen e. V. (DHS), die generell vor einer Ausweitung des<br />
Glücksspielangebotes warnen und sich für einen kleinen,<br />
regulierten Glücksspielmarkt aussprechen. Hinsichtlich des<br />
Spielerschutzes sprechen wir uns außerdem für das<br />
uneingeschränkte Werbeverbot für Glücksspiele, die Einführung<br />
von personenbezogenen Spielerkonten und eine zentrale Sperrdatei<br />
für Spielhallen aus.<br />
- 52 -
7.3 Online-Beratung<br />
Seit einigen Jahren bieten wir mit Unterstützung des Deutschen<br />
Caritasverbandes unseren Kunden in Iserlohn die Möglichkeit der<br />
Online-Beratung.<br />
Im Berichtsjahr ist nach langer Vorbereitungsphase nun endlich die<br />
neu gestaltete Beratungsplattform online gegangen, die erstmals<br />
auch in einer mobilen Version für Smartphones verfügbar ist. Das<br />
Design der neuen Beratungsplattform ist nutzeroptimiert und<br />
intuitiv bedienbar. Wichtigster Bestandteil der Weiterentwicklung ist<br />
dabei die Neuprogrammierung einer modernen Beratungsplattform<br />
mit nutzeroptimierten Design. Eine offene digitale Infrastruktur mit<br />
höchsten Sicherheitsstandards soll dabei den Arbeitsfeldern mit<br />
ihren unterschiedlichen Beratungssettings gerecht werden.<br />
Die Online-Beratung ist anonym, kostenlos und vertraulich<br />
gestaltet. Die Interessenten melden sich unter einem frei<br />
erfundenen Namen an, wählen ein Passwort und gelangen<br />
automatisch in das eigene Postfach. Von dort aus können Anfragen<br />
an die Suchtberatung gesendet werden. Der Kunde entscheidet, ob<br />
und wann die Beratung beendet wird und ob der Zugang gelöscht<br />
wird.<br />
In der Regel wird jede Anfrage innerhalb von 48 Stunden<br />
bearbeitet. Sollte diese einmal nicht möglich sein, etwa weil der<br />
zuständige Berater krankheitsbedingt fehlt, erhalten die Kunden<br />
eine entsprechende Benachrichtigung.<br />
Ziel der Online-Beratung ist es, den ersten Schritt zur Kontaktaufnahme<br />
mit dem Suchthilfesystem zu erleichtern. Im Vordergrund<br />
steht zunächst einmal der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses<br />
zwischen Klient und Berater. Wenn sich herausstellt, dass eine<br />
Online-Beratung nicht ausreichend ist, schlagen wir den Klienten<br />
die Fortsetzung der Beratung im direkten Gespräch in unserer<br />
Suchtberatungsstelle vor.<br />
- 53 -
7.4 Medienabhängigkeit / Internetsucht<br />
Laut dem Drogen- und Suchtbericht 2015 gibt es in Deutschland im<br />
Bereich der Computerspiel- und Medienabhängigkeit ca. 560.000<br />
Menschen, die eine Abhängigkeit aufweisen. Das entspricht einer<br />
Prävalenz von 1 Prozent (Frauen: 0,8 Prozent, Männer: 1,2<br />
Prozent).<br />
Jüngere Menschen sind häufiger betroffen: So zeigen in der<br />
Altersgruppe der 14- bis 24-Jährigen etwa 250.000 Personen (2,4<br />
Prozent) Anzeichen einer Abhängigkeit.<br />
Unter den 14- bis 16-Jährigen sind es sogar 4 Prozent, also etwa<br />
100.000 Betroffene.<br />
In der Altersgruppe der über 25-Jährigen sind insgesamt etwa 0,7<br />
Prozent wahrscheinlich medienabhängig.<br />
„Nicht das Medium Computerspiel macht krank, sondern der falsche Umgang damit. Auf<br />
einige Kinder üben Computerspiele eine unwiderstehliche Sogwirkung aus. Das ist immer<br />
dann der Fall, wenn die Wirklichkeit zu wenig positive Reize bietet. Kinder, die sich als<br />
minderwertig, als nicht sportlich, nicht attraktiv empfinden und nie gelernt haben, was es<br />
heißt, ein Bedürfnis aufzuschieben; die von ihren Eltern keine Wertschätzung erfahren – die<br />
driften eher in virtuelle Welten ab, als Jugendliche, die in der realen Welt ausreichend<br />
Bestätigung erfahren.“<br />
Forscher Jürgen Fritz zum Thema Computersucht, FocusOnline am 22.03.2010<br />
Eine neue Studie der DAK-Gesundheit und des Deutschen<br />
Zentrums für Suchtfragen aus dem Jahr <strong>2019</strong> hat sich intensiv mit<br />
dem Phänomen der In-Game-Käufe und dessen Suchtrisiko für<br />
Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 bis 17 Jahren<br />
beschäftigt. Danach sind ca. 465.000 Jugendliche sogenannte<br />
Risiko-Gamer. 15.345 Jugendliche erfüllen sogar die Kriterien einer<br />
Computerspielabhängigkeit mit Entzugserscheinungen, Kontrollverlusten<br />
oder anderen Symptomen.<br />
Unserer Erfahrung nach vernachlässigen Computerspielsüchtige<br />
ihre realen sozialen Kontakte, gehen nicht mehr zur Schule oder<br />
zur Arbeit und verwahrlosen auch körperlich, da das Körpergefühl<br />
und somit auch das Hunger- und Durstgefühl ausgeschaltet wird.<br />
In der Regel verschiebt sich auch der Tag- und Nachtrhythmus, da<br />
auch das Schlafbedürfnis zugunsten der Medien-Nutzung nicht<br />
mehr von Bedeutung ist. Online-Süchtige leben in einer virtuellen<br />
Welt, in der sie Anerkennung finden, die ihnen im echten Leben<br />
häufig verwehrt wird. Sie verlieren die Kontrolle über die Zeit am<br />
PC und leiden unter Entzugserscheinungen, wie erhöhter<br />
Reizbarkeit, schlechter Laune, Angstzuständen, feuchten Händen<br />
und innerer Unruhe. Manchmal treten auch aggressive Handlungen<br />
gegen sich selber oder gegenüber der Umwelt auf, welche bis hin<br />
zum Suizid reichen können. Die Folgen ähneln einer Alkohol- oder<br />
Drogenabhängigkeit.<br />
- 54 -
Computerspiele:<br />
465.000 Jugendliche sind Risiko-Gamer<br />
- 55 -<br />
März <strong>2019</strong><br />
Neue Studie von DAK-Gesundheit und Deutschen Zentrum für Suchtfragen<br />
untersucht auch Geldausgaben bei 12- bis 17-Jährigen<br />
In Deutschland spielen rund drei Millionen Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren<br />
regelmäßig am Computer. Nach einer neuen DAK-Studie gelten 15,4 Prozent der<br />
Minderjährigen als sogenannte Risiko-Gamer. Damit zeigen rund 465.000 aller<br />
Jugendlichen dieser Altersgruppe ein riskantes oder pathologisches Spielverhalten<br />
im Sinne einer Gaming-Sucht. Die Betroffenen fehlen häufiger in der Schule, haben<br />
mehr emotionale Probleme und geben deutlich mehr Geld aus. Das zeigt der Report<br />
„Geld für Games – wenn Computerspiel zum Glücksspiel wird“ der DAK-Gesundheit<br />
und des Deutschen Zentrums für Suchtfragen. DAK-Vorstandschef Andreas Storm<br />
will die Aufklärung über Risiken verstärken. Er fordert ferner ein Verbot sogenannter<br />
Loot-Boxen in Deutschland, die Gamer für lange Spielzeiten oder bei Geldzahlungen<br />
belohnen.<br />
Für die repräsentative Studie „Geld für Games“ hat das Forsa-Institut 1.000 Kinder und<br />
Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren befragt. Neben der Suchtgefahr wurden erstmals<br />
auch die Ausgaben für die Anschaffung von Computerspielen und Extras untersucht. Jeder<br />
vierte Risiko-Gamer spielt am Wochenende fünf Stunden und mehr am Tag. Einzelne<br />
Spieler geben in sechs Monaten bis zu 1.000 Euro aus. „Durch die Tricks der Industrie<br />
finden viele Jugendliche kein Ende und verzocken Zeit und Geld“, sagt Andreas Storm,<br />
Vorstandschef der DAK-Gesundheit. „Aus Spaß kann schnell Sucht werden. Deshalb muss<br />
der Glückspielcharakter in Computerspielen eingedämmt werden. Wir brauchen wie in<br />
Belgien und den Niederlanden ein Verbot von Loot-Boxen oder Glücksrädern. Außerdem<br />
sollten für Gamer Warnhinweise eingeblendet werden, wenn bestimmte Spielzeiten<br />
überschritten sind.“<br />
90 Prozent aller Jungen spielen regelmäßig Fortnite und Co.<br />
Laut DAK-Studie spielen 72,5 Prozent der Jugendlichen in Deutschland regelmäßig<br />
Computerspiele wie Fortnite, FIFA oder Minecraft. Das sind hochgerechnet mehr als drei<br />
Millionen Minderjährige. Insgesamt spielen knapp 90 Prozent aller Jungen und gut 50<br />
Prozent der Mädchen. Nach einer Analyse des Deutschen Zentrums für Suchtfragen am<br />
Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf (UKE) zeigen 15,4 Prozent von ihnen ein riskantes<br />
oder pathologisches Spielverhalten. Damit wären 465.000 Kinder und Jugendliche zwischen<br />
12 und 17 Jahren Risiko-Gamer, davon 79 Prozent Jungen. 3,3 Prozent der Betroffenen<br />
erfüllen sogar die Kriterien einer Computerspielabhängigkeit mit Entzugserscheinungen,<br />
Kontrollverlusten oder Gefährdungen.<br />
Risiko-Gamer haben verstärkt Schul-Probleme<br />
„Ein riskantes Gaming-Verhalten kann zu verstärkten Schulproblemen führen“, erklärt<br />
Studienleiter und Suchtexperte Professor Dr. Rainer Thomasius. „Elf Prozent der Risiko-<br />
Gamer fehlen innerhalb von einem Monat eine Woche oder mehr in der Schule oder<br />
Ausbildung. Das ist etwa drei Mal häufiger als bei unauffälligen Spielern.“ Die betroffenen<br />
Jugendlichen haben mehr emotionale oder Verhaltensprobleme. So berichten etwa 21<br />
Prozent der Risiko-Gamer über Sorgen und Ängste, während es bei den unauffälligen<br />
Spielern nur sechs Prozent waren. Deutliche Unterschiede gibt es auch bei der<br />
Konzentration, motorischer Unruhe oder aggressivem Verhalten.<br />
Bis zu 1.000 Euro für Spiele und Extras<br />
Die DAK-Studie „Geld für Games“ untersucht erstmals auch die Ausgaben für<br />
Computerspiele. Mehr als die Hälfte der regelmäßigen Spieler kaufte in den sechs Monaten<br />
vor der Befragung Spiele oder Extras. Im Durchschnitt lagen die Ausgaben bei 110 Euro,<br />
wobei auch ein Spitzenwert von knapp 1.000 Euro genannt wurde. Jeder dritte Euro wurde<br />
für die Computerspiele Fortnite und FIFA ausgegeben. Bei den Extras wurde das Geld meist<br />
für die sogenannte In-Game-Währung oder für Spaß- und Verschönerungselemente<br />
eingesetzt.
Sechs Prozent der Gamer gaben an, das Geld für Extras am ehesten in Loot-Boxen zu<br />
investieren, die wie beim Glücksspiel „zufällig“ über den weiteren Spielverlauf entscheiden.<br />
„Die Risiko-Gruppe ist deutlich mehr bereit, Geld für Games auszugeben“, erklärt<br />
Suchtexperte Thomasius. „Sie stecken zum Beispiel doppelt so viel Geld in Extras als<br />
unauffällige Spieler. Und je ausgeprägter das Spielverhalten ist, desto mehr Geld investieren<br />
sie in Spiele.“<br />
Jugendliche wollen vor allem „Spaß“<br />
Die befragten Kinder und Jugendlichen selbst nennen fast alle „Spaß“ als Hauptgrund für ihr<br />
Lieblingsspiel. 75 Prozent geben an, beim Computerspiel „gut abschalten“ zu können. Jeder<br />
zweite spielt, weil Freunde auch spielen. Knapp 30 Prozent der Befragten gibt an, durch die<br />
Games nicht an „unangenehme Dinge“ denken zu müssen. 15 Prozent der Risiko-Gamer<br />
fühlen sich unglücklich, wenn sie nicht spielen konnten. Fünf Prozent hatten durch das<br />
Spielen „ernsthafte Probleme“ mit der Familie oder Freunden.<br />
So steigern Computerspiele die Suchtgefahr<br />
Nach Einschätzung des Deutschen Zentrums für Suchtfragen fördern aktuelle Games mit<br />
ihrem Spielverlauf die mögliche Abhängigkeit bei Kindern und Jugendlichen. Als Beispiele<br />
werden genannt:<br />
Open-End: Die virtuellen Welten verändern sich ständig. Es werden neue Spielerlebnisse<br />
ohne endgültiges Ziel angeboten.<br />
• Personalisierung: Games gehen auf Bedürfnisse und Wünsche der Spieler ein und<br />
berücksichtigen persönliche Fähigkeiten<br />
• Soziale Zugehörigkeit: Ein Teamverbund ermöglicht schnelle Spielfortschritte und schafft<br />
Wertschätzung und Anerkennung.• Belohnungen für hohes Spielengagement der Gamer.<br />
• Loot-Boxen: Diese Überraschungskisten gibt es für erfolgreiches Spiel oder gegen Geld.<br />
Nutzer werden so an die suchtgefährden Mechanismen des klassischen Glücksspiels<br />
herangeführt. In Belgien und den Niederlanden sind Loot-Boxen bereits verboten<br />
• Virtuelle Währung: Geld intensiviert das Spielerlebnis. Bestimmte Funktionen sind nur im<br />
Tausch gegen Geld zu erlangen (In-Game-Käufe). Es werden virtuelle Währungen wie z.B.<br />
„V-Bucks“ eingesetzt, wodurch der Überblick der Ausgaben erschwert wird.<br />
DAK-Gesundheit setzt auf Verbote und Aufklärung<br />
Als Konsequenz aus den aktuellen Umfrageergebnissen „Geld für Games“ fordert die DAK-<br />
Gesundheit ein Verbot von Glücksspielelementen in Computerspielen sowie Warnhinweise<br />
für den Spielzeiten und Ausgaben. Ferner verstärkt die Krankenkasse ihre Prävention und<br />
Aufklärung. „Wir untersuchen das Thema Internetsucht und Gaming bereits seit fünf Jahren“<br />
sagt Vorstandschef Andreas Storm. Aktuell finanziert die DAK-Gesundheit neue Broschüren,<br />
die Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte gezielt über die moderne Entwicklung bei den<br />
Computerspielen informieren, Risiken aufzeigt und Hilfen anbietet. Herausgegeben werden<br />
die Hefte mit ausführlichen Hintergrundinformationen, Beispielen und einem Selbsttest vom<br />
Deutschen Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ) am<br />
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Weitere Informationen gibt es auch im Internet<br />
unter www.computersuchthilfe.info oder unter www.dak.de/internetsucht<br />
Jörg Bodanowitz Chef-Pressesprecher<br />
Im Mai <strong>2019</strong> hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den<br />
neuen ICD-11 verabschiedet. Es wird im Jahr 2022 in Kraft treten.<br />
Dies bedeutet auch, dass Computerspielsucht (als „Gaming<br />
Disorder“) nun tatsächlich als diagnostizierbares Störungsbild und<br />
somit als Erkrankung anerkannt ist.<br />
Seit <strong>2019</strong> sind Krankenkassen und Rentenversicherungsträger nun<br />
verpflichtet die Kosten für eine stationäre oder ambulante<br />
Behandlung zu übernehmen. Dieses werten wir als großen Erfolg<br />
und freuen uns über die damit entstandene Rechtssicherheit für<br />
unsere Klienten.<br />
- 56 -
Die Kriterien für stoffungebundene Abhängigkeit, die sich ihrerseits<br />
an den Kriterien für stoffgebundene Abhängigkeitserkrankungen<br />
orientieren, werden ab jetzt auch auf die Computerspielsucht<br />
anwendbar sein.<br />
Es müssen 5 von 9 Kriterien erfüllt sein um die Diagnose „Gaming<br />
Disorder“ zu stellen. Dabei darf nur die pathologische Nutzung<br />
von Online- und Offlinespielen, nicht aber die berufliche oder<br />
private Nutzung anderer Internetangebote mit einbezogen werden.<br />
1. Gedankliche Vereinnahmung. Der Spieler muss<br />
ständig an das Spielen denken, auch in Lebensphasen,<br />
in denen nicht gespielt wird (zum Beispiel in der Schule<br />
oder am Arbeitsplatz).<br />
2. Entzugserscheinungen. Der Spieler erlebt vegetative<br />
(nicht physische oder pharmakologische)<br />
Entzugssymptome, wie Gereiztheit, Unruhe, Traurigkeit,<br />
erhöhte Ängstlichkeit, oder Konzentrationsprobleme,<br />
wenn nicht gespielt werden kann.<br />
3. Toleranzentwicklung. Der Spieler verspürt im Laufe<br />
der Zeit das Bedürfnis, mehr und mehr Zeit mit<br />
Computerspielen zu verbringen.<br />
4. Kontrollverlust. Dem Spieler gelingt es nicht, die<br />
Häufigkeit und Dauer des Spielens zu begrenzen und die<br />
Aufnahme und Beendigung des Spielens selbstbestimmt<br />
zu regulieren.<br />
5. Fortsetzung trotz negativer Konsequenzen. Der<br />
Spieler setzt sein Spieleverhalten fort, obwohl er weiß,<br />
dass dieses nachteilige psychosoziale Auswirkungen auf<br />
ihn hat.<br />
6. Verhaltensbezogene Vereinnahmung. Der Spieler<br />
verliert sein Interesse an vormals geschätzten Hobbies<br />
und Freizeitaktivitäten und interessiert sich nur noch für<br />
das Computerspielen.<br />
7. Dysfunktionale Stressbewältigung. Der Spieler setzt<br />
das Computerspielen ein, um damit negative Gefühle zu<br />
regulieren oder Probleme zu vergessen.<br />
8. Dissimulation. Der Spieler belügt Familienmitglieder,<br />
Therapeuten oder andere Personen über das tatsächliche<br />
Ausmaß seines Spielverhaltens.<br />
9. Gefährdungen und Verluste. Der Spieler hat wegen<br />
seines Computerspielens wichtige Beziehungen,<br />
Karrierechancen oder seinen Arbeitsplatz riskiert oder<br />
verloren oder seinen Werdegang in anderer Weise<br />
gefährdet.<br />
- 57 -
Aufnahme in WHO-Katalog:<br />
20.05.<strong>2019</strong><br />
Online-Spielsucht als Krankheit anerkannt<br />
Wenn das Daddeln am Computer wichtiger wird als Freunde, Job oder sogar Schlafen<br />
- dann sprechen Mediziner von einer Sucht. Die WHO nimmt die Spielsucht nun in ihr<br />
Verzeichnis auf.<br />
Mehr als 34 Millionen Deutsche spielen Computer- und Videospiele, schätzt der Verband der<br />
deutschen Games-Branche. Nur ein verschwindend kleiner Teil - weniger als ein Prozent -<br />
spiele exzessiv. Wann aber wird das Spielen zur krankhaften Sucht?<br />
Bettina Borisch vom Institut für globale Gesundheit an der Universität Genf sagt, Ärzte in<br />
aller Welt standen bisher bei der Diagnose der Onlinespielsucht stets vor einer<br />
Herausforderung: Man müsse herausfinden, ab wann die Sucht, am Computer zu spielen,<br />
krankhaft sei. Dafür brauche man ganz klare Kriterien. Um diese Kriterien überall anwenden<br />
zu können, müssten sie global sein, sie müssten von der Weltgesundheitsorganisation<br />
(WHO) kommen.<br />
Wenn alles dem Spielen untergeordnet wird<br />
Für die WHO beginnt die Problematik, wenn ein Mensch länger als ein Jahr lang alle<br />
anderen Aspekte des Lebens dem Spielen unterordnet. Wenn er Freunde und Familie<br />
vernachlässigt, in der Schule, bei der Ausbildung oder im Job die Leistung abnimmt oder<br />
sich das Spielen sogar auf das Schlafen und die Ernährung auswirkt.<br />
Schon länger diskutierten die 194 Mitgliedsstaaten der WHO darüber, die Computer- und<br />
Onlinespielsucht in den weltweiten Katalog der Gesundheitsstörungen aufzunehmen. Das<br />
überarbeitetete Verzeichnis soll auf der zur Zeit in Genf tagenden<br />
Weltgesundheitsversammlung beschlossen werden. Die Computerspielsucht wird darin<br />
erstmals als eigene Krankheit anerkannt.<br />
Mit den Folgen der Sucht umgehen<br />
Bereits im letzten Jahr erklärte WHO-Experte Vladimir Poznyak: Der Hauptgrund dafür seien<br />
nicht nur die vorliegenden wissenschaftlichen Beweise, sondern auch der<br />
Behandlungsbedarf und die Forderung der Mediziner nach einer Anerkennung, erklärt<br />
Poznyak. Die Ärzte hofften dadurch, dass die Forschung verstärkt wird, dass vorbeugende<br />
Maßnahmen durchgeführt werden können und dass man sich mehr mit den<br />
gesundheitlichen Folgen dieser Sucht befasst.<br />
Etwa 560.000 Deutsche gelten als Internetabhänig. Ein Teil von ihnen sind Gamer, die<br />
Schwierigkeiten haben, ihr Spiel zu kontrollieren. Für sie und ihre Angehörigen sei die<br />
Anerkennung der Krankheit ein hilfreicher Schritt, meint die Drogenbeauftragte der<br />
Bundesregierung, Marlene Mortler.<br />
Spahn: Krankenkassen zahlen Behandlung<br />
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass sich für die Therapie der<br />
Süchtigen nun viel ändert: Wenn die Onlinespielsucht in einem amtlichen, internationalen<br />
Verzeichnis der Erkrankungen sei, dann hieße das automatisch, dass eine entsprechende<br />
Behandlung in Deutschland möglich sei, so Spahn. Und dass diese Krankheit durch die<br />
gesetzlichen Krankenkassen finanziert würde, dass den Menschen direkt geholfen werden<br />
könne.<br />
Aber nicht Online-Spiele generell verteufeln<br />
Die Aufnahme von Video- und Onlinespielsucht in den weltweiten Krankheitenkatalog war<br />
nicht unumstritten. So fürchtete die Gaming-Industrie, dass Menschen, die viel spielen,<br />
plötzlich als therapiebedürftig eingestuft werden könnten. Und sogar Gesundheitsexperten<br />
warnen davor, die Online-Spiele grundsätzlich zu verteufeln. Spieler könnten auch einiges<br />
lernen - etwa strategisches Denken oder die Zusammenarbeit in der Gruppe.<br />
- 58 -
Die Frage der Mediengefährdung und Mediensucht ist ein deutliches<br />
Schnittstellenthema von Kinder- und Jugendhilfe einerseits und<br />
Suchthilfe / Suchtprävention andererseits. Nach Aussage der Freien<br />
Wohlfahrtspflege NRW haben weder die Beratungsstellen der<br />
Suchthilfe noch die der Jugendhilfe bislang einen expliziten<br />
landespolitischen Auftrag, sich dieser neuen Klientengruppe zu<br />
öffnen. Zunehmende Fallzahlen und bestehende begrenzte<br />
Personalressourcen in der Sucht- und Jugendhilfe erlauben keine<br />
Ausweitung der Klientengruppen ohne vernünftige und realistische<br />
Erweiterung der personellen Besetzung. Um ein fachliches und<br />
hilfreiches Angebot für betroffene Klienten schaffen zu können ist<br />
es demnach notwendig, dass die Träger der Sucht- und Jugendhilfe<br />
vor Ort in kooperativer Weise die Hilfsangebote entwickeln und<br />
aufeinander abstimmen.<br />
Wir erhielten auch <strong>2019</strong> Anfragen von besorgten Eltern und<br />
Lehrern, die mit jungen Menschen konfrontiert waren, welche zum<br />
Teil exzessive „Mediennutzung“ betrieben und haben diese<br />
Hilfesuchenden im Rahmen unserer derzeit bestehenden<br />
Möglichkeiten beraten und begleitet. In der Regel ging es um junge<br />
Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren, welche abhängig Online-<br />
Spiele konsumierten, noch zu Hause bei den Eltern lebten und zum<br />
Teil auch noch zur Schule gingen. Die Beratung der Angehörigen<br />
gestaltet sich durch die oftmals fehlende Krankheitseinsicht der<br />
Betroffenen schwierig. In diesen Fällen können wir die Eltern dann<br />
nur über ihr eigenes co-abhängiges Verhalten aufklären und sie<br />
ermutigen, negative Konsequenzen von dem Süchtigen nicht fern<br />
zu halten und ihm die Verantwortung für sein süchtiges Verhalten<br />
zu übertragen. Notfalls kann dieses auch bedeuten, den jungen<br />
Erwachsenen „vor die Tür“ zu setzen oder bei minderjährigen das<br />
Jugendamt einzuschalten und eine „Familienhilfe“ zu beantragen.<br />
Ein weiteres Problem stellen die wenigen, auf Gaming disorder<br />
spezialisierten, stationären und ambulanten Behandlungsangebote<br />
dar. Oftmals haben diese Einrichtungen eine lange Wartezeit.<br />
Bei Minderjährigen gibt es zwar für die Eltern theoretisch die<br />
Möglichkeit, den Süchtigen gegen seinen Willen in eine<br />
psychiatrische Klinik einweisen zu lassen, aber praktisch gestaltet<br />
sich die Behandlung der jungen Menschen schwierig, da, ohne<br />
Krankheitseinsicht des Süchtigen eine erfolgreiche Therapie oftmals<br />
nicht möglich ist.<br />
Wir haben bereits vor einigen Jahren vor Ort begonnen, uns mit<br />
der Familien- und Erziehungsberatung in unserem Hause zu<br />
vernetzen. Es finden gemeinsame Teams statt um uns über<br />
Vorgehensweisen und neue Angebote für medienabhängige<br />
Jugendliche und junge Erwachsene auszutauschen.<br />
- 59 -
7.5 Cari-Point Selbsthilfegruppe<br />
Auch <strong>2019</strong> traf sich die Selbsthilfegruppe Cari-Point regelmäßig am<br />
Mittwochabend in den Räumen der Caritas.<br />
„In der Selbsthilfegruppe werde ich meine Sorgen los.<br />
Und sie hilft mir, trocken zu bleiben!“ (Hans-Jörg)<br />
Teilnehmen kann jeder, der selbst von einer Suchterkrankung<br />
betroffen ist, oder einen suchtkranken Angehörigen hat. In der<br />
Gruppe treffen sich Menschen mit verschiedenen Suchterkrankungen<br />
(Alkohol, Medikamente, Drogen).<br />
Die Teilnahme kann anonym erfolgen und ist kostenlos.<br />
Selbstverständlich gilt in der Gruppe eine gegenseitige<br />
Schweigepflicht, wonach keine Informationen von Teilnehmern aus<br />
der Gruppe an andere Personen weitergegeben werden dürfen.<br />
„Ich bin nicht mehr allein mit meinen Problemen. Die Gruppe ist<br />
ein Teil meines Lebens geworden.“ (Monika)<br />
Geredet werden kann über „alles“, aber keiner „muss“ etwas<br />
sagen. Jeder ist willkommen erst einmal nur zuzuhören. Mit dem<br />
Schildern eines Problems – ob in der Partnerschaft, am<br />
Arbeitsplatz, mit der Arbeitsagentur, mit Tod und Trauer – gibt<br />
jeder Mensch nicht nur ein Stück davon ab, zumeist erfährt er<br />
auch, dass es anderen Süchtigen und Angehörigen ganz ähnlich<br />
ging oder geht, und dass sie diese Phasen auch durchgemacht<br />
haben. So profitiert jeder vom Austausch, selbst wenn er nur<br />
zuhört.<br />
„Da sind Menschen, die mich verstehen und wissen,<br />
wie es mir geht.“ (Ingo)<br />
Cari-Point ist bereits offiziell als Selbsthilfegruppe eingetragen und<br />
anerkannt. Das wiederum sichert die finanzielle Unterstützung<br />
durch die Krankenkassen. Auch die Aufnahme in den<br />
Selbsthilfegruppen-Führer für den Märkischen Kreis ist erfolgt.<br />
Die Gruppe trifft sich mittwochs in der Zeit von 17:30 – 19:15 Uhr<br />
im Tagungsraum des Caritasverbandes.<br />
Wir freuen uns sehr über diese seit Bestehen unserer<br />
Suchtberatung einmalige Entwicklung, danken für das uns<br />
entgegen gebrachte Vertrauen und stehen der Gruppe Cari-Point<br />
natürlich gern auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite.<br />
- 60 -
8. Qualitätssicherung<br />
8.1 Qualitätsmanagementsystem (EFQM)<br />
Unsere Beratungsstelle hat sich für die Einführung des EFQM-<br />
Modells (European Foundation for Quality Management) entschieden.<br />
EFQM ist besonders für kleinere Beratungsstellen ein<br />
sinnvoller Weg, um mit begrenzten personellen und zeitlichen<br />
Ressourcen den Einstieg in einen Qualitätsmanagementprozess zu<br />
gewährleisten. Es ermöglicht die erfolgreiche Sicherung und<br />
Weiterentwicklung der Qualität der eigenen Arbeit und stellt ein<br />
vom Land anerkanntes System dar.<br />
Das Herzstück des EFQM-Modells besteht aus einer Selbstbewertung<br />
der Einrichtung, die alle zwei Jahre durchgeführt wird.<br />
Anhand der späteren gemeinsamen Auswertung werden die<br />
Bereiche deutlich, in denen die Einrichtung bereits jetzt schon eine<br />
gute Arbeit leistet oder wo zukünftig etwas verändert oder ergänzt<br />
werden sollte.<br />
Neben der Überprüfung der bereits erreichten Ziele aus den<br />
vorangegangenen Selbstbewertungen wurden wichtige Veränderungsprojekte<br />
und -prozesse für die nächsten Jahre entwickelt und<br />
in <strong>2019</strong> kontinuierlich vorangetrieben. Für 2020 ist eine weitere<br />
Selbstbewertung in der Suchtberatung geplant.<br />
Im Rahmen des Qualitätsmanagements unserer Suchtberatung<br />
beteiligen wir uns seit 2010 an einer externen und unabhängigen<br />
Beschwerdestelle, welche eine sehr sinnvolle und hilfreiche<br />
Ergänzung unseres Beschwerdemanagements darstellt (Kap. 8.3).<br />
Insgesamt hat sich der Prozess des Qualitätsmanagement als eine<br />
gute Möglichkeit herausgestellt unseren bereits vorhandenen hohen<br />
Qualitätsstandard in der Beratung abzubilden, zu bestätigen und<br />
durch sinnvolle Veränderungen weiterzuentwickeln.<br />
- 61 -
8.2 PATFAK Light / Computergestützte Dokumentation<br />
und Auswertung<br />
Seit vielen Jahren wird der Deutsche Kerndatensatz zur<br />
Dokumentation in der Suchtkrankenhilfe (KDS) angewendet. Er<br />
stellt die Grundlage für die einheitliche Dokumentation in<br />
ambulanten und stationären Einrichtungen dar, in denen Personen<br />
mit substanzbezogenen Störungen sowie stoffungebundenen<br />
Suchtformen in Deutschland beraten, betreut und behandelt<br />
werden.<br />
Seit einigen Jahren nutzen wir das Dokumentationssystem<br />
PATFAK Light von der Firma Redline Data um den KDS erfassen<br />
zu können. Aufgrund einer umfangreichen Ergänzung des KDS in<br />
2017 kam es auch noch über das gesamte Jahr <strong>2019</strong> immer wieder<br />
zu neuen Softwareupdates die Auswirkungen auf unseren<br />
gesamten Arbeitsablauf hatten.<br />
Die politisch gewünschte Erweiterung des Kerndatensatzes hat<br />
unseren Verwaltungsaufwand leider erheblich vergrößert und<br />
bindet zunehmend Zeit, welche wir notwendigerweise gerne für<br />
unsere Klienten zur Verfügung haben würden.<br />
Unsere Suchtberatung hat sich bereit erklärt, an dem Modellprojekt<br />
„Dokumentation der Lebenssituationen der Kinder von der in der<br />
ambulanten Sucht- und Drogenhilfe betreuten Klientinnen und<br />
Klienten“ teilzunehmen.<br />
Hierfür wurde ein eigenes Modul entwickelt und von uns mit den<br />
entsprechenden Eingaben versehen. Das Ministerium für<br />
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW,<br />
MGEPA, finanziert die Software-Programmierung sowie die<br />
(externe) Datenauswertung.<br />
Die Landeskoordinierungsstelle Frauen und Sucht NRW, BELLA<br />
DONNA, begleitet die fachliche, inhaltliche und technische<br />
Umsetzung, unterstützt die teilnehmenden Einrichtungen bei der<br />
Implementierung und bewertet und analysierte die erhobenen<br />
Daten.<br />
Durch dieses zusätzliche Modul kann die Anzahl der Kinder der<br />
Klientinnen und Klienten in den ambulanten Sucht- und<br />
Drogenhilfeeinrichtungen erfasst und insgesamt genauere<br />
Erkenntnisse über die Lebenssituation der minderjährigen Kinder<br />
gewonnen werden. Gleichzeitig können über diese einheitliche<br />
Dokumentation vergleichbare und gemeinsam auswertbare Daten<br />
generiert werden.<br />
- 62 -
8.3 Unabhängige Beschwerdestelle des Märkischen<br />
Kreises<br />
Unsere Suchtberatung beteiligt sich im Rahmen ihres<br />
Qualitätsmanagements (Kap. 8.1) an der unabhängigen<br />
Beschwerdestelle für Menschen mit seelischen Störungen und<br />
Suchterkrankungen im Märkischen Kreis.<br />
Die Beschwerdestelle ist eine der ersten in NRW, in der betroffene<br />
Bürgerinnen und Bürger gleichberechtigt mit professionellen<br />
Helfern Beschwerden bearbeiten. Bei den Kunden handelt es sich z.<br />
B. um Bewohner des ambulant und stationär betreuten Wohnens,<br />
um Patienten der Kliniken, um Teilnehmer an Freizeit- und<br />
Kontaktangeboten, Ratsuchende beim Sozialpsychiatrischen Dienst<br />
oder den Suchtberatungsstellen sowie Beschäftigte in Werkstätten<br />
für Menschen mit psychischen Behinderungen.<br />
Jede Bürgerin und jeder Bürger kann sich mit einer Beschwerde -<br />
gleich welcher Art - bei Schwierigkeiten mit den kooperierenden<br />
Einrichtungen an die Beschwerdestelle wenden. Dieses ist<br />
telefonisch, per Post, per E-Mail sowie persönlich in den<br />
wöchentlichen Sprechstunden möglich. Die jeweils zuständigen<br />
Mitglieder der Beschwerdestelle nehmen zunächst Kontakt zum<br />
Beschwerdeführer auf und klären weitere Details. Danach wird das<br />
Gespräch mit der Einrichtung gesucht, in der die Probleme<br />
auftreten.<br />
Die weitere Vorgehensweise richtet sich nach dem jeweiligen<br />
Einzelfall. Ziel ist es, die Beschwerde zu klären und zwischen<br />
Kunden und psychosozialer Einrichtung zu vermitteln. Sollten sich<br />
gleichlautende Beschwerden häufen, ist es im Sinne des<br />
Qualitätsmanagements wichtig, die betroffene Einrichtung bei einer<br />
grundsätzlichen Klärung zu unterstützen und für die Zukunft<br />
Abhilfe zu schaffen. Die Beschwerdestelle arbeitet kostenlos. Die<br />
Mitglieder der Beschwerdestelle unterliegen der Schweigepflicht.<br />
- 63 -
9. Résumé/Ausblick<br />
Das Angebot der Suchtberatungsstelle des Caritasverbandes<br />
Iserlohn, Hemer, Menden, Balve e. V. ist ein wichtiges Element in<br />
der Kette der Hilfsanbieter im Bereich der Suchtkrankenhilfe. Als<br />
fest integrierter Bestandteil wurde es auch im Jahr <strong>2019</strong> vielfach<br />
von den Bürgern der Stadt Iserlohn wahrgenommen. Mit einer<br />
positiven Veränderung der Symptomatik in 52 % der beendeten<br />
Betreuungen können wir auch in <strong>2019</strong> auf ein erfolgreiches<br />
Berichtsjahr zurückblicken.<br />
Bedingt durch die fortschreitend hohen Klientenzahlen und<br />
Beratungskontakte gelangt unsere Suchtberatungsstelle seit Jahren<br />
an die Grenzen ihrer zeitlichen und persönlichen Ressourcen und<br />
Möglichkeiten. Um den vielen Klienten und Anfragen gerecht<br />
werden zu können, werden wir auch weiterhin unsere offene<br />
Sprechstunde anbieten. Sie ermöglicht es uns auch in Zukunft,<br />
trotz hoher Nachfrage für unsere Kunden zeitnahe Hilfe und eine<br />
regelmäßige Erreichbarkeit sicher zu stellen.<br />
Wie in den letzten Jahren sticht bei der Auswertung unserer Daten<br />
besonders die hohe Zahl der Arbeitslosengeld I- und der<br />
Arbeitslosengeld II -Empfänger und die hohe Zahl der<br />
Grundsicherungsempfänger mit einer Suchtproblematik ins<br />
Auge. Dies ist zum einen auf die schwierige Arbeitsmarktlage<br />
speziell für langzeitarbeitslose Menschen zurückzuführen, zum<br />
anderen muss allerdings mit Besorgnis betrachtet werden, dass<br />
sich das Fehlen von Arbeit, Beschäftigung und Tagesstruktur als<br />
Sucht fördernde Komponente herausstellt, welche immer häufiger<br />
dazu führt, dass bereits junge Menschen frühzeitig erwerbsunfähig<br />
werden und Grundsicherung erhalten müssen. Im Rahmen unserer<br />
Hilfe wird die Beschäftigung mit der entstehenden Armut durch die<br />
Folgen der Arbeitsmarkt- und Sozialreformen der letzten Jahre<br />
leider auch in den folgenden Jahren weiterhin ein zentrales Thema<br />
bleiben. Um den betroffenen Menschen eine Zukunftsperspektive<br />
vermitteln zu können, wünschen wir uns unter Anderem die<br />
Einrichtung eines „Dritten Arbeitsmarktes“, der auch von der Freien<br />
Wohlfahrtspflege als sinnvoll und notwendig erachtet wird und<br />
erhoffen uns für die Zukunft entsprechende politische<br />
Weichenstellungen.<br />
Die Begleitung und Beratung der hohen Anzahl von Patienten mit<br />
Doppel- oder Mehrfachdiagnosen wird auch in Zukunft eine enorme<br />
Herausforderung für uns darstellen und einen großen Anteil unserer<br />
Arbeit ausmachen. Viel zu wenig ambulante Psychotherapieplätze,<br />
zu wenig psychiatrische Fachärzte und fehlende integrative<br />
Behandlungsprogramme im ambulanten Rahmen werden unsere<br />
Arbeit auch in Zukunft zusätzlich erschweren. Wir fordern daher die<br />
Einrichtung von ausreichenden ambulanten Psychotherapieplätzen,<br />
- 64 -
insbesondere für die Gruppe der Patienten mit Doppel- und<br />
Mehrfachdiagnosen!<br />
In unserer Arbeit hat sich sowohl die interne Kooperation mit<br />
dem gut ausgebauten Netz unseres Caritasverbandes als auch die<br />
externe Zusammenarbeit mit den Hilfsangeboten in Iserlohn und<br />
Umgebung bewährt.<br />
Die besorgniserregende Entwicklung auf dem Glücksspielmarkt und<br />
die vergleichsweise hohe Nachfrage unseres Beratungsangebotes<br />
für Glücksspieler und betroffene Angehörige bestätigt uns in der<br />
Schwerpunktsetzung unseres Angebotes und bestärkt uns darin,<br />
auch in Zukunft die Selbsthilfegruppe für Glücksspieler weiter<br />
fortzuführen.<br />
Auch die therapeutisch geleitete Nachsorgebehandlung in<br />
Kooperation mit dem Therapieverbund ARS-MK werden wir 2020<br />
in Iserlohn fortführen und um eine Weiterbehandlungsgruppe<br />
für Menschen mit einem erweiterten Behandlungsbedarf ergänzen.<br />
Wir freuen uns, auch weiterhin die Selbsthilfegruppe Cari-Point<br />
in unserem Haus beheimatet zu wissen und wünschen ihr auch für<br />
das kommende Jahr regen Zulauf und eine gute und erfolgreiche<br />
Arbeit.<br />
Hinsichtlich der pathologischen Computer- und Mediennutzung<br />
müssen in Zukunft neue Zugangswege und Hilfsangebote<br />
in Iserlohn gefunden und installiert werden. Dies wird leider nicht<br />
im Rahmen unseres bisherigen Angebotes finanzierbar und<br />
durchführbar sein. Die Informations- und Kooperationstreffen mit<br />
der Familien- und Erziehungsberatung in unserem Hause werden<br />
weiterhin stattfinden, damit wir die betroffenen Eltern,<br />
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Iserlohn zumindest im für<br />
uns durchführbaren Rahmen unterstützen können.<br />
Die Teilnahme an Arbeitskreisen und Gremien ist auch weiterhin<br />
notwendig und vorgesehen, um die wichtigen Vernetzungs- und<br />
Kooperationsmöglichkeiten auf lokaler, regionaler und überregionaler<br />
Ebene nutzen zu können.<br />
Auch für das Jahr 2020 haben wir uns vorgenommen, die bereits<br />
hohen Qualitätsstandards unserer Beratungsstelle zu halten und<br />
mit Hilfe des bestehenden Qualitätsmanagementsystems weiter<br />
auszubauen. Hierzu wird im kommenden Jahr auch wieder eine<br />
Selbstbewertung zählen. Die Erhebung und Auswertung des<br />
erweiterten Kerndatensatzes KDS 3.0 (Kap. 8.2) wird auch<br />
weiterhin sowohl für uns als auch für unsere Klienten und die Hardund<br />
Software eine besondere Herausforderung darstellen, der wir<br />
uns im Sinne weiterhin guter Qualitätsstandards stellen.<br />
- 65 -
10. Dank<br />
An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, die uns bei unserer<br />
Arbeit in der Beratung von Hilfe suchenden Abhängigkeitskranken<br />
und deren Angehörigen unterstützt haben:<br />
• den mit uns in Kontakt stehenden Einrichtungen, Institutionen,<br />
Ämtern, Krankenhäusern, Therapieeinrichtungen, Beratungsstellen,<br />
und (Selbsthilfe-) Gruppen<br />
• den Kooperationspartnern des ARS-MK<br />
• den Kollegen und Mitarbeitern des Caritasverbandes Iserlohn,<br />
Hemer, Menden, Balve e.V.<br />
Wir wünschen uns weiterhin eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit,<br />
so dass wir auch weiterhin die Menschen, die uns um Hilfe<br />
bitten, kompetent beraten und begleiten können und damit<br />
unseren gesellschaftlichen Auftrag nach besten Wissen und<br />
Gewissen erfüllen können.<br />
Iserlohn, Februar 2020<br />
Uta von Holten<br />
Thomas Kreklau<br />
Dipl. Soz. arb / Dipl. Soz. päd.<br />
Dipl. Soz. arb.<br />
Suchttherapeutin (VDR) Suchttherapeut i. A.<br />
Systemische Familientherapeutin (DGSF)<br />
- 66 -
Psychosoziale Suchtberatung<br />
Karlstr. 15<br />
58636 Iserlohn<br />
Telefon 02371/8186 20<br />
02371/8186 19<br />
Telefax 02371/8186 81<br />
u.vonholten@caritas-iserlohn.de<br />
t.kreklau@caritas-iserlohn.de<br />
www.caritas-iserlohn.de<br />
www.suchtberatung-iserlohn.de<br />
www.caritas-chamäleon.de<br />
- 67 -