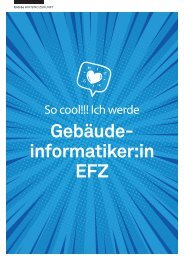eTrends Magazin 03/2019
Das Schweizer Brachenmagazin für Elektro, Smart Building und E-Mobility. Von der Branche für die Branche, mit der Branche.
Das Schweizer Brachenmagazin für Elektro, Smart Building und E-Mobility. Von der Branche für die Branche, mit der Branche.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
eTrends 03 : 2019 ELEKTRO, SMART BUILDING, MULTIMEDIA, ICT/IOT, LICHT, EMOBILITY
eTrends
ELEKTRO, SMART BUILDING, MULTIMEDIA
ICT/IOT, LICHT, EMOBILITY
No3
2019
IOT
Das Zeitalter des
Internet der Dinge hat
bereits begonnen.
SWISSBAU 2020
Interview zum Ausbau
der Messe als Chance
für die Branche.
MULTIMEDIA
Streaming, Business
für den Multimediafachandel.
Einfach. Mehr.
Das beste Gesamtpaket.
Alles aus einer Hand und mit 9 Niederlassungen immer in Ihrer Nähe.
Das ist das beste Gesamtpaket der Elektrobranche.
Jetzt mehr erfahren: elektro-material.ch
EDITORIAL
NOTBELEUCHTUNGEN.
Mit unserem Wireless
Professional stehen
Sie nie im Dunkeln.
Der Umbruch
Dieser Titel ist doch eine schöne
Schlagzeile, oder? Und solche Zeilen
sollen uns, wie es ihr Name sagt, einen
Schlag versetzen. Ein Schlag weckt
auf, beendet das Träumen. Und wir
brauchen Leute, die wach sind und
ihre Träume verwirklichen wollen.
In eTrends berichten wir deshalb
über Träume, Ambitionen und Projekte
von wachen Menschen. Deshalb
sehen wir die Titelschlagzeile als äusserst
positiv und schauen hin, was sich
alles bewegt, hier in der kleinen
Schweiz. Und wir stellen fest: Alles
scheint im Wandel, nichts ist, wie es
einmal war. Das einzige Konstante
scheint der Wandel selbst zu sein.
Doch war dies nicht schon immer so?
Ganz bestimmt! Auch schon vor 125
Jahren, als Siemens mit dem Bau des
Kraftwerks Wynau erstmals mit eigenem
Personal in der Schweiz arbeitete.
Weil sich alles wandelt, können
wir auch in dieser Ausgabe wieder
sehr viel Gutes über Trends aus dem
Umfeld der Elektroinstallation berichten.
Das ermutigt uns, zusammen
mit unseren Lesern und Partnern weiterzuarbeiten
für eine effizientere
Schweiz, die bewusster mit ihren
Energien und Ressourcen umgeht.
Nun fragen Sie: «Wie zum Beispiel?»
Zum Beispiel mit dem Engagement
der Swissbau, die neu die Themen Gebäudeautomation
und Licht mit der
Architektur zusammenbringt. Dies
ist eine grosse Chance für die Automationsbranche,
wenn sie denn gepackt
wird. Dann mit der neuen Ausbildung
zum/zur Projektleiter/-in
Gebäudeautomation, die im Mai in
Winterthur gestartet ist. Eine Chance
für junge Berufsleute. Oder mit dem
neuen Verein SmartGridready, der
die Vernetzung von elektrischen Geräten
mit dem Stromnetz fördert.
Aber auch Betriebsoptimierungen im
Gebäude gehören dazu. Und sicher
RENÉ SENN
Chefredaktor
redaktion@etrends.ch
«Was die Elektrobranche
derzeit
erlebt, ist durchaus
ein Schlaraffenland
– vergleichbar
mit der Zeit nach
der Erfindung der
Glühbirne und des
Wechselstroms.»
haben Sie auch gelesen, dass im März
erstmals in der Schweiz mehr Erstzulassungen
für Elektroautos registriert
wurden als für Benziner. Dies dürfte
zwar eine Momentaufnahme sein,
gibt aber kleinen Elektrofahrzeugen
wie den brandneuen Microlino und
eGo Schub. Auf den ersten elektrischen
Porsche müssen Sie noch etwas
warten, auf eTrends nicht. Unser Layout
hat auch diesmal ganze Arbeit geleistet
und die Umbrüche so gestaltet,
dass eTrends auch optisch ein Vergnügen
ist.
...die perfekte Lösung für die
Gebäudesanierung.
▪ Keine Installationen in Funktionserhalt
▪ Wirtschaftliche und nachhaltige Lösung
▪ 100% Normkonform
▪ Keine Komforteinbusse für Unterhalt
▪ Selbständiger Aufbau der Funkkommunikation
▪ Individuelle Funktions- & Kapazitätstests
▪ Meldungen via E-Mail-Funktion
▪ Integrierbar in Gebäudeleitsysteme
Weitere Infos: www.awag.ch oder 044 908 19 19
awag.ch
Immer auf der sicheren Seite
Brandschutz mit System
1
2
Vom Wohngebäude bis zum Industriekomplex –
OBO hat die passende Lösung für eine brandsichere
Elektroinstallation. Unsere geprüften und zugelassenen
Brandschutz-Systeme decken alle
relevanten Schutzziele des baulichen Brandschutzes
ab und bieten funktionale Anwendungen für die Praxis.
1
2
Sicherheitsstromversorgung
gewährleisten auch im Holzbau
Funktionserhalt‘s Lösungen für die
unterschiedlichsten Anwendungen
Flucht- und Rettungswege sichern
Brandschutzkanäle und Tragsysteme
BETTERMANN AG
Lochrütiried 1
CH-6386 Wolfenschiessen
Telefon: 041 629 77 00
E-Mail: info@bettermann.ch
www.obo.ch
190639 - BSS Anzeige Schweiz_184x264.indd 1 28.05.19 11:24
INHALT
Seite 18
Interview Swissbau
Seite 50
Internet der Dinge
Seite 56
Multimedia
Seite 68
Prävention
Entrée
6 Trends
Die aktuellen Trends schon
gesehen?
11 Grosses Interview
SmartGridready und bereit
für die Zukunft.
15 Projektleiter/in GA
Ausbildung für Gewerkeübergreifendes
Wissen.
18 Swissbau-Interview
Der Ausbau der Swissbau
2020 und die Chancen.
22 Die Cloud-Studie
Der Game-Changer im
ICT-Betrieb.
Elektrotechnik
24 Effiziente Motoren
Neue Antriebstechnik
spart richtig Geld.
eTrends 03 : 2019 ELEKTRO, SMART BUILDING, MULTIMEDIA, ICT/IOT, LICHT, EMOBILITY
eTrends
ELEKTRO, SMART BUILDING, MULTIMEDIA
ICT/IOT, LICHT, EMOBILITY
IOT
Das Zeitalter des
Internet der Dinge hat
bereits begonnen.
SWISSBAU 2020
Interview zum Ausbau
der Messe als Chance
für die Branche.
MULTIMEDIA
Streaming, Business
für den Multimediafachandel.
Titelfoto: © Samsung
Kunst ist auch die Reduktion
auf das Wesentliche.
No3
2019
28 Betriebsoptimierung
Faktenbasiert und je nach
Kanton gar Vorschrift.
31 125 Jahre Siemens
Die Firmengeschichte in der
Kurzform.
Praxis
34 Licht beim Matterhorn
Spielgelwerfer für optimales
Licht bei jedem Wetter.
36 Das intelligente Hotel
Herausforderung neue
Raumautomation.
39 Predictive Maintenance
Das Post-Verteilzentrum,
das sich selbst überwacht.
42 e-Trends Praxistipp
100 % weniger Fehler:
stecken statt verdrahten.
46 prSIA 2060
Infrastruktur für Elektrofahrzeuge
in Gebäuden.
48 Positive Bewertung
Online-Kundenbewertung:
Worauf muss ich achten?
Smart Building
50 Internet der Dinge, IoT
Neustrukturierung der
Gebäudeautomation.
54 Wunderprotokoll MQTT
Kommunikation mit wenig
Aufwand
Multimedia
56 Streaming Hardware
Hochkonjunktur für die
Multimedia-Branche.
59 TV und Kunst
Die schwarze Glotze muss
nicht mehr sein.
eMobility
62 This is not a car
Der Microlino wird jetzt in
der Schweiz ausgeliefert.
64 Der Elektro-Porsche
Die Ära der Elektrosportwagen
beginnt defintiv.
Basiswissen
68 Schutz der Lernenden
Prävention von Elektrounfällen
bei Lernenden
71 NIN-Prüfungsfragen
Drei Fragen: Prüfe dein
Normen-Fachwissen.
72 Der Ringerder
Wann braucht es einen und
wann nicht?
Finale
74 Minergiemodul
76 Plattform
80 Verbände
82 Kolumne Streiflicht
82 Impressum
Ausgabe 3/19
eTrends 05
TRENDS
Innovativ
beleuchten
Die neue TRILUX Bicult LED revolutioniert
die Bürobeleuchtung. Sie
kombiniert als erste Tischleuchte einen
direkten und indirekten Lichtaustritt.
Während die nach oben gerichtete
blendfreie Indirektbeleuchtung das gesamte
Büro erhellt, schafft der Direktanteil
perfektes Licht auf dem Schreibtisch.
Nutzer können ihr persönliches
Licht individuell an der Leuchte oder
per App einstellen. Das ermöglicht
normgerechtes Licht mit einer noch nie
dagewesenen Flexibilität.
www.trilux.com
Einzigartige Kombination
Mit dem CombiAdoraTrocknen V4000 DualDry lässt sich Wäsche im Trockner oder
an der Leine aufgehängt trocknen. Dafür sind keine zusätzlichen Installationen wie
Abwasserleitungen oder ein separater Stromanschluss notwendig. Auf Knopfdruck
startet am DualDry der Raumluftwäschetrocknungs-Modus starten. Nach der Wahl
des Programms auf dem Display müssen die beiden Klappen am Gerät geöffnet werden.
Der Trockner zieht bei der unteren Klappe die Raumluft an, entzieht ihr im Gerät
Wasser und gibt die trockene Luft wieder über die obere Klappe ab – simpel und
genial. Mit dem Programm Feuchteregelung misst der DualDry während einer Woche
permanent die Luftfeuchtigkeit im Raum. Ist sie höher als die definierte Zielfeuchtigkeit,
startet das Gerät automatisch den Raumluftwäschebetrieb. Sobald es den
Zielwert erreicht hat, wird die Raumluftwäschetrocknung gestoppt, und das Gerät
beginnt wieder mit der Messung der Luftfeuchtigkeit.
www.vzug.ch
Brandschutzkanal-System
Der Brandschutzkanal von Bettermann aus Stahlblech hat eine im
Brandfall aufschäumende Innenbeschichtung, die die Ausbreitung von
Feuer und Rauch verhindert. Flucht- und Rettungswege bleiben nutzbar.
PYROLINE® Rapid kann abgehängt oder direkt an Wand, Decke oder
Boden montiert werden. Der Kanal ist auch in der Ausführung Reinweiss
erhältlich und verfügt über eine VKF-Anerkennung.
www.obo.ch
06 eTrends Ausgabe 3/19
FAKTEN
Im Dezember 2018 hatte der
Streamingdienst Spotify weltweit
Millionen Nutzer. 96
Die Audio-Sonnenbrille
Für die Mitmenschen ist es nur eine Sonnenbrille. Eine mit Brillenscharnieren aus
Metall, einer Fassung aus Nylon und splitter- und kratzfesten Gläsern in klassischem
Design. Doch wer sie trägt, kennt ihre Geheimnisse. Dank kleinsten, in den
Bügeln versteckten Elektronikkomponenten von Bose geniesst Mann und Frau ein
revolutionäres, persönliches, kraftvolles Klangerlebnis. Exklusive Technologien
und spezielle Lautsprecher sorgen dafür, dass der Klang nur auf Sie ausgerichtet
ist, sodass andere praktisch nichts hören. Die innovative Sonnenbrillen-Kollektion
umfasst zwei klassische Modelle, eines im eckigen Look mit grösserer Passform
und eines mit abgerundeten Gläsern mit kleinerer Passform.
www.bose.ch
Fernsehen
per App
Die neue Apple TV-App steht ab
sofort auf allen 2019er Samsung
Smart TV-Modellen und per
Software-Update auch auf ausgewählten
Geräten der Generation
2018 zur Verfügung. Darüber hinaus
unterstützen die gleichen Modelle
jetzt auch AirPlay 2 . Als erster Hersteller
ermöglicht Samsung seinen
Kunden, Apple TV-Kanäle, iTunes-
Filme und -Serien auf ihrem Smart
TV zu geniessen.
www.samsung.com
Mobiles
digitales Flipchart
Flexibilität für jeden Raum – so
lässt sich das mobile, digitale Flipchart
i3SIXTY von i3-Technologies
auf den Punkt bringen. Das stylische
Device mit seinem um 90 Grad
drehbaren, interaktiven Screen
bietet umfassende Whiteboarding-
Funktionen und besticht durch ein
natürliches Touch-Erlebnis. Der
grosse Funktionsumfang verwandelt
jedes Besprechungszimmer
und jeden Seminarraum in eine
moderne, benutzerfreundliche,
kollaborative Arbeitsumgebung. So
lassen sich beispielsweise Ideen
schnell und komfortabel festhalten.
Zudem unterstützt das i3SIXTY
dank integrierter Kamera und
Mikrofon verschiedene Videokonferenzanwendungen.
Darüber hinaus
ist es mit einem Browser ausgerüstet
und ermöglicht mithilfe der App
i3ALLSYNC oder dem sogenannten
i3ALLSYNC-Transmitter drahtlose
Präsentationen ab unterschiedlichsten
Devices.
www.ceconet.ch
Ausgabe 3/19 eTrends
07
Feller AG
SMARTES LICHT. SMARTER TASTER.
Neu lässt sich das intelligente Beleuchtungssystem Philips Hue nicht
mehr nur mit der App steuern, sondern auch mit dem von Feller entwickelten
Smart Light Control, der sich in das bestehende EDIZIOdue
Schalterprogramm integriert. Die Taster können frei platziert werden,
da sie weder Batterien noch Kabel benötigen.
Als erster Schweizer Anbieter von intelligenten
Lichtschaltern ist die Feller
AG «Friends of Hue»-Partner von
Signify (ehemals Philips Lighting) und
somit Teil des smarten LED-Beleuchtungsökosystems
«Philips Hue» mit
seinen 16 Millionen Farben. Philips
Hue kombiniert brillantes und energiesparendes
LED-Licht mit intuitiver
Technologie.
Ohne Batterie und Kabel,
frei platzierbar
Smart Light Control ist batterie- und
drahtlos. Die erforderliche Energie
erzeugt der Benutzer des Tasters nämlich
selbst. Durch das Betätigen des
Wippschalters wird genügend Energie
produziert, um das Schaltsignal per
Funk zu übertragen. Smart Light Control
bietet die Möglichkeit, das Licht
zu dimmen, ein-/auszuschalten oder
Szenen abzurufen. Die Taster lassen
sich ganz einfach mit der Philips Hue
App programmieren. So eröffnet die
vernetzte Wohnungsbeleuchtung unendlich
viele Möglichkeiten für Farbspiele
und lässt sich mit Musik, Fernseher
oder Games synchronisieren.
Ein weiterer Vorteil ist die innovative
Befestigung. Für die Montage stehen
drei Varianten zur Verfügung: als
Standalone mittels Kleben oder
Schrauben für individuelle Anwendungen,
als Integration in eine bestehende
Installation oder als Erweiterung
(Retrofit) mit einem EDIZIOdue
Kombinationsrahmen von Feller.
Smart Light Control im
EDIZIOdue Design
Für die richtige Wohlfühloase zuhause
muss jedes Detail aus einem
Guss kommen. So legt Feller grössten
Wert auf ausgewogenes und durchdachtes
Design, um Form und Farbe
an die Oberflächen anzupassen. Smart
Light Control ist in allen zwölf Farben
der EDIZIOdue colore Linie erhältlich.
Für noch exklusivere Designansprüche
lassen sich die Taster mit 15
hochwertigen Echtmaterialrahmen,
wie zum Beispiel Glas, Chromstahl
oder Messing, im EDIZIOdue prestige
Design kombinieren. Und das gewisse
Etwas: Die individuelle Tasterbeschriftung
bietet zusätzlichen
Bedienkomfort.
Erweitertes Connected
Home Ökosystem
Feller gilt als Pionier in der Entwicklung
von intelligenten Schaltern und
Tastern für zuhause. Seit 2001 ermöglicht
Feller ihren Kunden, Licht, Jalousien
und Temperaturregelung intelligent
zu bedienen und zu steuern.
Die Erweiterung des Feller Sortiments
mit Smart Light Control ist somit
eine logische Konsequenz, um das
«Smart Light
Control for Philips
Hue ist ideal für
Renovationen oder
Nachrüstungen –
dank innovativen
Befestigungsmöglichkeiten,
Funktechnologie
und batterielosem
Betrieb.»
Niko Ryhänen, Future Offer Senior
Manager bei Feller
Feller Connected Home Ökosystem
weiter auszubauen. Die intelligenten
Feller Taster sind im Philips Hue Ökosystem
als «Friends of Hue Switch»
sichtbar – neben anderen Anbietern
wie Amazon, Apple oder Google.
Feller AG
8810 Horgen
www.feller.ch/hue
TRENDS
Digitales Licht
der Zukunft
Das Ziel von Zumtobel ist es, Licht über
seine Kernfunktion der puren Beleuchtung
hinaus weiterzuentwickeln und
dadurch eine Grundlage für eine sichere,
drahtlose Highspeed-Verbindungen zu
schaffen. Für den Testlauf im Frühjahr
2019 hat Zumtobel das System von pure-
LiFi in seine LED-Leuchten integriert. Das
System ermöglicht eine Datenübertragung
mit hoher Geschwindigkeit mittels
einer LED-Leuchte, indem die Helligkeit
der Leuchte geringfügig variiert. Das
Ergebnis ist eine Hochgeschwindigkeits-
Internetverbindung, die sicherer und zuverlässiger
ist und eine Bandbreite liefern
kann, welche die Möglichkeiten konventioneller
Drahtlos-Kommunikationssysteme
wie Wi-Fi bei Weitem übertrifft.
Einzige Voraussetzung: Das Licht muss
dazu natürlich eingeschaltet sein. In den
kommenden Monaten wird Zumtobel die
Marktnachfrage nach dieser bahnbrechenden
Technologie weiter prüfen.
www.zumtobel.ch
VEREINFACHEN SIE IHREN ALLTAG.
Mit Steuerungs- und Automatisierungstechniken
Das KA11 Touchpanel ist die ultimative Wahl für einfache, intuitive
Steuerung des Home Entertainments, der Haustechnik und Konferenzräume
in Wohn- oder Gewerbeeinrichtungen.
JETZT INFORMIEREN!
www.stilus.ch | info@stilus.ch
TRENDS
Jetzt lieferbar: Der e.GO Life –
Sportwagen und Kompaktauto!
Scooter im Trend
Wer an die Zukunft und an Trends
denkt, kommt an einem nachhaltigen
und umweltbewussten Lebensstil nicht
vorbei. Elektro-Scooter spielen vor allem
im urbanen Raum eine immer wichtigere
Rolle. Diesen Trend nutzt die Zürcher
Firma eflizzer. Der eScooter Basic
verfügt über einen 500-Watt-Motor und
eine 18-Ah-Akku, der eine Reichweite
bis 80 Kilometern bietet. Neu verfügt
das Elektro-Trotti über eine elektrische
Motorbremse mit Rekuperationsfunktion
und hydraulischem Bremssystem.
Das Fahrzeug ist für den Schweizer
Strassenverkehr zugelassen.
www.eflizzer.ch
Der neue e.GO Life des 2015 gegründeten deutschen Autoherstellers e.GO Mobile AG
kombiniert Fahrspass mit praktischem Nutzen. Das Fahrzeug wurde von Grund auf als
kompaktes, spritziges Elektroauto entwickelt und beweist, dass Elektromobilität ohne
jegliche Abstriche oder Aufpreise möglich ist. Im Mai 2019 begann die Auslieferung
des Elektroautos e.GO Life, für das bereits 3300 Vorbestellungen eingegangen waren.
www.e-go-mobile.com
Zu Hause tanken
Wer ein Elektroauto fährt, braucht
zu Hause auch eine Tankstelle. Die
neue EVlink Wallbox G4 von Schneider
Electric zur Wand- oder Bodenmontage
eignet sich perfekt für das sichere
Aufladen im Innen- oder Aussenbereich.
Damit die Ladestation nicht
unrechtmässig benutzt wird, kann
sie mit einem Schlüsselschalter oder
einer RFID-Karte gesperrt werden.
Ob die Solaranlage genügend Strom
liefert oder im Gegenteil ein Engpass
besteht, lässt sich dank einem
Steuereingang an der Station mit
Hilfe eines potentialfreien Kontaktes
anzeigen. Ein feines Detail: Über eine
optionale Steckdose kann auch mal
das E-Bike aufgeladen werden.
www.schneider-electric.ch
10 eTrends Ausgabe 3/19
Entrée VERBANDSNEWS
SmartGridready
INTERVIEW: RENÉ SENN
«Bereit für die Zukunft!» ist der Slogan des Vereins
SmartGridready, der im März in Bern gegründet wurde. Wer
steckt dahinter und was sind die Ziele und Chancen des
Vereins? eTrends fragt nach bei Präsident Jürg Grossen.
M
it SmartGridready wurde
am 29. März 2019 im
Bundeshaus in Bern ein
neuer Verein gegründet.
Unter den Gründungsmitgliedern
befinden sich namhafte
Schweizer Firmen aus dem Verteilnetz-
und Gebäudesektor sowie Verbände
und Fachhochschulen. Der Verein
führt die Ergebnisse eines seit 2017
laufenden und von Energie Schweiz
unterstützen Projekts weiter: Geräte
wie Wärmepumpen, Waschmaschinen
und Ladestationen für Elektroautos
sollen künftig dank dem Label «Smart-
Gridready» Informationen mit dem
Stromnetz und den Produktionsanlagen
austauschen können. Damit wird
eine effizientere, dezentralere und sicherere
Stromversorgung möglich.
Nur so wird die neue Energiewelt mit
mehr Stromeffizienz und erneuerbarer,
dezentraler Stromproduktion bald
Realität.
Mittelfristig müssen alle elektrischen
Geräte mit dem Smart Grid
kommunizieren können. Dies ist ein
sehr wichtiger Aspekt, der zukünftig
an Brisanz gewinnen wird und für den
in der Schweiz eine Lösung bereitstehen
muss. Ist der neue Verein der
Schlüssel dazu?
Hand aufs Herz, braucht die
Branche, die Schweiz noch einen
neuen Verein?
Jürg Grossen: Irgendeine Organisationsform
brauchen wir (lacht), ein Verein
ist für unser Anliegen das Richtige.
Der Bedarf für eine Vereinheitlichung
der Kommunikation im Stromnetz
zwischen Geräten, Produktionsanlagen
und Netzen ist vorhanden.
In allen Vereinen der Gebäudetechnik
sind mehr oder weniger
dieselben Leute engagiert.
Besteht da nicht die Gefahr, dass
es thematisch zu wenig rasch
vorwärts geht?
Es gibt wohl nicht «den» Verein, der
alle Bedürfnisse abdeckt. Wir haben
den Anspruch, dass mit unserer zielorientierten
Vereinsstruktur nicht Firmenpolitik,
sondern eine sachliche
Jürg Grossen
Energiefachmann und
Unternehmer, Nationalrat
und Präsident der GLP. Er
engagiert sich für eine
umweltverträgliche
Wirtschaft. Energie- und
insbesondere Stromeffizienz
sind für ihn den
Schlüssel zur Umsetzung
der Energiewende.
Strom- und Energiepolitik betrieben
wird, so dass wir rasch vorwärts kommen.
Was ist das Ziel von
SmartGridready?
Das Ziel von SmartGridready ist ein
breit anerkanntes und verbreitetes
Qualitätslabel für eine intelligent
kommunizierende Energieversorgung.
Einerseits sind der Aufbau und
die Verbreitung des Labels ein Ziel.
Andererseits wollen wir den Herstellern
und Vertreibern von SmartGridready-kompatiblen
Produkten die
Möglichkeit bieten, Geräte, Applikationen
und Systeme zertifizieren zu
lassen. Ebenso im Fokus sind die Förderung
der interdisziplinären Zusammenarbeit
der Mitglieder und der
technischen Entwicklung im Austausch
mit der internationalen Standardisierung
sowie die Spezifikation
des Labels.
Wie funktioniert SmartGridready?
Elektrische Geräte und Ladestationen
sollen künftig dank der Funktion
«SmartGridready» mit dem Stromnetz
und den Produktionsanlagen vernetzt
sein und mit ihnen kommunizieren. Es
wird eine effizientere, dezentralere
und sicherere Stromversorgung möglich,
und zwar durch die Interoperabilität
von «Communicator» und «Product»,
wobei hier die Begriffe für
Hardware und Software ihre Gültigkeit
haben. Diese Interoperabilität
wird mit dem Label «SmartGridready®»
und einem Flexibilitätsfaktor
deklariert.
→
Ausgabe 3/19 eTrends
11
Firmenmitglieder
Stand Mitte Mai 2019
• Allenbach Holzbau und
Solartechnik AG
• Amstein + Walthert AG
• Centralschweizer
Kraftwerke AG
• Elektroplan Buchs &
Grossen AG
• Energie 360° AG
• Energie Thun AG
• Eprotraffic GmbH
• IBT Ing.büro Brönnimann Thun
• Invisia AG
• it4power
• Optimatik AG
• Robotron Schweiz GmbH
• Sauter Building Control
Schweiz AG
• Smart Energy Control GmbH
• Smart Energy Link AG
• Solutil
• Sunngarten GmbH
• Topsolaris one GmbH
• The Brandpower
• Wago Contact SA
• Zehnder Group Schweiz AG
Ist SmartGridready ein Standard,
eine Technologie oder ein Kommunikationsmodus,
oder muss ein
Hersteller ein spezifisches Bauteil
von Dritten einkaufen und in seine
Steuerung integrieren?
Es ist ein Standard mit einem Zertifikat
für Interoperabilität und Kommunikation,
also zur Sicherstellung von
Kompatibilität für Technologien untereinander.
Ihr schreibt, das System basiere
auf zwei Komponenten. Kannst du
uns das Prinzip erklären?
Die zwei Komponenten nehmen an
einer Art elektronischem Energiedialog
über Flexibilität teil. Der Communicator,
beispielsweise eine Software
eines Energieanbieters, führt in einer
koordinierenden Rolle mehrere Dialoge
mit Products, das heisst mit Gebäudesystemen.
Dementsprechend ist
das Gegenstück in jedem Gebäude
auch eine Kommunikationssoftware.
Sie kann das Product sein, das mit dem
Communicator verhandelt. Das
2-Komponenten-Prinzip fokussiert
auf eine spezifische Beziehungsebene.
In der Praxis gibt es von der Produktion
bis zum Endverbraucher immer
mehrere solcher Ebenen, welche jeweils
einzeln betrachtet werden.
Communicator und Product verstehen
sich bei einer Netzanbindung auf Anhieb.
Um dies zu ermöglichen, führen
wir den Flexibilitätsindikator ein. Er
beschreibt, wie flexibel das System ist,
um Energie zu unterschiedlichen Zeitpunkten
zu liefern oder zu beziehen.
Aufgrund dieser Information kann ein
System so konfiguriert werden, dass es
sich automatisch nach Kosten, dem
Strommix oder der Energieeffizienz
optimiert. Dank SmartGridready ist
dies mit einer herstellerunabhängigen
Kommunikation möglich.
Ist nicht die Vernetzung der
Wohnungen und Häuser die Basis
für SmartGridready? Sprich, ohne
Smart Home kein SmartGridready?
Das Thema ist grösser und umfasst
unter anderem Smart Buildings jeder
Art, Areale, Zusammenschlüsse zum
Eigenverbrauch (ZEV), Smart Cities
sowie Mobilitätskonzepte. Die Vernetzung
von Smart Homes ist hierbei ein
wichtiger Mosaikstein.
Wie ist die Kommunikation im
Gebäude angedacht?
Da muss das Rad nicht neu erfunden
werden, zahlreiche Systeme und Geräte
auf dem Markt erfüllen die
Grundvoraussetzungen für Smart-
Gridready. Die Interoperabilität vom
und zum Netz muss nun standardisiert
werden. Für die Kommunikation im
Gebäude gibt es ja schon zahlreiche
Interessenverbände, die sich der Konnektivität
im Gebäude angenommen
haben. Sie sind unsere Partner, mit
denen wir unsere Ziele erreichen.
Braucht es netzseitig nicht auch
Infrastruktur, damit das am
Schluss funktioniert, Stichwort
Flexibilität im elektrischen Netz?
Selbstverständlich. Es müssen auch
netzseitig flexible, sichere und kompatible
Softwaretechnologie sowie ent-
Voller Energie Die Mitglieder
der Gründungsversammlung
von SmartGridready.
12 eTrends Ausgabe 3/19
sprechende Hardware bereitgestellt
werden.
Wie kann der Verein Hersteller
dafür gewinnen, Geräte
SmartGridready zu bauen?
HD-ready-Fernseher waren schon auf
dem Markt, bevor in HD gesendet
wurde. Dieser Standard brachte für
Hersteller und Endkunden Investitionssicherheit.
SmartGridready soll
für die Hersteller, die das Zertifikat
haben, einen ebenso klaren Wettbewerbsvorteil
bringen. Auch für Endkunden
bedeutet ein mit SmartGridready
zertifiziertes Gerät oder System
Investitionssicherheit. Sie sind damit
bereit für das Stromsystem der Zukunft.
Gibt es schon Hersteller, die an
der Entwicklung konkreter,
kompatibler Produkte arbeiten?
Ja, einige entwickeln bereits in diese
Richtung. Allerdings müssen wir unsere
Vorgaben für die Zertifizierung
zuerst noch fertig erarbeiten, damit die
erwähnte Investitionssicherheit garantiert
ist.
Und wer stellt einen SmartGridready
Communicator her, wo und
wann kann ich einen kaufen?
Communicators gibt es schon am
Markt. Das können zum Beispiel Steuerungen
von Wärmepumpen, Rundsteuerungen,
Bussysteme und vieles
mehr sein. Die Frage ist, welchen Flexibilitätsfaktor
sie erreichen. Hierzu
finden momentan Gespräche und Abstimmungen
mit den unterschiedlichsten
Stakeholdern statt.
Wer ist der Vermittler der
Technologie? Der Installateur,
der Planer, der Hersteller oder
adressiert ihr den Endkunden
direkt?
Die ersten drei Anspruchsgruppen
werden wir sicherlich in einem ersten
Schritt adressieren, um für die Botschaft
von SmartGridready möglichst
viele Multiplikatoren zu gewinnen.
Aber auch der Endkunde muss das
Thema verstehen, um den Nutzen zu
erkennen und seine Bedürfnisse damit
abzudecken. Der «Endkunde»
darf gerne auch ein Immobilieninvestor
sein.
Wer macht die Implementierung
beim Kunden, ist das Plug and
Play?
Das können ganz viele sein, zum Beispiel
Netzanbieter, Serviceanbieter,
Systemintegratoren, Installateure und
Gerätelieferanten. Ja, das Ziel ist eine
Art Plug and Play.
Hat die Schweiz im Zeitalter der
Globalisierung und Digitalisierung
überhaupt eine Chance bezüglich
eigenen Standards und Labels?
Durchaus. Die Schweiz hat das modernste
Energie- und Stromversorgungsgesetz
der Welt. Die Energiestrategie
2050 ermöglicht eine echte
Dezentralisierung und ist damit nahe
an der Physik. Um das umzusetzen,
brauchen wir nun richtig intelligente
Stromnetze. Wir haben zudem hervorragende
technologische Voraussetzungen.
Wir müssen als «Schweiz» lernen,
unsere Konzepte besser zu vermarkten
und zu verkaufen. Wir haben mit
unseren Regularien, unserer Infrastruktur,
unserem Knowhow zahlreiche
Trümpfe in der Hand und dadurch
Wettbewerbsvorteile.
→
Viel Neues unter der Sonne
im Bereich Energieeffizienz
Bestellen Sie jetzt
kostenlos die
Frühlings-Ausgabe:
e2f.ch/magazin
Das Magazin für Bauherren, Elektriker und
Architekten. Mit innovativen Produktlösungen,
spannenden Expertenmeinungen
sowie ausgewählten Referenzprojekten.
Wie ist die Anbindung oder der
Einfluss von internationalen
Standards gesichert?
Wir unterhalten sehr gute und intensive
Beziehungen mit den internationalen
Standardisierungsgremien und
bringen dort unsere Lösungskonzepte
ein.
In der Schweiz gibt es nur wenige
Hersteller, kann sich die Schweiz
einen eigenen SmartGridready-
Standard leisten?
Auch deswegen ist die internationale
Vernetzung notwendig. Wir verfügen
aber auch in der Schweiz über zahlreiche
Hersteller von smarten Produkten
und Systemen in unterschiedlichen
Disziplinen. Der Verein SmartGridready
ist sehr wichtig, um diesen Herstellern
national und international
eine starke Stimme zu geben. Die
Schweiz hat diesen Leistungsnachweis
bereits bei anderen Standards erbracht.
Gibt es eine Roadmap,
wie ist der Zeithorizont?
Ja, in den nächsten vier Jahren soll sich
das Label etablieren. Wir sind an der
Ausarbeitung der Anforderungen für
den Label-Inhalt und dessen Weiterentwicklung.
Wie ist die Abgrenzung zum Verein
Smart Grid Schweiz?
Vertreter des Vereins Smart Grid
Schweiz sowie einige Mitgliedsfirmen
arbeiten aktiv am Aufbau von Smart-
Gridready mit. Smart Grid Schweiz
deckt vorwiegend die Interessen der
Stakeholder aus dem Netzbereich ab.
Mit den Aktivitäten von SmartGridready
bauen wir eine Brücke zwischen
dem «Netz» und dem «Gebäude» und
sind somit die sinnvolle Ergänzung
zum Verein Smart Grid Schweiz.
Was ist der Nutzen von
SmartGridready für die Mitglieder
und die Branche?
In der Aufbauphase ist der Nutzen sicherlich
ein Wettbewerbsvorteil für
die Mitglieder durch Wissensvorsprung.
Im Betrieb und weiteren Ausbau
werden die Transparenz und die
Investitionssicherheit für Anschaffungen
und Produkte-Entwicklungen ein
wichtiger Nutzen sein.
www.smartgridready.ch
Verbandsmitglieder
und Fachhochschulen
Gründung 29.3.2019
• CRB, Standards für das
Bauwesen
• FH Nordwestschweiz
• Gebäudeklima Schweiz GKS
• Konferenz der GebäudetechnikVerbände,
KGTV
• Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen
VSE
• Verein Smart Grid Schweiz
VSGS
Jetzt
anmelden!
Informationsveranstaltung
NIN 2020
Die Änderungen der NIN 2020 – kompakt und aus erster Hand
Kompetente Referenten erläutern an halbtägigen Veranstaltungen praxisnah die Neuerungen und Anpassungen,
welche für Planung, Installation und Kontrolle von Bedeutung sind.
www.ninkurs.ch
In Zusammenarbeit mit:
Entrée BERUFSPRÜFUNG
Es geht los
Der erste Lehrgang der Schweiz zur Vorbereitung
auf die Berufsprüfung zum/zur Projektleiter/in
Gebäudeautomation hat begonnen.
AUTOR: RENÉ SENN
E
nde 2017 unterzeichnete
das Staatssekretariat für
Bildung, Forschung und
Innovation SBFI die Wegleitung
zur Ausbildung
und zur Berufsprüfung Projektleiter/in
Gebäudeautomation. Damit erweitert
die Branche ihre Gebäudeautomations-Kompetenzen
und führt das
Gebäudeautomations-Knowhow in
den Bereichen Heizung, Lüftung,
Klima, Sanitär und Elektro (HLKSE)
zusammen.
Die Ausbildung richtet sich an Berufsleute
mit einem Fähigkeitszeugnis
aus der Elektro- oder Gebäudetechnikbranche,
die sich für eine moderne
und vernetzte Gebäudetechnik interessieren.
Der Lehrgang wird berufsbegleitend
absolviert und dauert rund
zwei Jahre. Er umfasst die fünf Module
technische Grundlagen, Projektführung,
technische Bearbeitung, Automation
und Leadership, die mit
einer Prüfung abgeschlossen werden.
Nach Abschluss der Modulprüfungen
kann die Berufsprüfung absolviert
werden.
Die Prüfungsordnung und Wegleitung
wurden vom Verband Schweizerischer
Elektro-Installationsfirmen
(VSEI, bald EIT.swiss), der Gebäude
Netzwerk Initiative (GNI) und dem
Schweizerisch-Liechtensteinischen
Gebäudetechnikverband (suissetec)
erarbeitet. Nachdem das SBFI die
Wegleitung unterzeichnet hatte, stellten
diese Verbände die weiteren
Unterlagen und Musterprüfungen zusammen.
Die Schulen ihrerseits kümmerten
sich um die Vorbereitung, Ausschreibung
und Durchführung der
Ausbildung.
«Die
Ausbildung
ist für mich
ein neuer
Weg, der die
Ausbildungen,
wie wir sie bisher
kannten,
ersetzt»
Marcel Lüdi, Kursteilnehmer
Die STFW macht den Start
Pius Nauer, Direktor Stv. der Schweizerischen
technischen Fachschule
Winterthur STFW, und sein Team
setzten sich schon früh und mit grossem
Engagement für die Ausbildung
ein. So ist es nur logisch, dass nun die
STFW als erste Schule den Lehrgang
anbieten kann. Sie führt seit 2005 den
Lehrgang zum Gebäudeautomatiker
durch und verfügt somit über eine gute
Wissensbasis, auf der sie aufbauen
kann. Glauco Schaub, Lehrgangsverantwortlicher
und Fachlehrer an der
STFW, sieht es als grossen Vorteil,
dass seine Schule mit ihren Dozierenden
bereits alle HLKSE-Gewerke abdeckt
und damit über eine hervorragende
Ausgangslage für die
Durchführung des neuen Lehrgangs
verfügt.
Am 6. Mai 2019 startete der erste
Lehrgang mit 23 Studierenden. Sie
kommen aus so unterschiedlichen
Fachbereichen wie Installation, Planung
und Lüftungsinstallation. Am
Ende der ersten Woche, einer von drei
Projektwochen, wagte sich die Klasse
zusammen mit Kursleiter Ivan Califano
bereits an die Funktionsweise der
Wärmepumpe, den Kompressionskreislauf
in Verbindung mit einem
Eisspeicher und somit an die Grundlagen
der Wärmeerzeugung und
Wärmelehre. Hoch- und Niederdruck
Ausgabe 3/19 eTrends
15
Ausbildung
Die Berufsprüfung zum/zur
Projektleiterin Gebäudeautomation
ist für alle Gewerke der
HLKSE gedacht. In der Wegleitung
dazu sind die benötigten
Kompetenzen in den Bereichen
Projektführung, Koordination,
Ausführung und Inbetriebsetzung
beschrieben. Die Ausbildung
richtet sich zum Beispiel an
Inhaber eines eidgenössischen
Fähigkeitszeugnisses (EFZ) als
Elektroinstallateur, Automatiker
oder Gebäudetechnikplaner
Heizung, die mindestens zwei
Jahre lang in der Gebäudeautomation
gearbeitet haben. Wenn
sie die Modulprüfungen bestanden
haben, können sie sich für
die Berufsprüfung anmelden.
Weitere Zulassungsbestimmungen
sind in der Prüfungsordnung
zum Projektleiter Gebäudeautomation
zu finden.
Ivan Califano «Die Studierenden
sollen fähig sein, über den
Tellerrand hinauszuschauen und
zu vermitteln. Leute, die das
können, fehlen in der Branche.»
Der modulare Aufbau der Ausbildung
ist ein Mehrwert für die
Absolventen, denn wer bereits
eine Berufsprüfung des VSEI
bestanden hat, dem können
gewisse Module für die neue
Berufsprüfung angerechnet
werden. So ist z. B. das Modul 5
«Leadership, Kommunikation
und Personalmanagement» in
allen Berufsprüfungen des VSEI
dasselbe und muss somit nicht
noch einmal abgeschlossen
werden.
Bereits drei Schulen haben die
Anerkennung für die Zulassung
der Modulprüfungen zum Lehrgang
Projektleiter Gebäudeautomation
beim VSEI erhalten. Es
sind die Schweizerische Technische
Fachschule Winterthur
STFW (Start 4. Mai 2020), die ibW
Höhere Fachschule Südostschweiz
(Start 19. August 2019)
und die IBZ (Start Oktober 2019,
bzw. März 2020). Die Kurse sind
auf den Webseiten der Schulen
ausgeschrieben, wo auch Anmeldeformulare
zu finden sind.
www.stfw.ch
www.ibw.ch
www.ibz.ch
16 eTrends Ausgabe 3/19
der Wärmepumpe fanden die Studierenden
spannend und forderten vor
allem diejenigen aus dem Elektrobereich.
Für Glauco Schaub ist es wichtig,
dass der Lehrgang mit einer Projektwoche
startet, damit sich die Klasse
kennen lernen und die Schule deren
Wissensstand ermitteln kann. Die Dozenten
erfahren, wo die Schwerpunkte
der TeilnehmerInnen liegen, und haben
somit die Möglichkeit, gewisse
Themen, wie zum Beispiel die NIV, mit
dem in diesem Lehrgang schon fast alle
vertraut sind, etwas kürzer zu behandeln
und mehr Zeit für anderes aufzuwenden.
Ein sehr innovativer Ansatz.
Brandneues Unterrichtsmaterial
Die grösste Aufgabe, so Glauco
Schaub, war die Erarbeitung des Lehrgang-Stoffs.
Die Inhalte mussten komplett
neu erstellt werden. Den Teilnehmenden
stehen sämtliche Unterlagen
sowohl in Form eines traditionellen
Papierordners als auch auf einer
eLearning-Plattform zur Verfügung.
Darüber hinaus können die Lernenden
ein HLK-Labor mit einer Brennstoffzelle
sowie ein Lüftungslabor
nutzen. Für die Projektwoche «Gebäudeautomation»
besteht eine komplette
Infrastruktur mit Bussystemen.
Die Lehrpersonen, die ein Labor betreuen,
unterrichten das jeweilige
Fach auch, was gemäss Glauco Schaub
eine perfekte Ausgangsbasis für diese
gewerkeübergreifende Ausbildung ist,
die einen guten Mix aus Theorie und
Praxis bietet.
Beste Berufschancen
Die Studierenden werden voraussichtlich
2021 die erste eidgenössische Prüfung
zum/zur Projektleiter/in Gebäudeautomation
absolvieren. Ihre
Berufschancen dürften hervorragend
sein, denn der Mangel an Fachkräften,
die im Bereich Smart Buildings über
ein breites Fachwissen über alle Gewerke
verfügen, wird dann noch grösser
sein als heute. Die Statements der
TeilnehmerInnen zeigen, dass diese
Ausbildung ein neuer Weg ist, sich als
Elektroinstallateur in einem spannenden
Umfeld weiterzubilden und
gleichzeitig eine Höhere Fachprüfung
mit eidgenössischem Abschluss zu
machen.
«Die
Gebäudeautomation
ist sehr
spannend!
Für mich
spannender,
als mich mit
Normen zu
befassen.»
Fabio Stierli, Kursteilnehmer
Smartes Licht.
Smarter Taster.
Smart Light Control for Philips Hue.
Mit dem batterie- und kabellosen Funktaster steuern Sie Philips Hue
Leuchten einfach und smart. Smart Light Control ist im EDIZIOdue
Design in 12 unterschiedlichen Farben erhältlich und passt somit perfekt
zu den bestehenden Schaltern und Tastern. Mehr Informationen:
feller.ch/hue
Entrée MESSEPLATZ
Ausbau der
Swissbau 2020
SWISSBAU
2020
14. – 18.1.2020
Messe Basel
swissbau.ch
eTrends nimmt den Wandel der Swissbau zum Anlass, um bei
Messeleiter Rudolf Pfander nachzufragen, wo die Vorteile der
Integration der Messen Ineltec und Sicherheit liegen und wie
sich dieser Entscheid der MCH Group auf die Branche auswirkt.
AUTOR: RENÉ SENN
18 eTrends Ausgabe 3/19
D
ie Absage der beiden Fachmessen
Ineltec und Sicherheit
im Februar 2019 hat
die Branche bewegt. Seither
erreichen die MCH
Group positive Signale betroffener
Firmen, die an alternativen Präsentationsmöglichkeiten
interessiert sind.
Als führende Fachmesse der Schweizer
Bau- und Immobilienwirtschaft bietet
die Swissbau der gesamten Gebäudetechnologie-
und Sicherheitsbranche
eine interdisziplinäre Business-Plattform.
Der Entscheid der MCH Group,
die Swissbau mit den beiden Branchen
zu stärken, macht für Experten Sinn.
Rudolf Pfander
Der Swissbau Messeleiter legt
grossen Wert auf den persönlichen
Kontakt von Mensch zu Mensch.
heitsbranche alle zwei Jahre eine wichtige
Plattform bieten kann. In der
Gebäudeautomation kennen wir uns
gut aus, doch die Anbieter und Produkte
im Elektrotechnik- und Sicherheitsbereich
müssen wir noch kennenlernen.
Die Swissbau ist eine Fachmesse,
ist das korrekt?
Ja, denn von den 100 000 Besuchern
sind 80 % Fachleute. Wir hören zwar
immer wieder, die Swissbau sei eine
Publikumsmesse. Doch das stimmt
nicht. Sie ist eine Fachmesse mit Publikumsanteil.
Zunehmend wird die
Swissbau auch von Eigentümern und
Investoren, Immobiliendienstleistern,
Facility Managern, Building Information
Modeling (BIM)-Verantwortlichen
und Gebäudetechnikspezialisten
besucht. Und vergessen Sie nicht: auch
die 20 % Privatbesucher sind bauinteressiert
und potenzielle Kunden.
Was ist die grösste Herausforderung
bei der Integration
der Ineltec und Sicherheit?
Der Informationsbedarf ist aktuell
sehr gross. Wir müssen die Komplexität
der Swissbau als Mehrbranchenmesse
erklären und aufzeigen, warum
sie die führende Fachmesse der Bauund
Immobilienwirtschaft in der
Schweiz ist und warum sie der gesamten
Gebäudetechnologie- und Sicher-
Wird der Teil Automation und
Sicherheit auf der Messe thematisch
zusammengefasst?
Die Gebäudeautomation und Sicherheit
sind wesentliche Puzzleteile im
Lifecycle einer Immobilie, der dank
der Integration der Ineltec und Sicherheit
an der Swissbau nun komplett abgebildet
werden kann. Dies zeigt sich
in der verdichteten Platzierung sowie
im neuen Produkteverzeichnis. Da die
Gebäudetechnik an der Swissbau bereits
die Halle 1 Süd belegt, macht es
natürlich Sinn, die Aussteller der Ineltec
und Sicherheit in dieser Halle unter
einem Dach zu vereinen.
Was ist der grösste Vorteil für
einen Aussteller, der sich jetzt
statt für die Ineltec/Sicherheit für
die Swissbau entscheidet?
Die Besucherzielgruppen. Die Swissbau
bietet den Ineltec- und Sicherheit-
Ausstellern mit ihren 100 000 Besuchern
ein zusätzliches Potenzial an
Fachleuten: 21 000 Architekten, Innenarchitekten,
Ingenieure, Planer
diverser Fachrichtungen und Bau- →
Cello Duff , Schneider Electric
(Schweiz) AG und Feller AG
Für Feller und
Schneider Electric
bietet die neue
Plattform eine gute
Chance, Themen der
Wohn- und Buildingautomation
im Gesamtkontext
der Gebäudetechnik
einem breiten
Fachpublikum zu
präsentieren.
Ausgabe 3/19 eTrends
19
1 NORD
ROHBAU + GEBÄUDEHÜLLE
Rohbau, Baumaterialien
1 NORD
Metallbau (Systeme/Verarbeitung)
Dämmung, Dichtung
Tiefbau ROHBAU + GEBÄUDEHÜLLE
Aussenanlagen Rohbau, Baumaterialien
Fenster, Türen Metallbau (Systeme/Verarbeitung)
Schliesstechnik Dämmung, Dichtung
Baustelle, Werkhof Tiefbau
Aussenanlagen
Fenster, Türen
Schliesstechnik
Baustelle, Werkhof
2INNENAUSBAU
Raumwelten: Boden, Wand, Decke,
Büro- und Objekteinrichtungen,
Licht und Beleuchtungstechnik*
Küchen
2INNENAUSBAU
Bad, SanitärRaumwelten: Boden, Wand, Decke,
Trendwelt Bad Büro- und Objekteinrichtungen,
Licht und Beleuchtungstechnik*
IT-LÖSUNGEN Küchen
Bad, Sanitär
Software/Hardware,
Trendwelt Bad
digitale Anwendungen
IT-LÖSUNGEN
Software/Hardware,
digitale Anwendungen
1 SÜD
GEBÄUDETECHNIK
Heizung, Energie
1 SÜD im Gebäude*
Lüftung, Klima, Kälte
Gebäudeautomation, Elektrotechnik*
Kommunikationsinfrastruktur,
GEBÄUDETECHNIK
Netzwerktechnik* Heizung, Energie im Gebäude*
Sicherheit* Lüftung, Klima, Kälte
Gebäudeautomation, Elektrotechnik*
SWISSBAU Kommunikationsinfrastruktur,
INNOVATION LAB
Netzwerktechnik*
Sonderschau für digitale Transformation
Sicherheit*
SWISSBAU FOCUS
SWISSBAU INNOVATION LAB
Veranstaltungs- und Netzwerkplattform,
Sonderschau für digitale Transformation
Verbände, Institutionen, Forschung,
Aus- und Weiterbildung
SWISSBAU FOCUS
Veranstaltungs- und Netzwerkplattform,
Verbände, Institutionen, Forschung,
Aus- und Weiterbildung
Highlights
* Erweiterte Sektoren
(ehem. Ineltec, Sicherheit)
Highlights
* Erweiterte Sektoren
(ehem. Ineltec, Sicherheit)
Werner Fehlmann,
Siemens Schweiz AG
Siemens steht hinter
dem Konzept der
Integration der
Gebäudeautomation,
Gebäudesicherheit und
Energiesystemtechnik
an der Swissbau.
leiter. Dazu 15 000 Handwerker aus
dem Bauhaupt- und Ausbaugewerbe
sowie 3200 FM-Verantwortliche und
Immobiliendienstleister.
Wie bieten Sie solchen Firmen
Hand?
Wir gehen aktiv auf die Firmen zu.
Seit April stehen wir in Kontakt mit
Verbänden und Ausstellern der Ineltec
und Sicherheit. Wir sind auf Besuchstour
in der ganzen Schweiz. Für
interessierte Aussteller der Ineltec
und Sicherheit haben wir in Zürich
extra einen Infotag durchgeführt, die
Swissbau erklärt und die Vorteile aufgezeigt.
Jetzt geben wir richtig Gas.
Am Wichtigsten ist das persönliche
Gespräch.
Was ist der grosse Vorteil der
Integration der Ineltec/Sicherheit?
Schon länger gab es bei den drei Messeangeboten
Überschneidungen in
den Sektoren Gebäudeautomation,
Energie im Gebäude, Licht und Beleuchtungstechnik
sowie Gebäudesicherheit.
Durch diese thematische
Ergänzung kommt zusammen, was
zusammengehört, und die ganze Wertschöpfungskette
einer Immobilie kann
abgebildet werden. Diese Relevanz
vereint alle Protagonisten der Schweizer
Bau- und Immobilienbranche zur
gleichen Zeit am gleichen Ort. Das ist
für die Aussteller ein grosser Vorteil.
Die Gebäudetechnik war ja schon
vertreten an der Messe …
Ja, die Gebäudetechnik ist bereits mit
Anbietern aus den Bereichen Heizung,
Lüftung und Gebäudeautomation vertreten.
Die Überführung der Ineltecund
Sicherheit-Themen ergänzt deshalb
die bisherige Gebäudetechnik
ideal. Ein Vorteil für die Fachbesucher,
die sich in der Halle 1 kompakt
und umfassend informieren können.
Neu bieten wir den Ausstellern aus
dem Bereich Gebäudetechnik die
Möglichkeit, das Praxis-Forum Energie
für eigene Anlässe zu nutzen.
Und das Thema Licht?
Die Swissbau ist auch für Firmen aus
der Licht- und Beleuchtungstechnik
die ideale Plattform. Denn Licht ist
auch immer Teil der Architektur. Und
Architekten und Innenarchitekten
stellen eine interessante Besuchergruppe
an der Swissbau dar, davon
werden diese Firmen profitieren.
20 eTrends Ausgabe 3/19
Bringt die Digitalisierung
Änderungen in der Vernetzung
der Branchen mit sich?
Die Digitalisierung verändert die
Branche. Die verschiedenen Bereiche
der Bau- und Immobilienwirtschaft
wachsen immer mehr zusammen. Wir
greifen diese Entwicklung auf und bieten
den Firmen mit dem Swissbau Focus
und dem Innovation Lab zudem
die Möglichkeit, ihre Innovationen
einem interessierten Fachpublikum zu
präsentieren.
Ist die Swissbau zufrieden mit
dem Stand der Anmeldungen
aus den Themenfeldern der
Ineltec/Sicherheit?
Vor gut einem Monat ist der Akquisitionsprozess
angelaufen. Der Erklärungsbedarf
ist gross, die Gespräche
sind intensiv, die Entscheidungsfindung
braucht Zeit. Wir stellen fest,
dass das Interesse an der Swissbau
vorhanden ist. Mit dem Verband
Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen
VSEI, Swiss Engineering, dem
Verband Schweizerischer Errichter
von Sicherheitsanlagen SES und KNX
Swiss stehen wichtige Verbände hinter
der Swissbau. Sie sind an der Swissbau
Die Messe
Die Swissbau findet alle zwei
Jahre statt, zählt zu den grössten
Baumessen in Europa und
ist die führende Fachmesse der
Bau- und Immobilienwirtschaft
in der Schweiz. Während den
fünf Messetagen treffen in Basel
rund 1100 Aussteller auf über
100 000 Besucher. 80 Prozent der
Besucher sind Fachbesucher. Sie
erhalten die Gelegenheit, sich
eine umfassende Marktübersicht
zu verschaffen sowie eine Vielzahl
neuer Produkte und Dienstleistungen
kennen zu lernen.
Der Dialog zwischen Ausstellern,
Verbänden, Institutionen und
Besuchern dient dem Wissensaustausch
und der Vernetzung,
so auch im Veranstaltungs- und
Netzwerkformat Swissbau Focus
mit rund 70 Veranstaltungen und
der Sonderschau zur digitalen
Transformation, Swissbau Innovation
Lab.
swissbau.ch
präsent und unterstützen uns bei der
Aktivierung der Besucher. Ein erstes
Fazit können wir voraussichtlich im
Spätsommer ziehen.
Wie kann die Swissbau die Besucher
der Ineltec motivieren, an die
Swissbau zu kommen?
Mit der Relevanz der Swissbau und
aktivem Besuchermarketing zusammen
mit den Branchenverbänden und
Ausstellern. Die Swissbau ist die Leitmesse
der Schweizer Bau- und Immobilienwirtschaft.
Eine Fachmesse, die
alle zwei Jahre die ganze Wertschöpfungskette
einer Immobilie abbildet.
Wenn alle Akteure der Schweizer Bauwirtschaft
zur gleichen Zeit an einem
Ort sind, ist das ein Alleinstellungsmerkmal.
Austausch und Kollaboration
sind notwendig. Nur zusammen
können wir – Aussteller, Besucher,
Medien, Institutionen, Hochschulen,
Behörden, Bundesämter – die Herausforderungen
der Baubranche anpacken
und auch für die neuen Zielgruppen
eine relevante Branchenplattform sein.
Neben dem Angebot in der Messe bieten
der Swissbau Focus sowie das
Swissbau Innovation Lab einen grossen
Zusatznutzen. Und noch eine gute
Neuigkeit für die Besucher der Sicherheit:
Der von der Firma SAVE AG
organisierte Sicherheitskongress findet
an vier Halbtagen parallel zur Swissbau
im Congress Center Basel statt.
Was dürfen die Besucher im
Swissbau Innovation Lab
erwarten?
Das Swissbau Innovation Lab nimmt
sich den aktuellen Themen der Digitalisierung
an. Die Sonderschau für digitale
Transformation wurde 2018 lanciert
und traf den Nerv der Zeit. Was
hier im iRoom und im Innovation Village
auf 2000 m 2 geboten wird, darf als
Messe der Zukunft betrachtet werden.
Rund 50 Partner aus den unterschiedlichsten
Disziplinen zeigen, wie sie die
digitale Transformation leben. In
Workshops erarbeiten sie schon jetzt
anhand des realen Projekts «Uptown
Basel» Ideen und Lösungen. Dabei
verwischen die Grenzen zwischen
Ausstellern und Besuchern. Wir sprechen
neu von Community. Das Swissbau
Innovation Lab wird im Januar
zusätzlich um einen Startup-Hub und
den Speakers-Corner erweitert. Das
müssen Sie live erleben!
Und was erwartet sie im Swissbau
Focus?
Der Swissbau Focus ist die interdisziplinäre
Veranstaltungs- und Netz-
Simon Hämmerli, VSEI
Durch die Zusammenführung
der verschiedenen
Bereiche unter
dem Dach der Swissbau
wird die Gebäudetechnik
als Ganzes
gestärkt. Für die
Gebäudetechnik ist
das eine grosse
Chance.
werkplattform der Swissbau und hat
hohe Relevanz für Entscheidungsträger
aus Wirtschaft und Politik. Deshalb
ist der Swissbau Focus der ideale
Treffpunkt für Architekten, Planer,
Ingenieure und Unternehmer und
dient der Weiterbildung und dem Networking.
Gibt es sonst noch Highlights?
Wir bieten Ausstellern und Besuchern
noch mehr Gelegenheiten, um mit ihrer
Zielgruppe ins Gespräch zu kommen,
Stichwort Guided Tours, geführte
Touren von Architekten für Architekten
oder unsere Fuckup-Night zum
Thema «Scheitern als Teil des Wegs
zum Erfolg» sowie die Swissbau Night,
ein exklusiver Abendanlass für die gesamte
Community.
Welches Gefühl haben Sie am
Samstag, 18. Januar 2020 um
16 Uhr?
Ich hoffe ein gutes – erfüllt und zufrieden.
Mein Team und ich geben seit zwei
Jahren alles, um die Swissbau für Aussteller,
Besucher und die Community
zum Erfolg zu führen. Nach der Swissbau
werden wir sie in Kollaboration mit
den führenden Ausstellern und Verbänden
analysieren und die Learnings
und Ideen in das weiterführende Konzept
einfliessen lassen.
Ausgabe 3/19 eTrends
21
Entrée MARKTSTUDIE
Managed
Services &
Swissness
Die Studie «Die Cloud im
Zentrum des ICT-Betriebs» von
MSM Research zeigt auf, dass
die Ausgaben für traditionelle
ICT-Infrastruktur und
Anwendungen sinken und
gleichzeitig für externe Cloud
Services steigen. Managed
Services und Swissness sind die
Erfolgsfaktoren.
Datenschutz und
Sicherheit
Komplexität der
Umgebung
Organisatorische Fragen
MSM Research: Herausforderungen
bezüglich einer gemischten ICT-Umgebung
66 %
52 %
46 %
AUTOR:
CHRISTOPH
FLÜCKIGER
D
ie Cloud ist ein Game-
Changer, die es Unternehmen
ermöglicht, die digitale
Transformation mit
mehr Agilität, Kosteneffizienz
und Individualisierung als je zuvor
zu verfolgen. Der ICT-Betrieb und
die damit verbundenen Ausgaben verlagern
sich zunehmend hin zu externen
Anbietern. Und diese Entwicklung ist
messbar. MSM Research errechnet in
ihrer Studie «Die Cloud im Zentrum
des ICT-Betriebs» im Auftrag von
Swisscom, dass 2019 die Ausgaben für
den traditionellen ICT-Eigenbetrieb
für Infrastruktur und Anwendungen
um 8 Prozent sinken und gleichzeitig
für externe Managed und Cloud Services
um 14 Prozent zulegen werden.
Cloud-Infrastrukturen, gerade in
hybriden Umgebungen, werden immer
komplexer, und für Unternehmen ist
es schwierig, selbst Schritt zu halten.
Deshalb entsteht derzeit eine grosse
Anzahl an Managed Services. Sie
übernehmen die Cloud-Computing-
Ziele eines Unternehmens. Die vor
Ort und in der Cloud bestehende Systeme
werden zuerst grundlegend geprüft.
Danach werden Vorschläge erstellt,
wie die IT optimiert werden
kann. Das beinhaltet Dienste wie Migration,
Infrastrukturmanagement,
Sicherheit, Automatisierung und die
Bildung von Data Lakes und ihrer
Analyse. Letztendlich geht es häufig
22 eTrends Ausgabe 3/19
nicht nur um eine kostensenkende
Strategie, sondern auch um das Potenzial
der Datenerschliessung und darum,
wettbewerbsfähig zu bleiben. Die
Diskussion verlagert sich beim Aufbau
von Managed Services vom Kostendruck
hin zur Potenzialerschliessung.
Nicht zuletzt deshalb werden die Ausgaben
2019 für externe Sourcing-
Dienstleister gemäss MSM Research
im Vergleich zu 2017 um 15 Prozent
steigen.
Nicht vergessen werden darf, dass
die Nutzung interner Legacy-IT-Plattformen
sinkt und damit die Kosten für
die Pflege dieses Legacys steigen – und
die Erhaltung des Knowhows in Zukunft
einen wichtigen Faktor bilden
wird. Es muss verhindert werden, dass
technologische Altlasten die Kosten
steigern und die Innovationsfähigkeit
behindern. Sonst entsteht eine Lose-
Lose-Situation.
Wozu Managed Services für Cloud
Services?
Managed Services sind flexibel und
werden den Cloud-Anforderungen
von Unternehmen angepasst. Gemäss
MSM Research sind für 66 Prozent der
Unternehmen Datenschutz und Sicherheit
ausschlaggebend dafür, dass
umfangreiche ICT-Umgebungen an
Managed Service Provider übergeben
werden. Denn sie sind in der Lage, die
steigenden Sicherheits- und Compliance-Anforderungen
zu erfüllen.
Neben dem Sicherheitsthema
nannte über die Hälfte auch die Komplexität
der Umgebung als Grund dafür,
dass ein externer Provider beauftragt
wird. Als dritte Herausforderung
werden organisatorische Fragen angegeben,
welche mit externen Providern
besser gelöst werden können.
Skalieren mit externen Anbietern
Die Skalierbarkeit von IT-Ressourcen
ist einer der grössten Vorteile der
Cloud. Ein Managed Cloud Service
Provider verfügt über umfassendes
Wissen darüber, wie die von ihm unterstützten
Cloud-Umgebungen funktionieren.
Ein Anbieter von Managed
Services, der beispielsweise Azure
oder AWS unterstützt, kennt die Services
dieser beiden globalen Cloud
Provider und weiss, wie sie genutzt
werden können. So kann er den Unternehmen
helfen, die Vorteile zu nutzen
und Kosten mit Hilfe intelligenter Skalierung
zu senken.
Globale oder Schweizer Anbieter?
Für Schweizer Unternehmen sind die
Themen Datenschutz und Sicherheit,
Zwingend aufgrund von
regulatorischen oder
gesetzlichen Gründen
Wichtig aus technischen
Gründen wie z. B. Latenz,
Nähe zum Provider usw.
Netzwerklatenz sowie Bandbreite
omnipräsent. Damit Cloud-Projekte
erfolgreich sind, braucht es lokale
Ansprechpersonen eines Cloud-Anbieters
oder eines externen Managed
Service-Providers. Nur so ist das Wissen
rasch verfügbar, wenn konzeptionelle
und operative Probleme und
Fragen auftauchen, die ein Unternehmen
nicht selber lösen kann. Daneben
«Es muss
verhindert
werden, dass
technologische
Altlasten die
Kosten steigern
und die Innovationsfähigkeit
behindern.»
MSM Research: Bedeutung
des Daten-Standorts und des
Providers
59 %
45 %
gehören auch netzwerktechnische
Überlegungen zur Standortentscheidung.
Die Latenz und Ladezeit eines
Webservices spielen beispielsweise
beim Ranking auf Suchmaschinen
eine Rolle, für Unternehmen mit
eCommerce-Lösungen ein eminenter
Faktor. Auch auf Windows-Umgebungen
kommen Latenzzeiten zum
Tragen, speziell bemerkbar wird dies
in hybriden Cloud-Umgebungen.
Die Studie von MSM Research hat
ergeben, dass ein anderer Faktor an
erster Stelle steht, wenn es um den
Entscheid «lokaler oder globale Anbieter»
geht. 59 Prozent der Unternehmen
wählen aus regulatorischen oder
gesetzlichen Gründen den Standort
Schweiz.
Cloud ist der Start für neue
ICT-Entwicklungen
Die Migration in die Cloud bietet eine
langfristige Grundlage für die digitale
Transformation eines Unternehmens.
Neben der Skalierbarkeit und Kosteneffizienz
können damit die Möglichkeiten
neuer Technologietrends ausgelotet
werden. Der Zugang zu
Datenanalysen, prädiktiven Aussagen,
Kostenvorteilen durch andere
Zahlungsmodelle (SaaS), Kontrolle
auf Datenzugriffe in der gesamten Organisation
und noch kommende Entwicklungen
werden ermöglicht. Doch
derzeit beschäftigen sich gemäss MSM
Research erst 10 Prozent der Schweizer
Unternehmen konkret mit den
neuen Technologien wie künstliche
Intelligenz oder der Blockchain. Die
zukünftigen Entwicklungen lassen
sich aber nicht aufhalten, der Start mit
der Cloud als neuer ICT-Umgebung
bietet die Grundlage für die
Entwicklung von Unternehmen.
www.msmag.ch
Christoph Flückiger ist bei Swisscom
zuständig für das B2B Marketing für
Cloudangebote.
Ausgabe 3/19
eTrends
Elektrotechnik MOTOREN
Quelle: ABB
24 eTrends Ausgabe 3/19
NEUE ANTRIEBSTECHNIK SPART RICHTIG GELD
Effiziente
Elektromotoren
In der Schweiz verbrauchen wir laut BFE für elektrische
Antriebe rund 45 Prozent unseres Energiebedarfs. Wenn die
Energiestrategie 2050 aufgehen soll, gilt es vorallem bei den
grossen Verbrauchern anzusetzen. AUTOR: RAYMOND KLEGER
D
ie Vorteile energiesparender
Motoren sind überwältigend.
Es ist schwer nachvollziehbar,
dass ihr
Einsatz nur über Zwang
gelingt. Sie sparen echt Geld durch
kleinere Verluste, sie erwärmen sich
weniger und leben dadurch länger, sie
benötigen weniger Schmiermittel, was
Wartungsintervalle erhöht, sie haben
grössere Überlastreserven im Dauerbetrieb
und sie leisten einen echten
Beitrag zum Umweltschutz und amortisieren
sich schnell.
Bei einer Neuanlage ist für die Investitionen
oft ein Generalunternehmer
zuständig; die Betriebskosten
hernach interessieren ihn wenig. Bei
elektrischen Antrieben beträgt der
Anteil der Energiekosten an den gesamten
Betriebskosten jedoch häufig
über 90 Prozent. Jeder Chef, der die
Gesamtkosten berücksichtigt und
nicht nur den Anschaffungspreis,
wählt eine energiesparende Version.
Würde man Investoren nach Gründen
für die Nichtwahl eines energiesparenden
Antriebs fragen, wären ihre
Antworten vielfach nachvollziehbar:
Informationen sind teilweise mangelhaft,
es gibt Unsicherheiten bei der
Produktwahl, und bezüglich des zu
erwartenden Energiesparpotenzials
fehlt die Transparenz.
Effizienz bei Motoren
Asynchronmotoren sind für geschätzte
30 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs
verantwortlich. Sie sind einfach
aufgebaut und sehr robust. Abbildung
1 zeigt die Wirkungsgrade der
IE1- bis IE4-Motoren von 0,1 bis 1000
kW bei Netzbetrieb, d.h. bei ungeregeltem
Lauf. Auffallend ist, dass die
IE4-Klasse auch bei kleinen Leistungen
schon sehr gute Wirkungsgrade
aufweist.
Wo entstehen Verluste?
Beim IE4-Motor müssen die Verluste
gegenüber dem IE3-Motor nochmals
um 10 bis 24 Prozent sinken. Bei einem
vierpoligen IE4-Asynchronmotor mit
30 kW Leistung teilen sich die Verluste
so auf:
∙ Joule-Verluste in der Statorwicklung:
43,7 %
Wirkungsgrad bei Nennleistung [%]
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
0,1 1 10 100 1000
Mechanische Motor Outputleistung [kW]
• IE4 Super Premium
Effizienz 50 Hz
• IE3 Premium
Effizienz 50 Hz
• IE2 Hohe Effizienz
50Hz
• IE1 Standard
Effizienz 50 Hz
Abbildung 1
Effizienz von
Motoren der Klasse
IE1 bis IE4. Quelle:
Lonza AG Visp
Ausgabe 3/19
eTrends
∙ Eisenverluste: 26,7 %
∙ Joule-Verluste im Rotor: 20,4 %
∙ mechanische Verluste: 3,53 %
∙ Oberwellenverluste: 0,67 %
∙ Zusatzverluste: 4,91 %
Erste Priorität haben die Joule-Verluste
(Wärmeverluste aufgrund des
Wicklungswiderstands). Als Zweites
kommen die Eisenverluste. Ein kleinerer
Widerstand bei der Statorwicklung
beeinflusst den Anlaufstrom, das Anlaufmoment
und den Leistungsfaktor.
Es gilt allerdings nicht nur den Wirkungsgrad
zu erhöhen, sondern auch
die Geräusche und Vibrationen zu
verringern.
Abbildung 2 Die Joule-Verluste
in der Statorwicklung reduziert
WEG durch einen Mix aus
längerem Stator, geringerer
Windungszahl der Wicklungen
und einem grösseren
Drahtquerschnitt.
Priorität 1: Statorwicklung
Die Verluste lassen sich nur durch einen
geringeren Widerstand der Wicklungen
reduzieren (Abb. 2). Dazu
erhöht man entweder den Drahtdurchmesser
und/oder verlängert den
Stator. Je länger ein Motor, desto kleiner
ist der Einfluss des Wicklungskopfes,
der nur Verluste produziert und
nichts zum Drehmoment beiträgt. Mit
einem längeren Motor wird auch die
Kühloberfläche grösser. Dadurch
lässt sich Energie fürs Belüftungssystem
sparen. Wird die Drahtdicke erhöht
bei gleichen Eisenblechen, wird
das Einfüllen der Wicklungen in die
Statornuten schwierig. Werden die
Nuten vergrössert, verkleinert sich der
Statorkern, was zu höheren Flussdichten
und damit grösseren Eisenverlusten
führt.
Rotor
Für die Joule-Verluste im Rotor ist
nicht nur die Leitfähigkeit des Materials
(Aluminium oder Kupfer) massgebend,
sondern auch die Form der Leiter
und speziell auch die Konstruktion
der Kurzschlussringe (Abb. 3). Seit ein
paar Jahren ist es möglich, auch Kupfer
wirtschaftlich zu giessen. Die Anforderungen
sind aber viel höher als
bei Aluminium.
Priorität 2: Eisenverluste
Es bieten sich zwei Möglichkeiten an:
Entweder man verwendet dünnere,
verlustärmere Blechschnitte aus Siliziumstahl
– was kostspielig ist – oder
man reduziert die Flussdichte durch
eine grössere Menge Blech, was die
Kosten ebenfalls erhöht. Auch hier ist
es nicht einfach, die Eisenverluste bei
möglichst geringen Kostensteigerungen
und Einhaltung der Normen für
die Motorabmessungen zu reduzieren.
Ein kleinerer Luftspalt zwischen Ro-
Abbildung 3 Kupfer-Rotor für
hocheffiziente Asynchronmotoren
bei Elektroautos. Quelle:
Wieland
tor und Stator hilft, den magnetischen
Widerstand zu verringern.
Mechanische Verluste
Eine optimale Belüftung ist der
Schlüssel zur Senkung der mechanischen
Verluste (Abb. 4). Der viel bessere
Wirkungsgrad des IE4-Motors
gegenüber dem IE1-Motor verkleinert
natürlich den Lüftungsbedarf. Bei
Neuentwicklungen erzielt man tiefere
Geräuschpegel durch verbesserte Ventilatorblätter
und eine bessere Geometrie
der Kühlrippen.
Teillast
Motoren haben keinen konstanten
Wirkungsgrad, wie Abb. 5 zeigt. Motoren,
die während sehr vieler Betriebsstunden
pro Jahr im Einsatz stehen,
betreibt man im Arbeitspunkt mit maximalem
Wirkungsgrad. Dieser Punkt
hängt vom Motortyp ab und liegt üblicherweise
im Bereich von 60 bis 80
Prozent der Nennleistung. Weil der
Motor sich weniger erwärmt, besteht
Wirkungsgrad [%]
100
90
80
70
60
45 kW
3 kW
50
40
30
20
10
0
0
120 W
20 40 60 80 100
Abbildung 5
Teillasteffizienz von
Asynchronmotoren. Bei
bis zu etwa 30 Prozent
der Nennleistung bleibt
die Effizienz bei
Motoren grösserer
Leistung gut.
Quelle: FH Luzern
Auslastung [%]
26 eTrends Ausgabe 3/19
eine höhere Lebenserwartung, und die
Leistungsreserve ist besser. Asynchronmotoren
benötigen nebst Wirkleistung
auch Blindleistung, die bei
tieferer Auslastung etwas höher ist als
im Nennbetrieb.
Abbildung 4 Aerodynamisch
optimierte Lüfter arbeiten
effizienter und erzeugen
weniger Geräusche.
Geregelte Antriebe
Viele Antriebe laufen mit Nenndrehzahl,
obwohl die Arbeitsmaschine gar
nicht die volle Leistung erbringen
muss. In solchen Fällen wird ein Teil
der aufgebrachten elektrischen Energie
letztlich in Wärme umgesetzt.
Trotz zusätzlicher Verluste des Frequenzumrichters
spart ein geregelter
Motor (Abb. 6) elektrische Energie.
Untersuchungen zeigen, dass das gesamte
Einsparpotenzial eines optimierten
Systems (Motor zusammen
mit Arbeitsmaschine) bei 30 bis 60
Prozent liegt. Höchstens ein Drittel
davon geht aufs Konto eines hocheffizienten
Motors.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Umwälzpumpe.
Bei kleinem Wärmebedarf
im Gebäude macht es keinen
Sinn, wenn die Umwälzpumpe mit
Nenndrehzahl läuft. Der Rücklauf
darf und soll um ein paar Grad tiefer
liegen als der Vorlauf. Es ist somit notwendig,
die Drehzahl der Pumpe zu
reduzieren, wenn der Wärmebedarf im
Gebäude gering ist. Drehzahlgeregelte
Umwälzpumpen sparen grosse Energiemengen.
Ersatz von Motoren
Ist ein Motor zu ersetzen oder gar ein
Antrieb neu auszulegen, lohnt es sich
innezuhalten und folgende Frage zu
prüfen: Könnte die Arbeitsmaschine
an Effizienz gewinnen, wenn nicht nur
ein Netzbetrieb, sondern ein geregelter
Betrieb vorliegt?
Beim Ersatz eines Standardmotors
durch einen energieeffizienten Motor
ist der erhöhte Anlaufstrom zu beachten.
Die hohen Anlaufströme erfordern
bei Schaltgeräten ein grösseres
Schaltvermögen, teilweise auch geänderte
Einstellungen beim Kurzschlussschutz.
Bei der Anschaffung neuer
Schaltgeräte ist also auf IE4-Motoren-
Tauglichkeit zu achten.
Was gilt es beim Ersatz bestehender
Motoren zu berücksichtigen? Ein
stark überdimensionierter Motor wird
durch einen nur leicht überdimensionierten
ersetzt. Ist der Motor schwankender
Last ausgesetzt, soll der Ersatz
bei maximaler Leistung gerade im
Nennbetrieb sein. Richtig dimensionierte
Standardmotoren kann man
durch baugleiche, hocheffiziente Typen
ersetzen.
Fazit
Die grösste Barriere zur Wahl eines
energieoptimalen Antriebs ist die Fixierung
auf einen niedrigen Anschaffungspreis.
Wenn es gelingt, transparent
aufzuzeigen, dass Mehrkosten für
einen besseren Motor zusammen mit
der optimalen Steuerung teilweise in
einem Jahr amortisiert sind, lässt sich
jeder Chef überzeugen. Vielen Motorenherstellern
ist es gelungen, hocheffiziente
IE4-Motoren mit Asynchrontechnologie
auf den Markt zu bringen.
Mit Synchronmotoren ist IE4-Effizienz
einfacher zu erreichen, nur sind
Synchronmotoren viel teurer und laufen
je nach Technik nicht selbstständig
an, sondern müssen über einen Frequenzumrichter
betrieben werden.
Abbildung 6 Drehzahlgeregelter
Motor mit Frequenzumrichter
direkt auf Motor. Quelle:
JS-Technik GmbH
MAXIMALE FLEXIBILITÄT
CECOFLEX Patchpanels für LSA-Plus- und Keystone-Steckverbinder
Setzen Standard: die kaskadierbaren Patchpanels von CECOFLEX
- Das LSA-Plus-Patchpanel unterstützt bis zu 12 RJ45-basierte CAT6A-Anschlüsse, die Einbindung eines
ALL-IP-DSL-Moduls und die Verteilung der ATA-1- und ATA-2-Anschlüsse auf drei RJ45-Anschlüsse (grün).
- Das Keystone-Patchpanel ermöglicht die Aufnahme von bis zu 12 RJ45-Keystone-Buchsen und bietet
nebst CAT6A-Modulen auch einen geschalteten ALL-IP-Anschluss (violett) sowie einen RJ45-Anschluss
(grün, 8-polig) für die Telefonie an.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ceconet.
Ceconet AG Hintermättlistrasse 1 5506 Mägenwil T +41 62 887 27 37 info@ceconet.ch www.ceconet.ch
Elektrotechnik MESSTECHNIK
Faktenbasierte
Energie- und
Betriebsoptimierung
Wer Energieflüsse optimieren möchte, muss
korrekte und validierte Messdaten der
Infrastruktur besitzen. In einzelnen Kantonen
ist eine Betriebsopti mierung je nach
Gebäudetyp sogar Vorschrift.
AUTOR: MARKUS TREICHLER
N
ach wie vor besteht in
Industrie, Gewerbe und
Dienstleistung ein grosses
Energieeffizienz- und somit
Kostenpotenzial, das
durch energetische Betriebsoptimierungen
(BO) erschlossen werden kann.
Die Realisation von BO-Massnahmen
ist besonders attraktiv, weil sie wenig
Kosten verursachen und somit eine
hohe Wirtschaftlichkeit aufweisen. Die
Massnahmen zahlen sich in der Regel
innert weniger als zwei Jahren aus, und
zwar unabhängig von der Grösse der
Anlage oder Infrastruktur.
Abhängig vom Alter der Anlagen
Das Sparpotenzial ist je nach Alter der
Infrastruktur enorm, es kann bis zu
25 Prozent betragen, doch Investitionen
zur Verbrauchsminderung und
Steigerung der Energieeffizienz kön-
nen nur dann zielgerichtet und wirtschaftlich
getätigt werden, wenn detaillierte
Daten über den aktuellen
Energiebedarf vorliegen. Vor der Planung
und Umsetzung der Energiesparmassnahmen
ist es deshalb ratsam,
sich die folgende wichtige Frage zu
stellen: Wo wird wann und wie viel
Energie verbraucht? Aus der Antwort
ergeben sich die zur Planung und Umsetzung
der Energiesparmassnamen
notwendigen Daten. Doch woher bekommt
man sie?
Vorhandene Daten nicht
differenziert genug
Einen geringen Teil der Informationen
liefert die Auswertung von Energiedaten
wie beispielsweise der Energierechnung
des Elektrizitätswerks
oder des hauseigenen Energiezählers.
Allerdings liefern diese Daten keine
detaillierten Erkenntnisse darüber,
wann und wo genau die Energie verbraucht
wird. Eine Aussage zur Energieoptimierung
ist damit, und das
leuchtet auch jedem Nicht-Techniker
ein, nicht möglich.
Temporäre Energieanalyse
Um der Problematik der zentralen
Messung entgegenzuwirken, ist es
ideal, wenn temporäre und ergänzende
Daten für Energieanalysen von Niederspannungsanlagen
mittels dezentraler,
mobiler oder stationärer Messung
der elektrischen Leistung, bzw.
Energie erhoben werden. Dabei ist es
vor allem das Ziel, grosse Verbraucher
und deren Betriebszeiten zu identifizieren
sowie Spitzenlastbezüge, aber
auch den Verbrauch ausserhalb der
Nutzungszeit der Anlage aufzuzeigen
(z. B. Standby-Verbrauch von Anla-
28 eTrends Ausgabe 3/19
Energieverbraucher
Je nach Unternehmenszweck lassen sich in unterschiedlichen
Betriebsteilen die grössten Einsparpotenziale ausschöpfen.
Eine detaillierte Analyse der Verbräuche ist daher die
Voraussetzung für eine erfolgreiche Betriebsoptimierung.
Merkblatt
Betriebsoptimierung
der GNI
gen). Mit dieser Methode können die
Energieflüsse schnell und kostengünstig
analysiert werden, ohne dass grosse
Investitionen in Messeinrichtungen
getätigt werden müssen. Entsprechende
Messgeräte für gleichzeitiges
Messen lassen sich zudem sehr einfach
für einen begrenzten Zeitraum anmieten.
Vom Groben ins Detail
Für die Datenerhebung und Analyse
konzentriert man sich natürlich zuerst
auf die grössten Verbraucher, bzw.
Verbrauchszweige innerhalb des zu
beurteilenden Betriebsteils, weil zuerst
das grösste Potenzial ausgeschöpft
werden soll. Je nach Firmenzweck,
bzw. Gebäudeinfrastruktur ändert
sich die Priorität, was das zu beurteilende
Betriebsmittel angeht. So sind
zum Beispiel in Produktionsbetrieben
Motoren die erste Herausforderung,
gefolgt von thermischen Prozessschritten
sowie der Gebäudelüftung. Interessanterweise
bietet die Beleuchtung
oft das kleinere Energiesparpotenzial
in einer Infrastruktur, sollte jedoch
auf keinen Fall vernachlässigt werden.
Zudem lohnt es sich, die verschiedenen
grösseren Abgänge einzeln zu
messen und sie nicht aus der Differenz
zu ermitteln, weil dies in der Praxis oft
sehr falsche Resultate liefert.
Passende Zeitspanne
Bei der mobilen, bzw. temporären Datenerfassung
sollte jeweils mindestens
eine Periode von einer Woche, bzw.
sieben Tagen aufgezeichnet werden. In
vielen Betrieben umfasst eine Arbeitswoche
zwar nur fünf Tage, doch ist es
für die Erfassung des gesamten Sparpotenzials
wichtig, auch die beiden →
Um den Vollzug der Energievorschriften
der Kantone zu
erleichtern, veröffentlichte die
Gebäude Netzwerk Initiative
(www.g-n-i.ch) das Merkblatt
Betriebsoptimierung. Bei den
Mustervorschriften der Kantone
im Energiebereich (MuKEn)
handelt es sich um das von den
Kantonen, gestützt auf ihre
Vollzugserfahrung, gemeinsam
erarbeitete Gesamtpaket
energierechtlicher Mustervorschriften
im Gebäudebereich.
Sie bilden den gemeinsamen
Nenner der Kantone und haben
ein hohes Mass an Harmonisierung
im Bereich der kantonalen
Energievorschriften zum Ziel, um
die Bauplanung und die Bewilligungsverfahren
für Bauherren
und Fachleute, die in mehreren
Kantonen tätig sind, zu vereinfachen.
Ausgabe 3/19 eTrends
29
«Die Jahreszeit
oder die
Auftragslage
eines Unternehmens
können einen
erheblichen
Einfluss auf den
Energieverbrauch
haben.»
Wochenendtage zu analysieren. Oft
fördert dies erstaunliche und einfach,
bzw. kostengünstig umzusetzende
Einsparpotenziale zu Tage. Je nach
Betrieb spielen auch saisonale Aspekte
eine Rolle. Die Jahreszeit oder
die Auftragslage eines Unternehmens
können einen erheblichen Einfluss auf
den Verbrauch haben.
Betriebsoptimierung ist Vorschrift
Gemäss den Mustervorschriften der
Kantone (MuKEn) 2014 ist eine
Betriebsoptimierung für spezifische
Gebäudetypen Vorschrift. Die Vorschrift
zur periodischen Betriebsoptimierung
betrifft Betriebsstätten, in
denen die MuKEn 2014 angenommen
wurden und die einen Elektrizitätsverbrauch
von mindestens 200 000 kWh/a
(200 MWh/a) aufweisen. Wohnbauten
sind davon ausgenommen. Als Betriebsstätten
gelten eines oder mehrere
Gebäude eines Unternehmens am
gleichen Standort mit einer gemeinsamen
Einspeisung pro Energieträger
(Messeinrichtung). Haben die Gebäude
an einem Standort mehrere Einspeisungen
pro Energieträger (Mess
einrichtungen), gelten sie auch dann
als Betriebsstätte, wenn die Gebäude
funktional zusammenhängen oder zu
einem Unternehmen, bzw. einer gemeinsamen
Betreibergesellschaft gehören.
Markus Treichler ist bei der
Transmetra GmbH zuständig für
Beratung, Schulung und Support
NEU
ALADIN mit EnOcean-Funktechnologie
› ALADIN – das erprobte Funksystem für Profis. Über 250 000
Geräte in der Schweiz im Einsatz, Funkprotokoll: EnOcean
› ALADIN – die effiziente Gebäudesteuerung mit
UP-Empfänger, REG-Empfänger und KNX-Gateways
› ALADIN – Funktaster, Funkthermostate, Funkpräsenzmelder
etc. funktionieren wartungsfrei ohne Verkabelung, ohne Batterie
› ALADIN – dank kompakter Bauform ist eine einfache Planung
und Installation auch in bestehende Anlagen möglich
Flextron AG Lindauerstrasse 15 8317 Tagelswangen Telefon +41 52 347 29 50 info@flextron.ch www.flextron.ch
Elektrotechnik JUBILÄUM
SIEMENS
Seit 125 Jahren
in der Schweiz
Das Flusskraftwerk Wynau war das erste Projekt, bei
dem Siemens eigenes Personal in der Schweiz beschäftigte.
Der Baustart im Jahr 1894 markiert deshalb den
Beginn der Siemens-Geschichte in unserem Land.
AUTOR: BENNO ESTERMANN
F
irmengründer Werner von
Siemens hatte schon 1851
erste Kontakte mit Schweizer
Behörden und Geschäftsleuten.
Im Laufe der
Jahrzehnte entwickelte sich das Unternehmen
zu einem der bedeutendsten
Arbeitgeber der Schweiz. Heute beschäftigt
Siemens hierzulande mehr als
5700 Mitarbeitende.
Die Idee für den Bau eines Elektrizitätswerks
im bernischen Wynau
hatte der Kaufmann Robert Müller-
Landsmann. 1891 kaufte er ein geeignetes
Stück Land an der Aare. Die
Planung und Finanzierung überstiegen
jedoch seine Möglichkeiten. Die finanziellen
Probleme löste die Berliner
Firma Siemens & Halske. Für 300’000
Franken kaufte sie von Müller-Landsmann
das Projekt und erhielt vom Kanton
Bern die Konzession für den Betrieb
des Flusskraftwerks. Siemens
richtete ein Baubüro ein und engagierte
geeignete Fachleute. Die Bauarbeiten
in Wynau wurden im November
1894 in Angriff genommen. 14 Monate
später konnte das Kraftwerk den ersten
Strom ins Netz speisen. Am 23. Januar
1896 kurz nach 18 Uhr brannte im nahegelegenen
Langenthal erstmals elektrisches
Licht.
Werner von Siemens
und die Schweiz
Trotz der zahlreichen Aufenthalte der
Siemens-Familie in der Schweiz
drängte sich hierzulande eine Firmengründung
zunächst nicht auf. Über
viele Jahrzehnte wurden die Schweizer
Kunden über externe Vertreter oder
direkt von Berlin aus bedient. 1865
beschaffte die Armee für die neue Militärkaserne
in Thun Zeigertelegraphen
von Siemens & Halske. Im Dezember
1877 war Siemens bei einem
weiteren Pionierprojekt dabei. So
wurde am 13. Dezember 1877 das allererste
Schweizer Telefongespräch
zwischen Bern und Thun durchgeführt
– mit Geräten von Siemens & Halske.
Die Schweizer Behörden hatten sie
wenige Tage vorher in Berlin bestellt
und 10,25 Reichsmark dafür bezahlt.
Zürich und Albisrieden
werden wichtig
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfolgten
wichtige Weichenstellungen, die
den Verlauf der Siemens-Geschichte in
der Schweiz massgeblich prägten. 1903
entstand an der Löwenstrasse 35 in Zürich
das erste technische Büro. Die
dortigen Räume wurden schon seit
1900 von der Elektrizitäts-Aktiengesellschaft
(EAG) als Geschäftsstelle
genutzt. EAG wurde kurz darauf mit
der Starkstromabteilung von Siemens
& Halske fusioniert, was 1903 zur →
«Am 13. Dezember 1877
wurde das allererste
Schweizer Telefongespräch
zwischen Bern und
Thun durchgeführt.»
Ausgabe 3/19 eTrends
31
Das Flusskraftwerk Wynau
Das erste Projekt, bei dem Siemens
eigenes Personal in der Schweiz
beschäftigte. Der Baustart im Jahr
1894 markiert den Beginn der
Siemens-Geschichte hierzulande.
Gründung der Siemens-Schuckertwerke
GmbH führte. Das Zweigbüro
Zürich war somit die erste Niederlassung
von Siemens in der Schweiz. In
der Folge entstanden auch in anderen
wichtigen Städten solche Niederlassungen:
Basel (1912), Lausanne (1913) und
Bern (1920). Den Siemens-Vertriebsleuten
in Bern gelang es, ein besonderes
Vertrauensverhältnis zu PTT und
SBB aufzubauen, das die Grundlage
schuf für das umsatzstarke Behördengeschäft,
vor allem im Bereich der Telefon-
und Vermittlungsanlagen.
1922 wurde in Zürich die «Siemens
Elektrizitätserzeugnisse AG» gegründet,
in welche die vier bestehenden
technischen Büros integriert wurden.
Im gleichen Jahr kaufte Siemens &
Halske die in Albisrieden ansässige
«Protos Telephonwerke AG» mit ihren
60 Mitarbeitenden. Damit hatte Siemens
erstmals eine Produktionsstätte
in der Schweiz. 1924 wurde der Name
geändert in «Telephonwerke Albisrieden
AG». Die Hauptaktivitäten von
Siemens in der Schweiz lagen im Bereich
der Telefon- und Nachrichtentechnik.
Zudem hatte sich die Firma
Hauptsitz
Seit dem 1. April 2019 ist Zug der globale
Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure
mit weltweit über 70 000 Mitarbeitenden.
mit Anlagen für Kraftwerke, Bahnen
und Flugplätze, Studioeinrichtungen,
Feldübermittlungs-, Infrarot- und Radargeräte
gut etabliert. In den Boomjahren
nach dem Krieg war Siemens als
Hauptlieferant der damaligen PTT
gefordert, die steigende Nachfrage
nach Telefonanlagen zu befriedigen.
Fusion und Fokussierung
Im Juli 1971 fusionierten die Albiswerk
Zürich AG und die Siemens AG
Zürich zur Siemens-Albis AG. Mit
dem Zusammenschluss wurde zugleich
die künftige Geschäftsstrategie
konkreter: weg vom Produzenten einzelner
Apparate, hin zum umfassenden
System- und Lösungsanbieter für
diverse Industrien und Branchen. Die
Elektrowatt AG beteiligte sich mit am
Aktienkapital von Siemens-Albis.
Diese langjährigen Geschäftsbeziehungen
und die persönlichen Kontakte
waren hilfreich, als 25 Jahre später die
Übernahme des Industrieteils von
Elektrowatt durch Siemens aktuell
wurde.
Ereignisreiche 90er-Jahre
Zur Unterstreichung ihrer Eigenständigkeit
und nationalen Verankerung
wurde Siemens-Albis am 1. Januar
1996 in Siemens Schweiz AG umbenannt.
Ende 1996 gab die Siemens AG
32 eTrends Ausgabe 3/19
Alles aus einer Hand …
Videoüberwachung und mehr
ihre Pläne bekannt, den Industrieteil
von Elektrowatt zu übernehmen. Die
Ankündigung sorgte für Aufsehen,
gehörten doch bekannte Schweizer
Industriefirmen wie Cerberus, Landis
& Stäfa, Kummler + Matter, Göhner
Merkur, Landis & Gyr Utilities oder
Landis & Gyr Communications zum
Elektrowatt-Portfolio. Siemens führte
die übernommenen Einheiten und die
eigenen Aktivitäten auf dem Gebiet
Gebäudeautomation, Gebäudesicherheit
und Brandschutz im neuen Bereich
Building Technologies (BT) zusammen.
Dieser nahm seine Arbeit am
1. Oktober 1998 auf. Für die Schweiz
war diese Übernahme sehr wichtig. So
wurde die Zahl der Siemens-Standorte
in der Schweiz stark erhöht – nicht nur
in der Deutschschweiz, sondern auch
in der Romandie, wo seit 1993 alle Aktivitäten
von Renens aus koordiniert
wurden. Heute verfügt Siemens neben
dem Hauptsitz in Renens über fünf
weitere Standorte in der Westschweiz
und ist im ganzen Land an über 20
Standorten präsent.
Da sich Siemens ab 2005 nach und
nach aus dem Telekom-Geschäft zurückzog
und die entsprechenden Aktivitäten
auch in der Schweiz sukzessive
veräusserte, waren die Firmenübernahmen
der 90er-Jahre von zentraler
Bedeutung für den heutigen Erfolg.
Dank dem Elektrowatt-Portfolio
wurde der Werkplatz Schweiz massiv
gestärkt, und insbesondere der Entscheid,
den weltweiten Hauptsitz der
Gebäudetechniksparte Siemens Building
Technologies in Zug anzusiedeln,
war wegweisend. Im Dezember 2018
wurde dort der neue Siemens-Campus
eröffnet. Dieser umfasst ein siebenstöckiges
Bürohaus, ein neu erstelltes Produktionsgebäude
sowie ein Bestandsgebäude,
das in den kommenden
Jahren komplett saniert wird.
Mit der Siemens-Vision 2020+ hat
die Schweiz innerhalb des Siemens-
Konzerns eine zusätzliche Aufwertung
erfahren. Seit dem 1. April 2019
ist Zug der globale Hauptsitz von
Smart Infrastructure. Die neue Operating
Company von Siemens mit ihren
weltweit über 70 000 Mitarbeitenden
vereint die Aktivitäten im Bereich Gebäudetechnik
und Energiemanagement
unter einem Dach.
Die Vernetzung der Haustechnik bringt viele Vorteile –
so auch bei der Kombination von Videoüberwachung,
Zutrittskontrolle und Türsprechen.
Nutzen Sie unser systemübergreifendes Know-how als
Gesamtanbieter und profitieren Sie von den Synergien.
Nebst einem umfassenden Sortiment von hoch wertigen
Produkten, erhalten Sie diese Dienstleistungen:
– gemeinsame Konzepterarbeitung, auf die Wünsche
Ihres Kunden zugeschnitten
– Programmierung und Inbetriebnahme
– Schulung bei uns oder auf der Anlage – für Sie und
Ihren Kunden
– Service, Erweiterung und Modernisierung
www.siemens.ch/125
Benno Estermann ist Head of Public
Relations bei Siemens Schweiz AG.
Ausgabe 3/19
eTrends
www.kochag.ch
Praxis LICHTTECHNIK
Licht bis
ganz oben
Im Herbst 2018 eröffneten die Zermatt
Bergbahnen die neue Seilbahn von Trockener
Steg bis zum Klein Matterhorn. Wegen der
grossen Höhe – die Bahn ist die weltweit
höchste ihrer Art – mit möglicher extremer
Kälte und bis zu 200 km/h starken Winden war
der Bau reich an Herausforderungen.
TEXT: RENÉ SENN FOTOS: FRANK SCHWARZBACH
34 eTrends Ausgabe 3/19
Klare Aufgabe
In der Gondelhalle
auf dem Trockenen
Steg sorgen LED-
Scheinwerfer für
genügend Helligkeit
bei Service- und
Wartungsarbeiten.
Die höchste
Bergstation Europas
Auf dem Klein Matterhorn
auf 3883 m ü. M ist ein
besonderes Lichtprojekt
und erschliesst den Blick auf
einen der bekanntesten
Berge der Welt – das
Matterhorn.
D
ie Dreiseilumlaufbahn befördert
in nur neun Minuten
28 Personen pro Gondel
von dem auf 2923 m ü. M.
gelegenen Trockenen Steg
auf das Klein Matterhorn auf 3821 m ü
M. Sie verbessert damit die Verbindung
zwischen dem Skigebiet der
Schweiz und Italiens.
EM Licht plante und lieferte die
Beleuchtung für die Tal- und Bergstation.
Ob in der Gondelhalle, in den
Kassenbereichen oder in den Technikräumen
– zu den üblichen Anforderungen
und individuellen Kundenwünschen
aus architektonischer Sicht
kamen die Herausforderungen des
Geländes.
Spiegelwerfer statt
Pendelleuchten
Wie wichtig die Berücksichtigung der
besonderen Situation mit Wind und
Kälte ist, zeigte sich schnell: So stellten
sich die ursprünglich vom Architekten
für die Gondelhalle gewünschten Pendelleuchten
aufgrund der teils auch im
Innern der Stationen herrschenden
Windverhältnisse als ungeeignet heraus.
Zudem wären sie unter Umständen
einem für Wartungsarbeiten fest
installierten Kran im Weg gewesen.
Stattdessen wurde der Einsatz von
Spiegelwerfern geprüft, die sich gut in
die Architektur integrieren und ein
indirektes, angenehmes Licht erzeugen.
«Gerade an dunklen Schlechtwettertagen
spielt die Beleuchtung eine
wichtige Rolle. Das leicht goldene,
gelbliche Licht der Reflektoren schafft
in der Bergbahnstation die Illusion
von Sonnenlicht», erklärt EM Lichtberater
Yannick Tscherrig.
Bemusterung vor Ort
Die Bemusterung vor Ort war zunächst
eher als Entscheidungsgrundlage
für die Produktauswahl gedacht:
Wie fügen sich die Leuchten in die
Architektur ein, wie gut wird das Licht
gestreut? Doch das vor Ort montierte
Muster sollte kurz darauf helfen, eine
wichtige Frage zu beantworten: Kann
mit dieser Lösung das Konzept wie
geplant umgesetzt werden?
Es konnte, und auf dieser Basis erarbeitete
Lichtplaner Tobias Hutter
eine Beleuchtungslösung, die allen
Anforderungen und Wünschen des
Kunden entspricht. «Die Lösung mit
den Spiegelwerfern ist zwar nicht unbedingt
alltäglich, passt jedoch zur
Gesamtsituation», so Yannick Tscherrig.
«Denn als höchste Bergstation
Europas ist das Klein Matterhorn sowohl
technisch als auch architektonisch
etwas Besonderes − und damit
eine Attraktion für Besucher aus aller
Welt.»
Ausgabe 3/19 eTrends
35
Praxis TECHNIKERSATZ
Raumautomation
für Hotels
Sie kommen spätabends ins
Hotelzimmer, werden mit einer freundlichen
Atmosphäre und angenehmem
Licht begrüsst, und die Temperatur
im Raum ist genauso, wie Sie es
gerne haben. Das ist möglich, wenn
im Buchungssystem Daten zu Ihren
Vorlieben hinterlegt sind und eine
intelligente Steuerung im Einsatz ist.
AUTOR: RAYMOND KLEGER
M
an stelle sich ein Business-Hotel
vor, das vor
zehn Jahren gebaut
wurde. Nur wenige Jahre
nach der Fertigstellung
wurde angekündigt, dass die Raumautomations-Komponenten
nicht mehr
unterstützt werden. Was tun, wenn immer
mehr Geräte ausfallen? Eine Planungsfirma
suchte nach einer Lösung.
Sie kam auf die Kleinfirma Penta-
Control AG zu, die mit 14 Mitarbeitenden
schon lange im Business der
Gebäudeautomation mit eigenen Komponenten
tätig ist. Sie entwickelte kurzerhand
eine eigene Hardwarelösung.
Die Lösung ist baugleich mit dem alten
Gerät einer Grossfirma und passt perfekt
als Ersatzgerät. Natürlich flossen
in diese Neuentwicklung jahrzehnte-
lange Erfahrung im Bereich Steuerungstechnik
aller Gewerke ein.
Der erste Eindruck zählt
Wenn der Gast an der Reception seine
Formalitäten (Check-in) erledigt, beginnt
bereits die Technik im Zimmer
mit den Vorbereitungen. Das Klima
wechselt in den Komfort-Modus. Die
Gäste werden mit einem «Willkommen-Szenario»
begrüsst: Die Zimmerbeleuchtung
und leise Musik gehen an.
Sind elektrische Vorhänge vorhanden,
öffnen sie sich, und das TV-Gerät zeigt
einen personalisierten Willkommensgruss.
Zudem vermittelt eine schöne
Innenarchitektur den ersten, entscheidenden
visuellen Eindruck.
Die eingesteckte Zutrittskarte im
Zimmer aktiviert auch das Touch-Panel.
Apropos Panel: Da erwartet der
anspruchsvolle Gast ein perfektes,
sauberes Display. Dies ist auf Jahre
hinaus nur mit einer randlosen
Glasoberfläche möglich, die sich problemlos
mit «scharfen» Mitteln reinigen
lässt. Plastiklösungen sehen nach
wenigen Jahren schmuddelig aus.
Auch hier wurde eine baugleiche Lösung
zur alten Version gefunden, womit
ein Austausch einfach möglich
war.
Die Bedienung der Panels muss
höchst einfach sein, so dass der Gast
nur einen «Versuch» braucht, um das
einzustellen, was er möchte. Die installierte
Lösung ist sprachunabhängig,
Temperatur und Ventilationsstärke
bedürfen keiner Erklärung, wie das
Bild zeigt. Ein Amerikaner kann →
36 eTrends Ausgabe 3/19
Hotel Four Points by Sheraton in Zürich
Die Technik ist dank einer Eigenentwicklung
wieder auf dem neusten Stand.
Wohlbefinden
Im Hotelzimmer
ist das richtige,
individuell eingestellte
Raumklima
entscheidend.
Ausgabe 3/19 eTrends
37
Steuergerät PentaControl
Speziell für Hotelzimmer
die Temperatur auch auf Fahrenheit
umstellen – ein nicht zu unterschätzendes
Detail. Schön ist an der Weckfunktion,
dass sich die elektrisch betriebenen
Vorhänge am Morgen zur
gewünschten Zeit öffnen und sich der
Radio bzw. TV einschaltet – natürlich
nur, wenn gewünscht.
Über den Kartenleser sind für das
System auch An- und Abwesenheit
erkennbar; bei Abwesenheit wird der
Raum in den Eco-Modus versetzt. Ist
der Gast besonders energiebewusst,
drückt er am Touch-Panel bei Abwesenheit
auf die Eco-Taste und bringt
so das Zimmer in den Modus mit dem
geringsten Energieverbrauch.
Klima im Zimmer
Manche lieben es im Zimmer kühl,
andere ganz warm. Spätestens beim
zweiten Aufenthalt im selben Hotel
oder in Zukunft in einem Hotel derselben
Kette, sind für den Gast im
Zimmer die gewünschten Komfort-
Parameter eingestellt. Das Klima im
Zimmer ist entscheidend für die Behaglichkeit.
Fürs Heizen, Kühlen und
Lüften stehen verschiedene Systeme
bereit.
Heizen: über Radiatoren oder
Bodenheizungen und teilweise
auch übers Klimagerät.
Kühlen: über ein Umluftgerät, das
von einer zentralen Stelle aus mit
Kühlflüssigkeit durchflossen wird.
Es gibt auch Geräte, die sowohl
heizen als auch kühlen können.
Zur Regulierung dienen Ventile.
Der Gast kann die Stärke des
Umluftventilators festlegen.
Lüften: Hotelzimmer werden mit
Frischluft versorgt, die meistens
über einen Volumenstromregler
geleitet wird. Selbstverständlich
wird nur Frischluft eingeleitet,
wenn ein Gast im Zimmer ist,
bzw. demnächst erwartet wird.
Sensoren: Jede Regelung bedingt
Sensoren; im Raum muss mindestens
ein Temperatursensor
installiert sein! Er lässt sich nicht
ins Touch-Panel einbauen, weil die
Eigenwärme des Geräts das
Messresultat verfälschen würde.
Technik im Detail
Schaut man sich die Anschlüsse des
speziell entwickelten neuen Steuergeräts
an, fragt man sich: Und das alles
für ein einziges Hotelzimmer? Jawohl,
so ist es. Das Gerät bietet Anschlüsse
für acht Taster, acht Lichtgruppen, einen
Lüfter, Ventile für Heizen und
Kühlen, einen Kartenleser, geschaltete
Steckdosen und ein Touch-Panel
über IP-Ethernet. Die Hardware
wurde von PentaControl AG entwickelt
und wird in der Schweiz produziert.
Die Lichtgruppen lassen sich mit
konventionellen Tastern schalten. Die
Empfangsbeleuchtung ist individuell
definierbar, natürlich auf den Gast zugeschnitten.
Auf Wunsch lassen sich
sämtliche Leuchten auch ab Touch-
Panel bedienen; hier sind auch Szenen
und gedimmte Lichtgruppen möglich.
Die Beschattung soll Hitzeeintrag und
Blendung verhindern. Gut gelöst, kann
sie vor allem im Sommer viel Energie
sparen. Bei klimatisierten Zimmern
Richtung Süden fällt über grosse Fenster
ohne Beschattung viel Wärmeenergie
an, die durch die Klimaanlage wieder
abgeführt werden muss. Storen
können, je nachdem, ob der Gast im
Zimmer ist oder nicht, automatisch
oder manuell gestellt werden. Markisen
müssen bei zu viel Wind eingezogen
bleiben – das wird im Display angezeigt.
Installiert wurde die Anlage von
einem Elektroinstallateur. Spezielle
Aufgaben und natürlich die Inbetriebnahme
übernahmen Mitarbeiter von
PentaControl AG. Für den verantwortlichen
Techniker des Hotels ist es
wichtig, dass er alle Zimmer zentral
parametrieren kann. Die Zimmersteuerungen
geben ihm auch wichtige Informationen
über Vergangenheitsdaten
und Fehler.
Hard- und Software aus einer Hand
Die flexible Lösung ermöglicht es, bestehende
Anlagen zu ersetzen und
neue zu erstellen. So ist das Hotel für
die Zukunft auf dem neusten Stand
der Technik. Diese Lösung zeigt nebenbei,
dass Hotelzimmer ganz selbstverständlich
mit moderner vernetzter
Technik ausgerüstet werden können.
Die ausgereifte Technik steht für viele
weitere Hotels bereit.
38 eTrends Ausgabe 3/19
Praxis UNTERHALT
Selbst
überwachtes
Paketzentrum
AUTOR: WILLI MEISSNER
Rund 700 000 Pakete werden pro Tag in den Schweizer
Paketzentren verarbeitet. Jeder Defekt gefährdet die pünktliche
Auslieferung. Die HSR Hochschule für Technik Rapperswil
forscht an einem Paketzentrum, das sich selbst überwacht und
rechtzeitig Reparaturen anfordert.
Action Kippschalter-Sorter sind die wichtigsten Teile in den Paketzentren.
Sie kippen ihre Fracht automatisch am richtigen Ort ab.
Technik In den Paket zentren der Post laufen
Tausende Pakete pro Stunde über Sortier anlagen.
P
akete sind wahre Weltenbummler.
Von der Bestellung
bis zur Zustellung
legen die Kartonschachteln
riesige Strecken zurück.
Eine der letzten Stationen auf der
langen Reise sind die insgesamt drei
Paketzentren der Schweizerischen
Post. Hier werden rund 700000 Pakete
pro Tag angeliefert und über verschlungene
Förderband-Systeme weitgehend
automatisiert nach Postleitzahlen und
Adressdaten sortiert. Durch diese ausgeklügelte
Sortierung können die Postboten
schweizweit alle Pakete in ihrem
Gebiet rechtzeitig ausliefern.
Unerwartete Ausfälle
auf null reduzieren
Nur in der Nacht und an den Wochenenden
stehen die Bänder in den Paketzentren
still. In dieser Zeit werden
Instandhaltungsarbeiten durchgeführt
und defekte Teile ausgetauscht. Im
Block- und Schichtbetrieb müssen Mitarbeitende
dafür sorgen, dass am
nächsten Morgen alles rund läuft.
Doch das reicht nicht immer – in jedem
Paketzentrum stehen die Kippschalensorter
pro Jahr 20 bis 30 Mal wegen
eines unerwarteten Ausfalls still. «In
einem solchen Fall rücken unsere speziell
geschulten Teams aus und beheben
das Problem in durchschnittlich 15
Minuten», sagt Thomas Nufer, der für
die mechanischen Installationen in
den Paketzentren verantwortlich ist.
15 Minuten Stillstand: Das sind
Tausende Pakete, die nicht planmässig
sortiert werden können, während am
Liefereingang ein Lkw nach dem anderen
neue Pakete anliefert. So kann
es passieren, dass bis zum Ende des
Tages nicht alle Pakete wie geplant
sortiert werden können und sich die
Auslieferung verzögert. «Durch den
boomenden Onlinehandel gibt es immer
mehr Pakete, und die permanente
Verfügbarkeit der Paketzentren wird
für uns noch wichtiger», sagt Nufer.
Die Post hat deshalb das Ziel, die
ungeplanten Ausfälle möglichst zu reduzieren
und den Aufwand für Inspektionen
zu verringern. Dafür arbeitet
sie zusammen mit dem ILT Institut
für Laborautomation und Mechatronik
der HSR sowie weiteren Partnern
an einem besonderen Überwachungssystem
für die Paketzentren. Es soll
Verschleiss erkennen und rechtzeitig
melden, damit ausfallgefährdete Teile
während der geplanten Wartungen
ausgetauscht werden können. Das
Konzept nennt sich Predictive Maintenance
und ist eines der grossen Ziele,
die Logistik- und Produktionsunternehmen
mit der Digitalisierung ihrer
Fabriken und Anlagen verfolgen.
Mit Sensoren und Algorithmen
die Zukunft voraussehen
Die Forschenden der HSR konzentrieren
sich auf den wichtigsten Teil in den
Paketzentren: die Kippschalen-Sorter.
Das sind Systeme mit Sortierwagen,
auf denen Pakete transportiert werden.
Erreicht ein Paket auf dem Wagen
die Zielrutsche für das richtige Postleitzahl-Gebiet,
kippt der Wagen das
Paket hinunter. Bis zu 1080 in einem
Endloskreislauf fahrende Sortierwagen
ermöglichen die effiziente Sortierung
der Pakete. Wenn ein Wagen
ausfällt, blockiert er den gesamten
Kippschalensorter, und ein Teil der
Sortieranlage steht still.
Der Zustand jedes einzelnen Wagens
soll permanent automatisch erkannt
werden. Zeigt ein Wagen kritische
Verschleisserscheinungen an, soll
eine Software den Wagen für die
Reparatur während der nächsten geplanten
Wartung anmelden oder in
kritischen Fällen einen sofortigen Austausch
durch das Personal veranlassen.
Um den Zustand der Wagen zu prüfen,
experimentiert das ILT-Team um
Prof. Dr. Christian Bermes mit verschiedenen
Sensoren. Sie messen entweder
die Temperatur von beweglichen
Teilen oder Vibrationen, nehmen Geräusche
auf oder prüfen per Laser die
Oberflächen. «Erfahrene Ingenieure
oder Instandhaltungsfachleute erkennen
verschlissene Teile sofort. Für ein
automatisches System müssen wir zuerst
herausfinden, welche Sensoren die
besten Informationen über den Zustand
eines Wagens liefern», erklärt
Bermes. Deshalb forsche man derzeit
daran, «wie und wo genau wir den Patienten
den Puls fühlen müssen, um
zuverlässige Aussagen über ihre Gesundheit
machen zu können.» Um den
optimalen Diagnoseaufbau herauszufinden,
arbeiten die HSR-Forschenden
mit der Küffer-Elektro-Technik AG,
40 eTrends Ausgabe 3/19
«Schon eine
Viertelstunde
Stillstand
verzögert die
Paketauslieferung
erheblich.»
der Automation + Controlsystem ACS
AG sowie der Neratec Solutions AG
zusammen.
Technologietransfer in die Praxis
Damit aus aktuellen Sensordaten
Wartungspläne für die Zukunft werden,
müssen die Daten auf die Cloud-
Server des Projektpartners leanBI
hochgeladen werden. Dort untersuchen
komplexe Algorithmen die Sensordaten
und treffen Vorhersagen, wie
lange welche Kippschalen-Sorter voraussichtlich
noch fehlerfrei funktionieren.
Wird das Ziel des sich selbst
überwachenden Paketzentrums Realität,
will leanBI-CEO Dr. Marc Tesch
das Konzept generalisieren: «Mit den
Erfahrungen aus diesem Projekt
möchten wir ein Algorithmenset entwickeln,
das sich in vielen intralogistischen
Anlagen einsetzen lässt – etwa
im Maschinenbau, der Lebensmittelund
Pharmaindustrie oder bei anderen
Logistikunternehmen.»
Die Generalisierbarkeit interessiert
auch Dr. Christian Heumann von
der FHS St. Gallen, die sich im Projekt
als federführender Forschungspartner
unter anderem mit einer Analyse der
Marktanforderungen befasst. Dazu
interviewt und besucht das Team derzeit
Schweizer Unternehmen mit intralogistischen
Anlagen um herauszufinden,
inwieweit sich Verfahren und
Erkenntnisse aus dem Projekt auf
ähnliche Anwendungsfälle übertragen
lassen.
Das von der Kommission für Technologie
und Innovation des Bundes
mitfinanzierte Forschungsprojekt
läuft noch bis Mitte 2019. Laut HSR
Professor Christian Bermes sehen die
Zwischenergebnisse gut aus: «Wir kennen
die kritischen Zustände und Komponenten
in den Paketzentren, die
Sensor-Messinstallationen sind getestet
und sie funktionieren.»
www.hsr.ch
Willi Meissner ist Kommunikationsmitarbeiter
an der Hochschule für
Technik Rapperswil HSR.
LED Spot-Downlight Modul
DECENT CIRCLE ®
ist ein sehr flacher Einbau-Spot mit einer Höhe
von 26.6mm und ø80mm Ausschnitt. Der
DECENT CIRCLE ® wird im SET inkl. externem,
hauseigenem Mini-Treiber geliefert. Der
Treiber hat einen Soft-Start, ist netzstörungsresistent
und ist mit den gängigsten Dimmern
(Phasenabschnitt) dimmbar. Ebenso ist der
DECENT CIRCLE ® auch als DALI-Version erhältlich.
Den DECENT CIRCLE ® gibt es in der
Ausführung schwenkbar oder fix. Seine opale
Linse erzeugt einen bemerkenswert weichen
und breiten Lichtkegel. Optional ist er auch mit
Kristall-Linse erhältlich, welche einen klaren
und konkret definierten Lichtkegel erzeugt. Der
DECENT CIRCLE ® ist blendfrei (UGR 19) und
hat einen Abstrahlwinkel von 38°. Der Ring ist
erhältlich in weiss, silber oder schwarz. Mit
seiner Schutzklasse IP54 kann er in diversen
Standards:
Bereichen eingesetzt werden. Der DECENT
CIRCLE ® garantiert eine schnelle Installation
durch Stecksystem. Garantie: 5 Jahre.
LED
CREE
10W
36V
200mA
weiss
schwarz
550mA
gebürstet
silber
ø80mm
Ausschnitt
ø100mm
Aussendurch.
*h26.6mm
0PTIK
550mA
OPALE
LINSE
38°
IP54
2-Step
MacAdams
binning
CRI
85
Standard
inklusive
Mini-Treiber
Phasenabschnitt
2700K
UGR
550mA SOFT
60.000 Std. 5 Jahre
S T A R T DALI 3000K 550mA 85% Lichtstrom Garantie
19
550mA
4000K
www.perdix.swiss
Praxis INSTALLATIONSTIPP
100 Prozent
weniger Fehler
AUTOR: RENÉ SENN, EVA GRAF
Löcher bohren, Dosen setzen, Kabel abmanteln,
Drähte abisolieren, Klemmen sortieren, Fehler suchen: Das
muss heute zumindest auf gewerblichen Baustellen wirklich
nicht mehr sein. Denn innovative Energie- und Signalverkabelung
ist doch so einfach. Einstecken, fertig.
Zeit ist Geld Ob Schulzimmer, Hotel, Parkhaus,
Laden- oder Infrastrukturbau: Steckverbindersysteme
machen vieles viel einfacher.
Ausgangslage
Installationsauftrag in Büro- und
Verwaltungsgebäude:
• Zentraler Korridor mit
Kabeltrasse
• Hohldecken
• Bürozone, aufgeteilt in Installationsachsen
• drei Leuchtenzonen pro Büro
• Grossraumbüro
• DALI-Technologie für die Leuchten
?
Keine
Intelligenz
W
elcher Installateur kennt
dies nicht: Je nach Grösse
der Baustelle gibt es
unzählige Dosen, Lampen
und Schalter zu verkabeln
und zu verdrahten. Meist sind
sie an Orten platziert, die nicht ohne
weiteres zugänglich sind. Diese Montageart
kann durchaus als veraltet betrachtet
werden. Zudem ist es leider oft
so, dass sich solche Installationen je
nach Objekt, zum Beispiel pro Stockwerk
und Büro, mehrmals wiederholen
und sich bei der Instalaltion auch noch
Fehler einschleichen. Klar ist auch,
dass solches Handwerk sehr aufwändig
und zeitintensiv ist. Und weil Zeit ist ja
bekanntlich Geld ist, lohnt es sich, sich
in der Planung einige Systemgedanken
zu machen.
Es wäre doch so einfach
Viel einfacher geht es, wenn der Planer
bereits in der Planungsphase überlegt,
wie eine Installation mit Hilfe eines
Steckverbindersystems aufgebaut werden
kann. Dabei spielen vor allem folgende
Faktoren eine Rolle:
∙
∙
wiederkehrende
Verdrahtungsanforderungen
Definition einer
∙
∙
∙
∙
∙
Grundinfrastruktur
digitale, bzw. systematische
Planung
Reduktion der Komplexität
Schaffen von klaren
Installationsstrukturen
Schaffen von klaren
Lieferschnittstellen
ein System für alle Gewerke
Auf diese Art und Weise können Installationen
geplant werden, die sich
innerhalb der knappen Zeitfenster und
der kurzen Fertigstellungstermine, die
dem Installateur auf der Baustelle oft
zur Verfügung stehen, realisieren lassen.
Was natürlich auch bei einer Systemlösung
nicht leiden darf, sind die
Flexibilität und die Vielfalt der Anschlusstechnik,
damit eine rasche Reaktion
auch auf ungeplante Ereignisse
möglich ist.
Details zum Produkt
und der Anwendung
Das gesis® Installationssystem hat die
Elektroinstallation revolutioniert. Das
System ist im Baukastenprinzip konzipiert
und basiert auf wenigen, einfachen
Produkten, die sich je nach Anforderungen
beliebig kombinieren
lassen. Zudem ergänzen sich alle →
Ausgabe 3/19 eTrends
43
SYSTEMÜBERSICHT
DEZENTRALE ELEKTROINSTALLATION.
gesis® + RST® SYSTEMPRODUKTE
MERKMALE STECKBARKEIT:
• Schnelle Installation.
• Sichere Installation.
• Strukturierte Verkabelung.
• Geringe Fehleranfälligkeit.
• Industriell vorgefertigte
Qualität vom Weltmarktführer.
• Flexibles Baukastensystem.
• Wiederverwendbar.
• Erweiterbar.
gesis®NRG
gesis®RAN
Lösung
Die flexible Stromschiene für die
effiziente Infrastrukturverkabelung.
Der projektspezifische Systemverteiler
für smarte Installation.
Für die Basiserschliessung des
Grossraumbüros und der Büros mit
DALI-Leuchten wird die 7-polige
gesis®NRG Flachleitung verwendet. Sie
ermöglicht in Kombination mit
SYSTEMÜBERSICHT
gesis®Classic eine sehr einfache DEZENTRALE ELEKTROINSTALLATION.
Verdrahtung der Leuchten. Diese werden
von Vorteil bereits ab Werk mit den
entsprechenden Anschlusskabeln
geliefert, so dass sich die Installation auf
die Einspeisung der 7-poligen Flachleitung
mit den nötigen Adaptern sowie das
Verbinden, bzw. Stecken der entsprechenden
Anschlussleitungen, Steckverbinder
und Verlängerungskabel
beschränkt.
gesis® + RST® SYSTEMPRODUKTE
MERKMALE STECKBARKEIT:
• Schnelle Installation.
• Sichere Installation.
• Strukturierte Verkabelung.
• Geringe Fehleranfälligkeit.
• Industriell vorgefertigte
Qualität vom Weltmarktführer.
• Flexibles Baukastensystem.
• Wiederverwendbar.
• Erweiterbar.
gesis®NRG
SYSTEMÜBERSICHT
DEZENTRALE ELEKTROINSTALLATION. Stecksystem
• Erweiterbar.
gesis®RAN
Die flexible Stromschiene MERKMALE für die STECKBARKEIT: Der projektspezifische Systemverteiler
für smarte Installation.
effiziente Infrastrukturverkabelung.
• Schnelle Installation.
• Sichere Installation.
gesis®CLASSIC
Die steckbare Elektroinstallation
für Bodentanks, Beleuchtung
usw.
8 . Gebäudeinstallation
gesis® + RST® SYSTEMPRODUKTE
• Strukturierte Verkabelung.
• Geringe Fehleranfälligkeit.
• Industriell vorgefertigte
Qualität vom Weltmarktführer.
• Flexibles Baukastensystem.
• Wiederverwendbar.
• Erweiterbar.
gesis®NRG
Die flexible Stromschiene für die
effiziente Infrastrukturverkabelung.
gesis®RAN
gesis®MINI
Der projektspezifische Systemverteiler
für smarte Installation.
Die größenoptimierte Version
für beengte Platzverhältnisse.
Die IP-geschützte Elektroinstallation
für den Außenbereich.
SYSTEMÜBERSICHT
DEZENTRALE ELEKTROINSTALLATION.
gesis® + RST® SYSTEMPRODUKTE
MERKMALE STECKBARKEIT:
• Schnelle Installation.
• Sichere Installation.
• Strukturierte Verkabelung.
• Geringe Fehleranfälligkeit.
• Industriell vorgefertigte
Qualität vom Weltmarktführer.
• Flexibles Baukastensystem.
• Wiederverwendbar.
gesis®CLASSIC
Die steckbare Elektroinstallation
für Bodentanks, Beleuchtung
usw.
RST®CLASSIC/RST®MINI
SYSTEMÜBERSICHT
DEZENTRALE ELEKTROINSTALLATION.
gesis® + RST® SYSTEMPRODUKTE
gesis®NRG
Die flexible Stromschiene für die
effiziente Infrastrukturverkabelung.
MERKMALE STECKBARKEIT:
• Schnelle Installation.
• Sichere Installation.
• Strukturierte Verkabelung.
• Geringe Fehleranfälligkeit.
• Industriell vorgefertigte
Qualität vom Weltmarktführer.
• Flexibles Baukastensystem.
• Wiederverwendbar.
• Erweiterbar.
gesis®MINI
Die größenoptimierte Version
für beengte Platzverhältnisse.
gesis®RAN
Der projektspezifische Systemverteiler
für smarte Installation.
gesis®NRG
Die flexible Stromschiene für die
effiziente Infrastrukturverkabelung.
RST®CLASSIC/RST®MINI
Die IP-geschützte Elektroinstallation
für den Außenbereich.
gesis®RAN
Der projektspezifische Systemverteiler
für smarte Installation.
gesis®CLASSIC
gesis®MINI
RST®CLASSIC/RST®MINI
Die steckbare Elektroinstallation
für Bodentanks, Beleuchtung
usw.
Die größenoptimierte Version
für beengte Platzverhältnisse.
Die IP-geschützte Elektroinstallation
für den Außenbereich.
8 . Gebäudeinstallation
30 Prozent
weniger Installationskosten
Die steckbare Elektroinstallation
Hohe Intelligenz
für Bodentanks, Beleuchtung
usw.
8 . Gebäudeinstallation
Die größenoptimierte Version
für beengte Platzverhältnisse.
Die IP-geschützte Elektroinstallation
für den Außenbereich.
Die Verwendung eines Stecksystems
bietet neben 70 Prozent weniger
Zeitaufwand bei der Installation noch
sehr viele weitere Vorteile. Sie lassen sich
folgendermassen gliedern:
8 . Gebäudeinstallation
• nachhaltige Qualität
• wirtschaftliche
Planbarkeit
• Tools für die Planung
• einfacher Unterhalt
8 . Gebäudeinstallation
Die steckbare Elektroinstallation
für Bodentanks, Beleuchtung
usw.
Die größenoptimierte Version
für beengte Platzverhältnisse.
Die IP-geschützte Elektroinstallation
für den Außenbereich.
gesis®CLASSIC
gesis®MINI
RST®CLASSIC/RST®MINI
gesis®CLASSIC
gesis®MINI
RST®CLASSIC/RST®MINI
Wirtschaftlichkeit
• kostenoptimierte Installation
• Support und Planungsunterstützung
• einfache Planung
Nutzen
• einfach und steckbar
• schnelle Montage
• sichere Installation
• weniger Fehler
• Kodiermöglichkeit
System und Technologie
• umfassendes System
• unterschiedliche Einsatzgebiete
• individuelle Lösungen möglich
Anwendungen
• Licht
• HLK
• Brüstungskanäle
• Bodenkanäle Hohlbodensysteme
• Jalousie
44 eTrends Ausgabe 3/19
Produktgruppen und ermöglichen so
eine smarte und wirtschaftliche Elektroinstallation
von der Verteilung bis
hin zum Verbraucher. Das oberste Ziel
des Systems ist die Vereinfachung der
Verkabelung und damit verbunden die
Reduktion der Installationszeit bei
mehr Sicherheit. Eine solche Verkabelung
ist auch effizienter und flexibler.
An den Flachleitungen lassen sich
zudem jederzeit schnell und sicher Abzweigungen
an beliebiger Stelle montieren
– ganz ohne Leitungsunterbrechung!
Eine isolierungsdurch dringende
Anschlusstechnik sorgt für die Kontaktierung.
Dafür stehen fünf Flachkabel-Systeme
mit unterschiedlichen
Querschnitt-Dimensionen zur Verfügung,
die Energie, Signale oder Busleitungen
verteilen können.
Objektspezifische Installationsverteiler
für die dezentrale Energieversorgung
und Gebäudeautomation
komplettieren das Installationssystem.
Auch sie werden steckbar ausgeführt
und können so einfach vorkonfiguriert,
getestet und dann installiert
werden. Das System ermöglicht 70
Prozent Zeit- und 30 Prozent Kostenersparnis
im Vergleich zu herkömmlichen
Installationsarten.
Die Verdrahtung einer konventionellen
Abzweigdose gilt gemäss den
Normen als feste Verbindung. Nach
EN 61535 zählt eine gesis® Steckverbindung
mit Verriegelungen ebenfalls
zu den festen elektrischen Verbindungen
und kann somit ohne weiteres installiert
werden.
Nutzen für Endkunden
∙ Drehstromversorgung bis ins Feld
reduziert den Spannungsfall und
spart Energie
∙ rasche und einfache Erweiterbarkeit
∙ Reparaturen, z.B. der Austausch
einer Leuchte, sind sehr einfach
Nutzen für den Installateur
und Planer
∙ einfachste und sehr schnelle
Installation
∙ sehr gute Planbarkeit
∙ Drehstromgruppen bis ins Feld
∙ Leuchten lassen sich z.B. bereits
mit Anschlusskabel bestellen
∙ Öffnen und Anschliessen von
∙
∙
∙
∙
∙
Leuchten entfällt
Leuchten können sehr schnell
ausgetauscht werden
vereinfachte Montage
sichere Installation
weniger Brandlast
Farbcodierung für unterschiedliche
Anwendungen/Gewerke
Früher trugen Sie einen.
Heute sind es mehrere.
Gewinnen Sie Zeit fürs Wesentliche. Wir machen den Rest.
Mitglied werden und profitieren. www.eev.ch
Praxis NORMEN
Vernehmlassung
für prSIA 2060
AUTOR: RENÉ SENN
Der SIA hat den Normentwurf prSIA 2060
«Infrastruktur für Elektrofahrzeuge in Gebäuden» für
Stellungnahmen in die Vernehmlassung gegeben.
M
it Blick auf den Ausbau
und die Entwicklung
der eMobilität und den
damit verbundenen Anforderungen
hat eine
Arbeitsgruppe der SIA den Normentwurf
prSIA 2060:2019-04 erstellt. Nun
steht er wie üblich der Öffentlichkeit
zur Verfügung, um Stellungsnahmen
einzubringen. Das Merkblatt behandelt
hauptsächlich den Planungsprozess
von Infrastrukturen für Elektrofahrzeuge
in Gebäuden, liefert aber
auch umfassende Informationen zur
allgemeinen Verständigung aller am
Projekt Beteiligten in Form von Begriffen,
Definitionen und Symbolen,
die im Planungsprozess verwendet werden
können. Es bietet auch Hilfestellungen,
indem es Begriffe wie Ladepunkt,
Ladestation, Ladeanlage,
Ladebetriebsart und Lastmanagementsystem
definiert.
Stellungnahmen sind mit dem
entsprechenden Formular noch
bis zum 14. Juli 2019 einzureichen
an VL2060@sia.ch.
Projektierung im Fokus
Das zweite Kapitel behandelt die Projektierung
mit den energetischen Anforderungen
und liefert Empfehlungen
zu Ladeleistung, Energiebedarf und
Ladezeiten. Zudem gibt das Kapitel
Hinweise zur Bewilligungspflicht und
definiert fünf mögliche Ausbaustufen,
mit Angaben und Empfehlungen zur
Anzahl der Ladeplätze und ihrer Ladeleistung.
Auch der Systemaufbau
mit der Thematik Ladeplatz, Ladesta-
46 eTrends Ausgabe 3/19
tion, Zahlungssystem und Speicherung
sowie Angaben zu den Verbindungsleitungen
im Gebäude werden
behandelt.
Hinweise zur Auslegung
Im dritten Kapitel werden die Berechnung
und Bemessung der Ladeleistung
erläutert. Dabei geht es vor allem darum,
wie der Planer den Leistungs- und
Energiebedarf berechnen und festlegen
kann. Kapitel 4 liefert eine Art
Checkliste zur Prüfung der Ausführung
und Dokumentation der Anlage
bei der Übergabe. Kapitel 5 enthält
Angaben über die unterschiedlichen
Betreibermodelle und Nutzungskonzepte.
Quantifizierung und Planungstipps
Ein umfassender Anhang liefert abschliessend
Szenarien für die Quantifizierung
der Ausbaustufen, Informationen
zum Lastmanagementsystem
sowie zur Anordnung der Ladeplätze
mit entsprechenden Empfehlungen
und Berechnungsbeispielen, die es
dem Planer erleichtern, ein Projekt zu
berechnen und die Leistungen und
Anschlusswerte zu bestimmen.
Hilfsmittel für Planer und
Architekten
Hauptzielgruppe des Dokuments sind
Architekten und Investoren. Es wird
aufgezeigt, welche Fragen vor der Installation
geklärt werden müssen. Das
Merkblatt soll ein Hilfsmittel sein, um
Gebäude korrekt mit Ladestationen
auszurüsten. Es dient auch Elektroplanern
als Werkzeug für die Verständigung
und legt die Eckwerte für ihre
Tätigkeit fest.
Der Normentwurf steht auf der
Homepage des SIA unter folgendem
Link zur Verfügung:
www.sia.ch/vernehmlassungen
«Das Merkblatt
soll ein Hilfsmittel
sein,
um Gebäude
korrekt mit
Ladestationen
auszurüsten.»
Jetzt wird das Zuhause smarter
Centero Home ist der ideale Einstieg in
die Smart Home Welt. Die zentrale
Steuereinheit (Gateway) wird per WLAN
mit dem hauseigenen Router verbunden
und fügt alle eingelernten Geräte zu einem
System zusammen. Die Bedienung erfolgt
mit einer iOS®- oder Android-App manuell oder automatisch. Das
Centero Home-System kann sowohl
ausserhalb des hauseigenen WLANs
über die Cloud als auch lokal genutzt
werden. Die benutzerfreundliche und
intuitive Bedienung per Smartphone
oder Tablet überzeugt Bauherren, Architekten
und Handwerker gleichermassen.
M-BUS CENTER
Zählerauslesung
leicht gemacht
Das M-Bus Center eignet
sich für die Auslesung von
Strom-, Wasser-, Wärmeund
Gaszähler mit M-Bus
Schnittstelle.
Die Messwerte dienen als
Basis für die Energiekosten
Abrechnung in einer ZEV
oder Minergie Zertifizierung.
• Komplette elero-Funkwelt
• Wetterdienst mit Prognose
• Bewegungsmelder
• Rauchwarnmelder
• Tür-/Fensterkontakte
• Temperatursensoren
• Heizkörper-Thermostate
• Philipps Hue Leuchten
• Osram Lightify
• RTS 433 MHz
• TV-Steuerungen Infrarot
• Amazon Alexa
• Videotürsprechanlagen
• Netatmo Wetterstationen
• Sonos Soundanlagen
„Alexa“ Wohnzimmer
beschatten...
ü
ü
ü
ü
Auswertung via Webserver
M-Bus zu BACnet IP
16GB Speicher
Geeignet für ZEV & Minergie
EMU
Electronic AG
Jöchlerweg 2 | 6340 Baar
Tel. 041 545 03 00
info@emuag.ch
www.emuag.ch
Meimo AG – 8954 Geroldswil – T 043 455 30 40 – www.meimo.ch
Qualität, die zählt - Made in Switzerland
Praxis KUNDENBEWERTUNG
Kunden gewinnen
dank positiven
Bewertungen
Die digitale Schwester der Mund-zu-Mund-Propaganda
heisst Online-Kundenbewertung. Und sie wird stets
wichtiger. Denn Kundenbewertungen und Empfehlungen
im Internet nehmen immer häufiger Einfluss darauf,
was wir kaufen, buchen oder essen.
I
n der Cafeteria: Zwei Arbeitskolleginnen
unterhalten
sich über Kaffee. Die eine
lobt den einfachen Bestellprozess,
den Geschmack und
den Preis einer Marke. Die andere
nickt beeindruckt und merkt sich die
Marke.
Mund-zu-Mund-Propaganda in ihrer
reinsten Form. Die älteste aller
Werbeformen kommt auch heute nicht
aus der Mode. Empfehlungen von
Freunden und Bekannten sind für die
meisten Menschen das stärkste Argument
bei einer Kaufentscheidung.
Doch in unserer immer digitaleren
Welt holen Online-Kundenbewertungen
auf.
Kundenbewertungen ausschlaggebend
für Kaufentscheidung
Gemäss einer repräsentativen GfK-
Umfrage des Kölner Lokalmarketing-
Unternehmens Greven Medien lesen
zwei Drittel (66,4 Prozent) aller Deutschen
vor einer verbindlichen Kaufentscheidung
Bewertungen im Netz.
Dabei ist die Nutzung von Bewertungsportalen
weder Frauen- noch
Männersache, denn knapp 40 Prozent
beider Geschlechter geben an, häufig
bis sehr häufig einen Blick auf Tripadvisor
& Co. zu werfen. Auffallend
ist: In der Altersklasse der 20- bis
39-Jährigen bestätigt etwa jeder
Zweite (52,6 Prozent), sich regelmässig
in Bewertungsportalen zu erkundigen.
Eindrückliche Aussagen, welche
die deutsche Expertin für Loyalitätsmarketing
Anne M. Schüller in ihrem
Referat an einer Unternehmertagung
der ELITE Electro-Partner in Zürich
auch in Bezug auf die Schweiz bestätigte.
Daher ihr Aufruf: «Sei wirklich
gut, und bringe die Leute dazu, dies
vehement weiterzutragen!».
Konkurrenzvorteil durch
Kundenzufriedenheit
Wir halten fest: Kundinnen und Kunden
klicken häufig auf den Bewer-
48 eTrends Ausgabe 3/19
eev Fachreport
Marketing- und Servicedienstleisterin
der Elektrobranche
eev | aae, 3322 Urtenen-Schönbühl
www.eev.ch
800 m 2 MIT
NUR EINEM SENSOR
ERFASSEN. ESY!
tungs-Link. Doch welche Kriterien
muss ein Unternehmen oder eine
Dienstleistung erfüllen, damit sie fünf
Sterne erhält und gerne weiterempfohlen
wird? Das Zauberwort lautet
Kundenzufriedenheit. Sie hängt davon
ab, inwieweit die wahrgenommenen
Leistungen der Kunden mit den
erwarteten Leistungen übereinstimmen.
Sind sie grösser als die Erwartungen,
führt dies zu Zufriedenheit
auf hohem Niveau. Sind sie genauso
gross, spricht man von einem konstanten
Niveau. Sind die wahrgenommenen
Leistungen jedoch kleiner als die
erwartete Sollleistung, mündet dies in
Unzufriedenheit. Kunden zahlen einen
Preis für ein Leistungsversprechen
und erwarten dessen Erfüllung.
Wird es lediglich erfüllt, sehen sie
nichts Besonderes darin, denn dies
wurde erwartet und bezahlt. Bekommen
sie jedoch mehr als erwartet, reagieren
sie zufriedener und entwickeln
eine Loyalität dem Anbieter
gegenüber.
Dialog mit Kunden
Wer dank positiver Online-Kundenbewertungen
neue Kunden gewinnen
möchte, setzt auf eine hohe Kundenzufriedenheit.
Basis dafür ist das
Übertreffen der erwarteten Leistungen.
Doch um die Erwartungen der
Kunden zu kennen, braucht es einen
stetigen Dialog mit ihnen. Geben Sie
Ihren Kunden daher eine Plattform
zur Bewertung und lernen Sie ihre Bedürfnisse
immer besser kennen. Dann
klappt es auch mit fünf Sternen.
Ausgabe 3/19
eTrends
STRAHLUNGSFREIE PIR-SENSORIK
OHNE ELEKTROSMOG
COMPACT-SERIE
MIT 32 METER REICHWEITE
Effizienz bedeutet nicht nur, Beleuchtung oder
Lüftung ausschliesslich bei Bedarf einzuschalten.
Effizient ist auch, dafür so wenige Präsenz melder
einzusetzen wie möglich.
Bestes Beispiel: Die neuen Präsenz- und
Bewegungsmelder PD/MD-C 360i/32 unserer
Erfolgsserie COMPACT. Mit ihrer Reichweite von
32 Metern im Durchmesser erfassen sie selbst
weitläufigste Flächen wie z. B. in Grossraumbüros
und senken so oft ganz im Alleingang die Energiekosten
– egal ob als Variante für 230 Volt, DALI
oder KNX!
PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Swiss AG | info@esylux.ch | www.esylux.ch
Smart Building GEBÄUDEAUTOMATION
Internet
der Dinge
und
Gebäudetechnik
Auch in der konservativen Gebäudebranche
hat das Zeitalter des Internet
der Dinge und der künstlichen Intelligenz
bereits begonnen, ohne dass wir dies
richtig mit bekommen haben. Die
Gebäude automation muss deshalb
neu strukturiert werden.
AUTOR: JÜRG BICHSEL
50 eTrends Ausgabe 3/19
W
er ein Ferienhaus besitzt,
kennt die Sorgen:
Funktioniert die Heizung
noch oder ist die
Temperatur unter die
Frostschutzgrenze gesunken und droht
ein Schaden durch geborstene Wasserleitungen?
Früher wurde das Problem
über die analoge Telefonleitung mit
einer Fernüberwachung und Steuerung
mit kleinem Funktionsumfang gelöst.
Die Kosten dafür betrugen oft einen
Viertel der Anlagenkosten. Kommunikation,
Hard- und Software wurden als
lukratives Geschäft verkauft. Heute
sieht es ganz anders aus: Der Heizungsmonteur
fragt, wo der Ethernet-Anschluss
ist, alles andere ist im Gerät
integriert, die Daten können über die
Cloud abgerufen werden, und zusätzlich
wird noch ein Störmeldeservice
angeboten.
Die Herausforderungen am Gebäude
Spezialisierung
Die Bauindustrie ist heute extrem
fachspezifisch segmentiert; dadurch
können sicherlich Spitzenleistungen in
Teilbereichen bezüglich Terminen
oder Qualität erzielt werden, der Fokus
auf den Bau als Gesamtes geht
aber verloren. Dies zeigt sich auch in
der kommunikativen Gebäudetechnik.
Das Licht weiss nichts von der
Verschattungsregelung, und die Kühlung
und Heizung wissen nichts über
die Belegung des Gebäudes. Anders
ausgedrückt schlummert hier ein grosses
Verbesserungspotenzial. Die partikulären
Lösungen werden aber auch
nicht besser, wenn wir alles in die
Cloud auslagern.
Vertraulichkeit, Datenintegrität
und Verfügbarkeit
Häufig wird argumentiert, dass es den
Grundsätzen der Vertraulichkeit widerspreche,
wenn Daten von Sensoren
für andere Gewerke einsehbar sind.
Dies ist insofern richtig, als persönliche
Daten nicht einfach öffentlich zugänglich
sein dürfen. Wird aber mit
anonymisierten Daten ein Mehrwert
geschaffen (z. B. wenn die Kühlung
weiss, dass der Raum belegt ist und sie
prädiktiv Kühlleistung zur Verfügung
stellen kann), steigt die Bereitschaft
enorm, diese Daten zur Verfügung zu
stellen. Neben diesem rechtlichen Aspekt
interessiert auch, ob die Daten
korrekt (Integrität) und zuverlässig
verfügbar sind. Also: Entsteht für den
Kunden ein Mehrwert, werden die Daten
auch zur Verfügung gestellt.
Traditionelle Strukturierung
der Gebäudeautomation
Die EN 16484 beschreibt die traditionellen
Gebäudeautomationssysteme
(Abb. 1). Sie sind hierarchisch in die
Ebenen Feld, Automation und Management
gegliedert, und die «Intelligenz»
nimmt von unten nach oben zu.
Traditionell gilt dies jeweils separat
für jedes Gewerk wie Heizung, Kühlung,
Beleuchtung und Verschattung.
Dieser Aufbau ist mit Blick auf die
historische Entwicklung der Computertechnik
verständlich, weil grosse
Rechenleistung teuer, energieintensiv
und schwer war.
→
Abbildung 1
Traditionelle Strukturierung
der Gebäudeautomation
nach EN16484 mit der Ergänzung
eines Gewerks mit
«siloartigen» Cloudlösungen.
Quelle: D. Kunz, FHNW
Managementebene
Visualisierung
Automationsebene
Feldebene
Anlagenautomation
Raumautomation
Fassadenautomation
Gebäudeautomation
Ausgabe 3/19 eTrends
51
Abbildung 2
Entwicklung in der Gebäudeautomation von Cloud- zu EDGE- und FOG-Computing;
Publisher (= Datenquelle), Subscriber (= Datenabonnent), Router (= Datenweiterleitung);
Server (Datenzwischenspeicher, Verdichtung der Daten), Broker (= Datenverteiler);
die Linie stellt den Übergang zum Internet dar. Quelle: D. Kunz, FHNW
Message
Broker
Subscriber
(Aktor)
Cloud
Subscriber
Message
Broker
Subscriber
(Aktor)
Cloud
Message
Broker
(Aktor)
Cloud
EDGE
Router
EDGE
Router
FOG
Router
FOG
FOG
Router
Publisher
(Sensor)
Subscriber
(Aktor)
Publisher
(Sensor)
Subscriber
(Aktor)
Publisher
(Sensor)
Subscriber
(Aktor)
Publisher
(Sensor)
Subscriber
(Aktor)
Zukünftige Strukturierung
der Gebäudeautomation
Der Kunde erwartet heute, dass seine
Daten, Betriebszustände der Anlagen
und Eingriffsmöglichkeiten weltweit
und jederzeit verfügbar sind. Diese
Forderung favorisiert Internet-basierte
Technologien mit Anschluss der Datenbanken.
Zusätzlich sind die Hardund
Softwarekosten extrem stark gesunken,
und grosse Rechenleistung
kann auf kleinstem Raum direkt in
Sensoren verbaut werden. Diese technische
Entwicklung ermöglicht Konzepte,
die früher undenkbar waren und
die den Gesamtnutzen des Systems
stark steigern. In der Praxis haben sich
einige Begriffe etabliert, welche die
technischen Ausprägungen der Lösungen
beschreiben (Abb. 2):
∙ Cloud-Computing: Die Intelligenz
wird in ein «Rechenzentrum»
ausgelagert; jeder
kommuniziert über das Internet
mit der Cloud.
∙ EDGE-Computing: Die lokale
Intelligenz wird gestärkt, es
gibt idealerweise genau einen
∙
Eintrittspunkt für das Internet
mit der Cloud-Anbindung; der
Firewall-Schutz des Internets
wird zentralisiert und professionalisiert
und kann von einer Stelle
aus gewartet werden.
FOG-Computing: Die lokale
Intelligenz wird nochmals
gestärkt; alles, was lokal entschieden
werden kann, bleibt lokal
und macht keinen Umweg über das
Internet; die Automationshierarchie
wird wie bei der traditionellen
Gebäudeautomation lokal erstellt,
das System wird schneller, zuverlässiger
und stabiler; über den
FOG-Servern folgt typischerweise
ein EDGE-Router.
FOG-Computing löst die heutigen
Problemstellungen am besten. Es ermöglicht:
∙ lokal verteilte künstliche Intelligenz,
die sowohl vernetzt als auch
autark eigene Entscheide fällen
kann,
∙ Kommunikation unter intelligenten
Geräten ohne Aufforderung
∙
∙
seitens einer zentralen Stelle,
Lernen aus der Vergangenheit für
die Zukunft ohne Zutun des
Menschen,
Erkennen neuer Geräte und
Funktionalitäten ohne Zutun des
Menschen.
Das zentrale Hirn (Managementebene)
wird in der neuen Strukturierung nicht
mehr benötigt, weil lokale künstliche
Intelligenz diese Rolle übernimmt.
Hiermit steigt die Zuverlässigkeit der
Anlage, und Gewerke können ihre Daten
direkt austauschen. Auch der Unterbruch
einer Kommunikationsleitung
führt nicht mehr zum Stillstand des
Systems.
Einsatz der richtigen Technologie
Es ist bereits heute ratsam, auf Technologien
zu setzen, die etablierte
Standards aus der Kommunikationsund
Computertechnik nutzen, um an
der enormen Entwicklungsgeschwindigkeit
und den neuen Eigenschaften
und Sicherheitsupdates teilhaben zu
können.
52 eTrends Ausgabe 3/19
Abbildung 3
Smart Grid Ready und die
einzelnen Entwicklungsstufen
(Quelle: Smart Grid Ready).
1.0
diskret
on/off
Aus- und Freischalten der Anlage oder
Tarifumschaltung (z. B. Rundsteuerung)
2.0
diskret
diverse
Diskrete gerätespezifische Zustände/Sollwerte
oder Tarifumschaltung (z. B. SG_Ready)
Die kommenden
Herausforderungen
In einem Punkt muss sich die Baubranche
noch einigen: Wie sehen die zukünftigen
Kommunikationsstandards
aus, die nicht nur einen Austausch von
Informationen unter den Gewerken,
sondern auch die Optimierung von
Geld-, Material- und Energieflüssen
ermöglichen? Um dies zu klären,
wurde am 29. März 2019 in Bern der
Verein Smart Grid Ready gegründet,
der sich zum Ziel gesetzt hat, nicht nur
Informationen auszutauschen, sondern
auch die energetische Optimierung
unserer vernetzten Welt voranzutreiben.
Heute sind wir erst bei Version
1.0 angelangt, der Weg zur Version 6.0
ist noch lang (Abb. 3) und mit vielen
Hürden gepflastert, die jedoch mit vorhandenen
Technologien bewältigt werden
können.
Die Einführung des Internets der
Dinge geschieht fast unmerklich. Zu
den traditionellen Gewerken werden
neue Felder hinzukommen wie beispielsweise
die Integration von «passiven
Sensoren», die etwas über den
3.0
kontinuierlich
statisch
4.0
kontinuierlich
dynamisch
5.0
dynamisch
6.0
Prognose
Bauteilezustand aussagen können
(z. B. in Beton eingegossene Sensoren,
die situativ ausgelesen werden können).
Dies ermöglicht eine weitere
Vernetzung am Bau in den Bereichen
Planen, Bauen, Bewirtschaften und
Rückbauen. Hier beginnt das Building
Information Modeling (BIM), bei dem
digitale Zwillinge der geplanten Bauten
erstellt werden.
Fix definierte Kennlinien/Profile oder
Tarifvereinbarungen (z. B. Kennlinien in
PV-Invertern)
Dynamische Tarife oder Sollwerte (Echtzeit)
Dynamische Kennlinien (Echtzeit)
Verhalten anhand eines Zeitprofils
beispielsweise bezüglich Preisen, selbstprognostizierten
Werten, CO2 oder Sollwerten
www.fhnw.ch/habg/iebau
www.smartgridready.ch
Jürg Bichsel ist Leiter des Instituts
Energie am Bau der Fachhochschule
Nordwestschweiz.
Messgeräte für
Energie optimierung
mieten!
Leistung, Energie, Schallkamera (Leckortung), Wärmebildkamera,
inklusive Support während Miete, optional Datenauswertung / Bericht
erstellung durch uns. Wir verkaufen auch das ganze FLUKE Sortiment!
052 624 86 26 | info@transmetra.ch
Smart Building PROTOKOLLE
AUTOR: RENÉ SENN
Was ist MQTT?
Es wird Zeit zu klären, was hinter diesem
Begriff, oder besser gesagt diesem Protokoll
steckt und wie es funktioniert, allerdings
ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen.
D
as Internet of Things ist in
der Automationsbranche
mittlerweile ein gängiger
Begriff. Gemeint ist das
Internet der Dinge, in dem
Geräte mit anderen Geräten vernetzt
sind, damit sie untereinander Informationen
austauschen können. Der Begriff
des Ubiquitous Computing, also
Vorteile von
MQTT
• einfaches Applikationsprotokoll
• geringer Overhead
• geringe NetzBandbreite
nötig
• leichtgewichtige
Nachrichtenübermittlung
• geringer Stromverbrauch
• benötigt wenig Speicherplatz
und Prozessorleistung
• unterstützt unterschiedliche
Plattformen und
Programmiersprachen
• hohe Zuverlässigkeit
der Übertragung
• Überwachung der
Verbindung möglich
• OpenSource
mqtt.org
www.hivemq.com
die Allgegenwärtigkeit von Computern,
Sensoren und Aktoren, ist ebenfalls
nicht neu, er wurde von Mark
Weiser im Jahr 1991 geprägt. Weiser
erregte mit seinem Artikel «The Computer
for the 21st Century» Aufsehen
in der Branche. Er beschreibt darin,
wie er sich die Computer und die Welt
der Computer in der Mitte oder am
Ende des 21. Jahrhunderts vorstellt:
Weiser lag damit ziemlich richtig, wie
die Geschichte zeigt. Kommen wir aber
zurück zu MQTT (Message Queue Telementry
Transport) und betrachten
seine Geschichte und Herkunft.
MQTT wurde bereits 1999 von Dr.
Andy Stanford-Clark (IBM) und Arlen
Nipper (Arcom) entwickelt, um
eine Öl-Pipeline in der Wüste über eine
Satellitenverbindung zu überwachen.
Nicht erst von gestern
Heute wird MQTT als Anwendungsprotokoll
vor allem in der Machineto-Machine-Kommunikation
(M2M)
eingesetzt, bei der Maschinen oder
Geräte mit anderen Dingen (bidirektional)
kommunizieren und dabei oft
nur kleine Datenmengen austauschen.
MQTT benötigt aufgrund seiner geringen
Komplexität, seiner hohen Flexibilität
und dem geringen Overhead
seiner Pakete nur sehr limitierte Netzinfrastrukturen.
Es ermöglicht eine
zuverlässige, einfache Nachrichtenübermittlung
auch mit energiesparenden
Geräten und einer begrenzten
Leistung. Mittlerweile ist MQTT ein
Open-Source-Protokoll, das seit 2013
von der Organization for the Advan-
cement of Structured Information
Standards (OASIS) standardisiert
wird. Die aktuelle Version (seit 2018)
ist die MQTT-v5-Spezifikation. Zur
Auswahl des Kommunikationsnetzes
(Netzwerk-Layer nach dem 5-Schichten-OSI-Modell)
für MQTT-basierende
Geräte stehen unterschiedliche
Infrastruktur-Technologien zur Verfügung.
Aufgrund der einfachen Installation
werden die Geräte oft kabellos
miteinander verbunden. Zum Einsatz
kommen so Technologien wie Bluetooth,
Lo-RaWAN, Narrowband IoT
oder solche der klassischen Mobilfunk-Infrastrukturen
(LTE, 4G, 5G).
Neben MQTT bestehen weitere IoT-
Anwendungsprotokolle wie CoAP
(Constrained Application Protocol),
XMPP (Extensible Messaging and
Presence Protocol) und HTTP/1.1 und
HTTP/2.
Funktionsweise von MQTT
Die Kommunikationsarchitektur von
MQTT basiert auf einem sogenann -
ten Publish/Subscribe-Modell. Dies
bedeutet, dass Sensoren Informationen
senden und Empfänger diese Informationen
abonnieren. Die Informationen
werden aber nicht direkt vom
Sender (Publisher) an den Empfänger
(Subscriber) gesendet, sondern immer
über einen sogenannten MQTT-Broker,
der als «zentraler Server» bei der
Datenübermittlung funktioniert. Er
ist Dreh- und Angelpunkt beim Austausch
von Informationen innerhalb
eines MQTT-Netzes, ohne ihn geht
nichts. Er verwaltet die Daten, die alle
54 eTrends Ausgabe 3/19
Publisher senden, und überwacht auch
die Funktion aller angeschlossenen
Publisher und Subscriber sowie deren
Kommunikation.
Funktion der Kommunikation
Die Kommunikation läuft bei MQTT
folgendermassen ab: Ein Sensor, also
ein Publisher, liefert zum Beispiel
seine Temperatur an den MQTT-Broker,
der diesen Wert speichert und an
alle Subscriber sendet, die diesen Wert
bei ihm abonniert haben. Es kann sich
dabei nur um einen oder um Tausende
Subscriber handeln, die an diesem
Wert interessiert sind.
Dieses Publish/Subscribe-Prinzip
hat den entscheidenden Vorteil, dass
bei einem grossen System mit vielen
Subscribers alle die Information
gleichzeitig erhalten. Erreicht wird
dies durch einen sogenannten Broadcast,
das heisst den Versand des Temperaturwerts
an alle Subscriber
gleichzeitig. Ein weiterer Vorteil ist,
dass für die Kommunikation keine
Ports oder IP-Adressen der Empfänger
bekannt sein müssen. Publisher
subscribe
Laptop
Temperatursensor
MQTT
Broker
publish
«21 °C»
publish «21 °C»
Mobiles
Gerät
Topic «Temperatur»
abonnieren (subscribe)
Topic «Temperatur»
senden (publish)
subscribe
und Subscriber wissen grundsätzlich
nichts voneinander, da alles über den
Broker abgewickelt wird. Kommt ein
neuer Subscriber hinzu, zum Beispiel
das Smartphone in der nachfolgenden
Grafik, das ebenfalls über die Temperatur
informiert sein will, sendet ihm
der Broker den von ihm zuletzt gespeicherten
Wert einfach zu.
Funktion der Adressierung
Die Adressierung, bzw. der Nachrichtenaustausch
zwischen Client und Broker
wird über sogenannte Topics gesteuert.
Topics bestehen technisch
gesehen aus einem UTF-8-String und
sehen auf den ersten Blick genauso aus
wie eine URL, die im Internet verwendet
wird. Beispiele für Topics sind:
«haus/keller/weinkeller/temperatur»
oder «haus/keller/weinkeller/feuchte»
In unserem Beispiel sendet ein im
Weinkeller installierter Publisher
(Raumtemperatur-Client) die Temperatur
dieses Raums an einen Broker.
Dieser hat nun die Möglichkeit, diese
Information an die Subscriber weiterzuleiten,
die den Temperaturwert
abonniert haben. Das Slash-Zeichen
(/) fungiert als so genannter «Topic
Level Separator». Es separiert mehrere
Levels, von denen es beliebig viele
geben kann, innerhalb eines hierarchischen
Baums. Der einfache, hierarchische
Aufbau der Adressierung ermöglicht
es auch, mit Hilfe sogenannter
Wildcards mit einer Anfrage an den
MQTT-Broker alle Temperaturen im
Haus oder alle Zustände in einem
Raum abzufragen.
MQTT kann noch viel mehr
Natürlich gäbe es an dieser Stelle noch
viel über das MQTT-Protokoll zu berichten,
zum Beispiel, dass es bei Bedarf
auch über einen Quality of Service
mit drei unterschiedlichen Levels
verfügt, dass ein Client dem Broker
zur Überwachung seiner Anwesenheit
innerhalb des Systems ein Lebenszeichen
oder den letzten Willen (Last
Will and Testament, LWT) senden
kann, mit dem er beim Verlust einer
Verbindung eine «letzte» Benachrichtigung
an andere Clients senden kann.
Und natürlich ist auch eine Sicherheitsarchitektur
in MQTT enthalten,
die eigene Sicherheitsmechanismen
sowie bereits vorhandene Lösungen
unterstützt.
Konfiguration
Wie aber werden die Clients und der
Broker konfiguriert? Nicht wie bei anderen
standardisierten Systemen mit
einem fix definierten Tool, sondern
mit MQTT-fähigen Komponenten
(Chips und Bauteilen) auf den Clients,
auf denen bereits eine MQTT-Applikation
installiert ist. Es gibt dafür ganz
unterschiedliche Hardware. Es sind in
der Regel nicht fixfertige Komponenten,
sondern der Aufbau hat eher etwas
mit Elektronikentwicklung und
Programmierung zu tun. Das gleiche
gilt natürlich auch für den MQTT-
Broker. Auch für ihn kann die unterschiedlichste
Hardware verwendet
werden. So kann die Applikation auf
einem Rasperry-Pie, auf einem Smartphone
oder auf jedem PC oder Linux-
Rechner laufen. HiveMQ zum Beispiel
ist eine sehr bekannte Applikation, die
dafür eingesetzt werden kann und die
auf sehr vielen Plattformen funktioniert.
Die Konfiguration ist dann
«nur» noch reine Programmierarbeit.
Fazit
MQTT ist das Standardprotokoll für
Messaging und Datenaustausch im Internet
der Dinge. Die Technologie bietet
eine skalierbare und kostengünstige
Möglichkeit, Geräte über das
Internet zu verbinden. MQTT ist in
der Lage, Daten über das Internet in
nahezu Echtzeit zu versenden, und bietet
dafür entsprechende Übermittlungssicherheit.
Die Verbindung von
Millionen von IoT-Geräten, das sofortige
Versenden von Updates und die
effiziente, leichtgewichtige und kostengünstige
Übertragung von Daten
sind die Stärken von MQTT. Diese
Einfachheit und die oben aufgeführten
Punkte führen dazu, dass MQTT
immer mehr Verbreitung findet.
Diese Grundlagen aus eTrends liefern
hoffentlich die wichtigsten Kenntnisse,
um beim nächsten Klatsch vor
der Kaffeemaschine mitdiskutieren zu
können.
intelligenteswohnen.com
GNI Fachreport Die Gebäude
Netzwerk Initiative (GNI) ist der
national führende Fachverband
für Gebäudeautomation und
Intelligentes Wohnen (IW). An
dieser Stelle berichtet die GNI
regelmässig über Trends aus dem
Umfeld des Smart Home.
www.intelligenteswohnen.com
Ausgabe 3/19 eTrends
55
Multimedia SOUND SYSTEME
Klangqualität
zu Hause &
im Büro
Ausgezeichnetes Design
Der Revox STUDIOART A100 gewann den
begehrten red dot Design Award 2019.
56 eTrends Ausgabe 3/19
AUTOR: RENÉ SENN
Musik steht für Emotionen, die Vorlieben sind sehr
individuell. Netzwerkbasierende Systeme haben
Hochkonjunktur und sind ein interessantes
Geschäftsfeld für den Multimedia-Fachhandel.
Der Traditionshersteller Revox bringt nun ein
hochwertiges System auf den Markt.
D
er Wunsch nach individuell
zusammengestellter Musik
in den eigenen vier Wänden
ist mehr als nur ein Trend,
und um ihn sich zu erfüllen,
braucht es noch nicht einmal ein Smart
Home. Vor allem im Multimediafachhandel
sind Produkte aus diesem Bereich
mindestens in den letzten zwei
Jahren zu einem wichtigen Bestandteil
des Verkaufsportfolios geworden.
Kaum mehr ein Schaufenster eines
Multimediafachhändlers, in dem nicht
autonome und vernetzte WLAN-
Speaker-Systeme und Bluetooth-Geräte
zu sehen sind. Dieser Trend ist
nicht zuletzt getrieben von Streamingdiensten
wie Spotify, Amazon Music,
Apple Music und vielen, vielen mehr,
aber natürlich auch von den unzähligen
Internet-Radiostationen für alle
möglichen Musikrichtungen aus aller
Welt.
Sound im Geschäft
Basierend auf diesem Trend werden
auch im Business-Umfeld zunehmend
autonome und vernetzte WLAN-
Speaker-Systeme eingesetzt, sei es
beim Coiffeur, im Restaurant, im In-
Café um die Ecke, in der Boutique
oder einfach im Büro. Gerade die Internet-Musikdienste,
die zu einem bestimmten
Genre Musik liefern, sind
sehr beliebt und in Kombination mit
vernetzten WLAN-Systemen eine
deutlich bessere Alternative zu traditionellen
Radiostationen. Nonstop
Musik macht sich in diesem Umfeld
einfach deutlich besser, auch für die
Kunden, als Werbung und Nachrichten
jede volle Stunde. Zudem sind die
Installation und die mögliche Wartung
solcher Systeme bei Geschäftskunden
(B2B) ein ergänzender und willkommener
Service für den Multimedia-
Fachhandel oder den innovativen
Elektroinstallateur. Also, warum nicht
mal diesen Kundenbereich in den Fokus
nehmen?
Qualität und Kompetenz
in der Beratung
Angesichts der Digitalisierung, der
Problematik «Wegwerfgesellschaft»
sowie den aktuellen Klima-Diskussionen
gilt es auch in der IT-Technologie
darauf zu achten, dass langlebige und
hochwertige Produkte eingesetzt werden.
Eine Systemlösung soll daher
«WLAN-
Speaker-Systeme
haben Hochkonjunktur»
auch immer unter dem Gesichtspunkt
der Nachhaltigkeit angeschafft werden.
Zudem kann es für den einen oder
anderen Fachhändler auch interessant
sein, seinen Kunden Produkte anzubieten,
die es nicht in jedem Web-Shop
gibt. Denn gerade dort, wo der persönliche
Kontakt zum Kunden noch wichtig
ist, werden qualitativ hochwertige
Produkte und ausgezeichnete Fachkompetenz
in der Beratung erwartet.
Emotionen und die Sicherheit, in das
richtige Produkt investiert zu haben,
ist dieser Kundengruppe wichtiger als
die Jagd nach dem billigen Produkt,
das nach einer Woche wegen Unzufriedenheit
umgetauscht werden muss.
Sound aus dem Schwarzwald
Angesichts der oben genannten Vorteile
ist es spannend, dass der deutsche
Hersteller Revox nun neben seinem
erfolgreichen Multi-User System ein
Produkt für eine noch weitere Zielgruppe
auf den Markt bringt und damit
das Produktsortiment ideal ergänzt.
Seit mehr als 70 Jahren steht der
Name Revox für Audio-Produkte in
höchster technischer Perfektion, etwa
für das legendäre Tonbandgerät Revox
B77, das auch nach Jahrzehnten noch
als Massstab für Spitzenqualität gilt
und immer noch in ein Revox Multiroom/Multiuser-System
eingebunden
werden kann. Damals wie heute entwickelt
Revox Produkte, die so visionär
und zukunftsorientiert sind, dass
sie aus der Unübersichtlichkeit des
Massenangebots herausragen.
Tonqualität als Versprechen
Musikwiedergabe in originalgetreuer
Studio-Klangqualität ist das besondere
Merkmal der Revox Produkte.
Wer seine Musik zuhause so hören
will, wie sie von den Künstlern im Studio
aufgenommen wurde, ist damit seit
vielen Jahren hervorragend bedient.
Mit der neuen STUDIOART-Serie
bringt Revox nun die markentypischen
Tugenden in die populärsten Produktkategorien,
nämlich in die der vielseitigen,
handlichen und autonomen →
Ausgabe 3/19
eTrends
57
WLAN-Speaker-Systeme und Bluetooth-Geräte.
Aktiver Lautsprecher
Das Bedienfeld
ermöglicht den Zugriff
auf Musikquellen, auch
ohne Revox App. Akkuund
Netzbetrieb sind
möglich.
Aktive Basis
Im Mittelpunkt der neuen Serie steht
der kompakte STUDIOART A100
Room Speaker. Das A steht für «Active»:
Der integrierte Verstärker und
die innovative Technologie bieten ein
einzigartiges Klangerlebnis mit vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten. Bluetooth
verbindet den A100 ohne Umwege
mit dem Smartphone als
Klangquelle. WLAN ermöglicht die
Wiedergabe von Musik aus dem Netzwerk,
und Airplay, die ideale Anbindung
für alle Apple-Geräte, spielt die
Musik direkt ab dem Tablet. Die Streamingdienste
Tidal, Deezer und Spotify
aktiviert man mit Hilfe der Revox
App für STUDIOART. Das Einrichten
ist sehr einfach. Zudem ist die Bedienung
direkt am A100 auch ohne
App möglich – inklusive fünf Presets,
die gespeichert werden können.
Einfach mal mitnehmen
Ein ganz spannendes Detail am STU-
DIOART A100 Room Speaker ist der
integrierte Akku. Er macht den hochwertig
verarbeiteten Lautsprecher
netz unabhängig und sorgt für bis zu
acht Stunden Spieldauer, zum Beispiel
auf der Terrasse, beim nächsten Grillfest,
temporär im Bügelzimmer oder
der Waschküche oder zum Hören von
entspanntem Sound von Antenne Bayern
Chillout in der Badewanne.
STUDIOART
A100 Room
Speaker
Aktiver Lautsprecher mit
höchster Wiedergabequalität
bis 192 kHz/ 24 bit. Integrierte
Bassreflextechnologie.
• H x Ø: 222 mm x 100 mm
• Lautsprecher: 1 x Ø 70 mm
Fullrange
• Frequenzgang: 52 Hz...
20 kHz (-3dB)
• Schalldruck: max. 95 dB / 1 m
• Leistung: 1 x 20W mono,
2 x 20W stereo mit passivem
Zusatzlautsprecher
• Quellen: Analog In (Ø 3,5mm),
Bluetooth, Airplay, DLNA,
iRadio, Tidal, Deezer, Spotify
• Anschlüsse: 1 x 12 V DC/5 A,
1 x Ethernet, 1 x Analog
• Input, 1 x Speaker Output,
1 x USB (Service)
• Akku-Betrieb: min. 8 Stunden
mono, 5 Stunden stereo
Kabellose Funkverbindung
zu anderen STUDIOART
Lautsprechern
Klein anfangen und ausbauen
Bei solchen Streaming-Systemen lohnt
es sich immer, klein anzufangen und
das Basissystem je nach Bedürfnissen
schrittweise zu erweitern. So wächst
auch ein STUDIOART System von
Revox mit den Wünschen seiner Besitzer:
Es lässt sich jederzeit mit einem
weiteren, per Funk verbundenen STU-
DIOART A100 zum Stereosystem
ausbauen. Per WLAN können in anderen
Räumen zusätzliche A100 zum
System hinzugefügt werden. Für die
direkte Verbindung nutzt Revox die
KleerNet Technology, die speziell
für die drahtlose Audio-Konnektivität
entwickelt wurde. Mit dem passiven
STUDIOART P100 steht auch eine
preisgünstige, kabelgebundene Ergänzung
des A100 für eine klangstarke
Stereo-Konfiguration zur Verfügung.
Ideal, wenn zwei Lautsprecher einfach
über ein Kabel verbunden werden sollen.
Wer die Tiefen mag
Optional sorgt das aktive STU-
DIOART B100 Bass Module für eine
eindrückliche Verstärkung des Bass-
Fundaments. Ein B100 wird per Funk
(KleerNet) mit dem A100 verbunden
und ist somit eine besonders
wohnraumfreundliche Lösung. Eine
Verkabelung entfällt, was vor allem die
Nachrüstung deutlich vereinfacht und
zudem die Möglichkeit bietet, das Modul
auch mal an einem anderen Platz
im Wohnzimmer zu platzieren.
Ausblick für den TV
Diese STUDIOART Produkte von
Revox sind sicher nur die ersten Mitglieder
einer spannenden neuen Produktefamilie
des traditionsreichen
Herstellers aus dem Schwarzwald. Mit
der STUDIOART AB100 Audiobar
soll Ende Jahr eine hochwertige, ein
Meter breite Soundbar für den TV, die
mit dem System vernetzt werden kann,
auf den Markt kommen. Mit einer
Leistung von 3 x 35 W (L+C+R) / 4 x
35 W (Subwoofer) und einer Gesamtleistung
von 240 Watt wird sie in Zusammenarbeit
mit zwei A100 Room
Speakern, einem B100 Bass Module
und dem passenden Flatscreen auch im
Wohnzimmer effektvolles Einzelraum
5.1 Surround-Kinoerlebnis bieten.
Dank der netzwerkbasierenden Plattform
dürfte auch die Einbindung in
Smart Home-Systeme und die damit
einhergehenden Vorteile schon bald
verfügbar sein.
58 eTrends Ausgabe 3/19
Multimedia TV TECHNOLOGIE
Hol dir
Kunst
ins Wohnzimmer
AUTOR: RENÉ SENN
In die Röhre glotzen geht
schon seit Jahren nicht mehr,
und auch der TV-Konsum
verändert sich zunehmend
Richtung TV-on-Demand. So
stellt sich die Frage, ob ein
Fernseher nicht einfach nur
schön aussehen kann, wenn
er nicht gebraucht wird.
Ja, er kann.
A
ngesichts der Entwicklung
beim Fernsehkonsum
macht es durchaus
Sinn, sich als TV-Hersteller
über die schwarzen
Kisten im Wohnzimmer innovative
Gedanken zu machen. Samsung
scheint dies bei der Entwicklung seiner
neusten Geräte getan zu haben, wobei
zwei äusserst spannende Serien entstanden
sind. Sie nennen sich The
Frame und The Serif und bieten weit
mehr als nur schwarz, TV, Konsum und
eine hohe Auflösung mit OLED-Display.
Nein, Samsung schafft es, Konsum
mit Kunst zu verbinden.
Stylisch und doch High-Tech
an Bord
Die neueste QLED-Generation der
Lifestyle-TVs The Frame und The Serif
von Samsung sind seit Ende April
im Handel erhältlich. Sie bieten brillante
Bildqualität mit 4K-Auflösung,
100 Prozent Farbvolumen und intelligentem
AI-Upscaling und stellen bei
jeder Helligkeit Farben akkurat dar.
HDR10+ bietet im Vergleich zu High
Dynamic Range (HDR) dynamische
Metadaten für jede Szene und eine
ausgefeilte Kontraststeuerung. Der
sowohl in The Frame als auch in The
Serif integrierte Quantum-Prozessor
4K ermöglicht es, unterschiedliche
Quellinhalte in verschiedenen Auflösungen
mit Szene für Szene verbesserter
Helligkeit, Bild- und Tonqualität
bereitzustellen.
Mehr als nur ein TV
The Frame und The Serif sind mit dem
Sprachassistenten Bixby ausgestattet.
So lässt sich der TV auch bequem per
Sprachbefehl über die Sprachassistenten
von Amazon und Google steuern.
Darüber hinaus sind im Samsung
Smart Hub viele teils kostenpflichtige
Inhaltsanbieter wie Netflix, Amazon
Prime, Apple TV+, Apple Airplay 2
sowie HD+ und Waipu TV bereits integriert,
sodass die Zuschauer über
eine grosse Auswahl an hochwertigen
Inhalten verfügen.
The Frame
The Frame ist in den Bildschirmgrössen
65, 55, 49 und 43 Zoll erhältlich.
Wird der TV, der einem hochwertigen
Bilderrahmen zum Verwechseln ähnlich
sieht, gerade nicht zum Fernsehen
verwendet, verwandelt er sich im Art
Mode in ein Kunstwerk. Er passt Helligkeit
und Farben des Motivs an das
Umgebungslicht an, sodass ein realis-
tischer Bildeindruck entsteht. Um
Energie zu sparen, schaltet sich der TV
mithilfe eines Bewegungssensors automatisch
aus, wenn niemand mehr im
Raum ist. Mit vier verschiedenen, optional
erhältlichen Rahmen, die einfach
anzubringen sind, können Besitzer
ihren The Frame weiter nach ihren
Designvorstellungen anpassen. Zur
Auswahl stehen Varianten in Walnussoptik,
Beige, Weiss und Schwarz. Mit
der Wandhalterung schmiegt sich der
Lifestyle TV wie ein echtes Bild nahezu
lückenlos an die Wand an. Nur
ein einziges Kabel für alle AV-Signale
sowie die Stromversorgung führt vom
Bildschirm zur One Connect Box, in
der alle weiteren Anschlüsse verborgen
sind. Wer den TV nicht an die
Wand hängen möchte, kann den Studio-Stand
erwerben, mit dem The
Frame wie ein Gemälde auf einer Staffelei
frei im Raum aufgestellt werden
kann.
Für Kunstwerke, auch eigene
Im Art Mode, der digitale Kunstwerke
auf dem Bildschirm zeigt, verwandelt
The Frame das Wohnzimmer in eine
Kunstgalerie. Über 100 Kunstwerke
sind beim Kauf bereits in The Frame
enthalten, darunter zehn beliebte zeit-
60 eTrends Ausgabe 3/19
Minimalistisch
Die Kunst ist auch, die
Technik auf ein Minimum
zu reduzieren.
genössische Motive aus der original
Samsung Collection und zehn von Kuratoren
ausgewählte Werke aus der
neuen Sammlung „Alte Meister“ mit
Klassikern von Claude Monet, Camille
Pissarro oder Edgar Degas. Darüber
hinaus sind im Samsung Art
Store mehr als 1000 Kunstwerke verfügbar,
zum Beispiel von renommierten
Galerien und Museen wie dem
Städel Museum in Frankfurt, Saatchi
Art, Magnum oder Lumas. Kunstfans
können den Art Store für vier Monate
kostenlos testen und so auf die gesamte,
wachsende Auswahl zugreifen.
Selbstverständlich ist es auch möglich,
eigene Fotos und Bilder auf The Frame
anzuzeigen. 2 GB Speicher stehen für
etwa 400 Fotos in 4K-Qualität zur Verfügung.
Nutzer können auch eine eigene
Sammlung ihrer Lieblingsbilder
anlegen und sie als Diashow anzeigen
lassen. Jeder Samsung QLED ist vom
VDE für 100 Prozent Farbvolumen
zertifiziert.
The Serif
The Serif begeistert rundum mit seinem
einzigartigen Design und kommt
in zwei unterschiedlichen Farbausführungen
daher. Im Profil gleicht der TV
einem grossen «I» in einer zeitlosen
Serifenschriftart. Die Kabel sind elegant
in den 50 cm hohen Standfüssen
versteckt, sodass sich der TV harmonisch
in die Wohnumgebung einfügt
und von allen Seiten ein Hingucker
bleibt. Im Ambient-Modus ist The Serif
in der Lage, Informationen wie Zeit,
Wetter und aktuelle Nachrichten oder
Inhalte wie persönliche Fotos anzuzeigen.
Darüber hinaus steht eine grosse
Vielfalt dekorativer Motive und passender
Musik zur Auswahl, die es erleichtert,
die Wohnzimmeratmosphäre
nach den eigenen Wünschen zu gestalten.
Mit der praktischen NFC-Funktion
kann The Serif auch als Musikbox
fungieren: Einfach ein kompatibles
Android-Smartphone an das NFC-Tag
am Rahmen halten, und der Fernseher
wird im Ambient-Modus aktiviert. Via
Bluetooth spielt der TV nun die Musik
vom Smartphone über seinen leistungsstarken
Lautsprecher ab.
Smart Home
Gebäudesytemtechnik
eMobility QUER PARKEN
Technische Daten
• Reichweite: 125 km / 200 km
(optional)
• Batterie: 8 kWh / 14.4 kWh
(optional)
• Leistung: 11.5 kW
• Max. Geschwindigkeit: 90 km/h
• Leergewicht: 513 kg
(inklusive Batterie)
• Ladezeit: 1 Stunde (Ladesäule) /
4 Stunden (Haushaltsstecker)
• Kofferraumvolumen: 300 Liter
• Farben: einfarbig: schwarz, weiss
Zweifarbig: blau/weiss, rot/weiss,
orange/weiss, mint/weiss, grau/
weiss, beige/weiss
• Preis: Ab ca. 12 000 Euro
• Dimensionen: Höhe 1,45 m /
Länge 2,43 m / Breite 1,5 m
62 eTrends Ausgabe 3/19
Microlino:
this is
not a car!
Inspiriert von Kabinenrollern aus den
50ern, kombiniert der Microlino die
Vorzüge eines Motorrads mit denen
eines Autos. Er wurde über 10 000-mal
vorbestellt und wird seit Januar 2019
produziert.
Urbane Mobilität
Der Microlino passt
durch alle Gassen und
in jede Parklücke.
«Seit Juni 2019
wird er auch in
der Schweiz
ausgeliefert.»
D
er Microlino wurde als ideales
Fahrzeug für die Alltagsfahrten
zur Arbeit
oder zum Einkaufen entworfen.
Dabei werden im
Schnitt nur 35 km gefahren, weshalb
die Standard-Reichweite von 125 km
mehr als ausreicht. Für den Stadtverkehr
ist auch die Maximalgeschwindigkeit
von 90 km/h hoch genug.
Der Kofferraum bietet Platz für
vier Kisten Bier und enthält einen
Micro-Tretroller, um die letzte Meile
vom Parkplatz zum Ziel zurückzulegen.
Der Microlino kann an einer normalen
Haushaltssteckdose in nur vier
Stunden geladen werden, zuhause ist
keine spezielle Ladestation notwendig.
Dank seiner geringen Grösse lässt er
sich quer parken – durch die Fronttüre
steigt man direkt aufs Trottoir aus. Der
Microlino ist in acht Farben erhältlich
und mit einem Basispreis von 12‘000
Euro zudem eines der ersten bezahlbaren
Elektrofahrzeuge.
Dank der kleinen Batterie, dem geringen
Gewicht und den wenigen verbauten
Teilen verbraucht der Microlino
rund 60 Prozent weniger Energie für
seine Produktion und rund 65 Prozent
weniger während der Fahrt. Energie
sparen war noch nie so einfach!
Verkauft werden die Fahrzeuge
über eigene Flagshipstores, für den
Service konnte Bosch Schweiz als
Partner gewonnen werden. Das Unternehmen
ist an über 70 Standorten
schweizweit vertreten.
Produktion und Vertrieb in Lizenz
Der Microlino wurde speziell für die
dezentrale Produktion entwickelt.
Geplant ist, Lizenzen für die Produktion
und den Vertrieb des Microlinos
zu vergeben, was lokale Arbeitsplätze
schaffen soll. Für eine Lizenzgebühr
ab einem tiefen einstelligen Millionenbetrag
erhalten Lizenzpartner ein
nach europäischen Standards entwickeltes
Fahrzeug und Unterstützung
beim Aufbau der Produktion und der
Distribution. Ferner profitieren sie von
einem weltweit bekannten Brand. Für
einen Bruchteil der ansonsten notwendigen
Investitionen und mit wenig Risiko
lässt sich der Microlino somit
mittels einer Lizenzpartnerschaft im
eigenen Land einführen.
www.microlino-car.com
Ausgabe 3/19 eTrends
63
eMobility SPORTWAGEN
64 eTrends Ausgabe 3/19
Mit Spannung
erwartet
Gegen ihn ist selbst ein neuer Elfer nebensächlich:
Mit dem Taycan beginnt auch für Porsche die Ära der
Elektroautos. Kein Wunder, dass die Schwaben bis
zur letzten Minute testen. Wir haben sie dabei begleitet.
AUTOR: THOMAS GEIGER
M
ehr als zwei Dutzend
Länder, zig Millionen
Kilometer und jede Klimazone,
die sich die Meteorologen
vorstellen
können – Stefan Weckbachs Dienstwagen
sind in den letzten Jahren ziemlich
herumgekommen. Denn der Ingenieur
leitet die Entwicklung des Porsche
Taycan und geht dabei auf Nummer
sicher. Schliesslich ist der Viertürer mit
seiner Silhouette zwischen 911 und
Panamera, mit überraschend viel Platz
im Fond und mit je einem Kofferraum
in Heck und Bug nicht einfach irgendeine
neue Baureihe. Sondern als erstes
Elektroauto der Schwaben soll er dem
Sportwagenhersteller den Weg in eine
neue Ära ebnen und zugleich das
Überleben sichern.
Das Projekt scheint
in trockenen Tüchern
Mit dieser Last auf den Schultern
würde man dem Baureihenleiter sicher
eine gewisse Nervosität nachsehen.
Doch wenn man ihn auf einer seiner
vielen Runden um das Entwicklungszentrum
in Weissach begleitet, wirkt
er entspannt und gelassen. Denn vier
Monate vor der Publikumspremiere
auf der IAA und ein halbes Jahr vor
dem Start der Auslieferungen ist die
Arbeit fast getan und Weckbach mit
seinem Werk zufrieden. «Der Tycan
ist ein echter Porsche geworden»,
schwärmt der Ingenieur, als er mit ihm
geräuschlos wie ein Tarnkappenbomber
im Tiefflug über die Landstrassen
schiesst. Zwar wiegt der Taycan in allen
mittelfristig geplanten Konfiguration
mit grossen oder kleinen Akku-
Paketen, mit mehr Leistung oder
weniger, mit Heck- oder Allradantrieb
immer mindestens 2,5 Tonnen, doch
mit einem Schwerpunkt niedriger als
beim GT3, mit einer adaptiven Luftfederung
und der mitlenkenden Hinterachse
tut er sich auch auf engen, gewundenen
Landstrassen so leicht, dass
Weckbach oft nur mit einer Hand lenkt
und mit der anderen seine Worte unterstreicht.
Zum Beispiel wenn er erzählt,
dass der Taycan sogar noch dynamischer
geworden ist, als er es beim
Debüt der Studie versprochen hat:
Zwei E-Motoren mit zusammen mehr
als 600 PS reichen deshalb für einen
Sprint von 0 auf 100 in weniger als
3,5 Sekunden und treiben den elektrischen
Luxusliner in unter zwölf Seekunden
auf 200 km/h.
eTrends-Experte
Thomas Geiger ist zur
Stelle, wenn es um
Elektromobilität geht.
Ausgabe 3/19 eTrends
65
«Porsche wäre
nicht Porsche,
wenn der Taycan
seine Leistung
nicht immer und
überall bringen
könnte.»
nauso zu einem Porsche wie eine Bevormundung
beim Rekuperieren. Klar,
verzögert auch der Taycan erst einmal
durch die Energierückgewinnung und
beisst die Backen nur dann zusammen,
wenn der Generator alleine nicht genügend
Bremswirkung hat. «Doch wer
bremsen will, soll gefälligst auch das
Bremspedal benutzen», erteilt er dem
weit verbreiteten One-Pedal-Feeling
eine Absage. Dass bei der ganzen Raserei
die Reichweite in den Keller
rauscht, ficht ihn nicht an. Denn erstens
wird der Akku gross genug sein für einen
Normwert von über 500 Kilometern.
Und zweitens ist Porsche schliesslich
auch beim Laden einer der
Schnellsten: Mit der richtigen Säule von
Ionity zapft der Taycan den Strom für
100 Kilometer in vier Minuten.
Doch ein typischer Porsche
Zwar ist der Taycan vom Fahrverhalten
bis zu dem, was man unter der nur
noch leichten Tarnung vom Design
erkennen kann, tatsächlich typisch
Porsche – von den typisch überhöhten
Kotflügeln bis zum durchgehenden
Leuchtenband am Heck. Doch zugleich
macht er mit jedem Blick deutlich,
dass er ein Auto einer neuen Ära
Ein Sportwagen eben
Und Porsche wäre nicht Porsche, wenn
der Taycan diese Leistung nicht immer
und überall bringen könnte: «Solange
genug Strom im Akku ist, sind diese
Ergebnisse auch reproduzierbar. Und
zwar nicht einmal oder zweimal, sondern
immer und immer wieder», sagt
Weckbach, aktiviert heimlich die
Launch-Control und zwingt die Mitfahrer
mit einem Kickdown zum Headbanging.
So einen Punch bietet nicht
einmal ein 911 Turbo, und so geräuschlos,
wie sich diese Kraft entfaltet, wirkt
sie noch einmal imposanter. Würde er
auf dem Pedal stehen bleiben, müsste
er die Arbeit am Cross Tourismo als
erstem Derivat der intern J1 genannten
Baureihe zwar womöglich den Kollegen
überlassen und stattdessen mit dem
Bus zur Arbeit fahren. Mit dem Effekt,
dass der Taycan sicher nicht bis Ende
nächsten Jahres fertig würde. Dennoch
könnte er sich zumindest kurzfristig als
Spitzenreiter unter den Stromern fühlen.
Denn wo Audi und Mercedes ihre
Akku-Autos meist bei spätestens 180
abregeln, verspricht er für das Taycan-
Top-Modell Geschwindigkeiten um die
250 km/h. Eine freiwillige Selbstbeschränkung
passt für Weckbach geist.
So funkeln aus dem neuen Gesicht
freistehende Projektionsscheinwerfer
und die typische Dachlinie, die in einem
ausfahrbaren Spoiler ausläuft, hat
einen neuen Twist. Vor allem innen
macht der Taycan noch einmal einen
riesigen Sprung und lässt selbst den
neuen Panamera ziemlich alt aussehen:
Wenn Weckbach die Tarnmatten
kurz lupft, sieht man zwar weiterhin
ein auf den Fahrer ausgerichtetes
Cockpit und ein konventionell bestücktes
Lenkrad. Doch die Instrumente
werden zu einem freistehenden,
leicht gebogenen Bildschirm, es gibt
kaum mehr Schalter oder Taster, und
selbst die Klimaausströmer steuert
man vom Touchscreen aus. Ausserdem
darf sich erstmals auch der Beifahrer
auf einen eigenen Bildschirm freuen.
Aber so neu die Welt in dem Wagen
auch sein mag, gibt es bei Porsche eine
Konstante, die auch für den Taycan
gilt: Das Zündschloss ist links vom
Lenkrad – selbst wenn es jetzt nur
noch ein Startkopf ist, den man eigentlich
gar nicht mehr braucht. Denn die
Zukunft von Porsche ist nach dem Einsteigen
automatisch startklar.
www.porsche.com
VOM MITARBEITER
ZUM PROJEKTLEITER.
Unsere Profis bringen Ihnen die nötigen Skills bei und versorgen
Sie mit viel Praxiswissen, das Sie in Ihrem Berufsalltag direkt
einsetzen können.
JETZT
ANMELDEN!
Projektleiter
Installation & Sicherheit
ab 14.10.2019 (7 x 3 Wo.)
www.stfw.ch | T 052 260 28 00
Projektleiter
Gebäudeautomation
ab 04.05.2020 (Do ganztags)
FLEXIBILITÄT
TOTAL
SMART HOME AND BUILDING SOLUTIONS.
GLOBAL. SECURE. CONNECTED.
Der Standard:
einfach, unabhängig,
für alle Gewerke
Offene Architektur:
modular, flexibel, skalierbar
Hochwertiges System:
intuitiv, effizient
programmiert, sicher
Neuste Technologie:
vernetzt für IoT und BIM
Join us
www.knx.ch
SWISS ADV-210x142-CO-07 Kopie.indd 5 09.10.18 15:14
DAS NEUE
FACHMAGAZIN
Erfahren Sie alles über die
neusten Innovationen und
Trends aus den Bereichen
Elektrotechnik · Smart
Building · Multimedia ·
ICT/IoT · Licht · eMobility
Abonnieren
Sie jetzt!
Bestellen Sie jetzt ein
Jahres-Abo mit 6 Ausgaben
für CHF 75.– unter
www.etrends.ch/abo
Basiswissen NACHWUCHS SCHÜTZEN
Das menschliche Gehirn
Präfrontaler Cortex (rot)
AUTOR: THOMAS
HAUSHERR
Prävention
von Elektrounfällen
bei
Lernenden
30 Prozent der Elektrounfälle betreffen Lernende.
Mehr als 300 Unfälle hätten 2018 mit der Einhaltung
der fünf lebens wichtigen Regeln für spannungsfreies
Arbeiten verhindert werden können. Aus Zeitdruck
werden sie oft vernachlässigt.
G
emäss Verordnung zum Arbeitsgesetz
(ArGV) muss
der Arbeitgeber dafür sorgen,
dass die Jugendlichen
in seinem Betrieb in Bezug
auf Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz von einer befähigten
Person ausreichend und angemessen
informiert und angeleitet werden (Art.
19 ArGV 5).
Drei Gründe für Elektrounfälle
von Lernenden
Nicht wahrgenommene
Verantwortung
Detaillierte Abklärungen bei Unfällen
mit Lernenden haben gezeigt, dass
der Mitarbeiter häufig seine Verantwortung
gegenüber den ihm zugewiesenen
Lernenden nicht kennt. Wird ein
Lernender einem Mitarbeiter zugewiesen,
übernimmt der Mitarbeiter die
Verantwortung für den Lernenden
und hat ihm gegenüber eine Aufsichtspflicht.
Verunfallt ein Lernender bei
der Arbeit, so trägt der Mitarbeiter
mindestens eine Teilschuld. Jeder Mitarbeiter
ist für die Sicherheit der Lernenden
verantwortlich, nicht nur der
Berufsbildner im Betrieb. Lernende
beobachten genau, wie die Kollegen
mit Vorschriften und Regeln umgehen,
und passen sich schnell der gelebten
Unternehmenskultur an. Umso
wichtiger ist es, dass im Ausbildungsbetrieb
eine solide Sicherheits- und
68 eTrends Ausgabe 3/19
Arbeitskultur herrscht. Die Arbeitsweise
des Lernenden muss auch bei
einfachen Routinearbeiten periodisch
überprüft werden.
Ungenügende Instruktion
und Schulung
Der Berufsbildner und der Mitarbeiter
sind verpflichtet, die Lernenden auszubilden
und zu schulen. Zudem sind
ihnen klare, verständliche Aufträge zu
erteilen, für die sie vorgängig instruiert
werden müssen.
Die Ausbildung im Lehrbetrieb
muss der Arbeitssicherheit hohe Priorität
einräumen. Die Lernenden müssen
lernen, die Gefahren der täglichen
Arbeit zu erkennen. Sie müssen in der
Lage sein, geeignete Massnahmen einzuleiten,
um die Gefahren zu beseitigen.
Den Lernenden muss beigebracht
werden, bei Unsicherheiten STOPP zu
sagen und umgehend ihren Vorgesetzen
zu orientieren. Vorgesetze (Mitarbeiter)
besprechen die Situation mit
den Lernenden und treffen Massnahmen
für ein sicheres Arbeiten. Wird
bei einer Arbeit eine PSA (persönliche
Schutzausrüstung) benötigt, so ist der
Mitarbeiter dafür verantwortlich, dass
der Lernende weiss, wie sie richtig anzuwenden
ist und dies auch tut.
Mangelhafte Arbeitsvorbereitung
Dass Lernende verunfallen, hat oft
auch mit einer ungenügenden Arbeitsvorbereitung
seitens des Vorgesetzten
zu tun.
Fakten zum jugendlichen Gehirn
Auf einer Grossbaustelle herrscht
beim Innenausbau kurz vor der Fertigstellung
meist ein grosses Durcheinander.
Jeden Tag müssen Probleme gelöst
und Installationen angepasst oder geändert
werden. Plötzlich hat der Kunde
ebenfalls noch Wünsche, die irgendwie
in der verbleibenden Zeit bis zur
Eröffnung noch erfüllt werden müssen.
Wichtige Details gehen vergessen.
Der Tag verläuft häufig nicht wie geplant,
weil einzelne Konstruktionen
noch nicht fertig sind oder die Farbe
an den Wänden noch nicht trocken ist.
Ähnlich wie auf einer Grossbaustelle
sieht es im Gehirn eines Jugendlichen
während der Pubertät aus. In dieser
Zeit verändert sich das Gehirn sehr
schnell. Als Letztes wird die oberste
Kommandozentrale (Innenausbau
kurz vor der Vollendung) umgebaut,
der präfrontale Cortex, der Frontallappen
der Grosshirnrinde. Diese
Hirnregion ist für die Steuerung von
Aufmerksamkeit, Entscheidungen sowie
für die Planung oder das Abschätzen
der Folgen einer Handlung zuständig.
Er steuert auch die Emotionen.
Diese Baustelle im Gehirn führt auch
zu den zum Teil impulsiven Handlungen
der Jugendlichen. Der Umbau dieser
Hirnregion ist erst zwischen dem
20. und 25. Lebensjahr abgeschlossen.
Aufgrund der Hirnentwicklung bei
Jugendlichen besteht die akute Gefahr,
dass Lernende unüberlegt handeln
oder risikoreich arbeiten. Deshalb
muss ihre Arbeitsweise häufig
überprüft werden.
Umgang mit Lernenden –
Vorbildfunktion der Mitarbeitenden
Nicht nur das jugendliche Gehirn befindet
sich in der Lehrzeit im Umbruch,
sondern auch die Jugendlichen
selbst. Sie sind durch den Übergang
von der Schule ins Arbeitsleben mit
zahlreichen neuen Herausforderungen
konfrontiert und nicht unerheblichen
Belastungen ausgesetzt.
«Nie mehr
im Leben wird
ein Mensch
so fasziniert
sein von einem
anderen
Menschen
wie in der
Jugendzeit.»
Hirnforscher und
Neuropsychologe
Lutz Jäncke
Wie kann ich als Mitarbeiter und Vorgesetzter
den Jugendlichen faszinieren?
Ich muss versuchen, ihm jederzeit
ein Vorbild zu sein. Jugendliche suchen
Vorbilder und möchten sie nachahmen.
Die Lernenden erwarten von
mir eine motivierte, positive und qualitätsbewusste
Einstellung. Jugendliche
brauchen klare Grenzen – die sie
sofort zu überschreiten versuchen.
Geschieht dies, so muss ich darauf sofort
freundlich, aber bestimmt reagieren.
Wichtig ist auch, die Freude an
den Lernfortschritten mit den Jugendlichen
zu teilen und sie immer stärker
für den zu erlernenden Beruf zu begeistern.
Fazit: Wie können Unfälle von
Lernenden verhindert werden?
Lernende arbeiten risikoreicher, weil
sie sich der Risiken noch zu wenig bewusst
sind. Dies hat auch mit ihrer
Hirnentwicklung, bzw. Hirnreifung zu
tun, die erst im Alter von 25 Jahren
abgeschlossen ist. Die Jugendlichen
können die Konsequenzen ihres Handelns
noch nicht einschätzen. Sie reagieren
auch auf Störungen wie Handytöne,
Lärm usw. viel intensiver und
lassen sich viel schneller ablenken.
Arbeitssicherheit vom ersten Tag
an thematisieren
Wenn junge Menschen ins Berufsleben
starten, sind sie unerfahren. Deshalb
ist es wichtig, ihnen gleich von Anfang
an die Bedeutung des Arbeitsschutzes
klarzumachen – damit Unfälle gar
nicht erst passieren.
Die Ausbildung, bzw. Sensibilisierung
der Lernenden für die Arbeitssicherheit
vom ersten Tag an führt zu
einer besseren Risikowahrnehmung
und ist ein wichtiger Baustein der Unfallprävention.
Die Lernenden müssen
vom ersten Arbeitstag an mit der geeigneten
Schutzausrüstung ausgerüstet
und geschult werden. Als Vorgesetzter
und Mitarbeiter achte ich
konsequent auf die Einhaltung des
Arbeitsschutzes bei mir und bei den
Lernenden. Arbeitsaufträge in kleine
Teilaufgaben unterteilen. Diese Teilaufgaben
klar und verständlich erläutern.
Eine regelmässige Überprüfung
der Arbeiten der Lernenden, insbesondere
bezüglich des Arbeitsschutzes,
hat höchste Priorität. Der Umbau
im Gehirn führt dazu, dass Lernende
auch einfache Arbeiten nach kurzer
Zeit verlernen können. Sich der →
Ausgabe 3/19 eTrends
69
Literatur
Eidgenössisches Starkstrominspektorat
ESTI. «Elektrounfälle
2017» in Bulletin SEV/VSE
10/2018. S. 2 - 4
SECO. Jugendarbeitsschutz.
Informationen für Jugendliche
bis 18 Jahre. 2014
Zähringer, Monika. Gesundheitsfördernde
Massnahmen in der
Ausbildung. Eine Bedarfsanalyse.
2016
Rechtsquellen
Bildungsplan zur Verordnung
über die berufliche Grundbildung
für Elektroinstallateurin EFZ /
Elektroinstallateur EFZ / Anhang
2: Begleitende Massnahmen der
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
(Checkliste)
EKAS Richtlinie 6508 (Anhang I)
• SNG 491000 – 4052a Lernende
und Arbeiten unter
Spannung (AuS 1) in Niederspannungsanlagen
• SR 822.113 Verordnung 3 zum
Arbeitsgesetz (Gesundheitsschutz,
ArGV 3)
• SR 822.115 Verordnung 5 zum
Arbeitsgesetz (Jugendarbeitsschutzverordnung,
ArGV 5)
• 822.115.2 Verordnung des WBF
über gefährliche Arbeiten für
Jugendliche
• SR 832.20 Bundesgesetz über
die Unfallversicherung (UVG)
• SUVA 84042 5 + 5 lebenswichtige
Regeln im Umgang mit
Elektrizität
Verordnung des SBFI über die
berufliche Grundbildung Elektroinstallateurin/Elektroinstallateur
mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis
(EFZ)
Electrosuisse Fachreport
Als neutraler Fachverband bietet
Electrosuisse erstklassige
Dienstleistungen und Produkte
rund um Beratung, Normung und
Weiterbildung an.
www.electrosuisse.ch
Instruktion lohnt sich Um Unfälle zu vermeiden, müssen Lernende
bei der Arbeit jederzeit angeleitet und kontrolliert werden
Verantwortung gegenüber den Lernenden
bewusst werden. Der Berufsbildner
ist für die Ausbildung im Lehrbetrieb
verantwortlich. Wird ein
Lernender einem Mitarbeiter zugeteilt,
so trägt dieser die Verantwortung,
vor allem für den Bereich der
Arbeitssicherheit. Dies bedarf eventuell
einer Instruktion oder Sensibilisierung
des Mitarbeiters durch den Berufsbildner.
Keine Arbeiten unter
Spannung. Lernende dürfen bis zum
überbetrieblichen Kurs 3. Lehrjahr
(ÜK 3) keine Arbeiten unter Spannung
(AuS 1) ausführen. Sie arbeiten
nur an Anlagen und Installationen, die
nach den fünf Sicherheitsregeln für
spannungsfreies Arbeiten ausgeschaltet
sind und die sie selbst unter Anleitung
und Überwachung des Vorgesetzten
auf Spannungslosigkeit überprüft
haben. Alle haben eine Vorbildfunktion.
Mitarbeiter in Betrieben mit Lernenden
müssen jederzeit ein Vorbild
sein. Eine professionelle, positive und
motivierende Einstellung der Mitarbeiter
am Arbeitsplatz überträgt sich
sehr schnell auf die Lernenden. Das
positive Arbeitsklima fördert das
Qualitätsbewusstsein und trägt massgeblich
zur Unfallverhütung bei.
Elektrounfälle von Lernenden
können nur verhindert werden,
wenn die ganze Firma keine
Improvisationen zulässt und jeder
und jede versucht, dem Lernenden
ein Vorbild zu sein.
70 eTrends Ausgabe 3/19
Basiswissen NORMEN-FRAGEN
Prüfe dein
Normen-
Fachwissen
Fragen und Antworten zur NIN SN 411000
und anderen Normen.
Mit freundlicher Unterstützung von Electrosuisse
Frage 1:
Gilt eine 4-polige CEE-Industrie-Steckdose
als freizügig
verwendbar?
Frage 2:
Warum ist das Aluminium-Seil
als Fundamenterder nicht in
den NIN aufgeführt?
Frage 3:
Weshalb ist die Aufstellhöhe
in m.ü.M. von z.B. Leistungsschaltern
begrenzt?
Antwort 3:
«Oben ist die Luft dünner» –
bei Aufstellhöhen über
2000 m.ü.M sind die Isolationsund
Kühleigenschaften der
Luft reduziert. Deswegen
machen die Hersteller Angaben
für Aufstellhöhen auf über
2000 m. Typischerweise gelten
dabei geringere Spannungen
oder reduzierte Abschaltvermögen.
EN 60497-xx und Angaben des
Herstellers
Antwort 2:
Wegen der elektrochemischen
Spannungsreihe würden
Korrosionsprobleme
entstehen! Zwischen Eisen
(– 0.45 V) und Aluminium
(–1.66 V) entstehen 1.21 V.
Bei Spannungen ab 700–
800 mV sind Korrosionsprobleme
zu erwarten. Deswegen
ist Aluminium als Erdermaterial
nicht zulässig. Geeignete
Erdermaterialien sind: Stahl
(verzinkt), nichtrostender
Stahl und Kupfer.
SNR 464022 und SNR 464113
Antwort 1:
Die freizügige Verwendung
von Steckdosen bezieht sich
auf das Steckerbild und nicht
auf die Anzahl Pole. CEE-
Industrie-Steckdosen, bei
welchen der Schutzleiterkontakt
auf 6 h positioniert ist, gelten
demzufolge als freizügig
verwendbar.
2 4.1.1.3.3 und
SNG 491000-2076a
Hinweis: Die Nummern sind die Quellen der jeweiligen Dokumente für weitere Informationen.
Ausgabe 3/19 eTrends
71
Basiswissen ERDUNGSSYSTEME
In welchen Fällen
braucht es einen
Ringerder?
M
inergie-Häuser, die im
Vergleich mit herkömmlichen
Bauten weniger als
die Hälfte an Heizenergie
verbrauchen, müssen
nicht nur überirdisch wärmegedämmt
werden, sondern auch unter der Bodenplatte
und an den Wänden im Erdreich.
Und bekanntlich sind wärmeisolierende
Stoffe sehr schlechte elektrische
Leiter.
Wärmegedämmte Fundamente
Die SNR 464113:2015 «Fundamenterder»
fordert, dass bei wärmegedämmten
und somit elektrisch isolierten
Fundamenten oder bei Fundamenten,
die gegen das Eindringen von Wasser
speziell abgedichtet sind, ausserhalb
dieser Dichtung ein erdfühliger Ersatzerder
zu verlegen ist. Solche Ersatzerder
bestehen aus Kupfer oder
nichtrostendem Stahl und sollen möglichst
als geschlossene Ringerder erstellt
werden. Ist dies nicht möglich,
müssen Strahlen- oder Tiefenerder
verwendet werden. In diesen Fällen
dient nicht das Fundament, sondern
der Ringerder als «Erdelektrode». Die
Bewehrung im Fundament wird jedoch
in den Potenzialausgleich einbezogen
und dient oft als «Potenzialausgleichs-Schiene».
Thematik weisse Wanne – «wasserdichter»
Beton
Weisse Wannen werden dort erstellt,
wo das Fundament bis unter den
Grundwasserspiegel reicht. Es ist
dann oft nicht klar, ob die Wannen
nicht nur wasserdicht, sondern auch
elektrisch isolierend sind und ob auch
Fundamente von hoch isolierten
Gebäuden, beziehungsweise von
wärmegedämmten Bodenplatten
und Fundamenten haben häufig
keinen Erdkontakt mehr. Es muss
also ein zusätzlicher Erder im
Erdreich verlegt werden.
AUTOREN: JOSEF SCHMUCKI, DR. MARKUS BÜCHLER
ein «aussenliegender» Ersatzerder erforderlich
ist. Dabei gilt es Folgendes
zu berücksichtigen: Der elektrische
Widerstand von Beton ist von gewissen
Randbedingungen abhängig, genauso
wie derjenige des Bodens. Die
wichtigste Einflussgrösse ist die Betonfeuchtigkeit.
Der Boden bleibt
selbst in sehr trockenen Sommern ab
einer Tiefe von ca. einem Meter feucht.
Und eine weisse Wanne, bei der drückendes
Wasser ansteht, reicht meist
tiefer als einen Meter ins Erdreich.
Somit bleibt die Wassersättigung der
Kapillarporen des Betons hoch.
Massgebend ist die elektrische
Isolation
Bei weissen Wannen kann deshalb aufgrund
der hohen Bodenfeuchtigkeit
von minimalsten elektrischen Widerständen
ausgegangen werden. Aus dem
Bereich des Streustromschutzes ist zudem
bekannt, dass mit Beton keine
wirksame elektrische Isolation von
Fundamenten erreicht werden kann,
sondern nur mit sehr hohem technischem
Aufwand mit dielektrischen
Materialien wie z.B. mit praktisch fugenlos
verlegten Wärmedämmungen
oder verschweissten Abdichtungen.
Bei weissen Wannen ist also nicht
mit erhöhtem Betonwiderstand zu
rechnen, weil sie wie erwähnt normalerweise
in feuchtem Boden stehen
und somit niedrigste Betonwiderstände
aufweisen, die durchaus vergleichbar
sind mit den Werten des
Erdbodens.
Die Schlussfolgerung, dass mit einer
weissen Wanne erhöhte Werte zu erwarten
sind, treffen aus folgenden
Gründen nicht zu:
72 eTrends Ausgabe 3/19
1. Der einzige Unterschied zwischen
einer weissen Wanne und einem normalen
Fundament ist, dass sie keine
Risse und Poren aufweisen. Dies wird
üblicherweise durch eine erhöhte Bewehrungsdichte
erreicht. Mit geeigneten
Zusatzstoffen kann die Riss- oder
Luftporenbildung verringert oder behindert
werden. Die Anzahl an Kapillarporen
wird jedoch nicht verringert.
Insbesondere in feuchtem Boden bleiben
die Kapillarporen stets wassergefüllt,
und die Stromdurchlässigkeit
bleibt erhalten – der Betonwiderstand
wird nicht relevant verändert.
2. Die Leitfähigkeit von Beton beruht
weder auf Rissen noch auf von aussen
eingedrungenem Wasser. Vielmehr ist
sie das Ergebnis der in den feinen Kapillarporen
enthaltenen alkalischen
und hygroskopischen Porenlösung.
Selbst an der Luft kann Beton daher
nicht vollständig austrocknen und
bleibt leitfähig. Dies ist der Grund für
die seit Jahrzehnten weit verbreitete
Anwendung von kathodischem Korrosionsschutz
bei Hochbauten. Dieser
funktioniert, weil der Beton selbst an
der Luft elektrisch leitfähig bleibt. Es
zeigt sich, dass in nassem Beton bei
hoher Feuchtigkeit, wie sie bei weissen
Wannen besteht, mit geringsten elektrischen
Widerstandswerten zu rechnen
ist. Da der Widerstand durch die
Kapillarporen und nicht durch die
Luftporen oder Risse bestimmt ist,
wird der erwartete Widerstand des Erders
nur beschränkt vom Beton beeinflusst.
3. Die meisten Fundamente sind oberhalb
des Grundwasserspiegels verlegt.
Es kann folglich kein Wasser in die
möglicherweise vorhandenen Risse
oder Poren eindringen. Es wird immer
eine Sauberkeitsschicht eingebaut.
Selbst wenn sie oberhalb des Grundwassers
liegt, führt dies erfahrungsgemäss
nicht zu Problemen mit der Erderwirkung
von Fundamenterdern.
Beton ist ein guter, mit dem Erdreich
vergleichbarer elektrolytischer
Leiter. Dies gilt für sämtliche Betonmischungen
und auch für die meisten
Kunststoffmörtel, insbesondere wenn
sie im Grundwasser stehen. Die erfolgreiche
langjährige Anwendung von
Fundamenterdern zeigt dies deutlich.
Fazit
Weil praktisch alle Arten von Beton
ähnlich gute elektrische Leiter sind,
müssen zusätzliche erdfühlige Ringerder
lediglich bei wärmegedämmten
Fundamenten oder Bodenplatten erstellt
werden.
www.electrosuisse.ch
www.sgk.ch
Josef Schmucki, ist Projektleiter bei
Electrosuisse und Mitglied des TK 64
des CES. Er arbeitet auch in verschiedenen
nationalen und internationalen
Technischen Komitees bei IEC und
Cenelec mit.
Dr. Markus Büchler, Dipl. Werkstoffing.
ETH/STV ist Geschäftsführer
der SGK Schweizerische Gesellschaft
für Korrosionsschutz.
1 Erdungsanschluss für
Potenzialausgleich
2 Verbindung Anschlussstelle –
Fundamenterder
3 Erdelektrode (Ersatzerder)
4 Isoliertes (wärmegedämmtes)
Fundament
5 Kontrollschacht
Ausgabe 3/19 eTrends
73
Basiswissen MINERGIEMODUL
GNI Fachreport Die Gebäude
Netzwerk Initiative (GNI) ist der
national führende Fachverband
für Gebäudeautomation und
Intelligentes Wohnen (IW). An
dieser Stelle berichtet die GNI
regelmässig über Trends aus dem
Umfeld des Smart Buildings.
www.g-n-i.ch
Es wäre so einfach
AUTOR: RENÉ SENN
Die GNI hat 2012 mit dem Minergiemodul Raumautomation ein
Hilfsmittel für Planer und Integratoren geschaffen. Belimo und
Priva ergänzen nun die Auswahl verfügbarer Module.
D
amals war es ein wirkliches
Novum: Mit dem Minergiemodul
Raumkomfort der
GNI wurde erstmals in der
Geschichte von Minergie
ein Modul vorgestellt, das neben der
Hardware auch eine gewisse Logik
oder Software verlangte. Das war bei
den Modulen für Fenster, Türen usw.
nicht der Fall gewesen, hier ging es
immer um Konstruktion, sprich um
die Hardware, und nicht um die Software.
Minergie zur Standardisierung der
Ausführung
Das von der GNI betreute Minergiemodul
Raumkomfort definiert die
Sensorik und Logik, also die Funktionalität,
und die Aktorik sowie die
Stellglieder und eignet sich deshalb für
Anwendungen in üblichen Ein- und
Mehrfamilienhäusern sowie in vergleichbaren
Nutzungen wie Zimmern
von Heimen oder Hotels. Ganz spannend
ist es auch für Nachrüstungen in
bestehenden Bauten.
Für Planer geschaffen
Es wäre so einfach: Bei Ausschreibungen
ein System gemäss Minergiemodul
Raumkomfort fordern – und schon
sind alle wichtigen Bauteile, die Funktion
und die Anforderungen an eine
energieeffiziente Raumautomation
exakt dokumentiert und reglementiert.
Das Modul garantiert die Qualität
der Bauteile und definiert auch den
Eigenverbrauch des Systems. Denn
Systeme müssen nicht wenig Energie
verbrauchen, sondern auch gebrauchs-
74 eTrends Ausgabe 3/19
tauglich, mechanisch fest, wartungsfreundlich
und wirtschaftlich sein. Die
Vorgaben geben auch Hinweise zur
Bedienung durch den Endnutzer, und
auch die Inbetriebnahme mit Abnahmeprotokoll
ist Teil des Moduls und
damit geregelt. Der Planer kann somit
neutral ausschreiben, bei gleichbleibender
Funktionalität.
Schulung als Basis
Ein System funktioniert immer nur so
gut, wie es installiert und konfiguriert
wurde. Ein wichtiger Bestandteil des
Minergie-Zertifikats, das an die Hersteller
von Raumautomations-Systemen
vergeben wird, ist deshalb auch
der Nachweis der anwendungsbezogenen
Schulung der Systeminstallateure.
Jeder Hersteller muss belegen, dass er
seine Partner für die Installation und
Konfiguration der Systeme ausbildet.
Ebenfalls Teil dieser Ausbildung sind
die Grundlagen von Minergie und die
wichtigsten Informationen zum Minergiemodul
Raumkomfort.
Neue Anbieter kommen dazu
Priva Schweiz AG und Belimo Automation
AG, spezialisiert auf Gebäudeautomatisierung,
haben die Minergie-Zertifizierung
des iHome Lab der
Hochschule Luzern und der Gebäude
Netzwerk Initiative (GNI) gemeinsam
erhalten. Das komplette Priva Blue ID
Sortiment sowie die Priva Sensoren
und Belimo Stellglieder entsprechen
den Minergie-Normen und sind nach
anerkannten Vorschriften hergestellt.
Eine ganze Bibliothek von Priva Regelmodulen,
Anlage- und Funktionsmakros
unterstützt die Umsetzung von
Minergie-Lösungen. Heizung, Kühlung,
Lüftung, Beleuchtung und Sonnenschutz
werden nach Bedarf exakt
aufeinander abgestimmt. An der Ausbildung
vom 28. Mai, die bei Belimo
in Hinwil stattfand, wurden die ersten
Priva-Systeminstallateure über die
Grundlagen des Moduls sowie über
die korrekte Installation und Konfiguration
informiert.
Zertifizierte Systeme stehen nun von
folgenden Anbietern zur Verfügung:
Siemens Schweiz AG, Kieback&Peter,
ABB Schweiz AG, Sauter AG, Loxone,
Theben HTS und Priva/Belimo.
www.g-n-i.ch
www.minergie.ch
Ausgabe 3/19
eTrends
Schwer zu erreichen?
Reeltech Liftsysteme bringen Leuchten,
Werbebanner und Dekomaterial auf Arbeitshöhe
Mini-Type Leuchten-Lifte
Die perfekte Lösung für den
Office- und Heimbereich.
Rotorlifte
Setzen Sie Ihre Werbebanner,
Dekomaterial oder Ausstellungsobjekte
perfekt in Szene.
Wartungsfrei
Keine regelmässige Prüfpflicht
Maximale Sicherheit
Reinigung und Wartung der Leuchte
im stromlosen Zustand
Äusserst kompakt
Geringe Abmessungen und Mindestlasten
Für Lichtsteuerungen geeignet
Multikontakt-Ausführungen für komplexe
Anforderungen wie DALI-Steuerungen
oder Sicherheitsleuchten
Fernbedienung RCU
Mit einer Fernbedienung können bis zu
999 Leuchten-Lifte angesteuert werden.
Mehr Informationen zu den
Produkten finden Sie in
unserer Broschüre!
Generalvertretung für die Schweiz:
REEL TECH
Leuchten-Lifte
Leuchten-Lifte Compact-Type
Die Lösung für Hallenreflektoren,
Bühnenstrahler im Eventbereich
oder für mittelschwere Leuchten
wie in Foyers oder Kirchen.
Demelectric AG • Steinhaldenstrasse 26 • 8954 Geroldswil
Telefon +41 43 455 44 00 • Fax +41 43 455 44 11
info@demelectric.ch • www.demelectric.ch
Bezug über den Grossisten. Verlangen Sie unsere Dokumentation.
D32
D32
AWAG
IN DER NOT
SICHTBAR, IM
ALLTAG DEZENT
Die universell einsetzbaren Einzelakku-LED-Notleuchten
sind ideal für
Installationen in Gewerbebauten,
Mehrfamilienhäusern und Tiefgaragen
– aber auch für den Einsatz in architektonisch
anspruchsvollen Umgebungen
wie einem Kunstmuseum.
Genauso vielfältig sind auch die praktischen
Vorteile: Die Leuchten können
auf drei Arten montiert werden, bestechen
mit ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis
und sind schnell und einfach
installiert. AWAG bietet auch ein qualitativ
hochstehendes, breites Sortiment
an Rettungszeichen und Sicherheitsleuchten.
AWAG Elektrotechnik AG
8604 Volketswil
www.awag.ch
DIE GEBÄUDEAUTOMATION
Edanis
STECKDOSEN IM HAFEN
FREIGEBEN UND SPERREN
Wie eine clevere Gebäudeautomation
auch in einem Jachthafen dem Hafenmeister
die Arbeit erleichtern kann.
Wie eine clevere
Gebäudeautomation
auch in einem Jachthafen
dem Hafenmeister die
Arbeit erleichtern kann.
Mit Gebäudeautomation hat dieses
Projekt zwar nicht viel zu tun, es ging
vielmehr darum, die Elektro-Steckdosen
an den Jacht-Liegeplätzen zu steuern.
Denn der Hafenmeister wollte die
Kontrolle darüber zu haben, welcher
Jachtbesitzer Strom bezieht. Nun kann
er von seinem Büro aus die Steckdose
an jedem Liegeplatz einzeln ein- oder
ausschalten, Missbrauch ist ausgeschlossen
und das Unfallrisiko erheblich
reduziert. Eine hervorragende
Lösung!
EDANIS Elektronik AG
8575 Bürglen
www.sigmalon.ch
DIE GEBÄUDEAUTOMATION
Referenz: Jachthafen
Plattform
FI-Schutzschalter
Licht-Schnittstelle
zwischen DALI und KNX
Vom Typ A und F: Nebst FI-Schaltern mit einer Kurzschlussfestigkeit
von 6 kA (in Verbindung mit einer Vorsicherung) bietet
Hager neu ein FI-Schutzprogramm von 16 bis 125 A mit hoher
Kurzschlussfestigkeit von 10 kA an. Es ist dank Bi-Connect-
Klemmen mit Phasenschienen durchgängig verschienbar
und mit Zusatzeinrichtungen wie Hilfsschaltern kompatibel.
Ebenfalls neu im Sortiment sind Fehlerstromschutzschalter
des Typs F. Sie schützen bei Fehlerströmen mit Mischfrequenz,
die bei einphasigen Verbrauchern mit Frequenz-Umrichtern
entstehen können.
www.hager.ch
Intelligent: Das KNX/DALI-Gateway Tunable White von
Eelectron verbindet ein DALI-Lichtsystem mit der KNX-Installation.
Es schaltet und dimmt bis zu 64 Leuchten mit sechs
unterschiedlichen Adressierungsmodi einzeln oder in bis zu
32 Gruppen. Neben der Lichtintensität regelt das Gateway
bei DALI-Devices vom Typ 8 auch die Farbtemperatur von
Warm- bis Kaltweiss (1000 bis 10 000 K). Zudem steuert es
bis zu 16 Lichtszenen und Effekte und bietet programmierbare
Dimmzeiten sowie Sperrfunktionen für jede Gruppe.
www.inyx.ch
TWILINE erobert den
Audiobereich
Leuchtende Werbedisplays
Ein guter Tag: Mit einem simulierten Sonnenaufgang
und angenehmer Musik im Schlafzimmer aufzuwachen, ist
optimal. TWILINE koppelt SONOS und neu auch Bose Sound-
Touch. Die Anlage kommuniziert per Sprachdurchsagen: Ein
«Guten Tag» beim Aufstehen oder ein «Achtung, Fenster offen»
beim Abmelden erhöhen das Wohlbefinden und die Sicherheit.
Das System übernimmt Verantwortung, führt die Funktionen
entweder selbst aus oder erinnert den Bediener an kritische
Situationen. So sehen Smart-Home-Lösungen der Extraklasse
aus.
www.twiline.ch
Es wurde noch nie ein so tageslichttaugliches Display
für Aussenbereiche gebaut, das rauen Elementen so standhält,
wie das Xtreme High Bright von Peerless-AV®. Die
XtremeTM High Bright Outdoor Displays verfügen über ein
vollständig abgedichtetes, IP68-zertifiziertes Design und ein
patentiertes Dynamic Thermal Transfer-System. Sie sind
wartungsfrei, ohne Lüfter, Belüftungsöffnungen oder Filter
und sind vollständig gegen Wasser, Staub, Feuchtigkeit und
sogar Insekten geschützt. Erhältlich sind sie bei der
Stilus SA in den Grössen 43“ – 55“.
www.stilus.ch
ReelTech Objektlifte
Stabile Software für
effiziente Planung
Leuchten, Dekormaterial und Werbeträger
in hohen Räumen, Treppenhäusern usw.
sind schwer zugänglich und erfordern Gerät
und Fachpersonal. Es besteht eine latente
Gefahr für Beschädigungen der Einrichtungen
oder Unfälle.
Sicherheit auf höchstem Niveau
ReelTech Objektlifte bringen Lasten mittels Fernbedienung
in die gewünschte Arbeitshöhe und sparen damit Kosten
und Arbeitsaufwand, die entstehen, wenn Hubarbeitsbühnen
oder andere Geräte gemietet werden müssen. Weil die
Stromversorgung beim Absenkvorgang automatisch getrennt
wird, sind Unfälle durch Stromschläge ausgeschlossen. In
der Parkposition ist der absenkbare Teil des Lifts zusätzlich
elektromechanisch verriegelt. Die Fernbedienung ist für alle
Lifttypen geeignet und lässt sich individuell programmieren.
Für jegliche Anwendung passend
Mit einer Absenkhöhe von 7 bis 20 Metern und Hebelasten
von 1 bis 500 Kilogramm bieten die acht Geräteserien auch
bei komplexen Anwendungen wie z.B. DALI, DMX oder Sicherheitsleuchten
passende Lösungen. Für Überwachungseinrichtungen
eignet sich ein CCTV-Lift. Dank dem homogenen
Zubehörsortiment werden die Liftsysteme auch ästhetischen
Anforderungen wie z.B. im Büro- oder Wohnbereich gerecht.
Perfekt in Szene gesetzt
ReelTech Rotorlifte verleihen Bannern und Dekos zusätzliche
Aufmerksamkeit. Durch die Rotationsbewegung können Objekte
rundum betrachtet werden. Der Austausch der Last ist
in wenigen Minuten möglich. Werbeträger und Dekos können
so beliebig oft ausgewechselt werden. Dadurch amortisieren
sich die Initialkosten des Systems innert Kürze.
www.demelectric.ch
Software in der Cloud Viele Anwender von Planungssoftwares
sind enttäuscht, weil ihre Programme nicht flüssig laufen. Das
HEMAG-CAD ist die Lösung für Plan- und Schemazeichnen
sowie für die Projektverwaltung, denn die ressourcenschonende
Software läuft auch auf Cloudservern oder PCs stabil. Mit
dem integrierten Browser greifen Sie direkt auf Webshops zu
und können Ihr Material einem Symbol zuweisen. Steckdosen,
Lichtschalter usw. exportieren Sie einfach in eine Excel-Tabelle
für Ihre Rapporte, Offerten und Rechnungen. Dank der Partnerschaft
mit Steiger dient das HEMAG-CAD als Schnittstelle
für den Datenexport mit Steiger-Kalkulationsdaten. Da hinter
jedem Symbol ein Steigerartikel erfasst ist, sind 90 Prozent der
Offerte bereits erstellt.
www.hemag.ch
Die neue Baureihe - JA Comfort
Dank den Comfort-
Antrieben fahren Jalousien
nahezu geräuschlos in die
gewünschte Position.
Den JA Comfort gibt es in drei Ausführungen, mit und ohne
integrierten Funk sowie mit einer SMI-Schnittstelle zur
Anbindung an Bussysteme. Die Antriebe sind einfach zu
installieren und mit Stillstanderkennung und Bandlängenausgleich
ausgestattet. Ob mit 26, 35 oder 50 Umdrehungen,
dank Softbremse werden die Endlagen langsam und ohne
Klackgeräusche angefahren. Die Langsamfahrt ermöglicht es
auch, die Wendung der Lamellen zielgenau anzufahren.
www.meimo.ch
78 eTrends Ausgabe 3/19
Stressfrei campen mit dem
passenden Adapter
Endlich Ferien, endlich auf dem Campingplatz und dann das
Ärgernis: Es sind nur blaue CEE «Campingsteckdosen» vorhanden.
Und im Reisegepäck befindet sich nur ein Verlängerungskabel
mit Schweizer Stecker. Dank dem robusten und handlichen
Adapter von WAROB kann der Campingtrip stressfrei
beginnen. Er ermöglicht den Übergang von Stecker CEE 16-3
blau PE 6h (SEV Typ 63) auf Kupplungen Typ 23. Aber nicht nur
in der Freizeit, auch im Berufsalltag ist der kleine Helfer vielseitig
einsetzbar. Dank seiner einfachen Handhabung findet der
Zwischenstecker auch in Industriebetrieben, in der Eventtechnik,
im HLK-Bereich und in der Schifffahrt Verwendung.
www.warob.ch
Zeitlose und formschöne
Büroleuchten mit transparenter
Leuchtfläche
HALLO
GEBÄUDE.
SICHERE VERBINDUNGEN
SEIT ÜBER 100 JAHREN.
Als Erfinder der sicheren
elektrischen Verbindungstechnik
stehen wir für individuelle und
sichere Systemlösungen für die
Industrie sowie Gebäude- und
Beleuchtungstechnik.
Unsere Lösungen sind darauf
ausgerichtet, Ihnen Sicherheit
zu geben.
Die schadstofffreie LCC-Technologie hat in die mobilen Büro-
Beleuchtungssysteme Einzug gehalten. Die eleganten und
hochwertigen Büro-Stehleuchten aus Aluminium trumpfen mit
Up-/Down-Beleuchtung und zusätzlicher Extravaganz auf: Bei
ausgeschaltetem Lichtstrom ist die Leuchtfläche aus Polycarbonat
transparent! Der Touch-Dimmer garantiert jederzeit eine
stufenlose, individuelle Lichtführung. Die Leuchte steht stabil
und sicher und kann, platzsparend oder für eine direkte Beleuchtung
des Arbeitsplatzes, unter das Pult geschoben werden. Jetzt
auch als Tischmodell erhältlich. LCC (Laser Crystal Ceramics)
unterscheidet sich durch die organische Beschichtung grundlegend
von LED und ist schadstofffrei sowie energieeffizient.
Das bietet WIELAND ELECTRIC:
+ Sichere, steckbare Verbindungen
+ gesis® Installationssystem
zur Gebäudeverkabelung
+ Raumautomation mit KNX
+ Energiebussystem podis®
zur dezentralen Energieverteilung
www.lcclichtgmbh.ch
Ausgabe 3/19
eTrends
Erfahren Sie mehr über uns unter:
www.wieland-electric.ch
Verbände
GNI
VIEL NEUES
BEI DER GNI
Die Generalversammlung
im Zeichen der
Erneuerung.
KNX Swiss
EIN WORT AUF DIE
NACHHALTIGKEIT
Standardisierte
Systeme verhindern
Schreckenszenarien.
VSRT
VSRT WIRD ZU
MMTS
MMTS, MultiMedia
TecSwiss, steht für
Offenheit.
Pierre Schoeffel, Geschäftsführer GNI
Die Gebäude Netzwerk Initiative
führte am 16. Mai 2019 im Kunden-
Center der Hager AG in Emmen ihre
Generalversammlung durch. Präsident
Peter Scherer ging einleitend auf die
jüngsten Entwicklungen in der Bauwirtschaft
ein. Dazu verwies er auf den
viel zitierten Satz: «Es gibt keinen Planeten
B.» Dieser fasst die Sorgen um
das Klima und die Umwelt zusammen,
die sich zunehmend auch auf die Bautätigkeit
auswirken und die Automatisation,
die Ressourcen schont, voranbringen
werden. Peter Scherrer sprach
auch den Fachkräftemangel an. Ausbildungen
stehen deshalb ganz oben
auf der Liste der Aktivitäten der GNI.
Im Rahmenprogramm zur GV berichteten
zwei Schulen über Gebäudeautomations-Lehrgänge:
Dr. Olivier Steiger
von der Hochschule Luzern trat als
Nachbar auf und gab mit seiner Präsentation
«Gebäudeautomation an der
HSLU in Gegenwart und Zukunft»
eine ausführliche Übersicht über die
Schulungsthemen. Wie man am sfb
Bildungszentrum in Dietikon ein ganzheitliches
Verständnis für komplexe
und effiziente Gebäude entwickelt,
erklärte Thomas Laux.
Es fanden dieses Jahr auch Wahlen
statt, die dem GNI-Vorstand ein neues
Gesicht geben. Thomas von Ah, der
sich mit viel Herzblut für die GNI einsetzt,
wurde zum Vize-Präsidenten
gewählt. Neu im Vorstand sind Klaus
Jank, Siemens Schweiz AG, Sven Kuonen,
Drees & Sommer AG, Gabriel
Morard, Pelco SA, und Tobias Müller,
Migros Genossenschaft Zürich. Ausgetreten
sind Vize-Präsident Bruno
Kistler, PentaControl AG, Julien
Marguet, Siemens Schweiz AG, Emil
Rebsamen, 1A Consulting, und Marco
Savia, ABB Schweiz Normelec AG.
Sie alle werden erfreulicherweise für
die GNI aktiv bleiben.
www.g-n-i.ch
René Senn, Geschäftsführer KNX Swiss
In einem Gebäude gibt es verschiedenste
Systeme, z.B. für die Video-
Gegensprechanlage, die Kameras, die
Musik usw. Es sind Subsysteme des
Basissystems KNX oder eines anderen
Standards. Was geschieht, wenn nach
einiger Zeit Komponenten eines Subsystems
defekt sind oder nicht mehr
zur Verfügung stehen? Dann gibt es
zwei Möglichkeiten: Diesen Missstand
so sein zu lassen, wie er ist, oder einen
Systemwechsel in Betracht ziehen.
Weil uns niemand sagen kann, wie
lang ein System von Herstellern unterstützt
wird, ist es wesentlich und wichtig,
standardisierte Systeme einzusetzen,
die allenfalls von mehreren
Herstellern angeboten werden. Dies
gilt vor allem für Systeme, die die Gewerke
steuern. In diesem Bereich
kann KNX seine Trümpfe voll und
ganz ausspielen. Der Standard hat sich
über die letzten beinahe 30 Jahre in
vielen Projekten bewährt und schon
viele Sub- und proprietäre Systeme
überlebt. Dank KNX bleibt es vielen
Anlagebesitzern erspart, bereits nach
zehn Jahren eine grössere Investition
für den Wechsel des Basissystems zu
tätigen, nur damit Beleuchtung, Storen
und die Einzelraumregulierung
wieder funktionieren. Um ein solches
Schreckensszenario von Anfang an zu
verhindern, ist es enorm wichtig, für
die Basisfunktionen nachhaltige Systeme
einzusetzen. Dadurch relativiert
sich langfristig auch das Argument des
Preises.
Und schlussendlich liegt die Kunst
der sinnvollen Automation nicht nur
im Beherrschen des Systems selbst,
sondern auch im Bereitstellen von tollen
Funktionalitäten für die Bewohner.
www.knx.ch
Mary Napoli, Geschäftsführerin VSRT
VSRT-Präsidient Bruno Schöllkopf
eröffnete die 96. Generalversammlung
vom 6. Mai 2019 des VSRT mit
einem Zitat von Albert Einstein: «Die
reinste Form des Wahnsinns ist, alles
beim Alten zu belassen – und zu hoffen,
dass sich etwas ändern wird.»
2019 wollen wir uns intelligent verändern.
Deshalb wurden an der Generalversammlung
zwei Profis einstimmig
als neue Vorstandsmitglieder
gewählt: Markus Haller, Verkaufsleiter
B+T Bild und Ton AG, und Christoph
Widler, Präsident Swiss GIN und
Gründer der TeleConex AG. Ihre Innovationskraft
und ihr Elan werden
unser Verbandsleben stark bereichern.
Auch die Revision der Statuten
wurde einstimmig genehmigt. Die Änderungen
ermöglichen es uns, auch
mit der Branche nahestehenden Unternehmen
ausserhalb des Fachhandels
zusammenzuarbeiten und sie in
unserem Verband als Aktivmitglieder
aufzunehmen. Dies vor allem, weil das
Interesse, Mitglied des Verbandes zu
werden, aber auch die Freude, sich für
einen unserer drei Berufe (Multimeidaelektroniker
EFZ, Dethailhandelsfachletute
EFZ und Detailhandelsassistenten
EBA) zu engagieren,
wachsen.
Weil wir uns für neue Mitglieder
geöffnet hatten, hiess es bald einmal:
«Mit dem Namen VSRT ist kein Staat
mehr zu machen, und mit seinem ursprünglichen
Inhalt haben wir nicht
mehr viel zu tun!» Der Vorstand hat
deshalb entschieden, dem VSRT einen
zeitgemässen Namen zu geben. Unter
dem Namen «MultiMediaTecSwiss»,
abgekürzt MMTS, und mit der
Domain mmts.ch werden wir ab dem
1. September 2019 für die Branche
wirken.
www.vsrt.ch
80 eTrends Ausgabe 3/19
eev | aae
EEV MIT ROBUSTEM
ERGEBNIS 2018
TRIVALITE ® –
mehr als Licht
Die eev blickt
optimistisch zurück
und voraus.
Massimiliano Messina,
Leiter Kommunikation eev
Dank stabiler Konjunktur war das
Elektrogewerbe 2018 insgesamt gut
ausgelastet. Viele Investoren nahmen
die tiefen Zinsen zum Anlass, in Immobilien
zu investieren, zu sanieren
und zu renovieren. Entsprechend
machten Sanierungen und Renovationen
2018 den grössten Teil der Aufträge
für die Mitglieder und Vertragspartner
der eev aus.
Die Genossenschaftsmitglieder
bezogen im vergangenen Jahr Waren
im Wert von CHF 707 Millionen
bei den Vertragspartnern. Damit lag
das Einkaufsvolumen über dem Vorjahreswert
von CHF 701 Millionen.
CHF 13 Millionen zahlte die eev
2018 als Umsatzrückvergütung aus.
Weitere CHF 3 Millionen kamen in
Form der fünfjährlich ausbezahlten
Zusatzrückvergütung dazu. Insgesamt
weist die Genossenschaft für
2018 ein leicht positives Ergebnis aus
und liegt über dem Budget.
Für das laufende Jahr rechnet die
Schweizerische Elektro-Einkaufs-
Vereinigung mit guten Marktchancen
für ihre Mitglieder. Besonders im Bereich
Umbauten und Sanierungen besteht
weiterhin grosses Potenzial. Die
eev sieht dem Geschäftsjahr 2019 deshalb
optimistisch entgegen.
Um die Schweizer Elektrobranche
für die Zukunft zu stärken, erhalten
Kompetenz und Engagement bei der
eev dieses Jahr besondere Beachtung:
«kompetent engagiert» lautet das
Motto für 2019. «Wir wollen jeden Tag
mit Fachwissen und Kompetenz das
Beste für unsere Mitglieder und Vertragspartner
geben», sagt Thomas
Emch, Präsident des Verwaltungsrates.
Zugleich will die eev den Mitgliedern
helfen, das Motto selbst zu leben,
und ruft zu regelmässiger Weiterbildung
auf.
Intelligente und energieeffiziente Beleuchtung für Büro,
Zweck- und Wohnbau.
Licht nur dann, wenn Sie es brauchen, so viel und so
lange wie nötig. Bedarfsgerechtes Licht garantiert ein
Maximum an Funktionalität, steigert den Komfort und
minimiert die Betriebskosten. Dank Funk- oder
Drahtkommunikation ideal für Renovation und Neubau.
Hocheffiziente LED-Leuchten mit bis zu 132 lm/Watt
Schnell installiert und sofort betriebsbereit
Flache, runde und lineare Leuchten bis IP66
Bezeichnung
E-No
Ara-R35-3-B, Deckenaufbauleuchte, rund, Ø 350 mm, 3000 K 941 000 399
Ara-R35-4-B, Deckenaufbauleuchte, rund, Ø 350 mm, 4000 K 941 000 439
Ara-R40-3-B, Deckenaufbauleuchte, rund, Ø 400 mm, 3000 K 941 000 479
Ara-R40-4-B, Deckenaufbauleuchte, rund, Ø 400 mm, 4000 K 941 000 519
Hydra-L120N-4-B, Nassleuchte, linear, IP66, 1160 mm, 4000 K 941 001 529
Hydra-L150N-4-B, Nassleuchte, linear, IP66, 1560 mm, 4000 K 941 001 549
Vela-Q600-4-B, Einbauleuchte, flach, 600 x 600 mm, 4000 K 941 400 389
Vela-Q625-4-B, Einbauleuchte, flach, 625 x 625 mm, 4000 K 941 400 289
IR-Connect, Bluetooth-IR Schnittstelle für App 941 933 999
Alle Leuchten auch mit Notlicht-Akku erhältlich
www.trivalite.ch
www.eev.ch
Ausgabe 3/19
eTrends
Swisslux AG
Industriestrasse 8
CH-8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80
Fax: +41 43 844 80 81
Technik-Hotline:
+41 43 844 80 77
www.swisslux.ch
Kolumne
STREIFLICHT
Wo sind die Berufsmaturanden?
Den BMI Body Mass Index oder auch den
IQ Intelligenzquotienten kennen wohl
alle. Aber wie ist es mit BM1 bzw. BM2?
Hier handelt es sich nicht um Körper,
bzw. Geist, sondern um die Berufsmaturität.
BM1 steht für die Absolvierung
während der Berufslehre mit einem
zusätzlichen Schultag. Und BM2 für die
Absolvierung nach der Berufslehre.
Besonders in den gebäudetechnischen
Berufen HLKSE ist auffallend, dass während
der Berufslehre nur rund 3 Prozent
der Auszubildenden die BM1 besuchen.
Im Unterschied zu den kaufmännischen
oder auch naturwissenschaftlichen Berufen,
wo rund 30 Prozent die Berufsmaturität
in der BM1 abschliessen. Woran
mag das liegen?
In erster Linie wohl an den Installationsfirmen,
die häufig nicht wollen, dass
ihre Lehrlinge einen weiteren Schultag
ausserhalb der Firma verbringen. Die Begründung
lautet meist, dass die jungen
Leute am Arbeitsplatz fehlen würden.
Dies hört man vor allem von Kleinfirmen,
oft sogar mit der Bemerkung, dass sie
keine Lehrlinge einstellen würden, die die
BM1 absolvieren möchten – sie sollen
bitte nach dem Lehrabschluss die BM2
machen.
In zweiter Linie kann es allenfalls auch
an der Auswahl der Lehrlinge liegen, für
die die BM1 ausserhalb der intellektuellen
Reichweite ist. So fällt zum Beispiel
auf, dass im Kanton Zürich die relativ
tiefen Erfolgsquoten der Lehrabschlussprüfung
bei den Elektroinstallateuren
EFZ und Montage-Elektrikern EFZ seit
Jahren um 72 bis 83% pendeln und
mit der tiefen Beteiligung an der BM1
korrelieren.
Speziell im Zusammenhang mit der
Automatisierungstechnik – sprich Gebäudeautomation
– stellen sich hohe Ansprüche.
Montage-Elektriker werden für
die einfacheren Tätigkeiten ausgebildet,
den Elektroinstallateuren werden die
anspruchsvolleren Aufgaben zugemutet.
Und genau da ist eine gute berufliche
Schulbildung mit der BM1 notwendig,
in der die sprachliche Bildung und auch
das Denken vor allem in Zusammenhängen
geschult werden. Die Lernenden
sind dadurch im Berufsalltag in der Lage,
auch schwierigere Probleme zu lösen.
Dies nützt auch der Lehrfirma, die mit
einem motivierten und gut ausgebildeten
Mitarbeiter bereits während der Lehrzeit
punkten kann, auch bei den Kunden.
Die Berufsmatura ist der Königsweg zu
den Hochschulen. Dank unserem offenen
Berufsbildungssystem werden die Absolventen
der BM1 ihre Karriere mit einem
Studium an einer Fachhochschule, allenfalls
sogar an einer Universität, fortsetzen.
Später können sie zum Beispiel als
Ingenieure dem Gewerbe, der Industrie
und auch der Allgemeinheit auf einem
höheren Niveau dienen. Unser hoher
Lebensstandard ist auch in Zukunft nur
dank sehr gut ausgebildeten Fachleuten
auf allen Stufen gewährleistet.
Hans R. Ris ist Publizist und Autor
aktueller Fachbücher in den Fachgebieten
Energie und Lichttechnik.
eTrends
IMPRESSUM
Die Fachzeitschrift für Elektrotechnik,
Smart Building, Multimedia,
ICT/IoT, Licht, eMobility
Leser-Service / Abonnement
1 Jahr, CHF 75.– inkl. MwSt.
T +41 62 544 92 82
abo@etrends.ch
www.etrends.ch/abo
Herausgeber
Medienart AG
Valentin Kälin, Jürg Rykart
Aurorastrasse 27, CH5000 Aarau
www.medienart.ch
Archithema Verlag AG
Felicitas Storck
Rieterstrasse 35, CH8002 Zürich
www.metermagazin.ch
Chefredaktion René Senn
redaktion@etrends.ch
Mitarbeit Daniel Hofmann, Raymond
Kleger, Josef Schmucki, Pierre Schoeffel
Korrektorat Annette Jaccard
Designkonzept Archithema Verlag AG
Layout Martin Kurzbein
(Art Director), Selina Slamanig
(Layout, AVD Goldach AG)
Anzeigen
SPO Solutions AG
André Fluri
Oberneuhofstrasse 5, CH6340 Baar
T +41 41 727 22 00
werbung@etrends.ch
www.etrends.ch/mediadaten
Anzeigendisposition
Archithema Verlag AG
Denise Kreuzer
Rieterstrasse 35, CH8002 Zürich
T +41 44 204 18 84
denise.kreuzer@archithema.ch
Druck IbPrint AG,
Seetalstrassse, CH5703 Seon
www.ibprint.ch
Erscheinungsweise
6× jährlich, 1. Jahrgang
Auflage
9000 Exemplare
Die nächste
Ausgabe
erscheint am
23.8.19
Alle Urheber und Verlagsrechte an
dieser Publikation oder Teilen davon
sind vorbehalten. Jede Verwendung
oder Verwertung bedarf der schriftlichen
Zustimmung der Herausgeber.
Der Inhalt dieses Heftes wurde
sorgfältig geprüft. Dennoch übernehmen
die Herausgeber keine Haftung für
seine Richtigkeit.
Eine Publikation von
82 eTrends Ausgabe 3/19
1
EMF-Abschirmungen Made in Switzerland
2
3
4
5
1 µShield ® EMF-Abschirmplatten für Flächen- und Raumabschirmungen
2 mrShield ® EMF-Abschirmkabinen für Forschung, Entwicklung und Medizin
3 PowerMan EMF-Abschirmwinkel für NS- und MS-Verteilungen
4 TrafoMan EMF-Abschirmgehäuse für Leistungstransformatoren
5 CableMan ® EMF-Abschirmelemente für erdverlegte HS-Kabel
pph.ch, 12/18 ch
Führend in EMV- und
Abschirmungs-Technologie
CFW EMV-Consulting AG • Dorf 9 • CH-9411 Reute AR • Tel. +41 71 891 57 41 • www.cfw.ch
domovea:
Smart Home
leicht gemacht
IoT
Viel-in-eins
Lösung
Viel kann so easy sein
easy richtig installieren, steuern und visualisieren:
mit domovea! Innovative Technik in einem einzigen kompakten
Baustein, der KNX Bauteile, IP- und IoT-Komponenten verbindet,
steuert und schlussendlich intuitiv in einer zeitgemässen Visualisierung
vereint. Nach Planung, Installation und Konfiguration ist
die Bedienung von Beleuchtungsanlagen, WLAN-Soundsystem
und anderen IoT-Anwendungen über NUR eine App möglich.
Mehr Informationen unter hager.ch/domovea