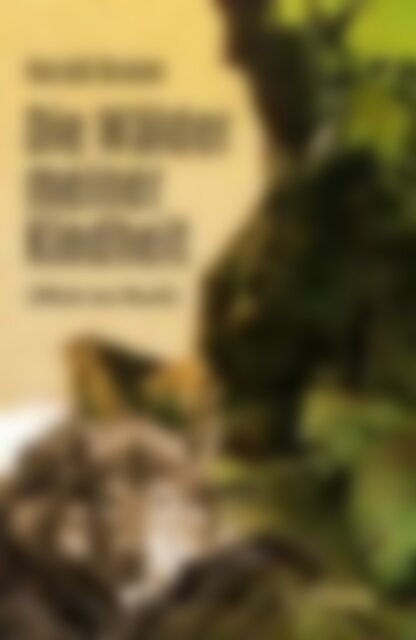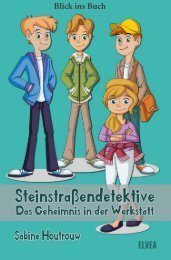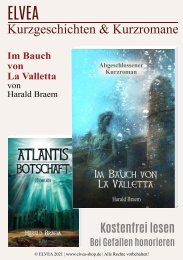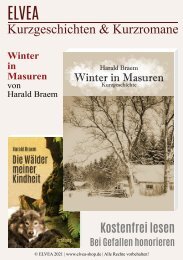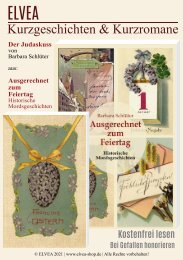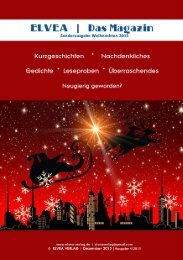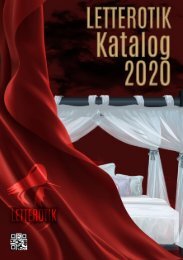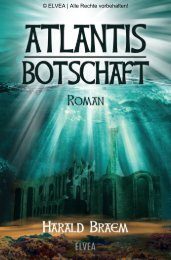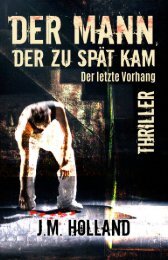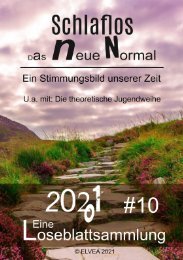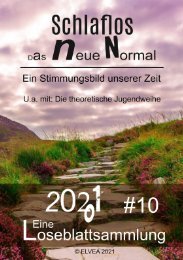Harald Braem - Wälder meiner Kindheit (Blick ins Buch)
„Waldbaden“ vor 75 Jahren: Ein Flüchtlingsjunge wächst, zusammen mit einem Wolfshund und den Großeltern, unter ärmlichsten Bedingungen im Westerwald auf. Truda hat das „zweite Gesicht“, gilt als Hexe und Heilfrau. Der alte Mudri ist Freigeist, Ingenieur und Erfinder und träumt von einer besseren Welt. Unter diesen Bedingungen lernt der Junge die „Waldschule“ kennen.
„Waldbaden“ vor 75 Jahren: Ein Flüchtlingsjunge wächst, zusammen mit einem Wolfshund und den Großeltern, unter ärmlichsten Bedingungen im Westerwald auf.
Truda hat das „zweite Gesicht“, gilt als Hexe und Heilfrau.
Der alte Mudri ist Freigeist, Ingenieur und Erfinder und träumt von einer besseren Welt.
Unter diesen Bedingungen lernt der Junge die „Waldschule“ kennen.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
[<strong>Blick</strong> <strong>ins</strong> <strong>Buch</strong>]
Die <strong>Wälder</strong> <strong>meiner</strong> <strong>Kindheit</strong><br />
<strong>Harald</strong> <strong>Braem</strong><br />
Erzählung
Die Handlung und alle Personen des Textes sind frei<br />
erfunden.<br />
Alle möglichen Ähnlichkeiten mit tatsächlichen<br />
Vorgängen oder Ereignissen bzw. mit lebenden oder<br />
gestorbenen Personen sind rein zufällig.
»Rasch, greif das Glück und wünsch<br />
dir was. Aber nicht zu viel, denn<br />
Sterne sind schnell und vergesslich.«<br />
(einer von Mudris Ratschlägen, die sich tief<br />
in mein Gedächtnis eingeprägt haben)<br />
»Ich der Wolf und du das Schaf.«<br />
(einer von Trudas Zaubersprüchen)
Der Autor<br />
<strong>Harald</strong> <strong>Braem</strong>, geboren 1944 in Berlin, war<br />
Professor für Kommunikation und Design an der<br />
Fachhochschule Wiesbaden und lebt heute in<br />
Nierstein am Rhein und auf der Kanaren<strong>ins</strong>el La<br />
Palma. Jüngste Veröffentlichung: ›Die<br />
abenteuerlichen Reisen des Juan G.‹ im Elvea Verlag<br />
2020.<br />
Weitere Informationen: www.haraldbraem.de
Das <strong>Buch</strong><br />
Manchmal duften die Pilze im Moos bis in meine<br />
Träume hinein. Dann höre ich wieder die Stimmen<br />
der Ahnen, meine Großeltern, ganz leise das Flüstern<br />
der Geister.<br />
Sie schlafen in der Speisekammer, die sie geschickt<br />
mit Kissen, Decken und einem Teppich zur<br />
Kemenate umgestaltet haben. Sie können die dünnen<br />
Holzlattentüren von innen schließen wie Läden an<br />
einem Haus. Das gibt Schutz und Wärme, besonders<br />
im Winter. Aber nach dem Zubettgehen bleiben sie<br />
stets noch einen Spalt weit offen. Dann beginnt für<br />
mich die magische Nacht.<br />
Ich höre den alten Mudri mit seinem sonoren Bass,<br />
der brummen kann wie ein Bär, der schmachtende<br />
Lieder der Donkosaken singt, der gern aus dem<br />
Stegreif dramatisch klingende Ansprachen hält, die<br />
meist dazu führen, dass die Anwesenden, zumal<br />
wenn Wodka im Spiel ist, gerührt in Tränen<br />
ausbrechen und ihre Gläser über die Schulter an die<br />
Wand werfen und ein klirrendes Chaos anrichten.<br />
Derselbe Mudri, der aber auch tagelang schweigen<br />
kann, besonders bei der Arbeit in den <strong>Wälder</strong>n.<br />
Und ich höre Truda, die Ahnfrau, die mit ihrem<br />
Mund alle Geräusche der Welt nachahmen kann: den<br />
Wind, die Stimmen der Tiere, alle Lieder, die sie<br />
5
irgendwann und irgendwo einmal aufgeschnappt hat<br />
(»Bei mir biste scheen für eine Mark und zehn, für<br />
eine Mark und acht die janze Nacht«). Truda, die die<br />
Gabe (oder den Fluch) des Zweiten Gesichts besitzt<br />
und manchmal in einer Sprache spricht, die außer ihr<br />
niemand versteht.<br />
Ich höre, wie sie in der Speisekammer rumoren<br />
und halblaut miteinander reden, mitunter flüstern sie<br />
oder kichern. Ich versuche einzelne Worte<br />
aufzuschnappen, dem Sinn ihrer Unterhaltung zu<br />
folgen. Es gelingt mir nicht, so sehr ich auch<br />
angestrengt lausche. Zu undeutlich und verworren<br />
bleiben die Stimmen. Und wenn ich etwas zu<br />
verstehen glaube, das in mir Bilder erzeugt, wenn die<br />
Unterredung intensiver wird und an Lautstärke<br />
zunimmt, wenn Truda ein »Pscht« macht, das wie<br />
ein ferner Peitschenknall klingt und ich schlagartig<br />
begreife, dass dieses »Pscht« mir gilt, weil sie wohl<br />
ahnt, dass ich noch wach bin auf dem Strohlager<br />
neben dem Ofen, dann reden sie plötzlich nur noch<br />
in der ›Blumensprache‹ miteinander, das heißt mit<br />
bestimmten Worten und Andeutungen, die<br />
wahrscheinlich für ganz andere Dinge stehen, oder<br />
auf Russisch weiter, bis ich e<strong>ins</strong>chlafe.<br />
Diese magischen Nächte, durch die mich die<br />
Stimmen der Ahnen aus der Speisekammer tragen,<br />
sind ungemein aufregend, aber nicht immer schön.<br />
Mitunter schnappe ich Einzelheiten auf, gruselige<br />
Details, die mit Sicherheit nicht für meine Ohren<br />
6
estimmt sind. Ich höre hemmungsloses Schluchzen<br />
und Jammern von Truda, erlebe eine Trübsal, die<br />
selbst Mudris beruhigend klingender Bass nicht<br />
eindämmen kann. Aus Bruchteilen von Worten,<br />
Sätzen, Reden und Gegenreden, verschwommen aus<br />
dem Nebel auftauchenden Bildern versuche ich das<br />
eben Erlauschte sinnvoll zusammenzufügen.<br />
Manches davon erschreckt mich und ich schiebe die<br />
schlimmen Bilder rasch beiseite, doch das klamme<br />
Bauchgefühl bleibt haften. Wieder murmeln die<br />
Ahnen, es ähnelt einem monotonen Gesang oder dem<br />
Sprudeln von Wasser über runde Steine im Bachlauf.<br />
Dieses Geräusch lässt mich ruhiger werden, ich<br />
dämmere ein und schwebe schwerelos durch<br />
Träume, in denen sich Personen bewegen, die mir<br />
fremd, aber seltsam vertraut sind. Wer sind diese<br />
Geister, was haben sie mit mir zu schaffen, was<br />
wollen sie mir sagen?<br />
Ich höre sie unentwegt flüstern, auf Deutsch und<br />
auf Russisch und in anderen, unbekannten Sprachen.<br />
Ihr Wispern gilt der Steppe, der Taiga, dem großen<br />
Strom. Sie sind mit dem Wind unterwegs, Nomaden<br />
der Nacht, auf der Suche nach Heimat, und tragen<br />
ihre Erinnerungen mit sich wie kostbarste Schätze,<br />
Geheimnisse, die sie hüten müssen und nur an<br />
wenige weitergeben dürfen. Warum ausgerechnet an<br />
mich?<br />
Sie flüstern sehr leise, sie fordern meine Ohren<br />
heraus. Es ist ein Spiel, das weiß ich. Und ich lasse<br />
7
mich darauf ein. Sie sind die Rufer, ich bin der<br />
Fänger. Ich werde Nacht für Nacht besser.<br />
Wenn ich die Augen fest schließe und zum<br />
hingebungsvollen Zuhörer werde, zum<br />
Gesamtkörper Ohr und nur noch wartende<br />
Hörmuschel bin, wenn ich ruhig und gleichmäßig<br />
atme, wie Truda es mir beigebracht hat, und mich<br />
bemühe, an nichts zu denken, mich von nichts<br />
ablenken zu lassen, entsteht in meinem Kopf die<br />
innere Welt mit ihren fantastischen Bildern. Ein<br />
Garten, in dem man sich verirren kann …<br />
Ich habe seltsame Träume. Ich reite auf einem<br />
kleinen, stämmigen Pferd und wundere mich, wie<br />
leicht es mir fällt. In Wirklichkeit habe ich das noch<br />
nie gemacht, die Tiere sind mir einfach zu groß.<br />
Aber im Traum spielt das alles keine Rolle. Ich sitze<br />
fest im Sattel und reite mit Männern, mit vielen<br />
Männern, in einem Heer aus ledergepanzerten,<br />
behelmten Reitern nach Westen. Das war schon<br />
immer so, das haben wir seit Jahrhunderten so<br />
gemacht. Wie ein Sturmwind galoppieren wir mit<br />
donnernden Hufen über die Steppe. Dieser Traum<br />
wiederholt sich lange Nacht für Nacht …<br />
8
Aber es gibt auch Nächte, in denen ich jedes Wort<br />
ihrer Unterhaltung deutlich mithören kann. Am<br />
besten ist, wenn Großvater von seiner masurischen<br />
Heimat erzählt, jenem fernen Land, das wohl, glaubt<br />
man dem alten Mudri, und ich zweifele nie an seinen<br />
Worten, nur aus endlosen <strong>Wälder</strong>n besteht, in denen<br />
es von Elchen, Bären und Wölfen nur so wimmelt.<br />
Truda stammt von der baltischen Ostseeküste, was<br />
ihr aber nicht anzumerken ist, denn sie benutzt selten<br />
die breite ostische Mundart, höchstens wenn sie<br />
etwas betonen will oder wenn sie sich ärgert oder<br />
aufgeregt ist. Von der alten »Haimat« zu berichten,<br />
das sei nicht ihre Sache, wehrt sie ab. Da solle ich<br />
doch lieber Mudri fragen, der könne sowieso viel<br />
besser erzählen als sie und sich Dinge merken, die<br />
sie längst vergessen habe.<br />
An der Kurischen Nehrung hatten sie sich<br />
kennengelernt, und sie war ihm gefolgt, wohin auch<br />
immer die Wirren der Zeit sie führten. Truda und<br />
Mudri lieben sich. Diese Liebe überstand alles,<br />
Hunger, Not und Vertreibung, den Tod des einzigen<br />
Kindes, Ihres Sohnes, meines leiblichen Vaters, der<br />
im letzten Jahr des Krieges an der Ostfront fiel. Sie<br />
überstanden auch den Schmerz über den Verlust<br />
ihrer e<strong>ins</strong>t so herzlich in die Familie aufgenommenen<br />
Schwiegertochter Charlotte, <strong>meiner</strong> Mutter, die bei<br />
der Flucht auf einem Bahnhof spurlos verschwand<br />
und seitdem nicht mehr gesehen wurde. Andere<br />
Verwandte leben nicht mehr oder sind wie Charlotte<br />
verschollen.<br />
9
Truda und Mudri haben sich <strong>meiner</strong> angenommen.<br />
Wir wohnen in einem winzigen Haus, eigentlich<br />
mehr eine notdürftig eingerichtete Hütte, dicht am<br />
Waldrand und ein gutes Stück weit vom Dorf<br />
entfernt. Ein Mann von dort, dem mein Großvater<br />
gelegentlich aushilft, hat uns die Unterkunft<br />
überlassen. Vorübergehend nur, wie er betont. Viel<br />
Kontakt zu den anderen Menschen im Dorf gibt es<br />
nicht. Wir sind die Fremden, die Flüchtlinge, und<br />
wer will hier im Westerwald mit solchen Leuten<br />
unklarer Herkunft schon näher zu tun haben?<br />
»Ich bin kein Deutscher, ich bin Masur«, pflegt<br />
Großvater mitunter unvermittelt in solchen Nächten<br />
zu äußern, und seine Stimme klingt traurig und<br />
trotzig dabei.<br />
»Pscht«, zischt Truda dann, weil sie weiß, dass,<br />
wenn er in dieser Stimmung weitermacht, nichts<br />
Erfreuliches dabei herauskommt. »Nu, bist du wohl<br />
stille jetzt. Wenn dich die Laite hören!«<br />
Ich schrecke jedesmal zusammen, wenn sie so<br />
spricht. Was meint sie? Wir hausen doch ganz allein,<br />
das Dorf liegt weit weg. Oder sollte sich jemand<br />
angeschlichen haben, um uns heimlich zu<br />
belauschen? Mit ans Holz gepresstem Ohr vor<br />
unserer Haustür hocken?<br />
»Doch, ich bin Masur«, wiederholt Großvater<br />
halsstarrig. »Wer dort geboren ist und einmal die<br />
Luft eingeatmet hat, der bleibt es für immer.«<br />
10
»Nein, du bist Daitscher, Reichsdaitscher, begreif<br />
es endlich, so is es nu ma«, sagt meine Großmutter,<br />
»und nu sei endlich stille und lass uns schlafen.«<br />
Und da der alte Mudri am Abend ein paar Gläser<br />
vom selbstgebrannten Kartoffelschnaps getrunken<br />
hat, schläft er auch tatsächlich bald ein. Sein<br />
Schnarchen dröhnt aus der Speisekammer und tönt<br />
lauter als der Motor, der im Sägewerk ratternd läuft,<br />
wo ich ihn einmal besucht habe, um ihm das<br />
Mittagessen im Blecheimer zu bringen.<br />
Ein anderes Mal fragt er: »Weißt du noch, wie wir<br />
am Strand Bernstein gesammelt haben?«<br />
»O ja, natürlich«, antwortet Truda. »Das war ein<br />
wunderbarer Sommer damals, mein Lieber! Ich habe<br />
ständig gebetet, er möge nie zu Ende gehen, so schön<br />
war es damals. Besonders in den Dünen.«<br />
Was sie mit der letzten Bemerkung meint, begreife<br />
ich nicht recht. Ich hoffe nur, sie wird nicht weinen,<br />
denn meine Großmutter neigt mitunter zu Wehmut<br />
und Weltschmerz und hat dann dicht am Wasser<br />
gebaut. Es ist furchtbar, sie in einem solchen Zustand<br />
zu erleben, denn eigentlich ist sie ja ein durchaus<br />
lebensfroher Mensch. Sie kann gurrend wie ein<br />
Täubchen lachen, und mitunter trällert sie am<br />
helllichten Tag frivole Lieder mit zweideutigem<br />
Inhalt. Ich verstehe das meiste davon nicht richtig,<br />
finde es aber schön, dass sie gute Laune hat.<br />
»Alles hat ein Ende«, pflegt der alte Mudri dann<br />
zu sagen, um das Gespräch in eine andere Richtung<br />
11
zu lenken, »nur die Leberwurst hat zwei.« Oder:<br />
»Alles, alles ist vergänglich, nur der Kuhschwanz,<br />
der bleibt länglich.«<br />
Dann lacht sie wieder, und er setzt, um die<br />
Wirkung zu verstärken, noch e<strong>ins</strong> drauf, indem er<br />
anfängt, eine Reihe von witzigen Begebenheiten zu<br />
erzählen, die sie allesamt zum Prusten bringen.<br />
»Da gab es doch die Beerdigung vom<br />
Schnipkoweit, dem ollen Lorbas.« Es war Winter<br />
und der Weg zum Friedhof hart gefroren und völlig<br />
vereist. Sehr schwierig zu begehen bei dem Wetter,<br />
besonders für die alten Leute. Weil es bitterkalt war,<br />
wurde unterwegs reichlich Wodka getrunken, um<br />
sich an diesem traurigen Tag wenigstens von innen<br />
etwas aufzuwärmen. Das letzte Stück an den Gräbern<br />
vorbei zur Friedhofskapelle war fürchterlich glatt, sie<br />
kamen äußerst langsam und schwankend voran. »Da<br />
kam jemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, auf<br />
die glorreiche Idee, die Urne zu öffnen und<br />
Schnipkoweits Asche als Streugut zu nutzen.« Als<br />
das Grüppchen schließlich beim Pfarrer ankam, war<br />
die Urne leer. Schnipkoweit hatte, obgleich ihn im<br />
Leben keiner so recht mochte, weil er ein<br />
unausstehlicher Knickeböcker und Streithammel<br />
war, zuletzt der Geme<strong>ins</strong>chaft doch noch einen<br />
nützlichen Dienst erwiesen.<br />
»Ja, so war das. Alle haben dichtgehalten und dem<br />
Herrn Pfarrer nichts verraten. Wir haben dann das<br />
Gefäß ohne Schnipkoweit beigesetzt. War harte<br />
Arbeit bei dem gefrorenen Boden.«<br />
12
»Und niemand hat etwas verraten?«<br />
»Nein, niemand. Aber später, im nächsten<br />
Sommer, und auch noch Jahre danach nannten die<br />
Leute diesen Weg nur noch Schnipkoweits Pfad.<br />
Alle wussten davon, aber keiner sprach darüber mit<br />
dem Pfarrer. Der Mann war streng in seinen<br />
Ansichten und in der Bevölkerung nicht so beliebt,<br />
wie er es gern gehabt hätte. Waren ja allesamt noch<br />
halbe Heiden, man nahm es mit der Religion nicht so<br />
genau.«<br />
Und er fügt, spielerisch in den alten Dialekt<br />
fallend, die Stimmen aus dem Gedächtnis hinzu:<br />
»Laite, Laite, seid doch stille, dass euch nicht der<br />
Pastor heert, ja was is mit <strong>meiner</strong> Brille? Is ja janz<br />
mit Schmand beschmeert …«<br />
»Wenn ich einmal tot bin, möchte ich, dass meine<br />
Asche in der Ostsee verstreut wird«, sagt<br />
Großmutter.<br />
Und der alte Mudri weicht rasch, um sie<br />
abzulenken und auf andere Gedanken zu bringen, auf<br />
eine weitere schalkhafte Episode aus, die Geschichte<br />
vom Dorftrottel Igor, der sich einmal eine lange<br />
Holzleiter auslieh, sie aber nicht mehr zurück in die<br />
Scheune bringen konnte, weil er stundenlang<br />
vergeblich versuchte, das sperrige Ding quer anstatt<br />
längs durch das Tor zu bringen. Großvater erzählt<br />
die Sache stets anders, so dass es jedes Mal<br />
spannend für mich wird, ihm zuzuhören. Vielleicht<br />
ist das auch nie passiert, vielleicht hat er die<br />
Begebenheit nur erfunden. Aber es macht ihm<br />
13
großen Spaß, sie immer wieder mit neuen<br />
Ausschmückungen zu erzählen. Ich liebe seine<br />
skurrilen, bildhaften Sätze.<br />
14
Truda und Mudri sitzen in Gedanken in Elbing an<br />
der Promenade und essen Sprotten. »Kuck, ich kann<br />
die Jräten mitessen, so zart sind die.« Und nachher<br />
gibt es geräucherten Aal, den Truda aber nicht<br />
vertragen kann, weil er ihr viel zu fett ist. Sie mag<br />
lieber Seezunge oder Makrele, am meisten aber<br />
Scholle nach Finkenwerder Art mit angebratenen<br />
Speckkrümeln und viel Petersilie. Sie stöhnt<br />
genüsslich, weil sie just daran denkt. »Und der<br />
Weißwein«, sagt sie, »das re<strong>ins</strong>te Vergnügen, so süß<br />
wie der war. Hätte man im Keller bunkern sollen.«<br />
»Hätte hätte Fahrradkette«, brummt Mudri. »Und<br />
was hätt uns der Keller noch genützt, wo das ganze<br />
Haus kaputt war? Nee, nee, da hätt uns der Wein<br />
auch nicht mehr viel geholfen.«<br />
»Warum denn nicht? Immer nobel geht die Welt<br />
zugrunde«, widerspricht Truda, »hätten wir’s<br />
wenigstens im Suff ertragen, den ganzen<br />
Schlamassel.«<br />
»Quatsch«, sagt Mudri, der immer noch an Aal<br />
und Sprotten denkt und ohnehin lieber Bier trinkt<br />
und gelegentlich Wodka. »Wir haben’s doch<br />
ertragen. Und so isses nu ma im Leben: Man kann<br />
nich alles kriegen, was man sich wünscht. Das ist<br />
wie bei der Sache mit dem Gänsebraten …« Und er<br />
fügt, sehr zum Vergnügen von Truda, mit verstellter<br />
Stimme hinzu: »Gänsebraten ist ein feiner Braten.<br />
Ich hab noch keinen gegessen, aber meines Vaters<br />
Bruders Sohn, der kannte einen, der hat mal neben<br />
15
einem gesessen, und der sah einen Gänsebraten essen<br />
…«<br />
Truda prustet vor Lachen und wiehert wie ein<br />
Pferd. »Den Abromeit«, ruft sie, »mach mir den<br />
Abromeit!«<br />
»Da kallerten ihm die Arpsen vons Mässär runter<br />
und die Jabel half auch nicht ville … da war der<br />
Lorbas janz von oben bis unten beklackert …«, sagt<br />
Großvater mit fremder Stimme und muss selbst<br />
lachen.<br />
16
Unsere Hütte mit Tür und zwei Fenstern ist winzig<br />
klein nur, aber immerhin mit einem wärmenden Ofen<br />
ausgestattet, der auch zum Kochen dient. Er wird mit<br />
gesammeltem Bruchholz gefüttert und darf nie<br />
ausgehen, vor allem im eisigen Winter. Ich sehe<br />
Großvater vor der Ofenluke knien, trockenes Reisig<br />
in die fast schon erloschene Restglut nachlegen und<br />
die Flamme anblasen. Die Asche tragen wir in einem<br />
Blecheimer in den Schuppen und sammeln sie in<br />
einer alten, zerbeulten Tonne, sie dient als Kompost<br />
für Trudas Gemüsebeete und als Streugut im Winter.<br />
Jedes Mal wenn die Reihe an mir ist, (Mudri und ich<br />
wechseln uns in einem genau festgelegten Rhythmus<br />
bei den verschiedensten Arbeiten ab), wenn ich also<br />
mit dem Blecheimer Asche aus der Sammeltonne<br />
hole und den weißgrauen Flugstaub über das Eis<br />
verteile, muss ich dabei an Schnipkoweit denken.<br />
Wenn der wüsste, dass man selbst im fernen<br />
Westerwald nach so langer Zeit noch an ihn denkt,<br />
würden ihm die Ohren klingeln…<br />
Wir schöpfen das Trinkwasser aus dem<br />
nahegelegenen Bach und kochen es auf dem Ofen<br />
ab, obgleich es sauber und genießbar scheint.<br />
»Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste«, meint<br />
Mudri, der weiß, wovon er spricht. Er hat auf dem<br />
langen Treck unterwegs schlimme Dinge erlebt und<br />
besteht darauf, ohne die geheimen Wirkkräfte der<br />
Blutwurz, die Truda für den Fall eines Falles<br />
beschwörend <strong>ins</strong> Spiel bringt, anzweifeln zu wollen.<br />
17
Größere Mengen an Bachwasser, die es dann in<br />
Eimern zu schleppen gilt, werden zu Trudas<br />
Waschtagen benötigt. Der große Kochbottich steht<br />
bereits im Hof auf dem Feuer. Später wird sie<br />
während der ausgedehnten Prozedur mit Inbrunst die<br />
nassen, dampfenden Stoffe über das Waschbrett<br />
schleifen, drücken, würgen und wringen, bevor sie,<br />
noch triefend, mit Holzklammern an der Leine<br />
aufgehängt werden. Außer bei Regen und Sturm<br />
spielt das Wetter meistens mit, denn hier weht<br />
ständig ein frisches Lüftchen und lässt die Wäsche<br />
rasch trockenflattern.<br />
»Du kannst dich ruhig mal wieder waschen und<br />
saubere Kleider anziehen, du stinkst schon wie ein<br />
Schmeerfink!«, ruft Truda und spritzt eine Handvoll<br />
Seifenlauge in meine Richtung. Ich springe mit<br />
einem empörten Aufschrei beiseite. Stimmt, ich trage<br />
Tag für Tag dieselben Klamotten: eine kurze<br />
Lederhose mit Gürtel, Sandalen und ein schmutziges<br />
Hemd, das ich über dem Bauch zusammenknote im<br />
Sommer. Im Winter besteht die Kluft aus langen<br />
Wollstrumpfhosen unter der gefütterten Hose,<br />
richtigen Stiefeln, die man innen mit Moos<br />
auspolstern kann, dazu Pullover, Windjacke, Schal<br />
und Fellmütze.<br />
»Und du wie ein Geißbock!«, wendet sie sich zu<br />
Mudri um und spritzt ihn neckisch nass. »Dich<br />
braucht man nicht zu heeren, dich riecht man schon<br />
von weitem. Los nu, runter zum Bach, heute is<br />
Waschtag, das gilt für alle.«<br />
18
Weitere Veröffentlichungen von<br />
<strong>Harald</strong> <strong>Braem</strong>:<br />
Taschenbuch:<br />
ISBN: 978-3-946751-88-5
Taschenbuch:<br />
ISBN: 978-3-946751-90-8
Taschenbuch:<br />
ISBN: 978-3-946751-91-5
Taschenbuch:<br />
ISBN: 978-3-946751-94-6
Impressum<br />
www.elveaverlag.de<br />
Kontakt: elvea@outlook.de<br />
© ELVEA 2020<br />
Alle Rechte vorbehalten.<br />
Das Werk darf, auch teilweise,<br />
nur mit Genehmigung des Verlages<br />
weitergegeben werden.<br />
Autor: <strong>Harald</strong> <strong>Braem</strong><br />
Titelbilder: Katja Piolka<br />
Covergestaltung/Grafik: ELVEA<br />
Layout: Uwe Köhl<br />
Projektleitung<br />
www.bookunit.de