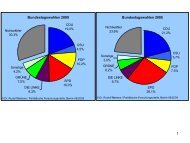Das Ende der Arbeitsgesellschaft
Das Ende der Arbeitsgesellschaft
Das Ende der Arbeitsgesellschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Das</strong> <strong>Ende</strong> <strong>der</strong> <strong>Arbeitsgesellschaft</strong>? Von wegen.<br />
Wer heute Arbeit hat, schuftet mehr denn je. Wer Arbeit sucht, muss sich auf ständig wechselnde<br />
Jobs einstellen<br />
4.12.2003 - Von Wolfgang Uchatius - Die Zeit - Man muss sich Herrn Ruggaber als einen glücklichen<br />
Menschen vorstellen. Eines Tages am Bodensee zum Beispiel steigt er mit seiner Frau auf einen<br />
Ausflugsdampfer. Um zu zahlen, klappt Ruggaber sein Portemonnaie auf. An <strong>der</strong> Kasse steht <strong>der</strong><br />
Schiffseigner selbst, sein Blick fällt auf Ruggabers Firmenausweis. Ein weißes Stück Plastik, darauf <strong>der</strong><br />
schwarz gedruckte Name eines großen deutschen Konzerns.<br />
„Schaffet Se etwa beim Daimler?“<br />
„Freilich.“<br />
„Ond wo?“<br />
„I mach d’ S-Klass.“<br />
„Subber, gradduliere. I hen selbscht oine. Des isch’s beschte Audo, was es gibbd.“<br />
<strong>Das</strong> mache ihn stolz, sagt Ruggaber: wenn jemand die S-Klasse lobt. Regierungschefs und<br />
Unternehmensvorstände, Amerikaner, Japaner und Schwaben, Reiche und Wichtige aller Län<strong>der</strong> fahren S-<br />
Klasse. Ruggaber nicht. Viel zu teuer. Trotzdem ist die S-Klasse sein Auto. An den Fließbän<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Halle<br />
46 des Daimler-Werks in Sindelfingen sieht er sie jeden Tag vom stählernen Skelett zur glänzenden<br />
Limousine wachsen. Sieht, wie die Kollegen die Sitzschienen und Auspuffanlagen an das Metall<br />
schrauben, an 288 Wagen am Tag. Früher hat Ruggaber mitgeschraubt, dann haben sie ihn beför<strong>der</strong>t, seit<br />
26 Jahren ist er jetzt in <strong>der</strong> Qualitätssicherung. Ruggaber kennt die S-Klasse wie ein Kind seinen Fischer-<br />
Technik-Kasten. Er passt auf, dass sich in den teuren Wagen kein Fehler versteckt. <strong>Das</strong> ist seine Arbeit. Im<br />
blau-grauen Kittel geht er die Bän<strong>der</strong> ab, schaut, prüft, testet. Fühlt sich wohl. Sagt: „Die Identifikation mit<br />
dem Produkt ist enorm.“<br />
52 Jahre alt ist er jetzt, ein kleiner, gedrungener Mann mit Dreiviertelglatze und grauem Bart. Vorname<br />
Hans, aufgewachsen in Mühringen bei Horb am Neckar, 1100 Einwohner. „Zwei davon fahren S-Klasse.“<br />
Da wohnt er noch immer. Sein Vater war <strong>der</strong> Erste im Ort, <strong>der</strong> zu Daimler ging. Heute arbeitet auch einer<br />
von Ruggabers zwei Söhnen dort, 50 Meter vom Vater entfernt.<br />
Rein statistisch kommt es auf ihn nicht an bei Mercedes. Er ist ja nur einer von 40000 Leuten im Werk, das<br />
groß ist wie eine kleine Stadt. Aber je<strong>der</strong> <strong>der</strong> 40000 hat nun einmal seine Aufgabe, wird irgendwo<br />
gebraucht. „Und darauf kommt es doch an im Leben“, sagt Ruggaber. „<strong>Das</strong>s man eine Arbeit hat, dass<br />
man gebraucht wird.“<br />
<strong>Arbeitsgesellschaft</strong>. Diesen Begriff wählen Sozialforscher, um ein Land wie Deutschland mit einem Wort zu<br />
beschreiben. Beson<strong>der</strong>s ein Land wie Deutschland, in dem die Leute ihren Beruf in Todesanzeigen<br />
schreiben und mitunter auf die Grabsteine und in dem sie, sollten sie einan<strong>der</strong> lebend kennen lernen,<br />
spätestens nach dem fünften Satz fragen: „Und, was machen Sie beruflich?“<br />
Nur, was geschieht mit <strong>der</strong> <strong>Arbeitsgesellschaft</strong>, wenn die Menschen keine Arbeit mehr finden?<br />
Anfang <strong>der</strong> siebziger Jahre, als sich Hans Ruggaber bei Daimler bewarb, waren in Deutschland ein paar<br />
hun<strong>der</strong>ttausend Menschen arbeitslos. Mitte <strong>der</strong> Neunziger waren es fast vier Millionen. Bücher und<br />
Aufsätze prophezeiten das <strong>Ende</strong> <strong>der</strong> Arbeit. Wissenschaftler wie <strong>der</strong> Starsoziologe Ulrich Beck erfanden<br />
neue Vorsilben für „Gesellschaft“. Wo massenhaft Arbeitsplätze fehlen, so die Annahme, tauge die<br />
Erwerbsarbeit nicht länger als sinnstiftendes Element. 1997 gaben mit Edmund Stoiber und Kurt<br />
Biedenkopf zwei leibhaftige Ministerpräsidenten eine Erklärung ab, in <strong>der</strong> sie das Naheliegende for<strong>der</strong>ten:<br />
Man müsse Alternativen finden, neue Formen <strong>der</strong> Beschäftigung.<br />
Auf den ersten Blick eine vernünftige Idee. Denn trotz steigen<strong>der</strong> Arbeitslosigkeit wächst das deutsche<br />
Volkseinkommen, allein seit 1991 um 17 Prozent, <strong>der</strong> verteilbare Wohlstand nimmt also zu. So gesehen,<br />
könnte es das Beste sein, die Erwerbslosen hörten auf, nach einem Job als Automechaniker o<strong>der</strong><br />
Bankkaufmann zu suchen. Stattdessen erledigten sie, was Sozialforscher als Bürgerarbeit bezeichnen: Sie<br />
engagieren sich ehrenamtlich und für gute Zwecke, helfen alten Nachbarn beim Einkaufen, trainieren junge<br />
Fußballer. Was sie zum Leben brauchen, gibt ihnen die Allgemeinheit. Deutschland braucht all die Arbeiter<br />
nicht mehr.<br />
Aber die Deutschen brauchen die Arbeit.<br />
<strong>Das</strong> <strong>Ende</strong> <strong>der</strong> <strong>Arbeitsgesellschaft</strong>? Von Wegen - Von Wolfgang Uchatius - Die Zeit, 4.12.2003
2<br />
Die Republik hat das Konzept einer Nichterwerbsgesellschaft abgestoßen wie ein menschlicher Körper ein<br />
falsch verpflanztes Organ. <strong>Das</strong> Land sehnt sich nach Jobs. „Arbeit, Arbeit, Arbeit“ plakatierte die SPD zu<br />
den Bundestagswahlen. O<strong>der</strong> auch: „Es gibt viele schöne Plätze, die schönsten sind Arbeitsplätze“. Wer<br />
das an<strong>der</strong>s sieht, gerät neuerdings in Schwierigkeiten. Bundesbürgern, die arbeiten können, aber nicht<br />
wollen, wird nach dem Willen von Regierung und Opposition künftig die Unterstützung gekürzt. Zwar soll,<br />
wer nicht arbeitet, auch weiterhin zu essen haben, aber nicht mehr so viel.<br />
<strong>Ende</strong> <strong>der</strong> <strong>Arbeitsgesellschaft</strong>? Von wegen. „Die Erwerbszentrierung ist nicht gesunken, son<strong>der</strong>n<br />
gestiegen“, sagt Gerd Mutz, Leiter des Münchner Instituts für Sozialforschung. Nie strömte ein so großer<br />
Teil <strong>der</strong> Bundesbürger zwischen 25 und 55 auf den Arbeitsmarkt wie heute (siehe Grafik). Nie hatten sie es<br />
so schwer, dort einen Platz zu finden. Umfragen zufolge sieht ein Großteil <strong>der</strong> Deutschen die Arbeit als<br />
Quelle von Zufriedenheit und Stolz. Aber wer heute einen Job bekommen und behalten will, muss<br />
Kompromisse schließen. Die Hoffnung auf Arbeit erzwingt Umzüge, beendet Freundschaften, verhin<strong>der</strong>t<br />
Familiengründungen und bringt Eltern dazu, ihren Kin<strong>der</strong>n das Spielen zu verbieten und das Lernen zu<br />
befehlen.<br />
Der Soziologe Wolfgang Bonß von <strong>der</strong> Universität <strong>der</strong> Bundeswehr in München sagt: „Die<br />
<strong>Arbeitsgesellschaft</strong> geht jetzt erst richtig los.“ Überall in <strong>der</strong> Republik ist das zu besichtigen. Ob in Berlin<br />
o<strong>der</strong> einem Dorf in Bayern, ob in Cottbus, Frankfurt o<strong>der</strong> einem Gewerbegebiet in Chemnitz.<br />
Man muss sich auch Frau Rothe als einen glücklichen Menschen vorstellen. Aber an<strong>der</strong>s als Hans<br />
Ruggaber. Sein Arbeitsleben läuft seit Jahrzehnten störungsfrei wie ein S-Klassen-Motor, ihres geriet<br />
immer wie<strong>der</strong> ins Stocken, starb ab. Jetzt ist es wie<strong>der</strong> angesprungen, endlich. Ihr Glück ist das einer<br />
Davongekommenen.<br />
Auch sie ist Anfang 50, eine kräftige Frau mit kurzen, grauen Haaren, die es nicht stört, wenn Arbeiten<br />
Zupacken bedeutet und einen krummen Rücken. Ursula Rothe: Aufgewachsen ist sie in Thüringen, gleich<br />
an <strong>der</strong> Grenze nach drüben, und gleich nach <strong>der</strong> Wende hat sie den Job verloren. Wie so viele im Osten.<br />
<strong>Das</strong> Arbeitsamt hat Ursula Rothe dann zur Industriemechanikerin umschulen lassen, zwei Jahre lang,<br />
obwohl sie als ausgebildete Elektromonteurin wenig Neues lernte. Weil Anfang 1993 keine Stellen für<br />
Industriemechaniker verfügbar waren, kam sie in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) unter:<br />
Zäune ziehen an einem Wildgatter. Damit die Hirsche nicht abhauen. Mit Industriemechanik hatte das<br />
wenig zu tun, aber sie war nicht unzufrieden. „Arbeit an <strong>der</strong> frischen Luft, das hat Spaß gemacht“, sagt<br />
Ursula Rothe. Außerdem hat sie dabei ihren heutigen Mann getroffen, was nicht untypisch ist. In <strong>der</strong><br />
Arbeitsrepublik Deutschland lernen sich 30 Prozent <strong>der</strong> Paare im Job kennen, und ABM zählen da natürlich<br />
auch dazu.<br />
Nach zwei Jahren war sie wie<strong>der</strong> arbeitslos, dann wie<strong>der</strong> ABM, diesmal Fahrradwege bauen, dann wie<strong>der</strong><br />
arbeitslos, fast drei Jahre lang. Also: Bewerbungen schreiben, fernsehen und täglich die Frage, wofür sie<br />
eigentlich aufsteht. Sie kannte ja die Statistiken, wonach in Deutschland nur rund zehn Prozent <strong>der</strong><br />
Arbeitslosen über 50 noch eine Stelle finden. Doch an einem Frühlingstag 1999 läutete das Telefon, eine<br />
Zeitarbeitsfirma war dran mit einem Angebot für sie, und da ist Ursula Rothe „eine Steinlawine vom Herzen<br />
gefallen“. Die Arbeit gab den Tagen ihre Ordnung wie<strong>der</strong>.<br />
Die Zeitarbeitsfirma hat sie zu Siemens nach Chemnitz geschickt. Dort ist sie heute noch. Sie bestückt<br />
Leiterplatten, steckt Transistoren, Dioden und Wi<strong>der</strong>stände auf grüne Kunststoffplatten, die dann an<strong>der</strong>swo<br />
in Fernseher o<strong>der</strong> Computer eingebaut werden. In diesem Jahr ist sie in die Siemens-Stammbelegschaft<br />
aufgerückt, arbeitet Frühschicht und Spätschicht, im wöchentlichen Wechsel. Genau wie Hans Ruggaber.<br />
Hans Ruggaber und Ursula Rothe: Für die Protokollanten <strong>der</strong> deutschen <strong>Arbeitsgesellschaft</strong> gehören beide<br />
zur selben großen Gruppe <strong>der</strong>er, die im so genannten Normalarbeitsverhältnis stehen. Trotz Minijobs und<br />
Zeitverträgen, steigen<strong>der</strong> Teilzeit- und Selbstständigenquote zählen noch immer 60 Prozent <strong>der</strong> deutschen<br />
Erwerbstätigen zu diesen Normalarbeitern: Sie haben unbefristete Vollzeitverträge. Trotzdem könnte <strong>der</strong><br />
Unterschied zwischen Ruggaber und Rothe kaum größer sein. Der Westdeutsche Hans Ruggaber hat seit<br />
drei Jahrzehnten so einen sicheren Arbeitsplatz, die Ostdeutsche Ursula Rothe erst seit einigen Monaten.<br />
Ruggaber ist sich gewiss, ihn bis zur Rente zu behalten, Rothe ist skeptischer. „Heutzutage kann man nie<br />
wissen.“<br />
<strong>Das</strong> <strong>Ende</strong> <strong>der</strong> <strong>Arbeitsgesellschaft</strong>? Von Wegen - Von Wolfgang Uchatius - Die Zeit, 4.12.2003
3<br />
Als vor gut 14 Jahren die Mauer fiel, galt <strong>der</strong> Westen dem Osten als ökonomisches Vorbild, und in vielen<br />
Dingen, von den Automarken bis zu den properen Einfamilienhäusern an den Stadträn<strong>der</strong>n haben sich die<br />
neuen Bundeslän<strong>der</strong> tatsächlich den alten angeglichen. In <strong>der</strong> Arbeitswelt aber war es eher umgekehrt. Die<br />
gefühlte o<strong>der</strong> echte Ungewissheit, die in den Neunzigern fast alle ostdeutschen Arbeitnehmer beschlich, ist<br />
heute, in <strong>der</strong> wirtschaftlichen Krise, schon beinahe gesamtdeutsche Realität. „Bundesweit ist nur noch ein<br />
Drittel <strong>der</strong> Beschäftigten über einen Zeitraum von fünf Jahren dauerhaft vollzeitbeschäftigt“, sagt <strong>der</strong><br />
Münchner Soziologe Wolfgang Bonß. „Die Mehrheit dagegen pendelt zwischen unbefristeter<br />
Vollzeitbeschäftigung und an<strong>der</strong>en Arbeitsformen o<strong>der</strong> zwischen Beschäftigung, Nichtbeschäftigung und<br />
Wie<strong>der</strong>beschäftigung.“ Die Normalarbeit hat ihre Normalität verloren. Deutschland im 21. Jahrhun<strong>der</strong>t, das<br />
heißt, arbeiten im Stop-and-go.<br />
Einerseits hat sich die Freizeit ausgeweitet. Im Schnitt arbeitet heute ein Bundesbürger 1443 Stunden im<br />
Jahr, weniger als je zuvor. An<strong>der</strong>erseits hat sich wie als Reaktion die Arbeit in die Freizeit gedrängt. Im<br />
Jahr 1970 lag die durchschnittliche jährliche Arbeitszeit noch bei 1956 Stunden. Aber damals hatten fast 85<br />
Prozent <strong>der</strong> Erwerbstätigen einen Normalarbeitsplatz, und damals hieß das noch: eine Anstellung auf<br />
Lebenszeit. Gingen die Normalarbeiter abends nach Hause, mussten sie an die Arbeit kaum noch<br />
Gedanken verschwenden. Gestern und heute waren eins, und auch morgen würden sie ihren Job noch<br />
haben. Die Arbeit war da, und deshalb konnte man sie vergessen. Die <strong>Arbeitsgesellschaft</strong> endete an den<br />
Fabriktoren.<br />
Rund 30 Jahre später, als Ursula Rothe als ABM-Kraft Zäune zog und Fahrradwege baute, da dachte sie in<br />
ihrer Freizeit nicht an Freizeit, son<strong>der</strong>n daran, wie es wohl weitergehe nach dem <strong>Ende</strong> <strong>der</strong> zeitlich<br />
befristeten ABM. Die große Mehrheit <strong>der</strong> Deutschen macht sich ähnliche Sorgen. Nach Angaben <strong>der</strong><br />
Industrielän<strong>der</strong>-Organisation OECD fürchten im Osten rund 95 Prozent und im Westen knapp 70 Prozent<br />
<strong>der</strong> Bundesbürger, sie könnten ihren Job verlieren. Die <strong>Arbeitsgesellschaft</strong> hat die Wohnzimmer erreicht.<br />
Victor Terbers Wohnungen sahen Jahre lang aus „wie die von Sozialhilfeempfängern“. Ein Bett, ein Stuhl,<br />
ein Tisch, ein kaputter Schrank. Am fehlenden Geld lag das nicht. Terber machte schon im ersten<br />
Berufsjahr 269000 Mark. Es lag an Terber selbst, <strong>der</strong> keine Zeit hatte, sich einzurichten, ganz abgesehen<br />
davon, dass es sich nicht lohnte. Er blieb ja nicht lange.<br />
Terber, <strong>der</strong> flexible Mensch. 1987 hatte <strong>der</strong> heute 36-Jährige begonnen, in Freiburg Medizin zu studieren,<br />
dazu Informatik an <strong>der</strong> Fernuni Hagen. Beides hat er nie abgeschlossen. Stattdessen hörte er sich<br />
Vorlesungen aller Fächer an, „außer Theologie“, kandidierte für die FDP vergeblich für den Bundestag und<br />
bastelte an Computern herum. Nach 20 Semestern brach er das Studium ab, warb per Anzeige in <strong>der</strong><br />
Computerwoche für sein Können und war von da an selbstständig. <strong>Das</strong> ist er bis heute. Selbstständig als<br />
was genau? „Gute Frage, auf meine Visitenkarte schreibe ich meistens IT-Consultant.“<br />
Soll heißen: Er programmiert und repariert Software. Vor allem ist er immer beim Kunden. <strong>Das</strong> sind meist<br />
große Unternehmen, und ein Auftrag dauert selten länger als ein Jahr. Also zieht Terber um. Ständig. Von<br />
Freiburg nach Düsseldorf, nach Wiesbaden, nach München. Irgendwann hatte er genug und mietete sich in<br />
Frankfurt „eine anständige Wohnung“. Knapp 100 Quadratmeter für ihn allein.<br />
Viel hat er nicht davon. Im September klingelte sein Handy: Siemens baue in London das mo<strong>der</strong>nste<br />
Postverteilzentrum Europas auf, brauche dringend Software-Experten. Terber nahm an, fünf Tage später<br />
stieg er ins Flugzeug. Jetzt arbeitet er jeden Monat drei Wochen in London, sechs Tage die Woche, zehn<br />
bis zwölf Stunden am Tag. Danach hat er eine Woche frei, dann sieht er seine Wohnung.<br />
Terber sagt, ihm gefalle dieses mo<strong>der</strong>ne <strong>Das</strong>ein. „Man lernt viel Neues kennen.“ Jahrelang hat er es<br />
deshalb ertragen, dass sich die Arbeit in sein Leben drängte, dass wenige Freundschaften die Umzüge<br />
überlebten, dass seine Existenz von immer neuen Aufträgen abhängt, die nach dem Internet-Boom<br />
plötzlich ausblieben. Vier, fünf Monate lang. „Hätte ich eine Familie, wäre ich ins Schwitzen gekommen.“ Er<br />
hat ja keine.<br />
Aber eigentlich will er eine. Deshalb fängt Terber an zu zweifeln. Und muss feststellen, dass so ein<br />
Arbeitsleben manchmal schwer zu lenken ist, selbst wenn <strong>der</strong> Motor wie<strong>der</strong> flüssig läuft.<br />
Vor etwas mehr als einem Jahr hat er eine Frau kennen gelernt, im Internet. Sie lebt in München, arbeitet<br />
bei einer Bio-Tech-Firma. Mit ihr, sagt Terber, könne er sich vorstellen, Kin<strong>der</strong> zu haben. Allerdings<br />
müssen sich die beiden beeilen, auch sie ist 36. Und wie soll das mit <strong>der</strong> Familie überhaupt funktionieren,<br />
<strong>Das</strong> <strong>Ende</strong> <strong>der</strong> <strong>Arbeitsgesellschaft</strong>? Von Wegen - Von Wolfgang Uchatius - Die Zeit, 4.12.2003
4<br />
wenn sie in München arbeitet und er in…, ja wo eigentlich? Der Vertrag mit Siemens in London endet im<br />
Sommer.<br />
Eine Festanstellung gäbe ihm Raum für das eigene Leben, aber selbst wenn Terber es wollte, er fände<br />
schwer einen Job, <strong>der</strong> ihm gefällt. Im strengen Sinn <strong>der</strong> deutschen Arbeitswelt hat er nichts gelernt. Keine<br />
Ausbildung abgeschlossen, kein Studium. Er denkt daran, sein für die Alterssicherung gedachtes Geld zu<br />
nehmen und ein Unternehmen aufzumachen. Eines, bei dem er in München leben kann. „Aber dazu fehlt<br />
mir noch eine tragfähige Geschäftsidee.“<br />
Fragt man Sozialforscher, woran es liegt, dass die Arbeit immer größere Teile des einst privaten Raumes<br />
besetzt, geben sie zwei Antworten.<br />
Erstens: „Die Unternehmen verlangen nach mehr Flexibilität“, sagt Ulrich Walwei vom Nürnberger Institut<br />
für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. An<strong>der</strong>s gesagt: Sie wollen ihre Kosten drücken. Deshalb läutete<br />
zum Beispiel bei Frau Rothe das Telefon. <strong>Das</strong> Siemens-Werk in Chemnitz gleicht<br />
Produktionsschwankungen bevorzugt mit Zeitarbeitern aus. Die kann man schnell einstellen, wenn die<br />
Aufträge steigen, und wenn diese sinken, wird man sie leicht wie<strong>der</strong> los. Als Angestellte <strong>der</strong><br />
Zeitarbeitsfirma saß Ursula Rothe zwei Meter neben Siemens-Kolleginnen, die die gleiche Arbeit<br />
erledigten, aber mehr Geld verdienten. Heute, da sie selbst zu Siemens gehört, sitzt sie zwei Meter neben<br />
Zeitarbeiterinnen, <strong>der</strong>en Neid sie spürt, weil sie nicht wissen, wie lange sie den Job noch haben.<br />
Zweitens: „Die Arbeit ist den Menschen wichtiger geworden“, sagt <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nisierungsforscher Helmut<br />
Klages von <strong>der</strong> Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Früher galt sie den Deutschen als<br />
notwendige Pflicht, nötig vor allem, um Geld zu verdienen. Über mögliche Berufe machten sie sich wenig<br />
Gedanken, oft gingen sie schlicht dorthin, wohin die Eltern sie schickten. Heute lesen sie dutzendweise<br />
Ratgeber, sitzen in Informationszentren, lassen von Psychologen ihre Talente und Neigungen testen. Die<br />
Arbeit hat sich zum Mittel <strong>der</strong> Selbstverwirklichung entwickelt. Für einen Großteil <strong>der</strong> Bundesbürger ist <strong>der</strong><br />
Beruf heute Teil des individuellen Lebensstils, ein Markenzeichen wie Mode o<strong>der</strong> Musikgeschmack. Noch<br />
vor 20 Jahren hätte einer wie Terber die nächstbeste Festanstellung angenommen. Heute sagt er: „Ich bin<br />
nicht <strong>der</strong> Typ, <strong>der</strong> 30 Jahre an einem Ort arbeitet.“<br />
In den Sechzigern o<strong>der</strong> Siebzigern entsprachen viele Deutsche noch diesem Typ. Weil damals<br />
Vollbeschäftigung herrschte, sind diese Jahre als Hochzeit <strong>der</strong> Arbeit im kollektiven Gedächtnis verhaftet,<br />
als die Zeit des Wirtschaftswun<strong>der</strong>s und <strong>der</strong> Stahlarbeiter. Tatsächlich waren sie, zumindest im Westen,<br />
die Zeit <strong>der</strong> Hausfrauen. 1970 strebten 48 von 100 Frauen im Alter zwischen 25 und 55 auf den<br />
Arbeitsmarkt. Heute sind es 79. <strong>Das</strong> hat auch damit zu tun, dass in den vergangenen Jahren die realen<br />
Nettolöhne kaum gestiegen sind; Haushalte, die sich finanziell verbessern wollen, können es sich nicht<br />
leisten, dass nur einer Geld verdient. Vor allem aber liegt es daran, dass Frauen heute „Anspruch auf ein<br />
Stück eigenes Leben“ erheben, so die Soziologin Elisabeth Beck-Gernsheim. Sie wollen, was ihre Männer<br />
wollen: einen Beruf.<br />
So gesehen, krankt <strong>der</strong> Kapitalismus hierzulande an seinem eigenen Erfolg. Anstatt sich wie anständige<br />
Marxisten ausgebeutet und entfremdet zu fühlen, haben die Deutschen die Arbeit schätzen gelernt.<br />
Weshalb es nicht mehr genug Jobs für alle gibt.<br />
O<strong>der</strong> etwa doch?<br />
An den Wochenenden kommen die Ersten so gegen neun o<strong>der</strong> zehn. Hängt auch vom Wetter ab. Bei<br />
Regen kommen weniger. Aber ein paar schauen immer vorbei, junge Frauen zumeist, Unternehmer- o<strong>der</strong><br />
Anwaltstöchter. In Reitstiefeln, Reithose und mit Reitkappe reden sie auf ihre Pferde ein, striegeln sie,<br />
streicheln sie und führen sie von <strong>der</strong> Koppel für den wöchentlichen Ausritt. Gut, dass Bielecki die drei<br />
Dutzend Pferde morgens schon gefüttert hat.<br />
Er hat sie auch getränkt, ihren Mist in die Schubkarre geladen und weggebracht, und jetzt hievt er mit <strong>der</strong><br />
Mistgabel große Strohballen vom Hänger in die Schubkarre. Dabei flucht er wie<strong>der</strong> einmal innerlich, dass<br />
die Pferde nicht alle in einem großen Stall stehen, son<strong>der</strong>n in fünf kleinen, verstreut über die ganze Koppel.<br />
Deshalb muss er dauernd rennen. Wenigstens regnet es nicht.<br />
Seit bald zwei Jahren läuft er jetzt auf diesem Pferdehof herum. Dariusz Bielecki (Name geän<strong>der</strong>t), Mitte<br />
30, eigentlich ausgebildeter Musiker, aber als Musiker verdient er in Polen nicht viel, außer im Sommer und<br />
an Weihnachten und Ostern, da spielt er auf Hochzeiten und bei Familienfesten. In <strong>der</strong> übrigen Zeit ist er<br />
meist in Deutschland. Offiziell als Tourist, inoffiziell als illegaler Arbeiter, als Knecht bei einem bayerischen<br />
<strong>Das</strong> <strong>Ende</strong> <strong>der</strong> <strong>Arbeitsgesellschaft</strong>? Von Wegen - Von Wolfgang Uchatius - Die Zeit, 4.12.2003
5<br />
Bauern, <strong>der</strong> entdeckt hat, dass er gutes Geld verdienen kann, wenn er auf seinen Wiesen die Pferde<br />
wohlhaben<strong>der</strong> Städter versorgt. O<strong>der</strong> von billigen Polen wie Bielecki versorgen lässt. Die wohnen zu dritt in<br />
zwei Zimmern im alten Bauernhaus, arbeiten zehn Stunden am Tag, am Sonntag fünf, erledigen auch noch<br />
den Neubau des Hauses, und das alles für freies Essen und 200 Euro die Woche, bar auf die Hand. Ein<br />
Deutscher würde sich dafür nie finden.<br />
Nach Schätzung des Ökonomen Friedrich Schnei<strong>der</strong> von <strong>der</strong> Universität Linz sind inzwischen 1,2 Millionen<br />
illegal beschäftigte Auslän<strong>der</strong> Teil <strong>der</strong> deutschen <strong>Arbeitsgesellschaft</strong>. Sie putzen, misten, spülen und<br />
schrubben, erledigen Jobs, für die es in Deutschland zwar eine Nachfrage gibt, aber kein Angebot,<br />
jedenfalls nicht zu diesem Preis. „Sie machen die Arbeit für weniger Geld und weniger Ärger“, so die<br />
Sozialwissenschaftlerin Helma Lutz von <strong>der</strong> Universität Münster, die davon ausgeht, dass acht Prozent <strong>der</strong><br />
deutschen Haushalte ausländische Putz- o<strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>frauen beschäftigen.<br />
Theoretisch wäre das große Problem <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Marktwirtschaft also leicht zu lösen. Die Deutschen<br />
müssten sich auf einfache Arbeiten besinnen, längst vergessene Berufe zu neuem Leben erwecken:<br />
Knechte, Mägde, Dienstmädchen, Tellerwäscher.<br />
Kaum einer ist dazu bereit, und das liegt weniger daran, dass die Deutschen fauler wären als die Polen,<br />
son<strong>der</strong>n daran, dass „in <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Gesellschaft Selbstvertrauen und sozialer Status untrennbar mit<br />
unserer Arbeit und unserem Einkommen verbunden sind“, wie es <strong>der</strong> Wirtschaftsnobelpreisträger Robert<br />
Solow schon vor Jahren ausdrückte.<br />
Für Dariusz Bielecki bedeutet die Schufterei auf <strong>der</strong> Pferdekoppel einen Fortschritt, weil er so seiner<br />
Familie in Tschenstochau ein Haus, ein Statussymbol, finanzieren kann. Für die meisten Deutschen wäre<br />
es ein Abstieg und das <strong>Ende</strong> dessen, was <strong>der</strong> Frankfurter Soziologe Sighard Neckel die „zentrale<br />
Erfahrung“ deutscher Nachkriegsgeschichte nennt: „Bisher ist es vielen, fast allen, stetig besser<br />
gegangen.“<br />
Dann fügt er hinzu: „Aber das bricht jetzt zusammen.“<br />
Im Erzgebirge kleben Frauen heute für 4 Euro die Stunde Holzfiguren zusammen, in Berlin arbeiten<br />
Wachmänner nicht selten 60 Stunden in <strong>der</strong> Woche für wenig mehr, in Cottbus kommt Christine Schuller<br />
(Name geän<strong>der</strong>t) netto auf 2,40 Euro pro Stunde. Fürs Waschen, Schneiden, Föhnen.<br />
Friseurin war immer ihr Traumberuf. „Aber zu DDR-Zeiten lief das nur über Beziehungen.“ Damals hat sie<br />
in einem volkseigenen Betrieb Patronenhülsen geschliffen, nach <strong>der</strong> Wende und nach jahrelangem Jobben<br />
aber doch die Chance ergriffen und sich zur Friseurin umschulen lassen. Mitte 30 ist sie jetzt und arbeitet<br />
bei einer großen Friseurkette. Statt eines Festgehalts erhält sie eine kleine Umsatzbeteiligung. So kommt<br />
sie brutto auf etwas über 400 Euro im Monat. Bis vor kurzem musste sie als Alleinerziehende auch noch<br />
ihre 16-jährige Tochter versorgen, was nur klappte, weil <strong>der</strong> Staat Geld zuschoss, damit sie wenigstens<br />
den Sozialhilfesatz erreichte.<br />
Inzwischen ist die Tochter zum Vater gezogen, „finanziell hat sie es da besser“, und Christine Schuller hat<br />
ihren Arbeitgeber verklagt. Er soll ihr wenigstens das Tarifgehalt zahlen. Dann erhielte sie brutto 700 Euro<br />
im Monat. Reich wird sie auch damit nicht, aber sie könnte helfen, ihrer Tochter das Auslandsjahr in<br />
Amerika zu finanzieren. Die geht aufs Gymnasium und will wahrscheinlich studieren. Sie wird es besser<br />
haben, hofft Christine Schuller.<br />
Zwar ist die Zahl <strong>der</strong> arbeitslosen Akademiker in den vergangenen Jahren sprunghaft gestiegen, aber noch<br />
immer ist ein Studium die beste Versicherung gegen einen schlechten Job und viele Unannehmlichkeiten<br />
<strong>der</strong> <strong>Arbeitsgesellschaft</strong>. Nur, dafür muss man erst einmal das Diplom ablegen und das Vordiplom, muss<br />
das Abitur bestehen und die Prüfungen in <strong>der</strong> Grundschule. Nicht je<strong>der</strong> schafft das einfach so.<br />
<strong>Das</strong> weiß auch die steigende Zahl von Eltern, die heute schon Sechsjährige von einer Schule in die an<strong>der</strong>e<br />
schicken, weil sie glauben, dass sie dort besser geför<strong>der</strong>t werden. Die sich, bevor die Kin<strong>der</strong> die dritte<br />
Klasse erreicht haben, nach dem besten Gymnasium erkundigen. Wahrscheinlich wissen es auch die<br />
inzwischen mehreren zehntausend Eltern, die ihren Kin<strong>der</strong>n täglich Psychopharmaka verabreichen, um<br />
Aufmerksamkeit und Konzentration zu stärken. Die <strong>Arbeitsgesellschaft</strong> ist in den Kin<strong>der</strong>zimmern<br />
angekommen.<br />
<strong>Das</strong> <strong>Ende</strong> <strong>der</strong> <strong>Arbeitsgesellschaft</strong>? Von Wegen - Von Wolfgang Uchatius - Die Zeit, 4.12.2003
6<br />
Kein Wun<strong>der</strong>. Unternehmensverbände, wie kürzlich die Vereinigung <strong>der</strong> Bayerischen Wirtschaft, warnen<br />
regelmäßig, die Fähigkeiten deutscher Schul- und Hochschulabgänger genügten den Anfor<strong>der</strong>ungen des<br />
Arbeitsmarktes nicht mehr. Und was heißt hier Schulen: Jürgen Kluge, Chef <strong>der</strong> Unternehmensberatung<br />
McKinsey, zum Beispiel betont in Talkshows und Interviews stets, die Zukunft beginne nicht in <strong>der</strong><br />
Grundschule, son<strong>der</strong>n im Kin<strong>der</strong>garten. Schon dort würden die Weichen gestellt für die spätere<br />
Leistungsfähigkeit kleiner Menschen.<br />
Malte Freier kann sich zwar kaum an seinen Kin<strong>der</strong>garten erinnern. Trotzdem würden ihm wohl alle<br />
Unternehmensverbände zugestehen, dass er ihre Anfor<strong>der</strong>ungen voll und ganz erfüllt. Auslandsstudium,<br />
Praktika, glänzendes Diplom. Danach fand er sofort den ersten Job, <strong>der</strong> nicht <strong>der</strong> letzte blieb.<br />
Freier war für einen deutschen Konzern in Asien, hat eine Dotcom-Firma selbst gegründet, bei einer<br />
an<strong>der</strong>en als Geschäftsführer gearbeitet und heute, mit Mitte 30, ist er in Berlin bei einer großen<br />
Unternehmensberatung. Allerdings nicht mehr lange, weil er schon mit Kollegen daran bastelt, ein eigenes<br />
Beratungsunternehmen zu gründen. Außer diesen Kollegen darf das niemand wissen, deshalb darf<br />
niemand seinen echten Namen erfahren, im Moment. O<strong>der</strong> eigentlich nie. Denn „<strong>der</strong> Malte“, sagen<br />
Freunde, „<strong>der</strong> sucht dauernd nach Neuem, plant immer den Absprung.“<br />
Klar, so eine Firmengründung könne auch schief gehen, sagt Freier, <strong>der</strong> für einen kleinen Sohn sorgen<br />
muss. Aber na und, seine Frau sei auch Unternehmensberaterin, beide seien sie hervorragend<br />
ausgebildet, einer werde immer einen guten Job finden. „Es gibt tausend Sachen, die man machen kann.“<br />
Während des Studiums war Freier Triathlet. Heute sieht er den Beruf als Sport, den Arbeitgeber als<br />
Sponsor, den man wechselt, wenn das Geld nicht stimmt. „Es ist ein Deal, nichts weiter.“ So gesehen<br />
verbindet ihn nichts mit dem Daimler-Arbeiter Hans Ruggaber, <strong>der</strong> sagt, dass <strong>der</strong> Konzern ihm viel<br />
gegeben habe, und dabei nicht an sein Konto denkt. Dennoch haben sie viel gemein. Beide gehören zu<br />
jenen Deutschen, die sich gut eingerichtet haben in <strong>der</strong> Arbeitswelt, <strong>der</strong> eine in <strong>der</strong> alten, die immer kleiner<br />
wird, <strong>der</strong> an<strong>der</strong>e in <strong>der</strong> neuen.<br />
Man muss sich Malte Freier als einen glücklichen Menschen vorstellen.<br />
<strong>Das</strong> <strong>Ende</strong> <strong>der</strong> <strong>Arbeitsgesellschaft</strong>? Von Wegen - Von Wolfgang Uchatius - Die Zeit, 4.12.2003