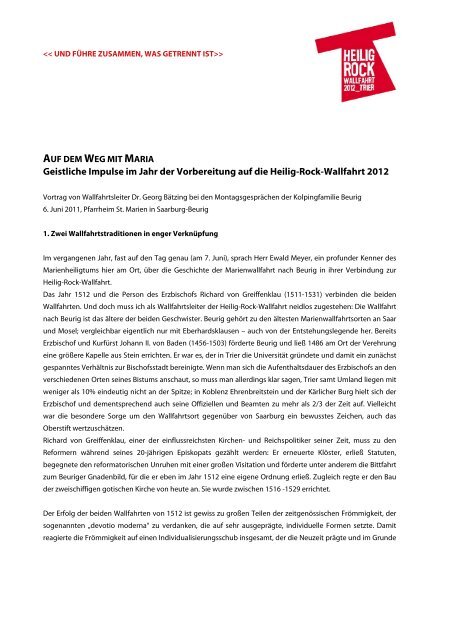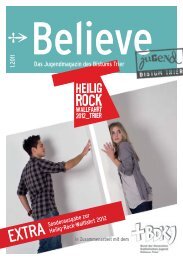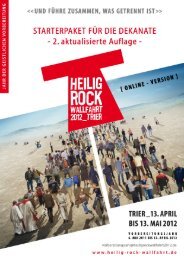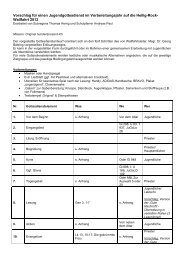auf dem weg mit maria - Heilig Rock Wallfahrt
auf dem weg mit maria - Heilig Rock Wallfahrt
auf dem weg mit maria - Heilig Rock Wallfahrt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
AUF DEM WEG MIT MARIA<br />
Geistliche Impulse im Jahr der Vorbereitung <strong>auf</strong> die <strong>Heilig</strong>-<strong>Rock</strong>-<strong>Wallfahrt</strong> 2012<br />
Vortrag von <strong>Wallfahrt</strong>sleiter Dr. Georg Bätzing bei den Montagsgesprächen der Kolpingfamilie Beurig<br />
6. Juni 2011, Pfarrheim St. Marien in Saarburg-Beurig<br />
1. Zwei <strong>Wallfahrt</strong>straditionen in enger Verknüpfung<br />
Im vergangenen Jahr, fast <strong>auf</strong> den Tag genau (am 7. Juni), sprach Herr Ewald Meyer, ein profunder Kenner des<br />
Marienheiligtums hier am Ort, über die Geschichte der Marienwallfahrt nach Beurig in ihrer Verbindung zur<br />
<strong>Heilig</strong>-<strong>Rock</strong>-<strong>Wallfahrt</strong>.<br />
Das Jahr 1512 und die Person des Erzbischofs Richard von Greiffenklau (1511-1531) verbinden die beiden<br />
<strong>Wallfahrt</strong>en. Und doch muss ich als <strong>Wallfahrt</strong>sleiter der <strong>Heilig</strong>-<strong>Rock</strong>-<strong>Wallfahrt</strong> neidlos zugestehen: Die <strong>Wallfahrt</strong><br />
nach Beurig ist das ältere der beiden Geschwister. Beurig gehört zu den ältesten Marienwallfahrtsorten an Saar<br />
und Mosel; vergleichbar eigentlich nur <strong>mit</strong> Eberhardsklausen – auch von der Entstehungslegende her. Bereits<br />
Erzbischof und Kurfürst Johann II. von Baden (1456-1503) förderte Beurig und ließ 1486 am Ort der Verehrung<br />
eine größere Kapelle aus Stein errichten. Er war es, der in Trier die Universität gründete und da<strong>mit</strong> ein zunächst<br />
gespanntes Verhältnis zur Bischofsstadt bereinigte. Wenn man sich die Aufenthaltsdauer des Erzbischofs an den<br />
verschiedenen Orten seines Bistums anschaut, so muss man allerdings klar sagen, Trier samt Umland liegen <strong>mit</strong><br />
weniger als 10% eindeutig nicht an der Spitze; in Koblenz Ehrenbreitstein und der Kärlicher Burg hielt sich der<br />
Erzbischof und <strong>dem</strong>entsprechend auch seine Offiziellen und Beamten zu mehr als 2/3 der Zeit <strong>auf</strong>. Vielleicht<br />
war die besondere Sorge um den <strong>Wallfahrt</strong>sort gegenüber von Saarburg ein bewusstes Zeichen, auch das<br />
Oberstift wertzuschätzen.<br />
Richard von Greiffenklau, einer der einflussreichsten Kirchen- und Reichspolitiker seiner Zeit, muss zu den<br />
Reformern während seines 20-jährigen Episkopats gezählt werden: Er erneuerte Klöster, erließ Statuten,<br />
begegnete den reformatorischen Unruhen <strong>mit</strong> einer großen Visitation und förderte unter anderem die Bittfahrt<br />
zum Beuriger Gnadenbild, für die er eben im Jahr 1512 eine eigene Ordnung erließ. Zugleich regte er den Bau<br />
der zweischiffigen gotischen Kirche von heute an. Sie wurde zwischen 1516 -1529 errichtet.<br />
Der Erfolg der beiden <strong>Wallfahrt</strong>en von 1512 ist gewiss zu großen Teilen der zeitgenössischen Frömmigkeit, der<br />
sogenannten „devotio moderna“ zu verdanken, die <strong>auf</strong> sehr ausgeprägte, individuelle Formen setzte. Da<strong>mit</strong><br />
reagierte die Frömmigkeit <strong>auf</strong> einen Individualisierungsschub insgesamt, der die Neuzeit prägte und im Grunde
ja auch der geistige Nährboden für die Reformation geworden ist. In diesem Zusammenhang wurden<br />
sogenannte „christozentrische Heiltümer“ zunehmend beliebt; dazu zählen neben Reliquien, die <strong>auf</strong> das Leben<br />
und Leiden Jesu Christi hinweisen, eben auch <strong>maria</strong>nische <strong>Wallfahrt</strong>sorte. Die Förderung dieser<br />
Frömmigkeitstraditionen hat sich (im Nachhinein betrachtet) allerdings als wenig nachhaltig erwiesen. Sie<br />
konnte der wenige Jahre später einsetzenden Reformationsbe<strong>weg</strong>ung nicht wirklich etwas entgegen setzen –<br />
womöglich auch, weil sie zu sehr äußerlich orientiert war.<br />
Das Jahr, der Name „Richard von Greiffenklau“ und die Absicht, die Menschen durch Stärkung ihrer<br />
persönlichen Frömmigkeit an die Kirche und an den Glauben zu binden, verbinden also Trier und Beurig. Und<br />
doch besteht ein entscheidender Unterschied. Der Erzbischof hat die Marienverehrung in Beurig von Anfang an<br />
persönlich aktiv unterstützt. Dagegen setzte er sich, ähnlich wie das Trierer Domkapitel, der von Kaiser<br />
Maximilian I. im Frühjahr 1512 angeregten Erhebung der Reliquie der Tunika Christi zunächst hartnäckig<br />
entgegen. Sucht man Gründen dafür, muss man die Glaubensgestalt der damaligen Zeit berücksichtigen: Es<br />
gibt in der Trierer Reliquientradition eine tief sitzende Scheu vor einer unwürdigen Be<strong>weg</strong>ung und Erhebung<br />
des Heiltums und die Angst vor einer daraus zu erwartenden Strafe Gottes. Da<strong>mit</strong> lebten die Menschen (vgl. die<br />
Erblindungsepisode aus der Agritius-Helena-Vita um das Jahr 1072), das prägte sie. Inwieweit darüber hinaus<br />
auch theologische Gründe – etwa lehramtliche Verlautbarungen gegen die öffentliche Zeigung von Reliquien –<br />
eine Rolle spielten, muss offen bleiben. Vermutlich aber misstrauten der Trierer Erzbischof und das Domkapitel<br />
offensichtlich der Uneigennützigkeit des Kaisers. Sie wollten einer möglichen Entfremdung der größten Trierer<br />
Reliquie durch den Kaiser vorbeugen (vgl. Michael Embach, Die Rolle Kaiser Maximilians I. [1459-1519] im<br />
Rahmen der Trierer <strong>Heilig</strong>-<strong>Rock</strong>-Ausstellung von 1512, in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 21<br />
[1995] 409-438, hier: 437).<br />
Gewiss war der Habsburger Maximilian ein frommer Mensch, aber er war auch ein kluger Politiker, der für sich<br />
selbst Propaganda betrieb, in<strong>dem</strong> er <strong>mit</strong> großen Gesten, die äußerlich nichts <strong>mit</strong> den politischen<br />
Verhandlungen zu tun hatten, doch die Atmosphäre etwa eines Reichstages beeinflussen konnte. Nicht<br />
umsonst ließ der Kaiser <strong>mit</strong> der Erhebung des <strong>Heilig</strong>en <strong>Rock</strong>es solange warten, bis hochgestellte Personen in<br />
Trier angereist waren. Die Erhebung der Tunika Christi stellt ein Element des christlichen Kaisermythos dar, den<br />
Maximilian I. für sich zu nutzen wusste. Sie geschah sicher nicht zufällig. Im Hause Habsburg gab es bereits eine<br />
verwurzelte Verehrung des Kreuzes Jesu Christi, und als Vorbild bezog man sich <strong>auf</strong> Kaiser Konstantin.<br />
Maximilian hatte darüber hinaus großes Interesse an der Kaisermutter Helena; seine eigene Mutter nahm bei<br />
der Heirat sehr bewusst den neuen Namen „Helena“ an. Unter <strong>dem</strong> Blickwinkel eines typologischen<br />
Geschichtsverständnisses konnten sich also geschichtliche Ereignisse wiederholen: Im Jahr 1512 wird <strong>dem</strong> Sohn
der Kaiserin Helena die Gnade zuteil, den <strong>Heilig</strong>en <strong>Rock</strong> Christi zu sehen und nach Jahrhunderten in<br />
Verborgenheit nunmehr der Verehrung der Menschen zuzuführen. Das heißt, die Erhebung stilisiert die<br />
kaiserliche Würde und bezieht die Person des Kaisers <strong>auf</strong> ihre geschichtlichen Wurzeln und Vorbilder.<br />
Dies alles bedeutet freilich nicht, dass die Auffindung der Tunika Christi ganz „inszeniert“ wurde und nicht<br />
bereits <strong>auf</strong> vorhandene Traditionen zurückgriff. Schon 1473 war Maximilian als 14-jähriger Begleiter seines<br />
Vaters zum ersten Mal in Trier gewesen und hatte dort von der Konstantin-Helena-Tradition gehört, wie auch<br />
von der Kostbarkeit des <strong>Heilig</strong>en <strong>Rock</strong>es, die schriftlich spätestens seit <strong>dem</strong> 11. Jahrhundert bezeugt ist. Dass<br />
<strong>dem</strong> Kaiser die Reliquie auch persönlich wichtig war, belegt die Tatsache, dass er sich bei seinem letzten<br />
Aufenthalt in Trier im Jahr 1517 die Tunika Christi nochmals zeigen ließ.<br />
Zwei <strong>Wallfahrt</strong>straditionen in enger Verknüpfung – bei genauerem Hinsehen aber doch sehr verschieden. 1512<br />
begegnen sich aus unterschiedlichen Herkünften die Traditionsfäden der Beuriger Marienwallfahrt und der<br />
Trierer <strong>Heilig</strong>-<strong>Rock</strong>-Tradition wie in einem Knotenpunkt, um dann für einige Jahre dicht <strong>mit</strong>einander verwoben<br />
zu bleiben. Danach lösten sie sich wieder voneinander. Doch beide <strong>Wallfahrt</strong>en existieren bis heute; und im<br />
kommenden Jahr verknüpfen sich die Fäden wieder in einem Knotenpunkt. Das rechtfertigt die Frage, wie die<br />
Marienwallfahrt an der Saar und die Christuswallfahrt in der Moselmetropole religiös zusammenhängen. Gibt es<br />
zwischen beiden einen inneren Zusammenhang geistlicher Art, der unseren Glauben als Zeitgenossen des 21.<br />
Jahrhunderts zu inspirieren vermag? Für diese Überlegungen ersuche ich jetzt noch eine zeitlang Ihre<br />
Aufmerksamkeit.<br />
2. Geistliche Impulse aus der Verbindung der Beuriger Marienwallfahrt und der <strong>Heilig</strong>-<strong>Rock</strong>-<strong>Wallfahrt</strong><br />
nach Trier<br />
a. Kleider machen Leute<br />
Erst seit den Restaurierungsarbeiten in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts bietet sich das gotische Bildnis der<br />
stillenden Muttergottes (Maria lactans) <strong>dem</strong> Anblick der Beter wieder frei und unverhüllt. Man hatte den Mut,<br />
die Kleider <strong>weg</strong>zunehmen, <strong>mit</strong> denen man Jahrhunderte verschämt die Brust einer Mutter bedeckt hatte, die ihr<br />
Kind stillt. Darf man die Muttergottes so entblößt darstellen? Ich denke, es hat schon Diskussionen gegeben.<br />
Gehören nicht Kleider dazu? Waren sie nicht – ebenso wie die Kronen für Jesus und Maria – Ausdruck einer
besonderen Verehrung (man denke an den Bildtypus des Luxemburger Gnadenbildes der Trösterin der<br />
Betrübten und ihre vielen kostbaren Kleider)?<br />
Doch wenn das so ist, dann war <strong>mit</strong> Jesus im wahrsten Sinn des Wortes nicht viel „Staat zu machen“. Er trug das<br />
Kleid der Armen. Noch heute ist der Anblick des <strong>Heilig</strong>en <strong>Rock</strong>es nicht besonders „erhebend“ im äußeren Sinn.<br />
Erdfarben, zerklüftet, in Stoffschollen auseinanderklaffend präsentiert sich das Kleid. Man hat die<br />
ursprünglichen Reliquien bereits seit <strong>dem</strong> frühen Mittelalter immer wieder <strong>mit</strong> Stoffen umhüllt, wollte sie<br />
schützen, bewahren – und hat ihm schließlich bei Versuchen der Konservierung Ende des 19. Jahrhunderts<br />
großen Schaden zugefügt.<br />
Als man in Beurig die äußeren Hüllen vom Marienbild <strong>weg</strong>nahm, sah man das Bild wirklicher Schönheit. Seither<br />
erzählt das Bild wieder von der wahren Menschheit Jesu Christi, der wie jedes Baby <strong>auf</strong> die Muttermilch<br />
angewiesen war, um wachsen zu können; der angewiesen war <strong>auf</strong> menschliche Wärme, Geborgenheit und<br />
Liebe. Ja, so anstößig konkret ist unser christlicher Glaube an die Menschwerdung Gottes, dass wir annehmen:<br />
Gott brauchte eine Mutter, das menschliche Ja-Wort, um zur Welt kommen zu können. Ohne die äußeren<br />
Hüllen „spricht“ das Beuriger Marienbild also wieder stark vom Glauben.<br />
Ohne die äußere Hülle gab sich auch Gott zu erkennen in Jesus Christus. Als man ihm für die Kreuzigung seine<br />
Kleider nahm, da wurde ansichtig, wozu der Herr wirklich fähig war. Er wollte wirklich das Äußerste geben, sich<br />
hingeben aus Liebe zu uns Menschen bis in den Tod. Was er zurückließ, was er gelassen hat, das ist heute unser<br />
Schatz – so darf man im übertragenen Sinn vom <strong>Heilig</strong>en <strong>Rock</strong> sagen. Kleider machen Leute? Der äußere<br />
Anschein gibt es so vor; unsere Erfahrung sagt zu Recht: oft kaschieren sie, verbergen; geben vor, was innerlich<br />
nicht gedeckt ist.<br />
Darf man aus dieser interessanten Parallele zwischen den „Gnadenbildern“ in Trier und Beurig einen geistlichen<br />
Impuls für uns ableiten? Es legt sich nahe. Und ich fand ihn in einem Text bei Richard Rohr (* 1943,<br />
amerikanischer Franziskanerpater, Autor spiritueller Bücher):<br />
Man wird nicht durch Hinzufügen heilig,<br />
sondern durch Abziehen:<br />
durch das Ablegen seiner Illusionen,<br />
das Loslassen seiner Fassaden,<br />
das Freilegen seines falschen Ich,<br />
das Aufbrechen seines Herzens<br />
und die Offenheit<br />
und das Verständnis für andere.
Und bei all<strong>dem</strong><br />
nimmt man sein eigenes Ich nicht so wichtig.<br />
Wir sind gewissermaßen<br />
<strong>auf</strong> der völlig falschen Spur:<br />
Wir bemühen uns um einen Aufstieg,<br />
während Jesus absteigt.<br />
Da ist viel Wahres dran. Aber leicht ist es nicht. Loslassen, abgeben, Blöße eingestehen fällt uns schwer. Das<br />
geht Einzelnen so, und da<strong>mit</strong> tun sich Gemeinschaften von Menschen nicht leicht: Parteien, Verbände, Kirchen<br />
tun sich schwer da<strong>mit</strong>, Verlust und Schwäche einzugestehen. Wir Menschen suchen die Hüllen, die Häute,<br />
Kleider, um da<strong>mit</strong> unsere Scham vor der eigenen Blöße zu bedecken. Die eigene Haut reicht uns nicht. Kleider<br />
werden uns zur zweiten Haut. Das Haus und die Wohnung sozusagen zur dritten Haut – und weitere folgen.<br />
Interessanterweise verbindet die <strong>Heilig</strong>e Schrift die erste Erwähnung von Kleidern <strong>mit</strong> <strong>dem</strong> Sündenfall („Da<br />
gingen beiden die Augen <strong>auf</strong>, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen<br />
und machten sich einen Schurz. … Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen und<br />
bekleidete sie da<strong>mit</strong>“: Gen 3, 7.21).<br />
Die Enthüllungsskandale über den Missbrauch von Kindern und jungen Menschen durch Priester und in<br />
kirchlichen Einrichtungen beschämen uns doch auch deshalb noch Jahrzehnte nach der eigentlichen Tat, weil<br />
man so lange versucht hat, das Verbrechen an diesen Menschen zu verbergen – und so verhindert hat, dass den<br />
Opfern die nötige Hilfe zur Aufarbeitung ihres Traumas gegeben werden konnte. Auch im politischen bis hin<br />
zum persönlichen Bereich erregen „Enthüllungen“ deshalb solches Aufsehen, weil sie den immer neuen<br />
Versuchen, die Wirklichkeit zu kaschieren, ein Ende machen. Niemand will sich gern Blößen geben. Und doch<br />
müssen wir irgendwie lernen, <strong>mit</strong> unseren Schwächen, Grenzen, <strong>mit</strong> Schuld und Versagen zu leben – auch<br />
wenn sie uns beschämen.<br />
Eine bildliche Darstellung der Tunika Christi, des <strong>Heilig</strong>en <strong>Rock</strong>es, begleitet mich seit <strong>dem</strong> vergangenen Jahr<br />
besonders. Ich fand sie am romanischen T<strong>auf</strong>becken des Domes von San Gimignano in der Toskana. Da ist die<br />
T<strong>auf</strong>e Jesu dargestellt – nicht umsonst bereits am Beginn der Evangelien ein Vorausbild <strong>auf</strong> die Demut und den<br />
Gehorsam Jesu, die ihn ans Kreuz führen. Jesus steigt nackt in den Jordan herab, um sich von Johannes t<strong>auf</strong>en<br />
zu lassen. Unterdessen hält ein Engel sein Gewand. Er hält es <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> Relief so, als wollte er es uns entgegen<br />
halten, als sollten wir es uns überstreifen. Als der Apostel Paulus den Gemeinden Galatiens den Sinn der T<strong>auf</strong>e<br />
und ihre tiefe Wirkung zu verdeutlichen sucht, schreibt er: „Ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in
Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr <strong>auf</strong> Christus get<strong>auf</strong>t seid, habt Christus (als Gewand) angelegt“ (Gal 3, 26-27).<br />
Der Glaube an Jesus Christus ist also unser neues Kleid: Ein Kleid der Barmherzigkeit, das unsere Blöße bedeckt;<br />
wir sind und bleiben allezeit Gottes geliebte Kinder. Ein Kleid, das uns behütet wie ein zweite Haut; wer echte<br />
Glaubensüberzeugungen hat und daraus lebt, der wagt auch den Widerspruch gegen den Mainstream, wenn er<br />
da<strong>mit</strong> seinem Gewissen folgt. Ein Kleid, das uns schmückt und „gut aussehen“ lässt, ohne in Äußerlichkeiten<br />
abzudriften; wünschen wir uns das nicht sehr für die Kirche in unserer Zeit? Solch ein Kleid ist der christliche<br />
Glaube.<br />
b. Man muss gehen können und bleiben<br />
Einen feinen Unterschied sehe ich zwischen der Beuriger Marienwallfahrt und der Trierer <strong>Heilig</strong>-<strong>Rock</strong>-<strong>Wallfahrt</strong>;<br />
und der gibt <strong>mit</strong> wieder Anregung, einen geistlichen Nutzen daraus zu ziehen. Zum <strong>Heilig</strong>en <strong>Rock</strong> pilgern die<br />
Menschen hin. Er selbst bleibt an seinem Ort. Ich erinnere mich an die großen Vorbehalte, die es im Vorfeld der<br />
<strong>Wallfahrt</strong> von 1996 gab, als man beabsichtigte, die Reliquie aus der Heiltumskammer heraus näher zu den<br />
Pilgern und Pilgerinnen zu bringen. Sie erinnern sich: Der <strong>Heilig</strong>e <strong>Rock</strong> wurde im Mittelgang vor den Altarstufen<br />
präsentiert und gab so allen Menschen die Möglichkeit, ganz nahe heran zu kommen. So wird es auch im<br />
nächsten Jahr sein. Aber der <strong>Heilig</strong>e <strong>Rock</strong> verlässt den Trierer Dom nicht (Beispiel: Anfrage der Redaktion für<br />
Katholische Fernseharbeit zur Verlegung der Reliquie, um einen Sonntagsgottesdienst im <strong>Wallfahrt</strong>szeitraum<br />
übertragen zu können – und Gründe für den negativen Bescheid). In unruhigen und kriegerischen Zeiten<br />
musste man den <strong>Heilig</strong>en <strong>Rock</strong> oft in Sicherheit bringen; und zu Zeiten, da die Erzbischöfe hauptsächlich in<br />
Koblenz residierten, wollten sie diese größte Kostbarkeit gern in ihrer Nähe haben; so wurde die Reliquie oft aus<br />
Trier <strong>weg</strong> gebracht. Ehrenbreitstein, Köln, Würzburg, Bamberg, Böhmen und Augsburg sind als Aufenthaltsorte<br />
geschichtlich bezeugt. Doch letztendlich gehört sie in den Trierer Dom. Und dort wird sie in sicheren Zeiten<br />
auch den Wallfahrern gezeigt.<br />
In Beurig ist das etwas anders. Denn die Hauptfeierlichkeit im L<strong>auf</strong> des Jahres ist die Marientracht am Sonntag<br />
nach <strong>dem</strong> Fest Maria Heimsuchung (2. Juli). Da wandert die Statue durch die Straßen <strong>mit</strong>ten unter den<br />
Menschen – so wie es Maria tat, als sie ihre Verwandte Elisabeth im Bergland von Judäa besuchte (Lk 1, 39-56).<br />
Aufbrechen und Bleiben – beides lässt sich <strong>auf</strong> unser Leben übertragen. Dazu wieder ein kleiner Text, diesmal<br />
von der deutschen Lyrikerin Hilde Domin (1909-2006). Unter <strong>dem</strong> Titel „Ziehende Landschaften“ hat sie<br />
folgende Zeilen notiert:
man muss <strong>weg</strong>gehen können<br />
und doch sein wie ein Baum<br />
als bliebe die Wurzel im Boden<br />
als zöge die Landschaft und wir stünden fest<br />
man muss den Atem anhalten<br />
bis der Wind nachlässt<br />
und die fremde Luft<br />
um uns zu kreisen beginnt.<br />
bis das Spiel von Licht und Schatten<br />
von Grün und Blau<br />
die alten Muster zeigt<br />
und wir zu Hause sind<br />
wo es auch sei<br />
und niedersitzen können und uns anlehnen<br />
als sei es an das Grab unsrer Mutter<br />
Nicht ganz leicht zu deuten, liegt der Grundgedanke doch nahe: Menschliches Leben gelingt und kann<br />
wachsen, wenn es die Kunst beherrscht, Veränderung und Beständigkeit in guter Balance zu halten. Ständige<br />
Veränderung überfordert uns; Menschen wirken getrieben wie <strong>auf</strong> der Flucht, wenn sie nicht ruhig bleiben<br />
können. Umgekehrt kann Beständigkeit verhärten; und allzu Hartes bricht leicht. Denken Sie an so manche<br />
Partnerschaft: die einen scheitern an mangelnder Treue eines der Partner; doch genau so viele Ehen gehen<br />
auseinander, weil der eine Partner (statistisch gesehen sind es meistens Frauen) sich weiterentwickelt, während<br />
der andere irgendwie erlahmt und erstarrt. In einem langen Eheleben ist es heute vermutlich die große<br />
Herausforderung, bei aller nötigen oder von außen <strong>auf</strong>genötigten Veränderung beieinander zu bleiben,<br />
einander immer neu zu entdecken und der Liebe des Anfangs zu trauen.<br />
Das gilt auch für die Kirche. Ich muss Ihnen nicht im Detail beschreiben, in welch denkwürdiger Umbruchphase<br />
wir uns befinden. Sie erleben das an den vielen Herausforderungen, die sich für die Seelsorge in unserem<br />
Bistum stellen: Strukturplanung, Personalmangel, Finanzsorgen sind ja nur die äußeren Indizien einer Krise, die<br />
viel tiefer reicht und die kirchliche Bindungskraft und den Gottesglauben der Menschen selbst betrifft. Einen<br />
„Bruch zwischen Evangelium und Kultur“ hatte bereits Papst Paul VI. in den 70er Jahren des letzten<br />
Jahrhunderts als die große Herausforderung für eine Neuevangelisierung konstatiert; heute trifft uns dieser<br />
„Bruch“ <strong>mit</strong> aller – teils bitteren – Konsequenz. Und – wie könnte es anders sein – so gibt es auch in dieser
Krisenzeit konträre Ansichten und Initiativen: Fordern die einen endlich entschiedene Veränderungen und die<br />
Anpassung kirchlicher Strukturen und Lehren an die Lebensumstände und Denkgewohnheiten heutiger<br />
Menschen, suchen die anderen <strong>mit</strong> ebensolchem Elan zu bewahren, was ihnen im Glauben Heimat und<br />
Sicherheit gab. Persönlich bin ich davon überzeugt, dass der Weg auch hier nur die Suche nach einer<br />
ausgewogenen Balance zwischen Veränderung und Beständigkeit sein kann, denn die Kirche ist ein lebendiger<br />
Organismus. Beide Schwerpunkte verbinden sich übrigens in <strong>dem</strong> Begriff „Tradition“. Er hört sich an vor allem<br />
nach „Bewahren“, aber das lateinische Wort „tradere“ bedeutet „übergeben, hergeben, hingeben, ausliefern“ –<br />
und ist da<strong>mit</strong> ein sehr dynamischer Begriff. Bewahren können wir nur, was wir anderen übergeben; man muss<br />
hergeben, was einem wichtig ist, sonst vergeht es; um Wertvolles zu bewahren, muss es sich verändern. Das gilt<br />
auch für den Glauben. Die Verkündigung sucht die Sprache der Menschen, sonst trifft sie niemanden ins Herz.<br />
Der Schatz des Glaubens will <strong>auf</strong>geschlossen und ver<strong>mit</strong>telt werden, da<strong>mit</strong> er junge Menschen berührt und<br />
bereichert. Die soziale Gestalt der Kirche braucht Anpassung, sonst erstarrt und erstirbt sie. Sie spüren, wie<br />
anspruchsvoll und herausfordernd es ist, Traditionen zu bewahren.<br />
„Wollt ihr Kinder?“, so hat ein Gemeindeberater in die Runde der versammelten Verantwortlichen einer<br />
Pfarrgemeinde hinein gefragt und großes Erstaunen erregt. „Wollt ihr Kinder?“, ist die grundlegende Frage,<br />
denn klar ist: Wer sich dafür entscheidet, Leben weiterzugeben, der nimmt da<strong>mit</strong> in K<strong>auf</strong>, dass sich das ganze<br />
bisherige Lebenskonzept verändert. Nichts bleibt, wie es ist, wenn ein Kind als „Dritter im Bunde“ die<br />
Partnerschaft weitet. Ein Kind richtet sich nicht nach den vorgegebenen Regeln, es schreibt neue Regeln. Wer<br />
also ernsthaft daran geht zu fragen, wie es uns gelingen kann, den Glauben weiterzugeben an eine neue<br />
Generation, der steht vor derselben Herausforderung: Er wird sich <strong>auf</strong> Veränderungen einstellen, neue Fragen,<br />
neue Lebens- und Glaubensformen, Abschied von Hergebrachtem … Wollen wir das wirklich in unseren<br />
Gemeinde, in unserem Bistum, in unserer Kirche? Darüber lohnt es sich, ernsthaft <strong>mit</strong>einander ins Gespräch zu<br />
kommen. Es lohnt den Dialog, zu <strong>dem</strong> unsere Bischöfe einladen. Denn die Alternative ist ebenso klar: Wer am<br />
Liebsten alles beim Alten lässt, bringt keine Nachkommen hervor; der hat keine Zukunft.<br />
Das Zweite Vatikanische Konzil hat seine Aussagen über die Gottesmutter Maria bewusst im Zusammenhang<br />
der Lehre über die Kirche getroffen (in der Kirchenkonstitution „Lumen Gentium“). Maria und die Kirche sind in<br />
vieler Hinsicht ähnlich. Vor allem ist Maria das Urbild der pilgernden Kirche, die <strong>mit</strong> <strong>dem</strong> Schatz des Glaubens<br />
unter<strong>weg</strong>s ist durch die Zeit, um allen Menschen Jesus Christus nahe zu bringen als den Heiland und Erlöser, als<br />
guten Grund, <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> man das Leben bauen kann. Maria hat Ja gesagt zu all der unüberschaubaren<br />
Veränderung. Sie ist <strong>dem</strong> Ja treu geblieben, das sie Gott gegeben hat. Und ihr Gottvertrauen hat sie getragen.<br />
Das macht Maria – treu und dynamisch zugleich – zum Vorbild für die Kirche heute.
c. Mit Maria in der Spur des Erlösers<br />
Mitten in der beschriebenen Umbruchzeit kirchlichen Lebens will die <strong>Heilig</strong>-<strong>Rock</strong>-<strong>Wallfahrt</strong> 2012 ein Zeichen<br />
setzen. Wir weisen <strong>auf</strong> Jesus Christus hin und werden von ihm reden, in <strong>dem</strong> sich Gott so menschenfreundlich<br />
offenbart hat. Er machte Gottes Namen groß, in<strong>dem</strong> er Menschen zum Leben verhalf – gegen Krankheit, Schuld<br />
und Tod. Als man ihm seine Kleider nahm und ihn <strong>dem</strong> Tod eines Verbrechers auslieferte, hielt er fest am<br />
Vertrauen <strong>auf</strong> Gott und an der Liebe zu uns Menschen. Darum hat Gott seinen Sohn aus <strong>dem</strong> Tod gerettet und<br />
ihn in seine Herrlichkeit erhöht. Der Glaube an Jesus Christus, das Licht der Welt und den Erlöser aller<br />
Menschen, das ist die Mitte der Kirche. Dass er heute unter uns lebt und wirkt, um Menschen aus ihrer Angst<br />
und Selbstentfremdung in die Freiheit Gottes zu führen, das sollen die Pilger am Ziel ihrer <strong>Wallfahrt</strong> in Trier<br />
erfahren können. Sie sollen etwas von der Gnade Gottes spüren, die froh macht und Horizonte weitet. Das<br />
bedarf einer soliden Vorbereitung – in der äußeren Organisation wie im inneren Zugehen <strong>auf</strong> diese festlichen<br />
Wochen. Das Jahr der geistlichen Vorbereitung, zu <strong>dem</strong> Bischof Dr. Stephan Ackermann uns eingeladen hat,<br />
dient diesem Ziel.<br />
In einem Interview erzählt die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller (* 1953) einmal von ihrer Kindheit und<br />
Jugend im rumänischen Banat. Ihr Großvater führte einen Kolonialwarenladen, in <strong>dem</strong> auch Kleider verk<strong>auf</strong>t<br />
wurden. Besonders gut erinnert sie sich an einen großen Karton <strong>mit</strong> dicker Unterwäsche: Hose und Oberteil <strong>mit</strong><br />
langen Ärmeln und Beinen aus einem Stück, wärmender dicker Flanell, leider auch etwas kratzig. Vor allem der<br />
längst ungebräuchliche aber ausdrucksstarke Name hat es der Schriftstellerin angetan: „Leib- und Seelgewand“.<br />
Das passt, wie ich finde: Die Tunika, die Jesus <strong>auf</strong> Erden getragen hat, soll uns zum „Leib- und Seelgewand“<br />
werden. So verstehe ich die Einladung des Bischofs zum Jahr der geistlichen Vorbereitung. Das Gewand Jesu<br />
Christi ist Zeichen für den Mensch gewordenen Gottessohn, der uns erlöst hat. Es verweist ins Zentrum des<br />
christlichen Erlösungsglaubens. Es inspiriert, den roten Faden der Erlösung im eigenen Leben <strong>auf</strong>zugreifen und<br />
ihm zu folgen. Es animiert zu fragen, was es denn heißt, als erlöster Mensch zu leben.<br />
Es geht also in diesem Jahr um eine geistliche Erfahrung und die Einladung <strong>auf</strong> einen geistlichen Weg. Konkret<br />
wird uns ein Weg in fünf Schritten vorgeschlagen, um in unserer eigenen Lebenswirklichkeit Spuren von<br />
Erlösung zu entdecken:<br />
- Ausgehend von der bewussten Wahrnehmung, dass ich bin: geschaffen, gerufen, von Gott geliebt,<br />
- nehme ich Ohnmacht wahr, Grenzen, Schuld und Erlösungsbedürftigkeit in mir und bei anderen, in der<br />
Welt;<br />
- erfahre Zuspruch aus <strong>dem</strong> Wort des Evangeliums und <strong>dem</strong> Reichtum des Glaubens;
- erspüre die Lebendigkeit, die solche Impulse wecken;<br />
- und entwickle daraus hoffnungsvolle Perspektiven für meinen, für unseren Lebens- und Glaubens<strong>weg</strong>.<br />
Hier an diesem <strong>Wallfahrt</strong>sort haben Sie es im Grunde leicht, diesen Weg der geistlichen Vorbereitung zu gehen.<br />
Denn sie können sich von Maria an die Hand nehmen lassen. Das Evangelium des Festtages der Heimsuchung<br />
Mariens gipfelt in <strong>dem</strong> großen Lied von der Erlösung (<strong>dem</strong> Magnifikat), das Maria sozusagen „vorsingt“, da<strong>mit</strong><br />
wir es nachsingen können. Wenn ich es Ihnen vortrage, hören Sie einmal, wie alle Etappen des geistlichen<br />
Weges, die ich eben genannte habe, sich darin wieder finden: Dasein – Ohnmacht – Zuspruch von Gott –<br />
Lebendigkeit – Hoffnung.<br />
„Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, /<br />
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.<br />
Denn <strong>auf</strong> die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. / Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.<br />
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan / und sein Name ist heilig.<br />
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht / über alle, die ihn fürchten.<br />
Er vollbringt <strong>mit</strong> seinem Arm machtvolle Taten: / Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind;<br />
er stürzt die Mächtigen vom Thron / und erhöht die Niedrigen.<br />
Die Hungernden beschenkt er <strong>mit</strong> seinen Gaben / und lässt die Reichen leer ausgehen.<br />
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an / und denkt an sein Erbarmen,<br />
das er unsern Vätern verheißen hat, / Abraham und seinen Nachkommen <strong>auf</strong> ewig.“ (Lk 1, 46-55)<br />
Sie haben hier in Beurig also eine ganz wunderbare Gelegenheit, ihre eigene geistliche Vorbereitung <strong>auf</strong> die<br />
<strong>Heilig</strong>-<strong>Rock</strong>-<strong>Wallfahrt</strong> zu gestalten, in<strong>dem</strong> sie das Lied Mariens von der Erlösung immer wieder singen, beten,<br />
bedenken und darin wie in einem Spiegel ihr eigenes Leben betrachten. Wie wäre es denn, Sie würden Ihre<br />
Veranstaltungen der Kolpingfamilie bis zur <strong>Wallfahrt</strong> im kommenden Jahr immer <strong>mit</strong> diesem Gebet (im<br />
Gotteslob Nr. 688 und 689) beginnen; Sie würden es jeden Tag einmal persönlich beten – am Morgen oder am<br />
Abend, oder zwischendurch einmal, wenn Pause ist. Ich bin ganz sicher, dann werden Sie für sich selbst Großes<br />
entdecken, Geschenke Gottes, ein wohltuendes Aufatmen – etwas von der Erlösung, die uns Jesus geschenkt<br />
hat. Dann sind Sie <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> Weg <strong>mit</strong> Maria zu Jesus – dann gehen Sie in der Spur des Erlösers.