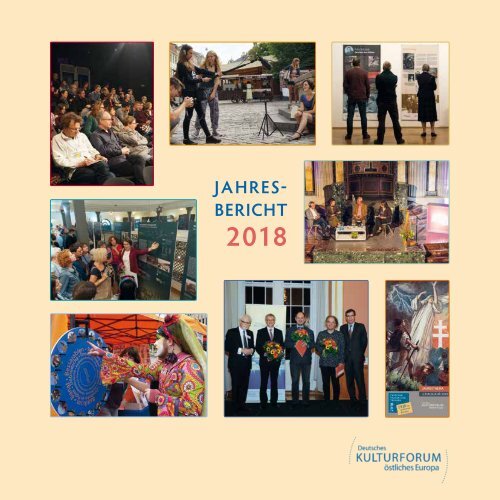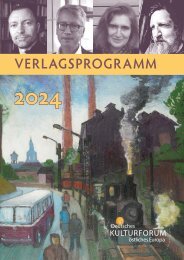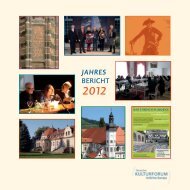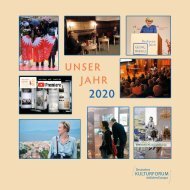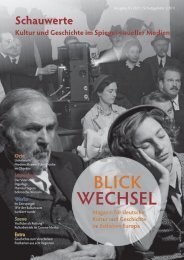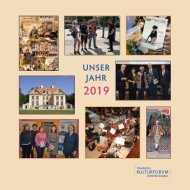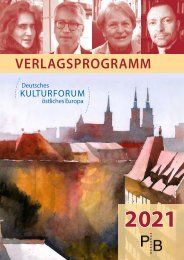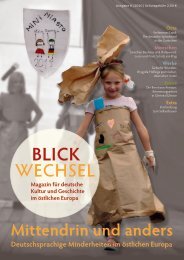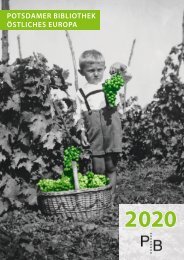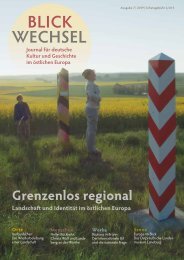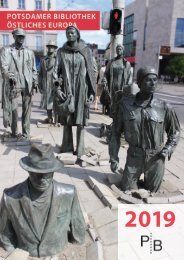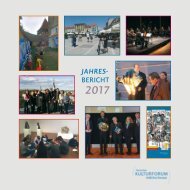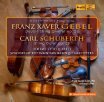Jahresbericht 2018
Überblick über die Aktivitäten des Deutschen Kulturforums östliches Europa, Potsdam, im Kalenderjahr 2018
Überblick über die Aktivitäten des Deutschen Kulturforums östliches Europa, Potsdam, im Kalenderjahr 2018
- TAGS
- oestliches-europa
- deutsches-kulturforum
- literaturtage-an-der-neisse
- prag
- literatur
- juedisches-leben
- hans-von-held
- die-oder
- erster-weltkrieg
- markus-roduner
- alvydas-slepikas
- brigitte-doebert
- miljenko-jergovic
- georg-dehio-buchpreis
- ukraine
- barbara-theriault
- lemberg---lwiw
- donauschwaben
- max-brod
- ausstellung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
JAHRES-<br />
BERICHT<br />
<strong>2018</strong>
Zwischen Trauer und Triumph................................................................................................................................. 3<br />
Das Schicksalsjahr 1918 als ambivalenter Gedenkanlass<br />
Der unbequeme Hans von Held............................................................................................................................... 5<br />
Buch und Ausstellung über einen aufgeklärten Staatsdiener zwischen Preußen und Polen<br />
»Das menschliche Erleben der Geschehnisse«...................................................................................................... 6<br />
Indiviualisierte Geschichte in der Ausstellung Die Schaleks – eine mitteleuropäische Familie<br />
Georg Dehio-Buchpreis <strong>2018</strong>................................................................................................................................... 8<br />
Die Auszeichnung ging an Miljenko Jergović, Brigitte Döbert, Alvydas Šlepikas und Markus Roduner<br />
Eine Einladung zur Spurensuche..............................................................................................................................10<br />
Die Wanderausstellung Im Fluss der Zeit. Jüdisches Leben an der Oder<br />
Erkundungen in Lemberg/Lwiw................................................................................................................................12<br />
Barbara Thériault berichtete als Stadtschreiberin aus der westukrainischen Metropole<br />
Über Grenzen gehen .................................................................................................................................................14<br />
Die 3. Literaturtage an der Neiße reagierten auf aktuelle Debatten<br />
Aus Liebe zur Meisterschaft......................................................................................................................................15<br />
Ein Themenabend in Prag würdigte Max Brod als Vermittler und Entdecker<br />
Festivalfieber hoch drei.............................................................................................................................................16<br />
Das Kulturforum bei filmPOLSKA, auf dem Jüdisches Filmfestival und beim FilmFestival Cottbus<br />
Schwaben an der Donau............................................................................................................................................18<br />
Neuerscheinung zu einem wichtigen Kapitel europäischer Wanderungsgeschichte<br />
Bücher als Schlüssel zur Welt....................................................................................................................................19<br />
Messeauftritte in Leipzig, Frankfurt am Main, Wien und Breslau/Wrocław<br />
Achtung, Kanalarbeiten!...........................................................................................................................................20<br />
Auftritte des Kulturforums in den Sozialen Medien und auf Internetplattformen<br />
Programm und Verlag <strong>2018</strong>......................................................................................................................................21
Zwischen Trauer und Triumph<br />
Das Schicksalsjahr 1918 als ambivalenter Gedenkanlass<br />
Als wir im Gedenkjahr <strong>2018</strong> nach den<br />
Folgen des Ersten Weltkriegs fragten,<br />
tat sich ein großer Spannungsbogen<br />
auf. Wir haben als Kulturforum stets<br />
das gesamte östliche (Mittel-)Europa im<br />
Blick – ist es da möglich, sich zwischen<br />
Trauer und Triumph zu entscheiden?<br />
Zweifelsfrei spielt beides ins Gedenken<br />
hinein, und so wollten wir diese Problematik<br />
auch in unseren Angeboten zum<br />
Ausdruck bringen. Es ging dabei um die<br />
vor hundert Jahren neu gegründeten<br />
Nationalstaaten genauso wie um den<br />
Zerfall der scheinbar festgefügten Ordnung<br />
der alten Imperien, um Identitätsfindung<br />
genauso wie um den Entzug<br />
von Identitätsgrundlagen, um Friedensverträge<br />
wie um nationale Propaganda.<br />
Die seinerzeit neu entstehenden nationalen<br />
Ikonografien, ob zur Glorifizierung<br />
der eigenen Nation<br />
oder zum Beweinen ihres<br />
Schicksals, bieten für<br />
diese Fragen vielfältige<br />
Illustrationsmöglichkeiten.<br />
Bei unseren Vorträgen,<br />
Podiumsgesprächen,<br />
Filmvorführungen und Ausstellungsbeteiligungen<br />
aber<br />
merkten wir, dass es nach vier Jahren<br />
der Auseinandersetzung mit dem Ersten<br />
Weltkrieg auch eine gewisse Ermüdung<br />
des Interesses gab – und dass es noch<br />
ganz andere Gedenkanlässe gibt, die<br />
heute die Menschen bewegen, zumal<br />
sich immer wieder herausstellte, dass<br />
die Ergebnisse des Jahres 1918 den Keim<br />
für einen großen Teil des Unglücks des<br />
20. Jahrhunderts in sich trugen.<br />
Auf offizieller und großer Bühne<br />
war das Augenmerk auf das Europäische<br />
Kulturerbejahr <strong>2018</strong> gerichtet.<br />
Dabei stellten auch wir einen Teil unserer<br />
Aktivitäten, die sich ja grundsätzlich<br />
mit einem heute gemeinschaftlichen<br />
Erbe befassen, unter das von der<br />
Europäischen Kommission ausgerufene<br />
schaurig-schöne Motto »Sharing Heritage«.<br />
Dazu gehörten etwa unsere<br />
Ausstellungen zur Backsteingotik<br />
Hinrich Brunsbergs,<br />
zum jüdischen Leben<br />
an der Oder und zur<br />
deutsch-böhmischjüdischen<br />
Familie<br />
Schalek sowie die Erzählwerkstätten<br />
mit Schülern im<br />
südöstlichen Europa.<br />
»Triumph« auf dem Titelblatt unseres Jahresthemenprogramms.<br />
Die um 1918 herausgegebene<br />
Postkarte nach einem Gemälde von Josef<br />
Koči zeigt allegorisch das Erwachen der slowakischen<br />
Nation: In slowakische Hirtentrachten<br />
gekleidete Männer haben eine göttliche<br />
Erscheinung, im Hintergrund ist der Dreiberg<br />
mit Patriarchenkreuz zu sehen, der auch das<br />
Staatswappen der Slowakei schmückt.<br />
© Herder-Institut, Marburg, Bildarchiv<br />
3
Neben bewährten Formaten wie einem Stadtschreiberstipendium, der Dehio-Preisverleihung,<br />
dem Journal Blickwechsel oder den Görlitzer Literaturtagen und der Fortführung<br />
eines knappen Dutzends Ausstellungen sind für das Jahr <strong>2018</strong> vier neue Bücher,<br />
eine Audio-CD, drei Filme und drei neue Wanderausstellungen als besondere Höhepunkte<br />
zu nennen. Im Hintergrund liefen intensive Vorbereitungen für eine Erneuerung<br />
unserer Internetpräsenz und weitere Maßnahmen zum Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit<br />
– über die Ergebnisse wird im kommenden Jahresheft zu berichten sein.<br />
Harald Roth<br />
»Zwischen Trauer und Triumph« hieß eine vom Adalbert Stifter Verein und vom Institut für deutsche<br />
Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) veranstaltete Konferenz zum Jahr 1918 in der mitteleuropäischen<br />
Literatur, die auch unserem Jahresthema den Namen lieh. Zwei Themenabende in Kooperation<br />
mit dem Kulturforum widmeten sich ebenfalls diesem Bereich. Das Foto entstand bei der Münchener<br />
Veranstaltung am 27. November <strong>2018</strong> und zeigt Dr. Florian Kührer-Wielach, Dr. Olivia Spiridon,<br />
Prof. Dr. Pieter M. Judson, Prof. Dr. Dr. Michael Rössner und Dr. Peter Becher (v. l. n. r.) im Gespräch.<br />
© IKGS<br />
»Trauer« auf der Rückseite der <strong>2018</strong>er Ausgabe<br />
des Journals Blickwechsel: Das Plakat stammt<br />
aus dem Ungarn der Zwischenkriegszeit. Der<br />
Text war aus einem 1920 ausgerufenen Wettbewerb<br />
hervorgegangen, der dazu aufforderte,<br />
das Lebensgefühl der Ungarn nach der Teilung<br />
des Landes infolge des Vertrags von Trianon in<br />
einem Gebet auszudrücken: »Ich glaube an den<br />
einen Gott, ich glaube an die eine Heimat, ich<br />
glaube an Gottes ewige Wahrheit, ich glaube an<br />
Ungarns Auferstehung. Amen.«<br />
4
Der unbequeme Hans von Held<br />
Buch und Ausstellung über einen aufgeklärten Staatsdiener zwischen Preußen und Polen<br />
Das Porträt wurde im<br />
Oktober 1801 erstellt,<br />
kurz bevor Hans von<br />
Held seine Festungshaft<br />
antreten musste. Punktierstich<br />
von Friedrich<br />
Wilhelm Bollinger,<br />
© Privatarchiv Anna<br />
Joisten<br />
Der Beamte und politische Schriftsteller<br />
Hans von Held (1764–1842) zählte<br />
zu den bekanntesten Persönlichkeiten<br />
der Spätaufklärung in<br />
Preußen. Aufsehen erregte er<br />
vor allem mit seinen Anklagen<br />
gegen die preußische<br />
Staatsverwaltung Ende des<br />
18. Jahrhunderts und seiner<br />
öffentlichen Kritik am preußischen<br />
Vorgehen nach den<br />
Teilungen Polens.<br />
Der in Schlesien geborene<br />
Hans von Held war zunächst als<br />
Sekretär der niederschlesischen<br />
Akzise- und Zolldirektion in Glogau/<br />
Głogów und Küstrin/Kostrzyn tätig.<br />
1793 wurde er nach Posen/Poznań<br />
versetzt. Als Zollrat der neuen Provinz<br />
Südpreußen war er mit der Korruption<br />
unter hohen Beamten, der<br />
Bereicherung des Adels und Ausbeutung<br />
der Bevölkerung konfrontiert.<br />
Von der Gedankenwelt der Aufklärung<br />
beeinflusst und von der Französischen<br />
Revolution beflügelt, machte<br />
er die Missstände in einem Werk publik,<br />
das als Schwarzes Buch bekannt<br />
wurde.<br />
Die deutsch- und polnischsprachige Wanderausstellung<br />
Wortgewalten. Hans von Held – Ein aufgeklärter Staatsdiener<br />
zwischen Preußen und Polen mit gleichnamigem Begleitbuch<br />
vermittelt anhand der Lebensgeschichte Hans von Helds<br />
ein lebendiges Bild der Geschichte Ostmitteleuropas in den<br />
Jahrzehnten um 1800. Neben dem Wirken Hans von Helds<br />
wird auch das konfliktreiche Verhältnis zwischen Preußen und<br />
Polen-Litauen sowie die Entwicklung in den neuen preußischen<br />
Provinzen dargestellt.<br />
Die Wanderausstellung wurde von Anna Joisten und<br />
Prof. Dr. Joachim Bahlcke vom Historischen Institut der Universität<br />
Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Kulturforum<br />
erarbeitet.<br />
Claudia Tutsch<br />
Bahlcke, Joachim;<br />
Joisten, Anna (Hg.)<br />
Wortgewalten. Hans von<br />
Held – Ein aufgeklärter<br />
Staatsdiener zwischen<br />
Preußen und Polen<br />
Mit zahlr. farb. u. S.-W.-Abb. u.<br />
Übersichtskarten<br />
417 S, geb., € 19,80,<br />
ISBN 978-3-936168-81-5<br />
5
»Das menschliche Erleben der Geschehnisse«<br />
Indiviualisierte Geschichte in der Ausstellung Die Schaleks – eine mitteleuropäische Familie<br />
Lisa Fittko ermahnte ihren Cousin Fritz Schalek, er solle mit seinen<br />
Erinnerungen nicht geizen, denn »das menschliche Erleben<br />
der Geschehnisse« bestimme das Handeln – und »so ist<br />
Geschichtsschreibung voller Trugschlüsse, wenn die, die dabei<br />
waren, schweigen.« Diesem Ansatz folgend, will eine mit dem<br />
Autor Ralf Pasch verwirklichte Wanderausstellung über fünf<br />
Persönlichkeiten der deutsch-tschechisch-jüdischen Familie<br />
Schalek die dunklen Kapitel des 20. Jahrhunderts über deren<br />
Individualisierung konkret und emotional ansprechend vermitteln.<br />
Vorgestellt werden Alice Schalek (1874–1956), k. u. k. Kriegsberichterstatterin<br />
im Ersten Weltkrieg, Robert Schalek (1877–<br />
1963), Vorsitzender Richter im ersten Prozess gegen den Hellseher<br />
Erik Jan Hanussen, Malva Schalek (1882–1944), wichtige<br />
künstlerische Zeugin des Ghettos Theresienstadt, die Fluchthelferin<br />
Lisa Fittko (1909–2005) und Fritz Schalek (1913–2006),<br />
kommunistischer Widerstandskämpfer und Emigrant in der<br />
von den Nationalsozialisten besetzten Tschechoslowakei, Dissident<br />
und Aktivist der deutschen Minderheit in der kommunistischen<br />
ČSSR. Die Biografien werden durch Comic-Panels<br />
ergänzt, die Interaktionen zwischen den Familienmitgliedern<br />
zeigen. Jeder Biografie ist ein Banner mit dem entsprechenden<br />
historischen Kontext zugeordnet.<br />
Zur Ausstellung wurde ein neunminütiger Begleitfilm<br />
erstellt, der anhand von historischen Bilddokumenten prä-<br />
Erstpräsentation in Deutschland im Kulturrathaus Dresden<br />
am 6. November <strong>2018</strong>, © Peter R. Fischer<br />
6
Der Filmstill aus Die Schaleks – zwischen den Fronten | Schalekovi. Mezi frontami zeigt Porträts von Malva Schalek: Fritz Schalek,<br />
ein Selbstbildnis der Künstlerin und Robert Schalek (v. l. n. r.). Die Kurzdokumentation zur Ausstellung erstellten das Kulturforum<br />
und Ralf Pasch gemeinsam mit der Produktionsfirma Die Kulturingenieure in einer deutschen und einer tschechischen Version.<br />
gende Ereignisse aus den Biografien präsentiert. Er ist an den<br />
Ausstellungsorten und auf dem YouTube-Kanal des Kulturforums<br />
zu sehen.<br />
Parallel in Tschechien und Deutschland wurde die zweisprachige<br />
Ausstellung im Rahmen der Tschechisch-Deutschen<br />
Kulturtage zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert: im<br />
Kulturrathaus Dresden und im Stadtmuseum in Aussig/Ústí<br />
nad Labem, wo das Projekt mit Ralf Paschs Sichtung des Nachlasses<br />
von Fritz und Robert Schalek im Collegium Bohemicum<br />
seinen Anfang genommen hatte.<br />
Tanja Krombach<br />
7
Georg Dehio-Buchpreis <strong>2018</strong><br />
Die Auszeichnung ging an Miljenko Jergović, Brigitte Döbert, Alvydas Šlepikas und Markus Roduner<br />
Die international zusammengesetzte<br />
Jury wählte in ihrer Sitzung im April<br />
<strong>2018</strong> einstimmig den Schriftsteller Miljenko<br />
Jergović für sein erzählerisches<br />
Werk zum Hauptpreisträger. Außerdem<br />
beschloss die Jury, die Übersetzerin<br />
Brigitte Döbert, die Jergovićs erzählende<br />
Prosa aus dem Kroatischen ins<br />
Deutsche übersetzt, ebenfalls auszuzeichnen.<br />
Auch bei der Entscheidung<br />
für den Träger des Förderpreises war die<br />
Entscheidung einstimmig und fiel auf<br />
den litauischen Autor Alvydas Šlepikas<br />
für seinen Roman Mein Name ist Marytė.<br />
Zusammen mit dem Autor wurde auch<br />
der Übersetzer des Romans in Deutsche,<br />
Markus Roduner, ausgezeichnet.<br />
Bereits vor der Preisverleihung fand<br />
im Literaturhaus Berlin eine gemeinsame<br />
Lesung beider Autoren statt. Der<br />
V. l. n. r.: MinDgt. i. R. Winfried Smaczny, Alvydas Šlepikas,<br />
Markus Roduner, Miljenko Jergović, Dr. Günter Winands,<br />
Dr. Harald Roth. Dr. Brigitte Döbert fehlte krankheitsbedingt.<br />
Alle Bilder auf dieser Doppelseite: Anke Illing, Berlin<br />
Journalist Jörg Plath führte ein gehaltvolles<br />
Gespräch mit den anwesenden<br />
Preisträgern und stimmte das Publikum<br />
sehr sachkundig auf die Lesung<br />
der Autoren und Übersetzer aus den<br />
prämierten Texten ein.<br />
Die feierliche Preisverleihung fand<br />
im Festsaal der Berliner Rathauses statt.<br />
Nach der Begrüßung durch Harald Roth<br />
als Direktor des Kulturforums und einer<br />
Ansprache von Günter Winands als Vertreter<br />
der Beauftragten der Bundesregierung<br />
für Kultur und Medien hielt die<br />
Berliner Journalistin Doris Akrap ihre<br />
Laudatio auf Miljenko Jergović. Gemeinsam<br />
mit dem Vorstandsvorsitzenden<br />
des Kulturforums, Winfried Smaczny,<br />
überreichten sie die Urkunden. Die Laudatio<br />
auf Alvydas Šlepikas hielt der Historiker<br />
Christopher Spatz. Die Preisträger<br />
bedankten sich bei den Laudatoren<br />
und bei der Jury für die ehrenvolle Auszeichnung.<br />
Für passende musikalische<br />
Umrahmung sorgte die Pianistin Maja<br />
Matijanec mit kurzen, eindrucksvollen<br />
Klavierwerken des kroatischen Komponisten<br />
Boris Papandopulo.<br />
Klaus Harer<br />
8
1<br />
Das Kulturforum vergibt jeden Herbst in jährlichem<br />
Wechsel den von der Beauftragten der Bundesregierung<br />
für Kultur und Medien ausgelobten Georg Dehio-<br />
Kulturpreis sowie den Georg Dehio-Buchpreis. Der<br />
Georg Dehio-Buchpreis wird Autorinnen und Autoren<br />
verliehen, die Themen der gemeinsamen Kultur und<br />
Geschichte der Deutschen und ihrer östlichen Nachbarn<br />
in ihrem literarischen, wissenschaftlichen oder<br />
publizistischen Werk aufgreifen, auf hohem Niveau<br />
reflektieren und breiten Kreisen anschaulich vermitteln.<br />
Er ist aufgeteilt in einen Hauptpreis und einen Förderpreis.<br />
Der Hauptpreis würdigt ein publizistisches<br />
oder literarisches Gesamt- und Lebenswerk, der Förderpreis<br />
eine herausragende innovative Publikation.<br />
2<br />
1 Markus Roduner (links) und Alvydas Šlepikas<br />
bedanken sich für die Auszeichnung.<br />
2 Miljenko Jergović erhält von Dr. Günter<br />
Winands den Hauptpreis des Georg Dehio-<br />
Buchpreises <strong>2018</strong>.<br />
3 Großen Anklang bei den zahlreich erschienenen<br />
Gästen der Preisverleihung fand auch das<br />
musikalische Rahmenprogramm der Pianistin<br />
Maja Matijanec.<br />
3<br />
9
Eine Einladung zur Spurensuche<br />
Die Wanderausstellung Im Fluss der Zeit. Jüdisches Leben an der Oder<br />
Die Landschaft an der Oder mit ihren<br />
wechselnden herrschaftlichen und nationalen<br />
Zugehörigkeiten war über Jahrhunderte<br />
ein Begegnungsraum. Hier<br />
kreuzten sich auch die deutsch-jüdische<br />
und die polnisch-jüdische Kultur.<br />
Erst der Nationalismus, gepaart<br />
mit dem Antisemitismus, und schließlich<br />
der Nationalsozialismus zerstörten<br />
diese kulturelle Vielfalt. Nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg, als die Oder in weiten<br />
Abschnitten zur deutsch-polnischen<br />
Grenze und die deutsche Bevölkerung<br />
vertrieben wurde, fanden Polen hier<br />
eine neue Heimat. Kurze Zeit schien<br />
es, dass in Niederschlesien und Pommern<br />
jüdisches Leben heimisch werden<br />
könnte. Mehrere Zehntausend polnisch-jüdische<br />
Holocaustüberlebende<br />
siedelten sich hier an, doch die meisten<br />
wanderten bis Ende der 1960er Jahre<br />
wieder aus. Die jahrhundertelange<br />
Anwesenheit von Juden fiel dem Vergessen<br />
anheim, viele ihrer Spuren wurden<br />
verwischt.<br />
Seit 1989 ist das jüdische Leben in<br />
Polen wieder sichtbar. Seine Zentren<br />
im Oderraum sind heute neben Breslau/Wrocław<br />
und Stettin/Szczecin<br />
Sorau/Żary, Liegnitz/Legnica und Reichenbach/Dzierżoniów.<br />
Darüber hinaus<br />
macht eine Vielzahl an privaten<br />
und kommunalen Initiativen, Vereinen<br />
und Kulturinstitutionen auf das jüdische<br />
Erbe aufmerksam, nicht selten in<br />
deutsch-polnischen Kooperationen.<br />
Im Fluss der Zeit. Jüdisches Leben an<br />
der Oder, eine Wanderausstellung des<br />
Kulturforums, widmet sich auf zwanzig<br />
Tafeln Momenten der jüdischen<br />
Geschichte beiderseits der Oder von<br />
ihren Anfängen bis heute. Sie will zum<br />
Nachdenken und zum Gespräch zwischen<br />
den ehemaligen und heutigen<br />
Bewohnern der Region anregen.<br />
Zugleich ist sie eine Einladung zur Neuentdeckung<br />
des deutsch-polnisch-jüdischen<br />
Kulturerbes dieser Landschaft.<br />
Die Ausstellung wurde 2016 und 2017<br />
erarbeitet, wandert seit Mitte <strong>2018</strong> entlang<br />
der deutsch-polnischen Grenze<br />
und war bisher in Breslau/Wrocław, Berlin,<br />
Landsberg an der Warthe/Gorzów<br />
Wielkopolski, Greifswald und Stettin/<br />
Szczecin zu sehen. Weitere Stationen<br />
sind in Planung. Zur Ausstellung ist ein<br />
zweisprachiger Katalog erschienen.<br />
Magdalena Gebala<br />
Der 1930 in Stettin/Szczecin geborene Manfred Heymann, eigentlich Manfred Hajmann, war einer der<br />
im Februar 1940 aus der pommerschen Hafenstadt ins Generalgouvernement deportierten Juden.<br />
Er überlebte die Inhaftierung im Ghetto Bełżyce und im Konzentrationslager Flossenbürg sowie den<br />
Todesmarsch nach Dachau. Das Foto zeigt den Jungen im Jahr 1945 und sollte ihm helfen, seine Familie<br />
zu finden. © United States Holocaust Memorial Museum Washington<br />
10
Ausstellungseröffnung in der Synagoge<br />
zum Weißen Storch in Breslau/Wrocław,<br />
Juni <strong>2018</strong>, Führung mit den beiden<br />
Kuratorinnen Dr. Magdalena Abraham-<br />
Diefenbach (links) und Dr. Magdalena<br />
Gebala (unten). Fotos: Adam Czerneńko<br />
11
Erkundungen in Lemberg/Lwiw<br />
Barbara Thériault berichtete als Stadtschreiberin aus der westukrainischen Metropole<br />
Das Stadtschreiberstipendium des Kulturforums war im Jahr<br />
<strong>2018</strong> erstmals in einer Stadt außerhalb der Europäischen Union<br />
angesiedelt, nämlich in der westukrainischen Metropole Lemberg/Lwiw.<br />
Bereits im Dezember 2017 beriet eine Jury, in der<br />
sowohl die Stadt Lwiw als auch die Ukrainische Botschaft vertreten<br />
war, über die zahlreichen Bewerbungen und entschied<br />
sich schließlich einstimmig für die kanadische Journalistin<br />
und Soziologin Barbara Thériault. Das Stipendium war – wie<br />
in den vergangenen Jahren – von der Beauftragten der Bundesregierung<br />
für Kultur und Medien dotiert und wurde vom<br />
Kulturforum in Zusammenarbeit mit dem Büro der UNESCO-<br />
Literaturstadt Lwiw durchgeführt.<br />
Bereits am 7. März <strong>2018</strong> stellte sich Barbara Thériault in einer<br />
Veranstaltung in der Botschaft der Ukraine in Berlin vor. Hier<br />
Viele Türen standen ihr offen: Barbara Thériault<br />
in Lemberg/Lwiw, © Uwe Fleischer<br />
konnten einige Kontakte geknüpft werden, die sich für den<br />
nachfolgenden Aufenthalt in Lemberg als hilfreich erwiesen.<br />
Ihren viermonatigen Aufenthalt in Lemberg trat Barbara<br />
Thériault Anfang Mai <strong>2018</strong> an. Die Lemberger Partner hatten<br />
eine günstig gelegene Wohnung in der Altstadt gefunden, die<br />
ein bequemer Ausgangspunkt für die Erkundungen der Stadtschreiberin<br />
werden sollte. In den darauffolgenden Monaten<br />
berichtete sie in einem deutsch geschriebenen Internet-Tagebuch<br />
über ihre Erlebnisse und Beobachtungen in der Stadt.<br />
Der Blog, der auch von der Thüringer Allgemeinen Zeitung veröffentlicht<br />
wurde, erschien parallel in einer ukrainischen Fassung.<br />
Er ist – wie alle Stadtschreiberblogs des Kulturforums<br />
– dauerhaft im Internet nachzulesen. Während ihres Aufenthaltes<br />
nahm die Stadtschreiberin an einer Reihe von öffentlichen<br />
Veranstaltungen an verschiedenen Orten der Stadt teil,<br />
etwa in der Urban Biblioteka und im Kulturzentrum Suputnyk,<br />
einem ehemaligen Kino im Stadtteil Lewandiwka. Ein besonderes<br />
Erlebnis, das auch im Blog seinen Niederschlag fand,<br />
war die Teilnahme am Vierten Deutsch-Ukrainischen Schriftstellertreffen<br />
im September <strong>2018</strong> in Mariupol.<br />
Vom 7. bis zum 12. Juli besuchte eine Schülergruppe des<br />
Babelsberger Filmgymnasiums die Stadtschreiberin in Lemberg<br />
und drehte einen 50-minütigen Dokumentarfilm unter<br />
dem Titel Die Stadt mit den vielen Namen – Lemberg, Lwów,<br />
Львів. Die Filmpremiere im voll besetzten Kinosaal des Medien-<br />
Campus Babelsberg am 19. November, zu der auch Barbara<br />
Thériault aus Montreal angereist war, wurde der lebendige<br />
Abschluss eines für alle Beteiligten eindrucksvollen Projekts.<br />
Klaus Harer<br />
12
Filmteam und Protagonistin am Tag der Premiere:<br />
Lorenz Reimann, Barbara Thériault, Helin Schwarz<br />
und Greta Wegener (v. l. n. r.), © Manfred Thomas<br />
Das jugendliche Filmteam aus Babelsberg beim<br />
Dreh mit Barbara Thériault: Lorenz Reimann<br />
(Kamera), Helin Schwarz (Ton) und Greta Wegener<br />
(Redaktion). © Constanze Beyer<br />
Der Film Die Stadt mit den vielen Namen –<br />
Lemberg, Lwów, Львів kann auf dem YouTube-<br />
Kanal des Kulturforums abgerufen werden<br />
– wie alle seit 2015 gedrehten Stadtschreiberfilme<br />
von bfg film productions, der Schülerfirma<br />
des Babelsberger Filmgymnasiums.<br />
: Stadtschreiberblog von Barbara Thériault:<br />
https://stadtschreiberin-lemberg.blogspot.com<br />
: Überblick über alle Stadtschreiberblogs des Kulturforums:<br />
http://bit.ly/alle_stadtschreiber<br />
13
Über Grenzen gehen<br />
Die 3. Literaturtage an der Neiße reagierten auf aktuelle Debatten<br />
Das Festival »Literaturtage an der Neiße« ist ein deutsch-polnisches<br />
Projekt, das seit 2014 in Kooperation zwischen der Görlitzer<br />
Kulturservicegesellschaft, der Kulturreferentin für Schlesien<br />
und dem Kulturforum in Görlitz und Zgorzelec im Zweijahrestakt<br />
realisiert wird. Das Ziel der Literaturtage ist es zum<br />
einen, einem breiten Publikum die neuesten Literaturtrends<br />
aus Deutschland und Polen jenseits des Mainstreams vorzustellen,<br />
und zum anderen, durch das Medium Literatur die<br />
Bewohner beider Grenzstädte für die aktuellen gesellschaftspolitischen<br />
und kulturellen Entwicklungen des Nachbarlandes<br />
zu sensibilisieren. Mit Crossing Borderlands, dem Motto<br />
für die <strong>2018</strong>er Ausgabe der Literaturtage, reagierten wir auf<br />
die gesellschaftspolitischen Debatten der letzten Jahre: Kein<br />
Thema schien darin aktueller, brisanter und virulenter als das<br />
Thema Grenze. Für ein in einer europäischen Grenzstadt stattfindendes<br />
internationales Literaturfest erschien es uns naheliegend,<br />
diese Entwicklung aufzugreifen und zu diskutieren<br />
– auch im Hinblick auf die von Migrationsbewegungen unterschiedlichster<br />
Art geprägte Geschichte und Gegenwart von<br />
Görlitz-Zgorzelec. Zum Gespräch über Grenzüberschreitungen<br />
im Schreiben, über biografische Erfahrungen mit Grenzen<br />
und den Umgang mit dem aktuellen Diskurs über dieses<br />
Thema wurden neben Schriftstellerinnen und Schriftstellern<br />
aus Deutschland und Polen erstmalig auch Autorinnen und<br />
Autoren aus Ländern außerhalb Europas eingeladen. An den<br />
Veranstaltungen der Literaturtage nahmen mehr als 900 Menschen<br />
aus Polen und Deutschland mit und ohne Einwanderungsgeschichte<br />
teil. Die nächste Edition der Literaturtage ist<br />
für April 2020 geplant.<br />
Magdalena Gebala<br />
Podiumsgespräch in der<br />
Görlitzer Synagoge zum<br />
Thema Sharing Europe –<br />
Wie viele Grenzen verträgt<br />
Europa?, v. l. n. r.: Najem<br />
Wali, Olga Tokarczuk,<br />
Uwe-Karsten Heye und<br />
Moderatorin Dr. Weronika<br />
Priesmeyer-Tkocz<br />
© Axel Lange<br />
14
Aus Liebe zur Meisterschaft<br />
Ein Themenabend in Prag würdigte Max Brod als Vermittler und Entdecker<br />
Nicht nur als Freund und Herausgeber Frank Kafkas hat der<br />
Prager deutsche Schriftsteller und Publizist Max Brod Literaturgeschichte<br />
geschrieben, ebenso groß sind seine Verdienste<br />
als Förderer, Kulturvermittler und Entdecker. Selbst aus einer<br />
alteingesessenen jüdischen Familie stammend, fragte er bei<br />
der Beurteilung eines Werkes nicht nach Sprache, religiösem<br />
Bekenntnis oder Nation des Urhebers, sondern nach künstlerischer<br />
Meisterschaft. Mit dem Brückenschlag zwischen deutscher<br />
und tschechischer Literatur-, Musik- und Theaterszene<br />
lehnte er sich gegen den herrschenden Zeitgeist auf. 1939 verließ<br />
Brod Prag in Richtung Palästina, bis zu seinem Tod im Jahr<br />
1968 lebte er in Tel Aviv.<br />
Zu Ehren seines 50. Todestages lud das Kulturforum zusammen<br />
mit dem Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren<br />
(Pražský literární dům autorů německého jazyka) und dem Kulturreferenten<br />
für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter<br />
Verein zu einem musikalisch-literarischen Abend in Max Brods<br />
Geburtsstadt Prag ein. Den tschechischen Part der Lesung<br />
aus Brods Werken übernahm die bekannte Schauspielerin<br />
Vilma Cibulková, auf Deutsch unterstützt von ihrem Berliner<br />
Kollegen Peter Tabatt. Einige Texte hatte Barbora Šrámková,<br />
die Programmleiterin des Literaturhauses, für diesen Abend<br />
übersetzt. Dazu erklangen Werke des mährischen Komponisten<br />
Leoš Janáček, dessen Bedeutung für die moderne Musik<br />
Max Brod früh erkannt hat. So entspann sich im Verlauf des<br />
Abends nicht nur ein Wechselspiel zwischen zwei Sprachen,<br />
sondern auch zwischen verschiedenen Genres: Die Mischung<br />
aus Festvortrag, Konzert und Dichterlesung hätte – so lässt<br />
sich spekulieren – auch den Geschmack des Jubilars getroffen.<br />
Vera Schneider<br />
Der prächtige Barocksaal der Smíchover Villa Portheimka konnte die vielen<br />
Interessierten kaum fassen. Auch Lukáš Herold, Stadtrat von Prag 5, und der<br />
deutsche Botschafter Christoph Israng waren der Einladung von Literaturhausdirektor<br />
David Stecher gefolgt.<br />
Beim wohlverdienten Schlussapplaus: Vilma Cibulková, Peter Tabatt,<br />
Prof. Dr. Steffen Höhne, der den Festvortrag bestritt, Jana Kubanková<br />
und Martin Hybler (v. l. n. r.). © Prager Literaturhaus<br />
15
Festivalfieber hoch drei<br />
Das Kulturforum bei filmPOLSKA, auf dem Jüdisches Filmfestival und beim FilmFestival Cottbus<br />
Neue Zielgruppen erreichen, Filme sichten, Kontakte knüpfen:<br />
Filmfestivals sind aus der Arbeit des Kulturforums nicht<br />
mehr wegzudenken. <strong>2018</strong> waren wir erstmals auf drei cineastischen<br />
Höhepunkten vertreten. Im Rahmen der 13. Ausgabe<br />
von filmPOLSKA, der renommierten polnischen Filmschau in<br />
Berlin, zeigte das Kino Krokodil zwei Filme zu Oberschlesien:<br />
Das stark nationalgefärbte, Deutsche und Polen in schwarzweißes<br />
Licht tauchende Kasimierz-Kutz-Drama Das Losungswort<br />
von 1983, das nach dem Überfall Deutschlands auf Polen<br />
im September 1939 in Kattowitz/Katowice spielt, bedurfte der<br />
einleitenden Einbettung in die Entstehungszeit und einiger<br />
Ausführungen zur Thematik, während Kornel Miglus‘ Road-<br />
Movie Am Ende des Reiches von 1990 über einen Ausflug dreier<br />
(west-)deutscher Mädchen in eine oberschlesische Kleinstadt<br />
auch ohne detaillierte Hintergrundinformationen sehr gut<br />
beim Publikum ankam.<br />
Eine eigene Filmpremiere konnte das Kulturforum beim<br />
Jüdischen Filmfestival Berlin und Brandenburg, <strong>2018</strong> zum<br />
24. Mal von seiner unermüdlichen Gründerin Nicola Galliner<br />
organisiert, feiern: Der Kurzfilm Die Schaleks – zwischen<br />
den Fronten, der anhand von fünf Porträts einer deutschjüdisch-tschechischen<br />
Familie hundert Jahre mitteleuropäische<br />
Geschichte beleuchtet und die Wanderausstellung zum<br />
gleichen Thema begleitet, lief als Vorfilm bei einer vom Kul-<br />
Sektion Regio: Silesia beim 28. FilmFestival Cottbus: Publikum in der Kammerbühne<br />
für das Doppelprogramm aus Agfa 1939: Podróż w czasy wojny |<br />
Agfa 1939: Meine Reise in den Krieg (Michał Wnuk, PL 2015) und Józio, chodż do<br />
domu | Józio, komm nach Hause (Marcin Chłopaś, PL 2016)<br />
16
turforum initiierten dreiteiligen Reihe »Besondere Biografien«<br />
aus Böhmen und dem Baltikum im Berliner Kino fsk am Oranienplatz.<br />
»No Fake Jews« – das Motto des Jüdischen Filmfestivals –<br />
spielte auf das verbreitete Phänomen der Fake News an, das<br />
auch Thema des deutsch-polnisch-tschechischen Jugendworkshops<br />
beim 28. FilmFestival Cottbus war. Dazu wurden drei<br />
kurze Mockumentaries der tschechischen Regisseurin Adéla<br />
Babanová gezeigt. Sie handeln unter anderem vom angeblichen<br />
Plan der tschechischen Regierung Mitte der 1970er Jahre,<br />
der tschechoslowakischen Republik durch einen Tunnel zur<br />
Adria einen Zugang zum Meer zu verschaffen. Die über dreißig<br />
Schüler konnten außerdem zwischen elf Filmen innerhalb der<br />
vom Kulturforum mitkonzipierten Sektion Regio: Silesia wählen.<br />
Mit dieser Reihe zur Industrie- und Regionalgeschichte<br />
Oberschlesiens setzten wir unsere inzwischen seit drei Jahren<br />
bewährte Zusammenarbeit mit dem international anerkannten<br />
Festival des osteuropäischen Films fort.<br />
Ariane Afsari<br />
Schon fast zu einem eigenen Filmfest des Kulturforums hat sich die von<br />
Dr. Ingeborg Szöllosi kuratierte Reihe von Filmen aus und über Siebenbürgen<br />
entwickelt, die 2019 verändert und erweitert zum zweiten Mal im Bundesplatzkino<br />
Berlin läuft.<br />
Filmgespräch nach dem Oberschlesien-Filmabend im Kino Krokodil:<br />
Dr. Vasco Kretschmann, damals Kulturreferent für Oberschlesien am Oberschlesischen<br />
Landesmuseum Ratingen, Bernd Buder, Programmdirektor<br />
des FilmFestival Cottbus, Dr. Vera Schneider vom Kulturforum und Kornel<br />
Miglus, Regisseur und Leiter von filmPOLSKA (v. l. n. r.), © Katarzyna Mazur/<br />
filmPOLSKA<br />
17
Schwaben an der Donau<br />
Neuerscheinung zu einem wichtigen Kapitel europäischer Wanderungsgeschichte<br />
»Endlich gibt es eine kompakte Darstellung der Geschichte<br />
aller Donauschwaben von der Ansiedlung bis in die Gegenwart«,<br />
freute sich Christian Glass vom Donauschwäbischen<br />
Zentralmuseum in Ulm (DZM). Die reich bebilderte, mit zahlreichen<br />
Registern und Karten versehene Buchpublikation<br />
Donauschwaben. Deutsche Siedler in Südosteuropa ist im Oktober<br />
<strong>2018</strong> im Verlag des Kulturforums erschienen. Ein Handbuch,<br />
das die aktuelle Forschung miteinbezieht und trotzdem gut zu<br />
lesen ist! Auf 371 Seiten fassen die Historiker Gerhard Seewann<br />
und Michael Portmann ein wichtiges Kapitel europäischer<br />
Wanderungsgeschichte zusammen. Von deutschen Donauhäfen<br />
aus fuhren im 18. Jahrhundert regelmäßig Schiffe flussabwärts<br />
– mit Menschen, die sich im Königreich Ungarn eine<br />
bessere Zukunft versprachen. Die Einwanderer nannte man<br />
unabhängig von ihrer Herkunft »Schwaben«. Nach 1918 gehörten<br />
diese nun »Donauschwaben« genannten Gruppen drei<br />
verschiedenen Staaten an. Ab 1944 verloren Hunderttausende<br />
durch Flucht, Vertreibung und Deportation ihr Zuhause, Tausende<br />
ihr Leben. Ein Großteil fand in Süddeutschland Zuflucht.<br />
Die Verbliebenen bilden heute aktive deutsche Minderheiten<br />
in ihren Heimatstaaten.<br />
Das Buch wurde <strong>2018</strong> erstmals auf der Messe Buch Wien<br />
vorgestellt, danach in Ulm und München.<br />
Ingeborg Szöllösi<br />
Michael Portmann und Gerhard Seewann im Gespräch mit Christian Glass,<br />
Direktor des DZM, auf der Buch Wien<br />
Gerhard Seewann,<br />
Michael Portmann<br />
Donauschwaben<br />
Deutsche Siedler<br />
in Südosteuropa<br />
Mit zahlr. farb. u. S.-W.-Abb.,<br />
Karten u. ausführl. Registern<br />
371 S., geb., € 19,80<br />
ISBN 978-3-936168-72-3
Bücher als Schlüssel zur Welt<br />
Messeauftritte in Leipzig, Frankfurt am Main, Wien und Breslau/Wrocław<br />
Nicht nur mit Standpräsentationen,<br />
sondern auch mit Programmbeiträgen<br />
nahm das Kulturforum wieder an<br />
wichtigen internationalen Buchmessen<br />
teil. Das Gastland Rumänien in Leipzig<br />
bot Gelegenheit zur Präsentation einer<br />
Fotoausstellung von Marc Schroeder<br />
über in der Nachkriegszeit nach Russland<br />
deportierte Rumäniendeutsche.<br />
Außerdem beteiligte sich das Kulturforum<br />
an zwei Podien, u. a. mit Carmen-<br />
Francesca Banciu, Claudiu M. Florian, Iris<br />
Wolff und Jan Koneffke.<br />
Im jährlichen »Weltempfang. Zentrum<br />
für Politik, Literatur und Übersetzung«<br />
der Frankfurter Buchmesse und<br />
des Auswärtigen Amtes veranstaltete<br />
das Kulturforum ein Podiumsgespräch<br />
über den Umgang mit dem gemeinsamen<br />
Kulturerbe in Kaliningrad. Der SPIE-<br />
GEL-Journalist Christian Neef befragte<br />
dazu die Kaliningrader Kulturaktivistin<br />
Anna Karpenko und die Autorin Ulla<br />
Lachauer.<br />
Die vom Kulturforum verlegten Titel<br />
stießen auch bei der Buch Wien auf<br />
reges Interesse, besonders die Neuerscheinung<br />
über die Donauschwaben<br />
mit einer öffentlichen Erstpräsentation<br />
durch die Autoren. Am Stand nahmen<br />
viele Schulklassen am Glücksradspiel<br />
teil und konnten so ihr Wissen zu Regionen<br />
im östlichen Europa erweitern.<br />
In Breslau/Wrocław zeigte das Kulturforum<br />
seine polnischen und deutschen<br />
Publikationen gemeinsam mit<br />
dem Schlesischen Museum zu Görlitz.<br />
Dabei kam es wie auch bei den anderen<br />
Messeauftritten zu interessanten<br />
Gesprächen mit Autorinnen und Kooperationspartnern,<br />
so mit dem Direktor<br />
des Stadtmuseums und einem Vertreter<br />
der OP ENHEIM-Stiftung.<br />
Tanja Krombach<br />
Treffpunkt der Generationen am Stand des Kulturforums<br />
und seiner Partnereinrichtungen auf<br />
der Leipziger Buchmesse <strong>2018</strong><br />
19
Achtung, Kanalarbeiten!<br />
Auftritte des Kulturforums in den Sozialen Medien und auf Internetplattformen<br />
Das Klischee von der glamourösen Pressereferentin, die mit<br />
Journalisten Kaffee trinkt oder zum Redaktionsbesuch beim<br />
örtlichen Fernsehsender vorbeischaut, ist längst Geschichte –<br />
es sei denn, sie verfügt über einen Stab von Assistenten. Heute<br />
erfolgt die Presse- und<br />
Öffentlichkeitsarbeit in erster<br />
Linie vom PC oder vom<br />
mobilen Endgerät aus. Die<br />
in Spitzenzeiten täglich verschickten<br />
Pressemitteilungen<br />
und die umfangreiche<br />
Website des Kulturforums<br />
als »klassische« Formen der<br />
digitalen PR sind dabei nur<br />
eine Seite der Medaille. Seit<br />
<strong>2018</strong> präsentieren wir uns<br />
in drei Sozialen Medien:<br />
Zur Facebook-Seite und zum YouTube-Kanal gesellt sich nun<br />
auch ein Instagram-Auftritt. Aus Kapazitätsgründen legen wir<br />
dabei den Schwerpunkt auf die Facebook-Seite, die mit zwei<br />
bis drei sorgfältig redigierten Postings wöchentlich gepflegt<br />
wird. Dazu kommen die regionalen Veranstaltungskalender,<br />
die Publikationsplattform Yumpu und themengebundene<br />
Portale wie die Website von Sharing Heritage, die anlässlich<br />
des Kulturerbejahrs <strong>2018</strong> initiiert wurde. Unsere Digital Natives,<br />
meist Praktikantinnen und Praktikanten, sind in diesen<br />
Belangen gefragte Experten. Manchmal verkünden sie auch<br />
Hiobsbotschaften – etwa, dass die Karawane der umworbenen<br />
jugendlichen Zielgruppe weitergezogen ist und das eben<br />
noch angesagte Netzwerk gerade aus der Mode kommt. Langweilig<br />
wird es also nicht, und Kaffee kann man ja auch vor<br />
dem Rechner trinken.<br />
Vera Schneider<br />
Seit Herbst <strong>2018</strong> hat die facebook-Seite des Kulturforums mit über<br />
2 000 Abonnenten die höchsten Nutzerzahlen unter den nach § 96 Bundesvertriebenengesetz<br />
vom Bund geförderten Institutionen.<br />
Im Hintergrund: Screenshot vom Intro der Plattform sharingheritage.de,<br />
das Projekte in ganz Europa vorstellt. Das markierte Puzzleteil ist ein Eintrag<br />
des Kulturforums zur Ausstellung Innovation und Tradition. Hinrich<br />
Brunsberg und die spätgotische Backsteinarchitektur in Pommern und der<br />
Mark Brandenburg.<br />
20
1 2 3<br />
Programm und<br />
Verlag <strong>2018</strong><br />
Thementage und Veranstaltungsreihen<br />
Literaturtage an der Neiße: Görlitz, Zgorzelec (April, Foto 1, © Axel<br />
Lange)<br />
Backstein im Nordosten. Mittelalterliche Architektur in Estland und<br />
Lettland: Brandenburg an der Havel (Juni, Foto 2)<br />
Multikulturelle Slowakei. Buchpräsentation und Film: Literarischer<br />
Reiseführer Pressburg/Bratislava und Sprechen Sie Karpatendeutsch?:<br />
Erfurt, Leipzig (September)<br />
»Auswanderung ohne Einwanderung«. Die Deportation der polnischen<br />
Juden aus dem Deutschen Reich 1938: Berlin (November)<br />
Aus Liebe zur Meisterschaft: Max Brod als Vermittler und Entdecker.<br />
Ein musikalisch-literarischer Themenabend zum 50. Todestag<br />
des Prager deutschen Autors: Prag (November)<br />
Zwischen Trauer und Triumph. Der Untergang des Habsburgerreichs<br />
1918 im Spiegel der Literatur: Wien, München (November)<br />
»… wenn einem nicht ein wunderbares Bild in der Seele fehlen<br />
soll.« Die Kurische Nehrung – einstige Grenzregion zwischen<br />
Deutschland und Litauen: Lüneburg (November)<br />
Deutsch-tschechische Familiengeschichten: Alena Mornštajnová,<br />
Hana. Berlin (November)<br />
Podiumsdiskussionen und Vorträge<br />
Im Fluss der Zeit – Jüdisches Leben an der Oder: Potsdam (Januar,<br />
Februar), Greifswald (Februar), Kulturzug Breslau/Wrocław–Berlin<br />
(Juni), Berlin (Juni, Oktober)<br />
Ein Nationalstaat mit vielen Nationalitäten – Polens Grenz- und<br />
Minderheitenpolitik 1918–1939: Berlin (Februar)<br />
Die Kaukasuspolitik des Deutschen Reiches 1918 und die Kaukasusdeutschen:<br />
Berlin (März)<br />
Die Schaleks – eine mitteleuropäische Familie. Fünf Biografien<br />
erzählen hundert Jahre Geschichte: München (März), Augsburg<br />
(Mai)<br />
Der andere Blick. Rumänien in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur:<br />
Leipzig (März)<br />
Entgrenzung – Deutsche auf Heimatsuche zwischen Württemberg<br />
und Kaukasien: Fürstenwalde (März)<br />
Bessarabien 1918. Eine historische Region in Südosteuropa am<br />
Ende des Ersten Weltkriegs: Berlin (April)<br />
Polen – ein Spielball der Großmächte? Probleme der Bewertung<br />
einer europäischen Frage in der Übergangszeit 1770–1830:<br />
Potsdam (Mai)<br />
»Zur Sprache bringen, was nicht verschwiegen bleiben kann«.<br />
Hans von Held – ein unbequemer Staatsdiener in Preußens<br />
Osten: Potsdam (Mai)<br />
Die Entwicklung der Presselandschaft in Posen/Poznań im 18. und<br />
19. Jahrhundert im Spannungsfeld der politischen Umwälzungen<br />
in Europa: Potsdam (Juni)<br />
Aus der Geschichte lernen. Lesung und Gespräch mit Michael<br />
Wieck: Lüneburg (September)<br />
Neue Grenzen – neue Gräben. Polen nach dem Weltkrieg und sein<br />
brisantes Minderheitenproblem: Potsdam (September)<br />
Kant in Kaliningrad. Gemeinsames Kulturerbe in Zeiten russischeuropäischer<br />
Konfrontation: Frankfurt am Main (Oktober, Foto 3)<br />
Zwischen Posen und Poznań. Zur Geschichte einer »Stadt dazwischen«:<br />
Potsdam (Oktober)<br />
Reformation und nationale Wiedergeburt in der Slowakei:<br />
Meißen (Oktober)<br />
21
4 5 6<br />
Die Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit. Ein demokratischer<br />
Nationalitätenstaat im Spannungsfeld zwischen Selbstbehauptung<br />
und äußeren Revisionsansprüchen:<br />
Potsdam (Oktober)<br />
Von Königsberg nach Kaliningrad. Ein russisch-deutsches<br />
Gespräch zum 100. Geburtstag des Dichters Johannes Bobrowski:<br />
Berlin (Oktober)<br />
Wannen-Poesie im Damenbad. Humor in Franzensbad-Texten<br />
von Marie von Ebner-Eschenbach und Jan Neruda: Franzensbad/<br />
Františkovy Lázně (November)<br />
Galizien 1918 – zwischen Kakanien und Chaos: Berlin (November)<br />
Das Kriegsende 1918 und seine Folgen im südöstlichen<br />
Europa: Potsdam (November)<br />
Plötzlich Minderheit! Ethnischer Bekenntniszwang und Indifferenz<br />
nach 1918: Berlin (Dezember)<br />
Fragiler Frieden. Das östliche Europa nach 1918:<br />
Potsdam (Dezember)<br />
Netzwerke der Moderne. Adolf Rading und Hans Scharoun an der<br />
Breslauer Kunstakademie: Berlin (Dezember)<br />
Die Dobrudschadeutschen und der Erste Weltkrieg – zwischen<br />
Selbstdarstellung und Fremdwahrnehmung: Berlin (Dezember)<br />
Lesungen und Buchvorstellungen<br />
Renata SakoHoess, Literarischer Reiseführer Pressburg/Bratislava:<br />
Berlin (Februar, Foto 4), Bernried am Starnberger See (März),<br />
München (Juli), Regensburg (November)<br />
Seelenruhig. Vom Aufwachsen in einer Minderheit. Lesung mit den<br />
Autoren Claudiu M. Florian und Florjan Lipuš: Leipzig (März)<br />
Das rote Akkordeon. Über Balthasar Waitz’ neuen Roman:<br />
Budapest (April)<br />
Arne Franke, Das schlesische Elysium. Burgen, Schlösser, Herrenhäuser<br />
und Parks im Hirschberger Tal: Erftstadt (September)<br />
Ein Abend mit Herta Müller. Lesung und Gespräch mit der<br />
Literaturnobelpreisträgerin von 2009: Detmold (Oktober)<br />
Peter Oliver Loew, Literarischer Reiseführer Danzig:<br />
Dresden (Oktober)<br />
Schlesische Erfahrungswelten – Lesung und Gespräch mit<br />
Matthias Nawrat: Berlin (Oktober)<br />
Gerhard Seewann, Michael Portmann, Donauschwaben: Wien, Ulm<br />
(November), München (Dezember)<br />
Andersstadt und Hünenkronen. Buchpräsentation und Lesung mit<br />
Paula Schneider: Kronstadt/Braşov (November)<br />
Das Oppenheim-Haus. Ein Bürgerhaus erzählt Breslauer Stadtgeschichte.<br />
Buchvorstellung: Breslau/Wrocław (Dezember)<br />
Russlanddeutsche Literatur. Lesung und Gespräch mit Eleonora<br />
Hummel und Artur Böpple: Berlin (Dezember)<br />
Film und Musik<br />
Wunden – Erzählungen aus Transsilvanien. Filmvorführung und<br />
Gespräch: Berlin (Januar)<br />
Hinter sieben Burgen. Filmvorführung und Gespräch:<br />
Berlin (Februar)<br />
Gherdeal. Filmvorführung und Gespräch: Berlin (März)<br />
Sprechen Sie Karpatendeutsch? Filmvorführung und<br />
Gespräch: Bernried am Starnberger See (März), Wien (Mai)<br />
Leaving Transylvania – Ein Siebenbürger Abschied. Filmvorführung<br />
und Gespräch: Berlin (April)<br />
Schlesien, Śląsk – eine filmische Entdeckung. Filmabend:<br />
Berlin (Mai)<br />
22
7 8 9<br />
Ein Dorf erwacht. Filmvorführung und Gespräch: Berlin (Mai)<br />
Filmreihe »Deutsch-jüdische Biografien aus Böhmen und dem<br />
Baltikum« beim 24. Jüdischen Filmfestival Berlin & Brandenburg:<br />
Berlin (Juni)<br />
Romantische Raritäten. Konzert und CD-Präsentation:<br />
Berlin (August), Nordwestuckermark (September, Foto 5)<br />
Wiederkehr. Ein Film von Volker Koepp zum 100. Geburtstag von<br />
Johannes Bobrowski. Vorführung und Gespräch: Berlin (Oktober)<br />
Sektion Regio: Silesia beim 28. FilmFestival Cottbus. 14 Filmvorführungen,<br />
teils mit Gesprächen: Cottbus (November, Foto 6)<br />
Eine Perle in der Krone. Filmvorführung und Vortrag:<br />
Potsdam (November)<br />
Lemberg – Lwów – Львів, die Stadt mit den vielen Namen.<br />
Eine Filmreportage mit Stadtschreiberin Barbara Thériault:<br />
Potsdam (November)<br />
Hunger in Waldenburg. DVD-Premiere: Potsdam (Dezember)<br />
Wir sind Juden aus Breslau. Filmvorführung: Breslau/Wrocław<br />
(Dezember)<br />
Messen, Events und Exkursionen<br />
Geschichtsmesse: Suhl (Januar)<br />
Leipziger Buchmesse (März)<br />
Potsdamer Europafest: Potsdam (Mai, Foto 7)<br />
Pompeji an der Oder: Küstrin/Kostrzyn und die Neumark entdecken.<br />
Das Kulturforum auf dem Potsdamer Tag der Wissenschaften:<br />
Potsdam (Mai, Foto 8)<br />
Auf den Spuren der Donauschwaben. Studienreise nach Ungarn,<br />
Serbien und Rumänien: ab/bis Wien (Juli, August)<br />
Kulturfestival der deutschen Minderheit in Breslau: Breslau/<br />
Wrocław (September)<br />
Frankfurter Buchmesse (Oktober)<br />
Buch Wien (November, Foto 9)<br />
Breslauer Buchmesse/Wrocławskie Targi Dobrych Książek<br />
(Dezember)<br />
Ausstellungen<br />
Was bewegte das östliche Europa nach 1918?: Potsdam (ganzjährig)<br />
Reformation im östlichen Europa – Siebenbürgen: 10 Orte in<br />
Siebenbürgen (ganzjährig), Debrecen (März), Pirna (April–Juni)<br />
»Meisterhaft wie selten einer …«. Die Gärten Peter Joseph Lennés<br />
zwischen Schlesien und Pommern: Frankfurt (Oder)/Słubice<br />
(Januar–März), Düsseldorf (April–Mai), Ratingen (Juli–Oktober),<br />
Jarocin (Oktober – Januar 2019)<br />
Reformation im östlichen Europa – Slowakei/Oberungarn: Bad Homburg<br />
(Januar–Februar), Debrecen (März), Pressburg/Bratislava (Mai)<br />
Reformation im östlichen Europa – Die böhmischen Länder:<br />
15 Orte in Tschechien (Februar–Dezember, Foto 10: Hermannstädtel/Heřmanův<br />
Městec), Augsburg (Mai), Speinshart (Mai–Juli), Altdorf<br />
(Juni–Juli)<br />
»Immer war diese Hoffnung …«. Ehemalige Russlanddeportierte<br />
erinnern sich: Leipzig (März)<br />
Entgrenzung – Deutsche auf Heimatsuche zwischen Württemberg<br />
und Kaukasien: Odessa (März–April), Nürnberg (Mai)<br />
Innovation und Tradition. Hinrich Brunsberg und die spätgotische<br />
Backsteinarchitektur in Pommern und der Mark Brandenburg:<br />
Berlin (März–April), Marburg/Lahn (Mai–Juli), Doberlug-Kirchhain<br />
(September–Januar 2019)<br />
23
10 11 12<br />
Reformation im östlichen Europa – Überblick: Debrecen (März),<br />
Siegen (Oktober), Iserlohn (November), Großenhain (Oktober–<br />
November)<br />
Wolfskinder. Verlassen zwischen Ostpreußen und Litauen:<br />
Ellingen (April–September)<br />
Wortgewalten – Hans von Held. Ein aufgeklärter Staatsdiener zwischen<br />
Preußen und Polen: Caputh (Mai–Juli), Neiße/Nysa (November),<br />
Breslau/Wrocław (Dezember–Januar 2019)<br />
Struktur und Architektur. Das postindustrielle Kulturerbe Oberschlesiens:<br />
Düsseldorf (Mai–Juli)<br />
Im Fluss der Zeit – Jüdisches Leben an der Oder: Breslau/Wrocław<br />
(Juni–August), Berlin (September–November), Landsberg a. d.<br />
Warthe/Gorzów Wielkopolski (November–Februar 2019)<br />
Reformation im östlichen Europa – Überblick (englisch):<br />
Schäßburg/Sighişoara (Juni–Dezember)<br />
Wissenschaftslandschaft Siebenbürgen: Gundelsheim (Juli)<br />
Brandenburg und Siebenbürgen: Karlsburg/Alba Iulia (September)<br />
Die Schaleks – eine mitteleuropäische Familie. Fünf Biografien<br />
erzählen hundert Jahre Geschichte: Aussig/Ústí n. L. (Oktober–<br />
November), Dresden (November–Januar 2019)<br />
Aus der Werkstatt des Krieges: Hermannstadt/Sibiu (November)<br />
Wissenschaftsstandorte in Potsdam – damals und heute:<br />
Potsdam (seit November)<br />
Kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und<br />
junge Erwachsene<br />
Sagen und Märchen aus meiner Region. Erzähl- und Schreibworkshops:<br />
Laibach/Ljubljana (März), Zagreb, Kischinew/Chișinău<br />
(April)<br />
Lenau und Anastasius Grün – Vermittler zwischen zwei Kulturen:<br />
Fünfkirchen/Pécs (April)<br />
Avantgarde im Dienste des Nationalismus? Brünn – weiße Stadt<br />
der Moderne. Zeichenexkursion: Brünn/Brno (Mai, Foto 11 ,<br />
© Jesper Hake)<br />
Fortbildungsseminar für Vertreter deutscher Minderheiten:<br />
Potsdam (Juni)<br />
Vom Traum zur Wirklichkeit. Internationales deutschsprachiges<br />
Studententheatertreffen: Klausenburg/Cluj (Oktober)<br />
Deutschsprachige Medien im östlichen Europa. Workshop für<br />
Studierende: Berlin, Potsdam (Oktober)<br />
Deutsch-polnisch-tschechische Schülerbegegnung:<br />
Filmgespräche und Workshops beim 28. FilmFestival Cottbus,<br />
Sektion Filmbildung (November)<br />
Schüler für Schüler. Geschichten mit Biss: Nauen, Bad Freienwalde,<br />
Müncheberg, Folkenberg, Cottbus (November)<br />
V. Bohdan-Osadchuk-School: Wohnwitz/Wojnowice (November)<br />
Glück auf! Gašpar im Hauerland. Puppentheater für deutschsprachige<br />
und deutschlernende Schüler/innen in der Slowakei:<br />
Kesmark/Kežmarok, Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnilcom,<br />
Kaschau/Košice, Kremnitz/Kremnica, Deutsch Proben/Nitrianske<br />
Pravno, Pressburg/Bratislava (Dezember, Foto 12 )<br />
Georg Dehio-Kulturpreis<br />
Georg Dehio-Buchpreis <strong>2018</strong>. Lesung der Preisträger und<br />
Gespräch: Berlin (Oktober)<br />
Georg Dehio-Buchpreis <strong>2018</strong>. Preisverleihung: Berlin (Oktober)<br />
24
Neuerscheinungen und Übersetzungen<br />
Joachim Bahlcke, Anna Joisten (Hg.), Wortgewalten. Hans von Held.<br />
Ein aufgeklärter Staatsdiener zwischen Preußen und Polen.<br />
Mit zahlr. farb. u. S.-W.-Abb. u. umfangr. Registern, 417 S., € 19,80,<br />
ISBN 978-3-936168-81-5 (Januar)<br />
Blickwechsel. Journal für deutsche Kultur und Geschichte im östlichen<br />
Europa. Ausgabe 6: Zwischen Trauer und Triumph. Das Jahr<br />
1918 und seine Folgen im östlichen Europa, 60 S., Schutzgeb. € 2,50,<br />
ISSN 2195-9439 (März)<br />
Anna Grusková, Jozef Tancer, Sprechen Sie Karpatendeutsch?,<br />
Dokumentarfilm, Slowakisch mit dt. UT, Deutsch und div. Dialekte,<br />
71 Min. (April)<br />
Franz Xaver Gebel, Doppelquintett op. 28 und Carl Schuberth,<br />
Oktett op. 23. Ersteinspielung auf CD durch das Hoffmeister-Quartett<br />
mit Patrick Sepec und Solisten des Wrocław Baroque-Orchestra.<br />
Mit deutsch-englischem Booklet, 62:49 Min., Kooperation mit<br />
Profil-Edition Günter Hänssler, Best.-Nr. PH 17071, € 15 (April)<br />
Reformation im östlichen Europa – Die böhmischen Länder.<br />
Begleitbroschüre zur Ausstellung, Ausgabe in Deutsch und<br />
Tschechisch (Mai)<br />
Ralf Pasch, Tanja Krombach, Die Kulturingenieure, Die Schaleks.<br />
Zwischen den Fronten, Begleitfilm zur Ausstellung Die Schaleks –<br />
eine mitteleuropäische Familie. Fünf Biografien erzählen hundert<br />
Jahre Geschichte. 9 Min., auf YouTube zugänglich, Versionen in<br />
Deutsch und Tschechisch (Juni, Oktober)<br />
Hunger in Waldenburg. DVD-Anthologie, 143 Min., € 14,90, Kooperation<br />
mit dem Filmmuseum Potsdam, absolut MEDIEN und der<br />
arte Edition, ISBN: 978-3-8488-3013-8 (Juli)<br />
Reformation im östlichen Europa – Siebenbürgen. Begleitbroschüre<br />
zur Ausstellung, Ausgabe in Ungarisch (Juli)<br />
Arne Franke, Das schlesische Elysium. 4., aktual. u. erw. Aufl., mit<br />
zahlr. farb. u. S.-W.-Abb., Glossar, Kurzbiogr., ausführl. Registern u.<br />
zweispr. Karten. 282 S., € 19,80, ISBN 978-3-936168-78-5 (August)<br />
Peter Oliver Loew, Literarischer Reiseführer Danzig. 2., aktual. u.<br />
erw. Aufl. Mit zahlr. farb. u. S.-W.-Abb., Kurzbiogr., Zeittafel, ausführl.<br />
Registern u. zweispr. Karten. 408 S., Integralbroschur m.<br />
Lesebändchen, € 19,80, ISBN 978-3-936168-79-2 (Oktober)<br />
Gerhard Seewann, Michael Portmann, Donauschwaben. Deutsche<br />
Siedler in Südosteuropa. Mit zahlr. farb. u. S.-W.-Abb., Karten u. ausführl.<br />
Registern, 371 S., € 19,80, ISBN 978-3-936168-72-3 (Oktober)<br />
Paula Schneider, Andersstadt und Hünenkronen. Orașul altfel şi<br />
Corona uriașilor: Einblicke der Stadtschreiberin von Kronstadt<br />
2017. Deutsch-rumänische Ausgabe, Übersetzung ins Rumänische:<br />
Antonia Binder, Kooperation mit Aldus Verlag Kronstadt, 167 S.,<br />
ISBN 978-606-984-0146 (November)<br />
Lisa Höhenleitner, Das Oppenheim-Haus. Ein Bürgerhaus erzählt<br />
Breslauer Geschichte, Deutsche und polnische Ausgabe, Kooperation<br />
mit der Stiftung OP ENHEIM, mit zahlr. farb. Abb., 92 S., € 15,80,<br />
ISBN 978-3-89923-398-8 (deutsche Ausgabe), ISBN 978-3-89923-<br />
401-5 (polnische Ausgabe) (Dezember)<br />
25
Team des Kulturforums<br />
Saskia Aberle, Assistenz Direktion, Veranstaltungsorganisation<br />
Ariane Afsari, Arbeitsbereiche Verlag und Kulturelle Bildung<br />
Susanna Becker, Assistenz Verlag, Elektronische Medien<br />
Bruno Dietrich, Bundesfreiwilligendienst (ab 1. September <strong>2018</strong>)<br />
Dr. Magdalena Gebala, Arbeitsbereich Polen<br />
Dr. Klaus Harer, Arbeitsbereiche Musik und Osteuropa<br />
Frauke Kraft, Verwaltungsleiterin<br />
Tanja Krombach, Stellvertretende Direktorin, Leitung Verlag,<br />
Arbeitsbereich Tschechien und Slowakei<br />
Dr. Harald Roth, Direktor<br />
Dr. Vera Schneider, Arbeitsbereiche Presse- und<br />
Öffentlichkeitsarbeit, Verlag und Elektronische Medien<br />
Ute Schwabe, Sachbearbeiterin (bis 31. August <strong>2018</strong>)<br />
Hana Kathrin Stockhausen, Grafik, Design<br />
Dr. Ingeborg Szöllösi, Arbeitsbereich Südosteuropa<br />
Dr. Claudia Tutsch, Arbeitsbereiche Kunstgeschichte und Baltikum<br />
Ilona Wäsch, Sachbearbeiterin Verwaltung/Buchhaltung<br />
André Werner, Redaktionsleitung Website<br />
Das Team des Kulturforums<br />
Vorstand<br />
MinDgt. i. R. Winfried Smaczny, Berlin, Vorstandsvorsitzender<br />
Prof. Dr. Katrin Boeckh, Regensburg<br />
MinDir. i. R. Hans-Heinrich v. Knobloch, Berlin<br />
Kuratorium<br />
Stefan Schmitt-Hüttebräuker, Referatsleiter bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (Vorsitz)<br />
Prof. Oliver Günther, Ph. D., Präsident der Universität Potsdam<br />
Jadwiga Janukowicz, III. Botschaftssekretärin der Botschaft der Republik Polen in Berlin<br />
Merit Kopli, Vertreter der Botschaft der Republik Estland<br />
Karin Melzer, Vertreterin des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg<br />
Dr. Joachim Mähnert, Direktor des Ostpreußischen Landesmuseum Lüneburg, Vertreter der Mitgliederversammlung im Kuratorium<br />
Prof. Dr. Matthias Weber, Direktor des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa<br />
26
Mitglieder<br />
Deutsche Gesellschaft e. V., Berlin: Dr. Andreas H. Apelt, Bevollmächtigter des Vorstandes der D. G. e. V.<br />
Institut für deutsche Kultur und Geschichte in Südosteuropa, München:<br />
Dr. Florian Kührer-Wielach, Direktor<br />
Institut für deutsche Musikkultur im östlichen Europa: Prof. Dr. Klaus W. Niemöller, Vorsitzender<br />
Moses Mendelssohn Zentrum, Potsdam: Prof. Dr. Julius H. Schoeps, Direktor<br />
Nordost-Institut – Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa e.V., Lüneburg:<br />
Prof. Dr. Joachim Tauber, Direktor<br />
Ostpreußisches Landesmuseum, Lüneburg: Dr. Joachim Mähnert, Direktor<br />
Pommersches Landesmuseum, Greifswald: Dr. Uwe Schröder, Direktor<br />
Schlesisches Museum zu Görlitz: Dr. Markus Bauer, Direktor<br />
Stiftung Martin Opitz Bibliothek, Herne: Dr. Hans-Jakob Tebarth, Direktor<br />
Universität Potsdam: Prof. Oliver Günther, Ph. D., Präsident<br />
Universität Potsdam, Philosophische Fakultät, Historisches Institut: Prof. Dr. Matthias Asche<br />
Alle Angaben auf dieser Doppelseite entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2019.<br />
Impressum<br />
Herausgeber: Deutsches Kulturforum östliches Europa e. V.<br />
Berliner Straße 135, Haus K1<br />
14467 Potsdam<br />
www.kulturforum.info<br />
deutsches@kulturforum.info<br />
© 2019. Alle Rechte vorbehalten.<br />
V. i. S. d. P.: Dr. Harald Roth<br />
Abbildungen und Bildrechte: Wenn nicht anders in der Bildunterschrift angegeben,<br />
stammen die Bilder vom Deutschen Kulturforum östliches Europa.<br />
Reihengestaltung: Hana Kathrin Stockhausen<br />
Gestaltung und Satz dieser Ausgabe: Ania Dejewska, Potsdam<br />
Redaktion: Dr. Vera Schneider<br />
Redaktionsassistenz: Kristina Frenzel<br />
Druck und Bindung: FLYERALARM Würzburg<br />
27
Gefördert von<br />
Deutsches Kulturforum östliches Europa<br />
Berliner Straße 135, Haus K1 · 14467 Potsdam<br />
Tel. +49(0)331/20098-0<br />
Fax +49(0)331/20098-50<br />
deutsches@kulturforum.info<br />
www.kulturforum.info<br />
28