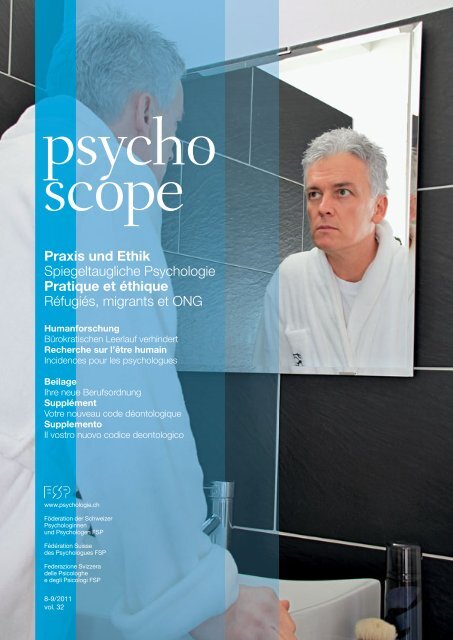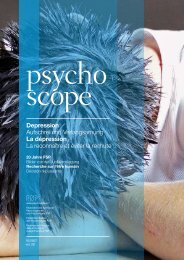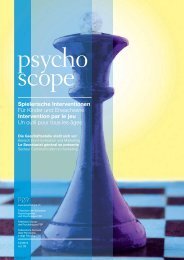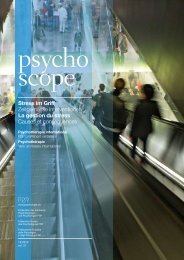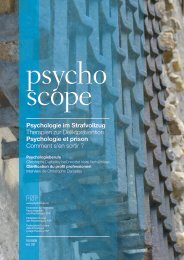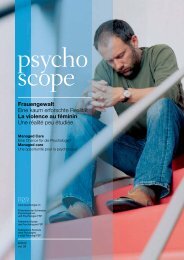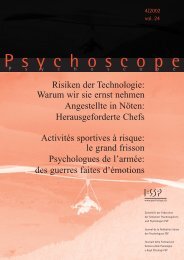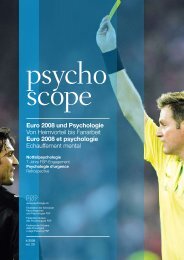KURSPROGRAMM pca.acp WEITERBILDUNG ... - FSP
KURSPROGRAMM pca.acp WEITERBILDUNG ... - FSP
KURSPROGRAMM pca.acp WEITERBILDUNG ... - FSP
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Praxis und Ethik<br />
Spiegeltaugliche Psychologie<br />
Pratique et éthique<br />
Réfugiés, migrants et ONG<br />
Humanforschung<br />
Bürokratischen Leerlauf verhindert<br />
Recherche sur l’être humain<br />
Incidences pour les psychologues<br />
Beilage<br />
Ihre neue Berufsordnung<br />
Supplément<br />
Votre nouveau code déontologique<br />
Supplemento<br />
Il vostro nuovo codice deontologico<br />
www.psychologie.ch<br />
Föderation der Schweizer<br />
Psychologinnen<br />
und Psychologen <strong>FSP</strong><br />
Fédération Suisse<br />
des Psychologues <strong>FSP</strong><br />
Federazione Svizzera<br />
delle Psicologhe<br />
e degli Psicologi <strong>FSP</strong><br />
8-9/2011<br />
vol. 32
Impressum<br />
Psychoscope ist die Zeitschrift der Föderation<br />
der Schweizer Psychologinnen und Psychologen<br />
(<strong>FSP</strong>).<br />
Psychoscope est le magazine de la<br />
Fédération Suisse des Psychologues (<strong>FSP</strong>).<br />
Psychoscope è la rivista della<br />
Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli<br />
Psicologi (<strong>FSP</strong>).<br />
Redaktion/Rédaction/Redazione<br />
Vadim Frosio (vf), redaction@fsp.psychologie.ch<br />
Susanne Birrer (sb), redaktion@fsp.psychologie.ch<br />
Redaktionskommission/Commission<br />
de rédaction/Comitato di redazione<br />
Carla Lanini-Jauch, lic. phil. (Präsidentin/<br />
Présidente/Presidente)<br />
Michela Elzi Silberschmidt, lic. phil.<br />
Rafael Millan, Dr psych.<br />
Susy Signer-Fischer, lic. phil.<br />
Hans Menning, Dipl.-Psych., Dr. rer. medic.<br />
Redaktionsadresse/Adresse de la rédaction/<br />
Indirizzo della redazione<br />
Choisystrasse 11, Postfach, 3000 Bern 14<br />
Tel. 031/388 88 28, Fax 031/388 88 01<br />
Tel. 031/388 88 00 (<strong>FSP</strong>-Sekretariat)<br />
E-Mail: psychoscope@fsp.psychologie.ch<br />
Internet: www.psychologie.ch<br />
Abonnemente/Abonnements/Abbonamenti<br />
Christian Wyniger<br />
Choisystrasse 11, Postfach, 3000 Bern 14,<br />
Tel. 031/388 88 28, Fax 031/388 88 01<br />
Inserate/annonces/annunci<br />
Stämpfli Publikationen AG, Postfach 8326,<br />
CH-3001 Bern, Tel. 031 300 63 83,<br />
Fax 031/300 63 90, inserate@staempfli.com<br />
Auflage/Tirage/Tiratura<br />
6150 (WEMF beglaubigt)<br />
Erscheinungsweise/Mode de parution/<br />
Pubblicazione<br />
10 mal jährlich/10 fois par année/10 volte l’anno<br />
Insertionsschluss/Délai pour les annonces/<br />
Termine d’inserzione<br />
der 15. des vorangehenden Monats/le 15 du<br />
mois précédent/il 15 del mese precedente<br />
Grafisches Konzept/Conception graphique/<br />
Concezione grafica<br />
PLURIAL VISION (www.plurialvision.ch)<br />
graphic design & communication, Fribourg<br />
Layout/Mise en page/Impaginazione<br />
Vadim Frosio, Susanne Birrer<br />
Druck/Impression/Stampa<br />
Effingerhof AG, 5200 Brugg<br />
Jahresabonnement/Abonnement annuel/<br />
Abbonamento annuale<br />
Fr. 85.– (Studierende/Etudiants/Studenti Fr. 48.–)<br />
Der Abonnementspreis ist im Jahresbeitrag der<br />
<strong>FSP</strong>-Mitglieder eingeschlossen.<br />
L’abonnement est inclus dans la cotisation<br />
annuelle des membres <strong>FSP</strong>.<br />
Il prezzo dell’abbonamento é incluso nella quota<br />
annuale dei membri <strong>FSP</strong><br />
Insertionspreise/Tarif des annonces/Inserzioni<br />
1 Seite/page/pagina Fr. 2100.–<br />
1/2 Seite/page/pagina Fr. 1150.–<br />
1/3 Seite/page/pagina Fr. 830.–<br />
1/4 Seite/page/pagina Fr. 670.–<br />
Copyright: <strong>FSP</strong><br />
ISSN-Nr.: 1420-620X<br />
Titelbild/Photo de coutverture:<br />
© wildworx – Fotolia.com<br />
Inhalt/Sommaire<br />
Psychoscope 8-9/2011<br />
Dossier<br />
Reserveengel der Exekutive?<br />
Von Susanne Guski-Leinwand 4<br />
Psychotherapie im 21. Jahrhundert<br />
Von Günter Schiepek 8<br />
L'action humanitaire et l'éthique<br />
Par Nago Humbert 12<br />
Migrants et réfugiés en consultation<br />
Par Betty Goguikian Ratcliff et Delphine Bercher 16<br />
Les articles signés reflètent l’opinion de leurs auteur(e)s<br />
Die Artikel widerspiegeln die Meinung der AutorInnen<br />
Vorstand - Comité - Comitato 20<br />
PsyG praktisch/LPsy en pratique<br />
Informationstag für Weiterbildungsanbieter 22<br />
Transparenz und Partizipation:<br />
Interview mit M. Gertsch und M. Stritt (BAG) 24<br />
Transparence et participation:<br />
Interview de M. Gertsch et M.Stritt (O<strong>FSP</strong>) 25<br />
Journée d'information <strong>FSP</strong> sur la formation 26<br />
<strong>FSP</strong>-aktuell/Actu <strong>FSP</strong><br />
Humanforschungsgesetz: Leerlauf verhindert 28<br />
DV: <strong>FSP</strong> vor neuen Herausforderungen 29<br />
Neue Zusatzqualifikation Gerontopsychologie 30<br />
Kurzmeldungen 30<br />
Recherche sur l'être humain: pas de temps morts 32<br />
AD: la <strong>FSP</strong> face à de nouveaux défis 33<br />
En bref 34<br />
Panorama 36<br />
Porträt: Ruth Enzler Denzler, Psychologin <strong>FSP</strong><br />
Ex-Bankdirektorin und Burnoutspezialistin 38<br />
Agenda 40
Editorial<br />
Berufsethische Gratwanderungen<br />
Bereits im hippokratischen Eid verankert – und bis<br />
heute insbesondere für menschenbezogenen Berufe<br />
zentral – ist das auch in der beigelegten <strong>FSP</strong>-Berufsordnung<br />
zu findende ethische Prinzip des «primum<br />
non nocere». Ebenso klassisch wie aktuell ist indes das<br />
mit ethischen Prinzipien unvermeidbar kollidierende<br />
brechtsche Lebensgesetz «Erst kommt das Fressen,<br />
dann die Moral».<br />
Für die in den Psychologieberufen tendenziell besonders<br />
anspruchsvolle Gratwanderung zwischen den genannten<br />
Extremen hofft das vorliegende Psychoscope<br />
den einen oder anderen anregenden Input für ein spiegeltaugliches<br />
Gesicht zu bieten.<br />
Dr. Susanne Guski-Leinwand, u.a. Lehrbeauftragte für<br />
Ethik in der Psychologie, hat sich in ihrem Beitrag mit<br />
der Beteiligung amerikanischer PsychologInnen an der<br />
sogenannten weissen Folter im US-Gefangenenlager<br />
Guantánamo beschäftigt.<br />
Das auf neusten Forschungsresultaten basierende, methodenunabhängige<br />
und interdisziplinäre Therapiemodell<br />
von Prof. Günter Schiepek umfasst auch berufsethische<br />
Aspekte. Dies u.a., indem das Fachwissen<br />
explizit der klienteneigenen Selbstorganisation dient.<br />
Nago Humbert ist Spezialist für medizinische Psychologie<br />
und mobile Palliativpflege sowie Präsident von<br />
Ärzte der Welt Schweiz (MdM). Im Psychoscope-Interview<br />
erläutert er u.a. den Zusammenhang zwischen berufsethisch<br />
korrektem Verhalten und dem Respekt der<br />
Bevölkerung in den Einsatzgebieten.<br />
Betty Goguikian Ratcliff und Delphine Bercher bewegen<br />
sich als Psychologin bzw. Psychotherapeutin in einem<br />
interkulturellen beruflichen Umfeld. Aus berufsethischer<br />
Sicht legen sie insbesondere Wert auf einen<br />
ressourcenorientierten Ansatz sowie die Berücksichtigung<br />
kultureller, juristischer und sozialer Aspekte.<br />
Susanne Birrer<br />
Deutschsprachige Redaktion<br />
La déontologie sur la corde raide<br />
Déjà ancré dans le Serment d’Hippocrate, le principe<br />
éthique du primum non nocere reste aujourd’hui encore<br />
d’une importance capitale pour les professions travaillant<br />
sur l’humain: il sera aussi présent dans le Code déontologique<br />
de la <strong>FSP</strong> que vous trouvez ci-joint. Tout aussi<br />
classique et actuelle est la règle de vie brechtienne, par<br />
essence inconciliable avec tout principe éthique: «La<br />
bouffe vient d’abord, ensuite la morale». Avancer sur la<br />
corde raide en maintenant un difficile équilibre entre<br />
ces deux extrêmes, c’est à quoi le présent numéro de<br />
Psychoscope aimerait d’une manière ou d’une autre inciter<br />
les psychologues dans l’exercice de leur profession.<br />
Le Dr Susanne Guski-Leinwand, chargée d’enseignement<br />
d’éthique en matière de psychologie, se penche<br />
dans son article sur la participation de psychologues<br />
américain(e)s à ce qu’on a appelé «la torture blanche»<br />
dans le camp de prisonniers de Guantánamo.<br />
Interdisciplinaire, basé sur les résultats les plus récents<br />
de la recherche, indépendant des méthodes et<br />
approches, le modèle de thérapie du Prof. Günter<br />
Schiepek présente aussi des aspects déontologiques.<br />
Ceci notamment quand le savoir professionnel sert explicitement<br />
à l’auto-organisation propre à chaque client.<br />
Nago Humbert, spécialiste en psychologie médicale et<br />
en soins palliatifs pédiatriques, est président de Médecins<br />
du Monde Suisse (MdM). Dans l’interview accordée<br />
à Psychoscope, il souligne notamment le rapport qui<br />
existe entre un comportement déontologique correct et<br />
le respect de la population dans les domaines d’intervention.<br />
Betty Goguikian Ratcliff et Delphine Bercher travaillent<br />
comme psychologue et psychothérapeute dans<br />
un environnement professionnel interculturel. En matière<br />
de déontologie, elles accordent une importance<br />
particulière à une approche fondée sur les ressources<br />
ainsi qu’à l’attention vouée aux aspects culturels, juridiques<br />
et sociaux.
4<br />
DOSSIER: Praxis und Ethik<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011 X-X/200X<br />
Dossier<br />
Praxis und Ethik<br />
Reserveengel<br />
der<br />
Exekutive?<br />
Ethik, Ethos und politische Verantwortlichkeit<br />
von Psychologinnen<br />
und Psychologen<br />
Anhand der Beteiligung amerikanischer<br />
PsychologInnen an der sogenannten<br />
weissen Folter in Guantánamo warnt die<br />
Heidelberger Lehrbeauftragte Dr. Susanne<br />
Guski-Leinwand davor, in die Rolle<br />
von «Reserveengeln der Exekutive» zu<br />
geraten. Die Autorin plädiert deshalb dafür,<br />
dass Psychologinnen und Psychologen<br />
ethische Richtlinien und spezifisches<br />
Fachwissen konsequent auch auf sich<br />
selber anwenden.<br />
Das Tätigkeitsfeld von Psychologinnen und Psychologen<br />
expandiert nicht nur hinsichtlich seiner Dreiteilung<br />
in Wissenschaft, Fach und Beruf (Graumann,<br />
1973) seit Jahrzehnten in seiner Breite, sondern erhält<br />
auch innerhalb dieser drei Teile eine zunehmende<br />
Vielfalt. Die Diskussion um die gesellschaftliche Relevanz<br />
der Psychologie, wie sie vor vielen Jahrzehnten im<br />
deutschsprachigen Raum aufgenommen wurde (Bondy,<br />
1959/1960; Baumgarten-Tramer,1961; Holzkamp,<br />
1970), muss deshalb heute noch mehr als damals über<br />
die Psychologieberufe geführt werden: In den beruflichen<br />
Tätigkeitsfeldern der Therapie, Beratung und Begutachtung<br />
schlagen sich zunehmend Aspekte und Beauftragungen<br />
aus der Exekutive, d.h. aus Bereichen der<br />
Regierung, der öffentlichen Verwaltung, der Staatsan-
Foto: © LOU OATES – Fotolia.com<br />
waltschaft und der Polizei, nieder, die als politische<br />
Verantwortlichkeit reflektiert werden sollten (Guski-<br />
Leinwand, 2007, 281ff.; Guski-Leinwand, 2010, 364ff.).<br />
Psychologie und Folter<br />
Die gegenwärtig wohl prominenteste Untersuchung zur<br />
politischen Verantwortlichkeit von Psychologinnen und<br />
Psychologen stammt von Mausfeld (2009): Er hatte<br />
die 2007 von der American Psychological Association<br />
(APA) bekundete Mithilfe von Psychologen bei der Entwicklung<br />
«alternativer Verhörtechniken» (z.B. der sogenannten<br />
weissen Folter, s. unten) und der zugehörigen<br />
Ausbildung von Experten zum Anlass genommen, den<br />
Beitrag der Psychologie in diesem Teil der Exekutive sowohl<br />
kritisch als politische Verantwortlichkeit von Wissenschaftlern<br />
wie auch ethisch in Bezug auf die Allgemeine<br />
Erklärung der Menschenrechte von 1948 (vgl.<br />
OHCHR, 2011) zu reflektieren.<br />
Unter dem Begriff der weissen Folter werden dabei verschiedene<br />
Foltermethoden zusammengefasst, die eine<br />
Zerstörung des psychischen Gleichgewichts zum Ziel<br />
haben, so u.a. die Isolationshaft, die soziale und die<br />
sensorische Deprivation (vgl. Mausfeld, R. [2009]. Foltern<br />
für das Vaterland. Über die Beiträge der Psychologie zur<br />
Entwicklung von Techniken der «weissen Folter», www.unikiel.de/psychologie/psychophysik/mausfeld/Mausfeld_<br />
Psychologie und Folter.pdf).<br />
Verletzte Menschenwürde<br />
Die meisten nationalen Berufsverbände der Psychologie<br />
(vgl. BDP/DGPs, 2005; SGP/SSP, 2003; Stemberger,<br />
2002) binden sich über ihre jeweilige nationale<br />
Verfassung an die Allgemeine Erklärung der<br />
Menschenrechte von 1948 (vgl. OHCHR, 2011), insbesondere<br />
an den Artikel 1, wonach die Würde des<br />
Menschen unantastbar ist. Im Zusammenhang mit psychischer<br />
Folter, über die Mausfeld dezidiert aufklärte,<br />
wird aber ebenjene Würde verletzt, deren Erhalt sich<br />
letztlich daran messen lässt, inwieweit im interpersonalen<br />
Kontakt bei allen Beteiligten eine Gleichwertigkeit<br />
hinsichtlich der Verfügbarkeit von Rechtsanspruch<br />
besteht. In Situationen psychischer Folter besteht diese<br />
Verfügbarkeit von Rechtsanspruch nicht mehr:<br />
«Der Schlüssel zur Erfassung von Folter liegt vielmehr in<br />
der Art der durch sie hergestellten interpersonalen Situation.<br />
In ihr erfährt sich der Gefolterte als ein vollständig<br />
rechtloses Objekt. Sie stellt die höchste Steigerungsform des<br />
Totalitären dar. Der vollständige Kontrollverlust und das<br />
grenzenlose Ausgeliefertsein einer Person an eine andere,<br />
die aus ihrer Sicht über eine gottgleiche Souveränität über<br />
sie verfügt, ist das bestimmende Merkmal der Folter.»<br />
(Mausfeld, 2009, 18).<br />
Moral und Mehrheit<br />
Normverletzungen und Verbrechen durch eine angebliche<br />
moralische Überlegenheit der verfolgten Ziele und<br />
durch Sicherheitsbedürfnisse des Staates zu rechtfertigen,<br />
wie es durch Mitglieder der American Psychological<br />
Association 2007 stattfand, widerspricht einer<br />
moralischen Urteilsfähigkeit, welche sich vor allem dadurch<br />
auszeichnet, dass «gewisse absolute Werte wie<br />
Leben oder Freiheit» (Colby & Kohlberg 1986, 146)<br />
Vorrang vor einer mehrheitlichen Meinung haben.<br />
Diese mehrheitliche Meinung unter etwa 150’000 Mitgliedern<br />
der APA war es jedoch, welche die psychologisch<br />
unterstützten und zur Deprivation führenden<br />
Verhörmethoden der CIA in Guantánamo als zulässig<br />
darstellte.<br />
Dass Psychologinnen und Psychologen in diesem Zusammenhang<br />
ihr eigenes Fachwissen (vgl. Colby &<br />
Kohlberg, 1986; Kohlberg, 1996; Lind, 2003; Montada,<br />
1998) nicht auf sich selbst anwenden, stellt eine besondere<br />
Merk-Würdigkeit dar, die offenbar werden lässt,<br />
dass es einer gesonderten Forderung dieser Selbstanwendung<br />
des eigenen Fachwissens innerhalb jeglicher<br />
ethischer Richtlinien bedarf. Die Anwendung des<br />
Fachwissens auf sich selbst bzw. auf die Profession ist<br />
bisher nur implizit und nicht explizit Gegenstand vieler<br />
nationaler ethischer Richtlinien. Geschieht diese Anwendung<br />
nicht, können Psychologen jedes Landes zu<br />
«Reserveengeln» jedweder Instanz werden.<br />
Musils Aktualität<br />
Im Kapitel 60 seines in den 30er-Jahren erschiene-<br />
nen Romans «Der Mann ohne Eigenschaften» charak-<br />
terisierte der promovierte Psychologe und Philosoph<br />
5
6<br />
DOSSIER: Praxis und Ethik<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011<br />
Robert Musil den Begriff des Reserveengels folgendermassen:<br />
«Gerichtshöfe gleichen Kellern, in denen die Weisheit der<br />
Vorvordern in Flaschen liegt; man öffnet diese und möchte<br />
darüber weinen, wie ungeniessbar der höchste, ausgegorenste<br />
Grad menschlicher Genauigkeitsanstrengung wird,<br />
ehe er vollkommen ist. Dennoch scheint er unabgehärtete<br />
Personen zu berauschen. Es ist eine bekannte Erscheinung,<br />
dass der Engel der Medizin, wenn er längere Zeit den Ausführungen<br />
der Juristen zugehört hat, sehr oft seine eigene<br />
Sendung vergisst. Er schlägt dann klirrend die Flügel zusammen<br />
und benimmt sich im Gerichtssaal wie ein Reserveengel<br />
der Jurisprudenz.»<br />
Wenn in Musils Roman auch Bezug auf die Medizin<br />
genommen wird, so ist das Zitat in Form der oben beschriebenen<br />
Haltung gegenüber der weissen Folter<br />
doch zweifellos auch auf ethisch bedeutsame Handlungsfelder<br />
der gegenwärtigen Psychologie anwendbar.<br />
Dienst(-Leistungen) für die Exekutive (wie auch für<br />
Unternehmen der Wirtschaft) müssen rollenadäquat<br />
und ethisch vertretbar bleiben.<br />
Historische und globale Aspekte<br />
Das Verbot der seelischen Misshandlung ist beispielsweise<br />
im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland<br />
in Artikel 104, Absatz 1, Satz 2, verankert: «Festgehaltene<br />
Personen dürfen weder seelisch noch körperlich<br />
misshandelt werden.» Vor diesem Hintergrund muss<br />
selbstverständlich auch die weisse Folter kritisch als<br />
seelische Misshandlung diskutiert werden.<br />
Inwieweit zudem Foltermethoden unter Mitwirkung<br />
von Psychologen respektive unter Hinzuziehung psychologischen<br />
Fachwissens bereits in der Zeit des Nationalsozialismus<br />
bzw. für den NS-Terror der Gestapo<br />
in den Konzentrationslagern und andernorts angewendet<br />
wurden, bedarf gerade vor dem Hintergrund<br />
der Diskussion um die weisse Folter mehr denn je einer<br />
systematischen Untersuchung. Diese steht indes<br />
seit Jahrzehnten aus (Guski-Leinwand, 2007, 5; Guski-<br />
Leinwand, 2010, 26f.).<br />
Amerikanische Psychologen hatten für ihre befürwortende<br />
Haltung zur weissen Folter 2007 eine nationalistische<br />
Begründung angeführt: Sie sahen sie zum<br />
Schutze der Nation als gerechtfertigt an. Dass dies international<br />
für Vertretende der Psychologieberufe kein<br />
Beugegrund sein sollte, hatte nach dem Zweiten Weltkrieg<br />
und nochmals Anfang der 60er-Jahre Franziska<br />
Baumgarten gefordert. Baumgarten war zwischen 1929<br />
und 1956 Privatdozentin bzw. Honorarprofessorin für<br />
Arbeitspsychologie und Psychotechnik an der Universität<br />
Bern sowie Mitglied der «Internationalen Vereinigung<br />
für Psychotechnik». Sie konstatierte, Psychologinnen<br />
und Psychologen seien «im Besitz ‹geistiger<br />
Waffen› zum Lenken, aber auch zum Hemmen, zum<br />
Einschreiten, also zum Einhaltgebieten gegenüber unerwünschten<br />
oder gar schädlichen Wegen des sozialen<br />
Lebens» (Baumgarten, 1949). Weiter forderte sie: «Die<br />
Freiheit der Forschung hat ihre Grenzen dort, wo dem<br />
Mitmenschen ein physisches oder seelisches Leid willentlich<br />
zugefügt wird.» (Baumgarten, 1961, 178). Analog<br />
zum hippokratischen Eid formulierte sie in diesem<br />
Zusammenhang zudem: «Menschliches Leid, wo immer<br />
und unter welchen Umständen es entstanden ist,<br />
muss gelindert werden.» (Baumgarten, 1961, 179).<br />
Kant als Massstab<br />
In Bezug auf die Psychologie als Wissenschaft und<br />
das Ethos der Psychologinnen und Psychologen gegenüber<br />
staatlichen oder ideologischen Aspekten erkannte<br />
Baumgarten:<br />
«Nur die voraussetzungslose Wissenschaft kann gedeihen;<br />
daher soll man nur an Problemen arbeiten, die keiner aufgezwungenen<br />
Theorie dienen. (...) Der Psychologe muss die<br />
der Gesellschaft aufgezwungene Ideologie auf ihren sozialethischen<br />
Inhalt hin prüfen und, falls das Ergebnis negativ<br />
ausfällt, diese Ideologie ablehnen. (...) Die Freiheit des Psychologen<br />
als Wissenschaftler soll sich auf die Ablehnung<br />
von Staatsbefehlen (erstrecken), die der Moral entgegengesetzt<br />
sind und den Mitbürgern körperliches und seelisches<br />
Leid bringen können.» (Baumgarten, 1961, 180ff.).<br />
Baumgarten sah den Psychologen stets so, dass er sich<br />
«in den Dienst des Mitmenschen» stellte (Baumgarten,<br />
1961, 177) und gemessen an den Stufen der moralischen<br />
Entwicklung nach Kohlberg (1986) geböte dies<br />
mindestens eine Orientierung am kategorischen Imperativ<br />
von Immanuel Kant: «Handle nur nach derjenigen<br />
Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie<br />
ein allgemeines Gesetz werde.» (Kant, 1785, 421/6).<br />
Baumgarten stellte schliesslich die Forderung nach einem<br />
internationalen ethischen Kodex, der unterdessen<br />
nachgekommen wurde: Nationale Berufsverbände –<br />
und seit einigen Jahren auch die European Federation<br />
of Psychologists Associations EFPA (an der sich auch<br />
die aktuelle Berufsordnung der <strong>FSP</strong> ausrichtet, Anm.<br />
der Red.) haben ethische Richtlinien und Codes bzw.<br />
Kodices veröffentlicht.<br />
Mahnung zur Konsequenz<br />
Werden diese aber nicht bzw. nicht in Verbindung mit<br />
dem eigenen spezifischen Fachwissen angewendet und<br />
somit nicht als Qualitätskriterium verstanden, wirft<br />
dies die Frage nach dem geistigen Gehalt sowie der<br />
Nachhaltigkeit des professionellen Handelns auf.<br />
«Ein Geist, der nicht zugleich immer auch sich selbst aufklärt<br />
und damit unter anderem Einsichten in seine eigenen<br />
Möglichkeiten erkennt, auch in Machtsphären zu<br />
wirken, ist von vornherein zur Wirkungslosigkeit und Bedeutungslosigkeit<br />
verurteilt.» (Pott, 2003, 12).
Mit diesen Worten interpretierte Hans-Georg Pott Robert<br />
Musils Rede von 1935 auf dem 1. Internationalen<br />
Kongress zur Verteidigung der Kultur (Pott, 2003, 12;<br />
vgl. auch Amann, 2007; Luserke, 1995; Stauf, 2007).<br />
Diese Auslegung könnte für Psychologinnen und Psy-<br />
chologen gemäss der Vorschläge von Franziska Baumgarten<br />
nicht nur Richtlinie, sondern auch Mahnung<br />
für professionelles Handeln überall dort sein, wo es um<br />
Tätigkeiten in der Therapie und Beratung geht sowie<br />
um die Begutachtung bezüglich beruflicher und natio-<br />
naler (Re-)Integration, Asyl, Abschiebung (vgl. von Ler-<br />
sner, 2009), Folter und Gefängnishaft.<br />
Zeit für einen «kategorischen Eid»<br />
Auf jeden einzelnen dieser Aspekte einzugehen, ist im<br />
Rahmen dieses Artikels nicht möglich. Die hier zugrunde<br />
liegende Absicht besteht deshalb vielmehr darin,<br />
darauf aufmerksam zu machen und dafür zu sensibilisieren,<br />
dass das (moralische) Urteilen und Handeln<br />
von Psychologen und Psychologinnen – sollen und wollen<br />
sie nicht zu den beschriebenen Reserveengeln der<br />
Exekutive werden – stets die Einhaltung des ethischen<br />
Codes und die Anwendung des spezifischen Fachwissens<br />
auf sich selbst erfordert.<br />
Für die Psychologie gibt es bisher keinen Eid, der –<br />
analog zum hippokratischen Eid – dazu verpflichtet,<br />
immer zum Wohle des Menschen zu handeln. Für die<br />
Psychologie könnte in Nachfolge von Baumgartens Vorschlägen<br />
ein «kategorischer Eid» diskutiert werden, gemessen<br />
am kategorischen Imperativ nach Kant (Guski-<br />
Leinwand, 2007, 285; Guski-Leinwand, 2010, 351). Die<br />
Zeit dafür scheint jedenfalls überreif.<br />
Susanne Guski-Leinwand<br />
Bibliografie<br />
Die vollständige Literaturliste ist bei der Autorin erhältlich.<br />
Amann, K. (2007). Robert Musil. Literatur und Politik. Reinbek<br />
bei Hamburg: Rowohlt.<br />
Guski-Leinwand, S. (2010). Wissenschaftsforschung zur<br />
Genese der Psychologie in Deutschland vom ausgehenden<br />
19. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Berlin: LIT<br />
Verlag.<br />
Lind, G. (2003). Moral ist lehrbar – Handbuch zur Theorie<br />
und Praxis demokratischer Bildung. München, Oldenburg:<br />
Schulbuchverlag GmbH.<br />
Pott, H.-G. (2003). Geist und Macht im essayistischen Werk<br />
Robert Musils. Online-Ressource: http://www.phil-fak.uniduesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Germanistik/AbteilungII/Materialien_Pott/Aufsaetze/GeistMusil.pdf<br />
von Lersner, U. (2009). Psychische Gesundheit und Humanitäre<br />
Reintegration im Kontext von Förderprogrammen<br />
zur Freiwilligen Rückkehr von Flüchtlingen. Psychosozial,<br />
115,1, 119–134.<br />
Die Autorin<br />
Dr. Susanne Guski-Leinwand ist freiberuflich in verschiedenen<br />
Feldern der Beratung tätig sowie Lehrbeauftragte<br />
für Ethik in der Psychologie an der Ruprecht-Karls-Universität<br />
Heidelberg. Fachlich ist sie u.a. auf Wissenschaftsgeschichte<br />
und Ethik der Psychologie spezialisiert.<br />
Anschrift<br />
Frau Dr. Susanne Guski-Leinwand, Dipl. Psych., Ruprecht-Karls-Universität<br />
Heidelberg, Psychologisches<br />
Institut, Hauptstr. 47–51, D-69117 Heidelberg.<br />
art-atelier@arcor.de<br />
Résumé<br />
Chargée d’enseignement à Heidelberg, le Dr Susanne<br />
Guski-Leinwand est une spécialiste des questions<br />
d’éthique dans le domaine de la pratique psychologique.<br />
Après la participation de psychologues américain(e)s à<br />
ce qu’on a appelé «la torture blanche» à Guantánamo,<br />
l’auteure, faisant référence à L’Homme sans qualités de<br />
Robert Musil, met en garde contre le risque de tomber<br />
dans le rôle «d’anges de réserve de l’exécutif».<br />
Dans le domaine des professions de la psychologie,<br />
Guski-Leinwand se prononce aussi pour l’introduction<br />
d’un «serment catégorique», qui, sur le modèle du serment<br />
d’Hippocrate des professions médicales, en s’appuyant<br />
à la fois sur les droits de l’homme et sur l’impératif<br />
catégorique de Kant, imposerait de se mettre en permanence<br />
au service du bien de l’homme et de ne jamais lui<br />
causer de préjudices.<br />
7
8<br />
DOSSIER: Praxis und Ethik<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011<br />
Psychotherapie im<br />
21. Jahrhundert<br />
Praxis-Implikationen einer schulenunabhängigen Psychotherapie<br />
Der renommierte Salzburger Psychotherapieforscher<br />
Prof. Dr. Günter Schiepek<br />
definiert die Psychotherapie der Zukunft<br />
als schulenunabhängiges synergetisches<br />
Prozessmanagement. Für Psychoscope<br />
leitet er daraus ethische und<br />
professionelle Standards ab.<br />
Die Organisation von Psychotherapie und Psychotherapieausbildungen<br />
nach «Schulen» kann aus wissenschaftlicher<br />
Sicht schon seit einiger Zeit als obsolet<br />
gelten. Mit dem neuen Psychologieberufegesetz der<br />
Schweiz ist sie zum ersten Mal nun auch rechtlich obsolet.<br />
Der Weg in die Zukunft, in eine Psychotherapie<br />
des 21. Jahrhunderts, ist frei. Bravo Schweiz.<br />
Fassen wir eingangs einige Argumente zusammen, die<br />
diese Entwicklung sinnvoll machten, und wenden wir<br />
uns dann den notwendigen professionellen und ethischen<br />
Standards für eine schulenunabhängige Psychotherapie<br />
zu.<br />
Zukunftsmodell Prozessmonitoring<br />
Schon seit längerem impliziert die aktuelle Psychotherapieforschung,<br />
dass schulenunspezifische Wirkfaktoren<br />
(wie Klaus Grawe sie treffend beschrieben hat) wie<br />
Therapeutenmerkmale, therapeutische Beziehung, Setting<br />
und soziales Umfeld – und insbesondere Klientenmerkmale<br />
wie Persönlichkeit, Problemaktualisierungsfähigkeit,<br />
Ressourcen, Problembewältigungsfähigkeiten<br />
und die intrinsische Veränderungsmotivation – wesentlich<br />
mehr zum Behandlungserfolg oder -misserfolg beitragen<br />
als methodenspezifische Technikvariablen (vgl.<br />
die Beiträge in Duncan, Miller, Wampold und Hubble,<br />
2010, sowie in Lambert, 2004).<br />
Hochaktuell und zahlenmässig schnell zunehmend<br />
sind zudem Studien zu «sudden gains» oder «early rapid<br />
responses», die die komplexe Dynamik des therapeutischen<br />
Prozesses berücksichtigen. Diese zeigen anhand<br />
engmaschig erfasster Therapieprozessdaten, dass<br />
Veränderungen in der Psychotherapie oft diskontinuierlich<br />
und sprunghaft statt linear und sukzessive stattfinden,<br />
wie auch, dass sie paradoxerweise häufig vor und<br />
nicht während oder nach den eingesetzten Interventionen<br />
auftreten.<br />
Schliesslich konnten Metamodelle zur Funktionsweise<br />
von Psychotherapie bereitgestellt werden (z.B. Grawe,<br />
1998; Haken & Schiepek, 2006/2010), die nicht mehr<br />
auf einem linearen Input-Output- bzw. Treatment-Effekt-Mechanismus<br />
und auf der additiven Superposition<br />
von Einzeleffekten und Einzelmassnahmen beruhen.<br />
Das Allgemeine Lineare Modell und die korrespondierende<br />
RCT-Logik (randomisierte kontrollierte Studien)<br />
sind Standards von gestern und wurden ersetzt durch<br />
eine aus dem Bereich der nichtlinearen, komplexen<br />
Systeme inspirierten Methodologie des Prozessmonitorings<br />
und Prozessfeedbacks.<br />
Professionalität neu definiert<br />
Psychotherapie wird dabei verstanden als ein dynamisches<br />
und adaptives Schaffen von Bedingungen für<br />
selbst organisierten Musterwandel im bio-psycho-sozialen<br />
System der Klientinnen und Klienten. Ein solches<br />
Modell von Psychotherapie findet seine Entsprechung<br />
in der Modellierung des Gehirns als System hochdynamischer,<br />
nichtlinearer, neuronaler Netzwerke, welche<br />
sich permanent wandelnde Synchronisationsmuster<br />
und Kaskaden von Ordnungsübergängen auf unterschiedlichen<br />
Zeitskalen erzeugen. Selbstorganisation<br />
scheint dabei ein zentrales Prinzip zu sein, das auf neuronaler,<br />
psychischer und sozialer Ebene Funktionswandel<br />
mit Strukturwandel in komplexen Systemen verbindet<br />
(Strunk & Schiepek, 2006).<br />
Die Professionalität der Psychotherapie liegt dann<br />
nicht mehr darin, Interventionen und Behandlungstechniken<br />
nach einem vorgegebenen Programm ablaufen<br />
zu lassen, sondern darin, Bedingungen für Selbstorganisationsprozesse<br />
herzustellen. Diese Bedingungen<br />
werden in Form der sogenannten «generischen Prinzipien»<br />
konkretisiert (Haken & Schiepek, 2006/2010).<br />
Was ist gute Psychotherapie?<br />
Nun gibt es sicher auch einige Gefahren und Paradoxien<br />
auf dem Weg zu einer «neuen» Psychotherapie, für<br />
die ja eine innovative Gesetzgebung allenfalls die Rahmenbedingungen<br />
liefern kann.
Eine Paradoxie kann darin bestehen, mit einer «allgemeinen»<br />
oder schulenneutralen Psychotherapie selbst<br />
wieder eine Schule zu gründen, was Anhänger und<br />
Gegner auf den Plan ruft.<br />
Eine andere Gefahr besteht darin, dass die Identifikationsmöglichkeiten<br />
mit den gewachsenen Therapieschulen<br />
und ihren Verbänden verloren geht. Schliesslich<br />
geht es darum, das Erfahrungswissen im Umgang mit<br />
einem reichen Fundus an Interventionen und im Sinne<br />
der bedeutsamen Therapeutenvariablen auch eine persönliche<br />
Wahlfreiheit für präferierte Vorgehensweisen<br />
und Techniken zuzulassen.<br />
Eine gute Psychotherapie wäre also eine, bei der die gewachsenen<br />
methodenspezifischen Identitäten noch teilweise<br />
erhalten blieben und auch der individuelle Erfahrungsschatz<br />
und das persönliche Kompetenzprofil jeder/<br />
jedes Einzelnen als Ressource genutzt werden kann.<br />
Aus dem Gesagten ergibt sich der Vorschlag, Psychotherapie<br />
nicht über eine Positivliste von einzusetzenden<br />
Methoden oder Therapieansätzen zu definieren – etwa<br />
nach dem Motto: Wissenschaftlich anerkannt und gerechtfertigt<br />
ist, wer der Richtung X angehört oder das<br />
Behandlungsprogramm A bei Störungsbild B einsetzt.<br />
Vielmehr wäre es sinnvoll, einen Katalog von Mindestanforderungen<br />
festzulegen, innerhalb dessen Therapeutinnen<br />
und Therapeuten sich relativ flexibel und<br />
nach den Erfordernissen der jeweiligen Konstellation<br />
und des individuellen Prozesses bewegen können.<br />
Ethische und professionelle Standards<br />
In Bezug auf die professionellen und ethischen Standards<br />
der Therapiepraxis legen die vorausgehenden<br />
Überlegungen Folgendes nahe:<br />
1. Es ist sicherzustellen, dass Therapeutinnen und<br />
Therapeuten nach hohen ethischen Standards handeln.<br />
Hierzu gehört es beispielsweise, emotionale<br />
oder sexuelle Übergriffe, aber auch narzisstischen,<br />
machtmotivierten, finanziellen oder anderen Missbrauch<br />
der Klientel zu verhindern. Solche ethischen<br />
Standards gibt es in Berufskodizes durchaus, die<br />
Frage ist meist eher, wie man ihre Einhaltung garantiert<br />
(z.B. über Videomitschnitte von Sitzungen,<br />
regelmässige Intervision und Supervision, «reflecting<br />
teams» und anderes).<br />
2. Im Sinne einer Negativliste sollten «unsinnige»<br />
Therapien, für die es weder empirische Evidenz<br />
noch eine sinnvolle, d.h. wissenschaftlich ernst zu<br />
nehmende Begründung gibt oder geben kann, ausgeschlossen<br />
werden. Dies ist liberaler gefasst als<br />
eine Positivliste mit «zugelassenen» Methoden und<br />
schafft auch Chancen für neue Ansätze wie z.B.<br />
derzeit vielversprechende achtsamkeitsorientierte,<br />
mentalisierungsorientierte oder emotionsfokussierte<br />
Vorgehensweisen.<br />
3. Hierbei ist es wichtig, dass auch ein prozess-, klienten-<br />
und kontextadäquater Einsatz von Vorgehensweisen<br />
gewährleistet wird: Der Einsatz eines an sich<br />
bewährten Vorgehens (z.B. Reizkonfrontation) im<br />
falschen Moment oder ohne die geeigneten motivationalen<br />
und kognitiven Voraussetzungen kann genauso<br />
problematisch sein wie die Anwendung einer<br />
absurden Therapiemethode. Es geht nicht nur um<br />
Indikation, sondern um adaptive, prozessadäquate<br />
Indikation.<br />
4. Die Möglichkeit und Teilnahme an regelmässiger<br />
Supervision und/oder Intervision ist sicherzustellen.<br />
5. Therapeutinnen und Therapeuten sollten über eine<br />
relativ gute soziale Kompetenz, emotionale Intelligenz<br />
und Selbstreflektiertheit verfügen. Dies ist<br />
an sich trivial und wird hier nur der Vollständigkeit<br />
halber erwähnt. Weniger trivial ist allerdings,<br />
wie diese Kompetenzen vermittelt und trainiert werden<br />
sollen. Ebenso bedeutsam ist die Frage, wie soziale<br />
Kompetenzen überprüft werden können: Gibt<br />
es therapierelevante Assessment Center? Gibt es objektivierbare<br />
Kriterien zur Beurteilung von live vorgeführten<br />
oder videografierten Therapiesitzungen?<br />
Und schliesslich fragt sich, wie diese Kompetenzen<br />
am Leben erhalten werden können, also auch bei<br />
längerer Berufstätigkeit nicht von Burnout oder Alltagsroutine<br />
erodiert werden.<br />
6. Psychotherapie bedeutet auf mehreren Ebenen und<br />
Zeitskalen ein Handeln in komplexen Systemen (für<br />
eine Überblick siehe Martin Rufer [2011]: Erfasse<br />
komplex – handle einfach). Dies kann intraindividuelle<br />
(mentale, emotionale) oder interpersonelle Systeme<br />
(z.B. die Klient-Therapeut-Interaktion oder die<br />
Paar- oder Familiendynamik in einer Paar- oder Familientherapie)<br />
betreffen sowie die Mikrodynamik<br />
in einer kurzen Interaktionssequenz oder die Gestaltung<br />
einer gesamten mehrmonatigen Therapie.<br />
Gefordert ist daher eine umfassende Systemkompetenz,<br />
d.h. das Verständnis sowie methodische und<br />
praktische Kompetenzen im Umgang mit und der<br />
Analyse von Systemstrukturen und -dynamiken.<br />
Elemente der Systemkompetenz<br />
Systemkompetenz (Haken & Schiepek, 2006/2010)<br />
umfasst zudem (a) natürlich klassische soziale Kompetenzen<br />
und die Fähigkeit zu kontextadäquatem Handeln,<br />
(b) den Umgang mit der Dimension Zeit, d.h. mit<br />
Phänomenen wie Nichtlinearität, Nichtvorhersehbarkeit,<br />
Eigendynamik, «Kairos» (qualifizierte Momente<br />
für Interventionen) und anderen, (c) den Umgang mit<br />
Stress, eigenen wie fremden Emotionen, Ressourcenaktivierung,<br />
Prävention von Burnout etc., (d) die Unterstützung<br />
von intraindividuellen und interpersonellen<br />
Selbstorganisationsprozessen, wobei hier die generi-<br />
9
10<br />
DOSSIER: Praxis und Ethik<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011<br />
schen Prinzipien als Beurteilungs- und Entscheidungshilfen<br />
eine wichtige Rolle spielen, (e) Wissen zur Funktionsweise<br />
komplexer Systeme, aber auch zu relevanten<br />
psychologischen wie medizinischen Themen und zur<br />
Neurowissenschaft, und (f) Modellierung und Analyse<br />
von Strukturen und Prozessen komplexer Systeme, wobei<br />
hier auch das Verständnis sämtlicher therapierelevanter<br />
Verfahren der nichtlinearen Zeitreihenanalyse<br />
subsumiert wird.<br />
Prozessmonitoring als Standardmethode<br />
Zum Standard einer schulenunabhängigen Psychotherapie<br />
sollte der Einsatz von Prozessmonitoring-Systemen<br />
gehören (Lambert, 2010; Lutz et al., 2010; Schiepek<br />
et al., 2011). Verfahren wie das Synergetische<br />
Navigationssystem (SNS) erlauben die hochfrequente<br />
(z.B. tägliche) Erfassung von unterschiedlichen Aspekten<br />
des Erlebens, die grafisch in Form von Zeitreihen<br />
dargestellt werden und mitlaufend analysiert werden.<br />
Implementiert sind hier vor allem Methoden, welche<br />
Hinweise auf sich verändernde Muster und kritische<br />
Instabilitäten geben. Die auf Basis des Therapie-Prozessbogens<br />
implementierte «Ampel» liefert einen aktuellen<br />
Kurzeindruck der erlebten Stabilität und Sicherheit<br />
des Klienten, seiner Veränderungsmotivation und<br />
Prozessinvolviertheit und des jeweiligen Grades der dy-<br />
namischen Komplexität als Hinweis auf eine kritische<br />
Instabilität vor Musterveränderungen bzw. Ordnungsübergängen<br />
(Schiepek et al., 2008, 2011). Neben der<br />
internetbasierten Prozesserfassung ist auch eine Outcome-Messung,<br />
z.B. in wöchentlichem Abstand oder<br />
im Vorher-nachher-Katamnese-Vergleich möglich. Spezifische<br />
einzelfallbezogene Fragebögen können zur Erfassung<br />
individueller Indikatoren dazugeschaltet werden.<br />
Über das Monitoring individueller Verläufe steht<br />
im SNS auch noch eine Beziehungsmusteranalyse für<br />
Dyaden, Familien, Gruppen, Helfersysteme oder Organisationen<br />
zur Verfügung.<br />
Relativ rationale Rechtfertigung<br />
Die neue Psychotherapie legt neben der bisher fast ausschliesslichen<br />
Fokussierung auf Interventionsmethoden<br />
bzw. Behandlungsprogramme und Störungsbilder also<br />
einen Akzent auf die Therapiesteuerung, was hier die<br />
Unterstützung und Gestaltung von Selbstorganisationsprozessen<br />
des Klienten bedeutet. In Konsequenz müsste<br />
auch der Begriff der Evidenzbasierung erweitert werden.<br />
Er bezieht sich heute fast ausschliesslich auf den Wirksamkeitsnachweis<br />
der eingesetzten Therapietechniken<br />
und Interventionen, während in Zukunft die Begründung<br />
des konkreten Vorgehens im Einzelfall im Mittelpunkt<br />
stehen sollte. Im Sinne einer «relativ rationalen<br />
Abb. 1: Struktur und Komponenten des synergetischen Prozessmanagements mit Bezug auf das Tätig keitsfeld<br />
Psychotherapie Quelle: zVg
Rechtfertigung» des therapeutischen Handelns (Westmeyer,<br />
1979) gilt es, dieses unter Bezugnahme auf eine<br />
Theorie der Veränderung und auf den aktuellen Entwicklungsstatus<br />
des KlientInnensystems zu begründen.<br />
Neu ist, dass dieser Entwicklungsstatus mit einem internetgestützten<br />
Prozessmonitoring wie dem SNS nun datenbasiert<br />
vorliegt und mit Bezug auf die zugrunde liegende<br />
Theorie der Selbstorganisation komplexer Systeme<br />
(Synergetik) analysiert und interpretiert werden kann.<br />
Bio-psycho-sozialer Ansatz bleibt<br />
Die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen wird uns<br />
allemal abverlangt, nicht nur wenn in Zukunft etwa<br />
Verfahren der adaptiven Neuromodulation oder des<br />
Neurofeedbacks mit Echtzeit-fMRT (funktionelle<br />
Magnetresonanztomografie) in der Psychotherapie<br />
mitbedacht werden könnten. Natürlich werden in Zukunft<br />
neurobiologische Erkenntnisse über Lern- und<br />
Entwicklungsprozesse, klinische Störungsbilder und<br />
Emotionen, Kognitionen und soziale Beziehungen zu<br />
berücksichtigen sein – aber auch weiterhin psychologische<br />
und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse.<br />
Neurowissenschaften und Philosophie (Erkenntnistheorie)<br />
werden in die Psychotherapie ebenso selbstverständlich<br />
zu integrieren sein wie Informatik (etwa<br />
zu Zwecken des Prozess- und Outcome-Monitorings)<br />
oder Mathematik (etwa zu Zwecken der Analyse von<br />
nichtlinearen Dynamiken). Schulenübergreifende Psychotherapie<br />
ist damit nicht ausschliesslich Neuropsychotherapie,<br />
sondern ein trans- und interdisziplinäres,<br />
multimethodales Mehrebenenprojekt mit starkem Innovationspotenzial.<br />
Damit ist und bleibt Psychotherapie ein äusserst spannendes<br />
bio-psycho-soziales Gesamtprojekt.<br />
Günter Schiepek<br />
Bibliografie<br />
Die vollständige Literaturliste ist beim Autor erhältlich.<br />
Duncan, B., Miller, S., Wampold, B. & Hubble, M. (Eds.)<br />
(2010). The Heart and Soul of Change (2nd. Ed.). Washington<br />
DC: American Psychological Association.<br />
Grawe, K. (1998). Psychologische Therapie. Göttingen:<br />
Hogrefe.<br />
Haken, H. & Schiepek, G. (2006, 2. Aufl. 2010). Synergetik<br />
in der Psychologie. Selbstorganisation verstehen und<br />
gestalten. Göttingen: Hogrefe.<br />
Schiepek, G. (2008). Psychotherapie als evidenzbasiertes<br />
Prozessmanagement. Ein Beitrag zur Professionalisierung<br />
jenseits des Standardmodells. Nervenheilkunde, 27(12),<br />
1138−1146.<br />
Schiepek, G. (Hrsg.) (2011). Neurobiologie der Psychotherapie<br />
(2. völlig überarbeitete und erweiterte Auflage).<br />
Stuttgart: Schattauer.<br />
Der Autor<br />
Prof. Dr. Günter Schiepek leitet in Salzburg das Institut für<br />
Synergetik und Psychotherapieforschung der Paracelsus<br />
Medizinischen Privatuniversität. Seine Arbeitsschwerpunkte<br />
sind Synergetik und Dynamik nichtlinearer Systeme<br />
in Psychologie und Neurowissenschaften,<br />
Anschrift<br />
Prof. Dr. Günter Schiepek, Institut für Synergetik und<br />
Psychotherapieforschung, Paracelsus Medizinische<br />
Privatuniversität, Universitätsklinikum/Christian Doppler<br />
Klinik, Ignaz Harrer Str. 79, 5020 Salzburg, Österreich.<br />
guenter.schiepek@pmu.ac.at<br />
Résumé<br />
Dans l’état actuel des recherches en psychothérapie, il<br />
semble que la mise sur pied d’une psychothérapie indépendante<br />
des différentes écoles – ou transversale – soit<br />
quelque chose de nécessaire et d’utile.<br />
Chercheur réputé en psychothérapie, le Professeur<br />
Günter Schiepek présente ici les critères et les standards<br />
professionnels et éthiques qui devraient régir à l’avenir<br />
ce genre de psychothérapie. S’il souligne l’importance<br />
d’avoir en la matière une bonne base en neurosciences,<br />
il y ajoute une métathéorie telle que la gestion synergique<br />
des processus, qui voit dans la thérapie l’opportunité de<br />
créer les conditions de démarches auto-organisées par<br />
et pour chaque client.<br />
11
12<br />
DOSSIER: ??? Pratique et éthique<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011 X-X/200X<br />
Dossier<br />
Pratique et éthique<br />
L’action<br />
humanitaire<br />
et l’éthique<br />
Quels sont les principaux défis<br />
auxquels les ONG doivent faire<br />
face sur le terrain et avec quelle<br />
éthique ?<br />
Président de Médecins du Monde<br />
(MdM) Suisse et spécialiste en psychologie<br />
médicale, Nago Humbert explique<br />
à Psychoscope le rôle et les buts<br />
de l’association. Pour lui, il est important<br />
d’obéir à une éthique afin de respecter<br />
les populations dont MdM s’occupe.<br />
Médecins du Monde est activement engagée sur le terrain<br />
de l’action humanitaire. Quels sont les principaux défis<br />
éthiques auxquels votre organisation est confrontée sur<br />
ce terrain ?<br />
Le premier défi est la provenance des fonds qui nous<br />
permettent de financer nos missions et la manière de<br />
les récolter. MdM est contre le marketing agressif et<br />
plus pour une fidélisation des donateurs qui nous permettent<br />
de garder notre indépendance vis-à-vis des<br />
bailleurs étatiques pour notre action de témoignage.<br />
Le deuxième défi est de ne pas être toxique pour les populations<br />
que nous sommes censés aider (humanitaire<br />
spectacle, ONG qui vont où sont les caméras). Une de
Photo: Jean Emmanuel Julo-Reminiac<br />
nos devises est «aller où les autres ne vont pas» et les<br />
seules questions à se poser sont: est-ce que quelqu’un<br />
nous a demandé de l’aide ? est-ce que quelqu’un va<br />
nous accueillir ? est-ce que quelqu’un va nous accompagner<br />
sur le terrain ?<br />
Parfois, l’action humanitaire peut être vécue par les populations<br />
comme le renouveau du colonialisme du nord<br />
vers le sud.<br />
Médecins du Monde déploie une activité importante<br />
dans plusieurs parties du monde. Elle est aussi engagée<br />
sur le terrain dans les pays riches tels que la Suisse.<br />
Comment se justifie ce type d’assistance dans ces pays ?<br />
Un de nos engagements est de favoriser l’accès aux<br />
soins pour les populations vulnérables où qu’elles<br />
soient. C’est pourquoi nous avons deux missions dites<br />
«nationales», soit en Suisse une à la Chaux-de-Fonds<br />
auprès des sans-papiers, l’autre à Lausanne pour les<br />
travailleurs du sexe. Actuellement, nous sommes en réflexion<br />
pour témoigner des difficultés d’accès aux soins<br />
de la population résidant régulièrement en Suisse et<br />
assurée par l’assurance de base; une étude des HUG<br />
a démontré que, pour les personnes gagnant moins de<br />
CHF 3’000 par mois, 30% avaient renoncé à des soins<br />
de santé pour des questions financières en 2009.<br />
En cas de catastrophe dans une région du monde, on<br />
assiste souvent à une profusion sur le terrain d’ONG dites<br />
«humanitaires» (le cas d’Haïti). Existe-t-il un cadre éthique<br />
homogène qui régule leur action sur le terrain ?<br />
Effectivement, après le Tsunami et la catastrophe des<br />
humanitaires, on aurait pu penser que la leçon avait<br />
porté. Hélas nous avons constaté que le cirque humanitaire<br />
était encore bien présent lors du tremblement<br />
de terre en Haïti. Beaucoup d’ONG inexpérimentées<br />
et peu professionnelles se sont précipitées à Port-au-<br />
Prince. Une des raisons de cette «gabegie» est, évidemment,<br />
l’absence d’autorités étatiques, mais également<br />
l’absence de règles pour les ONG. Nous sommes<br />
en train, avec un groupe de la DDC (Direction du développement<br />
et de la coopération suisse), de réfléchir à<br />
une éventuelle certification des ONG suisses capables<br />
d’intervenir en cas d’urgence humanitaire.<br />
Bien que toujours utile pour les populations<br />
en détresse, l’action des ONG sur le<br />
terrain humanitaire peut contribuer à l’absentéisme<br />
des Etats. C’est un problème de<br />
nature éthique, car la présence des ONG<br />
pourrait ainsi retarder le but qu’elles poursuivent.<br />
Qu’en pensez-vous ?<br />
Haïti en est un exemple flagrant puisque<br />
95% des soins de santé sont prodigués par<br />
des ONG ou des structures privées. C’est<br />
évidemment un scandale. En ce qui nous<br />
concerne, Médecins du Monde ne doit jamais<br />
se substituer à des structures étatiques.<br />
Au contraire, une grande partie de<br />
notre travail (notamment en Palestine et<br />
au Bénin) est de renforcer les structures<br />
publiques d’accès aux soins. Le problème d’Haïti<br />
est complexe dans la mesure où effectivement le peu<br />
d’autorité actuelle pourrait ne pas investir sous prétexte<br />
que les ONG sont là pour faire le travail.<br />
La participation de psychologues sur le terrain humanitaire<br />
est-elle fréquente ? Quel est leur rôle ?<br />
Oui: à Médecins du Monde, nous travaillons notamment<br />
sur la santé mentale en Palestine, où nous venons<br />
de former le personnel médical du premier centre de<br />
pédopsychiatrie à Hébron. Notre coordinateur médical<br />
est une psychologue, et nous avons également dans<br />
certaines missions une psychologue qui, si nous prenons<br />
l’exemple d’Haïti, est référente du programme de<br />
nutrition infantile.<br />
Ces compétences peuvent être utilisées également pour<br />
un débriefing de nos expatriés.<br />
Outre votre engagement dans Médecins du Monde,<br />
vous êtes aussi, entre autres, directeur de l’unité mobile<br />
des soins palliatifs du CHU Sainte-Justine de Montréal.<br />
Dans quels cas de figure est-il pertinent de proposer des<br />
soins palliatifs à un enfant ?<br />
Idéalement, lorsque nous considérons que la médecine<br />
ne peut plus guérir l’enfant et qu’il souffre d’une maladie<br />
potentiellement mortelle. Avec notre expérience,<br />
nous nous sommes aperçus que parfois même à l’an-<br />
13
14<br />
DOSSIER: Pratique et éthique<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011<br />
nonce du diagnostic il était positif de présenter l’équipe<br />
de soins palliatifs (maladie dégénérative par exemple).<br />
Contrairement à la prise en charge adulte, une des spécificités<br />
des soins palliatifs pédiatriques est la durée de<br />
cette prise en charge, qui peut être de plusieurs années<br />
et qui concerne non seulement le petit patient mais<br />
également les parents, les frères et sœurs et les grandsparents.<br />
Comment se pose la question de l’éthique professionnelle<br />
dans le domaine des soins palliatifs en pédiatrie ?<br />
L’éthique fait partie de la prise en charge globale des<br />
soins palliatifs. Nous avons dans notre unité un médecin<br />
éthicien.<br />
Dans le domaine de la néonatologie, il peut arriver qu’on<br />
soit appelé à prendre des décisions difficiles. Le cas de la<br />
réanimation des très grands prématurés en est un exemple,<br />
compte tenu des risques de séquelles cérébrales.<br />
Comment l’éthique médicale vous oriente-t-elle dans ces<br />
cas de figure ?<br />
C’est effectivement une des questions d’actualité pour<br />
notre unité puisque, sur les 160 décès annuels dans<br />
notre hôpital, 50% surviennent dans les 7 premiers<br />
jours de vie. Régulièrement, nous nous posons la question,<br />
avec mes collègues néonatologistes, de la pertinence<br />
de la vie à tout prix sans connaître les graves<br />
séquelles avec lesquelles le patient devrait vivre par la<br />
suite et les conséquences sur sa famille.<br />
Dans la pratique clinique, le médecin et le psychologue<br />
se trouvent souvent dans une relation de pouvoir vis-à-vis<br />
du patient. Cette relation a-t-elle une fonction ? Est-elle<br />
compatible avec l’éthique professionnelle ?<br />
Malheureusement, nous vivons également au Québec<br />
cet antagonisme dont les effets sont multipliés par la<br />
structure très corporatiste des soignants. Ceci ne favorise<br />
pas la communication entre les différents acteurs<br />
de la santé. Vous comprendrez que dans notre unité<br />
il est primordial de collaborer avec le psychologue qui<br />
connaît souvent l’enfant depuis plusieurs années. Par<br />
contre, lors d’une décision thérapeutique, dans la relation<br />
entre un médecin et le psychologue, c’est encore,<br />
hélas, le pouvoir médical qui triomphe.<br />
Chez les patients adultes, il peut arriver que, lorsque la<br />
souffrance est particulièrement importante, la person ne<br />
choisisse l’arrêt complet de tout traitement, voire dans<br />
certains cas réclame le libre choix de mourir. Quelle serait<br />
l’attitude éthiquement correcte face à cette situation ?<br />
Nous avons rarement des demandes d’euthanasie de la<br />
part des enfants. Pour moi cette question est un faux<br />
problème. Nous devons simplement, avec les parents<br />
et avec l’adolescent, décider très en amont du niveau de<br />
traitement acceptable pour sa qualité de vie. Par exemple,<br />
une intubation, un séjour aux soins intensifs. Nous<br />
devons dans tous les cas respecter et entendre les demandes<br />
des parents et des enfants sur les questions<br />
d’acharnement thérapeutique et ne pas prolonger une<br />
existence dont la qualité serait misérable et douloureuse.<br />
Plus généralement, en cas de désaccord concernant un<br />
traitement entre le patient et le médecin ou le psychologue,<br />
quelle est l’attitude éthiquement responsable qui devrait<br />
être prise par le clinicien ?<br />
Au vu de la réponse ci-dessus, l’attitude éthiquement<br />
responsable devrait être qu’en cas de désaccord une<br />
consultation devrait impérativement être adressée à<br />
notre unité d’éthique clinique.<br />
En médecine, tout comme en psychologie, le clinicien<br />
est un fournisseur de prestations. Parfois celles-ci sont<br />
sollicitées par un tiers (assurance, police, justice, etc.).<br />
Quelle est l’attitude à avoir lorsque les exigences du<br />
mandant ne sont pas conformes au code éthique du<br />
fournisseur de prestations ?<br />
Pour moi, il est évident que le code d’éthique du clinicien<br />
prévaut sur toute demande, quelle qu’en soit l’origine.<br />
Parfois, le clinicien peut se faire imposer par la justice la<br />
réalisation d’un acte thérapeutique non désiré par la personne<br />
concernée (par exemple, le cas de M. Rappaz, en<br />
Suisse). D’un point de vue éthique, quelle devrait être<br />
l’attitude adéquate du clinicien ?<br />
Il s’agit avant tout du respect de la demande du patient,<br />
étant entendu que le patient est en état de la formuler.<br />
Personne ne peut obliger un clinicien à effectuer un<br />
geste thérapeutique avec lequel il n’est pas à l’aise. Il<br />
n’est pas rare que des parents déchirés par la dou leur<br />
nous demandent de procéder, sur un enfant, à une<br />
tentative de réanimation qui, dans les conditions médicales,<br />
serait non éthique puisque totalement inefficace.<br />
Dans ce cas, personne ne peut obliger un soignant à<br />
procéder à cet acte.<br />
La <strong>FSP</strong> (Fédération Suisse des Psychologues) a mis récemment<br />
en consultation son code éthique. A votre<br />
connaissance, existe-t-il un domaine où la psychologie<br />
devrait être particulièrement attentive ?<br />
Ma grande peur, mais ceci comprend tous les soignants,<br />
est le jugement et la stigmatisation, souvent à vie, d’une<br />
personne par un diagnostic hâtif. Par exem ple, quand<br />
la médecine ne comprend pas l’origine du mal du patient,<br />
elle le juge.<br />
Interview:<br />
Carla Lanini et Rafael Millan
Médecins du Monde<br />
Fondée en 1993, Médecins du Monde-Suisse s’investit<br />
principalement dans des missions de développement<br />
qu’elle gère seule ou en collaboration avec d’autres délégations<br />
MdM. L’organisation participe également de façon<br />
ponctuelle aux différentes actions d’urgence mises<br />
sur pied par le réseau MdM, par l’envoi de personnel<br />
médical qualifié et la recherche de fonds nécessaires au<br />
financement d’actions comme celle en cours en Côte<br />
d’Ivoire.<br />
MdM-Suisse est membre de MdM-International, mais<br />
définit en toute indépendance sa politique, ses missions<br />
sur le terrain, et gère ses finances seule. Depuis 1993,<br />
MdM-Suisse a pu développer des projets dans les pays<br />
suivants: Bénin, Chiapas (Mexique), Égypte, Guatemala,<br />
Haïti, Iran, Mali, Mauritanie, Népal, Palestine,<br />
Roumanie, Sahara Occidental et Tchoukotka (Sibérie<br />
orientale).<br />
MdM-Suisse est présente aussi en Suisse, à la Clinique<br />
pour les sans-papiers de La Chaux-de-Fonds et à Lausanne<br />
auprès des travailleurs du sexe.<br />
Pour plus de détails: www.medecinsdumonde.ch<br />
L’auteur<br />
Nago Humbert est Président de Médecins du Monde<br />
Suisse.<br />
Il est également spécialiste en psychologie médicale et<br />
Directeur de l’Unité de Consultation en Soins Palliatifs<br />
Pédiatriques au CHU Mère-Enfant Sainte-Justine de Montréal.<br />
Il est aussi Professeur au département de pédiatrie,<br />
à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.<br />
Adresse<br />
Pr Nago Humbert, Directeur, Unité de Consultation en<br />
Soins Palliatifs Pédiatriques.<br />
Professeur adjoint dpt de pédiatrie, CHU Sainte-Justine,<br />
3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, Qc,<br />
Canada, H3T 1C5.<br />
E-mail: nago.humbert@umontreal.ca.<br />
Zusammenfassung<br />
Nago Humbert, Präsident der Organisation Ärzte der Welt<br />
Schweiz (MdM) und Spezialist für medizinische Psychologie<br />
erläutert, wie das berufsethische Verhalten von MdM<br />
Schweiz in den Einsatzgebieten den Respekt der Bevölkerung<br />
gewährleistet. Er vertritt zudem die Überzeugung,<br />
dass eine Zertifizierung der NGOs eine hilfreiche Garantie<br />
für Professionalität und Erfahrung sein könnte.<br />
Da Nago Humbert zudem Leiter der mobilen Palliativpflege<br />
an der Universitätsklinik in Montreal ist, geht er in<br />
diesem Psychoscope-Interview schliesslich auch auf die<br />
wichtige Rolle der Berufsethik in diesem Berufsfeld ein.<br />
15
16<br />
DOSSIER: Pratique et éthique<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011<br />
Migrants et réfugiés<br />
en consultation<br />
Quelles pratiques et quelle éthique ?<br />
Dans leur article, Betty Goguikian Ratcliff,<br />
docteur en psychologie, et Delphine<br />
Bercher, psychologue-psychothérapeute,<br />
montrent l’importance de la composante<br />
culturelle et contextuelle lorsque l’on travaille<br />
avec des migrants. Elles expliquent<br />
également pourquoi une intervention<br />
éthique doit tenir compte de plusieurs<br />
autres considérations.<br />
Dans nos sociétés contemporaines, toute personne travaillant<br />
dans le domaine du soin est amenée à rencontrer<br />
des individus issus d’une culture différente. Ces<br />
migrants peuvent porter un regard particulier quant<br />
aux représentations qui touchent la maladie, la souffrance,<br />
l’origine d’un désordre, et aux traitements adéquats<br />
pour y remédier. Cette confrontation culturelle<br />
débouche parfois sur des incompréhensions, des malentendus,<br />
des frustrations, des échecs ou des ruptures<br />
dans les interventions. Ignorer la composante culturelle<br />
et contextuelle des troubles peut conduire à des impasses<br />
thérapeutiques et avoir un coût social important.<br />
Ce constat nous amène à nous poser la question suivante:<br />
à quels écueils nous confronte la prise en charge<br />
d’une population migrante, issue de mondes culturels<br />
différents et parfois victime de persécutions politiques<br />
ou de discriminations sociales pré et postmigratoires ?<br />
Risque de «misdiagnosis»<br />
Plusieurs études soulignent que la prévalence des<br />
troubles mentaux chez les migrants à leur arrivée est<br />
égale voire inférieure à celle des autochtones (Kirmayer<br />
et al., 2011). Cependant, une revue de la littérature effectuée<br />
par Kirkbride et Jones (2011) montre comment<br />
des études épidémiologiques successives, dès 1932 et<br />
jusqu’à nos jours, rapportent des taux significativement<br />
plus élevés de symptômes psychotiques, notamment<br />
schizophréniques, au sein de certaines populations mi<br />
grantes établies dans des pays occidentaux comme le<br />
RoyaumeUni, les USA ou les pays scandinaves. Plusieurs<br />
hypothèses ont été proposées au fil des années<br />
pour expliquer ce constat, les unes liées à des caractéristiques<br />
relevant d’une présumée différence génétique,<br />
d’autres invoquant la différence culturelle dans l’expression<br />
de la détresse psychique, d’autres encore mettant<br />
l’accent sur l’impact psychologique de la migration,<br />
ou encore sur les difficultés de la vie en contexte postmigratoire.<br />
Une hypothèse plus récente suggère que le<br />
surdiagnostic de psychose pourrait être expliqué par<br />
les préjugés négatifs des cliniciens et leur manque de<br />
connaissance de l’expression culturelle des symptômes<br />
(Nazroo & Iley, 2011; Jacobs, 2006).<br />
Du point de vue de l’anthropologie médicale, Kleinman<br />
(1988) a été parmi les premiers à souligner que les catégories<br />
diagnostiques que nous utilisons habituellement,<br />
et que nous considérons comme universelles, sont intimement<br />
liées à la culture occidentale. Si elles sont utilisées<br />
de manière rigide pour évaluer les désordres de<br />
personnes issues d’autres aires culturelles, apparaît le<br />
risque majeur d’aboutir à des erreurs de jugement clinique<br />
et à des erreurs diagnostiques.<br />
Un cas de figure notable, le diagnostic d’état de stress<br />
posttraumatique. Si l’on se réfère à la définition de<br />
l’état de stress posttraumatique figurant dans la CIM<br />
10 ou le DSMIV, les symptômes qui le caractérisent<br />
sont les suivants: remémoration constante de l’événement<br />
stressant sous forme de reviviscences envahissantes<br />
(flashbacks), sentiment de détresse et évitement<br />
lorsque le sujet est exposé à des situations rappelant le<br />
stresseur ou associées à ce dernier, hypervigilance/activation<br />
neurovégétative, rêves répétitifs.<br />
Or, force est de constater que nous rencontrons au sein<br />
de la clinique transculturelle un certain nombre de réfugiés<br />
qui, ayant été exposés à des événements traumatiques<br />
et souffrant de troubles psychiques, ne présentent<br />
pas toujours le tableau décrit cidessus. En réalité,<br />
chez ces patients, les somatisations diffuses et rebelles<br />
sont fréquemment au premier plan et constituent l’es
Photo: Elena Martinez<br />
sentiel de leurs plaintes, de même que les revendications<br />
d’ordre social. Les conduites d’évitement sont<br />
également massives. A cet égard, Tull et al. (2004) ont<br />
montré que chez les personnes ayant vécu des traumatismes<br />
multiples à répétition, il existe un lien entre les<br />
conduites d’évitement liées au PTSD et les troubles somatoformes.<br />
L’explication proposée est que la douleur<br />
physique serait un mécanisme – non conscient – permettant<br />
de justifier l’évitement.<br />
Par ailleurs, les cauchemars traumatiques sont peu rapportés.<br />
En revanche, nous observons parfois des tableaux<br />
cliniques constitués d’états de transe, de possession,<br />
de dissociation, ou encore par des hallucinations<br />
auditives ou olfactives et des idées de persécution. Si<br />
ces états figurent dans les manuels, soit en tant que<br />
manifestation faisant partie des troubles liés à une<br />
culture donnée (culture bound syndroms), soit en tant<br />
qu’expression d’un trouble d’allure psychotique, ils ne<br />
relèvent pas, selon ces manuels, d’une réaction liée à<br />
un facteur de stress.<br />
Or, des illustrations cliniques décrivant des tableaux de<br />
possession chez des migrants, suite à des événements<br />
traumatiques, ont été rapportées à plusieurs reprises<br />
dans la littérature (James, 2009; Baubet, Taïeb et al.,<br />
2005). A la lumière de ces cas, il serait erroné de rattacher<br />
des phénomènes de possession et de transe à un<br />
trouble psychotique, comme nous le ferions au sein de<br />
notre clinique habituelle.<br />
En effet, si l’on étudie ces symptômes à la lumière des<br />
notions d’effraction psychique et d’effroi [sentiment<br />
ressenti face à un événement d’ordre interpersonnel<br />
inattendu, effrayant et potentiellement sidérant (situation<br />
typique pouvant entraîner un état de stress posttraumatique)],<br />
cela amène un éclairage utile pour la<br />
compréhension du phénomène.<br />
Dans certaines aires culturelles, on perçoit le monde<br />
comme étant peuplé à la fois d’humains et de nonhumains,<br />
d’êtres visibles et invisibles. Le mal, la maladie<br />
et le malheur sont ainsi pensés dans cette logique de<br />
l’effraction, où un humain, à la faveur de circonstances<br />
particulières, peut se retrouver investi, habité par un<br />
«autre» malveillant qui a pu pénétrer en lui dans un<br />
moment de vulnérabilité et se manifester lors d’un état<br />
de transe.<br />
L’exemple décrit cidessus autour de l’état de stress<br />
posttraumatique nous montre à quel point l’utilisation<br />
de ce concept limitée à la description du CIM10 (ou du<br />
DSMIV) est insuffisante, ethnocentrée et donc réductrice<br />
pour décrire les conséquences psychiques du traumatisme<br />
en situation interculturelle.<br />
17
18<br />
DOSSIER: Pratique et éthique<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011<br />
Une clinique psychosociale<br />
L’enjeu ne se réduit pas à une alternative entre une clinique<br />
«centrée sur la culture» et une clinique plus<br />
«universaliste», mais dépasse cette seule différence<br />
pour venir interroger le contexte dans son ensemble.<br />
DurieuxPaillard et Eytan (2007) relèvent l’importance<br />
d’une telle approche pour éviter des écueils tels qu’un<br />
supposé «syndrome méditerranéen» ou un diagnostic<br />
de simulation susceptibles de stigmatiser un individu et<br />
de barrer la route à des stratégies thérapeutiques adaptées.<br />
Dans cette perspective, LewisFernandez et Diaz<br />
(2002) ont développé un guide de «formulation culturelle»<br />
qui permet de situer un individu, audelà des<br />
symptômes et des troubles apparents, dans un contexte<br />
plus global, social, économique et culturel.<br />
Ce guide de formulation culturelle, dont un résumé figure<br />
en appendice du DSMIV, propose d’évaluer cinq<br />
dimensions (pour une description détaillée, Baubet<br />
2005; Dominicé Dao, 2009):<br />
• L’identité culturelle de l’individu: groupe(s)<br />
culturel(s) auxquel(s) le patient appartient, nationalité,<br />
ethnie, religion, langue, statut au sein de sa<br />
communauté, stratégie d’acculturation, etc.<br />
• Le modèle étiologique des troubles: explications et<br />
sens culturels du trouble qui incluent la cause<br />
supposée, l’évolution, le traitement habituellement<br />
proposé et les itinéraires thérapeutiques déjà parcourus.<br />
• Les facteurs culturels liés à l’environnement psychosocial<br />
et au niveau du fonctionnement individuel:<br />
évaluation des facteurs de stress vécus par l’individu<br />
et sa famille, ainsi que des ressources à disposition.<br />
• Les éléments culturels de la relation entre le clinicien<br />
et le patient: identité culturelle du clinicien et son<br />
incidence sur la relation thérapeutique; connaissances<br />
spécifiques de la culture du patient et existence<br />
de possibles stéréotypes culturels. Possibilités<br />
de conflits de valeurs entre le clinicien et le patient.<br />
• Synthèse de l’évaluation culturelle: rôle des facteurs<br />
socioculturels et de l’histoire migratoire dans la<br />
problématique et proposition de solutions alternatives<br />
pour la prise en charge.<br />
Ce guide de formulation culturelle présente l’avantage<br />
de proposer une méthode systématique d’évaluation<br />
d’un individu, prenant en considération l’ensemble des<br />
facteurs importants dans le cadre de la migration, sans<br />
en privilégier l’un par rapport à l’autre. Il permet de ne<br />
pas se focaliser sur la seule identification des symptômes<br />
d’un trouble, mais, au contraire, s’intéresse à la<br />
personne dans toutes ses dimensions – son histoire, sa<br />
culture, la situation politique de son pays, son projet<br />
migratoire, son rôle au sein de sa communauté. Il in<br />
vestigue également sa situation actuelle, l’impact des<br />
inégalités sociales et des conditions de vie sur la santé.<br />
L’autre versant de ce que nous considérons comme<br />
étant une exigence d’ordre éthique face à des personnes<br />
venant de pays où sont survenus des bouleversements<br />
importants, de nature politique, économique, religieuse<br />
ou sociale, est de tenir compte – systématiquement –<br />
dans notre évaluation de la dimension «psychopolitique»<br />
(Sironi, 2007) du tableau clinique présenté et<br />
des enjeux parfois vitaux qui y sont liés.<br />
Parmi ces enjeux, celui de la demande d’un certificat<br />
médical est capital, car il peut faciliter l’obtention du<br />
statut de réfugié politique, ce qui représente pour le patient<br />
la reconnaissance des souffrances endurées, la fin<br />
de l’errance et le droit de poursuivre sa vie dans le pays<br />
d’accueil.<br />
Certificats médicaux pour requérants<br />
La politique migratoire des pays européens en matière<br />
d’asile se caractérise actuellement par l’adoption de mesures<br />
restrictives et le développement d’un discours criminalisant<br />
les demandeurs d’asile (D’Halluin, 2006).<br />
Ils sont considérés avec suspicion par les instances<br />
en charge d’accorder le statut de réfugié, et doivent<br />
convaincre les autorités de la véracité de leurs allégations<br />
et du caractère politique des événements les ayant<br />
conduit à s’exiler.<br />
Les représentants de l’Etat, chargés de statuer sur<br />
les demandes d’asile, sont placés en position de faire<br />
le tri entre les «vrais» et les «faux» réfugiés. Dans ce<br />
contexte, les psychologues et les psychiatres travaillant<br />
avec ces populations peuvent être sollicités par les requérants<br />
ou leurs conseillers juridiques dans le cadre<br />
de la procédure d’asile afin de rédiger un certificat médical<br />
dont la fonction est de renforcer la crédibilité de<br />
leur récit. Ce certificat sera une pièce importante du<br />
dossier: la certification des séquelles psychiques vient<br />
asseoir la réalité des persécutions invoquées et devient<br />
un élément de preuve des événements traumatiques<br />
mis en avant. Il sert à étayer les décisions prises par les<br />
juges, telles que l’octroi d’autorisations de séjour provisoires<br />
pour soins ou, au contraire, le renvoi.<br />
L’implication du psychologue à la fois dans la sphère<br />
thérapeutique et juridicoadministrative ne va pas sans<br />
poser des questions et des dilemmes éthiques. En effet,<br />
le clinicien est placé simultanément en position de soignant<br />
et d’expert, devant 1) faciliter la parole des exilés<br />
dans un cadre sécurisant, c’estàdire recueillir leur<br />
témoignage et les aider à élaborer un récit autobiographique<br />
cohérent, 2) soulager les séquelles psychiques
ésultant d’événements potentiellement traumatiques,<br />
3) se prononcer sur la compatibilité entre les violences<br />
alléguées et les tableaux cliniques présentés, 4) se prononcer,<br />
d’un point de vue médical, sur la dangerosité<br />
ou non du renvoi dans le pays d’origine.<br />
En se pliant à cette demande, le clinicien entre de facto<br />
dans le jeu d’inclure ou d’exclure des étrangers sur le<br />
sol national, ce qui va bien audelà de sa fonction sociale.<br />
Mais s’y refuser revient à mettre en doute la parole<br />
d’un patient et à refuser de l’appuyer dans sa procédure<br />
d’asile. Sans être dupes des ambiguïtés éthiques<br />
de la situation, nous devons être conscients que, dans<br />
certains cas, notre intervention peut servir à éviter des<br />
expulsions arbitraires.<br />
Cependant, le psychologue atil sa place dans le délicat<br />
problème de l’admission des réfugiés ? La rédaction<br />
des certificats médicaux dans le cadre des procédures<br />
d’asile a donné lieu à un vif débat parmi les cliniciens<br />
travaillant auprès d’exilés (Asensi & Le Du, 2003; Henriques,<br />
2005; Goguikian Ratcliff & Strasser, 2010). Ils<br />
dénoncent l’incompatibilité entre la position de thérapeute<br />
et la logique d’expertise, par définition inquisitrice<br />
et fondée sur la mise en cause des déclarations de<br />
la personne. Une des propositions est de confier l’expertise<br />
à une autre personne que le thérapeute. Toutefois,<br />
cela ne résout pas les effets pervers produits par<br />
l’octroi du statut de réfugié pour raisons humanitaires<br />
de santé, qui fait de la maladie un critère de régularisation<br />
(Fassin, 2001).<br />
Pour conclure, nous dirons qu’une intervention éthique<br />
devrait tenir compte à la fois des aspects culturels, juridiques,<br />
administratifs, sociaux, économiques, et de leur<br />
impact sur le développement et le maintien des manifestations<br />
symptomatiques. Elle doit également s’inscrire<br />
toujours dans un processus d’identification des<br />
ressources favorisant des attitudes résilientes, ces ressources<br />
pouvant revêtir des formes très variées selon les<br />
cultures et selon le contexte dans lequel évolue le patient.<br />
Betty Goguikian Ratcliff<br />
Delphine Bercher<br />
Bibliographie<br />
Une bibliographie plus complète peut être obtenue auprès<br />
des auteures.<br />
Goguikian Ratcliff, B. & Strasser, O. (dir.) (2010). Clinique<br />
de l’exil: chroniques d’une pratique engagée.<br />
Genève: Georg Editeur.<br />
Kleinman, A. (1988). Rethinking Psychiatry. From Cultural<br />
Psychiatry to Personal Experience.<br />
New York: The Free Press.<br />
Lewis-Fernandez, R. & Diaz, N. (2002). The Cultural Formulation:<br />
A Method for Assessing Cultural Factors Affecting<br />
the Clinical Encounter. Psychiatric Quarterly 73 (4),<br />
271-295.<br />
Les auteures<br />
Betty Goguikian Ratcliff est docteur en psychologie, enseignante<br />
et chercheuse à la Faculté de Psychologie et<br />
des Sciences de l’Education de l’Université de Genève.<br />
Elle dirige l’Unité de psychologie clinique interculturelle et<br />
exerce comme psychothérapeute à Appartenances-Genève,<br />
centre de soins psychologiques pour migrants.<br />
Delphine Bercher est psychologue et psychothérapeute,<br />
formée à l’ethnopsychiatrie à Paris au Centre Georges-<br />
Devereux (Université Paris VII); elle exerce depuis 1996 à<br />
Appartenances Lausanne et Genève.<br />
Adresses<br />
Betty Goguikian Ratcliff, Université de Genève (FPSE),<br />
40, Bd du Pont-d’Arve, 1205 Genève<br />
Email: Betty.Goguikian@unige<br />
Delphine Bercher, Appartenances-Genève,<br />
72, Bd St-Georges, 1205 Genève.<br />
Email: delphine.bercher@appartenances-ge.ch<br />
Zusammenfassung<br />
Die promovierte Psychologin Betty Goguikian Ratcliff und<br />
die Psychotherapeutin Delphine Bercher weisen in ihrem<br />
Beitrag auf die Bedeutung kultureller und kontextueller<br />
Komponenten bei der Arbeit mit MigrantInnen hin. Werden<br />
diese ausgeklammert, kann dies in therapeutischer<br />
Hinsicht in eine Sackgasse führen und hohe soziale Folgekosten<br />
mit sich bringen.<br />
Ethisch korrekte Interventionen müssen deshalb gemäss<br />
den beiden Expertinnen insbesondere kulturelle, juristische<br />
und soziale Aspekte berücksichtigen – aber auch in<br />
einen Prozess integriert sein, in dem die gesundheitsfördernden<br />
Ressourcen der Klientinnen und Klienten identifiziert<br />
werden.<br />
19
20<br />
ACTU Vorstand <strong>FSP</strong> – AKTUELL: Comité – Comitato ???<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011 X-X/200X<br />
Zukunftsgerichtet stark<br />
Die Diskussionen an der Delegiertenversammlung<br />
vom 25. Juni waren<br />
herausfordernd, sowohl für den<br />
Vorstand als auch für die Delegierten<br />
der Gliedverbände. Auf dem Tisch<br />
lag eine reich befrachtete Traktandenliste<br />
mit wichtigen strategischen<br />
Themen.<br />
Die beeindruckende Qualität des<br />
Austausches hat uns einmal mehr gezeigt,<br />
wie ernst die Delegierten ihren<br />
Einsatz für den Berufsverband nehmen.<br />
Wir dürfen ihnen wohl im Namen<br />
aller <strong>FSP</strong>-Mitglieder herzlichst<br />
danken für die Zeit und Energie, die<br />
sie für unseren Berufsstand investieren!<br />
<strong>FSP</strong> nimmt FH-AbsolventInnen<br />
auf<br />
Ein zukunftsweisendes Thema war<br />
die Aufnahme von FachhochschulpsychologInnen<br />
in die <strong>FSP</strong>. Die von<br />
zwei Gliedverbänden eingereichte<br />
Motion forderte neu die Aufnahme<br />
von Personen mit einem «Master<br />
in Psychologie einer Schweizer<br />
Hochschule (Universität oder Fachhochschule)»<br />
anstatt wie bis anhin<br />
ausschliesslich «einer Schweizer Universität».<br />
Die vom Vorstand unterstützte Motion<br />
wurde ausgiebig und eindrücklich<br />
diskutiert. Es gab Stimmen, die<br />
ohne Wenn und Aber hinter der Motion<br />
standen. Andere waren sich der<br />
Auswirkungen unsicher und wollten<br />
den Antrag um ein Jahr vertagen.<br />
Viele Fragen betrafen auch Inhalte<br />
und Standards der FH-Ausbildung;<br />
Fragen, die zur allgemeinen Zufrie-<br />
denheit beantwortet werden konnten.<br />
Mit 141 von 144 anwesenden Stimmen<br />
haben die Delegierten schliesslich<br />
zugestimmt.<br />
Das PsyG zeigt Wirkung<br />
Für den <strong>FSP</strong>-Vorstand ist klar: Die<br />
Erweiterung der Aufnahmekriterien<br />
ist eine logische Konsequenz des Psychologieberufegesetzes<br />
und stärkt<br />
den Berufsdachverband.<br />
Ein starker Dachverband kann die<br />
Interessen seiner Mitglieder besser<br />
vertreten! Indem die <strong>FSP</strong> künftig<br />
auch FH-AbsolventInnen aufnimmt,<br />
wird die Psychologielandschaft der<br />
Schweiz homogener. Ein wichtiges<br />
Argument für unsere nächsten politischen<br />
Schritte!<br />
Mit der Aufnahme der FH-AbsolventInnen<br />
eröffnen wir ein neues Kapitel<br />
in der Geschichte der <strong>FSP</strong>: Unsere<br />
Föderation bietet nun allen Psychologinnen<br />
und Psychologen der Schweiz<br />
eine berufspolitische Heimat und<br />
wird zum Verband der gesetzlich anerkannten<br />
PsychologInnen!<br />
Die Änderungen im Aufnahmereglement<br />
treten per 1. Januar 2012 in<br />
Kraft. Die Gliedverbände müssen<br />
ihre Statuten anpassen.<br />
Weitere Informationen zur Umsetzung<br />
werden ab kommendem Oktober<br />
auf www.psychologie.ch, im Psychoscope<br />
und im Newsletter publiziert.<br />
Lasst uns den nächsten Schritt gehen,<br />
gemeinsam.<br />
Ihr <strong>FSP</strong>-Vorstand<br />
Sybille Eberhard Alfred Künzler<br />
Cap sur l’avenir<br />
Les discussions de l’AD du 25 juin<br />
ont fait souffler un vent de renouveau<br />
aussi bien sur le Comité que sur<br />
les Délégué(e)s des associations affiliées.<br />
A l’ordre du jour, une liste très<br />
chargée de points sur des sujets d’importance<br />
stratégique. La qualité remarquable<br />
des débats nous a montré<br />
une fois de plus avec quel sérieux les<br />
Délégué(e)s s’engagent pour l’association.<br />
Nous ne pouvons que les remercier<br />
très chaleureusement, au nom de<br />
tous les membres de la <strong>FSP</strong>, pour le<br />
temps et l’énergie qu’ils consacrent à<br />
la défense des intérêts de notre profession<br />
!<br />
Les diplômés HES admis à la<br />
<strong>FSP</strong><br />
Parmi les sujets en prise sur le futur<br />
figurait l’admission au sein de la <strong>FSP</strong><br />
des psychologues diplômé(e)s des<br />
Hautes écoles spécialisées. Une motion<br />
présentée par deux associations<br />
affiliées proposait l’admission des personnes<br />
au bénéfice d’un «Master en<br />
psychologie d’une Haute école suisse<br />
(Université ou HES)» pour remplacer<br />
la formule habituelle d’«une Université<br />
suisse».<br />
Soutenue par le Comité, la motion a<br />
été abondamment et chaudement discutée.<br />
Les uns, faisant fi des «si» et<br />
des «mais», appuyaient sans réserve la<br />
motion; d’autres s’interrogeaient sur<br />
les conséquences et voulaient reporter<br />
d’une année la demande. Nombre<br />
de questions ont aussi concerné les<br />
contenus et les standards de la formation<br />
délivrée par les HES, toutes<br />
questions qui ont reçu des réponses
Roberto Sansossio Peter Sonderegger Karin Stuhlmann Anne-Christine Volkart<br />
débouchant sur une large adhésion.<br />
Les Délégué(e)s ont finalement accepté<br />
la motion par 141 voix sur 144.<br />
La LPsy fait sentir ses effets<br />
Pour le Comité, les choses sont<br />
claires: l’élargissement des critères<br />
d’admission est une conséquence logique<br />
de la Loi sur les professions de<br />
la psychologie et renforce sa position<br />
d’association faîtière de la profession.<br />
Une faîtière plus forte est mieux à<br />
même de défendre les intérêts de ses<br />
membres ! Avec la prochaine admission<br />
des diplômé(e)s HES au sein de<br />
la <strong>FSP</strong>, le paysage de la psychologie en<br />
Suisse devient plus homogène: un argument<br />
de poids pour nos prochaines<br />
avancées sur le plan politique !<br />
L’admission des diplômé(e)s des HES<br />
ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire<br />
de la <strong>FSP</strong>: en devenant l’association<br />
regroupant les psychologues<br />
reconnus par la loi, notre fédération<br />
offre désormais à tous les psychologues<br />
de Suisse un toit et une «patrie»<br />
pour défendre les intérêts de leur profession<br />
!<br />
Les modifications du règlement d’admission<br />
entreront en vigueur le 1 er<br />
janvier 2012. Les associations affiliées<br />
devront adapter leurs statuts. Des informations<br />
sur la mise en place de la<br />
nouvelle organisation seront publiées<br />
dès octobre sur www.psychologie.ch,<br />
dans Psychoscope et dans la Newsletter.<br />
Le moment est venu de passer, tous<br />
ensemble, à l’étape suivante.<br />
Le Comité de la <strong>FSP</strong><br />
Forte impegno per il futuro<br />
I lavori in occasione dell’Assemblea<br />
dei delegati del 25 giugno sono stati<br />
molto impegnativi sia per il Comitato,<br />
che per i delegati delle associazioni<br />
affiliate. All’esame c’era una lunga<br />
lista di temi importanti dal punto di<br />
vista strategico.<br />
L’alta qualità della discussione e dello<br />
scambio di opinioni ci ha mostrato<br />
ancora una volta che i delegati prendono<br />
molto sul serio il loro impegno<br />
a favore della federazione. A nome di<br />
tutti i soci della <strong>FSP</strong> li ringraziamo vivamente<br />
per il tempo e l’energia investiti.<br />
La <strong>FSP</strong> ammette i titolari di un<br />
master SUP<br />
Un tema di grande rilevanza per il futuro<br />
è l’ammissione nella <strong>FSP</strong> degli<br />
psicologi titolari di un master di una<br />
scuola universitaria professionale.<br />
La mozione presentata da due associazioni<br />
affiliate chiedeva infatti l’ammissione<br />
dei titolari di un master in<br />
psicologia ottenuto presso una scuola<br />
universitaria (università o scuola universitaria<br />
professionale), anziché<br />
come finora solo presso un’università<br />
svizzera.<br />
La mozione, sostenuta dal Comitato,<br />
è stata discussa in modo accurato e<br />
approfondito. C’era chi approvava la<br />
mozione senza riserve, chi invece nutriva<br />
dubbi sulle conseguenze e chiedeva<br />
di rinviare la discussione di un<br />
anno. Molte delle domande sollevate<br />
riguardavano i contenuti e gli standard<br />
della formazione impartita nelle<br />
scuole universitarie professionali. Le<br />
risposte sono state precise e esaurien-<br />
ti, tanto che i delegati hanno accettato<br />
la mozione con 141 voti su 144.<br />
Primi effetti della LPPsi<br />
Per il Comitato è chiaro che l’estensione<br />
dei criteri di ammissione è la logica<br />
conseguenza del varo della legge<br />
sulle professioni psicologiche (LPPsi)<br />
e rafforza la posizione della <strong>FSP</strong>. È<br />
convinto che un’associazione di categoria<br />
forte può rappresentare meglio<br />
gli interessi dei propri soci. Dato che<br />
ora la <strong>FSP</strong> ammette anche i titolari di<br />
un master rilasciato dalle scuole universitarie<br />
professionali, il settore della<br />
psicologia della Svizzera diventa più<br />
omogeneo. Questo è un importante<br />
argomento che si potrà far valere a livello<br />
politico.<br />
Con l’ammissione dei titolari di un<br />
master SUP si apre un nuovo capitolo<br />
nella storia della <strong>FSP</strong>: ora la nostra<br />
federazione offre a tutti gli psicologi<br />
svizzeri una base politica che tutela<br />
i loro interessi. Inoltre, la <strong>FSP</strong> diventa<br />
l’associazione nazionale di tutti gli<br />
psicologi riconosciuti dal diritto svizzero.<br />
Le modifiche del regolamento di ammissione<br />
entreranno in vigore il 1°<br />
gennaio 2012. Entro tale data le associazioni<br />
affiliate dovranno adeguare<br />
il loro statuto. Da ottobre pubblicheremo<br />
informazioni in merito all’attuazione<br />
sul sito www.psychologie.ch, su<br />
Psychoscope e nella newsletter.<br />
Ora siamo pronti per affrontare nuove<br />
sfide. Insieme.<br />
Il Comitato <strong>FSP</strong><br />
21<br />
ACTU Vorstand <strong>FSP</strong> – AKTUELL: Comité – Comitato ???<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011 X-X/200X
22<br />
ACTU PsyG praktisch <strong>FSP</strong> AKTUELL: ???<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011 X-X/200X<br />
Informationstag für Weiterbildungsanbieter<br />
Die <strong>FSP</strong> hat am 20. Mai 2011 in Bern eine Informationsveranstaltung<br />
für ihre Weiterbildungsanbieter durchgeführt.<br />
Hauptthemen waren die Akkreditierung gemäss<br />
PsyG und die geplante <strong>FSP</strong>-Weiterbildungsreform.<br />
Die Verabschiedung des Psychologie-<br />
berufegesetzes (PsyG) und diverse<br />
neuere Entwicklungen im Weiterbildungsbereich<br />
tragen zahlreiche Herausforderungen<br />
an die <strong>FSP</strong> und ihre<br />
Weiterbildungsinstitutionen heran.<br />
Dazu gehören die Akkreditierung bestimmter<br />
Weiterbildungsgänge, ein<br />
festgestellter Nachholbedarf im Bereich<br />
der Qualitätssicherung, ein<br />
vermehrter Einbezug der aktuellen<br />
Kompetenzendiskussion sowie eine<br />
Vereinfachung der zu komplizierten<br />
Anerkennungs- und Titelverleihungsverfahren<br />
innerhalb des Verbandes.<br />
Die <strong>FSP</strong> stellt sich diesen neuen Anforderungen<br />
mit einer umfassenden<br />
Weiterbildungsreform und will die<br />
Weiterbildungsanbieter bei den notwendigen<br />
Veränderungen aktiv und<br />
fachgerecht unterstützen. Die Reform<br />
fügt sich in den Rahmen eines<br />
grösseren strategischen Paradigmenwechsels<br />
von einer traditionellen<br />
Mitgliederorganisation zu einem<br />
professionellen Dienstleistungsunternehmen.<br />
Die Neuausrichtung des<br />
Rudolf Nägeli, Bereichsleiter<br />
Weiter- und Fortbildung <strong>FSP</strong><br />
Weiterbildungssystems erfordert zudem<br />
eine verstärkte Zusammenarbeit<br />
zwischen den <strong>FSP</strong>-Organen und den<br />
Weiterbildungsanbietern.<br />
Inhaltliches Ziel des Informationstages<br />
war es, den Weiterbildungsinstitutionen<br />
einen ersten Überblick über<br />
die geplante Bundesakkreditierung<br />
gemäss PsyG und die Stossrichtungen<br />
der vorgesehenen <strong>FSP</strong>-Weiterbildungsreform<br />
zu vermitteln. Daneben<br />
ging es insbesondere auch darum, die<br />
Kontaktpflege zu intensivieren, Informationen<br />
zu bedeutsamen Veränderungen<br />
im Weiterbildungsbereich<br />
auszutauschen und allfällige Fragen<br />
im Zusammenhang mit den Verfahren<br />
gemäss PsyG zu klären.<br />
Akkreditierung gemäss PsyG<br />
Marianne Gertsch und Marlene<br />
Stritt (beide Bundesamt für Gesundheit,<br />
BAG) erläuterten die wichtigsten<br />
Elemente der im PsyG vorgesehenen<br />
Bundesakkreditierung und<br />
orientierten über die Abläufe der beiden<br />
in Vorbereitung befindlichen Akkreditierungsverfahren<br />
(provisorische<br />
und ordentliche Akkreditierung).<br />
Mehr Informationen zu diesen Verfahren<br />
finden sich im nachfolgenden<br />
Interview. Das BAG erachtet die sogenannten<br />
verantwortlichen Organisationen,<br />
zu denen massgeblich auch<br />
die <strong>FSP</strong> gehören wird, als ihre primären<br />
Ansprechpartner für alle Fragen<br />
im Zusammenhang mit den Akkreditierungsverfahren.<br />
<strong>FSP</strong>-Weiterbildungsreform<br />
Dr. Rudolf Nägeli, Bereichsleiter Weiter-<br />
und Fortbildung <strong>FSP</strong> und Projektleiter<br />
der <strong>FSP</strong>-Weiterbildungsreform,<br />
gab in seinem Referat einen<br />
Überblick über die derzeitige Reform-<br />
diskussion innerhalb der <strong>FSP</strong>. Eine<br />
umfassende Struktur- und Kontext-<br />
analyse hatte einige Mängel und<br />
Schwachstellen des bisherigen Systems<br />
aufgezeigt. Gestützt auf diese<br />
Analyse hat die Geschäftsstelle mit<br />
dem Vorstand bereits erste Grundsätze<br />
und Stossrichtungen für die geplante<br />
Weiterbildungsreform erarbeitet,<br />
wozu die Gesamterneuerung der<br />
Weiterbildungsrichtlinien, eine Anpassung<br />
der bestehenden Weiterbildungsgefässe<br />
an das Bologna-System<br />
der Hochschulen sowie eine kontinuierliche<br />
strategische Steuerung und<br />
Entwicklung des gesamten Weiterbildungssystems<br />
durch die verantwortlichen<br />
<strong>FSP</strong>-Organe gehören.<br />
Qualitätssicherung<br />
Dr. André Widmer, Präsident der<br />
Weiter- und Fortbildungskommission<br />
der <strong>FSP</strong>, machte in seinem Referat<br />
deutlich, dass eine kontinuierliche<br />
Qualitätssicherung und -entwicklung<br />
(QSE) heute europaweit als unverzichtbarer<br />
Standard angesehen<br />
wird. Massnahmen der Qualitätssicherung<br />
sollen die Anbieter darin<br />
unterstützen, mit ihren Leistungen<br />
die Bedürfnisse und Erwartungen<br />
der relevanten Ansprechgruppen zufriedenzustellen.<br />
Mit Blick auf aktuelle<br />
Entwicklungen im nationa-<br />
Verena Schwander, Geschäftsleitung<br />
<strong>FSP</strong>, Sybille Eberhard, Vorstand <strong>FSP</strong><br />
Fotos: Vadim Frosio
len Bildungsbereich und auf künftige<br />
Anforderungen des PsyG braucht es<br />
eine bessere Integration von konkreten<br />
QSE-Normen und -Massnahmen<br />
in die neuen <strong>FSP</strong>-Richtlinien.<br />
Die <strong>FSP</strong> will zukünftig gemeinsame<br />
QSE-Standards setzen und ihre Anbieter<br />
beim Aufbau einer umfassenden<br />
Qualitätskultur beraten und unterstützen.<br />
Kompetenzorientierung<br />
Das Konzept der Kompetenzorientierung<br />
als pädagogisches Leitkriterium<br />
liegt sowohl in Europa als auch in der<br />
Schweiz derzeit voll im Trend. Benno<br />
Stecher, Studienleiter der CCHRM-<br />
Weiterbildung in Studien- und Laufberatung,<br />
konnte in seinem Erfahrungsbericht<br />
deutlich machen, wie<br />
wichtig die Umsetzung des gelernten<br />
Wissens in ein persönliches Kompetenzenprofil<br />
ist. Die Einführung eines<br />
kompetenzorientierten Curri-<br />
culums erlaubt das verbindliche Setzen<br />
von Ausbildungsstandards gegen<br />
innen und aussen. Wichtige erste<br />
Schritte bei der Planung sind eine<br />
detaillierte Aufgaben- und Anforderungsanalyse<br />
sowie die Formulierung<br />
von praktisch nachweis- und<br />
überprüfbaren Handlungskompetenzen.<br />
Da sich die Arbeitswelt laufend<br />
weiterentwickelt, muss das System<br />
auch periodisch adaptiert werden<br />
können. Laut einer kürzlich von der<br />
<strong>FSP</strong> durchgeführten Anbieterbefragung<br />
beschäftigt sich bereits ein Drittel<br />
der <strong>FSP</strong>-Anbieter mit dem Thema<br />
der Kompetenzorientierung. Die<br />
rege Diskussion zeigte, dass von Seiten<br />
der Anbieter ein grosses Interesse<br />
an dieser Thematik besteht. Die <strong>FSP</strong><br />
wird deshalb mittelfristig mit Experten<br />
und interessierten Anbietern das<br />
Gespräch aufnehmen und prüfen, ob<br />
sich gemeinsame Grundlagen für die<br />
Planung und Entwicklung der Methodik<br />
kompetenzbasierter Curricula<br />
erarbeiten lassen.<br />
Ausblick<br />
Um ihre Anbieter für das PsyG zu<br />
wappnen und ihr Weiterbildungssystem<br />
den Veränderungen im schweizerischen<br />
und europäischen Umfeld<br />
anzupassen, strebt die <strong>FSP</strong> den Aufbau<br />
eines Kompetenzzentrums für<br />
Fragen bezüglich Akkreditierung und<br />
Qualitätssicherung an. Sie wird sich<br />
zudem dem BAG als verantwortliche<br />
Organisation gemäss PsyG zur Verfügung<br />
stellen und sieht in dieser Funktion<br />
ihre Hauptaufgabe darin, ihre<br />
Anbieter in allen Akkreditierungsfragen<br />
zu beraten und zu begleiten.<br />
Dazu gehört auch die Suche nach allfälligenVereinfachungsmöglichkeiten<br />
im Rahmen der in Vorbereitung<br />
befindlichen Bundesakkreditierung.<br />
Die Teilnahme von rund 80 Personen<br />
am Informationstag machte deutlich,<br />
dass ein grosser Informationsbedarf<br />
zu den vorgestellten Themen besteht.<br />
Rückmeldungen zur Veranstaltung<br />
zeigten zudem, dass ein enger und regelmässigerer<br />
Kontakt zwischen der<br />
<strong>FSP</strong>-Geschäftsstelle und den Weiterbildungsinstitutionen<br />
gewünscht<br />
wird. Aus diesem Grund wird die<br />
<strong>FSP</strong> in näherer Zukunft weitere Informationsveranstaltungen<br />
planen<br />
und etwa auch gezielte Workshops zu<br />
wichtigen Einzelfragen durchführen.<br />
Die <strong>FSP</strong> wird ihre Mitglieder und<br />
Weiterbildungsanbieter zudem über<br />
alle wichtigen Änderungen, Anlässe<br />
und Termine im Zusammenhang<br />
mit der Akkreditierung wie auch der<br />
Weiterbildungsreform auf dem Laufenden<br />
halten.<br />
Miriam Burkhalter, Rudolf Nägeli<br />
Informationen:<br />
Ein ausführlicher Tagungsbericht kann<br />
bei Interesse angefordert werden.<br />
miriam.burkhalter@fsp.psychologie.ch<br />
23<br />
ACTU PsyG praktisch <strong>FSP</strong> AKTUELL: ???<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011 X-X/200X
24<br />
ACTU PsyG praktisch <strong>FSP</strong> AKTUELL: ???<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011 X-X/200X<br />
Transparenz und Partizipation<br />
Marianne Gertsch und Marlene Stritt vom Bundesamt für<br />
Gesundheit (BAG) bereiten derzeit die ab 2013 geplante<br />
Umsetzung des PsyG vor. Im Psychoscope-Interview erklären<br />
sie unter anderem, weshalb ihnen dabei ein transparentes<br />
Vorgehen und der Einbezug der Beteiligten ein<br />
zentrales Anliegen ist.<br />
Marianne Gertsch und Marlene Stritt,<br />
seit der erfolgreichen Verabschiedung des<br />
PsyG im März 2011 beschäftigen Sie sich<br />
vor allem mit der Vorbereitung der Umsetzung<br />
dieses Gesetzes. Welche Bedeutung<br />
kommt hierbei der Akkreditierung<br />
der psychologischen und psychotherapeutischen<br />
Weiterbildungsgänge zu (vgl. dazu<br />
auch S. 22/23)? – Und: Wieso braucht<br />
es überhaupt eine zusätzliche Akkreditierung<br />
durch den Bund?<br />
Die sorgfältige Vorbereitung der<br />
Grundlagen und Verfahren der Akkreditierung<br />
ist eine wesentliche Aufgabe<br />
im Rahmen der Vorarbeiten<br />
zum Vollzug des PsyG: Aufgrund der<br />
Akkreditierung wird ja darüber entschieden<br />
werden, welche der zahlreichen<br />
Weiterbildungsgänge inskünftig<br />
eidgenössische, d.h. bundesweit anerkannte<br />
Titel erteilen können.<br />
Ein solcher eidgenössischer Weiterbildungstitel<br />
wird gemäss PsyG notwendig<br />
sein für Psychotherapeutin-<br />
nen und -therapeuten, die ihren Beruf<br />
selbständig, in eigener fachlicher<br />
Verantwortung ausüben wollen.<br />
Daraus ergibt sich die grosse Bedeutung<br />
der Akkreditierung sowohl für<br />
angehende Psychotherapeutinnen<br />
und -therapeuten als auch für die<br />
Anbieter entsprechender Weiterbildungen.<br />
Dementsprechend ist es uns<br />
ein grosses Anliegen, bei der Vorbereitung<br />
der Akkreditierung möglichst<br />
transparent vorzugehen und die Beteiligten<br />
und Betroffenen einzubeziehen.<br />
Die Akkreditierung gemäss PsyG löst<br />
das heutige System ab, in welchem<br />
verschiedene Fach- und Berufsverbände<br />
– mit unterschiedlichen An-<br />
sätzen – über die Anerkennung von<br />
Weiterbildungen bestimmen. Der<br />
Bund schafft damit eine einheitliche<br />
Grundlage für die Anerkennung von<br />
Weiterbildungen. Dies wiederum ist<br />
eine notwendige Bedingung für die<br />
Schaffung von eidgenössischen Weiterbildungstiteln.<br />
Was ist der Unterschied zwischen der<br />
«provisorischen» und der «ordentlichen»<br />
Akkreditierung?<br />
Die «provisorische» Akkreditierung<br />
ist eine übergangsrechtliche Regelung,<br />
welche nur im Bereich der Psychotherapie<br />
zum Zuge kommen wird.<br />
Konkret wird der Bundesrat vor Inkraftsetzung<br />
des PsyG bestimmen,<br />
welche der heute von den unterschiedlichen<br />
Berufs- und Fachverbänden<br />
anerkannten Weiterbildungen<br />
für eine Dauer von 5 Jahren<br />
provisorisch akkreditiert sind.<br />
Dabei wird kein eigentliches Akkreditierungsverfahren<br />
durchgeführt,<br />
sondern der Entscheid aufgrund der<br />
Vorschläge der Verbände getroffen<br />
werden. Provisorisch akkreditierte<br />
Weiterbildungen werden während<br />
5 Jahren als eidgenössisch geltende<br />
Titel erteilen können. Damit ist der<br />
Übergang sichergestellt bis zum Zeitpunkt,<br />
zu dem die «ordentliche» Akkreditierung<br />
nach PsyG greifen wird.<br />
Wie sehen die Zeitpläne für diese beiden<br />
Verfahren aus?<br />
Die Liste der provisorisch akkreditierten<br />
Weiterbildungen in Psychotherapie<br />
wird bis im Sommer 2012,<br />
gemeinsam mit den Verbänden,<br />
vorbereitet.<br />
Sie wird anschliessend der Psychologieberufekommission<br />
zur Stellung-<br />
nahme und spätestens im November<br />
2012 dem Bundesrat zum Entscheid<br />
vorgelegt.<br />
Die Grundlagen und Verfahren der<br />
«ordentlichen» Akkreditierung müssen<br />
bis Ende 2012 so vorbereitet sein,<br />
dass ordentliche Akkreditierungsprozesse<br />
ab Inkraftsetzung des PsyG<br />
möglich sind. Für provisorisch akkreditierte<br />
Weiterbildungen in Psychotherapie<br />
gilt, dass sie spätestens am<br />
Ende der 5-jährigen Übergangszeit<br />
ordentlich akkreditiert sein müssen,<br />
um weiterhin eidgenössische Titel<br />
erteilen zu können.<br />
Welche Rolle kann unser Verband im<br />
Rahmen der Akkreditierungsverfahren<br />
des Bundes übernehmen?<br />
Die <strong>FSP</strong> kann die Rolle der «verantwortlichen<br />
Organisation» im Akkreditierungsprozess<br />
wahrnehmen. Sie<br />
übernimmt damit die Verantwortung<br />
für die zu akkreditierenden Weiterbildungen<br />
und deren Akkreditierungsvorhaben.<br />
Wie wird die Bezeichnung der zukünftigen<br />
eidgenössischen Weiterbildungstitel<br />
lauten?<br />
Die genauen Bezeichnungen stehen<br />
noch nicht fest: Sie werden in einer<br />
Bundesratsverordnung, wiederum<br />
nach Anhörung der betroffenen Berufskreise<br />
und der Psychologieberufekommission,<br />
festgelegt werden.<br />
Interview:<br />
Rudolf Nägeli
Transparence et participation<br />
Marianne Gertsch et Marlene Stritt, de l’Office fédéral<br />
de la santé publique (O<strong>FSP</strong>), travaillent actuellement à la<br />
mise en place de la LPsy, qui entrera en vigueur en 2013.<br />
Dans l’interview qui suit, elles expliquent notamment les<br />
raisons pour lesquelles une politique de transparence et<br />
une participation des personnes concernées sont une<br />
nécessité.<br />
Marianne Gertsch et Marlene Stritt, depuis<br />
l’adoption de la LPsy en mars 2011,<br />
vous travaillez à la mise en place de la loi.<br />
Quelle importance accordez-vous dans<br />
ce cadre à l’accréditation des cursus de formation<br />
postgrade et continue en psychologie<br />
et en psychothérapie (sur le même<br />
sujet, cf. p. 26-27) ?<br />
En quoi une accréditation fédérale de<br />
plus est-elle indispensable ?<br />
Elaborer soigneusement les bases et<br />
la procédure d’accréditation est une<br />
des tâches essentielles qui doit précéder<br />
la mise en place définitive de la<br />
LPsy: c’est sur la base de l’accréditation<br />
qu’il sera décidé, parmi les nombreux<br />
cursus de formation, ceux qui<br />
par la suite donneront le droit de porter<br />
un titre postgrade fédéral, à savoir<br />
un titre valable à l’échelle de la Suisse<br />
tout entière. Dès l’entrée en vigueur<br />
de la LPsy, les psychothérapeutes qui<br />
voudront exercer leur profession de<br />
manière indépendante et sous leur<br />
propre responsabilité devront être en<br />
possession d’un tel titre postgrade fédéral.<br />
Voilà qui souligne le rôle essentiel de<br />
l’accréditation pour les futur(e)s psychothérapeutes,<br />
tout comme pour les<br />
prestataires des formations correspondantes.<br />
Aussi est-il d’une grande<br />
importance d’avancer dans l’élaboration<br />
de l’accréditation avec le maximum<br />
de transparence possible et de<br />
faire participer au processus les milieux<br />
concernés.<br />
Aux termes de la LPsy, l’accréditation<br />
remplacera le système actuel, dans lequel<br />
les différentes associations professionnelles<br />
– avec des approches<br />
différentes – fixent elles-mêmes les<br />
critères de reconnaissance des formations.<br />
Désormais ce sera à la Confédération<br />
d’édifier une base uniforme<br />
pour la reconnaissance des formations<br />
postgrades. C’est aussi une<br />
condition nécessaire si l’on veut créer<br />
des titres de formation postgrade<br />
reconnus au niveau fédéral.<br />
Quelle différence y a-t-il entre l’accréditation<br />
«provisoire» et l’accréditation «ordinaire»<br />
?<br />
L’accréditation «provisoire» est une<br />
mesure transitoire, qui n’interviendra<br />
que dans le domaine de la psychothérapie.<br />
En clair, le Conseil fédéral décidera<br />
avant l’entrée en vigueur de la<br />
LPsy quelles formations aujourd’hui<br />
reconnues par les associations professionnelles<br />
feront l’objet d’une accréditation<br />
provisoire pour une durée de 5<br />
ans. Pour cela, il n’y aura pas de procédure<br />
d’accréditation à proprement<br />
parler, mais la décision sera prise sur<br />
la base des propositions des associations.<br />
Les formations postgrades à accréditation<br />
provisoire donneront droit<br />
à porter un titre valable sur le plan fédéral<br />
aux personnes les ayant terminées<br />
au plus tard à la fin de la période<br />
de transition de 5 ans. Ces mesures<br />
permettront d’assurer la transition<br />
jusqu’au moment où l’accréditation<br />
«ordinaire» prévue par la LPsy prendra<br />
effet.<br />
Quel calendrier prévoyez-vous pour ces<br />
deux procédures ?<br />
Le projet de liste des formations en<br />
psychothérapie accréditées provisoirement<br />
sera dressé avant l’été 2012,<br />
en collaboration avec les associations.<br />
Il sera ensuite examiné par la Commission<br />
des professions de la psychologie,<br />
qui prendra position, avant qu’il<br />
soit soumis au Conseil fédéral au plus<br />
tard en novembre 2012.<br />
Les bases et les procédures de l’accréditation<br />
«ordinaire» devront être<br />
prêtes pour la fin de l’année 2012,<br />
afin que des processus d’accréditation<br />
ordinaire soient possibles dès l’entrée<br />
en vigueur de la LPsy. Pour les formations<br />
en psychothérapie accréditées<br />
provisoirement, elles devront obtenir<br />
une accréditation ordinaire au<br />
plus tard à la fin de la période transitoire<br />
de 5 ans, afin de donner de suite<br />
le droit de porter un titre fédéral.<br />
Quel rôle notre association peut-elle jouer<br />
dans le cadre de la procédure d’accréditation<br />
de la Confédération ?<br />
La <strong>FSP</strong> pourra assumer, si elle le<br />
désire, le rôle d’«organisation responsable»<br />
dans le processus d’accréditation.<br />
Elle aura dès lors la responsabilité<br />
des formations postgrades à accréditer<br />
et des projets d’accréditation<br />
de ces formations.<br />
Comment s’appelleront à l’avenir les titres<br />
fédéraux de formation postgrade et continue<br />
?<br />
Les désignations exactes ne sont pas<br />
encore choisies: elles seront fixées par<br />
une ordonnance fédérale, après une<br />
nouvelle audition des milieux professionnels<br />
concernés et de la Commission<br />
des professions de la psychologie.<br />
Interview:<br />
Rudolf Nägeli<br />
25<br />
LPsy en pratique<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011
26<br />
ACTU LPsy en <strong>FSP</strong> pratique AKTUELL: ???<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011 X-X/200X<br />
Journée d’information <strong>FSP</strong> sur la formation<br />
La <strong>FSP</strong> a organisé le 20 mai 2011 à Berne une journée<br />
d’information destinée à ses prestataires en matière de<br />
formation. Ses thèmes principaux ont été l’accréditation<br />
aux termes de la LPsy et la future réforme de la formation<br />
postgrade et continue <strong>FSP</strong>.<br />
L’adoption de la Loi sur les professions<br />
de la psychologie (LPsy) et les développements<br />
récents dans le domaine<br />
de la formation postgrade et continue<br />
posent de nombreux défis à la <strong>FSP</strong> et<br />
à ses institutions de formation: l’accréditation<br />
des différents cursus de<br />
formation postgrade et continue, le<br />
besoin de combler un retard avéré<br />
dans le domaine de l’assurance qualité,<br />
l’intérêt croissant pour la discussion<br />
actuelle sur la compétence et la<br />
nécessité de simplifier des procédures<br />
trop compliquées de reconnaissance<br />
et d’attribution des titres délivrés par<br />
l’association.<br />
Pour relever ces nouveaux défis, la<br />
<strong>FSP</strong> songe à une refonte complète de<br />
la formation postgrade et continue,<br />
avec la ferme intention d’aider activement<br />
et efficacement les prestataires<br />
confrontés aux changements indispensables.<br />
La réforme s’inscrit dans<br />
le cadre d’un changement de paradigme<br />
stratégique d’une certaine importance,<br />
assurant le passage d’une<br />
organisation associative traditionnelle<br />
Rudolf Nägeli, responsable formation<br />
postgrade et continue<br />
à une entreprise de services de caractère<br />
professionnel. La nouvelle orientation<br />
du système de formation exige<br />
en outre un renforcement de la collaboration<br />
entre les organes de la <strong>FSP</strong><br />
et les prestataires de formation postgrade<br />
et continue.<br />
L’objectif premier de la journée d’information<br />
était de donner aux institutions<br />
de formation un premier aperçu<br />
de ce que sera l’accréditation fédérale<br />
prévue dans la LPsy et d’indiquer les<br />
orientations de la réforme de la formation<br />
postgrade et continue envisagée<br />
par la <strong>FSP</strong>. Parallèlement, il<br />
s’agissait surtout de développer les<br />
contacts, d’échanger des informations<br />
sur les changements les plus importants<br />
dans le domaine de la formation<br />
et de clarifier d’éventuelles questions<br />
en rapport avec les procédures définies<br />
par la LPsy.<br />
Accréditation selon la LPsy<br />
Mmes Marianne Gertsch et Marlène<br />
Stritt, de l’Office fédéral de la santé<br />
publique (O<strong>FSP</strong>), ont présenté les<br />
principaux éléments de l’accréditation<br />
par la Confédération telle qu’elle est<br />
prévue dans la LPsy et ont donné des<br />
renseignements sur le déroulement<br />
des deux procédures d’accréditation<br />
(provisoire et ordinaire) en préparation.<br />
On trouvera davantage de détails<br />
sur ces procédures dans l’interview<br />
ci-avant. L’O<strong>FSP</strong> considère ce qu’il<br />
appelle les organisations responsables,<br />
au premier rang desquelles la <strong>FSP</strong>,<br />
comme ses partenaires privilégiés<br />
pour toute question touchant aux procédures<br />
d’accréditation.<br />
La réforme de la formation <strong>FSP</strong><br />
Le Dr Rudolf Nägeli, responsable de<br />
la formation postgrade et continue de<br />
la <strong>FSP</strong> et du projet de réforme de la<br />
formation postgrade et continue <strong>FSP</strong>,<br />
a donné dans son exposé un aperçu<br />
des discussions en cours au sein de la<br />
<strong>FSP</strong> à propos de la réforme envisagée.<br />
Une analyse exhaustive de la structure<br />
et du contexte du système actuel fait<br />
apparaître un certain nombre de lacunes<br />
et de faiblesses dans le système<br />
en vigueur jusqu’ici. En s’appuyant<br />
sur cette analyse, le Secrétariat général<br />
et le Comité ont déjà élaboré les<br />
premiers principes et orientations de<br />
la réforme de la formation postgrade<br />
et continue, qui reposera sur une redéfinition<br />
complète des lignes directrices<br />
de la formation, sur une adaptation<br />
des modules de formation<br />
existants au système de Bologne des<br />
hautes écoles ainsi que sur un pilotage<br />
continu du système de formation<br />
dans son ensemble et sur le développement<br />
global du système par les organes<br />
responsables de la <strong>FSP</strong>.<br />
Assurance qualité<br />
Dans sa présentation, le Dr André<br />
Widmer, Président de la Commission<br />
de formation postgrade et de formation<br />
continue de la <strong>FSP</strong>, a insisté sur<br />
le fait que l’assurance qualité et le développement<br />
constant d’un concept<br />
qualité sont aujourd’hui considérés à<br />
l’échelle européenne comme une né-<br />
Verena Schwander, Secrétaire générale<br />
<strong>FSP</strong>, Sybille Eberhard, Comité <strong>FSP</strong><br />
Photos: Vadim Frosio
cessité incontournable. Dans cette<br />
optique, les prestataires doivent encourager<br />
les mesures propres à assurer<br />
la qualité en s’efforçant par leurs<br />
prestations de satisfaire les besoins et<br />
les attentes des groupes de personnes<br />
concernés. Etant donné les développements<br />
actuels sur le plan national<br />
et les exigences futures de la LPsy, il<br />
est indispensable de mieux intégrer<br />
les normes et mesures propres à assurer<br />
concrètement la qualité dans les<br />
nouveaux principes directeurs de la<br />
<strong>FSP</strong>. A l’avenir, la <strong>FSP</strong> devra instaurer<br />
des règles et des standards communs<br />
en matière d’assurance et de<br />
développement de la qualité; elle aura<br />
aussi à conseiller et épauler ses prestataires<br />
si elle entend instaurer une<br />
véritable culture de la qualité.<br />
Orientation sur la compétence<br />
Devenu un critère de base en matière<br />
de pédagogie, le concept d’orientation<br />
sur la compétence a aujourd’hui le<br />
vent en poupe, en Europe comme en<br />
Suisse. M. Benno Stecher, Directeur<br />
de la formation CCHRM en conseil<br />
de gestion de carrière, s’est appuyé<br />
sur son expérience pour montrer l’importance<br />
du savoir appris dans l’élaboration<br />
d’un profil de compétence<br />
personnel. L’introduction d’un cursus<br />
orienté sur la compétence permet de<br />
mettre en place des standards de formation<br />
solides et sérieux sur le plan<br />
interne et vis-à-vis de l’extérieur. En<br />
matière de planification, la première<br />
chose à faire sera d’analyser en détail<br />
tâches et exigences et de formuler<br />
des compétences qui soient démontrables<br />
et vérifiables dans la pratique.<br />
Comme le monde du travail ne cesse<br />
d’évoluer, il faudra aussi pouvoir<br />
adapter périodiquement le système.<br />
Selon un sondage mené récemment<br />
par la <strong>FSP</strong> auprès des prestataires, un<br />
tiers ont déjà introduit dans leur réflexion<br />
le thème de l’orientation sur<br />
la compétence. Une discussion nourrie<br />
a montré que, du côté des prestataires,<br />
il existe un fort intérêt pour le<br />
sujet. C’est pourquoi la <strong>FSP</strong> nouera<br />
à moyen terme des contacts avec des<br />
experts et des prestataires intéressés<br />
et examinera dans quelle mesure des<br />
principes communs de planification<br />
et de développement de la méthodologie<br />
permettront de mettre sur pied<br />
des cursus basés sur la compétence.<br />
Perspectives<br />
Pour préparer ses prestataires aux<br />
nouveautés de la LPsy et adapter son<br />
système de formation postgrade et<br />
continue aux changements intervenus<br />
sur le plan suisse ou européen, la <strong>FSP</strong><br />
appelle de ses vœux la création d’un<br />
centre de compétence pour traiter des<br />
questions ayant trait à l’accréditation<br />
et à l’assurance qualité. En tant qu’organisation<br />
responsable aux termes<br />
de la LPsy, elle se mettra en outre à<br />
la disposition de l’O<strong>FSP</strong> et, dans ce<br />
cadre, l’essentiel de sa mission consistera<br />
à conseiller et accompagner ses<br />
prestataires sur toute question ayant<br />
trait à l’accréditation. Elle aura aussi à<br />
imaginer des solutions pour simplifier<br />
les procédures d’accréditation fédérale<br />
actuellement en chantier.<br />
La participation de près de 80 personnes<br />
à la journée d’information<br />
montre à l’évidence qu’il existe une<br />
grosse demande en matière d’information<br />
sur les sujets présentés. Les<br />
réactions enregistrées à l’issue de la<br />
manifestation suggèrent aussi que<br />
des contacts étroits et plus réguliers<br />
entre le Secrétariat général de la <strong>FSP</strong><br />
et les institutions de formation continue<br />
seraient souhaitables. Pour cette<br />
raison, la <strong>FSP</strong> prévoit dans un futur<br />
proche d’organiser d’autres journées<br />
d’information et peut-être aussi de<br />
mettre sur pied des workshops<br />
consacrés plus spécifiquement à<br />
des thèmes d’actualité. La <strong>FSP</strong> ne<br />
manquera pas en outre de tenir ses<br />
membres et ses prestataires de formation<br />
continue au courant de tous les<br />
changements importants et de tous<br />
les rendez-vous et manifestations en<br />
rapport avec l’accréditation ou la réforme<br />
de la formation postgrade et<br />
continue.<br />
Miriam Burkhalter, Rudolf Nägeli<br />
Un rapport détaillé sur la journée d’information<br />
est disponible en français et en allemand<br />
et peut être commandé auprès de:<br />
miriam.burkhalter@fsp.psychologie.ch.<br />
27<br />
ACTU LPsy en <strong>FSP</strong> pratique AKTUELL: ???<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011 X-X/200X
28<br />
ACTU <strong>FSP</strong> AKTUELL <strong>FSP</strong> AKTUELL<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011<br />
Humanforschungsgesetz: Leerlauf verhindert<br />
Das Gesetz zur Forschung am Menschen (HFG) kommt<br />
im Parlament voran. Wichtige Anliegen der Psychologie<br />
wurden dank Felix Gutzwiller erfolgversprechend eingebracht.<br />
Soll die Forschung «ohne direkten<br />
Nutzen» für die Beforschten («fremdnützige<br />
Forschung») bei unmündigen<br />
oder nicht urteilsfähigen Personen<br />
verboten werden? Soll der Gesetzgeber<br />
jede Forschung ohne vorherige<br />
und vollständige Aufklärung untersagen?<br />
Sollen die kantonalen Ethikkommissionen<br />
für jede Forschung<br />
mit Menschen zuständig sein? Für<br />
die psychologische Forschung stehen<br />
beim Humanforschungsgesetz<br />
(HFG), das sich derzeit im Parlament<br />
befindet, diese drei Fragen im Zentrum<br />
des Interessens.<br />
Pauschale Verbote vom Tisch<br />
Während pauschale Verbote der<br />
«fremdnützigen» sowie der zum Voraus<br />
nicht vollständig aufgeklärten<br />
Forschung bereits frühzeitig verhindert<br />
werden konnten, drohte nach<br />
der Behandlung im Nationalrat immer<br />
noch eine unverhältnismässige<br />
Bürokratisierung von Vorhaben, deren<br />
Risiken und Belastungen für die<br />
Probanden minimal sind, vergleichbar<br />
mit jenen des Alltags: Soll es tatsächlich<br />
zu den Aufgaben einer kantonalen<br />
Ethikkommission gehören,<br />
klassische Forschungskonzepte, etwa<br />
der Sozial- und der Gesundheitspsychologie,<br />
beispielsweise zu den Auswirkungen<br />
des Lebensstils, zu Chancengleichheit<br />
und Gesundheit oder<br />
zu Stress am Arbeitsplatz, zu bewilligen?<br />
Und müssen alle diese Projekte<br />
zusätzlich in einem Register des<br />
Bundes eingetragen werden? Führende<br />
ExpertInnen der psychologischen<br />
Forschung in der Schweiz, darunter<br />
Prof. Andreas Maercker (Universität<br />
Zürich) und Prof. Alexander<br />
Grob (Universität Basel), verneinen<br />
dies. Sie betonen, dass solche Auflagen<br />
nicht die Qualität der Forschung<br />
verbessern, sondern teuren und langwierigen<br />
bürokratischen Leerlauf<br />
schaffen.<br />
Bürokratie gestoppt<br />
Diese Sichtweise vertrat im Parlament<br />
auch Felix Gutzwiller. Der Zürcher<br />
Ständerat forderte, dass aus dem<br />
Geltungsbereich des HFG nicht nur<br />
hervorgehen müsse, was geregelt werde,<br />
sondern auch, was nicht geregelt<br />
werde. Es sei wichtig festzuhalten,<br />
dass der Geltungsbereich die krankheitsorientierte<br />
Forschung, beispielsweise<br />
bei psychischen Krankheitsbildern,<br />
umfasse, aber nicht allgemeine<br />
Forschungsprojekte zur Psyche. Ein<br />
Projekt über die Ursachen einer Depression<br />
oder krank machende Faktoren<br />
würde folglich vom HFG erfasst,<br />
hingegen nicht Forschungsprojekte,<br />
die ohne direkten Bezug zur Krankheit<br />
zum Beispiel die Entwicklung<br />
der Empathiefähigkeit von Kindern<br />
untersuchen. Zuhanden des amtlichen<br />
Protokolls, das für die spätere<br />
Gesetzesauslegung von Bedeutung<br />
ist, betonte Gutzwiller: «Die<br />
Ethikkommissionen werden mit diesem<br />
Gesetz eine bedeutendere Rolle<br />
bekommen. Es ist deshalb wichtig,<br />
auch zu definieren, wo die Grenzen<br />
sind. (…) Es ist nicht die Idee des Gesetzes,<br />
sämtliche Forschungsprojekte,<br />
die mit Fragen des Menschen zu tun<br />
haben, den Ethikkommissionen zu<br />
unterstellen. (…) Ich bitte darum, das<br />
zur Kenntnis zu nehmen.»<br />
Ein weiterer Diskussionspunkt betraf<br />
die Frage, welche Art von Forschung<br />
künftig in ein Register des Bundes<br />
eingetragen werden muss. Felix Gutzwiller<br />
erklärte dazu im «Stöckli»:<br />
«Heute gehören öffentliche Register<br />
ohne Zweifel zum Standard in der internationalen<br />
klinischen Forschung.<br />
Felix Gutzwiller: Stoppt bürokratische<br />
Leerläufe in der psychologischen Forschung.<br />
(...) Wenn man aber die Absicht hätte,<br />
sämtliche Forschungsprojekte,<br />
wiederum etwa jene in den Sozialwissenschaften,<br />
zu registrieren, würde<br />
das zu einer unverhältnismässigen<br />
Bürokratisierung führen.»<br />
Der Ständerat ist dem Antrag Gutzwiller<br />
gefolgt: Künftig sollen nur klinische<br />
Studien – clinical randomized<br />
trials – in ein öffentliches Register des<br />
Bundes eingetragen werden müssen.<br />
Man darf zuversichtlich sein<br />
Das HFG kommt nun in die Differenzbereinigung<br />
der Räte. Aus Sicht<br />
der Psychologie darf man zuversichtlich<br />
sein, dass der Nationalrat den<br />
Entscheiden des Ständerats gegen<br />
unnötige und teure bürokratische<br />
Leerläufe folgen wird. Im Psychoscope<br />
wird weiter darüber berichtet werden.<br />
Daniel Habegger
DV: <strong>FSP</strong> vor neuen Herausforderungen<br />
Höhepunkte der <strong>FSP</strong>-Delegiertenversammlung vom<br />
25. Juni bildeten die Ausführungen von Nationalrätin<br />
Jacqueline Fehr zur berufspolitischen Situation der PsychologInnen<br />
und die neu vorgesehene Aufnahme von<br />
PsychologInnen mit einem Fachhochschul-Master.<br />
Knapp 150 Delegierte fanden sich<br />
am 25. Juni zur 47. Delegiertenversammlung<br />
der <strong>FSP</strong> in Bern ein. Neben<br />
dem Auftritt von SP-Nationalrätin<br />
Jacqueline Fehr erwartete sie hier<br />
die Behandlung einer Vielzahl wichtiger<br />
Traktanden.<br />
So wurden die Jahresberichte des<br />
Vorstands und der Kommissionen<br />
von den Delegierten einstimmig genehmigt.<br />
Der Rückblick auf das vergangene<br />
Jahr war mit Genugtuung<br />
verbunden, hat die <strong>FSP</strong> doch mit der<br />
Verabschiedung des Psychologieberufegesetzes<br />
(PsyG) im März 2011<br />
ihr wichtigstes Legislaturziel erreicht.<br />
Die <strong>FSP</strong> werde damit zum Dachverband<br />
der gesetzlich anerkannten Psychologinnen<br />
und Psychologen, so der<br />
scheidende <strong>FSP</strong>-Präsident Markus<br />
Hartmeier.<br />
Berufspolitisch am Ball<br />
Die <strong>FSP</strong> hat mit dem PsyG eine<br />
wichtige Etappe erfolgreich abgeschlossen,<br />
die nächsten Herausforderungen<br />
warten aber schon. So<br />
befindet sich die <strong>FSP</strong> mitten in einer<br />
Reform des Weiter- und Fortbildungssystems.<br />
In diesem Bereich<br />
will die <strong>FSP</strong> zu einer «verantwortlichen<br />
Organisation» für eidgenössische<br />
Akkreditierungen und Titelvergaben<br />
werden.<br />
Ein Dauerbrenner bleibt auch die berufliche<br />
Besserstellung der Psychotherapeutinnen<br />
und -therapeuten im<br />
Gesundheits- und Sozialbereich, namentlich<br />
in der Sozialversicherung<br />
und in der privaten Zusatzversicherung.<br />
Doch bis zur Regelung und<br />
Anerkennung der psychologischen<br />
Psychotherapie im Krankenversicherungsgesetz<br />
(KVG) sei der Weg noch<br />
lang, betonte SP-Nationalrätin Jaque-<br />
line Fehr in ihren Ausführungen zur<br />
Positionierung der PsychologInnen<br />
nach der Verabschiedung des PsyG.<br />
Beitragserhöhung verschoben<br />
Ohne Gegenstimme bei 24 Enthaltungen<br />
genehmigten die Delegierten<br />
die mit einem aus den Reserven gedeckten<br />
Defizit von 93’000 Franken<br />
veranschlagte Jahresrechnung 2010.<br />
In den nächsten Jahren steht die<br />
<strong>FSP</strong> vor einer finanziellen Herausforderung,<br />
weil es als Folge des PsyG<br />
neue Aufgaben zu bewältigen gilt. Da<br />
sämtliche Sparmassnahmen schon<br />
ausgeschöpft worden sind, beantragte<br />
der Vorstand den Delegierten eine<br />
Erhöhung der Mitgliederbeiträge –<br />
beschloss dann aber angesichts des<br />
Diskussionsverlaufs, diesen Antrag<br />
um ein Jahr zu verschieben.<br />
Ebenso beschlossen die Delegierten,<br />
dass weiterhin die DV – und nicht<br />
wie beantragt der Vorstand – für die<br />
An- oder Aberkennung der Weiterbildungs-Curricula<br />
zuständig sein soll.<br />
Zustimmung gab es hingegen für den<br />
Vorstandsvorschlag, vorläufig nicht<br />
am EuroPsy-Programm teilzunehmen,<br />
sowie – einstimmig – für die<br />
neue <strong>FSP</strong>-Berufsordnung (s. Beilage).<br />
Wahlen und Aufnahmen<br />
Zügig über die Bühne ging das Traktandum<br />
«Wahlen»: Als Nachfolger<br />
des zurückgetretenen <strong>FSP</strong>-Präsidenten<br />
Markus Hartmeier wurde per 1.<br />
Juli 2011 turnusgemäss der bisherige<br />
Vizepräsident Roberto Sansossio<br />
gewählt. Als Vizepräsidentin wurde<br />
Karin Stuhlmann bestimmt, die ihren<br />
Rücktritt aus dem <strong>FSP</strong>-Vorstand<br />
per Ende Juni 2012 bekannt gab. Die<br />
durch Markus Hartmeiers Rücktritt<br />
entstandene Vakanz bei den deutsch-<br />
sprachigen Vorstandsmitgliedern<br />
wurde durch die Wahl von Peter<br />
Sonderegger besetzt.<br />
Sesselrücken gab es schliesslich auch<br />
an der Spitze der Weiter- und Fortbildungskommission<br />
(WFBK), wo neu<br />
André Widmer anstelle von Jérôme<br />
Rossier als Präsident Einsitz nimmt.<br />
Die <strong>FSP</strong> hat weiter die PsychologInnen-Sektionen<br />
von Relance Relationelle<br />
und der Schweizerischen Gesellschaft<br />
für Sexologie (SSS) sowie<br />
systemis.ch als neue Gliedverbände<br />
aufgenommen.<br />
Unter den zu behandelnden Curricula<br />
wurde einzig das postgraduale<br />
Weiterbildungscurriculum in daseinsanalytischer<br />
Psychotherapie nicht anerkannt.<br />
Entgegen der Haltung des<br />
Vorstands folgten die Delegierten hier<br />
der Empfehlung der WFBK.<br />
Ein Zeichen der Öffnung<br />
Ab 2012 wird die <strong>FSP</strong> erstmals auch<br />
Psychologie-Masterabsolventen der<br />
Fachhochschulen aufnehmen. Die<br />
Delegierten stimmten einer entsprechenden<br />
Änderung der Statuten zu.<br />
Dies gilt auch für PsychologInnen,<br />
die über ein eidgenössisch anerkanntes<br />
Fernstudium einen Bachelor und<br />
anschliessend ein Masterstudium an<br />
einer Schweizer Universität absolviert<br />
haben.<br />
Stefan Bruderer<br />
Informationen und Protokoll:<br />
www.psychologie.ch>Mitgliederbereich<br />
29<br />
ACTU <strong>FSP</strong> AKTUELL <strong>FSP</strong> AKTUELL: ???<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011 X-X/200X
30<br />
ACTU <strong>FSP</strong> AKTUELL <strong>FSP</strong> AKTUELL: ???<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011 8-9/2011<br />
Neue Zusatzqualifikation Gerontopsychologie<br />
Im Sommer 2010 hat die <strong>FSP</strong> ein neues Zusatzqualifika -<br />
tions-Curriculum in Gerontopsychologie anerkannt.<br />
Dem wachsenden Bedarf an quali-<br />
fizierten gerontopsychologischen<br />
Dienstleistungen steht bisher kein<br />
Weiter- oder Fortbildungsangebot gegenüber,<br />
das – basierend auf dem<br />
Studienabschluss Psychologie – weiterführend<br />
gerontopsychologisches<br />
Fachwissen auf qualitativ hohem Niveau<br />
vermittelt.<br />
Ziele und Zielpublikum<br />
Die Schweizerische Fachgesellschaft<br />
für Gerontopsychologie (SFGP) hat<br />
diesen Mangel erkannt: Die in Zusammenarbeit<br />
mit dem Zentrum für<br />
Gerontologie (ZfG) am Psychologischen<br />
Institut der Universität Zürich<br />
angebotene neue Zusatzqualifikation<br />
in Gerontopsychologie soll dazu befähigen,<br />
eigenverantwortlich und selb-<br />
Politik<br />
Das PsyG<br />
ist unbestritten<br />
Am 7. Juli ist die Referendumsfrist<br />
gegen das Psychologieberufegesetz<br />
abgelaufen. Das Gesetz wird von<br />
keiner Partei oder Organisation angefochten<br />
und tritt wahrscheinlich<br />
am 1. Januar 2013 in Kraft.<br />
Informationen:<br />
www.bag.admin.ch>Themen>Gesundheitsberufe>Psychologieberufe-Gesetz<br />
<strong>FSP</strong>-Organe<br />
Neue Schlich-<br />
tungsstelle<br />
Die im Rahmen der reformierten<br />
<strong>FSP</strong>-Verbandsgerichtsbarkeit an-<br />
ständig in verschiedenen Tätigkeitsfeldern<br />
der Gerontopsychologie tätig<br />
zu sein. Das Curriculum richtet sich<br />
an PsychologInnen mit Hochschulabschluss<br />
auf Masterebene in Psychologie,<br />
welche über eine Berufstätigkeit<br />
im Bereich der Gerontologie<br />
verfügen resp. sich in ein solches Feld<br />
vertieft einarbeiten möchten.<br />
Inhaltliche Schwerpunkte<br />
Insgesamt sind 300 Stunden an Weiterbildungszeit<br />
erforderlich. Die Module<br />
sind in Theorie, Praxis und Supervision<br />
/ Intervision aufgeteilt.<br />
Thematische Schwerpunkte sind:<br />
• Grundlagen der Gerontopsychologie<br />
(z.B. Alterstheorien, Methoden,<br />
Gesundheitsförderung, soziales<br />
Umfeld, Lebensqualität, Spirituali-<br />
gekündigte neue Schlichtungsstelle<br />
hat sich unterdessen konstituiert.<br />
Das Gremium übernimmt ab dem<br />
1. Oktober 2011 die Aufgabe, in<br />
den folgenden Streitfällen Schlichtungsversuche<br />
zu unternehmen:<br />
1. zwischen Organen oder Mitgliedern<br />
des Verbandes;<br />
2. zwischen Dritten und Mitgliedern<br />
des Verbandes;<br />
3. zwischen den Gliedverbänden<br />
der <strong>FSP</strong>.<br />
Die Schlichtungsstelle der <strong>FSP</strong> bietet<br />
zudem an, auch bei Beschwerden<br />
und Rekursen an die Rekurs-<br />
kommission der <strong>FSP</strong> einen Schlichtungsversuch<br />
durchzuführen.<br />
Als Schlichter und Schlichterinnen<br />
hat der Vorstand in diesem Sommer<br />
die folgenden verdienstvollen <strong>FSP</strong>-<br />
Mitglieder gewählt:<br />
Lisbeth Hurni, Bern; Julien Perriard,<br />
Pully; Samuel Rom, Rheinfelden;<br />
Ingrid Vernez, Ecublens; Eva<br />
Zimmermann, Avry.<br />
Weitere Details zur Funktionsweise<br />
der neuen <strong>FSP</strong>-Schlichtungsstelle<br />
finden Sie im Reglement auf der<br />
tät, Geriatrie)<br />
• Neuropsychologie im Alter<br />
• Klinische Gerontopsychologie<br />
• Geragogik<br />
• Coaching und Beratung im Alter<br />
Bis Juni 2012 können Anträge gemäss<br />
der Übergangsbestimmungen<br />
gestellt werden, sofern eine Berufstätigkeit<br />
im Bereich der Gerontopsychologie<br />
während mindestens drei<br />
Jahren zu mindestens 50 Prozent vorliegt<br />
und 50 Prozent der verlangten<br />
Leistungen nachgewiesen werden<br />
können.<br />
Sandra Oppikofer,<br />
Vorstand SFGP<br />
Informationen:<br />
www.psychologie.ch>zusatzqualifikationen<br />
s.forstmeier@psychologie.uzh.ch<br />
<strong>FSP</strong>-Website sowie demnächst im<br />
Psychoscope.<br />
Informationen und Kontakt:<br />
www.psychologie.ch>Mitgliederbereich<br />
>Dokumentation;<br />
schlichtungsstelle@fsp.psychologie.ch<br />
Gliedverbände<br />
Neue Präsiden-<br />
tin beim vipp<br />
Der Verband der Innerschweizer<br />
Psychologinnen und Psychologen<br />
vipp hat an seiner Mitgliederversammlung<br />
vom 16. Juni 2011 eine<br />
neue Präsidentin gewählt.<br />
Amtsnachfolgerin von Eva Rothenbühler<br />
wurde Franziska Eder, lic.<br />
phil, aus Horw.<br />
Informationen:<br />
www.vipp.ch
Weiter- und Fortbildung<br />
Praxisänderung<br />
Fachtitel<br />
Im Rahmen eines Fachtitelantrages<br />
für Psychotherapie werden mindestens<br />
200 Std. Selbsterfahrung<br />
verlangt. Hiervon müssen neu nur<br />
noch mindestens 100 Std. während<br />
der Weiterbildung erfolgen, die anderen<br />
Stunden können vor oder<br />
während des Studiums absolviert<br />
worden sein. Da es sich hierbei um<br />
eine Erleichterung der Auflagen<br />
handelt, tritt diese mit ihrer Publikation<br />
in Kraft und gilt für alle KandidatInnen.<br />
Die Liste der Praxisänderungen<br />
wird entsprechend ergänzt und ist<br />
auf der Website abrufbar.<br />
Informationen:<br />
www.psychologie.ch>fachtitel<br />
Neue Fachtitel<br />
Die Fachtitel- und Zertifikatskommission<br />
FZK hat an ihrer Sitzung<br />
vom 2. Juli 2011 folgende Fachtitel<br />
vergeben: herzliche Gratulation!<br />
COACHING-PSYCHOLOGIE<br />
Gschwind, Michael F. (7.5.2011)<br />
Niederhauser, Ursula<br />
KINDER- UND JUGEND-<br />
PSYCHOLOGIE<br />
Bach Gyalog, Sylvia<br />
Bernardoni, Simone<br />
Bucher, Lukas<br />
Bürgi, Susanne<br />
NEUROPSYCHOLOGIE<br />
Rodel, Renate<br />
PSYCHOTHERAPIE<br />
Bernasconi, Alex<br />
Biermann, Philipp<br />
Chevalier, Mohana<br />
Conne, Philippe<br />
Cuennet, Marie-France<br />
de Weck-Yomha, Mariel<br />
Délèze, Mireille (7.5.2001)<br />
Eidenbenz Hermanns, Rahel<br />
Elghezouani, Abdelhak<br />
Gedeon-Chappuis, Marie-Christine<br />
Giuliani, Fabienne<br />
Gloor, Fabienne (7.5.2011)<br />
Gmelch, Simone<br />
Graber, Karin<br />
Gravvani, Despina<br />
Hofmann Kaufmann, Sabine<br />
Höller, Josy<br />
Jost Marx, Marion<br />
Kuper-Yamanaka, Misa<br />
Meier, Cornelia<br />
Miszak, Teresa<br />
Pallas, Elena<br />
Pfefferlé, Martine<br />
Pfeifer-Burri, Silvia<br />
Rechlin, Claudia<br />
Russo, Claire<br />
Schmid, Cécile<br />
Toffanin, Paola<br />
Torsello, Isabella<br />
Weissen-Schelling, Simone<br />
Wullschleger-Zangerl, Monika<br />
VERKEHRSPSYCHOLOGIE<br />
Beck, Hermann<br />
Grand, Sian<br />
Raithel, Jürgen<br />
<strong>FSP</strong>-Berufsethik<br />
Berufsordnung<br />
verabschiedet<br />
An der Delegiertenersammlung<br />
vom 25. Juni wurde die neue Berufsordnung<br />
(BO) verabschiedet.<br />
Damit verfügt die <strong>FSP</strong> über berufsethische<br />
Leitlinien, die sowohl zeitgemäss<br />
als auch praxisnah sind und<br />
auf die wir stolz sein dürfen.<br />
Die BO ist für <strong>FSP</strong>-Mitglieder verbindlich<br />
und tritt am 1. Oktober in<br />
Kraft. Sie finden das Dokument als<br />
Beilage in diesem Psychoscope sowie<br />
auf der <strong>FSP</strong>-Website.<br />
Informationen:<br />
www.psychologie.ch >Die <strong>FSP</strong> >Be-<br />
Menschliche<br />
Abgründe<br />
2011. 327 S., Kt<br />
€ 24.95 / CHF 37.40<br />
ISBN 978-3-456-84926-3<br />
Serienmörder, Vergewaltiger und<br />
Verbrecher üben eine starke Faszination<br />
aus, die sich in Büchern, Filmen<br />
oder Fernsehserien niederschlägt.<br />
Aber tatsächlich sind Psychopathen<br />
in modernen Gesellschaften oft sehr<br />
erfolgreich – soziale Chamäleons,<br />
die nicht erkannt werden und die<br />
geschickt ihre Mitmenschen mani -<br />
pulieren und schädigen.<br />
Der forensische Psychiater Robert<br />
I. Simon berichtet aus langjähriger<br />
Erfahrung über die «bösen Menschen».<br />
rufsordnungErhältlich im Buchhandel oder über<br />
www.verlag-hanshuber.com<br />
31<br />
ACTU <strong>FSP</strong> AKTUELL <strong>FSP</strong> AKTUELL: ???<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011
32<br />
ACTU <strong>FSP</strong><br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011<br />
Recherche sur l'être humain: pas de temps morts<br />
La Loi relative à la recherche sur l’être humain (LRH) fait<br />
son chemin au Parlement. Grâce au Conseiller aux Etats<br />
Felix Gutzwiller, les psychologues sont en passe de voir<br />
exaucer certains vœux importants.<br />
Faut-il interdire une recherche si elle<br />
n’a pas d’utilité directe pour les personnes<br />
qui en font l’objet lorsqu’il<br />
s’agit de mineurs ou de personnes incapables<br />
de discernement ? Le législateur<br />
doit-il interdire toute recherche<br />
qui ne reposerait pas sur une justification<br />
complète et un consentement<br />
préalable ? Les commissions d’éthique<br />
cantonale doivent-elles être en<br />
toute situation compétentes en matière<br />
de recherche sur l’être humain ?<br />
Pour la recherche en psychologie, ces<br />
trois questions sont fondamentales<br />
dans le cadre de la loi actuellement<br />
en discussion devant le Parlement.<br />
Interdictions générales à la trappe<br />
Si l’interdiction générale de la recherche<br />
«sans bénéfice direct pour la personne<br />
concernée», ainsi que celle de<br />
toute recherche qui n’aurait pas été<br />
préalablement justifiée de manière<br />
complète, a été rapidement écartée,<br />
la menace subsiste, à l’issue des discussions<br />
du Conseil national, d’une<br />
bureaucratisation excessive à l’égard<br />
de projets ne comportant pour les sujets<br />
de la recherche qu’un minimum<br />
de risques et d’inconvénients, comparables<br />
à ceux rencontrés dans la<br />
vie de tous les jours: est-ce vraiment à<br />
une commission d’éthique cantonale<br />
d’examiner et approuver des concepts<br />
classiques de la recherche, en psychologie<br />
sociale par exemple ou en psychologie<br />
de la santé, sur des sujets<br />
tels que le style de vie et ses répercussions,<br />
l’égalité des chances et la santé,<br />
ou encore le stress au travail ?<br />
Et tous ces projets doivent-ils en plus<br />
être inscrits dans un registre de la<br />
Confédération ? A ces questions, les<br />
experts les plus en vue en matière de<br />
recherche psychologique en Suisse,<br />
notamment les Professeurs Andreas<br />
Maercker (Université de Zurich) et<br />
Alexander Grob (Université de Bâle),<br />
répondent non, en soulignant que ce<br />
genre de conditions ne vont pas améliorer<br />
la qualité de la recherche, mais<br />
risquent de faire perdre beaucoup de<br />
temps et d’argent en tracasseries administratives.<br />
Stop à la bureaucratie<br />
Ce point de vue a aussi été défendu<br />
devant le Parlement par Felix<br />
Gutzwiller. Le Conseiller aux Etats<br />
zurichois a demandé que le texte de<br />
la loi ne fasse pas seulement ressortir,<br />
au niveau des applications, ce qui<br />
sera réglementé, mais aussi ce qui ne<br />
le sera pas. Il convient de souligner<br />
que, si son domaine d’application<br />
comprend la recherche centrée sur<br />
la maladie, notamment pour les tableaux<br />
cliniques des maladies psychiques,<br />
il n’englobe pas en revanche les<br />
projets de recherche de nature générale<br />
sur la psyché. Si un projet analysant<br />
les causes de la dépression ou les<br />
facteurs conduisant à la maladie fait<br />
effectivement partie intégrante de la<br />
LRH, ce n’est pas le cas des recherches<br />
sans lien direct avec la maladie,<br />
telles qu’un projet étudiant «le développement<br />
de la capacité d’empathie<br />
chez l’enfant». A propos du protocole<br />
officiel, qui est d’une grande importance<br />
pour l’interprétation future de<br />
la loi, Gutzwiller s’est montré catégorique:<br />
«Avec cette loi, les commissions<br />
d’éthique auront un rôle plus<br />
important à jouer. C’est pourquoi il<br />
est essentiel de définir aussi où seront<br />
les limites. (…) L’idée de la loi n’est<br />
pas de soumettre aux commissions<br />
d’éthique l’ensemble des projets de<br />
recherche touchant à l’être humain.<br />
(…) Je vous prie de ne pas l’oublier.»<br />
Une autre question soulevée a été de<br />
Felix Gutzwiller: Halte aux atermoiements<br />
bureaucratiques en matière de recherche<br />
psychologique !<br />
déterminer quelle sorte de recherche<br />
devrait à l’avenir faire l’objet d’une<br />
inscription dans un registre de la<br />
Confédération. A la tribune, Felix<br />
Gutzwiller a donné son avis sur ce<br />
point: «Il ne fait pas de doute qu’aujourd’hui<br />
les registres officiels sont la<br />
règle dans la recherche internationale<br />
en matière clinique. (...) Mais si l’intention<br />
est d’enregistrer tous les projets<br />
de recherche, par exemple tous<br />
ceux concernant les sciences sociales,<br />
cela risque de conduire à une bureaucratisation<br />
excessive.»<br />
Le Conseil des Etats a suivi la motion<br />
Gutzwiller: à l’avenir, seules les<br />
études cliniques (clinical randomized<br />
trials) devront obligatoirement faire<br />
l’objet d’une inscription au registre<br />
officiel de la Confédération.<br />
La confiance est de rigueur<br />
La LRH est actuellement en examen<br />
aux Chambres pour gommer d’éventuelles<br />
différences. Du point de<br />
vue de la psychologie, on peut faire<br />
confiance au Conseil national: il saura<br />
suivre la volonté du Conseil des<br />
Etats d’éviter toute perte de temps<br />
et d’argent due à des tracasseries administratives.<br />
Psychoscope rendra<br />
compte ultérieurement des débats et<br />
des décisions prises.<br />
Daniel Habegger
AD: la <strong>FSP</strong> face à de nouveaux défis<br />
Points culminants de l’Assemblée des Délégué(e)s de la<br />
<strong>FSP</strong> du 25 juin: les remarques de la Conseillère nationale<br />
Jacqueline Fehr sur la situation professionnelle des psychologues<br />
et l’admission au sein de la <strong>FSP</strong> des psychologues<br />
au bénéfice d’un master des HES.<br />
Près de 150 délégué(e)s se sont<br />
retrouvé(e)s à Berne le 25 juin pour<br />
la 47 e Assemblée des Délégué(e)s de<br />
la <strong>FSP</strong>. Faisant suite à l’intervention<br />
de la Conseillère nationale Jacqueline<br />
Fehr, toute une série de points importants<br />
étaient à l’ordre du jour.<br />
Politique professionnelle<br />
Les rapports annuels du Comité et des<br />
commissions ont été adoptés à l’unanimité.<br />
Au moment de dresser le bilan<br />
de l’année écoulée, l’heure était<br />
à la satisfaction: l’adoption de la Loi<br />
sur les professions de la psychologie<br />
(LPsy), en mars 2011, permet à la <strong>FSP</strong><br />
d’atteindre son principal objectif de législature.<br />
En devenant ainsi, selon les<br />
termes du président sortant Markus<br />
Hartmeier, l’association faîtière par excellence<br />
des psychologues reconnu(e)s<br />
par la loi, la <strong>FSP</strong> a franchi une étape<br />
importante, nonobstant les prochains<br />
défis qui l’attendent. La <strong>FSP</strong> se trouve<br />
de fait engagée dans une réforme de<br />
son système de formation postgrade et<br />
continue, un domaine dans lequel elle<br />
entend s’imposer comme une «organisation<br />
responsable» en matière d’accréditations<br />
et d’attribution des titres<br />
fédéraux.<br />
Non moins brûlante reste la question<br />
de l’amélioration des conditions de<br />
travail des psychothérapeutes dans<br />
les domaines de la santé et du social,<br />
notamment dans le cadre des assurances<br />
sociales et des assurances<br />
complémentaires privées. Mais le<br />
chemin sera encore long jusqu’à ce<br />
que la psychothérapie psychologique<br />
soit réglementée et reconnue dans la<br />
Loi sur l’assurance-maladie (LAMal),<br />
comme l’a souligné la Conseillère nationale<br />
Jacqueline Fehr (PS) dans ses<br />
observations sur le positionnement<br />
des psychologues après l’adoption de<br />
la LPsy.<br />
Requête ajournée<br />
Les comptes annuels se soldant sur<br />
un déficit de 93’000 francs, couvert<br />
par les réserves, ont été adoptés par<br />
les délégué(e)s sans opposition, avec<br />
24 abstentions.<br />
Dans les prochaines années, la <strong>FSP</strong><br />
fera face à un véritable défi financier<br />
si elle entend assumer pleinement les<br />
nouvelles tâches résultant de la LPsy.<br />
Puisque toutes les mesures d’économies<br />
ont déjà été épuisées, le Comité<br />
a proposé aux délégué(e)s d’augmenter<br />
la cotisation des membres: vu la<br />
tournure prise par les discussions, il<br />
a été décidé de repousser la requête<br />
d’une année.<br />
Les délégué(e)s ont aussi décidé qu’à<br />
l’avenir ce sera à l’AD, et non au Comité,<br />
comme cela était demandé,<br />
d’assumer la responsabilité de reconnaître<br />
ou refuser des cursus de formation<br />
continue. En revanche l’accord<br />
s’est fait autour de la proposition<br />
du Comité de cesser provisoirement<br />
de participer au programme EuroPsy,<br />
ainsi que sur le nouveau Code déontologique<br />
de la <strong>FSP</strong>, accepté à l’unanimité<br />
(cf. Annexe).<br />
Elections et admissions<br />
Les «élections» ont été menées tambour<br />
battant: pour succéder à Markus<br />
Hartmeier, président sortant, le viceprésident<br />
Roberto Sansossio a été élu<br />
pour le 1er juillet 2011 selon le turnus.<br />
Karin Stuhlmann, qui a annoncé<br />
son désir de se retirer du Comité à<br />
fin juin 2012, accède à la vice-présidence.<br />
Pour combler le vide créé par<br />
le départ de Markus Hartmeier au<br />
sein des membres germanophones du<br />
Comité, le choix s’est porté sur Peter<br />
Sonderegger. Dernier changement<br />
intervenu, André Widmer prend la<br />
place de Jérôme Rossier à la tête de la<br />
Commission de formation postgrade<br />
et de formation continue (CFPFC).<br />
La <strong>FSP</strong> a en outre accepté comme<br />
nouvelles associations affiliées les<br />
sections de psychologues de Relance<br />
Relationnelle et de la Société suisse de<br />
sexologie (SSS) ainsi que systemis.ch.<br />
Parmi les cursus examinés, seul le<br />
cursus de formation postgrade en<br />
psychothérapie basée sur la Daseinanalyse<br />
n’a pas été accepté. Contre<br />
l’avis du Comité, les Délégué(e)s ont<br />
ici suivi la recommandation de la<br />
CFPFC.<br />
Un signe d’ouverture<br />
A partir de 2012, la <strong>FSP</strong> acceptera<br />
pour la première fois en son sein les<br />
personnes au bénéfice d’un master en<br />
psychologie des HES. En corollaire,<br />
les Délégué(e)s ont voté un changement<br />
des statuts. La nouvelle règle<br />
s’applique aussi aux psychologues qui,<br />
à l’issue d’études à distance reconnues<br />
par la Confédération, auraient<br />
obtenu un bachelor puis un master<br />
auprès d’une université suisse.<br />
Stefan Bruderer<br />
Informations et procès-verbal:<br />
www.psychologie.ch > Espace membres<br />
33<br />
ACTU <strong>FSP</strong><br />
AKTUELL: ???<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011 X-X/200X
34<br />
ACTU <strong>FSP</strong><br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011<br />
politique<br />
Pas d’opposition<br />
à la LPsy<br />
Le délai référendaire contre la Loi<br />
sur les professions de la psychologie<br />
a expiré le 7 juillet 2011. Aucun<br />
parti ou organisation ne l’a contestée<br />
et il y a de fortes chances pour<br />
qu’elle entre en vigueur le 1 er janvier<br />
2013.<br />
Informations:<br />
www.bag.admin.ch > Thèmes > Professions<br />
de la santé > Loi sur les professions<br />
de la psychologie.<br />
organes de la <strong>FSP</strong><br />
Nouvel organe<br />
de conciliation<br />
Le nouvel organe de conciliation<br />
annoncé dans le cadre de la juridiction<br />
associative de la <strong>FSP</strong> a pris<br />
forme. C’est donc à partir du 1 er octobre<br />
2011 que cet organe entrera<br />
en fonction afin de tenter d’arbitrer<br />
les conflits suivants:<br />
1. entre les organes ou les<br />
membres de l’Association;<br />
2. entre des tiers et des membres<br />
de l’Association;<br />
3. entre des associations affiliées<br />
à la <strong>FSP</strong>.<br />
L’organe de conciliation de la <strong>FSP</strong><br />
offre également, même en cas de<br />
plaintes et de recours auprès de la<br />
Commission de recours de la <strong>FSP</strong>,<br />
de procéder à une tentative de<br />
conciliation. Cet été, le Comité a<br />
nommé comme conciliateurs et<br />
conciliatrices les membres suivants<br />
de la <strong>FSP</strong>: Lisbeth Hurni, Berne;<br />
Julien Perriard, Pully; Samuel<br />
Rom, Rheinfelden; Ingrid Vernez,<br />
Ecublens; Eva Zimmermann, Avry.<br />
Vous trouverez d’autres détails sur<br />
le fonctionnement du nouvel organe<br />
de conciliation de la <strong>FSP</strong> dans<br />
le Règlement sur la page Internet<br />
de la <strong>FSP</strong> ainsi que dans le prochain<br />
Psychoscope.<br />
Informations et contacts:<br />
www.psychologie.ch > Espace membres<br />
> Documentation.<br />
organe-de-conciliation@fsp.psychologie.ch<br />
éthique professionnelle<br />
Code de<br />
déontologie <strong>FSP</strong><br />
L’AD du 25 juin a adopté le nouveau<br />
Code déontologique (CD). La<br />
<strong>FSP</strong> dispose désormais en matière<br />
de déontologie de lignes directrices<br />
aussi modernes que pratiques, et<br />
nous pouvons en être fiers. Le CD<br />
a force de loi pour les membres; il<br />
entrera en vigueur le 1 er octobre.<br />
Vous le trouverez en annexe du présent<br />
numéro de Psychoscope ainsi<br />
que sur le site Internet de la <strong>FSP</strong>.<br />
www.psychologie.ch > La <strong>FSP</strong> > Code<br />
déontologique.<br />
commission<br />
Nouveaux titres<br />
Lors de sa séance du 2.7.11, la<br />
CTSC a délivré les titres suivants:<br />
PSYCHOLOGIE DU COACHING<br />
Gschwind, Michael F. (7.05.2011)<br />
Niederhauser, Ursula<br />
PSYCHOLOGIE DE L’ENFANCE<br />
ET DE L’ADOLESCENCE<br />
Bach Gyalog, Sylvia<br />
Bernardoni, Simone<br />
Bucher, Lukas<br />
Bürgi, Susanne<br />
NEUROPSYCHOLOGIE<br />
Rodel, Renate<br />
PSYCHOTHERAPIE<br />
Bernasconi, Alex<br />
Biermann, Philipp<br />
Chevalier, Mohana<br />
Conne, Philippe<br />
Cuennet, Marie-France<br />
de Weck-Yomha, Mariel<br />
Délèze, Mireille (7.05.2011)<br />
Eidenbenz Hermanns, Rahel<br />
Elghezouani, Abdelhak<br />
Gedeon-Chappuis, Marie-Christine<br />
Giuliani, Fabienne<br />
Gloor, Fabienne (7.05.2011)<br />
Gmelch, Simone<br />
Graber, Karin<br />
Gravvani, Despina<br />
Hofmann Kaufmann, Sabine<br />
Höller, Josy<br />
Jost Marx, Marion<br />
Kuper-Yamanaka, Misa<br />
Meier, Cornelia<br />
Miszak, Teresa<br />
Pallas, Elena<br />
Pfefferlé, Martine<br />
Pfeifer-Burri, Silvia<br />
Rechlin, Claudia<br />
Russo, Claire<br />
Schmid, Cécile<br />
Toffanin, Paola<br />
Torsello, Isabella<br />
Weissen-Schelling, Simone<br />
Wullschleger-Zangerl, Monika<br />
PSYCHOLOGIE DE LA<br />
CIRCULATION<br />
Beck, Hermann<br />
Grand, Sian<br />
Raithel, Jürgen<br />
Nos sincères félicitations aux<br />
nouveaux titulaires !<br />
Changement<br />
de pratique<br />
Dans le cadre d’une demande de<br />
titre de spécialisation en psychothérapie,<br />
nous demandons au minimum<br />
200 heures d’expérience personnelle<br />
psychothérapeutique.<br />
Dès maintenant il faut effectuer<br />
au minimum 100 heures pendant<br />
la formation postgrade, le reste<br />
des heures pouvant être effectuées<br />
avant ou pendant les études. Vu<br />
qu’il s’agit d’un allègement des exigences,<br />
ce critère entre en vigueur<br />
avec sa publication et est valable<br />
pour tous les candidats.<br />
La liste des changements de pratique,<br />
qui est accessible sur Internet,<br />
est complétée en conséquence.<br />
Informations: www.psychologie.ch ><br />
Titre de spécialisation.
Human Resources Diagnostik<br />
MSCEIT TM<br />
Mayer-Salovey-Caruso Test zur Emotionalen Intelligenz<br />
Deutschsprachige Adaptation des Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT)<br />
von John D. Mayer, Peter Salovey & David R. Caruso<br />
von Ricarda Steinmayr, Astrid Schütz, Janine Hertel & Michela Schröder-Abé<br />
MSCEIT, der weltweit am häufi gsten eingesetzte, ökonomische Leistungstest zur Erfassung<br />
von Emotionaler Intelligenz, liegt nun auch in der deutschen Version vor.<br />
Emotionale Intelligenz beschreibt die Fähigkeit, Emotionen in soziale und analytische Problemlöseprozesse<br />
zielführend einzubeziehen. Unsere emotionalen Fähigkeiten beeinfl ussen<br />
maßgeblich, wie wir mit uns selbst und anderen umgehen; sie entscheiden so auch mit<br />
über unsere privaten und berufl ichen Erfolge. MSCEIT eignet sich für den fl exiblen Einsatz<br />
in allen Kontexten, in denen menschliche Interaktion eine Rolle spielt, wie z. B. bei Führung<br />
von Mitarbeitern, Teamentwicklung, Gewinnung von und Umgang mit Kunden.<br />
Mit acht Subtests erfasst MSCEIT die folgenden Bereiche: Gesamtwert Emotionale Intelligenz,<br />
Erfahrungsbasierte Emotionale Intelligenz, Strategische Emotionale Intelligenz, Emotionswahrnehmung,<br />
Emotionsnutzung, Emotionswissen und Emotionsregulation.<br />
Test komplett, bestehend aus:<br />
Manual, 10 Fragenhefte, Auswerteprogramm inkl. 10 Auswertungen und Box<br />
Bestellnummer 03 159 01, € 550.00/CHF 744.00<br />
LJI Leadership Judgement Indicator<br />
Deutschsprachige Adaptation des Leadership Judgement Indicator (LJI)<br />
von Michael Lock, Robert Wheeler, Nick Burnard & Colin Cooper<br />
von Aljoscha C. Neubauer, Sabine Bergner & Jörg Felfe<br />
Führungskräfte sind häufi g mit komplexen Situationen konfrontiert, in denen sie schnell angemessene<br />
Entscheidungen treffen müssen. Dabei sind sie nicht nur gefordert, sachlich richtig<br />
zu urteilen, sondern auch gleichzeitig kompetent und geschickt mit Mitarbeitern bzw.<br />
dem gesamten Team umzugehen. Der LJI ermöglicht es, die bevorzugten Entscheidungsstile<br />
und die Urteilsfähigkeit einer Führungskraft und damit auch die Angemessenheit und die<br />
Güte der Entscheidungen in einer Vielzahl von Führungssituationen zu erfassen.<br />
Der LJI basiert auf 16 erprobten und getesteten Szenarien aus dem Führungskontext,<br />
in denen Entscheidungen zu treffen sind. Für jedes Szenario werden vier Handlungsalternativen<br />
angeboten, wie mit der Situation umzugehen ist. Die Führungskraft bewertet<br />
die Angemessenheit jeder einzelnen Alternative und vermittelt dadurch Informationen<br />
über den von ihr präferierten Führungstil: direktiv, konsultativ, konsensual/<br />
einvernehmlich oder delegativ.<br />
Der LJI ist damit ein wichtiges Instrument für alle, die sich professionell mit dem Thema<br />
Führungskräfteauswahl und -entwicklung beschäftigen.<br />
Bestellnummer 03 158 01<br />
Zu beziehen bei Ihrer Testzentrale:<br />
Herbert-Quandt-Straße 4 · D-37081 Göttingen · Tel.: 0049-(0)551 50688-999 · Fax: -998<br />
E-Mail: testzentrale@hogrefe.de · www.testzentrale.de<br />
Länggass-Strasse 76 · CH-3000 Bern 9 · Tel.: 0041-(0)31 30045-45 · Fax: -90<br />
E-Mail: testzentrale@hogrefe.ch · www.testzentrale.ch<br />
NEU<br />
MSCEIT ist ein eingetragenes Warenzeichen von MHS Inc.<br />
VORANKÜNDIGUNG
36<br />
PANORAMA<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011<br />
<strong>FSP</strong>-AutorInnen<br />
Die Funktion<br />
des Dritten<br />
In seinem neu erschienenen Werk<br />
«Architektur des psychischen Raumes»<br />
illustriert der Psychoanalyti-<br />
ker Jürgen Grieser «die Funktion<br />
des Dritten» in der beraterischen<br />
und therapeutischen Praxis.<br />
Anhand zahlreicher Beispiele wird<br />
aufgezeigt, wie die triadische Perspektive<br />
Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten<br />
erweitert.<br />
Grieser, J. (2011). Architektur des psy-<br />
chischen Raumes. Die Funktion des<br />
Dritten. Giessen: Psychosozial-Verlag.<br />
394 Seiten, ca. CHF 40.–<br />
ISBN-13: 9783837920703.<br />
Veranstaltungen<br />
SGPP-Kongress:<br />
Stimmenvielfalt<br />
Der diesjährige Jahreskongress der<br />
Schweizerischen Gesellschaft für<br />
Psychiatrie und Psychotherapie<br />
SGGP steht unter dem Motto<br />
«Stimmenvielfalt».<br />
Der Anlass findet am 14.–16. September<br />
in Interlaken statt und bietet<br />
ein attraktives und inhaltlich<br />
top-aktuelles Rahmenprogramm.<br />
Interessierte <strong>FSP</strong>-Mitglieder können<br />
sich zum vergünstigten Mitgliedertarif<br />
anmelden.<br />
Informationen:<br />
www.psychiatrie-kongress.ch<br />
Drei Fragen an …<br />
Timur Steffen Maurer*, Psychologe <strong>FSP</strong><br />
Im September 2011 ging es an<br />
einem Medienworkshop** um<br />
die Rolle der Medien bei der Suizidprävention.<br />
Gibt es dazu neue<br />
Erkenntnisse?<br />
Suizide können durch unsorgfäl-<br />
tige Berichterstattung der Medien<br />
ausgelöst werden. Diese Nachah-<br />
mungs-Suizide werden nach Goe-<br />
thes «Werther» als Werther-Effekt<br />
bezeichnet.<br />
Neu gibt es nun auch empirische<br />
Daten darüber, wie Berichte über<br />
bewältigte suizidale Krisen weitere<br />
Suizide verhindern können. Dieser<br />
positive Effekt wird Papageno-<br />
Effekt genannt, nach der Figur des<br />
suizidalen Papageno aus Mozarts<br />
«Zauberflöte», der von drei Knaben<br />
an die Einmaligkeit des Lebens<br />
und dessen Chancen erinnert wird.<br />
Durch den Fokus auf die Bewältigungsmöglichkeiten<br />
lässt Papageno<br />
von seinen suizidalen Plänen ab.<br />
Falls Medien berichten wollen<br />
oder müssen, sollen sie den Fokus<br />
deshalb auf den Papageno-Effekt<br />
ausrichten.<br />
Die «Empfehlungen zur Medien-<br />
berichterstattung über Suizid» des<br />
Berner Bündnisses gegen Depression<br />
enthalten gute, empirisch<br />
belegte Tipps hierzu.<br />
Wann ist Medienberichterstattung<br />
zum Thema Suizid am gefährlichsten?<br />
Allgemein gilt: Je grösser die Aufmachung<br />
eines Berichtes über Suizid<br />
und je emotionaler der Inhalt,<br />
desto häufiger kommt es zu Nach-<br />
ahmungen: vor allem bei Titelge-<br />
schichten mit Schlagzeilen und Fo-<br />
Panorama<br />
psychoscope 8-9/2011<br />
tos. Die Nachahmungsgefahr<br />
steigt mit der Identifikation der<br />
Lesenden mit dem Betroffenen,<br />
der Glorifizierung der Tat, der<br />
Aufmerksamkeit und der konkreten<br />
Handlungsanleitung. Entscheidend<br />
ist also neben der Frage,<br />
ob berichtet wird, vor allem<br />
auch die Frage, wie berichtet wird.<br />
Wie können insbesondere Psychologinnen<br />
und Psychologen<br />
zur Suizidprävention beitragen?<br />
Gegenüber Fachleuten und Teammitgliedern<br />
sollten Aufklärung<br />
und Information im Vordergrund<br />
stehen.<br />
Gegenüber Patientinnen und Patienten<br />
sollte neben der bewussten<br />
Wertschätzung alternativer Lösungen<br />
und dem Angebot von Beziehung<br />
und Hilfe ein direktes, aber<br />
behutsames Ansprechen von Sui-<br />
zidplänen alltäglich werden.<br />
*Lic. phil. Timur Steffen Maurer arbeitet<br />
bei den Universitären Psychiatrischen<br />
Diensten Bern (UPD), ist Mitglied im<br />
Care Team des Kantons Bern und Vorstandsmitglied<br />
im Berner Bündnis gegen<br />
Depression BBgD.<br />
**Der Medienworkshop «Berichterstattung<br />
zu Suizid und Suizidalität» vom 1.<br />
September 2011 wurde von der Fachgruppe<br />
Suizidprävention Kanton Bern organisiert.<br />
Zu ihr gehört auch das Berner<br />
Bündnis gegen Depression.<br />
Informationen:<br />
www.berner-buendnis-depression.ch<br />
www.bernergesundheit.ch
37<br />
PANORAMA<br />
PSYCHOSCOPE X-X/200X<br />
congrès<br />
Multiplicité<br />
des voix<br />
Le Congrès annuel 2011 de la Société<br />
Suisse de Psychiatrie et Psychothérapie<br />
sera placé sous le<br />
thème de la multiplicité des voix.<br />
Il se déroulera du 14 au 16 septembre<br />
2011 à Interlaken et offrira<br />
un programme attractif et des<br />
contenus en prise sur l’actualité.<br />
Les membres de la <strong>FSP</strong> qui sont<br />
intéressés à s’inscrire bénéficient<br />
d’un tarif avantageux.<br />
Informations:<br />
www.psychiatrie-kongress.ch<br />
livre<br />
Croire avec<br />
Freud ?<br />
Emmanuel Schwab, docteur en<br />
psychologie et licencié en théologie,<br />
propose dans ce livre* une manière<br />
originale de rencontrer Freud. En<br />
effet, Freud est souvent considéré<br />
comme un contempteur de la religion,<br />
au même titre que Nietzsche<br />
et Marx. Mais la réalité est plus<br />
complexe, car Freud reste travaillé<br />
par le religieux et marqué par une<br />
crise radicale à la suite de la mort<br />
de son père.<br />
L’approche d’Emmanuel Schwab<br />
met en question la domination du<br />
«soupçon» moderne et défend l’idée<br />
que tout n’est pas joué d’avance.<br />
* Emmanuel Schwab. Croire avec<br />
Freud ? Quête de l’origine et identité.<br />
Psychologie et spiritualité.<br />
Trois questions à …<br />
Timur Steffen Maurer*, psychologue <strong>FSP</strong><br />
En septembre 2011 s’est tenu un<br />
workshop** sur le rôle des médias<br />
dans la prévention du suicide.<br />
Y a-t-il sur ce sujet de nouvelles<br />
connaissances ?<br />
Le suicide peut être déclenché par des<br />
émissions ou des articles peu scrupuleux<br />
des médias. Ce type de suicide<br />
par mimétisme est appelé «effet Werther»<br />
d’après l’œuvre de Gœthe.<br />
Récemment des données empiriques<br />
ont aussi montré que des articles ou<br />
des émissions sur des crises suicidaires<br />
surmontées peuvent empêcher<br />
d’autres suicides. Cet effet positif est<br />
nommé «effet Papageno», d’après le<br />
personnage suicidaire de la Flûte enchantée<br />
de Mozart, auquel trois garçons<br />
viennent rappeler combien la vie<br />
et ses charmes sont uniques. En mettant<br />
l’accent sur les possibilités de s’en<br />
sortir, ils parviennent à dissuader Papageno<br />
de mettre en œuvre ses projets<br />
de suicide.<br />
Si le but ou le devoir des médias est<br />
d’informer, c’est une bonne raison<br />
pour insister sur l’effet Papageno. Les<br />
«recommandations aux médias sur<br />
le suicide» de l’Alliance Bernoise contre<br />
la Dépression contiennent sur ce point<br />
d’excellents tuyaux, éprouvés empiriquement.<br />
Quand les articles de presse sur<br />
le thème du suicide sont-ils le plus<br />
dangereux ?<br />
En général, plus un article sur le suicide<br />
prend de place et plus son contenu<br />
est émotionnel, plus il favorise le<br />
mimétisme, surtout lorsque l’article<br />
est à la une avec gros titres et photos.<br />
Le risque de mimétisme s’accroît avec<br />
l’identification du lecteur avec la per-<br />
Panorama<br />
psychoscope 8-9/2011<br />
sonne concernée, avec la glorification<br />
de l’acte, avec l’attention portée à<br />
la manière d’agir et son évocation détaillée.<br />
Ce qui est important en la matière,<br />
ce n’est pas tellement de se demander<br />
si on va relater un fait, mais<br />
plutôt de s’interroger sur la manière<br />
dont on va le relater.<br />
Quelle peut être la contribution<br />
des psychologues à la prévention du<br />
suicide ?<br />
Vis-à-vis des spécialistes et des<br />
équipes d’intervention, l’essentiel est<br />
d’expliquer les choses et d’informer. A<br />
l’égard des patient(e)s, à côté de la réflexion<br />
sur la recherche de solutions<br />
alternatives et de l’offre de dialogue<br />
et d’assistance, le fait de parler directement<br />
– mais avec précaution – des<br />
projets de suicide a fait ses preuves.<br />
*Timur Steffen Maurer, lic. phil., qui<br />
travaille auprès des Services universitaires<br />
psychiatriques de Berne (UPD),<br />
est membre du Care Team du canton de<br />
Berne et membre du comité de l’Alliance<br />
Bernoise contre la Dépression (ABcD).<br />
**L’atelier «Médias, suicide et suicidalité»<br />
du 1 er septembre 2011 a été organisé par<br />
le Groupe de prévention du suicide du<br />
canton de Berne, auquel appartient aussi<br />
l’Alliance Bernoise contre la Dépression.<br />
Informations:<br />
www.berner-buendnis-depression.ch<br />
www.bernergesundheit.ch<br />
37<br />
PANORAMA<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011
38<br />
PANORAMA<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011 X-X/200X<br />
Portr Porträt orträt<br />
Ruth Enzler Denzler ist als selbständige Unternehmensberaterin<br />
auf Burnoutprävention spezialisiert. Geprägt<br />
haben sie u.a. die Jahre bei einer Schweizer Grossbank.<br />
«Als Moralapostel anderen die rote<br />
Karte zu zeigen liegt mir nicht.»<br />
Wenn es Ruth Enzler Denzler als<br />
Unternehmensberaterin und Coach<br />
mit schwierigen Situationen zu tun<br />
hat, wie z.B. intransparenten Zielsetzungen<br />
(hidden agendas), sieht sie<br />
dies eher als Herausforderung denn<br />
als Hinderungsgrund.<br />
Das Nützlichste erreichen<br />
So ist ihr unlängst gelungen, den<br />
Ausstieg einer jungen High-Potential-<br />
Angestellten in einem Beratungsunternehmen<br />
befriedigend zu lösen, obwohl<br />
der offizielle Auftrag der Chefin<br />
gegenüber der Betroffenen «Burnout-<br />
Rehabilitation» gelautet hat. Enzler<br />
stellt in den Vorgesprächen mit der<br />
Auftraggeberin fest, dass ein Wiedereinstieg<br />
in Wirklichkeit gar nicht geplant<br />
war – was indes gegenüber der<br />
Klientin nie klar kommuniziert worden<br />
war. Es gelang dann einerseits,<br />
Transparenz zu schaffen, und andererseits,<br />
durch das Aushandeln eines<br />
angemessenen Ausstiegs mit sechs<br />
Monaten Outplacement-Coaching<br />
für die Klientin einen gesichtswahrenden<br />
Stellenwechsel zu erreichen.<br />
Das Fazit der Beraterin hinsichtlich<br />
ethischer Fragen in ihrem Berufsfeld:<br />
Wäre dieser Auftrag aus ethischen<br />
Gründen von Vornherein abgelehnt<br />
worden, hätte jemand anders eventuell<br />
eine schlechtere Lösung erarbeitet.<br />
«Ich versuche, unter den gegebenen<br />
Voraussetzungen das Nützlichste<br />
so zu erreichen, dass ich mich am<br />
Morgen noch im Spiegel anschauen<br />
kann.»<br />
Weltliches statt göttliches Recht<br />
Als Selbständige (www.psylance.ch)<br />
arbeitet Ruth Enzler Denzler seit dem<br />
Jahr 2006, nach einem Zweitstudium<br />
in Psychologie. Zuerst hat die heute<br />
45-Jährige indes in Zürich Jura studiert:<br />
In die Auslegeordnung der eher<br />
zufällig in die Altgriechisch-Klasse<br />
geratenen Mittelschülerin schaffen<br />
es ursprünglich die drei potenziellen<br />
Studienfächer Theologie, Psychologie<br />
und die Rechtswissenschaften.<br />
Für Psychologie fühlt sich Ruth Enzler<br />
damals noch zu unreif und mit<br />
der Barfuss-Askese der Theologiestudierenden<br />
kann sie nichts anfangen.<br />
So wendet sie sich schliesslich dem<br />
weltlichen Recht zu. «Da musste ich<br />
dann zum ersten Mal nicht viel arbeiten,<br />
weil mir die strukturierte Denkweise<br />
entgegenkam.»<br />
Frühe Budgethoheit<br />
Als anspruchsvoller erweist sich die<br />
Frage, was mit dem Jura-Studium angefangen<br />
werden soll. Während ihres<br />
Anwaltspraktikums stellt Ruth Enzler<br />
Denzler fest, dass ihr die Rolle eines<br />
«gegen Entgelt gemieteten Gewissens»<br />
nicht entspricht. Am liebsten<br />
wäre sie Richterin geworden, um<br />
anhand von Argumenten zwischen<br />
Positionen abwägen zu können. Doch<br />
gibt es in der Schweiz keine eigentliche<br />
Richterlaufbahn und es hätte<br />
viel Glück und die richtige politische<br />
Parteizugehörigkeit gebraucht, um<br />
dieses Ziel zu verwirklichen. Auch<br />
war der Anwalt als Mediator damals<br />
noch kaum bekannt.<br />
Durch eine Initiativbewerbung im<br />
richtigen Moment steigt Enzler 1991<br />
in die wirtschaftspolitische Kommunikation<br />
der Gesellschaft zur<br />
Förderung der Schweizer Wirtschaft<br />
(heute: Economiesuisse) ein. Sie<br />
leitet die 20 Schweizer Stützpunkte<br />
und verfügt für Abstimmungskampagnen<br />
über ein Budget von mehreren<br />
Millionen Franken.<br />
Foto: © Reto Oeschger / Tages-Anzeiger
«Nie mehr einen Chef!»<br />
Die sehr kommunikative Arbeit und<br />
die Möglichkeit, an vorderster Front<br />
dazu beizutragen, wie Gesetze entste-<br />
hen, faszinieren die Berufseinsteigerin.<br />
Nach dem Abgang ihres ersten Chefs<br />
kommt es indes zu zwischenmenschlichen<br />
Turbulenzen: Als ihr schliesslich<br />
ihre Post nicht mehr ausgehändigt<br />
wird, wechselt Enzler notfallmässig<br />
zu einer PR-Agentur. Kurz darauf<br />
fallen deren wirtschaftliche Probleme<br />
mit der privaten Scheidungskrise<br />
zusammen und Ruth Enzler beugt<br />
sich der Notwendigkeit, sich beruflich<br />
und finanziell zu konsolidieren.<br />
Selber in einer Bänkler-Familie aufgewachsen,<br />
geht sie 1994 zur UBS.<br />
Erfolg durch Transparenz<br />
Nach einer Einführungsphase für<br />
HochschulabsolventInnen steigt Enzler<br />
als Handlungsbevollmächtigte ins<br />
Firmenkundengeschäft ein, entscheidet<br />
über Kreditvergaben und wirkt an<br />
Sanierungen und Restrukturierungen<br />
mit. Dass sie dabei häufig konstruktive<br />
Lösungen herbeiführt, erklärt<br />
sie mit ihrem Prinzip, die Karten<br />
offen auf den Tisch zu legen. Rote Bilanzen<br />
nennt sie rot und selbst heikle<br />
Rollenkonflikte spricht sie offen an:<br />
«Dass Sie Mühe haben, jetzt von einer<br />
Prokuristin und nicht mehr vom<br />
Direktor betreut zu werden, kann ich<br />
verstehen. Aber wenn wir am gleichen<br />
Strick ziehen, machen wir das<br />
Beste aus der Situation.»<br />
Eine Fusion mit Folgen<br />
1998 führt die Fusion der UBS mit<br />
dem Schweizerischen Bankverein zu<br />
einem heftigen Kulturwandel: Enzlers<br />
Abteilung wird vom idyllischen<br />
Zürcher Seefeld in ein noch unfertiges<br />
Industriegebäude in Oerlikon<br />
versetzt, Firmenkredite werden härter<br />
gehandhabt, grosszügige Lohnerhöhungen<br />
und Boni sollen die Fügsamkeit<br />
der Mitarbeitenden gewährleisten.<br />
Enzler aber stösst sich u.a. am Um-<br />
gang mit den über 50-Jährigen, die<br />
zum Stellenwechsel bzw. in die Früh-<br />
pensionierung gedrängt werden. Als<br />
ihr selber der erste Anlauf in die Direktion<br />
zugunsten weniger kompetenter<br />
Familienväter verweigert wird,<br />
kommt sie zum Schluss: «Nie mehr<br />
einen Chef!»<br />
Spezialität Burnoutprävention<br />
In der Laufbahnberatung wird der<br />
mittlerweile erfolgreich zur Direktorin<br />
aufgestiegenen Ruth Enzler zu einem<br />
Zweitstudium in Psychologie geraten.<br />
Nach dem ersten Schock über<br />
den bevorstehenden Kraftakt heiratet<br />
sie ihren Partner, reduziert ihr Pensum<br />
auf 30 Prozent und nimmt Degradierung<br />
und Statusverlust in Kauf.<br />
Neben Psychopathologie und Geron-<br />
topsychologie vertieft sich Enzler<br />
Denzler an der Universität Zürich ins<br />
Thema Burnoutprävention. Als sie<br />
das neue Fachwissen auf ihr früheres<br />
Arbeitsfeld anwendet, lautet ihr Fazit:<br />
«Innovative Erkenntnis- und soziale<br />
Typen haben es in grossen Systemen,<br />
insbesondere in Finanzkonzernen<br />
schwer und sollten deshalb gut auf<br />
ihre Gesundheit achten.»<br />
Es hat sich gelohnt<br />
Aus Enzlers Dissertation entsteht die<br />
viel beachtete Publikation «Karriere<br />
statt Burnout». Darin unterscheidet<br />
die Autorin zwischen macht-, er-<br />
kenntnis- und sozial orientierten<br />
Führungspersönlichkeiten und entwickelt<br />
für diese je spezifische Stress-<br />
bewältigungsstrategien. Um Burnoutprävention<br />
geht es auch in Enzler<br />
Denzlers 2011 erschienenem Buch<br />
«Keine Angst vor Montag Morgen».<br />
Als Erkenntnistyp hat Ruth Enzler<br />
Denzler in der beruflichen Selbständigkeit<br />
ihr ideales berufliches Umfeld<br />
gefunden. Ihr Weg habe sich zudem<br />
gelohnt, weil sie heute von aussen<br />
deutlich mehr bewegen könne als<br />
früher intern: «So lange in Führungspositionen<br />
Persönlichkeiten sind, die<br />
ihren Lebenssinn aus Wettbewerb,<br />
Macht und Gewinn schöpfen, wird<br />
sich an der heutigen Gierkultur kaum<br />
etwas verändern.»<br />
Susanne Birrer<br />
Résumé<br />
Ruth Enzler Denzler naît en 1966<br />
dans une famille de banquiers zurichois.<br />
Après une maturité en grec,<br />
elle se décide pour des études de<br />
droit après avoir penché pour la<br />
théologie et la psychologie. Elle les<br />
achève sans la moindre difficulté,<br />
avant de réaliser qu’elle n’aimerait<br />
pas être avocate.<br />
Des talents de communicatrice<br />
Son premier emploi auprès de la<br />
Société pour le développement de<br />
l’économie suisse (aujourd’hui Economiesuisse)<br />
lui permet de participer<br />
à des campagnes politiques<br />
et à la promotion d’une initiative.<br />
A l’époque déjà, elle dispose d’un<br />
budget confortable et découvre<br />
ses talents de communicatrice.<br />
Après avoir vécu une crise sur les<br />
plans professionnel et privé, Ruth<br />
Enzler se cherche un domaine<br />
d’activité plus sûr et se lance à<br />
l’UBS dans le département des<br />
crédits pour entreprises. C’est là<br />
qu’elle développe son goût de la<br />
transparence en matière de communication,<br />
notamment quand<br />
il s’agit de trouver des solutions<br />
constructives pour assainir les finances<br />
d’une entreprise.<br />
Reprendre les études<br />
En 1998, à la suite de la fusion<br />
de la SBS et de l’UBS, son travail<br />
prend une nouvelle direction, avec<br />
laquelle elle peine à s’identifier. Un<br />
cabinet de conseil de carrière lui<br />
recommande d’entreprendre des<br />
études de psychologie. Son travail<br />
de thèse aboutit à la publication<br />
d’un ouvrage qui reçoit un accueil<br />
très favorable, «Karriere statt Burnout»<br />
– Carrière ou burnout ?, dans<br />
lequel elle décrit trois types de personnalités<br />
largement répandues<br />
dans les milieux économiques et<br />
pour lesquelles elle développe des<br />
stratégies distinctes de gestion du<br />
stress. En 2011 paraît «Keine Angst<br />
vor Montagmorgen» – Vaincre la<br />
peur du lundi matin.<br />
Le jeu en valait la chandelle<br />
En 2006, Ruth Enzler Denzler devient<br />
indépendante et ouvre son<br />
cabinet de conseil d’entreprise et<br />
de coaching (www.psylance.ch). Ne<br />
serait-ce que parce que cette fonction<br />
la fait bouger davantage, elle<br />
se sent aujourd’hui partout à l’aise<br />
et heureuse de l’être.<br />
39<br />
PANORAMA<br />
PSYCHOSCOPE 8-9/2011 X-X/200X
40<br />
AGENDA I PSYCHOSCOPE 8-9/2011<br />
agenda<br />
September/septembre 2011<br />
Auf den Punkt kommen … Therapeutisches<br />
Reden und Hören als Prozesssteuerung<br />
Datum: 14.09.11<br />
Ort: Bern<br />
Leitung: lic. phil. Martin Rufer<br />
Informationen: info@zsb-bern.ch, www.zsb-bern.ch<br />
Self-coaching durch Mentaltraining und Sport<br />
in der systemischen Praxis<br />
Datum: 16.09.11<br />
Ort: Bern<br />
Leitung: dipl. Soz. Markus Grindat<br />
Informationen: info@zsb-bern.ch, www.zsb-bern.ch<br />
Das Höhlenhaus der Träume. Theorie zur psychoanalytischen<br />
Rezeption von Filmen<br />
Datum: 16.09.11, 20.30 Uhr<br />
Ort: Freud-Institut Zürich, Zollikerstr. 144, 8008 Zürich<br />
Referentin: Mechthild Zeul, Dipl. Psych. (Madrid und<br />
Frankfurt/M.)<br />
Informationen: www.freud-institut.ch<br />
Eintritt: Fr. 30.–/Studierende Fr. 10.–<br />
Weiterbildung Schematherapie 2011 Workshop<br />
«Schematherapie der Borderline-Störung»<br />
Datum: 16.09./17.09.2011<br />
Ort: Clienia Littenheid<br />
Leitung: Neele Reiss, Friederike Vogel<br />
Anmeldung: Institut für Schematherapie Ostschweiz<br />
auf www.istos.ch<br />
Infoabend Jahrestraining «Intuitive Präsenz»<br />
Datum: 16.09.11, 19:00–20:30 Uhr<br />
Ort: IBP Institut, Winterthur<br />
Leitung: Darrel Combs<br />
Anmeldung: www.ibp-institut.ch, Tel. 052 212 34 30<br />
Befriending Conflict Interaktive und erfahrungsorientierte<br />
Einführung in Worldwork nach Arnold<br />
Mindell in drei Modulen: Arbeit an der persönlichen<br />
Erfahrung, Beziehungsund Gruppendynamik<br />
Datum: 17./18.09.2011; 12./13.11.2011; 17./18.03.2012<br />
Ort: Zürich<br />
Informationen: Zentrum Prozessarbeit, Zürich,<br />
Binzstr. 9, 8045 Zürich, www.reinihauser.net<br />
Anmeldung: fg-pop@gmx.ch<br />
Einführungskurs «Intuitive Präsenz»<br />
Datum: 17.09.11, 10:00–18:00 Uhr<br />
Ort: IBP Institut, Winterthur<br />
Leitung: Darrel Combs<br />
Anmeldung: www.ibp-institut.ch, 052 212 34 30<br />
Veranstaltungsagenda der Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen <strong>FSP</strong><br />
Agenda des manifestations de la Fédération Suisse des Psychologues <strong>FSP</strong><br />
Calendario della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi <strong>FSP</strong><br />
MAS Systemische Beratung Der Masterlehrgang<br />
vermittelt Kenntnisse in systemischer, ressourcen-<br />
und lösungsorientierter Beratung und deren<br />
Umsetzung in die Beratungspraxis. Abschluss:<br />
Master of Advanced Studies ZFH.<br />
Beginn: 12. März 2012<br />
Datum: Infoveranstaltungen: 20.09.11, 18.30 Uhr, IAP,<br />
Merkurstrasse 43, Zürich. 04.11.11, 18.30 Uhr,<br />
ZSB, Villettemattstr. 15, Bern<br />
Ort: Zürich (20.09.2011) und Bern (04.11.11)<br />
Leitung: Kursanbieter: ZHAW IAP Institut für<br />
Angewandte Psychologie in Zusammenarbeit mit<br />
dem ZSB Bern<br />
Informationen: Tel. +41 58 934 83 72, veronika.<br />
bochsler@zhaw.ch, www.iap.zhaw.ch/weiterbildung<br />
Ambulante systemische Therapie der Alkoholabhängigkeit<br />
– Mit Fokus auf das Paar- und Familiensetting<br />
und den Ambulanten Alkoholentzug<br />
Datum: 21.09.11 (Wiederholung)<br />
Ort: Bern<br />
Leitung: Dr. med. Oliver Grehl<br />
Informationen: info@zsb-bern.ch, www.zsb-bern.ch<br />
Krank? Störend? Auffällig? – Verhaltensstörungen<br />
von Kindern und Jugendlichen erkennen<br />
Leitung: Dr. med. Wilhelm Rotthaus<br />
Datum: 21./22.09.2011<br />
Infos: Institut für Ökologisch-systemische Therapie,<br />
Klosbachstr. 123, 8032 Zürch, Tel. 044 252 32 42,<br />
www.psychotherapieausbildung.ch<br />
Dann komm ich halt, sag aber nichts Motivierung<br />
Jugendlicher in Therapie und Beratung<br />
Datum: 22./23.09.11 (Wiederholung 1.5 Tage)<br />
Ort: Bern<br />
Leitung: Dr. med. Jürg Liechti<br />
Informationen: info@zsb-bern.ch, www.zsb-bern.ch<br />
Congrès francophone de thérapie de couple<br />
Imago: Le cerveau relationnel<br />
Date: Vendredi 23.09.11<br />
Localité: Site de Cery, Prilly/Lausanne<br />
Informations: www.imago-therapie.com<br />
Inscription: info@imago-therapie.com<br />
Selbsterfahrungskurs: Auch gut für sich selbst<br />
sorgen, Wohlbefindens-Regulation und Selbstfürsorge<br />
für Therapeutinnen und Therapeuten<br />
Daten: 30.09.2011<br />
Leitung: Dr. Renate Frank<br />
Information: www.sgvt-sstcc.ch<br />
Weiterbildung Schematherapie 201.Workshop<br />
«Schematherapeutische Fallkonzeptualisierung»<br />
Datum: 29./30.09.2011<br />
Ort: Clienia Littenheid<br />
Leitung: Michael Sturm<br />
Anmeldung: Institut für Schematherapie Ostschweiz auf<br />
www.istos.ch<br />
Oktober/octobre 2011<br />
Basisausbildung in Prozessarbeit nach Arnold<br />
Mindell<br />
Datum: Oktober 2011 – Juni 2013<br />
Ort: Zentrum für Prozessarbeit, Binzstr. 9,<br />
8045 Zürich<br />
Informationen: Tel. 044 451 20 70,<br />
email fg-pop@gmx.ch, www.prozessarbeit.ch<br />
9. Schweizer Fachtagung Psycho-Onkologie<br />
der Schweizerischen Gesellschaft für Psycho-<br />
Onkologie, SGPO<br />
Datum: 07.10.2011<br />
Ort: CHUV Lausanne<br />
Informationen: kontakt@psycho-onkologie,<br />
www.psycho-onkologie.ch<br />
Kognitive und verhaltenstherapeutische Ansätze,<br />
Verfahren und Interventionen in der Behandlung<br />
chronifizierter Traumafolgestörungen<br />
Datum: 07./08.10.2011<br />
Ort: Schaffhausen<br />
Leitung: Dr. phil. Doris Denis<br />
Informationen: Psychotherapeutisches Institut im Park,<br />
Steigstr. 26, 8200 Schaffhausen, Tel.: 052 624 97 82,<br />
info@iip.ch, www.iip.ch<br />
Weiterbildung Schematherapie 2011 Workshop<br />
«Group Schema Therapy»<br />
Datum: 07./08.10.11<br />
Ort: Clienia Littenheid<br />
Leitung: Joan Farrell, Ida Shaw (Indianapolis), Neele<br />
Reiss (Mainz)<br />
Anmeldung: Institut für Schematherapie Ostschweiz<br />
auf www.istos.ch<br />
Fachtagung «Babys besser verstehen lernen»<br />
Wege und Nutzen der Prävention und Intervention<br />
im frühen Kindesalter. Die interdisziplinäre<br />
Tagung gibt einen breiten Überblick zum aktuellen<br />
Stand der Bindungsforschung und deren Nutzen<br />
in der Praxis.<br />
Datum: 07.10.2011, 09.40–17.15 Uhr.<br />
Ort: Universität Fribourg: Pérolles 2, Saal Joseph Deiss.<br />
Referate von: Dipl.-Psych. Marisa Benz, Dr. Jörg Bock,<br />
Dr. Margarete Bolten, Dr. med. René Glanzmann,<br />
Dr. Karin Grossmann, Dr. Yves Hänggi, lic. iur. Gisela Kilde,<br />
Prof. Dr. Manfred Laucht, Prof. Dr. Alexandra Rumo-<br />
Jungo.<br />
Veranstalter: Institut für Familienforschung und -beratung,<br />
Universität Fribourg.<br />
Information und Anmeldung: www.unifr.ch/iff<br />
9. Schweizer Fachtagung Psycho-Onkologie der<br />
Schweizerischen Gesellschaft für Psycho-Onkologie,<br />
SGPO<br />
Datum: 07.10.2011<br />
Ort: CHUV Lausanne<br />
Info: kontakt@psycho-onkologie.ch,<br />
www.psycho-onkologie.ch
agenda<br />
Séminaire en psychiatrie transculturelle,<br />
ethnopsychiatrie et clinique psychosociale<br />
Date: du 11.10.11 au 08.05.12, 12h15–13h45<br />
Localité: Appartenances, Terreaux 10, Lausanne<br />
Informations: www.appartenances.ch ou<br />
tél. 021 341 12 50<br />
Inscription: Délai d’inscription: 18 septembre 2011<br />
Weiterbildung Schematherapie 2011 Gruppen-<br />
supervisionsworkshop<br />
Datum: 14.10.11<br />
Ort: Clienia Littenheid<br />
Leitung: Christoph Fuhrhans<br />
Anmeldung: Institut für Schematherapie Ostschweiz auf<br />
www.istos.ch<br />
Weiterbildung in Klinischer Gestaltherapie Fortbildung<br />
in Gestalttherapie<br />
Datum: 17.–18.10.11 (Informations- und Auswahlseminar)<br />
Ort: Zürich<br />
Leitung: Anja Jossen und Peter Schulthess<br />
Anmeldung: Institut für Integrative Gestalttherapie,<br />
Theaterstr. 4, D-97070 Würzburg,<br />
Tel 0049-(0)931/354450, www.igw-gestalttherapie.de<br />
E-Mail: info@igw-gestalttherapie.de<br />
Information: Peter Schulthess,<br />
E-Mail: igw-zuerich@pschulthess.ch, Gabriela Frischknecht,<br />
E-Mail: frischknecht@bluewin.ch<br />
Weiterbildung in psychoanalytischer Psychotherapie,<br />
Sigmund-Freud-Zentrum Bern 4-jähriger<br />
Kurs. Einstieg möglich auf Beginn des Kursjahres:<br />
Datum: 18.10.11<br />
Ort: Bern<br />
Leitung: Dr. med. Anna Wyler von Ballmoos<br />
Informationen: www.freud-zentrum.ch<br />
Anmeldung: Tel. 0041 31 351 64 65<br />
mail: anna.wyler@freud-zentrum.ch<br />
Auf den Punkt kommen … Therapeutisches<br />
Reden und Hören als Prozesssteuerung.<br />
Mit Dritten im Bunde: Eltern und/oder Kinder<br />
Datum: 19.10.11<br />
Ort: Bern<br />
Leitung: lic. phil. Martin Rufer<br />
Informationen: info@zsb-bern.ch, www.zsb-bern.ch<br />
Postgraduale Weiterbildung in systemischer<br />
Therapie und Beratung Curriculum A/B<br />
Datum: nächster Start 20.10.2011<br />
Ort: Bern<br />
Informationen: info@zsb-bern.ch, www.zsb-bern.ch<br />
Symposium Schlüsselfaktoren in Therapie und<br />
beruflicher Reintergration bei Burnout und Stressfolgeerkrankungen<br />
Datum: 20.10.2011<br />
Ort: Holiday Inn Bern-Westside<br />
Anmeldung: www.burnoutexperts.ch/symposium2011<br />
Angst- und Panikstörungen<br />
Datum: 21.–22.10.2011<br />
Ort: Schloss Greifensee, Greifensee/ZH<br />
Leitung: Dr. med. Thomas Ulz<br />
Informationen: Weiterbildungsinstitut für Phasische<br />
Paar- und Familientherapie, Carmenstrasse 51,<br />
8032 Zürich, ++41(0)44 253 28 60/61 Fax,<br />
info@gammer.ch, www.phasischesystemtherapie.ch<br />
Kognitive Verhaltenstherapie von Posttraumatischen<br />
Belastungsstörungen<br />
Daten: 21./22.10.2011<br />
Leitung: Dr. phil. Julia Müller<br />
Information: www.sgvt-sstcc.ch<br />
Seminarreihe Sex und Liebe:<br />
Erotische Fähigkeiten<br />
Datum: 22./23.10.2011<br />
Ort: Zürich<br />
Leitung: ZISS, Lic. phil. Christa Gubler Gabban<br />
und Lic. theol. Stephan Fuchs-Lustenberger<br />
Informationen: www.ziss.ch<br />
Achtsame Kommunikation<br />
Datum: 25.10, 1./8./15./22./29.11.2011 und 6.12.2011<br />
Ort: Zürich<br />
Leitung: Béatrice Heller, dipl. Beraterin <strong>pca</strong><br />
Informationen: <strong>pca</strong>.<strong>acp</strong>, Schweizerische Gesellschaft<br />
für den Personzentrierten Ansatz, Josefstr. 79,<br />
8005 Zürich, Tel. 044 271 71 70, www.<strong>pca</strong>-<strong>acp</strong>.ch,<br />
info@<strong>pca</strong>-<strong>acp</strong>.ch<br />
Anwendung von Hypnose-Techniken in der systemischen<br />
Therapie<br />
Datum: 26.10.2011<br />
Ort: Bern<br />
Leitung: Carla Kronig, lic. Erziehungswissenschaften<br />
Informationen: info@zsb-bern.ch, www.zsb-bern.ch<br />
Wenn Angst und Ekel spezifische Situationen beherrschen<br />
– Anleitung zur Konfrontationstherapie<br />
bei spezifischen Phobien mit Live-Expositionen<br />
Datum: 28.10.2011<br />
Ort: Bern<br />
Leitung: lic. phil. Livia Sara Winzeler<br />
Informationen: Zentrum für Systemische Therapie und<br />
Beratung ZSB, Villettemattstrasse 15, 3007 Bern,<br />
Tel. 031 381 92 82, info@zsb-bern.ch, www.zsb-bern.ch<br />
Traumatherapie mit der Bildschirmtechnik<br />
(Einführung in die Screentechnik)<br />
Datum: 28. und 29.10.2011<br />
Ort: Schaffhausen<br />
Leitung: Dr. med. Michael Hase<br />
Informationen: Psychotherapeutisches Institut im Park,<br />
Steigstr. 26, 8200 Schaffhausen, Tel.: 052 624 97 82,<br />
info@iip.ch, www.iip.ch<br />
Logosynthese Basic Ein neues, elegantes Modell<br />
für begleitete Veränderung in Psychotherapie und<br />
Coaching<br />
Datum: 28.–30.10.2011<br />
Ort: ias, Bristol, Bad Ragaz<br />
Leitung: Dr. Willem Lammers<br />
Informationen: www.logosynthese.ch<br />
Anmeldung: office@iasag.ch oder Tel. 081 302 77 03<br />
»Offensive Abwehr: Immer für andere da?»<br />
Phänomene der Überverantwortlichkeit. Helfersyndrom<br />
und Burnout aus Sicht von IBP.<br />
Datum: 28.10.2011, 13.15–19.45 Uhr<br />
Ort: IBP Institut, Winterthur<br />
Leitung: Matthias Keller & Sarah Radelfinger<br />
Anmeldung: www.ibp-institut.ch, Tel. 052 212 34 30<br />
November/novembre 2011<br />
Öffentlicher Abendvortrag: Die abenteuerliche<br />
Reise von Paaren auf der Suche nach dem<br />
Glück<br />
Leitung: Dr. phil. Carmen Kindl-Beilfuss<br />
Datum: 01.11.2011, 19.00 – 20.30 Uhr<br />
Infos: Institut für Ökologisch-systemische Therapie,<br />
Klosbachstr. 123, 8032 Zürch, Tel. 044 252 32 42,<br />
www.psychotherapieausbildung.ch<br />
(Neu) Entdeckungen im Wunderland systemischer<br />
Interventionen<br />
Leitung: Dr. phil. Carmen Kindl-Beilfuss<br />
Datum: 02./03.11.2011<br />
Infos: Institut für Ökologisch-systemische Therapie,<br />
Klosbachstr. 123, 8032 Zürch, Tel. 044 252 32 42,<br />
www.psychotherapieausbildung.ch<br />
Formation: Approche des migrant-e-s, concepts<br />
et méthodologies<br />
Date: du 02.11.2011 au 02.05.2012, 17h15–20h15<br />
Localité: Appartenances, Terreaux 10, Lausanne<br />
Informations: www.appertenances.ch ou<br />
tél. 021 341 12 50<br />
Inscription: Délai d’inscription: 2 octobre 2011<br />
70. Schweizer Seminare für Katathym Imaginative<br />
Psychotherapie KIP<br />
Datum: 03.11. – 06.11.2011<br />
Ort: Thun<br />
Informationen: Sekretariat SAGKB/GSTIC,<br />
Marktgasse 55, Postfach, 3000 Bern 7, www.sagkb.ch<br />
Einführung in das CBASP (Cognitive Behavioral<br />
Analysis System of Psychotherapy) nach<br />
McCullough<br />
Datum: 04.11.2011<br />
Leitung: Dr. Martina Belz<br />
Information: www.sgvt-sstcc.ch<br />
41<br />
AGENDA I PSYCHOSCOPE 8-9/2011
42<br />
AGENDA I PSYCHOSCOPE 8-9/2011<br />
agenda<br />
Formation: Outils,pratiques & savoirs dans<br />
la rencontre et la pratique avec les migrant-e-s<br />
Date: 3, 10 et 17.11.2011, 17h15–20h15<br />
Localité: Appartenances, Terreaux 10, Lausanne<br />
Informations: www.appartenances.ch ou 021 341 12 50<br />
Inscription: Délai d’inscription: 30 septembre 2011<br />
Formation: Autour des traumatismes<br />
Date: du 07.11.2011 au 12.03.2012, 17h15–19h15<br />
Localité: Appartenances, Terreaux 10, Lausanne<br />
Informations: www.appartenances.ch ou 021 341 12 50<br />
Inscription: Délai d’inscription: 2 octobre 2011<br />
Einbezug der Angehörigen – (K)ein Problem?<br />
Datum: 10./11.11.2011 (1.5 Tage)<br />
Ort: Bern<br />
Leitung: Dr. med. Jürg Liechti<br />
Informationen: info@zsb-bern.ch, www.zsb-bern.ch<br />
Auf den Punkt kommen … Therapeutisches<br />
Reden und Hören als Prozesssteuerung<br />
Datum: 16.11.2011<br />
Ort: Bern<br />
Leitung: lic. phil. Martin Rufer<br />
Anmeldung: info@zsb-bern.ch, www.zsb-bern.ch<br />
EMDR-Einführungsseminar<br />
Datum: 10. – 12.11.11 und Praxistag am 14.01.12<br />
Ort: Schaffhausen<br />
Leitung: Hanne Hummel, EMDR-Institut Schweiz<br />
Informationen: Psychotherapeutisches Instititut im<br />
Park, Steigstr. 26, 8200 Schaffhausen,<br />
Tel.: 052 624 97 82,<br />
info@iip.ch, www.iip.ch, www.emdr-institut.ch<br />
Fortbildung zum/r integrativen KörperpsychotherapeutIn<br />
IBP 4-jähriger berufsbegleitender Fortbildungslehrgang<br />
für PsychiaterInnen, ÄrztInnen<br />
und PsychotherapeutInnen.<br />
Datum: 16.–20.11.2011<br />
Ort: Seminarhaus Schöpfe, Büttenhardt, SH<br />
Leitung: Dr. med. Markus Fischer<br />
Anmeldung: www.ibp-institut.ch, Tel. 052 212 34 30<br />
Weiterbildung Schematherapie 2011 Workshop<br />
«Mode Work with Cluster C Patients»<br />
Datum: 17. /18.11.2011<br />
Ort: Clienia Littenheid<br />
Leitung: Remco van der Wijngaart (Maastricht)<br />
Anmeldung: Institut für Schematherapie Ostschweiz<br />
auf www.istos.ch<br />
Logosynthese Live Ein neues, elegantes Modell<br />
für begleitete Veränderung in Psychotherapie und<br />
Coaching<br />
Datum: 18./19.11.2011<br />
Ort: ias AG, Bristol, Bad Ragaz<br />
Leitung: Dr. Willem Lammers<br />
Informationen: www.logosynthese.ch<br />
Anmeldung: office@iasag.ch oder Tel. 081 302 77 03<br />
1. Schweizer Netzwerktreffen Schematherapie 2011<br />
Datum: 18.11.2011 14.00–17.00 Uhr<br />
Ort: Clienia Littenheid<br />
Informationen: www.istos.ch<br />
Anmeldung: beatrice.amrhein@clienia.ch oder<br />
www.istos.ch<br />
Animation de groupes<br />
Date: 19 .11.11<br />
Lieu: Lausanne<br />
Conférenciers: Stéphanie Haymoz & Christian Follack<br />
Information: www.sgvt-sstcc.ch<br />
Beratung im Cyberspace – online-Beratung im<br />
Personzentrierten Ansatz<br />
Datum: 19.11.2011<br />
Ort: Männedorf ZH<br />
Leitung: Doris Schmider, Psychotherapeutin <strong>FSP</strong>/<strong>pca</strong><br />
Informationen: <strong>pca</strong>.<strong>acp</strong>, Schweizerische Gesellschaft<br />
für den Personzentrierten Ansatz, Josefstr. 79,<br />
8005 Zürich, T 044 271 71 70, www.<strong>pca</strong>-<strong>acp</strong>.ch,<br />
info@<strong>pca</strong>-<strong>acp</strong>.ch<br />
Einführung in das Meilener Konzept (Grundlage<br />
der Weiterbildung)<br />
Datum: 21.–23.11.2011<br />
Ort: Ausbildungsinstitut Meilen, Klosbachstrasse 123,<br />
8032 Zürich<br />
Leitung: Bruno Hildenbrand, Gabriella Selva,<br />
Robert Wäschle<br />
Informationen: Ausbildungsinstitut Meilen, Systemische<br />
Therapie und Beratung, Klosbachstrasse 123, 8032 Zürich,<br />
Tel. 044 923 03 20, mail@ausbildungsinstitut.ch,<br />
www.ausbildungsinstitut.ch<br />
Systemisches Elterncoaching Jahreskurs<br />
Datum: 21.11.2011<br />
Ort: IEF-Zürich<br />
Anmeldung: Institut für systemische Entwicklung und<br />
Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, www.ief-zh.ch<br />
State of the Art Seminar Emotionsregulation –<br />
Grundlagen und therapeutische Interventionen<br />
Datum: 24.11.2011, 9:15 Uhr bis 17:00 Uhr<br />
Ort: Zürich<br />
Leitung: Prof. Dr. Martin Bohus, Zentralinstitut für Seelische<br />
Gesundheit, Universität Heidelberg<br />
Informationen: Klaus-Grawe-Institut für Psychologische<br />
Therapie, Grossmünsterplatz 1, 8001 Zürich<br />
Anmeldung: per E-Mail an weiterbildung@ifpt.ch oder<br />
telefonisch +41 (0)44 251 24 40 Maximal 20 Teilnehmer<br />
Stationäre Systemtherapie (inkl. Jugendhilfe) und<br />
hilfreiche Komplexitätsreduktion in Netzwerken<br />
Datum: 25.11.2011<br />
Ort: Bern<br />
Leitung: dipl. Soz. Markus Grindat<br />
Informationen: info@zsb-bern.ch, www.zsb-bern.ch<br />
Familien mit Adoptivkindern, Kinder und Jugendliche<br />
in Heimen oder Pflegefamilien, Stiefkinder<br />
Datum: 25.–26.11.2011<br />
Ort: Zürich<br />
Leitung: Dr. Carole Gammer<br />
Informationen: Weiterbildungsinstitut für Phasische<br />
Paar- und Familientherapie, Carmenstrasse 51,<br />
8032 Zürich, ++41(0)44 253 28 60/61 Fax,<br />
info@gammer.ch, www.phasischesystemtherapie.ch<br />
Journée d’information: Autisme, de l’enfance à<br />
l’âge adulte: que propose Genève?<br />
Date: samedi 26 novembre 2011<br />
Localité: Genève<br />
Coûts: CHF 25.–<br />
Direction: Autisme Genève<br />
Informations: www.autisme-ge.ch<br />
Schematherapeutische Modusarbeit<br />
Daten: 25./26.11.2011<br />
Leitung: Marina Poppinger<br />
Information: www.sgvt-sstcc.ch<br />
Achtsamkeit für psychotherapeutisch Tätige<br />
Datum: 30.11. – 4.12.2011 und 9. – 11.12. 2011<br />
Ort: Haus Rutishauser, Mattwil<br />
Kosten: 30.11. – 4.12.2011, Seminarkosten Fr. 490.–,<br />
zzgl. Kost und Logis Fr. 380.–<br />
9. – 11.12.2011, Seminarkosten Fr. 320.–,<br />
zzgl. Kost und Logis Fr. 195.–<br />
Anmeldung: Monika Schäppi, Fachpsychologin für<br />
Psychotherapie <strong>FSP</strong>, Stolzestrasse 3, 8006 Zürich,<br />
Telefon 044 281 32 82,<br />
mail: monika.schaeppi@psychologie.ch<br />
Dezember/decembre 2011<br />
«Können wir oder will ich überhaupt noch?» Paartherapie<br />
als Krisenintervention und Klärungshilfe<br />
Datum: 01./02.12.2011 (1.5 Tage)<br />
Ort: Bern<br />
Leitung: lic. phil. Martin Rufer<br />
Informationen: info@zsb-bern.ch, www.zsb-bern.ch<br />
Einführung in Stressbewältigung durch Achtsamkeit<br />
– MBSR<br />
Datum: 1.12.–2.12.2011<br />
Ort: IEF-Zürich<br />
Leitung: Susanna Püschel, Yuka Nakamura Entwicklung<br />
und Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84,<br />
www.ief-zh.ch<br />
Anmeldung: Institut für systemische Entwicklung und<br />
Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, www.ief-zh.ch<br />
Formation postgraduée en psychothérapie<br />
centrée sur la personne 15 (cycle I)<br />
Date: décembre 2011 à juin 2014<br />
Localité: Fribourg et en Suisse romande<br />
Direction: Philippe Dafflon, formateur <strong>acp</strong>; Dinah<br />
Favarger, formatrice <strong>acp</strong>; Ani Gürün, formatrice <strong>acp</strong>;<br />
Olivier Siegenthaler, formateur <strong>acp</strong>; Philippe Wandeler,<br />
formateur <strong>acp</strong><br />
Inscription: <strong>pca</strong>.<strong>acp</strong>, Société Suisse pour l’approche<br />
centrée sur la personne, Josefstr. 7, 8005 Zurich,<br />
tél. 044 271 71 70, www.<strong>pca</strong>-<strong>acp</strong>.ch, info@<strong>pca</strong>-<strong>acp</strong>.ch
agenda<br />
»ich schaff’s» das lösungsorientierte Programm<br />
für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen<br />
Datum: 5./6.12 2011<br />
Ort: IEF-Zürich<br />
Leitung: Thomas Hegemann<br />
Anmeldung: Institut für systemische Entwicklung und<br />
Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84,<br />
www.ief-zh.ch<br />
Depression<br />
Datum: 9.–10.12.2011<br />
Ort: Schloss Greifense, Greifensee/ZH<br />
Leitung: Dr. med. Thomas Utz<br />
Informationen: Weiterbildungsinstitut für Phasische<br />
Paar- und Familientherapie, Carmenstrasse 51, 8032<br />
Zürich, ++41(0) 253 28 60/61 Fax, info@gammer.ch,<br />
www.phasischesystemtherapie.ch<br />
Kreativitätstraining: Burnout-Prävention und<br />
Psychohygiene der besonderen Art<br />
Leitung: Frauke Nees, Diplom-Psychologin, Personzentrierte<br />
Psychotherapie (GwG), Psychodynamisch<br />
Imaginative Traumatherapie (PITT) nach Reddemann,<br />
Tänzerin. Petra Daiber, Diplom-Psychologin, Ergotherapeutin,<br />
Clown.<br />
Datum: 09.12.–10.12. 2011<br />
Ort: Zürich ZH<br />
Infos: <strong>pca</strong>.<strong>acp</strong>, Schweizerische Gesellschaft für den<br />
Personzentrierten Ansatz, Josefstr. 79, 8005 Zürich,<br />
Tel. 044 271 71 70, www.<strong>pca</strong>-<strong>acp</strong>.ch, info@<strong>pca</strong>-<strong>acp</strong>.ch<br />
Paaranalyse. Das narzisstische System einer<br />
Partnerschaft und seine Gefährdungen<br />
Datum: 14./15.12.2011<br />
Ort: Ausbildungsinstitut Meilen, Klosbachstrasse 123,<br />
8032 Zürich<br />
Leitung: Wolfgang Schmidbauer<br />
Informationen: Ausbildungsinstitut Meilen, Systemische<br />
Therapie und Beratung, Klosbachstrasse 123,<br />
8032 Zürich, Tel. 044 923 03 20,<br />
mail@ausbildungsinstitut.ch,<br />
www.ausbildungsinstitut.ch<br />
Marte Meo Basisausbildung<br />
Datum: 01.2012<br />
Ort: IEF-Zürich<br />
Leitung: Christine Kellermüller<br />
Anmeldung: Institut für systemische Entwicklung und<br />
Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, www.ief-zh.ch<br />
Weiterbildung Schematherapie 2011 Workshop<br />
«Chairwork Training»<br />
Datum: 13./14.01.2012<br />
Ort: Clienia Littenheid<br />
Leitung: Scott Kellogg (New York)<br />
Anmeldung: Institut für Schematherapie Ostschweiz auf<br />
www.istos.ch<br />
Grundlagen der Psychotraumatologie und Traumazentrierten<br />
Psychotherapie<br />
Datum: 20./21.01.2012<br />
Ort: Schaffhausen<br />
Leitung: Hanne Hummel<br />
Informationen: Psychotherapeutisches Institut im Park,<br />
Steigstr. 26, 8200 Schaffhausen, Tel.: 052 624 97 82,<br />
ino@iip.ch, www.iip.ch<br />
Kinder/Jugendliche lernen mit Konflikten umgehen.<br />
Ein Streitschlichtermodell.<br />
Datum: 27./28.01.2012<br />
Ort: IEF-Zürich<br />
Leitung: Aldo Venzi und Leonie Meier<br />
Anmeldung: Institut für systemische Entwicklung und<br />
Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, www.ief-zh.ch<br />
La question du sexuel dans l’approche centrée sur<br />
la personne<br />
Date: 27/28.01.2012<br />
Localité: Lausanne<br />
Direction: Maria Martinez Alonso, psychologue-psychothérapeute<br />
<strong>FSP</strong>/<strong>acp</strong><br />
Inscription: <strong>pca</strong>.<strong>acp</strong>, Société Suisse pour l’approche<br />
centrée sur la personne, Josefstr. 79, 8005 Zurich,<br />
tél. 044 271 71 70, www.<strong>pca</strong>-<strong>acp</strong>.ch,<br />
info@<strong>pca</strong>-<strong>acp</strong>.ch<br />
Februar/février 2012<br />
Thème 2012–2013:<br />
Transfert et contre-transfert Diplôme de formation continue<br />
universitaire en psychothérapie psychanalytique.<br />
Cycle de trois ans, diplômant, ou accessible par certificats<br />
d’une année. Ouvert aux médecins et psychologues en<br />
cours de spécialisation.<br />
Date: Début: février 2012.<br />
Localité: Département de Psychiatrie des HUG Genève.<br />
Coûts: 4600.– Frs. par an.<br />
Inscription: philippe.rey-bellet@hcuge.ch,<br />
tél. 022 305 47 01 (délai: 30 novembre)<br />
Frühe Kindheit – Brücken bauen Wissenschaft<br />
und Praxis im Dialog 17. Jahrestagung der GAIMH<br />
(German Speaking Association for Infant Mental<br />
Health)<br />
Datum: 2.02.–4.02.2012<br />
Ort: Universität Basel<br />
Informationen: Call for Papers, Anmeldung unter<br />
www.gaimh.org<br />
Internationaler Workshop-Kongress für<br />
Psychotherapie und Beratung «Grenzen-<br />
Systeme-Kulturen 2012»<br />
Datum: 19.02.–25.02.2012<br />
Ort: Golf von Neapel – Isola d’Ischia<br />
• Prof. Dr. habil. Rainer Sachse/Ruhr-Univ. Bochum.<br />
• Prof. Dr. habil. Bruno Hildenbrand/Univ. Jena und Institut<br />
Meilen<br />
• Prof. Dr. habil. Dirk Revenstorf/Präs. der Milton Erickson<br />
Ges. für klin. Hypnose<br />
• Prof. Dr. phil. Allan Guggenbühl/IKM Zürich, Toronto<br />
• Prof. Dr. phil. Kirsten von Sydow/Psychologische Hochschule<br />
Berlin (PHB)<br />
• Adj. Prof. Stefan Geyerhofer/Webster Univ. Vienna<br />
• Tom Levold/Köln u.a.<br />
Informationen: psyseminare, Casinoplatz 7,<br />
CH-7000 Chur, Tel. +41 (0)81 250 53 78<br />
www.psyseminare.com, info@psyseminare.com<br />
Einführung in die Ego State Therapie.<br />
Die Psychotherapie des geteilten Selbst.<br />
Datum: 24./25. Februar 2012<br />
Ort: IEF-Zürich<br />
Leitung: Kai Fritzsche<br />
Anmeldung: Institut für systemische Entwicklung und<br />
Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, www.ief-zh.ch<br />
März/mars 2012<br />
Die Kraft der Mehrgenerationenperspektive<br />
Datum: 9./10.03.2012<br />
Ort: IEF-Zürich<br />
Leitung: Gunther Schmidt<br />
Anmeldung: Institut für systemische Entwicklung und<br />
Fortbildung, Zürich, Psychoscope<br />
Tel. 044 362 84 84, www.ief-zh.ch<br />
Umgang mit AS: Emotionen 15.08.2011<br />
Datum: 28./29.03.2012<br />
Ort: IEF-Zürich<br />
ET: 10.09.2011<br />
Leitung: Heiner Krabbe<br />
Anmeldung: Institut für systemische Entwicklung und<br />
Fortbildung, Zürich, Tel. 044 362 84 84, www.ief-zh.ch<br />
April/avril 2012<br />
Jahrestraining «Intuitive Präsenz» 1-jährige<br />
Intuitionsschulung bestehend aus 5 Modulen<br />
Datum: 12.04.2012<br />
Ort: Seminarhaus Schöpfe, Büttenhardt SH<br />
Leitung: Darrel Combs<br />
Anmeldung: www.ibp-institut.ch, Tel. 052 212 34 30<br />
Akademie bei König & Müller<br />
Semmelstr. 36 / 38<br />
97070 Würzburg<br />
Tel.: +49 931 - 46079033<br />
Fax: +49 931 - 46079034<br />
akademie@koenigundmueller.de<br />
www.koenigundmueller.de<br />
Neurologie für NeuropsychologInnen<br />
21.-22.10.2011 CH-Kreuzlingen (FB111021C)<br />
Dr. Klaus Scheidtmann; 16 Std.; 316 €<br />
Fallseminar funktionelle Hirnanatomie kognitiver<br />
Störungsbilder<br />
11.-12.11.2011 CH-Kreuzlingen (FB111111C)<br />
Dr. Mario Paulig; 16 Std.; 316 €<br />
Evidenced-Based Neuropsychological Assessment<br />
29.03.2012 GB-London (FB120329A)<br />
Prof. Grant L. Iverson, PhD ; 8 Std.; 182 €<br />
Klinische Neuropsychologie des Dysexekutiven<br />
Syndroms<br />
30.-31.03.2012 CH-Kreuzlingen (FB120330A)<br />
Dipl.-Psych. Dipl.-Inf. Wiss. Joachim Kohler &<br />
Dr. Karen Lidzba, Dipl.-Psych.; 16 Std.; 326 €<br />
3. Fachtagung "Alltagsorientierte Rehabilitation<br />
emotionaler und kognitiver Störungen“<br />
11.-12.05.2012 CH-Kreuzlingen (FB120511A)<br />
PD Dr. Reiner Kaschel, Dipl.-Psych. et al.;<br />
12 Std.; 220 €<br />
*Kosten inkl. MwSt.<br />
43<br />
AGENDA I PSYCHOSCOPE 8-9/2011
eratungsausbildungen mit bso-anerkennung:<br />
coaching, supervision / teamcoaching und organisationsberatung<br />
modular aufgebaut, anerkennung von früheren weiterbildungen möglich<br />
best practice in beratung und führung mit:<br />
friedrich glasl, wolfgang looss, klaus doppler, ursula könig, gunther schmidt, arist von schlippe,<br />
ruth seliger, brigitte lämmle, torsten groth<br />
17. – 19.november 2011<br />
haim omer , eia asen, idan amiel:<br />
stärke statt macht - neue autorität und multi-systemische kooperation<br />
weitere informationen unter: www.systemische-impulse.ch<br />
isi – institut für systemische impulse, entwicklung und führung, zürich<br />
Master of Advanced Studies in Cognitive-Behavioral<br />
and Interpersonal Psychotherapy (MAS)<br />
Konzept Prof. Dr. Klaus Grawe<br />
Im April 2012 beginnt der nächste Studiengang unserer postgradualen Weiterbildung Psychotherapie mit kognitiv-behavioralem<br />
und interpersonalem Schwerpunkt, der als MAS der Universität Basel angeboten wird. Ziel dieser Weiterbildung ist die<br />
selbständige Berufsausübung als PsychotherapeutIn. <strong>FSP</strong>-Mitglieder können nach Abschluss der Weiterbildung den Titel<br />
FachpsychologIn <strong>FSP</strong> für Psychotherapie erwerben.<br />
Die theoretische Grundlage der Weiterbildung ist ein in der empirischen Psychologie fundiertes allgemeines Modell des<br />
psychischen Funktionierens des Menschen, der Entstehung und Aufrechterhaltung von psychischen Störungen sowie von<br />
psychotherapeutischen Veränderungsprozessen. Das Kurscurriculum der Weiterbildung bezieht sich auf den aktuellen<br />
Erkenntnisstand der Psychotherapieforschung und insbesondere auf die Arbeiten von Prof. Dr. Klaus Grawe, dem Begründer<br />
einer empirisch orientierten, schulenübergreifenden Psychologischen Therapie. Die empirisch nachgewiesene Wirksamkeit von<br />
Interventionsformen und die nachgewiesene Bedeutung therapeutischer Wirkfaktoren sind wesentliche Kriterien für die<br />
Bestimmung der Weiterbildungsinhalte.<br />
Schwerpunkte: Konsistenztheoretische Fallkonzeption und Therapieplanung; Diagnostik; Konzepte und Methoden der Problem-<br />
und Ressourcenanalyse; Systemische Konzepte und Kompetenzen; Psychotherapeutische Beziehungsgestaltung;<br />
Ressourcenaktivierung und Problemaktualisierung im Paar-, Familien- und Gruppensetting; Störungsspezifische Konzepte und<br />
Methoden aus der kognitiven Verhaltenstherapie; Konzepte und Methoden zur motivationalen Klärung (insbesondere zur<br />
Bearbeitung intrapsychischer Konflikte); Qualitätskontrolle in der Psychotherapie.<br />
Die vierjährige Weiterbildung ist berufsbegleitend und praxisorientiert. Die Weiterbildungskurse finden jeweils Freitag/Samstag in<br />
Zürich statt. Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Universitätsstudium mit Hauptfach Psychologie.<br />
Informationen und Bewerbung<br />
Klaus-Grawe-Institut für Psychologische Therapie, lic. phil. Nusa Sokolic,<br />
Weiterbildungskoordinatorin, Grossmünsterplatz 1, 8001 Zürich,<br />
Tel. +41 (0)44 251 24 40, Fax +41 (0)44 251 24 60, weiterbildung@ifpt.ch,<br />
www.klaus-grawe-institut.ch<br />
Trägerschaft<br />
Klaus-Grawe-Institut für Psychologische Therapie Zürich<br />
in Zusammenarbeit mit dem Advanced Studies Center der Universität Basel<br />
Congrès francophone de thérapie de couple Imago<br />
LE CERVEAU RELATIONNEL<br />
Ce que les neurosciences peuvent apprendre aux<br />
thérapeutes de couples<br />
Hedy Schleifer, psychologue-psychothérapeute, Miami, USA<br />
Maya Kollman, psychologue-psychothérapeute, New Jersey, USA<br />
Dr Paul Earley, Atlanta, USA<br />
Vendredi 23 septembre 2011 – Site de Cery, Prilly/Lausanne<br />
Uniquement sur inscription par mail à: info@imago-therapie.com<br />
AFTRI<br />
Association Francophone de Thérapie Relationnelle Imago<br />
Renseignements et détails sur: www.imago-therapie.com<br />
Eye Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR<br />
Formation à la méthode thérapeutique développée par<br />
Francine Shapiro PhD pour le traitement des personnes traumatisées.<br />
1 ère partie: (à choix)<br />
1 au 4 févr. 2012 à Lausanne ou 21 au 24 mars 2012 à Fribourg<br />
2ème partie: les 8-9-10 nov. 2012 à Fribourg, CH.<br />
Formatrice agréée : Eva Zimmermann (CH), EMDR Institute<br />
Organisation : Institut Romand de Psychotraumatologie<br />
www.irpt.ch Tél. : 021 311 96 71 e-mail : info@irpt.ch
Pour le Secteur de Psychiatrie et Psychothérapie pour personnes<br />
âgées du Réseau Fribourgeois de Santé Mentale, le Service de psychologie<br />
met au concours, avec entrée en fonction au 1 er janvier<br />
2012 ou à convenir, deux postes de<br />
Psychologues spécialistes en<br />
neuropsychologie <strong>FSP</strong><br />
à 60 % (francophone) et<br />
à 40 % (germanophone)<br />
Les futur-e-s neuropsychologues seront chargé-e-s de réaliser des<br />
bilans neuropsychologiques et de mener des suivis individuels et de<br />
famille. La pluridisciplinarité sera au centre de leur activité, puisqu’il<br />
leur sera également demandé de travailler en collaboration avec<br />
d’autres professionnels de la santé mentale (médecins psychiatres,<br />
assistants sociaux, infirmiers,…) autant en milieu hospitalier qu’en<br />
ambulatoire. La gestion de situations de crise psychiatrique fait partie<br />
intégrante du travail des futur-e-s neuropsychologues.<br />
Profil<br />
• Très bonnes connaissances en neuropsychologie<br />
(«démentologie»)<br />
• Aptitude à travailler en équipe, mais également de manière<br />
autonome<br />
• Mobilité (travail sur plusieurs sites de soins : Marsens, Fribourg)<br />
Exigences<br />
• Master en psychologie<br />
• Titre de spécialisation en neuropsychologie <strong>FSP</strong> (ou en voie<br />
d’obtention)<br />
Mme Marianna Gawrysiak, gérontopsychologue-psychothérapeute<br />
<strong>FSP</strong>, (026 305 77 33; GawrysiakM@rfsm.ch) ou Mme Florence<br />
Guenot, responsable du Service de psychologie (026 305 77 38;<br />
GuenotF@rfsm.ch) se tiennent à votre disposition pour d’éventuels<br />
renseignements complémentaires.<br />
Votre dossier de candidature, accompagné des documents usuels,<br />
est à adresser jusqu’au 31 octobre 2011, au Réseau Fribourgeois<br />
de Santé Mentale, c/o Centre de soins hospitaliers, Département<br />
des Ressources Humaines, 1633 Marsens.<br />
Fachpsychologe <strong>FSP</strong> für Psychotherapie mit<br />
langjähriger Erfahrung sucht Teilzeitstelle in<br />
Delegation bei Arzt oder Ärztin im Raum Bern.<br />
Bisherige therapeutische und beraterische Tätigkeit mit<br />
Erwachsenen, Familien, Kindern und Jugendlichen.<br />
Kontaktaufnahme unter Tel. 077 44 300 70<br />
Ab 1. Oktober oder nach Übereinkunft wird ein Praxisraum 50%<br />
frei für Psychotherapeutin (delegiert und selbständig).<br />
Die systemisch orientierte psychiatrisch-psychotherapeutische<br />
Praxisgemeinschaft<br />
Dr. med. U. Davatz liegt an der Winterthurerstr.52, 8006 Zürich<br />
(Haltestelle Kinkel, Tram 9 und 10).<br />
Die Mietkosten für den Praxisraum (3.9m mal 4.9m) und separates<br />
Büro betragen 560 Franken monatlich.<br />
Auskunft erteilt:<br />
Tel. 044/361 54 68,<br />
claudialutzcampell@hotmail.com<br />
Die KJP Graubünden besteht aus einer ambulanten und zwei stationären Einrichtungen.<br />
Zu den Ambulanten Angeboten gehören die Zentralstelle in Chur sowie<br />
die Regionalstellen in Davos, Ilanz, Poschiavo, Roveredo und Samedan. Stationär<br />
wird die Jugendpsychiatrische Station und stationär/teilstationär die Sonderschule<br />
Therapiehaus Fürstenwald in Chur geführt.<br />
Unsere Institution hat vom Kanton Graubünden den Leistungsauftrag zur psychiatrischen<br />
Versorgung der Kinder und Jugendlichen Graubündens. Die Ambulanten<br />
Angebote bieten Psychotherapie, Gruppentherapie, Test- und neuropsychologische<br />
Diagnostik, forensische Gutachten und konsiliar- und liaisonpsychiatrische<br />
Dienste an.<br />
Für die Ambulanten Angebote, mit Dienststelle Davos und Chur, suchen wir<br />
baldmöglichst<br />
Psychotherapeutin/Psychotherapeut 80%<br />
Ihr Profil:<br />
• Psychologiestudium und berufliche Erfahrung im Bereich Psychotherapie/<br />
Diagnostik<br />
• Abgeschlossene Therapieausbildung mit <strong>FSP</strong>-Anerkennung<br />
• Vertiefte Kompetenzen im Bereich Kindertherapie<br />
• Bereitschaft und Fähigkeit sich in ein interdisziplinäres und motiviertes Team<br />
einzubringen<br />
Wir bieten:<br />
• Attraktive Anstellungsbedingungen mit umfangreichem Weiterbildungsangebot<br />
Weitere Informationen über uns finden Sie auch unter www.kjp-gr.ch.<br />
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!<br />
Schriftliche Bewerbung an:<br />
KJP Graubünden, Reto Mischol, lic. phil., leitender Psychologe<br />
Masanserstrasse 14, 7000 Chur<br />
Tel. 081 252 90 23
111307<br />
MAS Systemische Beratung<br />
In Kooperation mit dem ZSB Bern<br />
Der MAS vermittelt Kenntnisse in systemischer, ressourcen- und lösungsorientierter<br />
Beratung und deren Umsetzung in die Beratungspraxis.<br />
Abschluss: Master of Advanced Studies ZFH.<br />
Beginn: 12. März 2012<br />
Infoveranstaltungen:<br />
20. Sept. 2011, 18.30 Uhr, IAP, Merkurstrasse 43, Zürich<br />
4. Nov. 2011, 18.30 Uhr, ZSB, Villettemattstrasse 15, Bern<br />
Info und Anmeldung: Tel. +41 58 934 83 72,<br />
veronika.bochsler @zhaw.ch; www.iap.zhaw.ch / weiterbildung<br />
MAS Kinder- und<br />
Jugendpsychotherapie<br />
Im Zentrum dieser Ausbildung steht eine entwicklungsorientiert-systemische<br />
Ausrichtung, die an den Stärken und Ressourcen der Kinder,<br />
Jugendlichen und Familien anknüpft und Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie<br />
und -psychopathologie integriert. Abschluss:<br />
Master of Advanced Studies ZFH.<br />
Beginn: Herbst 2012<br />
Info und Anmeldung: Tel. +41 58 934 83 30,<br />
margrit.voneuw@zhaw.ch; www.iap.zhaw.ch/weiterbildung<br />
Fallbeispiele:<br />
www.coachingdisc.de<br />
AIM/AVM-CH<br />
Kleine Steine, große Wirkung!<br />
Die coaching disc ® ist ein multifunktionales Kommunikationstool: es kann als Denk- und<br />
Konzentrationshilfe oder zum Selbstcoaching eingesetzt werden. Die Anwendung ist nicht auf<br />
Coaching-Themen begrenzt, die Disc wird auch zur Beratung und Therapie eingesetzt.<br />
Eine runde Metallscheibe fungiert als Aktionsradius, der mit Magnetsteinen in verschiedenen<br />
Farben, Größen und Formen bespielt wird. Ihr Gesprächspartner stellt seine Situation oder<br />
sein Problem mithilfe dieses Mediums dar – und es ergeben sich überraschend neue Sichtweisen<br />
und Lösungswege.<br />
Deutscher Psychologen Verlag GmbH · Am Köllnischen Park 2 · 10179 Berlin · Tel. +49 (0) 30 - 209 166 410 · Fax +49 (0) 30 - 209 166 413 · verlag@psychologenverlag.de<br />
W W W . P S Y C H O L O G E N V E R L A G . D E<br />
Akademie für Verhaltenstherapie und Methodenintegration<br />
Neuer Weiterbildungsgang<br />
in kognitiver Therapie<br />
und Methodenintegration<br />
ab Oktober 2011 (Bern, Basel)<br />
Schwerpunkte der vierjährigen Weiterbildung für PsychologInnen<br />
bilden kognitive Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin.<br />
Weitere empirisch begründbare Therapieansätze<br />
anderer Therapieschulen werden ebenfalls berücksichtigt. Die<br />
Weiterbildung umfasst «Kurse», «Supervision» und «Selbsterfahrung».<br />
Der erfolg reiche Abschluss der vierjährigen Weiterbildung<br />
führt zum <strong>FSP</strong>-Fachtitel «FachpsychologIn für Psychotherapie<br />
<strong>FSP</strong>». Die kantonale Praxisbewilligung kann ebenfalls<br />
erlangt werden.<br />
Für externe InteressentInnen besteht auch die Möglichkeit, nur<br />
einzelne Kurse zu buchen. Preis pro Kurs CHF 390.– bzw. 420.–.<br />
Nächste Veranstaltungen:<br />
17./18.09.11 Klaus Bader, Dr. phil.<br />
Depression<br />
01./02.10.11 Peter Kosarz, Dr. biol. hum. Dipl.-Psych.<br />
Schwierige Therapiesituationen<br />
01./02.10.11 Aba Delsignore, Dr. phil.<br />
Angststörungen<br />
15./16.10.11 Günter Ruggaber, Dipl.-Psych.<br />
Sexuelle Störungen<br />
14./15.10.11 Brunna Tuschen-Caffier, Prof. Dr. phil.<br />
Essstörungen<br />
29./30.10.11 Jutta Stahl, Dipl.-Psych.<br />
Verhaltenstherapie/ältere Menschen<br />
Anmeldung und weitere Infos<br />
AIM, Cornelia Egli-Peierl, Psychiatrische Klinik, Zürcherstr. 30, 9500 Wil<br />
Direktwahl Tel. 071 913 12 54 (telefonisch erreichbar:<br />
Mo-/Mi-Morgen u. Freitag), egli@aim-verhaltenstherapie.ch oder<br />
www.aim-verhaltenstherapie.ch<br />
Testen auch Sie die coaching disc ® !
Postgraduale Ausbildung in Psychoanalyse<br />
Das Angebot richtet sich an Psychologinnen und Psychologen mit einem<br />
Universitätsabschluss im Hauptfach Psychologie sowie an Ärztinnen und Ärzte.<br />
Curriculum des 4-jährigen theoretisch-klinischen Grundkurses innerhalb der<br />
Ausbildung zum assoziierten Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für<br />
Psychoanalyse (SGPsa):<br />
• Einführung in psychoanalytisches Denken anhand von Fallbeispielen.<br />
Psychoanalytische Grundkonzepte. Psychoanalytische Entwicklungspsychologie.<br />
Geschichte der Psychologie.<br />
• Erstinterview und Indikation. Grundbegriffe der psychoanalytischen Technik.<br />
Störungsformen I: Hysterie, Zwang, Phobie, Angst. Traumdeutung und<br />
Traumtheorie.<br />
• Störungsformen II: narz. Störungen, Depression, Borderline, Psychosomatik,<br />
Essstörungen, posttraumat. Belastungsstörungen. Spezielle Konzepte der<br />
Theorie und Technik: Agieren, Container, Holding, Spaltung, projektive<br />
Identifikation, negative therapeutische Reaktion u.a.<br />
• Forschung in der Psychoanalyse. Psychoanalyse und psychoanalytische<br />
Psychotherapie. Evaluation und Qualitätssicherung.<br />
• Klinische Seminare mit Fallpräsentationen.<br />
Die Ausbildung zur Psychoanalytikerin/zum Psychoanalytiker SGPsa<br />
setzt sich aus einer persönlichen Lehranalyse, der Supervision von<br />
zwei Analysefällen und einer theoretischen Ausbildung zusammen. Der<br />
theoretische Teil besteht aus dem 4-jährigen Grundkurs, weiterführenden<br />
Seminaren und wissen-schaftlichen Veranstaltungen.<br />
Der 4-jährige Grundkurs ist <strong>FSP</strong> – anerkannt. Er führt zum Fachtitel<br />
«Fachpsychologe/in für Psychotherapie <strong>FSP</strong>».<br />
Ebenso ist er ein Modul innerhalb der Facharztweiterbildung, SGPPanerkannt<br />
und erbringt entsprechende Credits.<br />
Voraussetzung für die Teilnahme ist die Erlangung des Kandidatenstatus in<br />
der SGPsa. Bedingungen siehe www.freud-institut.ch.<br />
Beginn: Dienstag, 25. Oktober 2011, 20.00 – 21.40, wöchentlich.<br />
Information und Anmeldung: Freud-Institut Zürich, Zollikerstrasse 144,<br />
8008 Zürich, Tel. 044 382 34 19, Fax 044 382 04 80<br />
info@freud-institut.ch, www. freud-institut.ch<br />
PSZ<br />
DENKEN SIE NUR!<br />
Erfahrung und Kompetenz!<br />
Fundierte und anerkannte Weiterbildung in psychoanalytischer<br />
Psychotherapie und Ausbildung in Psychoanalyse!<br />
Weiterbildungsgänge, die den gesetzlichen Anforderungen für<br />
eine selbstständige Berufsausübung von Psychologen und Ärzten<br />
entsprechen!<br />
All das versteht sich von selbst. Darüber hinaus bieten wir eine<br />
Atmosphäre offener Diskussion und freien Denkens, das nicht in<br />
orthodoxen Bahnen stecken bleibt. Ein Denken, das weiter geht.<br />
www.psychoanalyse-zuerich.ch<br />
Semesterbeginn am 24. Oktober 2011.<br />
im Psychoanalytischen Seminar Zürich,<br />
Quellenstrasse 25, 8005 Zürich, Tel. 044 271 73 97<br />
P S Y C H O A N A L Y T I S C H E S S E M I N A R Z Ü R I C H<br />
INS_psychoscope_92x135_08-11<br />
Werkstatt Organisationsberatung<br />
Gestalten von Veränderungsprozessen in Organisationen<br />
• Modelle, Techniken und Interventionen der Organisationsentwick<br />
lung und des Change Managements<br />
• Fokussierung der organisationseigenen Kräfte für Lernen<br />
und Entwicklung<br />
• Beratungsprozesse zu den vereinbarten Ergebnissen führen<br />
Die Werkstatt ist eines der Vertiefungsmodule des Nachdiplomstudiums<br />
Beratung in Veränderungsprozessen. Zusammen mit der Werkstatt<br />
Coaching berechtigt dieses NDS plus zur Mitgliedschaft im BSO*. Für<br />
erfahrene Beratungspersonen besteht die Möglich keit, das NDS durch<br />
einen Äquivalenznachweis zu er setzen und direkt in die Werk statt module<br />
einzusteigen. Die BSO-Mitgliedschaft ist dann ebenfalls möglich.<br />
* Berufsverband für Supervision, Organisa tionsberatung und Coaching<br />
Zielpublikum Angesprochen sind Personen aus Beratung (intern oder<br />
extern) und Führung, die Veränderungsprozesse begleiten<br />
und gestalten. Vorausgesetzt wird Grund lagen -<br />
wissen zur Organisationsentwicklung.<br />
Daten/Ort 31. Oktober 2011 bis 25. April 2012 (12 Tage), Luzern<br />
Nähere Informationen und das Detailprogramm erhalten Sie unter<br />
www.weiterbildung.curaviva.ch oder Telefon 041 419 01 88<br />
CURAVIVA Weiterbildung Abendweg 1 6006 Luzern<br />
Telefon 041 419 01 72 weiterbildung@curaviva.ch<br />
Praxisnah und persönlich.<br />
Psychoanalytische Psychotherapie<br />
Das Kursprogramm besteht aus einem dreijährigen Grundkurs als Weiter- und<br />
Fortbildung in psychoanalytisch orientierter Psychotherapie.<br />
Der Grundkurs ist eine Weiterbildung für angehende ärztliche oder psychologische<br />
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Er erfüllt die Anforderungen<br />
der FMH. Diese Weiterbildung ist SGPP-anerkannt und<br />
erbringt entsprechende Credits.<br />
Für die Anforderungen zur Erlangung der Fachtitel der <strong>FSP</strong> und des SPV sowie<br />
der kantonalen Praxisbewilligung müssen Seminare und Veranstaltungen des<br />
Freud-Instituts ergänzend besucht werden. Diese Weiterbildung ist <strong>FSP</strong>zertifiziert.<br />
Diese Weiter- und Fortbildung wird neben der Ausbildung zur Psychoanalytikerin<br />
oder Psychoanalytiker SGPsa vom Freud-Institut Zürich angeboten.<br />
Kurskosten: Grundkurs: Fr. 2000.– pro Weiterbildungsjahr<br />
Kursbeginn: Monatg, 24. Oktober 2011, 19:30–21.10, wöchentlich.<br />
Ein Einstieg ist jeweils im Herbst oder Frühling möglich.<br />
Die Programme für die Kurse erhalten Sie beim:<br />
Sekretariat Freud-Institut Zürich, Zollikerstrasse 144, 8008 Zürich,<br />
Tel. 044 382 34 19, Fax 044 382 04 80<br />
info@freud-institut.ch, www.freud-institut.ch<br />
Analoge Kurse in Basel (Ausbildungszentrum für Psychoanalytische<br />
Psychotherapie, AZPP, J. Besch: Tel. 061 691 66 77, jbesch@vtxmail.ch<br />
oder Dr. C. Kläui: Tel. 061 271 89 22, praxis.klaeui@bluewin.ch) und Bern<br />
(Dr. med. A. Wyler von Ballmoos: Tel. 031 351 64 65,<br />
anna.wyler@freud-zentrum.ch)
www.traumahealing.ch<br />
Scham und Intimität<br />
Johannes Schmidt D<br />
am 7. - 9. Oktober 2011<br />
Der Polarity Embryo<br />
Dr. Jaap van der Wal NL<br />
Pränatale Entwicklung aus<br />
neuer, faszinierender Sicht<br />
28. - 30. Oktober 2011<br />
SOMATIC<br />
EXPERIENCING (SE)<br />
Einführung in die<br />
Traumalösungs-Arbeit nach<br />
Dr. Peter A. Levine<br />
30. September - 2. Oktober 2011<br />
in Lausanne mit<br />
Dominique Dégranges<br />
14. - 16. Dezember 2011 in Zürich<br />
mit Dr. Urs Honauer<br />
C.G. Jung,<br />
Advaita Vedanta und<br />
Somatic Experiencing (SE)<br />
Dr. Raja Selvam usa<br />
Vorweihnachtliches Retreat in Weggis<br />
9. - 12. Dezember 2011<br />
Polarität, Spirale<br />
und Lebensenergie<br />
Dr. med. Hanspeter Seiler ch<br />
Die abstrakte Mathematik von<br />
Relativitätstheorie und<br />
Quantenmechanik<br />
ist auch emotional erlebbar.<br />
1.5-tägiger Kurs mit dem ehemaligen<br />
Chefarzt der Bircher-Benner-Klinik Zürich<br />
17. - 18. September 2011<br />
ZENTRUM FÜR INNERE ÖKOLOGIE (ZIO)<br />
Zwinglistrasse 21 | 8004 Zürich | info@traumahealing.ch | Tel: 044 218 80 80<br />
<strong>FSP</strong> anerkannte postgraduale Weiterbildung in<br />
Klientenzentrierter Psychotherapie<br />
(focusing- und körper orientiert)<br />
Gesprächspsychotherapie<br />
Focusing<br />
Körperpsychotherapie<br />
Start der nächsten Weiterbildungsgruppe:<br />
15. September 2011 (Einstieg möglich bis Februar 2012)<br />
Informationsveranstaltungen:<br />
Freitag, 19. August 2011<br />
Freitag, 28. Oktober 2011<br />
Freitag, 09. Dezember 2011<br />
jeweils von 18.30 bis etwa 21 Uhr in der Praxisgemeinschaft<br />
Konradstrasse 54, 8005 Zürichfk-institut.ch<br />
Infos und Anmeldung unter gfk@bluewin.ch oder Telefon 043 817 41 24<br />
www.gfk-institut.ch
Hannelore Wildbolz-Weber<br />
Die Berner Vorlesungen über<br />
Theorie und Klinik der Psychoanalyse<br />
Bestell-Talon<br />
(Rückseite beachten!)<br />
Herausgegeben von Alexander Wildbolz<br />
EditionSolo<br />
bitte<br />
Logotherapie-Ausbildung<br />
Logotherapie ist eine sinnzentrierte Psychotherapie, begründet<br />
durch den Psychiater und Neurologen Prof.Dr.med.et phil. Viktor<br />
E. Frankl.Sie bezieht neben dem Psychophysikum besonders<br />
die geistige Dimension des Menschen mit ein.<br />
Ausbildung in logotherapeutischer Beratung und Begleitung<br />
– 4 Jahre berufsbegleitend<br />
– für Personen aus sozialen, pädagogischen und pflegerischen<br />
Berufen<br />
– vom Bundesamt für Bildung und Technologie (BBT) und vom<br />
Kanton Graubünden anerkanntes Nachdiplomstudium Höhere<br />
Fachschule<br />
Integrale Fachausbildung in Psychotherapie<br />
– 5 Jahre berufsbegleitend<br />
– für Psychologen/Psychologinnen sowie Absolventen/<br />
Absolventinnen anderer akademischer Hochschulstudiender<br />
Human- und Sozialwissenschaften<br />
– von der Schweizer Charta für Psychotherapie anerkannt<br />
Weitere Ausbildungsangebote unter www.logotherapie.ch<br />
Nächster Ausbildungsbeginn<br />
14. Januar 2012<br />
Institutsleitung: Dr. phil. Giosch Albrecht<br />
Freifeldstrasse 27, CH-7000 Chur<br />
Telefon 081 250 50 83, Fax 081 25050 84<br />
E-Mail: info@logotherapie.ch<br />
Internet: www.logotherapie.ch<br />
EditionSolo, Mai 2011, 316 Seiten, broschiert, CHF 39.90<br />
ISBN 978-3-9523374-3-1<br />
Bestellungen nimmt der Herausgeber gerne<br />
per E-Mail: bestellungen@freud-zentrum.ch<br />
oder mit untenstehendem Bestell-Talon entgegen.<br />
Bestellung<br />
Hannelore Wildbolz-Weber, 1943–2009, in München geboren<br />
und aufgewachsen als Tochter eines Sudetendeutschen und<br />
einer Wienerin. Medizinstudium in München und Zürich, FMH<br />
Psychiatrie und Psychotherapie, Ausbildungsanalytikerin der<br />
Schweizerischen Gesellschaft für Psychoanalyse, Gründungsmitglied<br />
der Psychoanalytischen Arbeitsgruppe Bern und des daraus<br />
hervorgegangenen Sigmund-Freud-Zentrums Bern. Hannelore<br />
Wildbolz lebte und wirkte hauptsächlich in Bern, wo sie eine<br />
intensive Praxis-, Seminar-, Vortrags- und Supervisionstätigkeit<br />
entfaltete.<br />
Die 43 Vorlesungen entstanden im Rahmen eines Lehrauftrags<br />
der Medizinischen Fakultät der Universität Bern 1996–2008<br />
über Theorie und Klinik der Psychoanalyse. Sie richten sich<br />
primär an Ärztinnen und Ärzte in psychiatrischer Ausbildung,<br />
an Psychologinnen und Psychologen und an Studierende,<br />
während sie für ausgebildete Psychoanalytikerinnen und<br />
Psychoanalytiker ein ausgezeichnetes Repetitorium sind. Aber<br />
auch ein breiteres Publikum dürfte sich für diese Vorlesungen<br />
interessieren, hat doch Hannelore Wildbolz eine besondere<br />
Gabe, die Psychoanalyse in allgemeinverständlicher Sprache und<br />
auf eine sehr lebendige Art mit vielen klinischen Fallbeispielen<br />
zu vermitteln. Dabei geht sie immer von Sigmund Freud aus,<br />
schliesst aber auch moderne Postfreudianer verschiedenster<br />
kultureller Provenienz ein. Zahlreiche, oft auch humorvolle<br />
persönliche Bemerkungen aus grosser beruflicher Erfahrung<br />
und ausführliche Literaturangaben bereichern das nun endlich<br />
in schriftlicher Form vorliegende Werk.
2. Weiterbildungskurs in kognitiv-verhaltenstherapeutischer Supervision<br />
Die postgraduale Weiterbildung in kognitiv-verhaltenstherapeutischer Supervision<br />
ist eine spezialisierte Qualifikation für die selbständige Durchführung<br />
von Supervision in unterschiedlichen Settings. Das Angebot setzt sich aus<br />
Gruppenunterricht, Supervisionspraxis (Supervision der Supervision), Selbsterfahrung<br />
und Intervision zusammen.<br />
Beginn Januar 2012<br />
Dauer 4 Semester<br />
Ort Universität Zürich<br />
Psychologisches Institut<br />
Attenhoferstrasse 9<br />
8032 Zürich<br />
Abschluss Diploma of Advanced Studies (DAS) in kognitiv-verhaltenstherapeutischer<br />
Supervision der Philosophischen Fakultät<br />
der Universität Zürich und <strong>FSP</strong>-Zusatzqualifikation in<br />
kognitiv-verhaltenstherapeutischer Supervision<br />
Durchführung Die Ausbildung ist berufsbegleitend konzipiert. Der Studienkurs<br />
umfasst 18 Wochentage, verteilt auf sechs Blöcke<br />
während 2 Jahren. Unterrichtet wird in Gruppen mit<br />
max. 15 Teilnehmer(inne)n.<br />
Trägerschaft Prof. Dr. rer. nat. Ulrike Ehlert<br />
Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Psychotherapie<br />
Psychologisches Institut, Universität Zürich in Kooperation<br />
mit der Schweizerischen Gesellschaft für Verhaltens- und<br />
Kognitive Therapie (SGVT), vertreten durch lic. phil Claude<br />
Haldimann<br />
mit Unterstützung der Akademie für Verhaltenstherapie und<br />
Methodenintegration (AIM)<br />
Anmeldung Dr. des. Tiziana Perini<br />
Attenhoferstrasse 9<br />
CH-8032 Zürich<br />
weiterbildung@psychologie.uzh.ch<br />
Internet www.psychologie.unizh.ch/klipsypt/weiterbildung<br />
oder www.sgvt.ch/de/fortbildungsangebot-sgvt/<br />
����������������<br />
����������������������<br />
��������������������<br />
��������������������<br />
�����������<br />
����������������������<br />
������������������������<br />
����������������������<br />
�������������������������<br />
������������������������<br />
�������������������<br />
�<br />
�����������������������<br />
��������������<br />
��������������<br />
����������������<br />
�������������������������<br />
�����������<br />
�<br />
Psychologische<br />
Psychotherapeutin<br />
mit Universitätsabschluss und<br />
langjähriger Erfahrung in<br />
Psychoanalytischer<br />
Psychotherapie und<br />
Tiefenpsychologisch fundierter<br />
Psychotherapie sowie<br />
Weiterbildung in Hypnose und<br />
weiteren Verfahren<br />
sucht<br />
Anschluss an<br />
Praxisgemeinschaft,<br />
Übernahme von bestehender<br />
Praxis, Tätigkeit in Klinik etc.<br />
Detaillierte Angaben über<br />
julagold@gmail.com<br />
www.kvt-tcc.ch<br />
Fort- und Weiterbildung,<br />
Kongresse in kognitiver<br />
Verhaltenstherapie<br />
www.tcc-kvt.ch<br />
Formation postgrade,<br />
continue et congrès<br />
en thérapie comportementale<br />
et cognitive<br />
Vom Wissen der Symptome zur Würde der Veränderung<br />
Es kennzeichnet die therapeutische Grundhaltung in der hypnosystemischen Arbeit, nicht nur die Person in ihrem Umfeld, sondern auch die Kompetenzen der<br />
Symptome und Konflikte wertzuschätzen und damit einen würdevollen Weg zur gewünschten Veränderung zu bahnen. Die «Hypnotherapie» kennt den Stoff,<br />
aus dem die Symptome und Veränderungen sind, die «Systemtherapie» das Feld, auf dem sie wachsen.<br />
Mit: Joe Barber · Reinhold Bartl · Martin Busch · Klaus-Dieter Dohne · Hansjörg Ebell · Évi Forgó Baer · Kai Fritzsche · Stefan Geyerhofer · Peter Hain · Woltemade<br />
Hartmann · Thomas Hegemann · Thomas Hess · Liz Lorenz-Wallacher · Corinne Marti Häusler · Ortwin Meiss · Antonio Nadalet · Burkhard Peter · Manfred Prior<br />
Mechthild Reinhard · Willibald Ruch · Gunther Schmidt · Claudia Starke · Bettina von Uslar · Thomas Villiger · Claudia Weinspach · Charlotte Wirl · Patrick Wirz · u.a.<br />
Special Guests: Joachim Faulstich, preisgekrönter Wissenschaftsjournalist sowie Buch- und Dokumentarfilmautor.<br />
jetzt<br />
anmelden!<br />
www.hypnosystemische-tagung.ch<br />
Tagungskosten 15.–17.06.2012 (inkl. Kaffee-Pausen):<br />
Frühbucherrabatt: CHF 444.– / 404.–* · ab 10.10.2011: CHF 555.– / 505.–* · ab 06.06.2012 und vor Ort: CHF 666.– / 606.–*<br />
*Mitglieder ghyps, ief, smsh, M.E.G., systemis.ch
4. Internationale Fachtagung für personzentrierte<br />
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie<br />
"Entwicklung im Focus – das personzentrierte<br />
Verständnis von Veränderung"<br />
Zürich, 21. / 22. April 2012<br />
www.kindertherapietagung.ch<br />
Schweizerische Gesellschaft für den Personzentrierten Ansatz<br />
Weiterbildung. Psychotherapie. Beratung.<br />
<strong>KURSPROGRAMM</strong> <strong>pca</strong>.<strong>acp</strong><br />
<strong>WEITERBILDUNG</strong> – FORTBILDUNG – KURSE<br />
Weiterbildung in Personzentrierter Psychotherapie nach Carl Rogers<br />
Vierjährige Weiterbildung für PsychologInnen, ÄrztInnen und HochschulabsolventInnen im Bereich der<br />
Humanwissenschaften mit zusätzlichen Qualifikationen gemäss Weiterbildungsrichtlinien. <strong>FSP</strong>-, SPV- und<br />
SBAP-Anerkennung. Nächste Weiterbildung beginnt am 23. November 2012<br />
Fortbildungsveranstaltungen für PsychotherapeutInnen und Kurse zum Kennenlernen des PCA<br />
z.B. Kreativitätstraining: Burnout-Prävention und Psychohygiene der besonderen Art, Achtsamkeit für<br />
TherapeutInnen, Biographie-Arbeit und vieles mehr<br />
Bestellung des Kursprogramms und Anmeldung über www.<strong>pca</strong>-<strong>acp</strong>.ch oder:<br />
<strong>pca</strong>.<strong>acp</strong> | Josefstrasse 79 | CH-8005 Zürich | T + 41 44 271 71 70 | F + 41 44 272 72 71 |
Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen<br />
Fédération Suisse des Psychologues<br />
Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi<br />
Kantonal-/Regionalverbände<br />
Associations cantonales/régionales<br />
Associazioni cantonali/regionali<br />
AFP/FPV: Association Fribourgeoise des Psychologues/<br />
Freiburger PsychologInnen-Verband<br />
Vice-présidente: Karin Wörthwein,<br />
S: E. Rumo, Dép. de Psychologie, 2, Rue Faucigny, 1700 Fribourg,<br />
026 300 73 60/76 33, elisabeth.rumo@unifr.ch, www.psyfri.ch<br />
AGPsy: Association Genevoise des Psychologues<br />
P: Pascal Borgeat, S: Pat Goldblat, Rue des Cordiers 12, 1207<br />
Genève 1, 022 735 53 83, agpsy@psy-ge.ch, www.psy-ge.ch<br />
AJBFPP: Association Jurassienne et Bernoise Francophone<br />
des Psychologues et Psychologues-Psychothérapeutes<br />
P: Simone Montavon Vicario,<br />
S: Anne-Catherine Aiassa, La Franay 11, 2735 Malleray,<br />
032 481 40 41, info-ajbfpp@psychologie.ch, www.ajbfpp.ch<br />
ANPP: Association Neuchâteloise des Psychologues et<br />
Psychologues-Psychothérapeutes<br />
P: Jean-Christophe Berger,<br />
S: Magali Kraemer Voirol, Rue Ph. Henri-Mathey 15,<br />
2300 La Chaux-de-Fonds, 079 767 93 03,<br />
magali_kraemer@yahoo.com, www.anpp.ch<br />
APPV/VWPP: Association des Psychologues et Psychothérapeutes<br />
du Valais/Vereinigung der Walliser Psychologen und<br />
Psychotherapeuten<br />
APPV: P: Ambroise Darbellay, S: Nadine Ecabert-Constantin,<br />
Rte d’Italie 71, 1958 Uvrier, 079 369 23 46,<br />
nadine.constantin@gmail.com, www.psy-vs.ch<br />
VWPP: P: Christine Sidler, S: Samuel Bischoff,<br />
Oberdorfstrasse 5, 3930 Eyholz, 027 946 11 14,<br />
samuel.bischoff@gmail.com, www.psy-vs.ch<br />
ATPP: Associazione Ticinese degli Psicologi e degli Psicoterapeuti<br />
P: Fabian Bazzana, S: Segretaria ATPP, Despina Gravvani, CP 112,<br />
6850 Mendrisio, d.gravvani@bluewin.ch, www.atpp.ch<br />
AVP: Association Vaudoise des Psychologues<br />
P: Carlos Iglesias, S: Julia Mosimann, Case postale 62, 1001<br />
Lausanne, 021 323 11 22, avp@psy-vd.ch, www.psy-vd.ch<br />
OSPP: Verband der Ostschweizer Psychologinnen und<br />
Psychologen<br />
P: Markus Sigrist, S: Rolf Franke, Zentrum f. Schulpsychologie<br />
und therap. Dienste, Waisenhausstr. 10, 9100 Herisau,<br />
071 354 71 01, rolf.franke@ar.ch, www.ospp.ch<br />
PPB: Verband der Psychologinnen und Psychologen beider Basel<br />
P: Sandrine Burnand,<br />
S: Eliane Scheidegger, Baselmattweg 145, 4123 Allschwil,<br />
061 264 84 45, ppb@vtxmail.ch, www.ppb.psychologie.ch<br />
VAP: Verband Aargauischer Psychologinnen und Psychologen<br />
P: Sara Michalik-Imfeld,<br />
S: Helen Wehrli, Vorstadtstr. 60, 5024 Küttigen,<br />
info@vap-psychologie.ch, www.vap-psychologie.ch<br />
VBP: Verband Berner Psychologinnen und Psychologen<br />
P: David Schmid, S: Daniela Schäfer, 3000 Bern, 033 654 60 70,<br />
vbp@psychologie.ch, www.vbp.psychologie.ch<br />
VIPP: Verband der Innerschweizer Psychologinnen und<br />
Psychologen<br />
P: Franziska Eder, S: Margareta Reinecke, Berglistrasse 17 a,<br />
6005 Luzern, margareta.reinecke@psychologie.ch, www.vipp.ch<br />
VSP: Verband der Solothurner Psychologinnen und<br />
Psychologen<br />
P: Franz Schlenk,<br />
S: VSP, Postfach 1817, 4502 Solothurn, www.vsp-so.ch<br />
ZüPP: Kantonalverband der Zürcher Psychologinnen und<br />
Psychologen<br />
P: Peter Hain, S: Geschäftsstelle ZüPP, Sonneggstrasse 26,<br />
8006 Zürich, 044 350 53 53, info@zuepp.ch, www.zuepp.ch<br />
Fachverbände<br />
Associations professionnelles<br />
Associazioni professionali<br />
APPOPS/SPPVP: Association des Psychologues et des<br />
Psycho therapeutes d’Orientation Psychanalytique de<br />
Suisse/Schweizer Psychologen- und Psychotherapeuten-<br />
verband Psychoanalytischer Richtung<br />
P: Stephan Wenger, Route de Genolier 14A, 1270 Trélex,<br />
appops@bluewin.ch, www.appops.ch<br />
APSYTRA: Association des Psychologues du Travail et des<br />
Organisations en Suisse Romande<br />
P: Sibylle Heunert Doulfakar, S: Laure Pittet-Dupuis,<br />
info@apsytra.ch, www.apsytra.ch<br />
ASPCo/SVKoP: Association Suisse de psychothérapie<br />
cognitive, Section des Psychologues/Schweizerischer Verein<br />
für kognitive Psychotherapie, PsychologInnensektion<br />
P: Marlène Sartori, S: Joana Iadaresta, 38, av. de Crozet, 1219<br />
Châtelaine, 022 796 39 82, aspcosecretariat@bluewin.ch,<br />
www.aspco.ch<br />
ASPSC-SPVKS: Association suisse des Psychologues<br />
sexologues cliniciens/Schweizerischer Psychologenverband<br />
Klinischer Sexologen<br />
P: Ursula Pasini, S: Yvonne Iglesias, 14 rue du Roveray, 1207 Genève,<br />
022 344 62 67, contact@aspsc-spvks.ch, www.aspsc-spvks.ch<br />
AVM-CH: Psychologensektion der Arbeitsgemeinschaft für<br />
Verhaltensmodifikation Schweiz<br />
P: Alessandra Colombo, S: Manuela Jimenez, AVM-CH Sektion<br />
PsychologInnen, c/o Stiftung AK15, Juravorstadt 42, Pf 4146,<br />
2500 Biel 4, 032 321 59 90, info@avm-ch.ch, www.avm-ch.ch<br />
GhypS: Psychologensektion der Gesellschaft für Klinische<br />
Hypnose Schweiz<br />
P: Josy Höller, S: Carmen Beutler, Bernstrasse 103a, 3052<br />
Zollikofen, 031 911 47 10, info@hypnos.ch, www.hypnos.ch<br />
IBP: PsychologInnen-Sektion des Schweizer Vereins für<br />
Integrative Körperpsychotherapie IBP<br />
P: Jasmin Ackermann, S: Sekretariat IBP, Wartstr. 3, 8400 Winterthur,<br />
052 212 34 30, fv@ibp-institut.ch, www.ibp-institut.ch<br />
IIPB: Sektion Schweiz des Internationalen Instituts für<br />
Psychoanalyse und Psychotherapie Charles Baudouin/Section<br />
Suisse de l‘Institut International de Psychanalyse et de<br />
Psychothérapie Charles Baudouin<br />
P: Thierry Freléchoz, 263, rte de St-Julien,1258 Perly,<br />
frelechoz.t@bluewin.ch<br />
NWP/RPPS: Netzwerk für wissenschaftliche Psychotherapie/<br />
Réseau Professionel de la Psychothérapie Scientifique<br />
P: Daniela Belarbi, S: Linda Rezny, Stauffacherstr. 1, 3014 Bern,<br />
nwp@psychologie.ch, www.nwpsy.ch<br />
<strong>pca</strong>.<strong>acp</strong> (früher SGGT), <strong>FSP</strong>-Sektion der Schweizerischen<br />
Gesellschaft für den Personzentrierten Ansatz/Section <strong>FSP</strong> de<br />
la Société Suisse pour l’approche centrée sur la personne<br />
P: Karin Hegar, S: Josefstrasse 79, 8005 Zürich, 044 271 71 70,<br />
info@<strong>pca</strong>-<strong>acp</strong>.ch, www.<strong>pca</strong>-<strong>acp</strong>.ch<br />
PDH: Psychodrama Helvetia<br />
P: Lilo Steinmann, S: Sekretariat PDH, c/o Brunau-Stiftung,<br />
Edenstr. 20, 8045 Zürich, sekretariat@pdh.ch, www.pdh.ch<br />
SAGKB/GSTIC: Psychologensektion Schweizer Arbeitsgemeinschaft<br />
für Katathymes Bilderleben/Section des Psychologues<br />
du Groupement Suisse de Travail d’Imagination Catathyme<br />
P: Ueli Zingg, S: Sekretariat SAGKB, Postfach 721, Marktgasse 55,<br />
3000 Bern 7, 031 352 47 22, info@sagkb.ch, www.sagkb.ch<br />
SASP/ASPS: Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie/Association<br />
Suisse de Psychologie du Sport<br />
P: Hanspeter Gubelmann, Stauberbergstr. 35, 8610 Uster, 044 942<br />
12 24, hgubelmann@bluewin.ch, www.sportpsychologie.ch<br />
SFDP: Psychologensektion des Schweizerischen<br />
Fachverbandes für Daseinsanalytische Psychotherapie<br />
P: Valeria Gamper, Luegete 16, 8053 Zürich, 044 381 51 51,<br />
sfdp-dai@daseinsanalyse.com, www.daseinsanalyse.com<br />
SGAOP/SSPTO: Schweizerische Gesellschaft für Arbeits- und<br />
Organisationspsychologie/Société suisse de Psychologie du<br />
Travail et des Organisations<br />
P: Tanja Manser, S: Silvia Moser Luthiger, Moser Luthiger & Partner<br />
Consulting, Hintere Bahnhofstrasse 9, 8853 Lachen, 055 442 91<br />
02, E-Mail: info@sgaop.ch, www.sgaop.ch<br />
SGAT/SSTA: Psychologensektion der Schweizerischen Ärzte-<br />
und Psychotherapeuten-Gesellschaft für Autogenes Training<br />
und verwandte Verfahren/Section des Psychologues de la<br />
Société Suisse des Médecins et Psychothérapeutes pratiquant<br />
le Training Autogène et méthodes apparentées<br />
P: Marianne Jossi, Bergstrasse 160, 8032 Zürich, marianne.<br />
jossi@psychologie.ch, sekretariat@sgat.ch, www.sgat.ch<br />
SGFBL: Schweizerische Gesellschaft für Fachpsychologie in<br />
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung<br />
P: Priska Fritsche, S: Geschäftsstelle SGFBL, Im Russer 108, 8708<br />
Männedorf, 079 827 39 05, psychologie@sgfbl.ch, www.sgfbl.ch<br />
Choisystr. 11, Postfach, 3000 Bern 14<br />
031 388 88 00, fsp@psychologie.ch<br />
www.psychologie.ch<br />
SGGPsy/SSPsyS: Schweizerische Gesellschaft für Gesundheitspsychologie/Société<br />
Suisse de Psychologie de la Santé<br />
P: Holger Schmid, Fachhochschule Nordwestschweiz,<br />
Institut für Soziale Arbeit und Gesundheit, Riggenbachstr. 16,<br />
4600 Olten, 062 311 95 97, holger.schmid@fhnw.ch,<br />
www.healthpsychology.ch<br />
SGIT: PsychologInnen-Sektion der Schweizerischen Gesellschaft<br />
für Integrative Therapie/Section des psychologues de<br />
la société suisse de thérapie intégrative<br />
P: Andreas Collenberg, S: Lotti Müller, Birt 519, 9042 Speicher,<br />
071 244 25 58, lomueseag@bluewin.ch,<br />
www.integrativetherapie-schweiz.ch<br />
SGP/SSP: Schweizerische Gesellschaft für Psychologie/<br />
Société Suisse de Psychologie<br />
P: Marianne Schmid Mast, S: Heidi Ruprecht, Dep. of Work<br />
and Organizational Psychology, University of Neuchâtel,<br />
Rue Emile-Argand 11, 2009 Neuchâtel, 078 902 26 95, sekretariat@ssp-sgp.ch,<br />
www.ssp-sgp.ch<br />
SGPO: Sektion <strong>FSP</strong> der Schweizerischen Gesellschaft für<br />
Psycho-Onkologie/Section <strong>FSP</strong> de la Société Suisse de<br />
Psycho-Oncologie<br />
P: Diana Zwahlen, S: Claudia Bigler, c/o Krebsliga Schweiz,<br />
Effingerstrasse 40, 3001 Bern, 031 389 91 30,<br />
kontakt@psycho-onkologie.ch, www.psycho-onkologie.ch<br />
SGRP/SSPL: Schweizerische Gesellschaft für Rechtspsychologie/Société<br />
Suisse de Psychologie Légale<br />
P: Leena Hässig, S: Jürg Vetter, Im Eisernen Zeit 21, 8057 Zürich,<br />
078 746 38 80, jvetter@datacomm.ch, www.rechtspsychologie.ch<br />
SGS-P (neu systemis.ch): PsychologInnensektion der<br />
Schweizerischen Gesellschaft für Systemtherapie<br />
P: Thomas Estermann, S: Beatrice Wapp, Mühleplatz 10,<br />
6004 Luzern, 041 410 66 57, www.systemis.ch<br />
SGVT-PsyS/SSTCC-PsyS: Sektion PsychologInnen der<br />
Schweizerischen Gesellschaft für Verhaltens- und Kognitive<br />
Therapie/Section des psychologues de la Société Suisse de<br />
Thérapie Comportementale et Cognitive<br />
P: Claudine Ott-Chervet, S: Laurence Swoboda-Bohren, Worblaufenstr.<br />
163, Postfach 30, 3048 Worblaufen, 031 311 12 12 (Mo/Di),<br />
info@sgvt-sstcc.ch, www.sgvt-sstcc.ch<br />
SKJP/ASPEA: Schweizerische Vereinigung für Kinder- und<br />
Jugendpsychologie/Association Suisse de Psychologie de<br />
l’enfance et de l’adolescence<br />
P: Roland Buchli, S: SKJP Geschäftsstelle, Josef Stamm, Postfach<br />
4720, 6002 Luzern, 041 420 03 03, info@skjp.ch, www.skjp.ch<br />
SPK: Sektion <strong>FSP</strong> der Schweizerischen Gesellschaft der<br />
PsychotherapeutInnen für Kinder und Jugendliche/Section<br />
<strong>FSP</strong> de la Société Suisse des Psychothérapeutes d’enfants et<br />
d’adolescents<br />
P: Roland Straub, Brambergerstrasse 3, 6004 Luzern,<br />
041 410 46 25, roland.straub@bluemail.ch, www.spkspk.ch<br />
SSCP: Swiss Society for Coaching Psychology<br />
P: Ursula Niederhauser, Postfach 855, 3000 Bern 9,<br />
031 302 58 54, info@coaching-psychology.ch, www.sscp.ch<br />
SVG: PsychologInnensektion des Schweizer Vereins für<br />
Gestalttherapie und Integrative Therapie<br />
P: Daniel Emmenegger, Scheibenschachenstr. 10, 5000 Aarau,<br />
062 822 71 58, daniel.e@gmx.ch, www.gestalttherapie.ch<br />
SVKP/ASPC: Schweizerische Vereinigung Klinischer Psychologinnen<br />
und Psychologen/Association Suisse des Psychologues<br />
Cliniciennes et Cliniciens<br />
P: Monika Bamberger, S: Eliane Scheidegger, Reichensteinerstr. 18,<br />
4053 Basel, 061 264 84 44, sekretariat@svkp.ch, www.svkp.ch<br />
SVNP/ASNP: Schweizerische Vereinigung der Neuropsychologinnen<br />
und Neuropsychologen/Association Suisse des<br />
Neuropsychologues<br />
P: Gregor Steiger-Bächler,<br />
S: Sekretariat SVNP, Gabriela Deutsch, c/o IMK Institut für<br />
Medizin und Kommunikation AG, Münsterberg 1, 4001 Basel,<br />
061 271 35 51, svnp@imk.ch, www.neuropsychologie.ch<br />
VfV/SPC: Schweizerische Vereinigung für Verkehrspsychologie/Société<br />
Suisse de Psychologie de la Circulation<br />
P: Andreas Widmer, Marktgasse 34, 4600 Olten, 062 212 55 56,<br />
andreas.widmer@psychologie.ch, www.vfv-spc.ch<br />
VNP.CH: Verein notfallpsychologie.ch<br />
P: Jacqueline Frossard,<br />
S: Katharina Lyner, Neuhofweg 23, 4102 Binningen,<br />
079 734 92 42, lynkat@intergga.ch