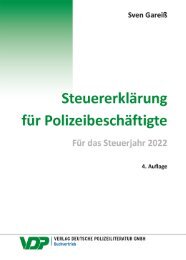Polizeiliche Berufsethik - Leseprobe
Von Beginn an gehört es zum polizeilichen Berufsalltag, gezielt und systematisch über das eigene berufliche Handeln und die ihm zugrunde liegenden Maßstäbe nachzudenken. Dies erfordert von den Polizeibeamtinnen und -beamten die Fähigkeit zur Reflexion und eine ausgebildete ethische Kompetenz. Ausgehend von Fallbeispielen leitet dieses Studienbuch zur ethischen Analyse polizeilicher Alltagspraxis und zur Reflexion des eigenen Berufsverständnisses an.
Von Beginn an gehört es zum polizeilichen Berufsalltag, gezielt und systematisch über das eigene berufliche Handeln und die ihm zugrunde liegenden Maßstäbe nachzudenken. Dies erfordert von den Polizeibeamtinnen und -beamten die Fähigkeit zur Reflexion und eine ausgebildete ethische Kompetenz.
Ausgehend von Fallbeispielen leitet dieses Studienbuch zur ethischen Analyse polizeilicher Alltagspraxis und zur Reflexion des eigenen Berufsverständnisses an.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Vorwort zur zweiten Auflage ............................................................................................... 5<br />
Einführung ............................................................................................................................ 6<br />
Aufbau des Studienbuchs .................................................................................................... 6<br />
Kapitel 1<br />
Kein Beruf wie jeder andere!<br />
Ein erster Zugang zu ethischen Herausforderungen der polizeilichen Arbeit ................. 14<br />
1.1 Die Bedeutung von Vertrauen und das Potenzial für Misstrauen im Polizeiberuf .. 15<br />
1.2 Ein Versuch moralischer Orientierung:<br />
Sieben Gebote für den Polizeibeamten (1945) ...................................................... 19<br />
1.3 Moralische Normen und Werte ............................................................................. 21<br />
1.4 <strong>Polizeiliche</strong> Organisationskulturen als Wertsysteme .............................................. 24<br />
1.5 Was ist eine gute Polizistin, ein guter Polizist? ....................................................... 29<br />
1.6 Berufsmotivation und Berufsbilder ........................................................................ 33<br />
1.6.1 Berufsbild „Freund und Helfer“:<br />
Vertrauen ist möglich – die Bannung der Angst vor der Polizei ............................. 35<br />
1.6.2 Berufsbild „Schutzmann“:<br />
Vertrauen ist nötig – die Bannung der Angst mithilfe der Polizei ........................... 37<br />
1.6.3 Berufsbild „Krieger“: Vertrauen in den eigenen Mut –<br />
die Überwindung von Angst in der Polizei .............................................................. 38<br />
1.6.4 Berufsbild „Jäger“: Vertrauen in das eigene Können ............................................. 41<br />
1.7 Der Diensteid ........................................................................................................... 46<br />
1.7.1 Versprechen – „Inseln in einem Meer der Ungewißheit“<br />
(Arendt 1981, S. 240) .............................................................................................. 46<br />
1.7.2 Der Eid als moralisches „Hochleistungsversprechen“ ............................................ 48<br />
1.7.3 Das Gewissen .......................................................................................................... 52<br />
1.8 Weiterführende Literatur ........................................................................................ 54<br />
1.9 Quellen zu Kapitel 1 ................................................................................................ 54<br />
1.10 Kontrollfragen zum erlangten Wissensstand .......................................................... 62<br />
<strong>Leseprobe</strong><br />
Kapitel 2<br />
Unantastbar? Von wegen!!<br />
Achtung und Schutz der Menschenwürde als Fundament und<br />
ständige Herausforderung polizeilicher Arbeit ................................................................. 63<br />
2.1 Wann ist die Menschenwürde verletzt? Einige Fallstudien .................................... 65<br />
2.2 Menschenwürde als Fundament der Menschenrechte ......................................... 67<br />
2.3 Verschiedene Würdeverständnisse ......................................................................... 67<br />
2.4 Der Würdeanspruch als Schutz der Selbstachtung ................................................. 69<br />
2.5 Achtung der Menschenwürde als vorgängiges und unhintergehbares Prinzip ..... 72<br />
© VERLAG DEUTSCHE POLIZILITERATUR GMBH Buchvertrieb, Hilden/Rhld.<br />
Wagener„<strong>Polizeiliche</strong> <strong>Berufsethik</strong>“, 2. Auflage 2019, ISBN 978-3-8011-0814-4
Inhaltsverzeichnis<br />
2.6 Moralische Dilemmata zwischen Folterverbot und Schutz des Lebens ................. 73<br />
2.7 Ist die Würde des Staatsdieners unantastbar? ...................................................... 77<br />
2.8 Weiterführende Literatur ........................................................................................ 80<br />
2.9 Quellen zu Kapitel 2 ................................................................................................ 80<br />
2.10 Kontrollfragen zum erlangten Wissensstand .......................................................... 84<br />
Kapitel 3<br />
Wir tragen Waffen und wenn es sein muss, benutzen wir sie auch.<br />
Polizistinnen und Polizisten als Vertreter des staatlichen Gewaltmonopols .................. 85<br />
3.1 Das staatliche Gewaltmonopol in Theorie und Praxis ............................................ 86<br />
3.1.1 Die Entwicklung des staatlichen Gewaltmonopols in der Neuzeit ......................... 86<br />
3.1.2 Die verfassungsrechtliche Ausgestaltung des Gewaltmonopols<br />
in der Bundesrepublik Deutschland ........................................................................ 90<br />
3.1.3 Zwischen Durchsetzungsfähigkeit und rechtsstaatlicher Begrenzung:<br />
die grundlegende Spannung des staatlichen Gewaltmonopols ............................. 90<br />
3.1.4 Macht und Machtlosigkeit: Paradoxien der polizeilichen Macht und Kontrolle .... 92<br />
3.1.5 Die innere Spannung des Gewaltmonopols und<br />
die polizeiliche Organisationskultur ........................................................................ 95<br />
3.2 Aggression und Gewalt in anthropologischer Sicht ................................................ 96<br />
3.2.1 Sozialpsychologische und neurobiologische Grundlagen der Aggression ............. 96<br />
3.2.2 Allgemeines Theoriemodell der Gewalt ................................................................. 99<br />
3.2.3 Grundprobleme professioneller Gewaltausübung ............................................... 100<br />
3.3 Verantwortungsvolle Gestaltung des Gewaltmonopols:<br />
berufsethische Überlegungen und Ansätze .......................................................... 106<br />
3.3.1 Struktureller Ansatz: Maßnahmen auf der Organisationsebene ......................... 107<br />
3.3.2 Ansätze zur Stärkung von Professionalität und Rollenstabilität<br />
der Beamtinnen und Beamten ............................................................................. 108<br />
3.4 Lebensbedrohliche Einsatzlagen ........................................................................... 112<br />
3.4.1 Die terroristische Bedrohung und die Reaktion westlicher Gesellschaften ......... 113<br />
3.4.2 Herausforderungen für Einsatz- und Führungskräfte ........................................... 115<br />
3.5 Weiterführende Literatur ...................................................................................... 119<br />
3.6 Quellen zu Kapitel 3 .............................................................................................. 120<br />
3.7 Kontrollfragen zum erlangten Wissensstand ........................................................ 124<br />
<strong>Leseprobe</strong><br />
Kapitel 4<br />
Wir helfen den Opfern – aber manche sind selbst schuld!<br />
Menschlichkeit, Mitgefühl und Professionalität ............................................................. 125<br />
4.1 Interventionskonzepte gegen häusliche Gewalt bzw.<br />
Gewalt im sozialen Nahraum ................................................................................ 127<br />
4.2 Häusliche Gewalt:<br />
Mythen und Fakten zur Phänomenologie und Verbreitung ................................. 130<br />
4.2.1 Häusliche Gewalt – ein Unterschichtsproblem? ................................................... 130<br />
© VERLAG DEUTSCHE POLIZILITERATUR GMBH Buchvertrieb, Hilden/Rhld.<br />
Wagener„<strong>Polizeiliche</strong> <strong>Berufsethik</strong>“, 2. Auflage 2019, ISBN 978-3-8011-0814-4
Inhaltsverzeichnis<br />
4.2.2 „Häusliche Gewalt = Männergewalt“ oder: „Häusliche Gewalt ist weiblich“? .... 131<br />
4.2.3 Männer schlagen, Frauen üben Psychoterror aus? .............................................. 134<br />
4.2.4 Gegenseitigkeit oder Einseitigkeit von Partnergewalt? ........................................ 135<br />
4.2.5 Gewalt und Geschlechterverhältnisse:<br />
Verletzungsmacht und Verletzungsoffenheit ....................................................... 135<br />
4.3 Verlaufsmodelle bei Partnergewalt: die Gewaltspirale, Strategien<br />
der Gewaltopfer und Überlegungen zu einem differenzierten Prozessmodell ... 136<br />
4.3.1 Die Gewaltspirale .................................................................................................. 137<br />
4.3.2 Gewaltverläufe und Opferstrategien .................................................................... 140<br />
4.4 Gutes Opfer – böses Opfer: die moralische und<br />
ethische Zwiespältigkeit des Opferbegriffs ........................................................... 142<br />
4.4.1 Zwei Seiten des Opferbegriffs ............................................................................... 142<br />
4.4.2 Konzepte des „idealen“ Opfers ............................................................................. 143<br />
4.4.3 Auswirkungen von Opferkonzepten im Bereich häuslicher Gewalt ..................... 144<br />
4.4.4 Ist der Opferbegriff überhaupt noch verwendbar? .............................................. 146<br />
4.5 Belastungen von Polizeibeamtinnen und -beamten im Zusam menhang<br />
mit Einsätzen häuslicher Gewalt ........................................................................... 147<br />
4.5.1 Verletzungsrisiko bei Einsätzen häuslicher Gewalt ............................................... 147<br />
4.5.2 Emotionale Belastungen und moralische Bedenken ............................................ 147<br />
4.5.3 Distanzierungsstrategien ....................................................................................... 149<br />
4.6 Berufsethische Überlegungen zum polizeilichen Umgang<br />
mit häuslicher Gewalt ........................................................................................... 150<br />
4.7 Weiterführende Literatur ...................................................................................... 153<br />
4.8 Quellen zu Kapitel 4 .............................................................................................. 153<br />
4.9 Kontrollfragen zum erlangten Wissensstand ........................................................ 157<br />
Kapitel 5<br />
Wenn einem die Worte fehlen …<br />
<strong>Polizeiliche</strong>r Umgang mit Sterben, Tod und Trauer ........................................................ 159<br />
5.1 Der polizeiliche Umgang mit Sterben, Tod und Trauer ......................................... 160<br />
5.2 Ethik der Fürsorge – Ethik der Selbstsorge. Zur Ausbalancierung von<br />
Verpflichtungen gegen sich selbst und andere ..................................................... 163<br />
5.3 Umgang mit Verletzten am Unfallort .................................................................... 164<br />
5.3.1 Notfallstress bei (Verkehrs-)Unfällen .................................................................... 165<br />
5.3.2 Betreuung von Verletzten am Unfallort ................................................................ 165<br />
5.4 Was geschieht, wenn ein Mensch trauert?<br />
Erkenntnisse moderner Trauerforschung ............................................................. 167<br />
5.4.1 Modelle des Trauerprozesses und der Trauerbegleitung ..................................... 167<br />
5.4.2 „Schleusenzeit“: die Bedeutung der ersten Trauerphase<br />
für den gesamten Trauerprozess .......................................................................... 170<br />
5.4.3 Reaktionen und Bedürfnisse der Angehörigen bei einem<br />
unvorhergesehenen Todesfall ............................................................................... 171<br />
<strong>Leseprobe</strong><br />
© VERLAG DEUTSCHE POLIZILITERATUR GMBH Buchvertrieb, Hilden/Rhld.<br />
Wagener„<strong>Polizeiliche</strong> <strong>Berufsethik</strong>“, 2. Auflage 2019, ISBN 978-3-8011-0814-4
Inhaltsverzeichnis<br />
5.5 Überbringen von Todesnachrichten ..................................................................... 173<br />
5.5.1 Todesbenachrichtigung als Stresssituation ........................................................... 173<br />
5.5.2 Empathie als professionelle Schlüsselkompetenz ................................................ 174<br />
5.5.3 Todesbenachrichtigung konkret: Tipps für Überbringende .................................. 176<br />
5.5.4 Einige in der Aus- und Weiterbildung häufig gestellte Fragen ............................. 177<br />
5.6 Interview Polizeiseelsorge ..................................................................................... 179<br />
5.7 Weiterführende Literatur ...................................................................................... 183<br />
5.8 Quellen zu Kapitel 5 .............................................................................................. 183<br />
5.9 Kontrollfragen zum erlangten Wissensstand ........................................................ 185<br />
Kapitel 6<br />
Den Dingen auf den Grund gehen.<br />
Zum Theoriehintergrund des Faches <strong>Polizeiliche</strong> <strong>Berufsethik</strong> ....................................... 187<br />
6.1 Zum Profil des Faches <strong>Berufsethik</strong> ........................................................................ 187<br />
6.2 Zentrale Begriffe der Ethik .................................................................................... 189<br />
6.2.1 Moral, Moralität, Ethik .......................................................................................... 189<br />
6.2.2 Werte und Normen ............................................................................................... 191<br />
6.3 Theorien der menschlichen Moralentwicklung ................................................... 192<br />
6.3.1 Ansätze von Moralerziehung bzw. ethischer Bildung ........................................... 193<br />
6.4 Stufenmodelle der Moralentwicklung .................................................................. 195<br />
6.4.1 Lawrence Kohlbergs Stufenmodell der Entwicklung<br />
moralischen Urteilsvermögens ............................................................................. 196<br />
6.4.2 Das Stufenmodell von Carol Gilligan .................................................................... 198<br />
6.4.3 Ethik der Gerechtigkeit oder Ethik der Fürsorge:<br />
die Kohlberg-Gilligan-Kontroverse ........................................................................ 202<br />
6.5 Grundmodelle ethischen Nachdenkens und Argumentierens ............................. 204<br />
6.5.1 Ethik des Guten – Ethik des Richtigen ................................................................... 204<br />
6.5.2 Drei ethische Theoriemodelle: Tugendethik, teleologische bzw.<br />
konsequentialistische Ethik und deontologische Moraltheorie ........................... 205<br />
6.6 Verfahren ethisch reflektierter Urteilsfindung ..................................................... 214<br />
6.7 Weiterführende Literatur ...................................................................................... 217<br />
6.8 Quellen zu Kapitel 6 .............................................................................................. 217<br />
6.9 Kontrollfragen zum erlangten Wissensstand ........................................................ 219<br />
<strong>Leseprobe</strong><br />
Abbildungsverzeichnis......................................................................................................... 221<br />
Tabellenverzeichnis.............................................................................................................. 222<br />
Personenverzeichnis ......................................................................................................... 223<br />
Stichwortverzeichnis ........................................................................................................ 227<br />
© VERLAG DEUTSCHE POLIZILITERATUR GMBH Buchvertrieb, Hilden/Rhld.<br />
Wagener„<strong>Polizeiliche</strong> <strong>Berufsethik</strong>“, 2. Auflage 2019, ISBN 978-3-8011-0814-4
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek<br />
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der<br />
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten<br />
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.<br />
<strong>Leseprobe</strong><br />
www.VDPolizei.de<br />
2. Auflage 2019<br />
© VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH Buchvertrieb; Hilden/Rhld., 2019<br />
Alle Rechte vorbehalten<br />
Satz: VDP GMBH Buchvertrieb, Hilden<br />
Druck und Bindung: Hubert & Co, Göttingen<br />
Printed in Germany<br />
ISBN 978-3-8011-0814-4<br />
© VERLAG DEUTSCHE POLIZILITERATUR GMBH Buchvertrieb, Hilden/Rhld.<br />
Wagener„<strong>Polizeiliche</strong> <strong>Berufsethik</strong>“, 2. Auflage 2019, ISBN 978-3-8011-0814-4
Vorwort zur zweiten Auflage<br />
Vorwort zur zweiten Auflage<br />
Die erste Auflage des Studienbuches <strong>Berufsethik</strong> ist seit einiger Zeit vergriffen. Ich freue<br />
mich sehr, dass das Buch so gute Resonanz gefunden hat. Es ist zu einer wichtigen Quelle<br />
für Ethik-Dozenten und -Dozentinnen sowie Studierende und Auszubildende im Polizeiberuf<br />
geworden.<br />
Dem Verlag Deutsche Polizeiliteratur und mir hat sich die Frage gestellt, ob das Buch in der<br />
ersten Fassung nachgedruckt werden soll oder ob eine aktualisierte und überarbeitete zweite<br />
Auflage herausgebracht werden soll.<br />
Für eine Überarbeitung sprach vor allem, dass verschiedene Ereignisse und Entwicklungen<br />
seit 2015 in der polizeilichen <strong>Berufsethik</strong> Berücksichtigung finden sollten. Insbesondere<br />
die Herausforderungen durch den internationalen Terrorismus sind mit dem Anschlag auf<br />
den Berliner Breitscheidplatz sehr deutlich geworden. Die deutschen Polizeien haben auf<br />
die fortdauernde Gefährdung mit verbesserter Ausrüstung und neuen Einsatzkonzepten<br />
reagiert. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Terrorismusbekämpfung viele ethische Fragen<br />
mit sich bringt, auf die in polizeilicher Aus- und Fortbildung eingegangen werden sollte.<br />
Ich habe mich deshalb entschieden, für diese zweite Auflage das Thema „Ethische Aspekte<br />
lebensbedrohlicher Einsatzlagen“ neu aufzunehmen (Teilkapitel 3.4). Darüber hinaus habe<br />
ich die vorhandenen Kapitel durchgesehen, neuere Entwicklungen ergänzt und die Literatur<br />
aktualisiert.<br />
Wie schon in der ersten Auflage konnte ich auch diesmal auf die bewährte Zusammenarbeit<br />
mit meinem Kollegen Werner Schiewek von der Deutschen Hochschule der Polizei zurückgreifen.<br />
Das neue Teilkapitel zu lebensbedrohlichen Einsatzlagen verdankt viele Überlegungen<br />
einem Seminar, das wir im Herbst 2017 gemeinsam an der DHPol durchgeführt haben.<br />
Des Weiteren danke ich Volkmar Hackbarth und dem Team der Lehrtrainer im Institutsbereich<br />
Einsatztraining der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg sowie Jana Schmidt<br />
vom polizeipsychologischen Dienst des Landes Baden-Württemberg für das gemeinsame<br />
Engagement, ethische Fragen ins Einsatztraining zu integrieren.<br />
Ich hoffe, dass diese überarbeitete und ergänzte zweite Auflage des Studienbuches wiederum<br />
aufmerksame und interessierte Leserinnen und Leser findet, die sich von den ethischen<br />
Überlegungen des Buches zu eigenem ethischen Denken und Reflektieren anregen lassen.<br />
Freiburg, im Mai 2019<br />
Ulrike Wagener<br />
<strong>Leseprobe</strong><br />
© VERLAG DEUTSCHE POLIZILITERATUR GMBH Buchvertrieb, Hilden/Rhld.<br />
Wagener„<strong>Polizeiliche</strong> <strong>Berufsethik</strong>“, 2. Auflage 2019, ISBN 978-3-8011-0814-4
Einführung<br />
Einführung<br />
Das Fach <strong>Berufsethik</strong> hat die Aufgabe, Sie in die Lage zu versetzen,<br />
––<br />
ethische Aspekte polizeilichen Handelns zu identifizieren und adäquat zu beschreiben,<br />
––<br />
komplexe Handlungssituationen unter ethischen Aspekten differenziert zu analysieren,<br />
––<br />
einen systematischen Weg moralischer Entscheidungsfindung zu beschreiten und<br />
––<br />
eigene moralische Überzeugungen zu reflektieren.<br />
Diese Aspekte greift das vorliegende Studienbuch auf, das für das Fach <strong>Polizeiliche</strong> <strong>Berufsethik</strong><br />
insbesondere im Bachelor-Studiengang für den gehobenen Polizeivollzugsdienst<br />
konzipiert ist. In mehrfacher Hinsicht schließt es eine Lücke: Neben einem praxisorientierten<br />
Überblick über zentrale Probleme, Argumentationen und Lösungen polizeilicher <strong>Berufsethik</strong><br />
vermittelt es durch die Bearbeitung konkreter Fallbeispiele aus der Praxis prüfungsrelevante<br />
Kompetenzen ethischen Denkens und Urteilens. Es ist also für das Selbststudium ebenso verwendbar<br />
wie im Kontaktstudium (Seminar) und zur Prüfungsvorbereitung. Darüber hinaus<br />
ist dieses Buch interdisziplinär angelegt und greift auf Erkenntnisse unterschiedlicher Fachdisziplinen<br />
wie Führungswissenschaften, Neurobiologie, Psychologie oder Soziologie zurück.<br />
Aufbau des Studienbuchs<br />
Im einführenden Kapitel 1 werden Grundsatzfragen polizeilicher <strong>Berufsethik</strong> behandelt.<br />
Dieses Kapitel ist die gekürzte und von mir überarbeitete Fassung eines Textes von Werner<br />
Schiewek, den dieser für das Buch zur Verfügung gestellt hat. Meinen herzlichen Dank dafür.<br />
Die Kapitel 2–5 diskutieren konkrete Bereiche der Polizeiarbeit unter ethischen Aspekten<br />
und haben weitgehend die gleiche Struktur:<br />
Nach der Einführung in das jeweilige Thema gibt es am Beispiel von drei fiktiven Polizistinnen<br />
und Polizisten (Alexander, Bianca und Marc) zwischen 20 und 33 Jahren, die sich in einem<br />
sozialen Netzwerk über Berufliches austauschen, persönliche Perspektiven auf praktische<br />
Fragestellungen des Themas. Die Arbeitsaufgaben schließen sich an praktische Fallbeispiele<br />
an. Diese Sachverhalte sind exemplarisch zu analysieren und ethisch zu bewerten. An<br />
dieser Stelle danke ich Jürgen Sterk, Yvonne Waldboth, Pia Winkler und den Studierenden<br />
der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen, von denen ich<br />
praktische Fallschilderungen in verfremdeter Form übernommen habe.<br />
<strong>Leseprobe</strong><br />
In den Materialteilen wird das für die Analyse der Fallbeispiele notwendige polizeiwissenschaftliche<br />
Fachwissen in komprimierter Form geboten. Ebenso wird ethisches Theorie- und<br />
Methodenwissen eingebracht, soweit es für die Bearbeitung des jeweiligen Themas notwendig<br />
ist. Querverweise zwischen den verschiedenen Materialteilen ermöglichen es außerdem,<br />
fachliche Verbindungen und Zusammenhänge zu erschließen. Wer das Buch auf diese<br />
Weise als Kompendium benutzt, wird von den Kontrollfragen profitieren, die am Ende der<br />
jeweiligen Kapitel zur selbstständigen Überprüfung des eigenen Wissensstandes einladen.<br />
In den fortlaufenden Text der Materialteile wurden Textkästen eingebaut, die Folgendes<br />
enthalten können:<br />
© VERLAG DEUTSCHE POLIZILITERATUR GMBH Buchvertrieb, Hilden/Rhld.<br />
Wagener„<strong>Polizeiliche</strong> <strong>Berufsethik</strong>“, 2. Auflage 2019, ISBN 978-3-8011-0814-4
Aufbau des Studienbuchs<br />
––<br />
eine pointierte Aussage, die zur Diskussion herausfordert,<br />
––<br />
die Definition eines wichtigen Begriffes oder<br />
––<br />
ein Zitat aus einer maßgeblichen Originalquelle.<br />
Wird in einem Materialteil ein recht komplexer Sachverhalt argumentativ entwickelt, so wird<br />
das Ergebnis in einem ebenfalls hervorgehobenen Fazit zusammengefasst. Des Weiteren<br />
enthält jeder Teil weiterführende Literaturhinweise sowie ein komplettes Verzeichnis der in<br />
den Materialteilen verwendeten Quellen.<br />
Das abschließende Kapitel 6 bietet vertieftes Theoriewissen der philosophischen Ethik,<br />
soweit es – nach meinem Dafürhalten – für ein gutes Verständnis berufsethischer Problemstellungen<br />
wichtig ist. Von diesem Kapitel dürften insbesondere Studierende profitieren, die<br />
eine Seminar- oder Bachelorarbeit im Bereich der <strong>Berufsethik</strong> schreiben.<br />
Der Index am Ende des Buches ermöglicht es, gezielt nach zentralen Begriffen sowie nach<br />
Autorinnen und Autoren zu suchen.<br />
Über Rückmeldungen – seien sie bestätigender oder kritischer Art – freue ich mich.<br />
<strong>Leseprobe</strong><br />
© VERLAG DEUTSCHE POLIZILITERATUR GMBH Buchvertrieb, Hilden/Rhld.<br />
Wagener„<strong>Polizeiliche</strong> <strong>Berufsethik</strong>“, 2. Auflage 2019, ISBN 978-3-8011-0814-4
<strong>Leseprobe</strong>
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Vorwort zur zweiten Auflage ............................................................................................... 5<br />
Einführung ............................................................................................................................ 6<br />
Aufbau des Studienbuchs .................................................................................................... 6<br />
Kapitel 1<br />
Kein Beruf wie jeder andere!<br />
Ein erster Zugang zu ethischen Herausforderungen der polizeilichen Arbeit ................. 14<br />
1.1 Die Bedeutung von Vertrauen und das Potenzial für Misstrauen im Polizeiberuf .. 15<br />
1.2 Ein Versuch moralischer Orientierung:<br />
Sieben Gebote für den Polizeibeamten (1945) ...................................................... 19<br />
1.3 Moralische Normen und Werte ............................................................................. 21<br />
1.4 <strong>Polizeiliche</strong> Organisationskulturen als Wertsysteme .............................................. 24<br />
1.5 Was ist eine gute Polizistin, ein guter Polizist? ....................................................... 29<br />
1.6 Berufsmotivation und Berufsbilder ........................................................................ 33<br />
1.6.1 Berufsbild „Freund und Helfer“:<br />
Vertrauen ist möglich – die Bannung der Angst vor der Polizei ............................. 35<br />
1.6.2 Berufsbild „Schutzmann“:<br />
Vertrauen ist nötig – die Bannung der Angst mithilfe der Polizei ........................... 37<br />
1.6.3 Berufsbild „Krieger“: Vertrauen in den eigenen Mut –<br />
die Überwindung von Angst in der Polizei .............................................................. 38<br />
1.6.4 Berufsbild „Jäger“: Vertrauen in das eigene Können ............................................. 41<br />
1.7 Der Diensteid ........................................................................................................... 46<br />
1.7.1 Versprechen – „Inseln in einem Meer der Ungewißheit“<br />
(Arendt 1981, S. 240) .............................................................................................. 46<br />
1.7.2 Der Eid als moralisches „Hochleistungsversprechen“ ............................................ 48<br />
1.7.3 Das Gewissen .......................................................................................................... 52<br />
1.8 Weiterführende Literatur ........................................................................................ 54<br />
1.9 Quellen zu Kapitel 1 ................................................................................................ 54<br />
1.10 Kontrollfragen zum erlangten Wissensstand .......................................................... 62<br />
<strong>Leseprobe</strong><br />
Kapitel 2<br />
Unantastbar? Von wegen!!<br />
Achtung und Schutz der Menschenwürde als Fundament und<br />
ständige Herausforderung polizeilicher Arbeit ................................................................. 63<br />
2.1 Wann ist die Menschenwürde verletzt? Einige Fallstudien .................................... 65<br />
2.2 Menschenwürde als Fundament der Menschenrechte ......................................... 67<br />
2.3 Verschiedene Würdeverständnisse ......................................................................... 67<br />
2.4 Der Würdeanspruch als Schutz der Selbstachtung ................................................. 69<br />
2.5 Achtung der Menschenwürde als vorgängiges und unhintergehbares Prinzip ..... 72<br />
© VERLAG DEUTSCHE POLIZILITERATUR GMBH Buchvertrieb, Hilden/Rhld.<br />
Wagener„<strong>Polizeiliche</strong> <strong>Berufsethik</strong>“, 2. Auflage 2019, ISBN 978-3-8011-0814-4
Inhaltsverzeichnis<br />
2.6 Moralische Dilemmata zwischen Folterverbot und Schutz des Lebens ................. 73<br />
2.7 Ist die Würde des Staatsdieners unantastbar? ...................................................... 77<br />
2.8 Weiterführende Literatur ........................................................................................ 80<br />
2.9 Quellen zu Kapitel 2 ................................................................................................ 80<br />
2.10 Kontrollfragen zum erlangten Wissensstand .......................................................... 84<br />
Kapitel 3<br />
Wir tragen Waffen und wenn es sein muss, benutzen wir sie auch.<br />
Polizistinnen und Polizisten als Vertreter des staatlichen Gewaltmonopols .................. 85<br />
3.1 Das staatliche Gewaltmonopol in Theorie und Praxis ............................................ 86<br />
3.1.1 Die Entwicklung des staatlichen Gewaltmonopols in der Neuzeit ......................... 86<br />
3.1.2 Die verfassungsrechtliche Ausgestaltung des Gewaltmonopols<br />
in der Bundesrepublik Deutschland ........................................................................ 90<br />
3.1.3 Zwischen Durchsetzungsfähigkeit und rechtsstaatlicher Begrenzung:<br />
die grundlegende Spannung des staatlichen Gewaltmonopols ............................. 90<br />
3.1.4 Macht und Machtlosigkeit: Paradoxien der polizeilichen Macht und Kontrolle .... 92<br />
3.1.5 Die innere Spannung des Gewaltmonopols und<br />
die polizeiliche Organisationskultur ........................................................................ 95<br />
3.2 Aggression und Gewalt in anthropologischer Sicht ................................................ 96<br />
3.2.1 Sozialpsychologische und neurobiologische Grundlagen der Aggression ............. 96<br />
3.2.2 Allgemeines Theoriemodell der Gewalt ................................................................. 99<br />
3.2.3 Grundprobleme professioneller Gewaltausübung ............................................... 100<br />
3.3 Verantwortungsvolle Gestaltung des Gewaltmonopols:<br />
berufsethische Überlegungen und Ansätze .......................................................... 106<br />
3.3.1 Struktureller Ansatz: Maßnahmen auf der Organisationsebene ......................... 107<br />
3.3.2 Ansätze zur Stärkung von Professionalität und Rollenstabilität<br />
der Beamtinnen und Beamten ............................................................................. 108<br />
3.4 Lebensbedrohliche Einsatzlagen ........................................................................... 112<br />
3.4.1 Die terroristische Bedrohung und die Reaktion westlicher Gesellschaften ......... 113<br />
3.4.2 Herausforderungen für Einsatz- und Führungskräfte ........................................... 115<br />
3.5 Weiterführende Literatur ...................................................................................... 119<br />
3.6 Quellen zu Kapitel 3 .............................................................................................. 120<br />
3.7 Kontrollfragen zum erlangten Wissensstand ........................................................ 124<br />
<strong>Leseprobe</strong><br />
Kapitel 4<br />
Wir helfen den Opfern – aber manche sind selbst schuld!<br />
Menschlichkeit, Mitgefühl und Professionalität ............................................................. 125<br />
4.1 Interventionskonzepte gegen häusliche Gewalt bzw.<br />
Gewalt im sozialen Nahraum ................................................................................ 127<br />
4.2 Häusliche Gewalt:<br />
Mythen und Fakten zur Phänomenologie und Verbreitung ................................. 130<br />
4.2.1 Häusliche Gewalt – ein Unterschichtsproblem? ................................................... 130<br />
© VERLAG DEUTSCHE POLIZILITERATUR GMBH Buchvertrieb, Hilden/Rhld.<br />
Wagener„<strong>Polizeiliche</strong> <strong>Berufsethik</strong>“, 2. Auflage 2019, ISBN 978-3-8011-0814-4
Inhaltsverzeichnis<br />
4.2.2 „Häusliche Gewalt = Männergewalt“ oder: „Häusliche Gewalt ist weiblich“? .... 131<br />
4.2.3 Männer schlagen, Frauen üben Psychoterror aus? .............................................. 134<br />
4.2.4 Gegenseitigkeit oder Einseitigkeit von Partnergewalt? ........................................ 135<br />
4.2.5 Gewalt und Geschlechterverhältnisse:<br />
Verletzungsmacht und Verletzungsoffenheit ....................................................... 135<br />
4.3 Verlaufsmodelle bei Partnergewalt: die Gewaltspirale, Strategien<br />
der Gewaltopfer und Überlegungen zu einem differenzierten Prozessmodell ... 136<br />
4.3.1 Die Gewaltspirale .................................................................................................. 137<br />
4.3.2 Gewaltverläufe und Opferstrategien .................................................................... 140<br />
4.4 Gutes Opfer – böses Opfer: die moralische und<br />
ethische Zwiespältigkeit des Opferbegriffs ........................................................... 142<br />
4.4.1 Zwei Seiten des Opferbegriffs ............................................................................... 142<br />
4.4.2 Konzepte des „idealen“ Opfers ............................................................................. 143<br />
4.4.3 Auswirkungen von Opferkonzepten im Bereich häuslicher Gewalt ..................... 144<br />
4.4.4 Ist der Opferbegriff überhaupt noch verwendbar? .............................................. 146<br />
4.5 Belastungen von Polizeibeamtinnen und -beamten im Zusam menhang<br />
mit Einsätzen häuslicher Gewalt ........................................................................... 147<br />
4.5.1 Verletzungsrisiko bei Einsätzen häuslicher Gewalt ............................................... 147<br />
4.5.2 Emotionale Belastungen und moralische Bedenken ............................................ 147<br />
4.5.3 Distanzierungsstrategien ....................................................................................... 149<br />
4.6 Berufsethische Überlegungen zum polizeilichen Umgang<br />
mit häuslicher Gewalt ........................................................................................... 150<br />
4.7 Weiterführende Literatur ...................................................................................... 153<br />
4.8 Quellen zu Kapitel 4 .............................................................................................. 153<br />
4.9 Kontrollfragen zum erlangten Wissensstand ........................................................ 157<br />
Kapitel 5<br />
Wenn einem die Worte fehlen …<br />
<strong>Polizeiliche</strong>r Umgang mit Sterben, Tod und Trauer ........................................................ 159<br />
5.1 Der polizeiliche Umgang mit Sterben, Tod und Trauer ......................................... 160<br />
5.2 Ethik der Fürsorge – Ethik der Selbstsorge. Zur Ausbalancierung von<br />
Verpflichtungen gegen sich selbst und andere ..................................................... 163<br />
5.3 Umgang mit Verletzten am Unfallort .................................................................... 164<br />
5.3.1 Notfallstress bei (Verkehrs-)Unfällen .................................................................... 165<br />
5.3.2 Betreuung von Verletzten am Unfallort ................................................................ 165<br />
5.4 Was geschieht, wenn ein Mensch trauert?<br />
Erkenntnisse moderner Trauerforschung ............................................................. 167<br />
5.4.1 Modelle des Trauerprozesses und der Trauerbegleitung ..................................... 167<br />
5.4.2 „Schleusenzeit“: die Bedeutung der ersten Trauerphase<br />
für den gesamten Trauerprozess .......................................................................... 170<br />
5.4.3 Reaktionen und Bedürfnisse der Angehörigen bei einem<br />
unvorhergesehenen Todesfall ............................................................................... 171<br />
<strong>Leseprobe</strong><br />
© VERLAG DEUTSCHE POLIZILITERATUR GMBH Buchvertrieb, Hilden/Rhld.<br />
Wagener„<strong>Polizeiliche</strong> <strong>Berufsethik</strong>“, 2. Auflage 2019, ISBN 978-3-8011-0814-4
Inhaltsverzeichnis<br />
5.5 Überbringen von Todesnachrichten ..................................................................... 173<br />
5.5.1 Todesbenachrichtigung als Stresssituation ........................................................... 173<br />
5.5.2 Empathie als professionelle Schlüsselkompetenz ................................................ 174<br />
5.5.3 Todesbenachrichtigung konkret: Tipps für Überbringende .................................. 176<br />
5.5.4 Einige in der Aus- und Weiterbildung häufig gestellte Fragen ............................. 177<br />
5.6 Interview Polizeiseelsorge ..................................................................................... 179<br />
5.7 Weiterführende Literatur ...................................................................................... 183<br />
5.8 Quellen zu Kapitel 5 .............................................................................................. 183<br />
5.9 Kontrollfragen zum erlangten Wissensstand ........................................................ 185<br />
Kapitel 6<br />
Den Dingen auf den Grund gehen.<br />
Zum Theoriehintergrund des Faches <strong>Polizeiliche</strong> <strong>Berufsethik</strong> ....................................... 187<br />
6.1 Zum Profil des Faches <strong>Berufsethik</strong> ........................................................................ 187<br />
6.2 Zentrale Begriffe der Ethik .................................................................................... 189<br />
6.2.1 Moral, Moralität, Ethik .......................................................................................... 189<br />
6.2.2 Werte und Normen ............................................................................................... 191<br />
6.3 Theorien der menschlichen Moralentwicklung ................................................... 192<br />
6.3.1 Ansätze von Moralerziehung bzw. ethischer Bildung ........................................... 193<br />
6.4 Stufenmodelle der Moralentwicklung .................................................................. 195<br />
6.4.1 Lawrence Kohlbergs Stufenmodell der Entwicklung<br />
moralischen Urteilsvermögens ............................................................................. 196<br />
6.4.2 Das Stufenmodell von Carol Gilligan .................................................................... 198<br />
6.4.3 Ethik der Gerechtigkeit oder Ethik der Fürsorge:<br />
die Kohlberg-Gilligan-Kontroverse ........................................................................ 202<br />
6.5 Grundmodelle ethischen Nachdenkens und Argumentierens ............................. 204<br />
6.5.1 Ethik des Guten – Ethik des Richtigen ................................................................... 204<br />
6.5.2 Drei ethische Theoriemodelle: Tugendethik, teleologische bzw.<br />
konsequentialistische Ethik und deontologische Moraltheorie ........................... 205<br />
6.6 Verfahren ethisch reflektierter Urteilsfindung ..................................................... 214<br />
6.7 Weiterführende Literatur ...................................................................................... 217<br />
6.8 Quellen zu Kapitel 6 .............................................................................................. 217<br />
6.9 Kontrollfragen zum erlangten Wissensstand ........................................................ 219<br />
<strong>Leseprobe</strong><br />
Abbildungsverzeichnis......................................................................................................... 221<br />
Tabellenverzeichnis.............................................................................................................. 222<br />
Personenverzeichnis ......................................................................................................... 223<br />
Stichwortverzeichnis ........................................................................................................ 227<br />
© VERLAG DEUTSCHE POLIZILITERATUR GMBH Buchvertrieb, Hilden/Rhld.<br />
Wagener„<strong>Polizeiliche</strong> <strong>Berufsethik</strong>“, 2. Auflage 2019, ISBN 978-3-8011-0814-4
Zum Einstieg<br />
Zum Einstieg: Drei Stimmen – drei persönliche Perspektiven auf den Polizeiberuf<br />
ALEX<br />
BIANCA<br />
MARC<br />
Hallo, ich bin Alexander, genannt Alex. Ich bin 33 Jahre und bin direkt nach der Realschule<br />
zur Polizei. Ausbildung bei der BePo, dann EHU und jetzt seit Jahren Streifendienst.<br />
Bin inzwischen Hauptmeister, aber im mittleren Dienst hat man ja keine Perspektive,<br />
auch mal was anderes machen zu können. Deshalb hab ich das Fachabi nachgeholt und<br />
jetzt auch die Zulassung zum Studium an der FH bekommen! Bin mal gespannt, wie das<br />
läuft, nach 15 Jahren auf der Straße wieder zu lernen wie in der Schule. Aber das haben<br />
andere ja auch geschafft. Hoffentlich wird es nicht zu theoretisch!<br />
Neulich habe ich bei den Polizeimeisterschaften im Handball Bianca kennengelernt. Wir<br />
haben uns über das Studium unterhalten; sie hat’s schon hinter sich und fand es sogar<br />
richtig gut. Jetzt bin ich noch mehr gespannt. Eine Auffrischung in den Rechtsfächern<br />
nach den ganzen Jahren finde ich auf jeden Fall nützlich. Ob man alles andere auch<br />
braucht, mal sehen.<br />
Hi, ich bin Bianca, ich bin 25 und seit drei Jahren bei der KriPo. Bei einer Info-Veranstaltung<br />
der Polizei hatte ich erfahren, dass man über das Fachhochschul-Studium direkt<br />
Kommissarin werden kann. Das fand ich richtig spannend. Sobald ich das Fachabi hatte,<br />
habe ich mich beworben und das Bachelor-Studium gemacht. Für mich war das ein<br />
tolles Studium: interessant, vielfältig und praxisorientiert.<br />
Als ich neulich bei den Handballmeisterschaften Alex kennengelernt habe, hat der mich<br />
über das Studium ausgefragt. Er konnte es gar nicht fassen, dass jemand richtig begeistert<br />
davon erzählt. Er hatte bisher viel Negatives gehört.<br />
Ich habe Alex auch mit Marc bekannt gemacht. Den habe ich über Facebook kennengelernt.<br />
Inzwischen hat er auch mit dem Studium angefangen. Alex lässt manchmal Marc<br />
gegenüber den erfahrenen Polizeibeamten raushängen – aber eigentlich verstehen die<br />
beiden sich gut.<br />
<strong>Leseprobe</strong><br />
Ja, Marc, das bin ich, 20 Jahre. Habe im letzten Jahr mein Abi gemacht und dann angefangen,<br />
Mathe zu studieren, aber das war‘s nicht. Ich wollte was Praktisches machen.<br />
Jetzt studiere ich an der Polizeihochschule und finde es sehr interessant. Wir sind im<br />
Studiengang aber alles Anwärter, die relativ frisch von der Schule kommen. Früher gab<br />
es auch Aufstiegsbeamte in den Studiengruppen, das hätte ich spannend gefunden,<br />
von deren Erfahrung zu profitieren. Umso toller ist der Austausch mit Bianca. Durch sie<br />
habe ich neulich auch Alex kennengelernt, der ist noch länger dabei und hat schon so<br />
ungefähr alles mitgemacht, was es bei der Polizei zu erleben gibt.<br />
© VERLAG DEUTSCHE POLIZILITERATUR GMBH Buchvertrieb, Hilden/Rhld.<br />
Wagener„<strong>Polizeiliche</strong> <strong>Berufsethik</strong>“, 2. Auflage 2019, ISBN 978-3-8011-0814-4
Kein Beruf wie jeder andere!<br />
1 Kein Beruf wie jeder andere!<br />
Ein erster Zugang zu ethischen Herausforderungen der polizeilichen<br />
Arbeit<br />
MARC<br />
ALEX<br />
Im Dienstrecht heute ging es um die „volle Hingabe“. Müssen wir wirklich alles geben?<br />
Das hat doch Grenzen!? Ich hab erst mal eins von diesen „What my buddies think I do“-<br />
Postern rumgeschickt – echt witzig! Kennt ihr die? War der Lacher!<br />
Weißt du, Marc, worauf es als Allererstes ankommt? Dass du nach der Schicht heil nach<br />
Hause kommst. Und warum sollten wir eigentlich bessere Menschen als der Rest sein?<br />
Die Polizei ist doch einfach nur ein Querschnitt der Gesellschaft.<br />
BIANCA<br />
Wir haben in <strong>Berufsethik</strong> einen Satz diskutiert, „polizeilicher Imperativ“ hieß der: „Verhalte<br />
dich so, als ob von dir ganz allein und ganz persönlich das Ansehen und die Wirksamkeit<br />
der Polizei abhinge.“ Da ist was dran: Ein einziger Kollege, der Mist baut – und<br />
sofort ist das Vertrauen in die gesamte Polizei beschädigt.<br />
Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben und verwenden Sie dabei die Materialien<br />
1.1–1.7 sowie die weiterführende Literatur.<br />
1. Analysieren Sie das Leitbild Ihrer eigenen Polizei (oder das Leitbild der Polizei<br />
Baden-Württembergs, Abb. 5 (Seite 14)) mithilfe des Wertevierecks von Wieland<br />
(Abb. 2 (Seite 14)): Aus welchem Bereichen stammen die im jeweiligen Leitbild<br />
vertretenen Werte?<br />
2. Vergleichen Sie das Leitbild Ihrer eigenen Polizei (oder das Leitbild der Polizei<br />
Baden-Württembergs, Abb. 5 (Seite 14)) mit den Handlungsmustern der Polizistenkultur<br />
nach Rafael Behr (Tab. 3 (Seite 14)).<br />
3. Sofern Sie in Ihrer bisherigen Ausbildung schon Praxiserfahrung gesammelt haben:<br />
Welche der Handlungsmuster nach Rafael Behr haben Sie in der polizeilichen Praxis<br />
wiedergefunden? Werden diese von den Kolleginnen und Kollegen in „Reinform“<br />
oder mit Modifikationen vertreten?<br />
<strong>Leseprobe</strong><br />
4. Was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten Eigenschaften eines guten Polizisten<br />
oder einer guten Polizistin? Vergleichen Sie Ihre Liste mit der Ihrer Mitstudierenden<br />
sowie mit der Liste positiver Eigenschaften in Tab. 4 (Seite 14).<br />
5. Mit welchem der in Kap. 1.6 dargestellten Berufsbilder können Sie sich am ehesten<br />
identifizieren, mit welchem am wenigsten?<br />
6. Darf man einen Eid brechen? Diskutieren Sie in Ihrer Studiengruppe Pro und Contra.<br />
7. Die polizeiliche Berufsausübung kann einzelne Beamtinnen oder Beamte manchmal<br />
in einen Gewissenskonflikt führen. Überlegen Sie, in welchen (Einsatz-)Situationen<br />
das der Fall sein kann. Was tut die Organisation Polizei dafür, um Gewissenskonflikte<br />
bei den Einzelnen möglichst zu vermeiden?<br />
8. Steht im Fall eines Gewissenskonfliktes das Gewissen über oder unter dem Gesetz?<br />
Begründen Sie Ihre Meinung.<br />
© VERLAG DEUTSCHE POLIZILITERATUR GMBH Buchvertrieb, Hilden/Rhld.<br />
Wagener„<strong>Polizeiliche</strong> <strong>Berufsethik</strong>“, 2. Auflage 2019, ISBN 978-3-8011-0814-4
Die Bedeutung von Vertrauen und das Potenzial für Misstrauen im Polizeiberuf<br />
1.1 Die Bedeutung von Vertrauen und das Potenzial für Misstrauen im<br />
Polizeiberuf<br />
Die Polizei genießt in der Bundesrepublik Deutschland ein hohes gesellschaftliches Vertrauen.<br />
Dies zeigt sich in den regelmäßig durchgeführten Umfragen zum Vertrauen der Bevölkerung<br />
in Institutionen. In der letzten Forsa-Befragung vom 19. Dezember 2018 bis 2. Januar<br />
2019 gaben 78 % von 2515 Befragten an, großes Vertrauen in die Polizei zu haben. Ein Jahr<br />
vorher brachten sogar 83% der Befragten der Polizei großes Vertrauen entgegen (s. Abb. 1).<br />
Gewisse Schwankungen von Jahr zu Jahr sind dabei normal; laut Infratest Dimap stieg der<br />
Anteil der Bevölkerung, die großes oder sehr großes Vertrauen in die Polizei angaben, zwischen<br />
November 2015 und Januar 2017 von 81% auf 88% (vgl. fowid 2017a).<br />
Im Vergleich mit anderen Institutionen belegt die Polizei in den Vertrauensumfragen seit<br />
Jahrzehnten einen der vorderen Ränge oder sogar den Spitzenplatz wie etwa 2018 und 2019.<br />
Wem vertrauen die Deutschen?<br />
Es haben großes Vertrauen in (Differenz zu 2018):<br />
Polizei<br />
Universitäten<br />
Ärzte<br />
Komunale Unternehmen<br />
Eigenen Arbeitgeber<br />
Meinungsforschungsinstitute<br />
Abb. 1:<br />
Schulen<br />
Radio<br />
Krankenkassen<br />
Gewerkschaften<br />
Presse<br />
53 % (-10)<br />
51 % (-5)<br />
46 % (-4)<br />
46 % (-3)<br />
41 % (+1)<br />
66 % (-6)<br />
66 % (-9)<br />
56 % (-2)<br />
78 % (-5)<br />
77 % (-3)<br />
77 % (-1)<br />
Vertrauen in Institutionen in Deutschland 2019. 2515 Befragte. Quelle: RTL-Trendbarometer<br />
2019<br />
<strong>Leseprobe</strong><br />
Bremer Einsatzerfahrungen<br />
„Ich war erschrocken über die Gewalt, die aus der Menschenmenge hervorging“, berichtete<br />
am Dienstag ein Polizist, der am Wochenende dabei war. „Nicht linkes Klientel hat den<br />
Ärger verursacht, der normale Bürger hat uns attackiert“, sagte der Beamte, seit 32 Jahren<br />
im Polizeidienst. „Wir wurden von Menschen bespuckt und beschimpft, die eigentlich mein<br />
Papa oder mein Opa hätten sein können“, zeigte sich eine junge Polizistin noch zwei Tage<br />
nach dem Einsatz betroffen. „Es war erschreckend zu sehen, dass uns normale Bürger von<br />
17 bis 60 Jahren gezielt attackiert haben“, sagte ein Kollege.<br />
Gewalt gegen Polizei in Bremen,<br />
Hamburger Abendblatt 6.9.2011<br />
© VERLAG DEUTSCHE POLIZILITERATUR GMBH Buchvertrieb, Hilden/Rhld.<br />
Wagener„<strong>Polizeiliche</strong> <strong>Berufsethik</strong>“, 2. Auflage 2019, ISBN 978-3-8011-0814-4
Kein Beruf wie jeder andere!<br />
Dies ist für die meisten Polizistinnen und Polizisten ein überraschender Befund. Denn das<br />
persönliche Erleben scheint eher für einen Autoritätsverlust der Polizei und für ein immenses<br />
gesellschaftliches Misstrauen zu sprechen.<br />
Doch auch innerhalb der polizeilichen Arbeit findet sich eine vergleichbare Spannung, nämlich<br />
die zwischen einem „professionellen“ Misstrauen im Hinblick auf das „polizeiliche Gegenüber“<br />
und dem grundsätzlich sehr hohen Vertrauen in das „polizeiliche Miteinander“,<br />
d.h. in die Kolleginnen und Kollegen. Eine weitere Vertrauensebene ist schließlich das Selbstvertrauen,<br />
das für die persönliche Berufsausübung und Lebensführung wichtig ist.<br />
Grundsätzlich scheint es ohne Vertrauen unter Menschen nicht zu gehen: „Menschliches<br />
Leben ist, wenn es nicht von Vertrauen getragen ist, schwer zu ertragen und kaum zu meistern.“<br />
(Köhl 2001, S. 115)<br />
Vertrauen ist eine Möglichkeit, mit der Unkontrollierbarkeit anderer Menschen, den Bedingungen<br />
um uns herum oder einem Zustand in uns selbst umzugehen. Derartige Unsicherheitsfaktoren<br />
können z.B. unsichere und/oder unvollständige Informationen sein, Unklarheiten<br />
über die Rahmenbedingungen des eigenen Handelns, aber auch Unsicherheiten in Bezug<br />
auf das eigene Können. Positiv kann man sagen: „Vertrauen kann ganz allgemein als ein<br />
Mittel zum Umgang mit der Freiheit anderer definiert werden.“ (Gambetta 2001, S. 213) Die<br />
Entwicklungspsychologie sieht in der grundlegenden menschlichen Hilfsbedürftigkeit in den<br />
ersten Jahren unseres Lebens die Ausgangsbasis unserer Fähigkeit zu vertrauen (vgl. Erikson<br />
1973, S. 62–75; Krampen 2002, S. 704 f.). Die Fähigkeit, anderen und sich selbst zu vertrauen,<br />
scheint so tief mit unserem Selbstverständnis verbunden zu sein, dass eine grundlegende<br />
Erschütterung dieses Vertrauens traumatisierend sein kann (Janoff-Bulman 1992, S. 18).<br />
Vertrauen und Misstrauen haben ihren Platz vorrangig in Interaktionen bzw. in Kooperationsbeziehungen.<br />
Die jeweils benötigte Unterstützung kann sich beziehen auf<br />
1. Leistungen, d.h., mein Gegenüber besitzt ein<br />
Wissen und/oder Können, das ich brauche,<br />
aber selber nicht besitze (der eingeforderte<br />
Wert ist in diesem Fall Unterstützung);<br />
2. Entgegenkommen, bei konkurrierenden Interessen<br />
oder im Falle eines Konflikts (eingeforderter<br />
Wert: Wohlwollen);<br />
3. Abstimmung zur gemeinsamen Handlungskoordination<br />
bei der Verfolgung gemeinsamer<br />
Ziele (eingeforderter Wert: Rücksichtnahme).<br />
Diese drei Aspekte bestimmen auf vielfache Weise die Polizeiarbeit.<br />
Was bedeutet Vertrauen?<br />
„Einer Person zu vertrauen bedeutet<br />
zu glauben, dass sie sich nicht in einer<br />
uns schädlichen Art und Weise verhalten<br />
wird, wenn sich ihr die Gelegenheit<br />
dazu bietet.“<br />
Gambetta 2001, S. 214<br />
<strong>Leseprobe</strong><br />
Leistungserwartung<br />
Die Gesellschaft erwartet Leistungen von der Polizei in den Bereichen Strafverfolgung, Gefahrenabwehr<br />
und Prävention, weil weder der oder die Einzelne noch die Gesellschaft als<br />
ganze solche Leistungen erbringen können. Nur Angehörige einer Organisation mit entsprechenden<br />
Befugnissen, ausreichender Legitimität (gesellschaftlicher Anerkennung), ausgebildetem<br />
Personal und genügend materiellen Ressourcen sind in der Lage, solche Leistungen<br />
in ausreichendem Umfang sowie mit hoher Verlässlichkeit und Qualität zu erbringen. Hier<br />
© VERLAG DEUTSCHE POLIZILITERATUR GMBH Buchvertrieb, Hilden/Rhld.<br />
Wagener„<strong>Polizeiliche</strong> <strong>Berufsethik</strong>“, 2. Auflage 2019, ISBN 978-3-8011-0814-4
Die Bedeutung von Vertrauen und das Potenzial für Misstrauen im Polizeiberuf<br />
gibt es dementsprechend ein Vertrauen der Gesellschaft in die Polizei, diese Leistungen von<br />
ihr in einem gewünschten Umfang und einer gewünschten Qualität zur Verfügung gestellt<br />
zu bekommen.<br />
Die Polizei erwartet wiederum Leistungen von der Gesellschaft, da die genannten Ressourcen,<br />
Legitimität und Befugnisse nicht von der Polizei selbst bereitgestellt werden können,<br />
sondern von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden. Hier ist wiederum ein Vertrauen<br />
der Polizei in die Gesellschaft unumgänglich.<br />
Entgegenkommen<br />
Die Polizei erwartet Entgegenkommen bei der ihr übertragenen Aufgabe der gesellschaftlichen<br />
Pazifizierung und Konfliktschlichtung von Seiten der Gesellschaft. Dazu gehört, dass<br />
Bürgerinnen und Bürger Informationen an die Polizei geben, dass andere gesellschaftliche<br />
Institutionen mit der Polizei kooperieren und ihre Arbeit unterstützen, die Bereitschaft<br />
von Bürgerinnen und Bürgern, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen, oder die generelle<br />
Bereitschaft aller gesellschaftlichen Akteure, ihre Konflikte gewaltfrei zu lösen sowie auf<br />
polizeiliche Interventionen grundsätzlich nicht mit Gewalt zu reagieren.<br />
Die Gesellschaft wiederum erwartet von der Polizei das Entgegenkommen, die Bereitstellung<br />
ihrer Kompetenzen von jedem politischen Interesse frei zu halten (Neutralitätspflicht) und<br />
legitimen gesellschaftlichen Vorgaben auch bei fachlichen Einwänden und inneren Widerständen<br />
zu folgen (Loyalität).<br />
Abstimmung<br />
Die Polizei ist auf die Abstimmung ihrer Arbeit mit weiteren gesellschaftlichen Akteuren<br />
(Staatsanwaltschaften und Gerichte, Hilfs- und Rettungsdienste, Ambulanzen und Krankenhäuser,<br />
soziale Hilfs- und Unterstützungsagenturen, weitere kommunale Einrichtungen und<br />
Behörden u.a.) unabdingbar angewiesen. Solche Kooperationen entsprechen der zunehmenden<br />
gesellschaftlichen Komplexität und nur so können nachhaltig wirksame Problemlösungen<br />
auf den Weg gebracht werden.<br />
<strong>Leseprobe</strong><br />
Die Gesellschaft wiederum ist auf die Abstimmung mit der Polizei angewiesen, um Erwartungssicherheit<br />
darüber zu gewinnen, mit welcher Art von Unterstützung von Seiten der<br />
Polizei gerechnet werden kann, mit welchen Mitteln die Polizei dabei zu Werke gehen darf<br />
und welche Grenzen sie zu respektieren hat. Und das gilt gleichermaßen für die Rahmenbedingungen<br />
der polizeilichen Arbeit wie für die Ebene konkreter Begegnungen im Alltag.<br />
Aus diesen Zusammenhängen ergibt sich für die Polizei und für die polizeiliche Arbeit ein<br />
enorm großer Vertrauensbedarf bzw. ein enorm großes Misstrauenspotenzial. Beides ist<br />
dadurch bedingt, dass die polizeiliche Arbeit nicht nur ein Kooperationsunternehmen ist,<br />
sondern für die Erfüllung ihrer Aufgaben auf eine breite wie inhaltlich vielfältige Kooperation<br />
verschiedenster gesellschaftlicher Akteure angewiesen ist und bleibt. Auf die dafür nötige<br />
Kooperationsbereitschaft bei ihren Partnern kann die Polizei keinen unmittelbaren Einfluss<br />
ausüben, sondern muss darauf vertrauen, dass sie ihr von der Gesellschaft immer wieder<br />
entgegengebracht wird.<br />
Weil Vertrauen und Misstrauen so eng miteinander verbunden sind, wird es das Moment des<br />
Misstrauens gegenüber der Polizei wie auch innerhalb der Polizei immer geben. Während<br />
© VERLAG DEUTSCHE POLIZILITERATUR GMBH Buchvertrieb, Hilden/Rhld.<br />
Wagener„<strong>Polizeiliche</strong> <strong>Berufsethik</strong>“, 2. Auflage 2019, ISBN 978-3-8011-0814-4
Kein Beruf wie jeder andere!<br />
das innere Misstrauen besonders im Bereich der polizeilichen Organisationskultur eine Rolle<br />
spielt, soll hier die Bedeutung des Misstrauens gegenüber der Polizei näher betrachtet werden.<br />
Diese Seite des Misstrauens zeigt sich beispielsweise<br />
dann, wenn die Polizei in ihrer<br />
Rolle als normdurchsetzende Organisation<br />
auftritt. Solche Momente sind prädestiniert<br />
für die Erzeugung von Misstrauen<br />
beim Gegenüber: Was habe ich falsch gemacht?<br />
Was will man von mir? Ist es hier<br />
gefährlich? An dieser Stelle wird etwas<br />
sehr Grundsätzliches über die Reaktion<br />
der Allgemeinheit auf die Polizei deutlich,<br />
das sich immer wieder erleben lässt: Man<br />
„Die Haltung und das Verhalten jedes individuellen<br />
Akteurs ist entscheidend für das<br />
Image der ganzen Organisation. Ein negativer<br />
Vorfall kann alle positiven Erfahrungen<br />
zunichte machen, die ein ‚Kunde‘ vorher<br />
gemacht hat. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
stehen im Zentrum jeder Dienstleistungsorganisation.“<br />
Feltes 2006, S. 128 [Übersetzung U.W.]<br />
ist froh, dass es die Polizei gibt, aber man möchte möglichst wenig mit ihr zu tun haben.<br />
Diese Einstellung findet sich z.B. auch gegenüber Ärzten oder in anderer Hinsicht gegenüber<br />
Versicherungen. Aus dieser Konstellation ergeben sich verschiedene Konsequenzen für das<br />
Vertrauen, das der Polizei entgegengebracht wird.<br />
Dieses Vertrauen kann man als eine Form von „Systemvertrauen“ verstehen (Luhmann<br />
1989, S. 50–66), in unserem Fall also als ein grundsätzliches Vertrauen in das Leistungserfüllungsversprechen<br />
einer Organisation, dessen Enttäuschung stets die Ausnahme bleibt.<br />
Werden Ausnahmen bekannt (wie z.B. durch Amnesty International 2010), müssen sie selbst<br />
erst einmal als vertrauenswürdig klassifiziert werden. Ist dies der Fall (ein Zeichen des Vertrauens<br />
in das Funktionieren einer kritischen Öffentlichkeit), dann kommt es entscheidend<br />
darauf an, ob der daraus entstandene Rechtfertigungs- und Erklärungsbedarf von der Polizei<br />
ernst genommen und aufgegriffen wird. Ob dieses Ernstnehmen und die angemessene Reaktion<br />
wiederum selbst vertrauenswürdig erscheinen, liegt erneut nicht unmittelbar in den<br />
Händen der Polizei, sondern wird von außen, d.h. von der nichtpolizeilichen Öffentlichkeit,<br />
beurteilt, die der Polizei auf diese Weise ein Mehr oder ein Weniger an Vertrauenswürdigkeit<br />
zuschreibt. Bisher haben die bekannt gewordenen Ausnahmen keine Dimension erreicht,<br />
die das Systemvertrauen grundsätzlich in Frage gestellt hätte. Auch darin zeigt sich die erstaunlich<br />
große Stabilität des Systemvertrauens, das die Polizei in Deutschland genießt. Es<br />
erweist sich, dass das Systemvertrauen „relativ unabhängig von einzelnen Erfahrungen“ ist<br />
und „deshalb nicht leicht enttäuscht“ wird (Lahno 2002, S. 358). Aber: Die zwar punktuelle,<br />
aber stetige und gegebenenfalls unbefriedigende Diskussion von Ausnahmen kann zu einem<br />
Umschlagpunkt im Bereich des Systemvertrauens führen (ein sog. Tipping Point, vgl.<br />
Gladwell 2002). Beim Erreichen eines Umschlagpunktes würde sich der Schwerpunkt zur<br />
Seite des Misstrauens hin verschieben. Bisherige Ausnahmen würden damit zur erwarteten<br />
bzw. befürchteten Regel, was bisher die Regel ist, würde zur Ausnahme. Wo immer dies<br />
weltweit geschieht, wird ein gesellschaftliches Grundvertrauen so massiv gestört, dass das<br />
gesellschaftliche Zusammenleben in größte Gefahr gerät. Diesen Fall kann man als eine gesellschaftliche<br />
„Großschadenslage“ ansehen.<br />
<strong>Leseprobe</strong><br />
Das Systemvertrauen ist nur eine Seite des der Polizei entgegengebrachten Vertrauens. Die<br />
andere Seite ist der konkrete persönliche Kontakt zwischen Polizei und Bürgerinnen und<br />
© VERLAG DEUTSCHE POLIZILITERATUR GMBH Buchvertrieb, Hilden/Rhld.<br />
Wagener„<strong>Polizeiliche</strong> <strong>Berufsethik</strong>“, 2. Auflage 2019, ISBN 978-3-8011-0814-4
Ein Versuch moralischer Orientierung<br />
Bürgern (vgl. Liebl 2005). Auch hier steht viel auf dem Spiel, denn wir „nehmen die Vertrauenswürdigkeit<br />
einzelner Personen als Signal der Vertrauenswürdigkeit einer Institution, deren<br />
komplexen Charakter wir im Einzelnen nicht überblicken können.“ (Lahno 2002, S. 359)<br />
Damit gewinnen das persönliche Auftreten und Handeln von Polizistinnen und Polizisten<br />
eine sehr wichtige Bedeutung für die Aufrechterhaltung des Systemvertrauens in die Polizei<br />
als Organisation.<br />
Ein besonderes Merkmal dieser „Schnittstelle“ zwischen Bürger und Polizei besteht darin,<br />
dass in vielen Einsatzsituationen die Polizistinnen und Polizisten als Einzelne bzw. als Streifenteam<br />
den einzelnen Menschen unmittelbar gegenüber stehen und eine darüber hinausgehende<br />
hierarchische Kontrolle ihres Handelns aktuell nicht gegeben ist. Sie entscheiden<br />
in der Regel also selbst unmittelbar vor Ort, was und wie etwas zu tun ist. In diesem Setting<br />
spiegelt sich etwas von der genannten Unkontrollierbarkeit wider – die von vielen Polizistinnen<br />
und Polizisten auch als eine besondere Freiheit ihrer Arbeit empfunden wird.<br />
Somit zeigt sich die Bedeutung des Vertrauens auf dreifache Weise:<br />
• Erstens bleibt der Organisation Polizei nichts anderes übrig, als darauf zu vertrauen,<br />
dass die Polizistinnen und Polizisten vor Ort das Richtige auf die richtige Weise tun.<br />
• Zweitens vertrauen die Bürgerinnen und Bürger darauf, dass die Polizistinnen und Polizisten<br />
dem ihnen abstrakt entgegengebrachten Systemvertrauen auch konkret vor Ort<br />
gerecht werden.<br />
• Drittens vertrauen die Polizistinnen und Polizisten darauf, dass sie unter Beachtung der<br />
genannten Erwartungen beider Seiten ihre Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten<br />
so einbringen können, dass kein weiterer Schaden entsteht und sich eine möglichst<br />
zufriedenstellende Lösung des anstehenden Problems für alle Beteiligten realisieren<br />
lässt.<br />
Auch hier zeigt sich die Allgegenwart von Vertrauensnotwendigkeiten einerseits, aber auch<br />
das permanente Angewiesensein auf Vertrauen, selbst und gerade in Situationen, die eher<br />
Misstrauen herausfordern. Doch wie kann man ein solches Vertrauen sichern? Im Hinblick<br />
auf Polizistinnen und Polizisten zumeist dadurch, dass versucht wird, „die Guten“ für den<br />
Polizeidienst zu gewinnen. Denn wem sollte man vertrauen können, wenn nicht ihnen?<br />
<strong>Leseprobe</strong><br />
1.2 Ein Versuch moralischer Orientierung:<br />
Sieben Gebote für den Polizeibeamten (1945)<br />
Die folgenden sieben Gebote für Polizeibeamte wurden von der britischen Militärregierung<br />
1945 als Richtschnur für den Wiederaufbau der deutschen Polizei in der britischen Besatzungszone<br />
formuliert. Dreißig Jahre später wurden sie in der Zeitschrift „Die Polizei“ noch<br />
einmal abgedruckt und mit dem Hinweis: „Heute so aktuell wie damals!“ versehen. Kann<br />
man das nach weiteren 44 Jahren immer noch sagen? Oder verändert sich der Polizeiberuf<br />
so schnell und so grundsätzlich, dass diese Anforderungen heute keine Rolle mehr spielen?<br />
Eine kurze Überprüfung scheint sinnvoll.<br />
Sie können Ihre Einschätzung zu den einzelnen Forderungen auf dem folgenden Fragebogen<br />
eintragen:<br />
© VERLAG DEUTSCHE POLIZILITERATUR GMBH Buchvertrieb, Hilden/Rhld.<br />
Wagener„<strong>Polizeiliche</strong> <strong>Berufsethik</strong>“, 2. Auflage 2019, ISBN 978-3-8011-0814-4