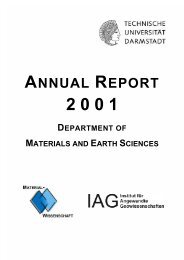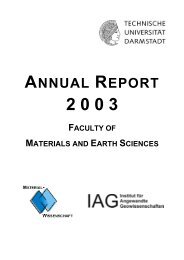Infoheft 2012/13 B.Sc.Materialwissenschaft - Materialwissenschaften ...
Infoheft 2012/13 B.Sc.Materialwissenschaft - Materialwissenschaften ...
Infoheft 2012/13 B.Sc.Materialwissenschaft - Materialwissenschaften ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Infoheft</strong> <strong>2012</strong>/<strong>13</strong><br />
B.<strong>Sc</strong>. <strong>Materialwissenschaft</strong><br />
Fachschaft <strong>Materialwissenschaft</strong>
Herausgeber:<br />
Fachschaft <strong>Materialwissenschaft</strong> an der TU Darmstadt<br />
Redaktion:<br />
Lukas Porz und Arne Klomp<br />
2
1. Keine Panik<br />
Hallo liebe Erstis,<br />
gewöhnt Euch erst mal an die Anrede, so werdet Ihr das ganze nächste Jahr bezeichnet. Ihr studiert<br />
jetzt <strong>Materialwissenschaft</strong>en. Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt auf jeden Fall ein sehr interessantes<br />
und vielseitiges Studium gewählt. Fortschrittliche Materialien und Werkstoffe werden in Zukunft<br />
immer mehr gefragt sein, darum sind <strong>Materialwissenschaft</strong>ler (kurz MaWis) in der Industrie begehrt.<br />
Doch muss man sagen, dass Ihr Euch nicht das einfachste Studium ausgewählt habt. Ihr werdet in den<br />
nächsten Monaten öfter ratlos in Vorlesungen und Übungen sitzen und denken, dass die Zeit nie reicht<br />
um die Protokolle, Übungsblätter und Praktikumsvorbereitung zu schaffen. Das ging allen vor Euch<br />
auch so. Mit der Zeit werdet Ihr merken, dass Ihr das Ganze mit etwas Disziplin, Eigeninitiative und<br />
Arbeit meistern könnt. Aber ihr seid nicht allein, bei Fragen oder Problemen könnt ihr euch immer an<br />
ältere Studenten wenden, ihr bekommt auch meistens eine kompetente Antwort! Für's Erste haben wir<br />
aber in einem späteren Abschnitt das wichtigste für den Start zusammengefasst.<br />
Viel Erfolg!<br />
Eure Fachschaft<br />
3
2. Vorwort des Dekans<br />
Liebe Studienanfängerinnen und Studienanfänger,<br />
mit diesem Vorwort möchte ich Sie ganz herzlich als Studentin/Student in der <strong>Materialwissenschaft</strong> an<br />
der Technischen Universität Darmstadt begrüßen und heiße Sie<br />
herzlich willkommen im Fachbereich Material- und<br />
Geowissenschaften. Ich freue mich sehr, dass Sie sich für unseren<br />
Studiengang entschieden haben. Zunächst ein paar Worte zur<br />
Historie des Studienganges <strong>Materialwissenschaft</strong>, der bekanntlich<br />
gegenüber den klassischen Disziplinen im Bereich der Natur- und<br />
Ingenieurwissenschaften wie Chemie, Mineralogie, Physik oder<br />
Maschinenbau und Elektrotechnik nicht so weit verbreitet ist.<br />
Nachdem zunächst im Jahr 1989 der Fachbereich<br />
<strong>Materialwissenschaft</strong> an der damaligen Technischen Hochschule<br />
Darmstadt gegründet wurde, konnte schon 1992 der Studienbetrieb<br />
aufgenommen werden. Damit war Darmstadt der erste Standort in<br />
Deutschland, an dem der Diplomstudiengang <strong>Materialwissenschaft</strong><br />
etabliert wurde. Im Unterschied zur klassischen und etablierten<br />
Disziplin Werkstoffwissenschaft mit Fokus auf die<br />
Ingenieurwissenschaften setzt das Studium der <strong>Materialwissenschaft</strong> seine fachspezifischen<br />
<strong>Sc</strong>hwerpunkte im Bereich der Naturwissenschaften. Dem Darmstädter Modell folgend gründeten in<br />
den Jahren danach eine Reihe anderer deutscher Universitäten ebenfalls materialwissenschaftliche<br />
Studiengänge. Seit 2008 erfolgte die sukzessive Umstellung des Diplomstudiengangs auf<br />
Bachelor/Master.<br />
Mit dem Fach <strong>Materialwissenschaft</strong> haben Sie sich für einen ausgesprochen interdisziplinären<br />
Studiengang entschieden. Während des Bachelorstudiums werden Ihnen zunächst die<br />
naturwissenschaftlichen Grundlagen in Chemie, Physik und Mathematik vermittelt. Darüber hinaus<br />
werden die Vorlesungen durch ingenieurwissenschaftliche Fächer in Technischer Mechanik und<br />
Elektrotechnik ergänzt. <strong>Sc</strong>hließlich erfahren Sie darauf aufbauend in einer Reihe von Vorlesungen die<br />
materialwissenschaftlichen Grundlagen insbesondere zum atomaren Aufbau von Festkörpern und den<br />
sich daraus ableitenden Materialeigenschaften. Das Vorlesungswissen wird in Praktika und Übungen<br />
vertieft. Ein Industriepraktikum von mindestens 6-wöchiger Dauer verschafft einen Einblick in das<br />
berufliche Umfeld eines <strong>Materialwissenschaft</strong>lers in der Industrie. Das Bachelorstudium wird dann mit<br />
einer Forschungsarbeit in einem der 16 Fachgebiete in der <strong>Materialwissenschaft</strong> abgeschlossen.<br />
Bei entsprechender Eignung und Qualifikation kann im sich daran anschließenden Masterstudium das<br />
Fach <strong>Materialwissenschaft</strong> in seinen unterschiedlichen Materialklassen wie Metalle, Keramiken,<br />
Halbleiter oder Verbundwerkstoffe sowie in den Methoden zur Materialcharakterisierung vertieft<br />
werden. Spätestens im Masterstudium sollte ein mindestens einsemestriges Studium an einer<br />
ausländischen Partneruniversität der TU Darmstadt z.B. in Europa, USA oder Japan angestrebt<br />
werden. Ein Auslandsaufenthalt erweitert nicht nur Ihre fachliche Expertise sondern auch Ihre<br />
Sprachkenntnisse und persönliche Lebenserfahrung.<br />
Das Studium der <strong>Materialwissenschaft</strong> mit seinen Bachelor- und Masterabschlüssen bietet Ihnen<br />
aufgrund seiner interdisziplinären Ausrichtung hervorragende Berufs- und Karrierechancen im<br />
industriellen aber auch im akademischen Umfeld. Darüber hinaus ist nicht nur das Studienfach<br />
4
<strong>Materialwissenschaft</strong> eine gute Wahl sondern auch der Standort Darmstadt. Denn zum einen zeichnet<br />
sich der Studiengang <strong>Materialwissenschaft</strong> durch ein sehr gutes Betreuungsverhältnis von Student zu<br />
Professor aus. Zum anderen sind Sie während des gesamten Studiengangs in einem eigenen<br />
Fachbereich beheimatet und müssen nicht wie an anderen Universitäten in unterschiedlichen<br />
Fachdisziplinen Ihr Studium absolvieren.<br />
Letztlich unternimmt auch unsere Universitätsleitung alle Anstrengungen, Ihnen die besten<br />
Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium zu gewährleisten. So befindet sich gerade ein Medien-<br />
und Hörsaalzentrum direkt gegenüber der <strong>Materialwissenschaft</strong> im Bau, das im Wintersemester<br />
<strong>2012</strong>/20<strong>13</strong> fertig gestellt werden wird. Weiterhin bietet Ihnen unser zentrales Web-basiertes<br />
Informationssystem für Studium und Lehre namens TUCaN Online-Informationen zu Vorlesungen<br />
(z.B. Inhalte, Übungsmaterialien und Skripte), Prüfungsergebnisse sowie aktualisierte Inhalte zu den<br />
angebotenen Lehrveranstaltungen an der TU Darmstadt. Hierzu nutzen Sie bitte folgende Webadresse:<br />
http://www.info.tucan.tu-darmstadt.de<br />
Zahlreiche weitere nützliche Informationen rund um Ihren Fachbereich bzw. Studiengang<br />
<strong>Materialwissenschaft</strong> finden Sie im Internet unter:<br />
http://www.mawi.tu-darmstadt.de<br />
Zum <strong>Sc</strong>hluss wünsche ich Ihnen, auch im Namen meiner Kollegen, einen gelungenen Start in Ihren<br />
neuen Lebensabschnitt und einen erfolgreichen Verlauf Ihres Studiums. Genießen Sie die Zeit als<br />
Student und erfreuen Sie sich der vielfältigen Möglichkeiten, die Ihnen ein Studium bietet, und nutzen<br />
Sie es nicht nur zur fachlichen sondern auch zu Ihrer persönlichen Bereicherung.<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Ralf Riedel<br />
Dekan des Fachbereichs Material- und Geowissenschaften<br />
5
3. Die Fachschaft<br />
3.1. Fachschaft?<br />
Offiziell versteht man unter Fachschaft alle Studierenden eines Fachbereichs. Im alltäglichen<br />
Sprachgebrauch meint man, wenn man von Fachschaft spricht, allerdings nur die Gruppe derjenigen<br />
Studenten, welche sich aktiv im Fachbereich engagieren, die studentischen Vertreter in Gremien<br />
stellen und mit der Organisation von Partys und kleineren Events dafür sorgen, dass das Studium nicht<br />
allzu langweilig wird. Die Fachschaft ist auch die Vertretung der Studenten gegenüber den anderen<br />
Gruppen des Fachbereichs (Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter, sonstige Mitarbeiter) und ist<br />
Ansprechpartner für diese, wenn es um studentische Belange geht. Ebenso können sich Studenten<br />
jederzeit an die Fachschaft wenden, wenn es Probleme mit 'unwilligen' Professoren, 'ungerechten'<br />
Prüfungen oder 'unkooperativen' Praktikumsbetreuern gibt.<br />
3.2. Räte und Ausschüsse<br />
Um die offiziellen Angelegenheiten im Fachbereich zu klären, also z.B. Prüfungszeiträume<br />
festzulegen, Gelder zu verteilen oder auch neue Professoren zu berufen gibt es eine ganze Reihe von<br />
Gremien, die wir euch hier kurz vorstellen möchten.<br />
3.3. Fachbereichsrat (FBR)<br />
Der Fachbereichsrat ist das wichtigste Entscheidungsgremium auf Fachbereichsebene. Er besteht aus<br />
Vertretern aller Gruppen und ist z.B. verantwortlich für die Wahl der Dekane, die Einsetzung von<br />
Berufungskommissionen und die Festlegung von Studien- und Prüfungsordnungen. Gewählt werden<br />
die drei studentischen Vertreter jedes Jahr bei den Hochschulwahlen.<br />
3.4. Fachschaftsrat (FSR)<br />
Der Fachschaftsrat ist die offizielle Vertretung aller Studierenden des Fachbereichs. Seine Aufgaben<br />
übernimmt üblicherweise die gesamte Fachschaft, wobei nur die in den Fachschaftsrat gewählten<br />
Mitglieder unterschriftsberechtigt sind. Die Vertreter werden ebenfalls jährlich bei den<br />
Hochschulwahlen gewählt.<br />
3.5. Prüfungskommission<br />
Die Prüfungskommission ist zuständig für die Regelung von Prüfungsfragen und die Festlegung von<br />
Prüfungszeiträumen und Prüfern. Ihr Vorsitzender (zur Zeit Prof. Riedel) ist zuständig für die<br />
Genehmigung von Wahlpflichtfächern und Industriepraktika. Die Kommission trifft sich 2-3 mal pro<br />
Jahr. Die Fachschaft entsendet einen Vertreter dorthin.<br />
3.6. Berufungskommission<br />
Eine Berufungskommission wird immer dann vom Fachbereichsrat eingesetzt, wenn eine Professur<br />
besetzt werden muss. Die Kommission wählt dann Bewerber aus, lädt diese zu Vorträgen und<br />
6
Gesprächen ein und bestimmt schließlich, wen sie gerne für die Professur hätte. Die Fachschaft schickt<br />
in jede Berufungskommission zwei Vertreter. Die studentischen Vertreter haben in all diesen Gremien<br />
volles Stimmrecht und Anregungen und Vorschläge seitens der Studierenden werden dort durchaus<br />
ernst genommen.<br />
3.7. Lernzentrum (MaLz)<br />
Das MaWi - Lernzentrum (MaLz) ist der Raum gleich rechts vom Haupteingang. Hier könnt ihr als<br />
Studenten lernen, Übungen rechnen oder einfach nur die Zeit zwischen Vorlesungen überbrücken. In<br />
den zwei <strong>Sc</strong>hränken der Präsenzbibliothek befinden sich Literatur und Prüfungsprotokolle, die zur<br />
Prüfungsvorbereitung äußert hilfreich sein können.<br />
Wichtig! Es handelt sich um eine Präsenzbibliothek (d.h. nichts verlässt das MaLz, außer zum<br />
Kopieren!). Vor einiger Zeit musste diese für längere Zeit geschlossen bleiben, da einige Bücher (ca.<br />
30) entwendet wurden. Auch für MaLz und Präsenzbibliothek (Aktualisierung, Bücher kaufen, etc.) ist<br />
die Fachschaft zuständig.<br />
3.8. Partys!<br />
Außerdem hat sich die Fachschaft die Planung, Finanzierung und Durchführung verschiedener<br />
Veranstaltungen zur Aufgabe gemacht, wie z.B. die Orientierungswoche für Erstsemester, die<br />
Fachschafts-Party, die Adventsfeier, das Sommerfest und eine Erstsemester-Party. Diese findet dieses<br />
Jahr am 26. Oktober im <strong>Sc</strong>hlosskeller statt.<br />
3.9. Forum & Homepage<br />
Auf unserer Homepage: http://www.mawi.tu-darmstadt.de/fs/fachschaft/index.de.jsp findet ihr ein<br />
paar allgemeine Infos und ein Forum, in dem ihr semesterintern oder öffentlich diskutieren oder den<br />
höheren Semestern Fragen stellen könnt. Dort finden sich seit einiger Zeit auch eine ganze Reihe von<br />
Prüfungs- und Praktikumsprotokollen.<br />
3.10. Fachschaft ist für alle da!<br />
Wie man zweifellos merkt: Die Fachschaft ist ein essenzieller Teil eures Unilebens. Wenn du auch<br />
einmal über den Tellerrand schauen möchtest, das Unileben aktiv mitgestalten willst, dann bietet die<br />
Fachschaft Freiräume um dich selbst einzubringen. Mitmachen kann jeder! Die Fachschaft trifft sich<br />
einmal pro Woche im Fachschaftsraum hinter dem MaLZ. Kommt doch einfach mal vorbei!<br />
7
4. Die Fachgebiete stellen sich vor<br />
4.1. Physikalische Metallkunde<br />
Das Fachgebiet wird momentan von Professor Clemens Müller geleitet.<br />
Forschung und Lehre des Fachgebietes Physikalische Metallkunde haben generell zum Ziel, ein<br />
tieferes Verständnis der Beziehungen zwischen der Herstellung, dem Gefüge und den Eigenschaften<br />
metallischer Werkstoffe herzustellen. Dies betrifft einerseits die – möglichst quantitative -<br />
Beschreibung bereits existierender Werkstoffe im Hinblick auf die Auswirkung unterschiedlicher<br />
Herstellungsvarianten auf die Betriebseigenschaften. Daraus sollen Vorhersagen abgeleitet werden<br />
über den Einfluss von Prozessparametern wie beispielsweise Wärmebehandlungen, Umform- oder<br />
Bearbeitungsvorgänge, um letztendlich das Potential dieser Werkstoffe im Einsatz besser ausschöpfen<br />
zu können. Andererseits entwickeln wir aber auch selbst neue Werkstoffe mit verbessertem<br />
Eigenschaftsprofil auf der Basis grundlegender metallphysikalischer Prinzipien.<br />
Aktuelle Forschungsaufgaben sind fokussiert auf Al-, Mg- und Ti-Leicht\-metalllegierungen, Stähle,<br />
Nickelbasis-Superlegierungen und Refraktärmetalllegierungen. Dabei werden hauptsächlich die<br />
mechanischen Eigenschaften der Werkstoffe, wie z.B. das Kriechen bei hoher Temperatur oder die<br />
Ermüdung bei zyklischer Belastung, untersucht, aber auch dazu in enger Beziehung stehende<br />
Phänomene wie Reibung und Verschleiß, Korrosion und Hochtemperaturoxidation. <strong>Sc</strong>hwerpunkte<br />
unserer Forschung sind derzeit (a) Werkstoffe mit ultrafeinkörnigem (engl. UFG) Gefüge und (b)<br />
metallische Konstruktionswerkstoffe für den Einsatz bei extrem hohen Temperaturen. UFG<br />
Werkstoffe stehen aktuell deshalb im Fokus der Forschung, weil sie in besonders vorteilhafter Weise<br />
hohe Festigkeiten und hohe Duktilitäten vereinigen können. Hier untersuchen wir in Zusammenarbeit<br />
mit dem Fachbereich Maschinenbau in mehreren Forschungsprojekten nicht nur neue Umformprozesse<br />
zur kontinuierlichen Herstellung solcher UFG Gefüge, sondern auch die Entwicklung dieser Gefüge<br />
und ihre Auswirkung auf die mechanischen Eigenschaften. Die Entwicklung metallischer<br />
Hochtemperaturwerkstoffe „jenseits der Nickelbasis-Superlegierungen“ für Einsatztemperaturen<br />
oberhalb 1200°C an Luft ist nicht nur aus der Sicht der Wissenschaft, sondern auch der Industrie eine<br />
Herausforderung mit potentiell großen Auswirkungen auf den Bereich der Ressourcen schonenden und<br />
hocheffizienten Energieerzeugung.<br />
Im Bereich der Lehre werden im Pflichtbereich Vorlesungen und Übungen zu den Grundlagen der<br />
Phasenbildung und –umwandlung (thematisch im 2. Semester angesiedelt), zu den mechanischen<br />
Eigenschaften von Konstruktionswerkstoffen (im 5. Semester), sowie zu den grundlegenden<br />
Mechanismen von Verformung und Bruch (im 4. Semester) gehalten. Spezielle Angebote existieren<br />
zur Erstarrung und Wärmebehandlung, quantitativen Gefügeanalyse und zu<br />
Hochtemperaturwerkstoffen. Zur Vertiefung und praktischen Veranschaulichung werden intensive<br />
Praktika auf allen Ebenen angeboten.<br />
4.2. Nichtmetallische-Anorganische Werkstoffe<br />
Für den länglichen Namen, der einfach für Keramik steht, können wir nichts. In der Arbeitsgruppe<br />
lehren und forschen <strong>Materialwissenschaft</strong>ler, Physiker und ein Chemiker, die meist aus Deutschland,<br />
aber auch aus Australien, Frankreich, Südkorea oder China kommen. Die gute internationale<br />
Vernetzung dient den Studenten insofern, als dass das Fachgebiet Vertiefungspraktika in den USA und<br />
Australien vermittelt und die eigenen Doktoranden jeweils 3 Monate im Ausland forschen. In der<br />
8
Lehre übernimmt Prof. Dr.-Ing. Jürgen Rödel derzeit Vorlesungen aus dem Hauptstudium über<br />
mechanisches Werkstoffverhalten und über numerische Methoden und hat<br />
vorher auch schon die Vorlesungen Defekte (3.Semester) und Konstruktions-<br />
wie Funktionswerkstoffe (8.Semester) gehalten. Die Assistenten und Prof.<br />
Rödel gestalten, in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet "Disperse Feststoffe",<br />
das Wahlpflichtfach "`Keramik"'. Ebenso werden jeweils ein Versuch im<br />
Praktikum für das 1. und 3. Semester, sowie vier Versuche im 5. Semester von<br />
den Doktoranden oder Assistenten betreut. In der Forschung arbeiten wir an<br />
keramischen Aktuatorwerkstoffen mit Anwendung in der Dieseleinspritzung,<br />
bei Miniaturmotoren und anderem. Aber auch an mechanischen Eigenschaften<br />
und an verschiedenen Herstellungsweisen z.B. für dünne Filme.<br />
4.3. Elektronische Materialeigenschaften<br />
Das Fachgebiet wird von Prof. Dr. Heinz von Seggern geleitet, der zuvor als Abteilungsleiter in der<br />
Zentralen Forschung und Entwicklung bei Siemens tätig war.<br />
In der Lehre vertritt er die elektronischen Eigenschaften von kristallinen und amorphen Materialien<br />
sowie von organischen und anorganischen Halbleitern. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den<br />
elektrischen, optischen, magnetischen und dielektrischen Eigenschaften fester Materie und deren<br />
praktischen Anwendungen.<br />
Die derzeitigen Forschungsschwerpunkte des Fachgebiets konzentrieren sich<br />
auf drei Bereiche:<br />
Organische Elektronik: In diesem Zusammenhang werden Leuchtdioden<br />
und Transistoren aus organischen Farbstoffen und Polymeren mit<br />
konjugierten π - Systemen als Grundbausteine einer organischen Elektronik<br />
evaluiert. Es werden sowohl elektrische als auch optische Eigenschaften,<br />
sowie die Langzeitstabilität dieser Bauelemente untersucht und optimiert.<br />
Derzeitige <strong>Sc</strong>hwerpunkte liegen auf der Lichtemission aus Transistoren, auf<br />
leuchtenden Textilien und Dünnschichtdielektrika sowie deren<br />
Langzeitstabilität von Leuchtdioden.<br />
Anorganische Leuchtstoffe und Speicherleuchtstoffe: Die Arbeiten konzentrieren sich zurzeit auf die<br />
Verbesserung bestehender Leuchtstoffsysteme, Szintillatoren und Speicherphosphore zur Detektion<br />
von Röntgen- und Neutronenstrahlung für bildgebende Anwendungen in der medizinischen<br />
Diagnostik. Hier werden konkrete Probleme der Strahlungsstabilität und des Nachleuchtens sowie der<br />
Steigerung des räumlichen Auflösungsvermögens für Anwendungen in der Mammographie untersucht.<br />
Ein weiterer Fokus liegt auf der Synthese neuer Lampenleuchtstoffe und deren spektraler<br />
Charakterisierung.<br />
Ferroelektrische Polymere: In diesem Arbeitsgebiet wird an einem neuartigen Prinzip zur Erzeugung<br />
piezoelektrischer Materialien gearbeitet, das im Gegensatz zu den konventionellen Materialien auf<br />
bipolar geladenen, porösen und ansonsten unpolaren Kunststoffen basiert. Derzeitige<br />
Herausforderungen bestehen in der Verbesserung der Langzeitstabilität heutiger Kunststoffe, der<br />
mechanischen Stabilität und der Polarisierung. Aufgrund der hohen Piezokonstanten haben diese<br />
Materialien ein großes Potenzial für zukünftige Anwendungen in der Sensorik und Aktuatorik.<br />
In allen Arbeitsgebieten wird eine enge Zusammenarbeit mit der Industrie gepflegt, die praxisrelevante<br />
Fragestellungen in dem Fachgebiet garantieren.<br />
9
4.4. Oberflächenforschung<br />
Die Professur wird seit Mai 1997 von Prof. Dr. Wolfram Jaegermann geleitet.<br />
In der Lehre wird die Physik und Chemie von Oberflächen und Grenzflächen<br />
in und an Festkörpern von den atomaren Grundlagen bis zu technologischen<br />
Bauelementen vertreten. In der Forschung werden die Elementarprozesse der<br />
Kontaktbildung, chemischer Grenzflächenreaktionen und von<br />
Ladungstransferprozessen an Halbleiterbauelementen sowie des Wachstums<br />
dünner <strong>Sc</strong>hichten erforscht. Einen <strong>Sc</strong>hwerpunkt bilden Systeme für die<br />
Energiegewinnung (Solarzellen), -wandlung (Elektrokatalysatoren) und -<br />
speicherung (Interkalationsbatterien). Die Experimente werden vorwiegend in<br />
aneinander gekoppelten Ultrahochvakuum Präparations- und<br />
Charakterisierungssystemen durchgeführt.<br />
4.5. Dünne <strong>Sc</strong>hichten<br />
Der Fachgebietsleiter Prof. Dr. Lambert Alff hat als Postdoc länger in Japan gearbeitet und war vor<br />
seinem Ruf nach Darmstadt Lehrstuhlinhaber an der Technischen Universität Wien.<br />
Das Fachgebiet beschäftigt sich mit modernen und teilweise<br />
einzigartigen Methoden der Dünnschichtherstellung von verschiedenen<br />
oxidischen Funktionswerkstoffen. Dabei geht es unter anderem auch um<br />
die <strong>Sc</strong>haffung ganz neuer Dünnschichtmaterie mit maßgeschneiderten<br />
Eigenschaften.<br />
1. Hochtemperatur-Supraleiter: Diese Materialien können z.B. genutzt<br />
werden, um Verlust frei Strom zu transportieren. Wer findet den ersten<br />
Raumtemperatur-Supraleiter?<br />
2. Magnetische Oxide: Am bald erwarteten Ende der sogenannten "roadmap"<br />
der Halbleiterindustrie steht oft das Stichwort "Spinelektronik".<br />
Wer kann die Materialien für diese neue Form der Elektronik machen?<br />
3. Dielektrische Materialien: Für viele Anwendungen in Aktorik und<br />
Sensorik sind neue Materialien gefragt. Auch Hochfrequenzkomponenten für den Gigahertzbereich<br />
(Ihr Handy!) müssen durch Materialforschung verbessert werden.<br />
4.6. Disperse Feststoffe<br />
Das Fachgebiet Disperse Feststoffe steht seit Januar 1993 unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. h. c. Ralf<br />
Riedel.<br />
In der Lehre wird das gesamte Spektrum der Synthese und Eigenschaften der verschiedenen<br />
Werkstoffklassen wie Metalle, Halbleiter, Keramiken und Gläser, sowie von Kunststoffen und<br />
Verbundwerkstoffen behandelt. In Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet NAW bieten wir im<br />
Hauptstudium das Wahlpflichtfach "Keramik" an.<br />
Die Forschungsarbeiten im Fachgebiet konzentrieren sich auf die Entwicklung von Strategien zur<br />
Herstellung neuer anorganischer Materialien mit Eigenschaften, die über den gegenwärtigen Stand der<br />
Technik weit hinausreichen. Synthesemethoden wie das Polymer-Pyrolyse-Verfahren, die Sol-Gel-<br />
10
Technik und die chemische Gasphasenabscheidung (CVD) werden hierzu gezielt weiterentwickelt. Zur<br />
Synthese zählen darüber hinaus auch Hochdruckverfahren, mit denen neben der Temperatur auch<br />
Druck als Reaktionsparameter zum Einsatz kommt und zur gezielten Synthese neuer Materialien<br />
eingesetzt werden kann. Über die so genannte "Bottom-Up"-Strategie werden spezifische anorganische<br />
Moleküle als molekulare Bausteine ("Nanotools") über Kondensations- und Polymerisationsvorgänge<br />
zu höher molekularen Netzwerken und Festkörperstrukturen geordnet.<br />
Damit lassen sich organische Komponenten mit anorganischen Strukturen verknüpfen, wodurch<br />
Materialien entstehen, die durch konventionelle Synthesen nicht zugänglich sind. Im Zentrum der<br />
Untersuchungen steht deshalb die Entwicklung von Materialien aus molekularen Einheiten durch<br />
kinetisch kontrollierte Syntheseverfahren im Bereich der <strong>Sc</strong>hnittstelle zwischen Molekül- und<br />
Festkörperchemie. Auf diese Weise können Zusammensetzung und Eigenschaften von Werkstoffen<br />
gezielt variiert und eingestellt werden. Das übergeordnete Ziel der Forschungsarbeiten ist daher, die<br />
"Bottom-Up"-Strategie im Hinblick auf die Synthese und Erforschung neuartiger Materialien<br />
systematisch zu studieren, um die technologischen Grundlagen für die Entwicklung dieser neuen<br />
Werkstoffe und deren potenziellen Einsatz zu erarbeiten.<br />
Mögliche Anwendungsgebiete molekular hergestellter, nanoskaliger Materialien liegen in den<br />
Bereichen der <strong>Sc</strong>hlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts wie der Transportsysteme, der<br />
Informationstechnologie, der Energiesysteme sowie der Umwelt- und Mikro- bzw.<br />
Nanosystemtechnik. Im Zentrum des Interesses stehen daher detaillierte Untersuchungen zur<br />
Korrelation zwischen dem Aufbau der molekularen Vorstufen sowie der Nanostruktur der daraus<br />
abgeleiteten Werkstoffe und deren Materialeigenschaften.<br />
4.7. Strukturforschung<br />
Die Professur Strukturforschung wurde im Jahre 2008 mit Prof. Dr. Wolfgang Donner neu besetzt.<br />
Im Mittelpunkt der Forschung steht der Zusammenhang zwischen dem<br />
strukturellen Aufbau von Materialien und deren physikalischen und<br />
chemischen Eigenschaften. Es wird ein <strong>Sc</strong>hwerpunkt auf die Erforschung<br />
von Dünnschichtmaterialien aller Art gelegt. Zurzeit gibt es Projekte zu<br />
magnetischen Speicherschichten, supraleitenden Vielfachschichten und<br />
Kathodenmaterialien für oxidische Brennstoffzellen. Neben der<br />
Röntgenbeugung im Institut in Darmstadt werden auch Einrichtungen an<br />
Großforschungseinrichtungen, d.h. Synchrotrons und Forschungsreaktoren,<br />
eingesetzt.<br />
In der Lehre vermittelt das Fachgebiet grundlegende Kenntnisse über die<br />
Struktur der Materie und zu den Methoden, die zu deren Erforschung<br />
eingesetzt werden.<br />
4.8. Materialanalytik<br />
Das von Prof. Dr. Wolfgang Ensinger geleitete Fachgebiet Materialanalytik beschäftigt sich mit der<br />
Ermittlung der chemischen Zusammensetzung von Materialien, sowie deren Einfluss auf die<br />
Eigenschaften der Materialien. Dabei werden die Haupt- und Nebenkomponenten erfasst, aber auch<br />
Spurenelemente, die für die Eigenschaften der Materialien eine wichtige Rolle spielen können.<br />
11
Dazu kommt eine Reihe von Analysemethoden zum Einsatz, wie die Sekundärionen-<br />
Massenspektrometrie (SIMS), die Röntgenfluoreszenz - Analyse (RFA) und<br />
die Optische Emissions - Spektrometrie mit Induktiver Plasma - Anregung<br />
(ICP-OES). Die Analytik umfasst alle Materialgruppen, von Keramiken über<br />
Halbleiter zu Metallen.<br />
In verschiedenen Projekten werden Materialien hergestellt und untersucht, z.B.<br />
Nanodrähte und -röhren aus Metallen und Oxiden, sowie Nanoschichten, die<br />
mit Plasma- und mit Sol - Gel- Methoden abgeschieden werden, wie<br />
diamantartiger Kohlenstoff oder bleifreie Piezomaterialien. Diese werden auf<br />
verschiedene Eigenschaften hin untersucht, wie Mikrostruktur und<br />
Bindungscharakteristika, auf denen ihre Funktionsfähigkeit für verschiedene<br />
Anwendungen beruht.<br />
4.9. Materialmodellierung<br />
Das Fachgebiet Materialmodellierung besteht seit November 2002 und wird von Dr. Karsten Albe<br />
geleitet.<br />
Der <strong>Sc</strong>hwerpunkt der Forschung liegt auf der Untersuchung von Materialeigenschaften und<br />
Strukturbildungsprozessen mit Hilfe atomistischer Computersimulationen. Molekulardynamische<br />
Simulationen dienen beispielsweise dazu, die Bewegung einiger Millionen Atome unter Bedingungen<br />
zu berechnen, die dem Experiment entsprechen. Wir setzen derartige Simulationen dazu ein, um die<br />
plastische Deformation von Nanokristallen und metallischen Gläsern zu<br />
studieren. Quantenmechanische Rechnungen helfen uns, elektronische und<br />
strukturelle Eigenschaften neuer Materialien zu verstehen. Dabei<br />
interessieren uns vor allem transparent leitfähige Oxide und ferroelektrische<br />
Materialien. Thermodynamischen Eigenschaften von Nanolegierungen für<br />
mögliche Anwendungen in Katalysatoren, Sensoren oder magnetischen<br />
Speichermaterialen untersuchen wir mit Hilfe von Monte-Carlo Verfahren.<br />
Grundsätzliches Ziel unserer Forschung ist es, Vorhersagen über<br />
Eigenschaften neuer Materialien zu machen, Simulationen zur Optimierung<br />
neuer Syntheseverfahren durchzuführen und das Verhalten bekannter<br />
Materialien zu verstehen und zu verbessern.<br />
In der Lehre hat das Fachgebiet bisher die Vorlesungen "Grundlagen der<br />
<strong>Materialwissenschaft</strong> II-IV", bei denen es um Phasendiagramme,<br />
Defekteigenschaften sowie Thermodynamik und Kinetik geht, betreut.<br />
Im Hauptstudium und Praktikum werden Veranstaltungen zur atomistischen Modellierung von<br />
Materialien angeboten.<br />
4.10. Physics of Surfaces<br />
Das Fachgebiet Physics of Surfaces wird seit Wintersemester 2010/11 von Prof. Robert Stark geleitet.<br />
Die Wechselwirkung zwischen Oberflächen und Fluiden ist für viele natürliche und technische<br />
Systeme von großer Bedeutung. Die Phänomene können auf dem ersten Blick sehr verschieden sein,<br />
wie beispielsweise Reibung und Verschleiß von Maschinenteilen, die Wechselwirkung lebender<br />
12
Objekte (Bakterien, Zellen oder Gewebe) mit benetzten Oberflächen oder auch Prozesse auf<br />
geologischer Skala wie die Benetzung von Lagerstättengesteinen mit<br />
Wasser, Öl oder Gas.<br />
Die grundlegenden physikalischen Effekte, die an diesen Oberflächen<br />
auftreten, gleichen sich jedoch. Dabei sind beispielsweise die Mikro-<br />
und Nanostruktur, sowie die chemische Funktionalität der Oberfläche<br />
zusammen mit den Strömungsverhältnisse und chemischen Prozesse im<br />
Fluid wichtige Einflussfaktoren. Das Forschungsgebiet des FG „Physics<br />
of Surfaces“ zielt deshalb auf ein besseres Verständnis und die Kontrolle<br />
von physikalische Phänomene an Oberflächen und Grenzflächen auf der<br />
Nanometerskala. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf dem<br />
Zusammenspiel von strukturierten und funktionalen Oberflächen mit<br />
dem umgebenden Medium. Forschungsschwerpunkte sind<br />
Oberflächenphänomene bei biologischen Materialien und die Entwicklung von Materialien für die<br />
Biologie sowie technische Anwendungen wie Reinigungsprozessen, <strong>Sc</strong>hmierung oder<br />
Mehrphasenströmungen in porösen Medien.<br />
4.11. Mechanik funktionaler Materialien<br />
Das Fachgebiet wird seit 2011 von J. Prof. Baixiang Xu geleitet.<br />
Die Forschungsthemen liegen im Gebiet der numerischen Mechanik, mit <strong>Sc</strong>hwerpunkten in Bereichen<br />
der Kontinuumsmodellierung und numerischen Simulationen von<br />
funktionalen Materialien und Systemen. Dazu gehören z.B. piezoelektrische<br />
Keramiken, dielektrische Elastomeraktuatoren, Lithium-Ionen-Batterien und<br />
Kompositwerkstoffe.<br />
Funktionale Materialien und Systeme beziehen normalerweise verschiedene<br />
physikalische Phänomene und Längenskalen mit ein. Außerdem hängt das<br />
makroskopische Verhalten der Materialien von der Mikrostruktur und von<br />
der entsprechenden thermodynamischen Kinetik ab.<br />
Die Forschung wird daher von einer interdisziplinären Herangehensweise<br />
geprägt und berücksichtigt dabei chemische, elektrische und mechanische<br />
Eigenschaften im Bezug auf Mikrostrukturentwicklung, mesoskopische<br />
Materialeigenschaften und Homogenisierung. Dies geschieht zumeist in Form eines Modells, welches<br />
durch Computersimulationen verfolgt wird.<br />
Professor Xu organisiert unter anderem das Computerpraktikum und hält die Vorlesung Technische<br />
Mechanik für <strong>Materialwissenschaft</strong>ler im 3. Semester.<br />
4.12. Molekulare Nanostrukturen<br />
Die Forschungsthemen des Fachgebietes Molekulare Nanostrukturen<br />
(MNS) unter Leitung von Prof. Dr. Ralph Krupke sind Kohlenstoff-<br />
Nanoröhren und Graphen, und deren elektronische und optische<br />
Eigenschaften. Das Besondere an den neuen Kohlenstoffformen ist, dass<br />
sie aus einer einzigen Lage von sp2-hybridisierten Kohlenstoffatomen<br />
bestehen und dadurch herausragende elektrische, optische, chemische und<br />
<strong>13</strong>
mechanische Eigenschaften besitzen. Diese Eigenschaften ermöglichen es neue<br />
Hochfrequenztransistoren, optoelektronische Bauelemente, Sensoren und Beschichtungen zu<br />
realisieren. Zur Untersuchung solcher Systeme wird im Fachgebiet derzeit ein Fourier-Transformator-<br />
Photostromspektrometer mit Superkontinuum-Lichtquelle aufgebaut. Die Experimente finden in<br />
Kooperation mit der Arbeitsgruppe des Fachgebietsleiters am Karlsruher Institut für Technologie statt,<br />
in der solche Systeme hergestellt werden. Als beispielhaftes Ergebnis der aktuellen Forschung sei die<br />
Realisierung eines schmalbandigen thermischen Licht-Emitters erwähnt<br />
(http://www.materialsgate.de/de/mnews/8830/Elektronik+Farbspiele+mit+Graphen.html).<br />
4.<strong>13</strong>. Ionenstrahlmodifizierte Materialien<br />
Das Fachgebiet beschäftigt sich mit der Wechselwirkung hochenergetischer Ionen mit Materie. Frau<br />
Prof. Christina Trautmann wurde <strong>2012</strong> berufen und ist gleichzeitig Leiterin der Abteilung<br />
Materialforschung des GSI Helmholtzzentrums, ein nationales Forschungszentrum mit<br />
Beschleunigeranlagen für Ionenstrahlen im Norden von Darmstadt.<br />
In der Arbeitsgruppe werden verschiedene Materialien mit Ionen unterschiedlicher Masse und Energie<br />
bestrahlt. Die daraus resultierenden veränderten Materialeigenschaften werden während oder im<br />
Anschluss an die Bestrahlung mit sich ergänzenden spektroskopischen und mikroskopischen<br />
Methoden untersucht. Derzeit spannende Themen betreffen die Frage wie ein Festkörper auf die<br />
gleichzeitige Wirkung von Druck und hohem Energieeintrag reagiert. Hierzu wurde die Technik<br />
entwickelt, Proben in Diamant-Hochdruckzellen einzubauen und den Ionenstrahlen auszusetzen.<br />
Teilchen mit hohen Energien bieten zudem einmalige Möglichkeiten Mikro- oder Nanostrukturen<br />
herzustellen. Viele interessante Anwendungen beruhen darauf, dass Ionenspuren chemisch aufgeätzt<br />
werden können. Die feinen Kanäle dienen als Biosensoren oder werden als Templat für die<br />
Herstellung von Nanodrähten eingesetzt. Viele spezielle Effekte und veränderte physikalischen<br />
Eigenschaften entstehen, wenn eine oder mehrere Dimensionen von Nanostrukturen bestimmte Größen<br />
unterschreiten.<br />
4.14. Funktionale Materialien<br />
Die moderne Industriegesellschaft hat den Klimawandel hervorgerufen und sieht sich nun mit der<br />
Erschöpfung der natürlichen Energieressourcen, und weiteren noch nicht absehbaren Folgen<br />
konfrontiert. Die Entwicklung effizienterer technologischer Lösungen für die bevorstehende<br />
Energiewende ist auch eine zentrale Herausforderung für die moderne<br />
<strong>Materialwissenschaft</strong>. In diesem Zusammenhang thematisiert das neue<br />
Fachgebiet „Funktionale Materialien“ von Prof. Dr. Oliver Gutfleisch die<br />
Erforschung neuer magnetischer Werkstoffe. Zur Steigerung der Effizienz in<br />
der Stromerzeugung durch Windturbinen, aber auch in der Elektromobilität,<br />
werden Hochleistungsmagnete benötigt. Diese bestehen jedoch zu Teilen aus<br />
Seltenerdmetallen, was in Anbetracht der angespannten Ressourcenlage<br />
langfristig sowohl in Bezug auf die Kosten als auch in der Verfügbarkeit ein<br />
Problem darstellt. Die Entwicklung von Recyclingverfahren und die Suche<br />
nach Werkstoffen ohne Seltenerden (Substitution) ist ein gemeinsames Ziel<br />
der Arbeitsgruppe in Darmstadt und der neu entstandenen Fraunhofer-<br />
Projektgruppe für Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie IWKS in<br />
14
Hanau. Ein weiteres Forschungsgebiet stellen magnetokalorische Materialien dar. Es handelt sich<br />
dabei um Stoffe, die ihre Temperatur ändern, wenn sie in ein Magnetfeld gebracht werden. Mit der<br />
magnetischen Kühlung lassen sich im Gegensatz zur herkömmlichen Kompressionstechnologie<br />
deutlich höhere Wirkungsgrade erzielen. In Anbetracht des weltweiten Energieverbrauchs für<br />
Klimatisierung und Kühlung ergibt sich ein immenses Einsparungspotential.<br />
15
5. Studentische Klischeekunde<br />
BWL<br />
Wahlweise angetan mit rosa Lacoste-Shirt oder moosgrüner Barbour-Jacke, liebt der BWLer einen<br />
Hauch englischen Adels. Rottet sich gern in studentischen Unternehmungsberatungen mit<br />
seinesgleichen zusammen, mietet am Wochenende Porsche-Cabrios und lacht über<br />
Wirtschaftsminister-Witze.<br />
Informatiker<br />
Waren schon in der <strong>Sc</strong>hule die Freaks. Ihr soziales Defizit kompensieren sie gern mit aufopfernden<br />
PC-Helfertätigkeiten – wenn auch immer mit leicht verächtlichem Das-ist-doch-ganz-einfach-Gehabe.<br />
Das Genie des Informatikers ist meist an seiner auffällig zurückgebliebenen Kleidung erkennbar,<br />
serienmäßig hat er einen übersichtlichen Lebenswandel.<br />
Mediziner<br />
Können weniger denken als andere Studis, das wird ihnen nämlich durch sinnloses Pauken im<br />
Grundstudium abgewöhnt. Sind immer in der Uni oder im Labor und suhlen sich wahlweise in der<br />
Ehrfurcht und dem Mitleid ihrer Mitmenschen. Ach ja, Medizin ist natürlich das schwerste Studium.<br />
Sozialpädagogen<br />
Wollten schon immer später mal "was mit Menschen" machen. Versteht die Welt besser als sich selbst,<br />
und hinterlässt deshalb bei einem selber grundsätzlich ein schlechtes Gewissen, was das eigene<br />
Sozialsein angeht.<br />
Lehrämtler<br />
Will natürlich alles besser machen als seine Lehrer. Motivation: Aufopferung für bessere Ergebnisse in<br />
künftigen PISA-Studien. Lehrämtler lieben Arbeitsgruppen und fallen im Seminar durch<br />
ungewöhnliche Diskutierfreudigkeit auf.<br />
Germanisten<br />
Das Gute am Germanistikstudium ist die akademische Freiheit des nahezu uneingeschränkten<br />
Kommens, Gehens und vor allem Zuhause-Bleibens. Der Germanist an sich ist hochgeistig tätig,<br />
deshalb hat er so banale Dinge wie ein klares Berufsziel gar nicht nötig.<br />
MaWis<br />
Wissen von allem etwas können aber nichts richtig. Sind weder ganz Ingenieur noch<br />
Naturwissenschaftler. Das Studium verbringen sie damit Papierkristalle zu basteln und das<br />
Treppenhaus zu umrunden und keiner weiß wozu sie eigentlich gut sind - aber alle sind immer wieder<br />
16
überrascht wie viele es gibt. Ihre Freizeit verbringen sie bevorzugt beim Volleyball um die<br />
Orientierung der Netzebene zu bestimmen.<br />
Einige Situationen:<br />
Stelle ein paar Personen die Frage: "Was ist 2*2", und Du wirst folgende Antworten erhalten:<br />
Der Ingenieur zückt seinen Taschenrechner, rechnet ein bisschen und meint schließlich:<br />
"`3,999999999"'<br />
Der Physiker: "In der Größenordnung von 1mal 10 hoch 1“<br />
Der Mathematiker wird sich einen Tag in seine Stube verziehen und dann freudestrahlend mit einen<br />
dicken Bündel Papier ankommen und behaupten: "Das Problem ist lösbar!" Dann zieht er sich wieder<br />
zurück und kommt nach einer Woche mit folgender Nachricht wieder: "Und es ist im Körper der<br />
reellen Zahlen sogar EINDEUTIG lösbar!"<br />
Der Logiker: "Bitte definiere 2*2 präziser."<br />
Der Hacker bricht in den NASA-Supercomputer ein und lässt den rechnen.<br />
Der Psychiater: "Weiß ich nicht, aber gut, das wir darüber geredet haben..."<br />
Der Jurist: "4, aber ich ich weiß nicht, ob wir vor Gericht damit durchkommen."<br />
Der Politiker: "Ich verstehe ihre Frage nicht..."<br />
Die angehenden Chemiker kommen nach 4 Wochen mit folgendem Ergebnis: "Wir sind sicher, dass<br />
für dieses mathematische Problem keine Lösung existiert. Es lässt sich nicht auf den Dreisatz<br />
zurückführen"<br />
Der Mediziner: "4" darauf die Anderen:"Öhh, auswendig gelernt"<br />
17
Zwei Mathematiker in einer Bar: Einer sagt zum anderen, dass der Durchschnittsbürger nur wenig<br />
Ahnung von Mathematik hat. Der zweite ist damit nicht einverstanden und meint, dass doch ein<br />
gewisses Grundwissen vorhanden ist. Als der erste mal kurz austreten muss, ruft der zweite die blonde<br />
Kellnerin und meint, dass er sie in ein paar Minuten, wenn sein Freund zurück ist, etwas fragen wird,<br />
und sie möge doch bitte auf diese Frage mit 'ein Drittel x hoch drei' antworten. Etwas unsicher bejaht<br />
die Kellnerin und wiederholt im Weggehen mehrmals: "Ein Drittel x hoch drei..." Der Freund kommt<br />
zurück und der andere meint: "Ich werde Dir mal zeigen, dass die meisten Menschen doch was von<br />
Mathematik verstehen. Ich frag jetzt die blonde Kellnerin da, was das Integral von x zum Quadrat ist."<br />
Der zweite lacht bloß und ist einverstanden. Also wird die Kellnerin gerufen und gefragt, was das<br />
Integral von x zum Quadrat sei. Diese antwortet: - "Ein Drittel x hoch drei." Und im Weggehen dreht<br />
sie sich nochmal um und meint: - "Plus c."<br />
Ein Ingenieur, ein Physiker und ein<br />
Mathematiker fahren nach <strong>Sc</strong>hottland. Als sie<br />
gerade über die sanften Hügel <strong>Sc</strong>hottlands<br />
fahren, sehen sie eine <strong>Sc</strong>hafherde; alle <strong>Sc</strong>hafe<br />
sind weiß bis auf eins. Der Ingenieur meint:<br />
"Ah, in <strong>Sc</strong>hottland gibt es schwarze <strong>Sc</strong>hafe".<br />
Darauf der Physiker: "In <strong>Sc</strong>hottland gibt es<br />
mindestens ein schwarzes <strong>Sc</strong>haf". Der<br />
Mathematiker: "In <strong>Sc</strong>hottland gibt es<br />
mindestens ein <strong>Sc</strong>haf, das auf mindestens einer<br />
Seite schwarz ist".<br />
Ein Mann geht mit seinem Hund an einem See<br />
spazieren. Plötzlich sieht er, wie sich eine Frau<br />
mit letzter Kraft über Wasser hält und dann bewusstlos zurücksinkt. Er springt ins Wasser, packt sich<br />
die Frau und zieht sie ans Ufer. Er legt sie auf den Rücken und beginnt mit ihren Armen pumpende<br />
Bewegungen zu machen. Jedes Mal kommt ein dicker Wasserstrahl aus ihrem Mund geschossen. Ein<br />
Fahrradfahrer hat inzwischen angehalten, schaut dem Treiben zu und schüttelt den Kopf. Der Mann<br />
pumpt weiter und jedes Mal kommt ein Wasserstrahl aus dem Mund der Frau. Der Fahrradfahrer<br />
schüttelt nur den Kopf und meint, dass das so nie etwas wird. Nach einiger Zeit platzt dem Mann der<br />
Kragen, und er schnauzt den Fahrradfahrer an: "Mensch, seien Sie still! Ich weiß, was ich tue, ich bin<br />
Arzt."' "`Naja"', meint der andere, "aber ich bin Ingenieur, und ich sage Ihnen, solange die Frau ihren<br />
Hintern im Wasser hat, pumpen Sie höchstens den See leer."<br />
Abschlussprüfung an der Uni. Thema dieses Semesters: <strong>Sc</strong>hall und Licht. Erster Kandidat betritt den<br />
Raum. Der Prof: "Was ist schneller, der <strong>Sc</strong>hall oder das Licht?" Der Student: "Das Licht." Der Prof:<br />
"<strong>Sc</strong>hön, und wieso?" Der Student: "Wenn ich das Radio einschalte, kommt erst das Licht und dann der<br />
Ton." Der Prof: "Raus!!!" Der zweite Kandidat. Dieselbe Frage. Antwort: "Der <strong>Sc</strong>hall." Der Prof:<br />
"Wieso das denn?!?" Der Student: "Wenn ich meinen Fernseher einschalte, kommt erst der Ton und<br />
18
dann das Bild." - "RAUS!!!",Der Prof fragt sich, ob die Studenten zu dumm sind oder ob er die Fragen<br />
zu kompliziert stellt. Der dritte Kandidat. Der Prof: "Sie stehen auf einem Berg. Ihnen gegenüber steht<br />
eine Kanone, die auf sie abgefeuert wird. Was nehmen sie zuerst wahr? Das Mündungsfeuer oder den<br />
Knall?" Der Student: "Das Mündungsfeuer." Der Prof frohlockt und fragt: "Können Sie das<br />
begründen?" Der Student druckst und meint dann: "Na ja, die Augen sind doch weiter vorne als die<br />
Ohren..."<br />
Die Prüfungsfragen<br />
Nachfolgend lest ihr eine Prüfungsfrage aus einer Zwischenprüfung im Fach Chemie an der<br />
Universität von Washington. Die Antwort eines Studenten war "so profund", dass der Professor sie via<br />
Internet mit Kollegen in der ganzen Welt teilen wollte. Bonus-Frage: Ist die Hölle exotherm (Wärme<br />
abgebend) oder endotherm (Wärme aufnehmend)? Die meisten Studenten untermauerten ihre Antwort,<br />
indem sie das Boyle-Mariotte-Gesetz heranzogen (Das Volumen und der Druck eines geschlossenen<br />
Systems sind voneinander abhängig, d.h. Gas kühlt sich ab, wenn es sich ausdehnt und erwärmt sich<br />
bei Kompression) Einer schrieb aber folgendes: "Zuerst müssen wir feststellen, wie sich die Masse der<br />
Hölle über die Zeit ändert. Dazu benötigen wir die Rate der Seelen, die "zur Hölle fahren" und die<br />
Rate derjenigen, die sie verlassen. Ich denke, wir sind uns einig, dass eine Seele, die einmal in der<br />
Hölle kam, diese nicht wieder verlässt. Wir stellen also fest: Es gibt keine Seelen, die die Hölle<br />
verlassen. Um festzustellen, wie viele Seelen hinzukommen, sehen wir uns doch mal die die<br />
verschiedenen Religionen der Welt an. Einige dieser Religionen sagen, dass man, wenn man nicht<br />
dieser Religion angehört, in die Hölle kommt. Da es auf der Welt mehr als eine Religion mit dieser<br />
Überzeugung gibt, und da niemand mehr als einer Religion angehört, kommen wir zu dem <strong>Sc</strong>hluss,<br />
dass alle Seelen in der Hölle enden. Auf Basis der weltweiten Geburten- und Sterberate können wir<br />
davon ausgehen, dass die Anzahl der Seelen in der Hölle exponentiell steigt. Betrachten wir nun die<br />
Veränderung des Volumens der Hölle, da nach dem Boyle-Mariotte- Gesetz bei gleich bleibender<br />
Temperatur und Druck das Volumen proportional zur Anzahl der hinzukommenden Seelen ansteigen<br />
muss. Daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten: 1. Expandiert die Hölle langsamer als die Anzahl der<br />
hinzukommenden Seelen, dann steigen Temperatur und Druck in der Hölle an, bis sie explodiert. 2.<br />
Expandiert die Hölle schneller als die Anzahl der hinzukommenden Seelen, dann sinken Temperatur<br />
und Druck in der Hölle, bis sie gefriert. Zur Lösung führt uns der Ausspruch meiner Kommilitonin<br />
Teresa: "Eher friert die Hölle ein, bevor ich mit dir ins Bett gehe . . ." Da ich bis heute nicht dieses<br />
Vergnügen mit Teresa hatte (und wohl auch nie haben werde), muss Aussage 2 falsch sein, was uns<br />
zur Lösung bringt: Die Hölle ist exotherm und wird nie einfrieren." Der Student bekam als einziger<br />
Prüfungsteilnehmer die volle Punktzahl.<br />
19
6. Plan der OWO<br />
Datum/Zeit Mittwoch, 10.10.12 (Raum S101/A01)<br />
10:00 – 10:30 Begrüßung & Vorstellung der Fachschaft<br />
10:30 – 11:45 Begrüßung durch Herrn Kastening<br />
11:15 – 11:45 Vorstellung der Bachelors <strong>Materialwissenschaft</strong><br />
11:45 – 12:00 Pause<br />
12:00 – 12:50 ????<br />
12:50 – 14:30 Mittagessen in der Mensa<br />
14:30 – 14:50 Vorstellung des FG NAW<br />
14:50 – 15:10 Vorstellung des FG Dünne <strong>Sc</strong>hichten<br />
15:10 – 15:20 Pause<br />
15:20 – 15:40 Vorstellung des FG Physikalische Metallkunde<br />
15:40 – 16:00 Vorstellung des FG E-Mat<br />
16:00-16:20 Evtl Vorstellung des FG Ionenstrahl modifizierte Mat.<br />
ab 16:30 GRILLEN<br />
Datum/Zeit Donnerstag, 11.10.12 (Raum L301/93)<br />
10:00 – 10:30 Vorstellung des Fachbereichs<br />
10:30 – 10:50 Vorstellung des FG Oberflächenforschung<br />
10:50 – 11:10 Vorstellung des FG MNS<br />
11:10 – 11:30 Vorstellung des FG MfM<br />
11:30 – <strong>13</strong>:00 Mittagessen<br />
<strong>13</strong>:00 – <strong>13</strong>:20 Vorstellung des FG Materialmodellierung<br />
<strong>13</strong>:20 – <strong>13</strong>:40 Vorstellung des FG Strukturforschung<br />
20
<strong>13</strong>:40 – <strong>13</strong>:50 Pause<br />
<strong>13</strong>:50 – 14:10 Präsentation des ERASMUS-Programms<br />
14:10 – 14:30 Vorstellung des FG Materialanalytik<br />
14:30 – 14:40 Pause<br />
14:40 – 15:00 Vorstellung des FG Physics of Surfaces<br />
15:00 – 15:20 Vorstellung des FG Funktionale Materialien<br />
ab 15:30 Kaffee & Kuchen im MaWi-Gebäude<br />
ab 20:00 Kneipenabend<br />
Datum/Zeit Freitag, 12.10.10<br />
12:00 – <strong>13</strong>:00 Essen Mensa Stadtmitte<br />
<strong>13</strong>:00 – 19:00 Stadt-Rallye<br />
ab 19:00 Bars und Kneipen<br />
21
7. Studienverlaufsplan B.<strong>Sc</strong>. <strong>Materialwissenschaft</strong><br />
22
8. To Do’s der ersten Wochen<br />
Am Anfang des Studiums gibt es so ein paar Dinge, die organisiert werden müssen. Anders als früher<br />
seid ihr dafür jetzt selbst verantwortlich. Aber damit sich nachher keiner beschweren kann - „Mir hat's<br />
ja niemand gesagt! - haben wir für euch die wichtigsten Dinge, die ihr innerhalb der ersten Woche tun<br />
solltet, zusammengefasst:<br />
• Anmeldung zum Physikalischen Grundpraktikum ausfüllen:<br />
http://gp-portal.physik.tu-darmstadt.de/GP_Anmeldung_Neu/student/<br />
• Anmeldung zum MaWi-Praktikum:<br />
erfolgt am 18.10.12 um 08:00 Uhr im Raum L203/6 (siehe Stundenplan)<br />
• Anmeldung zu allen Übungen erfolgt über TUCaN (Mathe, Physik, MaWi, Chemie)<br />
• HRZ-Account freischalten & Athene-Karte besorgen<br />
23
9. Bücherempfehlungen<br />
Im Laufe des Studiums werden Euch die Professoren viele Bücher empfehlen deren Anschaffung mehr<br />
oder weniger sinnvoll ist. Bei den meisten Büchern ist es sicherlich ausreichend diese aus der<br />
Bibliothek auszuleihen. Generell ist zu empfehlen Bücher, die man sich anschaffen möchte, zuerst<br />
auszuleihen, um herauszufinden, ob man mit ihnen überhaupt zurechtkommt.<br />
Hier ein kleiner Überblick der Bücher, die wir im Grundstudium für empfehlenswert halten:<br />
9.1. <strong>Materialwissenschaft</strong><br />
• Borchardt-Ott, Kristallographie<br />
Standardwerk zur Vorlesung MaWi I; ein wenig unübersichtlich, enthält aber alles wichtige für<br />
das erste Semester<br />
• Gottstein, Physikalische Grundlagen der Materialkunde<br />
hilfreich für MaWi I-III; reicht aber nicht aus für MaWi I<br />
9.2. Mathematik<br />
• Meyberg, Vachenhauer, Höhere Mathematik<br />
relativ knapp gehaltenes Buch, behandelt sehr viele Themen und erklärt ein wenig umständlich<br />
• Papula, Mathematik für Ingenieure I-III<br />
erklärt die behandelten Themen sehr ausführlich und weist selbst auf Dinge hin, die in andern<br />
Büchern als selbstverständlich angenommen werden, behandelt aber nicht alle Themen<br />
9.3. Chemie<br />
• Mortimer, Chemie<br />
erklärt die nötigen Themen für allg. Chemie ausführlich und verständlich, eher etwas für Leute<br />
mit wenig Vorwissen<br />
• Riedel, Anorganische Chemie<br />
ausschließlich für anorganische Chemie, dort aber wesentlich detaillierter als Mortimer<br />
• Atkins, Chemie einfach alles<br />
sehr umfassendes und ausführliches Lehrbuch für Grundlagen und Vertiefungen, geht weit über<br />
allg. Chemie hinaus<br />
24
9.4. Physik<br />
• Giancoli, Physik<br />
erklärt sehr gut fast alle wichtigen Themen für Physik I+II, weniger Formeln als in anderen<br />
Lehrbüchern<br />
• Tipler, Physik<br />
erklärt verständlich und gibt viele hilfreiche Formeln (unter anderem für das Physikpraktikum),<br />
mathematischer als Giancoli<br />
WICHTIG!!! Die hier aufgeführten Bücher müsst ihr nicht kaufen. Vor allem im ersten Semester<br />
könnt ihr euch die meisten Bücher in der Bibliothek ausleihen. Welches ihr lest hängt ganz von eurem<br />
Geschmack ab. Am besten probiert ihr verschiedene Bücher aus, da sie oft verschiedene<br />
Herangehensweisen und Vorgehen verwenden.<br />
25
10. Freizeitgestaltung in Darmstadt<br />
Hier findet ihr einige Möglichkeiten in Darmstadt aktiv zu sein. Diese Kurzfassung eines Reiseführers<br />
ersetzt jedoch in keiner Weise echte Erfahrungen, es wird daher dringend empfohlen sich selbst ein<br />
Bild davon zu machen, was in DA 'so geht'.<br />
10.1. Sportangebot<br />
Eine Studentenstadt hat viele junge Leute, die zu viel lernen und daher Bewegung als Ausgleich<br />
brauchen. Aus diesem und anderen Gründen gibt es Sportangebote der Uni, vom so genannten<br />
Unisportzentrum (USZ). Dort gibt es Kurse für fast alles und um dort mitmachen zu können muss man<br />
weder Mitglied in einem Verein sein noch Vorkenntnisse mitbringen, nur bei begrenzten<br />
Mitgliederzahlen sollte man sich anmelden solange noch Plätze frei sind. Der größte Teil dieser<br />
Angebote ist zudem auch kostenfrei, einzelne wie Tennis, Squash oder externe Kurse müssen bezahlt<br />
werden, was sich zumeist aber auch im Rahmen hält.<br />
TU-Unisportzentrum<br />
Rundeturmstraße 12<br />
64283 Darmstadt<br />
Tel.: +49 6151 16-2518<br />
www.usz.tu-darmstadt.de<br />
Selbstverständlich gibt es auch einige Möglichkeiten laufen, joggen oder radeln zu gehen. Die<br />
Lichtwiese selbst ist eine der beliebtesten Orte in Darmstadt, da nicht nur das große Areal zur Stadt<br />
hin, sondern auch die Anfänge des Odenwaldes südlich des Lichtwiese zum laufen einlädt. Dort gibt es<br />
einige gekennzeichnete Rundwege und für Radfahrer auch die ein oder andere Abfahrtsstrecke.<br />
Wer gern mit Mehreren aufbricht ist beim Lauftreff gut aufgehoben. Dieser trifft sich ganzjährig und<br />
bei jedem Wetter montags und donnerstags um 18.00 Uhr und Mitte November bis März zusätzlich<br />
samstags um 16.00 Uhr. Gestartet wird in unterschiedlichen <strong>Sc</strong>hwierigkeitsgraden der Wegstrecke und<br />
des Lauftempos. Treffpunkt ist das Parkdeck vor dem Architektengebäude auf der Lichtwiese.<br />
Sehr viele Möglichkeiten Sport zu machen bietet auch das Hochschulstadion am Lichtwiesenweg. Es<br />
beinhaltet nicht nur das erfrischende <strong>Sc</strong>hwimmbad der TUD (das momentan leider saniert wird)<br />
sondern neben den üblichen Feldern für allerlei Mannschaftssportarten auch eine Laufstrecke mit ca.<br />
einem knappen Kilometer Rundweg im dazugehörigen Waldgebiet. Dort lässt sich auch gut versteckt<br />
das 'Hüttchen' der Sportstudenten finden.<br />
In diesem Wäldchen befindet sich auch der Darmstädter Kletterwald, der von Ende März bis Anfang<br />
November auf mehreren Parcours Kletterspaß für Anfänger bis Profis bietet. Mit eurem<br />
Studentenausweis könnt ihr dort für 12 Euro klettern gehen.<br />
Hat euch dann das vertikale Fieber gepackt, könnt ihr dann neben dem Hochschulstadion die neue<br />
Kletterhalle des DAVs besuchen, in der ihr für 10 Euro den ganzen Tag klettern könnt. Im gleichen<br />
Gebäude befindet sich auch das Unifit, in dem ihr für knapp 60 Euro 3 Monate lang an Geräten<br />
trainieren könnt.<br />
Zum <strong>Sc</strong>hwimmen bieten natürlich auch die öffentlichen Bäder Gelegenheit. Der Sport hat Vorrang im<br />
Nordbad im Bürgerpark Nord (Linie 4 und 5), das Bessunger Hallenbad direkt an den Gleisen der<br />
26
Linie 3 und das renovierte Jugendstilbad in der Landgraf-Georg-Straße bleiben mehr, aber nicht<br />
ausschließlich, der Erholung überlassen.<br />
10.2. Kultur<br />
Es gibt ein staatliches Theater, eingeteilt in Großes Haus, Kleines Haus, Werkstattbühne und<br />
Werkstattcafé, sowie mehrere private Theater bzw. Theaterinitiativen. Viele Vorstellungen im<br />
Staatstheater sind zudem für Studenten kostenlos oder können für Studenten stark reduziert<br />
Das TAP (Die Komödie) spielt vorwiegend Komödien und ist ein gemütliches Boulevardtheater,<br />
daneben spielt das TAP auch Kinder- und Jugendtheater.<br />
Das halbNeun Theater ist eine Kleinkunstbühne mit wechselnden Programmen: Kabarett, Kleines<br />
<strong>Sc</strong>hauspiel, Tanztheater, Chanson, Folklore, Pantomime etc.<br />
Darmstadt hat zwei Museen im Zentrum. Das Museum im <strong>Sc</strong>hloss und das Hessische Landesmuseum<br />
(momentan wegen Renovierung geschlossen) mit einer beachtlichen Einzelsammlung dem Mittelalter,<br />
zur Moderne, zum Jugendstil und zur Glasmalerei sowie eine graphische Sammlung vom<br />
internationalem Rang.<br />
Sehenswert ist auch das Museum im Jagdschloss Kranichstein, das neben einer Ausstellung von<br />
allerlei Gehörnten eine beachtliche Jagdwaffensammlung enthält und inmitten einer reizvollen<br />
Landschaft aufwartet.<br />
Einen Besuch lohnt sich ebenfalls auf der Mathildenhöhe. Sie stellt mit ihren Bauten ein<br />
kunstgeschichtliches Museum dar. Dort finden sich auch zwei der Wahrzeichen der Stadt, der<br />
Hochzeitsturm und die Russische Kapelle. Ebenso ein Beliebter Treffpunkt ist die Rosenhöhe, die sich<br />
gerade auf der anderen Seite der Gleisen der Regionalbahn befindet.<br />
10.3. Kino<br />
Der Studentische Filmkreis zeigt wöchentlich sehenswerte Filme im Audimax. Die günstige<br />
Alternative zu einem Kino lädt ein mit familiärer Atmosphäre, Selbstversorgung und garantiertem<br />
Gesellschaftsfaktor.<br />
Kommerzielle Kinos gibt es natürlich auch. 'Pali', 'Festival', 'Helia' und 'Rex' sind Lichtspielhäuser in<br />
der Innenstadt, dazu kommt noch das große 'Cinemaxx' am Hauptbahnhof.<br />
10.4. Ausgehen<br />
Zunächst wäre da die vom ASTA unterhaltene Partylocation: Der <strong>Sc</strong>hlosskeller, der wie der Name<br />
schon vermuten lässt, unterhalb des <strong>Sc</strong>hlosses liegt und über den Innenhof erreichbar ist. Günstige<br />
Eintritts- und Getränkepreise zu interessanten Veranstaltungen locken immer wieder Publikum an, egal<br />
ob zu Bandauftritten, Disco, Theater, Lesungen oder politischen Veranstaltungen. Auch die<br />
Fachschaftsparty der MaWis wird dort am 26.Oktober <strong>2012</strong> stattfinden.<br />
www.schlosskeller-darmstadt.de<br />
Über die restlichen Kneipen, Cafés, Clubs und Diskotheken soll hier nicht endlos geredet werden,<br />
diese sind einem jedem in Gruppen zum Selbststudium überlassen. Aber um hier noch einige Namen<br />
fallen zu lassen:<br />
27
Centralstation, Enchilada, Hobbit, Vacaciones, Orange, K60, Corroborree, Herkules, Hotzenplotz, El<br />
Shisha, Musikpark A5 Darmstadt, Nachtcafé, Magenta, Krone und viele mehr.<br />
Oder kürzer: www.partyamt.de<br />
28
11. Nützliche Adressen<br />
Technische Universität Darmstadt Karolinenplatz 5<br />
64289 Darmstadt<br />
+496151/16-01<br />
Fachbereich 11 <strong>Materialwissenschaft</strong> Renate Ziegler-Krutz<br />
L2|01 79<br />
Petersenstraße 23<br />
64287 Darmstadt<br />
+49 6151 16-5377<br />
Studierendensekretariat Mo.--Do. 9:30-<strong>13</strong>:00 Uhr<br />
Fr. nach Vereinbarung<br />
Karolinenplatz 5<br />
64289 Darmstadt<br />
Amt für Ausbildungsförderung Petersenstr. 14<br />
642<strong>13</strong> Darmstadt<br />
+49 6151 16-2510<br />
Wohnraumverwaltung Alexanderstr. 4 (über der Mensa Stadtmitte)<br />
+496151 162710<br />
HRZ Technische Universität Darmstadt<br />
HRZ-Service<br />
S1|03 020 bzw. L1|01 66<br />
+49 6151 16-4357 (-help)<br />
29
12. Lageplan Lichtwiese<br />
30
<strong>13</strong>. Lageplan Stadtmitte<br />
31