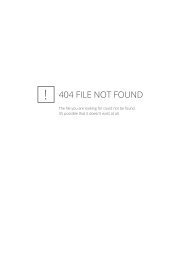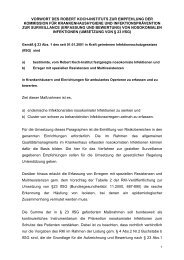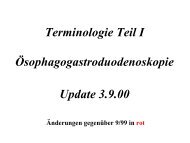Aszites, spontan bakterielle Peritonitis, hepatorenales ... - DGVS
Aszites, spontan bakterielle Peritonitis, hepatorenales ... - DGVS
Aszites, spontan bakterielle Peritonitis, hepatorenales ... - DGVS
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Sedimentanteil in 100 ml nativer Ergussflüssigkeit eingesandt<br />
werden [67] (Evidenzgrad IIb).<br />
<strong>Aszites</strong> aus einer Drainage sollte nicht mehr als wenige Stunden<br />
gesammelt werden, da die Gefahr der <strong>bakterielle</strong>n Kontamination<br />
und damit der Autolyse erhöht ist [67]. Bei großer<br />
Menge an Punktionsflüssigkeit oder bei Drainageflüssigkeit<br />
sollte jeweils die letzte gewonnene Fraktion eingesendet werden,<br />
da diese den höheren Zellgehalt an vitalen Zellen aufweist<br />
[68].<br />
Der Versand sollte möglichst zügig und nativ in sterilen,<br />
bruchsicheren und dicht schließenden Gefäßen erfolgen, unter<br />
diesen Bedingungen ist die Ergussflüssigkeit 2 –3 Tage haltbar,<br />
ohne dass die Zellen morphologisch und immunologisch Schaden<br />
nehmen [66]. Ist kein sofortiger Versand möglich, sollte<br />
das Punktionsmaterial bei 4 °C gelagert werden. Da seröse<br />
Flüssigkeiten gute Nährmedien sind, halten sich die Zellen darin<br />
bis zu 24 h bei Raumtemperatur, bei 4 °C auch bis zu 48 h<br />
[67].<br />
Wichtig für eine treffsichere zytologische Diagnostik ist die<br />
Mitteilung wesentlicher klinischer Befunde und der diagnostischen<br />
Fragestellung durch den behandelnden Arzt [66]. Dabei<br />
sind detaillierte Angaben zu zugrunde liegenden Erkrankungen,<br />
wie z. B. Herzinsuffizienz und auch therapeutische Maßnahmen,<br />
wie z.B. Chemo- oder Strahlentherapie hilfreich [66].<br />
Lavageflüssigkeiten (z. B. intraoperative Abdominallavage) sollten<br />
als solche gekennzeichnet werden [67].<br />
Technische Bearbeitung im Labor<br />
Bei geringen Ergussvolumina oder klaren Transsudaten bzw.<br />
bei resuspendierten zellarmen Sedimenten, bei denen eine geringe<br />
Zellzahl zu erwarten ist, können Zytozentrifugenpräparate<br />
angefertigt werden [66, 69].<br />
Größere Flüssigkeitsmengen sollten in Portionen von 500 –<br />
1000 ml bei 1500 – 2500 Umdrehungen pro min (700 g) 10 min<br />
zentrifugiert werden. Muss das Punktat aufgeteilt werden,<br />
sollten die Sedimente gemischt und nochmals zentrifugiert<br />
werden.<br />
Befinden sich Gewebspartikel oder Präzipitate bzw. Fibrinflocken<br />
im Erguss, sollten diese in Paraffin eingebettet werden<br />
[67]. Hiervon können dann gefärbte Paraffinschnitte angefertigt<br />
werden [66].<br />
Die zytologische Diagnostik erfolgt an May-Grünwald-Giemsa<br />
(MGG)-Präparaten; andere Färbemethoden werden kontrovers<br />
diskutiert [66, 67, 69].<br />
Eine Eisenfärbung kann zusätzlich zum Nachweis hämosiderinspeichernder<br />
Makrophagen, eine PAS-Färbung bei V.a. eine<br />
Infiltration durch ein monozellulär schleimbildendes Karzinom<br />
durchgeführt werden [67].<br />
Eine Gramfärbung ist in der Regel nicht indiziert, da die Keimkonzentration<br />
meist zu gering ist, sodass nur in Einzelfällen<br />
ein Keimnachweis gelingt [70].<br />
Standardisierte lichtmikroskopische Beurteilung<br />
Die Befundung sollte standardisiert nach der unten folgenden<br />
– von den Deutschen Gesellschaften für Pathologie und Zytologie<br />
erarbeiteten – Nomenklatur für die extragenitale Zytologie<br />
erfolgen [66, 68 –72].<br />
1. Angabe des eingesandten Untersuchungsmaterials, ggf. auch<br />
der klinischen Verdachtsdiagnose laut Begleitschein.<br />
2. Beschreibung des erhaltenen Untersuchungsmaterials (Typ,<br />
Makroskopie/Farbe, Menge).<br />
Leitlinie 755<br />
3. Beschreibung der Zellbilder, ggf. mit Hinweisen auf Erhaltungszustand<br />
und Repräsentativität.<br />
4. Stufung der Malignitätswahrscheinlichkeit<br />
▶ bösartige Zellen nicht nachweisbar (negativ) (0%)<br />
▶ bösartige Zellen nicht auszuschließen (zweifelhaft)<br />
(ca. 30%)<br />
▶ bösartige Zellen wahrscheinlich (dringender Verdacht)<br />
(ca. 60%)<br />
▶ bösartige Zellen nachweisbar (positiv) (100%)<br />
▶ unzureichendes Untersuchungsmaterial (mit Begründung:<br />
nekrotische, autolytische und osmotisch geschädigte Zellen)<br />
5. Diagnose im Klartext, möglichst unter Verwendung von „preferred<br />
terms“ der ICD-O-M bzw. des SNOMED, ggf. Angabe<br />
von Ausschlussdiagnosen, evtl. Hinweis auf mangelhafte Repräsentativität,<br />
unzureichenden Erhaltungszustand oder Präparationsartefakte.<br />
Weiterhin Kommentare, Empfehlungen,<br />
Stellungnahme zu klinischen Fragestellungen.<br />
Die Papanicolaou(Pap)-Klassifikation eignet sich nicht für die<br />
extragenitale Zytodiagnostik und sollte nicht verwendet werden<br />
[72]. Die Verwendung von Nomenklaturen der Krebsvorsorgezytologie<br />
des Gebärmutterhalses (nach Papanicolaou)<br />
sollte außerhalb dieses Diagnostikfelds eingestellt werden.<br />
Auch die aktuellen Versionen (Münchner Nomenklatur II und<br />
Bethesda-Nomenklatur II) heben ausschließlich auf die Befundung<br />
von Gebärmutterhalsabstrichen ab. Sie sind ungeeignet<br />
zur Befundmitteilung in der Punktionszytologie [72].<br />
Etablierte Zusatztechniken<br />
Bei malignitätsverdächtigen oder nicht eindeutigen Befunden<br />
können zusätzliche immunzytochemische bzw. immunhistochemische<br />
(nach Anfertigen eines Zellblocks) Untersuchungen<br />
durchgeführt werden, um die Treffsicherheit der zytologischen<br />
Untersuchung zu erhöhen. Dabei können auch geringe Anzahlen<br />
von Karzinomzellen durch den Nachweis epithelspezifischer<br />
Antigene identifiziert werden [71].<br />
Treffsicherheit<br />
Die konventionelle Ergusszytologie besitzt eine Sensitivität von<br />
58%, eine Spezifität von 97% und einen mittleren positiven<br />
Prädiktionswert von 99% sowie einen negativen Prädiktionswert<br />
von 80%. Circa 5% der zytologischen Diagnosen sind<br />
zweifelhaft/unklar [73]. Die diagnostische Genauigkeit lässt<br />
sich mittels Immunzytochemie und DNA-Zytometrie erhöhen<br />
[66, 72, 74 –77] (Evidenzgrad Ib).<br />
I.5. Spezifische Diagnostik bei Patienten mit <strong>Aszites</strong><br />
bedingt durch ein Budd-Chiari-Syndrom (BCS) oder<br />
sinusoidales Obstruktionssyndrom<br />
<strong>Aszites</strong> ist ein charakteristisches Symptom des BCS [78 –81].<br />
Aus diesem Grunde muss das BCS in der Differenzialdiagnose<br />
von Patienten mit <strong>Aszites</strong> berücksichtigt werden. Insbesondere<br />
die Kombination von rasch auftretendem <strong>Aszites</strong>, Schmerzen<br />
im rechten Oberbauch und deutlich erhöhten Leberwerten<br />
sollten den Blick auf das BCS lenken. Das BCS ist definiert als<br />
eine Ausflussbehinderung der Leber, die auf jeder Stufe des<br />
venösen Abflusses von den kleinen Lebervenen bis hin zum<br />
Übergang in den rechten Vorhof auftreten kann [82, 83]. Hierdurch<br />
entstehen eine portale Hypertension, Ischämie und noduläre<br />
Hyperplasie der Leber. Die Lokalisation der Ausflussbehinderung<br />
liegt in den westlichen Ländern vorwiegend in den<br />
Lebervenen (etwa 90%) mit oder ohne gleichzeitig vorliegen-<br />
Gerbes AL et al. S3-Leitlinie „<strong>Aszites</strong>, <strong>spontan</strong>… Z Gastroenterol 2011; 49: 749 –779<br />
Heruntergeladen von: Thieme Verlagsgruppe. Urheberrechtlich geschützt.