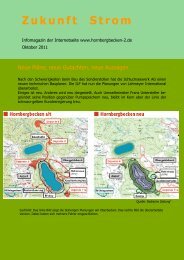Band 2 von 1984 - KEIN Hornbergbecken 2
Band 2 von 1984 - KEIN Hornbergbecken 2
Band 2 von 1984 - KEIN Hornbergbecken 2
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
..12.- Bestandsentwick~ung<br />
Die Entwicklung der Auerhuhn - Bestände. verläuft ge[':en<br />
wärtig in ganz Europa negatiVI rückläufige Tendenzen<br />
werden aus ganz M,itteleuropa, Skandinavien, der west- jI<br />
lichen UdSSR sowie. aUs großen Teileri der Alpen geweIdet.<br />
Zwei Beispiele mögen diese r;ntwickl~g belegen. Nach<br />
offizieller Jagdstatistik hat der'A~e~huhnbestand.Bad~n<br />
Württembergs <strong>von</strong> 1366 Hähnen' im Jahr 1955 auf 735 Hähne<br />
- ',-<br />
1971 abgenomme~. In einer Analyse der Balzplätze im<br />
-, '.<br />
# Schwarzwald fa·nd man heraus. daß 1971' fast die !lälfte der<br />
Balzp~ätze mH nur einem Hahn oder zwei Hil"hnenbesetzt ist<br />
-.Populationen al·so. die.niit 'größter'Wahrscheinlichkeit<br />
, ,<br />
zum Aussterben verurteilt sind! Im Bayerischen Nald war<br />
das Auerhuhn um 1900 bis in d~e Tä~er hinein häufig. Ab<br />
1950 begann ein markanter Rückzug der Hühner in die höheren<br />
Lagen. Seit 1970 lebte im Nationalpark ein lieliktbestand<br />
<strong>von</strong> etwa 27 Hähnen (insgesamt 60 Vögel). der sic.h<br />
seit 1980 auf etwa 11 Hähne (ca. 20 ,Vögel) verringertet<br />
Wie ist die Situation ~m Schwarzenbachtal ? Im Turbenmoos,<br />
einem Hauptbalzplatz des Gebietes, waren bis<br />
etwa 1968/69 ,ca. 20 Hennen und 8 Hähne zu b~obachten. Bs<br />
folgte eine drastische Abnahme, so daß 1979/80 nur ein bis<br />
zwei'Hennen und etwa 10 Hähne (also in umgekehrtem Ge-'<br />
schlechterverhäl t'niB) sich- am Balzplatz einfanden; 1983 wurden ,zwei<br />
Hennen und 4 Hähne gesehen. Seit vier Jahren sind<br />
offensichtlich keine Jungtiere mehr durchgekommen. Die<br />
Ursache.ist wahrscpeinlich in der Tatsache zu sehen, daß<br />
die 1965 gepflanzten Fichtenkulturen inzwischen eine Größe<br />
~rreicht haben, die optimale Lebensräume des Auerhuhns<br />
durch fehlende Sichtverbindung ze~teilt. Dadur~h kommt<br />
es zur Abwanderung einzelner Tiere in unbesetzte, inselartige<br />
Lebensräume, die sich ergebenden inselartigen VorkoIilmenbergen<br />
die Gef\3.hrder genetischen Isolat'ion durch<br />
Verkleinerung 'des Gen"" Vorrats. Auf diese Weise kann<br />
die Resistenz gegenüber 'feindlichen Umwelteinflüssen '<br />
(Krankheiten, Feinden) vermindert werden, so daß ßerade<br />
kleine Inselpopulationen zusammenbrechen. L:.usätzlichist<br />
eine geringere NaChkpmmenschaft zu erwarten, da ein gewisser<br />
~r6zentsatz ger Küken immer den natürlichen Feinden<br />
"<br />
(Habicht, Fuchs u.a.) oder ungünst~gen Witterungsverhältnissen<br />
zum Opfer - fällt. Da der'Lebe-nsr,,+umfür ~ da'sAuerwild<br />
n'icht mehr optimale Schut~möglichkei ten bietet. fall~n<br />
a~ch Alttiere den Feinden i.eichter z.umOpfer.<br />
Gefiihrdung<br />
Al~ Eauptursache für di~ dramatische Situation in ganz<br />
.l!;uropaist -wie vQn Kennern einheitlich angeg~ben...;die<br />
intEmsive Bewirtschaftung anzusehen, die durch Kahl<br />
sChlagwirtsch:,ft. kurze Umtriebszeiten u.ä. großflächige<br />
Waldareale zerstückelt, Alt-und Totholzheotände,d,ezi<br />
miert und, darüber hinauS o.ffene Waldwiesen und Moore<br />
durch Aufforstung, zerßtört. Weitere Ursachen sind fleja<br />
~ung (bis zur un~ens~hutzs~~llung durch die,Bundesartenschutz<br />
,- Verordnung) •.Freizeitbetrieb (Loipen, Wand,erwege,<br />
StörUi'l-gendurch "Naturliebhaber") und andere, we'niger<br />
relevante Faktd,ren.<br />
Die Auswirkungen des 8kilanglaufes auf Auerhtthn " Lebensräumehat<br />
1982/85 H.V.olk (Forstliche Versuchs - und Forschu)'IgsanstaltFreiburg)<br />
am Notschrei -zw;if1chenSchauinsland<br />
und 'J'odtnaugelegen- untersucht. ·S.eitlangemsind da:e<br />
Veränderungen und8t6ru~gen der Landschaft'durch Anlage<br />
und Betrieb <strong>von</strong> Loipen belegt. Die wichtigsten<br />
, -..,.<br />
Faktoren<br />
sind dabei;'<br />
- Anlage der. Loipentrasse<br />
...; D~ain~ge feuchter 8iellen<br />
~_Bau <strong>von</strong> ~arkplät~en. Hinwe1stllfeln, Hütten im S'tartund<br />
Ziel'gebie·t<br />
Abf'älle durch. di~ Langläufer<br />
Betroffen sind vor' allem' Fe41clttgebieteund Auerh,uhn<br />
Lebensfä~ume. 'Empfindliche Pflanzengesellschaften der Moope<br />
werden durch Wegwerfen -<strong>von</strong> Abfällen sowie durch ':T,ritt<br />
schäden im Sommer in' ihrem N,iihrstöffhauSh~~t ßes"t.qr1;und<br />
teilweise durch wenig.er empfindliche veTdTängt.- Da .sich'<br />
im SchwaTzwald die schneesicheren, hochgelege.nen S'kilarig~<br />
lauf - Gebiete größtenteils m.it Auerwild- Biotopen de<br />
cken, ,kommt e~ häufig zu de~enBeeinträchtigung, auch<br />
wenn in einzelnen Fällen verständige Verantwo~tliche<br />
~13-<br />
./<br />
/<br />
f'