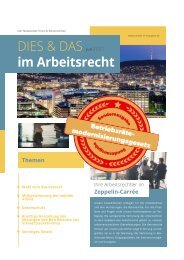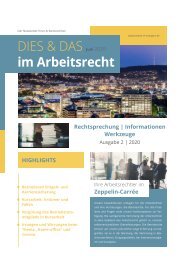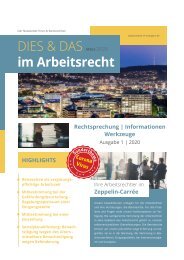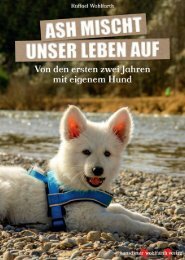Leseprobe: Dies & Das aus der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 2019/2020
Mit diesem Band setzen wir die Reihe „Dies und Das aus der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts“ nahtlos anschließend an die Bände 1 bis 3 fort. Band 4 enthält 93 ausgewählte Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts, die im Zeitraum 2019 bis Dezember 2020 veröffentlicht wurden. Vorgestellt und besprochen werden 49 Entscheidungen aus dem kollektiven Arbeitsrecht und 44 Entscheidungen aus dem Individualarbeitsrecht. Beibehalten wurde die Interviewform, die sich bewährt hat. In Frage und Antwort werden nicht nur die Entscheidungen und Sachverhalte dargestellt und erläutert. Großer Wert wurde auf die Wiedergabe der allgemein geltenden Rechtsgrundsätze gelegt und auf die vom Bundesarbeitsgericht vorgegeben Definitionen der entscheidungserheblichen Rechtsbegriffe. Der Band 4 gibt aus diesen Gründen nicht nur einen schnellen Überblick über die ausgewählte Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, sondern kann als Nachschlagewerk benutzt werden und ist hilfreich für die Vermittlung von Grundkenntnissen des Arbeitsrechts. Band 4 ist gleichermaßen für Rechtsanwälte, Verbandsvertreter, Personalabteilungen, Betriebsräte und Studenten geeignete Lektüre.
Mit diesem Band setzen wir die Reihe „Dies und Das aus der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts“ nahtlos anschließend an die Bände 1 bis 3 fort.
Band 4 enthält 93 ausgewählte Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts, die im Zeitraum 2019 bis Dezember 2020 veröffentlicht wurden. Vorgestellt und besprochen werden 49 Entscheidungen aus dem kollektiven Arbeitsrecht und 44 Entscheidungen aus dem Individualarbeitsrecht.
Beibehalten wurde die Interviewform, die sich bewährt hat. In Frage und Antwort werden nicht nur die Entscheidungen und Sachverhalte dargestellt und erläutert. Großer Wert wurde auf die Wiedergabe der allgemein geltenden Rechtsgrundsätze gelegt und auf die vom Bundesarbeitsgericht vorgegeben Definitionen der entscheidungserheblichen Rechtsbegriffe.
Der Band 4 gibt aus diesen Gründen nicht nur einen schnellen Überblick über die ausgewählte Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, sondern kann als Nachschlagewerk benutzt werden und ist hilfreich für die Vermittlung von Grundkenntnissen des Arbeitsrechts.
Band 4 ist gleichermaßen für Rechtsanwälte, Verbandsvertreter, Personalabteilungen, Betriebsräte und Studenten geeignete Lektüre.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Raffael Wohlfarth<br />
<strong>Dies</strong> & <strong>Das</strong> <strong>aus</strong> <strong>der</strong> <strong>Rechtsprechung</strong> <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>arbeitsgerichts<br />
<strong>2019</strong>/<strong>2020</strong>
Raffael Wohlfarth<br />
<strong>Dies</strong> & <strong>Das</strong><br />
<strong>aus</strong> <strong>der</strong> <strong>Rechtsprechung</strong><br />
<strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>arbeitsgerichts<br />
<strong>2019</strong>/<strong>2020</strong><br />
hansdieter wohlfarth verlag
1. Auflage 2021<br />
ISBN: 978-3-947133-15-4<br />
© 2021 hansdieter wohlfarth verlag<br />
Alle Rechte vorbehalten<br />
Spemannstraße 35<br />
70186 Stuttgart<br />
Deutschland<br />
info@edition-wohlfarth.net<br />
☛ www.edition-wohlfarth.net<br />
Text: Hans-Dieter Wohlfarth, Raffael Wohlfarth<br />
Konzeption, Satz, Layout & Covergestaltung:<br />
Raffael Wohlfarth, Augsburg<br />
☛ www.ra-wo.net<br />
Druck: WIRmachenDRUCK GmbH, Backnang
Inhalt<br />
Vorwort.....................................................................................................................................7<br />
Teil A: Kollektives Arbeitsrecht.........................................................................9<br />
Kapitel 1: Wahl <strong>des</strong> Betriebsrats...........................................................................................9<br />
Kapitel 2: Mitglie<strong>der</strong> <strong>des</strong> Betriebsrats...............................................................................17<br />
Kapitel 3: Betriebsratsgremien...........................................................................................25<br />
Kapitel 4: Auskunftsanspruch <strong>des</strong> Betriebsrats...............................................................35<br />
Kapitel 5: Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten...............................................47<br />
Kapitel 6: Arbeits- und Gesundheitsschutz.....................................................................59<br />
Kapitel: 7 Personelle Angelegenheiten.............................................................................71<br />
Kapitel 8: Betriebsvereinbarung.........................................................................................89<br />
Kapitel 9: Einigungsstelle..................................................................................................103<br />
Kapitel 10: Sozialplan......................................................................................................... 111<br />
Kapitel 11: Wirtschafts<strong>aus</strong>schuss.....................................................................................121<br />
Kapitel 12: Recht <strong>der</strong> Schwerbehin<strong>der</strong>tenvertretung...................................................127<br />
Teil B Individuelles Arbeitsrecht................................................................... 131<br />
Kapitel 1: Vergütung...........................................................................................................131<br />
Kapitel 2: Urlaub.................................................................................................................157<br />
Kapitel 3: Betriebsübergang..............................................................................................177<br />
Kapitel 4: Kündigungsrecht..............................................................................................193<br />
V
Kapitel 5: Befristung.......................................................................................................... 209<br />
Kapitel 6: Arbeitnehmerdatenschutz...............................................................................219<br />
Kapitel 7: Recht <strong>der</strong> Schwerbehin<strong>der</strong>ten....................................................................... 223<br />
Vorabentscheidungsersuchen EuGH............................................................239<br />
Entscheidungen zur betrieblichen Altersversorgung................................... 241<br />
Anhang..................................................................................................................................243<br />
VI
Vorwort<br />
Mit diesem Band setzen wir die Reihe „<strong>Dies</strong> und <strong>Das</strong> <strong>aus</strong> <strong>der</strong> <strong>Rechtsprechung</strong><br />
<strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>arbeitsgerichts“ nahtlos anschließend an die Bände 1 bis 3 fort.<br />
Band 4 enthält 93 <strong>aus</strong>gewählte Entscheidungen <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>arbeitsgerichts, die<br />
im Zeitraum <strong>2019</strong> bis Dezember <strong>2020</strong> veröffentlicht wurden. Vorgestellt und besprochen<br />
werden 49 Entscheidungen <strong>aus</strong> dem kollektiven Arbeitsrecht und 44 Entscheidungen<br />
<strong>aus</strong> dem Individualarbeitsrecht.<br />
Beibehalten wurde die Interviewform, die sich bewährt hat. In Frage und Antwort<br />
werden nicht nur die Entscheidungen und Sachverhalte dargestellt und erläutert.<br />
Großer Wert wurde auf die Wie<strong>der</strong>gabe <strong>der</strong> allgemein geltenden Rechtsgrundsätze<br />
gelegt und auf die vom Bun<strong>des</strong>arbeitsgericht vorgegeben Definitionen <strong>der</strong> entscheidungserheblichen<br />
Rechtsbegriffe.<br />
Der Band 4 gibt <strong>aus</strong> diesen Gründen nicht nur einen schnellen Überblick über die<br />
<strong>aus</strong>gewählte <strong>Rechtsprechung</strong> <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>arbeitsgerichts, son<strong>der</strong>n kann als Nachschlagewerk<br />
benutzt werden und ist hilfreich für die Vermittlung von Grundkenntnissen<br />
<strong>des</strong> Arbeitsrechts.<br />
Band 4 ist gleichermaßen für Rechtsanwälte, Verbandsvertreter, Personalabteilungen,<br />
Betriebsräte und Studenten geeignete Lektüre.<br />
Die Verfasser im Januar 2021
Teil A: Kollektives Arbeitsrecht<br />
Kapitel 1: Wahl <strong>des</strong> Betriebsrats<br />
Thema: Betriebsratswahl - Wahlvorstand - Bestellung durch Arbeitsgericht<br />
R. W.: Der Weg zur Errichtung eines Betriebsrats ist oft ein beschwerlicher und<br />
langwieriger, wie <strong>der</strong> Beschluss <strong>des</strong> 7. Senats vom 20. Februar <strong>2019</strong>1 eindringlich<br />
beweist, selbst bei einem Betrieb mit gerade einmal 23 Arbeitnehmern, vielleicht<br />
gerade <strong>des</strong>halb. Ver.di und drei Arbeitnehmer <strong>des</strong> Betriebes luden zu einer Wahlversammlung<br />
zur Wahl eines Wahlvorstands ein, an <strong>der</strong> 21 Arbeitnehmer teilnahmen.<br />
Acht stellten sich zur Wahl für den <strong>aus</strong> drei Personen bestehenden Wahlvorstand.<br />
Für den Kandidaten, <strong>der</strong> am meisten Stimmen auf sich vereinigen<br />
konnte, wurden zehn Stimmen abgegeben. Ein zweiter Wahlgang wurde nicht<br />
durchgeführt. Daraufhin beantragten vier Arbeitnehmer die Bestellung eines Wahlvorstands<br />
mit drei Mitglie<strong>der</strong>n und zwei Ersatzmitglie<strong>der</strong>n beim Arbeitsgericht.<br />
Die Arbeitgeberin beantragte die Abweisung <strong>des</strong> Antrags mit <strong>der</strong> Begründung, es<br />
hätte auf <strong>der</strong> Betriebsversammlung ein weiterer Wahlvorgang stattfinden müssen.<br />
Der 7. Senat musste sich mit vielerlei prozessualen Fragen, insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Antragsberechtigung,<br />
beschäftigen, auf die wir in <strong>der</strong> gebotenen Kürze am Ende <strong>der</strong><br />
Besprechung eingehen werden.<br />
RA W.: Die gerichtliche Bestellung eines Wahlvorstands in einem Kleinbetrieb wie<br />
vorliegend bestimmt sich nach § 17a BetrVG. Da im Unternehmen we<strong>der</strong> ein<br />
Gesamt- noch ein Konzernbetriebsrat bestand, ist <strong>der</strong> Wahlvorstand nach § 17a Nr.<br />
3 Satz 1 iVm. § 17 Abs. 2 BetrVG in einer Betriebsversammlung von <strong>der</strong> Mehrheit<br />
<strong>der</strong> anwesenden Arbeitnehmer zu wählen. Wählt die Betriebsversammlung<br />
keinen Wahlvorstand, so bestellt ihn das Arbeitsgericht nach § 17a Nr. 4 iVm. §<br />
17 Abs. 4 BetrVG auf Antrag von min<strong>des</strong>tens drei Wahlberechtigten o<strong>der</strong> einer<br />
1 Beschluss vom 20. Februar <strong>2019</strong> - 7 ABR 40/17<br />
9
im Betrieb vertretenen Gewerkschaft. Ein Wahlvorstand wurde im ersten und einzigen<br />
Wahlgang nicht gewählt, weil keiner <strong>der</strong> Kandidatinnen und Kandidaten die<br />
erfor<strong>der</strong>liche Stimmenanzahl von min<strong>des</strong>tens 11 Stimmen <strong>der</strong> anwesenden Arbeitnehmer<br />
auf sich vereinen konnte. Es genügt nämlich nicht die Mehrheit <strong>der</strong> abgegeben<br />
Stimmen. Erfor<strong>der</strong>lich ist die Mehrheit <strong>der</strong> Stimmen <strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Betriebsversammlung<br />
anwesenden Arbeitnehmer. Es wurde folglich kein Wahlvorstand<br />
gewählt.<br />
R. W.: Muss kein zweiter Versuch unternommen werden, ehe das Arbeitsgericht die<br />
Mitglie<strong>der</strong> <strong>des</strong> Wahlvorstands bestimmt?<br />
RA W.: Nein. Es wäre zulässig gewesen, notfalls mehrere Wahlvorgänge durchzuführen<br />
o<strong>der</strong> zu weiteren Wahlversammlungen einzuladen. <strong>Das</strong> ist aber nach den<br />
Feststellungen <strong>des</strong> 7. Senats keine Vor<strong>aus</strong>setzung dafür, einen Antrag auf gerichtliche<br />
Bestellung <strong>des</strong> Wahlvorstands stellen zu können. In unserem Fall kam es auch<br />
nicht dazu. Der Vorrang <strong>der</strong> Belegschaft <strong>des</strong> Betriebs, selbst einen Wahlvorstand<br />
nach ihren Vorstellungen einzusetzen, wird gesichert, weil die gerichtliche Bestellung<br />
eines Wahlvorstands nach § 17 Abs. 4 BetrVG nur erfolgen kann, wenn es<br />
den Arbeitnehmern <strong>des</strong> Betriebs nicht gelungen ist, auf einer Wahlversammlung,<br />
zu <strong>der</strong> ordnungsgemäß eingeladen wurde, einen Wahlvorstand zu wählen.<br />
R. W.: Kann dieser Vorrang auch noch gesichert werden, wenn das gerichtliche Bestellungsverfahren<br />
noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist?<br />
RA W.: In <strong>der</strong> Tat. Den Arbeitnehmern <strong>des</strong> Betriebs bleibt es unbenommen, bis<br />
zur Rechtskraft <strong>der</strong> durch das Arbeitsgericht erfolgten Bestellung eines Wahlvorstands<br />
in einer weiteren Betriebsversammlung einen Wahlvorstand zu wählen. Die<br />
Arbeitnehmer <strong>des</strong> Betriebs haben es also in <strong>der</strong> Hand, noch bis zum rechtskräftigen<br />
Abschluss <strong>des</strong> Verfahrens selbst einen Wahlvorstand zu wählen. Der 7. Senat nahm<br />
das Verfahren zum Anlass, darauf hinzuweisen, die gerichtliche Bestellung eines<br />
Wahlvorstands setze vor<strong>aus</strong>, dass eine ordnungsgemäße Einladung zu einer Wahlversammlung<br />
nach § 17a Nr. 3, § 17 Abs. 3 BetrVG erfolgt ist. In unserem Fall<br />
(Wahl eines Betriebsrats im vereinfachten Wahlverfahren nach § 14a BetrVG) sind<br />
10
die Beson<strong>der</strong>heiten <strong>der</strong> Wahlordnung zu beachten. <strong>Dies</strong>e sind in § 28 WO wie<br />
folgt geregelt:<br />
(1) Zu <strong>der</strong> Wahlversammlung, in <strong>der</strong> <strong>der</strong> Wahlvorstand nach § 17a Nr. 3 <strong>des</strong> Gesetzes<br />
(§ 14a Abs. 1 <strong>des</strong> Gesetzes) gewählt wird, können drei Wahlberechtigte <strong>des</strong> Betriebs<br />
o<strong>der</strong> eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft einladen (einladende Stelle) und Vorschläge<br />
für die Zusammensetzung <strong>des</strong> Wahlvorstands machen. Die Einladung muss<br />
min<strong>des</strong>tens sieben Tage vor dem Tag <strong>der</strong> Wahlversammlung erfolgen. Sie ist durch Aushang<br />
an geeigneten Stellen im Betrieb bekannt zu machen. Ergänzend kann die Einladung<br />
mittels <strong>der</strong> im Betrieb vorhandenen Informations- und Kommunikationstechnik<br />
bekannt gemacht werden; § 2 Abs. 4 Satz 4 gilt entsprechend. Die Einladung<br />
muss folgende Hinweise enthalten:<br />
a) Ort, Tag und Zeit <strong>der</strong> Wahlversammlung zur Wahl <strong>des</strong> Wahlvorstands;<br />
b) dass Wahlvorschläge zur Wahl <strong>des</strong> Betriebsrats bis zum Ende <strong>der</strong> Wahlversammlung<br />
zur Wahl <strong>des</strong> Wahlvorstands gemacht werden können (§ 14a Abs. 2 <strong>des</strong> Gesetzes);<br />
c) dass Wahlvorschläge <strong>der</strong> Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Wahl <strong>des</strong> Betriebsrats<br />
min<strong>des</strong>tens von einem Zwanzigstel <strong>der</strong> Wahlberechtigten, min<strong>des</strong>tens jedoch<br />
von drei Wahlberechtigten unterzeichnet sein müssen; in Betrieben mit in <strong>der</strong> Regel bis<br />
zu zwanzig Wahlberechtigten reicht die Unterzeichnung durch zwei Wahlberechtigte;<br />
d) dass Wahlvorschläge zur Wahl <strong>des</strong> Betriebsrats, die erst in <strong>der</strong> Wahlversammlung zur<br />
Wahl <strong>des</strong> Wahlvorstands gemacht werden, nicht <strong>der</strong> Schriftform bedürfen.<br />
Werden diese Regeln nicht eingehalten wird nicht ordnungsgemäß eingeladen und<br />
ein Wahlvorstand kann nicht vom Arbeitsgericht eingesetzt werden!<br />
R. W.: Abschließend zu den prozessualen Fragen: Oftmals beenden Antragsteller<br />
während eines laufenden Beschlussverfahrens ihr Arbeitsverhältnis, im Antrag genannte<br />
Arbeitnehmer für das Amt <strong>des</strong> Wahlvorstands nehmen ihr Einverständnis<br />
zurück. So war es auch im vorliegenden Verfahren. Von den vier Antragstellern beendeten<br />
im Laufe <strong>des</strong> Beschwerdeverfahrens beim Lan<strong>des</strong>arbeitsgericht zwei ihr<br />
Arbeitsverhältnis, zwei an<strong>der</strong>e traten dem Verfahren bei. Nach <strong>der</strong> Verkündung <strong>der</strong><br />
11
Beschwerdeentscheidung teilten zwei Arbeitnehmer mit, die Aufgabe als Wahlvorstand<br />
nicht mehr annehmen zu wollen. Während <strong>des</strong> Rechtsbeschwerdverfahrens<br />
beim Bun<strong>des</strong>arbeitsgericht beendete ein weiterer Antragsteller sein Arbeitsverhältnis<br />
und ein an<strong>der</strong>er nahm seinen Antrag zurück und ver.di beteiligte sich am Verfahren.<br />
Beteiligte im Rechtsbeschwerdeverfahren waren daher formell noch sechs<br />
Arbeitnehmer und ver.di. Die Anträge von drei Arbeitnehmern hatten keinen<br />
Erfolg, weil diese im Verlauf <strong>des</strong> Verfahrens <strong>aus</strong> ihren Arbeitsverhältnissen mit<br />
<strong>der</strong> Arbeitgeberin <strong>aus</strong>geschieden waren und sie damit ihre für die gerichtliche Bestellung<br />
eines Wahlvorstands erfor<strong>der</strong>liche Antragsberechtigung verloren hatten.<br />
Im Unterschied hierzu muss in einem Wahlanfechtungsverfahren die Wahlberechtigung<br />
<strong>des</strong> die Betriebsratswahl anfechtenden Arbeitnehmers nur zum Zeitpunkt<br />
<strong>der</strong> Wahl gegeben sein, so dass <strong>der</strong> spätere Wegfall <strong>der</strong> Wahlberechtigung<br />
durch Ausscheiden <strong>aus</strong> dem Betrieb nicht zum Wegfall <strong>der</strong> Anfechtungsbefugnis<br />
führt, es sei denn sämtliche die Wahl anfechtenden Arbeitnehmer sind <strong>aus</strong> dem<br />
Betrieb <strong>aus</strong>geschieden. Obwohl ein Arbeitnehmer seinen Antrag im Verfahren<br />
zur Bestellung <strong>des</strong> Wahlvorstands zurückgenommen hat, bleibt er gleichwohl Beteiligter<br />
<strong>des</strong> Verfahrens. <strong>Das</strong> hat seinen Grund darin, dass eine Rücknahme <strong>des</strong><br />
Antrags im Rechtsbeschwerdeverfahren nach § 92 Abs. 2 Satz 3 ArbGG nur mit<br />
Zustimmung <strong>der</strong> übrigen Beteiligten <strong>des</strong> Verfahrens zulässig ist. Die notwendige<br />
Zustimmung lag nicht vor. Der Antrag von ver.di war nicht mehr zulässig, weil<br />
dieser eine Beteiligtenän<strong>der</strong>ung auf Seiten <strong>der</strong> Antragsteller darstellt, die im Rechtsbeschwerdeverfahren<br />
nicht mehr erfolgen kann. Und noch ein Hin<strong>der</strong>nis kann eintreten:<br />
Wenn das Gericht im Zeitpunkt seiner Entscheidung davon <strong>aus</strong>gehen muss,<br />
dass die bestellte Person die Amtsübernahme ablehnen wird, kann eine Bestellung<br />
nicht erfolgen.<br />
RA W.: Von <strong>der</strong> Antragstellung am 10. November 2015 bis zum Beschluss <strong>des</strong><br />
Bun<strong>des</strong>arbeitsgerichts vom 20. Februar <strong>2019</strong> sind drei Jahre und fast vier Monate<br />
vergangen und noch immer ist kein Wahlvorstand bestellt, da die Sache an das<br />
Lan<strong>des</strong>arbeitsgericht zurückverwiesen werden musste, das das Bun<strong>des</strong>arbeitsgericht<br />
nicht berechtigt ist, selbst die Personen für den Wahlvorstand zu bestellen. <strong>Das</strong> obliegt<br />
dem Tatsachengericht!<br />
12
Wir halten fest: Die Anfor<strong>der</strong>ungen an die Wahl eines Wahlvorstands und eine<br />
evtl. gerichtlich notwendig werdende Bestellung sind hoch. Fehlerquellen erkennen<br />
und vermeiden!<br />
Thema: Betriebsratswahl - Anfechtung - Öffnung <strong>der</strong> Freiumschläge<br />
R. W.: Die Anfor<strong>der</strong>ungen an einen Wahlvorstand, die Betriebsratswahl so zu<br />
organisieren und durchzuführen, dass möglichts keine Gründe für eine Anfechtung<br />
<strong>der</strong> Wahl entstehen, sind immens. Insbeson<strong>der</strong>e die Briefwahl birgt<br />
ein großes Anfechtungsrisiko, wie <strong>der</strong> Beschluss <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>arbeitsgerichts vom<br />
20. Mai <strong>2020</strong> zeigt. 2 Die Daten <strong>der</strong> Wahl in Kürze: Wahl laut Wahl<strong>aus</strong>schreiben<br />
am Wahltag von 06:30 Uhr bis 18:30 Uhr und Auszählung <strong>der</strong> Stimmen am Wahltag<br />
ab 18:35 Uhr im Wahlraum. Gegen 16:30 Uhr begann <strong>der</strong> Wahlvorstand mit<br />
<strong>der</strong> Öffnung <strong>der</strong> Freiumschläge <strong>der</strong> Briefwähler, dem Vermerken <strong>der</strong> Stimmabgabe<br />
in <strong>der</strong> Wählerliste und dem Einwerfen <strong>der</strong> Wahlumschläge in die Wahlurne. <strong>Dies</strong>er<br />
Vorgang wurde gegen 17:30 Uhr abgeschlossen. Eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft<br />
hat die Wahl <strong>aus</strong> mehreren Gründen angefochten. Im Zentrum stand<br />
die Verletzung von § 26 Abs. 1 Erste Verordnung zur Durchführung <strong>des</strong> Betriebsverfassungsgesetzes<br />
(BetrVGDV1WO):<br />
§ 26 Verfahren bei <strong>der</strong> Stimmabgabe<br />
(1) Unmittelbar vor Abschluss <strong>der</strong> Stimmabgabe öffnet <strong>der</strong> Wahlvorstand in<br />
öffentlicher Sitzung die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Freiumschläge und<br />
entnimmt ihnen die Wahlumschläge sowie die vorgedruckten Erklärungen. Ist die<br />
schriftliche Stimmabgabe ordnungsgemäß erfolgt (§ 25), so legt <strong>der</strong> Wahlvorstand den<br />
Wahlumschlag nach Vermerk <strong>der</strong> Stimmabgabe in <strong>der</strong> Wählerliste ungeöffnet in die<br />
Wahlurne.<br />
Streitig und zu prüfen war, ob <strong>der</strong> Wahlvorstand die Verpflichtung erfüllt hatte,<br />
unmittelbar vor Abschluss <strong>der</strong> Stimmabgabe die eingegangenen Freiumschläge zu<br />
2 Beschluss vom 20. Mai <strong>2020</strong> – 7 ABR 42/18<br />
13
öffnen, da er gegen 16:30 Uhr mit <strong>der</strong> Öffnung <strong>der</strong> Freiumschläge <strong>der</strong> Briefwähler<br />
begonnen hatte und die Stimmabgabe um 18.30 Uhr abgeschlossen war.<br />
RA W.: <strong>Das</strong> Lan<strong>des</strong>arbeitsgericht war noch davon <strong>aus</strong>gegangen, <strong>der</strong> Wahlvorstand<br />
habe zu früh mit <strong>der</strong> Öffnung <strong>der</strong> Freiumschläge begonnen und <strong>der</strong> Anfechtung<br />
mit dieser Begründung stattgegeben. <strong>Das</strong> Bun<strong>des</strong>arbeitsgericht ist dem nicht gefolgt.<br />
Der Wahlvorstand habe einen Beurteilungsspielraum, welcher Zeitraum für<br />
die nach § 26 Abs. 1 WO gebotenen Handlungen zu veranschlagen ist, um so den<br />
Zeitpunkt zu bestimmen, ab dem die Freiumschläge geöffnet werden dürfen bzw.<br />
müssen, damit die Vorgabe „unmittelbar vor Abschluss <strong>der</strong> Stimmabgabe“ eingehalten<br />
werden kann. Ob die Festlegung <strong>des</strong> Zeitpunkts vom Beurteilungsspielraum<br />
<strong>des</strong> Wahlvorstands noch gedeckt war, kann erst im Nachhinein festgestellt<br />
werden. Unproblematisch ist es, wenn <strong>der</strong> Wahlvorstand die Aufgaben nach § 26<br />
Abs. 1 WO mit o<strong>der</strong> innerhalb weniger Minuten vor o<strong>der</strong> nach dem Ende <strong>der</strong> für<br />
die Stimmabgabe vorgesehenen Zeit beendet. Seine Prognose wurde dann bestätigt.<br />
R. W.: Wie ist es aber, wenn wie hier eine Stunde dazwischen liegt?<br />
RA W.: Dar<strong>aus</strong> folgt nach <strong>der</strong> Auffassung <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>arbeitsgerichts nicht ohne<br />
weiteres, dass die Prognose unzutreffend war. Vielmehr können im Verfahren<br />
um die Wahlanfechtung die Gründe dargelegt werden, aufgrund <strong>der</strong>er <strong>der</strong> Wahlvorstand<br />
davon <strong>aus</strong>gehen durfte, mit dem Öffnen <strong>der</strong> Freiumschläge so frühzeitig<br />
beginnen zu müssen. Zu berücksichtigen sei nicht nur <strong>der</strong> Zeitaufwand für<br />
die Öffnung <strong>der</strong> Freiumschläge, son<strong>der</strong>n auch die Klärung <strong>der</strong> Ordnungsgemäßheit<br />
<strong>der</strong> schriftlichen Stimmabgabe und ob die Stimme als ungültig zu werten<br />
ist. <strong>Dies</strong> kann im Einzelfall längere Zeit in Anspruch nehmen. Der Wahlvorstand<br />
hatte pro Freiumschlag eine Dauer von einer Minute kalkuliert, also min<strong>des</strong>tens 80<br />
Minuten für die Vornahme <strong>der</strong> notwendigen Handlungen bei einer Anzahl von 80<br />
bis 100 Freiumschlägen. Die Berücksichtigung eines Zeitpuffers von 40 Minuten<br />
wegen <strong>der</strong> persönlichen Abgabe von Stimmen durch Wahlberechtigte im Wahlraum<br />
sei grundsätzlich durch den Beurteilungsspielraum <strong>des</strong> Wahlvorstands gedeckt.<br />
An<strong>der</strong>erseits wäre eine an<strong>der</strong>e Betrachtung geboten, wenn es sich nur um 46<br />
zu öffnende Freiumschläge gehandelt hätte. Selbst bei einem noch zulässigen Zeit-<br />
14
puffer von 60 Minuten wäre <strong>der</strong> Vorgang ca. eine viertel Stunde vor dem Abschluss<br />
<strong>der</strong> Stimmabgabe erfolgt und damit zu früh. Auf die Zahl kommt es also an, was<br />
vom Lan<strong>des</strong>arbeitsgericht infolge <strong>der</strong> Zurückverweisung zu prüfen ist.<br />
R. W.: Warum führt ein solcher Verstoß zur Unwirksamkeit <strong>der</strong> Wahl? <strong>Das</strong> erschließt<br />
sich mir noch nicht.<br />
RA W.: Ich darf daran erinnern, dass die gebotenen Handlungen <strong>des</strong> Wahlvorstands<br />
in öffentlicher Sitzung bis zum Abschluss <strong>der</strong> Stimmabgabe zu erfolgen<br />
haben. <strong>Das</strong> Bun<strong>des</strong>arbeitsgericht führt <strong>aus</strong>:<br />
Nach § 26 Abs. 1 WO hat <strong>der</strong> Wahlvorstand die im Freiumschlag enthaltenen Unterlagen<br />
- Wahlumschläge und Erklärung über die persönliche Stimmabgabe - zu prüfen<br />
und - ähnlich wie bei <strong>der</strong> Stimm<strong>aus</strong>zählung - Entscheidungen zu treffen. Deshalb<br />
hat die Betriebsöffentlichkeit ein Interesse daran, diesen Vorgang - ebenso wie die<br />
Stimm<strong>aus</strong>zählung - verfolgen zu können. Beginnt <strong>der</strong> Wahlvorstand zu früh mit <strong>der</strong><br />
Öffnung <strong>der</strong> Freiumschläge, ist die Anwesenheit <strong>der</strong> Betriebsöffentlichkeit gefährdet.<br />
Es kann nicht <strong>aus</strong>geschlossen werden, dass es bei <strong>der</strong> Öffnung <strong>der</strong> Freiumschläge zu<br />
Fehlern kommt, die bei Anwesenheit wahlberechtigter Arbeitnehmer nicht unterlaufen<br />
wären.<br />
R. W.: Habe ich verstanden. Wie erfährt die Belegschaft von <strong>der</strong> öffentlichen<br />
Sitzung <strong>des</strong> Wahlvorstands, die in unserem Fall wohl um 16.30 Uhr mit dem<br />
Öffnen <strong>der</strong> Freiumschläge begonnen hat? Den Arbeitnehmern war <strong>der</strong> Zeitpunkt<br />
<strong>der</strong> Öffnung <strong>der</strong> Freiumschläge we<strong>der</strong> im Wahl<strong>aus</strong>schreiben noch an<strong>der</strong>weitig mitgeteilt<br />
worden!<br />
RA W.: Gute Frage. Dazu gibt uns we<strong>der</strong> das BetrVG noch die WO eine Antwort.<br />
<strong>Das</strong> Bun<strong>des</strong>arbeitsgericht stellte lapidar fest, die öffentliche Sitzung <strong>des</strong> Wahlvorstands<br />
sei am Wahltag konkludent einberufen, da alle Mitglie<strong>der</strong> <strong>des</strong> Wahlvorstands<br />
im einzigen Wahlraum versammelt waren und gemeinsam mit <strong>der</strong> Öffnung<br />
<strong>der</strong> Freiumschläge begonnen haben. <strong>Das</strong> geschehe regelmäßig im Rahmen einer<br />
konkludent einberufenen öffentlichen Sitzung <strong>des</strong> Wahlvorstands. Im Übrigen sei<br />
mehr angesichts <strong>der</strong> im Wahl<strong>aus</strong>schreiben enthaltenen Angaben zu den Öffnungs-<br />
15
zeiten eines einzigen Wahllokals zur persönlichen Stimmabgabe nicht erfor<strong>der</strong>lich.<br />
Da <strong>der</strong> Wahlvorstand die Freiumschläge nach § 26 Abs 1 BetrVGDV1WO<br />
„unmittelbar vor Abschluss <strong>der</strong> Stimmabgabe“ öffnet, bestehe kein Zweifel, an<br />
welchem Ort und zu welcher Zeit dies zu geschehen hat.<br />
R. W.: Abschließend noch ein Hinweis. Bemängelt wurde auch, dass teilweise<br />
auf eine Frankierung und entsprechende Beschriftung <strong>der</strong> Freiumschläge verzichtet<br />
worden sei. <strong>Das</strong> Bun<strong>des</strong>arbeitsgericht misst diesem Einwand keine Bedeutung<br />
zu, wenn ein Wahlberechtigter gegenüber dem Wahlvorstand erklärt, er<br />
werde im Zeitpunkt <strong>der</strong> Wahl wegen Abwesenheit vom Betrieb an <strong>der</strong> persönlichen<br />
Stimmabgabe verhin<strong>der</strong>t sein, und um die Unterlagen zur schriftlichen Stimmabgabe<br />
bittet. <strong>Dies</strong>es Verlangen umfasse regelmäßig alle in § 24 Abs. 1 S. 1 Nr.<br />
1 bis Nr. 5 BetrVGDV1WO genannten Unterlagen. Erklärt <strong>der</strong> Wahlberechtigte<br />
jedoch, er werde die Briefwahlunterlagen im Betrieb <strong>aus</strong>füllen und persönlich an<br />
den Wahlvorstand zurückreichen, so liege hierin im Zweifel kein Verlangen nach<br />
einem frankierten und nach § 24 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 BetrVGDV1WO beschrifteten<br />
Umschlag. Es genüge die Übergabe eines größeren Umschlags, um die schriftliche<br />
Stimmabgabe im Betrieb durchzuführen. Ein solches Vorgehen dient <strong>der</strong> Vermeidung<br />
nicht erfor<strong>der</strong>licher Wahlkosten iSd. § 20 Abs. 3 S. 1 BetrVG.<br />
Und noch ein Hinweis: Bei <strong>der</strong> erneuten Verhandlung vor dem Lan<strong>des</strong>arbeitsgericht<br />
hat dieses nicht nur die von den Antragstellern vorbrachten Anfechtungsgründe<br />
zu prüfen, son<strong>der</strong>n von Amts wegen alle Gründe, die im Verlauf <strong>des</strong> Anfechtungsverfahrens<br />
auf Grund <strong>des</strong> vorgetragenen Sachverhalts sichtbar werden.<br />
Eine Wahlanfechtung ist daher immer für überraschende Ergebnisse gut!<br />
Wir halten fest: Der Ablauf und die Durchführung einer Briefwahl sind beson<strong>der</strong>s<br />
sorgsam zu organisieren, insbeson<strong>der</strong>e die zeitlichen Vorgaben bei <strong>der</strong><br />
Öffnung <strong>der</strong> Freiumschläge.<br />
16
Juristische Fachliteratur<br />
Belletristik | Fotografie<br />
Kunst<br />
Besuchen Sie uns unter<br />
www.edition-wohlfarth.net