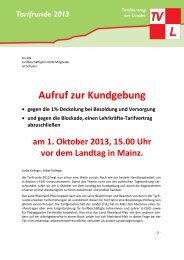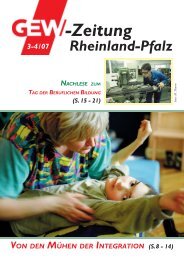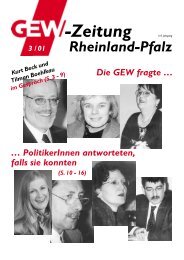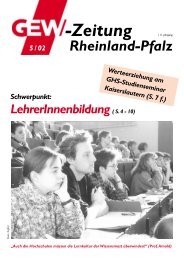-Zeitung - GEW
-Zeitung - GEW
-Zeitung - GEW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Foto: Thurm<br />
Foto: T. Senger<br />
1-2/05<br />
-<strong>Zeitung</strong><br />
Pädagogischer Konstruktivismus<br />
Teil 3 (S. IX - XII)<br />
114. Jahrgang<br />
Rheinland-Pfalz<br />
Personalratsarbeit ist unsere Sache - <strong>GEW</strong><br />
Wahrheit<br />
durch VERA?<br />
(S. 8 -11)<br />
Pädagogische Fachkräfte -<br />
Arbeit unter unsortierten Verhältnissen (S.4 - 7)
Foto: Clessienne<br />
Kolumne / Inhalt / Impressum<br />
2<br />
Die schärfsten<br />
Kritiker der Elche...<br />
waren früher selber welche. So dichtete<br />
einst Robert Gernhardt und nahm damit<br />
jene Zeitgenossen auf die Schippe,<br />
die - einem Laster gerade entronnen -<br />
mit einem Eifer missionarischen Ausmaßes<br />
ihre noch der Sucht verfallenen<br />
Mitmenschen auf den Pfad der Tugend<br />
zu bringen versuchen - und damit meist<br />
genau das Gegenteil des Intendierten<br />
erreichen.<br />
Thema Sucht und wie man davon los kommt. Vordergründig ist ja<br />
alles klar. Legale Drogen wie Nikotin und Alkohol schaden nicht nur<br />
dem Konsumenten, sondern auch dessen Umwelt. Beifall also für jene<br />
Bundesländer wie Hessen, die Nikotin- und Alkoholkonsum an Schulen<br />
verboten haben?<br />
Ach ja, wie schön wäre es, wenn sich Süchte durch schlichte Restriktionen<br />
aus der Welt schaffen ließen. Verändern wird sich - das zeigen<br />
Erfahrungen an so genannten „rauchfreien Schulen“ - nur insofern<br />
etwas, als die Probleme vom Schulgelände wegverlagert werden. Eine<br />
rauchfreie Schule ist schließlich keine raucherfreie. Die qualmenden<br />
SchülerInnen verziehen sich dann eben bei jeder Gelegenheit in die<br />
Wichtige Info für Mitglieder<br />
Wie jedes Jahr sind Beitragsquittung und Mitgliedsausweis<br />
im kartonierten Umschlag der Februar-Ausgabe unserer Bundeszeitung<br />
E&W zu finden, der unsere Landeszeitung beiliegt.<br />
Also: nicht wegwerfen, sondern heraustrennen und dann beim<br />
Finanzamt Kohle zurückholen. red<br />
Aus dem Inhalt <strong>GEW</strong>-ZEITUNG Rheinland-Pfalz Nr. 1-2 / 2005:<br />
Schulen Seiten 3 - 17<br />
Betriebsratsfortbildung Seite 18<br />
Rechtsschutz Seite 19<br />
Nachruf: Zum Gedenken an Rainer Probst Seite 20<br />
Alter + Ruhestand Seite 21<br />
Tipps + Termine Seiten 21 - 26<br />
Kreis + Region Seite 27<br />
<strong>GEW</strong>-Handbuch Seite 28<br />
Mittelteil: Päd. Konstruktivismus, Teil 3 Seiten IX - XII<br />
Impressum <strong>GEW</strong>-ZEITUNG Rheinland-Pfalz<br />
Herausgeber: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz, Neubrunnenstr. 8, 55116<br />
Mainz, Tel.: (0 61 31) 28988-0, Fax: (06131) 28988-80, E-mail: gew@gew-rheinland-pfalz.de<br />
Redaktion: Günter Helfrich (verantw.), Paul Schwarz (Stellvertr./Bildungspolitik), Ursel Karch (Gewerkschaftspolitik),<br />
Karin Helfrich (Außerschulische Bildung), Marc-Guido Ebert (Junge <strong>GEW</strong>);<br />
Redaktionsanschrift: <strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz, Postfach 22 02 23, 67023 Ludwigshafen, Tel./<br />
Fax: (0621) 564995, e-mail: guenter.helfrich@gew-rlp.de<br />
Verlag und Anzeigen, Satz und Druck: Verlag Pfälzische Post GmbH, Winzinger Str. 30, 67433<br />
Neustadt a.d.W., Tel.: (06321) 8 03 77; Fax: (0 63 21) 8 62 17; e-mail: vpprei@aol.com, Datenübernahme<br />
per ISDN: (0 63 21) 92 90 92 (Leonardo-SP - = 2 kanalig)<br />
Manuskripte und Beiträge: Die in den einzelnen Beiträgen wiedergegebenen Gedanken entsprechen<br />
nicht in jedem Falle der Ansicht des <strong>GEW</strong>-Vorstandes oder der Redaktion. Für unverlangt eingesandte<br />
Manuskripte oder zugemailte Daten wird keine Gewähr übernommen.<br />
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten; für Nichtmitglieder jährlich Euro 18,-- incl. Porto<br />
+ MWSt. (Bestellungen nur beim Herausgeber.) Kündigung 3 Monate vor Ablauf des Kalenderjahres.<br />
Im anderen Falle erfolgt stillschweigend Verlängerung um ein weiteres Jahr.<br />
Anzeigenpreisliste Nr. 12 beim Verlag erhältlich. Redaktionsschluss: jeweils der 1. des Vormonats.<br />
außerschulische Umgebung, was garantiert zu massiven Probleme mit<br />
der Nachbarschaft führt. Wer mag schon einen mit Kippen übersäten<br />
Bürgersteig vor seinem Haus.<br />
Auch Lehrkräfte und Verwaltungsangestellte werden das Rauchen nur<br />
aus eigenem Antrieb (und vielleicht unterstützt durch Entwöhnungsprogramme)<br />
und ganz bestimmt nicht durch Druck von oben aufgeben.<br />
Im Gegenteil: Wer lässt sich schon gerne ausgerechnet von Politikern<br />
erziehen, die ansonsten eher Probleme produzieren als lösen.<br />
Auch hier wird sich die Nachbarschaft freuen - in diesem Falle wirklich,<br />
denn die Gaststätten und Cafés der Umgebung dürfen sich auf<br />
steigende Umsätze verlassen, während in der Schule die Kommunikation<br />
zurück geht.<br />
Halt! Stopp! Das klingt doch wie ein Plädoyer für die Sucht. Schließlich<br />
haben Lehrkräfte gefälligst Vorbilder zu sein.<br />
Arme LehrerInnen. Da ist euer Job schon aufreibend genug, und jetzt<br />
sollt ihr auch noch perfekte Vorbilder sein. Aber wirklich perfekt. Also,<br />
nicht rauchen, nicht trinken und gesund ernähren. Schließlich sprechen<br />
Ernährungsforscher inzwischen von einer Epidemie der Fettsucht,<br />
unter der mehr als die Hälfte der Menschen in Industrienationen leiden.<br />
Nicht zu vergessen: die nicht-stofflichen Süchte, die einen krank machenden<br />
Psycho-Mief verbreiten können, gegen den ein Aufenthalt im<br />
Raucherabteil wie ein Kururlaub wirkt.<br />
Wer hat nicht schon vordergründig „suchtfreie“ KollegInnen oder Vorgesetzte<br />
erlebt, die durch ihren Egozentrismus, ihre Profilierungs- und<br />
Geltungssucht verheerend auf das Betriebsklima wirken und schamlos<br />
ihre Launen und ihren Frust an ihren bedauernswerten Mitmenschen<br />
ausleben.<br />
Wenn es Erwartungen an die Vorbildungsfunktion von Lehrkräften<br />
gibt, dann sollten diese realistisch und machbar sein. Wie wäre es z.B.<br />
mit diesem Anspruch: Gute LehrerInnen bemühen sich, ordentlich vorbereitet<br />
und möglichst ausgeglichen in ihren Unterricht zu gehen, um<br />
in einer positiven Atmosphäre Lernprozesse zu ermöglichen. Wie sie<br />
sich in ihrer freien Zeit entspannen, ist ihre Privatangelegenheit.<br />
Günter Helfrich<br />
<strong>GEW</strong>-Schnellerhebung zur Unterrichtsversorgung zu Beginn des S<br />
Ist Soll U-Ausfall Anzahl Klassen + -<br />
GS 33.202 33.282,8 0,20% 1.340 1,40% -3,10%<br />
GHS 9.055 9.231 1,90% 297 0,00% -6,40%<br />
HS 14.006,5 14.550 3,80% 383 0,30% -7,00%<br />
RegS 9.673,5 9.996 3,40% 288 4,10% -2,10%<br />
DOS 3.881 3.949 1,70% 103 6,70% -1,00%<br />
RealS 14.700 15.102,5 2,70% 554 1,10% -3,10%<br />
IGS 7.261,5 7.470,3 2,90% 185 3,30% -0,50%<br />
BBS 4.541 5.028 10,70% 252 4,40% 0,00%<br />
Gym 17.758 18.365,7 3,40% 439 2,30% 0,00%<br />
SoSch 17.641,7 18.568,4 5,20% 499 2,80% 1,60%<br />
Unterrichtsausfall insgesamt (ohn<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 / 2005
Amtliche Statistik sagt wenig über die Schulwirklichkeit aus<br />
Am 17. November 2004 veröffentlichte das Bildungsministerium<br />
die alljährliche Statistik zur Unterrichtsversorgung an den<br />
Schulen in Rheinland-Pfalz. Darin hieß es: „Unterrichtsversorgung<br />
im Schuljahr 2004/2005 weiter auf hohem Niveau - Gesamtschülerzahl<br />
erstmals leicht rückläufig“. Das ist die offizielle<br />
Lesart. Die <strong>GEW</strong> sieht diese Besserung nicht und stützt sich dabei<br />
auf ihre jedes Jahr zu Beginn des Schuljahres durchgeführte<br />
„Schnellerhebung“ an den Schulen des Landes.<br />
Von den 1.843 allgemein bildenden Schulen des Landes haben 303<br />
Schulen (16,4%) eine Rückmeldung an die <strong>GEW</strong> geschickt (vgl. Tabelle<br />
1). Abgefragt wurden das Unterrichtsstunden-Ist zu Beginn des<br />
Schuljahres 2004/2005, das Unterrichtsstunden-Soll (Anzahl der Stunden,<br />
die der Schule zugewiesen werden müssten, um eine Hundertprozent-Versorgung<br />
zu erreichen) und die aktuelle Anzahl der Klassen im<br />
Vergleich zum Unterrichtsjahr 2003/2004. Außerdem wollten wir<br />
wissen, ob die Schulen Neue Ganztagsschulen sind (insgesamt 72 von<br />
303 Schulen).<br />
Zunächst die „gute“ Nachricht: Die Ergebnisse, die die <strong>GEW</strong> Rheinland-Pfalz<br />
ermittelte, weichen unwesentlich von den Ergebnissen des<br />
Ministeriums ab: Wie das MBFJ ermittelte auch die <strong>GEW</strong> bei den<br />
Grundschulen eine Unterversorgung von 0,2%. Diese gute Versorgung<br />
führen wir ebenfalls auf die gesunkenen SchülerInnen-Zahlen - und<br />
damit weniger einzurichtender Klassen - zurück (vgl. Tabelle 1, Zeilen<br />
5 und 6). Die Aussage des Ministeriums, dass die SchülerInnen-Zahlen<br />
auch in den Hauptschulen, den Förderschulen und den Realschulen<br />
zurückgegangen seien, bestätigen die Umfrageergebnisse der <strong>GEW</strong><br />
(vgl. Tabelle 1, Zeilen 5 und 6 bei den jeweiligen Schularten). Ebenfalls<br />
fast identisch sind die Zahlen bei den Zuwächsen in den Dualen<br />
Oberschulen (<strong>GEW</strong> 5,7%, MBFJ 5.5%) und Regionalen Schulen<br />
(<strong>GEW</strong> 2%, MBFJ 2,3%).<br />
Bei Realschulen und Integrierten Gesamtschulen liegen die ermittelten<br />
Zahlen der <strong>GEW</strong> zur Unterrichtsversorgung fast identisch zu denen<br />
des MBFJ (RS 2,7% <strong>GEW</strong>, 2,3% MBFJ; IGS 2,9% <strong>GEW</strong>, 2,8%<br />
MBFJ).<br />
chuljahres 2004/2005<br />
GTS keine GTS Rückm. ges. Sch. insg. 03/04 % Rückm.<br />
17 144 161 990 16,30%<br />
4 12 16 86 18,60%<br />
13 14 27 138 19,60%<br />
6 9 15 84 17,90%<br />
2 3 5 13 38,50%<br />
3 15 18 117 15,40%<br />
1 6 7 19 36,80%<br />
0 3 3<br />
2 14 16 140 11,40%<br />
24 14 38 141 27,00%<br />
e BBS) : 2,6 %<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 /2005<br />
Auswertung:<br />
Kai Boehlkau<br />
Schulen<br />
Völlig anders sieht das allerdings bei den Hauptschulen, Regionalen<br />
Schulen, Dualen Oberschulen und Förderschulen aus:<br />
Schulart <strong>GEW</strong> MBFJ<br />
Hauptschule 3,8% 2,2%<br />
Regionale Schule 3,4% 1,8%<br />
Duale Oberschule 1,7% 0,6%<br />
Förderschule 5,2% 3,8%<br />
Wie lassen sich diese Unterschiede erklären?<br />
Während die <strong>GEW</strong> Rheinland-Pfalz „ungeschminkte“ Auskünfte erhält,<br />
basieren die Daten des MBFJ auf der amtlichen Statistik, die von<br />
den SchulleiterInnen und SchulaufsichtsbeamtInnen bearbeitet werden.<br />
Außerdem sind die Angaben der Schulen zu Beginn des neuen Schuljahres<br />
an die <strong>GEW</strong> übermittelt worden.<br />
Wie anders lassen sich sonst Zahlen erklären, die der <strong>GEW</strong> signalisieren,<br />
dass an Schulen im sozialen Brennpunkt bzw. an Schulen in Regionen,<br />
die nicht zu den bevorzugten gehören (Westpfalz, Westeifel,<br />
Hunsrück, hoher Westerwald, Ludwigshafen-Stadt) zum Teil mehr als<br />
70 Stunden fehlen (z. B. GHS in Rheinhessen: - 70 Stunden, HS im<br />
Westerwald: - 92 Stunden, RegS in der Pfalz: - 78 Stunden, RS in der<br />
Eifel: - 65 Stunden, DOS im Rheingraben: - 42 Stunden, Förderschule<br />
L: - 65 Stunden, Gymnasium an der Mosel: - 73,5 Stunden, IGS im<br />
Rheingraben: - 74,5 Stunden)?<br />
Von den Haupt- und Förderschulen, die eine Rückmeldung an die <strong>GEW</strong><br />
gegeben haben, wurde immer wieder angemerkt, dass es an ausgebildetem<br />
Personal fehlt bzw. bestimmt Fächerkombinationen nicht zu besetzen<br />
sind und deshalb der Unterrichtsausfall so hoch ist. Auch Vertretungslehrkräfte<br />
sind nicht mehr zu haben (das melden nicht nur die<br />
Schulen, sondern auch die Bezirkspersonalräte der Schulen bei der ADD<br />
in Trier).<br />
Während das MBFJ einen Versorgungsgrad von 98,1% an den allgemein<br />
bildenden Schulen ermittelt hat, ergab die <strong>GEW</strong>-Umfrage eine<br />
Unterversorgung von insgesamt 2,6% oder einen Versorgungsgrad von<br />
97,4% (Differenz zum MBFJ = 0,7%).<br />
Die <strong>GEW</strong> Rheinland-Pfalz stellt fest:<br />
Ohne eine ausreichende Lehrerfeuerwehr bzw. eine Vertretungsreserve,<br />
kann der Unterricht nicht voll gewährleistet werden. Gruppen oder<br />
Klassen müssen zusammen gelegt werden, bestimmte Fächer können<br />
nicht unterrichtet werden, nach wie vor basiert die „Unterrichtsversorgung<br />
auf hohem Niveau“ auf wackligen Füßen, da zum Teil Vertretungslehrkräfte<br />
mit nicht ausreichender Qualifikation den Unterricht<br />
aufrecht erhalten.<br />
Wer Qualität in den Schulen, Qualität im Unterricht und eine Qualitätsentwicklung<br />
verlangt, muss auch entsprechend qualitätsvoll ausgebildetes<br />
Personal zur Verfügung stellen. Wenn Ministerin Ahnen in ihrer<br />
Presseerklärung vom 17. November 2004 ausführt: „Auch weiterhin<br />
müssen wir uns anstrengen, um unsere Schülerinnen und Schüler<br />
mit gutem Unterricht zu versorgen, und wir werden das tun.“, dann ist<br />
es überhaupt nicht nachzuvollziehen, dass auch für 2005 eine Lehramtsanwärter-Höchstzahlverordnung<br />
erlassen wurde. Alle an den Universitäten<br />
ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer müssen ohne jede<br />
Wartezeit und ohne eine Höchstzahlverordnung übernommen werden,<br />
denn die Schulen in Rheinland-Pfalz brauchen dringend jede/n Lehrerin<br />
und jeden Lehrer.<br />
Tilman Boehlkau<br />
3
Schulen<br />
Pädagogische Fachkräfte - Arbeit unter unsortierten Verhältnissen<br />
120 TeilnehmerInnen aus nahezu ganz Rheinland-Pfalz bei <strong>GEW</strong>-Tagung<br />
An Schulen arbeiten LehrerInnen, klar. Und sonst? Die KollegInnnen im Sekretariat,<br />
der Hausmeister und...? Da war doch noch was? Ach ja, die Pädagogischen<br />
Fachkräfte. Aber, was sind deren eigentliche Aufgaben? Was verdienen<br />
sie und wie werden sie eingesetzt?<br />
Um diese und weitere Fragestellungen zu erörtern und über Perspektiven für<br />
Pädagogische Fachkräfte zu diskutieren, lud die <strong>GEW</strong> nach Ludwigshafen<br />
ein. Weit über 100 Pädagogische Fachkräfte folgten der Einladung. Veranstaltungen<br />
in Trier und Koblenz sind terminiert.<br />
4<br />
Eine Veranstaltung für Pädagogische<br />
Fachkräfte an Schulen also. Nichts<br />
schwieriger als das, so die einhellige<br />
Meinung unserer ReferentInnen. Der<br />
Grund: Kaum irgendwo sind die Arbeitsverhältnisse<br />
so unterschiedlich<br />
geregelt wie in diesem Bereich. „Machen<br />
wir natürlich trotzdem oder<br />
besser: gerade deswegen!“ So begannen<br />
Brigitte Strubel-Mattes (Juristin<br />
der <strong>GEW</strong>), Sylvia Sund (stellvertretende<br />
Vorsitzende der <strong>GEW</strong> und<br />
Hauptpersonalrätin für Förderschulen)<br />
sowie Thomas Rausch (Bezirkspersonalrat<br />
für Förderschulen bei der<br />
ADD in Trier) mit der inhaltlichen<br />
Vorbereitung. Im Ludwigshafener<br />
Heinrich-Pesch-Haus fand der Autor,<br />
der als Organisator fungierte, den<br />
richtigen Rahmen, einen Raum, geeignet<br />
für ungefähr dreißig Personen.<br />
Mehr würden zu diesem trockenen<br />
Thema wohl ohnehin nicht kommen,<br />
zumal der 30. November nicht<br />
gerade für angenehme Temperaturen<br />
und gute Straßenverhältnisse steht.<br />
Am Ende musste der Raum zweimal<br />
umgebucht werden und schließlich<br />
kamen sage und schreibe 120 TeilnehmerInnen<br />
aus nahezu ganz<br />
Rheinland-Pfalz. Erfreulich: Alle<br />
Schularten, in denen Pädagogische<br />
Fachkräfte arbeiten, waren vertreten.<br />
Kaum begonnnen, wurden die Problemlagen<br />
schnell klar.<br />
Gekündigter<br />
BAT-Tarifvertrag<br />
Die Tarifgemeinschaft der Länder<br />
(TdL) hat zum 30. April 2004 die<br />
Arbeitszeitbestimmungen des BAT<br />
gekündigt. Für KollegInnen, die vor<br />
dem 01. Mai 2004 eingestellt wurden,<br />
ist dies zunächst nicht von allzu<br />
großer Bedeutung. Sie unterliegen<br />
der sogenannten Nachwirkung,<br />
die alten Regelungen gelten fort. Für<br />
alle KollegInnen, die später eingestellt<br />
wurden, ist die Sache jedoch<br />
problematischer. Landesangestellte<br />
werden neuerdings auf Grundlage<br />
einer 40-Stundenwoche eingestellt.<br />
Das bedeutet für KollegInnen in<br />
Teilzeit ein niedrigeres Gehalt, da die<br />
Bemessungsgröße nun von 38,5 auf<br />
40 Stunden steigt. Für KollegInnen<br />
in Vollzeit ändert sich jedoch nichts.<br />
Wichtig: Auch die Präsenzzeit ändert<br />
sich aufgrund des gekündigten Tarifvertrages<br />
nicht! Sollte dennoch<br />
eine höhere Präsenzzeit angeordnet<br />
werden, ist dies nicht korrekt. In diesem<br />
Falle wird den betroffenen KollegInnen<br />
geraten, sich an ihre <strong>GEW</strong><br />
zu wenden. Bezirks- und Hauptpersonalräte<br />
setzen sich zurzeit dafür<br />
ein, dass die teilzeitbeschäftigten<br />
KollegInnen nicht benachteiligt und<br />
die Verschlechterungen zurückgenommen<br />
werden.<br />
Schwieriger gestaltet sich die Sachlage<br />
für KollegInnen, die bei freien<br />
Trägern angestellt sind. Diese unterliegen<br />
nicht dem Tarifvertrag. Jedoch<br />
bezieht sich der jeweilige Arbeitsvertrag<br />
in der Regel mehr oder weniger<br />
auf den BAT. Und dieses „mehroder-weniger“<br />
ist genau das Problem.<br />
„Da müssen wir genau hinschauen,<br />
im Zweifelsfall jeden Arbeitsvertrag<br />
einzeln prüfen“, so Strubel-Mattes<br />
auf der Veranstaltung. Denn es gibt<br />
eine Vielzahl von uneindeutigen Formulierungen.<br />
Oftmals muss gar die<br />
„betriebliche Praxis“ herhalten. So,<br />
wenn im Arbeitsvertrag keine genauen<br />
Regelungen festgehalten wurden.<br />
„In Anlehnung an BAT“ ist solch<br />
eine wachsweiche Formulierung.<br />
Wer lehnt sich denn da in welchen<br />
Punkten wie stark an? Klarer wird es<br />
bei Formulierungen wie „es gilt der<br />
BAT für Angestellte der Länder in<br />
seiner jeweils gültigen Fassung“.<br />
Eine Klassenfahrt, die ist<br />
lustig...<br />
Kann eine Pädagogische Fachkraft<br />
zur Teilnahme an einer Klassenfahrt<br />
verpflichtet werden? Grundsätzlich<br />
ja, so die Juristin, denn die Teilnahme<br />
an Klassenfahrten ist Teil der<br />
schulischen Aufgaben. Die entscheidende<br />
Frage ist jedoch nicht, ob eine<br />
Pädagogische Fachkraft an einer<br />
Klassenfahrt teilnehmen muss, sondern<br />
zu welchen Bedingungen sie<br />
dies tut. Einige erstaunte Gesichter<br />
gab es im Saal beim Thema Teilnahme<br />
von Teilzeitkräften. Während einer<br />
Klassenfahrt sind Teilzeitkräfte<br />
nämlich den Vollzeitkräften gleichgestellt.<br />
Das heißt, sie haben für den<br />
Zeitraum der Klassenfahrt Anspruch<br />
auf Vergütung als Vollzeitkraft. Die<br />
Vergütung erfolgt jedoch zunächst<br />
nicht in Euro, sondern in Freizeit.<br />
Nur wenn diese nicht gewährt werden<br />
kann, besteht ein Anspruch auf<br />
Bezahlung. Auch in diesem Fall gilt:<br />
Mitglieder wenden sich bei Problemen<br />
an ihre <strong>GEW</strong>.<br />
Willkür bei Präsenzzeiten?<br />
Kollegin Müller arbeitet seit einiger<br />
Zeit als Pädagogische Fachkraft an<br />
einer Grundschule. Ihre Präsenzzeit<br />
beträgt 27,5 Stunden bei einer vollen<br />
Stelle. Kollege Meier ist neu an<br />
der Schwerpunktschule. Er wurde<br />
von einer Förderschule hierher abgeordnet.<br />
Meier freut sich wie ein<br />
Schneekönig über die Arbeitszeiten,<br />
hatte er doch in der Förderschule 33<br />
Stunden Präsenzzeit zu leisten. Als<br />
er aber nun seinen Stundenplan<br />
sieht, fällt er aus allen Wolken. Ihm<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 / 2005
wird wiederum eine Präsenzzeit von<br />
33 Stunden abverlangt. Doch Kollege<br />
Meier lässt sich das nicht so<br />
ohne weiteres gefallen. Er wendet<br />
sich an seine <strong>GEW</strong>-Personalrätin<br />
und - was muss er da hören - sie bestätigt<br />
diese höhere Präsenzzeit. Leider,<br />
leider, so die Personalrätin, existieren<br />
in den verschiedenen Schularten<br />
höchst unterschiedliche Regelungen.<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 /2005<br />
Wie unterschiedlich die Regelungen<br />
sind, zeigt das Schaubild.<br />
So war es nicht verwunderlich, dass<br />
sich in Ludwigshafen Empörung<br />
breit machte. Die Politiker müssten<br />
doch einsehen, dass solch eine Ungleichbehandlung<br />
untragbar sei.<br />
Strubel-Mattes stellte unmissverständlich<br />
klar, dass die ungleichen<br />
Regelungen untragbar, aber dennoch<br />
kein rechtliches, sondern viel<br />
mehr ein politisches Problem seien.<br />
Die <strong>GEW</strong> setzt sich schon lange für<br />
Verbesserungen speziell an Förderschulen<br />
ein. Da dort die Mehrzahl<br />
der Pädagogischen Fachkräfte eingestellt<br />
ist, wäre dies mit erheblichen<br />
Kosten für das Land verbunden. Für<br />
eine wirklich tragbare Neuregelung<br />
ist wohl noch einige Überzeugungsarbeit<br />
im Ministerium zu leisten -<br />
es gibt „dicke Bretter zu bohren“.<br />
Verwirrung komplett: Die Aufteilung der Arbeitszeiten von pädagogischen Fachkräften an den verschiedenen Einsatzorten.<br />
Und Geld gibt’s auch - die<br />
Eingruppierungsproblematik<br />
Eingruppiert wird nach den Richtlinien<br />
der Tarifgemeinschaft deutscher<br />
Länder (TdL). Dort ist klar<br />
geregelt, dass beispielsweise eine Erzieherin<br />
als pädagogische Unterrichtshilfe<br />
an Förderschulen (Sonderschulen)<br />
zunächst BAT Vc und<br />
nach mehrjähriger Bewährung BAT<br />
V b erhält. Der Anspruch „mehrjährig“<br />
ist übrigens bereits nach zwei<br />
Jahren erfüllt. Hat die ErzieherIn<br />
eine entsprechende Zusatzausbildung,<br />
beginnt sie bereits mit BAT<br />
Vb und steigt nach einer Bewährungszeit<br />
von vier Jahren nach BAT<br />
IVb auf.<br />
Ein Auszug aus den Richtlinien:<br />
III. Lehrkräfte an Sonderschulen<br />
6. Erzieher, Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen, Krankengymnastinnen,<br />
Logopäden und Beschäftigungstherapeuten<br />
mit entsprechender staatlicher Prüfung oder staatlicher<br />
Anerkennung und Zusatzausbildung<br />
als pädagogische Unterrichtshilfen .......................................... V b<br />
nach mindestens vierjähriger Bewährung in dieser<br />
Tätigkeit und in dieser Vergütungsgruppe ............................. IV b<br />
(Die Länder werden ermächtigt, im Einzelfall zu entscheiden,<br />
welche sonstigen Angestellten aufgrund einer geeigneten<br />
gleichwertigen Ausbildung den Erziehern, Kindergärtnerinnen,<br />
Hortnerinnen, Krankengymnastinnen,<br />
Logopäden und Beschäftigungstherapeuten gleichgestellt<br />
werden können)<br />
Schulen<br />
5
Schulen<br />
7. Erzieher, Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen,<br />
Krankengymnastinnen, Logopäden und Beschäftigungstherapeuten<br />
mit entsprechender staatlicher Prüfung oder<br />
staatlicher Anerkennung als pädagogische Unterrichtshilfen<br />
............................................................................ V c<br />
nach mehrjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit<br />
und in dieser Vergütungsgruppe ................................... V b<br />
(Die Länder werden ermächtigt, im Einzelfall zu entscheiden,<br />
welche sonstigen Angestellten aufgrund einer<br />
geeigneten gleichwertigen Ausbildung den Erziehern,<br />
Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen, Krankengymnastinnen,<br />
Logopäden und Beschäftigungstherapeuten<br />
gleichgestellt werden können)<br />
8. Sonstige pädagogische Unterrichtshilfen ohne<br />
Ausbildung nach Fallgruppe 5, Fallgruppe 6<br />
oder Fallgruppe 7<br />
mit Zusatzausbildung ................................................... V c<br />
nach mehrjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit und<br />
in dieser Vergütungsgruppe ........................................... V b<br />
6<br />
Willkür bei Präsenzzeiten von Pädagogischen<br />
Fachkräften Foto: Thurm<br />
Des Weiteren existieren Richtlinien für KollegInnen an Schulkindergärten<br />
oder an Vorschulklassen (siehe unten). Für alle diejenigen<br />
Fachkräfte, die weder an einer Förderschule noch in einem<br />
Schulkindergarten / einer Vorschulklasse eingestellt sind, gibt es<br />
keine gesonderten Eingruppierungsrichtlinien der TdL. Sie werden<br />
analog der unten aufgeführten Richtlinien eingestellt.<br />
Ein weiteres Beispiel: Kollegin Schmidt arbeitete als Erzieherin<br />
zwei Jahre in einem Schulkindergarten. Dieser wurde aufgelöst<br />
und sie arbeitete weitere zwei Jahre als Pädagogische Fachkraft in<br />
der Grundschule. Begonnen hatte Frau Schmidt mit BAT Vc. Aber<br />
bekommt sie den Bewährungsaufstieg nach BAT Vb (der ihr -<br />
hätte der Schulkindergarten weiter bestanden - zugestanden hätte)<br />
nun auch? Verlangt ist diesbezüglich eine vierjährige Tätigkeit<br />
Eine gute Sache:<br />
Demnächst ist diese Info-Dienst-Broschüre über die <strong>GEW</strong><br />
Landesgeschäftsstelle in Mainz (für <strong>GEW</strong>-Mitglieder kostenfrei)<br />
zu beziehen.<br />
in einem Schulkindergarten oder einer Vorschulklasse. Wird die<br />
Zeit in der Grundschule anerkannt oder nicht?<br />
Ein ähnlich gelagertes Problem: Kollege Geiger hat eine Zusatzausbildung,<br />
arbeitet aber weder in einem Schulkindergarten noch<br />
in einer Vorschulklasse. Bekommt er die höhere Eingruppierung<br />
nach BAT V b oder bekommt er sie nicht?<br />
Solche und ähnliche Fälle müssen nicht, können aber zu Problemen<br />
führen. Eine klare Regelung in den Richtlinien ist also dringendst<br />
erforderlich. Bis dahin wird eine großzügige Auslegung von<br />
der <strong>GEW</strong> und den Personalräten eingefordert.<br />
Der Auszug aus den Richtlinien:<br />
VII. Lehrkräfte an Schulkindergärten oder an Vorschulklassen<br />
für schulpflichtige Kinder<br />
4. Erzieher, Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen,<br />
Krankengymnastinnen, Logopäden und<br />
Beschäftigungstherapeuten<br />
mit entsprechender staatlicher Prüfung oder<br />
staatlicher Anerkennung und sonderpädagogischer<br />
Zusatzausbildung<br />
als Leiter eines Schulkindergartens oder einer<br />
Vorschulklasse ............................................................... V b<br />
nach mindestens vierjähriger Bewährung in dieser<br />
Tätigkeit und in dieser Vergütungsgruppe ................... IV b<br />
5. Erzieher, Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen, Krankengymnastinnen,<br />
Logopäden und Beschäftigungstherapeuten<br />
mit entsprechender staatlicher Prüfung oder staatlicher<br />
Anerkennung und sonderpädagogischer Zusatzausbildung<br />
in einem Schulkindergarten oder in einer<br />
Vorschulklasse ............................................................... V b<br />
6. Erzieher, Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen,<br />
Krankengymnastinnen, Logopäden und<br />
Beschäftigungstherapeuten<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 / 2005
mit entsprechender staatlicher Prüfung oder<br />
staatlicher Anerkennung in einem Schulkindergarten<br />
oder in einer Vorschulklasse .......................................... V c<br />
nach mindestens vierjähriger Bewährung in dieser<br />
Tätigkeit und in dieser Vergütungsgruppe .................... V b<br />
Nach recht anstrengenden zwei Abendstunden waren viele Informationen<br />
gegeben, die Missstände benannt und entsprechende<br />
politische Forderungen der <strong>GEW</strong> von den Anwesenden untermauert.<br />
Das Ministerium ist weiterhin gefordert, klare einheitliche<br />
Regelungen zu schaffen, die den hohen Bildungsananforderungen<br />
und der hohen Belastung der KollegInnen Rechnung tragen.<br />
Abschließend stellten sich zahlreiche - teilweise von sehr weit her -<br />
angereiste <strong>GEW</strong>-ExpertInnen zur Klärung von Einzelfragen zur<br />
Verfügung. Es zeigte sich, dass bei vielen Problemlagen in der Tat<br />
nur eine individuelle Beratung weiterhilft. Die <strong>GEW</strong> steht dafür<br />
weiterhin zur Verfügung.<br />
Und auch „zwischen den Jahren“ waren unsere ExpertInnen nicht<br />
untätig: Demnächst ist die Info-Dienst-Broschüre Nr. 40 „Pädagogische<br />
Fachkräfte an Schulen“ in der <strong>GEW</strong>-Landesgeschäftsstelle<br />
erhältlich. In dieser Broschüre sind die wichtigsten Rechtsverordnungen<br />
und Richtlinien abgedruckt und mit kurzen Kommentaren<br />
versehen. Ein Muss für jede Pädagogische Fachkraft. Für<br />
unsere Mitglieder geben wir die Broschüre selbstverständlich wie<br />
immer kostenlos ab.<br />
Weitere Veranstaltungstermine:<br />
• Trier, 22.02.2005<br />
• Koblenz, 08.03.2005<br />
pbg<br />
<strong>GEW</strong>-Intern:<br />
Aktualisierung der<br />
Mitgliederdaten<br />
Um die Mitgliederverwaltung auf den neuesten Stand zu bringen,<br />
bitten wir alle diejenigen, bei denen im Laufe des Jahres Änderungen<br />
ihrer persönlichen Daten eingetreten sind, nebenstehenden Vordruck<br />
auszufüllen, auszuschneiden und an die <strong>GEW</strong>-Landesgeschäftsstelle<br />
in Mainz zu senden. Vielen Dank.<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 /2005<br />
✂<br />
Daten zur Aktualisierung<br />
meiner Unterlagen:<br />
Name ____________________________________<br />
Straße ____________________________________<br />
Schulen<br />
PLZ /Ort: __________________________________<br />
Telefon priv. ________________________________<br />
Mitgliedsnummer __________________________<br />
Name der Dienststelle: _______________________<br />
_________________________________________<br />
Straße ____________________________________<br />
PLZ/Ort __________________________________<br />
Arbeitgeber ________________________________<br />
Tätigkeit _________________________________<br />
Eingruppierung ____________ ab ____________<br />
Beschäftigungsumfang _______ ab ____________<br />
Bankverbindung:<br />
Bankleitzahl ________________________________<br />
Kontonummer ______________________________<br />
Datum __________ Unterschrift ________________<br />
Bei Veränderungen bitte schicken an: <strong>GEW</strong>-Landesgeschäftsstelle<br />
· Neubrunnenstr. 8 · 55116 Mainz<br />
7
Schulen<br />
Wahrheit durch VERA?<br />
Anmerkungen zum 1. Durchgang der Leistungstests in 7 Ländern 1<br />
- Von Prof. Dr. Hans Brügelmann -<br />
Die am Anfang der vierten Klasse in Rheinland-Pfalz und sechs weiteren<br />
Bundesländern im September dieses Jahres durchgeführte Lernstandserhebung<br />
VERA (VERgleichsArbeiten... 2 ) hat unter LehrerInnen viel Aufregung<br />
verursacht. Meine Reaktion ist ambivalent: Als Forscher habe ich großen Respekt<br />
davor, was die VERA-KollegInnen unter den gegebenen Rahmenbedingungen<br />
geleistet haben. Gleichzeitig frage ich mich, ob man sich auf die gegebenen<br />
politischen und organisatorischen Rahmenbedingungen hätte einlassen<br />
sollen. Funktion, Anlage und Durchführung der Studie haben darunter<br />
gelitten.<br />
8<br />
Die Erfahrungen aus diesem Durchgang<br />
sollten deshalb als Chance genutzt<br />
werden, um zu lernen. Das gilt<br />
für diejenigen, die die Tests entwikkeln<br />
bzw. ihren Einsatz verordnen<br />
und durchführen, aber auch für die<br />
LehrerInnen, die kritisch prüfen<br />
müssen, was sie mit den Ergebnissen<br />
anfangen können - und was<br />
nicht.<br />
Was sollen und was können<br />
zentrale Testprogramme<br />
leisten? 3<br />
Drei Funktionen von VERA sind in<br />
der Außendarstellung von verschiedenen<br />
Beteiligten unterschiedlich<br />
stark betont worden und faktisch<br />
auch unterschiedlich gut einlösbar:<br />
* Bei der Bestandsaufnahme von<br />
grundlegenden Leistungen auf Landesebene<br />
(„System-Monitoring“) hat<br />
das deutsche Schulsystem tatsächlich<br />
einen Nachholbedarf. Diese Funktion<br />
können standardisierte Testprogramme<br />
und konkret auch VERA<br />
von ihrer Anlage her gut erfüllen (zu<br />
einigen spezifischen Vorbehalten s.<br />
u.).<br />
* Auch die Rückmeldung der Ergebnisse<br />
an einzelne Schulen und LehrerInnen<br />
ist hilfreich. Zum einen<br />
können LehrerInnen genauer sehen,<br />
in welchen Bereichen ihre Klassen<br />
relativ zu anderen Lerngruppen Stärken<br />
und Schwächen haben - bedingt<br />
durch besondere Vorerfahrungen der<br />
Kinder, durch eigene Schwerpunkte<br />
im Unterricht, durch die Anlage der<br />
verwendeten Schulbücher oder an-<br />
dere Faktoren. Deren Bedeutung ist<br />
allerdings nur vor Ort von den Beteiligten<br />
selbst zu klären. Außerdem<br />
können LehrerInnen im Vergleich<br />
mit Klassen, die unter ähnlichen Bedingungen<br />
arbeiten („Referenzschulen“),<br />
ihre Anforderungen an die<br />
Kinder und ihre Maßstäbe bei der<br />
Leistungsbeurteilung überprüfen.<br />
Dies darf aber nicht einfach Anpassung<br />
an die externen Kriterien bedeuten,<br />
sondern verlangt eine Reflexion<br />
der externen und der eigenen Annahmen.<br />
* Der Anspruch einer „Diagnose“ des<br />
Lernstands einzelner Kinder allerdings<br />
überfordert die Instrumente.<br />
Eine punktuelle Messung muss inhaltlich<br />
auf wenige Ausschnitte begrenzt<br />
werden. Zudem ist sie immer<br />
fehlerbehaftet, d. h. der festgestellte<br />
Wert kann nur als Anhaltspunkt für<br />
eine Bandbreite, innerhalb derer der<br />
„wahre“ Wert mit einiger Sicherheit<br />
liegt, genommen werden. Je mehr<br />
man das Fehlerrisiko minimieren<br />
will, umso breiter muss man die<br />
Bandbreite möglicher Schwankungen<br />
ansetzen - und umso weniger<br />
hilfreich ist dann das Ergebnis. In<br />
Kennwerten für Gruppen, also in<br />
Werten für ganze Klassen oder gar ein<br />
Bundesland, gleichen sich individuelle<br />
Schwankungen weitgehend aus,<br />
so dass das Fehlerrisiko der entsprechenden<br />
Durchschnittswerte entsprechend<br />
gering ist. Einmalige Tests<br />
bei einzelnen Personen bieten dagegen<br />
nur grobe Annäherungen an die<br />
tatsächliche Leistung. Sinnvoll nut-<br />
zen lassen sich die Ergebnisse trotzdem,<br />
wenn man Abweichungen zur<br />
eigenen Einschätzung als „Warnlampe“<br />
nutzt, also als Anlass, um die<br />
Differenzen durch weitergehende<br />
Beobachtungen aufzuklären.<br />
Für alle drei Ebenen gilt gleichermaßen:<br />
Die Ergebnisse sind als ein Element<br />
in einem umfassenderen Rechenschaftssystem<br />
zu sehen 4 , als ein<br />
wichtiges und bisher unterrepräsentiertes<br />
Evaluationsinstrument, aber<br />
auch als ein in seiner Aussagekraft<br />
und Geltung begrenztes. Das größte<br />
Problem in der seit TIMSS öffentlich<br />
geführten Schuldebatte sind ihre<br />
Schrumpfung auf den Vergleich von<br />
Punktwerten und die Überhöhung<br />
der Testautorität. PolitikerInnen und<br />
Medien schauen nur noch auf den<br />
Output. Berichte der Schulaufsicht,<br />
Forschungsergebnisse zu Lehr-/<br />
Lern-Prozessen und ihren Bedingungen<br />
verlieren an Bedeutung. Auch<br />
viele LehrerInnen nehmen die Vergleichsdaten<br />
nicht als nützliche Zusatzinformation<br />
über Stärken und<br />
Schwächen ihrer Klasse, sondern<br />
trauen oft ihrem eigenen Urteil nicht<br />
mehr, obwohl es aus einer längerfristigen<br />
Erfahrung erwächst. Testergebnisse<br />
einzelner Kinder werden für<br />
Eltern (und oft auch für LehrerInnen)<br />
zum „wahren“ Wert für ihre<br />
Leistung, statt zu einem Indikator,<br />
der interpretationsbedürftig ist.<br />
Konkrete Anmerkungen zu<br />
den Aufgaben und Verfahren<br />
von VERA<br />
Analysiert man die Test- und die<br />
Begleitunterlagen, unterhält man<br />
sich mit KollegInnen aus der Grundschulpädagogik<br />
bzw. der Fachdidaktik<br />
und befragt man LehrerInnen aus<br />
den beteiligten Bundesländern nach<br />
ihren ersten Erfahrungen mit VERA,<br />
so stößt man auf sehr unterschiedliche<br />
Reaktionen. Manche KollegInnen,<br />
die VERA im oben genannten<br />
Sinn als ein Element im Rahmen verschiedener<br />
Informationsquellen ver-<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 / 2005
stehen, finden die Tests nützlich.<br />
Auch viele Kinder haben die Aufgabe,<br />
„zu zeigen, was ihr könnt“, als<br />
Herausforderung positiv angenommen.<br />
Andere, vor allem leistungsschwächere<br />
SchülerInnen und Kinder<br />
mit Migrationshintergrund, erlebten<br />
viele Aufgaben und den Umfang<br />
insgesamt als völlige<br />
Überforderung. Darüber<br />
hinaus gibt es eine Reihe von<br />
Problemen, die bei der Weiterentwicklung<br />
des Instrumentariums<br />
und seinem zukünftigen<br />
Einsatz bedacht<br />
werden müssen:<br />
Zum inhaltlichen<br />
Ansatz<br />
Einige Aufgaben bieten interessante<br />
Anregungen für<br />
Leistungskontrollen, die<br />
LehrerInnen nutzen sollten,<br />
um ihr eigenes Repertoire zu<br />
erweitern. Die Formate bringen<br />
aber - wegen der notwendigen<br />
Standardisierung<br />
von Durchführung und Auswertung<br />
- unvermeidlich<br />
auch Einschränkungen mit<br />
sich 5 :<br />
* Aufgaben ohne Kontextbezug,<br />
wie er z. B. in den Lehrplänen<br />
für Deutsch gefordert<br />
wird, sind für viele SchülerInnen<br />
überraschend. Sie<br />
verändern auch das Lösungsverhalten,<br />
z. B. wenn in 20<br />
min. ein Text zu einem Thema<br />
geschrieben werden soll, obwohl<br />
den SchülerInnen beigebracht worden<br />
ist, dass das Schreiben guter Texte<br />
ein Brainstorming, eine Textplanung,<br />
mehrere Zyklen der Überarbeitung<br />
(z. B. in Schreibkonferenzen)<br />
und insgesamt eine rege Kommunikation<br />
mit anderen voraussetzt.<br />
Dagegen untersagen die Instruktionen<br />
bei VERA ausdrücklich Fragen<br />
an die Lehrerin und Gespräche der<br />
Kinder untereinander.<br />
* Die Richtigkeits-Orientierung, wie<br />
sie für eine standardisierte Auswertung<br />
erforderlich ist, gerät in Konflikt<br />
mit der Mehrdeutigkeit von<br />
Verhalten, insbesondere von sprachlichen<br />
Vorlagen einerseits und Lösungen<br />
andererseits, und sie fördert<br />
bei SchülerInnen eine Haltung, die<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 /2005<br />
nach gewünschter Lösung sucht,<br />
statt dem eigenem Denken zu trauen.<br />
* Werden Hilfsmittel, deren Gebrauch<br />
die SchülerInnen nicht nur<br />
gewohnt sind, sondern deren Beherrschung<br />
auch explizit als Lernziel<br />
von den Lehrplänen eingefordert<br />
VERA? Na und! Foto: Tanja Senger<br />
wird (z. B. Wörterbücher zur Kontrolle<br />
der Richtigschreibung von<br />
Wörtern) vorenthalten, entsteht eine<br />
Konkurrenz zu den Prinzipien des<br />
Unterrichts und den Erfahrungen<br />
der SchülerInnen.<br />
* Auch das dicht konzentrierte Abarbeiten<br />
von unzusammenhängenden<br />
Aufgaben unter Zeitdruck (z. B.<br />
in Form von Diktaten) steht im Widerspruch<br />
zu Leistungssituationen,<br />
wie sie neuere Lehrpläne fordern<br />
und wie die Kinder in vielen Klassen<br />
sie gewohnt sind. Das ganze<br />
„Setting“ wird von den Grundschulen,<br />
die nach den Richtlinien und<br />
Lehrplänen der letzten Jahre arbeiten,<br />
als Fremdkörper empfunden.<br />
Und diejenigen, die gerade die er-<br />
sten Schritte machen, werden eher<br />
entmutigt - oder sogar in ihren alten<br />
Vorstellungen bestätigt.<br />
* Die unterstellte Eindimensionalität<br />
der Fähigkeitsniveaus innerhalb<br />
z. B. von Arithmetik, Geometrie und<br />
Sachrechnen/ Größen in Mathematik,<br />
wird dem nicht gerecht, was zunehmend<br />
über „eigene<br />
Wege“ des mathematischen<br />
und schriftsprachlichen<br />
Lernens bekannt ist 6 .<br />
* Über die Angemessenheit<br />
einzelner Aufgaben, z.<br />
B. der Deutung von wenig<br />
gängigen Sprichwörtern<br />
im Deutschtest, wird nach<br />
der Auswertung zu diskutieren<br />
sein.<br />
Diese kritischen Anmerkungen<br />
stellen nicht in<br />
Frage, dass die Ergebnisse<br />
als wichtige Indikatoren<br />
für die angepeilten Leistungen<br />
dienen können.<br />
Aber die gewonnenen Daten<br />
müssen entsprechend<br />
interpretiert werden 7 ,<br />
Punktwerte dürfen nicht<br />
at face value zu Urteilen<br />
über Kinder oder LehrerInnen<br />
werden.<br />
Damit sind wir bei der<br />
Durchführung von VERA<br />
und ihren Folgen:<br />
Zur Wirkung der Erhebungssituation<br />
Die Schulen sind sehr unterschiedlich<br />
mit den Vorgaben umgegangen,<br />
so dass sowohl das Durchschnittsniveau<br />
als auch die Vergleichbarkeit<br />
der Ergebnisse einzelner<br />
Klassen ernsthaft in Frage zu stellen<br />
sind. Zudem deuten sich schon jetzt<br />
ambivalente bis problematische Auswirkungen<br />
auf den Unterricht an. 8<br />
* In einer Reihe von Schulen wurden<br />
Aufgaben(typen) geübt 9 , so dass<br />
die Ergebnisse über Klassen hinweg<br />
nicht vergleichbar sind.<br />
* Manche LehrerInnen haben ihren<br />
Klassen oder einzelnen Kindern entgegen<br />
den ausdrücklichen Anweisungen<br />
geholfen, so dass die empirisch<br />
gewonnenen Daten nur schwer<br />
als „Referenz“-Daten zu etablieren<br />
sind.<br />
* Zudem wurde bei der Bewertung<br />
Schulen<br />
9
Schulen<br />
10<br />
„VERA“<br />
von Lösungen unterschiedlich „kulant“<br />
mit Lösungen umgegangen -<br />
zum Schutz einzelner SchülerInnen,<br />
aber auch im Interesse des eigenen<br />
Unterrichtserfolgs...<br />
* Testformate beginnen darüber hinaus,<br />
die Aufgabenformate im Unterricht<br />
zu bestimmen, obwohl Lernsituationen<br />
anderen Prinzipien gehorchen<br />
als Leistungskontrollen.<br />
* Es zeichnet sich eine Einengung<br />
des Unterrichts auf die in den Tests<br />
geforderten Inhalte und Kompetenzen<br />
ab, z. B. auf technische Informations”entnahme“<br />
aus Textstücken<br />
statt persönlicher Auseinandersetzung<br />
mit der inhaltlichen „Botschaft“.<br />
* Es ist absehbar, dass Eltern und die<br />
lokale Presse Informationen aus der<br />
verpflichtenden schulinternen Diskussion<br />
für ein informelles äußeres<br />
Ranking nutzen werden, ohne dass<br />
die notwendigen Einschränkungen<br />
mit bedacht werden (können).<br />
* Der Zeitpunkt der Erhebung und<br />
die Dreistufigkeit des Kompetenzmodells<br />
legen eine Zuordnung zu<br />
den Schularten der Sekundarstufe<br />
nahe und werden vor allem von Eltern<br />
oft so missverstanden. Die ministeriell<br />
immer wieder beschworene<br />
individuelle Förderung ist im letz-<br />
ten Halbjahr der Grundschulzeit<br />
kaum mehr möglich<br />
Im Vergleich zu den in NRW in den<br />
Vorjahren eingeführten Parallelarbeiten<br />
mindert der weniger enge Lehrplanbezug<br />
den Wert der Ergebnisse,<br />
ebenso die nicht mehr notwendige<br />
Zusammenarbeit von KollegInnen<br />
den Ertrag für die innerschulischen<br />
Entwicklungsprozesse.<br />
Zu den organisatorischen<br />
Rahmenbedingungen:<br />
Auch wenn die logistische Leistung<br />
der Landauer Forschergruppe und<br />
der Projektleitungen in den Bundesländern<br />
bewundernswert ist: Viele<br />
Schulen klagen über den Zeitdruck,<br />
die unzureichende Vorbereitung und<br />
den hohen personellen und finanziellen<br />
Aufwand bei der Durchführung.<br />
Als abträglich für die alltägliche<br />
Arbeit unter sowieso schon<br />
schwierigen Bedingungen werden<br />
insbesondere genannt:<br />
* hoher Materialaufwand für das<br />
Kopieren bei begrenztem Etat (in der<br />
Sekundarstufe wurden die Materialien<br />
zentral vervielfältigt...);<br />
* hoher Zeitaufwand, einsetzbare<br />
Testhefte zusammen zu stellen, und<br />
hoher Korrekturaufwand 10 - beides<br />
zieht Zeit von anderen Aktivitäten<br />
ab;<br />
* sehr kurzfristige Anforderung der<br />
Ergebnisse aus den Referenzschulen<br />
und damit immenser Zeitdruck bei<br />
der Auswertung (Herbstferien als<br />
Korrekturzeit...);<br />
* die Fehleranfälligkeit bzw. unzulängliche<br />
Passung der komplizierten<br />
Auswertungsvorgaben und des<br />
Computersystems;<br />
* die nicht immer abgestimmten Informationen<br />
von verschiedenen<br />
Quellen und an verschiedene Zielgruppen,<br />
so dass Unsicherheit und<br />
zum Teil auch Argwohn entstanden<br />
ist;<br />
* die als nicht repräsentativ wahrgenommene<br />
Auswahl der Beispielaufgaben,<br />
die den Schulen im Frühjahr<br />
zur Vorinformation zugeschickt worden<br />
waren;<br />
* der geringe Ertrag für die Weiterentwicklung<br />
des Unterrichts und die<br />
Förderung einzelner Kinder.<br />
Die von der Politik erzeugte Hektik<br />
hat sowohl der Testzentrale in Land-<br />
au als auch anderen Beteiligten die<br />
Arbeit erschwert und manchen<br />
Goodwill in den Schulen verschenkt.<br />
Insbesondere das Versprechen, es<br />
werde kein Ranking geben, wird<br />
durch die Verpflichtung, allen Eltern<br />
nicht nur die Ergebnisse ihres Kindes,<br />
sondern ebenso die Durchschnittswerte<br />
seiner Klasse und der<br />
Schule mitzuteilen, faktisch wertlos.<br />
Wer in Ländern wie England und<br />
den USA beobachtet hat, welche<br />
Konsequenzen die Publikation von<br />
globalen Testdaten einzelner Schulen<br />
z. B. auf die Immobilienpreise<br />
von Stadtteilen hat 11 , wird sich keine<br />
Illusionen machen, was den verständigten<br />
Umgang mit solchen<br />
Daten in der Öffentlichkeit betrifft.<br />
Zu hoffen ist, dass aus diesen<br />
Schwierigkeiten für weitere Erhebungen<br />
gelernt wird<br />
Fazit:<br />
* Für ein regelmäßiges System-Monitoring,<br />
bei dem die Entwicklung<br />
des Schulsystems insgesamt erfasst<br />
werden soll, würde es reichen, alle<br />
vier bis sechs Jahre Erhebungen<br />
durchzuführen. Außerdem könnte<br />
man sich (wie bei PISA und IGLU)<br />
auf repräsentative Stichproben beschränken<br />
und anderen Schulen eine<br />
freiwillige Teilnahme (wie bei<br />
LUST 12 ) ermöglichen, was die Belastungen<br />
solcher Testprogramme<br />
mindern und ihre Akzeptanz beträchtlich<br />
erhöhen dürfte. Zugleich<br />
würden damit Mittel frei für andere<br />
Evaluationsaktivitäten (s. u.).<br />
* Um LehrerInnen hilfreiche Informationen<br />
zur Kalibrierung ihrer<br />
Maßstäbe und für den Vergleich der<br />
eigenen mit anderen Klassen zu geben,<br />
wäre bei den nächsten Terminen<br />
ein Wechsel auf andere Kompetenzbereiche<br />
von Deutsch bzw. Mathematik<br />
und auch auf andere Lernbereiche<br />
wie Sachunterricht und die<br />
musisch-ästhetischen Fächer sinnvoll.<br />
Dabei sollten generell auch weniger<br />
standardisierte Formate erprobt<br />
werden.<br />
* Für die Individualbeobachtung<br />
müssten Instrumente zur Lernbegleitung<br />
entwickelt werden, um differenziertere<br />
Einschätzungen anzuregen<br />
und zu unterstützen, als sie<br />
durch eine punktuelle Messung<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 / 2005
möglich sind.<br />
Der letzte Punkt hat aus meiner<br />
Sicht in der nahen Zukunft Priorität,<br />
soll das Evaluationssystem nicht<br />
Schlagseite bekommen. Der Grundschulverband<br />
hat eine Arbeitsgruppe<br />
eingesetzt, die entsprechende Hilfen<br />
für Sprache, Mathematik und<br />
Sachunterricht entwickeln und in<br />
Form eines Fortbildungspakets publizieren<br />
soll. Es ist zu hoffen, dass<br />
auch staatliche Institutionen zumindest<br />
einen Teil ihrer Ressourcen in<br />
solche Aktivitäten investieren.<br />
Der Aufsatz stammt aus Heft 89 von<br />
„Grundschule aktuell“, der Zeitschrift<br />
des Grundschulverbandes, auf<br />
dessen Homepage www.grundschul<br />
verband.de ab Februar 05 ein Forum<br />
zum Thema „Vergleichsarbeiten“<br />
eingerichtet worden ist.<br />
Literatur<br />
Bartnitzky, H./ Speck-Hamdan, A. (Hrsg.)<br />
(2004, i.D.): Pädagogische Leistungskultur:<br />
Leistungen der Kinder wahrnehmen -<br />
würdigen - fördern. Beiträge zur Reform<br />
der Grundschule, Bd. 118. Grundschulverband:<br />
Frankfurt.<br />
Bartnitzky, H., u. a. (1999): Zur Qualität<br />
der Leistung - 5 Thesen zu Evaluation und<br />
Rechenschaft der Grundschularbeit.<br />
Grundschulverband - Arbeitskreis Grundschule<br />
e. V.: Frankfurt. Auch in: Schmitt,<br />
R. (Hrsg.) (1999): An der Schwelle zum<br />
dritten Jahrtausend. BundesGrundschul-<br />
Kongress 1999. Grundschulverband - Arbeitskreis<br />
Grundschule: Frankfurt, 165-<br />
196.<br />
Brügelmann, H. (Hrsg.) (1998): Kinder lernen<br />
anders: vor der Schule - in der Schule.<br />
Libelle: CH-Lengwil.<br />
Brügelmann, H. (i. D.): Schule verstehen -<br />
Forschungsbefunde zu Kontroversen über<br />
Erziehung und Unterricht. Libelle: CH-<br />
Lengwil (erscheint im Sommer 2005).<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 /2005<br />
Metzger, K., u. a. (2004): Sprachbezogene<br />
Leistungen würdigen. Die aktuelle Leistungsdiskussion<br />
und erfolgreicher<br />
Deutschunterricht. Ms. für: Bartnitzky/<br />
Speck-Hamdan (2004, i.D.).<br />
Anmerkungen<br />
1 Ich danke verschiedenen KollegInnen<br />
(die z.T. ausdrücklich lieber ungenannt<br />
bleiben wollen....) für hilfreiche Anmerkungen<br />
zu einer Vorfassung dieses Papiers<br />
2 Informationen des Projekts unter: http:/<br />
/www.uni-landau.de/vera/<br />
3 Vgl. dazu ausführlicher meine Beiträge<br />
in Bartnitzky/ Speck-Hamdan (2004,<br />
i.D.) und in GSV-aktuell Nr. 79, 82, 83,<br />
sowie in Brügelmann (i. D., Kap. 47-<br />
51).<br />
4 Vgl. Bartnitzky u. a. 1999<br />
5 Vgl. zur inhaltlichen Kritik die konkreten<br />
Anmerkungen von Bartnitzky und<br />
Selter in diesem Heft sowie Metzger u.<br />
a. (2004, i.D.).<br />
6 Vgl. anschaulich, auch für Eltern, die<br />
Beiträge in Brügelmann (1998).<br />
7 Die Landauer Forschungsgruppe hat<br />
dazu unter dem Titel „Pädagogische<br />
Nutzung der Vergleichsarbeiten“ und<br />
„Handreichung zur Analyse der Falschlösungen“<br />
wichtige Hinweise gegeben,<br />
deren Berücksichtigung helfen könnte,<br />
das vielerorts beklagenswerte Niveau der<br />
Feststellung, Interpretation und Bewertung<br />
von Schülerleistungen anzuheben.<br />
Zu befürchten ist auf der anderen Seite,<br />
dass viele LehrerInnen und Eltern sich<br />
mit Summenwerten begnügen und ihre<br />
Urteile auf oberflächliche Vergleiche<br />
stützen werden.<br />
8 Das ging bis zu Diskussionen, ob die<br />
Kinder während der vorgesehenen 10minütigen<br />
Pause während der Deutscharbeit<br />
die Klasse verlassen und miteinander<br />
sprechen dürften - oder ob die<br />
Pause schweigend im Klassenraum zu<br />
verbringen sei, unterbrochen allenfalls<br />
vom Gang zur Toilette! Wenn die Klausurlogik<br />
sich entfaltet ...<br />
9 ... in mindestens einer mit bekannten<br />
Klasse sogar zum Üben mit nach Hause<br />
gegeben!<br />
0800 / 66 68 88 9<br />
für alle Regionalbüros<br />
Ermittlung · Beobachtung · Detektivausbildung<br />
33 Jahre kriminalpolizeiliche Erfahrung<br />
Tätigkeitsschwerpunkte in Rheinland-Pfalz und Saarland<br />
Unsere Leistungen und Fachbereiche unter wwww. 24 Stunden erreichbar:<br />
unternehmensdetektei.de familiendetektei.de Tel.: 06 21 / 56 45 75<br />
anwaltsdetektei.de seniorendetektei.de freecall: 0800 / 66 68 99 9<br />
versicherungs-detektei.de sektendetektei.de Fax: 06 21 / 56 45 90<br />
immobiliendetektei.de mobbingdetektei.de e-mail: info@tective.de<br />
ausbildungsdetektei.de behoerdendetektei.de Internet: www.tective.de<br />
preiswerte • kompetente • gerichtsverwertbare Beweiserhebung<br />
Schützenstraße 26 · 67061 Ludwigshafen a. Rh. (und in Ihrer Nähe)<br />
Bücherspalte<br />
Schulen<br />
10 Mindestwert ca. ein Halbtag pro Fach<br />
und Klasse bis hin zu einem Tag schriftliche<br />
Auswertung in den Ferien zu Hause<br />
und einem weiteren weiterer Tag Eingabe<br />
am PC für die zentrale Auswertung<br />
in Landau.<br />
11 S. aktuell http://www.mercurynews.com<br />
/mld/mercurynews/living/education/<br />
10045224.htm?1c [Abruf: 4.11.2004]<br />
12 Vgl. meinen Beitrag in GSV-aktuell Nr.<br />
84<br />
<strong>GEW</strong>-Handbuch für<br />
Lehrerinnen und Lehrer<br />
4. Auflage 1998 Loseblattausgabe<br />
- Gesamtwerk mit Spezialordner<br />
4. überarbeitete Fassung<br />
Stand März 2003<br />
Das rund 1.400 Seiten starke<br />
Werk enthält alle wichtigen Gesetze<br />
und Verwaltungsvorschriften<br />
für den Schulbereich in<br />
Rheinland-Pfalz.<br />
Mitglieder: 23,00 Euro<br />
Nichtmitglieder: 32,00 Euro<br />
jeweils zzgl. Porto<br />
Wissenswertes für Beamtinnen<br />
und Beamte<br />
Informationen zu beamtenrechtliche<br />
Themen wie Besoldung, Arbeitszeit,<br />
Reise- und Umzugskosten,<br />
Versorgung und Beihilfe<br />
240 Seiten, Ausgabe 2003/2004<br />
2,60 Euro zzgl. Porto<br />
Die Beihilfe<br />
Der Ratgeber mit praktischen<br />
Tipps zu Beihilfeberechtigung,<br />
Bemessung, beihilfefähige Aufwendungen<br />
uvm.<br />
220 Seiten, Aufl. 2003<br />
Euro 2,60 zzgl. Porto<br />
Beihilfenverordnung<br />
in der Fassung vom 10. Dezember<br />
2002 mit der Einführung einer<br />
Kostendämpfungspauschale<br />
und den Änderungen zu Wahlleistungen<br />
<strong>GEW</strong>-Mitglieder kostenlos -<br />
Nichtmitglieder 1,30 Euro, jeweils<br />
zzgl. Porto<br />
Bestellungen an:<br />
<strong>GEW</strong> Rheinland-Pfalz<br />
Neubrunnenstr. 8 · 55116 Mainz<br />
11
Schulen<br />
Das Bewerbungsverfahren transparent gemacht<br />
Schreiben der ADD an InteressentInnen für Funktionsstellen<br />
Wenn sich Schulen positiv entwickeln sollen, brauchen<br />
sie - natürlich abgesehen von den notwendigen Rahmenbedingungen<br />
- vor allem zweierlei: ein engagiertes<br />
Kollegium und eine kompetente Schulleitung. Leider<br />
scheuen viele durchaus geeignete Lehrkräfte die<br />
Bewerbung um eine Funktionsstelle, wie die Mehrfachausschreibungen<br />
im Amtsblatt zeigen. Gründe dafür<br />
gibt es viele: Eine Ursache könnte die Scheu vor einem<br />
12<br />
Sehr geehrte Kollegin,<br />
sehr geehrter Kollege,<br />
Sie beabsichtigen, sich um eine schulische<br />
Funktionsstelle zu bewerben, um<br />
auf diese Weise dauerhaft über die Lehrertätigkeit<br />
hinaus für die schulische<br />
Entwicklung Mitverantwortung zu<br />
übernehmen. Das ist eine Entscheidung,<br />
die sicherlich auf reiflicher Reflexion<br />
beruht und für die unter anderem<br />
auch die Frage bedeutsam ist, auf<br />
welche Verfahren der Auswahl und<br />
Überprüfung man sich damit einlässt.<br />
Bewerberinnen und Bewerber stellen<br />
häufig die folgenden Fragen:<br />
• Welche Aufgaben hat man zu erledigen?<br />
• Welche Erwartungen und Anforderungen<br />
werden an die Übernahme einer<br />
solchen Stelle geknüpft?<br />
• Welche Maßstäbe hat die Behörde?<br />
• Wie läuft das ganze Verfahren eigentlich<br />
ab?<br />
Die Entscheidung für eine Bewerbung<br />
kann leichter fallen, wenn man in dem<br />
einen oder anderen innerschulischen,<br />
pädagogischen und außerschulischen<br />
Bereich Erfahrungen gesammelt hat,<br />
insbesondere auch in der Kooperation<br />
mit Kolleginnen und Kollegen. Beispielhaft<br />
seien hier angeführt: eigene Fortbildung,<br />
Mitwirkung bei der Referendarausbildung,<br />
Fachkonferenzleitung,<br />
Beteiligung an besonderen schulischen<br />
und unterrichtlichen Projekten, Mitwirkung<br />
an einem Schulversuch, der<br />
Lehrplanentwicklung, Mitwirkung bei<br />
Fort- und Weiterbildung u.a. Jede besondere<br />
Funktion im schulischen Bereich<br />
lässt Ihr Engagement über die reine<br />
Lehrertätigkeit hinaus erkennen.<br />
Dazu gehören auch Tätigkeiten als Verbindungslehrer,<br />
Schwerbehindertenver-<br />
undurchschaubaren Bewerbungsverfahren sein. Die<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> veröffentlicht deshalb ein Schreiben des<br />
Leiters der ADD Schulabteilung, Thomas Bartholomé,<br />
das an Interessentinnen und Interessenten um schulische<br />
Funktionsstellen geht und das Verfahren erläutert.<br />
Wir danken für die Abdruckgenehmigung. Weitere<br />
Infomationen werden folgen.<br />
gh<br />
tretung, Gleichstellungsbeauftragte und<br />
Personalvertretung. Auch die Wahrnehmung<br />
gesellschaftlicher Aufgaben im<br />
örtlichen oder überörtlichen Bereich<br />
kann hilfreich sein.<br />
Die Bedeutung solcher Tätigkeiten liegt<br />
nicht in der Quantität, sondern in den<br />
exemplarischen Erfahrungen mit Koordinations-<br />
und Führungsfunktionen.<br />
Besonders hilfreich kann auch die Teilnahme<br />
an Vorbereitungskursen für<br />
Schulleitungsaufgaben sein. Wichtig ist<br />
die Freude an der Gestaltung der Zusammenarbeit<br />
innerhalb des Kollegiums.<br />
Die folgenden Darlegungen sollen Sie<br />
über die wichtigsten Abläufe eines solchen<br />
Auswahlverfahrens informieren.<br />
Diese Informationen wollen Transparenz<br />
schaffen, die Motivation für das<br />
angestrebte Amt erhöhen sowie Orientierung<br />
und Hilfe bieten.<br />
Nach wie vor sind Frauen in Führungsfunktionen<br />
unterrepräsentiert. Wir begrüßen<br />
es, wenn sich insbesondere Frauen<br />
verstärkt um Funktionsstellen bewerben.<br />
Veröffentlichung von<br />
Funktionsstellen<br />
Die schulischen Funktionsstellen werden<br />
im Gemeinsamen Amtsblatt ausgeschrieben.<br />
Diese können auch im Internet<br />
unter der Homepage der ADD<br />
(www.add.rlp.de) oder des MBFJ<br />
(www.mbfj.rlp.de) eingesehen werden.<br />
Im Vorspann werden allgemeine wichtige<br />
Informationen gegeben, z.B. dass<br />
in der Regel eine Funktionsstelle auch<br />
in Teilzeitform angestrebt werden kann.<br />
Es empfiehlt sich, vor Abgabe einer Bewerbung,<br />
ein Gespräch mit der zuständigen<br />
Schulfachreferentin/dem zuständigen<br />
Schulfachreferenten zu führen,<br />
um sich über allgemeine Fragen des<br />
Verfahrens und über die Anforderungen<br />
der angestrebten Stelle zu informieren.<br />
Entscheidend ist das Stellenprofil,<br />
das schriftlich bei der Schule vorliegt,<br />
aber auch bei der Schulaufsicht erhältlich<br />
ist und künftig im Internet abrufbar<br />
sein wird.<br />
Auswahlverfahren<br />
Die Auswahlentscheidung erfolgt unter<br />
Beachtung des Leistungsgrundsatzes.<br />
Gemäß § 10 Landesbeamtengesetz<br />
sind hierbei die Kriterien der Eignung,<br />
Befähigung und fachlichen Leistung zu<br />
Grunde zu legen.<br />
Grundlage für die Auswahlentscheidung<br />
ist zunächst die aktuelle dienstliche<br />
Beurteilung. Nach ständiger<br />
Rechtsprechung kann diese aber zurücktreten,<br />
wenn der zu vergebende<br />
Dienstposten spezielle Eignungsanforderungen<br />
stellt (Stellenanforderungsprofil),<br />
die durch den Inhalt der Beurteilung<br />
nicht umfassend abgedeckt<br />
sind. Dies ist bei Funktionsstellen im<br />
Schulbereich stets der Fall. Deshalb<br />
werden die Bewerberinnen und Bewerber<br />
einer funktionsbezogenen Überprüfung<br />
unterzogen. Diese geht über<br />
den Inhalt der dienstlichen Beurteilung<br />
hinaus und hat zum Ziel, die Eignung<br />
der Bewerberinnen und Bewerber für<br />
das jeweils zu besetzende konkrete Amt<br />
festzustellen. Es handelt sich hierbei<br />
nicht um ein „drittes Staatsexamen“,<br />
bei dem umfängliche Theoriekenntnisse<br />
abgeprüft werden, sondern - praxisbezogen<br />
- um die Feststellung der<br />
Eignung für die angestrebte Stelle.<br />
Die funktionsbezogene Überprüfung<br />
kann sich aus folgenden Bestandteilen<br />
zusammensetzen:<br />
1. Besuch einer von der Bewerberin/<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 / 2005
dem Bewerber zu haltenden Unterrichtsstunde<br />
durch die Schulaufsicht,<br />
2. Beurteilung einer fremden Unterrichtsstunde<br />
durch die Bewerberin/den<br />
Bewerber,<br />
3. Leitung einer Konferenz oder<br />
Dienstbesprechung,<br />
4. Kolloquium.<br />
Zurzeit sind bei der Bewerbung um<br />
eine Schulleiter- und eine Erste Stellvertreterstelle<br />
(Ständiger Vertreter bzw.<br />
Ständige Vertreterin) in der Regel drei<br />
Überprüfungsbestandteile (2. - 4.) vorgesehen.<br />
Bei Bewerbungen um andere Funktionsstellen<br />
(z.B. Studiendirektor/-in)<br />
sind in der Regel ein Kolloquium und<br />
die Leitung einer Konferenz oder<br />
Dienstbesprechung vorgesehen. Letzteres<br />
ist dann der Fall, wenn die Ausübung<br />
der Funktionsstelle wesentlich<br />
auch die Durchführung von derartigen<br />
Besprechungen erfordert (z.B. Mitglied<br />
der Schulleitung, MSS-Leitung<br />
und Pädagogische und Didaktische<br />
Koordinatoren/-innen an einer IGS).<br />
Zu 1.: Besuch einer Unterrichtsstunde<br />
der Bewerberin/des Bewerbers<br />
durch die Schulaufsicht<br />
In der Regel ist ein aktueller Unterrichtsbesuch<br />
nicht erforderlich, insbesondere<br />
dann nicht, wenn aus einer<br />
früheren Funktionsstellenbewerbung<br />
die pädagogisch/unter-richtliche Kompetenz<br />
festgestellt worden ist.<br />
Der Besuch der Unterrichtsstunde gibt<br />
der Schulaufsicht die Möglichkeit, einen<br />
Einblick in die konkrete schülerbezogene<br />
pädagogische Arbeit der Bewerberin/des<br />
Bewerbers zu gewinnen.<br />
Die Unterrichtstunde kann Basis für<br />
die gemeinsame Reflexion über diesen<br />
Unterricht, ggf. auch im Hinblick auf<br />
alternative didaktische und methodische<br />
Überlegungen sein. Damit können<br />
im besonderen Maße Aspekte der Unterrichtsentwicklung<br />
ins Blickfeld gerückt<br />
werden.<br />
Zu 2. Beurteilung einer fremden<br />
Unterrichtsstunde durch<br />
die Bewerberin / den Bewerber<br />
Bei der Beurteilung einer Unterrichtsstunde<br />
ist von Bedeutung, inwieweit<br />
die Bewerberin/der Bewerber eine<br />
Stunde angemessen beurteilen und -<br />
wichtiger noch - ein konstruktives Be-<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 /2005<br />
ratungsgespräch führen kann.<br />
Zu 3.: Leitung einer Konferenz<br />
oder Dienstbesprechung<br />
Bei der Dienstbesprechung oder Konferenz<br />
von etwa einstündiger Dauer soll<br />
die Bewerberin/der Bewerber eine Tagesordnung<br />
mit einem pädagogischen<br />
Schwerpunkt vorbereiten und die Leitung<br />
übernehmen. Eine angemessene<br />
Beteiligung der Teilnehmerinnen und<br />
Teilnehmer, die Moderation, die Strukturierung<br />
und die Ergebnissicherung<br />
stehen im Vordergrund.<br />
Zu 4.: Kolloquium<br />
Das Kolloquium orientiert sich vor allem<br />
am Stellenprofil. In der Regel werden<br />
auch aktuelle pädagogische und<br />
schulpolitische Entwicklungen der betroffenen<br />
Schulart angesprochen. Außerdem<br />
betrifft es - und das ist Bestandteil<br />
nahezu aller Funktionsstellen - Fragen<br />
der Unterrichts-, Personal- und Organisationsentwicklung,<br />
außerdem<br />
Vorstellungen der Bewerberin/des Bewerbers<br />
über Möglichkeiten der Qualitätssicherung<br />
und -entwicklung.<br />
Es können auch Fragestellungen aus<br />
dem Unterrichtsbesuch, der Fremdbeurteilung<br />
und der Leitung einer Dienstbesprechung/Konferenz<br />
aufgegriffen<br />
und im Gespräch vertieft werden.<br />
Einbeziehung von Ergebnissen<br />
aus früheren Bewerbungsverfahren<br />
in das Auswahlverfahren<br />
Sofern sich eine Lehrkraft um mehrere<br />
Stellen bewirbt, sei es in zeitlicher Parallelität<br />
oder nacheinander, gilt die<br />
Regel, dass für eine Dauer von bis zu<br />
zwei Jahren auf die letzte dienstliche<br />
Beurteilung und bestimmte Elemente<br />
des Überprüfungsverfahrens zurückgegriffen<br />
werden kann. Es ist der Bewerberin/dem<br />
Bewerber allerdings freigestellt,<br />
einzelne Teile oder das ganze<br />
Überprüfungsverfahren zu wiederholen.<br />
Ein erneutes oder ergänzendes Kolloquium<br />
ist im Hinblick auf das konkrete<br />
Stellenprofil immer erforderlich.<br />
Unter Beachtung der unterschiedlichen<br />
Stellenprofile kann es durchaus auch zu<br />
unterschiedlichen Eignungsfeststellungen<br />
kommen.<br />
Beteiligte Gremien am<br />
Bewerbungsverfahren<br />
Mit allen Besetzungsverfahren für<br />
Funktionsstellen sind Beteiligungs-,<br />
Benehmensherstellungs- oder Mitbestimmungsrechte<br />
verbunden und zwar<br />
für<br />
• Personalräte,<br />
• Gleichstellungsbeauftragte,<br />
• Schwerbehindertenvertretung,<br />
• Schulträger und Schulausschuss und<br />
• Schulleiter/-in.<br />
Von der Personalratsbeteiligung ausgenommen<br />
sind die Schulleiter/-innenstellen<br />
und die der Ständigen Vertreter/-innen<br />
(Erste Konrektorinnen / Erste<br />
Konrektoren).<br />
Die Gleichstellungsbeauftragte ist zu<br />
beteiligen, wenn sich für eine Stelle sowohl<br />
Frauen als auch Männer bewerben.<br />
Ist eine schwerbehinderter Lehrkraft im<br />
Verfahren beteiligt, ist die Schwerbehindertenvertretung<br />
zu den Beurteilungsverfahren<br />
aller Mitbewerberinnen<br />
und Mitbewerber einzuladen.<br />
Für Schulleiterstellen ist außerdem eine<br />
Schulen<br />
Soll ich mir das antun, mich auf eine Funktionsstelle zu bewerben? Foto: Thurm<br />
13
Schulen<br />
14<br />
„qualifizierte Benehmensherstellung“<br />
mit dem Schulausschuss und dem<br />
Schulträger vorzunehmen; diese Gremien<br />
laden in der Regel die Bewerberinnen<br />
und Bewerber zu einem Gespräch<br />
ein. Einzelheiten über die Benehmensherstellung<br />
sind im Gemeinsamen<br />
Amtsblatt Nr. 15/1992 veröffentlicht.<br />
Dort finden sich auch Aussagen<br />
zu den Bedingungen, unter denen<br />
sogenannte Hausbewerbungen möglich<br />
sind und befürwortet werden können.<br />
Die Schulleiterin/der Schulleiter der<br />
Schule, an welcher die Stelle zu beset-<br />
Sehr geehrte Kollegin,<br />
sehr geehrter Kollege,<br />
wir hoffen mit diesen Informationen<br />
Transparenz über das Verfahren<br />
- und dessen Notwendigkeit -<br />
herzustellen. Wenn sich einzelnen<br />
Rahmenbedingungen für die Funktionsstellenverfahren<br />
ändern, wird<br />
auch diese Information jeweils entsprechend<br />
aktualisiert.<br />
Wir würden es begrüßen, wenn Sie<br />
durch diese Informationen in Ihrer<br />
Motivation gestärkt werden und<br />
möchten Sie ausdrücklich zu einer<br />
Bewerbung ermuntern.<br />
zen ist, kann an allen Überprüfungselementen<br />
teilnehmen, soweit organisatorische<br />
Gründe nicht entgegenstehen<br />
und es sich nicht um die eigene Nachfolge<br />
handelt. Das Ergebnis der funktionsbezogenen<br />
Überprüfung und die<br />
vorgesehene Personalentscheidung wird<br />
mit ihr/ihm erörtert; das Ergebnis wird<br />
protokolliert.<br />
Auswahlentscheidung<br />
und Beförderung<br />
Im Anschluss an das Überprüfungsverfahren<br />
erstellt das federführende Referat<br />
für jede Bewerberin/jeden Bewerber<br />
ein schulfachliches Gutachten, das<br />
eine Gesamteignung für die zu besetzende<br />
Stelle feststellt und nach einer<br />
vergleichenden Bewertung in einen<br />
Besetzungsvorschlag mündet. Nachdem<br />
Referatsleitung, der Koordinierende<br />
Referent (in Neustadt und Koblenz)<br />
und der Abteilungsleiter zugestimmt<br />
haben, trifft der Präsident bei eigener<br />
Zuständigkeit (Grundschulrektor/-in<br />
und Konrektoren/-innen bis A14) die<br />
abschließende Entscheidung bzw. unterbreitet<br />
in den übrigen Fällen dem<br />
Ministerium für Bildung, Frauen und<br />
Jugend seinen Personalvorschlag, über<br />
Schulleitung - ist das was für mich?<br />
Auf der Ebernburg veranstaltete der<br />
<strong>GEW</strong>-Landesverband Rheinland-<br />
Pfalz vom 03.-05.12.04 für angehende<br />
SchulleiterInnen ein Orientierungs-<br />
und Vorbereitungsseminar.<br />
Der Bericht eines Referenten<br />
basiert auf den Rückmeldungen der<br />
TeilnehmerInnen.<br />
Zu den Fragen „ob ich den Anforderungen,<br />
die an die Schulleitung<br />
gestellt werden, überhaupt gerecht<br />
werden kann?“, „wie ich mich bewerben<br />
kann und wie das Überprüfungsverfahren<br />
aussieht?“, „wie kann<br />
ich mich vorbereiten?“, „ob ich auf<br />
dem richtigen Weg bin?“ erwarteten<br />
13 KollegInnen auf der Ebernburg<br />
an einem Adventswochenende Antworten.<br />
Um es vorweg zu nehmen:<br />
Diese Fragen bekamen im Seminar<br />
allmählich einen anderen Stellenwert,<br />
sie rückten im Interesse nach<br />
hinten. Denn den TeilnehmerInnen<br />
wurde im Laufe des Prozesses bewusst,<br />
dass vor der Bewältigung ei-<br />
ner Aufgabe eine klare Zielvorstellung,<br />
eine Vision stehen muss, dann<br />
ergeben sich die „Wege beim Gehen“.<br />
Und sie erfuhren und erlebten,<br />
dass das, was man als Kompetenzen,<br />
als Fähigkeiten braucht, sich<br />
alles lernen lässt. Doch dieses Lernen<br />
bedarf der Planung, der Struktur,<br />
der Orientierung.<br />
So begann das Seminar unter der<br />
Leitung erfahrener SchulleiterInnen<br />
mit einer Standortbestimmung, mit<br />
der Entwicklung der Traumschule,<br />
ehe Themen wie Innovation und<br />
Rolle der SchulleiterIn näher betrachtet<br />
werden konnten. Fachvorträge<br />
und eigenes Erleben in Rollenspielen<br />
wechselten sich ab, in den<br />
Gruppen wurde viel gearbeitet, aber<br />
es wurde weder als ermüdend noch<br />
als anstrengend empfunden. Die<br />
TeilnehmerInnen ließen sich sehr<br />
bereitwillig auf die einzelnen Bausteine<br />
des Seminars ein, was sicher<br />
die Effektivität erhöhte.<br />
Breiten Raum nahm das Bewer-<br />
den dann die Ministerin bzw. der Ministerpräsident<br />
entscheidet.<br />
Alle Bewerberinnen und Bewerber werden<br />
über das Ergebnis des Auswahlverfahrens<br />
informiert. Nach einer dreiwöchigen<br />
Frist wird die vorgesehene Bewerberin/der<br />
vorgesehene Bewerber<br />
kommissarisch ernannt. Eine Beförderung,<br />
sofern diese mit der neuen Stelle<br />
verbunden ist, erfolgt frühestens nach<br />
einer erfolgreichen Erprobungszeit. Voraussetzung<br />
für die Beförderung ist die<br />
Feststellung der Schulbehörde, dass sich<br />
die Bewerberin/der Bewerber in der<br />
neuen Funktion bewährt hat.<br />
Personalentwicklungsgespräch<br />
Nach Abschluss des Verfahrens haben<br />
alle Bewerberinnen und Bewerber die<br />
Möglichkeit, sowohl die auf die eigene<br />
Person bezogenen Beurteilungsberichte<br />
einzusehen als auch ein Beratungsgespräch<br />
mit der federführenden Referentin<br />
/ dem federführenden Referenten zu<br />
führen. Ziele des Gespräches sind die<br />
Herstellung von Transparenz sowie die<br />
Beratung im Hinblick auf weitere berufliche<br />
Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten.<br />
bungsverfahren selbst ein, dessen Teile<br />
nicht als allgemein bekannt vorausgesetzt<br />
werden können und wo es<br />
viele Hinweise und Tipps gab, die<br />
den TeilnehmerInnen nun eine zielgerichtete<br />
Vorbereitung ermöglichen.<br />
Fragen wie nach dem Stellenwert von<br />
Rechtskenntnissen, der Beratung einer<br />
KollegIn nach einem Unterrichtsbesuch,<br />
dem „richtigen“ Verhalten<br />
in der Überprüfung und vieles<br />
mehr wurde von den ReferentInnen<br />
beantwortet, gaben teilweise aber<br />
auch zu heftigen Diskussionen Anlass.<br />
Immer deutlicher wurde dabei<br />
den TeilnehmerInnen, dass aus der<br />
Sicht der Schulleitung das System<br />
Schule anders aussieht, anders aussehen<br />
muss, und manche äußerte -<br />
selbst überrascht- mehr Verständnis<br />
für das Handeln der eigenen Schulleitung.<br />
Der berufliche Hintergrund der TeilnehmerInnen<br />
war sehr unterschiedlich,<br />
es waren alle Schulformen und<br />
extrem verschiedene Systemgrößen<br />
vertreten. Entsprechend unterschiedlich<br />
waren auch die Bilder, die jede<br />
Fortsetzung nach dem Einhefter (S. 15)<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 / 2005
Was tun?<br />
Denise - *Name und Bild<br />
sind anonymisiert.<br />
TeilnehmerIn von einer Konferenz<br />
mitbrachte. Die ReferentInnen sorgten<br />
mit einem Rollenspiel zunächst<br />
für ein gemeinsames Erlebnis. Da<br />
wurde es schon hitzig, durfte sich<br />
doch jede eine Rolle aussuchen, die<br />
im schulischen Alltag manchmal<br />
auch eher als störend empfunden<br />
wird. Da der gespielte Schulleiter an<br />
dem behandelten Thema so gar kein<br />
Interesse zeigte, bot sich den überzeugend<br />
spielenden LehrerInnen eine<br />
gute Reibungsfläche. In der Auswertung<br />
wurde auch hier der Rollenwechsel<br />
deutlich herausgearbeitet,<br />
der immer dann eintritt, wenn eine<br />
Kollegin in die Schulleitung wechselt.<br />
Die TeilnehmerInnen profitierten<br />
davon, dass sie<br />
• erfuhren, womit sie bei einer Bewerbung<br />
(Ansprechpartner, Vorinformation<br />
etc.) beginnen,<br />
• Klarheit bekamen über mögliche<br />
Hindernisse, Schwierigkeiten,<br />
• konkret am Thema arbeiteten und<br />
Beispiele aus der Praxis vieles verdeutlichten,<br />
• viele Informationen über das Verfahren<br />
bekamen,<br />
• sich gedanklich mit den Einzelhei-<br />
Die Sache ist doch eigentlich klar - Judenwitze<br />
und Rassismus haben an der<br />
Schule nichts zu suchen. Doch wie soll<br />
sich ein verantwortungsbewusster Lehrer<br />
verhalten, der mit einer Rechtsradikalen<br />
zu tun hat? Soll er sie aus der<br />
Schule entfernen (sofern laut Schulgesetz<br />
möglich) oder soll er versuchen, seinem<br />
Auftrag zur Erziehung der Jugend<br />
nachzukommen. Soll er versuchen zu<br />
integrieren, zu erziehen, aufzuklären -<br />
oder soll er ausgrenzen, um andere vor<br />
Rassismus zu schützen? Ich möchte diese<br />
Frage anhand eines aktuellen Beispiels<br />
an die Leserschaft weitergeben.<br />
Der Fall: Denise * hat an meiner Schule<br />
das Berufsvorbereitungsjahr 2 (BVJ2)<br />
besucht, eine inzwischen zum Glück<br />
abgeschaffte Schulform, in der Schüler<br />
ohne Aussicht auf einen Schulabschluss<br />
ihr letztes Jahr der Schulpflicht absitzen<br />
mussten. Als ich die Klasse übernahm,<br />
war die Klasse geradezu ver-<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 /2005<br />
ten der Prüfung auseinandersetzten,<br />
* die persönlichen Erfahrungen der<br />
ReferentInnen des Seminars nutzten,<br />
* regen Gedankenaustausch untereinander<br />
auch in den Seminarpausen<br />
und am Abend pflegten,<br />
* inhaltliche Informationen und<br />
Tipps bekamen.<br />
Die wenigen kritischen Anmerkungen<br />
werden von uns genutzt, um in<br />
zukünftigen Seminaren im Detail<br />
anders vorzugehen. Die schon mehrfach<br />
praktizierte Struktur des Seminars<br />
hat sich aber wieder bewährt.<br />
Am ersten Wochenende im Dezember<br />
2005 ist eine Wiederholung geplant;<br />
Näheres ist bei der <strong>GEW</strong>-Geschäftsstelle<br />
zu erfahren.<br />
Nach unserem Eindruck verließen<br />
die TeilnehmerInnen das Seminar<br />
zufrieden, was sich aus den Schlussanmerkungen<br />
ablesen lässt:<br />
• durch das Seminar hat sich der<br />
„Traum Schulleitung“ konkretisiert,<br />
da ich mein Ziel und den Weg dorthin<br />
jetzt konkreter strukturieren<br />
kann,<br />
• die informellen Gespräche in den<br />
Pausen und abends waren sehr interessant<br />
und lehrreich,<br />
• fühlte mich sehr wohl,<br />
wahrlost, Lehrkräfte weigerten sich,<br />
dort zu unterrichten, und von 16 Schülern<br />
waren in der Regel allenfalls fünf<br />
anwesend. Eine von diesen halbwegs<br />
disziplinierten war Denise, 16 Jahre<br />
alt, die die Hauptschule nach der 8.<br />
Klasse hatte verlassen müssen. Mit dem<br />
Willen, den Aufstieg in das BVJ1 zu<br />
schaffen und zu einem Schulabschluss<br />
zu gelangen, kam sie nahezu täglich in<br />
die Schule. Und sie schaffte es, wurde<br />
in das BVJ1 übernommen. In dieser<br />
Zeit fing sie an, sich verstärkt mit Jugendlichen<br />
aus der rechtsradikalen Szene<br />
zu treffen, ihr erster Freund war ein<br />
Skinhead in voller Kampfmontur, sie<br />
äußerte sich zunehmend ausländerfeindlich<br />
und versuchte auch, andere für<br />
die Sache zu werben. Die Mutter einer<br />
mit Denise befreundeten Klassenkameradin<br />
beschwerte sich zudem über die<br />
starke negative Veränderung der Tochter<br />
durch einen - der Familie gänzlich<br />
fremden - Ausländerhass.<br />
Zurück zu Denise: Trotz dieser Freizeitgestaltung<br />
kam sie weiterhin täglich in<br />
die Schule und erhielt ein Abschluss-<br />
Schulen<br />
• eine freundliche Atmosphäre durch<br />
die Leute und die Wahl der Tagungsstätte,<br />
• auf jede Frage wurde eingegangen,<br />
• es war richtig hierher zu kommen<br />
und der weitere „Weg entsteht beim<br />
Gehen“,<br />
• es war schön! Vielen Dank!,<br />
• Danke _,<br />
• Danke für die angenehme, freundschaftliche<br />
Atmosphäre.<br />
Diese abschließenden Anmerkungen<br />
der TeilnehmerInnen vermitteln vielleicht<br />
ein bisschen Seminaratmosphäre,<br />
obwohl man diese bei Interesse<br />
am Thema besser selbst erleben<br />
sollte, wenn man sich auf den Weg<br />
machen will. Viele SchulleiterInnen<br />
werden in den nächsten Jahren in<br />
Pension gehen, die deutsche Schule<br />
muss und wird sich nach PISA verändern,<br />
und dazu werden besonders<br />
hohe Ansprüche an die SchulleiterInnen<br />
gestellt. Es ist eine lohnende,<br />
eine anregende und sehr befriedigende<br />
Arbeit, die durch zielgerichtete<br />
Vorbereitung, wie in diesem Seminar<br />
praktiziert, wesentlich erleichtert<br />
wird.<br />
Text: Hans-Peter Kirsten-Schmidt<br />
zeugnis mit dem Notendurchschnitt<br />
von 3,0. Nun bewarb sie sich um die<br />
Aufnahme in die Berufsfachschule 1<br />
(BF1) mit dem Ziel, auch die BF2 und<br />
somit den mittleren Bildungsabschluss<br />
zu erlangen. Die Plätze für diese Schulform<br />
waren ziemlich knapp, auf 180<br />
Schulplätze kamen ca. 300 Bewerbungen.<br />
Die Meinungen darüber, ob Denise<br />
in die BF1 übernommen werden<br />
sollte, war im Kollegium geteilt. Die<br />
einen meinten, eine Rechtsradikale sei<br />
eine zu große Belastung für eine Klasse<br />
und für die Lehrer und somit besser<br />
abzulehnen, andere vertraten die Ansicht,<br />
dass die Schule eine Erziehungsauftrag<br />
habe und sich gerade um solche<br />
Schüler kümmern müsse, da es ansonsten<br />
keiner täte. Die für mich wichtige<br />
Frage lautet nun: Wie würden Sie<br />
entscheiden? mge<br />
Bitte mailen Sie mir Ihre Antwort:marc-guido.ebert@gewrlp.de.<br />
In der nächsten Ausgabe werden<br />
die Antworten veröffentlicht.<br />
15
Schulen<br />
Gender macht Schule<br />
Zwischenbilanz zum Gender Mainstreaming in der <strong>GEW</strong><br />
Für den Anfang Dezember vergangenen Jahres hatte der Vorstandsbereich<br />
Frauenpolitik der Bundes-<strong>GEW</strong> zur Gender-Konferenz nach Fulda geladen.<br />
Ca. 60 Frauen und Männer waren der Einladung gefolgt und erlebten eine<br />
sehr abwechslungsreiche Tagung. Zweck der Veranstaltung war es, eine Zwischenbilanz<br />
zu ziehen, inwieweit der Beschluss des Gewerkschaftstages von<br />
2001 zum „doing gender“ bereits umgesetzt ist. Die Tagung beleuchtete neben<br />
der Praxis auch den Aspekt der Bildungspolitik und der <strong>GEW</strong>-internen<br />
Umsetzung.<br />
16<br />
Laut der Referentin Prof. Dr. Rabe-<br />
Kleberg hat das schlechte Abschneiden<br />
der Jungen bei Pisa einiges mit<br />
der wenig gefestigten Geschlechtsidentität<br />
in der frühen Kindheit zu<br />
tun. In Kindergärten und Grundschulen,<br />
in denen quasi das gesamte<br />
Bildungspersonal weiblich sei, fänden<br />
Jungen keine Geschlechtervorbilder.<br />
Rabe-Kleberg folgerte daraus,<br />
dass Gender in Kindergärten thematisiert<br />
werden müsse. In der anschließenden<br />
Diskussion wurde herausgestellt,<br />
dass gerade die ErzieherInnen<br />
in den Kindergärten grundlegendes<br />
Genderwissen nicht besitzen und<br />
dass hier starker Handlungs-/Bildungsbedarf<br />
bestünde. Tilman Boehlkau<br />
formulierte im Anschluss den<br />
Wunsch, dass mehr Männer in den<br />
„Grundschule: Reine Frauenveranstaltung“<br />
Tilman Boehlkau: „Wo kommt gender<br />
mainstreaming in der Erzieherinnenausbildung<br />
vor? Wo kommt gender<br />
Erzieherberuf und in die Grundschulen<br />
gingen. Zu einer Entdramatisierung<br />
im Geschlechterumgang in<br />
Schulen rief Frau Prof. Dr. Hannelore<br />
Faulstich auf. Weder der Protektionismus<br />
für Mädchen noch der<br />
pauschale Generalverdacht, alle Jungen<br />
seien dominant, helfe beim gender<br />
doing. Zur Erweiterung der<br />
Handlungskompetenz empfahl Uli<br />
Boldt die Einführung von Jungenkonferenzen<br />
in Schulen. Jungen sollen<br />
hier lernen, Verhaltensmuster zu<br />
übernehmen, die sonst wie selbstverständlich<br />
von Mädchen übernommen<br />
werden (z.B. Trost zusprechen,<br />
Empathie).<br />
Doch gender mainstreaming stellt<br />
nicht nur PädagogInnen, sondern<br />
auch die Schulverwaltung vor große<br />
mainstreaming in der Lehrerinnenausbildung<br />
vor? Jetzt werden die Erzieherinnen-<br />
und Lehrerinnenausbildung<br />
in Rheinland-Pfalz reformiert,<br />
aber wo ist der Aspekt gender? Wie<br />
kann ich Jungen dafür gewinnen, in<br />
den Erzieherberuf zu gehen? Wie<br />
kann ich junge Männer dazu bewegen,<br />
in die Grundschulen zu gehen?<br />
Wenn wir uns die Grundschule ansehen,<br />
stellen wir fest, dass es eine reine<br />
Frauenveranstaltung ist, bis auf<br />
die Leitung, die ist männlich. Daran<br />
muss gearbeitet werden. Deswegen<br />
müssen wir immer darauf hinweisen,<br />
dass sich auch die Berufsberatung<br />
und die Studienberatung verändern<br />
müssen.“<br />
Foto: Marc-Guido Ebert<br />
Aufgaben. Besonders deutlich wurde<br />
dies bei der Vorstellung des neuen<br />
Genderreports durch Dr. Anke<br />
Burkhardt vom Hochschulforschungsinstitut<br />
Wittenberg. Der Bericht<br />
wurde im Auftrag des <strong>GEW</strong>-<br />
Hauptvorstandes erstellt und stellt<br />
anhand statistischer Erhebungen<br />
sehr anschaulich dar, wie es um die<br />
Geschlechtergleichheit im deutschen<br />
Bildungswesen bestellt ist. Der Genderreport<br />
ist über www.gew.de als<br />
pdf-Datei abrufbar.<br />
Laut Bericht sind Mädchen schneller<br />
und erfolgreicher in ihrer Schulkarriere,<br />
Frauen studieren ebenso<br />
häufig wie Männer, doch spätestens<br />
bei der Promotion kehren sich die<br />
Verhältnisse um, nun sind Männer<br />
eindeutig stärker vertreten. Bei Habilitationen<br />
ist das Verhältnis letztendlich<br />
bei 20:80, so der Report.<br />
Den Veranstaltern ist es mit dieser<br />
Tagung gelungen, die gesamte Bandbreite<br />
des gender mainstream aufzuzeigen.<br />
Die Aufgabe, die sich die<br />
<strong>GEW</strong> mit ihrem Genderbeschluss<br />
von 2001 gesetzt hat, scheint gewaltig.<br />
Dr. Larissa Klinzing zitiert denn<br />
auch Aristoteles: „Der Anfang ist die<br />
Hälfte des Ganzen“. Und der Anfang<br />
ist gemacht.<br />
Weitere Informationen zum Thema<br />
Gender Mainstream können ab<br />
März unter www.gew.de/gender_<br />
mainstream.html abgerufen werden.<br />
Es lohnt sich!<br />
Marc-Guido Ebert<br />
Klassenfahrten nach Berlin<br />
(incl. Transfer, Unterkunft,<br />
Programmgestaltung nach Absprache).<br />
Broschüre anfordern bei:<br />
Biss, Freiligrathstr. 3, 10967 Berlin,<br />
Tel. (030) 6 93 65 30<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 / 2005
Haupt- und Regionalschultag 2005 der <strong>GEW</strong><br />
Am Donnerstag, den 14. April 2005,<br />
veranstaltet die Landesfachgruppe<br />
Haupt- und Regionalschulen erneut<br />
einen Haupt- und Regionalschultag.<br />
Die Tagung ist als IFB-Fortbildung<br />
unter AZ.: 52 115 anerkannt.<br />
„Man sollte lieber fischen, segeln<br />
oder tanzen gehen, als dass man Dinge<br />
lernt, die keinerlei direkte Auswirkungen<br />
auf das eigene Leben ha-<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 /2005<br />
ben“ (Erich Fromm). Unter diesem<br />
Motto wird Otto Herz am Vormittag<br />
das Hauptreferat halten. Im Anschluss<br />
beginnen die Fachforen, die<br />
nach dem Mittagessen fortgesetzt<br />
werden:<br />
1. „Bildungsstandards Deutsch/Praxishilfen“<br />
(Marianne Steigner),<br />
2. „Hilfen für die Umsetzung der<br />
Bildungsstandards im Mathematik-<br />
Die <strong>GEW</strong> nimmt Haupt- und Regionalschulen sowie Gymnasien unter die Lupe.<br />
Karikatur: J. Mayr<br />
Tag der Bildung - Gymnasialtag der <strong>GEW</strong><br />
Am Montag, 11.04.05, veranstaltet die<br />
Landesfachgruppe Gymnasien erneut<br />
einen Gymnasialtag der <strong>GEW</strong>. Die Tagung<br />
ist als IFB-Fortbildung anerkannt.<br />
Vormittags eröffnet Otto Herz unseren<br />
Tag der Bildung mit einem Vortrag<br />
„Zwischen Tradition und Innovation:<br />
Aufbruch zu einer neuen Lernkultur“.<br />
Im Anschluss beginnen die Arbeitsgemeinschaften,<br />
die nach dem Mittagessen<br />
fortgesetzt werden. Hier eine Auswahl<br />
der geplanten AG-Themen:<br />
1. Vertiefung des Eingangsreferats mit<br />
Otto Herz<br />
2. Teamentwicklung in heterogenen<br />
Gruppen<br />
3. Jungenpädagogik<br />
4. Ganztagsschule und Gymnasium<br />
5. Entwicklungsrichtungen des Gymnasiums<br />
in den Bundesländern (Schulzeitverkürzung,<br />
zentrale Prüfungselemente,<br />
Bildungsstandards)<br />
6. Darstellendes Spiel als neues Unterrichtsfach<br />
7. Aktuelle Rechtsfragen der Personalratsarbeit<br />
8. Umgang mit Schulstress<br />
Die Veranstaltung schließt mit einem<br />
Informationsaustausch.<br />
Schulen<br />
unterricht der Hauptschule“ (Christel<br />
Schienagel-Delb),<br />
3. „Konfrontative Pädagogik“ (Markus<br />
Brand),<br />
4. „Jungenpädagogik (Klaus-Peter<br />
Hammer),<br />
5. „Ganztagsschulen“ (Guido Seelmann-Eggebert),<br />
6. „Berufsorientierung“ (Hubert<br />
Zöller).<br />
Die Veranstaltung schließt mit einem<br />
Stehcafé und dem dabei möglichen<br />
Informationsaustausch mit <strong>GEW</strong>-<br />
ExpertInnen / <strong>GEW</strong>-StufenvertreterInnen<br />
aus HPR und BPR. Zum<br />
Abschluss der Mittagspause, als<br />
Nachtisch sozusagen, haben die Veranstalter<br />
einen ganz besonderen kulturellen<br />
Leckerbissen gewinnen können:<br />
SchülerInnen der Regionalen<br />
Schule Kaisersesch werden Auszüge<br />
aus dem Musical Diabolo darbieten.<br />
Ort: Tagungszentrum Erbacher Hof,<br />
Mainz<br />
Zeit: Donnerstag, 14. April 2005,<br />
9.30 - 16.30 Uhr, bzw. offenes Ende<br />
mit Stehcafé<br />
Die Tagungsunterlagen werden spätestens<br />
Ende Februar an den Schulen<br />
sein bzw. können zu diesem Zeitpunkt<br />
bei der <strong>GEW</strong>-Geschäftsstelle<br />
in Mainz angefordert werden. Anmeldungen<br />
sind bis 16. März 2005<br />
bei der <strong>GEW</strong>-Geschäftsstelle möglich.<br />
pbg<br />
Ort: Tagungszentrum Erbacher Hof,<br />
Mainz<br />
Zeit: Montag, den 11. April 2005,<br />
9.30 - 16.30 Uhr<br />
Die Tagungsunterlagen werden Ende<br />
Februar an den Schulen sein bzw.<br />
können zu diesem Zeitpunkt bei der<br />
<strong>GEW</strong>-Geschäftsstelle in Mainz angefordert<br />
werden. Die Anmeldung ist bis<br />
11. März 2005 bei der <strong>GEW</strong>-Geschäftsstelle<br />
möglich.<br />
sh<br />
17
Betriebsratsfortbildung<br />
Tarifrecht nur eingeschränkt anwendbar<br />
<strong>GEW</strong>-Fortbildung für Betriebsräte sozialpädagogischer Einrichtungen<br />
Im Dezember haben 25 Betriebsräte sozialpädagogischer und sozialtherapeutischer<br />
Einrichtungen an einer Fortbildung der <strong>GEW</strong> in Vallendar teilgenommen.<br />
Für die Arbeitnehmervertreter, die analog der Personalräte für die<br />
Beschäftigten im Öffentlichen Dienst die Interessen der Kolleginnen und<br />
Kollegen gegenüber ihren jeweiligen privaten Arbeitgebern, z.B. einer regionalen<br />
Lebenshilfe e.V., wahrnehmen, ging es um zahlreiche interessante Themen.<br />
18<br />
Behandelt wurde z.B. die Frage: Wie<br />
können Betriebsräte reagieren, wenn<br />
ihre Arbeitgeber aus dem Bundesangestelltentarifvertrag<br />
(BAT) „aussteigen“?<br />
Ein brisantes Thema, denn<br />
entgegen bisher üblicher Praxis - der<br />
Tarifvertrag, der für die Angestellten<br />
im Öffentlichen Dienst gilt, wurde<br />
per Einzelvertrag vereinbart - kommt<br />
es nach Angaben der Betriebsräte<br />
immer häufiger vor, dass in den Arbeitsverträgen<br />
neu eingestellter Arbeitnehmer<br />
Arbeitsbedingungen<br />
deutlich unterhalb von BAT-Niveau<br />
vereinbart werden.<br />
Im Mittelpunkt der zweitägigen Veranstaltung<br />
standen deshalb die §§ 77<br />
und 87 des Betriebsverfassungsgesetzes<br />
(BetrVG), wonach Betriebsräte<br />
erzwingbare Mitbestimmungsrechte<br />
haben, wenn betriebsbezogene<br />
Lohn- und Gehaltsgrundsätze eingeführt<br />
werden. Die Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmer waren sich einig, zukünftig<br />
solche Lohn- und Gehaltsgrundsätze<br />
verhandeln zu wollen,<br />
Betriebsräte diskutieren (Foto: Marc Hannappel)<br />
um Arbeitsbedingungen für neu eingestellte<br />
ArbeitnehmerInnen abzusichern.<br />
Die Mitbestimmungsmöglichkeit<br />
bezieht sich aber lediglich auf<br />
Lohn- und Gehaltsgrundsätze. So<br />
können Betriebsräte beispielsweise<br />
mitbestimmen, welche Lohn- und<br />
Gehaltsgruppen entstehen sollen, in<br />
welche dieser Gruppen eine Einstufung<br />
erfolgen und wann bzw. unter<br />
welchen Voraussetzungen ein Gruppenaufstieg<br />
erfolgen soll.<br />
Keine Mitbestimmung sieht das Gesetz<br />
vor, wenn der konkrete Betrag,<br />
der einer Gruppe zugeordnet wird,<br />
festgelegt wird. Diese Regelung unterliegt<br />
einem so genannten Tarifvorbehalt,<br />
wonach sie von Arbeitgebern<br />
und Gewerkschaften durch Tarifvertrag<br />
getroffen wird. Fehlt jedoch eine<br />
tarifliche Vereinbarung, wie es in den<br />
meisten privaten sozialpädagogischen<br />
und sozialtherapeutischen Einrichtungen<br />
der Fall ist, dann bleibt<br />
die Lohnhöhe im Entscheidungsbereich<br />
des Arbeitgebers, und dieser<br />
trifft mit seinen<br />
ArbeitnehmerInneneinzelvertraglicheVereinbarungen.<br />
Damit sind die<br />
Möglichkeiten<br />
von Betriebsräten,<br />
Lohn- und<br />
Gehaltsfragen<br />
über die §§ 77<br />
und 87 des BetrVG<br />
kollektiv<br />
zu regeln, stark<br />
eingeschränkt.<br />
Probleme entstehen<br />
auch bezogen<br />
auf LohnundGehaltszu-<br />
wächse, wie sie beispielsweise von<br />
den Tarifpartnern im Öffentlichen<br />
Dienst in regelmäßigen Abständen<br />
vereinbart werden. Haben die ArbeitnehmerInnen<br />
privater Träger bisher<br />
durch einzelvertraglichen Bezug auf<br />
den BAT Anspruch auf entsprechende<br />
Zuwächse, so ist dieser Bereich für<br />
ArbeitnehmerInnen, deren Vergütung<br />
nach betrieblichen Lohn- und<br />
Gehaltsgrundsätzen vorgenommen<br />
wird, nicht geregelt. Der Betriebsrat<br />
kann zwar Verhandlungen über<br />
Lohn- und Gehaltsgruppenzuwächse<br />
verlangen, er bleibt aber dem Arbeitgeber<br />
gegenüber Bittsteller. Im<br />
Gegensatz zu den Gewerkschaften<br />
darf er zur Durchsetzung seiner Forderungen<br />
die ArbeitnehmerInnen<br />
seines Betriebes nicht zu einem Streik<br />
aufrufen, Erfolge hängen somit ausschließlich<br />
von freiwilligen Zusagen<br />
des Arbeitgebers ab.<br />
Wirksame kollektivrechtliche Regelungen<br />
zur Lohn- und Gehaltshöhe<br />
führen nur über einen Tarifvertrag,<br />
der auch als Haustarifvertrag mit einzelnen<br />
Arbeitgebern geschlossen werden<br />
kann. Dazu müssen sich die Beschäftigten<br />
bei privaten Arbeitgebern<br />
solidarisieren und den Arbeitgeber<br />
gemeinsam mit ihrer Gewerkschaft<br />
für Verhandlungen über einen Tarifvertrag<br />
gewinnen oder ihn zu solchen<br />
zwingen. Insofern haben gewerkschaftlich<br />
organisierte Betriebsräte<br />
eine doppelte Aufgabe. Erstens versuchen<br />
sie über die Möglichkeiten,<br />
die das BetrVG bietet, Arbeitsbedingungen<br />
kollektivrechtlich zu gestalten.<br />
Zweitens arbeiten sie daran, die<br />
gewerkschaftliche Basis im Betrieb zu<br />
verbessern, um mittel- und langfristig<br />
Vorraussetzungen für den Einstieg<br />
in Tarifverhandlungen zu schaffen.<br />
Bernd Huster<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 / 2005
Falschinformation durch den Philologenverband<br />
Mit Schreiben vom 24.03.2004 versandte<br />
der Philologenverband<br />
Rheinland-Pfalz ein Rundschreiben<br />
an alle KollegInnen, die in einem<br />
Angestelltenverhältnis mit Option<br />
auf eine Beamtenstelle (3/4-BAT-<br />
Stelle) tätig waren. Hierzu konnte<br />
eine Nebenabrede zum Erhalt einer<br />
Gewährleistungszusage unterschrieben<br />
werden.<br />
Der Philologenverband rief dazu auf,<br />
die geleistete Zahlung aus der Nebenabrede<br />
zurückzuverlangen, weil das<br />
Bundesverwaltungsgericht auf<br />
Grund einer Klage aus Niedersachsen<br />
solche Gehaltsabzüge für unwirksam<br />
erklärt hat. Das Urteil ist auf die<br />
rheinland-pfälzische Nebenabrede<br />
nicht zu übertragen.<br />
In Rheinland-Pfalz gab es - anders<br />
als in Niedersachsen - zwei Vertragsmöglichkeiten,<br />
beide mit der Zusage<br />
auf Übernahme ins Beamtenverhältnis:<br />
• Die eine war das Angebot eines<br />
Angestelltenvertrages mit Zahlung in<br />
die gesetzliche Kranken-, Rentenund<br />
Arbeitslosenversicherung.<br />
• Die andere war ein Angestelltenvertrag<br />
mit einer Zahlung für die Gewährleistungszusage,<br />
bei Krankheit,<br />
Dienstunfall und Ruhegehalt wie<br />
BeamtInnen versorgt zu werden.<br />
Die LehrerInnen in Niedersachsen<br />
hatten diese Wahlmöglichkeit nicht.<br />
Das Bundesverwaltungsgericht hat<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 /2005<br />
Rechtsschutz<br />
Betrifft: KollegInnen in ehemaligen 3/4-BAT-Verträgen mit Option auf eine Beamtenstelle<br />
Lehrkräfte: Vorsicht - böse Falle!<br />
In der letzten Zeit werben immer mehr<br />
Touristik- und Reiseunternehmen sowie<br />
Jugendherbergen und Vergnügungsparks<br />
für ihre Leistungen damit, dass<br />
sie Lehrkräften für sich und ihre Familien<br />
freie Reisen, Unterkünfte oder<br />
freien Eintritt im Vergnügungspark offerieren.<br />
Es wird dringend davor gewarnt, ein<br />
solches Angebot anzunehmen. Im Einzelfall<br />
kann eine solche Annahme den<br />
hierzu die Meinung vertreten, dass<br />
die Übernahme ins Beamtenverhältnis<br />
nicht von einer wirtschaftlichen<br />
Gegenleistung abhängig gemacht<br />
werden darf. Es kam zu dem Schluss,<br />
dass die geforderte Zahlung von - in<br />
Niedersachsen - 200,00 DM pro<br />
Monat als Gegenleistung für die Zusicherung<br />
der Einstellung in das Beamtenverhältnis<br />
anzusehen ist. Deshalb<br />
war das Gericht der Auffassung,<br />
dass diese vertragliche Vereinbarung<br />
nichtig ist und die gezahlten Beträge<br />
zurückgefordert werden können.<br />
In Rheinland-Pfalz wurde dagegen<br />
allen LehrerInnen im 3/4-BAT-Vertrag<br />
die Verbeamtung nach spätestens<br />
fünf Jahren vertraglich zugesichert.<br />
Die <strong>GEW</strong> hatte allen Betroffenen<br />
empfohlen, die Nebenabrede zu<br />
wählen, weil damit u. a. der Vorteil<br />
verbunden war, im Falle eines<br />
Dienstunfalls nach beamtenrechtlichen<br />
Vorschriften abgesichert zu<br />
sein. Auch der Anspruch auf die<br />
Mindestpension war in diesem Fall<br />
gesichert, während die Versicherten<br />
in der BfA in den ersten fünf Jahren<br />
noch keinen Rentenanspruch erworben<br />
hatten.<br />
Die <strong>GEW</strong> Rheinland-Pfalz hält es<br />
für unseriös, LehrerInnen zu einem<br />
Rechtsstreit zu bewegen, der keine<br />
strafrechtlichen Tatbestand der Vorteilsnahme<br />
bzw. der Bestechlichkeit<br />
erfüllen.<br />
Davon nicht erfasst sind Freiplätze,<br />
die gewährt werden, wenn Lehrkräfte<br />
eine Schülergruppe bei der Klassenfahrt<br />
begleiten. Diese Freiplätze können<br />
angenommen werden, weil in<br />
dem Fall die Lehrkraft Schüler betreut.<br />
bsm<br />
Aussicht auf Erfolg hat.<br />
Zudem ist es rechtlich offen, welche<br />
Folgen eine Rückabwicklung der<br />
Gewährleistungszusage in Rheinland-Pfalz<br />
für die Beamtenversorgung<br />
haben könnte. Die <strong>GEW</strong><br />
Rheinland-Pfalz ist der Meinung,<br />
dass eine mögliche Rückforderung<br />
negative Auswirkungen für die Betroffenen<br />
haben könnte (Nachversicherung<br />
bei der BfA, Nicht-Anrechnung<br />
auf die versorgungsfähige<br />
Dienstzeit).<br />
Bei weiteren Fragen bitte wenden an:<br />
<strong>GEW</strong>-Rechtsschutzstelle, Brigitte<br />
Strubel-Mattes, Neubrunnenstraße<br />
8, 55116 Mainz<br />
Tel: 06131-28988-21, Fax: 06131/<br />
29888-30 - brigitte.strubelmattes@gew-rheinland-pfalz.de<br />
bsm<br />
19
Nachruf<br />
20<br />
Zum Gedenken an Rainer Probst<br />
Ein Lehrer und Künstler, dem Schubladendenken<br />
und überkommene Konventionen fremd waren<br />
Die <strong>GEW</strong> trauert um Rainer Probst, der am 14. November<br />
2004, einen Monat vor seinem 63. Geburtstag, nach längerer<br />
schwerer Krankheit verstorben ist.<br />
Rainer engagierte sich seit 1973 in der<br />
<strong>GEW</strong> als Fachgruppensprecher IGS<br />
und Vorsitzender auf Kreisebene, er<br />
war langjähriges Mitglied im Landesfachgruppenausschuss<br />
Integrierte Gesamtschulen.<br />
Als überzeugter Gesamtschullehrer hat<br />
er die IGS Ernst-Bloch in Ludwigshafen<br />
und die IGS Wörrstadt entscheidend<br />
mitgeprägt, letztere durch Konzeptarbeit<br />
im Wahlpflichtbereich. Als<br />
Lehrer für Bildende Kunst und Arbeitslehre<br />
lag ihm das Fach „Kunsthandwerk“<br />
sehr am Herzen.<br />
Rainers Haupttätigkeitsfeld war jedoch<br />
die Personalratsarbeit. Seit Eintritt<br />
in den Schuldienst ÖPR - Vorsitzender<br />
an mehreren Schulen, wurde<br />
er 1988 zum Vertreter der Integrierten<br />
Gesamtschulen im BPR Gymnasien<br />
gewählt. Um den Kontakt zur Basis,<br />
sprich zu den Örtlichen Personalräten<br />
zu halten, gründete Rainer 1991 die AG der Personalräte<br />
an Integrierten Gesamtschulen. Als der Schulart IGS in<br />
Rheinland-Pfalz endlich eigene Stufenvertretungen zugestanden<br />
wurden, war es nur eine konsequente Folge aus diesem<br />
Engagement, dass Rainer Probst zum Vorsitzenden im Hauptpersonalrat<br />
gewählt wurde. Er hat dieses Amt mit großer Kompetenz,<br />
Umsichtigkeit und einer guten Portion Humor ausge-<br />
übt, manche Fehde mit der Dienststelle ausgefochten und dabei<br />
durch seine ruhige aber hartnäckige Art manchen Sieg davongetragen.<br />
Der Kontakt zur Schule war Rainer sehr<br />
wichtig, eine Vollfreistellung für die HPR-<br />
Arbeit kam für ihn nicht in Frage. Lehrerinnen<br />
und Lehrer und auch andere Berufsgruppen<br />
schätzten sein konsequentes<br />
Eintreten für gute Arbeitsbedingungen der<br />
Beschäftigten an Integrierten Gesamtschulen.<br />
Ratsuchende fanden beim HPR<br />
-Vorsitzenden immer ein offenes Ohr für<br />
ihre Fragen und Probleme und erhielten<br />
kompetente Auskunft.<br />
Dem Lehrer und Künstler Rainer Probst<br />
waren Schubladendenken und überkommene<br />
Konventionen fremd. Als durch und<br />
durch politischer Mensch ging er seinen<br />
eigenen, oft unkonventionellen Weg der<br />
politischen Arbeit. Dazu gehörte z. B.,<br />
dass er sich - vor allem nach seiner Pensionierung<br />
- in der PDS engagierte. Er<br />
war Mitglied des Bundesparteirates und<br />
arbeitete in der AG Bildung mit.<br />
Die Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule<br />
im Raum Worms war ein Ziel, das Rainer auf kommunaler<br />
Ebene verfolgte. Zu seinen Lebzeiten hat er sich vergeblich<br />
dafür eingesetzt. Wie man hört, gibt es jetzt aber eine<br />
Initiative in diese Richtung - es sieht so aus, als ob Rainers<br />
Wunsch doch noch in Erfüllung geht ...<br />
Wir trauern um den viel zu früh gestorbenen Menschen Rainer<br />
Probst. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.<br />
Barbara Fiévet<br />
Politik und Poesie waren die beide Pole im künstlerischen Schaffen von Rainer Probst<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 / 2005
Die <strong>GEW</strong> gratuliert …<br />
… im März 2005<br />
zum 70. Geburtstag<br />
Herrn Hinrich Rieken<br />
10.03.1935<br />
Westerburger Str. 2a · 56470 Bad Marienberg<br />
zum 75. Geburtstag<br />
Herrn Frit Riemenschnitter<br />
05.03.1930<br />
Hohlstr. 20 · 67053 Reipoltskirchen<br />
Frau Helga Nad<br />
13.03.1930<br />
Schloßstr. 12 · 67482 Altdorf<br />
Herrn Alfred Kellermann<br />
14.03.1930<br />
Hauptstr. 12 · 55758 Schmidthachenbach<br />
zum 80. Geburtstag<br />
Frau Sieglinde Tauber<br />
04.03.1925<br />
Kaiser-Wilhelm-Str. 45 · 67059 Ludwigshafen<br />
Herrn Willi Hirth<br />
16.03.1925<br />
Unt. Sommerwaldweg 134 · 66953 Pirmasens<br />
Treffen im Naturpark Pfälzerwald<br />
Tipps + Termine<br />
Wie in den vergangenen 12 Jahren<br />
wollen sich die KreiseniorenvertreterInnen<br />
auch 2005 an drei Tagen im<br />
Mai treffen, um miteinander gewerkschaftliche<br />
Themen zu erörtern, die<br />
Region um den Tagungsort kennen<br />
zu lernen und das gesellige Miteinander<br />
zu pflegen. Das Treffen findet<br />
vom 09.05 - 11.05.2005 im Hotelrestaurant<br />
am See „Saarbachhammer“<br />
in Ludwigswinkel, Kreisverband<br />
Pirmasens, statt. Die Tagung<br />
Sonderband zum Schillerjahr<br />
Stiftung Lesen<br />
Im Schillerjahr 2005 gibt ein langjähriges<br />
Mitglied der Stiftung Lesen,<br />
das Nachhilfe-Institut Studienkreis,<br />
gemeinsam mit der Stiftung Lesen<br />
einen 832 Seiten starken Sonderband<br />
mit fünf der bedeutendsten<br />
Werke des Dichters heraus. Ein Teil<br />
des Verkaufserlöses kommt unmit-<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 /2005<br />
Herrn Albert Zimmer<br />
20.03.1925<br />
Bockhofstr. 42 · 66909 Herschweiler-Pettersheim<br />
Frau Wilhelmine Ruff<br />
23.03.1925<br />
Staffelstr. 13 · 67292 Kirchheimbolanden<br />
Herrn Paul Unger<br />
27.03.1925<br />
Leibnizstr. 31 · 67292 Kirchheimbolanden<br />
zum 94. Geburtstag<br />
Frau Anna Sittel<br />
16.03.1911<br />
Hildegardring 52 · 67657 Kaiserslautern<br />
beginnt um 15.30 Uhr mit einer gemeinsamen<br />
Kaffeetafel, zu der der<br />
KV Pirmasens einlädt.<br />
Kollege Fritz Faul aus Lemberg hat<br />
die organisatorische Vorarbeit dazu<br />
getroffen. Am 1. Tag wird Hans<br />
Adolf Schäfer über den Verlauf des<br />
<strong>GEW</strong>-Bundesgewerkschaftstages<br />
2005 im April in Erfurt berichten.<br />
Danach stehen Informationen aus<br />
den Kreisverbänden auf dem Programm.<br />
Zum Abschluss wird erör-<br />
telbar den Leseförderprojekten der<br />
Stiftung zugute.<br />
Die Sonderedition wendet sich insbesondere<br />
an Gymnasien. DeutschlehrerInnen<br />
können das Buch für 3<br />
Euro im Klassensatz (ab 12 Exemplaren)<br />
bestellen Zusätzlich erhalten<br />
sie kostenfrei originelle Comic-Strips<br />
Alter + Ruhestand<br />
Der Landesvorstand<br />
tert, wie SeniorInnenarbeit effizient<br />
gestaltet werden kann.<br />
Am 2. Tag wird die Region im äußersten<br />
Südwesten von Rheinland-<br />
Pfalz erkundet.<br />
Am Vormittag des 3. Tages folgt eine<br />
Fahrt nach Pirmasens mit einem<br />
kleinen Stadtrundgang. Nach dem<br />
gemeinsamen Mittagessen geht es<br />
wieder heim.<br />
Edmund Theiß<br />
mit den Schlüsselszenen der fünf<br />
Dramen und anspruchsvolle Quiz-<br />
Aufgaben. In Zeiten enger Budgets<br />
wird den Schulen so ermöglicht, die<br />
fünf meistgelesenen Schillerwerke<br />
zum Preis von einem zu erwerben.<br />
Bestellung: Stiftung Lesen, Pressestelle,<br />
Römerwall 40, 55131 Mainz.<br />
pm<br />
21
Tipps + Termine<br />
Drei Frauen im Park<br />
Titanic im Trockendock<br />
22<br />
Drei Frauen treffen sich auf einer<br />
Bank im Kurpark, kommen ins Gespräch,<br />
monologisieren in Gedanken<br />
weiter über das alltägliche<br />
Knäuel von Beziehungen: Dann hat<br />
der … und als … und am Telefon<br />
hat eine frühere Freundin … So<br />
kommen neben den drei Frauen viele<br />
ins Spiel, viele Frauen, auch Männer:<br />
Thema des Gedankenaustauschs<br />
ist dieses mühsame, unklare<br />
Geflecht von Engagement und<br />
Selbstsucht, Hoffnung und Verwirrung,<br />
Mobbing und Teamwork,<br />
dem wir überall begegnen. Die drei<br />
Frauen suchen nach Klarheit, bald<br />
wird der Kuraufenthalt beendet sein,<br />
dann müssen sie wissen, wie es für<br />
sie weitergeht. Aber die Klarheit findet<br />
sich nicht. Die Erzählung bleibt<br />
in der Darstellung der Gedankenkreise.<br />
„Ich hätte meinen Mund aufmachen<br />
sollen“, sagt Mona. Die an-<br />
Kurz und bündig Z. Doch was dahinter<br />
steckt, kann man getrost gewaltig<br />
nennen. Eine Datenbank mit<br />
72.500 Aussagen, Meinungen,<br />
Schlagzeilen, Werbeslogans, Aphorismen,<br />
Sprichwörtern, Redens- und<br />
Mundarten: Zitaten.<br />
Z gibt Antworten auf 15.500 Themen.<br />
Klassische Antworten von Goe-<br />
dere heißt Lisa. Mona lächelt die<br />
Dritte, Lena, an. „Ich an Deiner Stelle<br />
würde kämpfen“, wird ein Kollege<br />
zitiert.<br />
Dabei kämpfen Lena und Mona in<br />
ihrem Berufsalltag, als Lehrerin, als<br />
Personalrätin. Sie trauen sich was zu,<br />
sie bewerben sich um Posten, sie treten<br />
für Frauenrechte ein, sie sehen<br />
durchaus, dass falsch gespielt wird<br />
und wissen Beispiele davon zu erzählen.<br />
Sie durchdenken die eigenen<br />
Fehler, stehen dazu. Das sollte doch<br />
zur Klärung beitragen? Aber nein,<br />
das Umfeld scheint ungerechtfertigt<br />
auf ihren Fehlern herumzureiten,<br />
warum? Eine typische Mobbingsituation?<br />
Ist damit die Situation von<br />
Frauen, die sich im Beruf engagieren,<br />
charakterisiert? Wo ist der Ausweg,<br />
die Lücke im Teufelskreis? Lisa<br />
bringt über die Schilderung der Mutter<br />
und ihrer Beziehung zu ihr das<br />
the, Shakespeare und Co. und ganz<br />
aktuelle.<br />
Wenn man z.B. die Suchwörter<br />
„Fernsehen“ und „Katastrophe“ eingibt,<br />
erhält man u.a. die bissige Bemerkung<br />
eines früheren deutschen<br />
Arbeitsministers: „Wir schlürfen die<br />
Katastrophen wie die Cocktails und<br />
richten uns, sozial gesichert, manch-<br />
Lese- und Hörtipps von Antje Fries<br />
Närrisch geworden?<br />
„Bist du närrisch geworden?“, will<br />
der Vater vom Vierzehnjährigen wissen,<br />
der sich statt mit der Schule viel<br />
intensiver mit literarischen Versuchen<br />
beschäftigt. Hätte er gewusst,<br />
wie erfolgreich sein Friedrich einmal<br />
werden würde, hätte Vater Schiller<br />
die Ambitionen seines Sprösslings<br />
sicher leichter akzeptiert. Natürlich,<br />
so glänzend wie seinem Freund und<br />
Kollegen Goethe ging es Schiller nie:<br />
Gläubiger und Krankheiten, Misserfolge<br />
und obendrein ein Schreibverbot<br />
durch seinen Landesherrn markieren<br />
sein Leben. Dennoch: Schil-<br />
lers Leidenschaft und rebellisches<br />
Wesen sorgen auch heute noch dafür,<br />
dass er einer der meistgelesenen<br />
Autoren ist. Gerade auch dann,<br />
wenn es in der Schule um Sturm und<br />
Drang und Deutsche Klassik geht.<br />
Harald Gerlachs Band aus der Reihe<br />
„Erzähltes Leben“ ist angenehm<br />
zu lesen und stellt den Dichter<br />
pünktlich zu dessen 200. Todesjahr<br />
2005 noch einmal sehr lebendig vor.<br />
Harald Gerlach: „Man liebt nur, was<br />
einen in Freyheit setzt“. Die Lebensgeschichte<br />
des Friedrich Schiller.<br />
Frauenleben einer Generation früher<br />
ins Blickfeld: der Kriegsgeneration,<br />
die nach dem Krieg Kinder aufzog.<br />
Deren Schweigen, deren Beziehungslosigkeit<br />
scheint auch die<br />
Töchtergeneration zu belasten …<br />
Die drei Frauen versuchen wie unsere<br />
Generation ein neues selbstbewusstes<br />
Frauenbild für sich zu entwickeln,<br />
zu leben und bleiben vorläufig<br />
im Unklaren hängen. Was<br />
tut’s? Man kann nicht ohne Karte in<br />
den Urwald gehen, ohne zu riskieren,<br />
dass man sich unterwegs verläuft.<br />
Wichtig ist, den Mut nicht zu<br />
verlieren auf dem Weg. Ich jedenfalls<br />
habe mich wiedergefunden in<br />
dieser Darstellung, ich kann mir vorstellen,<br />
dass es anderen Frauen wie<br />
mir geht.<br />
Heide Marie Vogt<br />
Gaby Thienken: Drei Frauen. Erzählung.<br />
Schardt Verlag Oldenburg<br />
2004, 80 Seiten, 10 Euro.<br />
mal sogar beamtenhaft abgestützt, im<br />
Untergang ein. Das neue Gesellschaftsspiel<br />
heißt ‘Titanic im Trokkendock‘.”<br />
Z kann man als kleine Probierversion<br />
mit 10.000 Datensätzen kostenfrei<br />
aus dem Netz downloaden. Die<br />
große Version gibt es auf CD-ROM.<br />
Info: www.dasgrossez.de<br />
pm<br />
Weinheim 2004. ISBN 3-407-<br />
80877-1. 14,90 Euro.<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 / 2005
Mitreden lernen<br />
„Nachgefragt: Politik. Basiswissen<br />
zum Mitreden“ ist eine interessante<br />
Sammlung von vier CDs der Hamburger<br />
HörCompany. Die schon als<br />
Buch erschienenen Texte von Christine<br />
Schulz-Reiss wurden nun von<br />
Marion von Stengel und Gerhard<br />
Garbers gesprochen. Auf der ersten<br />
CD geht es um „Du und ich und wir<br />
und ihr“: Was ist Politik überhaupt?<br />
Was ist ein Staat? Was eine Demokratie?<br />
Und wer regelt was in Stadt,<br />
Kreis, Land und Bund? Zweiter<br />
Block auf dieser CD sind die Bürgerrechte:<br />
Es geht beispielsweise um<br />
Petitionen, Volksbegehren, Wahlen,<br />
APO und Demonstrationsrecht.<br />
CD 2 erklärt, wer uns regiert, wie<br />
Gesetze gemacht werden und was<br />
„rechts“ oder „links“ und alle möglichen<br />
Farben in der Politik bedeuten.<br />
Wer außer der Regierung noch Politik<br />
betreibt, verrät CD 3. Wie die<br />
Politik und deren Vorhaben finanziert<br />
werden und innere und äußere<br />
Sicherheit des Staates funktionieren,<br />
wird hier ebenfalls beschrieben.<br />
Die vierte CD legt den Schwerpunkt<br />
auf die Außenpolitik und Verbände<br />
außerhalb der Politik, Gründe für<br />
und gegen Engagement in Parteien<br />
und die Möglichkeiten von Kindern,<br />
sich schon für eigene Rechte einzusetzen.<br />
Im Beiheft findet man ein nützliches<br />
Glossar und hilfreiche Internet-<br />
Adressen zu weiterer Recherche „für<br />
hinterher“. „Für vorneweg“ sorgt die<br />
lockere Einleitung auf der ersten CD<br />
dafür, dass man schon mal zustimmend<br />
nickenden und grinsenden<br />
Schülern gegenüber sitzt, die sich die<br />
im Schnitt zwei bis vier Minuten langen<br />
Politik-Stückchen sicher gern<br />
weiter anhören werden.<br />
Christine Schulz-Reiss: Nachgefragt:<br />
Politik. Basiswissen zum Mitreden.<br />
Hamburg 2004. 4 CDs im Schuber.<br />
ISBN 3-935036-65-5<br />
Sprachförderung in Kita<br />
und Schule<br />
„Schule ist toll“ lässt sich auf dem<br />
Titelfoto des Ordners lesen, der neu<br />
zur Sprachförderung in der Schuleingangsphase<br />
erschienen ist. Damit<br />
Schule wirklich toll wird, ist aber<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 /2005<br />
nicht selten wichtig, dass selbst die<br />
deutschen Kinder sprachlich gefördert<br />
werden. Dies könnte mit dem<br />
vorliegenden Werk, das eine enge<br />
Verzahnung von Kindertagesstätte<br />
und Grundschule vorschlägt, gelingen:<br />
Nun gut, Eva und Billi, die beiden<br />
Identifikationsfiguren, die Bären<br />
im Waldkindergarten sind, müssen<br />
einem nicht unbedingt gefallen.<br />
Den Kindern aber bestimmt umso<br />
eher! Und so trifft man die beiden<br />
in jedem Kapitel. Sie begleiten die<br />
Vorschulkinder vor dem Wechsel in<br />
die Schule bis in die ersten Wochen<br />
in der Grundschule. Zahlreiche Kopiervorlagen<br />
sind Anregungen für regelmäßige<br />
Übungen, die den Kindern<br />
eher als Spiele erscheinen werden.<br />
Viel in unterschiedliche Bereiche<br />
eingeteiltes Material gibt es auch<br />
für ErzieherInnen und LehrerInnen,<br />
und allem voran gestellt ist die theoretische<br />
Einführung, die nicht nur<br />
PISA zitiert, sondern auch zur tatsächlichen<br />
Vernetzung von Kita und<br />
Grundschule rät und neue Konzepte<br />
für die Arbeit in beiden Institutionen<br />
vorstellt. Keine Sorge, auch<br />
dieser theoretische Teil lässt sich gut<br />
lesen, und die umfangreichen Praxismaterialien<br />
machen Mut zum Anfangen,<br />
Lust zum Ausprobieren und<br />
Neugier auf die Ergebnisse. Warum<br />
nur muss der Ordner so teuer sein?<br />
So verbietet sich die private Anschaffung<br />
geradezu. Also mal bei der Chefin<br />
anfragen! Hoffentlich ist noch<br />
etwas drin im kargen Kita- oder<br />
Schul-Etat!<br />
Maria-Anna Rose/Rudolf Kretschmann/Ute<br />
Meinders: Schuleingangsphase:<br />
Sprachförderung. Materialien<br />
zur Vorbereitung und Gestaltung<br />
des Schulanfangs für Kindergarten<br />
und Schule. Weinheim 2004. ISBN<br />
3-407-62502-2. 59,90 Euro.<br />
Verhaltensprobleme<br />
erkennen<br />
„Also, meiner hat ja ADS, der kann<br />
da ja nix für!“ Wie beruhigend für<br />
alle Beteiligten! Oder sollte doch etwas<br />
anderes hinter den Problemen<br />
stecken? Und ab wann kann man<br />
überhaupt von einem Problemfall<br />
sprechen? Und wie dann damit umgehen?<br />
Tipps + Termine<br />
Im 6. Band der Reihe „Sozialpädagogische<br />
Praxis“ befasst sich der an der<br />
Fachschule für Sozialpädagogik in<br />
Bühl lehrende Erziehungswissenschaftler<br />
Adalbert Metzinger mit<br />
Verhaltensproblemen, deren Diagnose<br />
und Behandlung.<br />
Hier klärt er dann zunächst, was<br />
normales und was abweichendes Verhalten<br />
ist und welche Ursachen es<br />
dafür geben mag.<br />
Der Hauptteil des Buches dreht sich<br />
um speziell definierte Verhaltensstörungen<br />
bezüglich Sprache, Sozialverhalten,<br />
Wahrnehmung, Psychosomatik,<br />
Legasthenie, ADS und auch<br />
Sucht. Zu jedem Bereich gibt es<br />
nicht nur die Beschreibung des jeweiligen<br />
Problems, sondern auch<br />
absolut praxistaugliche Anregungen,<br />
die übersichtlich gehalten sind, aber<br />
gerade darum so gut umsetzbar werden.<br />
An einigen Stellen werden zusätzlich<br />
hilfreiche Adressen angeführt.<br />
Gut, nun wissen wir, was so eine Störung<br />
ist, aber wie beobachte ich das<br />
Ganze professionell? Wie bespreche<br />
ich den Fall sinnvoll mit den Kollegen?<br />
Und wie bringe ich es den Eltern<br />
bei? Auch hierzu gibt es angenehm<br />
lesbare Kapitel, und ein Überblick<br />
über Beratung und Behandlung<br />
sowie das weitere erzieherische Vorgehen<br />
bei Problemfällen runden einen<br />
gelungenen Leitfaden ab, der so<br />
stabil ist, dass man sich bestens daran<br />
festhalten kann.<br />
kursiv<br />
Adalbert Metzinger: Verhaltensprobleme<br />
erkennen, verstehen und behandeln.<br />
Weinheim 2005. 148 Seiten.<br />
14,90 Euro. ISBN 3-407-<br />
56282-9<br />
Bedeutsames Zukunftsthema<br />
Qualitätsmanagement<br />
Nicht, dass wir LehrerInnen nicht<br />
alle schon mal darüber gestöhnt<br />
hätten...Aber man könnte die in<br />
Mode gekommenen Evaluationsaufgaben<br />
ja auch mit literarischer Hilfe<br />
angehen: Nicht umsonst ist es bereits<br />
die vierte Auflage, die nun von „Qualitätsmanagement<br />
und Evaluation“<br />
erschienen ist. Durch die Überarbeitung<br />
und Ergänzung seitens der Autoren<br />
(dem Schulleiter Guy Kemp-<br />
23
Tipps + Termine<br />
24<br />
fert und dem Erziehungswissenschaftler<br />
Hans-Günter Rolff) liegt<br />
im Prinzip ein neues Buch vor. Neu<br />
sind die Kapitel über Feedback und<br />
Teamentwicklung, und aktuell angehängt<br />
sind zudem zahlreiche Testergebnisse,<br />
Parallel- und Vergleichsarbeiten<br />
und die Möglichkeiten der<br />
„innerschulischen Verarbeitung“ sowie<br />
Anleitungen zur schulinternen<br />
Unterrichtsevaluation und kollegialen<br />
Hospitation. Der abschließende<br />
Bereich befasst sich mit dem Weg<br />
zum Qualitätsmanagement und bietet<br />
eine Fülle von Checklisten für<br />
Schulleitungen und Kollegien an,<br />
die Einstieg wie weitere Arbeit erleichtern.<br />
Fazit: Ein kompakter<br />
Band voll ausnahmslos Nützlichem<br />
für alle Beteiligten, aktuell und verständlich<br />
gleichermaßen.<br />
Guy Kempfert/Hans-Günter Rolff:<br />
Qualität und Evaluation. Ein Leit-<br />
faden für Pädagogisches Qualitätsmanagement.<br />
4. überarbeitete und<br />
erweiterte Auflage, Weinheim 2005.<br />
286 Seiten. 22,90 Euro. ISBN 3-<br />
407-25360-5<br />
Landschaft - Glaube -<br />
Mythos<br />
Es ist nicht Hans-Christian Kirschs<br />
erstes Buch über Elisabeth Langgässer,<br />
das gerade in der rheinhessischen<br />
Reihe „Köpfe der Region“ erschienen<br />
ist. Doch indem er sich (auch unter<br />
seinem Pseudonym Frederik Hetmann)<br />
mehrfach mit ihr befasst,<br />
möchte er sich immer weiter annähern,<br />
schreibt der Autor. Und so liest<br />
sich schon der biographische Teil des<br />
Buches spannend, bewegend und<br />
teils tragisch. Das Leben der gebürtigen<br />
Alzeyerin wird, ohne jemals<br />
ausschweifend zu werden, detailliert<br />
beschrieben und lässt die folgenden<br />
Kapitel umso besser verstehen: Hier<br />
Klaus Doderer wurde 80<br />
Dem Nestor der deutschen Jugendbuchforschung zum Geburtstag<br />
Es ist kaum zu glauben: Klaus Doderer,<br />
emeritierter Professor für Didaktik<br />
der deutschen Sprache und<br />
Literatur an der Johann-Wolfgang-<br />
Goethe-Universität und gleichzeitig<br />
langjähriger Direktor des dortigen<br />
Instituts für Jugendbuchforschung,<br />
wurde am 20. Januar 2005<br />
achtzig Jahre alt.<br />
Er ist so wunderbar hessisch<br />
- und so ganz global<br />
Klaus Doderer, in Wiesbaden geboren,<br />
studierte in Marburg und am<br />
Pädagogischen Institut Darmstadt.<br />
Er war zwei Jahre Lehrer an einer<br />
hessischen Dorfschule. Er war<br />
Hochschullehrer in Jugenheim und<br />
Frankfurt; dort leitete er seit dessen<br />
Gründung (1963) das bald weltweit<br />
renommierte, der Universität angeschlossene<br />
Institut für Jugendbuchforschung.<br />
Er lebt seit Menschengedenken<br />
in Darmstadt.<br />
Seit es ihm möglich ist, geht er in<br />
die Welt hinaus, buchstäblich als<br />
Leser und in seinem wissenschaftlichen<br />
Anspruch. Hemingway und<br />
andere amerikanische Erzähler wer-<br />
den entdeckt. Die Reihe seiner veröffentlichten<br />
Arbeiten beginnt nicht<br />
zufällig 1953 mit der zum Standardwerk<br />
gewordenen Dissertation über<br />
„Die Kurzgeschichte in Deutschland“.<br />
Vorausgegangen ist eine erste<br />
Arbeit über die „Auffassung der<br />
deutschen Romantik in England und<br />
Frankreich“. Beide Arbeiten angefertigt<br />
bei aus der Emigration zurückgekehrten<br />
Doktorvätern. Den einen,<br />
den früh verstorbenen Werner<br />
Milch, zählt Doderer zu seinen wichtigen<br />
Lehrern wie Martin Wagenschein,<br />
Franz Borkenau, Eugen Kogon<br />
, Theodor W. Adorno und Max<br />
Horkheimer.<br />
Ein Jahr als Lektor an der Universität<br />
Birmingham erweitert den internationalen<br />
Bezug. Später werden<br />
Auslandsbeziehungen immer intensiver<br />
, eine Gastprofessur in Amerika,<br />
Aufenthalte in Japan und Australien<br />
und die „Reisen in erdachtes<br />
Land . Literarische Spurensuche<br />
vor Ort“, so ein Essay-Band 1998.<br />
Er wächst auf in einem Haus voller<br />
Bücher, am Rande von Opposition<br />
und Widerstand: Im Hause Dode-<br />
geht es um die Interpretation exemplarisch<br />
ausgewählter Langgässer-<br />
Werke wie „Gang durch das Ried“,<br />
„Das unauslöschliche Siegel“ oder<br />
„Märkische Argonautenfahrt“. Eine<br />
Zeittafel im Anhang verschafft einen<br />
Überblick nicht nur über die Lebensstationen<br />
Elisabeth Langgässers, sondern<br />
auch über ihre Familie, ihre<br />
Reisen und ihr Werk. Die Bibliografie<br />
lädt zum Weiterlesen über die Literatin<br />
ein, historische Familien- und<br />
melancholische Landschaftsfotos<br />
komplettieren den Inhalt und nicht<br />
zuletzt die äußere Gestaltung des 126<br />
Seiten starken Bandes macht es zum<br />
Schmuckstück im Bücherregal.<br />
Hans-Christian Kirsch: Elisabeth<br />
Langgässer. Literatur und Landschaft.<br />
2. Band der Reihe „Köpfe der<br />
Region“. Herausgegeben von Hans<br />
Berkessel. Ingelheim 2004. 126 Seiten.<br />
12,50 Euro. ISBN 3-937782-<br />
13-3<br />
rer gibt es verbotene Literatur, pazifistische,<br />
wie Ernst Glaesers „Jahrgang<br />
1902“ (Doderers Vater war mit<br />
Glaeser befreundet), Remarque und<br />
Barbusse. Gleichwohl lebt er wie seine<br />
Altersgenossen, macht 1943 Abitur<br />
und muss noch in den Krieg.<br />
Er ist ein Anreger,<br />
ein Macher, zuallererst<br />
ein großer Lehrer<br />
Nach der Heimkehr aus amerikanischer<br />
Gefangenschaft folgt das oben<br />
angedeutete germanistische Studium.<br />
Sehr bewusst wählt er den literaturwissenschaftlichen<br />
Abschluss; er<br />
will keine 0-8-15 -Ausbildung zum<br />
Studienrat. Dennoch, Lehrer will er<br />
sein. Die zwei Jahre an der hessischen<br />
Dorfschule sind geprägt vom stillen<br />
Experiment, seine Unterrichtspraxis<br />
orientiert sich an Adolf Reichwein,<br />
an Kerschensteiner, an den frühen<br />
Schulreformern, der Pädagogik „vom<br />
Kinde aus“. Statt Aufsätze schreiben<br />
zu lassen, probiert er beispielsweise<br />
ein „creative writing“. Diese Praxiserfahrungen<br />
münden in ein erfolgreich<br />
gewordenes Buch: „Wege in<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 / 2005
die Welt der Sprache“.<br />
Schließlich findet er 1963 zu seiner<br />
Lebensaufgabe, zu dem, was ihn und<br />
seine Arbeit weltweit bekannt gemacht<br />
hat, zu Aufbau und Leitung<br />
des Instituts für Jugendbuchforschung.<br />
Dort wurde bald vieles<br />
selbstverständlich, was andernorts<br />
erst erarbeitet und erstritten werden<br />
musste, Teamwork z.B. Dort, außerhalb<br />
der tradierten akademischen<br />
Zwänge, konnte Doderer seinen kulturwissenschaftlich<br />
geprägten Ansatz<br />
(er spricht von „literatursoziologischkulturanthropologischer<br />
Methode)<br />
fruchtbringend einsetzen.<br />
Praxisbezug war immer wichtig in<br />
seinen Arbeitsfeldern. Neben den<br />
vielen Forschungsprojekten gab es<br />
seit 1969 eigene Lehrangebote des<br />
Instituts, und es gab intensiven Kontakt<br />
zu „leibhaftige(n)“ Autoren in<br />
solchen Veranstaltungen, so mit<br />
James Krüss (1963), mit Erich Kästner<br />
(1965), mit Michael Ende<br />
(1965), mit Astrid Lindgren (1971).<br />
Das Institut veranstaltete Ausstellungen,<br />
hatte viele Außenkontakte, man<br />
sah den universitären Rahmen als<br />
Möglichkeit, nicht als Grenze an. Vor<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 /2005<br />
allem hatte man von Beginn an einen<br />
sehr weiten Literaturbegriff; es<br />
war selbstverständlich, dass Heftchenliteratur,<br />
Comics, Trivialliteratur<br />
dazu gehörten. Auch wurden die<br />
sich ankündigenden technischen<br />
Medien von Beginn an in die Forschung<br />
einbezogen, eine Forschung,<br />
gekennzeichnet von der Kooperation<br />
vieler Wissenschaften. - Und der<br />
internationale Rahmen der Institutsarbeit<br />
war selbstverständlich, gerade<br />
auch die frühen und bald intensiven<br />
Beziehungen zu Kinderbuchforschern<br />
hinter dem „Eisernen Vorhang“<br />
Klaus Doderers Verdienste um die<br />
Kinder- und Jugendliteratur, um<br />
Kultur überhaupt sind außergewöhnlich.<br />
Man dürfte nicht nur die<br />
Liste seiner Veröffentlichungen sich<br />
vornehmen (eine bis 2000 gehende<br />
Bibliographie umfasst mehr als 30<br />
Seiten) , man müsste vor allem auch<br />
das begutachten, was er angeregt,<br />
angestoßen, erkämpft und „durchgezogen“<br />
hat. Wenn nur eines genannt<br />
sein soll, dann das zwischen<br />
1975 und 1982 herausgekommene<br />
vierbändige „Lexikon der Kinderund<br />
Jugendliteratur“, ein Jahrhundertprojekt.<br />
Klaus Doderer hat in Deutschland<br />
mit großem Erfolg daran gearbeitet,<br />
Aktuelle Entwicklungen von Migrationsprozessen<br />
Frau Ilona Besha wurde am 16.<br />
Dezember 2004 das erste Zertifikat<br />
im wissenschaftlichen Weiterbildungsstudium<br />
„Europäische Migration“<br />
der Johannes Gutenberg -<br />
Universität Mainz überreicht. Damit<br />
wurde die erfolgreiche Teilnahme<br />
an sechs Seminaren aus fünf unterschiedlichen<br />
Themenbereichen<br />
sowie einem Kolloquium am Pädagogischen<br />
Institut bescheinigt.<br />
Tipps + Termine<br />
den „vermeintlichen Graben zwischen<br />
der Kinderliteratur“ und der<br />
„hohen Literatur“ zuzuschütten. International<br />
war seine Arbeit noch<br />
erfolgreicher, wie er in einem Interview<br />
1999 einräumte: „Die Entwicklung<br />
zu mehr ästhetischer Qualität<br />
der Kinder- und Jugendliteratur ist<br />
weltweit. Ganz unschuldig daran ist<br />
das kleine Frankfurter Institut für<br />
Jugendbuchforschung nicht gewesen.<br />
Wir hatten ohne Zweifel eine<br />
Theorie und Praxis beeinflussende<br />
Anregerfunktion. „<br />
Dafür erhielt Klaus Doderer 1987 -<br />
in Japan - den Internationalen Brüder<br />
Grimm-Preis .<br />
Hierzulande ehrte man ihn kürzlich<br />
mit dem Bundesverdienstkreuz, im<br />
Sommer 2004 noch von Johnnnes<br />
Rau überreicht.<br />
Und - zum Geburtstag - mit einem<br />
Forum zum Thema „Die Zukunft<br />
der Kinder- und Jugendliteratur“ im<br />
Jagdschloss Kranichstein bei Darmstadt.<br />
Erich Eberts<br />
Der Buchtipp zum Artikel:<br />
Klaus Doderer: Die Entdeckung der<br />
Kinder- und Jugendliteraturforschung,<br />
Autobiographische Reflexionen,<br />
Weinheim Basel 2005,<br />
28,90 Euro, ISBN 3 407 85890 6<br />
Verleihung des 1. Zertifikats im Weiterbildungsstudium „Europäische Migration“<br />
Seit über drei Jahren bietet die Johannes<br />
Gutenberg-Universität in<br />
Zusammenarbeit mit zahlreichen<br />
Kooperationspartnern aus dem<br />
Rhein-Main-Gebiet das Weiterbildungsstudium<br />
„Europäische Migration“<br />
an. Fachkräften aus der Bildungsarbeit,<br />
den Verwaltungen und<br />
der sozialen Arbeit sowie an Themengebieten<br />
aus dem Migrationsbereich<br />
Interessierten wird so die Möglichkeit<br />
gegeben, sich über aktuelle Entwicklungen<br />
von Migrationsprozessen<br />
und deren Auswirkungen auf Gesellschaft<br />
und Arbeitswelt zu informieren<br />
und auszutauschen.<br />
Zu fünf unterschiedlichen Themenschwerpunkten<br />
werden jährlich ca.<br />
sieben Veranstaltungen angeboten,<br />
die alle auch einzeln gebucht werden<br />
können. Besonders nachgefragt wurden<br />
bisher Veranstaltungen zur<br />
Sprachförderung von mehrsprachig<br />
aufwachsenden Kindern, zum Ausländer-<br />
und Flüchtlingsrecht und zur<br />
Vermittlung von interkulturellen<br />
Kompetenzen.<br />
Insgesamt über 250 Interessierte aus<br />
ganz unterschiedlichen Arbeits- und<br />
Lebenszusammenhängen konnten in<br />
den letzten Jahren ihre Erfahrungen<br />
und ihr Wissen in den Veranstaltungen<br />
des Weiterbildungsstudiums einbringen<br />
und erweitern.<br />
Ziel des Kooperationsprojektes ist es,<br />
durch die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern<br />
aus den unterschiedlichen<br />
Arbeitsbereichen einen<br />
25
Tipps + Termine<br />
26<br />
Ort zu schaffen, an dem es möglich<br />
ist, sich aktiv und wissenschaftlich<br />
fundiert über die Verständigung in<br />
unserer Gesellschaft über das soziale<br />
und interkulturelle Zusammenleben<br />
im Rhein-Main-Gebiet auseinander<br />
zu setzen und die Bildungschancen<br />
von Menschen und deren Teilhabe<br />
an der Gesellschaft zu fördern.<br />
Das weiterbildende Studium wird<br />
gefördert durch die Landesbeauftragte<br />
für Ausländerfragen bei der Staatskanzlei<br />
Rheinland-Pfalz.<br />
In diesem Jahr werden folgende Veranstaltungen<br />
angeboten:<br />
16./17. Februar: Muslimische Le-<br />
benswelten<br />
17./18. März: Flüchtlingskinder und<br />
Kinderflüchtlinge - Kinder im Schatten<br />
von Politik und Pädagogik<br />
23./24 Mai: Viele Kinder, viele Sprachen<br />
20.21. Juni: Grundlagen zur Entwicklung<br />
interkultureller Kompetenzen<br />
06./07 Oktober: Pädagogik und „besondere<br />
Pädagogik“ in der Einwanderungsgesellschaft<br />
17.-19. Oktober: Herausforderungen<br />
und Chancen interkultureller<br />
Begegnungen in der offenen Jugendarbeit<br />
Wie weit ist der Weg zur professionellen Lehrkraft?<br />
Nach einer alten chinesischen Weisheit<br />
beginnt auch der längste Weg<br />
mit einem ersten Schritt. Doch wie<br />
viele Schritte führen zu dem Ziel, ein<br />
„professioneller Lehrer“ zu sein? Der<br />
bekannte Lehrerfortbildner Reinhold<br />
Miller schlägt 99 in drei Etappen<br />
vor. Das klingt zunächst nach<br />
einem flotten Spaziergang. Seine<br />
Absicht benennt er auch dementsprechend:<br />
„in knapper Form mit<br />
Überblick zum Durchblick!“ Doch<br />
knapp ist nur die Form der Darstellung.<br />
Was dieses Buch bietet, ist in<br />
Wahrheit die Weisheit eines ganzen<br />
Pädagogenlebens, und die erschließt<br />
sich nur denen, die sich Zeit lassen<br />
und geduldig schrittweise vorangehen.<br />
Die „drei Etappen“ des Weges entsprechen<br />
Millers Vorstellung vom<br />
LehrerInnen-Beruf. Wer ihn ausübt,<br />
muss in drei Sparten zu Hause sein,<br />
nämlich bei sich selbst, bei anderen<br />
und bei den Sachen. Deshalb geht<br />
es bei der eigenen Professionalisierung<br />
stets darum, sowohl Achtsamkeit<br />
für sich selbst (berufliche Selbstkompetenz)<br />
als auch Achtsamkeit<br />
für andere (Beziehungskompetenz)<br />
sowie die Beherrschung der Sachen<br />
(erfolgreich unterrichten durch<br />
Sachkompetenz) zu entwickeln. In<br />
welcher Reihenfolge man voranschreitet<br />
und welche der 99 Schritte<br />
man tatsächlich „geht“, bleibt den<br />
LeserInnen selbst überlassen. Jeder<br />
einzelne Schritt bietet die Möglichkeit,<br />
sich zu informieren, darüber zu<br />
reflektieren, etwas auszuprobieren<br />
oder sogar zu trainieren und schließlich<br />
den Effekt zu evaluieren. Für<br />
jede dieser vier Phasen bietet jeder<br />
Schritt im Buch Anregungen und<br />
Übungen. 29 zusätzliche mehrseitige<br />
Materialien auf der mitgelieferten<br />
CD-ROM bieten weiteren, vertiefenden<br />
Übungsstoff. Und schließlich<br />
eröffnen die überschaubaren Literaturlisten<br />
am Ende jeder Etappe weitere<br />
Möglichkeiten des Vertiefens<br />
und Weitergehens auf dem Weg der<br />
Professionalisierung.<br />
Mehr Professionalität anzustreben<br />
bedeutet nach Miller keineswegs,<br />
„Über-Lehrkraft“ sein zu sollen. Gerade<br />
auf der ersten Etappe führt der<br />
Weg zu größerer Selbstkompetenz<br />
über die Wahrnehmung der eigenen<br />
Gefühle, den Umgang mit Belastungen<br />
und eigenen wie fremden Ansprüchen<br />
hin zu den Chancen des<br />
Älterwerdens und zu den notwendigen<br />
Abgrenzungen. Professionelle<br />
LehrerInnen schaffen also nicht alles,<br />
was sie theoretisch schaffen<br />
könnten, sondern gehen ökonomisch<br />
mit sich und den eigenen<br />
Kräften um. Nur wer mit sich selbst<br />
gut kann, kann auch mit anderen<br />
gut. - Da rund 80 Prozent der schulischen<br />
Arbeit aus Kommunikation<br />
und Beziehungsarbeit bestehen, bietet<br />
die zweite Etappe allein 43 Schritte<br />
für die Entwicklung der Fähigkeit<br />
an, mit anderen gut auszukommen.<br />
Dabei geht es um das Kommunikationsverhalten,<br />
um Konfliktfelder<br />
24.-30. Oktober: Voraussichtlich:<br />
Exkursion nach Messina (Italien)<br />
16./17. November:: Neue Entwicklungen<br />
im Ausländer- und Flüchtlingsrecht<br />
06/07. Dezember: Qualitätsentwicklung<br />
in der interkulturellen Jugendarbeit<br />
Weitere Informationen sind zu erhalten<br />
bei: Zentrum für wissenschaftliche<br />
Weiterbildung Johannes Gutenberg-Universität<br />
Mainz, Tel.: 0 61<br />
31 / 39-22901 oder -26241<br />
zww@verwaltung.uni-mainz.de<br />
www.zww.uni-mainz.de<br />
pm<br />
wie Beurteilung, Eltern-Lehrer-Beziehung<br />
oder Gewalt und nicht zuletzt<br />
um die Teamfähigkeit. - Die<br />
dritte Etappe beinhaltet so aktuelle<br />
Stichworte wie Bildungsstandards,<br />
Schulprogramm oder Unterrichtsentwicklung,<br />
aber auch traditionelle<br />
wie Merkmale guten Unterrichts,<br />
Unterrichtsplanung, Konzentrationsförderung<br />
und Methodik. Der<br />
letzte Schritt widmet sich - natürlich<br />
nicht ohne Absicht - den Grenzen<br />
der Schule.<br />
„99 Schritte zum professionellen<br />
Lehrer“ ist ein abwechslungsreiches,<br />
dank zahlreicher Fallbeispiele und<br />
Zitate manchmal amüsantes und vor<br />
allem anschaulich-verständlich geschriebenes<br />
Buch. Kein anderer<br />
Fachautor vermag unterrichtswissenschaftliche<br />
Theorie so praktisch und<br />
schulpraktische Phänomene so wissenschaftlich<br />
fundiert darzustellen<br />
wie Reinhold Miller. Seine Erkenntnis<br />
im Schlusswort dieser „pädagogischen<br />
Memoiren“ lautet: „Wir<br />
kommen nie an: Die Schule ist ein<br />
lebenslanges Lernfeld“ (S. 224). Das<br />
erinnert mich wieder an die alten<br />
Chinesen, denn wie hatte Laotse gesagt?<br />
Richtig: „Der Weg ist das Ziel.“<br />
Detlef Träbert<br />
Reinhold Miller: 99 Schritte zum<br />
professionellen Lehrer. Erfahrungen<br />
- Impulse - Empfehlungen, Seelze<br />
(Kallmeyer) 2004, 227 S. + CD-<br />
ROM, Euro 19,90<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 / 2005
Bezirk Trier<br />
Backes bleibt Vorsitzender des BV Trier<br />
In der Mitgliederversammlung des <strong>GEW</strong>-Bezirksverbandes Trier<br />
wurde Roman Backes erneut zum Vorsitzenden gewählt. Der Vorsitzende<br />
der <strong>GEW</strong> Rheinland-Pfalz, Tilman Boehlkau, befasste<br />
sich in einem Grundsatzreferat insbesondere mit der strukturellen<br />
Ungerechtigkeit unseres Schulsystems.<br />
Roman Backes eröffnete die Versammlung und freute sich besonders,<br />
unter den Anwesenden den ADD Präsidenten Dr. Josef Peter<br />
Mertes, den <strong>GEW</strong> Landesvorsitzenden Tilmann Boehlkau und<br />
den Regionalvorsitzenden des DGB, Karl Heinz Päulgen, begrüßen<br />
zu können. In seinem Grußwort hob Päulgen die gute Zusammenarbeit<br />
zwischen DGB und <strong>GEW</strong> hervor, indem er auf einige<br />
gemeinsame Projekte hinwies.<br />
Tilman Boehlkau ging in seinem Referat auf den besorgniserregenden<br />
Befund der OECD Studien ein, der besagt, dass in keinem<br />
vergleichbaren Land der Schulerfolg so eng an soziale Herkunft<br />
gekoppelt ist wie in Deutschland. Daraus ergebe sich die<br />
Notwendigkeit einer sachlichen Diskussion unserer Schulstruktur.<br />
Ziel sei es, eine Schule zu schaffen, „die alle mitnimmt“.<br />
Dabei gehe es nicht um „Einheitsschule“, sondern um eine längere<br />
gemeinsame Schulzeit, in der alle Kinder ihren Voraussetzungen<br />
entsprechend gefördert und gefordert werden können. Bündnispartner<br />
für eine Veränderung der Schulstrukturen sieht Boehlkau<br />
nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft und<br />
der Elternschaft. In Gesprächen mit Vertretern des Landeselterbeirats<br />
sei er bezüglich der Schaffung einer Schule für alle auf große<br />
Offenheit gestoßen.<br />
Nach einer längeren Aussprache zu Tilman Boehlkaus Vortrag berichtete<br />
Roman Backes über seine Tätigkeit als <strong>GEW</strong> Vorsitzender<br />
des Bezirks der vergangenen drei Jahre. Er bedankte sich besonders<br />
bei den aktiven Mitgliedern für ihre Unterstützung. Kritisch<br />
äußerte er sich zu den Vergleichstests an Grundschulen und<br />
zum rheinland-pfälzischen Abiturtermin, der im März liegt, die<br />
meisten Studiengänge aber erst im Herbst beginnen. Als besonders<br />
erfreuliche Tatsache erwähnte Backes die stark gestiegene<br />
Mitgliederzahl des Bezirkverbandes. Sie liege derzeit bei etwa 700,<br />
eine Größenordnung, bei der man doch ernsthaft über die baldige<br />
Einrichtung eines Regionalbüros in Trier nachdenken müsse.<br />
Anschließend wurde Roman Backes mit großer Mehrheit erneut<br />
zum Vorsitzenden des Bezirksverbandes gewählt. Dem geschäftsführenden<br />
Vorstand gehören Erni Schaaf-Peitz, Peter Heisig und<br />
Christian Gerteis an. Weitere Mitglieder des Vorstands sind: Theresia<br />
Görgen, Eckard Wiendl, Werner Grasediek, Henny Weber<br />
(Schriftführerin), Paul Volkensfeld (Rechner) und Hajo Arend<br />
(Pressereferent).<br />
Hajo Arend<br />
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 /2005<br />
Kreis + Region<br />
Bezirk Koblenz/Kreis Koblenz-Mayen<br />
Für die Zukunft lernen -<br />
Fördern und Fordern im Schulalltag<br />
Referent: Dr. Heinz Klippert, EFWI-Landau<br />
Durch Vortrag, Film und Diskussion erhalten die TeilnehmerInnen<br />
Einblick in die praktische Umsetzung der Klippertschen Lehrund<br />
Lernmethoden.<br />
Donnerstag, 10. März 2005, 15.00 - 18.30 Uhr<br />
Universität Koblenz-Landau<br />
Campus Koblenz-Metternich<br />
Raum MD 028<br />
Die Veranstaltung richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer aller<br />
Schularten und sonstige Interessierte. Die Teilnahme ist für <strong>GEW</strong>-<br />
Mitglieder kostenlos. Andere 5,00 Euro.<br />
Anmeldung unbedingt erforderlich:<br />
<strong>GEW</strong>-Regionalbüro Nord, Hohenzollernstr. 64, 56058 Koblenz,<br />
Tel.: 0261/1332880, Fax: 0261/1332881 email:gew-nord@gewrheinland-pfalz.de<br />
Eine Bitte der Redaktion:<br />
Die Redaktion der <strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> bittet bei Übermittlung von umfangreicheren<br />
Dateien unbedingt um Zusendung einer gebrannten<br />
CD, auf der neben dem Textbeitrag (bitte .doc oder .txt-Datei ohne<br />
eingebundene Bilddaten) die zu verwendenden Fotos, Illustrationen<br />
etc. separat im tif-, eps- oder jpg-Format abgespeichert sind.<br />
Vielen Dank!<br />
Wurde Ihr Haus vor 1984 gebaut?<br />
Dann sind Sie sicher schon vorausschauend darauf gekommen, dass das Eine oder Andere ohnehin<br />
renoviert werden muß!<br />
Warum also nicht eine Gesamtbetrachtung über Renovierungskosten und Zuschüsse, Baumängel,<br />
Energieeinsparung, Kostenersparnis mit KfW-Krediten und Ökologie in Form eines staatlich<br />
subventionierten Vor-Ort-Gutachtens machen lassen?<br />
Das kostet z.B. 450 € + MWSt. und wird mit 300 € bezuschußt!<br />
Später, nach der Renovierung, kann Ihr Haus zertifiziert und wertgesichert werden: Das kann bis<br />
zu einer künstlerisch gestalteten neuen Hausnummer mit dem Zeichen der neuen Energie-<br />
Effizienz-Klasse gehen.<br />
Machen Sie einen Termin mit dem Energie- und Baukonstruktionsgutachter mit über<br />
20-jähriger Erfahrung, bestellt vom Wirtschaftsministerium des Bundes (BMWi):<br />
»BAUEN + FORSCHEN«<br />
Dipl.-Ing. (FH) Architekt WOLF HOFFMANN<br />
Sauerbrunnenpfad 32 · 67433 Neustadt/Weinstr.<br />
Tel. 0 63 21 - 3 43 42 · Fax 0 63 21 - 3 36 23<br />
Studienreisen / Klassenfahrten<br />
8-Tage-Busreise z.B. nach<br />
WIEN ÜF 192,-- €<br />
BUDAPEST ÜF 192,-- €<br />
LONDON ÜF 254,-- €<br />
PRAG ÜF 199,-- €<br />
PARIS ÜF 224,-- €<br />
ROM ÜF 238,-- €<br />
10-Tage-Busreise z.B. nach<br />
SÜDENGLAND Ü 213,-- €<br />
TOSKANA Ü 202,-- €<br />
SÜDFRANKREICH Ü 230,-- €<br />
(Unterbringung in<br />
Selbstversorgerunterkünften)<br />
Alle Ausflugsfahrten inklusive.<br />
Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele (z.B. Ferienparks<br />
in den Niederlanden oder Belgien) auf Anfrage möglich!<br />
REISEBÜRO KRAUSE GMBH · MÜNSTERSTR. 55a · 44534 LÜNEN<br />
Tel: 0 23 06/7 57 55-0 · Fax: 0 23 06/7 57 55-49 · E-mail: info@rsb-krause.de<br />
www.rsb-krause.de<br />
27
<strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz<br />
Beilage zur E&W<br />
Anzeige<br />
28<br />
� Hiermit bestelle ich<br />
__ Expl. Akt. Gesamtwerk mit Spezialordner<br />
"Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer"<br />
(incl. 5. Aktualisierungslieferung)<br />
<strong>GEW</strong>-Mitgliedspreis E 23,regulärer<br />
Preis E 32,-<br />
Gleichzeitig bestelle ich hiermit die voraussichtlich im<br />
Herbst 2005 erscheinende 6. Aktualisierungslieferung.<br />
ANTWORT<br />
<strong>GEW</strong> Rheinland-Pfalz<br />
Neubrunnenstr. 8<br />
55116 Mainz<br />
Neuauflage<br />
Handbuch für Lehrerinnen<br />
und Lehrer<br />
Handbuch<br />
für<br />
Lehrerinnen<br />
und Lehrer<br />
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft<br />
Rheinland-Pfalz<br />
<strong>GEW</strong>-Handbuch<br />
auf neuestem Stand<br />
Gesamtwerk mit ca. 1200 Seiten<br />
ISBN: 3-927316-21-0<br />
Das Nachschlagewerk "Handbuch<br />
für Lehrerinnen und Lehrer" hat<br />
sich in den vergangenen Jahren als<br />
große Hilfe für die tägliche Arbeit im<br />
Schulbereich erwiesen.<br />
<strong>GEW</strong> Rheinland-Pfalz<br />
Neubrunnenstraße 8 · 55116 Mainz<br />
Telefon: 06131-28988-0 • FAX 06131-28988- 80<br />
E-mail: <strong>GEW</strong>@<strong>GEW</strong>-Rheinland-Pfalz.de<br />
Aus dem Inhalt (über 100 Fachabteilungen):<br />
Abiturprüfungsordnung AIDS-Aufklärung im Schulunterricht, AIDS-Fachkräfte in den<br />
Schulen, Aufsicht in Schulen, Berufliches Gymnasium, Berufsfachschulverordnung,<br />
Berufsschulverordnung, Betriebspraktikum, Bewertung der Rechtschreib- und<br />
Zeichensetzungsleistungen, Dienstliche Beurteilung von Lehrern, Dienstliche<br />
Beurteilung der staatlichen Lehrkräfte an Schulen und Studienseminaren,<br />
Dienstordnung, Durchführung der integrierten Fördermaßnahmen, Erkundungen und<br />
Praktika an allgemeinbildenden Schulen, Erprobungszeit im Schulbereich, Ersatz von<br />
Sachschäden, Europa im Unterricht, Fachlehrer mit beratenden Aufgaben,<br />
Fachoberschulverordnung, Ferienordnung, Ferientermine, Förderung von Kindern mit<br />
Lernschwierigkeiten Friedenserziehung in der Schule, Ganztagsschulen, Hitzefrei,<br />
Integrierte Gesamtschulen (LVO), Internet an Schulen, Klassenarbeiten, Klassenbildung<br />
für die Klassenstufen 5 – 10, Klassenbildung und Lehrerversorgung an<br />
Sonderschulen, Klassenelternversammlung/Schulelternbeirat, Klassen- und Kursbildung<br />
- Berufsbildende Schulen, Konferenzordnung, Landesbeamtengesetz<br />
(Auszug), Laufbahnverordnung (Auszug), Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung, Mainzer<br />
Studienstufe, Mehrarbeit im Schuldienst, Menschenrechtserziehung, Misshandlung<br />
und sexueller Missbrauch von Mädchen und Jungen, Mitwirkung von Fachleuten aus<br />
der Praxis, Mutterschutzverordnung, Nachprüfung – Hinweise zur Durchführung,<br />
Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe, Nutzung von Sendungen der Rundfunkund<br />
Fernsehanstalten, Oberstufe – Berufswahlvorbereitung, Pädagogischer Freiraum,<br />
Personalaktenführung, Rechtsunterricht an Schulen, Regelstundenmaße, Regionale<br />
Schulen (LVO), Reisekostenerstattung, Schlüsselausgabe, Schulgesetz, Schulkindergarten,<br />
Schulordnungen, Schulwahlordnung, Schulwanderungen, Schülervertretungen,<br />
Schülerzeitung, Schwimmen und Baden bei Schulver-anstaltungen,<br />
Sportförderunterricht, Stundentafeln, Sucht- und Drogenprävention in der Schule,<br />
Suchtvorbeugung, Tätigkeit und Arbeitszeit der pädagogischen Fachkräfte an<br />
Sonderschulen, Teilzeit, Teilzeitbeschäftigung, Teilzeitlehrkräfte, Überlassung von<br />
Anschriften, Unfallfürsorge, Unterricht der Kinder ausländischer Arbeitnehmer,<br />
Unterrichtsorganisation, Urlaub zur Betreuung eines erkrankten Kindes, Urlaubsverordnung,<br />
Verkehrserziehung in den Schulen, Radfahrerausbildung, Widerstand in<br />
der NS-Zeit, Winterliche Straßenverhältnisse, Zusammenarbeit Kindergarten und<br />
Grundschule, Zusammenarbeit Schule und Berufsberatung<br />
Bestellschein<br />
� Hiermit bestelle ich<br />
__ Expl. 5. Aktualisierungslieferung<br />
"Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer",<br />
ca. 304 Seiten,<br />
<strong>GEW</strong>-Mitgliedspreis E 26,10<br />
regulärer Preis E 34,80<br />
Für Fensterumschlag vorbereitet oder<br />
per Fax an: 06131-2898880 <strong>GEW</strong>-<strong>Zeitung</strong> Rheinland-Pfalz 1-2 / 2005<br />
per e-mail an: <strong>GEW</strong>@<strong>GEW</strong>-Rheinland-Pfalz.de