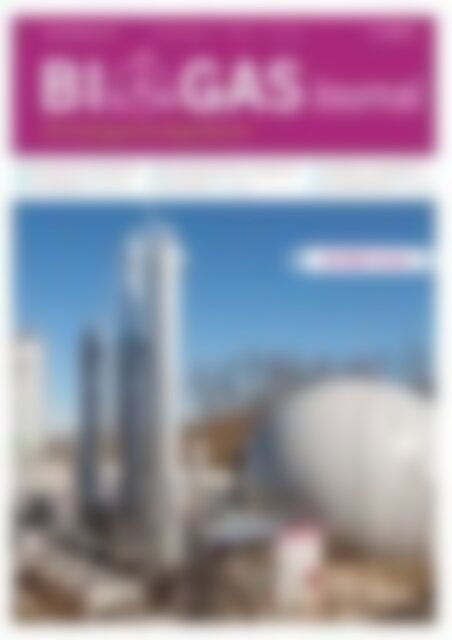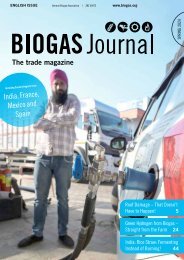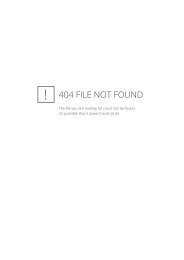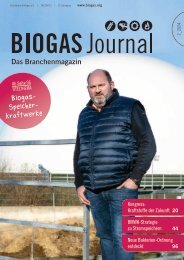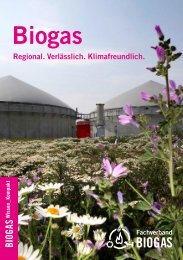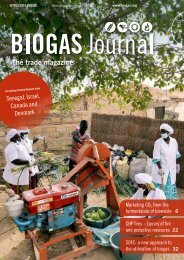3_2019 Leseprobe
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
www.biogas.org Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 50073 | 22. Jahrgang<br />
3_<strong>2019</strong><br />
Bi<br />
GaS Journal<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche<br />
Papierfabrik: Biomethan<br />
aus Abwasser S. 46<br />
Bio-Kondensatoren: Supercaps<br />
aus Gärrest S. 66<br />
Frankreich: Biomethan<br />
aus Kundensicht S. 78<br />
Biomethan
Inhalt<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Alles aus einer Hand -<br />
Ihren Anforderungen entsprechend!<br />
Adsorber<br />
Produktion<br />
Flachbett- &<br />
Schüttbettadsorber<br />
auf Basis<br />
nachwachsender<br />
Rohstoffe<br />
Kunststoff &<br />
Edelstahl<br />
Aktivkohle-Wechsel<br />
kurze<br />
Reaktionszeit<br />
Entsorgung<br />
inkl. Nachweis<br />
kurze Lieferzeiten<br />
flexible<br />
Liefermengen<br />
Logistik<br />
Auslegung inkl.<br />
Standzeitberechnung<br />
Optimierungsberatung<br />
Qualitätskontrolle<br />
Service<br />
Labor<br />
Beladungsuntersuchung<br />
Natürlich besser!<br />
• Dotierte Aktivkohle<br />
zur Entschwefelung &<br />
Reinigung von technischen<br />
Gasen<br />
• entfernt zusätzlich in<br />
einem Schritt Siloxane,<br />
VOC´s und Mercaptane<br />
• hergestellt in Deutschland<br />
• lange Standzeiten, weniger<br />
Wechsel<br />
Sparen Sie Kohle und sichern Sie sich ihr Angebot!<br />
AdFiS products GmbH<br />
Am Kellerholz 14<br />
2<br />
D-17166 Teterow<br />
Telefon: +49 (0) 3996 15 97-0<br />
Fax: +49 (0) 3996 15 97-99<br />
E-Mail: sales@adfis.de<br />
web: www.adfis.de
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Editorial<br />
Wo bleibt die<br />
Biogasstrategie der<br />
Bundesregierung?<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
sowohl in Brüssel als auch in Berlin stehen alle Zeichen<br />
auf eine neue Klimaschutzpolitik mit dem klaren<br />
Ziel der Treibhausgaseinsparung. Der gesellschaftliche<br />
Druck, nicht zuletzt auch aus der Jugend heraus forciert,<br />
zwingt die Politik zum Handeln. Das spüren wir<br />
mehr und mehr in unseren Gesprächen mit den politischen<br />
Vertretern.<br />
Endlich wird Biogas nicht nur auf die reine Energieproduktion<br />
degradiert, sondern seine multifunktionale Rolle,<br />
insbesondere in der Landwirtschaft, in das richtige<br />
Licht gerückt. Dieser Rückenwind aus den Ländern und<br />
von den Parlamentariern macht Mut für die notwendige<br />
Weiterentwicklung der Biogasbranche.<br />
Sicherlich werden wir unsere Anlagen und die Einsatzstoffe<br />
an neue Kriterien wie Effizienz, Artenvielfalt,<br />
Klimawandel und Nachhaltigkeit weiter anpassen<br />
müssen. Es reicht an dieser Stelle aber nicht, nur Ziele<br />
und Szenarien für die Zukunft zu verkünden, sondern<br />
es muss auch eine branchenspezifische und ministeriumsübergreifende<br />
Strategie zur Erreichung dieser Ziele<br />
entwickelt werden. Eine solche Biogas-Strategie der<br />
Bundesregierung muss jetzt kommen!<br />
Zahlreiche bestehende Anlagen erreichen in den nächsten<br />
Jahren das Ende ihrer ersten Vergütungslaufzeit<br />
und überlegen gerade sehr genau, ob sie angesichts<br />
der zahllosen Hürden und ständig steigenden Auflagen<br />
ihre mühsam abgeschriebenen Biogasanlagen zurückbauen.<br />
Wir müssen endlich wegkommen von halbfertigen,<br />
der Zeitnot geschuldeten Gesetzeskrücken, die<br />
den speziellen Ansprüchen von Biogasanlagen nicht<br />
gerecht werden. An dieser Stelle ist die Politik in der<br />
Pflicht, wenn sie die Biogasbranche als Schlüsseltechnologie<br />
für die Erreichung der Klimaschutzziele einsetzen<br />
will.<br />
Es macht keinen Sinn, willkürliche und unter fragwürdigen<br />
Bedingungen entstehende Auflagen, wie in der<br />
TRAS 120 oder bei der AwSV im Bereich des Betonbehälterbaus,<br />
der Branche aufs Auge zu drücken. Den<br />
jeweiligen Fachbehörden mag zwar jedes Detail wichtig<br />
sein, aber im Sinne einer zukunftsfähigen Biogasstrategie<br />
und unter Beachtung der anstehenden Herausforderungen<br />
beim Klimaschutz müssen Kompromisse<br />
gefunden werden, die eine Weiterentwicklung der Branche<br />
noch zulassen.<br />
Wie so oft gleiten wir in Deutschland in Detaildiskussionen<br />
ab und verlieren das „große Ganze“ aus den Augen.<br />
An dieser Stelle muss die Politik den Mut entwickeln,<br />
die Herausforderungen rechtzeitig und richtig anzupacken.<br />
Biogas kann seinen Beitrag in vielfältigster Form<br />
leisten. Einige Beispiele im Bereich der Einspeisung<br />
von Biomethan oder der „Flexibilisierung“ sind in dieser<br />
Ausgabe des Biogas Journals zu finden.<br />
Die Branche steht jetzt bereit, eine wesentliche Rolle<br />
bei den anstehenden Aufgaben zu übernehmen. Wir<br />
werden aus diesem Grund auch in den nächsten Wochen<br />
verstärkt öffentlichkeitswirksam darstellen, welchen<br />
Beitrag wir als Branche und jeder einzelne in der<br />
Branche Aktive bereits jetzt leistet.<br />
Herzlichst Ihr<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk,<br />
Geschäftsführer des Fachverbandes Biogas e.V.<br />
3
Inhalt<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Titelthema<br />
Biomethan<br />
26 Kleiner Anlagenzubau im Jahr 2018<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
26<br />
30 Biomethan auf die Straße bringen –<br />
Marktanreize und Fördermechanismen<br />
Von Dipl.-Ing. Alexey Mozgovoy<br />
Editorial<br />
POLITIK<br />
WISSENSCHAFT<br />
3 Wo bleibt die Biogasstrategie<br />
der Bundesregierung?<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk,<br />
Geschäftsführer des<br />
Fachverbandes Biogas e.V.<br />
AKTUELLES<br />
6 Meldungen<br />
8 Bücher & Termine<br />
12 Stoffkreisläufe für mehr Klimaschutz<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
16 Landwirtschaftliche Produktivität<br />
gesteigert ohne Zunahme der Klimagasemissionen<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
20 Regionale Vermarktung im Fokus<br />
des Pooltreffens BSN<br />
Von M.Sc. Georg Friedl und Rainer Weng<br />
22 Artenschutz geht uns alle an<br />
Von Dipl.-Ing. agr. Andrea Horbelt<br />
24 Klimaschutzgesetz<br />
Zerreißprobe für die Politik und<br />
Hoffnungsträger für die Erneuerbaren<br />
Von Sandra Rostek<br />
und Dr. Guido Ehrhardt<br />
PRAXIS<br />
34 Interview<br />
Durchwachsene Silphie – Anbau<br />
sachlich planen<br />
Interviewer: Dipl.-Ing. agr. (FH)<br />
Martin Bensmann<br />
36 Checkliste Silphieanbau<br />
Von Dennis Schiele<br />
38 Flexibel Strom produzieren und die<br />
Wärme zu 100 Prozent nutzen<br />
Von Thomas Gaul<br />
42 Messen, was drin ist<br />
Von Steffen Bach<br />
46 Biogas aus dem Pelletsschlamm<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
52 Zuckerrübe: vielversprechendes<br />
Spitzenlastsubstrat<br />
Von M.Sc. Biol. Kerstin Maurus, Dr. Sharif<br />
Ahmed und Prof. Dr. Marian Kazda<br />
58 Mehr Flexibilität mit vorhandenem<br />
Gasspeicher möglich<br />
Von Dipl.-Ing. · Dipl. Journ. Martina Bräsel<br />
62 Konversion von Biomasse zu Wasserstoff<br />
und Methan<br />
Von Robert Manig, Denise Münch,<br />
Jürgen Tenbrink, Jörg-Uwe Ackermann<br />
und Hartmut Krause<br />
66 Bio-Supercaps aus Gärresten<br />
Von Dipl.-Ing. · Dipl. Journ. Martina Bräsel<br />
4
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Inhalt<br />
titelFoto: Carmen Rudolph i Fotos: HZI BioMethan GmbH, Carmen Rudolph, Martina Bräsel<br />
46 58<br />
INTERNATIONAL<br />
Europa<br />
70 LNG: Ein globales Pokerspiel um<br />
Zukunftspositionen ist im Gange<br />
Von Eur. Ing. Marie-Luise Schaller<br />
Frankreich<br />
78 Biomethanprodukte – Privatverbraucher<br />
sind noch wenig informiert<br />
Von Prof. Dr. Carsten Herbes<br />
VERBAND<br />
Aus der Geschäftsstelle<br />
82 Biogas – Quo vadis?<br />
Von Dr. Stefan Rauh und<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
86 Aus den Regionalbüros<br />
88 Firmen diskutierten über die Zukunft<br />
von Biogas in Deutschland<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
90 Mischpreisverfahren<br />
Von Dr. Simone Peter, BEE<br />
RECHT<br />
92 Energetisches Quartierskonzept bringt<br />
Biogasanlagenbetreiber und Bürger<br />
zusammen<br />
Von Gerrit Müller-Rüster<br />
95 Interview<br />
TRAS-Regeln bilden Anhaltspunkte für<br />
behördliche Entscheidungen<br />
Interviewer: Dipl.-Ing. agr. (FH)<br />
Martin Bensmann<br />
98 Voten zum Landschaftspflege-Bonus und<br />
zur Vergütungsverringerung bei Meldeverstößen<br />
veröffentlicht<br />
Von Beatrice Brunner und Elena Richter<br />
Beilagenhinweis:<br />
Das Biogas Journal enthält Beilagen<br />
der Firmen 2G, agrikomp, greentec,<br />
BEEREPOOT & VOSKAMP, SaM-Power und<br />
UNION Instruments.<br />
produktnews<br />
100 Produktnews<br />
102 Impressum<br />
5
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Getreidestroh-Silagen für<br />
Biogasanlagen geeignet<br />
Foto: www.landpixel.eu<br />
Zukunftsenergien<br />
Münsterland<br />
„Für die Energiewende bieten wir erstmalig eine<br />
gemeinsame Plattform,“ verkündet Thomas Voß<br />
vom Regionalverband Münsterland im Landesverband<br />
Erneuerbare Energie NRW.<br />
Am 13. Juni <strong>2019</strong> findet von 9.00 Uhr bis 22.00<br />
Uhr der 1. Tag der Zukunftsenergien in Heiden in<br />
der Westmünsterlandhalle statt. Fachprogramm,<br />
Messe und Podium – neben Anlagenbetreibern<br />
finden auch Unternehmen und kommunale Vertreter<br />
informative Angebote. Ab 16.00 Uhr ist der<br />
Eintritt zur Veranstaltung frei. Weitere Infos unter<br />
msl.lee-nrw.de<br />
Gülzow/Soest – Stroh, zum Beispiel von Weizen, Gerste<br />
oder Mais, lässt sich durch Silierung so aufschließen,<br />
dass es in Biogasanlagen zügig vergoren wird. Als<br />
Co-Substrat vereinfacht es zudem die Silierung von<br />
Zuckerrüben und anderen energiereichen Rohstoffen<br />
mit hohen Wasseranteilen. Die Gaserträge solcher<br />
Mischsilagen reichen an Silomais heran, wie Forscher<br />
der Fachhochschule Südwestfalen am Fachbereich Agrarwirtschaft<br />
in Soest herausfanden. Gefördert wurden<br />
sie dabei vom Bundesministerium für Ernährung und<br />
Landwirtschaft.<br />
Getreidestroh fällt als landwirtschaftliches Koppelprodukt<br />
in großen Mengen an. Hiervon könnten jährlich<br />
rund 10 Millionen Tonnen<br />
energetisch genutzt werden,<br />
ohne die Humusbilanzen<br />
der landwirtschaftlichen<br />
Flächen und den Bedarf<br />
an Einstreu zu beeinträchtigen.<br />
Die Gaserträge von<br />
Stroh reichen zwar nicht an<br />
den als Standard geltenden<br />
Silomais heran, allerdings<br />
bindet Stroh als Koppelprodukt<br />
der Getreideproduktion<br />
auch keine zusätzlichen<br />
landwirtschaftlichen<br />
Flächen und kann zudem<br />
einzelbetrieblich helfen,<br />
den im EEG eingeführten<br />
Maisdeckel einzuhalten.<br />
Für Biogasanlagen ist Stroh<br />
zunächst jedoch nur bedingt geeignet: Seine lignocellulosereichen<br />
Komponenten und die wasserabweisenden<br />
Oberflächen der Halme erschweren und verlangsamen<br />
die Abbau- und Gasbildungsprozesse, was vorgeschaltete<br />
Aufschlussverfahren jedoch teilweise kompensieren<br />
können. So lässt sich Stroh neben chemischem<br />
oder physikalischem Aufschluss auch durch Silierung<br />
so vorbehandeln, dass eine Umsetzung im Biogasreaktor<br />
zügig erfolgt. Das konnten die Forscher von der FH<br />
Südwestfalen ausführlich und mit verschiedenen Stroharten<br />
belegen.<br />
Um die Gaserträge der Strohsilagen zu verbessern, führten<br />
sie auch Versuche zur Mischsilierung von Stroh mit<br />
Zuckerrübenschnitzeln sowie nassen Koppelprodukten<br />
wie Zwischenfrüchten und Rübenblatt durch. Hier zeigt<br />
sich, dass Stroh die gemeinsame Silage mit Rohstoffen<br />
mit niedrigen Trockensubstanz-Gehalten ermöglicht<br />
und dabei deren Lagerverluste minimiert. Silagen, die<br />
etwa zur Hälfte aus Maisstroh und aus Zuckerrübenschnitzeln<br />
bestanden, erreichten bei den Gaserträgen<br />
etwa das Niveau von Mais-GPS.<br />
Die Ergebnisse sind vor allem für Biogasanlagen-Betreiber<br />
relevant, die verstärkt auf Koppelprodukte im<br />
Substratmix setzen. Übertragbar ist das Verfahren zudem<br />
auch auf Reststoffe wie Pferdemist, für die sich in<br />
Abhängigkeit von den regionalen Aufkommen durchaus<br />
auch eine wirtschaftliche Attraktivität darstellen lässt.<br />
Der Abschlussbericht zum Projekt „Biomasseaufwertung<br />
und Silierung lignocellulosereicher Koppelprodukte<br />
zur Optimierung der Methanausbeute“ steht in<br />
der Projektdatenbank der FNR unter dem Förderkennzeichen<br />
22400715 zur Verfügung.<br />
6
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Aktuelles<br />
EuGH bestätigt: EEG keine staatliche Beihilfe<br />
Berlin – Der Europäische Gerichtshof<br />
(EuGH) hat Ende März per Urteil bestätigt:<br />
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)<br />
2012 war keine Beihilfe. Der Bundesverband<br />
Erneuerbare Energie e.V.<br />
(BEE) begrüßt das EuGH-Urteil. „Es<br />
ist eine klare und deutliche Entscheidung<br />
des obersten Europäischen<br />
Gerichts“, sagte Dr. Simone Peter,<br />
Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare<br />
Energie (BEE), zu dieser<br />
positiven Nachricht. Das sei wegweisend<br />
für die Weiterentwicklung der<br />
Fördersystematik und gebe der Branche<br />
nach jahrelangem Tauziehen<br />
Rechtssicherheit. „Aus dem Urteil<br />
des EuGH folgt, dass die Beihilfeleitlinien<br />
der Europäischen Kommission<br />
auf das EEG keine Anwendung<br />
finden. Der deutsche Gesetzgeber hat dadurch<br />
wieder deutlich mehr Handlungsspielräume“,<br />
äußerte Peter weiter.<br />
Nun müsse alles auf den Prüfstand, was<br />
auf Druck der EU-Kommission in das EEG<br />
aufgenommen wurde und mehr Nachteile<br />
als Vorteile bringt, dazu gehörten unter<br />
anderem die Vorschriften zur Nicht-Vergütung<br />
bei negativen Strompreisen. Auch<br />
die Ausschreibungsregelungen müsse man<br />
Foto: www.landpixel.eu<br />
sich genauer anschauen. Bei der Analyse<br />
gelte es, auch die neuen EU-Rahmenbedingungen<br />
insbesondere der Erneuerbare-<br />
Laut Europäischem Gerichtshof stellt das EEG von 2012<br />
keine staatliche Beihilfe dar.<br />
Energien-Richtlinie sowie der Strommarktverordnung<br />
und Strommarktrichtlinie zu<br />
beachten.<br />
Der EuGH setzt mit seinem Urteil sowohl<br />
das Urteil des Gerichts der Europäischen<br />
Union (EuG) als auch die Entscheidung der<br />
EU-Kommission außer Kraft. In seiner Begründung<br />
führt der EuGH an, dass die Kommission<br />
nicht nachgewiesen habe, dass<br />
„die im EEG 2012 vorgesehenen Vorteile<br />
staatliche Beihilfen darstellten“. Anders<br />
als von der EU-Kommission dargestellt, ist<br />
der EuGH der Auffassung, dass über das<br />
EEG keine staatlichen Mittel zum<br />
Einsatz kamen. Der BEE hatte immer<br />
die Rechtsansicht vertreten, dass das<br />
EEG keine Beihilfe ist, und wurde<br />
nun vollumfänglich seitens des EuGH<br />
bestätigt. Damit entschied der EuGH<br />
in Kontinuität zu seinem Urteil von<br />
2001, in dem er bereits entschieden<br />
hatte, dass das Stromeinspeisungsgesetz<br />
mit seinem Umlagenmechanismus<br />
keine Beihilfe ist.<br />
Hintergrund: Die Europäische Kommission<br />
hatte im November 2014 das<br />
EEG als Beihilfe deklariert. Das Gericht<br />
der Europäischen Union (EuG)<br />
in Luxemburg hatte in erster Instanz<br />
im Mai 2016 die Sichtweise der EU-Kommission<br />
bestätigt und eine Klage der Bundesregierung<br />
gegen die EU-Kommission<br />
abgewiesen. Nach diesem Entscheid hatte<br />
die Bundesregierung wiederum Rechtsmittel<br />
eingelegt und vor dem Europäischen<br />
Gerichtshof in zweiter Instanz geklagt. Das<br />
Urteil des EuGH ist rechtlich bindend und<br />
hebt alle anderen Urteile auf, der Klageweg<br />
ist abgeschlossen.<br />
Kinovorstellung Unterrichtsfilm Erneuerbare Energien<br />
München – Der Unterrichtsfilm Erneuerbare Energien<br />
ist auf Youtube schon mehr als 12.000-mal<br />
angeschaut worden. Darüber hinaus wurden über<br />
500 DVDs an Schulen verschickt. Jetzt hatte der Film<br />
in München seine Kinopremiere. In Anwesenheit<br />
des Hauptdarstellers Georg Hackl, des Regisseurs<br />
und Verbandsvertretern der im Film vorkommenden<br />
Erneuerbaren Energien nahmen zahlreiche Lehrerinnen<br />
und Lehrer die Gelegenheit wahr, sich über das<br />
hochaktuelle Thema Klimawandel, Klimaschutz und<br />
die Erneuerbaren Energien zu informieren.<br />
Die Resonanz war durchweg positiv, als „sehr<br />
geeignet für den Unterricht“ befanden die anwesenden<br />
Pädagogen den Film. Im Anschluss an die<br />
25-minütige Vorführung stellten die Verbändevertreter<br />
sich und ihre regenerative Energieform kurz<br />
vor und erläuterten die Möglichkeiten, ihr Thema<br />
im Unterricht zu behandeln. Beim anschließenden<br />
Get Together nutzten die Lehrenden die Chance, um<br />
mit den Verbändevertretern Fragen zu<br />
ihrer individuellen Unterrichtsgestaltung<br />
in Sachen Erneuerbare Energien<br />
zu klären. Gerade vor den aktuellen<br />
Protesten der Friday for Future Kids<br />
ist der Klimaschutz wieder stark in<br />
den Fokus gerückt. Das veranlasste<br />
letztendlich auch den Bayerischen<br />
Rundfunk, in seiner Abendschau über<br />
die Filmvorführung zu berichten (BR-<br />
Mediathek, Abendschau Der Süden,<br />
am 28.02.<strong>2019</strong>).<br />
Der Film kann nach wie vor als kostenlose<br />
DVD beim Fachverband Biogas<br />
bestellt (info@bigoas.org) oder auf<br />
Youtube angeschaut und im Unterricht<br />
gezeigt werden. Der dazugehörige Test<br />
steht auf der Seite www.biogas.org unter<br />
Service / Infomaterial / Kids.<br />
Foto: Fachverband Biogas e.V.<br />
7
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Bücher<br />
Berliner Kommentar zum<br />
Energierecht<br />
EEG – Erneuerbare-Energien-Gesetz 2017 und<br />
WindSeeG – Windenergie-auf-See-Gesetz<br />
Dieser Band des Berliner<br />
Kommentars bietet<br />
eine umfassende Erläuterung<br />
des Rechts der<br />
Erneuerbaren Energien,<br />
wie es im Erneuerbare-Energien-Gesetz<br />
2017 (EEG 2017) und<br />
dem Windenergie-auf-<br />
See-Gesetz (WindSeeG) geregelt ist. Der<br />
Berliner Kommentar bearbeitet das EEG<br />
einschließlich der Änderungen durch den<br />
Gesetzgeber im Dezember 2016 sowie der<br />
Ergänzungen durch das Mieterstromgesetz.<br />
Schwerpunkt der Neubearbeitung sind die<br />
Ausschreibungsverfahren zur Bestimmung<br />
der Förderhöhe und die bessere Abstimmung<br />
des Ausbaus der EEG-Anlagen mit<br />
dem Netzausbau. Besondere Beachtung<br />
erfuhren die gesetzlichen Änderungen der<br />
Eigenversorgung. Die Förderung der Offshore-Windenergie<br />
ist in ein eigenes Gesetz<br />
ausgelagert worden. Der Kommentar trägt<br />
den aus der neuen Mengensteuerung entstehenden<br />
Rechtsproblemen mit einer umfassenden<br />
Kommentierung des WindSeeG<br />
Rechnung. Der Kommentar richtet sich an<br />
Rechtsanwälte, Energieversorgungs-Unternehmen,<br />
Unternehmen, Netzbetreiber, Gerichte,<br />
Energie- und Kartellbehörden sowie<br />
Universitäten.<br />
Deutscher Fachverlag GmbH, Frankfurt am<br />
Main. Berliner Kommentar, Band 6, 4. völlig<br />
überarbeitete und wesentlich erweiterte<br />
Auflage, 2018, 2.848 Seiten, gebunden,<br />
289 Euro. ISBN 978-3-8005-1652-0<br />
Statusreport<br />
Föderal Erneuerbar<br />
2018<br />
Die Bundesländer spielen<br />
für die Gestaltung<br />
der Energiewende in<br />
Deutschland eine wesentliche<br />
Rolle: Ob es<br />
um die Flächenausweisung für Erneuerbare<br />
Energien, den Ausbau der Strom- und<br />
Wärmenetze oder um den weiteren Umgang<br />
mit den bestehenden fossilen Kraftwerken<br />
geht, überall haben die Länder einen entscheidenden<br />
Einfluss. Die AEE-Publikation<br />
„Statusreport Föderal Erneuerbar 2018“<br />
widmet sich auf knapp 240 Seiten den<br />
jüngsten Entwicklungen der Energiewende<br />
auf Länderebene.<br />
Aktuelle Zahlen, Fakten und Infografiken<br />
sowie Interviews mit den zuständigen Ministerinnen<br />
und Ministern, energiepolitische<br />
Analysen und Best-Practice-Beispiele<br />
machen die Schwerpunkte der jeweiligen<br />
Landesregierungen bei der Energiewende<br />
deutlich.<br />
Statusreport Föderal Erneuerbar 2018, 240<br />
Seiten. Download der Teilkapitel: https://<br />
www.foederal-erneuerbar.de/bundeslaender-mit-neuer-energie-statusreport-foederal-erneuerbar-2018<br />
Die gebundene Fassung können Sie bestellen<br />
unter www.unendlich-viel-energie.de/<br />
shop<br />
Termine<br />
6. bis 9. Mai<br />
AHK-Geschäftsreise Dänemark –<br />
Wärme erzeugung mit Bioenergie<br />
Aalborg<br />
www.energiewaechter.de<br />
3. bis 6. Juni<br />
AHK-Geschäftsreise Litauen & Lettland –<br />
Eigenversorgung mit EE in der Industrie<br />
Vilnius<br />
www.energiewaechter.de<br />
24. bis 28. Juni<br />
AHK-Geschäftsreise „Hybridisierung mit<br />
Erneuerbaren Energien in Industrie und<br />
Gewerbe in Nigeria“<br />
www.german-energy-solutions.de<br />
7. bis 9. Mai<br />
Qualifizierung für zur Prüfung befähigte<br />
Personen – Modul 2<br />
Burgdorf Ehlershausen<br />
www.service-gmbh.biogas.org<br />
9. Mai<br />
ThEEN-Fachforum „Power-to-X“<br />
Erfurt<br />
www.theen-ev.de<br />
15. bis 18. Mai<br />
Qualifizierung für zur Prüfung befähigte<br />
Personen – Modul 3<br />
Burgdorf Ehlershausen<br />
www.service-gmbh.biogas.org<br />
21. bis 22. Mai<br />
12. Biogas-Innovationskongress<br />
Osnabrück<br />
www.dbu.de<br />
3. bis 7. Juni<br />
AHK-Geschäftsreise „Dezentrale Energieversorgung<br />
mit EE in Guatemala, El Salvador<br />
und Honduras“<br />
www.german-energy-solutions.de/<br />
13. Juni<br />
1. Tag der Zukunftsenergien Münsterland<br />
Heiden<br />
www.lee-nrw.de<br />
17. bis 21. Juni<br />
AHK-Geschäftsreise „Biogaslösungen<br />
für die Palmölindustrie in Malaysia“<br />
Malaysia<br />
www.german-energy-solutions.de<br />
24. bis 27. Juni<br />
Qualifizierung für Biogasanlagenbetreiber<br />
(inkl. TRGS 529)<br />
Nienburg<br />
www.klimaschutz-leb.de<br />
3. bis 4. Juli<br />
UK AD and World Biogas Expo <strong>2019</strong><br />
Birmingham, UK<br />
www.biogastradeshow.com<br />
9. bis 10. September<br />
FNR / KTBL – Biogaskongress <strong>2019</strong><br />
Leipzig<br />
www.fnr.de/biogaskongress<br />
25. und 26. September<br />
Finanzierungs- und Fördertage des<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Kaiserin-Friedrich Haus<br />
Berlin<br />
Infos beim Fachverband Biogas per<br />
Mail unter international@biogas.org<br />
Diese und weitere Termine rund um die<br />
Biogasnutzung in Deutschland und der Welt<br />
finden Sie auf der Seite www.biogas.org<br />
unter „Termine“.<br />
8
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Aktuelles<br />
Schreiber<br />
Anlagenbau<br />
Industrie | Biogas | Sondermaschinen | Klärtechnik<br />
DOSIER-MISCHERSCHNECKE 2.0<br />
mit einer Windung komplett V2A<br />
Unsere bewährte Mischerschnecke<br />
durch viel Erfahrung verbessert<br />
und weiterentwickelt<br />
durch verbesserte<br />
Geometrie der Windung,<br />
Reduzierung des Stromverbrauchs<br />
Hergestellt aus V2A – 10 mm<br />
bis Ø 2400 mm<br />
mit großer Serviceöffnung inkl. Abdeckung<br />
zwei Räumschwerter aus 15 mm V2A<br />
4 Messerhalter<br />
optional Ausräumer (rot) erhältlich<br />
ABGAS 3-WEGE KLAPPE<br />
von DN150 – DN300 lieferbar<br />
als T oder Y erhältlich<br />
komplett aus Edelstahl<br />
Fixiermöglichkeit auch auf Teilstellung<br />
optimal für<br />
Gärresttrockner<br />
sowie Sommer-/<br />
Winterbetrieb<br />
GASAUFBEREITUNG<br />
Gasaufbereitungen bereits ab 75 kW lieferbar<br />
Unsere Gasaufbereitungen können individuell auf Ihre<br />
Anforderungen/Bedarf ausgelegt & angepasst werden<br />
ABGASWÄRMETAUSCHER<br />
von DN250 – DN400 lieferbar<br />
komplett handgefertigt<br />
Sonderanfertigungen möglich<br />
Tauschrohre Ø 33,7 (auf Wunsch andere Ø möglich)<br />
hohe Tauschleistung<br />
VA FÖRDERSCHNECKE /<br />
FÖRDERSYSTEME<br />
Aktivkohlefilter in Edelstahl mit 1,6 m³ Volumen<br />
(passend für ein Big Pack 500 kg)<br />
Gaskühler und Erwärmung in Edelstahl mit 91 Tauschrohren<br />
& einem Durchmesser von 300 mm<br />
Beruhigungszone mit verbesserter Oberfläche für<br />
eine optimale Kondensierung<br />
Kälteaggregat mit erhöhtem Speichertank und<br />
intelligenter Steuerung<br />
Grundgestell und komplette Verrohrung der Komponenten<br />
schlüsselfertige Auslieferung für eine schnelle Montage<br />
für alle gängigen Hersteller<br />
Sondermaße schnell produziert<br />
erhöhte Standzeit durch hohe Materialstärke<br />
optional mit Hartauftrag aufgeschweißt<br />
komplette Fördersysteme<br />
9<br />
Gasaufbereitung | Substrataufbereitung | Separation | Trocknungsanlagen | Instandsetzungen | Sonderanfertigung<br />
Tel.: 07305 95 61 501 | info@schreiber-anlagenbau.de | www.schreiber-anlagenbau.de
Aktuelles<br />
BIOGAS-KIDS<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Biogas heute und morgen<br />
iStock<br />
Seit über 20 Jahren gibt es die Biogastechnik, wie du sie<br />
kennst. Weit über 9.000 Anlagen sorgen inzwischen in<br />
ganz Deutschland für klimafreundliche Energie. Viele<br />
kluge Köpfe haben dafür Technik und Konzepte neu und<br />
weiterentwickelt. Und noch viel mehr Menschen nutzen<br />
diese Technik, warten und reparieren sie und sammeln<br />
viel Erfahrung dabei. Damit entsteht ein riesiger Wissensschatz,<br />
der hilft, die Zukunft zu bewältigen. Denn wie<br />
bei anderen Technologien müssen auch beim Biogas das<br />
Bisherige überdacht und Änderungen vorgenommen werden.<br />
Experten machen sich deshalb schon jetzt Gedanken<br />
darüber, wie sie sich die Biogaserzeugung der Zukunft vorstellen.<br />
Das gilt zum Beispiel für die Technik im Fermenter.<br />
Die meisten Anlagen arbeiten bisher mit großen Rührwerken,<br />
die dafür sorgen, dass das Futter für die Biogasbakterien<br />
immer schön gemischt wird. In Zukunft ist jedoch<br />
damit zu rechnen, dass immer mehr schwer vergärbare<br />
Reststoffe wie Festmist, Grünschnitt oder auch Essensreste<br />
in den Fermentern verarbeitet werden. Technik und<br />
Steuerung müssen damit ebenso klarkommen wie die Mikroorganismen,<br />
die davon leben. Auch über sie wissen wir<br />
noch viel zu wenig: Etwa 2.000 verschiedene Arten dieser<br />
winzigen Tierchen helfen, Biogas und andere wertvolle<br />
Reststoffe zu erzeugen. Aber tatsächlich haben wir nur<br />
sehr wenig Ahnung davon, was sie genau tun. Sie besser<br />
… wenn der Wetterfrosch verrücktspielt<br />
April, April, der weiß nicht, was er will. Eine Bauernweisheit<br />
besagt: „Gehst du im April bei Sonne aus, lass nie den<br />
Regen schirm zu Haus“. Im April steht die Sonne schon so hoch wie<br />
im August, sie hat also reichlich Kraft. Kommt dann die Kaltluft aus<br />
dem Norden, folgt innerhalb einer Stunde auf blauen Himmel kräftiger<br />
Regen, dem wieder Sonne folgt. Das passiert mehrmals am Tag<br />
und ist typisches Aprilwetter. In der Sonne ist es angenehm warm,<br />
die Schauer sind ungemütlich und kalt. Das kommt von der unterschiedlich<br />
schnellen Erwärmung des Kontinents und des Ozeans.<br />
So können nach einer frühsommerlich warmen Woche nochmals<br />
Graupel schauer und Nachtfrost folgen.<br />
iStock<br />
zu verstehen bedeutet auch, die Qualität der Produkte zu<br />
erhöhen, die am Ende aus der Anlage herauskommen. Geforscht<br />
wird auch daran, die komplizierten Abläufe in der<br />
Anlage zu automatisieren, damit es für den Betreiber einfacher<br />
wird. Dazu gehören beispielsweise Sensoren. Das<br />
sind kleine Technikbausteine, die in der Biogasanlage wie<br />
Augen, Nase und Ohren arbeiten. Sie sammeln viele Daten<br />
und geben sie an die Computersteuerung weiter. Am<br />
Bildschirm oder mit dem Smartphone kann der Bediener<br />
der Anlage diese Daten abrufen und erkennen, ob alles in<br />
Ordnung ist. Da erwarten uns bestimmt noch viele spannende<br />
Geschichten.<br />
Biogas aus bunten Wildpflanzen<br />
Viel wird zurzeit über Insekten geredet. Die Brummer und Summer<br />
sind nicht nur wichtiger Teil der Natur. Sie übernehmen auch<br />
für die Landwirtschaft unverzichtbare Aufgaben: die Bestäubung<br />
von Nutzpflanzen und viele Nützlinge machen Jagd auf andere<br />
Insekten, die ansonsten in den Kulturpflanzen Schäden anrichten.<br />
Doch dafür brauchen sie Lebensraum und Rückzugsräume. Auf<br />
bunten, artenreichen Blühflächen<br />
in der Landschaft<br />
fühlen sich Insekten und<br />
viele Kleintiere sehr wohl.<br />
Und nicht nur das. Wird ein<br />
solch bunter Mix aus vielen<br />
verschiedenen Wildpflanzen<br />
(Blühpflanzen, Kräuter,<br />
Gräser) jetzt im Frühjahr auf<br />
dem Acker ausgesät, eignet<br />
sich die Ernte im Herbst<br />
auch zur klimafreundlichen<br />
Energieerzeugung in der Biogasanlage. Zwar ist die Gasausbeute<br />
deutlich geringer als beim Mais. Aber der Anbau als Ergänzung zu<br />
anderen Kulturpflanzen macht für die Landwirtschaft in jedem Fall<br />
Sinn.<br />
Mehr zum Thema findest du hier: www.lebensraumbrache.de<br />
Knapkon<br />
www.agrarkids.de<br />
Landwirtschaft entdecken und verstehen –<br />
Die Fachzeitschrift für Kinder<br />
10
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Aktuelles<br />
ERFAHRUNG<br />
IST DIE BASIS<br />
JEDER INNOVATION<br />
Bei allem, was wir tun, verlieren wir nie aus den Augen, worum es für Sie geht:<br />
effiziente Technik und eine einfache Handhabe.<br />
Als Erfinder der elastomerbeschichteten Drehkolbenpumpe und Innovationstreiber für<br />
Einbring- und Aufbereitungstechnik sehen wir uns bei Vogelsang dem guten Ruf der deutschen<br />
Maschinenbauindustrie und ihrem Beitrag zur Energiewende verpflichtet. Seit der Gründung<br />
des Unternehmens 1929 liefern wir technische Lösungen, deren Funktionalität, Qualität<br />
und Zuverlässigkeit von unseren Kunden weltweit hoch geschätzt werden und unseren Wettbewerbern<br />
als Vorbild dienen.<br />
Unser umfassendes Know-how und die langjährige Erfahrung im Bereich Biogas nutzen<br />
wir, um unseren Kunden als kompetenter Partner zur Seite zu stehen. Mit schlagkräftiger<br />
Pump-, Zerkleinerungs-, Desintegrations- und Feststoffdosiertechnik ebenso wie mit unseren<br />
individuellen Beratungsleistungen.<br />
vogelsang.info<br />
ENGINEERED TO WORK<br />
11
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Stoffkreisläufe für mehr Klimaschutz<br />
Blick in den Dülfersaal<br />
der Technischen<br />
Universität Dresden<br />
während der Abfallvergärungstagung.<br />
Experten für die Vergärung biologisch abbaubarer Abfälle diskutierten in Dresden über<br />
den derzeitigen Stand, Rahmenbedingungen und Perspektiven der Branche.<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Die Herausforderungen im Bereich der Vergärung<br />
biologischer Abfälle – sowohl bei<br />
der Entfernung von Folien und Verpackungen<br />
aus dem Stoffstrom als auch die spezifischen<br />
Möglichkeiten der Branche bei der<br />
Sicherung einer gesellschaftlich angestrebten, stabilen<br />
Kreislaufwirtschaft – waren Gegenstand der Abfallvergärungstagung<br />
vom 11. bis 13. März in Dresden. Die<br />
ausgebuchte Fachkonferenz organisierten der Fachverband<br />
Biogas, das Forum für Abfallwirtschaft und Altlasten,<br />
die Gütegemeinschaft Gärprodukte und die Technische<br />
Universität (TU) Dresden erstmals gemeinsam.<br />
Etwa 120 Praktiker, Wissenschaftler und Behördenvertreter<br />
reisten dafür in die sächsische Landeshauptstadt.<br />
An den ersten beiden Veranstaltungstagen im<br />
Dülfersaal der TU Dresden, in dem sich auch Firmen<br />
mit ihren Produkten und Dienstleistungen präsentierten,<br />
bestimmten Fachvorträge über Praxiserfahrungen,<br />
rechtliche Neuerungen und Forschungsergebnisse sowie<br />
die sich daran anschließende Diskussion das Programm.<br />
Guten Anklang fand der Austausch in Networking-Gruppen<br />
zu Themen, die die Konferenzteilnehmer zuvor<br />
selbst bestimmten. Für den dritten Veranstaltungstag<br />
hatten die Organisatoren zwei Lehrfahrten organisiert.<br />
Sie führten zu einer Bioabfallanlage, die Inhalte der<br />
kommunalen Biotonne vergärt, und zu einem Reaktorsystem,<br />
in dem aus Resten bei der Milchverarbeitung<br />
Energie und Gärprodukte erzeugt werden.<br />
Unterschiede bei der Erfassung<br />
von Bioabfall<br />
Mehrere Referenten beleuchteten in ihren Vorträgen<br />
die derzeitigen Rahmenbedingungen für die Vergärung<br />
biogener Abfälle sowie die Ansprüche, denen sich die<br />
Akteure jetzt und zukünftig stellen müssen. Die Menge<br />
an biologisch abbaubaren Materialien, die in den Abfallbehandlungsanlagen<br />
jährlich verarbeitet wird, bezifferte<br />
Prof. Dr. Christina Dornack, Leiterin des Instituts<br />
für Abfall- und Kreislaufwirtschaft an der TU Dresden,<br />
mit 15,6 Millionen (Mio.) Tonnen (t). Davon kommen 9<br />
Mio. t aus der getrennten Erfassung von Bioabfällen und<br />
3 Mio. t aus der Lebensmittelindustrie.<br />
„Betrachtet man das erfasste Aufkommen genauer, zeigt<br />
sich bei den Flächenländern eine Trennlinie zwischen<br />
West und Ost“, verdeutlichte Dornack anhand einer<br />
Balkengrafik. Sie zeigt, dass alle ostdeutschen Länder<br />
beim Aufkommen unter dem Bundesdurchschnitt von<br />
109 Kilogramm (kg) pro Erwachsenem und Jahr liegen.<br />
Schlusslicht ist Brandenburg mit 39 kg. Zum Vergleich:<br />
Jeder erwachsene Niedersachse sammelt im statistischen<br />
Mittel jährlich 144 kg Bioabfall. Das ist fast dreimal<br />
so viel wie in Sachsen (knapp 51 kg).<br />
„In einer Biopotenzialstudie haben wir dieses Phänomen<br />
untersucht und als Hauptgründe die Faktoren<br />
Kosten und Service ausgemacht“, berichtet die Wissenschaftlerin.<br />
So seien zum einen die Restabfallgebühren<br />
in den alten Bundesländern oft deutlich höher und dadurch<br />
sei der Anreiz größer, das Angebot der Biotonne<br />
12
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Aktuelles<br />
Fotos: Carmen Rudolph<br />
Dr. Christian Abendroth, TU Dresden<br />
Prof. Dr. Christina Dornack,<br />
TU Dresden<br />
Peter Ewens, Bundesministerium für<br />
Umwelt, Naturschutz und nukleare<br />
Sicherheit<br />
Horst Seide, Fachverband Biogas e.V.<br />
zu nutzen. Zum anderen böten Kommunen im Westen<br />
ein dichteres Netz von Annahmestellen mit bürgerfreundlichen<br />
Öffnungszeiten.<br />
Vorherrschende Methode bei der Verarbeitung von Bioabfall<br />
sei noch die Kompostierung. Doch die Vergärung<br />
hole mengenmäßig auf und liege mit 6,5 Mio. t nur noch<br />
1 Mio. t hinter der Kompostierung. Dies könne jedoch<br />
nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Substratgemisch<br />
aller bundesweit mehr als 9.000 Biogasanlagen<br />
insgesamt nur zu 4,2 Prozent aus kommunalen Abfällen<br />
und zu 2,4 Prozent aus gewerblichen Reststoffen besteht.<br />
Obwohl Kompostanlagen 15 bis 80 Kilowattstunden<br />
(kWh) pro Tonne Input verbrauchten, während sich<br />
bei der Vergärung pro Tonne etwa 200 kWh an Stromüberschuss<br />
und Wärme erzielen ließen, würden sich<br />
noch viele Kommunen wegen des größeren technischen<br />
Aufwandes und der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen<br />
vor dem Bau einer Vergärungsanlage für den Bioabfall<br />
scheuen. „Abhängig von der Inputqualität und dem<br />
Behandlungsverfahren entstehen bei der Vergärung aus<br />
einer Tonne Bioabfall 80 bis 140 Normkubikmeter Biogas.<br />
Das ist vergleichbar mit Substraten wie Geflügelmist<br />
oder Grassilage“, nennt Dornack als Faustformel.<br />
Der Präsident des Fachverbandes Biogas e. V. Horst Seide<br />
beleuchtete die aktuellen Entwicklungen aus Sicht<br />
seines Verbandes. Dabei verwies er auf nachdrückliche<br />
Forderungen aus der Politik, wonach eine Weiterentwicklung<br />
der Branche nur mit sauberen, effizienten und<br />
sicheren Biogasanlagen erfolgen kann. Anlass für die<br />
kritische Sicht seien Unfälle und Störungen mit teils<br />
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt und einem<br />
entsprechenden Medienecho. Die verschärften Verordnungen<br />
in den „Technischen Regeln für die Anlagensicherheit<br />
von Biogasanlagen“ (TRAS 120) seien eine<br />
Folge solcher Schadensereignisse.<br />
„Die zweite Ausschreibungsrunde für den Anlagenzubau<br />
blieb mit einem Gebotsumfang der 79 Teilnehmer<br />
von insgesamt 76,5 Megawatt (MW) erneut weit unter<br />
dem Ausschreibungsvolumen von 225,8 MW“, informiert<br />
Seide. Das zeige, dass das Ausschreibungsprozedere<br />
einer Überarbeitung bedürfe. Eine Untersuchung<br />
des Fachverbandes habe ergeben, dass die Hälfte der<br />
Betreiber, die sich an Ausschreibungen beteiligen, ihre<br />
Anlagen durch Überbauung nach vorne entwickeln,<br />
während die andere Hälfte ihre Betriebsgenehmigung<br />
nicht anfasse und die Leistung teilweise bis auf die<br />
Hälfte reduziere.<br />
In den Verhandlungen zum Energiesammelgesetz (En-<br />
SaG) habe man mit Rückenwind aus den Ländern für<br />
das EEG mehr erreicht als erwartet. Das betreffe beispielsweise<br />
den Flexdeckel. Dieser reduzierte sich zwar<br />
auf 1 GW und würde daher voraussichtlich bereits in<br />
diesem Frühjahr erreicht. Doch gleichzeitig habe sich<br />
die Karenzzeit auf 16 Monate verlängert. „Das bedeutet<br />
für flexwillige Betreiber bis Mitte 2020 Investitionssicherheit.<br />
Machen Sie was draus“, ermuntert Seide.<br />
Alles verwerten, um Quoten zu erreichen<br />
Die in der Abfallrahmenrichtlinie vereinbarten verbindlichen<br />
Recycling-Quoten machen es nach Ansicht<br />
von Hans-Peter Ewens vom Bundesministerium für<br />
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)<br />
erforderlich, die Bioabfälle, die mittlerweile ein Viertel<br />
der Siedlungsabfälle ausmachen, vollständig zu verwerten.<br />
Seit der Aufnahme einer Verpflichtung im Kreislaufwirtschaftsgesetz<br />
zur Getrenntsammlung habe die<br />
Menge an erfassten Bioabfällen deutlich zugenommen.<br />
Jüngste Statistiken weisen einen Zuwachs von rund 6<br />
kg je Einwohner aus. Doch ein großer Teil der Bioabfälle<br />
würde immer noch über die graue Tonne entsorgt, sodass<br />
von einem ungenutzten Potenzial von 3 bis 4 Mio.<br />
t ausgegangen werden könne.<br />
Mit Blick auf die fast schon zu Ende verhandelte EU-<br />
Düngemittelverordnung verweist der Referent in diesem<br />
Zusammenhang darauf, dass der Entwurf auch Kriterien<br />
für das Ende der Abfalleigenschaft von behandelten<br />
Bioabfällen (Komposten) als frei auf dem Binnenmarkt<br />
handelbare Düngeprodukte enthält. Bestimmte Düngeprodukte,<br />
das können auch behandelte Bioabfälle sein,<br />
wären damit europaweit frei handelbar. „Wir sind aber<br />
guter Hoffnung, dass die Hürden für die Einführung<br />
solcher Produkte, beispielsweise durch die geforderte<br />
CE-Kennzeichnung, so hoch sind, dass nicht zu viele<br />
solcher Produkte ohne weitere Regelung, ohne Dünge-<br />
13
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Stefan Hüsch, Bundesministerium für<br />
Ernährung und Landwirtschaft<br />
Dr. Andreas Kirsch, Bundesgütegemeinschaft<br />
Kompost e.V.<br />
Prof. Dr.-Ing. Frank Scholwin,<br />
Institut für Biogas, Kreislaufwirtschaft<br />
und Energie<br />
Anne Geißler, TU Dresden<br />
mittelrecht oder Bioabfallverordnung auf<br />
Flächen in Deutschland aufgebracht werden“,<br />
so Ewens.<br />
Als Reaktion auf den Fund großer Mengen<br />
von Kunststoffverpackungen in einem<br />
norddeutschen Gewässer habe der Bundesrat<br />
im September 2018 eine Entschließung<br />
zur Vermeidung von Kunststoffabfällen in<br />
der Umwelt bei der Entsorgung verpackter<br />
Lebensmittel verabschiedet. Gegenwärtig<br />
werde eine bundesweit einheitliche Regelung<br />
zur schadlosen und ordnungsgemäßen<br />
Verwertung von verpackten Lebensmitteln<br />
erarbeitet. Sie soll noch <strong>2019</strong> vorliegen.<br />
Die Verbände würden einbezogen.<br />
Mit Blick auf die Diskussion um Kunststoffe<br />
in der Umwelt legte Dr. Andreas Kirsch<br />
von der Bundesgütegemeinschaft Kompost<br />
e.V. (BGK) dar, dass entgegen negativer<br />
Pressemeldungen der Kunststoffanteil<br />
in den bei der Gütesicherung analysierten<br />
flüssigen Gärprodukten mit im Mittel<br />
0,023 Prozent auf Trockenmasse bezogen<br />
weit unter dem Grenzwert von 0,1 Prozent<br />
liege. Nach Schätzungen der BGK fallen<br />
in Deutschland jährlich etwa 750.000 t<br />
verpackter Lebensmittel als Biomüll an.<br />
Der Gewichtsanteil der Verpackungsmaterialien<br />
betrage 10 bis 15 Prozent. „Die in<br />
jüngster Zeit verstärkt erhobene Forderung<br />
nach einer umfassenderen Kunststoffabtrennung<br />
bereits vor der Vergärung würde<br />
technologisch bedingt einen höheren Verlust<br />
an organischer Substanz im Biogasinput<br />
und damit eine geringere Gasausbeute<br />
sowie weniger Nährstoffe und Humus im<br />
Gärprodukt bedeuten“, gibt Kirsch zu bedenken.<br />
Über Zwänge, denen die Bundesregierung<br />
bei der erneuten Überarbeitung<br />
der Düngeverordnung (DüV) unterliege, informierte<br />
Stefan Hüsch vom Bundesministerium<br />
für Ernährung und Landwirtschaft.<br />
Die Nitratgehalte im Grundwasser und in<br />
Oberflächengewässern müssten in einem<br />
überschaubaren Zeitrahmen sinken und<br />
die Forderungen der EU-Kommission umgesetzt<br />
werden. Sonst drohten ein Zweitverfahren<br />
und Bußgelder von täglich bis zu<br />
858.000 Euro.<br />
Das Ministerium überlege, die Auswirkungen<br />
der nochmals verschärften DüV in bestimmten<br />
Gebieten durch ein Bundesprogramm<br />
Gülle abzumildern. Als angedachte<br />
Maßnahmen nennt Hüsch die Gülleseparation,<br />
die Herstellung von exportwürdigem<br />
Phosphatdünger, die Ansäuerung von Gülle<br />
mit Schwefelsäure, wie sie in Dänemark<br />
verbreitet ist, und den Einsatz der NIRS-<br />
Technologie zur Ermittlung der Nährstoffgehalte<br />
in Gülle und Gärprodukten.<br />
Es werde Licht im Biogas-Reaktor<br />
Spannende Ergebnisse aus der Forschung<br />
präsentierten Wissenschaftler der TU Dresden.<br />
So berichtete Anne Geißler über ihre<br />
Versuche zur optimalen Vergärung von<br />
stickstoffreichen Substraten. Stickstoff<br />
kann bereits ab einer Konzentration von<br />
0,15 Gramm pro Liter Prozessstörungen<br />
verursachen. In ihren Testserien mit verschiedenen<br />
Substraten und unterschiedlichen<br />
Hochleistungsreaktoren aus dem<br />
Bereich der Abwasserreinigung zeigte sich<br />
der Rieselbettreaktor durch eine schnelle<br />
Anpassung der Mikroben an den Aufwuchsträgern<br />
am robustesten gegenüber wechselnden<br />
Substrateigenschaften und einer<br />
hohen Stickstoffbelastung.<br />
Bei Untersuchungen der Mikrobiologie in<br />
Biogasreaktoren fiel Dr. Christian Abendroth<br />
die Gattung der Methanosarcina auf.<br />
Diese „Superbakterien“ haben die Fähigkeit,<br />
auf direktem Wege Elektronen untereinander<br />
auszutauschen, und können auf<br />
verschiedenen Stoffwechselwegen und aus<br />
unterschiedlichen Substraten Methan produzieren.<br />
Zwar werde dadurch aus der gleichen<br />
Menge an Input nicht mehr Methan<br />
erzeugt, aber durch eine Anreicherung der<br />
Methanosarcina im Fermenter ließe sich<br />
der Gärprozess auch bei wechselnder Substratzusammensetzung,<br />
wie dies für die<br />
Abfallvergärung typisch ist, stabilisieren.<br />
Zufällig entdeckte Abendroth bei Versuchen<br />
in einem Glasreaktor, dass sich Methanosarcina<br />
unter dem Einfluss von Licht<br />
deutlich schneller reproduzieren. „Damit<br />
eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten für<br />
eine gezielte Steuerung der Mikrobenpopulationen<br />
bei der Biogasproduktion“, sagt<br />
der Wissenschaftler.<br />
Prof. Dr.-Ing. Frank Scholwin, Leiter des<br />
Instituts für Biogas, Kreislaufwirtschaft<br />
und Energie, entwarf zum Abschluss der<br />
Tagung einen Maßnahmenkatalog für eine<br />
stärkere stoffliche und energetische Nutzung<br />
von Bioabfall und gab einen Überblick<br />
zu Trends in der Biogasbranche, wie<br />
die Kopplung der Biogaserzeugung mit<br />
Bioraffinerieprozessen, die Veredlung des<br />
Biomethans zu gasförmigen und flüssigen<br />
Biokraftstoffen oder die Separation einzelner<br />
Nährstoffe aus Gärprodukten. Scholwin<br />
ermunterte die Tagungsteilnehmer, Neues<br />
zu wagen und gute Beispiele selbstbewusst<br />
zu präsentieren.<br />
Autor<br />
Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Freier Journalist<br />
Rudolph Reportagen – Landwirtschaft<br />
Umwelt, Erneuerbare Energien<br />
Kirchweg 10 · 04651 Bad Lausick<br />
03 43 45/26 90 40<br />
info@rudolph-reportagen.de<br />
www.rudolph-reportagen.de<br />
14
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Aktuelles<br />
15
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Niedersachsen<br />
Landwirtschaftliche Produktivität<br />
gesteigert ohne Zunahme der Klimagasemissionen<br />
Am 6. März fand im niedersächsischen Verden die nunmehr 10. Biogasfachtagung der<br />
Landwirtschaftskammer statt. Rund 180 Interessierte informierten sich unter anderem<br />
über Klimaschutzleistungen von Biogasanlagen, über Biomethan im Kraftstoffbereich<br />
sowie über Schadensursachen bei Blockheizkraftwerken.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Laut Ansgar Lasar<br />
stellt die gasdichte<br />
Lagerung von<br />
Wirtschaftsdünger<br />
eine wichtige Form der<br />
Emissionsreduktion<br />
dar.<br />
Ansgar Lasar, Klimaschutzfachmann der<br />
Landwirtschaftskammer Niedersachsen,<br />
referierte zum Thema „Klimaschutz als<br />
Aufgabe der Zukunft – was kann Biogas<br />
leisten?“. Er sagte: „Das deutsche Klimaschutzgesetz<br />
wird jetzt geschrieben. Das sollte nicht<br />
ohne Zutun der Landwirtschaft geschehen.“ Was der<br />
Klimawandel bedeutet, zeigte er am Beispiel des<br />
Landes Bangladesch auf. Dort würden rund<br />
164 Millionen Menschen nur einen Meter<br />
über dem Meeresspiegel leben, allerdings<br />
auf einer Landesfläche, die<br />
nur halb so groß ist wie Deutschland.<br />
Bis 2030 will Deutschland 55<br />
Prozent weniger CO 2<br />
gegenüber<br />
dem Referenzjahr 1990 ausstoßen.<br />
Im Jahr 2050 sollen es 80<br />
Prozent weniger CO 2<br />
sein. Laut Lasar<br />
hat Deutschland 13 Prozent seiner<br />
Treibhausgase in den ersten Jahren der<br />
Wiedervereinigung nur durch diesen Effekt<br />
eingespart. In den Folgejahren seien nur noch 10<br />
Prozent dazugekommen. 2014 hat Deutschland Treibhausgasemissionen<br />
in Höhe von 902 Millionen Tonnen<br />
CO 2<br />
-Äquivalente verursacht. 7,3 Prozent davon entfallen<br />
auf die Landwirtschaft, 6,8 Prozent auf Industrieprozesse.<br />
85 Prozent der Treibhausgase stammen, so<br />
Lasar, aus der Verbrennung fossiler Energieträger.<br />
1990 habe die deutsche Landwirtschaft 79,6 Millionen<br />
(Mio.) Tonnen CO 2<br />
-Äquivalent (CO 2<br />
-Äqu.) ausgestoßen,<br />
2015 seien es 67 Millionen Tonnen CO 2<br />
-Äquivalent<br />
gewesen. In Niedersachsen habe zwischen 1990 und<br />
2015 der Klimagasausstoß der Landwirtschaft auf fast<br />
gleichbleibendem Niveau gelegen. 1990: 14,4 Mio.<br />
Tonnen CO 2<br />
-Äqu., 2000: 13,4 Mio. Tonnen CO 2<br />
-Äqu.,<br />
2007: 12,9 Mio. Tonnen CO 2<br />
-Äqu. und 2015: 14,8<br />
Mio. Tonnen CO 2<br />
-Äqu. Im aktuellen Klimaschutzplan<br />
2050 der Bundesregierung sollen bis 2030 60 Prozent<br />
der anfallenden Wirtschaftsdünger vergoren werden.<br />
In diesem Zusammenhang wies Lasar darauf hin, dass<br />
ohne einen Anstieg der Treib hausgasemissionen aus<br />
der Quellgruppe Landwirtschaft in Niedersachsen die<br />
produzierte Milchmenge um 22 Prozent gestiegen ist,<br />
die Zahl der Masthähnchenplätze vervierfacht wurde,<br />
die Erträge im Pflanzenbau um 30 Prozent gestiegen<br />
sind und in Biogasanlagen 7,1 Milliarden Kilowattstunden<br />
Strom erzeugt worden sind. Mit dem Biogasstrom<br />
seien rund 7 Mio. Tonnen CO 2<br />
aus vermiedener Kohleverstromung<br />
eingespart worden.<br />
Tierproduktion mit Biogas koppeln<br />
Die gasdichte Lagerung von Wirtschaftsdünger stelle<br />
eine wichtige Form der Emissionsreduktion dar. Denn<br />
mit der flächendeckenden gasdichten Lagerung könnten<br />
die Landwirtschaftsemissionen um 1-Prozentpunkt<br />
reduziert werden. Ein weiteres Einsparpotenzial sieht<br />
Lasar in der emissionsarmen Stickstoffdüngung. „In<br />
der Tierproduktion ist die Verwertung des Wirtschaftsdüngers<br />
in Biogasanlagen die größte Stellschraube,<br />
um Treibhausgasemissionen zu senken“, betonte der<br />
Referent.<br />
Eine Untersuchung in 73 Biogasanlagen im niedersächsischen<br />
Landkreis Oldenburg hat ergeben, dass<br />
die Bestandsbiogasanlagen mit ihren typischen Gärsubstraten<br />
und Betriebsweisen im Vergleich zu anderen<br />
Varianten mit mehr Wirtschaftdüngeranteilen und<br />
geringerem Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen<br />
gegenüber der Braunkohleverstromung die höchste<br />
Treibhausgasvermeidung aufweisen.<br />
Verglichen wurden die Varianten auch mit der Erdgasverstromung.<br />
Hier zeigte sich ein anderes Bild. Die<br />
Variante 4 mit 100 Prozent Wirtschaftsdüngereinsatz<br />
und schneller Überführung der Exkremente in die Biogasanlage<br />
hatte eine höhere Treibhausgasvermeidung<br />
als die Ist-Anlagen. Variante 5 war wie Variante 4 ausgelegt,<br />
jedoch zusätzlich mit einer gasdichten Lagerung<br />
des Gärdüngers gerechnet worden. Dadurch war<br />
Variante 5 in der Treibhausgasvermeidung noch besser<br />
als Variante 4 und die Ist-Anlagen.<br />
16
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Aktuelles<br />
Zum Schluss seiner Ausführungen merkte Lasar an,<br />
dass die Treibhausgasvermeidungskosten mit der Biogasstromproduktion<br />
im Vergleich zur Wind- oder Solarstromerzeugung<br />
zwar relativ hoch sind, sich aber<br />
mit jenen Stromerzeugungsformen Wirtschaftsdünger<br />
nicht gasdicht lagern lasse.<br />
Abrupte Substratwechsel vermeiden<br />
Über den Umgang mit wechselnden Substraten, insbesondere<br />
mit trockenem Silomais, referierte Dr. Manfred<br />
Bischof von der LUFA Nord-West in Oldenburg.<br />
Nach seinen Worten ist die Bakteriengemeinschaft im<br />
Fermenter ein „Gewohnheitstier“. Daher seien nach<br />
Möglichkeit abrupte Futterwechsel, wechselnde Futtermengen,<br />
wechselnde Futterqualitäten sowie Mangelsituationen<br />
bei Makro- und Mikronährstoffen zu<br />
vermeiden. Er riet, den Makronährstoff Schwefel zu beachten<br />
– vor allem, wenn Eisensalze eingesetzt würden,<br />
wie zum Beispiel Eisenschlamm aus Wasserwerken.<br />
Im vergangenen Jahr seien die ersten Häckselketten in<br />
manchen Regionen bereits Mitte August ausgerückt,<br />
um Silomais zu ernten – rund sechs Wochen früher als<br />
in „normalen“ Jahren. „So trocken wie in 2018 waren<br />
die Maissilagen noch nie. Die Silagen sind sogar<br />
trockener als im Jahr 2003, das einen Hitzesommer<br />
hatte“, machte Bischof deutlich. Dennoch sei die<br />
durchschnittliche Trockensubstanz<br />
von Frischmaisproben in 2016<br />
höher gewesen als in 2018. Auffällig<br />
bei den 2018er Maisproben<br />
sei, dass der Stärkegehalt im Vergleich<br />
zu den Vorjahren deutlich<br />
niedriger liegt.<br />
Laut Bischof lag der Energiegehalt<br />
der Maissilage in 2018 bei 6,5 Megajoule<br />
pro Kilogramm Trockenmasse.<br />
Zum Vergleich: In dem sehr heißen<br />
Sommer 2003 lag der Wert bei knapp unter<br />
6,4. In den Jahren 2006 bis 2017 haben die Werte<br />
immer über 6,5 gelegen. Er erläuterte weiter, dass die<br />
Verdaulichkeit der Silagen teilweise schlecht sei. Die<br />
Verdaulichkeit werde durch längere Silierzeiträume<br />
verbessert. Bischof nannte drei bis vier Monate. Hier<br />
stellt sich jedoch die Frage, wie praktikabel das auf<br />
den Betrieben ist.<br />
CO 2<br />
-Vermeidung mit Biomethan-Kraftstoff<br />
Über Biomethan als Kraftstoff sprach Horst Seide,<br />
Präsident des Fachverbandes Biogas e.V. Nach seinen<br />
Worten erreicht Biomethan die mit Abstand höchsten<br />
CO 2<br />
-Einsparungen aller Biokraftstoffe. Biomethan aus<br />
Rest- und Abfallstoffen sei eine kostengünstige Form<br />
Fotos: Martin Bensmann<br />
Dr. Manfred Bischof:<br />
„So trocken wie in 2018<br />
waren die Maissilagen<br />
noch nie. Die Silagen<br />
sind sogar trockener<br />
als im Jahr 2003, das<br />
einen Hitzesommer<br />
hatte.“<br />
Wir machen Ihre Biogasanlage fit für die Zukunft.<br />
Die Schmack Service-Kompetenz:<br />
Besuchen Sie uns auf dem<br />
Bayerischen Biogas-Branchentreff<br />
in Straubing, 05. Juni <strong>2019</strong><br />
Messehalle Straubing, Stand 120<br />
Betriebsführung<br />
Modernisierung<br />
Technischer<br />
Service<br />
Biogasanlage<br />
Biologischer<br />
Service<br />
Profitieren Sie jetzt von mehr als 20 Jahren<br />
Biogas-Know-how.<br />
Schmack ist der kompetente Service-Partner rund<br />
um Ihre Biogasanlage. Von der Beratung über<br />
Optimierung bis hin zur Betriebsführung sind wir<br />
gerne für Sie da. www.schmack-biogas.de<br />
Schmack Biogas Service GmbH · 24-Stunden-Service-Hotline: Tel. +49 (0) 9431 751-277<br />
info@schmack-biogas.com<br />
17
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Michael Wentzke riet,<br />
alle Ursachen, die<br />
Schwingungsschäden<br />
hervorrufen können,<br />
auszumerzen.<br />
der CO 2<br />
-Vermeidung im Verkehrssektor.<br />
Potenziale für den Kraftstoffmarkt<br />
seien kurzfristig verfügbar,<br />
denn rund 200 Anlagen<br />
würden schon heute etwa 950<br />
Millionen Normkubikmeter<br />
Biomethan ins Erdgasnetz einspeisen.<br />
„Gehandelt werden die eingesparten<br />
Tonnen an CO 2<br />
, was eigentlich<br />
kein Zertifikatehandel ist. Mit der Zusatzleistung<br />
CO 2<br />
-Vermeidung lässt sich Geld<br />
verdienen. Diese Leistung lässt sich heute nur im<br />
Kraftstoffmarkt erzielen“, berichtete Seide.<br />
Die Mineralölwirtschaft müsse Treibhausgasminderungsquoten<br />
erfüllen.<br />
2015 waren das 3,5 Prozent, seit<br />
2017 müssen 4,0 Prozent weniger<br />
Treibhausgase emittiert werden.<br />
Ab 2020 sind es dann 6 Prozent.<br />
Die neue Erneuerbare-Energien-<br />
Richtlinie (RED II) der Europäischen<br />
Union fördert den Einsatz<br />
von Wirtschaftsdünger zur Produktion<br />
von Biomethan. Im Verkehrssektor<br />
soll der Anteil Erneuerbarer<br />
Energien bis 2030 14 Prozent erreichen.<br />
In diesen 14 Prozent sollen Biokraftstoffe und<br />
Biogas, die aus einer Liste bestimmter Rest- und Abfallstoffe<br />
wie Stroh, Gülle, Bioabfälle etc. produziert<br />
werden, mindestens 0,2 Prozent in 2022, 1 Prozent<br />
in 2025 und 3,5 Prozent im Jahr 2030 betragen. Die<br />
RED II muss bis zum 30. Juni 2021 in deutsches Recht<br />
umgesetzt sein. Ab 2021 will die EU den Anteil von<br />
Nahrungs- und Futtermittelpflanzen im Verkehrssektor<br />
von 7 Prozent bis auf 3,8 Prozent in 2030 senken.<br />
Biomethan muss laut Seide in den CNG-Kraftstoffmarkt.<br />
Die Mobilitätsstruktur müsse sich ändern, was<br />
im Kleinen schon geschehe. 63 Prozent des deutschen<br />
Kraftstoffmarktes entfallen auf Dieselkraftstoff. „Wenn<br />
die Hälfte des Schwerlastverkehrs mit Gas führe, wären<br />
wir ein Teil der Lösung“, so der Verbandspräsident.<br />
Tipps zum BHKW-Betrieb<br />
Michael Wentzke, Geschäftsführer der IG Biogasmotoren<br />
e.V., sprach über den optimalen Biogas-BHKW-<br />
Betrieb mit hoher Verfügbarkeit. Wenn ein Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) 32.000 Betriebsstunden auf dem<br />
Zähler hat, dann entspreche das einem Pkw-Motor mit<br />
etwa 4,8 Millionen Straßenkilometern. Als wichtigste<br />
Ursachenfelder von BHKW-Problemen nannte er konstruktive<br />
Mängel, Fehler bei der Inbetriebnahme, Fehler<br />
bei der Projektierung, Instandhaltungsmängel sowie<br />
falsche Reaktionen auf Frühindikatoren.<br />
Im Blick sollten Betreiber auch die Funktion des Aktivkohlefilters<br />
haben. Er riet, vor dem Filter etwas Sauerstoff<br />
einzublasen. Die Gasfeuchte sollte 50 bis 60<br />
Prozent betragen, um eine optimale<br />
Beladungsleistung der Aktivkohle zu erreichen.<br />
Die Temperatur der Gaskühlung sollte<br />
bei 12 Grad Celsius liegen, sonst werde das Gas zu<br />
trocken. Die Gasvorwärmung sollte auf 25 Grad Celsius<br />
eingestellt werden. „Beim flexiblen BHKW-Betrieb<br />
ist es vorteilhaft, den Aktivkohlefilter vorzuwärmen“,<br />
erklärte Wentzke.<br />
Des Weiteren sprach er das Thema Schwingungsschäden<br />
an. Ursachen für solche Schäden können<br />
sein: wenn zum Beispiel Fundamente statisch falsch<br />
bedacht worden sind oder der Boden des Containers,<br />
in dem das BHKW steht, sich durchbiegt. Probleme<br />
würden auch nicht entkoppelte Maschinenfundamente<br />
bei Raumaufstellung verursachen. „Weitere Gründe<br />
können zu weiche, geschraubte Motorengestelle, verschlissene<br />
Dämpfungselemente, verspannte Kompensatoren,<br />
zu hohe Differenzen in den Zünddrücken oder<br />
Motorklopfen sein. Starkes klopfen ist Motortod mit<br />
Ansage“, betonte Wentzke.<br />
Bezüglich Standzeiten von Zündkerzen empfahl er, den<br />
Auslastungsgrad des BHKW zu überprüfen und gegebenenfalls<br />
leicht zu senken. Ebenso riet er, auf Siloxane<br />
in Stallreinigungsmitteln zu achten, da diese über<br />
das Gas in den Brennraum des Motors gelangen und<br />
dort zu Quarz verbrennen würden. Ein Augenmerk sollte<br />
auch auf den Schmierölverbrauch gerichtet werden.<br />
Dieser werde zu selten genau gemessen. Normalverbräuche<br />
lägen zwischen 0,1 und 0,3 Gramm pro Kilowattstunde.<br />
Ein 800-Kilowatt-BHKW verbrauche 2,1<br />
bis 6,3 Liter Schmieröl pro Tag. „Der Ölverbrauch ist<br />
ein zuverlässiger Indikator für den Verschleißzustand<br />
der Kolben, Kolbenringe und Laufbuchsen. Er weist<br />
auch auf den Zustand der Ventilschaftabdichtung hin.<br />
In diesem Zusammenhang ist auch die Ölnebeldampfabscheidung<br />
zu überwachen“, machte der Referent<br />
aufmerksam.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
0 54 09/90 69 426<br />
martin.bensmann@biogas.org<br />
Horst Seide: „Mit der<br />
Zusatzleistung CO 2<br />
-<br />
Vermeidung lässt sich<br />
Geld verdienen. Diese<br />
Leistung lässt sich<br />
heute nur im Kraftstoffmarkt<br />
erzielen.“<br />
18
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Aktuelles<br />
Passende Rührtechnik für jedes Substrat<br />
– Alle Rührwerkstypen<br />
– Über 25 Jahre Erfahrung<br />
– Optimierung, Nachrüstung, Tausch<br />
Tel. +49.7522.707.965.0 www.streisal.de<br />
Gas Technologie von APROVIS<br />
APROVIS. Better Performance.<br />
FriCon – Gaskühlsysteme<br />
ActiCo – Aktivkohlefilter<br />
Gaswärmeübertrager<br />
Verdichter<br />
Wartung & Service<br />
91746 Weidenbach-Triesdorf · Tel.: +49 9826 6583 - 0 · info@aprovis.com<br />
www.aprovis.com<br />
DIE BESTEN BIOGASANLAGEN<br />
mit getrennter Hydrolyse ...<br />
... nachhaltig wirtschaftlich<br />
Mehr Leistung durch zweistufige Vergärung.<br />
Wir garantieren die herstellerunabhängige<br />
Beratung und Planung.<br />
Optimierung bestehender Biogasanlagen.<br />
Durchführung von Abnahmeprüfungen nach<br />
§15 und wiederkehrender Prüfungen nach<br />
§16 BetrSichV und/oder § 29a BImSchG.<br />
INNOVAS Innovative Energie- & Umwelttechnik<br />
Anselm Gleixner und Stefan Reitberger GbR<br />
Margot-Kalinke-Str. 9 · 80939 München<br />
Tel.: 089 16 78 39 73 · Fax: 089 16 78 39 75<br />
info@innovas.com · www.innovas.com<br />
19
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Foto: Fachverband Biogas e.V.<br />
Der Stromdirektvermarktungspool<br />
Bayerisch Schwaben<br />
Nord besichtigte die<br />
Biogasanlage der<br />
Bioenergie Reimlingen<br />
GmbH & Co.KG.<br />
Die Anlage verfügt<br />
über rund 500 kW<br />
Bemessungsleistung<br />
und etwa 2.000 kW<br />
installierte Leistung.<br />
Außerdem betreibt sie<br />
eine Gaseinspeisung.<br />
Regionale Vermarktung im<br />
Fokus des Pooltreffens BSN<br />
Im Februar fand der Direktvermarktungstag <strong>2019</strong> des Stromdirektvermarktungspools<br />
Bayerisch Schwaben Nord (BSN) in Wemding statt. Mehr als 150 Teilnehmer informierten<br />
sich dabei zum Thema regionale Stromvermarktung sowie zu den aktuellen Entwicklungen<br />
bei der Fahrplanfahrweise und Regelenergie.<br />
Von M.Sc. Georg Friedl und Rainer Weng<br />
Der Direktvermarktungspool BSN stellt einen<br />
losen Betreiberzusammenschluss dar, der<br />
über verschiedene Vermarkter gemeinsam<br />
Strom vermarktet und dabei mit geprüften<br />
Rahmenverträgen arbeitet. Zum Pool<br />
zählen aktuell mehr als 400 Anlagenbetreiber mit gut<br />
300 Megawatt (MW) installierter Anlagenleistung. Eine<br />
wichtige Aufgabe des Pools besteht im Fachaustausch<br />
und der Wissensvermittlung im Bereich Stromdirektvermarktung.<br />
Dabei spielt der jährliche Direktvermarktungstag<br />
eine zentrale Rolle.<br />
Im ersten Vortrag stellte Florian Weh, Geschäftsführer<br />
der Renergie Allgäu, den Marktplatz cells energy vor.<br />
Mit ihm sollen Erzeuger und Verbraucher zusammengebracht<br />
werden für die Zeit nach dem EEG. „Es ist noch<br />
keine Lösung für die Post-EEG-Zeit für Biogasanlagen<br />
vorhanden“, so Florian Weh, „aber heute können bereits<br />
Kunden für diese Zeit gebunden werden.“ Seiner<br />
Ansicht nach werden Kunden, die sich zu 100 Prozent<br />
mit erneuerbarem Strom versorgen wollen, schnell feststellen,<br />
dass dies ohne flexible Biogasanlagen nicht<br />
funktionieren wird.<br />
Regionale Stromvermarktung<br />
Im Anschluss berichtete Florian Doktorczyk über das<br />
Regionalstromprodukt „Mein Strom bleibt vor Ort“<br />
der Stadtwerke Würzburg. Dabei geht es um die Belieferung<br />
von Endkunden mit Strom, der in der Region<br />
erzeugt wird. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen<br />
schafft das EEG über die so genannten Regionalnachweise:<br />
Es darf die Regionalität, nicht aber die grüne<br />
Eigenschaft von EEG-Strom genutzt werden. Florian<br />
Doktorczyk ist dabei von höherer Wertschöpfungstiefe<br />
überzeugt, „weil wir am liebsten bei den Menschen<br />
kaufen, die wir kennen“.<br />
In zwei weiteren Vorträgen wurden dann Stromprodukte<br />
vorgestellt, die den gezielten Anbau von Blühpflanzen<br />
fördern sollen. So präsentierte Alexandra Kipp vom<br />
Energiepark Hahnennest das Produkt „Silphieenergie<br />
– ein landwirtschaftliches Klimaschutzprojekt“.<br />
Dabei wird bei Abschluss eines Stromliefervertrages<br />
ein bestimmter Betrag für das Anlegen von Flächen<br />
mit Durchwachsener Silphie, die laut Kipp „eine Ergänzung<br />
zum Maisanbau darstellt“, unterstützt. Georg<br />
Friedl vom Fachverband Biogas e.V. stellte mit dem<br />
20
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Aktuelles<br />
„Bienenstrom“ der Stadtwerke Nürtingen<br />
einen weiteren Ansatz zur Förderung der<br />
Biodiversität über Stromprodukte dar. In<br />
diesem Fall zahlen die „Bienenstrom“-<br />
Kunden 1 Cent pro Kilowattstunde mehr für<br />
ein Grünstromprodukt. Der damit erzielte<br />
Betrag wird Landwirten („Blühpaten“) zur<br />
Verfügung gestellt, die Blühmischungen<br />
anlegen. Auch in den darauffolgenden Jahren<br />
erhalten die Landwirte eine finanzielle<br />
Unterstützung. Das geplante Franchise-<br />
System der Stadtwerke ermöglicht es künftig,<br />
auch anderen Energieversorgern „Bienenstrom“<br />
anzubieten.<br />
Aktuelle Entwicklungen bei<br />
der Fahrplanfahrweise und<br />
Regelenergie<br />
Jochen Schwill (Next Kraftwerke) und<br />
Anette Keil (Energy2Market) berichteten<br />
über die Entwicklungen bei der Regelenergievermarktung<br />
aufgrund des im Oktober<br />
eingeführten Mischpreisverfahrens (siehe<br />
ausführlichen Bericht im Biogas Journal<br />
2_<strong>2019</strong>). Durch die Einbeziehung des Arbeitspreises,<br />
der bei Biogasanlagen relativ<br />
hoch ist, beim Zuschlagsverfahren, erhalten<br />
Biogasanlagen kaum noch Zuschläge<br />
bei der Regelenergie, der Markt wurde von<br />
den fossilen Kraftwerken übernommen.<br />
Wenn Anlagen einen Zuschlag erhalten,<br />
dann erfolgen im Vergleich zu früher sehr<br />
viele Abrufe, was sowohl technisch als auch<br />
wirtschaftlich problematisch ist. Im Ergebnis<br />
haben sich zwar die Ausgleichsenergiepreise,<br />
die die Vermarkter bei Fahrplanabweichungen<br />
bezahlen müssen, gesenkt, die<br />
Leistungspreise, die über die Netzentgelte<br />
abgewickelt werden, haben sich aber erhöht<br />
und damit sind die Gesamtkosten sogar<br />
gestiegen. Ab Ende <strong>2019</strong>/Anfang 2020<br />
könnte nach Ansicht von Jochen Schwill<br />
„die Regelenergie wieder interessant werden,<br />
wenn der Regelenergiearbeitsmarkt<br />
greift“. Poolsprecher Rainer Weng appellierte<br />
an die Vermarkter, die vom derzeitigen<br />
System profitieren, die Branche nicht<br />
hängen zu lassen, weil „Biogasanlagen damit<br />
nicht mehr systemrelevant sind“.<br />
Im weiteren Verlauf berichteten die Vermarkter<br />
über die Umsetzung der Fahrplanfahrweise.<br />
Anette Keil merkte dabei an,<br />
dass „Landwirte nicht traurig sind, wenn<br />
die Fahrplanfestlegung vom Vermarkter<br />
übernommen wird“. Um Mehrerlöse erzielen<br />
zu können, müssen die Anlagen „wirklich<br />
flexibel und nicht scheinflexibel sein“.<br />
Fahrpläne sind stets sehr<br />
individuell<br />
Jan Sagefka von der BayWa r.e. Clean Energy<br />
Sourcing GmbH ergänzte, dass es „viel<br />
mehr wert ist, einen Fahrplan zu fahren, den<br />
die Anlage leisten kann, als einen Fahrplan<br />
der Anlage aufzuzwingen“. Die Stadtwerke<br />
Würzburg sahen zwei Alleinstellungsmerkmale:<br />
Zum einen sind sie kommunaler Vermarkter,<br />
zum anderen betreiben sie auch<br />
eigene Kraftwerke. Florian Doktorczyk wies<br />
daraufhin, dass „Fahrpläne stets sehr individuell“<br />
sind und bei Problemen angepasst<br />
werden. Jochen Schwill wiederum fand,<br />
dass die wesentliche Herausforderung und<br />
Aufgabe aus Sicht des Vermarkters darin<br />
besteht, „technische Restriktionen mit<br />
Marktoptionen zu verknüpfen“. Wie zum<br />
Teil auch andere Vermarkter bieten diese<br />
die Vergütung einer „Flexpauschale“ an,<br />
wenn die Anlagen vom Betreiber vollständig<br />
freigegeben werden.<br />
Christian Dorfner von der SK Verbundenergie<br />
AG (SKVE) berichtete über deren<br />
Dienstleistungsangebot, Fahrpläne für flexible<br />
Anlagen zu erstellen. Als Betreiber<br />
von Anlagen wissen sie genau, worauf es<br />
ankommt. Anlagenbetreiber Markus Feucht<br />
bestätigte dies, weil er in der Zwischenzeit<br />
„mehr erlöst, als ursprünglich berechnet<br />
wurde“. Die Fahrplanerstellung erfolgt völlig<br />
automatisch und ständig aktuell anhand<br />
der tatsächlichen Anlagenparameter. In der<br />
Regel kommen laut Dorfner die Anlagen mit<br />
zwei Starts pro Tag aus. Aus seiner Sicht ist<br />
es wichtig, dass die BHKW mindestens 90<br />
bis 120 Minuten laufen, bevor sie wieder<br />
geregelt werden.<br />
Zum Abschluss stellte Oliver Fritz die Strategie<br />
der Firma NatGas vor. Als Alleinstellungsmerkmal<br />
sieht er, dass NatGas keine<br />
Entgelte für die reine Vermarktung der<br />
Strommengen in Rechnung stellt, also 100<br />
Prozent der Managementprämie beim Betreiber<br />
bleiben.<br />
Überbauung gut überlegen<br />
Im weiteren Verlauf wurde die Frage aufgeworfen,<br />
welche Zusatzerlöse mit den verschiedenen<br />
Fahrweisen möglich sind und<br />
ob die Vermarkter eine bestimmte Überbauung<br />
empfehlen. Die Vermarkter äußerten<br />
sich dabei generell zurückhaltend,<br />
die Flexibilisierung muss jeweils anlagenbezogen<br />
gesehen werden, Anlagen mit<br />
höherer Überbauung haben natürlich bessere<br />
Chancen. Christian Dorfner erläuterte<br />
den Vorteil einer „Dreifach-Überbauung“<br />
(= Verdreifachung der installierten Leistung)<br />
gegenüber einer „Doppelüberbauung“:<br />
Geht das Bestands-BHKW kaputt,<br />
ist die Anlage immer noch „doppelt überbaut“,<br />
während im anderen Fall die Bemessungsleistung<br />
halbiert werden müsste, um<br />
dies zu erreichen.<br />
Er hält es daher für richtig, mehr als „doppelt<br />
zu überbauen“, ohne dies allerdings<br />
gleich völlig auszureizen. Als Rahmen für<br />
die Mehrerlöse werden derzeit etwa 0,5<br />
Cent pro Kilowattstunde bei einer Doppelüberbauung<br />
gesehen. Michael Völklein,<br />
ebenfalls Poolsprecher, erklärte die Zurückhaltung<br />
der Vermarkter damit, dass es<br />
derzeit „ein enges Geschäft ist, ansonsten<br />
würden sich die Vermarkter offensiver äußern“.<br />
In der Diskussion um eine maximale<br />
Überbauung („Fünffach-Überbauung“)<br />
gab er zu bedenken, dass es in Jahren wie<br />
2018 mit extrem knapper Substratversorgung<br />
zu Problemen mit der Erreichung der<br />
mindestens 20 Prozent Bemessungsleistung<br />
kommen könnte. Wird der Wert nicht<br />
erreicht, entfällt die Prämie für das komplette<br />
Jahr.<br />
Autoren<br />
M.Sc. Georg Friedl<br />
Leiter des Referats Mitgliederservice<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 ∙ 85356 Freising<br />
0 81 61/98 46 60<br />
mitgliederservice@biogas.org<br />
Rainer Weng<br />
Sprecher Vermarktungspool<br />
Bayerisch Schwaben Nord<br />
Regionalgruppensprecher<br />
Bayrisch Schwaben Nord<br />
im Fachverband Biogas e.V.<br />
21
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Artenschutz geht uns alle an<br />
Sechs Wochen nach dem großen Erfolg des bayerischen Volksbegehrens „Artenvielfalt“ fand im niederbayerischen<br />
Straubing die Tagung „Da blüht uns was – Mehr Biodiversität durch Nachwachsende Rohstoffe“ statt.<br />
Über 120 Teilnehmer waren der Einladung des Technologie- und Förderzentrums (TFZ) am 28. März gefolgt,<br />
um über die Chancen und Schwierigkeiten beim Anbau alternativer Kulturpflanzen zu diskutieren.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. Andrea Horbelt<br />
Der Blick auf die Ackerflächen<br />
ist geschärft in diesen Wochen,<br />
das Interesse der Bevölkerung<br />
am Thema Artenvielfalt und Artenschutz<br />
ist groß. Ein Auslöser<br />
für die neue Sensibilität war sicher auch<br />
der Hitzesommer 2018 und die immer<br />
häufiger auftretenden Extremwetterlagen.<br />
Selbst die Blumenkästen am Münchner<br />
Rathaus werden in diesem Jahr erstmals<br />
bienenfreundlich bepflanzt. Ein hochaktuelles<br />
Thema also. So aktuell, dass die<br />
Bayerische Staatsministerin für Ernährung,<br />
Landwirtschaft und Forsten, Michaela Kaniber,<br />
kurzfristig ihre Teilnahme absagen<br />
musste, weil der Runde Tisch zum Artenschutz<br />
in München gleichzeitig tagte.<br />
Ihren Vortrag übernahm Dr. Werner Ortinger,<br />
der gleich zu Beginn betonte: „Artenschutz<br />
geht uns alle etwas an.“ Zwar sei die<br />
Landwirtschaft, die rund 50 Prozent der<br />
Bodenfläche im Freistaat bewirtschaftet,<br />
in einer besonderen Rolle – aber man dürfe<br />
die Landwirte nicht allein lassen. Zudem<br />
sei jeder zweite Landwirt eh schon an Maßnahmen<br />
zum Schutz der Umwelt beteiligt,<br />
beispielsweise über das Kulturlandschaftsprogramm<br />
KULAP – ein Beispiel, dessen<br />
Praktikabilität im Laufe der Tagung allerdings<br />
noch häufiger infrage gestellt werden<br />
sollte.<br />
Über den Stand und die Ursachen des aktuellen<br />
Biodiversitätsverlustes informierte<br />
Prof. Dr. Wolfgang Weisser von der TU München.<br />
Seine Aussagen haben niemanden<br />
im Auditorium wirklich überrascht: Pflanzenschutzmittel,<br />
Homogenisierung der<br />
Landschaft, Versiegelung, Klimawandel,<br />
etc. Was Weisser aber vor allem kritisierte:<br />
„Es fehlt ein realistisches Ziel. Was genau<br />
wollen wir?“ Es gebe viele Maßnahmen,<br />
auch durchaus gute Ansätze, aber unterm<br />
Strich wenig Ergebnisse.<br />
Häufig sei die Herangehensweise zu wenig<br />
durchdacht. „Von der Anzahl der Insekten<br />
auf den Blüten auf deren Vorkommen zu<br />
schließen sei so, als würde man auf dem<br />
Oktoberfest Freibier ausschenken und<br />
daraus auf die Einwohnerzahl Münchens<br />
schließen“, veranschaulichte Weisser. Insekten<br />
leben nicht auf Blüten, sondern im<br />
Boden oder im Totholz.<br />
In der anschließenden Statement-Runde<br />
gingen die Meinungen zu den notwendigen<br />
Zielen und Maßnahmen erwartungsgemäß<br />
auseinander. Walter Heidl vom Bayerischen<br />
Bauernverband hob den bereits geleisteten<br />
Beitrag der Landwirte hervor und betonte<br />
die gesamtgesellschaftliche Aufgabe. „Wir<br />
wollen etwas tun – aber nicht alleine.“ Richard<br />
Mergner vom BUND sah hingegen allein<br />
aufgrund der Flächenwirkung den entscheidenden<br />
Hebel in der Landwirtschaft,<br />
betonte aber auch, dass man die Bauern<br />
nicht allein lassen dürfe. Der Naturschützer<br />
sah im Anbau Nachwachsender Rohstoffe<br />
eine Chance für die Landwirtschaft. Der<br />
Fehler liege aktuell in einer verfehlten Agrarpolitik.<br />
Das Problem aus Sicht der Bienen betrachtete<br />
Peter Maske vom Deutschen Imkerbund.<br />
Von 2,5 Millionen auf 800.000 sei<br />
die Zahl der Bienenvölker zurückgegangen.<br />
Zurückzuführen vor allem auf Nahrungsmangel.<br />
Von der Imkerei leben könne heute<br />
kaum noch jemand; weniger als 100 Berufsimker<br />
gebe es in Deutschland. „Zum<br />
Glück nimmt aber die Zahl der Hobbyimker<br />
zu. Diese übernehmen eine ganz wichtige<br />
Aufgabe“, betonte Maske.<br />
Werner Ortingen unterstrich in der Statement-Runde,<br />
dass Kommunikation, Respekt<br />
und eine offene Diskussion jetzt<br />
wichtig seien. Die Chance hierzu ergriff<br />
dann auch gleich ein Landwirt aus dem<br />
Publikum, der die Sinnhaftigkeit des KU-<br />
LAP-Programms infrage stellte. Die darin<br />
vorgeschriebene Bodenbearbeitung beispielsweise<br />
sei der Tod vieler Hasen. „Die<br />
Programme sollten zu Ende gedacht und<br />
optimiert werden“, forderte der Landwirt.<br />
Es müsse einen gerechten Lohn geben für<br />
die Pflege der Landschaft.<br />
Statement-Runde (von<br />
links): Peter Maske<br />
(Präsident des Deutschen<br />
Imkerbundes), Richard<br />
Mergner (BUND-Vorsitzender),<br />
Dr.-Ing. Werner<br />
Ortinger (Bayerisches<br />
Staatsministerium für Ernährung,<br />
Landwirtschaft<br />
und Forsten), Walter Heidl<br />
(BBV-Präsident) und Florian<br />
Schrei (BR-Moderator).<br />
„Zum Glück nimmt<br />
aber die Zahl der<br />
Hobbyimker zu“<br />
Peter Maske<br />
22
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Aktuelles<br />
Im zweiten Teil der Tagung gaben renommierte<br />
Forscher der wichtigsten bayerischen<br />
Institute einen Einblick in ihre<br />
aktuelle Arbeit. Über das Leben der Feldbewohner<br />
berichtete Roswitha Walter von<br />
der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL).<br />
Ihre Passion sind die Regenwürmer, die<br />
„zwar nicht so hübsch aussehen und so einfach<br />
zu beobachten sind wie beispielsweise<br />
Schmetterlinge, aber umso wichtiger für<br />
ein gesundes Feld“. Von den 49 bekannten<br />
Regenwurmarten kämen 25 auf landwirtschaftlichen<br />
Flächen vor. Und – wie spätestens<br />
der Sommer 2018 gezeigt hat – sie<br />
sind sehr hitzeresistent.<br />
Zusammenfassend stellte Walter heraus:<br />
Wildlebende Tiere mögen mehrjährige Arten<br />
lieber als einjährige, sie profitieren von<br />
kleinen Schlägen und Blühstreifen, von<br />
einer hohen Vielfalt in einem Lebensraumverbund<br />
ebenso wie von Fruchtfolgen und<br />
humusreichem Boden. Der häufig in Verruf<br />
geratenen Energiepflanze Mais attestierte<br />
die Forscherin: „Für Fluginsekten ist er<br />
nicht viel schlechter als Dauerkulturen wie<br />
Sida oder die Durchwachsene Silphie, vor<br />
allem in der Nähe von Blühflächen.“<br />
Neue Pflanzen können<br />
Arbeitsspitzen entzerren<br />
Eine kompakte Übersicht über weitere Alternativen<br />
zum Mais verschaffte Maendy<br />
Fritz vom TFZ. Einleitend erläuterte sie ihre<br />
Beweggründe für ihre Forschungsarbeit:<br />
Von den rund 7.000 Kulturarten nutzt die<br />
Menschheit gerade mal 15, um daraus 95<br />
Prozent ihrer Nahrung zu erzeugen. Hiervon<br />
wiederum machen Weizen, Mais und<br />
Raps knapp zwei Drittel aus. „Das ist ein<br />
ganz schlechtes Risikomanagement“, betonte<br />
Fritz. Darüber hinaus böten alternative<br />
Arten viele Vorteile: Neben einer guten<br />
Humusbilanz durch die ganzjährige Bodenbedeckung,<br />
einer hohen Biodiversität und<br />
einer gesunden und vielfältigen Fauna entzerrten<br />
neue Pflanzen die Arbeitsspitzen<br />
für den Landwirt durch andere Aussaatund<br />
Erntetermine als die etablierten Kulturarten.<br />
„Und sie bedeuten eine Risikoabsicherung<br />
bei Extremwitterungen – wie im<br />
Sommer 2018“, erklärte Fritz.<br />
Von den zahlreichen alternativen Energiepflanzen,<br />
über die das TFZ forscht, stellte<br />
Fritz einige exemplarisch vor: Der „Legu-<br />
Mix“ ist eine Mischung aus einer Leguminosenart<br />
wie beispielsweise der Zottelwicke<br />
und einer Ackerfrucht wie dem Weizen.<br />
Dr. Maendy Fritz (Sachgebietsleiterin Rohstoffpflanzen<br />
am TFZ) sagte, dass von den rund 7.000<br />
Kulturarten die Menschheit gerade mal 15 nutzt,<br />
um daraus 95 Prozent ihrer Nahrung zu erzeugen.<br />
Das sei ein schlechtes Riskikomanagement.<br />
Bei diesem Mix könne man komplett auf<br />
Pflanzenschutzmittel verzichten, was unter<br />
anderem für die Hummel von großem Vorteil<br />
ist. „Die Hummel startet als eine der ersten<br />
Insekten ins Frühjahr und ist allein deshalb<br />
schon sehr wichtig. Sie ist zudem ausdauernder<br />
und fleißiger als die Biene“, erörterte<br />
die Forscherin. Sie habe nur nicht so ein<br />
„Top-Marketing“ wie letztere und werde<br />
deshalb oft nicht gebührend beachtet.<br />
Prinzipiell seien Dauerkulturen vorteilhafter<br />
als einjährige, erklärte Mandy Fritz.<br />
Dass sie trotz ihrer Vorteile nur wenig verbreitet<br />
seien, liege zum einen daran, dass<br />
der Landwirt eine langfristige Entscheidung<br />
treffen müsse; außerdem seien die Etablierungskosten<br />
erst mal hoch und die Züchtungsfortschritte<br />
langsam. Als Beispiel für<br />
eine aktuell erfolgreiche Dauerkultur nannte<br />
Fritz die Durchwachsene Silphie, die bereits<br />
auf 500 Hektar in Bayern wachse, 280<br />
Hektar davon seien ökologische Vorrangfläche.<br />
„Die Silphie ist eine gute Ergänzung<br />
zum Mais“, sagte Fritz. Sie erreiche knapp<br />
75 Prozent von dessen Ertrag.<br />
Bayern: 58 Prozent der<br />
Erneuerbaren aus Bioenergie<br />
Vom Acker in den Wald entführte Prof. Dr.<br />
Jörg Ewald das Straubinger Publikum. Er<br />
unterstrich, dass eine integrative Forstwirtschaft<br />
die Biodiversität auch in diesem<br />
Lebensraum erhöhen könne. Die Potenziale<br />
seien zwar begrenzt, aber auch der Wald<br />
leiste einen wichtigen Beitrag für die Energiewende<br />
– ohne negative Nebenwirkungen.<br />
Ewald betonte, dass 58 Prozent der<br />
in Bayern verwendeten Erneuerbaren Energien<br />
aus Bioenergie stammen, davon rund<br />
Fotos: Andrea Horbelt<br />
ein Drittel vom Holz. Über Blühmischungen<br />
zur energetischen Nutzung referierte<br />
Kornelia Marzini von der Landesanstalt für<br />
Weinbau und Gartenbau (LWG). „Wir brauchen<br />
eine Ergänzung zum Mais“, forderte<br />
Marzini. Der aktuelle Shootingstar der LWG<br />
ist der „Hanfmix“ – eine Mischung mehrjähriger<br />
Wildpflanzen unterschiedlichster<br />
Eigenschaften. „Mehrjährige sind sinnvoller<br />
und nachhaltiger“, stimmte Marzini<br />
ihren Vorrednern zu.<br />
Wichtig sei eine Mischung aus Pflanzen,<br />
die sich gegenseitig ergänzen und nicht unterdrücken.<br />
Eine Kombination aus Ammenpflanzen,<br />
Füllarten und Leitarten. Die Ammenpflanzen<br />
bedecken den Boden schnell<br />
und unterdrücken dadurch Beikräuter –<br />
eine Aufgabe für den Hanf. Ammenpflanzen<br />
werden im September geerntet. Im<br />
zweiten Jahr wachsen Füllarten wie Kletten<br />
oder Eselsdistel und optimieren den Ertrag.<br />
Ab dem dritten Jahr kommen die Leitarten<br />
ins Spiel (Rainfarn, Fenchel Stockrosen)<br />
und bilden das langfristige Gerüst.<br />
Wildpflanzen: Vorzeigeprojekt<br />
Rhön-Grabfeld<br />
Ein hervorragendes Anschauungsobjekt für<br />
den Hanfmix ist das Wildpflanzenprojekt<br />
Rhön-Grabfeld. Im Gemeinschaftsprojekt<br />
von Landwirten, Biogasanlagenbetreibern,<br />
Naturschützern und Imkern wird der Anbau<br />
alternativer Energiepflanzen für den späteren<br />
Einsatz in Biogasanlagen getestet –<br />
mit dem Ziel, die Biodiversität auf den Flächen<br />
zu erhöhen. „Die Werkzeuge liegen<br />
auf dem Tisch – man muss eigentlich nur<br />
zugreifen“, schloss Kornelia Marzini ihren<br />
Vortrag.<br />
Am Ende der Tagung waren sich alle Beteiligten<br />
darin einig, dass der Rückgang der<br />
Artenvielfalt ein drängendes Problem ist,<br />
das nur gemeinsam zu lösen ist. Es mangelt<br />
nicht an Lösungsansätzen, aber an der<br />
praktikablen Umsetzung. Werner Ortinger<br />
wird einige neue Erkenntnisse mit nach<br />
München genommen haben, von denen der<br />
Runde Tisch Artenvielfalt sicherlich profitieren<br />
kann.<br />
Autorin<br />
Dipl.-Ing. agr. Andrea Horbelt<br />
Pressesprecherin<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 · 85356 Freising<br />
0 81 61/98 46 60<br />
info@biogas.org<br />
23
Politik<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Klimaschutzgesetz<br />
Zerreißprobe für die Politik<br />
und Hoffnungsträger für die<br />
Erneuerbaren<br />
Das für <strong>2019</strong> angekündigte Klimaschutzgesetz wird von der Branche<br />
mit Spannung erwartet. Ein erster Entwurf wurde nun in Berlin vorgelegt.<br />
Der ist allerdings politisch sehr umstritten – Ausgang ungewiss.<br />
Ein Kurzbericht zum Ringen um den Klimaschutz.<br />
Von Sandra Rostek und Dr. Guido Ehrhardt<br />
Mitte Februar dieses Jahres<br />
erreichte die Stimmung im<br />
Bundestag ein selbst für<br />
diese Legislaturperiode historisch<br />
anmutendes Tief.<br />
Dabei schien der Anlass zunächst unschuldig:<br />
Die zuständige SPD-Ministerin<br />
Svenja Schulze aus dem Bundesumweltministerium<br />
(BMU) hatte<br />
lediglich getan, was im Koalitionsvertrag<br />
fixiert und somit lange angekündigt<br />
worden war: Sie legte einen<br />
Entwurf für das „Klimaschutzgesetz“<br />
vor, mit dem die Klimaziele<br />
2030 der Bundesregierung gesetzlich<br />
festgeschrieben und sichergestellt<br />
werden sollen. Eigentlich also<br />
alles nach Plan.<br />
Wobei, die Ministerin selbst schien wohl<br />
auch geahnt zu haben, dass dieser Vorgang<br />
kein x-beliebiges Dienstgeschäft sein<br />
würde, schickte sie doch den Entwurf zur<br />
Frühkoordination ins Kanzleramt, statt an<br />
die anderen Ministerien. Das macht man,<br />
wenn man weiß, dass Streit droht.<br />
Und tatsächlich reagierten viele, insbesondere<br />
die Unionsfraktion, mit öffentlicher,<br />
lauter Entrüstung. Warum? Nun, der<br />
Entwurf birgt politischen Sprengstoff: Er<br />
nimmt die Pariser Klimaziele für bare Münze<br />
und dekliniert das durch, so dass herauskommt,<br />
dass die deutsche Volkswirtschaft<br />
bis 2050 um mindestens 95 Prozent dekarbonisiert<br />
werden muss. Und wer hier nicht<br />
nur Lippenbekenntnisse abgeben, sondern<br />
Taten folgen lassen will, der muss die Sektoren<br />
Strom, Wärme, Verkehr, Industrie und<br />
Landwirtschaft ganz gewaltig umkrempeln.<br />
Das bedeutet, beim Wähler nicht unbedingt<br />
populäre Maßnahmen anzugehen – und darin<br />
liegt vermutlich auch der Hauptgrund<br />
für den Widerstand. Da man das aber nicht<br />
öffentlich diskutieren kann, diskutiert man<br />
stattdessen das Für und Wider der Detailvorschläge<br />
des BMU, und meidet die eigentlichen<br />
politischen Kernfragen.<br />
Reichlich Kritik gab es so an dem geplanten<br />
Mechanismus der Zuweisung von Treibhausgasemissionen<br />
zu den Sektoren und daraus<br />
folgenden (Budget!)-Verantwortlichkeiten<br />
der Ressorts. Man mag zu diesen Detailregelungen<br />
stehen, wie man will: Das BMU<br />
hat einen Vorstoß gewagt, der die Erneuerbaren<br />
Energien endgültig als die zentrale<br />
Säule des Klimaschutzes etablieren würde.<br />
Erstentwurf mit „Mantelgesetz“ –<br />
„Maßnahmengesetz“ folgt<br />
Und auch Biogas, Holz und andere Bioenergieformen<br />
dürften dann vollends eine<br />
Renaissance erleben: Alles, aber auch alles<br />
würde händeringend gebraucht, um die<br />
ambitionierten Ziele der Bundesregierung<br />
zu erfüllen. Und das nun im Erstentwurf<br />
vorliegende so genannte „Mantelgesetz“<br />
ist erst der Auftakt – im darauf folgenden<br />
„Maßnahmengesetz“ erhoffen wir uns als<br />
Branche konkrete Impulse für Erhalt, Optimierung<br />
und neue Potenzialerschließungen<br />
der Biomasse – eigene Vorschläge haben wir<br />
bereits unterbreitet.<br />
Bis dieser erste Entwurf als Klimaschutzgesetz<br />
verabschiedet wird, stehen sicherlich<br />
noch einige Veränderungen bevor, doch als<br />
erster Aufschlag ist er allemal vielversprechend.<br />
Es bleibt zu hoffen, dass das Gesetz<br />
nicht gänzlich an machtpolitischen Erwägungen<br />
scheitert. Wobei, vielleicht spielen<br />
uns als Erneuerbaren gerade diese machtpolitischen<br />
Dynamiken sogar am Ende noch<br />
in die Hände. Und zwar bei einer anderen<br />
zentralen Forderung des Fachverbandes<br />
Biogas e.V., des Bundesverbandes Erneuerbare<br />
Energie e.V., aber auch mittlerweile<br />
vieler weiterer Verbände sowie weiter Teile<br />
der Industrie: der Einführung eines CO 2<br />
-<br />
Preises.<br />
Diese Forderung war es, die bislang bei<br />
den gleichen Gegnern eine ähnliche Totalblockade<br />
wie nun das Klimaschutzgesetz<br />
ausgelöst hatte. Nun, so scheint es, betrachtet<br />
man dies in einem anderen Licht<br />
und scheint gewillt, darüber zumindest zu<br />
diskutieren – die neue Parteivorsitzende<br />
der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, hat<br />
dies angekündigt. Denn irgendetwas, das ist<br />
zumindest offenbar allen klar, gilt es nun<br />
anzupacken in Sachen Klimaschutz – allein<br />
schon, um nach der nächsten Bundestagswahl<br />
womöglich Bündnisse mit gewissen<br />
anderen Parteien grundsätzlich eingehen<br />
zu können, die genau diese Fragen des Klimaschutzes<br />
zur Gretchenfrage machen.<br />
Autoren<br />
Sandra Rostek<br />
Leiterin des Berliner Büros<br />
des Fachverbandes Biogas e.V.<br />
und Dr. Guido Ehrhardt<br />
Leiter des Referats Politik<br />
des Fachverbandes Biogas e.V.<br />
Invalidenstr. 91 · 10115 Berlin<br />
030/2 75 81 79-0<br />
biogas@berlin.org<br />
Grafik: Fotolia_ j-mel<br />
24
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Politik<br />
Gemeinschaftlich. Vorausdenkend.<br />
Engagiert.<br />
Biogaskongress <strong>2019</strong><br />
9. / 10. September in Leipzig<br />
»Mit Hochdruck für unser Klima.«<br />
(unbekannt)<br />
Kontakt<br />
Christian Falke<br />
Salomonstr. 19, 04103 Leipzig<br />
Telefon: 0341/978566-0<br />
Fax: 0341/978566-99<br />
E-Mail: kontakt@prometheus-recht.de<br />
www.prometheus-recht.de<br />
© Christian Schwier - www.stockadobe.com<br />
Alle Infos unter www.fnr.de/biogaskongress<br />
Ideeller Partner<br />
Termin bitte<br />
vormerken<br />
Medienpartner<br />
Save the date!<br />
» Aktuelle Vorträge aus der<br />
Branche für die Branche<br />
» Exklusive Workshops<br />
» Leitthemen:<br />
· Zukunftschancen<br />
· Sicherheit<br />
· Effizienz<br />
· Recht<br />
· EEG<br />
· Gärprodukte<br />
· Abfallvergärung<br />
· Innovationen<br />
· Biogas International<br />
10. – 12. Dezember <strong>2019</strong><br />
NCC Mitte, Messegelände Nürnberg<br />
Mit großer Fachausstellung, Ausstellerforum<br />
und Abendveranstaltung<br />
Aktuelle Informationen und Anmeldung:<br />
www.biogas-convention.com<br />
Lehrfahrt<br />
Biogasanlagen<br />
am 13. Dezember<br />
25
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Biomethan<br />
Kleiner Anlagenzubau im Jahr 2018<br />
Der Neubau von Anlagen, die Biomethan ins Erdgasnetz einspeisen, stagniert weiter im unteren<br />
einstelligen Bereich. Dennoch erreichte die Gesamtanlagenzahl die magische Schwelle von 200.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Im vergangenen Jahr sind vier neue Biomethaneinspeiseanlagen<br />
ans deutsche<br />
Erdgasnetz angeschlossen worden (siehe<br />
Abbildung 1). Das ist eine Anlage<br />
mehr als in 2017. Ende 2018 speisten<br />
insgesamt 200 Anlagen Biomethan in das<br />
deutsche Erdgasnetz ein. Die neu errichtete<br />
Rohgasaufbereitungskapazität erreichte<br />
im vergangenen Jahr 3.200 Normkubikmeter<br />
pro Stunde (siehe Abbildung 2). Zwei<br />
der neuen Einspeiseanlagen wurden in<br />
Mecklenburg-Vorpommern, eine in Rheinland-Pfalz<br />
und eine in Hessen gebaut. Insgesamt<br />
verteilen sich die Anlagen auf die<br />
Bundesländer wie folgt:<br />
Niedersachsen: 31<br />
Sachsen-Anhalt: 33<br />
Bayern: 18<br />
Brandenburg: 24<br />
Hessen: 14 (+1)<br />
Nordrhein-Westfalen: 14<br />
Mecklenburg-Vorpommern: 18 (+2)<br />
Sachsen: 13<br />
Baden-Württemberg: 13<br />
Thüringen: 9<br />
Schleswig-Holstein: 4<br />
Rheinland-Pfalz: 6 (+1)<br />
Berlin, Saarland, Hamburg: je 1<br />
Die Einspeiseanlagen verfügen über Rohgasaufbereitungskapazitäten<br />
zwischen 500<br />
von 1.400 Normkubikmetern pro Stunde.<br />
Die Rohgasaufbereitungskapazität beträgt<br />
in Summe für das zurückliegende Jahr<br />
3.200 Normkubikmeter pro Stunde. Sie<br />
liegt damit 1.700 Normkubikmeter niedriger<br />
als in 2017. Die gesamte in Deutschland<br />
errichtete Rohgasaufbereitungskapazität<br />
stieg bis Ende 2018 auf 210.765<br />
Normkubikmeter pro Stunde an. In der Zahl<br />
enthalten ist auch der Austausch einer alten<br />
Aufbereitungsanlage durch ein neues, leistungsfähigeres<br />
System.<br />
Eine der neuen Anlagen des vergangenen<br />
Jahres vergärt nachwachsende Rohstoffe.<br />
Die anderen drei setzen Bioabfall und industrielle<br />
Abfälle ein. Eine der Anlagen reinigt<br />
das Rohgas mittels Membrantechnik, eine<br />
nutzt ein physikalisches Waschverfahren,<br />
die dritte Anlage reinigt das Rohgas mit der<br />
drucklosen Aminwäsche. Für die vierte Anlage<br />
konnte bis Redaktionsschluss das Reinigungsverfahren<br />
nicht ermittelt werden.<br />
Abbildung 1: Entwicklung Entwicklung der Zahl der Zahl der Biomethaneinspeiseanlagen der Biomethaneinspeiseanlagen in Deutschland, in Deutschland, jährlicher jährlicher Zubau Zubau seit 2006 seit 2006<br />
35<br />
35<br />
30<br />
32<br />
29<br />
25<br />
20<br />
19<br />
23<br />
15<br />
17<br />
16<br />
10<br />
10<br />
5<br />
7<br />
3<br />
4<br />
0<br />
2 3<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018<br />
Quelle: Fachverband Biogas e.V., Stand: 08. April <strong>2019</strong><br />
Quelle: Fachverband Biogas e.V., Stand: 08. April <strong>2019</strong><br />
26
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
praxis / Titel<br />
Foto: HZI BioMethan GmbH<br />
27
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Entwicklung der Rohgasaufbereitungskapazität in Nm 3 /h in Deutschland,<br />
jährlicher Zubau seit 2006 und kumuliert<br />
Abbildung 2: Entwicklung der Rohgasaufbereitungskapazität in Nm 3 /h in Deutschland, jährlicher Zubau seit 2006 und kumuliert<br />
250.000<br />
200.000<br />
175.165<br />
190.465<br />
202.665<br />
207.565 210.765<br />
150.000<br />
125.065<br />
151.915<br />
100.000<br />
50.000<br />
0<br />
89.865<br />
36.835 56.665<br />
33.200 35.200<br />
28.250 19.830<br />
26.850 23.250<br />
15.300<br />
3.950<br />
12.200<br />
1.000 2.950<br />
4.635<br />
8.585<br />
4.900 3.200<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018<br />
Quelle: Fachverband Biogas e.V., Stand: 08. April <strong>2019</strong><br />
Quelle: Fachverband Biogas e.V., Stand: 08. April <strong>2019</strong><br />
Jährl. Zubau d. Rohgasaufbereitungskapazität in Nm³/h<br />
Kumulierter Zubau d. Rohgasaufbereitungskapazität<br />
Bei einer durchschnittlichen jährlichen Laufzeit von<br />
rund 8.500 Stunden können die 200 am Erdgasnetz<br />
befindlichen Anlagen 1,79 Milliarden (Mrd.) Kubikmeter<br />
Rohbiogas verarbeiten. Setzt man einen Methangehalt<br />
des Rohbiogases von durchschnittlich 55 Prozent<br />
an, weil die überwiegende Zahl der Anlagen nachwachsende<br />
Rohstoffe vergärt, so können jährlich theoretisch<br />
rund 985 Millionen Kubikmeter Biomethan ins deutsche<br />
Erdgasnetz eingespeist werden. Das entspricht<br />
etwa 16 Prozent des 2018 in Deutschland geförderten<br />
Erdgases.<br />
Die heimische Erdgasförderung ist in 2018 um 12,7<br />
Prozent auf 61,6 Mrd. Kilowattstunden (kWh) zurückgegangen.<br />
Bezogen auf den Erdgasverbrauch in<br />
Deutschland im vergangenen Jahr stammt aus Biomethan<br />
1 Prozent. Die aktuelle Produktionsmenge<br />
reicht zudem, um rund 2,8 Millionen deutsche Haushalte<br />
(Verbrauch von 3.500 kWh Wärme pro Jahr) mit<br />
Biomethan voll zu versorgen.<br />
Ausblick: Der Neubau von Biomethaneinspeiseanlagen<br />
wird in <strong>2019</strong> voraussichtlich im einstelligen Bereich<br />
bleiben. Eine Anlage war Anfang dieses Jahres in Betrieb<br />
gegangen, drei weitere Anlagen befanden sich mit<br />
Stand April noch in der Bauphase.<br />
2018: Erdgasverbrauch gesunken<br />
Der Erdgasverbrauch in Deutschland ging 2018 laut<br />
AG Energiebilanzen um gut 7,3 Prozent auf 933,9 Milliarden<br />
Kilowattstunden (kWh) oder auf rund 93 Mrd.<br />
Kubikmeter Gas zurück. „Nachdem die kalte Witterung<br />
im 1. Quartal für einen deutlichen Verbrauchsanstieg<br />
gesorgt hatte, kam es im Jahresverlauf durch höhere<br />
Temperaturen zu Verbrauchsrückgängen im Raumwärmemarkt.<br />
Einfluss auf den Verbrauchsrückgang<br />
im Gesamtjahr hatten zudem der weitere Anstieg der<br />
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sowie die<br />
Preisentwicklung“, erklärt die AG Energiebilanzen.<br />
Die AG schreibt weiter: „Der Erdgasverbrauch erreichte<br />
2018 einen Wert von 3.071 Petajoule (PJ) und lag damit<br />
um 1,6 Prozent unter dem Vorjahr. Hauptgrund für<br />
diesen Rückgang war der geringere Erdgaseinsatz für<br />
Wärmezwecke, da es um rund 7,5 Prozent wärmer war<br />
als 2017 und um 12,3 Prozent milder als im langjährigen<br />
Durchschnitt. Gegen Jahresende führte der Produktionsrückgang<br />
in der chemischen Industrie zu einer<br />
rückläufigen Nachfrage nach Erdgas. Zudem wurde<br />
2018 weniger Erdgas zur Stromerzeugung eingesetzt.“<br />
Im Bericht der AG Energiebilanzen wird weiter ausgeführt:<br />
„Der Anteil von Erdgas am gesamten Primärenergieverbrauch<br />
stieg verglichen mit 2017 von 23,2<br />
auf 23,8 Prozent im Jahr 2018. In Summe wurde der<br />
Erdgasverbrauch Deutschlands zu rund 6 Prozent<br />
aus inländischen Erdgasquellen gedeckt. […] Rund<br />
70 Prozent seines Energiebedarfs muss Deutschland<br />
durch Importe decken. Zum mit Abstand wichtigsten<br />
Lieferanten hat sich Russland entwickelt.“<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
0 54 09/90 69 426<br />
martin.bensmann@biogas.org<br />
28
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Schubbodensanierung<br />
in verstärkter<br />
Edelstahl-Lösung<br />
Axel Hagemeier GmbH & Co. KG<br />
Am Wasserfeld 8 • 27389 Fintel<br />
Tel.: 04265 / 13 65<br />
Fax: 04265 / 83 94<br />
E-Mail: info@axel-hagemeier.de<br />
Web: www.axel-hagemeier.de<br />
M I K - Service<br />
Günstig & Bewährt –<br />
einfache Technik<br />
N E U / oder Ersatzteile<br />
Reparatur gängiger Typen<br />
Tel. 04441-921477<br />
49377 Vechta<br />
Fax 921478 / www.mik-service.de<br />
praxis / Titel<br />
Visuelle<br />
Kontrolle Ihrer<br />
Biogas-Produktion<br />
Lumiglas optimiert Ihren<br />
Biogas-Prozess<br />
• Fernbeobachtung mit dem<br />
Lumiglas Ex-Kamera-System<br />
• Lokale oder globale Paketlösungen<br />
schaffen kostengünstig Sicherheit<br />
... UND ALLES AUS EINER HAND! www.paulmichl-gmbh.de<br />
PAULMICHL GmbH Kisslegger Straße 13 · 88299 Leutkirch · Tel. 0 75 63/84 71 · Fax 0 75 63/80 12<br />
Alter beschädigter Kolben Altes Gummi ist entfernt Der erneut vulkanisierte Kolben<br />
Info-Material<br />
gleich heute anfordern!<br />
Segment-Kolben Linear-Kolben Flügel-Kolben<br />
Registrieren und sofort Kaufen in unserem Webshop<br />
WWW.BENEDICT-THO.NL | E: info@benedict-tho.nl | T: 0031 545 482157 |<br />
29<br />
F.H. Papenmeier GmbH & Co.KG<br />
Telefon 0 23 04-205-0<br />
info.lumi@papenmeier.de<br />
www.lumiglas.de
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Biomethan auf die Straße bringen –<br />
Marktanreize und Fördermechanismen<br />
Foto: Hafen Hamburg/Christian Modla/Verbio AG<br />
Neben den fünf<br />
VERBIO-eigenen CNG/<br />
Biomethan-Lkw der<br />
Marke IVECO betreibt<br />
die Zippel-Gruppe<br />
deutschlandweit mit<br />
ihren SCANIA Fahrzeugen<br />
die zweitgrößte<br />
Flotte im Güterverkehr,<br />
die den neuartigen<br />
Kraftstoff einsetzt.<br />
Die Bundesregierung<br />
fördert die Anschaffung<br />
von Erdgasfahrzeugen.<br />
Die Strom- und Wärmebereitstellung waren in den vergangenen Jahren die Anwendungen,<br />
in denen sich Biogas besonders durchgesetzt hat. An weit über 9.000 Biogasanlagen mit<br />
einer kumulierten elektrischen Leistung von etwa 5 Terawatt wird jährlich so viel Strom<br />
produziert, wie es etwa 10 Millionen deutsche Haushalte brauchen. Neben den Sektoren<br />
Strom und Wärme gibt es noch einen Anwendungsbereich, in dem sich Biogas in seiner<br />
aufbereiteten Form als Biomethan bislang nicht richtig etablieren konnte: der Mobilitätssektor.<br />
Dieser Artikel behandelt Aspekte der Etablierung von Biomethan auf dem Kraftstoffmarkt:<br />
gesetzliche Anreize und vorhandene Stolpersteine.<br />
Von Dipl.-Ing. Alexey Mozgovoy<br />
Diversen Analysen zufolge liegt das realistische<br />
nachhaltige und noch nicht genutzte<br />
Biogaspotenzial wie etwa aus Rest- und<br />
Abfallstoffen bei rund 80 Terawattstunden<br />
(TWh). Dabei wurden im Jahr 2017 nur 9,8<br />
TWh Biomethan ins Gasnetz eingespeist. In den Jahren<br />
2016 und 2017 lag die Nutzung von Biomethan im<br />
Kraftstoffsektor, bezogen auf die jährlich produzierte<br />
Biomethanmenge, bei etwa 4 Prozent. Im Jahr 2017<br />
lag der energetische Anteil von Biomethan im Kraftstoffsektor<br />
unter den Erneuerbaren Energien nur bei<br />
1,1 Prozent und machte damit weniger als 0,1 Prozent<br />
im gesamten deutschen Kraftstoffmix aus.<br />
Komprimiertes Biomethan besitzt gleiche physikalisch-chemische<br />
Eigenschaften wie andere methanbasierte<br />
komprimierte Gase, so auch CNG aus Erdgas<br />
oder synthetisches Methan aus der Power-to-Gas-Produktion,<br />
und wird deshalb als Kraftstoff an Erdgastankstellen<br />
verkauft. Die Biomethanerzeugung kann<br />
auch für Post-EEG-Biogasanlagen eine interessante<br />
Option darstellen. Alternativ oder parallel zu der Verstromung<br />
des Biogases kann auch die Bereitstellung<br />
von Biomethan erfolgen. Aus ökologischer Sicht zeigt<br />
die Nutzung von Biomethan klare Vorteile: Dafür sprechen<br />
seine Treibhausgasbilanz (THG) und niedrige<br />
Fahrzeugemissionen. Beispielsweise liegen die THG-<br />
Emissionswerte der Biomethanerzeugung im Fall der<br />
Nutzung tierischer Exkremente im negativen Zahlenbereich,<br />
was durch die Emissionseinsparungen aufgrund<br />
der Nutzung von Frischmist und Frischgülle resultiert.<br />
Auch das Gasfahrzeug selbst erzeugt im Vergleich zum<br />
Dieselantrieb geringere Emissionen: Der Einsatz des<br />
Gasantriebs führt zu einer signifikanten Minderung von<br />
Verkehrslärm, NOx-Emissionen und Feinstaubausstoß.<br />
Rechtliche Rahmenbedingungen als<br />
Anreiz für den Biomethaneinsatz<br />
Ökologische Vorteile der Nutzung von Biomethan können<br />
erst durch seine Etablierung auf dem Markt realisiert<br />
werden. Dafür bedürfen die Marktteilnehmer eines<br />
spürbaren Anreizes, da das Umweltbewusstsein der<br />
Akteure dafür meist leider kein ausreichender Antrieb<br />
30
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
praxis / Titel<br />
Foto: IVECO<br />
ist. Hier greift nun der Gesetzgeber ein. Die Bestrebung,<br />
in Anlehnung an die THG-Minderungsziele im<br />
Rahmen des Pariser Klimaschutzübereinkommens den<br />
Anteil Erneuerbarer Energie im Energieverbrauch und<br />
darunter auch im Kraftstoffmarkt zu steigern, zieht sich<br />
als roter Faden durch die überarbeitete Erneuerbare-<br />
Energien-Richtlinie (RED II) der EU.<br />
Die RED II formuliert ein verbindliches EU-Ziel von<br />
mindestens 32 Prozent für den Anteil Erneuerbarer<br />
Energien bis zum Jahr 2030, um eine THG-Einsparung<br />
um mindestens 40 Prozent gegenüber dem Stand von<br />
1990 zu erreichen. Nach der RED II, die bis zum Jahr<br />
2021 in nationales Recht umgesetzt werden muss, soll<br />
der Mindestanteil Erneuerbarer Energie im Verkehrssektor<br />
auf 14 Prozent angehoben werden. Als Anreiz<br />
für die Etablierung besonders nachhaltiger Kraftstoffe<br />
beziehungsweise Energien legte der Gesetzgeber Quoten<br />
und auch eine mehrfache Anrechnung fest.<br />
Biomethan, das aus den im Anhang IX, Teil A aufgeführten<br />
Rohstoffen – unter anderem Stroh und tierische<br />
Exkremente – produziert wird, darf auf die Quote angerechnet<br />
werden. Der Anteil solcher Kraftstoffe soll im<br />
Jahr 2022 mindestens 0,2 Prozent, 2025 mindestens<br />
1 Prozent und im Jahr 2030 mindestens 3,5 Prozent<br />
betragen.<br />
Die bereits im Jahr 2009 verabschiedete erste Fassung<br />
der RED bewirkte eine Anpassung des nationalen<br />
rechtlichen Rahmens, was unter anderem das Bundes-<br />
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) betraf. Infolgedessen<br />
wurde die bisher angewandte energetische<br />
Biokraftstoffquote durch die THG-Minderungsquote<br />
abgelöst. Seit dem Jahr 2015 sind die Inverkehrbringer<br />
von Kraftstoffen verpflichtet, die THG-Emissionen der<br />
von ihnen jährlich in Verkehr gebrachten Kraftstoffe um<br />
einen festgelegten Prozentsatz gegenüber ihrem jeweilig<br />
individuell berechneten Referenzwert zu mindern.<br />
Seit der Einführung stieg der Prozentsatz der THG-<br />
Minderung von 3,5 Prozent ab dem Jahr 2017 auf 4<br />
Prozent und soll ab 2020 auf 6 Prozent steigen.<br />
Als mögliche Optionen greifen die Verpflichteten zur<br />
physischen Beimischung von Biokraftstoffen beziehungsweise<br />
Übertragung von Quoten zurück. Dabei<br />
werden aus Effizienzgründen Beimischkraftstoffe<br />
bevorzugt, die über das größte THG-Einsparpotenzial<br />
verfügen. Hier schneidet Biomethan besonders gut ab.<br />
Laut der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung<br />
lag der durchschnittliche THG-Emissionswert von<br />
Biomethan aus Abfall- und Reststoffen im Jahr 2017<br />
sogar im einstelligen Bereich, nämlich bei 7,77 Gramm<br />
CO 2<br />
-Äquivalent pro Megajoule, was im Vergleich mit<br />
dem Basiswert 94,1 Gramm CO 2<br />
-Äquivalent pro Megajoule<br />
nach Paragraf 3 der 38. Bundes-Immissionsschutzverordnung<br />
(BImSchV) eine signifikante THG-<br />
Einsparung pro eingesetzte Energieeinheit bedeutet.<br />
Der THG-Quotenhandel mit Biomethan wird durch den<br />
Abschluss des Kaufvertrags zwischen dem Betreiber<br />
einer CNG-Tankstelle und dem Verpflichteten ermöglicht.<br />
In diesem Kaufvertrag wird unter anderem die<br />
zu übertragene THG-Quotenmenge beziehungsweise<br />
die mit dem produzierten Biomethan erreichte THG-<br />
Einsparung fixiert. Dabei müssen beide Parteien die<br />
in einem Kalenderjahr in Verkehr gebrachte Quotenmenge<br />
bis spätestens 15. April des Folgejahres an die<br />
zuständige Biokraftstoffquotenstelle melden. Der Handel<br />
mit den THG-Quotenmengen ermöglicht dem Betreiber<br />
einer CNG-Tankstelle einen zusätzlichen Erlös<br />
zum Kraftstoffverkauf. Biomethanproduzenten können<br />
an diesem Geschäftsmodell auch direkt partizipieren,<br />
indem sie das biogene CNG an eigenen Zapfsäulen in<br />
Verkehr bringen.<br />
Die Erzeugung der THG-Quotenmenge, die im weiteren<br />
Verlauf dem Verpflichteten übertragen werden darf,<br />
benötigt eine entsprechende Zertifizierung des Biomethanproduktionsbetriebs<br />
– der letzten Schnittstelle<br />
im Sinne des Paragrafen 2 der Biokraftstoffnachhaltigkeitsverordnung<br />
(Biokraft-NachV). Das THG-Minderungspotenzial<br />
des Biomethans sowie die gelieferte<br />
Energiemenge werden für den Verpflichteten in einem<br />
Nachhaltigkeitsnachweis ausgewiesen, dessen Umfang<br />
die Biokraft-NachV beschreibt.<br />
Die Berechnung der THG-Einsparung erfolgt nach folgender<br />
Formel [11]:<br />
Einsparung = (EF-EB)/EF<br />
mit EB – Gesamtemissionen bei der Verwendung des<br />
Biokraftstoffs,<br />
EF – Referenzwert bzw. Gesamtemissionen des Komparators<br />
für Fossilbrennstoffe im Verkehrssektor.<br />
Der THG-Referenzwert EF berechnet sich durch Multiplikation<br />
des Basiswertes mit der in Verkehr gebrachten<br />
energetischen Menge fossilen Otto- und fossilen Dieselkraftstoffs<br />
zuzüglich der vom Verpflichteten in Verkehr<br />
gebrachten energetischen Menge an Biokraftstoff. Die<br />
Iveco Stralis NP 460 –<br />
Lkw mit Gasantrieb.<br />
Mit Biomethan betankt,<br />
fährt er noch umweltfreundlicher.<br />
31
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Die Biomethanerzeugung kann auch für Post-EEG-Biogasanlagen eine interessante Option darstellen. Alternativ<br />
oder parallel zu der Verstromung des Biogases kann auch die Bereitstellung von Biomethan erfolgen.<br />
THG-Gesamtemissionen von Biokraftstoffen<br />
EB berechnen sich durch Multiplikation<br />
der im Nachhaltigkeitsnachweis ausgewiesenen<br />
THG-Emissionen mit der vom Verpflichteten<br />
in Verkehr gebrachten energetischen<br />
Menge Biokraftstoff.<br />
Die THG-Emissionen der Biokraftstoffe<br />
können auf der Basis des vorgegebenen<br />
THG-Standardwertes ermittelt werden. Alternativ<br />
ist die Berechnungsformel nach der<br />
Anlage 1 der Biokraft-NachV zu verwenden,<br />
die es eventuell ermöglichen kann, nicht<br />
ausgeschöpfte THG-Einsparpotenziale des<br />
Betriebs zu erschließen. Hierfür kann der<br />
typische THG-Emissionswert als Richtwert<br />
für mögliche erzielbare Einsparungen in<br />
Betracht gezogen werden. Die in der Anlage<br />
1 der Biokraft-NachV erwähnte Formel<br />
ist auch dann anzuwenden, wenn für das<br />
eingesetzte Substrat kein Standardwert<br />
angegeben wird, was beispielsweise in den<br />
aktuellen Fassungen der RED II und der<br />
Biokraft-NachV Blüh- und Honigpflanzen<br />
betrifft.<br />
Fördermechanismen für Endnutzer<br />
Die relativ geringe Anzahl von CNG-Fahrzeugen<br />
war bislang eine der größten Hürden<br />
für die Durchsetzung von Biomethan<br />
auf dem Kraftstoffmarkt. So blieb die Zahl<br />
CNG-angetriebener Pkw mit Stand 1. Januar<br />
2018 bei etwa 75.500 Fahrzeugen. Der<br />
Bestand an Bussen bzw. Lkw mit CNG-Antrieb<br />
fiel dabei deutlich geringer aus. Diesen<br />
Zahlen sollen kürzlich eingeführte Förderinstrumente<br />
der Bundesregierung entgegenwirken,<br />
die die Kosten der Anschaffung und<br />
des Betriebs der Gasfahrzeuge reduzieren<br />
sollen. Bereits seit einigen Jahren gilt für<br />
gasförmige Kohlenwasserstoffe ein reduzierter<br />
Energiesteuersatz in Höhe von 13,90<br />
Euro pro Megawattstunde (EUR/MWh) statt<br />
den 31,80 EUR/MWh für Erdgas und sonstige<br />
gasförmige Kohlenwasserstoffe. Zuletzt<br />
wurde diese Maßnahme im Jahr 2017 verlängert,<br />
was ein signifikantes Wachstum<br />
der Zulassungszahlen für CNG-Fahrzeuge<br />
bewirkte. Die aktuelle Minderung des Energiesteuersatzes<br />
gilt nun bis Ende des Jahres<br />
2023.<br />
Die seit dem 1. Januar <strong>2019</strong> in Kraft gesetzte<br />
Mautbefreiung für Fahrzeuge mit<br />
Gasantrieb, die bis Ende des Jahres 2020<br />
gilt, soll je nach Fahrzeug bis zu 18,7 Eurocent<br />
pro gefahrenem Kilometer Ersparnis<br />
bedeuten. Unter der Berücksichtigung der<br />
Fahrleistung des Lkw – unter anderem auf<br />
mautpflichtigen Straßen und seiner Gewichtsklasse<br />
– kann die jährliche Ersparnis<br />
einen signifikanten Beitrag bedeuten.<br />
Auch die Anschaffung von Gasantrieben<br />
wird durch die Bundesregierung gezielt<br />
gefördert. Dabei wird der Schwerpunkt<br />
auf Lastkraftmobilität gesetzt. Seit seiner<br />
Einführung Mitte letzten Jahres stieß das<br />
vom Bundesministerium für Verkehr und<br />
digitale Infrastruktur installierte Förderprogramm<br />
für energieeffiziente und/oder CO 2<br />
-<br />
arme schwere Nutzfahrzeuge auf eine große<br />
Resonanz. Mit Stand Anfang März <strong>2019</strong><br />
betrug die Zahl der Lkw, deren Erwerb aus<br />
den Fördermitteln bezuschusst wird, etwa<br />
250 Fahrzeuge mit CNG-Antrieb und über<br />
600 Fahrzeuge, die für den Betrieb mit<br />
flüssigem Biomethan beziehungsweise LNG<br />
(Flüssigerdgas) geeignet sind. Dem Markteintritt<br />
von verflüssigtem Biomethan soll die<br />
anstehende Novellierung der 38. BImSchV<br />
Foto: Adobe Stock_vschlichting<br />
verhelfen. Der aktuelle Referentenentwurf<br />
dazu sieht die Anerkennung dieses Kraftstoffs<br />
für die THG-Minderung vor, was vom<br />
Fachverband Biogas ausdrücklich begrüßt<br />
wird.<br />
Ausblick und Zusammenfassung<br />
Die geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen<br />
sowie die Etablierung von Förderinstrumenten<br />
für alternative Antriebe geben<br />
dem Thema Gasmobilität neue Impulse.<br />
Beide Seiten – sowohl der Betreiber der<br />
Biogasanlage als auch der Fahrzeughalter<br />
– werden direkt oder indirekt angeregt,<br />
den Kraftstoff Biomethan zu entdecken.<br />
Die Möglichkeit, durch die Herstellung von<br />
Biomethan auch THG-Quotenmengen zu<br />
generieren und diese zu vermarkten, die es<br />
bereits seit dem Jahr 2015 gibt, wird durch<br />
die Vorgaben der RED II für Biomethanproduzenten<br />
zu einer besonders interessanten<br />
Option.<br />
Die Umsetzung der Bestimmungen der RED<br />
II, unter anderem hinsichtlich der aktualisierten<br />
Standardwerte für die THG-Emissionen<br />
der Biokraftstoffe, sollte sich für die<br />
Biomethanhersteller positiv auswirken, da<br />
die aktuell geltenden Werte wesentlich reduziert<br />
sind. So bekommt Biomethan aus<br />
Gülle, das in einer Anlage mit geschlossenem<br />
Gärdüngerlager und Abgasverbrennung<br />
erzeugt wird, den THG-Standardwert<br />
minus 100 Gramm CO 2<br />
-Äquivalent pro Megajoule.<br />
Es gibt jedoch viele politische Stellschrauben,<br />
die es noch zu optimieren gilt. Die<br />
festgelegte Quote für fortschrittliche Biokraftstoffe<br />
wirkt mit Blick auf den doppelten<br />
Anrechnungsfaktor nicht ambitioniert genug:<br />
Der reelle energetische Mindestanteil<br />
für das Ausbauziel 2030 beträgt dadurch<br />
nur 1,75 Prozent. Um den administrativen<br />
Aufwand für den Biomethanproduzenten zu<br />
reduzieren, sollen THG-Standardwerte auch<br />
für weitere Substrate eingeführt werden,<br />
Blüh- und Honigpflanzen gehören dabei in<br />
die Liste der Substrate für die Herstellung<br />
fortschrittlicher Kraftstoffe.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. Alexey Mozgovoy<br />
Leiter Stabsstelle Kraftstoff und Biomethan<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
030/2 75 81 79 23<br />
alexey.mozgovoy@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
32
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
praxis / Titel<br />
Kälte- und Wärmespeichersysteme für:<br />
› Wärme- und Kältenetze<br />
› Industrieanlagen<br />
› Gebäudetechnik<br />
› Landwirtschaft<br />
› Prozesstechnik<br />
› Energiepuffer<br />
CO-lOCATED WITh<br />
+49 4392 9177-0<br />
info@farmatic.com | farmatic.com<br />
a brand of<br />
Thanks to<br />
our sponsors<br />
FREE-TO-ATTEND<br />
REGISTER NOW<br />
3rd - 4th July <strong>2019</strong> NEC, Birmingham, UK<br />
www.biogastradeshow.com<br />
Events organised by<br />
WIR BRINGEN<br />
IHR BIOMETHAN AN DIE TANKSTELLE.<br />
IHR BIOMETHAN IN GUTEN HÄNDEN.<br />
Profitieren Sie von unserem breiten Netzwerk. Wir vermarkten Ihr<br />
Biomethan in die Sektoren Kraftstoff, Wärme und KWK. Als Dienstleister<br />
kümmern wir uns auch um alle notwendigen Schritte – von<br />
Transport über Nachweisführung bis zur Quotenvermarktung.<br />
Vertrauen auch Sie auf die Landwärme.<br />
33<br />
www.landwaerme.de
praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Interview<br />
Durchwachsene Silphie<br />
Anbau sachlich planen<br />
In den vergangenen drei Jahren wurde die Anbaufläche der Durchwachsenen Silphie in Deutschland, insbesondere<br />
aufgrund des innovativen Donau-Silphie-Aussaatverfahrens, um rund 3.000 Hektar ausgedehnt.<br />
Vereinzelt sind Biogasanlagenbetreiber aufgrund der vielen ökologischen Vorteile euphorisch und in großem<br />
Stil in den Anbau dieser Pflanze eingestiegen. Später bei der Realisierung der Methanerträge stellte sich<br />
Ernüchterung ein, weil die Pflanze eben nicht an Mais heranreicht.<br />
Im Gespräch mit Michael Dickeduisberg vom Zentrum für nachwachsende Rohstoffe der Landwirtschaftskammer<br />
NRW, der Empfehlungen und Hinweise zum Anbau der Silphie gibt.<br />
Interviewer: Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Biogas Journal: Welche ökologischen Vorteile<br />
hat die Durchwachsene Silphie gegenüber<br />
Silomais?<br />
Michael Dickeduisberg: Die Silphie ist eine<br />
mehrjährige Kultur mit tiefreichendem<br />
Wurzelsystem und einer ausgedehnten,<br />
sehr auffälligen gelben Blüte. Die lange<br />
und intensive Blütezeit ist ein Vorteil gegenüber<br />
dem Maisanbau. Honigbienen,<br />
Hummeln sowie weitere Insekten sind in<br />
der Silphie häufiger zu finden als im Mais.<br />
Ihr Vorkommen ist allerdings stark von der<br />
Umgebungslandschaft abhängig. In Regionen<br />
mit alternativem Nahrungsangebot,<br />
wie beispielsweise in kleinstrukturierter<br />
Agrarlandschaft mit vielen Feldrändern,<br />
finden Insekten auch abseits der Silphie<br />
Nahrung. Zudem ist es auch eine Frage der<br />
Betrachtungszeit. Einige Arten profitieren<br />
insbesondere von der lange andauernden<br />
Blüte bis Ende September. Daneben finden<br />
sich in der Silphie auch mehr Arten Begleitvegetation<br />
als im Mais.<br />
Im Frühjahr auflaufende Kräuter, wie die<br />
Kamille, können zur Blüte kommen, bevor<br />
sie von der Silphie überwachsen und unterdrückt<br />
werden. Ihr Vorkommen ist in der<br />
Regel nicht bekämpfungswürdig. Neben<br />
der markanten Blüte wirkt sich die Silphie<br />
sehr positiv auf den Boden aus. Ihr ganzjähriges<br />
Wachstum ist ein guter Schutz vor<br />
Bodenerosion. Das Wurzelsystem ist auch<br />
in niederschlagsreichen Wintermonaten<br />
in der Lage, den Boden zu halten und vor<br />
Erosion zu schützen und Nitrat vor Auswaschung<br />
in das Grundwasser zu fixieren. Aufgrund<br />
der Mehrjährigkeit kann die Silphie<br />
ein sehr tiefes und dichtes Wurzelwerk ausbilden.<br />
Da die Silphie während der Standzeit<br />
keiner Bodenbearbeitung unterzogen<br />
wird, steigt der Anteil mikrobieller Biomasse<br />
im Boden. Auch Regenwurmaktivitäten<br />
nehmen zu.<br />
Biogas Journal: Welche Standorte beziehungsweise<br />
Schläge eignen sich für den<br />
Anbau?<br />
Dickeduisberg: Gute Maisstandorte sind<br />
auch für die Silphie gut geeignet. Tiefgründige<br />
Böden eignen sich wegen der tiefen<br />
Durchwurzelung des Bodens sehr gut und<br />
ermöglichen der Silphie bei, einem gewissen<br />
Wasserhaltevermögen oder Nähe zum<br />
Grundwasser Trockenphasen besser zu tolerieren<br />
als einjährige Arten. In der Praxis<br />
wird die Silphie gerne zum ersten Ausprobieren<br />
auf kleinen Flächen mit einer ungünstigen<br />
Schlaggeometrie angebaut.<br />
Nach der Etablierung spart man sich für<br />
die nächsten etwa 15 Jahre das Drehen<br />
und Wenden auf kleinen Schlägen mit viel<br />
Vorgewende. Auch Schläge mit ungünstiger<br />
Lage und eher geringem Ertragsniveau werden<br />
gerne gewählt. Hier muss man sich aber<br />
im Klaren sein, dass die Silphie keine Wunderpflanze<br />
ist und auf schlechten Standorten<br />
keine Höchsterträge liefern kann.<br />
Biogas Journal: Welche Ertragserwartung<br />
kann man als Anbauer an die Silphie hinsichtlich<br />
Trockenmasse- und Methanertrag<br />
knüpfen?<br />
Dickeduisberg: Die Ertragserwartungen<br />
sind wie bei allen anderen Ackerkulturen<br />
stark von dem Standort, aber auch vom<br />
Management abhängig. Fehler bei der Bodenbearbeitung<br />
oder Aussaat lassen sich<br />
später nicht mehr korrigieren. Auf einigen<br />
Praxisflächen werden mit der Ernte sowie<br />
der Düngung irreversible Schäden produziert.<br />
Bei jeder Tätigkeit muss der Boden<br />
tragfähig und darf nicht durchnässt sein.<br />
Tiefe Spuren und Verdichtungen bleiben<br />
für die gesamte Standzeit erhalten.<br />
Fehlstellen aufgrund von Überfahren oder<br />
schlechtem Aufgang lassen sich durch<br />
Nachsaaten nicht korrigieren. Gut geführte<br />
Bestände erzielen an einigen Standorten<br />
wie in Thüringen etwas höhere Biomasseerträge<br />
als der Mais, an anderen Standorten<br />
sind aber etwas geringere Erträge im Mittel<br />
der Jahre die Regel. Dabei ist der Biomasseertrag<br />
auch von der Erntezeit abhängig.<br />
Ab September sinkt der Biomasseertrag<br />
durch Abbau von Stängelmaterial spürbar.<br />
Gleichzeitig sinkt auch die Methanausbeute<br />
von Ende August stark ab.<br />
Die spezifische Gasausbeute je Kilogramm<br />
organische Trockensubstanz wird in diversen<br />
Untersuchungen auf 70 bis 80 %<br />
vom Mais geschätzt, kann unter günstigen<br />
Umständen aber auch höher sein, bei sehr<br />
später Ernte aber auch geringer. Insbesondere<br />
bei späten Ernten ab Ende September<br />
wirken sich geringere Biomasseerträge und<br />
Gasausbeuten negativ auf den Methanhektarertrag<br />
im Vergleich zu Mais aus.<br />
Biogas Journal: Wie sieht der wirtschaftliche<br />
Vergleich zwischen Silphie und Silomais<br />
aus? Welchen Einfluss hat die Nut-<br />
34
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
praxis<br />
Tiefe Spuren und Verdichtungen auf Silphiefeldern aufgrund zu feuchter Erntebedingungen bleiben für die<br />
gesamte Standzeit erhalten. Hier im Bild ist zu sehen, dass die Silphie zwischen den Maisreihen wächst. Bei<br />
der Maisernte war der Boden zu nass.<br />
zungsdauer der Kultur Durchwachsene<br />
Silphie?<br />
Dickeduisberg: Die Wirtschaftlichkeit der<br />
Silphie ist maßgeblich von der Nutzungsdauer<br />
und dem Ertragsniveau abhängig.<br />
Im Vergleich zur gut bekannten Referenz<br />
Mais ist die Silphie bei nur siebenjähriger<br />
Nutzung um 165 Euro pro Hektar und<br />
Jahr günstiger in der Etablierung der Kultur<br />
(also ohne Ernte). Bei 15-jähriger Nutzung<br />
verteilen sich die Investitionskosten<br />
für die Kulturanlage entsprechend und<br />
führen zu einer Kostenersparnis gegenüber<br />
Mais von 350 Euro pro Hektar und<br />
Jahr.<br />
Dem stehen die geringeren Methanerträge<br />
entgegen, die allerdings stark vom<br />
Ertragsniveau des Standortes und der Erntezeit<br />
abhängig sind. Grundsätzlich ist der<br />
ökonomische Vergleich mit Mais aufgrund<br />
unterschiedlicher Systeme sehr schwer.<br />
Besser wäre ein Vergleich von Silphie mit<br />
einer Biogas-Fruchtfolge, die auch die<br />
Anlage von Zwischenfrüchten mit entsprechenden<br />
Kosten sowie den Wechsel von<br />
Kulturarten mit geringerer ökonomischer<br />
Leistung als Mais berücksichtigt.<br />
Ferner kann auch das Thema Greening<br />
einzelbetrieblich eine ökonomische Dimension<br />
haben, so dass der Greening-<br />
Faktor der Silphie mit 0,7 durchaus<br />
finanzielle Vorteile bietet. Ebenso die<br />
Verwendung alternativer Einsatzstoffe in<br />
Biogasanlagen. Erst unter Einbeziehung<br />
diverser Aspekte kann ein individueller<br />
ökonomischer Vergleich zwischen den Anbausystemen<br />
erfolgen.<br />
Biogas Journal: Wie lange wird es noch<br />
dauern, bis die Durchwachsene Silphie<br />
bundesweit so gut ist wie der Mais?<br />
Dickeduisberg: Die Frage ist, wie sich<br />
„gut“ definiert? Wenn der ökonomische<br />
Ertrag die einzige Maßzahl wäre, so dürften<br />
wohl kaum andere Kulturen als Mais<br />
für Biogasanlagen angebaut werden. Mit<br />
der Wahl unterschiedlicher Kulturen lässt<br />
sich nicht nur die Biodiversität steigern,<br />
sondern auch das Risiko, von einer Kultur<br />
abhängig zu sein, deutlich reduzieren. Bei<br />
Problemen wie mit dem Maiswurzelbohrer<br />
oder Maiszünsler achten viele Betriebe bereits<br />
auf eine ausgewogene Fruchtfolge.<br />
Die Silphie-Züchtung steht erst am Anfang.<br />
Ihr Ziel muss aber nicht das Ertragsniveau<br />
von Mais sein, das vermutlich auch nicht<br />
erreicht werden kann. Vielmehr soll sie ein<br />
ergänzender Baustein in der Kulturartenvielfalt<br />
sein. Geringere Erträge als Mais<br />
sollen durch gesteigerte Attraktivität für Insekten<br />
und Spaziergänger, Erosionsschutz<br />
etc. kompensiert werden. Nur dank Biogas<br />
verbindet die Silphie ökologische Vorteile<br />
mit einer wirtschaftlichen Nutzung.<br />
Weitere Infos finden Sie im Biogas Journal<br />
2_2018, Seite 40 bis 45 und 46 bis 49.<br />
Interviewer<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
0 54 09/90 69 426<br />
martin.bensmann@biogas.org<br />
Foto: Michael Dickeduisberg<br />
Rührwerk<br />
optimieren,<br />
Kosten<br />
reduzieren!<br />
Steigern Sie die Effizienz Ihrer<br />
Bio gas anlage und reduzieren Sie<br />
Ihre Stromkosten. Tauschen Sie<br />
z. B. ein altes 18,5-kW-Tauchmotor-<br />
Rührwerk durch ein effizientes<br />
11-kW-Stallkamp-Modell aus und<br />
sparen Sie – bei gleicher Rührleistung<br />
– rund 4.000 Euro jährlich*.<br />
Der Tausch amortisiert sich meist<br />
schon im ersten Jahr.<br />
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten<br />
unter www.stallkamp.de !<br />
| pumpen<br />
| lagern<br />
| rühren<br />
| separieren<br />
* Die Höhe der tatsächlichen Ersparnis ist abhängig von<br />
Laufzeit, Strompreis, TS-Gehalt, Fermenterauslegung<br />
und Wirkungsgrad des Rührwerks.<br />
35<br />
MADE IN DINKLAGE
praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Checkliste Silphieanbau<br />
Die Durchwachsene Silphie kann bis zu zwanzig Jahre genutzt werden. Im Pflanzjahr bildet sie eine<br />
bodenständige Blattrosette aus. Ab dem zweiten Standjahr liefert die Pflanze Biomasse für die Biogasanlage.<br />
Der Anbau ist auch auf Grenzertragsstandorten und auf leichten Böden möglich.<br />
Bodenvorbereitung<br />
ffHohe Erträge auf humosen Böden<br />
ffGute Wasserführung<br />
ffStaunässe unbedingt vermeiden<br />
ffAltverunkrautung bekämpfen<br />
ffFeinkrümeliges Saatbett<br />
Saat<br />
ffab Mitte April<br />
ffDrillmaschine oder Einzelkornsägerät<br />
ffSaatmenge: 2,5 kg/ha<br />
ff45 bis 75 cm Reihenabstand<br />
ffCa. 1 bis 2 cm Saattiefe<br />
ffAlternative zur Saat ist die Pflanzung,<br />
aber teurer.<br />
Pflanzung<br />
ffAnfang Mai bis Mitte Juni<br />
ff4 Pflanzen/m²<br />
Pflanzenschutz<br />
ffJungpflanzenentwicklung kritisch<br />
und maßgeblich für Erfolg<br />
ffUnkrautbekämpfung nach Pflanzung<br />
bzw. Aussaat unbedingt erforderlich<br />
ffAb dem zweiten Jahr in der Regel<br />
kein Pflanzenschutz mehr nötig<br />
Nährstoffbedarf<br />
ffStickstoff: 150 kg/ha<br />
ffPhosphor: 25 bis 30 kg/ha<br />
ffKali: 150 bis 200 kg/ha<br />
ffMagnesium: 50 bis 70 kg/ha<br />
ffKalk: 200 bis 250 kg/ha<br />
ffOrganische Düngung mit Gärprodukt.<br />
ffÜberfahrten mit schwerer Technik beeinträchtigen<br />
die Durchwachsene Silphie nicht.<br />
ffim Etablierungsjahr: ca. 40 bis 60 kg N<br />
+ Bedarf für den Mais – d.h. mindestens<br />
200 kg N<br />
ffim 2. Jahr: 200 kg N (hoher Bedarf für die<br />
Wurzelmasse)<br />
Sie suchen einen verlässlichen Partner für die<br />
FLEXIBILISIERUNG<br />
IHRER BIOGASANLAGE?<br />
Dann sollten wir unbedingt ins Gespräch kommen!<br />
Als kompetenter Anbieter haben wir die passende Lösung für Sie.<br />
Seit über 20 Jahren bieten wir innovative und effiziente Systeme<br />
zur Reinigung, Trocknung, Kühlung und Verdichtung von Gasen –<br />
individuell von uns geplant, hergestellt und installiert.<br />
36<br />
SILOXA ENGINEERING AG<br />
Tel: 0201 9999 5727<br />
vertrieb@siloxa.com<br />
www.siloxa.com
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
praxis<br />
Ernte<br />
ffErnte von Ende August bis Ende September – eine noch spätere<br />
Ernte kann nicht empfohlen werden.<br />
ffTS-Gehalt zwischen 26 bis 30 Prozent, oft sogar unter 25 Prozent.<br />
ffTS-Gehalt über 30 Prozent vermeiden, da Methanausbeute<br />
deutlich sinkt.<br />
ffErnte mit praxisüblichem Feldhäcksler.<br />
Erträge<br />
Anbauverträge<br />
ffAnbauvertrag auf Silphie<br />
anpassen und dabei geringeren<br />
Hektarertrag und Transportkosten<br />
berücksichtigen.<br />
ffVerträge „wie Mais“ ungeeignet.<br />
ffDie Durchwachsene Silphie kann und soll den Mais nicht verdrängen,<br />
sondern als Ergänzung fungieren.<br />
ffSilphie insbesondere dort geeignet, wo Mais und andere annuelle<br />
Kulturen sich weniger eignen: Entlang von Gewässern, am Wald, am<br />
Hang, unförmige Schläge.<br />
ffTrockenmasse pro ha: guter Standort bis zu 20 Tonnen/ha. Schlechte<br />
Standorte: 8 bis 16 Tonnen/ha.<br />
ffMethanausbeute im Bereich von 210 bis 260 Normliter pro Kilogramm<br />
organische Trockenmasse (ca. 40 Prozent unterhalb von Mais).<br />
Lagerung<br />
ffGeringen TM-Gehalt beachten<br />
wegen größerem Lagerraum für<br />
Gärprodukte.<br />
ffSilierung zusammen mit Mais<br />
problemlos möglich.<br />
Autor<br />
Dennis Schiele<br />
Fachreferent Mitgliederservice<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12<br />
85356 Freising<br />
0 81 61/98 46 60<br />
info@biogas.org<br />
Foto: Martin Bensmann<br />
Wachstumsmarkt<br />
Frankreich<br />
Nutzen Sie den Biogas-Boom<br />
In akkordierter Zusammen arbeit unterstützen wir Sie:<br />
→ Gestaltung des rechtlichen Rahmens:<br />
von der Firmengründung bis zum Genehmigungsverfahren<br />
→ Erstellung von Finanzierungskonzepten<br />
→Beantragung von Investitionszuschüssen<br />
→ Verhandlungen mit französischen Banken und Investoren<br />
→Bei Markteintritt und -erschließung<br />
→Deutsch-französische Steuerberatung<br />
Ihr Kontakt zu uns:<br />
biogas@sterr-koelln.com<br />
WWW.sterr-koelln.com<br />
RECHTSANWÄLTE<br />
WIRTSCHAFTSPRÜFER<br />
STEUERBERATER<br />
UNTERNEHMENSBERATER<br />
BERLIN<br />
PARIS<br />
FREIBURG<br />
STRASBOURG<br />
37
praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Flexibel Strom produzieren und die<br />
Wärme zu 100 Prozent nutzen<br />
Vom Landwirt zum Wärmelieferanten: Mit Biogas lässt sich nicht nur klimafreundlich<br />
Strom produzieren, sondern auch Wärme bereitstellen. Noch viel zu wenig genutzt wird<br />
die Möglichkeit, die großen Wärmeabnehmer in Gewerbe und Industrie zu versorgen. Ein<br />
Beispiel aus dem Weserbergland zeigt, wie es gehen kann – und das zusammen mit einer<br />
flexiblen Stromproduktion.<br />
Von Thomas Gaul<br />
Liegender Wärmespeicher<br />
am Satellitenstandort.<br />
Er hat ein<br />
Volumen von 300<br />
Kubikmeter. Der gleiche<br />
Speicher befindet sich<br />
auch noch einmal an<br />
der Biogasanlage.<br />
Das Heranrücken eines Gewerbegebietes an<br />
die Biogasanlage oder den landwirtschaftlichen<br />
Betrieb wird von den Betreibern meist<br />
mit Sorge betrachtet. Die Befürchtung ist,<br />
dass die neuen Nachbarn Anstoß nehmen<br />
könnten an Betriebsgeräuschen oder Gerüchen. Nicht<br />
jedoch bei Alexander Busse und seinem Vater Wilhelm<br />
aus Höxter-Albaxen im Weserbergland. Denn wenn die<br />
Stadt den „Wirtschaftspark Höxter“ auf einer 70 Hektar<br />
großen Ackerfläche vor der Biogasanlage der Busse<br />
GbR erweitert, gibt es mit den neuen Gewerbebetrieben<br />
weitere Abnehmer der Wärme der Biogasanlage.<br />
Bereits jetzt werden ein großer Ventilatorenhersteller<br />
und drei weitere Gewerbebetriebe mit der Wärme versorgt.<br />
Die Wärme wird damit vollständig genutzt, die<br />
Betriebe verzichten auf Heizöl und Erdgas und tun damit<br />
etwas für ihre Klimabilanz. Stück für Stück sind<br />
Vater und Sohn bei der Erweiterung der Energieproduktion<br />
mit Biogas vorgegangen. Den Anfang machte die<br />
Aussiedlung des Betriebes aus der engen Dorflage im<br />
Jahre 1999.<br />
„Hier im Ort noch Landwirtschaft zu betreiben ginge<br />
heute gar nicht mehr“, sagt Alexander Bosse. Ein gutes<br />
Stück außerhalb, direkt an der Bundesstraße B 64 und<br />
unweit der Weser, entstand ein neuer Milchviehstall.<br />
Denn mit der Aussiedlung spezialisierte sich der ursprüngliche<br />
Gemischtbetrieb auf die Milchviehhaltung<br />
und gab die Außenwirtschaft an Lohnunternehmen und<br />
einen benachbarten Ackerbaubetrieb ab.<br />
Biogasanlage statt Stallerweiterung<br />
Heute stehen hier 150 Milchkühe, die von zwei Melkrobotern<br />
gemolken werden. In Planung war, den Kuhstall<br />
auf 300 Kühe mit fünf Robotern zu erweitern.<br />
Doch dieser Plan wurde nicht umgesetzt. Stattdessen<br />
entschied man sich, 2010 in eine Biogasanlage mit<br />
265 Kilowatt (kW) installierter Leistung zu investieren.<br />
Die Kühe liefern mit ihrem Mist und der Gülle einen<br />
Großteil des Substrat-Inputs. Von anderen landwirt-<br />
38
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
praxis<br />
schaftlichen Betrieben, die teilweise im Nebenerwerb<br />
bewirtschaftet werden, kommt Mist hinzu. „Durch die<br />
verschärften gesetzlichen Auflagen haben diese Betriebe<br />
gar nicht die Möglichkeit, den Mist ordnungsgemäß<br />
zu lagern“, erläutert Alexander Busse. Geplant und gebaut<br />
wurde die Anlage wie mehrere in der Region durch<br />
den Maschinenring Kassel.<br />
Schon im Jahr darauf kam ein Satelliten-Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) mit ebenfalls 265 kW hinzu. Zugleich<br />
wurde mit dem Bau des Wärmenetzes begonnen,<br />
das zunächst auf 400 kW ausgelegt wurde. Erster<br />
Abnehmer war der Ventilatorenhersteller. „Der Kontakt<br />
ergab sich auf den Fluren des Bauamtes, als ich dort<br />
wegen einer Genehmigung war“, erinnert sich Wilhelm<br />
Busse. „Der Firmenchef war auch dort und meinte, wir<br />
könnten seine Fabrik doch nun mit der Wärme unserer<br />
Biogasanlage versorgen.“<br />
2014 ging es weiter Zug um Zug mit der Genehmigung<br />
für zusätzlich zwei weitere 265-kW-BHKW am Satellitenstandort<br />
und auf der Anlage selbst. Auch die Anlage<br />
wurde um noch einmal 265 kW erweitert. Fahrsilos und<br />
ein größerer Fermenter mit 5.000 Kubikmeter kamen<br />
hinzu. Die Gasproduktion am Anlagenstandort wurde<br />
auf 3,5 Millionen Kubikmeter beschränkt.<br />
Maximal flexibilisiert<br />
Nachdem das seinerzeitige EEG den Anlagenbetreibern<br />
die Möglichkeit zur Flexibilisierung eingeräumt hatte,<br />
stellten auch Busses erste Überlegungen in diese Richtung<br />
an. „Den Ausschlag gab dann eine Infoveranstaltung<br />
der Kampagne ‚KWK kommt‘ im Februar 2016<br />
in Hannover“, so Wilhelm Busse. „Wir haben auf der<br />
Rückfahrt diskutiert und dann fiel der Entschluss zur<br />
maximalen Überbauung.“ Das Ziel der Flexibilisierung<br />
war den beiden auch klar. Alexander Busse sagt: „Unser<br />
Ziel war das Erreichen der Höchstbemessungsleistung,<br />
was wir vorher nicht geschafft haben.“ Die beiden<br />
Busses stehen voll hinter der Flexibilisierung: „Nur so<br />
hat Biogas als relativ teure Energie eine Berechtigung“,<br />
Altgebäude: das erste Haus<br />
für den 265-kW-Motor.<br />
Fotos: Thomas Gaul<br />
sagt Alexander Busse. „Das lässt sich auch der Bevölkerung<br />
erklären, flexibel und bedarfsgerecht Strom zu<br />
produzieren.“ Flexibilisiert wurde sowohl auf der Anlage<br />
selbst als auch am Satellitenstandort mit einer Bemessungsleistung<br />
von jeweils 480 kW. Im 24-Stunden-<br />
Betrieb sollten die Biogas-BHKW nicht laufen.<br />
Die Flexibilisierung sieht der Landwirt und Anlagenbetreiber<br />
als eine „Investition in die Zukunft“. Zum Zeitpunkt<br />
der Entscheidung für die Flexibilisierung hatte<br />
die Anlage noch eine restliche Laufzeit mit EEG-Vergütung<br />
von 14 Jahren. Knapp 4 Millionen Euro hat die<br />
Busse GbR in die Flexibilisierung ihrer Anlage und das<br />
Wärmenetz investiert. Dazu zählen zwei große MTU-<br />
Motoren mit jeweils 1.870 kW auf der Anlage und am<br />
Satellitenstandort. Hinzu kommen zwei Wärmespeicher<br />
mit 300 Kubikmetern.<br />
Größerer Gasspeicher in Planung<br />
„Die liegenden Behälter sind die größten, die noch<br />
in einem Stück auf der Straße transportiert werden<br />
können“, berichtet Alexander Busse: „Mit der Größe<br />
kommen wir ganz gut klar. Ein Tag<br />
Wärmeproduktion lässt sich damit<br />
abpuffern.“ Mehr Flexibilität würde<br />
ein großer Gasspeicher bringen.<br />
„Das planen wir auch. Aber am<br />
vorgesehenen Standort neben der<br />
Biogasanlage stockt das Genehmigungsverfahren,<br />
so Alexander Busse.<br />
Immerhin ist das Wärmenetz<br />
jetzt auf eine Kapazität von 2,2<br />
Megawattstunden ausgelegt.<br />
Da die alten Trafos nicht ausreichten,<br />
wurden mit der Flexibilisierung<br />
zwei neue Trafostationen hinzugebaut.<br />
„Der Anschluss an das<br />
Stromnetz ist hier aber problemlos<br />
möglich, weil sich in der Nähe ein<br />
Umspannwerk befindet“, sagt Alex-<br />
Die beiden Betreiber<br />
Wilhelm (links) und<br />
Alexander Busse.<br />
39
praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Der große mtu-Motor<br />
leistet 1.870 kW elektrisch.<br />
Mehrere Gewerbebetriebe<br />
nehmen die<br />
„grüne Wärme“ der<br />
Biogasanlage ab.<br />
ander Busse. Eine Schaltstation des Energieversorgers<br />
steht direkt neben dem Satellitenstandort.<br />
Die Wärmeleitungen konnten alle in Eigenleistung verlegt<br />
werden. Die Trasse zum Satellitenstandort, auf der<br />
auch die Gasleitung zum Satelliten-BHKW verläuft, hat<br />
eine Länge von 600 Meter, die Ringleitung durch das<br />
Gewerbegebiet ist mit 2 Kilometern länger. „Unser Vorteil<br />
war, dass wir vor allem eigene Flächen für die Trasse<br />
nutzen können“, betont Wilhelm Busse. Aber auch mit<br />
den Firmeneigentümern im Gewerbegebiet habe es in<br />
dieser Hinsicht keine Probleme gegeben, da die Leitungsarbeiten<br />
schnell abgeschlossen werden konnten.<br />
Die Betreiber hoffen darauf, dass die Politik die Rahmenbedingungen<br />
für die „grüne Wärme“ aus Biogas<br />
erkennt. Denn hier besteht die Möglichkeit, schnell<br />
und wirksam etwas für den Klimaschutz zu tun. Die<br />
notwendige „Wärmewende“ würde entscheidend vorankommen,<br />
wenn CO 2<br />
teurer wird und die Vorteile<br />
von Biogas für private und gewerbliche Wärmekunden<br />
deutlich werden.<br />
Individuelle Wärmeabnahmeverträge<br />
„Wir wollten nur Wärme liefern, wenn wir flexibilisieren“,<br />
sagt Wilhelm Busse. Der Ausbau der Anlage und<br />
die umfassende Nutzung der Wärme waren nur möglich,<br />
weil die Flexibilisierung den Anreiz dafür geliefert<br />
hat. Die Bilanz nach einem Jahr flexiblen Betrieb fällt<br />
für die Betreiber positiv aus. So konnte ein Mehrerlös<br />
von 510.000 Euro erzielt werden. „Dabei haben sich<br />
die Gewinne aber verschoben“, sagt Alexander Busse:<br />
„Wir hatten Erlöse von etwa 110.000 bis 120.000<br />
Euro durch die Vermarktung von Regelenergie erwartet.<br />
Durch das Mischpreisverfahren ist die positive wie negative<br />
Sekundärregelleistung komplett weggefallen.“<br />
Obwohl die Preise am EPEX-Spotmarkt tendenziell<br />
eher steigen würden, seien die Schwankungen noch zu<br />
gering. Der Mehrerlös von rund 12.000 Euro je Quartal<br />
und Standort passe jedoch wie geplant. Hinzu kämen<br />
50.000 Euro aus der Vermarktung der Wärme im ersten<br />
Jahr. Bei der Gestaltung der Wärmelieferverträge<br />
muss mit jedem Kunden individuell verhandelt werden,<br />
betont Alexander Busse. Demzufolge wird für die Wärme<br />
auch ein unterschiedlicher Preis erzielt. Im Durchschnitt<br />
beläuft er sich auf 8 Cent pro Kilowattstunde.<br />
Die Gewerbebetriebe, die neu an das Wärmenetz der<br />
Busses angeschlossen werden, verlassen sich voll auf<br />
die Wärme aus Biogas. Beim ersten Wärmekunden,<br />
dem Ventilatorenhersteller, wäre immerhin noch eine<br />
alte Heizung vorhanden. Hier soll demnächst neben der<br />
Wärme zur Raumbeheizung auch Prozesswärme für die<br />
Lackiererei geliefert werden. Sollte die Wärmeabnahme<br />
noch weiter zunehmen, wird über ein<br />
Erdgas-BHKW nachgedacht.<br />
Denn während im Sommerbetrieb durchaus<br />
noch Kapazität zur Wärmelieferung<br />
vorhanden wäre, wird im Winter Wärme zur<br />
Fermenterheizung benötigt. Bei den Wartungskosten<br />
hat sich die Flexibilisierung<br />
ebenfalls positiv bemerkbar gemacht. So<br />
laufen die großen Motoren nur noch zweimal<br />
täglich, in der Regel von 6.00 Uhr bis<br />
12.00 Uhr und von 16.00 Uhr bis 22.00<br />
Uhr. Auch die Fütterung wird entsprechend<br />
angepasst, da am Wochenende nur die halbe<br />
Leistung gefordert ist.<br />
Autor<br />
Thomas Gaul<br />
Freier Journalist<br />
Im Wehrfeld 19a · 30989 Gehrden<br />
01 72/512 71 71<br />
gaul-gehrden@t-online.de<br />
40
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
praxis<br />
Wir sind Ihr Partner für Grüne Gase!<br />
Sie produzieren Biomethan – wir kaufen es!<br />
Dabei bieten wir Ihnen zu jeder Zeit garantierte<br />
Abnahme und Zahlungssicherheit.<br />
Ob aus Nawaro, Reststoffen oder Abfällen<br />
aus der Biotonne: Wir sind flexibel in der Abnahme<br />
aller Qualitäten und Einsatzstoffe.<br />
Als Experte für Grüne Gase erweitern wir<br />
unser Portfolio um Bio-SNG, Bio-LNG und<br />
grünen Wasserstoff. Sprechen Sie uns an!<br />
Profitieren Sie von unserer Erfahrung als führender<br />
Vermarkter von Biomethan und Experte für Grüne Gase.<br />
www.bmp-greengas.de<br />
Effiziente Komponenten und Konzepte für Ihre Flexibilisierung<br />
Aktivkohlefilter ∙ Gaskühlungen ∙ Leitungsbau ∙ Sanierung ∙ Wärmegewinnung ∙ Wartungsumläufe ∙ Aktivkohle ∙ Heizungsbau ∙ Katalysatoren<br />
Unser Dreamteam:<br />
∙ Bis zu 34% Kühlenergie-Einsparung !<br />
Aus EasyFlex wird BioBG!<br />
∙ Absolute Sicherheit für Ihr BHKW!<br />
DRBT Gas-Kühltrocknung &<br />
∙ 50% höhere Beladung der Aktivkohle bzw. Filtermedien!<br />
- Ein Wartungsumlauf für alle Biogasanlagen-Behälter.<br />
3-Kammer-Aktivkohle-Filtersystem!<br />
MAPRO International LOGO.pdf 1 12.11.13 10:21<br />
∙ Aktivkohlewechsel in Eigenregie, ohne Kontakt zur Kohle, möglich!<br />
- Umhängbar auf alle Behälter Ihrer Anlage!<br />
BioBG GmbH ∙ Webers Flach 1 ∙ 26655 Ocholt ∙ Tel.: 04409 666720 ∙ Email: info@biobg.de ∙ Internet: www.biobg.de<br />
MAPRO ® GASvERdIchTER<br />
volumenströme bis zu 3600 m³/h<br />
und drücke bis zu 3,2 bar g<br />
A Company of<br />
MAPRO ® INTERNATIONAL S.p.A.<br />
www.maproint.com<br />
WARTUNG ZUM FESTPREIS<br />
MAPRO ® Deutschland GmbH<br />
Tiefenbroicher Weg 35/B2 · D-40472 Düsseldorf<br />
Tel.: +49 211 98485400 · Fax: +49 211 98485420<br />
www.maprodeutschland.com · deutschland@maproint.com<br />
41
praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Messen, was drin ist<br />
Fotos: Zunhammer GmbH<br />
Die Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) liefert schnell und mit wenig<br />
Aufwand Daten zur Qualität von Gärsubstraten und Gärprodukten.<br />
Die Kosten der NIRS-Sensoren sind mit rund 30.000 Euro hoch. Die<br />
Genauigkeit der Messergebnisse soll in Zukunft weiter steigen.<br />
Von Steffen Bach<br />
NIRS-Technik bewährt sich<br />
seit Jahrzehnten in vielen<br />
Einsatzgebieten. In der Landwirtschaft<br />
kamen die ersten<br />
NIRS-Sensoren in der Ernte<br />
zum Einsatz. 2011 brachten John Deere<br />
und Claas Sensoren auf den Markt, die<br />
während der Ernte auf dem Feldhäcksler<br />
neben der Trockenmasse des Erntegutes<br />
auch die Inhaltsstoffe Stärke, Zucker, Rohprotein,<br />
Rohfaser, Rohfett und Rohasche in<br />
Gras sowie Mais permanent ermitteln konnten.<br />
Wird der Sensor direkt bei der Ernte im<br />
Häcksler eingesetzt, können so schlagspezifisch<br />
die geernteten Trockenmasseerträge<br />
ermittelt werden.<br />
John Deere erkannte das Potenzial der<br />
Messgeräte früh und ermöglichte einen<br />
Ausbau der Sensoren. So konnte das „Harvest<br />
Lab“ das ganze Jahr genutzt werden,<br />
um die Qualität von Getreide und Silagen zu<br />
messen. Trotz dieser komfortablen Lösung<br />
und eines großen Interesses in der Landwirtschaft<br />
blieb die Nachfrage für die Sensoren<br />
überschaubar, denn mit rund 30.000<br />
Euro sind die Investitionskosten hoch.<br />
Bei der Futtermittel- und Substratanalyse<br />
in den großen Analyseunternehmen sind<br />
die NIRS-Sensoren als Ergänzung zu den<br />
klassischen nasschemischen Verfahren<br />
auf dem Vormarsch. Bei Schmack Biogas<br />
werden seit November 2018 die von den<br />
Anlagenbetreibern eingeschickten Proben<br />
mithilfe der Nahinfrarotspektroskopie<br />
analysiert. Das Verfahren ermögliche eine<br />
schnelle und präzise Sofortanalyse des<br />
Gas ertrags verschiedener Substrate, erläutert<br />
Schmack-Mitarbeiter Jan Buschmeyer.<br />
Basis für die Kalibrierung der Sensoren<br />
seien eine Vielzahl durchgeführter Gärversuche<br />
unterschiedlicher Substrate.<br />
Schmack bietet die Messungen derzeit für<br />
Mais, Gras, Szarvazi-Gras, Durchwachsene<br />
Silphie, Hühnertrockenkot, Ganzpflanzensilagen,<br />
Hirse und Bioabfälle an. Ermittelt<br />
werden die Gehalte an Rohstärke, Rohprotein,<br />
Zucker, Rohfett, Rohfaser, ADFom,<br />
ADL, aNdFom, Elos und Eulos.<br />
Die aus den Werten berechneten Gaserträge<br />
zeigten eine hohe Übereinstimmung mit in<br />
Gärversuchen produzierten Biogas-Mengen,<br />
berichtet der Schmack-Mitarbeiter. Für den<br />
Anlagenbetreiber biete das neue Verfahren<br />
zwei Vorteile: Die Ergebnisse liegen bereits<br />
nach 48 Stunden vor und der Preis ist mit<br />
75 Euro deutlich niedriger als die nasschemischen<br />
Verfahren, die mit mehreren Hundert<br />
Euro ein Vielfaches kosten.<br />
Zunhammer<br />
bietet unter<br />
dem Namen<br />
Van-Control 2.0 ein<br />
System zur Bestimmung<br />
von Gülleinhaltsstoffen an. Möglich wird die<br />
Erfassung der Nährstoffe mit dem NIR-Sensor,<br />
der kontinuierlich Informationen über die<br />
Güllezusammensetzung aus der Gülleleitung<br />
abgreift. Die Gülle kann so beim Befüllen,<br />
beim Ausbringen oder beim Rühren untersucht<br />
werden. Aufgezeichnet werden dabei nicht nur<br />
Stickstoff (N), sondern auch Kali (K), Phosphat<br />
(P) oder die Trockenmasse (TM). Die Registrierung<br />
von weiteren Inhaltsstoffen ist machbar.<br />
Große Datenmengen für<br />
Kalibrierung notwendig<br />
Auch die Landwirtschaftlichen Untersuchungs-<br />
und Forschungsanstalten (LUFA)<br />
bieten an, den Gasertrag und die theoretische<br />
Gasausbeute mithilfe der NIRS-Technik<br />
zu ermitteln. Auf Dauer wird der Kreis<br />
der Anbieter wohl überschaubar bleiben.<br />
Grund: Um die Sensoren zu kalibrieren,<br />
ist eine große Datenmenge aus nasschemischen<br />
Verfahren und Gärversuchen erforderlich,<br />
die mit den im NIRS-Verfahren<br />
gewonnenen Daten abgeglichen werden.<br />
Die Genauigkeit der Ergebnisse gilt als recht<br />
gut, wobei bei den LUFA darauf hingewiesen<br />
wird, dass beim Gasertrag eher konservativ<br />
gerechnet werde und für exotische Substrate<br />
häufig noch nicht genug Daten vorliegen.<br />
Auf die etablierten Untersuchungsmethoden<br />
wird man deshalb auch in Zukunft nicht<br />
42
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
praxis<br />
Foto: Claas<br />
Der Crop-Sensor von Claas im Frontanbau des Schleppers ermöglicht mit<br />
dem ISARIA-Düngesystem jetzt zusätzlich zu den bisherigen unterstützten<br />
anorganischen Düngern und Pflanzenschutzmitteln auch die Ausbringung<br />
von organischem Dünger. Hierbei wird in der Volumeneinheit der Sollwert<br />
der Ausbringmenge berechnet.<br />
verzichten können, denn sie liefern die Werte,<br />
mit denen die Datenbanken gefüttert<br />
und verbessert werden. Fachleute glauben<br />
deshalb nicht, dass die Kosten der Sensoren<br />
in Zukunft deutlich sinken werden.<br />
Denn neben der Hardware ist in dem Preis<br />
auch die Nutzung der Datenbanken enthalten,<br />
ohne die aus den Daten der Nahinfrarotspektroskopie<br />
keine Messwerte für<br />
den Biogasproduzenten abgeleitet werden<br />
können.<br />
Sinnvoll<br />
und notwendig ist<br />
es deshalb, die Kalibrierung<br />
regelmäßig<br />
zu aktualisieren.<br />
Dies geschieht in<br />
der Regel über einen<br />
Wartungsvertrag mit<br />
dem Anbieter der<br />
Sensoren.<br />
Für die Produzenten<br />
von Biogas ist die<br />
NIRS-Technik auch<br />
in einem zweiten<br />
Bereich eine interessante<br />
Lösung. Mit<br />
den Vorgaben der<br />
Düngeverordnung wird die Dokumentation<br />
der Nährstoffströme weiter an Bedeutung<br />
gewinnen. Um besser nachvollziehen zu<br />
können, auf welchen Wegen Stickstoff,<br />
Phosphat und Kali in die Anlage hineinund<br />
wieder herausgekommen sind, existiert<br />
nun ein einfaches und schnelles Messverfahren<br />
für Schweine- und Rindergülle.<br />
Neben der Trockenmasse können der Gesamtstickstoff,<br />
Ammoniumstickstoff und<br />
der Phosphatgehalt gemessen werden.<br />
Nimmt der Güllelieferant auch Gärreste<br />
zurück, kann auch beim Abholen des Gärproduktes<br />
der Nährstoffgehalt mithilfe des<br />
Sensors ermittelt werden. Die Nährstoffströme<br />
sind so für alle Beteiligten transparent.<br />
Phosphatbestimmung muss<br />
verbessert werden<br />
Die Genauigkeit der Messergebnisse ist<br />
bei den Parametern Trockensubstanz, Gesamtstickstoff,<br />
Ammoniumstickstoff und<br />
Kali bereits so gut, dass die Hersteller John<br />
Deere, Zunhammer und Kaweco nach einer<br />
Prüfung eine Anerkennung der Deutschen<br />
Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. (DLG) erhielten.<br />
Probleme bereiten noch die Messungen<br />
beim Phosphatgehalt, für die bisher kein<br />
Gerät die Anforderungen der DLG erfüllte.<br />
Mitte Januar änderte Nordrhein-Westfalen<br />
(NRW) die Landesdüngeverordnung und<br />
gestattete für die Ermittlung und Dokumentation<br />
des Nährstoffgehaltes von flüssigen<br />
Wirtschaftsdüngern die NIRS-Technik,<br />
sofern eine Anerkennung der DLG vorliegt.<br />
Für die Phosphatwerte müssen deshalb bis<br />
auf Weiteres klassische Nährstoffanalysen<br />
Handeln Sie jetzt:<br />
Mit besten<br />
Aussichten für Ihre<br />
Biogasanlage.<br />
Professionelle Vermarktung Ihrer<br />
flexiblen Stromerzeugung<br />
Zusatzerlöse durch individuellen Fahrplanbetrieb<br />
Attraktives BHKW-Contracting<br />
Langjährige Expertise im Bereich Biogas<br />
und persönliche Ansprechpartner<br />
Fahren Sie mit uns als Energieexperte die beste<br />
Ernte für Ihre Biogasanlage ein. Interessiert? Rufen<br />
Sie uns an unter 0441 803-2299 oder schreiben Sie<br />
an virtuelleskraftwerk@ewe.de<br />
Wir freuen uns auf Sie. Willkommen bei EWE.<br />
www.ewe.de/virtuelleskraftwerk<br />
43
praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Fotos: Kotte<br />
Oben auf dem Güllefass befindet sich die Druckleitung, durch die<br />
die Gülle nach hinten in den Verteiler befördert wird. Der verzinkte<br />
„Stahlkasten“, der dort aufgeschraubt ist, beinhaltet den Sensor. Dieser<br />
misst im Güllestrom der auszubringenden Gülle die Nährstoffe. Die<br />
gemessenen Werte übermittelt der Sensor an die Steuerung/den Steuerblock<br />
des Güllewagens und dieser kommuniziert mit der Pumpe bzw. der<br />
Bordhydraulik. Diese regelt dann dementsprechend die Ausbringmenge.<br />
Mobile Nährstoffmessstation von Kotte Landtechnik. Diese steht zwischen Güllelager<br />
und Güllewagen und misst beim Befüllvorgang des Fasses die Nährstoffe. Dazu ist<br />
ein Durchflussmengenmesser notwendig, das ist der blaue Kasten, der von dem kleinen<br />
Bedienteil etwas verdeckt wird. Der Sensor befindet sich hinter der Werkzeugkiste<br />
unter der Stahlleitung (so nicht sichtbar). Anhand des Durchflussmengenmessers<br />
können die Nährstoffe auf die Güllemenge bezogen dargestellt werden. Auf dem<br />
Bedienterminal im Vordergrund werden die gemssenen Nährstoffwerte angezeigt.<br />
oder Richtwerte verwendet werden. Dies<br />
könnte sich aber in absehbarer Zeit ändern.<br />
Sebastian Zunhammer ist optimistisch,<br />
dass bessere Kalibrierungen auch für<br />
Phosphat Werte liefern, die die Vorgaben<br />
der DLG erfüllen. „Die Messergebnisse für<br />
Phosphat sind schon relativ gut“, meint der<br />
Juniorchef des oberbayerischen Güllespezialisten.<br />
Seitdem das Zunhammer-System<br />
Van-Control die Messlatte beim Phosphat<br />
bei einem DLG-Test im Jahr 2017 gerissen<br />
hatte, wurde die Datenbasis verbreitert und<br />
die Kalibrierung verbessert. Zunhammer<br />
vergleicht die Probleme mit der Einführung<br />
der ersten Navigationsgeräte für Autos.<br />
Auch dort habe es zunächst Ungenauigkeiten<br />
gegeben, die aber schnell ausgeräumt<br />
werden konnten.<br />
In den Fachbehörden anderer Bundesländer<br />
stieß das Vorpreschen in NRW auf<br />
Kritik. Offen aussprechen möchte niemand<br />
seine Zweifel. Berichtet wird darüber, dass<br />
auf politischer Ebene der Wunsch deutlich<br />
ausgesprochen wird, der Landwirtschaft<br />
schnell eine technische Lösung anzubieten,<br />
mit der die Auflagen der Düngeverordnung<br />
leichter umgesetzt werden können.<br />
Dr. Ulrich Rubenschuh, Experte für Düngetechnik<br />
bei der DLG, kennt die Vorbehalte<br />
gegenüber der neuen Technik. Richtig sei,<br />
dass die in den Sensoren gemessenen und<br />
die im Labor in nasschemischen Verfahren<br />
gewonnenen Messwerte zum Teil recht<br />
deutlich voneinander abwichen. Bedenken<br />
müsse man aber, dass es in der Praxis ebenfalls<br />
zu erheblichen Differenzen kommt,<br />
wenn man den gesamten Umgang mit der<br />
Probe betrachte.<br />
Kontinuierliche Messung merzt<br />
Probenahmefehler aus<br />
Durch Fehler bei der Probenahme sowie<br />
beim Transport und der Lagerung könnten<br />
ebenfalls große Abweichungen entstehen.<br />
Auch bei der Untersuchung im Labor<br />
gebe es bei den Ergebnissen eine gewisse<br />
Schwankungsbreite. Unter Berücksichtigung<br />
dieser aus der Praxis bekannten Gegebenheiten<br />
habe man bei der Prüfung der<br />
NIRS-Sensoren eine relativ große Toleranz<br />
zugelassen. Vorteil der neuen Technik sei,<br />
dass sie die Daten kontinuierlich misst und<br />
so keine Fehler durch eine falsche Probenahme<br />
entstehen können. Für die Zukunft<br />
erwartet Rubenschuh dank einer breiteren<br />
Datenbasis bessere Kalibrierungsmodelle<br />
und damit genauere Sensorergebnisse. „In<br />
zukünftigen Tests werden wir deshalb das<br />
Bewertungsschema anpassen“, kündigt<br />
der DLG-Experte an. Für eine erfolgreiche<br />
Prüfung der Sensoren wird die Messlatte<br />
also höher gelegt.<br />
Dennoch wird sich die neue Technik kaum<br />
aufhalten lassen, sind sich die Hersteller<br />
von Ausbringtechnik für flüssige Wirtschaftsdünger<br />
einig. Bei der Firma Kotte<br />
rechnet man wegen der drohenden erneuten<br />
Verschärfung des Düngerechts mit<br />
einer steigenden Nachfrage nach NIRS-<br />
Sensoren, erklärt der technische Leiter des<br />
Unternehmens Dr. Henning Müller. Kotte<br />
bietet eine eigene Lösung unter dem Namen<br />
NutrientContentLab (NCL) Mobile an.<br />
Die mobile Messstation kann im Fahrzeug<br />
verbaut oder an der Biogasanlage zwischen<br />
den Gärproduktbehälter und den Tankwagen<br />
geschaltet werden. Über eine Kooperation<br />
mit John Deere wird auf Wunsch auch<br />
das Harvest Lab in die Maschinen eingebaut.<br />
Die Kunden zeigen ein wachsendes<br />
Interesse an den Sensoren, stellt Müller<br />
fest. Viele Maschinen würden deshalb so<br />
ausgestattet, dass sie mit der NIRS-Technik<br />
nachgerüstet werden können.<br />
Sensoren am Fahrzeug bieten einen zusätzlichen<br />
Nutzen, denn sie ermöglichen<br />
eine teilflächenspezifische Ausbringung<br />
der Gärprodukte. Claas und Zunhammer<br />
haben dazu ihre Kompetenzen gebündelt<br />
und gemeinsam eine Lösung entwickelt,<br />
die eine teilflächenspezifische Stickstoffdüngung<br />
mit flüssigen Wirtschaftsdüngern<br />
ermöglicht. Bei der organischen Bestandsdüngung<br />
ermittelt der Claas Crop Sensor<br />
während der Überfahrt teilflächenspezifisch<br />
den optimalen Stickstoffbedarf der<br />
Pflanzen. Zugleich misst der Zunhammer<br />
Van-Control Sensor den Stickstoffgehalt<br />
der Gülle in Echtzeit. Anhand der beiden<br />
Werte wird die bedarfsgerechte Ausbringmenge<br />
berechnet und das Regelventil entsprechend<br />
gesteuert. Mit den Daten lassen<br />
sich Ausbringkarten und Nährstoffdokumentationen<br />
erstellen.<br />
Autor<br />
Steffen Bach<br />
Freier Journalist<br />
0 54 75/95 93 49<br />
steffen.bach@dfv.de<br />
44
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
praxis<br />
ENTDECKEN SIE DAS<br />
GEHEIMNIS VON GUTER<br />
DÜNGUNG<br />
HARVESTLAB 3000<br />
Offiziell von der Deutschen<br />
Landwirtschafts-Gesellschaft<br />
(DLG) für seine hervorragende<br />
Genauigkeit zertifiziert.<br />
GENAUE ANALYSEN FÜHREN ZU GROSSEN<br />
EINSPARUNGEN<br />
Jetzt können Sie wichtige Nährwerte von Gülle während der Ausbringung<br />
auf dem Feld in Echtzeit messen. Auf diese Weise erzielen Sie ein<br />
gleichmäßigeres Pflanzenwachstum sowie eine höhere Qualität und<br />
senken zudem erheblich Ihre Mineraldüngerkosten.<br />
Inhalt<br />
Trockenmasse<br />
N<br />
gesamt<br />
NH ₄ (N) K ₂ 0 P ₂ O ₅<br />
AS80160.1GER_DE<br />
45
Blick auf die kürzlich in<br />
Betrieb gegangene Gasreinigung<br />
in der Papierfabrik<br />
Julius Schulte in Trebsen.<br />
Die revis bioenergy GmbH<br />
errichtete die Anlage<br />
und betreibt sie auch. Im<br />
Hintergrund die beiden IC-<br />
Reaktoren zur Abwasserentfrachtung.<br />
praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Biogas aus dem Pelletsschlamm<br />
Die Papierfabrik Julius Schulte in Trebsen hat ihre Abwasseraufbereitung modernisiert. Die<br />
IC-Reaktoren der Kläranlage haben jetzt eine höhere Kapazität und das Biogas wird für die<br />
Netzeinspeisung aufbereitet.<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Der Übergabepunkt<br />
nach der Grobentschwefelung<br />
(liegender Behälter)<br />
führt das in den<br />
IC-Reaktoren erzeugte<br />
Biogas zur Gasreinigungsanlage<br />
der revis<br />
bioenergy GmbH.<br />
Für die Herstellung von Papier wird viel Wasser<br />
benötigt. Daher entschied man sich bei<br />
Gründung der Papierfabrik 1893 in der sächsischen<br />
Kleinstadt Trebsen für einen Standort<br />
unmittelbar neben der Mulde. Aus diesem<br />
Fluss bezieht die heutige Julius Schulte Trebsen GmbH<br />
& Co. KG nach wie vor das Wasser für die Papierherstellung.<br />
Allerdings sind die Umweltanforderungen mittlerweile<br />
wesentlich höher als zur Gründerzeit.<br />
Das am Ende der Prozesskette ebenfalls in großen Mengen<br />
anfallende Abwasser muss vor dem Wiedereinleiten<br />
in die Mulde gründlich gereinigt werden und darf vorgegebene<br />
strenge Grenzwerte etwa beim Stickstoffgehalt<br />
oder bei den organischen Inhaltsstoffen (CSB-Wert =<br />
chemischer Sauerstoffbedarf) nicht überschreiten.<br />
Verantwortlich dafür ist Dr.-Ing. Elmar Fischer. „Wir<br />
haben unsere Abwasserreinigung in den vergangenen<br />
Monaten fit gemacht für zukünftige Anforderungen und<br />
die geplante Erhöhung der Produktionsleistung“, sagt<br />
er beim Rundgang durch den Komplex auf dem Werksgelände.<br />
Viel Organik im Abwasser<br />
In Trebsen werden täglich in drei Schichten etwa 700<br />
Tonnen Braunpapier hergestellt. Die zu mannshohen<br />
Rollen aufgewickelten, rund 7 Kilometer langen Papierbahnen<br />
sind Ausgangsstoff für die Produktion von<br />
Wellpappen. Verpackungen aus diesem Material erle-<br />
46
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
praxis<br />
ben gegenwärtig eine wachsende<br />
Nachfrage, weil sie<br />
im Gegensatz zu Kunststoff<br />
nicht die Umwelt belasten<br />
und komplett wiederverwertbar<br />
sind.<br />
Tatsächlich ist der Ausgangsstoff<br />
für das Trebsener Produkt<br />
ausschließlich Altpapier.<br />
Es wird in Form großer<br />
buntgescheckter Pressquader<br />
angeliefert und zunächst<br />
in warmem Wasser aufgelöst.<br />
Da das Altpapier von der vorangegangenen<br />
Nutzung,<br />
etwa als Pizzaschachtel oder<br />
Gemüsekarton, jede Menge Anhaftungen mitbringt,<br />
gelangen dabei bedeutende Mengen organischer<br />
Schmutzfracht in die Lösungsflüssigkeit. Diese strömt<br />
nach Absieben der suspendierten Papierfasern zurück<br />
zum Ausgangspunkt der Einweichstrecke. Aus dem<br />
Kreislauf werden pro Stunde etwa 100 Kubikmeter<br />
ausgeschleust und durch Frischwasser ersetzt.<br />
Das aus der Produktion abgezweigte Abwasser enthält<br />
eine so hohe organische Fracht, dass eine biologische<br />
Kläranlage mit Belebungsbecken schnell überlastet<br />
wäre. Zugleich liegt es nahe, die Reinigung mit einer<br />
energetischen Nutzung der Organik zu verbinden. Zu<br />
diesem Zweck gelangt das Abwasser über eine Vorversauerungsstufe<br />
in zwei anaerobe, 27 beziehungsweise<br />
30 Meter hohe sogenannte IC-Reaktoren. IC steht dabei<br />
für internal circulation.<br />
Auslöser für den Zirkulationseffekt in den Hochbehältern,<br />
dem das Verfahren seinen Namen verdankt,<br />
ist das aufsteigende Biogas, das in dem granulierten<br />
Schlamm – auch als Pelletsschlamm bezeichnet – im<br />
Fotos: Carmen Rudolph<br />
Reaktorraum entsteht. Der Pelletsschlamm bildet und<br />
regeneriert sich, befördert durch die Behältergeometrie,<br />
nach dem Beimpfen selbstständig. „Das sind Zusammenballungen<br />
unterschiedlich spezialisierter Bakterien,<br />
wie man sie auch in jeder Biogasanlage findet“,<br />
zeigt Fischer auf die kleinen schwarzen Klümpchen in<br />
einem Trichterglas mit Flüssigkeit, die er aus dem Reaktor<br />
über ein Ventil entnommen hat.<br />
Maximal erreichen die Bakterienklumpen die Größe<br />
eines Kirschkerns. Sie haben annähernd die gleiche<br />
Dichte wie das sie umgebende Medium und schwimmen<br />
daher leicht auf. Das nach oben perlende Biogas<br />
absorbieren zwei Gassammler. Sie befinden sich im<br />
zweiten Drittel der Behälterhöhe sowie kurz unter dem<br />
Flüssigkeitsspiegel und bestehen aus nach unten geöffneten<br />
Rinnen. Diese sind sowohl nebeneinander als<br />
auch versetzt in fünf Lagen übereinander angeordnet.<br />
Das aufgefangene Gas strömt durch Rohre in einen<br />
Gasraum im Dom auf dem Reaktordach und wird von<br />
dort abgeleitet.<br />
Das bei der Abwasserklärung<br />
in den beiden<br />
IC-Reaktoren erzeugte<br />
Biogas wird jetzt nicht<br />
mehr verstromt,<br />
sondern zu Biomethan<br />
aufbereitet.<br />
Kraftstoff selbst erzeugen!<br />
+ Biomethan aus Biogas:<br />
einfach aufrüstbar<br />
mit EnviThan Gasaufbereitungsanlagen<br />
+ Biomethan/CNG für<br />
alle Erdgasfahrzeuge<br />
+ Auch ohne EEG<br />
wirtschaftlich<br />
Auf<br />
AllEN<br />
ANlAGEN<br />
möGliCh!<br />
EnviTec Biogas AG –<br />
weltweit führend im Biogassektor<br />
47<br />
www.envitec-biogas.de
praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Typisch für IC-Reaktoren<br />
sind die maximal<br />
kirschkerngroßen<br />
Zusammenballungen<br />
unterschiedlich spezialisierter<br />
Bakterien, der<br />
sogenannte Pelletsschlamm.<br />
Prozesswasser aus dem<br />
IC-Reaktor mit dem<br />
darin enthaltenen Pelletsschlamm,<br />
in dem<br />
das Biogas entsteht.<br />
Abbaurate von fast<br />
90 Prozent<br />
Von dem Domaufsatz führen<br />
außerdem Rohre in der Mitte<br />
des Behälters nach unten. Sie<br />
haben ihre obere Öffnung im<br />
Gasabscheidetank auf dem<br />
Behälter und enden kurz über<br />
dem Boden. Über diese Rohre<br />
gelangt hochgewirbeltes Abwasser-Schlamm-Gemisch<br />
zurück<br />
zum Behältergrund. „Das<br />
hat neben der internen Umwälzung,<br />
die ohne Pumpen auskommt,<br />
den nützlichen Effekt,<br />
dass sich der Pelletsschlamm<br />
gleichmäßig im Reaktorraum<br />
verteilt und kein Konzentrationsgefälle<br />
entsteht“, erläutert<br />
der Umweltexperte.<br />
Da chemische Reaktionen bei<br />
einer gleichmäßig niedrigen<br />
Konzentration mit einem höheren Umsatzgrad ablaufen<br />
als bei hoher Konzentration, ließen sich mit den<br />
IC-Reaktoren während der rechnerischen Verweilzeit<br />
von nur 12 bis 14 Stunden und einer Raumbelastung<br />
von bis zu 30 Kilogramm CSB pro Kubikmeter (m³) und<br />
Tag Abbauraten von fast 90 Prozent der allerdings im<br />
Abwasser bereits während der Altpapiereinweichung<br />
gelösten organischen Verbindungen erzielen. Dies<br />
und der Umstand, dass durch die Füllhöhe und den<br />
dadurch bedingten hydrostatischen Druck von 3 bar im<br />
Behälter bereits viel CO 2<br />
im Prozesswasser gelöst wird,<br />
bewirke auch den für das ICR-Verfahren typischen hohen<br />
Methangehalt von 65 bis 70 Prozent im erzeugten<br />
Biogas. Fischer spricht von einer Art vorausgehender<br />
Biogaswäsche. Die stündlich anfallenden rund 100 m³<br />
Abwasser aus der Papierproduktion werden vor dem<br />
Einleiten, das nahe am Behälterboden erfolgt, mit 300<br />
m³ Gärflüssigkeit vermischt. Diese sammelt sich aus<br />
dem oberen Überlauf kommend in einem Standrohr<br />
außen am IC-Reaktor. Ziel der Vermischung ist ebenfalls<br />
die Gewährleistung einer etwa gleichen Organik-<br />
Konzentration über die gesamte Reaktorhöhe. Die<br />
Reaktionstemperatur von rund 38 Grad Celsius sichert<br />
allein der Zufluss des von der Altpapierauflösung noch<br />
warmen Abwassers. Eine zusätzliche Heizmöglichkeit<br />
gibt es nicht.<br />
Während Abwasser in den Behälter strömt, werden<br />
gleichzeitig 100 m³ entfrachtetes Wasser aus dem<br />
Standrohr abgeleitet. Es kann nun in einer Kaskade<br />
von fünf Belebungsbecken und einem abschließenden<br />
Nachklärbecken soweit von der restlichen organischen<br />
Fracht sowie von Phosphor und Stickstoff gereinigt werden,<br />
bis die vorgeschriebenen Werte für eine Einleitung<br />
in die Mulde erreicht sind. „Die gesamte Kläranlage<br />
einschließlich der Reaktoren hat einen Einwohnergleichwert<br />
von 140.000, könnte also das Abwasseraufkommen<br />
einer Stadt bewältigen“, verdeutlicht Fischer<br />
den Reinigungsaufwand.<br />
Neue Anlage zur Gasaufbereitung<br />
Beide Abwasserbehandlungsstufen in der Papierfabrik<br />
Trebsen wurden in den vergangenen Monaten für rund<br />
2 Millionen Euro modernisiert und erweitert. So erhebt<br />
sich in dem Komplex jetzt ein zweiter silbrig glänzender<br />
IC-Reaktorturm. Er arbeitet seit Dezember vergangenen<br />
Jahres. „Zurzeit betreiben wir beide Abwasser-<br />
Reaktoren parallel mit je 40 bis 70 m³ Abwasser pro<br />
Stunde“, informiert der Trebsener Kläranlagenchef.<br />
Die aufgeteilte und dadurch für den einzelnen Gärtank<br />
geringere Raumbelastung befördere die Stabilität und<br />
das Wachstum der Bakterien im Pelletsschlamm. Dabei<br />
werde der neue Behälter behutsam hochgefahren. Bei<br />
voller Auslastung könne er dann allein die organische<br />
Fracht des Abwassers von der Altpapierauflösung abbauen<br />
und dabei bis zu 550 m³ Rohbiogas pro Stunde<br />
produzieren. Der ältere Gärbehälter dient künftig als<br />
Redundanz-Aggregat für die Sicherung einer unterbrechungsfreien<br />
Papierproduktion oder wird bei einem<br />
übermäßigen Anstieg der Schmutzfracht im Abwasser<br />
zugeschaltet.<br />
48
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
praxis<br />
Der BHKW-Service von WELTEC.<br />
Immer in Ihrer Nähe.<br />
Taucharbeiten im gefülltem Fermenter<br />
• Wir sind europaweit für Sie unterwegs!<br />
• Verbohren von Rührwerksstativen<br />
• Tauchen in Thermophilen Anlagen<br />
• Abtrennen von Rohrleitungen<br />
• Heizleitung Reparaturen<br />
• Suchen und Bergen<br />
Tel: 04872 3810<br />
Mobil: 0172 755 99 99<br />
voss.eurodiver24@gmail.com<br />
Ihre Vorteile<br />
• alle gängigen Motoren<br />
• langjährige & geschulte Mitarbeiter<br />
• 24/7 Notdienst<br />
Organic energy worldwide<br />
WELTEC BIOPOWER GmbH<br />
04441-999 78-0<br />
info@weltec-biopower.de<br />
Seitz Electric GmbH GasManager BGJ 1_<strong>2019</strong>.pdf 1 07.12.18 13:56<br />
www.eurodiver24.de<br />
BIOGAS<br />
SEITZ ELECTRIC<br />
messen · steuern · regeln<br />
Gas-Füllstand<br />
Für jeden Gasspeicher<br />
die richtige Füllstandsmessung<br />
GasHmeter XA oder XU<br />
GasManagement<br />
Gasspeicher-<br />
Füllstands-Abluftregelung<br />
Einen geregelten Füllstands-Ausgleich<br />
mehrerer Doppelmembran-Gasspeicher<br />
auf gleichen oder vordefinierten<br />
Füllstand<br />
.<br />
BHKW-Ansteuerung<br />
Flex,-/ Regelenergie-Betrieb über<br />
virtuelle Kraftwerksbetreiber<br />
Multi-Analog-Wandler<br />
Verbindet mehrere 4-20mA Signale von<br />
verschiedenen Messungen und Gasspeichern<br />
zu einem Gasfüllstands-Signal<br />
+ BHKW 1/2 Soll-Leistung<br />
+ Fackelansteuerung<br />
+ Hoch-, Tief-Alarme<br />
Gasspeicher-<br />
Druck-Ausgleich<br />
Gastransport zwischen EPDM-Hauben<br />
oder Gassack und Druck-Gasspeichern<br />
wie Doppelmembrane<br />
oder 3/4 Kugel<br />
49<br />
Seitz Electric GmbH Saalfeldweg 6 86637 Wertingen/Bliensbach 08272 993160 info@seitz-electric.de www.seitz-electric.de
praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
In der Papierfabrik werden täglich in drei Schichten etwa 700<br />
Tonnen Braunpapier hergestellt. Dafür wird viel Wasser benötigt.<br />
Rohstoff für die Herstellung von Braunpapier ist ausschließlich<br />
Altpapier. Bei dessen Aufbereitung entsteht stark mit Organik<br />
befrachtetes Abwasser, das gereinigt werden muss.<br />
Umweltexperte Dr.-Ing.<br />
Elmar Fischer erläutert<br />
anhand einer Skizze<br />
die Funktionsweise des<br />
IC-Reaktors.<br />
Ein Wermutstropfen ist der durch die Herkunft des Abwassers<br />
bedingte Schwefelgehalt des Gases von mehreren<br />
Tausend ppm. Die Grobentschwefelung erfolgte<br />
bislang durch das Einblasen großer Mengen Luftsauerstoff.<br />
Demnächst übernimmt dies eine mit Natronlauge<br />
arbeitende Gaswäsche. Dieses Verfahren hat neben<br />
einer hohen Entschwefelungsleistung den Vorteil, dass<br />
eine Verunreinigung des Biogases mit anderen Gasen<br />
vermieden wird und die Natronlauge nach einer Regenerierung<br />
erneut verwendet werden kann.<br />
Die weitere Verwertung des Biogases legt die Trebsener<br />
Papierfabrik jedoch in die Hände von Spezialisten.<br />
Das war bisher der Betreiber von zwei Blockheizkraftwerken<br />
mit einer Leistung von insgesamt 325 Kilowatt<br />
elektrische Leistung. Da künftig größere Gasmengen<br />
zur Verfügung stehen und die thermische Energie am<br />
BHKW-Standort ohnehin nicht genutzt werden konnte,<br />
errichtete und betreibt die in Münster ansässige revis<br />
bioenergy GmbH eine Gasaufbereitungsanlage. Sie<br />
übergibt seit diesem Jahr den zu fast reinem Biomethan<br />
aufbereiteten Energieträger an eine Einspeisestation<br />
der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Gas mbH. Die Investition<br />
umfasste nach Angaben von revis-Geschäftsführer<br />
Simon Detscher rund 4 Millionen Euro.<br />
Die Gasreinigung arbeitet nach dem Prinzip der physikalischen<br />
Absorption. Im Gegensatz zu anderen<br />
Verfahren kommt hier ein organisches Lösungsmittel<br />
zum Einsatz, das mehr CO 2<br />
aufnehmen kann als Wasser.<br />
Die Einspeisung und der Verkauf des<br />
Biomethans wird – weil das Abwasser kein<br />
Abfall ist – wegen der fehlenden Abfalleigenschaft<br />
des Inputs bei der Biogaserzeugung<br />
nicht durch das EEG begünstigt. „Wir<br />
vermarkten das Biomethan über langfristige<br />
Verträge im Bereich der alternativen<br />
Energieversorgung und kalkulieren mit<br />
einem 15-jährigen Betrieb der Gasreinigungsstrecke“,<br />
so Detscher.<br />
Autor<br />
Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Freier Journalist<br />
Rudolph Reportagen – Landwirtschaft<br />
Umwelt, Erneuerbare Energien<br />
Kirchweg 10 · 04651 Bad Lausick<br />
03 43 45/26 90 40<br />
www.rudolph-reportagen.de<br />
50
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
praxis<br />
www.michael-kraaz.de<br />
Siebkörbe<br />
Original + Nachbau<br />
Separatoren stationär / mobil / integrierte Pumpe<br />
Individuelle Beratung und Konzepte<br />
• Anlagenerweiterung und -flexibilisierung<br />
• Optimierung des Anlagenbetriebes<br />
• Genehmigungsplanung<br />
• Vorbereitung, Betreuung sämtlicher Prüfungen<br />
neutral, herstellerunabhängig, kompetent<br />
Tel +49 (0)5844 976213 | mail@biogas-planung.de<br />
Schubboden-Trockner + Luftwäscher<br />
Gärrest-Trockner-<br />
Eindicker mit Luftwäscher<br />
ab 400 kWtherm EEG 2009<br />
z.B. für 250 kWtherm EEG 2009<br />
Brikettierer<br />
Tel. 051 32 / 588 663<br />
Rotoren und Statoren<br />
für Excenterschneckenpumpen aller Hersteller.<br />
In Deutschland gefertigt im Originalmaß und aus<br />
demselben Material<br />
oft bis zu 40% billiger<br />
Alle Angebote unter www.ilmaco-vertrieb.de<br />
ILMACO Vertrieb oHG mb@ilmaco.de<br />
Fischerstr. 13 · 84137 Vilsbiburg · (0176) 476 494 69<br />
Ihr Biomethan-Experte<br />
NaWaRo/Abfall Projektentwicklung | Beteiligungsmanagement<br />
Stilllegungsnachweise | BHKW Umsetzung<br />
Ganzheitliche Beratung | Betriebsoptimierung<br />
24/7 Service und Ersatzteilmanagement<br />
ARCANUM Energy Systems | Iserlohner Straße 2 | D-59423 Unna | +49 (0)2303 96 720 - 0 | www.arcanum-energy.de<br />
BEEINDRUCKEND VIELSEITIG.<br />
HEBEN SIE IHRE ANSPRÜCHE.<br />
Kramer Teleskoplader<br />
bis 9 m Stapelhöhe:<br />
Robust, vielseitig und<br />
effizient bis ins letzte Detail.<br />
Ob es nun der kompakte Allrounder oder die maximale Leistung<br />
für den Profieinsatz werden soll - alle elf Modelle sind für die<br />
vielseitigen Aufgaben auf dem Hof wie gemacht.<br />
Dabei zeichnen sich die Teleskoplader durch ihre hohe<br />
Nutzerfreundlichkeit und die technische Raffinesse aus.<br />
Mehr Infos unter:<br />
www.kramer.de/teleskoplader<br />
NEUGIERIG<br />
?<br />
51
Kerstin Maurus füllt<br />
Wissenschaft<br />
Maissilage in die<br />
einzelnen Behälter des<br />
Ringtellers ein. Mit diesem<br />
System kann bei<br />
stündlicher Maiszufuhr<br />
die Fütterung für drei<br />
Tage automatisiert<br />
werden (72 Behälter im<br />
Ringsystem).<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Fotos: Kerstin Maurus<br />
Zuckerrübe: vielversprechendes<br />
Spitzenlastsubstrat<br />
Die flexible Stromproduktion durch gezieltes Substratmanagement ist eine vielversprechende<br />
Alternative zu teuren technischen Anpassungen. An der Universität Ulm werden<br />
in einem FNR-Forschungsprojekt Versuche mit Zuckerrübensilage als Spitzenlastsubstrat<br />
durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass sehr kurzfristig eine Verdoppelung der Biogasund<br />
Methanproduktionsraten möglich ist, hohe Zuckerrübenanteile aber zu Prozessinstabilitäten<br />
führen können.<br />
Von M.Sc. Biol. Kerstin Maurus, Dr. Sharif Ahmed und Prof. Dr. Marian Kazda<br />
Ein großer Vorteil der Energieerzeugung durch<br />
Biogas im Vergleich zu Solar- und Windkraft<br />
ist die Möglichkeit der bedarfsgerechten<br />
Produktion. Damit können die durch Tageszeiten<br />
und Wetter bedingten Schwankungen<br />
der Stromproduktion aus Sonne und Wind optimal ausgeglichen<br />
und kann Energie genau dann bereitgestellt<br />
werden, wenn sie benötigt wird. Für den Biogasproduzenten<br />
ergibt sich der zusätzliche wirtschaftliche<br />
Vorteil, dass der Strom dann produziert werden kann,<br />
wenn sich die höchsten Preise am Strommarkt erzielen<br />
lassen.<br />
Zusätzlich wird diese Entwicklung auch durch die<br />
Erneuerbare-Energien-Gesetze von 2012 und 2017<br />
beispielsweise mit der Flexprämie beziehungsweise<br />
mit dem Flexzuschlag gefördert. Eine flexible Stromproduktion<br />
lässt sich über technische Anpassungen<br />
wie die Vergrößerung der Speicherkapazitäten oder<br />
den Zusammenschluss mehrerer Anlagen bis hin zum<br />
Management der eingesetzten Substrate umsetzen. Die<br />
technische Anpassung von Bestandsanlagen ist meist<br />
durch den Zubau neuer Speichereinheiten und Schutzeinrichtungen<br />
teuer und hängt zudem von der verfügbaren<br />
Infrastruktur und Fläche ab.<br />
Eine Alternative zu diesen Investitionen ist die Flexibilisierung<br />
durch das Substratmanagement. Veränderungen<br />
der Menge und der zeitlichen Zufuhr des Substrats<br />
können die Fermentation und die Prozessstabilität im<br />
Vergleich zu einer kontinuierlichen Fütterung jedoch<br />
stärker beeinflussen. Dabei spielt vor allem die Abbaukinetik,<br />
also die Dynamik des Abbaus der eingesetzten<br />
Substrate, eine wichtige Rolle.<br />
52
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Abbildung 1: pH (blau) und FOS/TAC (rot) während der<br />
stoßweisen Zufuhr von unterschiedlichen Anteilen an<br />
Zuckerrübensilage im Substratmix<br />
A<br />
FOS/TAC<br />
B<br />
FOS/TAC<br />
0,6<br />
0,5<br />
0,4<br />
0,3<br />
0,2<br />
0,1<br />
0<br />
6<br />
0 10 20 30 40 50 60 70<br />
Tage<br />
0,6<br />
0,5<br />
0,4<br />
0,3<br />
0,2<br />
0,1<br />
0<br />
6<br />
0 10 20 30 40 50 60 70<br />
Tage<br />
8,5<br />
8<br />
7,5<br />
7<br />
8,5<br />
8<br />
7,5<br />
7<br />
pH pH<br />
6,5<br />
6,5<br />
C<br />
0,6<br />
8,5<br />
FOS/TAC<br />
D<br />
FOS/TAC<br />
0,5<br />
0,4<br />
0,3<br />
0,2<br />
0,1<br />
0<br />
6<br />
0 10 20 30 40 50 60 70<br />
Tage<br />
0,6<br />
0,5<br />
0,4<br />
0,3<br />
0,2<br />
0,1<br />
0<br />
0 10 20 30 40 50 60 70<br />
Tage<br />
FOS/TAC<br />
Fermenter 1: 1:0 (A), Fermenter 2: 6:1 (B), Fermenter 3: 3:1 (C),<br />
Fermenter 4: 1:3 (D); Verhältnis Mais-Zuckerrübensilage auf oTS Basis.<br />
8<br />
7,5<br />
7<br />
8,5<br />
8<br />
7,5<br />
7<br />
6,5<br />
6<br />
pH pH<br />
6,5<br />
pH<br />
Vollgas im Fermenter.<br />
Enzyme<br />
MethaFerm ® Mais liquid<br />
– Hochkonzentriertes Enzym<br />
zum Abbau von Cellulose,<br />
Hemicellulose und anderen<br />
Zellwandbestandteilen<br />
– Hervorragende Verteilung bei<br />
geringsten Aufwandmengen<br />
– Stabil auch in hohen pHund<br />
Temperaturbereichen<br />
– Geeigent für Mais und<br />
strukturreiche Substrate<br />
Ziel der Versuche des an der Universität Ulm durchgeführten<br />
und von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR)<br />
geförderten FLEXIZUCKER-Projektes (FKZ 22402115) ist es,<br />
diese alternative Möglichkeit der Flexibilisierung genauer zu<br />
untersuchen. Die Zuckerrübe erfüllt mit einem hohen Anteil an<br />
schnell verfügbaren Kohlenhydraten und einer guten Dosierbarkeit<br />
einige Voraussetzungen für die bedarfsgerechte Bio-<br />
Ideal bei trockengeschädigter<br />
Maissilage<br />
www.terravis-biogas.de<br />
53<br />
Ihr Ansprechpartner:<br />
Jens Petermann, Tel.: 0251 . 682-2438<br />
jens.petermann@terravis-biogas.de<br />
Benedikt Baackmann, Tel.: 0251 . 682-2645<br />
benedikt.baackmann@terravis-biogas.de<br />
FELD<br />
SILO<br />
FERMENTER<br />
ENERGIE
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Hier sind die Laborfermenter zu sehen mit den daneben befindlichen Ringtellern. Die Zuckerrübensilage<br />
wird über Peristaltikpumpen in die Fermenter geführt. Die Fermenter sind mit unterschiedlicher Messsensorik<br />
ausgestattet, wie Temperatur- oder pH-Sensoren.<br />
Insgesamt vier Laborfermenter (schwarze, zylinderförmige<br />
Behälter) können individuell betrieben<br />
werden.<br />
gasproduktion. Bisher macht die Zuckerrübe<br />
allerdings nur einen Anteil von etwa<br />
3 Prozent an den Bioenergiesubstraten in<br />
Deutschland aus. Die Charakteristik der Zuckerrübe<br />
als Spitzenlastsubstrat steht deshalb<br />
im Mittelpunkt der Untersuchungen.<br />
Versuchsablauf<br />
Für den Versuch wurden vier kontinuierliche<br />
Durchflussfermenter mit einem Gesamtvolumen<br />
von zwölf Litern verwendet.<br />
Alle Fermenter wurden bei einer Raumbelastung<br />
von 2,0 Kilogramm organische<br />
Trockensubstanz pro Kubikmeter und Tag<br />
(kg oTS m -3 d -1 ) mit Maissilage und Zuckerrübensilage<br />
in unterschiedlichen Verhältnissen<br />
betrieben. Fermenter 1 wurde nur<br />
mit Maissilage gefüttert (Verhältnis Maiszu<br />
Zuckerrübensilage auf oTS-Basis = 1:0)<br />
und diente als Kontrollfermenter. Für die<br />
Fermenter 2 bis 4 wurde der Anteil der Zuckerrübensilage<br />
jeweils erhöht und wurden<br />
die Mischungsverhältnisse 6:1, 3:1 und<br />
1:3 zugunsten der Zuckerrübe verschoben.<br />
Zunächst wurden beide Substrate zeitgleich<br />
und stündlich in die Fermenter zugeführt,<br />
um einen stabilen, kontinuierlichen<br />
Prozess bei der gewünschten Raumbelastung<br />
zu erreichen. Im Anschluss wurde das<br />
Fütterungsmanagement auf eine stoßweise<br />
Zufuhr der Zuckerrübensilage umgestellt.<br />
Dabei wurde die gleiche Menge an Zuckerrübensilage<br />
auf zwei Portionen pro Tag<br />
aufgeteilt, die im Abstand von zwölf Stunden<br />
in die Fermenter gegeben wurde. Die<br />
Maissilage als Grundsubstrat wurde weiterhin<br />
stündlich zugeführt. Während des<br />
gesamten Versuchs wurden das gebildete<br />
Biogas- und Methanvolumen, der pH-Wert,<br />
der FOS/TAC-Wert, der TS- und oTS-Gehalt<br />
sowie die organischen Säuren überwacht.<br />
Prozessstabilität<br />
Bei der Überwachung der pH- und FOS/<br />
TAC-Werte der Fermenter 1 bis 3 konnten<br />
keine Auffälligkeiten beobachtet werden.<br />
Während des gesamten Versuchs blieben<br />
die pH-Werte im optimalen Bereich zwi-<br />
WEGWEISENDE<br />
SEPARATIONSTECHNIK<br />
+ Multi Disc Technik für höchste<br />
Durchbruchsicherheit und TS-Gehalte bis zu 38 %<br />
+ Förderschnecke mit Faserstoffbürste verhindert<br />
metallische Reibung und sorgt für lange Standzeiten<br />
und kontinuierliche Reinigung des Filtersiebes<br />
+ anschlussfertige Komplettaggregate mit perfekt<br />
aufeinander abgestimmten Komponenten,<br />
Separator, Pumpe und Steuerungstechnik<br />
„aus einer Hand“<br />
Leistungsstark, langlebig<br />
und sicher.<br />
B I O S E L E C T<br />
54<br />
mehr unter:<br />
www.boerger.de<br />
Börger GmbH | D-46325 Borken-Weseke | Tel. 02862 9103 30
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Wissenschaft<br />
schen 7,5 und 8,5. Die FOS/<br />
TAC-Werte zeigten durchgehend<br />
stabile Werte um 0,1<br />
(siehe Abbildung 1). Auffällig<br />
hingegen war der Fermentationsverlauf<br />
im Fermenter 4,<br />
der den höchsten Anteil (75<br />
Prozent der eingesetzten oTS)<br />
an stoßweise zugeführter Zuckerrübensilage<br />
erhalten hatte.<br />
Bereits nach etwa 30 Tagen der<br />
flexiblen Fahrweise begannen die FOS/TAC-<br />
Werte zu steigen und zeitgleich die pH-Werte<br />
zu sinken. Durch die GC-Analyse konnte<br />
zusätzlich auch eine Zunahme der Essig-,<br />
Propion- und Buttersäure nachgewiesen<br />
werden. Bei einem FOS/TAC-Wert von 0,49<br />
wurde die Substratzufuhr gestoppt, um den<br />
Prozess nicht weiter zu belasten.<br />
Die Prozessstabilität ließ sich allerdings<br />
nicht langfristig wiederherstellen. Nachdem<br />
sich die FOS/TAC-Werte nach einer<br />
Woche auf einen Wert von 0,08 stabilisiert<br />
hatten und die Substratzufuhr wiederaufgenommen<br />
wurde, zeigten sich innerhalb<br />
weniger Tage ein erneuter Einbruch der pH-<br />
Werte sowie ein starker Anstieg der FOS/<br />
TAC-Werte auf bis zu 0,55.<br />
Biogas- und Methanerträge<br />
Zur Betrachtung der Biogas- und Methanerträge<br />
wurden die Daten, entsprechend den<br />
Fütterungsintervallen der Zuckerrübensilage,<br />
in Perioden von je zwölf Stunden eingeteilt.<br />
Dabei wurden die Werte alle fünf<br />
Minuten aufgezeichnet, um ein möglichst<br />
Spezifischer Biogas- und Methanertrag (erste Stufe einer<br />
kontinuierlichen Fermentation) der vier getesteten Verhältnisse<br />
von Mais- zu Zuckerrübensilage<br />
Fermenter<br />
Spezifischer Biogasertrag<br />
[L / kg -1 oTS]<br />
Spezifischer Methanertrag<br />
[L / kg -1 oTS]<br />
1 (M:Z 1:0) 467 281<br />
2 (M:Z 6:1) 470 290<br />
3 (M:Z 3:1) 479 294<br />
4 (M:Z 1:3) 386 230<br />
hochauflösendes Bild zu bekommen. Deutlich<br />
zu erkennen ist die Zunahme der Biogas-<br />
und Methanproduktionspeaks direkt<br />
nach Zugabe der Zuckerrübensilage. Je<br />
höher deren Anteil, desto höher auch die<br />
Produktionspeaks (siehe Abbildung 2).<br />
Der Fermenter 1 zeigte – bezogen auf diese<br />
fünfminütigen Intervalle – eine konstante<br />
Produktion von 0,03 Liter Biogas pro 5<br />
Minuten beziehungsweise 0,02 Liter Methan<br />
pro 5 Minuten, wie durch die kontinuierliche<br />
Beschickung zu erwarten war.<br />
Die Schwankungen, die sich in Abbildung<br />
2 zeigen, sind durch die Rührzyklen zu erklären,<br />
die nochmals zeigen, wie sensitiv<br />
das System innerhalb einer Biogasanlage<br />
auf äußere Einwirkungen reagiert.<br />
Die erhöhten Produktionsraten der Fermenter<br />
2 bis 4 nach Zugabe der Zuckerrübensilage<br />
hielten etwa zwei Stunden an.<br />
Die höchsten Biogas- und Methanproduktionsspitzen<br />
konnten im Fermenter 4 beobachtet<br />
werden. Direkt nach Zugabe der<br />
Zuckerrübensilage stieg die Produktionsrate<br />
auf 0,12 Liter Biogas pro 5 Minuten<br />
und 0,08 Liter Methan pro 5<br />
Minuten. Nach Abklingen des<br />
Peaks fielen die Produktionsraten<br />
jedoch unter 0,01 Liter pro<br />
5 Minuten, und blieben im Vergleich<br />
zu den anderen Fermentern<br />
unter deren beobachteter<br />
Basisproduktion. Einhergehend<br />
mit dem Anstieg der FOS/TAC-<br />
Werte konnte auch ein Einbruch<br />
der Biogas- und Methanerträge<br />
in diesem Fermenter beobachtet werden.<br />
Die spezifischen Erträge fielen demnach im<br />
Vergleich zu den anderen Fermentern auch<br />
deutlich geringer aus (siehe Tabelle).<br />
Die stoßweise Zugabe von leicht vergärbaren<br />
Substraten wie der Zuckerrübensilage<br />
führt dazu, dass die ersten Stufen der Biogasproduktion<br />
sehr schnell ablaufen und<br />
Säuren im Fermenter angereichert werden.<br />
Zusammen mit dem Fehlen faserreicher<br />
Substrate kann das zum Ungleichgewicht<br />
in der Aktivität der mikrobiellen Gemeinschaften<br />
führen, was im schlimmsten Fall<br />
ein komplettes Prozessversagen zur Folge<br />
hat. Dies hatte sich im Fermenter 4 mit<br />
einem überwiegenden Anteil an Zuckerrübensilage<br />
bereits abgezeichnet.<br />
Anwendbarkeit in der Praxis<br />
Auch wenn sich die höchsten Produktionsspitzen<br />
für Biogas und Methan beim<br />
höchsten Anteil der Zuckerrübensilage<br />
im Substratmix gezeigt haben, ist dieses<br />
Schema nicht für eine Anwendung in der<br />
Praxis geeignet. Die Ergebnisse ähneln ei-<br />
„ Energie sparen?<br />
Aber sicher! Dafür empfehle<br />
ich SILASIL ENERGY.XD“<br />
Jochen Blinn, Silage-Experte<br />
www.schaumann-bioenergy.eu<br />
„Die verkürzte Reifezeit mit SILASIL ENERGY.XD bringt Ihrem Silo sicheren Schutz vor<br />
Nach erwärmung und Verderb. So werden Energieverluste während der Lagerphase drastisch<br />
reduziert! Damit Sie das, was sie geerntet haben, optimal nutzen können.“<br />
Mehr Infos zu dem führenden Siliermittel-Programm erhalten Sie unter Tel. 04101 218-5400<br />
Kompetenz in Biogas<br />
55
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Abbildung 2: Durchschnittliche Biogas- (grün) und Methanproduktionsrate (orange) während einer Periode (12 Stunden),<br />
wobei die stoßweise Zufuhr von Zuckerrübensilage immer zum Zeitpunkt 0 stattgefunden hat<br />
0,14<br />
0,12<br />
0,1<br />
Nl 5 min -1<br />
0,08<br />
0,06<br />
0,04<br />
0,02<br />
A<br />
0<br />
0 2 4 6 8 10 12<br />
Stunden<br />
0 2 4 6 8 10 12<br />
Stunden<br />
B<br />
0,14<br />
0,12<br />
0,1<br />
Nl 5 min -1<br />
0,08<br />
0,06<br />
0,04<br />
0,02<br />
C<br />
0<br />
0 2 4 6 8 10 12<br />
Stunden<br />
0 2 4 6 8 10 12<br />
Stunden<br />
BPR MPR<br />
D<br />
Die Fermenter wurden jeweils mit unterschiedlichen Anteilen von Zuckerrübensilage gefüttert: Fermenter 1: 1:0 (A),<br />
Fermenter 2: 6:1 (B), Fermenter 3: 3:1 (C), Fermenter 4: 1:3 (D); Verhältnis Mais-Zuckerrübensilage auf oTS Basis.<br />
ner Monofermentation von Zuckerrüben,<br />
die bereits eingehend getestet wurde und<br />
zu Problemen führen kann. Die Methanerträge<br />
sind zu gering und das Risiko einer<br />
Übersäuerung zu hoch.<br />
Bei einem Anteil von 25 Prozent Zuckerrübensilage<br />
an zugeführter oTS (Fermenter<br />
3) konnte ein langfristig stabiler Prozess<br />
erreicht werden. Auch hier wird ein starker<br />
Anstieg der Biogas- und Methanproduktion<br />
ohne Verzögerungen nach der stoßweisen<br />
Zugabe der Zuckerrübe erreicht. Eine<br />
überschlägige Ertragsabschätzung ergab,<br />
dass mit dem Einsatz von einer Tonne Zuckerrübensilage<br />
bei einem angenommenen<br />
BHKW-Wirkungsgrad von 40 Prozent etwa<br />
75 Kilowatt Spitzenlaststrom innerhalb von<br />
zwei Stunden erzeugt werden könnten. Dies<br />
resultiert allein aus den schnell umsetzbaren<br />
Substratanteilen im ersten Fermenter<br />
einer Biogasanlage.<br />
Ähnliche spezifische Biogas- und Methanerträge<br />
für die Fermenter 1 bis 3 zeigen,<br />
dass eine Umstellung auf eine stoßweise<br />
Substratzufuhr den Biogasprozess im<br />
Ganzen nicht beeinflusst (siehe Tabelle).<br />
Im Gegensatz zu früheren Annahmen, dass<br />
die besten Produktionsraten nur durch einen<br />
kontinuierlichen Betrieb zu erreichen<br />
sind, hat sich in diesem Versuch sogar eine<br />
leichte Steigerung der Erträge nach der<br />
Umstellung auf die flexible Fahrweise gezeigt.<br />
Solche Befunde sind in der internationalen<br />
Literatur zu finden.<br />
Auch wenn der Prozess bis zu einem Verhältnis<br />
von 3:1 Mais- zu Zuckerrübensilage<br />
in diesen Versuchen keine Auswirkungen<br />
auf die Prozessstabilität gezeigt hat, kann<br />
die Fermentation mit Nährstoffen und puffernden<br />
Zusätzen unterstützt werden, da<br />
der Zuckerrübensilage diese Komponenten<br />
fehlen. Des Weiteren ist eine verstärkte Prozessüberwachung<br />
ratsam, um potenzielle<br />
Instabilitäten frühzeitig zu erkennen.<br />
Fazit: Die Zuckerrübe als Spitzenlastsubstrat<br />
zeigt sich bisher als sehr vielversprechend.<br />
Die Möglichkeit, innerhalb kürzester<br />
Zeit eine Verdoppelung der Biogas- und<br />
Methanproduktionsrate zu erreichen, bietet<br />
eine optimale Voraussetzung für die flexible<br />
Biogasproduktion durch Substratmanagement.<br />
Ein oTS-Anteil von 25 Prozent<br />
stoßweise zugeführter Zuckerrübensilage<br />
lieferte dabei die besten Ergebnisse für<br />
die Umstellung auf eine flexible Betriebsweise.<br />
Die nächsten Schritte innerhalb des<br />
Projekts an der Universität Ulm werden<br />
sich nun mit der Auslastung der Speicherkapazitäten<br />
bei einer zuckerrübenbasierten<br />
flexiblen Biogasproduktion und der Wirtschaftlichkeit<br />
des Substratmanagements<br />
beschäftigen.<br />
Autoren<br />
M.Sc. Biol. Kerstin Maurus<br />
Dr. Sharif Ahmed<br />
Prof. Dr. Marian Kazda<br />
Institut für Systematische Botanik und Ökologie<br />
Universität Ulm<br />
Albert-Einstein-Allee 11 · 89081 Ulm<br />
0731/ 50 23310<br />
kerstin.maurus@uni-ulm.de<br />
56
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Wissenschaft<br />
www.water-cover.de<br />
Zeltdächer<br />
Behälterabdeckung<br />
emissionsmindernd<br />
Tragluftdächer<br />
Gasspeicherdächer<br />
Doppelmembran-Dächer<br />
flexible Tanks<br />
Tel. 051 32 / 588 662<br />
57
Wissenschaft<br />
Das Hessische Biogaszentrum<br />
hat einen<br />
eigenen Energiepflanzen-Versuchsgarten.<br />
Hier werden auch<br />
verschiedene Substrate<br />
angebaut und im eigenen<br />
Labor getestet.<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Mehr Flexibilität mit vorhandenem<br />
Gasspeicher möglich<br />
Damit Biogasanlagen effizient in das Versorgungssystem integriert werden können,<br />
müssen sie flexibler werden. Ein Forschungsprojekt untersuchte, wie sich Biogasanlagen<br />
kostengünstig optimieren lassen.<br />
Von Dipl.-Ing. · Dipl. Journ. Martina Bräsel<br />
Die Biogasanlage besteht<br />
aus zwei Fermentern.<br />
Der Forschungsfermenter<br />
in der Mitte<br />
besitzt eine Betondecke,<br />
damit die produzierte<br />
Gasmenge exakt erfasst<br />
werden kann.<br />
Beim Upgrading von Bestandsbiogasanlagen<br />
hin zu flexiblen Energieerzeugern können<br />
deutlich Kosten eingespart werden. Dies<br />
fanden Wissenschaftler in einem dreijährigen<br />
Forschungsprojekt heraus, in dessen<br />
Mittelpunkt die bedarfsorientierte Dynamisierung der<br />
Biogasproduktion mit Blick auf die Prozessbiologie und<br />
die Anlagentechnik stand. „Für Bestandsanlagen bietet<br />
sich die Möglichkeit, mit geringem Aufwand bedarfsorientiert<br />
elektrische Energie bereitzustellen“, erklärt Dr.<br />
Henning Hahn vom Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft<br />
und Energiesystemtechnik (IEE).<br />
Es sei möglich, die Gasspeicherkapazitäten effektiver zu<br />
nutzen und dadurch die Wirtschaftlichkeit der Biogasanlage<br />
zu verbessern. Für Henning Hahn ist in der Praxis<br />
eine Einsparung des Gasspeichervolumens zwischen 20<br />
und 40 Prozent durchaus realistisch. „Auf jeden Fall<br />
kann der Anlagenbetreiber eine höhere Flexibilität anbieten,<br />
als sie der Gasspeicher momentan bietet.“<br />
Substrat- und Fütterungsstrategie<br />
Im Projekt konnte nachgewiesen werden, dass die<br />
Flexibilisierung der Gasproduktion von Biogasanlagen<br />
durch ein angepasstes Fütterungsmanagement<br />
möglich ist und ein hohes Potenzial in sich birgt. Eine<br />
Kombination von schnell und langsam abbaubaren<br />
Substraten und eine gezielte Fütterungsstrategie bringen<br />
erhebliche Vorteile und reduzieren das notwendige<br />
Gasspeichervolumen. Zu den<br />
Forschungspartnern des IEE<br />
gehörten die Maschinenring<br />
Kommunalservice GmbH Kassel,<br />
der Landesbetrieb Landwirtschaft<br />
Hessen (LLH) und<br />
der Landesbetrieb Hessisches<br />
Landeslabor (LHL).<br />
Die Laborversuche führte der<br />
LHL mit verschiedenen Kulturen<br />
durch. Getestet wurden<br />
unter anderem: Mais, Gülle<br />
und Mist, Getreideschrot und<br />
Ganzpflanzensilage, es kamen<br />
aber auch Wildpflanzenmischungen,<br />
Silphie und Zuckerrübe<br />
zum Einsatz. Um auf große<br />
Gasspeicher zu verzichten,<br />
sei es eine wichtige Vorausset-<br />
Fotos: Martina Bräsel<br />
58
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Wissenschaft<br />
zung, dass die Gasproduktion zügig einsetze. „Noch<br />
wichtiger ist, dass sie während Verstromungspausen<br />
möglichst schnell auf ein Minimum reduziert werden<br />
kann“, so Dr. Fabian Jacobi vom LHL.<br />
Zucker- und stärkehaltige Pflanzen würden prinzipiell<br />
schneller vergoren und eigneten sich deswegen gut<br />
für eine schnelle Biogasproduktion. „Im Labor zeigte<br />
sich, dass der notwendige Speicher unter den richtigen<br />
Bedingungen bis zu 50 Prozent reduziert werden<br />
konnte. Bei der richtigen „Fütterungsstrategie“ hätten<br />
aus Anbausicht ökologisch vorteilhafte Substrate wie<br />
Kleegras-Luzerne, Silphie und Wildpflanzenmischungen<br />
ähnliche Einsparpotenziale wie der Mais gezeigt.<br />
„In den Praxisversuchen an der großtechnischen Forschungsanlage<br />
mussten wir uns allerdings auf die<br />
drei vielversprechendsten Mischungen beschränken“,<br />
erklärt Dr. Hahn. Die besten Ergebnisse brachte ein<br />
Substratmix aus Rinderfestmist und Zuckerrüben. Die<br />
zweite Substratmischung bestand aus Gülle, Silphie<br />
und Getreideschrot. Die dritte Zusammensetzung, die<br />
großtechnisch erforscht wurde, bestand aus Gülle und<br />
Maissilage. Das Ergebnis war unerwartet: Alle drei Versuchsmischungen<br />
brachten bei der richtigen Fütterung<br />
Gasspeichereinsparungen von über 40 Prozent.<br />
Bei dieser erfolgreichen „Fütterungsstrategie“ wurde<br />
die Biogasanlage am Wochenanfang deutlich höher<br />
beschickt. „Wenn es möglich ist, sollten dann auch<br />
die schwer vergärbaren Substrate gefüttert werden“,<br />
verdeutlicht der IEE-Wissenschaftler. Im Verlauf der<br />
Woche sollte die Substratmenge verringert und sollten<br />
zunehmend leicht vergärbare Substrate eingebracht<br />
werden. Am Wochenende wird die BGA bis auf einen<br />
„kleinen Appetitanreger“ am Sonntagabend auf Nulldiät<br />
gesetzt.<br />
Ökonomische Analyse<br />
Aufbauend auf diesen Versuchsergebnissen betrachteten<br />
die Forscher die Wirtschaftlichkeit verschiedener<br />
Flexibilisierungsarten. „Bei unserer ökonomischen<br />
Analyse haben wir angenommen, dass ein Anlagenbetreiber<br />
vor der Entscheidung steht, ob es sich rechnet,<br />
den Anlagenbetrieb zu flexibilisieren“, so Hahn. Die<br />
damit verbundenen Investitionen möchte er jedoch nur<br />
tätigen, wenn die Rentabilität des eingesetzten Kapitals<br />
ausreichend ist. Bei der Abschätzung wurden drei<br />
verschiedene Fälle betrachtet: eine kontinuierliche<br />
Gasproduktion mit Gasspeichererweiterung, die flexible<br />
Gasproduktion mit Gasspeichererweiterung und die<br />
flexible Produktion ohne Erweiterung des Gasspeichers.<br />
In allen Fällen galt die Annahme, dass täglich (montags<br />
bis freitags) zweimal vier Stunden lang verstromt werden<br />
sollte. Am Wochenende stand das BHKW.<br />
Als Referenz diente eine typische NawaRo-Biogasanlage<br />
mit einer Stromvergütung nach dem EEG 2012. Es<br />
wurde angenommen, dass die Anlage eine installierte<br />
elektrische Leistung von 600 Kilowatt (kW) (500 kW el<br />
Bemessungsleistung) besitzt und mit diesen 8.000<br />
Die Herausforderung war, sehr kleine Gasmengen<br />
zu messen. Die vorhandene Messblendenmessung<br />
brachte nur bei größeren Volumenströmen gute<br />
Ergebnisse. Bei der Messblendenmessung wird in<br />
regelmäßigen Abständen druckgesteuert Gas abgezogen<br />
und durch die Messblende geschickt.<br />
Volllaststunden erreicht. Zudem sollten 30 Prozent<br />
der auskoppelbaren Abwärme extern genutzt und mit 2<br />
Cent pro Kilowattstunde thermische Energie (ct/kWhth)<br />
vergütet werden. Als „typische Substrate“ gingen Gülle,<br />
Getreide-GPS und Maissilage in die Berechnung ein.<br />
„Wir sind bei unserer Referenzanlage von einem Doppelmembrangasspeicher<br />
auf den Gärbehältern und<br />
einer Speicherkapazität von rund elf Stunden (bzw.<br />
4.638 Kubikmeter) ausgegangen“, so der Forscher.<br />
Diese Speichergröße diene zum Ausgleich von Produktionsschwankungen<br />
und zur Überbrückung von Wartungszeiten<br />
bei kontinuierlicher Gasproduktion. Zur<br />
Berechnung der Wirtschaftlichkeit sollte die Flexibilisierung<br />
der Anlage im zehnten Jahr der Anlagenlaufzeit<br />
für eine Restlaufzeit von zehn Jahren geschehen. Nach<br />
der Flexibilisierung sollte die installierte elektrische<br />
Leistung 2,1 Megawatt (MW) betragen.<br />
In den Fällen 2a und 2b wurde die Reduktion der Gasproduktion<br />
in den Zeiten ohne Verstromung um 40 Prozent<br />
(hoch) und 20 Prozent (gering) angesetzt und die<br />
Auswirkung der Flexibilität der Gasproduktion bewertet.<br />
Bei „hoch“ wurde angenommen, dass 40 Prozent<br />
des nutzbaren Gasspeicherbedarfs gegenüber der Anlage<br />
mit der kontinuierlichen Gasproduktion eingespart<br />
werden können.<br />
„Bei einer Investitionsbeurteilung mittels Annuitätenmethode<br />
ist die Wirtschaftlichkeit bei einer Annuität<br />
größer null gegeben, dann wäre der Kapitaldienst<br />
gedeckt und die erwünschte Rendite erfüllt“, erklärt<br />
Dr. Hahn. Die Ergebnisse zeigen: Bei gleicher Verstromungsflexibilität,<br />
aber kontinuierlicher Gasproduktion<br />
(Fall 1) und zusätzlicher Gasspeicherkapazität ist die<br />
Die Versuche in den Laborfermentern<br />
des LHL (Landesbetrieb Hessisches<br />
Landeslabor) zeigten, dass der<br />
notwendige Gasspeicher unter den<br />
richtigen Bedingungen bis zu 40<br />
Prozent reduziert werden kann.<br />
59
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Der Laborleiter des<br />
Fraunhofer IEE, Dipl.-<br />
Ing. Frank Schünemeyer,<br />
ließ sich etwas<br />
einfallen, damit die<br />
Gasmesstechnik des<br />
Forschungsfermenters<br />
auch bei sehr kleinen<br />
Volumenströmen<br />
funktionierte.<br />
Annuität am geringsten. Sie beträgt 619 Euro. Die an<br />
die Investition gestellten Erwartungen (Verzinsung des<br />
eingesetzten Kapitals, Entlohnung der Arbeit etc.) wurden<br />
trotzdem erfüllt.<br />
„Ein Anlagenbetreiber würde sich auch in diesem Fall<br />
für die Investition in die Erweiterung der Anlage entscheiden“,<br />
verdeutlicht der Wissenschaftler. Vor der<br />
Investition sollte sich der Betreiber fragen, ob die Annuität<br />
bei einer wirtschaftlichen Abschätzung ausreichend<br />
zur Entlohnung der Arbeitskraft und Verzinsung<br />
des eingesetzten Kapitals ist.<br />
„Die ökonomische Analyse zeigt, dass der Fall 2b<br />
(hoch) die wirtschaftlichste Variante ist“, so Hahn.<br />
Hierbei handelt es sich um die flexible Gasproduktion<br />
ohne Gasspeichererweiterung. In dem angenommenen<br />
Fall erzielte sie die höchste Annuität und wäre für Anlagenbetreiber<br />
die attraktivste Option. „Wenn der Gasspeicher<br />
kleiner ausfällt oder nicht nötig ist, reduzieren<br />
sich die Investitionskosten deutlich“, so Hahn.<br />
„Aus unserer Sicht ist für eine bedarfsgerechte Einspeisung<br />
eine Überbauung der Verstromungsaggregate<br />
notwendig, doch die zusätzliche Gasspeicherkapazität<br />
sollte möglichst effizient genutzt werden“, verdeutlicht<br />
Hahn. Übergroße Speicher hätten deutliche Nachteile:<br />
Neben dem größeren Investitionsaufwand, steigenden<br />
Betriebskosten und dem höheren Platzbedarf seien oft<br />
auch zusätzliche Sicherheits- und Genehmigungsauflagen<br />
zu erfüllen.<br />
Wenn der Anlagenbetreiber seine Anlage mit einem<br />
gezielten Fütterungsmanagement flexibilisieren will,<br />
dann gibt es einiges zu beachten: „Der Betreiber sollte<br />
ein anlagenspezifisches Konzept erstellen“, so der IEE-<br />
Forscher. Die Grundlage sollte ein festgelegter Verstromungsplan<br />
sein, auf dessen Basis ein Fütterungsplan<br />
aus Substraten mit unterschiedlichen Eigenschaften<br />
erstellt werden kann. Zudem sollten die geänderten<br />
Arbeitsabläufe (zum Beispiel Arbeitsspitzen unter der<br />
Woche und Entlastung an den Wochenenden) in das<br />
Betriebskonzept passen.<br />
Während des Forschungsprojektes durfte die Überdrucksicherung<br />
des Forschungsfermenters möglichst nicht anspringen.<br />
„Natürlich sollte sich der Gasspeicher für einen flexiblen<br />
Betrieb eignen und ausreichend groß sein“, fügt<br />
er hinzu. Wichtig sei auch, die Gasqualität regelmäßig<br />
zu kontrollieren und den Gasspeicherfüllstand und die<br />
Gasproduktionsrate richtig zu erfassen, mögliche Unsicherheiten<br />
sollten berücksichtigt werden. „Des Weiteren<br />
muss der gewählte Substratmix wirtschaftlich<br />
sein“, so Hahn, dazu sollte jeder Landwirt berücksichtigen,<br />
welche Substrate ihm regional und saisonal zur<br />
Verfügung stehen.<br />
„Der Betreiber sollte sich auch fragen, welche Möglichkeiten<br />
bestehen, kontinuierlich anfallende Substrate<br />
zwischenzulagern“, so der Forscher. Wichtig sei<br />
auch, die Anlagenfütterung über ein Wochenprogramm<br />
zu steuern. Auch sollte sich das Beschickungssystem<br />
für eine Substratumstellung eignen. „Sonst kann die<br />
Anlagentechnik Probleme bereiten“, verdeutlicht<br />
Henning Hahn. Nicht jede Biogasanlage verkrafte alle<br />
Substratrohstoffe, Zusammensetzungen und zeitlich<br />
erhöhte Fütterungsmengen.<br />
Für die Praxis bedeute dies, dass neben der Anpassung<br />
von Verstromungsaggregaten und Gasspeicherkapazitäten<br />
vor allem auch die Einbringtechnik „auf die<br />
hierfür notwendige Schlagkräftigkeit“ geprüft werden<br />
müsse. Zu prüfen sei, ob es bei hohen Substratzugaben<br />
in kurzer Zeit (Stoßbelastung) zu Kurzschlussströmen<br />
beim Überlauf in den Nachgärer kommen kann. „Es<br />
muss sicher sein, dass die Rührwerkstechnik für größere<br />
Substratstöße ausgelegt ist“, so Hahn.<br />
60
Biogas Investitionskosten Journal | 3_<strong>2019</strong> in € Fall 1 Fall 2a (hoch) Fall 2a (gering) Fall 2b (hoch) Fa<br />
Wissenschaft<br />
BHKW-Anschaffungskosten – durch Flexibilisierung verursacht 718.673 718.673 718.673 674.915<br />
Verstärkung Netzanschluss 56.499 56.499 56.499 41.499<br />
Annuität der untersuchten Anlagenkonzepte zur flexiblen Verstromung<br />
Gaslagererweiterungen 335.110 172.615 253.529 0<br />
Erweiterung Investitionskosten Periperie in € Fall 1 Fall 2a (hoch)<br />
177.216<br />
Fall 177.216 2a (gering) Fall 2b 177.216 (hoch) Fall 2b (gering) 56.742<br />
BHKW-Anschaffungskosten – durch Flexibilisierung verursacht 718.673 718.673 718.673 674.915 607.088<br />
Genehmigungen, Umweltgutachten 9.500 9.500 9.500 9.500<br />
Verstärkung Netzanschluss 56.499 56.499 56.499 41.499 41.499<br />
Anlagenzertifikat > 1 MW<br />
Gaslagererweiterungen el<br />
Mittelspannungsrichtlinie 2014 13.000 13.000 13.000 13.000<br />
335.110 172.615 253.529 0 0<br />
Planung Erweiterung und Periperie Genehmigung 177.216 65.500 177.216 57.375 177.216 56.742 61.421 53.051 39.783<br />
Wärmespeicher Genehmigungen, Umweltgutachten 9.500 105.000 9.500 105.000 9.500 105.000 9.500 9.500 85.000<br />
Rückbau<br />
Anlagenzertifikat > 1 MW el<br />
Mittelspannungsrichtlinie 2014 13.000 13.000<br />
69.625 61.500<br />
13.000 13.000<br />
65.546<br />
13.000<br />
42.908<br />
Planung und Genehmigung 65.500 57.375 61.421 39.783 36.207<br />
Invest, gesamt 1.550.122 1.371.378 1.460.383 963.346<br />
Wärmespeicher 105.000 105.000 105.000 85.000 85.000<br />
Rückbau 69.625 61.500 65.546 42.908 39.332<br />
Jährliche Kosten und Einnahmen in €/a<br />
Invest, gesamt 1.550.122 1.371.378 1.460.383 963.346 884.676<br />
Kapitalgebundene Kosten 108.200 84.939 96.522 37.535<br />
Betriebsgebunde<br />
Jährliche Kosten und<br />
Kosten<br />
Einnahmen in €/a<br />
65.283 61.897 63.583 52.181<br />
Kapitalgebundene Kosten<br />
Bedarfsgebundene Kosten<br />
108.200 84.939<br />
-13.970<br />
96.522<br />
-13.970<br />
37.535<br />
-13.970<br />
36.124<br />
-13.970<br />
Betriebsgebunde Kosten 65.283 61.897 63.583 52.181 47.157<br />
Sonstige Kosten<br />
Bedarfsgebundene Kosten -13.970<br />
16.152<br />
-13.970<br />
14.289<br />
-13.970<br />
15.217<br />
-13.970<br />
10.038<br />
-13.970<br />
Kosten, Sonstige Kosten gesamt 16.152 175.665 14.289 147.155 15.217 10.038 161.352 9.218 85.783<br />
Zusatzerlös Kosten, gesamt Strom 175.665 24.784 147.155 161.352 24.784 85.783 24.784 78.528 19.410<br />
Erlös<br />
Zusatzerlös<br />
Regelenergie<br />
Strom 24.784<br />
15.000<br />
24.784<br />
15.000<br />
24.784 19.410<br />
15.000<br />
14.259<br />
10.000<br />
Erlös Regelenergie<br />
Flexprämie<br />
15.000 15.000<br />
136.500<br />
15.000<br />
136.500<br />
10.000<br />
136.500<br />
10.000<br />
120.000<br />
Flexprämie 136.500 136.500 136.500 120.000 78.000<br />
Erlöse, gesamt<br />
Erlöse, gesamt 176.284<br />
176.284<br />
176.284<br />
176.284<br />
176.284<br />
176.284<br />
149.410<br />
149.410<br />
102.259<br />
Annuität 619 619 29.129 29.129 14.933 63.627 14.933 23.731 63.627<br />
Legende: Fall Fall 1: 1: kontinuierliche Gasproduktion Gasproduktion und Gasspeichererweiterung<br />
und Gasspeichererweiterung<br />
Fall Fall 2a: 2a: flexible flexible Gasproduktion, Gasproduktion, reduzierte reduzierte Gasspeichererweiterung, Gasspeichererweiterung, Verstromung wie Verstromung in Fall 1 wie in Fall 1<br />
Fall 2b: flexible Gasproduktion, keine Gasspeicherweiterung, geringere Flexibilität der Verstromung geg. Fall 1 und 2a<br />
Fall 2b: flexible Gasproduktion, keine Gasspeicherweiterung, geringere Flexibilität der Verstromung geg. Fall 1 und 2a<br />
Flüssigeinbringungstechniken seien hier vermutlich<br />
am geeignetsten, da sie bereits für eine weitgehende<br />
Einmischung und Verteilung der Substrate im Fermenter<br />
sorgen würden. „Und natürlich müssen die möglichen<br />
Mehrerlöse mit einem erfahrenen Stromvermarkter<br />
abgestimmt und den Kosten für die Flexibilisierung<br />
gegenübergestellt werden“, so der Wissenschaftler.<br />
Autorin<br />
Dipl.-Ing. · Dipl. Journ. Martina Bräsel<br />
Freie Journalistin<br />
Hohlgraben 27 · 71701 Schwieberdingen<br />
0 71 50/9 21 87 72<br />
braesel@mb-saj.de<br />
www.mb-saj.de<br />
61
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Konversion von Biomasse zu<br />
Wasserstoff und Methan<br />
Mittels eines zweistufigen Biogasprozesses können parallel und kontinuierlich wasserstoffhaltiges Gas (Biowasserstoff)<br />
und methanhaltiges Gas (Biogas) aus Biomasse erzeugt werden. Die angestrebte Verfahrenserweiterung<br />
bietet grundlegende Vorteile gegenüber der herkömmlichen einstufigen Variante. Der produzierte<br />
Biowasserstoff (~50 Volumenprozent) kann zum Beispiel als Betriebsmittel für Motor-BHKW und Brennstoffzellen<br />
dienen sowie zur Steigerung des elektrischen Wirkungsgrads beitragen.<br />
Von Robert Manig, Denise Münch, Jürgen Tenbrink, Jörg-Uwe Ackermann und Hartmut Krause<br />
Kern des Forschungsprojektes<br />
„Energetische und ökonomische<br />
Optimierung von<br />
Biogasanlagen durch die getrennte<br />
Erzeugung von Biowasserstoff<br />
und Biomethan (BioHy), FKZ.<br />
03KB123AB“, durchgeführt von DBI<br />
Gas- und Umwelttechnik GmbH und EnviTec<br />
Anlagenbau GmbH & Co.KG, ist die<br />
Erarbeitung geeigneter Betriebsparameter<br />
für das angestrebte zweistufige Verfahren.<br />
Aktuelle Experimente im Labormaßstab<br />
mit Maissilage der DBI haben gezeigt,<br />
dass das Verfahren „BioHy“ prozessstabil<br />
Biowasserstoff und Biogas produziert. Die<br />
weitere Verfahrensentwicklung zielt derzeit<br />
auf die Optimierung und Anpassung der<br />
ermittelten Betriebsparameter für den Einsatz<br />
weiterer Substrate wie Bioabfälle. Im<br />
Fokus steht dabei die Prozessstabilität der<br />
Wasserstoffstufe.<br />
Biogasanlagen tragen in einem erheblichen<br />
Maß zur Reduzierung der anthropogenen<br />
Kohlenstoffdioxidemissionen bei,<br />
indem die Anteile an regenerativen Energiequellen<br />
sowohl im Wärme- als auch im<br />
Strommarkt vergrößert werden. Die Kohlenstoffdioxidreduktion<br />
der in Deutschland<br />
etwa 9.000 installierten Biogasanlagen<br />
beträgt rund 20 Millionen Tonnen pro Jahr.<br />
Die Wirtschaftlichkeit einer Biogasanlage<br />
wird maßgeblich von der Methanausbeute<br />
aus den eingesetzten Substraten, dem<br />
stofflichen Wirkungsgrad und der Effizienz<br />
des nachfolgenden Blockheizkraftwerks<br />
(BHKW) bei der Stromproduktion – dem<br />
elektrischen Wirkungsgrad bestimmt.<br />
Abbildung 1: Prinzipielle Darstellung des zweistufigen Prozessregimes<br />
zur simultanen Produktion von Biowasserstoff und Biomethan<br />
Biomasse<br />
Hydrolyse<br />
einfache<br />
organische<br />
Verbindungen,<br />
Fettsäuren,<br />
Monomere<br />
H2 + CO2<br />
Acidogenese<br />
flüchtige<br />
Fettsäuren,<br />
Alkohole,<br />
H2, CO2<br />
Wasserstoffstufe<br />
Acetogenese<br />
Essigsäure,<br />
H2, CO2<br />
Essigsäure<br />
CH4 + CO2<br />
Methanogenese<br />
Methanstufe<br />
Gärrest<br />
Wasserstoffstufe vor Methanstufe<br />
Das Verfahren „BioHy“ setzt hier an. Mittels<br />
einer vorgeschalteten Fermentationsstufe,<br />
der Wasserstoffstufe, vor der eigentlichen<br />
Methanstufe im Hauptfermenter<br />
werden Biowasserstoff und Biogas parallel<br />
produziert. Durch die Einspeisung des Biowasserstoffs<br />
in das Verbrennungsgemisch<br />
des BHKW lassen sich die Verbrennungsgeschwindigkeit<br />
sowie die Verbrennungstemperatur<br />
steigern, wodurch der elektrische<br />
Wirkungsgrad gesteigert wird.<br />
Zusätzlich kann durch das saure Milieu in<br />
der Wasserstoffstufe – saure Hydrolyse –<br />
die Methanausbeute aus den eingesetzten<br />
Substraten verbessert werden. Die Steigerung<br />
des stofflichen Wirkungsgrads wirkt<br />
sich ebenfalls positiv auf den Gesamtwirkungsgrad<br />
der Biogasanlage aus. Biowasserstoff<br />
kann grundsätzlich durch eine<br />
gezielte Überlastung des Biogasprozesses<br />
erzeugt werden. In der Konsequenz liegt<br />
die größte Herausforderung eines solchen<br />
zweistufigen Verfahrens in der Prozessstabilität<br />
der Wasserstoffstufe, da diese im Gegensatz<br />
zur Methanstufe kein eigenstabiles<br />
Verhalten zeigt.<br />
Grundlagen<br />
Im Biogasprozess wird Biomasse über verschiedene<br />
Intermediate, wie Essigsäure<br />
und Wasserstoff, zu Methan und Kohlenstoffdioxid<br />
verstoffwechselt. Die eigentliche<br />
Methanbildung (Methanogenese) läuft dabei<br />
hauptsächlich auf zwei biochemischen<br />
Pfaden ab, der hydrogenotrophen (wasserstoffbasierten)<br />
und der acetoklastischen<br />
(essigsäurebasierten) Methanogenese.<br />
Das Grundprinzip des Verfahrens „Bio-<br />
Hy“ besteht in der Unterdrückung der hydrogenotrophen<br />
Methanogenese, um den<br />
biologisch erzeugten Wasserstoff einer<br />
Verwertung zugänglich zu machen. Verfahrenstechnisch<br />
wird ein zweistufiger Prozess,<br />
62
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Wissenschaft<br />
Abbildung 2: Fließbild des zweistufigen Fermentationsverfahrens im Labormaßstab<br />
Biowasserstoff<br />
(H 2<br />
, CO 2<br />
)<br />
Gasanalyse<br />
(Menge und Zusammensetzung)<br />
Biogas<br />
(CH 4<br />
, CO 2<br />
)<br />
Gärrest<br />
Substrat<br />
R. Manig, S. Hiller, R. Erler, H. Krause: Hydrogen as climate-friendly energy source produced<br />
by fermentative microorganisms, IGRC Rio 2017, Rio de Janeiro, 2017.<br />
Durch energie+agrar habe ich einfach<br />
“<br />
mehr Spaß mit meiner Biogasanlage. ”<br />
Abbildung 3: Versuchsaufbau der zweistufigen Laborbiogasanlage<br />
Oppmale Beratung<br />
und innovaave<br />
Produkte für Ihre<br />
Fermenter-Bakterien<br />
Höhere Substratausnutzung<br />
Bessere Rührfähigkeit<br />
bestehend aus der Wasserstoff- und der<br />
Methanstufe, genutzt (siehe Abbildung 1).<br />
In der Wasserstoffstufe wird die zugeführte<br />
Biomasse (Substrat) über verschiedene organische<br />
Zwischenverbindungen zu Essigsäure,<br />
Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid<br />
abgebaut. Der Biowasserstoff, bestehend<br />
aus Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid,<br />
wird abgeführt und steht für verschiedene<br />
Nutzungspfade zur Verfügung. Die entstehende<br />
energiereiche Essigsäure dient als<br />
Substrat für die Methanstufe und wird hier<br />
zu Methan und Kohlenstoffdioxid verstoffwechselt.<br />
Der verbleibende Gärrest wird<br />
unter Ausgleich der Massenbilanz aus der<br />
Methanstufe abgeführt.<br />
Mit Rezirkulat<br />
Essigsäureproduktion<br />
stabilisieren<br />
Hinsichtlich der Wasserstoffproduktion ergeben<br />
sich nun verschiedene prozesstechnische<br />
Konsequenzen. In der Wasserstoffstufe<br />
wird ein möglichst hoher Anteil an<br />
Essigsäuregärung durch hohe Raumbelastungen<br />
angestrebt. Daraus folgt ein Übersäuern<br />
des Fermenters mit entsprechender<br />
Prozessinstabilität. Mittels der Rezirkulierung<br />
von Fermenterflüssigkeit aus der<br />
Methan- in die Wasserstoffstufe kann zum<br />
einen der pH-Wert stabilisiert werden und<br />
zum anderen ist eine permanente Beimpfung<br />
der Wasserstoffstufe mit aktiver<br />
63<br />
Stabile biologische Prozesse<br />
Einsparung von Gärrestlager<br />
Senkung der Nährstoffmenge<br />
Repowering der Biologie<br />
Denn Ihre Biogas-Bakterien<br />
können mehr!<br />
energiePLUSagrar GmbH<br />
Tel.: +49 7365 41 700 70<br />
Web: www.energiePLUSagrar.de<br />
E-Mail: buero@energiePLUSagrar.de
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Abbildung 4: Wasserstoffbildungsrate und Wasserstoffanteil<br />
nach der Sondierungsphase<br />
Abbildung 5: Wasserstoffausbeute und -bildungsrate in Abhängigkeit<br />
von der Raumbelastung (Optimierungsphase)<br />
Wasserstoffanteil in Vol.-%<br />
42<br />
41<br />
40<br />
39<br />
38<br />
37<br />
36<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
Wasserstoffbildungsrate in ml/(l*d)<br />
Wasserstoffausbeute in ml/g<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
8 9 10 11 15<br />
Raumbelastung in g/(l*d)<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
Wasserstoffbildungsrate in ml/(l*d)<br />
35<br />
Start<br />
Ergebnis<br />
0<br />
Wasserstoffausbeute<br />
Wasserstoffbildungsrate<br />
Wasserstoffanteil<br />
Wasserstoffbildungsrate<br />
Abbildung 6: pH-Wertverlauf in den Prozessstufen in<br />
Abhängigkeit von der Raumbelastung, als Nachweis der<br />
Prozessstabilität<br />
pH-Wert<br />
7,5<br />
7,0<br />
6,5<br />
6,0<br />
Optimierung der Leistungsparameter des Verfahrens „BioHy“<br />
Start Optimierungsphase<br />
Wasserstoffausbeute 2 in ml/g 11,5 71,7<br />
Wasserstoffbildungsrate in ml/(l*d) 46,2 645,1<br />
Wasserstoffgehalt in Vol.-% 35,7 44,9<br />
Methanausbeute 3 in ml/g 170,6 225,5<br />
Methanbildungsrate 4 in ml/(l*d) 136,5 202,9<br />
Methangehalt in Vol.-% 54,7 59,0<br />
5,5<br />
5,0<br />
8 9 10 11 15<br />
Raumbelastung in g/(l*d)<br />
Wasserstoffstufe Methanstufe<br />
2<br />
Wasserstoffausbeute: gebildetes Wasserstoffnormvolumen bezogen auf die<br />
zugegebene Masse organischer Trockensubstanz.<br />
3<br />
Methanausbeute: gebildetes Methannormvolumen bezogen auf die zugegebene<br />
Masse organischer Trockensubstanz.<br />
4<br />
Methanbildungsrate: gebildetes Wasserstoffnormvolumen bezogen auf<br />
Fermentervolumen und Zeit<br />
Biogaskontor<br />
Köberle GmbH<br />
Wir können mit Druck umgehen<br />
Bullaugen für alle Einsatzfälle<br />
Für Kernbohrung Auf Stahlplatte nach In Tauchhülse für Über-/Unterdrucksicherung<br />
oder Futterhülse<br />
Kundenmaß<br />
Blick um die Ecke<br />
ÜU-TT<br />
Ø300 + Ø400 mm<br />
für Folienhauben<br />
Zubehör: Leuchten, Rosetten, Futterhülsen, Sonnenschutzhauben, etc.<br />
Weitere<br />
64<br />
Komponenten: Luftdosierstationen zur Entschwefelung, Füllstandsüberwachung, Messtechnik, Warnschilder<br />
Über-/Unterdrucksicherung<br />
ÜU-GD<br />
für Betondecken<br />
www.biogaskontor.de • info@biogaskontor.de • Germany 89611 Obermarchtal • Tel +49(0)737595038-0
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Wissenschaft<br />
Biologie sichergestellt. Nachteilig für die<br />
Wasserstoffproduktion ist die permanente<br />
Zufuhr von hydrogenotrophen Archaeen<br />
aus der Methan- in die Wasserstoffstufe.<br />
Deshalb werden biologische Stressfaktoren,<br />
wie pH- und Temperaturgradienten,<br />
zur Unterdrückung der Archaeenaktivität in<br />
der Wasserstoffstufe genutzt. Diese Überlegungen<br />
sind im Fließbild in Abbildung<br />
2 verfahrenstechnisch zusammengefasst.<br />
Der experimentelle Aufbau der zweistufigen<br />
Laborbiogasanlage ist in Abbildung 3 dargestellt.<br />
Als Inokulum wurde Klärschlamm<br />
genutzt. Maissilage diente als Substrat.<br />
Ergebnisse<br />
Zunächst lag der Fokus der Experimente<br />
auf der Einstellung eines stabilen Prozesses<br />
zur Produktion von Biowasserstoff.<br />
Daher wurden in der Sondierungsphase<br />
die Betriebsparameter auf Basis von Erfahrungswerten<br />
auf eine stabile Wasserstoffproduktion<br />
eingestellt. Die auf das<br />
Fermentervolumen bezogene Wasserstoffbildungsrate<br />
konnte deutlich von anfänglich<br />
~46 auf ~533 Milliliter pro Liter Gärvolumen<br />
und Tag (ml/(l*d) erhöht werden<br />
(siehe Abbildung 4). Der Wasserstoffanteil<br />
im Gas konnte auf einen Wert von 41,4 Volumenprozent<br />
gesteigert werden.<br />
In der nachgelagerten Optimierungsphase<br />
wurde die Raumbelastung systematisch variiert.<br />
Dabei zeigte sich ein Maximum von<br />
Wasserstoffbildungsrate und -ausbeute bei<br />
einer Raumbelastung von 9 Gramm pro Liter<br />
und Tag (g/(l*d) (siehe Abbildung 5). Im<br />
Vergleich zur Sondierungsphase (siehe Abbildung<br />
4) konnte die Wasserstoffbildungsrate<br />
von ~530 auf ~645 ml/(l*d) gesteigert<br />
werden.<br />
In der Tabelle sind die aktuell ermittelten<br />
Ausbeuten, Bildungsraten und Gasqualitäten<br />
des Verfahrens „BioHy“ zusammengestellt.<br />
Grundsätzlich ist festzustellen, dass<br />
alle Leistungsparameter im Vergleich zu<br />
den Startwerten während der Verfahrensentwicklung<br />
gesteigert werden konnten. Zur<br />
Beurteilung der Prozessstabilität kann der<br />
pH-Wert beider Fermentationsstufen herangezogen<br />
werden (siehe Abbildung 6). In beiden<br />
Fermentern sank der pH-Wert während<br />
der Optimierungsphase trotz zunehmender<br />
Raumbelastung nur minimal. Dies deckt<br />
sich mit der durchgängigen biologischen<br />
Aktivität des Systems über 140 Prozesstage.<br />
Die Prozessstabilität ist mit dem erarbeiteten<br />
Prozessregime und dem gefundenen<br />
Parameterset prinzipiell gewährleistet.<br />
Fazit: Für das zweistufige Verfahren „ Bio-<br />
Hy“ und das Substrat Maissilage konnte<br />
ein funktionierendes Betriebsparameterset<br />
ermittelt und im ersten Schritt optimiert<br />
werden. Dabei produziert der biologische<br />
Prozess kontinuierlich Wasserstoff und<br />
Methan bei einem stabilen und robusten<br />
Verhalten. Eine aktive pH-Regulierung über<br />
Zugabe von Säuren, Laugen oder Puffern ist<br />
nicht nötig. Die Bildungsraten (Produktivität)<br />
in der Wasserstoffstufe liegen deutlich<br />
über denen der Methanstufe. Im nächsten<br />
Schritt wird eine weitere Optimierung der<br />
Betriebsparameter vorangetrieben mit dem<br />
Ziel, Bildungsraten und Ausbeuten weiter<br />
zu steigern. Aus ökologischer und ökonomischer<br />
Sicht ist eine Nutzung biologischer<br />
Rest- und Abfallstoffe sinnvoll.<br />
Danksagung: Das diesem Bericht zugrunde<br />
liegende Vorhaben wurde mit Mitteln<br />
des Bundesministeriums für Wirtschaft<br />
und Energie unter dem Förderkennzeichen<br />
03KB123AB gefördert.<br />
Hinweis: Der hier abgedruckte Artikel enthält<br />
aus Platzgründen nicht alle Quellenangaben.<br />
Diese können auf Wunsch bei den<br />
Autoren angefordert werden.<br />
Autoren<br />
Robert Manig und<br />
Denise Münch<br />
DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH<br />
Karl-Heine-Str. 109/111<br />
04229 Leipzig<br />
Jürgen Tenbrink<br />
EnviTec Anlagenbau GmbH & Co.KG<br />
Boschstr. 2<br />
48369 Saerbeck<br />
Jörg-Uwe Ackermann<br />
Hochschule für Technik und Wirtschaft<br />
Bereich Chemieingenieurwesen<br />
Friedrich-List-Platz 1<br />
01069 Dresden<br />
Hartmut Krause<br />
TU Bergakademie Freiberg<br />
Institut für Wärmetechnik und Thermodynamik<br />
Gustav-Zeuner-Str. 7<br />
09599 Freiberg<br />
DENSO GE2-3<br />
Art.No. 30009919<br />
& viele weitere Ersatzteile<br />
für Ihren MAN-Gasmotor<br />
JETZT VORRÄTIG »<br />
+++ LÄNGERE STANDZEIT +++ NEU +++ OPTIMIERT +++ DENSO GE2-3 +++ MAN +++ DENSO +++<br />
65
Dr. Catalina Rodriguez<br />
Wissenschaft<br />
Correa und Studentin<br />
Svenja Kloße halten die<br />
Versuchsergebnisse<br />
fest. Entstanden sind<br />
Gärrest-Kohlen mit<br />
spezifischen Oberflächen<br />
von bis zu 3.000 m 2 /g.<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Bio-Supercaps aus Gärresten<br />
Fotos: Martina Bräsel<br />
Superkondensatoren gelten unter Branchenexperten als Schlüssel für Akkus der nächsten<br />
Generation. Forscherinnen der Uni Hohenheim entwickeln einen solchen Energiespeicher<br />
aus Gärresten.<br />
Von Dipl.-Ing. · Dipl. Journ. Martina Bräsel<br />
An der Universität Hohenheim wird kräftig<br />
daran geforscht, Kohlenstoffmaterialien<br />
aus verschiedenen Agrarreststoffen in<br />
wertvollere Produkte zu verwandeln. „Eines<br />
unserer wichtigen Forschungsgebiete<br />
ist die Entwicklung leitfähiger Kohlenstoffmaterialien<br />
aus Biomasse“, erklärt Prof. Dr. Andrea Kruse, Fachgebietsleiterin<br />
der Abteilung Konversionstechnologien<br />
nachwachsender Rohstoffe. „Für Kohlenstoff-Leiter<br />
wird bislang Aktivkohle verwendet, wir möchten das<br />
endliche fossile Material durch ein nachhaltiges Produkt<br />
ersetzen“, so die Wissenschaftlerin.<br />
Aktuell hat das Forschungsteam um Andrea Kruse einen<br />
besonders leistungsfähigen Energiespeicher aus<br />
Gärresten entwickelt, denn die Reststoffe aus Biogasanlagen<br />
sind reich an Kohlen- und Stickstoff, aber auch<br />
an Lignin. Damit bauen die Forscherinnen graphitähnliche<br />
Kohlenstoffe auf, aus denen Superkondensatoren<br />
zum großen Teil bestehen. Die sogenannten Supercaps<br />
füllen die Nische zwischen konventionellen Kondensatoren,<br />
Batterien und Akkus aus. Diese Superkondensatoren<br />
könnten künftig zum Beispiel in Elektroautos eine<br />
wichtige Rolle spielen.<br />
Für die Zukunft der Mobilität<br />
„Die Zukunft gehört der Elektromobilität“, fügt Viola<br />
Hoffmann hinzu. Dies sei nicht nur politisch gewollt,<br />
sondern mit Blick auf den Klimawandel und die knapper<br />
werdenden fossilen Ressourcen auch ökologisch sinnvoll.<br />
Die Doktorandin gehört zum Forschungsteam, dem<br />
es gelungen ist, die biologischen Supercaps herzustellen.<br />
„Laut Bundesregierung sollen bis zum Jahr 2020<br />
eine Million Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen<br />
unterwegs sein“, führt Hoffmann aus. Bis 2030 sollen<br />
es sogar sechsmal so viele Fahrzeuge werden.<br />
Im Statusbericht des VDI „Zukunft des Autos“ stehe<br />
dazu: „Der Erfolg des Elektroantriebs steht und fällt mit<br />
der Frage der Energiespeicherung“. Viola Hoffmann erklärt<br />
warum: „Geeignete Energiespeicher müssen nicht<br />
nur langlebig und leistungsstark sein, sondern vor allem<br />
auch hohe Kapazitäten besitzen, um möglichst<br />
viel Energie speichern und in kürzester Zeit liefern zu<br />
können“.<br />
Den wieder aufladbaren Batterien und Akkus, die es<br />
aktuell auf dem Markt gebe, mangele es vor allem an<br />
den ersten beiden Punkten: „Ihre Lebensdauer ist aufgrund<br />
chemischer Zersetzungsprozesse während der<br />
Lade- und Entladevorgänge auf wenige tausend Zyklen<br />
begrenzt“, erläutert Hoffmann. Zudem erfolge die Aufnahme<br />
und Abgabe von Energie relativ langsam. Superkondensatoren<br />
hätten diese Probleme nicht, deshalb<br />
seien sie eine vielversprechende Ergänzung.<br />
Supercaps für kurzzeitiges Speichern<br />
„Supercaps sind elektrochemische Kondensatoren“,<br />
verdeutlicht Dr. Catalina Rodriguez Correa, die eben-<br />
66
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Wissenschaft<br />
Anlagenbau<br />
Kohlenstoff ist sehr wandlungsfähig<br />
und lässt sich<br />
in unzählige Variationen<br />
bringen. Deshalb können<br />
die Forscherinnen die<br />
Carbon-Leiter nach den<br />
jeweiligen speziellen Anforderungen<br />
des Kunden<br />
aufbauen. In Kleinautoklaven<br />
mit Volumen<br />
von 10 Milliliter werden<br />
die Reaktionsparameter<br />
getestet.<br />
Sie möchten nicht länger Energie<br />
und Zeit verschwenden...<br />
Höchste Zeit für<br />
etwas Neues: Huning<br />
Feststoffdosierer<br />
falls zum Forschungsteam gehört. Das<br />
Elektrodenmaterial werde chemisch kaum<br />
angegriffen, deshalb hänge der Speichermechanismus<br />
nicht von irreversiblen chemischen<br />
Reaktionen oder Zersetzungsprozessen<br />
ab. „Die Auf- und Entladung findet<br />
innerhalb kürzester Zeit statt“, so die Forscherin.<br />
Weitere Vorteile seien hohe spezifische<br />
Leistungsdichten von über 1 Kilowatt pro<br />
Kilogramm und ihre Lebensdauer liege bei<br />
über 300.000 Zyklen. „Diese Eigenschaften<br />
machen sie interessant für Anwendungen,<br />
in denen Leistungsspitzen abgefangen<br />
oder große Energiemengen in (Milli-)<br />
Sekundenschnelle abrufbar sein müssen“,<br />
erklärt die Forscherin. Die Energiemenge,<br />
die ein Superkondensator in Form von Ladung<br />
speichern könne, hänge dabei von<br />
der Anzahl der Ionen ab, die sich an der<br />
Elek trode anlagern können.<br />
Das bedeutet: „Je größer die Elektrodenoberfläche,<br />
desto leistungsstärker ist<br />
der Kondensator“, sagt sie lachend. Da<br />
hochporöse Kohlenstoffmaterialien (Aktivkohlen)<br />
viele Vorteile haben, werden sie<br />
bislang eingesetzt. So beträgt ihre innere<br />
Oberfläche zwischen 300 und 3.000 Quadratmeter<br />
pro Gramm Kohle. Sie haben<br />
sich aber auch wegen ihrer vielfältigen<br />
Nanostrukturen (zum Beispiel Graphen,<br />
Nanoröhren) als geeignete Materialien für<br />
die Elektrodenproduktion bewährt. „Wir<br />
gehen davon aus, dass fossiler Kohlenstoff<br />
in Zukunft knapp und teuer wird“, fügt<br />
Fachgebietsleiterin Andrea Kruse hinzu,<br />
deshalb sei es sinnvoll, alternative Kohlenstoffquellen<br />
zu finden. Aus ihrer Sicht ist<br />
die Entwicklung biobasierter Kohlenstoffmaterialien<br />
mit hohen Kapazitätswerten<br />
„unverzichtbar“. Zudem habe sich gezeigt,<br />
dass sich mit „biobasierten Elektroden unter<br />
bestimmten Bedingungen sogar höhere<br />
Kapazitätswerte erzielen lassen als mit<br />
konventionellen Materialien“.<br />
Mit HTC zur Biokohle<br />
Bislang stammen die Ausgangsmaterialien<br />
für die Produktion der Bauteile noch aus<br />
fossilen Quellen. Eine Verschwendung,<br />
wenn man bedenkt, dass in Baden-Württemberg<br />
jährlich etwa 1,5 Millionen Tonnen<br />
(2015) Biomasse anfallen. Damit der<br />
Gärrest zur Biokohle werden kann, muss er<br />
allerdings verkohlt werden. An der Universität<br />
Hohenheim wird für die Herstellung<br />
hochporöser Kohlenstoffe die Hydrothermale<br />
Karbonisierung (kurz HTC, englisch:<br />
hydrothermal carbonization) verwendet.<br />
„Wir verkohlen nasse Biomasse unter Druck<br />
bei Temperaturen zwischen 180 und 250<br />
Grad Celsius“, so Dr. Catalina Rodriguez<br />
Correa. Dabei werden die Einzelbestandteile<br />
der Biomasse (Lignin, Cellulose und<br />
Hemicellulose) durch verschiedene chemische<br />
Prozesse in Kohlenstoffnanostrukturen<br />
umgebaut, deren Eigenschaften denen<br />
von Braunkohle ähneln. Durch einen<br />
67<br />
Ein UnTERnEHMEn<br />
DER HUninG GRUPPE<br />
HUNING Anlagenbau GmbH & Co. KG<br />
Wellingholzhausener Str. 6, D-49324 Melle<br />
Tel. +49 (0) 54 22/6 08-2 60<br />
Fax +49 (0) 54 22/6 08-2 63<br />
info@huning-anlagenbau.de<br />
www.huning-anlagenbau.de
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Fachgebietsleiterin<br />
Prof. Dr. Andrea Kruse<br />
(rechts) gemeinsam<br />
mit Dr. Catalina<br />
Rodriguez Correa vor<br />
dem HTC-Reaktor der<br />
Universität Hohenheim.<br />
In dieser HTC-Laboranlage<br />
wird der Gärrest zur Biokohle<br />
verkohlt. Die Ergebnisse<br />
der kleinen Versuchsanlage<br />
können 1:1 auf die Großanlage<br />
des Kooperationspartners<br />
HTCycle übertragen<br />
werden.<br />
zusätzlichen Schritt, Aktivierung<br />
genannt, wird das<br />
Porenvolumen innerhalb der<br />
Gärrest-Kohlen deutlich vergrößert.<br />
Je nach Ausgangsmaterial,<br />
Temperatur und Dauer der<br />
Karbonisierung und gewähltem<br />
Aktivierungsverfahren<br />
können Aktivkohlen mit<br />
unterschiedlichen Porenvolumen,<br />
Porengrößenverteilungen<br />
oder Oberflächen<br />
hergestellt werden. An der<br />
Universität Hohenheim werden die Gärrest-Kohlen<br />
zur Aktivierung zunächst ausgepresst und getrocknet.<br />
Anschließend werden die Kohlen mit Lauge gemischt<br />
und erneut erhitzt, diesmal aber auf 600 Grad. Es entstehen<br />
Gärrest-Kohlen mit spezifischen Oberflächen<br />
von bis zu 3.000 Quadratmeter pro Gramm. Im letzten<br />
Schritt werden die hergestellten Aktivkohlen auf ihre<br />
Tauglichkeit als Elektrodenmaterialien mit weitreichenden<br />
Messungen geprüft.<br />
Einsatzmöglichkeiten von Supercaps<br />
Superkondensatoren sind nicht nur bei den Erneuerbaren<br />
Energien im Bereich Photovoltaik und Windenergie<br />
zu finden, sondern auch im Mobilitätssektor. „Sie<br />
werden in regenerativen Bremssystemen und Hybridfahrzeugen<br />
– vor allem auch im öffentlichen Nahverkehr<br />
– eingesetzt“, so Rodriguez Correa. Zwar sei ihre<br />
Energiedichte geringer als die von Batterien, ihre Leistungsdichte<br />
aber sehr viel höher.<br />
Die Forscherin erklärt das so: „Weil Supercaps mittels<br />
elektrostatischer Prozesse funktionieren, ist eine höhere<br />
Anzahl an Zyklen möglich, zudem lassen sie sich<br />
viel schneller laden und entladen als Akkus“. Wegen<br />
ihrer niedrigen Energiedichte (sie liegt bei etwa 5<br />
Prozent der Energiedichte im Vergleich zu Lithium-<br />
Ionen-Akkus) würden sie aber nur für Pufferfunktionen<br />
eingesetzt. Sie seien ideal, um einem Fahrzeug einen<br />
Schub zu geben und als Ergänzung zu einer Lithium-<br />
Ionen-Batterie.<br />
„Züge nutzen diese Kondensatoren zur Beschleunigung<br />
beim Anfahren“, weiß die Fachfrau. Im E-Auto<br />
hingegen werden die Speicher bislang selten verwendet.<br />
Würde ein Elektroauto allein mit einem Superkondensator<br />
an Bord betrieben, könnte es zwar innerhalb<br />
kurzer Zeit aufgeladen werden, käme aber nur wenige<br />
Kilometer weit.<br />
Blick in die Zukunft<br />
„Unsere Gärrest-Kohle ist besser als fossile Graphite“,<br />
sagt Kruse. „Kohlenstoff ist sehr wandlungsfähig“ und<br />
ließe sich in unzählige Variationen bringen. Deshalb<br />
können die Forscherinnen die Carbon-Leiter nach den<br />
jeweiligen speziellen Anforderungen des Kunden aufbauen.<br />
Neben dieser Fähigkeit ist der größte Vorteil der<br />
Gärrest-Biokohle aber ihre nachhaltige Gewinnung.<br />
Zudem könnten angesichts der günstigen und frei verfügbaren<br />
Biomasse und des vergleichsweise energiearmen<br />
HTC-Verfahrens auch die Herstellungskosten im<br />
Rahmen bleiben.<br />
Sollte es den Hohenheimer Forscherinnen gelingen, ein<br />
konkurrenzfähiges Material zu entwickeln, müsste es<br />
entweder günstiger sein als konventionelle Materialien<br />
oder aber bessere Kapazitätswerte aufweisen. Prof. Dr.<br />
Andrea Kruse ist sich sicher, dass biogen hergestellte<br />
Materialien trotz höherer Produktionskosten den Markt<br />
erobern werden: „Unser Ziel muss sein, ein besseres<br />
Produkt herzustellen“, so die Forscherin. In frühestens<br />
acht Jahren seien die neuen Bio-Caps serienreif. Noch<br />
sei die Nachfrage gering, doch die Fachleiterin ist zuversichtlich:<br />
„Die Autohersteller suchen bereits nach<br />
Lösungen“, weiß die Fachfrau. Es könnte also gut sein,<br />
dass in Zukunft biobasierte Elektrodenmaterialien aus<br />
Gärresten ihre fossilen Vorgänger ablösen.<br />
Autorin<br />
Dipl.-Ing. · Dipl. Journ. Martina Bräsel<br />
Freie Journalistin<br />
Hohlgraben 27 · 71701 Schwieberdingen<br />
0 71 50/9 21 87 72<br />
braesel@mb-saj.de<br />
www.mb-saj.de<br />
68
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Wir lassen nichts<br />
an ihren Beton!<br />
www.besatec.eu<br />
I Biogasbehälter<br />
I Fahrsilos<br />
I Güllebecken<br />
I Sanieren<br />
I Beschichten<br />
I WHD-Strahlen<br />
neues System<br />
Fahrsilosanierung<br />
Wissenschaft<br />
noch nie<br />
hat das<br />
kleine<br />
schwarze<br />
so sehr<br />
überzeugt.<br />
Besatec Holsten GmbH Fischerweg 2a · 38162 Cremlingen · 05306 99 050 10 · info@besatec.eu<br />
Doppelmembrangasspeicher | Emissionsschutzabdeckungen<br />
Gasspeicher | EPDM-Hauben<br />
Leckagefolien<br />
Heimann Aktivkohle bietet Ihnen<br />
deutschlandweit von der Lieferung<br />
über den Austausch bis zur<br />
Entsorgung Ihrer Aktivkohle alle<br />
Services.<br />
Baur Folien GmbH<br />
Gewerbestraße 6<br />
D-87787 Wolfertschwenden<br />
0 83 34 99 99 1-0<br />
0 83 34 99 99 1-99<br />
info@baur-folien.de<br />
d www.baur-folien.de<br />
AGROTEL GmbH • 94152 NEUHAUS/INN • Hartham 9<br />
Tel.: + 49 (0) 8503 / 914 99- 0 • Fax: -33 • info@agrotel.eu<br />
69<br />
06473 411596<br />
info@aks-heimann.de<br />
www.aks-heimann.de
International<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
LNG-Tanker am<br />
LNG-Terminal.<br />
Foto: qatargas.com<br />
LNG: Ein globales Pokerspiel um<br />
Zukunftspositionen ist im Gange<br />
Die deutsche Energiepolitik setzt scheinbar auf Risiko, denn sie hat sich große Herausforderungen<br />
geschaffen. Durch den Ausstieg aus der Kernkraft bis 2022 und den Ausstieg<br />
aus der Kohleverstromung bis 2038 sind hier noch größere Ausgleichsanstrengungen als in<br />
anderen Ländern erforderlich.<br />
Von Eur. Ing. Marie-Luise Schaller<br />
Zum Erhalt der Versorgungssicherheit in<br />
Deutschland wird verstärkt auf Gas zu<br />
setzen sein – und nicht nur hier. Globale<br />
Machtspiele um die Vorherrschaft auf künftigen<br />
Energiemärkten haben bereits begonnen.<br />
Staatliche Interventionen und Investitionen<br />
rund um die Energiequelle Flüssigerdgas sind erste<br />
Signale, die es im Hinblick auf die Zukunft richtig zu<br />
deuten gilt.<br />
Ende Januar hat die Kohlekommission einen Konsens<br />
darüber erzielt, bis spätestens 2038 aus der Kohleverstromung<br />
auszusteigen. Bereits 2022 werden auch<br />
die letzten Kernkraftwerke außer Betrieb sein. Selbst<br />
wenn der Anteil der Erneuerbaren Energien im Stromsektor<br />
besonders hoch ist, können Industrieländer wie<br />
Deutschland den Bedarf vorerst nicht aus diesen fluktuierenden<br />
Quellen decken. Bis dies möglich ist, gilt<br />
Gas als wichtiger Energieträger, der die Nachfrage in<br />
industrieller Größenordnung befriedigen kann.<br />
So sagt das Unternehmen DNV GL in einer Studie zur<br />
globalen Energiewirtschaft voraus, dass Gas als letzter<br />
fossiler Primärenergieträger bis 2050 eingesetzt<br />
und 2035 die Spitze des weltweiten Bedarfs auftreten<br />
werde. Als Garant einer sicheren Versorgung wird es<br />
als unverzichtbarer Wegbegleiter für den steigenden<br />
Anteil Erneuerbarer Energien gesehen.<br />
70
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
UltraPract® InternationalP2<br />
Biogas Enzym 2.0<br />
mit AC Faktor<br />
Der CO 2<br />
-Fußabdruck werde derweil kontinuierlich<br />
verbessert: Zunächst sinken<br />
die Emissionen dadurch, dass Gas als<br />
Ersatz für Kohle in der Stromerzeugung<br />
oder für andere umweltbelastende Energieträger<br />
im Transport eingesetzt wird.<br />
Weitere Potenziale entstehen bei der Senkung<br />
der Methanemissionen entlang der<br />
gesamten Wertschöpfungskette und der<br />
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von<br />
großmaßstäblichen „carbon capture and<br />
storage (CCS)“-Verfahren (Verfahren zu<br />
CO 2<br />
-Verwertung und -speicherung). Allerdings<br />
ergibt diese DNV GL-Modellierung<br />
einen weltweiten Temperaturanstieg um<br />
2,5 Grad Celsius, während die maximale<br />
Erderwärmung gemäß dem Pariser Klimaschutzabkommen<br />
vom Jahr 2015 nicht<br />
über 2 Grad Celsius ansteigen darf.<br />
LNG auf Expansionskurs<br />
Doch angesichts des künftigen Bedarfanstiegs<br />
kommen die Vorteile von LNG (Liquefied<br />
Natural Gas, also Flüssigerdgas)<br />
zum Tragen: Gekühlt auf -160 Grad Celsius,<br />
verringert sich sein Volumen um den<br />
Faktor 600, ideal für die Lagerung und den<br />
Transport über weite Strecken. In Terminals,<br />
die möglichst in Nähe der Gasförderstätte<br />
liegen, wird das Erdgas verflüssigt<br />
und in Spezialtankschiffe geleitet, die es<br />
zu den Bestimmungshäfen transportieren.<br />
Dort wird es in Importterminals wieder in<br />
den gasförmigen Zustand versetzt und<br />
kann ins Gasnetz eingespeist oder mit<br />
Tankwagen abtransportiert werden.<br />
LNG wird meist da erzeugt, wo große Gasvorräte<br />
anstehen. Zu den Ländern, die LNG<br />
produzieren, gehören Nigeria, Algerien und<br />
Ägypten in Afrika, Oman und Katar im Nahen<br />
Osten, Indonesien und Malaysia in Asien,<br />
Australien sowie Trinidad, Kanada und<br />
die USA in Amerika. Neue Fördergebiete<br />
werden unter anderem offshore in Mosambik<br />
und Marokko erschlossen. Katar ist<br />
bislang weltweit der größte LNG-Produzent<br />
und betreibt 14 LNG-Anlagen mit einer<br />
Gesamtproduktionskapazität von 77 Millionen<br />
Tonnen pro Jahr (Mio. t/a).<br />
In Russland wird auf der Yamal-Halbinsel<br />
im arktischen Norden eine Anlage mit einer<br />
Kapazität von aktuell 11 Mio. t/a betrieben.<br />
Sie soll in diesem Jahr noch einen<br />
dritten Produktionszug erhalten und damit<br />
auf 17 Mio. t/a erweitert werden. Aufgrund<br />
der Lage können sowohl europäische als<br />
auch asiatische Märkte bedient werden.<br />
Asien ist auch der größte Abnehmer. Die<br />
einzige europäische Exportanlage befindet<br />
sich an der Nordspitze Norwegens bei<br />
Hammerfest.<br />
Die Importkapazitäten Europas belaufen<br />
sich auf etwa 20 Prozent der weltweiten<br />
Kapazitäten und lagen 2018 bei 227,8<br />
Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Deutschland<br />
besitzt derzeit noch kein eigenes<br />
Import-Terminal. Seit längerem wird die<br />
Errichtung einer Anlage am Standort<br />
Brunsbüttel diskutiert. Diese wird kapazitätsmäßig<br />
bereits im Netzentwicklungsplan<br />
berücksichtigt. Ein Konsortium<br />
bestehend aus Gasunie, Oiltanking und<br />
Vopak entwickelt das Projekt in Schleswig-<br />
Holstein. Daneben gibt es Ansätze für ein<br />
Terminal in Wilhelmshaven oder in Stade,<br />
beide in Niedersachsen gelegen. Interesse<br />
an einer Beteiligung sollen auch Investoren<br />
aus Katar geäußert haben, sofern die<br />
Sache rentabel sei.<br />
Befürworter wie die Bundeskanzlerin<br />
versprechen sich von einem deutschen<br />
Terminal eine größere Diversität der Energiequellen<br />
und damit eine größere Unabhängigkeit,<br />
zum Beispiel von Pipelinebelieferungen<br />
aus Russland. Hierbei ist<br />
auch zu bedenken, dass die deutsche und<br />
niederländische Förderung von L-Gas bald<br />
eingestellt werden und durch H-Gas ersetzt<br />
werden müssen.<br />
Im Land der unbegrenzten<br />
Möglichkeiten<br />
Auf Gas setzt man auch in den USA, wo<br />
es seit etwa Mitte der Neunzigerjahre zu<br />
einem Erdgasüberangebot kam. Mit unkonventionellen<br />
Fördermethoden, dem sogenannten<br />
Fracking, konnte nun auf bisher<br />
förderunwürdigen Lagerstätten produziert<br />
werden. Diese Mengen überschwemmten<br />
den US-Markt und senkten die Preise,<br />
wodurch wiederum die Ausfuhr angeregt<br />
wurde.<br />
Waren die Vereinigten Staaten bis 2016<br />
bilanziell noch Importeur, so überwiegen<br />
mittlerweile die Exporte. Seit 2013<br />
pusht die US-Regierung die Ausfuhr von<br />
Flüssig erdgas nach Japan und Europa<br />
und unterstützt dies insbesondere durch<br />
vereinfachte Genehmigungsverfahren. Die<br />
USA streben an, Ende <strong>2019</strong> der drittgröß-<br />
Hochwirksam, mit<br />
patentiertem Enzymprofil<br />
Mist statt<br />
Mais!<br />
Steigern Sie die<br />
Wirtschaftlichkeit<br />
Ihrer Biogasanlage.<br />
» Höhere Substratverwertung<br />
» Höherer Wirtschaftsdüngeranteil<br />
» Höhere Abbaugeschwindigkeit<br />
» Mehr Ertrag, weniger Gärrest<br />
fotolia.com © chrisberic<br />
71<br />
+49 (0)30 6670 - 2056 » www.biopract-abt.de
International<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
te Exporteur von LNG hinter Australien und<br />
Katar zu werden. Daher wird derzeit auch<br />
vor allem der Bestand an Exportterminals<br />
ausgebaut, die zu einem überwiegenden<br />
Teil im Golf von Mexiko liegen. 10 Exportterminals<br />
sind genehmigt, davon werden<br />
5 derzeit errichtet. 2 der 12 bestehenden<br />
Importanlagen werden um Verflüssigungsanlagen<br />
für die Ausfuhr ergänzt. Demgegenüber<br />
wird derzeit lediglich eine der drei<br />
72
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
International<br />
Mischen – Fördern –<br />
Zerkleinern<br />
Ihr Partner für die Energie<br />
der Zukunft<br />
Als Weltmarktführer von Exzenterschneckenpumpen<br />
und Spezialist in der<br />
Biogastechnologie bieten wir für die<br />
Biogasproduktion angepasste Misch- und<br />
Fördersysteme. Die Einsatzmöglichkeiten<br />
unserer NEMO® Exzenterschneckenpumpen,<br />
TORNADO® Drehkolbenpumpen<br />
sowie NETZSCH Zerkleinerungssysteme<br />
reichen vom Mischen über Fördern bis hin<br />
zum Zerkleinern.<br />
NEMO® B.Max®<br />
Mischpumpe<br />
Quelle: GIIGNL (2018), GLE (2017), Gas in Focus<br />
genehmigten Importanlagen gebaut. Beim<br />
Hydraulic Fracturing oder kurz Fracking<br />
werden Horizontalbohrungen in die zu explorierende<br />
Schicht eingebracht, durch die<br />
mit hohem Druck eine Flüssigkeit in die Lagerstätte<br />
gepresst wird. Damit sollen Risse<br />
erzeugt und aufgeweitet werden, um das<br />
Erdgas leichter fördern zu können. Diese<br />
Methode ist aufgrund der Umweltgefährdung<br />
sehr umstritten und in vielen Ländern<br />
73<br />
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH<br />
Geschäftsfeld Umwelt & Energie<br />
Tel.: +49 8638 63-1010<br />
info.nps@netzsch.com<br />
www.netzsch.com
International<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Übersicht über die Haupthandelsbewegungen von LNG im Jahre 2017 (Mengenangaben in Mrd. m³)<br />
BIOGASANALYSE<br />
GASANALYSENTECHNIK<br />
BIOGASANALYSENTECHNIK<br />
WASSERANALYSENTECHNIK<br />
AGRARMESSTECHNIK<br />
PRONOVA Analysentechnik GmbH&Co.KG<br />
Groninger Straße 25 I 13347 Berlin<br />
Tel +49 (0)30 455085-0 – Fax -90<br />
info@pronova.de I www.pronova.de<br />
FOS/TAC 2000<br />
automatischer Titrator zur Bestimmung<br />
von FOS, TAC und FOS/TAC<br />
SSM 6000 ECO<br />
SSM 6000<br />
der Klassiker für die Analyse<br />
von CH 4<br />
, H 2<br />
S, CO 2<br />
, H 2<br />
und O 2<br />
mit<br />
und ohne Gasaufbereitung<br />
mit proCAL für SSM 6000,<br />
die vollautomatische,<br />
prüfgaslose Kalibrierung<br />
74<br />
www.pronova.de
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
International<br />
Europas nicht zulässig. Zudem wird außerhalb<br />
der Staaten die Gefahr gesehen, dass<br />
der Fracking-Boom von der US-Regierung<br />
gefördert wird, um die amerikanische<br />
Souveränität auf dem Energiesektor zu<br />
erhalten und andere Nationen vom amerikanischen<br />
Fracking-Öl und -Gas abhängig<br />
zu machen. Damit würden CO 2<br />
-Emissionen<br />
weiter eskalieren und eine Klimakatastrophe<br />
immer drohender. Derartige Beunruhigungen<br />
erhielten im vergangenen<br />
Sommer angesichts eines Deals zwischen<br />
dem US-Präsidenten Donald Trump und<br />
dem EU-Kommissions-Präsidenten Jean-<br />
Claude Juncker weitere Nahrung. Es ging<br />
darum, den Handelsstreit zwischen den<br />
USA und der EU vorläufig beizulegen. Dabei<br />
erhielt Trump von Juncker die Zusage,<br />
in die EU mehr LNG zu importieren und<br />
Importterminals zu bauen. Die Begründung<br />
war, die Energieversorgung der EU<br />
diversifizieren zu wollen.<br />
Europäische Interessen<br />
Die Notwendigkeit eines deutschen Terminals<br />
wird nicht von allen gesehen, da<br />
manche zunächst innereuropäische Lösungen<br />
suchen. Aktuell liefern Norwegen<br />
und Russland noch ohne Probleme. Der<br />
Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 kommt<br />
voran, ein Projekt, das der amerikanische<br />
Präsident heftig attackiert. Der Bedarf an<br />
LNG soll derzeit zudem noch nicht sehr<br />
ausgeprägt sein. Allerdings wird das nicht<br />
ENERGIE-<br />
TECHNIK<br />
BHKW<br />
NEA<br />
USV<br />
SERVICE<br />
IHR PARTNER VON DER PLANUNG BIS ZUM RUND-UM-SERVICE<br />
KREFELD • WESSELING • MELLE • WUNSTORF • MÖSSINGEN<br />
75<br />
www.henkelhausen.de
International<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Neuer Typ eines<br />
LNG-Tankers.<br />
Foto: qatargas<br />
Stange BGJ 4_2018.pdf 1 08.06.18 12:01<br />
so bleiben. Es gibt wachsende Potenziale für den Absatz<br />
im Transportsektor, wo LNG den Diesel und das<br />
noch umweltschädlichere Schweröl in der Schifffahrt<br />
ablösen kann. Denn bei Umstellung auf (Flüssig-)Gas<br />
verbessern sich die Emissionen an CO 2<br />
, Stickoxiden,<br />
Schwefelverbindungen und Feinstaub, so dass die Notwendigkeit<br />
zusätzlicher Filter entfällt.<br />
Einerseits wird das durch staatliche Fördermaßnahmen<br />
begünstigt: In Deutschland sind LNG- und<br />
CNG-betriebene Lkw von der Maut befreit, was eine<br />
seit<br />
1946<br />
Schallschutz & Lufttechnik für Ihre BHKW-Anlage<br />
Schallschutz und Lufttechnik für Biogas-Anlagen<br />
Schalldämpfer · Schallschutzwände · Maschinen-Kapselungen · Lüftungsbauteile<br />
76<br />
seit<br />
1946<br />
Tel. 02171 7098-0 · Fax 02171 7098-30 · info@stange-laermschutz.de · www.stange-laermschutz.de
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
International<br />
Kostenreduzierung von bis zu 18,7 Cent pro Kilometer<br />
bewirken kann. Andererseits sorgen verschärfte<br />
Umweltvorschriften dafür, dass der Bedarf an LNG im<br />
Schiffverkehr künftig ansteigen wird. Dies trägt auch<br />
zur Lösung der Luftreinhalteprobleme der Städte bei,<br />
die an Binnenwasserstraßen liegen. Dafür muss jetzt<br />
verstärkt in die entsprechende Infrastruktur investiert<br />
werden. Das niederländische Unternehmen PitPoint.<br />
LNG aus dem Total-Konzern stellt sich darauf ein und<br />
errichtet derzeit im Kölner Hafen eine erste LNG-Bunkeranlage<br />
für Flüssigerdgas.<br />
Erdgas ist günstiger gegenüber LNG über das europäische<br />
Pipeline-Netz zu beziehen, da Verflüssigung und<br />
Rück-Vergasung sowie Schiffstransporte zusätzlichen<br />
Aufwand generieren. Die Shell-LNG-Studie weist hier<br />
einen ungefähren Preisvorteil für russisches Pipelineerdgas<br />
von 30 Prozent aus. Der steigende Bedarf<br />
an LNG kann durch die Importterminals in Belgien,<br />
Frankreich und Niederlande gedeckt werden.<br />
Globale Klimaeffekte<br />
Die Politik des Kohleausstiegs kann als konsequente<br />
und geradlinige nationale Maßnahme im Hinblick auf<br />
die Erfüllung des Vertrags von Paris betrachtet werden.<br />
Bestimmte weltweite Wechselwirkungen und Inkonsequenzen<br />
könnten die klimaschützenden Effekte<br />
in Summe allerdings wieder zunichtemachen. Wird<br />
Kohle in der Stromproduktion zunehmend durch Gas<br />
ersetzt, führt es dazu, dass die Kohle aus Ländern wie<br />
zum Beispiel Polen oder den USA günstiger angeboten<br />
wird und der Kohleeinsatz für Länder ohne Klimaschutzambitionen<br />
noch attraktiver ist.<br />
Im Stromsektor ist die Senkung der Treibhausgase relativ<br />
weit fortgeschritten. Im Wärme- und im Verkehrssektor<br />
werden die Ziele bisher verfehlt und sind nur<br />
gegen große Widerstände zu erreichen. Gas und insbesondere<br />
LNG wären zwar sehr flexibel in allen Sektoren<br />
zu nutzen. Auch würden die Probleme beim Netzausbau<br />
und bei den Batterieressourcen verringert. Doch<br />
kann der hohe energetische Aufwand für Verflüssigung<br />
und Transport sowie niedrige Standards zum Beispiel<br />
beim Schutz vor Methanausgasungen die Vorteile des<br />
LNG-Einsatzes bei globaler Betrachtung wieder zunichtemachen.<br />
Auch zeigen ja die Modellrechnungen,<br />
dass bei den zu erwartenden Gasszenarien der Klimaschutz<br />
verliert. Dazu müsste viel mehr auf regenerativ<br />
erzeugte Gase gesetzt werden. Schlussfolgernd lässt<br />
sich sagen, dass noch weitere Maßnahmen als „nur“<br />
der Kohleausstieg gefordert sind.<br />
Autorin<br />
Eur Ing Marie-Luise Schaller<br />
ML Schaller Consulting<br />
mls@mlschaller.com<br />
www.mlschaller.com<br />
SICHERE ERNTE.<br />
GARANTIERT.<br />
Direktvermarktung von Strom aus Biogas.<br />
Energiewende in Fahrt:<br />
Nutzen Sie unseren<br />
Vor-Ort-Service<br />
für den Flexbetrieb!<br />
Profitieren Sie von unseren Optimierungslösungen:<br />
100 % der Marktprämie, ohne Abzüge<br />
Monatliche Ausschüttung ohne weiteren<br />
Aufwand<br />
Einsatz moderner, sicherer Fernwirktechnik<br />
Haben Sie Fragen zum Thema Flexibilisierung?<br />
natGAS Aktiengesellschaft Tel: +49 331 2004-100<br />
Jägerallee 37 H Fax: +49 331 2004-199<br />
14469 Potsdam support@natgas.de<br />
Deutschland<br />
www.natgas.de<br />
Garantierte Zusatzerlöse aus Viertelstunden-<br />
Energiehandel und Regelenergievermarktung<br />
Integrierter Ansatz von Stromhandel und<br />
Technik<br />
77
International<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Paris<br />
Biomethanprodukte in<br />
Frankreich – Privatverbraucher<br />
sind noch wenig informiert<br />
Frankreich hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Bereits bis 2023 soll die<br />
Biomethaneinspeisung auf jährlich 6 Terawattstunden (TWh) steigen.<br />
Bislang wird das Biomethan vor allem im Verkehrssektor eingesetzt.<br />
Der Wärmemarkt ist aber eine vielversprechende Alternative, heizen<br />
doch über 40 Prozent der Haushalte in Frankreich mit Erdgas. Eine<br />
interviewbasierte Untersuchung zeigt jedoch, dass die privaten Endverbraucher,<br />
anders als in Deutschland, noch sehr wenig über Biogas und<br />
Biomethanprodukte wissen.<br />
Von Prof. Dr. Carsten Herbes<br />
78
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
International<br />
ETW SmartCycle<br />
Biomethaneinspeiseanlage<br />
im französischen<br />
Scherwiller (Elsass)<br />
nördlich von Colmar.<br />
Diese PSA-Anlage<br />
bereitet seit letztem<br />
Jahr 350 Nm³ Biogas<br />
pro Stunde auf.<br />
Biomethaneinspeisung in Frankreich: Ist-Situation und geplanter<br />
Ausbau sowie nötiger Zubau<br />
Einspeisekapazität in Terawattstunden (TWh)<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Ist<br />
Februar <strong>2019</strong><br />
1,3 4,7<br />
Nötiger Zubau<br />
<strong>2019</strong>-2023<br />
16,3<br />
Plan 2023<br />
laut PPE<br />
22 28<br />
Nötiger Zubau<br />
2023-2030<br />
Plan 2030<br />
Biomethananteil<br />
von 7%<br />
In der französischen Energiewende soll Biogas beziehungsweise<br />
Biomethan nach dem Willen der<br />
Regierung eine wichtige Rolle spielen: Spätestens<br />
2030 sollen 7 bis 10 Prozent (etwa 28 bis 40 TWh)<br />
des Gasverbrauchs aus Biogas stammen, für 2023<br />
ist eine Einspeisung von 6 TWh Biomethan geplant. Bis<br />
Anfang dieses Jahres lautete die Zielmarke sogar noch<br />
8 TWh, davon ist die französische Regierung aber inzwischen<br />
in ihrer letzten Version der „Programmation pluriannuelle<br />
de l’énergie“ vom Januar <strong>2019</strong> abgerückt.<br />
Dabei setzt Frankreich, anders als Deutschland in der<br />
Vergangenheit, vor allem auf Biogas aus Rest- und Abfallstoffen.<br />
Auf Veranstaltungen wird von französischer<br />
Seite oft explizit darauf hingewiesen, dass man angesichts<br />
der deutschen Erfahrungen bewusst einen anderen<br />
Weg gehe. Inzwischen sind in Frankreich insgesamt<br />
rund 800 Biogasanlagen in Betrieb, gut 80 davon bereiten<br />
nach Daten des Netzbetreibers GRDF das Biogas<br />
auf Erdgasqualität auf und speisen das Biomethan in<br />
das Gasnetz ein (maximale Jahreskapazität: etwa 1,3<br />
TWh per Februar <strong>2019</strong>).<br />
Foto: ETW Energietechnik GmbH<br />
Soll die Zielmarke einer jährlichen Einspeisung von<br />
6 TWh im Jahr 2023 erreicht werden, bedeutet dies,<br />
hochgerechnet auf Basis der Zahlen von 2018 und<br />
einer durchschnittlichen maximalen Einspeisemenge<br />
von 16 Gigawattstunden (GWh) pro Anlage, einen Zubau<br />
von mindestens 300 Biomethaneinspeiseanlagen<br />
bis 2023. Das ist ein durchaus ehrgeiziges Ziel, wenn<br />
man berücksichtigt, dass in Deutschland nach einer<br />
weit längeren Entwicklungszeit und zeitweise sehr positiven<br />
wirtschaftlichen Bedingungen aktuell lediglich<br />
rund 200 Anlagen mit einer Gesamteinspeisung von<br />
ungefähr 9 TWh in Betrieb sind.<br />
Erschwerend kommt hinzu, dass die französische Regierung<br />
in der neuesten Version der „Programmation<br />
pluriannuelle de l’énergie“ ein Vergütungsziel von 6,7<br />
EuroCent pro Kilowattstunde (kWh) (2023) beziehungsweise<br />
6,0 EuroCent/kWh (2028) vorsieht, was<br />
deutlich unter den heute gezahlten Tarifen liegt. Werden<br />
diese Preise nicht erreicht, sollen die Einspeisemengen<br />
reduziert werden. Maximal soll die Vergütung<br />
bei 8,7 EuroCent/kWh (2023) bzw. 8,0 EuroCent/<br />
kWh (2028) liegen. In der mittleren Zukunft werden<br />
in Frankreich allerdings neben den klassischen Biogasanlagen<br />
gegebenenfalls auch Anlagen auf Basis<br />
der thermochemischen Vergasung für die Produktion<br />
regenerativer Gase eine Rolle spielen, einige Demonstrationsprojekte<br />
existieren in Frankreich bereits.<br />
Verkehrssektor heute interessanter<br />
als der Wärmemarkt<br />
Wo wird das eingespeiste Biomethan verwendet? Heute<br />
fließt es vor allem in den Verkehrssektor, was auch damit<br />
zu tun hat, dass diese Verwendung aufgrund gesetzlicher<br />
Regelungen für die einspeisenden Anlagen finanziell<br />
attraktiver ist als ein Verkauf in den Wärmemarkt.<br />
In der Zukunft könnte der Wärmemarkt aber interessant<br />
werden, denn auch in Frankreich ist die Marktdurchdringung<br />
von Erdgasfahrzeugen mit 0,2 Prozent inklu-<br />
79
International<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
sive Lastfahrzeugen und Bussen sehr gering. Lediglich<br />
von Kommunen werden Erdgasfahrzeuge für ihre Busflotten<br />
und Müllfahrzeuge verstärkt eingesetzt.<br />
Auch sind sich französische Haushalte der Umweltwirkungen<br />
ihres Energieverbrauchs inzwischen stärker bewusst.<br />
Neben dem Ökostrommarkt mit etwa 40 landesweit<br />
verfügbaren Tarifen haben sich erste Biomethan<br />
basierte Ökogastarife entwickelt. War 2016 noch kein<br />
Biomethan basierter Tarif am Markt, so hatte sich 2017<br />
ein erstes Angebot etabliert und im August 2018 waren<br />
es schon drei. Inzwischen kann ein Einwohner von Paris<br />
zwischen vier Tarifen wählen, die allerdings alle von<br />
einem Anbieter stammen und sich nur in der Produktionsstätte<br />
und im Preis unterscheiden. Weitere drei<br />
Tarife von anderen Anbietern werden als „gaz vert“, als<br />
grünes Gas bezeichnet, sind aber Erdgastarife mit CO 2<br />
-<br />
Kompensation. In anderen Landesteilen gibt es zum<br />
Teil gar keine Ökogas-Angebote.<br />
Insgesamt ist der französische Gasmarkt stärker auf einige<br />
wenige Anbieter konzentriert als in anderen europäischen<br />
Ländern und die Konsumenten sind weniger<br />
wechselfreudig. Gerade das könnte aber ein Argument<br />
für Biomethan basierte Tarife sein. Gasanbieter können<br />
sich mithilfe dieser ökologischen Alternative von<br />
den Wettbewerbern abheben und Konsumenten zum<br />
Wechsel bewegen.<br />
Die Befragung<br />
Was aber halten die Verbraucher von Biomethan basierten<br />
Gastarifen? Diese Frage lag einer Untersuchung zugrunde,<br />
die die HfWU-Nürtingen-Geislingen in Frankreich<br />
durchgeführt hat. In ausführlichen qualitativen<br />
Interviews wurden zwanzig französische Privatkonsumenten<br />
zu ihrem Wissen und ihren Einstellungen zu<br />
Biogas allgemein und zu Biomethan basierten Gastarifen<br />
im Speziellen befragt. Das Wissen zum Thema<br />
Biogas war sehr gering ausgeprägt. Vier der zwanzig<br />
Befragten hatten weder den Begriff „Biogas“ noch<br />
das Wort „Biomethan“ je gehört. Die meisten anderen<br />
äußerten, dass sie nur über ein sehr geringes Wissen<br />
dazu verfügten, dasselbe galt für Erneuerbare Energien<br />
im Allgemeinen. Als Vorteile von Biogas wurden die<br />
Reduzierung negativer Umweltwirkungen genannt und<br />
die effiziente Verwendung von Abfällen, aber auch die<br />
geringere Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten.<br />
Als Nachteil wurde vor allem der Anbau von Biomasse<br />
für die Biogasproduktion genannt, zum Teil in Form des<br />
auch in Deutschland bekannten Teller-oder-Tank-Arguments.<br />
Aber auch der Abzug von Gülle und anderen<br />
organischen Düngern aus der landwirtschaftlichen Nutzung<br />
wurde kritisiert, obwohl tatsächlich ja die Nährstoffe<br />
über die Gärprodukte wieder der Landwirtschaft<br />
zur Verfügung stehen, hier handelt es sich also um eine<br />
Fehlwahrnehmung. Hinzu kam die Vermutung, dass die<br />
bisherige Infrastruktur, zum Beispiel Heizungsanlagen<br />
auf Basis von Erdgas, in Privathäusern nicht mehr genutzt<br />
werden könne, auch dies entspricht nicht der<br />
Realität. Beim Preis gingen die Vermutungen auseinander:<br />
Während einige Befragte einen höheren Preis<br />
befürchteten, erhofften andere eine Preissenkung,<br />
wenn es sich um ein abfallstämmiges Biogas handelt.<br />
Gewünschte Eigenschaften<br />
Die Ablehnung von Energiepflanzen, die bei den<br />
wahrgenommenen Nachteilen schon deutlich wurde,<br />
schlägt auch bei den gewünschten Eigenschaften von<br />
Biomethan basierten Tarifen durch. Landwirtschaftliche<br />
Rest- und Abfallstoffe sind unter den Substraten<br />
am beliebtesten, kurz dahinter folgen organische<br />
Haushaltsabfälle. Weit abgeschlagen dagegen folgen<br />
Zwischenfrüchte und auf dem letzten Platz Energiepflanzen.<br />
Innovative<br />
Energiegewinnung<br />
aus biogenen<br />
Reststoffen<br />
Das BEKON® Trockenfermentationsverfahren<br />
bietet effiziente und modulare Systeme für die<br />
Biogaserzeugung aus Abfallstoffen.<br />
Die ideale Lösung für Kommunen, private<br />
Entsorger und die Landwirtschaft.<br />
+49 89 9077959-0<br />
kontakt@bekon.eu | bekon.eu<br />
80
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Weitere positive Eigenschaften aus<br />
Sicht der meisten Befragten waren Öko-<br />
Labels und eine lokale Produktion des<br />
Biomethans. Letzteres vor allem, um die<br />
Transport aufwendungen zu minimieren,<br />
aber auch, weil dann die Anlagen kleiner<br />
sein können, wenn sie dezentral auf verschiedene<br />
Standorte verstreut sind. Bei<br />
der Frage, von welcher Art Lieferant sie am<br />
liebsten Biomethan kaufen würden, schnitten<br />
kleine Versorger am besten ab. Aber<br />
auch der Ex-Monopolist Gaz de France,<br />
heute Engie, bekam positive Kommentare.<br />
Zwar wird Engie ein Mangel an ökologischer<br />
Motivation unterstellt, aber die Sicherheit<br />
und Professionalität eines großen Versorgers<br />
durchaus gewürdigt.<br />
Kaufbereitschaft für Biomethan<br />
basierte Gastarife<br />
Am Ende der Interviews wurden die Befragten<br />
mit einem konkreten Tarif konfrontiert:<br />
ein Produkt von Engie mit 10 % Biomethananteil<br />
aus landwirtschaftlichen Rest- und<br />
Abfallstoffen, das in der Heimatregion der<br />
Befragten produziert wird. Fünf Befragte<br />
waren nicht bereit, einen gegenüber einem<br />
reinen Erdgastarif erhöhten Preis zu<br />
bezahlen. Elf würden einen Aufschlag von<br />
bis zu 10 Prozent akzeptieren, lediglich<br />
vier würden noch mehr bezahlen. Ungefähr<br />
die Hälfte zeigte sich, unabhängig von ihrer<br />
Zahlungsbereitschaft, überrascht, dass<br />
ein Tarif mit 10 Prozent Biomethan mehr<br />
kosten solle als ein reiner Erdgastarif. Zum<br />
Teil empfanden die Befragten einen höheren<br />
Preis als unlogisch. Warum würde denn<br />
überhaupt zu Biomethan geforscht, wenn<br />
es im Endeffekt teurer sei als Erdgas?<br />
Als Alternative wurde nach dem Biomethantarif<br />
noch ein reiner Erdgastarif mit<br />
Kompensation der CO 2<br />
-Emissionen durch<br />
Entwertung entsprechender Verschmutzungsrechte<br />
präsentiert. Hier überwog die<br />
Ablehnung, die meisten Befragten wollten<br />
lieber einen Biomethan basierten Tarif. Die<br />
Idee, dass Unternehmen durch den Kauf<br />
von Verschmutzungsrechten die Möglichkeit<br />
erwerben, mehr CO 2<br />
zu emittieren,<br />
wurde von vielen Befragten rundweg und<br />
mit zum Teil sehr drastischen Formulierungen<br />
abgelehnt: „Nein, aber ich mag das<br />
Prinzip des Kaufens von Emissionsrechten<br />
nicht, weil die großen Unternehmen sie<br />
die ganze Zeit kaufen und dann ungestraft<br />
mehr [Emissionen] produzieren als andere,<br />
nein!“ (Interview 16)<br />
„Wenn es so ist, tut mir leid, aber das ist<br />
eine totale Fehlentwicklung. Dann zahlt<br />
man für das Verschmutzen. Das ist inakzeptabel.“<br />
(Interview 19)<br />
Insgesamt schien es aber für die befragten<br />
französischen Verbraucher schwierig, den<br />
Mechanismus des Emissionsrechtehandels<br />
und ihrer Entwertung zu verstehen und sie<br />
äußerten entsprechende Unsicherheiten.<br />
In der Praxis würde sich die Frage stellen,<br />
ob die Verbraucher bei entsprechend knapp<br />
gehaltenen Informationen auf den Webseiten<br />
der Anbieter überhaupt zwischen<br />
Biomethan basierten Ökogasprodukten<br />
und Ökogasprodukten auf Basis von 100<br />
Prozent Erdgas mit CO 2<br />
-Kompensation<br />
zu unterscheiden wüssten. Auf dem Vergleichsportal<br />
Selectra wird allerdings klar<br />
ausgewiesen, welche Tarife Biomethan enthalten<br />
und welche auf einem Kompensationsmechanismus<br />
basieren.<br />
Fazit: Frankreich hat ehrgeizige Ziele beim<br />
Ausbau der Biomethaneinspeisung, die<br />
angesichts des heutigen Entwicklungsstandes<br />
nur schwer erreichbar erscheinen,<br />
wenn man die geplante Reduzierung der<br />
Vergütung in Betracht zieht. Will man neben<br />
dem heute in der Biomethanverwertung<br />
dominanten Verkehrssektor auch den<br />
Wärmemarkt entwickeln und private Haushalte<br />
erreichen, muss in der Kommunikation<br />
noch viel getan werden. Das ist nicht<br />
nur eine Aufgabe für das Marketing der Anbieter,<br />
sondern sollte durch Initiativen der<br />
Regierung flankiert werden.<br />
Die vollständigen Ergebnisse der Untersuchung<br />
wurden in englischer Sprache publiziert:<br />
Carsten Herbes, Simon Chouvellon,<br />
Joachim Lacombe (2018): “Towards<br />
marketing biomethane in France - French<br />
consumers’ perception of biomethane”,<br />
in: Energy, Sustainability and Society 8:<br />
37, kostenloser Download: https://energsustainsoc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13705-018-0179-7<br />
Autor<br />
Prof. Dr. Carsten Herbes<br />
Institute for International Research<br />
on Sustainable Management<br />
and Renewable Energy<br />
Hochschule für Wirtschaft und<br />
Umwelt Nürtingen-Geislingen<br />
Neckarsteige 6-10<br />
carsten.herbes@hfwu.de<br />
81<br />
INNOVATIVE International<br />
EINBRINGTECHNIK<br />
FÜR BIOGAS- UND<br />
RECYCLINGANLAGEN<br />
NEU!<br />
Jetzt auch als BIG-Mix Globe!<br />
Der BIG-Mix im ISO Seecontainer<br />
für den weltweiten Einsatz.<br />
BIG-Mix 35 bis 270m³<br />
effektiver Vorschub bei niedrigem<br />
Eigenstromverbrauch<br />
für 100% Mist und Grassilage<br />
mit Misch- und Aufbereitungsbereich<br />
komplett aus Edelstahl<br />
Biomischer 12 bis 80m³<br />
für 100% Mist und Grassilage<br />
massive Edelstahlkonstruktion<br />
mit Misch- und Aufbereitungsbereich<br />
auf Wunsch komplett aus Edelstahl<br />
KOMBI-Mix 8 und 12m³<br />
speziell für Kleinbiogasanlagen<br />
optional mit Vertikalmischschnecke<br />
für unterschiedlichste Substrate<br />
komplett aus Edelstahl<br />
Konrad Pumpe GmbH<br />
Fon +49 2526 93290<br />
Mail info@pumpegmbh.de<br />
www.pumpegmbh.de
Aus der<br />
Verbandsarbeit<br />
Bericht aus der Geschäftsstelle<br />
Biogas – Quo vadis?<br />
Dem spürbaren Rückenwind aus der Politik, dass Biogas<br />
eine besondere Rolle beim Klimaschutz einnehmen soll,<br />
stehen zunehmend mehr rechtliche Auflagen gegenüber.<br />
Von Dr. Stefan Rauh und<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Im politischen Berlin agierten die Haupt- und Ehrenamtlichen des<br />
Fachverbandes Biogas e.V. zuletzt mit gemischten Gefühlen. Während<br />
an einigen Fronten Aufbruchsstimmung aufkam, stagnierte an<br />
anderen Stellen der politische Prozess vollständig. So verzögerten<br />
sich die Vorarbeiten zur nächsten EEG-Reform, die eine parlamentarische<br />
Arbeitsgruppe eigentlich bis März abschließen sollten, aufgrund<br />
von Streitigkeiten in der Koalition auf unbestimmte Zeit.<br />
Dafür ging aber nach Vorlage eines ersten Entwurfs für das Klimaschutzgesetz<br />
ein Ruck durch die Politik. Zwar wird dieser Entwurf so wohl nicht<br />
Gesetz werden, aber die Botschaft ist klar – es muss etwas passieren in<br />
Sachen Klimaschutz. Dies merken wir in unserer täglichen Arbeit an einer<br />
Flut von Terminen und Anfragen. So hat etwa das Bundeswirtschaftsministerium<br />
einen neuen Dialogprozess gestartet, um endlich die längst<br />
überfällige „Gasstrategie 2030“ vorzubereiten, in der wir uns mit Biogas<br />
im Konzert mit den anderen grünen Gasen natürlich ebenfalls wiederfinden<br />
möchten. Und allein durch die Ankündigung, die strittigen Themen<br />
im neu aufgesetzten „Klimakabinett“ der betroffenen Minister klären zu<br />
wollen, kam in einige unserer zentralen politischen Themen, wie etwa in<br />
die Einführung eines CO 2<br />
-Preises, frischer Wind.<br />
Runder Tisch zur Güllvergärung<br />
In eine ähnliche Richtung ging auch ein im März durch das Hauptstadtbüro<br />
Bioenergie organisierter Runder Tisch zur Förderung der Güllevergärung,<br />
an dem wissenschaftliche Institute sowie das Bundeslandwirtschaftsministerium<br />
teilnahmen. Dabei wurden Hemmnisse (zum Beispiel<br />
AwSV, DüV) und Fördermöglichkeiten (zum Beispiel Investitionsförderung<br />
für Behälter, Änderung EEG) diskutiert. Einig war sich die Runde, dass<br />
viel getan werden muss, um zusätzliche Gülle in Biogasanlagen zu vergären.<br />
Aktuell besteht sogar eher die Gefahr, dass aufgrund der ungünstigen<br />
Rahmenbedingungen Bestandsanlagen die Gülle aus der Anlage nehmen<br />
oder ihren Betrieb einstellen müssen.<br />
82
Engagiert. Aktiv. Vor Ort. Und in Berlin: Der Fachverband Biogas e.V.<br />
Vom Referat Veranstaltungen wurde die Abfallvergärungstagung<br />
in Dresden vom 11. bis 13. März mit 120<br />
Teilnehmern und 10 Ausstellern durchgeführt. Eines<br />
der Kernthemen war die Vergärung entpackter Lebensmittel<br />
und die Ausbringung dabei entstehender Gärprodukte.<br />
Langfristiges Ziel ist, dass diese Wirtschaftsdünger<br />
sehr hohe Qualität aufweisen und so gut wie keine<br />
Fremdstoffe enthalten sollen. Zum Abschluss fand eine<br />
Lehrfahrt zu zwei Bioabfall-Anlagen statt. In der ersten<br />
besuchten Anlage werden die Inhalte der kommunalen<br />
Biotonne vergoren, während die zweite Anlage aus<br />
Milchresten Energie und Gärprodukte erzeugt.<br />
Neben der Abfallvergärungstagung wurden die Firmenvollversammlung<br />
(siehe Bericht auf Seite 88) durchgeführt<br />
sowie die Programm- und Vorplanungen für die<br />
BIOGAS Convention & Trade Fair <strong>2019</strong> vorgenommen.<br />
Zeitgleich liefen ferner die Vorbereitungen für die Beteiligungen<br />
an der agra vom 25. bis 28. April in Leipzig<br />
und der WeLa vom 14. bis 16. Juni in Borkenberge. Für<br />
die Service GmbH wurden ein Seminar zum Thema Güllekleinanlagen<br />
sowie ein Fachgespräch zur Flexibilisierung<br />
umgesetzt. Darüber hinaus sind bereits weitere<br />
Veranstaltungen für den Herbst in der Planung, so zum<br />
Beispiel Finanzierungs- und Fördertage am 25. September<br />
in Berlin oder der 2. Branchentag Erneuerbare<br />
Energien am 25. Oktober in Taufkirchen bei München.<br />
Zwei Fachgespräche zur TRAS 120<br />
In zwei Fachgesprächen hatte der Fachverband mit<br />
über 100 Sachverständigen und Firmen über die im<br />
Januar veröffentlichte TRAS 120 diskutiert. Das Ergebnis<br />
beider Veranstaltungen ist eine Reihe an interpretationswürdigen<br />
Anforderungen, die einer weiteren<br />
Klärung bedürfen. Diese Probleme der TRAS 120<br />
decken sich auch größtenteils mit den ersten Rückmeldungen<br />
aus dem sehr unterschiedlichen Vollzug<br />
in den Ländern. In einem ersten Austausch mit dem<br />
zuständigen Bundesumweltministerium wurde bereits<br />
signalisiert, dass eine Klärung dieser Fragen über die<br />
Kommission für Anlagensicherheit (KAS) nicht vorgesehen<br />
ist.<br />
Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, dass die<br />
Biogasbranche selbst eine Positionierung durchführt<br />
und Hilfestellungen zur Interpretation der TRAS 120<br />
entwickelt. In diversen Adhoc-Arbeitsgruppen (zum<br />
Beispiel Anforderungen an die Gasspeichermembran)<br />
diskutieren aktuell Experten über die Umsetzbarkeit<br />
der Anforderungen beziehungsweise über praxistaugliche<br />
Konkretisierungen der TRAS 120 (siehe auch das<br />
Interview auf Seite 95 zu dem Thema).<br />
Fachgespräch Flexibilisierung in Fulda<br />
Am 2. April trafen sich rund 30 Firmenmitglieder in<br />
Fulda, um sich über Erfahrungen rund um die Flexibilisierung<br />
auszutauschen. Anhand von Impulsvorträgen<br />
aus der Praxis sollten Haupthemmnisse für die Flexibilisierung<br />
der Branche und Handlungsempfehlungen<br />
sowohl innerverbandlich als auch für die Politik herausgearbeitet<br />
werden.<br />
Ein Fazit war, dass der Flexdeckel, der wohl im April<br />
ausgeschöpft sein wird, abgeschafft werden muss, um<br />
den Bedarf an flexibler Leistung in der Energiewende zu<br />
realisieren. Gleichzeitig muss die Branche noch stärker<br />
zeigen, dass sie tatsächlich flexibel fahren kann. Damit<br />
das auch wirtschaftlich attraktiv ist, muss die Regierung<br />
entsprechende Weichen stellen. Ein ausführlicher<br />
Bericht zum Treffen folgt in der nächsten Ausgabe des<br />
Biogas Journals.<br />
Neue Vorgaben für den Netzanschluss<br />
von BHKW<br />
Ende April wird die BDEW-Mittelspannungsrichtlinie<br />
endgültig von den Anwendungsregeln des VDE (Verband<br />
der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik<br />
e. V.) abgelöst. Durch die VDE AR 4110 gelten auch<br />
neue Anforderungen für den Netzanschluss von BHKW.<br />
Zum einen müssen die BHKW andere Einheitenzertifikate<br />
als in der Vergangenheit nachweisen. Sollten<br />
Kapazitäten, beispielsweise im Rahmen einer Flexibilisierung,<br />
zugebaut werden, sollte mit dem BHKW-<br />
Hersteller Rücksprache gehalten werden, ob dessen<br />
Produkte die neuen Anforderungen einhalten.<br />
Weiterhin muss beachtet werden, dass Anlagenzertifikate<br />
in Zukunft schon ab einer Anschlussleistung von<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich. Biogas kann‘s!<br />
83
Verband<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Neue MitarbeiterInnen<br />
Susanne Jakschitz-Wild<br />
unterstützt das Team des Referats Mitgliederservice<br />
im Fachverband Biogas e.V. in<br />
Freising seit dem 1. April. Hier kümmert<br />
sie sich als Fachreferentin um Fragen der<br />
Mitglieder und den Austausch von wichtigen<br />
Informationen. Zusätzlich übernimmt<br />
sie die Betreuung unserer Regionalbüros,<br />
wie ehemals Helene Barth. Sie studierte an<br />
der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf<br />
Agrarmarketing und Management und<br />
erwarb zusätzlich das Zertifikat Erneuerbare<br />
Energien. Während ihrer Diplomarbeit<br />
in Zusammenarbeit mit der Landesanstalt<br />
für Landwirtschaft mit dem Titel „Betriebsund<br />
Wartungskostenvergleich biogasbetriebener Blockheizkraftwerke zur dezentralen<br />
Stromversorgung“ beschäftigte sie sich intensiv mit fünf bayerischen Biogasanlagen.<br />
Anschließend war sie an der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) am Institut für<br />
Landtechnik (ILT) tätig. Sie arbeitete unter anderem am Projekt „Biogasanlagen –<br />
Betriebsmonitoring – alternative Verfahrensketten für die Einwerbung und Vergärung<br />
von Grünlandaufwüchsen“ mit.<br />
Mathias Hartel<br />
unterstützt seit April dieses<br />
Jahres ebenfalls das Team<br />
des Mitgliederservice in der<br />
Hauptgeschäftsstelle in<br />
Freising. Neben der Mitgliederbetreuung<br />
wird er sich<br />
auch Aufgaben im Referat<br />
Abfall, Hygiene und Düngung<br />
widmen. Der studierte<br />
Landschaftsplaner und<br />
ausgebildete Fachagrarwirt<br />
setzt sich bereits seit<br />
mehreren Jahren mit den<br />
Themen zur energetischen<br />
Biomassenutzung und Stoffströmen in der Landschaft auseinander.<br />
Als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Wirtschaftsdüngermanagement<br />
und Biogastechnologie der Bayerischen Landesanstalt für<br />
Landwirtschaft beschäftigte er sich unter anderem mit Toxinen, Spurenelementen<br />
sowie alternativen Energiepflanzen und den möglichen<br />
Auswirkungen auf den Biogasprozess.<br />
135 kW erforderlich werden. In diesem Fall ist ein „vereinfachtes<br />
Anlagenzertifikat (Typ B)“ ausreichend. Ab<br />
einer Anschlussleistung von 950 kW ist ein reguläres<br />
Anlagenzertifikat (Typ C) erforderlich. Der Fachverband<br />
überarbeitet zurzeit seine entsprechenden Arbeitshilfen<br />
und wird diese in nächster Zeit mit der Firmenrundmail<br />
und dem Betreiberfax verschicken.<br />
TRwS, 44. BImSchV und Co.<br />
Arbeitsschwerpunkt im Referat Genehmigung waren<br />
und sind Stellungnahmen zu Entwürfen von Technischen<br />
Regelwerken beziehungsweise Merkblättern der<br />
DWA aus dem Bereich anlagenbezogener Gewässerschutz<br />
(Gelbdruck TRwS 779) und Technische Ausrüstung<br />
(Gelbdruck DWA M 212) sowie die Begleitung der<br />
44. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV),<br />
die erneut im Bundestag behandelt wurde. Mit einem<br />
Inkrafttreten der 44. BImSchV ist höchstwahrscheinlich<br />
Mitte des Jahres zu rechnen.<br />
Größere Diskussionen ergeben sich in diesem Zusammenhang<br />
mit der zukünftig kommenden Nach- und<br />
Ausrüstung von BHKW mit NOx-Sensoren zur Überwachung<br />
des effektiven Betriebs der Katalysatoren.<br />
Daneben wurden zu Aktivitäten auf Länderebene Stellungnahmen<br />
erarbeitet – so zum Beispiel zum Entwurf<br />
des Regionalplanes Ruhr.<br />
Wir sorgen für sauberes Gas!<br />
Wir bieten mit der Donau Bellamethan Produktfamilie eine umfassende Lösung zur Grobentschwefelung an. Zusätzlich wird<br />
der Ammoniakgehalt verringert und die enthaltenen Spurenelemente gewährleisten eine Grundversorgung der Biologie.<br />
Donau Bellamethan – ein Qualitätsprodukt!<br />
» Verlässliche H 2<br />
S-Entfernung direkt im Substrat<br />
» freigegeben für den ökologischen Landbau,<br />
Eigenherstellung<br />
» langjährige Erfahrung und weitläufige Verbreitung<br />
» Geringe Einsatzmengen durch hochwertiges<br />
Eisen-II-chlorid mit 2,5 mol/kg Wirksubstanz<br />
» Lieferung auch in einzelnen IBC – Container möglich<br />
www.dcwatertech.com<br />
Ihr Donau Chemie Partner:<br />
Biogasberatung Sepp Lausch<br />
Petzenbichl 1<br />
83109 Tattenhausen<br />
Tel. 01 71 / 5 85 93 23<br />
www.biogasberater.com<br />
Betreiberschulung nach TRGS 529, Anmeldung auf unserer Website.<br />
DC_Inserat_LAUSCH_177x77_RZ.indd 1 29.11.18 15:31<br />
84
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Verband<br />
Internationale Aktivitäten<br />
Das Referat Internationales hatte sich in den vergangenen<br />
Wochen intensiv um neue Projektbeteiligungen<br />
bemüht, was jetzt zu ersten Aufträgen führt.<br />
Beispielsweise berät der Fachverband die UNIDO bei<br />
der Entwicklung von Biogasstandards in Kenia und<br />
gibt konkrete Vorschläge, wie die relevanten Stakeholder<br />
eingebunden werden müssen. Ebenfalls gibt<br />
es zwei Projektbeteiligungen im EU-Programm „Horizon2020“:<br />
a. DiBiCo: Digital Global Biogas Cooperation: Unterstützung<br />
der europäischen Biogas/Biomethan-Industrie<br />
durch die Vorbereitung von Märkten für den<br />
Export nachhaltiger Biogas/Biomethan-Technologie<br />
aus Europa in Entwicklungs- und Schwellenländer.<br />
b. REGATRACE: REnewable GAs TRAde Centre in Europe:<br />
Schaffung eines effizienten Handelssystems<br />
auf der Grundlage der Ausstellung und des Handels<br />
mit Biomethan/Erneuerbare Gase Herkunftsnachweisen.<br />
Harm Grobrügge EBA-Präsident<br />
Auf der Mitgliederversammlung des Europäischen Biogas<br />
Verbands (EBA) wurde Harm Grobrügge als Vertreter<br />
des Fachverbandes zum Präsidenten gewählt. Aufgrund<br />
der zunehmenden Bedeutung der EU-Regularien<br />
für die nationale Gesetzgebung ist diese Wahl sehr positiv<br />
einzustufen. Zu den besonders lukrativen Rahmenbedingungen<br />
für Biogasanlagen in Kalifornien hatte<br />
das Referat International ein Webinar für interessierte<br />
Mitgliedsfirmen organisiert. Eine Aufzeichnung des<br />
Webinars kann in der Geschäftsstelle angefragt werden.<br />
Die beiden Themen „Nutzung von Biogas im Kraftstoffmarkt“<br />
und „Synergien durch die Integration von<br />
Biogasanlagen in Power-to-X Konzepte“ sollen neben<br />
vielen anderen technologischen Ansätzen im neu gegründeten<br />
Netzwerk untersucht werden. Das Netzwerk<br />
„Power-to-X“, an dem auch der Fachverband<br />
sowie einige seiner Mitglieder beteiligt sind, verbindet<br />
Endanwender, Technologielieferanten und Forschungseinrichtungen<br />
mit dem Ziel, auf der Basis der Netzwerkarbeit<br />
neue Projekte im Bereich Sektorenkopplung<br />
ins Leben zu rufen. Für mögliche Fragen hinsichtlich<br />
der Teilnahme am Netzwerk steht Ihnen unser Kollege<br />
Alexey Mozgovoy gerne zur Verfügung:<br />
alexey.mozgovoy@biogas.org<br />
Auch der März war im Mitgliederservice und im Referat<br />
Energierecht und -handel geprägt durch den Start<br />
des Marktstammdatenregisters. Aufgrund von Programmierfehlern<br />
gab es Probleme bei der Erfassung<br />
der Meldungen zur Flexprämie und als Folge daraus<br />
resultierte die Frage nach der Erreichung des Flexdeckels.<br />
Nach aktuellem Stand geht der Fachverband<br />
Biogas e.V. davon aus, dass der Flexdeckel im April<br />
ausgeschöpft sein wird. Der Verband informiert seine<br />
Mitglieder über neue Entwicklungen und arbeitet<br />
dabei konstruktiv mit der BNetzA zusammen, um die<br />
Meldeprobleme zu lösen.<br />
Autoren<br />
Dr. Stefan Rauh<br />
Manuel Maciejczyk<br />
Geschäftsführer<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 85356 Freising<br />
Tel. 0 81 61/98 46 60<br />
info@biogas.org<br />
85
Verband<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
LEE Niedersachsen macht sich in<br />
Tarmstedt für Wärmewende durch<br />
Biogas stark<br />
Regional<br />
büro<br />
NORD<br />
Der Landesverband Erneuerbare Energien<br />
Niedersachsen/Bremen (LEE) präsentiert<br />
Mitte Juli die Erneuerbaren Energien auf<br />
der Tarmstedter Ausstellung. Mit dem gemeinsamen<br />
Auftritt wollen die Erneuerbaren<br />
Politik und Öffentlichkeit auf ihre Potenziale<br />
aufmerksam machen.<br />
In Niedersachsen läuft nicht alles rund im Bereich<br />
„Biogas“, die Energiewende gilt häufig als Stromwende<br />
und weniger als<br />
Wärmewende. Der<br />
LEE leistet daher vor<br />
Ort Überzeugungsarbeit<br />
und sucht das<br />
Gespräch mit den<br />
verantwortlichen Politikern.<br />
Denn Biogas<br />
spielt bereits heute<br />
eine wichtige Rolle in<br />
der Wärmewende: Allein<br />
in Niedersachsen<br />
verfügen 88 Prozent<br />
der Biogasanlagen<br />
über eine Wärmeauskopplung.<br />
Doch die<br />
Kopplung von Wärme-<br />
und Stromproduktion<br />
birgt Risiken<br />
Von links: Silke Weyberg, Geschäftsführerin LEE Niedersachen/ für die Anlagenbetreiber:<br />
Mitten im<br />
Bremen, Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara<br />
Otte-Kinast und Wilhelm Gantefort am Stand der Firma Wopereis<br />
auf der letzten Tarmstedter Ausstellung.<br />
Winter schaltete das<br />
Netzmanagement<br />
stromproduzierende<br />
Biogasanlagen vollständig ab, um die Netzstabilität zu<br />
erhalten. So im Februar in Rotenburg geschehen. Die<br />
Blockheizkraftwerke der Nawaro Biogas WBO Biogas<br />
GmbH & Co. KG versorgen die umliegenden Haushalte<br />
aber nicht allein mit Strom, sondern auch mit Wärme.<br />
Somit standen die Kunden rund zwei Tage ohne Strom<br />
und Wärme da.<br />
In mehrfacher Hinsicht bitter: Die Kunden ärgern sich<br />
über den Anlagenbetreiber, der Anlagenbetreiber ärgert<br />
sich über das Netzmanagement. Und da er Versorgungssicherheit<br />
bieten muss, muss er sein Blockheizkraftwerk<br />
mit fossiler Energie befeuern, um das<br />
Nahwärmenetz zu speisen. Diese Ereigniskette wirkt<br />
sich kontraproduktiv auf die Wärmewende aus.<br />
Foto: LEE<br />
Im Kern geht es dem LEE um einen diskriminierungsfreien<br />
Netzzugang für die kleinen Anlagenbetreiber, die<br />
die Energiewende aktiv unterstützen. Der LEE Niedersachsen/Bremen<br />
führt seit Jahren hierzu Gespräche im<br />
zuständigen Umweltministerium und startet jetzt auch<br />
parlamentarische Initiativen, da sich bisher nichts bewegt<br />
hat.<br />
Nach dem Vorbild Schleswig-Holsteins fordert der LEE,<br />
Biogasanlagen mit Wärmeauskopplung nachrangig zu<br />
schalten und grundsätzlich nicht auf null herunterzufahren.<br />
Zwar bekommen die Anlagenbetreiber ihre<br />
finanziellen Ausfälle erstattet, doch die Abschaltung<br />
führt auch zu erheblichen Problemen im Anlagenbetrieb.<br />
Themen, die dem LEE unter den Nägeln brennen<br />
und auch von der regionalen Presse aufgegriffen werden<br />
und kritisch kommentiert werden.<br />
In Tarmstedt wird der LEE deshalb politische Gespräche<br />
führen, um die Rand- und Rahmenbedingungen<br />
für die Biogasbranche in Niedersachsen und Bremen<br />
positiv zu gestalten. Auch die Düngemittelverordnung<br />
und Gärrestelagerung werden eine zentrale Rolle bei<br />
den Gesprächen spielen.<br />
Der Tarmstedter Ausstellung kommt eine besondere<br />
Bedeutung zu: Hier wurde der LEE Mitte vergangenen<br />
Jahres gegründet. Interessierte können den LEE bereits<br />
auf dem 36. Tag der Niedersachsen vom 14. bis 16.<br />
Juni in Wilhelmshaven kennenlernen. Eingebettet in<br />
die Natur- und Umweltmeile, stellt der Landesverband<br />
die Ziele und Potenziale seiner Mitglieder dar und informiert<br />
Politik, Öffentlichkeit und Medien über die<br />
Chancen, die die Wärmewende bietet.<br />
Hintergrundinformationen: Als Landesverband bündelt<br />
der LEE die energiepolitische Kompetenz seiner Mitglieder<br />
in Niedersachsen und Bremen. Der LEE setzt<br />
sich für die Wärmewende und den schnellen Ausstieg<br />
aus fossilen Brennstoffen ein.<br />
Autor<br />
Lars Günsel<br />
LEE Niedersachsen/Bremen<br />
Herrenstr. 6 · 30159 Hannover<br />
05 11/89 85 86 194<br />
lars.guensel@lee-nds-hb.de<br />
www.lee-nds-hb.de<br />
86
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Verband<br />
TLLLR bleibt<br />
Ansprechpartner für<br />
Anlagenbetreiber<br />
Unter dem Schwerpunktthema<br />
Biomethan und Kraftstoffe trafen<br />
sich am 26. Februar mehr<br />
als 100 Interessierte zur 51.<br />
Biogasfachtagung in der Bauernscheune<br />
Bösleben. Peter<br />
Ritschel, der neue Präsident des Thüringer<br />
Landesamts für Landwirtschaft und Ländlichen<br />
Raum (TLLLR), eröffnete mit einem<br />
Grußwort das Programm. Er betonte die<br />
Wichtigkeit von Biogasanlagen zur Diversifizierung<br />
der Betriebe im ländlichen Raum.<br />
Unter den aktuellen Rahmenbedingungen<br />
würden jedoch zahlreiche Anlagen<br />
abgeschaltet. Diese traurige Entwicklung<br />
vernichte Vermögenswerte und die Energiewende<br />
komme nicht voran. Das TLLLR<br />
werde auch nach interner Umstrukturierung<br />
Ansprechpartner für Betreiber in Thüringen<br />
bleiben und es werde keine Brüche in der<br />
Amtsverwaltung geben. Berater Dr. Gerd<br />
Reinhold untermauerte dies gleich am Beispiel<br />
einer aktuellen Förderrichtlinie für<br />
Nahwärmeleitungen.<br />
Das Multitalent Biogas kann auch zur Emissionsminderung<br />
im Verkehr beitragen und<br />
fossile Energieträger mit einer vorhandenen<br />
Fahrzeugtechnologie ablösen. RUM – Regional<br />
Umweltfreundlich Mobil heißt eine aktuelle<br />
Studie, die Biogas-Potenziale in Thüringen<br />
durch die Brille der THG-Einsparung<br />
betrachtet. Im Fokus ist hierbei auch die<br />
technische und wirtschaftliche Realisierbarkeit<br />
kleinmaßstäblicher Biogasaufbereitungsanlagen<br />
und deren regionale Nutzung<br />
als Kraftstoff.<br />
Volkmar Braune, Projektkoordinator des<br />
Auftraggebers Ohra Energie GmbH in<br />
Fröttstedt, wurde durch die positiven Ergebnisse<br />
ermutigt und will in einem zweiten<br />
Schritt ein Pilotprojekt an einem geeigneten<br />
Standort durchführen. Eine entschiedenere<br />
Positionierung der Politik mit angepassten<br />
Rahmenbedingungen würde diesem Nutzungskonzept<br />
zum wirtschaftlichen Durchbruch<br />
verhelfen, ist sich der technische<br />
Leiter des Gasdienstleisters sicher. Helfen<br />
Regional<br />
büro<br />
ost<br />
Mehr als 100<br />
Interessierte kamen<br />
Ende Februar zur 51.<br />
Biogasfachtagung in<br />
die Bauernscheune<br />
Bösleben.<br />
Manuel Maciejczyk,<br />
Geschäftsführer des<br />
Fachverbandes Biogas<br />
e.V., referierte über<br />
die Änderungen im<br />
Energiesammelgesetz<br />
sowie über die neuen<br />
Vorgaben der TRAS 120.<br />
kann diesem Ansatz die Neufassung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie<br />
der EU (RED<br />
II), bei der sich der Fachverband Biogas e.V.<br />
seit langem zum Beispiel für eine Anhebung<br />
von verbindlichen Quoten einsetzt.<br />
Dessen Geschäftsführer Manuel Maciejczyk<br />
betonte dies neben aktuellen Änderungen<br />
zum Beispiel im Energiesammelgesetz und<br />
in der „Technischen Regel für Anlagensicherheit“,<br />
TRAS 120. Den Marktvorteil der<br />
güllebetonten Biogasanlagen Thüringens<br />
im Kraftstoffsektor hob Prof. Dr.-Ing. Frank<br />
Scholwin, Institut für Biogas, Kreislaufwirtschaft<br />
& Energie in Weimar, hervor. Durch<br />
die hohe Anrechenbarkeit auf die THG-<br />
Quote lassen sich bei der Vermarktung als<br />
Kraftstoff in Zukunft und auch teilweise<br />
jetzt schon Erlöse generieren.<br />
Neben der Vermarktung der Energieprodukte<br />
müssen Betriebs- und Rohstoffkosten<br />
stets im Blick des Betreibers bleiben.<br />
Seine Erfahrungen aus der Praxis schilderte<br />
sehr überzeugend Thomas Balling von der<br />
GraNottGas GmbH in Grabsleben. Durch<br />
die Strohvergärung und die Erprobung<br />
verschiedener Verfahren des Rohstoffaufschlusses<br />
wurden hier Kosten gespart. Zusätzlich<br />
bleiben Nährstoffe auf dem Betrieb<br />
und der Imagegewinn ist erheblich.<br />
Jedoch: „Letztlich wird die beste Effizienzmaßnahme<br />
zunichte gemacht, wenn<br />
die Belegschaft nicht hoch motiviert ist“.<br />
Am Rande der Fachveranstaltung wurde<br />
von den Teilnehmern auch der aktuelle Beteiligungsprozess<br />
im Energieministerium<br />
Thüringens zur Unterstützung der Bioenergiebranche<br />
diskutiert. Inwiefern die Forderungen<br />
der hiesigen Marktakteure in einem<br />
Entwurf für eine Bundesratsinitiative zur<br />
EEG-Novellierung sich wiederfinden, bleibt<br />
abzuwarten.<br />
Autor<br />
Ingo Baumstark<br />
Regionalreferent Ost<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Meistersingerstr. 4<br />
14471 Potsdam<br />
03 31/23 53 738<br />
ingo.baumstark@biogas.org<br />
87
Verband<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Firmen diskutierten über die Zukunft<br />
von Biogas in Deutschland<br />
Am 13. März hatte der Fachverband<br />
Biogas e.V. und der<br />
dazugehörige Firmenbeirat zu<br />
einer Firmenvollversammlung<br />
nach Fulda eingeladen, um<br />
über den Status quo und die Zukunft der<br />
Biogaserzeugung in Deutschland zu diskutieren.<br />
Nach einer kurzen Begrüßung und Einführung<br />
in die aktuellen Herausforderungen<br />
der Energiewende im Allgemeinen durch<br />
den Vizepräsidenten Hendrik Becker ging<br />
die Leiterin des Berliner Hauptstadtbüros<br />
Sandra Rostek auf die biogasrelevanten<br />
energiepolitischen Entwicklungen ein. Sie<br />
hob dabei hervor, dass die bisher durchgeführten<br />
Ausschreibungen im Biogassektor<br />
alles andere als erfolgreich gelaufen sind<br />
und hier ein dringender Änderungsbedarf<br />
am Ausschreibungsdesign notwendig ist.<br />
In den nächsten Monaten stehen für die<br />
Biogasbranche existenziell wichtige Weichenstellungen<br />
an. Neben einer Novelle<br />
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)<br />
im Herbst sollen Maßnahmen zur Erreichung<br />
des Klimaschutzziels 2030 in einem<br />
Klimaschutzgesetz geregelt werden.<br />
Ein spürbarer Rückenwind kommt bei den<br />
aktuellen politischen Diskussionen aus<br />
den Ländern.<br />
Der Präsident des Fachverbandes Horst<br />
Seide ging in seinem Vortrag auf die neuen<br />
Chancen für Biomethan im Kraftstoffsektor<br />
ein. Durch die in der europäischen<br />
Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED II)<br />
beschlossenen Vorgaben ist die Energiegesetzgebung<br />
für die nächsten zehn Jahre<br />
festgelegt, und jetzt gilt es, sie durch die<br />
Bundesregierung umzusetzen. Insbesondere<br />
die Vergärung von Gülle nimmt einen<br />
hohen Stellenwert bei der Einsparung von<br />
Treibhausgasen ein und hat damit ein enormes<br />
Potenzial für die Erreichung der Klimaschutzziele.<br />
In der darauffolgenden intensiven Diskussion<br />
wurde klar, dass die Anbaubiomasse<br />
einerseits notwendig ist, um die Ziele zu<br />
erreichen beziehungsweise den Bestand zu<br />
sichern, andererseits aber die gesellschaftlichen<br />
Diskussionen über Biogas häufig im<br />
Zusammenhang mit dem Maisanbau stehen.<br />
Über den Status quo im Strommarkt<br />
beziehungsweise über die Wichtigkeit der<br />
konsequenten Flexibilisierung berichtete<br />
Uwe Welteke-Fabricius von den Flexperten.<br />
Zu den aktuellen Entwicklungen in der Verbändelandschaft<br />
der Erneuerbaren Energien<br />
referierte der Hauptgeschäftsführer<br />
des Fachverbandes Dr. Claudius da Costa<br />
Gomez. Neben einer Umstrukturierung<br />
der Geschäftsführung im Bundesverband<br />
Erneuerbare Energie e.V. (BEE) findet momentan<br />
auch eine verstärkte Gründung von<br />
Landesverbänden und Regionalvertretungen<br />
statt. Ziel dabei ist, die spartenübergreifende<br />
Zusammenarbeit zu fördern und<br />
die biogasspezifische Facharbeit weiter zu<br />
stärken.<br />
Die aktuell sehr umfangreich in Bearbeitung<br />
befindlichen technischen Anforderungen<br />
stellte der Geschäftsführer des<br />
Fachverbandes Biogas Manuel Maciejczyk<br />
in seinem Vortrag vor. Neben den Verschärfungen<br />
bereits bekannter Verordnungen<br />
(AwSV, DüV) berichtete er über die 44.<br />
Bundes-Immissionsschutzverordnung<br />
(BImSchV) und die damit verbundenen erheblichen<br />
Verschärfungen der Abgasgrenzwerte<br />
von Blockheizkraftwerken. In seinen<br />
Ausführungen ging er auch detaillierter<br />
auf die neu eingeführte Technische Regel<br />
TRAS 120 ein und gab einen Ausblick auf<br />
die weitere Bearbeitung der offenen Fragestellungen<br />
der TRAS 120.<br />
Die wichtige Rolle des Firmenbeirates<br />
im Fachverband Biogas beleuchtete der<br />
Sprecher Dr. Matthias Plöchl. Er rief dabei<br />
nochmals alle Firmenmitglieder auf, den<br />
Firmenbeirat bei allen Fragen, Wünschen<br />
oder strategischen Fragen zu nutzen. Im<br />
Anschluss gab Christoph Spurk in seiner<br />
Position als Firmenmitglied im Präsidium<br />
des Fachverbandes noch einen Überblick<br />
zu den aktuellen internationalen Aktivitäten<br />
im Verband.<br />
Neben der zunehmend wichtigeren Bearbeitung<br />
von europäischen Biogasthemen<br />
(MCPD, RED II, Seveso II etc.) wird<br />
die wichtige Kooperation mit relevanten<br />
Schwellen- und Entwicklungsländern<br />
weiter fortgeführt. Hinzu kommen diverse<br />
internationale Kooperationen und<br />
EU-Projekte (Horizon 2020). In diesem<br />
Zusammenhang wurde auch Rainer Eisler<br />
vorgestellt, der zukünftig die Interessen für<br />
Gemeinschaftsstände bei internationalen<br />
Biogasmessen im Auftrag des Fachverbandes<br />
koordinieren wird.<br />
Abgeschlossen wurde die Firmenvollversammlung<br />
mit einer Aussprache zu aktuellen<br />
Themen. Hier wurde insbesondere die<br />
Weiterentwicklung der Güllevergärung diskutiert.<br />
Hendrik Becker beendete die sehr<br />
interessante Veranstaltung mit dem Aufruf,<br />
im Verband und seinen Gremien noch<br />
intensiver mitzuwirken, um die Branche<br />
bei den anstehenden Zukunftsaufgaben<br />
erfolgreich zu unterstützen.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Geschäftsführer<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 · 85356 Freising<br />
0 81 61/98 46 60<br />
info@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
88
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Verband<br />
Elektro<br />
Hagl<br />
Ihr Partner<br />
in Sachen<br />
BHKW<br />
Komplettmodule 50kW-530kW<br />
Gas & Diesel Service<br />
+ Motoren Generatoren<br />
+ Notstromaggregate<br />
+ Schaltanlagen<br />
www.biogas-hagl.de · T. 0 84 52 . 73 51 50<br />
TAG DER<br />
ZUKUNFTS<br />
ENERGIEN<br />
MÜNSTERLAND<br />
<strong>2019</strong><br />
Repowering<br />
Flexibilisierung<br />
Lastmanagement<br />
Wärmespeicher<br />
Alles zur Zukunft der Energiewende<br />
Am 13. Juni in der Westmünsterlandhalle in Heiden<br />
Der größte Branchentreff im Münsterland<br />
Infos unter msl.lee-nrw.de<br />
Tel. 0461 3183364-0<br />
www.greenline-energy.de<br />
Wir machen Ihr Biogas CLEAN und COOL!<br />
Individuelle Anlagen von Züblin Umwelttechnik<br />
zur Reinigung und Kühlung von Biogas<br />
• CarbonEx Aktivkohle lter zur<br />
Feinentschwefelung von Biogas<br />
• GasCon Gaskühlmodul zur<br />
Kühlung von Biogas<br />
• BioSuldEx zur biologischen<br />
Entschwefelung von Biogas<br />
• BioBF Kostengünstiges System zur<br />
biologischen Vorentschwefelung<br />
NEU!<br />
Züblin Umwelttechnik GmbH, Otto-Dürr-Str. 13, 70435 Stuttgart<br />
Tel. +49 711 8202-0 • umwelttechnik@zueblin.de • zueblin-umwelttechnik.com<br />
EEG-Altvertrag zur Erweiterung Ihrer Biogasanlage<br />
• Vergütung nach EEG 2004<br />
• Boni: Formaldehyd, NawaRo + Gülle<br />
• 185 kW elektrisch<br />
• 121 thermisch o. Abgaswärme<br />
• 223 thermisch m. Abgaswärme<br />
• BHKW MAN 2876 LE 302 vorhanden<br />
• Inkl. Container und Gasregelstrecke<br />
• Inbetriebnahme 2006, Stilllegung 2012<br />
Kaufpreis und weitere Details auf Anfrage<br />
Kamin Projektentwicklung – mail: andreaskamin@aol.com – Telefon 0171 – 956 93 16<br />
89
Verband<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Mischpreisverfahren: ausbalancierte Bezuschlagung<br />
als Übergangsregelung einführen<br />
Gastbeitrag von Dr. Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbandes<br />
Erneuerbare Energie e.V. (BEE), zur Abschaffung des sogenannten<br />
Mischpreisverfahrens.<br />
Um den Ausbau der Erneuerbaren<br />
Energien gemäß den<br />
Klimazielen und im Sinne<br />
eines modernen Wirtschaftsstandorts<br />
voranzubringen,<br />
bedarf es passender Rahmenbedingungen.<br />
Anpassungen im Design der Energiemärkte<br />
sind dabei ein wichtiger Baustein, damit<br />
die Erneuerbaren ihre Aufgabe gut erfüllen<br />
können, klimafreundlichen und günstigen<br />
Strom zu liefern und auch Systemverantwortung<br />
zu übernehmen.<br />
Als Teil des nötigen Umbaus der Energiemärkte<br />
werden mit Inkrafttreten der „Guideline<br />
on Electricity Balancing“ auch in<br />
Deutschland Regelarbeitsmärkte in der<br />
Sekundärregelenergie und der Minutenreserve<br />
eingeführt, was sich positiv für die<br />
Regelenergie-Vermarktung Erneuerbarer<br />
Energien auswirkt. Zusätzliches Plus: Damit<br />
wird das sogenannte Mischpreisverfahren<br />
abgeschafft, das Erneuerbare-Energien-Anlagen<br />
und dabei vor allem Biogas<br />
deutlich benachteiligt hat. Zudem hat es<br />
zu signifikanten Kostensteigerungen in der<br />
Sekundärregelenergie sowie in der Minutenreserve<br />
geführt.<br />
Mit dem Mischpreisverfahren wurde im vergangenen<br />
Jahr eine Änderung hinsichtlich<br />
der Bezuschlagung bei der Bereitstellung<br />
von Regelenergie eingeführt, die konventionelle<br />
Anlagen systemisch bevorzugt.<br />
Erneuerbare-Energien-Anlagen werden aus<br />
dem Markt gedrängt – gerade jene Anlagen<br />
also, die in den vergangenen Jahren wesentlich<br />
zur Kostensenkung beigetragen haben.<br />
Zahlreiche Biogasanlagen führte das bereits<br />
ans Limit und zum Marktaustritt. Sie werden<br />
aber zwingend benötigt, im Versorgungssystem<br />
ebenso wie für den Klimaschutz.<br />
Erneuerbare Energien werden auch in der<br />
Regelenergie zunehmend konventionelle<br />
Kraftwerke ersetzen. Nun sollten ihnen aber<br />
mit wettbewerblichen Rahmenbedingungen<br />
auch die passenden Grundlagen geboten<br />
werden. Hierfür muss das gesamte Energieversorgungssystem<br />
Schritt für Schritt<br />
an die Erneuerbaren angepasst werden. Die<br />
Branche kann und will mehr Verantwortung<br />
übernehmen – sofern man sie lässt. Deshalb<br />
ist die Weiterentwicklung der Regelenergiemärkte<br />
besonders zu begrüßen.<br />
Der BEE drängt jedoch auf eine schnellere<br />
Umsetzung bei der Einführung der Regelarbeitsmärkte<br />
– am besten in drei bis sechs<br />
Monaten und spätestens bis Ende <strong>2019</strong>.<br />
Immerhin ist die EU-Guideline bereits seit<br />
2017 bekannt. Mit jedem Monat mehr summieren<br />
sich die negativen Auswirkungen<br />
des Mischpreisverfahrens: einerseits auf<br />
die Betreiber, vor allem von Biogasanlagen,<br />
und andererseits auf die Verbraucher, für<br />
die Mehrkosten entstehen. Der BEE hat mit<br />
seinen Fachverbänden Vorschläge entwickelt,<br />
um den Übergang zu gestalten.<br />
Hauptbestandteil der vorgeschlagenen<br />
Übergangsregelung ist die Bezuschlagung<br />
im Mischpreisverfahren, die anders<br />
geregelt werden soll, solange dieses noch<br />
gilt. Anstatt Arbeits- und Leistungspreise<br />
einfach zu vermischen, würde sich eine<br />
faire und ausbalancierte Bezuschlagung<br />
ergeben, verglichen mit heute. So sollte<br />
mit mehreren Gewichtungsfaktoren die<br />
Abrufwahrscheinlichkeit der letzten Quartale<br />
berücksichtigt werden, sodass die Zuschlagswahrscheinlichkeit<br />
für Erneuerbare<br />
wieder steigt. Auch die Bilanzkreistreue<br />
und die Systemsicherheit werden dadurch<br />
gestärkt. Das Verfahren kann relativ einfach<br />
in die Praxis umgesetzt werden, der Anpassungsbedarf<br />
ist minimal. Den Biogasanlagenbetreibern<br />
könnte auf diesem Weg sofort<br />
geholfen werden, bis schließlich das Mischpreisverfahren<br />
ganz abgeschafft ist.<br />
Warum wurde das Mischpreisverfahren<br />
überhaupt eingeführt? Grund waren im<br />
Herbst 2017 an einem einzigen Tag tatsächlich<br />
exorbitant hohe Arbeitspreise in<br />
manchen der gehandelten Viertelstunden<br />
in der Regelenergie. Dieser Ausschlag war<br />
problematisch, aber bislang einzigartig.<br />
Die Märkte haben auf Basis der damals<br />
bestehenden Regeln funktioniert und für<br />
eine weit kostengünstigere Regelenergiebereitstellung<br />
gesorgt. Dennoch hat die Bundesnetzagentur<br />
auf Betreiben der Übertragungsnetzbetreiber<br />
diesen Tag zum Anlass<br />
genommen, mit dem Mischpreisverfahren<br />
eine andere Preisbildung einzuführen.<br />
Das benachteiligt nun aber alle Anbieter<br />
mit strukturell hohen Liefer- und geringen<br />
Vorhaltekosten. Gerade sie sind es aber,<br />
die technisch und ökonomisch ideal geeignet<br />
sind, in sogenannten Peaker-Zeiten<br />
innerhalb der Regelenergie zu liefern. Da es<br />
derzeit wenige ökonomische Alternativen<br />
für diese Flexibilität gibt, würden sie im<br />
heutigen Mischpreisverfahren mittelfristig<br />
stillgelegt und damit auch nicht länger gehoben.<br />
Aus einem problematischen Einzelfall ist<br />
damit ein problematisches strukturelles<br />
Problem geworden, dessen Konsequenzen<br />
weit über den eigentlichen Regelungshintergrund<br />
hinauswirken. Und während Betreiber<br />
von Erneuerbare-Energien-Anlagen<br />
aus dem Markt gedrängt werden, verzeichnen<br />
konventionelle Anlagen erhebliche Gewinne.<br />
Das ist für die gesamte Energiewende<br />
kontraproduktiv.<br />
Mit der Abschaffung des Mischpreisverfahrens<br />
verbessert sich die Struktur der Regelenergiemärkte<br />
für Erneuerbare spürbar.<br />
Sie werden wieder für die Belebung der<br />
Regelenergiemärkte und für ein effizientes<br />
und günstiges Regelenergiesystem sorgen.<br />
Davon profitieren auch die Verbraucher. Für<br />
die Anlagenbetreiber ist eine schnelle Lösung<br />
wichtig, damit sie nicht auf dem Weg<br />
dorthin aus dem Markt gedrängt werden.<br />
90
„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist sie zu gestalten.“ (Willy Brandt)<br />
www.biogas.org // www.schulungsverbund-biogas.de // www.biogas-convention.com<br />
– 1 –<br />
1<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Verband<br />
Materialien für Ihre<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Sie planen ein Hoffest, bekommen eine Schulklasse<br />
zu Besuch oder werden zum Wärmelieferanten?!<br />
Der Fachverband bietet Ihnen für (fast) jede Gelegenheit<br />
die passenden Materialien.<br />
Immer wenn<br />
wir Energie brauchen,<br />
kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht,<br />
bei Wind und Wetter.<br />
Regional. Verlässlich.<br />
Klimafreundlich.<br />
Shop<br />
Fachverbands-Flyer<br />
Der Fachverband Biogas e.V. stellt sich vor<br />
DIN lang-Format, 6 Seiten<br />
Bestellnr.: KL-001<br />
für Mitglieder kostenlos<br />
Tel. 030 2758179-0<br />
Fax 030 2758179-29<br />
berlin@biogas.org<br />
Hauptstadtbüro<br />
Invalidenstr. 91<br />
10115 Berlin<br />
Dem Klimaschutz verpflichtet.<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstraße 12<br />
85356 Freising<br />
Tel. 08161 984660<br />
Fax 08161 984670<br />
info@biogas.org<br />
Engagiert. Aktiv. Vor Ort.<br />
Für Betreiber.<br />
Wissenschaftler.<br />
Hersteller.<br />
Institutionen.<br />
Interessierte.<br />
Biogas Journal<br />
Sonderhefte<br />
Die aktuellen Hefte finden Sie<br />
auf der Homepage (www.biogas.org)<br />
DIN A4-Format<br />
Bestellnr.: BVK-14<br />
Preis auf Anfrage<br />
Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 5 073 | 18. Jahrgang<br />
www.biogas.org März 2015<br />
Bi GaS Journal<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche<br />
Flexbetrieb: eine ökonomische<br />
Analyse S. 10 an den Fahrplanbetrieb S.<br />
Gasspeicher: Anforderungen<br />
30<br />
www.biogas.org Februar 2016<br />
Bi GaS Journal<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche<br />
Neue TRGS 529<br />
ernst nehmen S. 12<br />
SondeRheFt<br />
Stadtwerke Rosenheim bilden<br />
Kleinanlagenpool S. 65<br />
Direkt vermarktung<br />
BHKW<br />
Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 5 073 | 19. Jahrgang<br />
Sicherheitsrelevante<br />
dokumentationspflichten S. 24<br />
d<br />
SoNdeRheFT<br />
www.biogas.org April 2016<br />
Bi gAS Journal<br />
Statements zum einsatz<br />
von Prozesshilfsstoffen S. 38<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche<br />
Wildpflanzen: verbesserte<br />
Saatmischungen S. 6<br />
!<br />
SICHERHEIT<br />
Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 50073 | 19. Jahrgang<br />
neues vom Mais-Silphie-<br />
Mischanbau S. 19<br />
BGJ Anlagensicherheit BUCH 2016.in d 1 25.01.16 12:10<br />
SonderheFt<br />
Sommersubstrat: Buchweizen<br />
und Quinoa S. 24<br />
EnErgiEpFlAnzEn<br />
BGJ Energiepflanzen 2016 BUCH.in d 1 18.03.16 14:36<br />
Broschüre<br />
Biogas-Wissen<br />
Grundlegende Informationen rund um<br />
die Biogasnutzung in Deutschland<br />
Biogas<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
Broschüren<br />
Die Biogas Know-how-Serie –<br />
auch online verfügbar<br />
DIN A5-Format, 28 Seiten<br />
Bestellnr.: BVK-23 (deutsch)<br />
bis zu 20 Ex. kostenlos<br />
darüber 50 Cent / Broschüre<br />
BIOGAS Wissen_Kompakt<br />
Biowaste<br />
to Biogas<br />
BIOGAS<br />
Safety first!<br />
Guidelines for the safe use<br />
of biogas technology<br />
Biogas to<br />
Biomethane<br />
Düngen mit<br />
Gärprodukten<br />
Aufkleber für Ihre Braune Tonne<br />
21 x 10 cm<br />
Bestellnr.: KL-020<br />
5 Stück kostenlos –<br />
bei größerer Menge<br />
bitte nachfragen<br />
Fachverband_Biotonnenaufkleber_RZ.pdf 3 03.05.16 13:43<br />
Vielen Dank, dass Sie trennen!*<br />
1kg Bioabfall Biogasanlage Dünger<br />
*Aus einem Kilogramm Bioabfällen produziert eine Biogasanlage 240 Wh Strom.<br />
Je weniger Plastik in der Biotonne landet, desto sauberer der Dünger und desto höher die Energieausbeute!<br />
6h Strom<br />
www.biogas.org<br />
BIOGAS Know-how_1<br />
DIN A4-Format,<br />
68 Seiten<br />
Best.Nr.: KL-021<br />
(englisch)<br />
BIOGAS Know-how_2<br />
DIN A4-Format,<br />
68 Seiten<br />
Best.Nr.: KL-024<br />
(englisch)<br />
DIN A4-Format,<br />
68 Seiten<br />
Best.Nr.: KL-018<br />
(englisch)<br />
ein Heft kostenlos<br />
bei mehreren Heften berechnen wir Versand und Verpackung<br />
BIOGAS Know-how_3<br />
BIOGAS Wissen_2<br />
DIN A4-Format,<br />
68 Seiten<br />
Best.Nr.: KL-025<br />
(deutsch)<br />
as kann immer<br />
s kann gespeichert und je nach Bedarf in Energie umgewandelt<br />
n – auch wenn mal kein Wind weht und keine Sonne scheint.<br />
abilisiert unsere Stromnetze und ist für die technische Umseter<br />
Energiewende von entscheidender Bedeutung.<br />
Energiedörfer mit Biogas<br />
Biogas eignet sich hervorragend für die<br />
lokale Energieversorgung – und für neue<br />
Energiekonzepte in Kommunen und<br />
Regionen. Zahlreiche Wärmenetze, die<br />
teilweise genossenschaftlich betrieben<br />
werden, unterstreichen dieses Potenzial.<br />
Regionale Wertschöpfung<br />
Biogasanlagen produzieren dort Energie,<br />
wo sie gebraucht wird: In den Regionen.<br />
Das Geld für den Bau, den Betrieb und<br />
die Instandhaltung der Anlagen bleibt<br />
vor Ort – und fließt nicht in die Taschen<br />
der Ölmultis. Das sichert die regionale<br />
Energieversorgung und ist ein aktiver<br />
Beitrag zur Friedenspolitik.<br />
... und artenreich<br />
Viele Landwirte verzichten freiwi lig auf einen Teil ihres Gasertrages und setzen<br />
Pflanzen ein, die einen ökologischen Mehrwert für Mensch und Natur haben.<br />
„Die Biogasnutzung bietet die Möglichkeit,<br />
unterschiedlichste Pflanzen sinnvoll anzubauen<br />
und damit einerseits den Boden und das<br />
Grundwasser zu schützen und andererseits die<br />
Artenvielfalt auf den Feldern zu erhöhen.<br />
Das sieht nicht nur schön aus – es ist auch<br />
ein wichtiger Beitrag für den dringend<br />
notwendigen Schutz unserer Insekten.“<br />
Peter Maske, Präsident Deutscher Imkerbund e.V.<br />
Über gezielte Agrar-Fördermaßnahmen könnte<br />
Biogas einen wichtigen Beitrag für die Artenvielfalt<br />
leisten.<br />
Eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden<br />
Alternativen Energiepflanzen bietet die Seite<br />
www.farbe-ins-feld.de<br />
Der Fachverband Biogas e.V. ist mit über<br />
4.800 Mitgliedern die größte deutsche<br />
und europä ische Interessenvertretung der<br />
Biogas-Branche.<br />
Ziel der Verbandsarbeit ist es, die Biogaserzeugung<br />
und -nutzung für die bundes weite<br />
Strom-, Wärme- und Kraftstoff versorgung zu<br />
erhalten und auszubauen.<br />
Der Fachverband Biogas e.V. ist mit über<br />
4.700 Mitgliedern die größte deutsche und<br />
europäische Interessenvertretung der<br />
Biogas-Branche.<br />
Ziel der Verbandsarbeit ist es, die Biogaserzeugung<br />
und -nutzung für die bundesweite<br />
Strom-, Wärme- und Kraftstoffversorgung zu<br />
erhalten und auszubauen<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12<br />
85356 Freising<br />
A +49 (0)8161 984 660<br />
m info@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
Wissen_to go<br />
BIOGAS<br />
Biogas to go<br />
Artenvielfalt<br />
mit Biogas<br />
Handliche Fakten<br />
zur Biogasnutzung<br />
Biogas kann alles<br />
Biogas ist der vielseitigste erneuerbare Energieträger. Das umweltfreundliche<br />
Gas kann sowohl zur Strom- und Wärmegewinnung wie<br />
auch als Kraftstoff eingesetzt werden. Damit ist Biogas eine wichtige<br />
Säule für die bürgernahe und bezahlbare Energiewende!<br />
Strom aus Biogas<br />
Jetzt<br />
Biogas versorgt schon heute Millionen Haushalte in<br />
Deutschland mit klimafreundlichem Strom. Bei der<br />
Stromgewinnung im Blockheizkraftwerk entsteht automatisch<br />
auch Wärme.<br />
neu<br />
Wärme aus Biogas<br />
Mit Biogaswärme können zum Beispiel private Haushalte,<br />
kommunale Einrichtungen wie Schulen, Schwimmbäder<br />
und Turnhallen, Gewerbebetriebe oder Gewächshäuser<br />
beheizt werden.<br />
Kraftstoff aus Biogas<br />
Zu Biomethan aufbereitetes Biogas kann als klimafreundlicher<br />
und effizienter Kraftstoff von jedem CNG<br />
(compressed natural gas)-Fahrzeug getankt werden. Mit<br />
dem Biomethanertrag von einem Hektar Wildpflanzen<br />
kann ein Pkw einmal um die Erde fahren.<br />
< - - - - - - - - - - - 116 mm - - - - - - - - - - - > < - - - - - - - - - - - 118 mm - - - - - - - - - - - >< - - - - - - - - - - - 118 mm - - - - - - - - - - - > < - - - - - - - - - - - 116 mm - - - - - - - - - - - ><br />
Das Recycling von Bioabfä len in Biogasanlagen findet über die Vergärung und Kompostierung<br />
statt. Durch biologische Abbauprozesse entsteht in den Fermentern aus<br />
den Kartoffelschalen, dem Pizzarest und dem abgelaufenen Joghurt der Energieträger<br />
Biogas. Übrig bleibt ein hochwertiger Dünger, das sogenannte Gärprodukt.<br />
Dieses liefert a le wichtigen Nähr- und Humusstoffe für das erneute Pflanzenwachstum.<br />
Damit schließt sich der Nährstoffkreislauf. Die Vergärung in Biogasanlagen<br />
steht damit ganz klar vor der Verbrennung oder Deponierung.<br />
tuFige<br />
ierAchie<br />
ndung<br />
eislauf)<br />
rgetische) Verwertung<br />
Faltblätter<br />
Biogas to go<br />
Handliche Fakten zur<br />
Fachverband e.V.<br />
Biogasnutzung<br />
Angerbrunnenstr. 12<br />
85356 Freising<br />
A +49 (0)8161 984 660<br />
m info@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
11,8 x 11 cm<br />
1_Bestellnr.: BVK-37<br />
2_Bestellnr.: BVK-44<br />
3_Bestellnr.: BVK-45<br />
„Wenn unsere Nahrung<br />
schon in der Tonne statt<br />
auf dem Teller landet, dann<br />
sollte sie wenigstens noch<br />
sinnvoll genutzt werden“<br />
Georg Hackl, Rode legende<br />
Der Fachverband Biogas e.V. ist mit über<br />
4.700 Mitgliedern die größte deutsche und<br />
europäische Interessenvertretung der<br />
Biogas-Branche.<br />
Ziel der Verbandsarbeit ist es, die Biogaserzeugung<br />
und –nutzung für die bundesweite<br />
Strom-, Wärme- und Kraftstoffversorgung zu<br />
erhalten und auszubauen.<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12<br />
85356 Freising<br />
A +49 (0)8161 984 660<br />
m info@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
Wissen_to go<br />
BIOGAS<br />
Handliche Fakten<br />
zur Biogasnutzung<br />
Biogas ist bunt ...<br />
Biogas entsteht durch die Vergärung biogener Stoffe in einem luftdicht abgeschlossenen<br />
Behälter, dem sogenannten Fermenter. Vergoren werden kann fast a les,<br />
was biologischen Ursprungs ist: Gü le und Mist, Bioabfä le - oder Energiepflanzen.<br />
Letztere werden von den Landwirten extra angebaut. Ende 2017 wuchsen auf gut<br />
1,4 Mi lionen Hektar Energiepflanzen für den Einsatz<br />
in Biogasanlagen. Das sind rund acht Prozent<br />
der landwirtschaftlichen Nutzfläche.<br />
Fast jede Pflanze eignet sich für die Vergärung:<br />
bunte Wildblumen, weiß blühender Buchweizen<br />
oder die gelb blühende Durchwachsene Silphie.<br />
Sie unterscheiden sich jedoch in ihrem Gas- und<br />
damit Stromertrag. Aus einem Hektar Mais können<br />
ca. 21.000 Kilowattstunden Strom erzeugt<br />
werden. Bei der bunten Alternative Wildpflanzen<br />
liegt der Energieertrag etwa bei der Hälfte.<br />
Zahlreiche Institute und Hochschulen, aber auch<br />
viele Landwirte testen die verschiedensten Pflanzen<br />
auf ihre Biogastauglichkeit. In den letzten<br />
Jahren konnten dabei große Fortschritte erzielt<br />
werden und die Palette der potenzie len Energiepflanzen<br />
wächst kontinuierlich.<br />
Biogas aus<br />
Bioabfällen<br />
Handliche Fakten<br />
zur Biogasnutzung<br />
Booklet-Artenvielfalt 2018.indd 1 11.04.18 16:27<br />
bis zu 20 Ex. kostenlos<br />
darüber 50 Cent / Heft<br />
Wissen_to go_3<br />
BIOGAS<br />
Gelebte Kreislaufwirtschaft<br />
DVD<br />
Unterrichtsfilm<br />
Erneuerbare Energien<br />
Auch auf Youtube (FVBiogas)<br />
und zum Download auf Vimeo<br />
Wo Lebensmittel erzeugt und verbraucht werden, entsteht immer auch Abfa l. Das<br />
wird sich nie ganz vermeiden lassen. Seien es die Kartoffelschalen bei der Chips-<br />
Herste lung, die nicht ganz aufgegessene Pizza im Restaurant oder der abgelaufene<br />
Joghurt im Kühlregal.<br />
In der 5-stufigen Abfa lhierarchie des Kreislaufwirtschaftgesetzes hat die<br />
Vermeidung von Abfä len höchste Priorität. Gefolgt von der Wiederverwendung<br />
von Lebensmitteln – beispielsweise durch die Tafeln.<br />
An dritter Ste le kommt das Recycling, um (Nährstoff)Kreisläufe zu<br />
schließen und das Abfallaufkommen zu reduzieren. Dann erst folgt<br />
die energetische Verwertung (z.B. in Mü lverbrennungsanlagen)<br />
und ganz am Ende steht die Beseitigung, sprich die Ablagerung<br />
oder Deponierung, die zu vermeiden ist. FÜNFs<br />
Eine DVD für Schulen kostenlos<br />
Bestellungen an:<br />
andrea.horbelt@biogas.org<br />
ABFALLh<br />
1. Vermeidung<br />
2. Wiederverwe<br />
3. Recycling (Kr<br />
4. Sonstige (ene<br />
5. Beseitigung<br />
Bestellungen bitte per E-Mail an info@biogas.org<br />
91<br />
www.biogas.org
Recht<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Auf dem Gelände der Anlage, die<br />
Stedesand autark und genossenschaftlich<br />
mit Wärme versorgt. Von<br />
links: Ingo Böhm, Carsten F. Sörensen,<br />
Stephan Koth, Erik und Sina Steensen,<br />
Tobias Goldschmidt und Volquard<br />
Friedrichsen.<br />
Foto: Dirk Hansemann<br />
Energetisches Quartierskonzept bringt Biogasanlagenbetreiber<br />
und Bürger zusammen<br />
Hintergrund Quartierskonzept<br />
Förderprogramm: 432 der KfW „Energetische<br />
Stadtsanierung“<br />
Teil A: Quartierskonzept (Konzeptionierung)<br />
Teil B: Sanierungsmanagement (Umsetzungsbegleitung)<br />
Bundeszuschuss: 65 %<br />
Landeszuschuss: 20 %<br />
Eigenanteil der Gemeinde: 15 %<br />
Quartiersgröße „Ortsteil Stedesand“: etwa<br />
60 Hektar<br />
Quartierscharakter: Ein- und Zweifamilienhaus,<br />
rund 200 Gebäude aus den 1950er bis 1980er<br />
Jahren<br />
Ein Dorf macht Klimaschutz und vermeidet<br />
mit einem Wärmenetz 480 Tonnen CO 2<br />
pro Jahr durch Biogaswärme.<br />
Von Gerrit Müller-Rüster<br />
Mit der Errichtung einer Biogasanlage im<br />
Außenbereich der nordfriesischen Gemeinde<br />
Stedesand weckte Eric Steensen<br />
bereits 2010 großes Interesse in<br />
der Gemeinde, die entstehende Wärme<br />
im Dorf für die Beheizung von Wohngebäuden zu nutzen.<br />
Erst jetzt brachte das Quartierskonzept Betreiber<br />
und Gemeinde zusammen.<br />
Im Dezember 2018 wurde die<br />
Wärmeversorgung von 70 Liegenschaften<br />
aufgenommen.<br />
Mit der Biogasanlage gab der<br />
Landwirt den ersten Anstoß für<br />
Kennzahlen Biogasanlage<br />
Betreiber: Steensen Energy GmbH & Co. KG<br />
Inbetriebnahme Jahr: 2010<br />
Rohbiogasleitung: 3,5 Kilometer<br />
BHKW: 360 kW<br />
Flex-BHKW: 550 kW<br />
Investition für Versetzung und Flexibilisierung<br />
der BHKW: rund 1,0 Million Euro<br />
den kommunalen Klimaschutz – bereits in 2010 verfolgte<br />
man die Idee, im 3,5 Kilometer entfernten Ort<br />
Stedesand ein Satelliten-BHKW zu errichten und mit<br />
einer Rohbiogasleitung mit der Biogasanlage zu verbinden.<br />
Das Ziel, die Gebäude mit regenerativer Wärme zu<br />
versorgen, scheiterte jedoch damals an der mangelnden<br />
Rechtssicherheit bezüglich des Vergütungsstatus.<br />
Der Gedanke, die Wärme des Blockheizkraftwerks<br />
(BHKW) im Dorf zu nutzen, wurde aber nicht verworfen.<br />
Mit dem Förderprogramm 432 „Energetische<br />
Stadtsanierung“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau<br />
(KfW) wurde ein Planungs- und Umsetzungsinstrument<br />
gefunden, das ergebnisoffen eine unabhängige<br />
Entscheidungsgrundlage für Gemeinde, Bürger und<br />
Biogasanlagenbetreiber liefert.<br />
Kennzahlen Wärmenetz<br />
Betreiber: Wärmenetz Stedesand eG:<br />
Gründung: 9. November 2016<br />
Mitglieder (Stand 01/<strong>2019</strong>): 47 Mitglieder<br />
Anzahl der versorgten Liegenschaften: 70<br />
Netzlänge: 4,5 Kilometer<br />
Investition der Wärmenetz Stedesand eG: rund<br />
1,5 Millionen Euro<br />
Förderung für das Wärmenetz: rund 550.000 Euro<br />
Wärmearbeitspreis pro kWh: 7,74 ct/kWh inkl. USt.<br />
Wärmegrundpreis je kW: 39,67 € pro Monat bis<br />
25 kW Anschlussleistung inkl. USt.<br />
92
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Recht<br />
Foto: Dirk Hansemann<br />
Foto: Gerrit Müller-Rüster<br />
Einweihung Wärmenetz Stedesand: Zahlreiche Gäste ließen es sich nicht nehmen und nahmen<br />
am Schulweg in Stedesand die neue Anlage der Wärmenetz Stedesand eG in Augenschein.<br />
Einweihung Wärmenetz Stedesand: Der Biogasanlagenbetreiber<br />
Erik Steensen erläutert mit großer Freude die<br />
Anlagensteuerung seines neuen Flex-BHKW.<br />
Modellprojekt für kommunale Wärmewende<br />
Auf Initiative der Gemeindevertretung beauftragte die<br />
Gemeinde Stedesand im Jahr 2016 die Unternehmensberatung<br />
Treurat und Partner aus Kiel mit der<br />
Erstellung eines integrierten energetischen Quartierskonzeptes.<br />
Für die Erstellung und die Umsetzung des<br />
Konzeptes stellte die KfW mit dem Programm 432 der<br />
Gemeinde Stedesand einen Zuschuss in Höhe von 65<br />
Prozent zur Verfügung. Das Land Schleswig-Holstein<br />
stellte zusätzliche Fördermittel für das Konzept und<br />
die Umsetzungsbegleitung in Höhe von 20 Prozent<br />
zur Verfügung. Für Schleswig-Holstein war dies zum<br />
damaligen Zeitpunkt ein Modell- und Pilotprojekt für<br />
die kommunale Wärmewende. Ziel war es, geeignete<br />
Wege für ein klimaneutrales Leben und das Heben von<br />
Energieeffizienzpotenzialen im ländlichen Raum aufzuzeigen.<br />
Das Konzept lieferte dann die unabhängige Planungsgrundlage<br />
in der Gemeinde und diente den Bürgern als<br />
Entscheidungsgrundlage für die Gründung einer Genossenschaft.<br />
Mithilfe des Quartierskonzeptes wurde<br />
den Einwohnern des Dorfes Stedesand durch verschiedenen<br />
Workshops innerhalb von 12 Monaten die Idee<br />
einer genossenschaftlichen Wärmeversorgung vermittelt.<br />
Am 9. November 2016 war es soweit. Mit einer Gruppe<br />
von 15 Mitgliedern wurde die Wärmenetz Stedesand eG<br />
durch die Einwohner gegründet. Im Jahr 2017 wurde<br />
Treurat und Partner mit der Umsetzungsbegleitung beauftragt.<br />
Auch für diesen Auftrag setzte die Gemeinde<br />
Fördermittel des Förderprogramms 432 der KfW und<br />
des Landes Schleswig-Holstein in Höhe von insgesamt<br />
85 Prozent ein.<br />
Trotz Bundesförderung für die Investitionen in ein<br />
Wärmenetz ließ sich in einem Businessplan durch gestiegene<br />
Tiefbaukosten Ende 2017 kein wirtschaftlich<br />
umsetzbares Wärmenetz darstellen. Dank eines Zuschusses<br />
in Höhe von 100.000 Euro des Ministeriums<br />
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und<br />
Digitalisierung (MELUND) konnte die Wirtschaftlich-<br />
BioConstruct plant, errichtet und betreibt seit 2001 mit aktuell<br />
100 Mitarbeitern Anlagen zur Nutzung Erneuerbarer Energien in<br />
Deutschland und im europäischen Ausland. Wir sind ein inhabergeführtes<br />
Unternehmen und die weltweite Versorgung der Menschen<br />
mit Erneuerbaren Energien ist unsere gemeinsame Vision. Mit über<br />
400 errichteten Biogas- Windkraft- und Photovoltaikanlagen zählt<br />
BioConstruct zu den Marktführern in Europa.<br />
Zur tatkräftigen Unterstützung unseres Führungsteams suchen wir<br />
ab Juni <strong>2019</strong> eine(n) engagierte(n)<br />
Leiter Service (m/w/d)<br />
- Vollzeit -<br />
Detaillierte Stellenbeschreibungen finden Sie auf unserer Homepage<br />
www.bioconstruct.de<br />
Wir freuen uns auf Sie!<br />
BioConstruct GmbH<br />
Personalabteilung<br />
Wellingstraße 66 ∙ 49328 Melle<br />
job@bioconstruct.de<br />
www.bioconstruct.de<br />
93
Recht<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
keit hergestellt werden. Die Wärmenetz<br />
Stedesand beauftragte nach einer Ausschreibung<br />
ein Baukonsortium mit der<br />
Errichtung des rund 4,5 Kilometer langen<br />
Wärmenetzes.<br />
Hackschnitzelkessel liefert<br />
Prozesswärme für Fermenter<br />
Die Steensen Energy GmbH & Co. KG<br />
schloss mit der Wärmenetz Stedesand eG<br />
einen Vertrag über eine Wärmevollversorgung<br />
ab. Für die Wärmelieferung versetzte<br />
Eric Steensen sein BHKW von der Anlage<br />
zu einem neuen Standort im Dorf und stellte<br />
ein weiteres BHKW zur Sicherstellung<br />
eines flexiblen und bedarfsabhängigen Betriebs<br />
hinzu. Beide BHKW sind über eine<br />
Rohbiogasleitung mit der Anlage verbunden.<br />
Die Prozesswärme für die Fermenter<br />
am Anlagenstandort wird nun über einen<br />
Hackschnitzelkessel bereitgestellt. Die flexible<br />
Fahrweise der BHKW ermöglicht nicht<br />
nur bedarfsgerechte Stromerzeugung, sondern<br />
vor allem die bedarfsorientierte Wärmebereitstellung<br />
der angeschlossenen Liegenschaften.<br />
Nach einjähriger Bauzeit feierten die Anwohner<br />
von Stedesand, Vertreter der Baufirmen,<br />
Vertreter der örtlichen und überregionalen<br />
Politik am 12. Januar <strong>2019</strong> stolz<br />
und glücklich zusammen die Einweihung<br />
des Wärmenetzes. Bürgermeister Koth betonte:<br />
„ Die Höhen und Tiefen der Realisierung<br />
des Wärmnetzes konnten durch den<br />
gemeinsamen Willen, einen engagierten<br />
Vorstand, durch die professionelle Begleitung<br />
und die eingesetzten Fördermittel von<br />
Bund und Land gemeistert werden.“<br />
Steensen stellte überwältigt fest: „Unglaublich<br />
wie alle Beteiligten an einem<br />
Strang gezogen haben, um das Wärmenetz<br />
zu realisieren. Es gab Schwierigkeiten,<br />
aber auch immer wieder Lösungen!“ „Ein<br />
Leuchtturmprojekt, mit dem Sie auch zeigen,<br />
wie die Zukunft für Biogas aussehen<br />
kann“, betonte der Energiewendestaatssekretär<br />
Tobias Goldschmidt aus dem ME-<br />
LUND eine der Besonderheiten des Projektes.<br />
Das Wärmenetz versorgt seit Ende 2018<br />
private und öffentliche Liegenschaften.<br />
Die Wärmelieferung aus den BHKW verdrängt<br />
rund 150.000 Liter Heizöl pro Jahr.<br />
Das entspricht einer vermiedenen Menge<br />
von 480 Tonnen CO 2<br />
. Die angeschlossenen<br />
Haushalte erfüllen durch die Biogaswärme<br />
bereits im Jahr <strong>2019</strong> die klimapolitischen<br />
Ziele für das Jahr 2050 im Gebäudebereich.<br />
Das Wärmenetz führt außerdem zu<br />
einer regionalen Wertschöpfung von rund<br />
100.000 Euro pro Jahr, die nicht mehr<br />
über den Einkauf von Heizöl aus der Gemeinde<br />
abfließen. Die vorhandenen Kapazitäten<br />
bei den BHKW und dem Wärmenetz<br />
reichen aus, auch weitere Bürger an das<br />
Wärmenetz anzuschließen. Erste Interessenbekundungen<br />
liegen bereits vor.<br />
Autor<br />
Gerrit Müller-Rüster<br />
Treurat und Partner<br />
Unternehmensberatungsgesellschaft mbH<br />
Niemannsweg 109 · 24105 Kiel<br />
0431/59 36-373<br />
gmueller-ruester@treurat-partner.de<br />
www.treurat-partner.de<br />
RÜHRTECHNIK<br />
Zapfwellenmixer, Hydraulikmixer,<br />
Elektromixer, Tauchmotormixer,<br />
Spaltenbodenmixer, Güllemixer<br />
für Slalomsysteme<br />
Mathias Waschka<br />
Beratung und Vertrieb<br />
für landwirtschaftliche Erzeugnisse<br />
Trocknungstechnik bis 1,5 MW<br />
Mobil schallged. Varianten<br />
bis 500 kW 45 dB(A)<br />
Tel. 07374-1882, www.reck-agrar.com<br />
Schubboden-Trocknungscontainer<br />
Keine Korrosionsbeschichtung des Behälters<br />
Kein Gasvolumen gem. Störfall Verordnung<br />
www.n-e-st.de<br />
Tel.: 02561 449 10 10<br />
Tel.<br />
Fax<br />
Mobil<br />
mw@m-waschka.de<br />
www.m-waschka.de<br />
04482 - 908 911<br />
04482 - 908 912<br />
0151 - 23510337<br />
94
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Recht<br />
Interview<br />
»TRAS-Regeln bilden Anhaltspunkte<br />
für behördliche Entscheidungen«<br />
Im Gespräch mit dem Rechtsanwalt Philipp Wernsmann über die neue TRAS 120.<br />
Interviewer: Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Biogas Journal: Wie ist die TRAS 120 rechtlich einzustufen?<br />
Philipp Wernsmann: Die „Technische Regel für Anlagensicherheit<br />
– TRAS 120“ ist von der Kommission<br />
für Anlagensicherheit beschlossen und am 21. Januar<br />
<strong>2019</strong> im Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Die<br />
Kommission hat gemäß § 51a Absatz 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz<br />
(BImSchG) zwei Aufgaben: Sie<br />
soll erstens regelmäßig oder aus besonderem Anlass<br />
gutachterlich Möglichkeiten zur Verbesserung der Anlagensicherheit<br />
aufzeigen und zweitens dem Stand der<br />
Sicherheitstechnik entsprechende Regeln unter Berücksichtigung<br />
der für andere Schutzziele vorhandenen<br />
Regeln vorschlagen.<br />
In § 3 Absatz 6 BImSchG wird der Begriff „Stand der<br />
Technik“ definiert als Entwicklungsstand fortschrittlicher<br />
Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen mit<br />
praktischer Eignung unter anderem zur Begrenzung von<br />
Emissionen und Gewährleistung der Anlagensicherheit.<br />
Der „Stand der Sicherheitstechnik“ stellt sich insofern<br />
als ein Teilaspekt dar. In der Anlage zu § 3 Absatz 6<br />
BImSchG werden dazu einzelne Kriterien genannt.<br />
Die vorgeschlagenen Regeln sind Sachverständigenäußerungen<br />
der Kommission. Im Rahmen der behördlichen<br />
Entscheidung bilden sie einen Anhaltspunkt und<br />
haben indizielle Bedeutung. Der Stand der Technik<br />
beziehungsweise Sicherheitstechnik ist grundsätzlich<br />
gerichtlich überprüfbar und insofern nicht rechtsverbindlich<br />
wie beispielsweise eine Verordnung oder ein<br />
Gesetz.<br />
Das ist ein wesentlicher Unterschied zu den auf Grundlage<br />
des § 48 BImSchG erlassenen „normkonkretisierenden“<br />
Verwaltungsvorschriften wie TA Luft oder TA<br />
Lärm, die für die Behörden im Grundsatz verbindlich<br />
und damit auch vom Anlagenbetreiber zu beachten<br />
sind.<br />
Biogas Journal: Kann die TRAS 120 und deren Anwendung<br />
pauschal seitens der Vollzugsbehörden in Genehmigungsbescheiden<br />
oder Anordnungen gefordert<br />
werden?<br />
Wernsmann: Die TRAS 120 beansprucht keine unmittelbare<br />
Anwendbarkeit, sondern will den Stand der<br />
Technik/Sicherheitstechnik dokumentieren und als<br />
95
Recht<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Erkenntnisquelle dienen. Wird durch Verwaltungserlass<br />
die Anwendung verbindlich<br />
angeordnet, so müssen die Vollzugsbehörden<br />
sie verbindlich anwenden.<br />
In der Praxis wird die TRAS 120 so oder<br />
so praktische Wirkung entfalten, da hier<br />
umfassende technische und organisatorische<br />
Vorgaben für die Errichtung und den<br />
Betrieb von Biogasanlagen verschriftlicht<br />
sind. War bisher die Behörde im Begründungszwang,<br />
wenn sie über die bisherige<br />
Praxis hinaus weitergehende Anforderungen<br />
stellen wollte, so wird künftig der Anlagenbetreiber<br />
begründen müssen, warum er<br />
von bestimmten Anforderungen der TRAS<br />
120 abweichen will.<br />
Im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens<br />
wird geprüft, ob die Anlagen, die<br />
dem BImSchG beziehungsweise der 12.<br />
Bundes-Immissionsschutzverordnung<br />
(BImSchV) (Störfall-Verordnung) unterliegen,<br />
den Stand der Technik beziehungsweise<br />
Sicherheitstechnik einhalten (vgl.<br />
§ 5 Absatz 1 Nr. 2 BImSchG). Für neu zu<br />
errichtende Anlagen wird die TRAS 120<br />
vorrangig zu beachten sein.<br />
Eine Nachrüstung für bestehende Anlagen<br />
kann die Behörde gemäß § 17 BImSchG<br />
nachträglich anordnen, wenn die Allgemeinheit<br />
oder die Nachbarschaft nicht vor<br />
schädlichen Umwelteinwirkungen oder<br />
sonstigen Gefahren ausreichend geschützt<br />
ist. Sie muss dann aber die Verhältnismäßigkeit,<br />
also den Aufwand und deren Kosten<br />
im Vergleich zu dem angestrebten Erfolg<br />
besonders prüfen und beachten.<br />
Soll eine Anlage wesentlich geändert<br />
werden, beispielsweise weil ein weiteres<br />
BHKW zur Flexibilisierung oder ein neues<br />
Gärproduktlager geplant ist, ist eine Änderungsgenehmigung<br />
nach § 16 BImSchG zu<br />
Abgaswärmetauscher<br />
Dampferzeuger<br />
Gaskühler / Gaserwärmer<br />
Sonderanwendungen<br />
Zusatzkomponenten<br />
THERM<br />
Energiepark 26/28 91732 Merkendorf<br />
+49 9826-65 889-0 info@enkotherm.de<br />
www.enkotherm.de<br />
beantragen. Behörden neigen dazu, den<br />
aktuellen Stand der Technik in der Änderungsgenehmigung<br />
festzuschreiben, und<br />
zwar auch für Anlagenteile, die unverändert<br />
bleiben sollen. Hier ist es für die Anlagenbetreiber<br />
besonders wichtig, in den Antragsunterlagen<br />
den Gegenstand der Änderungsgenehmigung<br />
sorgfältig festzulegen<br />
und die schließlich erteilte Genehmigung<br />
und deren Nebenbestimmungen genauestens<br />
zu prüfen, besonders im Hinblick auf<br />
Auswirkungen für die bestehende und unveränderte<br />
Anlage.<br />
Biogas Journal: Wie ist mit überschneidenden<br />
anderen technischen und/oder<br />
rechtlichen Regelwerken, wie zum Beispiel<br />
der TRGS 529 oder der BetrSichV etc. (Arbeitsschutz),<br />
im Verhältnis zur TRAS 120<br />
umzugehen?<br />
Wernsmann: Grundsätzlich sind sämtliche<br />
technischen und rechtlichen Regelwerke<br />
zu beachten. Die Anwendung der Regelwerke<br />
auf die einzelne Biogasanlage erfolgt<br />
zunächst durch die jeweilige Genehmigung<br />
oder Anordnung der Behörde und im Betrieb<br />
der Anlage durch die regelmäßigen<br />
Prüfungen der Sachverständigen. Ergeben<br />
sich widersprüchliche Anforderungen, sollte<br />
dieser Punkt mit der Behörde oder dem<br />
Gutachter offen angesprochen werden.<br />
Biogas Journal: Was ist zu tun, wenn nachweislich<br />
der Stand der Technik, wie zum<br />
Beispiel in der TRAS 120, falsch wiedergegeben<br />
ist?<br />
Wernsmann: Da die TRAS 120 keine<br />
Rechtsnorm ist, kann sie nicht zum Gegenstand<br />
einer Klage gemacht werden. §<br />
51a Absatz 1 BImSchG verpflichtet die<br />
Kommission, regelmäßig spätestens nach<br />
fünf Jahren eine Überprüfung der<br />
sicherheitstechnischen Regeln vorzunehmen.<br />
Die Branche – also Hersteller,<br />
Planer, Betreiber und Gutachter<br />
– ist daher dazu aufgerufen,<br />
in den Gremien ihren Sachverstand<br />
einzubringen.<br />
Wird seitens der Behörde unter Bezugnahme<br />
auf die TRAS 120 eine<br />
bestimmte Maßnahme oder Ausführung<br />
gefordert, die nicht dem<br />
Stand der Technik entspricht oder<br />
wesentlich darüber hinausgeht,<br />
so sollte der Anlagenbetreiber mit<br />
sachverständiger Hilfe den Stand<br />
der Technik darlegen. Erforderlichenfalls<br />
muss er versuchen, seine Ansicht<br />
vor Gericht durchzusetzen. Der Stand der<br />
Technik ist eine dem Sachverständigenbeweis<br />
zugängliche Tatsachenfrage.<br />
Biogas Journal: Welche Stellung hat die<br />
TRAS 120 und der Stand der Technik<br />
bezüglich einer werkvertraglichen Einstufung?<br />
Ist eine Missachtung der TRAS 120<br />
von Fachfirmen per se ein Mangel?<br />
Wernsmann: Ob ein Mangel vorliegt, ist<br />
vorrangig danach zu beurteilen, was vertraglich<br />
zur Beschaffenheit vereinbart<br />
wurde. Grundsätzlich ist der Unternehmer<br />
aber verpflichtet, die anerkannten Regeln<br />
der Technik zu beachten. Beim Bauvertrag<br />
nach VOB/B gehören die anerkannten<br />
Regeln der Technik zur vertraglich vereinbarten<br />
Beschaffenheit, wenn die Vertragsparteien<br />
nicht ausdrücklich Abweichendes<br />
vereinbaren.<br />
Der Stand der Technik wird gegenüber den<br />
anerkannten Regeln der Technik teilweise<br />
als ein weitergehender fortschrittlicher<br />
Entwicklungsstand verstanden. Damit liegt<br />
bei abweichender Ausführung nicht zwingend<br />
ein Mangel vor, kann aber als Indiz<br />
dafür gewertet werden. Diese Frage wird im<br />
Streitfall durch Sachverständigengutachten<br />
entschieden werden.<br />
Anlagenbetreibern, die die Anforderungen<br />
der TRAS 120 einhalten wollen oder<br />
müssen, ist daher zu raten, die konkreten<br />
Anforderungen vertraglich ausdrücklich zu<br />
vereinbaren. Beispielsweise fordert die Nr.<br />
2.2.1 Absatz 6 TRAS 120 die Trennung von<br />
Maschinen- und Elektroräumen. Das kann<br />
beim Kauf eines neuen BHKW bereits verbindlich<br />
festgelegt werden. Damit können<br />
zwar höhere Kosten verbunden sein, aber<br />
der Anlagenbetreiber erfüllt dann jedenfalls<br />
den Stand der Technik und muss nicht<br />
in Zukunft möglicherweise kostenträchtiger<br />
nachrüsten.<br />
Biogas Journal: Können der Stand der<br />
Technik und der Stand der Sicherheitstechnik<br />
in einem Technischen Regelwerk<br />
vermischt werden?<br />
Wernsmann: Die TRAS 120 beansprucht<br />
für sich, sowohl den Stand der Technik als<br />
auch der Sicherheitstechnik zu beschreiben<br />
beziehungsweise festzulegen. Ob aufgrund<br />
der terminologischen Unklarheiten<br />
beziehungsweise unklaren Abgrenzung zwischen<br />
Technik und Sicherheitstechnik eine<br />
Kompetenzüberschreitung der Kommissi-<br />
96
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Recht<br />
on angenommen und damit die Anwendbarkeit<br />
im Einzelfall verneint werden kann,<br />
ist allerdings fraglich. Denn die Kriterien<br />
in der Anlage zu § 3 Nr. 6 BImSchG zum<br />
Stand der Technik verweisen in Nr. 4 beispielsweise<br />
auf „vergleichbare Verfahren,<br />
Vorrichtungen und Betriebsmethoden, die<br />
mit Erfolg im Betrieb erprobt wurden“, aber<br />
auch in Nr. 11 auf die „Notwendigkeit, Unfälle<br />
vorzubeugen und deren Folgen für den<br />
Menschen und die Umwelt zu verringern“.<br />
Biogas Journal: Was ist bei nicht am Markt<br />
verfügbaren Materialien und Komponenten<br />
aus rechtlicher Sicht zu tun, um vom Stand<br />
der Technik/Stand der Sicherheitstechnik<br />
abzuweichen?<br />
Wernsmann: Das Recht kann nur fordern,<br />
was tatsächlich umsetzbar ist. Was umsetzbar<br />
ist, muss im Einzelfall geprüft werden.<br />
Wenn bestimmte Materialien oder Komponenten<br />
am Markt nicht verfügbar sind, so<br />
sind diese offenbar auch nicht der Stand<br />
der Technik.<br />
Biogas Journal: Können in den Obliegenheitspflichten<br />
von Versicherungen pauschale<br />
Anforderungen zur Einhaltung der<br />
TRAS 120 definiert werden?<br />
Wernsmann: Vielfach wird in den Versicherungsverträgen<br />
abstrakt auf gesetzliche<br />
oder behördliche Sicherheitsvorschriften<br />
Bezug genommen, aber nicht auf einzelne<br />
technische Regelwerke. Eine pauschale<br />
Verpflichtung zur Einhaltung sämtlicher<br />
Vorgaben der TRAS 120 ergibt sich daraus<br />
nicht. Erlässt die Behörde allerdings eine<br />
konkrete Anordnung zur Umsetzung bestimmter<br />
Vorgaben oder legt die Versicherung<br />
konkrete Pflichten fest (beispielsweise<br />
bestimmte Prüfungsintervalle), kann bei<br />
versäumter Umsetzung die Versicherung<br />
leistungsfrei werden.<br />
Biogas Journal: Was bedeutet das jetzt konkret<br />
für die Praxis?<br />
Wernsmann: Anlagenbetreibern ist anzuraten,<br />
sich mit den neuen Anforderungen<br />
auseinanderzusetzen und insbesondere im<br />
Vorfeld anstehender wiederkehrender Prüfungen<br />
nach § 29a BImSchG beziehungsweise<br />
§ 16 BetrSichV mit dem Sachverständigen<br />
das Gespräch zu suchen. Denn<br />
sobald die einzureichenden Gutachten<br />
Mängel deswegen benennen, weil die neuen<br />
Anforderungen der TRAS 120 nicht erfüllt<br />
werden, wird behördlicherseits deren<br />
Beseitigung gefordert.<br />
Im Rahmen von Genehmigungen und behördlichen<br />
Anordnungen ist zu prüfen, ob<br />
die Anforderungen der TRAS 120 im Einzelfall<br />
technisch umsetzbar und verhältnismäßig<br />
sind. Im Rahmen von Genehmigungsverfahren<br />
für neue Anlagen ist eine<br />
vorherige Besprechung mit der Behörde zu<br />
empfehlen, um zu klären, ob und in welchem<br />
Umfang TRAS 120 für die konkrete<br />
Biogasanlage relevant ist.<br />
Biogas Journal: Herr Wernsmann, vielen<br />
Dank für das Gespräch!<br />
Interviewer<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
0 54 09/90 69 426<br />
martin.bensmann@biogas.org<br />
Fotos: www.landpixel.eu<br />
97
Recht<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Clearingstelle EEG | KWKG<br />
Voten zum Landschaftspflege-Bonus<br />
und zur Vergütungsverringerung bei<br />
Meldeverstößen veröffentlicht<br />
Die Clearingstelle EEG|KWKG hat in zwei Voten Fragen zum Landschaftspflegebonus sowie<br />
zu den Rechtsfolgen bei einem Meldeverstoß und Vorlage des Einsatzstoff-Tagebuchs nach<br />
dem 28. Februar beantwortet.<br />
Von Beatrice Brunner und Elena Richter<br />
Votum zum Landschaftspflegebonus: Im Votum<br />
2018/15 (abrufbar unter https://www.<br />
clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2018/15)<br />
hat die Clearingstelle geklärt, dass Zwischenfrüchte<br />
und Untersaaten von Ackerflächen<br />
kein „Landschaftspflegematerial“ im Sinne<br />
von Anlage 3 Nummer 5 der Biomasseverordnung aus<br />
2012 (BiomasseV 2012) sind. Diese Definition von<br />
Landschaftspflegematerial wurde für die Biomassevergütung<br />
des EEG 2012 geschaffen. Seit dem Inkrafttreten<br />
des EEG 2014 gilt sie aber auch für den sogenannten<br />
Landschaftspflege-Bonus des EEG 2009.<br />
Der Wortlaut der Definition ist zwar nicht eindeutig, da<br />
er mehrere konkretisierungsbedürftige Begriffe enthält:<br />
So gelten als Landschaftspflegematerial<br />
„alle Materialien, die bei Maßnahmen anfallen,<br />
die vorrangig und überwiegend den Zielen des<br />
Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne<br />
des Bundesnaturschutzgesetzes dienen und nicht<br />
gezielt angebaut wurden. Marktfrüchte wie Mais,<br />
Raps oder Getreide sowie Grünschnitt aus der<br />
privaten oder öffentlichen Garten- und Parkpflege<br />
oder aus Straßenbegleitgrün, Grünschnitt<br />
von Flughafengrünland und Abstandsflächen in<br />
Industrie- und Gewerbegebieten zählen nicht als<br />
Landschaftspflegematerial. Als Landschaftspflegegras<br />
gilt nur Grünschnitt von maximal zweischürigem<br />
Grünland.“<br />
Der Vergleich mit den übrigen Kategorien der BiomasseV<br />
2012 bestätigt jedoch, dass der Gesetzgeber<br />
den Anbau von Zwischenfrüchten und Untersaaten<br />
zur Gründüngung und Winterbegrünung von Ackerflächen,<br />
auf denen im Übrigen Marktfrüchte angebaut<br />
werden, eher der guten fachlichen Praxis im Ackerbau<br />
zugeordnet hat und nicht „überwiegend und vorrangig“<br />
dem Naturschutz und der Landschaftspflege im<br />
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes beziehungsweise<br />
der Kategorie „Landschaftspflegematerial“ der<br />
Biomasseverordnung aus 2012. Beispielsweise sind<br />
„Ackerrandstreifen“, „Kleegras und Luzernegras als<br />
Zwischenfrüchte von Ackerstandorten“ oder „Grünroggen“<br />
ausdrücklich in anderen Kategorien als das Landschaftspflegematerial<br />
aufgeführt. Ähnliches ergibt sich<br />
teils auch aus der Definition selber, derzufolge zum<br />
Beispiel nur Gräser von maximal zweischürigem Grünland,<br />
nicht aber Gräser von Ackerflächen Landschaftspflegematerial<br />
sind.<br />
Zudem sollte die BiomasseV 2012 den im EEG 2009<br />
umstrittenen Begriff des Landschaftspflegematerials<br />
ausdrücklich enger fassen und hierbei Marktfrüchte<br />
wie Mais ausschließen, auch wenn sie unter Beachtung<br />
beispielsweise von Agrarumweltprogrammen angebaut<br />
werden. Dies legt nahe, dass auch Pflanzen, die den<br />
Anbau von Marktfrüchten auf Ackerflächen natur- und<br />
umweltfreundlicher gestalten, kein Landschaftspflegematerial<br />
im Sinne der BiomasseV 2012 sein sollten.<br />
Votum zu Meldeverstößen und<br />
Einsatzstoff-Tagebuch<br />
Im Votum 2018/36 (abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2018/36)<br />
war zu klären,<br />
ob im konkreten Einzelfall das Einsatzstoff-Tagebuch<br />
bis zum 28. Februar vorzulegen war, damit die abgemilderte<br />
Sanktion in § 52 Absatz 3 Nummer 1 EEG 2017<br />
anwendbar ist.<br />
Dies hat die Clearingstelle verneint. Denn das Einsatzstoff-Tagebuch<br />
war im konkreten Fall kein für die Endabrechnung<br />
erforderliches Datum im Sinne des § 71<br />
Nummer 1 EEG 2017. Somit lag kein Doppelverstoß<br />
vor (zum „Doppelverstoß“ vgl. Clearingstelle, Hinweis<br />
v. 09.05.2018 – 2018/4, abrufbar unter https://www.<br />
clearingstelle-eeg-kwkg.de/hinwv/2018/4, Randnummer<br />
28 ff.), und daher war die Vergütung nur um 20<br />
Prozent zu verringern.<br />
Was war passiert? Der Anlagenbetreiber nahm die Biogasanlage<br />
im Dezember 2014 im Beisein des Netzbetreibers<br />
in Betrieb. Es handelte sich um eine kleine<br />
Gülleanlage mit einer installierten Leistung von 75 kW,<br />
in der mindestens 80 Masseprozent Gülle eingesetzt<br />
werden. Hierzu meldete der Anlagenbetreiber dem<br />
Netzbetreiber die eingesetzten Stoffe und die Vergü-<br />
98
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Recht<br />
tungsklasse. Der Netzbetreiber war Messstellenbetreiber.<br />
Bis zum 28. Februar 2015 lagen dem Netzbetreiber<br />
alle relevanten Daten für die Endabrechnung vor.<br />
Nur der Nachweis durch das Einsatzstoff-Tagebuch<br />
über die eingesetzten Stoffe wurde erst im April 2015<br />
geführt. Zudem wurde die Anlage erst im März 2015<br />
an das Register gemeldet. Die Parteien stritten über die<br />
Höhe der Verringerung des Zahlungsanspruchs.<br />
Entscheidung: Der Vergütungsanspruch des Anlagenbetreibers<br />
war wegen fehlender Registermeldung nicht<br />
auf null, sondern nur um 20 Prozent zu verringern. Diese<br />
abgemilderte Sanktion aus § 52 Absatz 3 Nummer 1<br />
EEG 2017 war anwendbar, weil die Kalenderjahresmeldung<br />
rechtzeitig erfolgt war. Denn dem Netzbetreiber<br />
waren die für die Kalenderjahresabrechnung erforderlichen<br />
Daten gemäß § 71 Nummer 1 EEG 2017 – insbesondere<br />
das Inbetriebnahmedatum, die Anlagenleistung,<br />
die eingespeiste Strommenge und auch die<br />
Einsatzstoffe beziehungsweise der (Mindest-)Umfang<br />
der eingesetzten Gülle – bekannt. Auf die Nachweisführung<br />
durch die Vorlage des Einsatzstoff-Tagebuchs<br />
kam es daher für die Vergütungshöhe im konkreten Fall<br />
nicht mehr an.<br />
Anlagenbetreiber sollten jedoch beachten, dass der<br />
Netzbetreiber die Biomasse-Vergütung (in voller oder<br />
verringerter Höhe) erst ab dem Zeitpunkt auszahlen<br />
kann, ab dem das Einsatzstoff-Tagebuch vorgelegt wird<br />
(§ 44c Absatz 1 EEG 2017). Bei Anlagen, die flüssige<br />
Biomasse einsetzen, gelten zudem besondere Sanktionen,<br />
wenn das Einsatzstoff-Tagebuch nicht vorgelegt<br />
wird (§ 44c Absatz 3 EEG 2017).<br />
Autorinnen<br />
Beatrice Brunner und Elena Richter<br />
Mitglieder der Clearingstelle EEG|KWKG<br />
Charlottenstr. 65 · 10117 Berlin<br />
030/206 14 16-0<br />
post@clearingstelle-eeg-kwkg.de<br />
IHR PLUS AN<br />
ERFAHRUNG.<br />
Individuelle Beratung und umfassende<br />
Absicherung für Ihre Photovoltaikanlagen.<br />
R+V-Privatkundenbetreuer Kevin Blohm berät Frau Starck-Bähr bei<br />
der Absicherung ihrer Photovoltaikanlage.<br />
Weitere Informationen erhalten Sie unter 0611 533 98751 oder<br />
auf www.kompetenzzentrumEE.de<br />
99
Produktnews<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Neues MWM Gasaggregat TCG 3020 V20<br />
Caterpillar Energy Solutions hat am Jahresanfang<br />
sein neues Gasaggregat MWM<br />
TCG 3020 V20 vorgestellt. Es zeichnet<br />
sich durch mehr Leistung und einen reduzierten<br />
Ölverbrauch aus. Zudem verfügt es<br />
über einen elektrischen Wirkungsgrad von<br />
bis zu 45 Prozent. Die Kombination aus<br />
sehr hoher Effizienz, Zuverlässigkeit und<br />
Leistungsfähigkeit macht den TCG 3020<br />
V20 zum Allround-Talent unter den Gasmotoren.<br />
Dank seines kompakten Designs erreicht<br />
das neue MWM Gasaggregat TCG 3020<br />
V20 mit einer Leistung von 2.300 Kilowatt<br />
(kW el<br />
) eine bis zu 15 Prozent höhere<br />
Ausgangsleistung als sein Vorgängermodell.<br />
Dabei besticht es nicht nur durch<br />
einen stark reduzierten Ölverbrauch von<br />
0,15 Gramm pro Kilowattstunde elektrische<br />
Leistung bei hohen Wirkungsgraden,<br />
sondern gleichzeitig durch geringere Wartungs-<br />
und Installationskosten.<br />
Der TCG 3020 V20 ist für Anwendungsbereiche<br />
mit Erdgas, Biogas, Deponie- und<br />
Propangas flexibel einsetzbar. Mit bis zu<br />
45 Prozent bei Erdgas- und 43,6 Prozent<br />
bei Biogas-Anwendungen bietet das neue<br />
MWM Stromaggregat beste elektrische Wirkungsgrade.<br />
Der Gesamtwirkungsgrad liegt<br />
im Erdgasbetrieb bei mehr als 87 Prozent.<br />
Durch die selbstentwickelte digitale Kraftwerkssteuerung<br />
TPEM (Total Plant & Energy<br />
Management) werden alle Daten zur<br />
Steuerung von Aggregat und Anlage in einem<br />
System zusammengefasst.<br />
Kontakt: Caterpillar Energy Solutions GmbH<br />
Carl-Benz-Str. 1, 68167 Mannheim<br />
Tel. 0621/384-0, info@mwm.net<br />
www.caterpillar-energy-solutions.de<br />
Foto: Caterpillar<br />
ALGEACELL: Prozessoptimierung mit der Kraft der Algen<br />
Neue 3-in-1-Biogassonde<br />
Vaisala, ein weltweit führender Anbieter von<br />
Umwelt- und Industriemessungen, präsentierte<br />
am Jahresanfang die weltweit erste<br />
3-in-1-Sonde für In-Situ-Biogasmessungen.<br />
Die einzigartige Multigas-Messsonde Vaisala<br />
MGP261 misst kontinuierlich Methan, Kohlendioxid<br />
und Feuchte direkt in der Prozessleitung<br />
der Biogasanlage. Die Sonde ist optimiert<br />
für Biogasproduktionsprozesse wie die<br />
anaeroben Vergärung von Abfällen aus der<br />
Landwirtschaft, der Industrie und von Kommunen<br />
sowie für die Nutzung von Deponiegas.<br />
MGP261 basiert auf der patentierten<br />
Vaisala CARBOCAP-Sensortechnologie, die<br />
im Laufe der 20-jährigen Erfolgsgeschichte<br />
des Unternehmens mit Infrarot-Gasmessungen<br />
entwickelt wurde.<br />
Schaumann BioEnergy nutzt bereits seit<br />
Jahren die positiven Eigenschaften der<br />
Braunalge zur Prozessoptimierung in<br />
Biogasanlagen. Mittels einer neuartigen<br />
Aufschlusstechnologie ist es gelungen,<br />
Rohalgen noch schonender und effizienter<br />
aufzuschließen, sodass nicht nur die Alginate<br />
in optimaler Form vorliegen, sondern<br />
auch noch weitere in der Alge enthaltene<br />
Wirkstoffe zur Verfügung stehen (z. B. Phytohormone<br />
und Laminarin).<br />
Das erweiterte Wirkspektrum von ALGE-<br />
ACELL ist bereits durch zahlreiche Laborergebnisse<br />
und Versuche im Technikum sowie<br />
in Feldtests belegt. Besonders Anlagen mit<br />
einem hohen Anteil an Wirtschaftsdüngern<br />
und unvollständigem Abbau aufgrund erhöhter<br />
Stickstoffgehalte oder kurzer Verweildauer<br />
erreichen durch den Einsatz von<br />
ALGEACELL eine signifikante Zunahme der<br />
Biogasproduktion.<br />
Gerade in futterknappen Zeiten bietet das<br />
neue Produkt die Möglichkeit, mehr Energie<br />
aus den verfügbaren Substraten herauszuholen<br />
und gleichzeitig den Anteil an Wirtschaftsdüngern<br />
im Substratmix zu erhöhen.<br />
Kontakt: Schaumann BioEnergy GmbH<br />
An der Mühlenau 4, 25421 Pinneberg<br />
Tel. 04101/218-5400, info@schaumann-bioenergy.eu<br />
www.schaumann-bioenergy.eu<br />
Die neue Sonde liefert Echtzeitmesswerte<br />
der Gaszusammensetzung ohne Probenahme<br />
oder -behandlung. Mit ihrer präzisen<br />
und stabilen Methanmessung unterstützt<br />
die kompakte und zuverlässige Sonde Betreiber<br />
von Biogasanlagen dabei, eine umfassende<br />
Kontrolle über ihren Prozess zu<br />
erlangen und die Leistung des Blockheizkraftwerks<br />
(BHKW) zu optimieren. Mit der<br />
MGP261 können die Anwender zudem die<br />
Feuchte kontrollieren, um den Verschleiß<br />
der BHKW-Motoren und Prozesskomponenten<br />
zu reduzieren.<br />
Die benutzer- und installationsfreundliche<br />
MGP261-Sonde kann in jedes bestehende<br />
System integriert werden. Die In-Line-Installation<br />
macht eine Probenahme und -behandlung<br />
überflüssig und ermöglicht Messungen<br />
ohne Entnahmeleitungen, Pumpen<br />
oder Entfeuchtersysteme. Die Sonde ist bis<br />
Ex-Zone 0 innerhalb von Rohrleitungen und<br />
bis Ex-Zone 1 außerhalb von Rohrleitungen<br />
zertifiziert.<br />
Kontakt: www.vaisala.com<br />
Foto: Vaisala Foto: Schaumann BioEnergy GmbH<br />
100
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
Produktnews<br />
Rechtsanwälte und Notare<br />
Seit vielen Jahren beraten und vertreten wir vornehmlich<br />
Betreiber und Planer kompetent und umfassend im<br />
- Recht der Erneuerbaren<br />
- Energien<br />
- Vertragsrecht<br />
- Gewährleistungsrecht<br />
- Energiewirtschaftsrecht<br />
- Umweltrecht<br />
- Immissionsschutzrecht<br />
- öffentlichen Baurecht<br />
- Planungsrecht<br />
Kastanienweg 9, D-59555 Lippstadt<br />
Tel.: 02941/97000 Fax: 02941/970050<br />
Ihre Ansprechpartner:<br />
RAuN Franz-Josef Tigges*<br />
RAuN Andreas Schäfermeier**<br />
RA W. Andreas Lahme*<br />
RA Dr. Oliver Frank*<br />
RA Martina Beese<br />
RA Dr. Mathias Schäferhoff<br />
RA Daniel Birkhölzer*<br />
RAuN Katharina Vieweg-Puschmann LL.M.<br />
Maîtrise en droit<br />
* Fachanwalt für Verwaltungsrecht<br />
** Fachanwalt für Insolvenzrecht<br />
kanzlei@engemann-und-partner.de<br />
www.engemann-und-partner.de<br />
Abgaskatalysatoren<br />
Für alle in Deutschland zugelassenen BHKWs<br />
Zur Einhaltung der neuen Abgasnorm von<br />
< 20mg Formaldehyd mit 120 mm Kat<br />
Zu sehr günstigen Preisen (netto inkl. Fracht)<br />
z.B. MAN bis 210 kW für 1.199 €<br />
Fordern Sie Ihr konkretes Angebot an unter<br />
www.ilmaco-vertrieb.de<br />
ILMACO Vertrieb oHG mb@ilmaco.de<br />
Fischerstr. 13 · 84137 Vilsbiburg · (0176) 476 494 69<br />
ÜBERWACHUNG VON BIOGAS-ANLAGEN<br />
Biogas 401<br />
Mehrkanal-Gasanalysator<br />
Biogas 905<br />
Mehrkanal-Gasanalysator<br />
SENSOREN<br />
Die beiden Gas-Analysatoren Biogas 401<br />
und Biogas 905 über wachen kontinuierlich<br />
oder dis kon ti nuierlich die Qualität des<br />
Biogases auf die Gaskompo nenten hin.<br />
Optional warnen zusätzliche Umgebungsluft-Sensoren<br />
frühzeitig vor gesundheitsge<br />
fähr denden, explo sions fähigen und<br />
nichtbrenn baren Gasen und Dämpfen.<br />
❯❯❯ Biogas Know-how seit 2001 ❮❮❮<br />
EINSATZBEREICHE:<br />
■ Biogas-Produktionsanlagen<br />
■ Kläranlagen<br />
■ Deponien<br />
GTR 210 IR<br />
CH 4 + CO 2<br />
TOX 592<br />
O 2 + H 2 S<br />
Trierer Str. 23 – 25 · 52078 Aachen<br />
Tel. (02 41) 97 69-0 · www.ados.de<br />
s e i t 1 9 0 0<br />
101
IMPRESSUM<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2019</strong><br />
IMPRESSUM<br />
BIOGASBEHÄLTER – Fermenter, Gärrestlager, Vorgruben, ...<br />
WOLF SYSTEM GMBH | Am Stadtwald 20 | 94486 Osterhofen<br />
09932 37-0 | mail@wolfsystem.de | WWW.WOLFSYSTEM.DE<br />
Bauen mit System!<br />
Abgaskatalysatoren<br />
Für alle in Deutschland zugelassenen BHKWs<br />
Hohe Lebensdauer durch hervorragende<br />
Schwefelresistenz. In Deutschland gefertigt<br />
Zu sehr günstigen Preisen (netto inkl. Fracht)<br />
Schnell bis 265 kW ab 2.990 €<br />
Fordern Sie Ihr konkretes Angebot an unter<br />
www.ilmaco-vertrieb.de<br />
ILMACO Vertrieb oHG mb@ilmaco.de<br />
Fischerstr. 13 · 84137 Vilsbiburg · (0176) 476 494 69<br />
Herausgeber:<br />
Fachverband Biogas e. V.<br />
Dr. Claudius da Costa Gomez (V.i.S.d.P.)<br />
Andrea Horbelt (redaktionelle Mitarbeit)<br />
Angerbrunnenstraße 12 · 85356 Freising<br />
Tel. 0 81 61/98 46 60<br />
Fax: 0 81 61/98 46 70<br />
E-Mail: info@biogas.org<br />
Internet: www.biogas.org<br />
ISSN 1619-8913<br />
Redaktion:<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Fachverband Biogas e. V.<br />
Tel. 0 54 09/9 06 94 26<br />
E-Mail: martin.bensmann@biogas.org<br />
Anzeigenverwaltung & Layout:<br />
bigbenreklamebureau GmbH<br />
An der Surheide 29 · 28870 Ottersberg-Fischerhude<br />
Tel. 0 42 93/890 89-0<br />
Fax: 0 42 93/890 89-29<br />
E-Mail: info@bb-rb.de<br />
Internet: www.bb-rb.de<br />
Franz Eisele u. Söhne GmbH & Co. KG<br />
www.eisele.de<br />
Druck: Druckhaus Fromm, Osnabrück<br />
Das BIOGAS Journal erscheint sechsmal im Jahr auf Deutsch.<br />
Zusätzlich erscheinen zwei Ausgaben in englischer Sprache.<br />
Pumpen & Rührwerke<br />
Hauptstrasse 2-4 72488 Sigmaringen Tel.: +49 (0)7571 / 109-0 info@eisele.de<br />
Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich<br />
geschützt. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben<br />
die Meinung des Verfassers wieder, die nicht unbedingt mit der<br />
Position des Fachverbandes Biogas e.V. übereinstimmen muss.<br />
Nachdruck, Aufnahme in Datenbanken, Onlinedienste und Internet,<br />
Vervielfältigungen auf Datenträgern wie CD-Rom nur nach vorheriger<br />
schriftlicher Zustimmung. Bei Einsendungen an die Redaktion<br />
wird das Einverständnis zur vollen oder auszugsweisen Veröffentlichung<br />
vorausgesetzt. Für unverlangt eingehende Einsendungen<br />
wird keine Haftung übernommen. Die Redaktion behält sich vor,<br />
Leserbriefe sinnerhaltend zu kürzen.<br />
102
Einfach eine<br />
runde Sache!<br />
Sehr gute Löslichkeit, auch<br />
bei hohen TS-Gehalten und<br />
Trockenfermentation<br />
Hocheffiziente Spurenelemente<br />
mit höchster biologischer<br />
Verfügbarkeit<br />
Keine versteckten Gefahren wie<br />
Stäube oder versehentlich<br />
angerissene Säcke<br />
Transparente Zusammensetzung<br />
und Anpassung<br />
Schutz vor Ausfällung durch<br />
Schwefel<br />
fermentierbare Folie, staubfrei<br />
Einfache, CO2-freundliche<br />
Lieferung per Paketdienst,<br />
keine Palettierung mehr<br />
TEC<br />
INNOVATIVE TECHNIK DURCH KOMPETENZ<br />
GE2-3<br />
DENSO®-Industriezündkerze<br />
Die neue DENSO®-Zündkerze GE2-3 wurde speziell für den<br />
Einsatz auf modernsten Motoranwendungen entwickelt und<br />
ist mit ihrer einzigartigen Iridiumlegierung auf Mittel- und<br />
Masseelektrode bestens für den Betrieb mit Erd- und Sondergasen<br />
geeignet.<br />
Die neugestaltete, verlängerte Masseelektrode mit Kupferkern<br />
ermöglicht eine verbesserte Wärmeabfuhr und reduziert den<br />
Verschleiß des Basismaterials der Elektrode, was zu einer<br />
erhöhten elektrischen und mechanischen Belastbarkeit und<br />
Lebensdauer führt. Das längere Isolator-Design bietet zudem<br />
besten Schutz gegen Funkenüberschläge.<br />
Längeres Isolator-Design für besten Schutz vor<br />
Funkenüberschlag<br />
Unterdrückung elektromagnetischer Beeinflussung (EMB)<br />
Die Masseelektrode mit Kupferkern erhöht die elektrische<br />
und mechanische Belastbarkeit<br />
J-Typ-Elektrode für verbesserte Verbrennung<br />
Höchste Beständigkeit gegen Funkenerosion<br />
Nutzen Sie das Potential Ihrer Grassilage voll aus !<br />
GRAS<br />
Zusammensetzung<br />
Grassilage nach DLG<br />
Cellulose 24,0 %<br />
Hemicellulose 18,2 %<br />
Lignin 5,3 %<br />
Zucker 3,2 %<br />
Protein 15,5 %<br />
Fett 3,9 %<br />
Sonstiges 29,9 %<br />
Maximierung des Gras-Anteils im Substratmix<br />
Verbesserte Substartausnutzung<br />
Vermeidung von Schwimm- und Sinkschichten<br />
Verbesserung der Fließfähigkeit<br />
Reduzierter Verschleiß an der Technik<br />
Verringerung des Eigenstrombedarfs<br />
Einsparung von Substraten und Gärrest<br />
Mehr Flexibilität im Substratmanagement<br />
Stabiler Anlagenbetrieb<br />
GMO-frei<br />
SaM-Power GmbH<br />
Schmiedestraße 9 · 27419 Sittensen - Lengenbostel<br />
Fon: (0 42 82) 6 34 99 - 0 · Fax: (0 42 82) 6 34 99 - 19<br />
103<br />
Mail: info@sam-power.de · www.sam-power.de
Unser „Full Service Paket“ für<br />
Ihren Emissionsminderungsbonus<br />
Unser neues „Full Service Paket - Emissionsminderungsbonus“*<br />
reduziert Ihren Aufwand und bietet Ihnen folgende Vorteile:<br />
• Vorbereitende Überprüfung zur Reduzierung der Rohemissionen<br />
(Ölwechselservice, Vorabmessung mittels Formaldehyd-Schnelltester,<br />
Einstellung der Motoren zum Messtermin)<br />
• Einbau des neuen optimierten und wartungsfähigen Formaldehydkatalysators<br />
(Art.-Nr.: 1-065-295) der Firma TEDOM SCHNELL GmbH zur<br />
garantierten Einhaltung des Emissionsgrenzwertes von unter<br />
20 mg/Nm³ Formaldehyd<br />
• Emissionsmessung durch ein akkreditiertes Messinstitut<br />
Sprechen Sie uns an!<br />
Integrierter Strömungsverteiler<br />
für bessere Anströmung<br />
und längere Standzeiten<br />
Ausführung als Wechselsystem<br />
erleichtert die Reinigung und<br />
den Tausch des Katalysators<br />
* Angebot nur innerhalb Deutschland buchbar bis zum 31.12.<strong>2019</strong>. Nur solange Messtermine verfügbar sind.<br />
TEDOM SCHNELL GmbH<br />
Felix-Wankel-Straße 1<br />
D-88239 Wangen im Allgäu<br />
Servicestützpunkt<br />
Alte Celler Heerstr. 1 • D-31637 Rodewald<br />
Telefon: +49 5074 9618-0 • Fax: +49 5074 9618-201<br />
E-Mail: info@tedom-schnell.de<br />
www.tedom-schnell.de