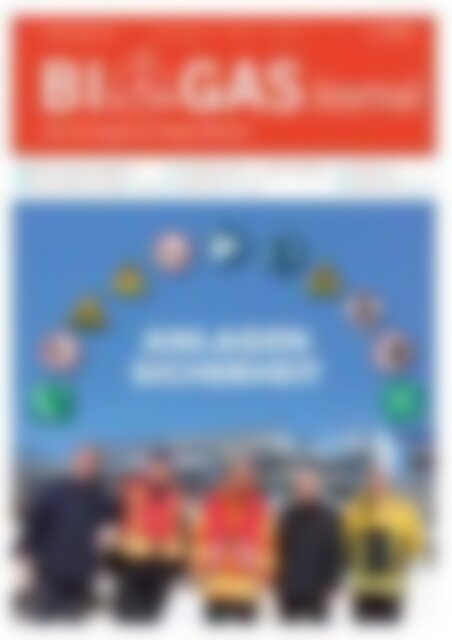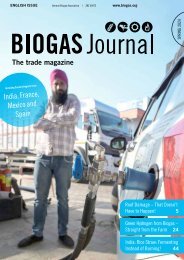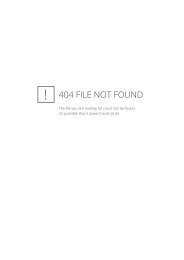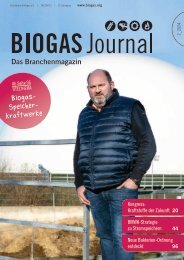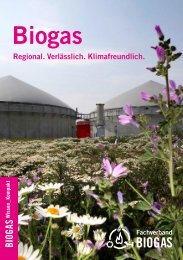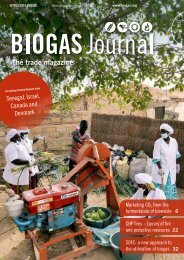2_2019 Leseprobe
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
www.biogas.org Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 50073 | 22. Jahrgang<br />
2_<strong>2019</strong><br />
Bi<br />
GaS Journal<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche<br />
Biomassepreisvergleich:<br />
Dürre 2018 mit Folgen S. 40<br />
Strohaufschluss: „Light Cooking“<br />
überrascht S. 56<br />
Argentinien:<br />
Reisebericht S. 74<br />
Anlagen<br />
sicherheit
Inhalt<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Alles aus einer Hand -<br />
Ihren Anforderungen entsprechend!<br />
Adsorber<br />
Produktion<br />
Flachbett- &<br />
Schüttbettadsorber<br />
auf Basis<br />
nachwachsender<br />
Rohstoffe<br />
Kunststoff &<br />
Edelstahl<br />
Aktivkohle-Wechsel<br />
kurze<br />
Reaktionszeit<br />
Entsorgung<br />
inkl. Nachweis<br />
kurze Lieferzeiten<br />
flexible<br />
Liefermengen<br />
Logistik<br />
Auslegung inkl.<br />
Standzeitberechnung<br />
Optimierungsberatung<br />
Qualitätskontrolle<br />
Service<br />
Labor<br />
Beladungsuntersuchung<br />
Natürlich besser!<br />
• Dotierte Aktivkohle<br />
zur Entschwefelung &<br />
Reinigung von technischen<br />
Gasen<br />
• entfernt zusätzlich in<br />
einem Schritt Siloxane,<br />
VOC´s und Mercaptane<br />
• hergestellt in Deutschland<br />
• lange Standzeiten, weniger<br />
Wechsel<br />
Sparen Sie Kohle und sichern Sie sich ihr Angebot!<br />
AdFiS products GmbH<br />
Am Kellerholz 14<br />
2<br />
D-17166 Teterow<br />
Telefon: +49 (0) 3996 15 97-0<br />
Fax: +49 (0) 3996 15 97-99<br />
E-Mail: sales@adfis.de<br />
web: www.adfis.de
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Editorial<br />
Deckel weg,<br />
Bremsen lösen,<br />
Gas geben!<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
wir stehen im Jahr <strong>2019</strong> vor entscheidenden energiepolitischen<br />
Weichenstellungen. Der erste wichtige Meilenstein,<br />
der erreicht wurde, ist der gefundene Kompromiss<br />
der Kommission für Wachstum, Strukturwandel<br />
und Beschäftigung (kurz: Kohlekommission) zur Beendigung<br />
der Kohleverstromung in Deutschland. Es ist ein<br />
breiter Konsens, da sehr viele Gruppierungen aus der<br />
Gesellschaft diesen Kompromiss gemeinsam erarbeitet<br />
haben.<br />
Die Bundesregierung ist nun am Zug. Sie muss die formulierten<br />
Ziele – so auch das 65-Prozent-Ziel für Erneuerbare<br />
Energien in der Stromversorgung bis 2030 – mit<br />
einem entsprechenden Rechtsrahmen so ausgestalten,<br />
dass die Arbeit der Kommission nicht vergebens war.<br />
Ein Verwässern oder Aufweichen oder gar ein Verschleppen<br />
in der Umsetzung der Ziele ist nicht akzeptabel.<br />
Im Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung ist<br />
festgeschrieben, dass es in diesem Jahr ein Klimaschutzgesetz<br />
für Deutschland geben soll. Mitte Februar<br />
haben sich allerdings CDU und CSU gegen einen von<br />
Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) präsentierten<br />
Gesetzesvorschlag positioniert. Streit in der<br />
Koalition ist vorprogrammiert. Dabei stellt das geplante<br />
Gesetz eine Möglichkeit dar, die Ziele der Kohlekommission<br />
sowie die Pariser Klimaziele festzuzurren. Es<br />
sollte eine Art Fahrplan darstellen für den Transformationsprozess,<br />
an dessen Ende unsere Energieversorgung<br />
ohne fossilen CO 2<br />
-Ausstoß in allen Sektoren Realität ist.<br />
Was aber bedeutet das 65-Prozent-Ziel eigentlich? Im<br />
nächsten Jahr werden die Erneuerbaren Energien vielleicht<br />
40 Prozent des deutschen Stromverbrauchs decken.<br />
Es muss also ein Anteil von 25 Prozent dazukommen.<br />
Das heißt, wir brauchen erheblich mehr Wind-,<br />
Solar- und Bioenergie. Die Bundesregierung muss,<br />
wenn sie das Ziel selbst ernst nimmt, alle Ausbaubremsen<br />
lösen und alle Zubaudeckel abschaffen. Nur so ist<br />
es in den nächsten zehn Jahren zu schaffen. Denn eins<br />
ist klar: Wir brauchen auch mehr Strom für die Mobilität<br />
und den Wärmesektor. Die Erneuerbare-Energien-Branche<br />
hat vor der Umsetzung keine Angst. Sie ist schon<br />
lange bereit, anzupacken und die Transformation der<br />
Energieerzeugung voranzutreiben.<br />
Die zweite wichtige energiepolitische Aufgabe der Bundesregierung<br />
in diesem Jahr ist die nationale Umsetzung<br />
der überarbeiteten Erneuerbare-Energien-Richtlinie<br />
der EU-Kommission (RED II). In der Richtlinie<br />
werden fortschrittliche Kraftstoffe wie Methan aus der<br />
Wirtschaftsdünger-Vergärung besonders positiv bewertet.<br />
Der Kraftstoff Gas bekommt eine hohe CO 2<br />
-Anrechnung.<br />
Wenn die Politik diesen Ansatz zügig umsetzt,<br />
dann erfahren wir einen deutlichen Wechsel weg von<br />
der Vergärung von Anbaubiomasse hin zur Wirtschaftsdünger-Vergärung.<br />
Ein wichtiger Effekt dabei ist, dass die deutsche Landwirtschaft<br />
durch die vollständige Vergärung von Mist<br />
und Gülle sage und schreibe 6 Millionen Tonnen CO 2<br />
pro Jahr einsparen kann. Die gleiche Menge wird noch<br />
einmal eingespart, weil Gaskraftstoff fossile Energieträger<br />
substituiert. Dazu müssen wir aber dringend neue<br />
Biogasanlagen bauen und Bestandsanlagen ermöglichen,<br />
auch auf diesen Weg einzuschwenken.<br />
Steter Wandel ist gewiss und ein Sprichwort sagt: Wer<br />
nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Die Biogasbranche<br />
ist bereit, den Wandel mitzugestalten und<br />
sich anzupassen. Auch an die neuen Sicherheitsvorschriften,<br />
wie sie in diesem Biogas Journal im Themenschwerpunkt<br />
dargestellt werden. Wir wünschen uns<br />
allerdings faire Bedingungen und tragfähige Perspektiven,<br />
die uns langfristig Biogas produzieren lassen.<br />
Herzlichst Ihr<br />
Horst Seide,<br />
Präsident des Fachverbandes Biogas e.V.<br />
3
Inhalt<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
!<br />
Editorial<br />
3 Deckel weg, Bremsen lösen, Gas geben!<br />
Von Horst Seide, Präsident, des<br />
Fachverbandes Biogas e.V.<br />
AKTUELLES<br />
6 Meldungen<br />
8 Bücher & Termine<br />
10 Biogas-Kids<br />
12 Biomethan: Der Kraftstoffmarkt<br />
bietet Perspektiven<br />
Von Thomas Gaul<br />
14 „Klimaschutz ist eine Chance, Wohlstand<br />
und Wachstum zu sichern“<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
POLITIK<br />
18 Noch 20 Jahre Kohlestrom<br />
Von Bernward Janzing<br />
Titelthema<br />
22 Sicherheit ernst nehmen!<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH)<br />
Manuel Maciejczyk<br />
28 Erste Bewertung der<br />
„Technischen Regel Anlagensicherheit<br />
– TRAS 120“<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH)<br />
Manuel Maciejczyk<br />
32 Rechtliche Anforderungen an<br />
die sichere Instandhaltung<br />
Von Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)<br />
Marion Wiesheu<br />
36 Interview<br />
Auf die Fachbetriebspflicht<br />
achten!<br />
Interviewerin:<br />
Dipl.-Ing. agr. Steffi Kleeberg<br />
PRAXIS<br />
40 2018er Dürre wirkt preistreibend<br />
Von Dr. Stefan Rauh<br />
44 Phosphorrecycling aus Abwasser<br />
Von Dierk Jensen<br />
47 Mischpreisverfahren – und jetzt?<br />
50 Neue Herausforderungen beim<br />
Nährstoffmanagement<br />
Von Thomas Gaul<br />
54 Die Energielandwerker – starker<br />
Partner der Anlagenbetreiber<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
4
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Inhalt<br />
titelFoto: Christa Maier i Fotos: Andreas Dittmer, Carmen Rudolph, Dr. Reinhold Siede<br />
62 66<br />
WISSENSCHAFT<br />
56 Die thermische Vorbehandlung<br />
(Desintegration) von Stroh –<br />
Einweichen oder „kochen“?<br />
Von Dipl. Des. (FH) Rainer Casaretto<br />
und M. Eng. (FH) René Casaretto<br />
62 Saubere Kraftstoffe aus<br />
schmutzigem Wasser<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
66 Biene und Biogas<br />
Aufwertung von Biogasfruchtfolgen<br />
mit Sorghum-Dualtypen<br />
Von Dr. Reinhold Siede, Björn Staub<br />
und Dr. Steffen Windpassinger<br />
70 Neues Gerät zur Online-Überwachung<br />
des FOS/TAC-Wertes ermöglicht<br />
repräsentative Probenentnahme<br />
Von M. Sc. Camilo Wilches, B. Eng. Maik<br />
Vaske, Prof. Dr. Kilian Hartmann<br />
und Prof. Dr. Michael Nelles<br />
INTERNATIONAL<br />
Argentinien<br />
74 Argentinien will 20 Prozent<br />
Erneuerbare bis 2025<br />
Von Giannina Bontempo<br />
VERBAND<br />
Aus der Geschäftsstelle<br />
76 <strong>2019</strong> mit hoher Taktung<br />
Von Dr. Stefan Rauh und<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
80 Aus den Regionalgruppen<br />
84 Aus den Regionalbüros<br />
86 Erderhitzung stoppen, jedes Jahr zählt!<br />
Von Dr. Simone Peter, BEE<br />
88 Wo die Gülle die Hauptrolle spielt<br />
Von Bernward Janzing<br />
90 Triesdorfer Biogastag<br />
Biogasanlagen – Spielball des EEG?<br />
Von Annette Schmid<br />
RECHT<br />
92 Umsatzsteuer aktuell im Biogasbereich<br />
Von Annette Sieckmann<br />
96 Güllekleinanlagen – Neuregelungen<br />
ab Dezember <strong>2019</strong>!<br />
Von René Walter und Dr. Andrea Bauer<br />
102 Impressum<br />
Beilagenhinweis:<br />
Das Biogas Journal enthält Beilagen<br />
der Firmen agrikomp, HR-Energiemanagement<br />
und der Messe Offenburg.<br />
5
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Landesverband Erneuerbare<br />
Energien (LEE) Bayern gegründet<br />
München – Mit einer so großen Resonanz<br />
hatten die Organisatoren nicht gerechnet:<br />
Knapp 200 Teilnehmer waren der Einladung<br />
zur Gründungsversammlung der Landesvertretung<br />
Bayern des Bundesverbandes Erneuerbare<br />
Energie e.V. – kurz LEE Bayern –<br />
am 12. Februar in den Bayerischen<br />
Landtag gefolgt.<br />
Die unterschiedlichsten<br />
Vertreter aller beteiligten<br />
Sparten waren mit von der<br />
Partie: vom Betreiber einer<br />
Biogasanlage über den Hersteller<br />
von Solarmodulen<br />
bis hin zu Mitarbeitern der<br />
Stadtwerke München und<br />
der Green City Energy. Insgesamt<br />
neun Spartenverbände<br />
haben im Anschluss<br />
an die Redebeiträge die<br />
Gründungsurkunde unterschrieben.<br />
Raimund Kamm eröffnete als einer der<br />
Sprecher des LEE Bayern die Veranstaltung<br />
mit dem Hinweis, dass allein in der bayerischen<br />
Erneuerbare-Energien-(EE)Branche<br />
mehr Menschen beschäftigt seien als in der<br />
gesamten Kohleindustrie in Deutschland.<br />
Bis vor 200 Jahren seien die regenerativen<br />
Energien die einzige Energiequelle in Bayern<br />
gewesen – „und in 30 oder 40 Jahren<br />
werden wir wieder dort angelangt sein“, gab<br />
sich Kamm zuversichtlich.<br />
Hinweis in eigener Sache<br />
Im Biogas Journal 1_<strong>2019</strong> ist uns auf Seite 49<br />
ein Fehler unterlaufen. Auf der Seite oben rechts<br />
befindet sich ein Foto, zu dem die Bildunterschrift<br />
nicht korrekt ist. Dort wird zerkleinerte Biomasse<br />
mit Kunststoffteilen auf der flachen Hand gezeigt.<br />
In der Bildunterschrift heißt es, dass das<br />
Material so aussieht nach der Behandlung in der<br />
sogenannten Stainpress. Richtig ist aber: Das auf<br />
der flachen Hand gezeigte Material wurde von der<br />
Stainpress noch nicht behandelt, sondern muss<br />
erst noch durch die Maschine geschickt werden.<br />
Wir bitten dies zu entschuldigen!<br />
Man dürfe sich allerdings nicht der Illusion<br />
hingeben, dass dies ohne Veränderungen in<br />
der Landschaft möglich sei. Nichtsdestotrotz<br />
sei der Wandel notwendig und unumkehrbar.<br />
Und am Ende würden alle davon<br />
profitieren. Man müsse jetzt auf das richtige<br />
Pferd setzen – denn: „Wer im Jahr 1900<br />
in Pferdekutschen investiert hatte, war 15<br />
Jahre später arbeitslos.“ Mit diesem historischen<br />
Querverweis schloss Kamm seinen<br />
Vortrag.<br />
Die Präsidentin des Bayerischen Landtags,<br />
Ilse Aigner, begrüßte die Bündelung der<br />
einzelnen Kräfte der EE-Branche. Es sei gut<br />
und wichtig, wenn die Abgeordneten informiert<br />
würden. Im LEE könnten gemeinsame<br />
Interessen gemeinsam vertreten werden.<br />
Grundsätzlich sei sie ein Freund der Erneuerbaren.<br />
„Im Ziel sind wir uns meistens einig<br />
– nur auf dem Weg dorthin und bei der<br />
Umsetzung nicht immer“, erklärte Aigner<br />
und verwies darauf, dass der Landtag die<br />
Interessen aller Bürger vertreten müsse.<br />
Auch Staatsminister Hubert Aiwanger freute<br />
sich „sehr sehr stark“ über die Gründung<br />
des LEE und die damit einhergehenden<br />
spartenübergreifenden Ansprechpartner<br />
für sein Ministerium. Die Gründung sei<br />
„ein historisches Ereignis – und wurde<br />
höchste Zeit.“ In seiner engagierten Rede<br />
versprach er neuen Schwung für die bayerische<br />
Energiewende. „Es muss wieder an<br />
den Stammtischen über die Energiewende<br />
geredet werden“, forderte der Minister. „Wir<br />
müssen die Menschen mitnehmen und für<br />
die Sache begeistern.“ Nur im gesellschaftlichen<br />
Konsens könne die Wende gelingen.<br />
Dabei verwies Aiwanger auch auf die noch<br />
immer gültige und im Koalitionsvertrag<br />
festgeschriebene 10H-Regelung für Windräder<br />
im Freistaat. Es sei für einen Kommunalpolitiker<br />
schwer, Windräder in seiner<br />
Gemeinde zu verkaufen. „Wir müssen die<br />
Akzeptanz zurückgewinnen“, betonte der<br />
Politiker. Geredet sei genug – „jetzt müssen<br />
wir es endlich umsetzen.“ Applaus bekam<br />
Aiwanger für seine Kritik am Ausbau der<br />
Übertragungsnetze.<br />
„Die Energiewende soll und<br />
muss dezen tral sein, dann<br />
müssen wir auch nicht so<br />
viele teure Stromleitungen<br />
bauen.“ Damit der Umstieg<br />
auf die regenerativen Quellen<br />
klappt, sei die Politik<br />
nun gefordert: „Es braucht<br />
Klarheit für den Anwender,<br />
er muss wissen, was<br />
kommt“, unterstrich Aiwanger,<br />
„die Politik muss<br />
ehrlich an der Seite der EE-<br />
Branche stehen und Planungssicherheit<br />
geben.“<br />
Die Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare<br />
Energie e.V. (BEE) Simone Peter<br />
freute sich über die „vielen engagierten<br />
Menschen im Flächenland Bayern“. Ihre<br />
Betrachtung der Energiewende ging über<br />
die Grenzen des Freistaats hinaus: Mit dem<br />
Beschluss der Kohlekommission habe man<br />
nun zumindest einen Fahrplan, wenn auch<br />
mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner;<br />
aber immerhin seien alle mit im Boot. Peter<br />
geht davon aus, dass der Ausstieg aus der<br />
Kohle mit der nun einsetzenden Dynamik<br />
früher als 2038 erfolgen werde.<br />
Die erneuerbaren Potenziale seien vorhanden<br />
und ein Teil der Industrieentwicklung.<br />
„Klimaschutz passt und gehört zum Industriestandort<br />
Deutschland“, hob Peter hervor.<br />
Jetzt gehe es darum, Perspektiven zu<br />
schaffen, Prosumer zu unterstützen, den<br />
Ausbau der Verteilnetze voranzubringen.<br />
„Deutschland ist das Land der Tüftler, Denker<br />
und Ingenieure – mit diesen Menschen<br />
ist die Energiewende zu schaffen.“<br />
Foto: Lea Helm<br />
Autorin<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Andrea Horbelt<br />
Pressesprecherin<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
6
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Aktuelles<br />
Leserbrief<br />
Leserbrief<br />
Zum Artikel „Kleine Ursache – große Wirkung“ im Biogas Journal<br />
Ausgabe 1_<strong>2019</strong>, Seite 68 bis 70 erreichte uns folgende Zuschrift:<br />
Das Problem von Rührwerksdurchführungen unterhalb des Substratspiegels<br />
ist bekannt und ich freue mich, dass es endlich einmal thematisiert<br />
wurde. Nahezu alle Stab- und Paddelrührwerke sind davon betroffen,<br />
denn jede Öffnung unterhalb des Substratspiegels stellt eine potenzielle,<br />
ernstzunehmende Gefahr für die Umwelt dar. Mit regelmäßigen Kontrollen<br />
und planmäßigem Austausch von Dichtungen – entsprechend den<br />
Vorgaben der Hersteller – lässt sich das Risiko zwar reduzieren, jedoch<br />
nicht vollständig ausschließen. Denn ein ganz wesentliches Prinzip in der<br />
Konstruktionsmethodik wird dabei nicht beachtet: Die „Ausfallsicherheit“<br />
bzw. „Versagenssicherheit“. Dieses Prinzip wird in vielen technischen<br />
Bereichen angewendet. Man unterstellt einer Maschine oder Anlage<br />
systematisch Fehler und versucht, die zugehörigen Auswirkungen so<br />
ungefährlich wie möglich zu gestalten. Im übertragenen Sinn werden<br />
neben Bauteil- oder Energieausfall auch Bedienungsfehler betrachtet<br />
(zum Beispiel Nichteinhaltung der Wartungsintervalle).<br />
Ein Lösungsansatz ist die im Artikel erwähnte Bauteilredundanz (doppelte<br />
Abdichtung), wobei es in letzter Konsequenz natürlich auch hier zu<br />
Leckagen kommen kann. Das Vermeiden von Öffnungen unterhalb des<br />
Substratspiegels ist daher die mit Abstand sicherste Lösung des im Artikel<br />
beschriebenen Problems. An dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass<br />
die Wellendurchführung des auf Seite 68 dargestellten Rührwerkes den<br />
Anforderungen der „Ausfallsicherheit“ und „Versagenssicherheit“ zu 100<br />
Prozent entspricht.<br />
Das Großflügel-Langachsrührwerk „Biobull ® “ der Firma streisal GmbH<br />
ist mit einer berührungslosen und daher verschleißfreien Wellendichtung<br />
ausgestattet, die oberhalb des Substratspiegels durch die Behälterwand<br />
geführt wird. Auch die Wellendurchführung des „Biosubstrator ® “<br />
(Stabrührwerk der Firma streisal GmbH) ist nach dem gleichen Prinzip<br />
ausgeführt: Wandöffnung oberhalb des Substratspiegels und berührungslose,<br />
verschließfreie Dichtung mit Wasservorlage/-siphon.<br />
Das Problem von Leckagen mit teilweise dramatischen Umweltbeeinträchtigungen<br />
kann somit ausgeschlossen werden.<br />
Peter Starz, streisal GmbH<br />
Zum Artikel „Entschwefelung funktioniert – Kreislauf noch nicht“ im<br />
Biogas Journal Ausgabe 1_<strong>2019</strong>, Seite 62 bis 66 erreichte uns folgende<br />
Zuschrift:<br />
In dem Fachbeitrag wird unter anderem das problematische Thema<br />
Selbstentzündung beschrieben. Leider wurde dabei nicht herausgearbeitet,<br />
dass dieses Phänomen im Bereich Biogas ausschließlich bei<br />
Aktivkohle aus Holzkohle aufgetreten ist. Nicht jede Kohle stellt eine<br />
Brandgefahr dar: Bei Aktivkohle auf Steinkohlebasis besteht diese Gefahr<br />
der Selbstentzündung im Bereich Biogas eindeutig bisher nicht.<br />
Bei Holzkohle beträgt die Selbstentzündungstemperatur etwa 160 Grad<br />
Celsius. Die von Steinkohle ist rund 100 bis 120 Grad Celsius höher.<br />
Problematisch kann es dann werden, wenn die beladene Aktivkohle aus<br />
Holzkohle mit Sauerstoff in Verbindung kommt. Vereinfacht gesagt produziert<br />
die Kohle dabei Wärme. Im Extremfall kann die entstehende Wärme<br />
ausreichen, um die Holzkohle zu entzünden.<br />
Verstärkt wird dieser Effekt insbesondere, wenn die Aktivkohle zur Erhöhung<br />
der Entschwefelungsleistung mit Kalium dotiert ist, denn Kalium<br />
wirkt hier praktisch als Brandbeschleuniger. Die Kohle selbst brennt dann<br />
zwar nicht, sondern glüht nur, allerdings können die Glutnester – wie im<br />
Artikel beschrieben – zu einer Entzündung des Verpackungsmaterials –<br />
beispielsweise der Big-Bags oder der Holzpalette – führen. All dies ist<br />
natürlich nur ein schwacher Trost, wenn gerade die teure Lagerhalle oder<br />
Scheune abgebrannt ist.<br />
Wir bei der Siloxa und bei Aktivkohle24 verwenden aufgrund dieser Gefahr<br />
ausschließlich kaliumfreie Aktivkohle auf Basis von Steinkohle. Diese<br />
modernen Kohlen sind inzwischen so verarbeitet, dass sie die gleiche<br />
Entschwefelungsleistung wie Aktivkohle auf Holzkohlebasis haben.<br />
Allerdings mit dem entscheidenden Vorteil, dass es keine Probleme mit der<br />
Selbstentzündung gibt! Siloxa bringt jedes Jahr über 1.000 Tonnen Aktivkohle<br />
in den Markt – die im Artikel beschriebene Entzündungsproblematik<br />
von Aktivkohle kennen wir mit Steinkohlen in keiner Weise, von Holzkohlen<br />
basierten Aktivkohlen jedoch reichlich.<br />
Wolfgang Doczyck,Vorstand<br />
Siloxa AG und Aktivkohle24<br />
Leserbrief<br />
Zum Artikel „Kleine Ursache – große Wirkung“ im Biogas Journal<br />
Ausgabe 1_<strong>2019</strong>, Seite 68 bis 70 erreichte uns auch folgende Zuschrift:<br />
In dem Artikel wird erwähnt, dass mit Fettstiften die<br />
Lebensdauer erhöht werden kann. Hier sollte unbedingt<br />
darauf hingewiesen werden, dass das falsche Fett die<br />
Manschette vorzeitig zerstört! Wenn die Manschette am<br />
Rührwerk aus EPDM besteht, dann ist zum Beispiel Melkfett<br />
oder Vaseline dafür überhaupt nicht geeignet, weil diese<br />
Fette aus Mineralöl-Grundstoffen bestehen und EPDM<br />
aufweichen und zerstören. Nur spezielle Fette wie Hirschoder<br />
Rindertalg sind für EPDM geeignet. Manschetten aus<br />
NBR-Gummi reagieren dagegen nicht empfindlich auf<br />
mineralische Fette.<br />
Erwin Köberle<br />
Biogaskontor Köberle GmbH<br />
7
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Bücher<br />
Messstellenbetriebsgesetz<br />
Das Werk aus der Reihe<br />
der „Berliner Kommentare“<br />
erläutert die komplizierte<br />
Materie rund<br />
um den Einbau und<br />
den Betrieb intelligenter<br />
Messsysteme und<br />
Zähler in der Energieversorgung.<br />
Der Praxiskommentar enthält Hinweise,<br />
Beispiele und praktikable Lösungsvorschläge,<br />
um die komplexen mess- und<br />
datenschutzrechtlichen Rahmenvorgaben<br />
zu durchdringen und schwierige Auslegungsfragen<br />
zu meistern.<br />
Käufer dieses Kommentares erhalten zudem<br />
einen passwortgeschützten Zugang<br />
zur Onlinedatenbank mit energierechtlichen<br />
Vorschriften der EU, des Bundes und<br />
der Länder in den jeweils aktuellen sowie<br />
früheren Fassungen.<br />
Erich Schmidt Verlag, 587Seiten, mit Onlinezugang<br />
zu energierechtlicher Vorschriftendatenbank,<br />
108 Euro<br />
ISBN: 978-3-503-18102-5<br />
Faustzahlen für die Landwirtschaft<br />
Das Buch bietet einen<br />
raschen Überblick über<br />
wichtige Daten der bedeutsamsten<br />
landwirtschaftlichen<br />
Produktionsverfahren.<br />
Vor allem<br />
Praktikern, Auszubildenden<br />
und Studierenden<br />
sowie Beratern und Beschäftigten der<br />
vor- und nachgelagerten Branchen dient<br />
es als Nachschlagewerk und zur Entscheidungsunterstützung.<br />
Der Schwerpunkt der „Faustzahlen“ liegt<br />
auf der Produktionstechnik in Pflanzenbau<br />
und Tierhaltung. Der Pflanzenbau schließt<br />
den Freilandgemüsebau, den Obstbau, den<br />
Weinbau sowie die Erzeugung Erneuerbarer<br />
Energien und nachwachsender Rohstoffe<br />
mit ein. Statistische und betriebswirtschaftliche<br />
Daten sowie Informationen zur<br />
Umwelt, Produktverarbeitung und Direktvermarktung<br />
runden das Angebot ab.<br />
KTBL, 1.386 Seiten, 30 Euro<br />
ISBN 978-3-945088-59-3<br />
Betriebsplanung Landwirtschaft<br />
2018/19 - 26. Auflage<br />
Die Datensammlung liefert<br />
sowohl Grund- und<br />
Ergebnisdaten zu den<br />
verschiedenen landwirtschaftlichen<br />
Produktionsrichtungen<br />
als auch<br />
methodische Hinweise<br />
zur Lösung betriebswirtschaftlicher<br />
Fragestellungen. Neben<br />
den Verfahrensabläufen werden Kennzahlen<br />
der Arbeitserledigung, ökonomische<br />
Erfolgsgrößen und Stückkosten für landwirtschaftliche<br />
Produkte ausgewiesen. Die<br />
Planungsbeispiele veranschaulichen die<br />
ökonomische Methode zur Bewertung der<br />
verschiedenen landwirtschaftlichen Produktionsverfahren.<br />
Die kostenlosen Online-<br />
Anwendungen unter www.ktbl.de ergänzen<br />
die gedruckte Datensammlung.<br />
KTBL, 776 Seiten, 26 Euro<br />
ISBN 978-3-945088-62-3<br />
termine<br />
11. bis 13. März<br />
Abfallvergärungstagung<br />
Dresden<br />
forum-abfallwirtschaft-altlasten.de/<br />
abfallvergaerungstagung<br />
11. März<br />
Zukunftsseminar Güllekleinanlagen<br />
Aulendorf<br />
www.service-gmbh.biogas.org<br />
Anmeldung: service-gmbH@biogas.org<br />
13. März<br />
Workshop Rechtsfragen<br />
Nienburg<br />
www.klimaschutz-leb.de<br />
18. bis 21. März<br />
AHK-Geschäftsreise „Bioenergie mit Fokus<br />
auf Gewinnung von Biomethan in Frankreich“<br />
Frankreich<br />
www.german-energy-solutions.de<br />
19. bis 20. März<br />
Jährliche Unterweisung, Brandschutzhelfer<br />
und Ersthelfer mit Bescheinigung<br />
Nienburg<br />
www.klimaschutz-leb.de<br />
20. bis 21. März<br />
Öko-Innovationen mit Biomasse <strong>2019</strong><br />
Papenburg (Ems)<br />
www.3-n.info/news-und-termine<br />
21. März<br />
Flex-Technik<br />
Nienburg<br />
www.klimaschutz-leb.de<br />
21. März<br />
Webinar „Dezentrale Energieversorgung<br />
mit erneuerbaren Energien in Guatemala,<br />
El Salvador und Honduras“<br />
www.german-energy-solutions.de<br />
21. März<br />
„Eigenversorgung für Industrie und Gewerbe<br />
im Südlichen Afrika“<br />
Berlin<br />
www.german-energy-solutions.de<br />
26. bis 27. März<br />
International Conference on Monitoring<br />
& Process Control of Anaerobic Digestion<br />
Plants<br />
Leipzig<br />
www.energetische-biomassenutzung.de<br />
29. bis 31. März<br />
bioenergie expo & congress<br />
Offenburg<br />
preussner@messe-offenburg.de<br />
4. April<br />
DFBEW-Konferenz zu Biogas in der<br />
Kreislaufwirtschaft<br />
La Défense/Paris<br />
energie-fr-de.eu/de/startseite.html<br />
9. Mai<br />
Power-to-X<br />
Erfurt<br />
https://www.theen-ev.de/de/powerto-x.html<br />
Diese und weitere Termine rund um die<br />
Biogasnutzung in Deutschland und der Welt<br />
finden Sie auf der Seite www.biogas.org<br />
unter „Termine“.<br />
8
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Aktuelles<br />
9
Aktuelles<br />
BIOGAS-KIDS<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Biogas im Rucksack<br />
Heute besuchen wir Afrika. Auf dem<br />
riesigen Kontinent, beispielsweise im<br />
Land Äthiopien, haben die Kleinbauern<br />
meist nur wenig Vieh: ein paar<br />
Kühe, Schweine oder Ziegen. Moderne<br />
Haustechnik ist für die meisten –<br />
oft genauso wie Strom – noch immer<br />
unerschwinglich oder unerreichbar.<br />
Traditionell wird deshalb vielfach mit<br />
Holz und Holzkohle gekocht. Holzsammeln<br />
und Kochen ist die Arbeit der<br />
Frauen. Eine mühsame Arbeit, denn<br />
pro Tag benötigt eine Familie 30 bis<br />
40 Kilogramm Holz, das oft von weither<br />
geholt und teuer bezahlt werden<br />
(B)energy<br />
muss. Denn an Holz mangelt es vielerorts in Afrika.<br />
Immer mehr Holz entnahme führt zu noch mehr Abholzung.<br />
Das ist nicht nur schlecht für den Klima schutz.<br />
Der ständige Umgang mit Feuerholz und Holzkohle in<br />
den Häusern ist auch sehr gesundheitsschädlich. Aus<br />
dieser Not haben Biogas-Experten aus Deutschland<br />
und Afrika ein tolles Biogas-Projekt entwickelt. Alles<br />
dreht sich dabei um eine besondere Erfindung: den<br />
„Biogas-Rucksack“. Die Kleinbauern liefern täglich ihren<br />
Tierdung, Küchenabfälle und Küchenabwässer an<br />
Frühjahrsmüdigkeit<br />
Bald kommt der Frühling<br />
wieder, wir freuen uns. Und<br />
dann? Wir kommen einfach<br />
nicht in Schwung, fühlen<br />
uns schlapp, müde, lustlos.<br />
Ständiges Gähnen ist angesagt!<br />
Das ist die Frühjahrsmüdigkeit.<br />
Auch die Tiere<br />
kommen da nicht drum herum.<br />
Woher kommt das? Hier<br />
treffen die Umstellung auf<br />
die neue Jahreszeit, das noch unbeständige Wetter und bisherige<br />
Ernährung aufeinander. Im Winter sinkt unsere Körpertemperatur,<br />
der Blutdruck steigt und das „Schlafhormon“<br />
Melatonin wird gebildet – ein bisschen wie Winterschlaf.<br />
Nun kitzeln uns die ersten Strahlen der Frühlingssonne. Wir<br />
werden aktiv, die Temperatur steigt, der Blutdruck sinkt.<br />
Aber noch steckt der Winterschlaf in uns. Dagegen hilft viel<br />
an die frische Luft gehen und Sonne tanken. Jetzt gehören<br />
mehrere kleine Mahlzeiten mit viel Obst und Gemüse auf<br />
unsere Speisezettel. Frühjahrsmüdigkeit ist keine Krankheit –<br />
die Umstellung dauert etwa zwei bis vier Wochen, dann ist<br />
alles wieder im Lot.<br />
eine sehr kleine Biogasanlage<br />
in der Nachbarschaft.<br />
Für eine geringe<br />
Gebühr bekommen<br />
sie dafür Biogas aus<br />
der Anlage. Das wird<br />
in den Biogas-Rucksack<br />
gefüllt – ein ziemlich<br />
großer, dafür aber nur<br />
vier Kilogramm schwerer<br />
Plastiksack. Der lässt<br />
sich schön leicht nach<br />
Hause tragen. Dort wird<br />
der Behälter einfach an<br />
einen Gaskocher angeschlossen.<br />
Eine Rucksack-Ladung reicht aus, um für<br />
die Familie 2 bis 4 Stunden das Essen zu kochen. Zusätzlich<br />
entstehen dabei in der Biogasanlage etwa<br />
20 Liter dickflüssiger Gärdünger. Das ist ein wertvoller<br />
organischer Dung, den die Bauern hervorragend für<br />
ihre Anbauflächen verwenden oder auch kompostieren<br />
können. Für die Familien ist das<br />
eine Riesenerleichterung und gleichzeitig<br />
ein wichtiger Beitrag zum<br />
Klimaschutz.<br />
Biogas<br />
ist jetzt<br />
filmreif<br />
Erneuerbare Energien müssen schon in der Schule ein Thema<br />
sein. Schließlich ist das der Ort, um zu lernen, worauf es für<br />
jeden in Zukunft ankommt. Der Fachverband Biogas e. V. hat<br />
deshalb für Youtube und auf DVD einen 25-minütigen Schulfilm<br />
über Solarenergie, Biogas und Co. produziert. Er richtet<br />
sich speziell an neunte und zehnte Klassen. Mit dabei ist auch<br />
wieder der Hackl Schorsch. Der dreifache Rodel-Olympia sieger<br />
Georg Hackl engagiert sich schon seit einigen Jahren aus Überzeugung<br />
für Biogas. In dem Film machen die Schülerinnen und<br />
Schüler der 9. Klasse eines Gymnasiums dem ehemaligen Sportler<br />
zunächst die Vorteile von Sonne, Wind, Biogas, Wasser und<br />
Erdwärme klar. Georg Hackl besucht dann verschiedene Betreiber<br />
solcher Anlagen und lässt sich Funktion und Vorteile erklären.<br />
Auf der Seite des Fachverbandes Biogas findest du den Film<br />
zum Download und Bestellen und den Link zu Youtube.<br />
www.agrarkids.de<br />
Landwirtschaft entdecken und verstehen –<br />
Die Fachzeitschrift für Kinder<br />
10
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Aktuelles<br />
ERFAHRUNG<br />
IST DIE BASIS<br />
JEDER INNOVATION<br />
Bei allem, was wir tun, verlieren wir nie aus den Augen, worum es für Sie geht:<br />
effiziente Technik und eine einfache Handhabe.<br />
Als Erfinder der elastomerbeschichteten Drehkolbenpumpe und Innovationstreiber für<br />
Einbring- und Aufbereitungstechnik sehen wir uns bei Vogelsang dem guten Ruf der deutschen<br />
Maschinenbauindustrie und ihrem Beitrag zur Energiewende verpflichtet. Seit der Gründung<br />
des Unternehmens 1929 liefern wir technische Lösungen, deren Funktionalität, Qualität<br />
und Zuverlässigkeit von unseren Kunden weltweit hoch geschätzt werden und unseren Wettbewerbern<br />
als Vorbild dienen.<br />
Unser umfassendes Know-how und die langjährige Erfahrung im Bereich Biogas nutzen<br />
wir, um unseren Kunden als kompetenter Partner zur Seite zu stehen. Mit schlagkräftiger<br />
Pump-, Zerkleinerungs-, Desintegrations- und Feststoffdosiertechnik ebenso wie mit unseren<br />
individuellen Beratungsleistungen.<br />
vogelsang.info<br />
ENGINEERED TO WORK<br />
11
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Biomethan: Der Kraftstoffmarkt<br />
bietet Perspektiven<br />
Elektromobilität ist nicht alles. Das wurde im Januar auf dem Kongress<br />
„Kraftstoffe der Zukunft“ in Berlin deutlich. Experten zeigten auf, dass<br />
mit Biokraftstoffen schnell wirksame Klimaschutzmaßnahmen im Verkehr<br />
umgesetzt werden könnten. Für Biomethan als Kraftstoff bietet die<br />
neue europäische Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED II) Chancen.<br />
Von Thomas Gaul<br />
Der internationale Kongress<br />
„Kraftstoffe der Zukunft“ in<br />
Berlin war mit über 600 Teilnehmern<br />
besser besucht als in<br />
den Vorjahren. Im Mittelpunkt<br />
stand die neue europäische Erneuerbare-<br />
Energien-Richtlinie (RED II). Die Richtlinie<br />
hat das Ziel, den Anteil Erneuerbarer<br />
Energien am Gesamtenergieverbrauch auf<br />
32 Prozent und im Verkehrssektor auf 14<br />
Prozent bis zum Jahr 2030 zu steigern.<br />
Im Jahr 2023 sollen diese Zielvorgaben von<br />
der EU überprüft werden. Bis Ende <strong>2019</strong><br />
sollen die EU-Mitgliedstaaten ihre nationalen<br />
Energie- und Klimapläne vorlegen.<br />
Um das Klimaschutzziel in Deutschland im<br />
Verkehrssektor zu erreichen, würden nach<br />
den Vorgaben der RED II selbst 6 Millionen<br />
Elektroautos nicht ausreichen, um die<br />
Minderung der Treibhausgasemissionen zu<br />
erreichen.<br />
Gibt es überhaupt eine Strategie?<br />
Dabei dreht sich die öffentliche Diskussion<br />
derzeit fast ausschließlich um die Elektromobilität.<br />
Da stellt sich die Frage, ob es<br />
eine Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der<br />
Bundesregierung überhaupt gibt? Steffen<br />
Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär<br />
im Bundesverkehrsministerium, sagte<br />
auf dem Kongress jedoch: „Nachhaltige<br />
Biokraftstoffe aus Rest- und Abfallstoffen<br />
werden einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz<br />
leisten. Deshalb haben wir das<br />
Deutsche Biomasseforschungszentrum<br />
mit einem Pilotprojekt beauftragt. Damit<br />
soll erstmals eine vollständige Nutzung<br />
der Potenziale der Rest- und Abfallstoffe<br />
realisiert und die Umwandlungseffizienz<br />
in Biomethan maximiert werden.“ Mit der<br />
Förderinitiative „Energiewende im Verkehr“<br />
fördert der Bund mit rund 87 Millionen<br />
Euro über die Laufzeit von drei Jahren<br />
Forschung und Entwicklung innovativer<br />
Kraftstoffe. Dazu gehört auch Biomethan<br />
mit Wasserstoffanteilen.<br />
Für die Autoindustrie kommt es darauf<br />
an, die künftigen EU-Flottengrenzwerte<br />
einzuhalten. „Alle Technologien zur CO 2<br />
-<br />
Reduzierung sollten die gleichen<br />
Chancen haben“, betonte Bernhard<br />
Mattes, Präsident des Verbandes<br />
der Automobilindustrie.<br />
Dabei seien derzeit die erneuerbaren<br />
Kraftstoffe stark benachteiligt.<br />
Bei der Frage nach neuen<br />
Kraftstoffen gehe es nicht um ein<br />
„Entweder-Oder“. Ein „Sowohlals-auch“<br />
mit einem „robusten<br />
Technologiemix“ sei die richtige<br />
Strategie.<br />
„Die Vollelektrifizierung des Verkehrs<br />
und die Elektromobilität<br />
allein werden es nicht schaffen“,<br />
sagte Wolfgang Langhoff,<br />
Vorstandsvorsitzender BP Europe<br />
SE. Deswegen kommt es<br />
aus seiner Sicht ebenso auf die<br />
Kraftstoffe an – „mit Biokraftstoffen,<br />
grünem Wasserstoff,<br />
Coprocessing und synthetischen<br />
Kraftstoffen.“ Das Ziel der CO 2<br />
-<br />
Reduzierung werde als politische<br />
Vorgabe akzeptiert, trotz Zweifeln,<br />
ob es auch erreichbar ist. Selbst wenn<br />
für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge der<br />
E-Mobilität die Zukunft gehört, werde auf<br />
absehbare Zeit weiterhin ein großer Teil der<br />
Pkw und werden die meisten Schwerlastfahrzeuge<br />
mit Verbrennungsmotor oder Hybridantrieb<br />
unterwegs sein. Denn innerhalb<br />
kurzer Zeit lässt sich der Fahrzeugbestand<br />
nicht austauschen. Hinzu kommt, dass die<br />
meisten Verbraucher hinsichtlich der derzeitigen<br />
Reichweitenbeschränkung rein<br />
batteriebetriebenen Fahrzeugen gegenüber<br />
noch skeptisch eingestellt sind.<br />
Abgesehen davon werden Luft- und internationaler<br />
Schiffsverkehr auf absehbare Zeit<br />
auf Kraftstoffe angewiesen bleiben. Deshalb<br />
wird es darauf ankommen, die fossilen<br />
Kraftstoffe für diese Verbrennungsmotoren<br />
zu ersetzen. Eine vergleichbare Energiedichte<br />
lässt sich kurz- bis mittelfristig nur<br />
mit erneuerbaren Kraftstoffen erreichen.<br />
Biomethan spart viel CO 2<br />
ein<br />
Mit Biomethan steht in Deutschland ein<br />
fortschrittlicher Biokraftstoff in relevanten<br />
Mengen zur Verfügung. Für fortschrittliche<br />
Biokraftstoffe soll es eine Unterquote<br />
geben. Mit 0,05 Prozent ab 2020 und<br />
0,5 Prozent ab 2025 ist sie aus Sicht der<br />
Akteure im Markt viel zu niedrig, um Planungssicherheit<br />
zu geben und Investitionsanreize<br />
zu setzen. Mit der Erhöhung der<br />
Horst Seide, Präsident des Fachverbandes Biogas e.V.: „Wir<br />
können den Diesel zwar nicht ersetzen und sind auch zu<br />
klein, um den Schwerlastverkehr ausschließlich versorgen zu<br />
können, aber wir können beim ,Ergrünen‘ helfen.“<br />
Unterquote könnte ein wirksamer Beitrag<br />
zum Klimaschutz geleistet werden, zumal<br />
auch deutlich weniger Stickoxide und Feinstaub<br />
emittiert werden.<br />
Durch die hohe Einsparung von CO 2<br />
wird<br />
der Quotenhandel für Biomethanerzeuger<br />
finanziell lukrativ, wie Horst Seide erläuterte.<br />
Der Präsident des Fachverbandes<br />
Biogas e.V. betreibt selbst mehrere Biomethananlagen<br />
und -tankstellen. Die Mi-<br />
12
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Aktuelles<br />
neralölfirmen müssen, um ihre Quote an<br />
Treibhausgaseinsparungen zu erreichen,<br />
Quote dazukaufen.<br />
„Wir handeln tatsächlich Treibhausgas-<br />
Einsparung“, sagte Seide. Im Anhang der<br />
RED II sind künftig Standard- und Teilstandardwerte<br />
für Biogas aus Gülle und Mais<br />
sowie aus Mischungen dieser Substrate<br />
vorgegeben. Biomethan als Kraftstoff aus<br />
reiner Güllevergärung erhält so eine Treibhausgaseinsparung<br />
von 200 Prozent gutgeschrieben.<br />
Reine NawaRo-Anlagen werden<br />
die notwendigen Treibhausgaseinsparungen<br />
nicht erreichen, sagte Seide: „Konzepte<br />
mit Gülle-Einsatz sind nötig.“<br />
Der Anteil von Biomethan am Kraftstoffmarkt<br />
ist erst gering: 2016 waren es gerade<br />
einmal 0,4 Prozent. „Unsere Branche ist so<br />
groß, diesen Anteil ausschließlich mit Biomethan<br />
beliefern zu können“, machte der<br />
Fachverbands-Präsident deutlich. Zumal<br />
das Potenzial noch groß ist, insbesondere<br />
Michael Kralemann vom Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende<br />
Rohstoffe (3N) sagte, wenn Bestandsanlagen von Stromeinspeisung<br />
auf Gaseinspeisung umgerüstet werden, sollten diese eine Anlagenleistung<br />
von 1,2 bis 2 MW el<br />
haben.<br />
um aus Gülle und Mist Biomethan zu erzeugen.<br />
Bislang gehen gerade 25 Prozent<br />
dieser tierischen Ausscheidungen in die<br />
Biogasanlage. Doch selbst wenn es gelingt,<br />
weiteres Potenzial zu mobilisieren, würde<br />
das nicht ganz reichen.<br />
Das zeigt der Anteil von 63 Prozent Diesel<br />
am Kraftstoffmarkt in Deutschland. Davon<br />
entfällt die Hälfte auf den Schwerlastverkehr.<br />
„Wir können den Diesel zwar nicht<br />
ersetzen und sind auch zu klein, um den<br />
Schwerlastverkehr ausschließlich versorgen<br />
zu können“, sagte Horst Seide: „Aber<br />
wir können beim ,Ergrünen‘ helfen. „Immer<br />
mehr Logistikunternehmen möchten emissionsärmer<br />
unterwegs sein“, stellte Lars<br />
Schulze-Beusingsen von der Energieagentur<br />
NRW fest.<br />
Immerhin kommt die Gasmobilität auch<br />
beim Lkw langsam in Fahrt, auch durch<br />
die neuen Fahrzeuge mit LNG-Antrieb.<br />
Dazu trägt auch die Mautbefreiung für<br />
diese Fahrzeuge bei. Schulze-Beusingsen<br />
verwies auf mehrere Projekte in NRW, die<br />
den Aufbau einer LNG-Infrastruktur zum<br />
Ziel haben.<br />
Fotos: Andreas Schöttker<br />
Perspektive für Bestandsanlagen<br />
Interessante Perspektiven durch den Kraftstoffmarkt<br />
ergeben sich insbesondere für<br />
Bestandsanlagen, die demnächst aus dem<br />
EEG laufen. Dabei kann auch über regionale<br />
Absatzwege nachgedacht<br />
werden. „Die Idee vom<br />
Kraftstoff aus der Region<br />
hat Charme“, sagte Prof.<br />
Dr. Frank Scholwin vom<br />
Institut für Biogas, Kreislaufwirtschaft<br />
& Energie.<br />
Seinen Ausführungen zufolge<br />
ließe sich die Aufbereitung<br />
von Biomethan für<br />
eine lokale Tankstelle im<br />
Vergleich zur Einspeisung<br />
in das Gasnetz durchaus<br />
wirtschaftlich realisieren.<br />
Abnehmer könnten etwa<br />
Betreiber von Buslinien<br />
sein, die den Überlandverkehr<br />
bedienen. Für<br />
dieses Streckenprofil kämen<br />
Elektrobusse eher<br />
nicht infrage. Wie Mattias<br />
Svensson von Sheepbrook<br />
Consulting berichtete,<br />
sind in Schweden bereits<br />
17 Prozent aller Busse mit<br />
CNG unterwegs. Das ermöglicht ihnen die<br />
Einfahrt in Umweltzonen.<br />
Bündelung mehrerer Anlagen<br />
sinnvoll<br />
In Niedersachsen arbeiten laut Michael<br />
Kralemann vom Niedersachsen Netzwerk<br />
Nachwachsende Rohstoffe (3N) derzeit 30<br />
Biomethan-Aufbereitungsanlagen. Sollen<br />
Anlagen umgerüstet werden, sollten diese<br />
eine Anlagenleistung von 1,2 bis 2 MW el<br />
haben.<br />
Das entspreche einer Einspeisung zwischen<br />
300 und 500 Kubikmeter pro Stunde.<br />
Ob die Umstellung einer Biogasanlage<br />
auf die Biomethaneinspeisung sinnvoll ist,<br />
hängt in erster Linie von der wirtschaftlichen<br />
Situation der Anlage ab.<br />
Die Betreiber sollten Interesse am Einstieg<br />
in die neue Technologie haben und bereit<br />
sein, mit benachbarten Anlagen zu kooperieren.<br />
Außerdem müssten neue Substrate<br />
erschlossen werden. In erster Linie ist da<br />
an Wirtschaftsdünger zu denken: In Niedersachsen<br />
werden 7,4 Millionen Tonnen Wirtschaftsdünger<br />
vergoren. Das sind 16 Prozent<br />
des Wirtschaftsdüngeraufkommens.<br />
Kommunale Bio- und Grünabfälle können<br />
ebenfalls als Substrat erschlossen werden,<br />
denn vom Grüngut werden nur 59 Prozent<br />
erfasst, beim Bioabfall sind es 86 Prozent.<br />
In geeigneten Biogasanlagen könnte auch<br />
der Grasschnitt von Straßenbegleitflächen<br />
genutzt werden. Aus der Lebensmittelproduktion<br />
ließen sich 38.000 Tonnen Reststoffe<br />
im Jahr in die Energieproduktion<br />
umlenken. Das Potenzial zur Biokraftstofferzeugung<br />
in Niedersachsen bezifferte<br />
Kralemann vorsichtig auf 260.000 Kubikmeter<br />
Biomethan im Jahr und 190.000<br />
Tonnen LNG jährlich. Damit ließen sich 4,2<br />
Prozent des niedersächsischen Kraftstoffbedarfs<br />
im niedersächsischen Straßenverkehr<br />
decken.<br />
Wie Michael Kralemann erläuterte, entspricht<br />
dies dem heutigen Marktvolumen<br />
alternativer Kraftstoffe. Würde dieses<br />
Potenzial also gehoben, liefe es auf eine<br />
Verdoppelung hinaus oder es ließen sich<br />
10 Prozent des Schwerlastverkehrs damit<br />
betreiben. Durch die rechtlichen Vorgaben<br />
erwartet Kralemann aber nur geringe Mengensteigerungen.<br />
Zur Realisierung würden<br />
verlässliche Rahmenbedingungen für den<br />
Betrieb von Biogasanlagen benötigt, die<br />
den Wechsel großer Bestandsanlagen aus<br />
der Verstromung anreizen würden.<br />
Autor<br />
Thomas Gaul<br />
Freier Journalist<br />
Im Wehrfeld 19a · 30989 Gehrden<br />
01 72/512 71 71<br />
gaul-gehrden@t-online.de<br />
13
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
„Klimaschutz ist eine Chance,<br />
Wohlstand und Wachstum zu sichern“<br />
Mitte Februar fand in Berlin der traditionelle Neujahrsempfang des<br />
Bundesverbandes Erneuerbare Energie e.V. statt. Rund 1.300 Branchenvertreter<br />
nahmen teil, um neue politische Statements zu hören.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Dr. Simone Peter stellte im Rahmen des<br />
Neujahrsempfangs die beiden neuen BEE-<br />
Geschäftsfüher vor: Wolfram Axthelm (links)<br />
vom Bundesverband Windenergie e.V. und<br />
Dr. Claudius da Costa Gomez vom Fachverband<br />
Biogas e.V., die beide auch weiterhin<br />
Geschäftsführer in den jeweiligen Spartenverbänden<br />
sein werden.<br />
Eine flammende Rede pro Energiewende<br />
und Klimaschutz, wie<br />
sie seit Jahren nicht mehr von<br />
einem politischen Gastredner<br />
gehalten worden ist, hielt der<br />
niedersächsische Energie- und Umweltminister<br />
Olaf Lies (SPD). Keine Spur von<br />
Bedenkenträgerei in seinen Ausführungen.<br />
„Klimaschutz ist eine Chance, Wohlstand<br />
und Wachstum zu sichern“, rief er überzeugt<br />
in den vollbesetzten Saal. „Wir müssen<br />
davon wegkommen, die Debatten der<br />
Vergangenheit zu führen, in denen gerne<br />
behauptet wurde, Klimaschutz bedeutet<br />
Restriktionen und Gefahr für Wohlstand<br />
und Wachstum“, forderte der Minister.<br />
Klimaschutz und Energiewende seien die<br />
Herausforderungen seiner Generation.<br />
Er fragt sich, wie Artenschutz und Klimaschutz<br />
ein Widerspruch sein könnten. „Wir<br />
sind nicht die letzte Generation, die den<br />
Klimawandel erlebt, aber wir sind wohl die<br />
letzte Generation, die etwas dagegen unternehmen<br />
kann“, betonte Lies, der damit<br />
den früheren US-Präsidenten Obama zitierte.<br />
So müsse dies zum Maßstab „unserer<br />
Arbeit werden“. Lies ist davon überzeugt,<br />
dass Klimaschutz und industrieller Wohlstand<br />
gemeinsam möglich sind – und zwar<br />
ohne fossilen CO 2<br />
-Ausstoß.<br />
„Keine Chance, vom Weg<br />
abzuweichen“<br />
Für ihn ist klar, dass Deutschland das Weltklima<br />
nicht allein retten kann, „aber wir<br />
zeigen der Welt auf, dass es funktionieren<br />
kann und sind Vorbild“. Die Energiewende<br />
brauche dringend einen neuen Namen,<br />
weil manche inzwischen denken würden,<br />
man könne auf dem eingeschlagenen Weg<br />
umdrehen. „Wir haben überhaupt keine<br />
Chance, von dem eingeschlagenen Weg<br />
abzuweichen. Wir können den Erfolg der<br />
Erneuerbaren Energien nicht aufhalten,<br />
aber wir können ihn verstolpern“, stellte<br />
Lies klar.<br />
Es fehle heute der ganzheitliche Mut,<br />
diese Energieversorgungswende wirklich<br />
konsequent anzugehen. „Wir erleben es<br />
ständig in ganz vielen Bereichen, dass<br />
versucht wird, Hürden aufzubauen und<br />
Bremsen einzulegen“, mahnte der Minister.<br />
Er wünscht sich, dass das Thema Gas<br />
als Partner der Energiewende ernst genommen<br />
wird. Denn Gas biete die Chance, die<br />
Energieversorgung CO 2<br />
-ärmer zu machen.<br />
Bezogen auf die Elektromobilität sagte er,<br />
dass wir weniger in Elektronen denken sollten<br />
als vielmehr in Molekülen. Es müsse<br />
in Stoffströmen gedacht werden, wie zum<br />
Beispiel mit Wasserstoff und Gastechnik.<br />
Das Leitungsnetz in Deutschland bestehe<br />
nicht nur aus Kupfer. Vielmehr existiere<br />
auch ein sehr gut verzweigtes Gasnetz. Es<br />
müssten Brücken gebaut werden zwischen<br />
Strom- und Gasnetz. In diesem Zusammenhang<br />
propagierte er auch eine Initiative für<br />
eine breite Wasserstoff-Strategie. „Für die<br />
Industrie in Deutschland sind Klimaschutz<br />
und der Ausbau der Nutzung Erneuerbarer<br />
Energien die Zukunfts-Chance schlechthin“,<br />
sagte Lies voller Überzeugung.<br />
Andere Länder entwickeln<br />
Wasserstoffstrategien<br />
Eine weit weniger glanzvolle Rede hielt<br />
beim BEE-Neujahrsempfang der neue<br />
Staatssekretär im Bundeswirtschaftsmi-<br />
14
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Aktuelles<br />
ÜBERWACHUNG VON BIOGAS-ANLAGEN<br />
Biogas 401<br />
Mehrkanal-Gasanalysator<br />
Biogas 905<br />
Mehrkanal-Gasanalysator<br />
SENSOREN<br />
Die beiden Gas-Analysatoren Biogas 401<br />
und Biogas 905 über wachen kontinuierlich<br />
oder dis kon ti nuierlich die Qualität des<br />
Biogases auf die Gaskompo nenten hin.<br />
Optional warnen zusätzliche Umgebungsluft-Sensoren<br />
frühzeitig vor gesundheitsge<br />
fähr denden, explo sions fähigen und<br />
nichtbrenn baren Gasen und Dämpfen.<br />
❯❯❯ Biogas Know-how seit 2001 ❮❮❮<br />
EINSATZBEREICHE:<br />
■ Biogas-Produktionsanlagen<br />
■ Kläranlagen<br />
■ Deponien<br />
Service rund um den Gasmotor<br />
Service vor Ort • Fachwerkstatt • Vertrieb Gasmotoren<br />
Der BHKW-Spezialist<br />
für Motoren mit<br />
Erd-, Bio- und<br />
Sondergasbetrieb<br />
Speller Str. 12 • 49832 Beesten<br />
Tel.: 05905 945 82-0 Fax: -11<br />
E-Mail: mail@eps-bhkw.de<br />
Internet: www.eps-bhkw.de<br />
GTR 210 IR<br />
CH 4 + CO 2<br />
TOX 592<br />
O 2 + H 2 S<br />
Trierer Str. 23 – 25 · 52078 Aachen<br />
Tel. (02 41) 97 69-0 · www.ados.de<br />
s e i t 1 9 0 0<br />
Neumodule für den<br />
Felxbetrieb<br />
von 75-1.500 kW im Container, Betonhaube<br />
oder als Gebäudeeinbindung<br />
Stützpunkte: Beesten • Rostock • Wilhelmshaven • Lübeck • Magdeburg<br />
BEEINDRUCKEND VIELSEITIG.<br />
HEBEN SIE IHRE ANSPRÜCHE.<br />
Frühjahrsaktion:<br />
Kramer Teleskoplader<br />
von 6 m bis 9 m Stapelhöhe<br />
Ob es nun der kompakte Allrounder oder die maximale<br />
Leistung für den Profieinsatz werden soll - alle elf Modelle<br />
sind für die vielseitigen Aufgaben auf dem Hof wie gemacht.<br />
Dabei zeichnen sich die Teleskoplader durch ihre hohe<br />
Nutzerfreundlichkeit und die technische Raffinesse aus.<br />
JETZT<br />
Mehr Infos unter:<br />
www.kramer.de/fruehjahrsaktion<br />
PREISVORTEIL<br />
SICHERN<br />
Wir machen Ihr Biogas CLEAN und COOL!<br />
Individuelle Anlagen von Züblin Umwelttechnik<br />
zur Reinigung und Kühlung von Biogas<br />
• CarbonEx Aktivkohle lter zur<br />
Feinentschwefelung von Biogas<br />
• GasCon Gaskühlmodul zur<br />
Kühlung von Biogas<br />
• BioSuldEx zur biologischen<br />
Entschwefelung von Biogas<br />
• BioBF Kostengünstiges System zur<br />
biologischen Vorentschwefelung<br />
NEU!<br />
Züblin Umwelttechnik GmbH, Otto-Dürr-Str. 13, 70435 Stuttgart<br />
Tel. +49 711 8202-0 • umwelttechnik@zueblin.de • zueblin-umwelttechnik.com<br />
15
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Niedersachsen Energieminister Olaf Lies.<br />
nisterium, Andreas Feicht. Mit Olaf Lies<br />
stimmte er überein, dass Erneuerbare<br />
Energien und Gas zusammengehören. Vor<br />
dem Hintergrund des Kohleausstiegs müsse<br />
eine Idee entwickelt werden, wie mit<br />
der Kraft-Wärme-Kopplung umgegangen<br />
werden soll. Er liebe gasgeführte Netzreserveanlagen.<br />
Wasserstoff und Grünes Gas sind laut<br />
Feicht die Themen der Zukunft. Die Verbindung<br />
beider Energieformen werde ab 2030<br />
bedeutsam werden. Allerdings würden Australien<br />
und einige arabische Länder schon<br />
heute Wasserstoffstrategien entwickeln, da<br />
dort die Situation für sehr preiswerte Produktionsbedingungen<br />
gegeben seien. Da<br />
sei durchaus die Idee vorhanden, in einen<br />
globalen Wasserstoffmarkt einzusteigen.<br />
Zur CO 2<br />
-Bepreisung sagte Feicht, dass es<br />
sie in dieser Legislaturperiode nicht mehr<br />
geben wird. Er gab sich überzeugt, dass es<br />
in der nächsten Legislatur in der Frage zu<br />
einer Entscheidung kommen wird. Netzausbau<br />
und Zubau Erneuerbarer Energien<br />
müssten synchron ablaufen. Zunächst würden<br />
die Erneuerbaren stark im Stromsektor<br />
die Wende bringen, dann schrittweise im<br />
Wärmebereich und in der Mobilität. Ausgehend<br />
von der zurzeit stark stattfindenden<br />
Stromerzeugungswende müsse es auch<br />
zur Wende in den anderen Sektoren kommen.<br />
Der Netzausbau sei unverhandelbar.<br />
Nicht nur auf der Übertragungsnetzebene,<br />
sondern auch bei den Verteilnetzen sei ein<br />
Ausbau notwendig.<br />
Schlüsselindustrie Erneuerbare<br />
Dr. Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbandes<br />
Erneuerbare Energie e.V.,<br />
sagte in ihrem Grußwort zur Eröffnung der<br />
Veranstaltung, dass sich die Erneuerbare-<br />
Energien-Branche längst als DIE innovative<br />
Schlüsselindustrie etabliert hat, die<br />
mit ganz konkreten Lösungen<br />
über alle ihre Sparten daran<br />
mitwirkt, dass der Industriestandort<br />
Deutschland moderner<br />
und zukunftsfähiger wird.<br />
Dafür brauche es gleichermaßen<br />
eine erfahrene wie neugierige<br />
junge Branche, die<br />
Lust auf Veränderung habe,<br />
die Pioniergeist und Knowhow<br />
mit neuen Möglichkeiten<br />
wie der Digitalisierung und<br />
der Sektorenkopplung verbinde<br />
und die trotz schwieriger<br />
politischer Rahmenbedingungen nicht<br />
resigniere, sondern den Blick in die Zukunft<br />
richte. Das mache sich zum Beispiel auch<br />
daran fest, dass zehn deutsche Start-ups<br />
aktuell unter den global führenden 100<br />
Clean-Tech-Unternehmen sind.<br />
„Der Mut zur Veränderung hat auch die<br />
Energiewende einst vorangetrieben. Vor<br />
Jahren ist das Ziel formuliert<br />
worden, 20 Prozent Erneuerbare<br />
im Strombereich bis 2020 zu<br />
erreichen. Ich freue mich darüber,<br />
dass im nächsten Jahr das<br />
Ziel nicht nur erreicht, sondern<br />
sogar die doppelte Menge Ökostrom<br />
produziert werden wird.<br />
Die Herausforderung ist also<br />
nicht mehr die Integration der<br />
Erneuerbaren in das System,<br />
sondern die Anpassung des<br />
Systems an die Erneuerbaren“,<br />
erklärte Peter.<br />
Und sie wies darauf hin, dass<br />
in der EU der Ökostrom-Anteil<br />
mit gut 32 Prozent im letzten<br />
Jahr erstmals höher war als<br />
der Kohleanteil. Das mache<br />
deutlich, dass die Länder um Deutschland<br />
herum nicht ruhen, sondern verstärkt auf<br />
saubere Technologien setzen und teilweise<br />
an Deutschland vorbeiziehen. „Wir haben<br />
jetzt die Chance, voll auf Erneuerbare Energien<br />
zu setzen. Denn in drei Jahren wird<br />
der Atomausstieg abgeschlossen sein und<br />
gleichzeitig wird das Ende der Kohleverstromung<br />
eingeleitet. Dieser Ausstieg wird<br />
auch international wahrgenommen“, sagte<br />
die Verbandspräsidentin.<br />
Fotos: BEE e.V.<br />
Kohleausstieg im<br />
Klimaschutzgesetz manifestieren<br />
Parallel zum Kohleausstieg müsse das Ziel<br />
65 Prozent Ökostrom bis 2030 jetzt angegangen<br />
werden. Der Kohleausstieg müsse<br />
im geplanten Klimaschutzgesetz manifestiert<br />
werden. Der Gesetzgeber sei auch gefordert,<br />
die Eigennutzung von Erneuerbarer<br />
Energie zu fördern und regionale Stromtarife<br />
zu ermöglichen, damit die Menschen vor<br />
Ort die preiswerte Wind- und Solarenergie<br />
direkt nutzen können. Denn immer mehr<br />
Menschen würden von sogenannten Konsumern<br />
zu Prosumern und damit aktiver Teil<br />
der Energieversorgung.<br />
Peter weiter: „<strong>2019</strong> muss ein Jahr der<br />
energie- und klimapolitischen Weichenstellungen<br />
werden. Die vorhandenen Deckel<br />
und Ausbaubremsen sind zu entfernen<br />
und der Energiewende muss eine Dynamik<br />
verliehen werden. Ein Deckel für PV ist<br />
nicht mehr zeitgemäß, und ein Flexdeckel<br />
bei Biogas ist nicht mehr zeitgemäß, Abstandsregelungen<br />
wie 10-H bei Wind sind<br />
nicht mehr zeitgemäß, und der Gegensatz<br />
zwischen Arten- und Klimaschutz ist auch<br />
Andreas Feicht, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.<br />
nicht mehr zeitgemäß.“ Der vergangene<br />
Hitzesommer habe klar gemacht: Klimaschutz<br />
ist Artenschutz. Deshalb seien Flächen<br />
bereitzustellen und Genehmigungsverfahren<br />
voranzubringen.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
0 54 09/90 69 426<br />
martin.bensmann@biogas.org<br />
16
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Schreiber<br />
Anlagenbau<br />
Industrie | Biogas | Sondermaschinen | Klärtechnik<br />
Aktuelles<br />
BIOGASTECHNIK<br />
EDELSTAHL MISCHERWELLE<br />
Sonderanfertigungen nach Absprache möglich<br />
GÜLLE-WÄRMETAUSCHER / ROHR-<br />
IN-ROHR WÄRMETAUSCHER<br />
aus eigener Produktion<br />
substratführendes Rohr in DN 150<br />
Ab<br />
2.586 €*<br />
3.600 €*<br />
*<br />
zzgl. MwSt. und Fracht<br />
Ab<br />
je Strang<br />
*<br />
zzgl. MwSt. und Fracht<br />
Für Sie auf Lager ab Standort Hüttisheim passend<br />
für folgende Hersteller:<br />
Strautmann<br />
Mayer Siloking<br />
BVL<br />
uvm …<br />
Höre<br />
Trioliet<br />
Fliegl<br />
komplett aus Edelstahl formiert geschweißt<br />
einfache Montage/Modulbauweise problemlos<br />
erweiterbar<br />
hohe Tauschleistung<br />
optional mit Isolierung<br />
GASAUFBEREITUNG<br />
GABK BAUREIHE<br />
Nicht die passende Größe für Ihre Anlage?<br />
Auf Kundenwunsch kann die Gasaufbereitung speziell für Sie angepasst werden!<br />
Bestehend aus:<br />
Aktivkohlefilter in Edelstahl mit 1,6 m³ Volumen<br />
(passend für ein Big Pack 500 kg)<br />
Gaskühler und Erwärmung in Edelstahl mit 91 Tauschrohren<br />
& einem Durchmesser von 300 mm<br />
Beruhigungszone mit verbesserter Oberfläche für<br />
eine optimale Kondensierung<br />
Kälteaggregat mit erhöhtem Speichertank und<br />
intelligenter Steuerung<br />
Grundgestell und komplette Verrohrung der Komponenten<br />
schlüsselfertige Auslieferung für eine schnelle Montage<br />
*<br />
GABK 500 für<br />
250 m³/h<br />
26.980 € *<br />
GABK 1000 für<br />
500 m³/h<br />
32.980 € *<br />
zzgl. MwSt.<br />
und Fracht<br />
Gasaufbereitung | Substrataufbereitung | Separation | Trocknungsanlagen | Instandsetzungen | Sonderanfertigung 17<br />
Tel.: 07305 95 61 501 | info@schreiber-anlagenbau.de | www.schreiber-anlagenbau.de
Politik<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Noch 20 Jahre Kohlestrom<br />
Mit vielen Milliarden an Steuergeldern will die Kohlekommission einen Kompromiss<br />
übertünchen, der zwar vielen Akteuren entgegenkommt, aber kein Konzept für eine<br />
vernünftige Energiewende hat.<br />
Von Bernward Janzing<br />
Das Enddatum ist – kaum überraschend –<br />
ein klassischer Kompromiss: Bis spätestens<br />
Ende 2038 soll Deutschland aus der<br />
Kohleverstromung aussteigen. Das hat die<br />
Kohlekommission (offiziell: Kommission<br />
für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung)<br />
Ende Januar mit 27 von 28 Stimmen beschlossen.<br />
Die installierte Kohlekapazität soll von aktuell 41 Gigawatt<br />
(41 Millionen Kilowatt) auf 30 Gigawatt im Jahr<br />
2022 (jeweils zur Hälfte Stein- und Braunkohle) sinken.<br />
Im Jahr 2030 sollen noch 17 Gigawatt (9 Braunkohle/8<br />
Steinkohle) am Netz sein. Manche Mitglieder der Kommission,<br />
wie auch viele gesellschaftliche Gruppen,<br />
hätten gerne einen schnelleren Kohleausstieg<br />
gesehen, andere hingegen lehnen ein Enddatum<br />
für die Kohle gänzlich ab – und<br />
so steht nun als Kompromiss das<br />
Jahr 2038 im Raum mit diversen<br />
Terminen einer Überprüfung.<br />
Vielleicht soll aber auch schon<br />
2035 Schluss sein; man will<br />
bis dahin mehrfach den Prozess<br />
evaluieren.<br />
Schon die Umfänge des Abschlussberichts<br />
machen jedoch<br />
deutlich, worum es vor<br />
allem geht. Dem eigentlichen<br />
Papier von 126 Seiten folgen<br />
nämlich 210 Seiten Anhang,<br />
auf denen die Wunschliste der<br />
Kohleregionen abgearbeitet<br />
wird – Förderung von Wirtschaft<br />
und Infrastruktur, von Maßnahmen<br />
der Daseinsvorsorge und von Wissenschaft<br />
und Innovation. Da werden zuhauf<br />
„Reallabore“ angekündigt und es werden<br />
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen beschrieben.<br />
Mindestens 40 Milliarden Euro soll der Staat für den<br />
Kohleausstieg bereitstellen – für die Steuerzahler wird<br />
es also teuer.<br />
Kohlekommission mit Bekenntnis zum Gas<br />
Fragen der Versorgungssicherheit hingegen werden nur<br />
am Rande behandelt. Zwangsläufig bekennt sich die<br />
Kommission zum Energieträger Gas, denn Deutschland<br />
benötige „absehbar in adäquatem Umfang gesicherte<br />
Kraftwerksleistung“. Angesichts der Klimaziele könnten<br />
dies „nach dem aktuellen Stand der Technik am<br />
besten Gaskraftwerke leisten“. Zur Herkunft des Gases<br />
jedoch – ob fossil, biogen oder als synthetisch hergestelltes<br />
Gas (Power-to-Gas) – sagt die Kohlekommission<br />
wenig. So wie auch viele andere konkrete Fragen der<br />
Energiewende offen bleiben.<br />
Die Kommission sollte eben – was schon ihre personelle<br />
Zusammensetzung dokumentiert – nur gesellschaftlichen<br />
Proporz abbilden und kein Fachgremium von<br />
Energieexperten sein. Was aus den Beschlüssen wird,<br />
wenn die Bundesregierung den Kohleausstieg in Gesetzesform<br />
gegossen hat, müssen in den kommenden<br />
Jahren dann doch die Fachleute diskutieren.<br />
Die meisten gesellschaftlichen Gruppen, die teilweise<br />
sogar direkt in der Kommission vertreten waren, äußerten<br />
sich nach Präsentation des Abschlussberichtes<br />
positiv. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND),<br />
der Deutsche Naturschutzring (DNR) und Greenpeace<br />
betonten gemeinsam, sie trügen „den Beschluss mit,<br />
weil er den jahrelangen Stillstand in der deutschen Klimapolitik<br />
aufbricht und den überfälligen Ausstieg aus<br />
der Kohle einleitet“. Da das Ergebnis aber für den Klimaschutz<br />
nicht ausreiche, sei „weiter Druck nötig für<br />
einen schnellen Kohleausstieg“. Der BUND-Vorsitzende<br />
Hubert Weiger hob hervor: „Mit der frühen Abschaltung<br />
von 3 Gigawatt Braunkohle im Rheinland ist der<br />
Hambacher Wald gerettet.“ Das sei auch „der Verdienst<br />
der neu erstarkten Klimabewegung“.<br />
Die angesprochenen Hambacher Aktivisten hingegen<br />
zeigten sich nicht zufrieden mit dem Erreichten.<br />
„Was die Kohlekommission vorlegt, ist kein Konsens.<br />
Damit wird das 1,5-Grad-Ziel unmöglich“, sagte Nike<br />
Mahlhaus, Pressesprecherin von Ende Gelände: „Die<br />
Konzerne bekommen hier Geld für nichts, was mit dem<br />
Hambi [also dem Hambacher Wald] und den Dörfern<br />
passiert, ist unklar.“ 20 Jahre Kohlekraft seien „20<br />
Jahre Kohlekraft zu viel“ und deswegen stelle sich<br />
Ende Gelände diesen Plänen entgegen.<br />
Kraftwerksplanungen der LEAG werden<br />
nicht angetastet<br />
Zu wenig Fortschritt sehen auch Kritiker in den ostdeutschen<br />
Kohlegebieten. „Während im Rheinland die<br />
notwendigen ersten Schritte zum Kohleausstieg gegangen<br />
werden, sollen die Steuermilliarden in die Lausitz<br />
18
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Politik<br />
Der BHKW-Service von WELTEC.<br />
Immer in Ihrer Nähe.<br />
Machen Sie mehr<br />
aus Ihrer Biogasanlage<br />
Installation und Reparatur von Pumpen,<br />
Rührwerken, Separatoren und Edelstahlbehältern.<br />
Als autorisierte Servicewerkstatt setzen wir auf<br />
hochwertige Komponenten unseres Partners<br />
Ihre Vorteile<br />
• alle gängigen Motoren<br />
• langjährige & geschulte Mitarbeiter<br />
• 24/7 Notdienst<br />
Organic energy worldwide<br />
WELTEC BIOPOWER GmbH<br />
04441-999 78-0<br />
info@weltec-biopower.de<br />
HARMS Systemtechnik GmbH · Alt Teyendorf 5 · 29571 Rosche<br />
Telefon: 0 58 03.98 72 77 · www.harms-system.de
Politik<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
praktisch ohne Gegenleistung fließen“,<br />
sagte René Schuster von der Grünen Liga,<br />
die Mitglied im Braunkohlenausschuss des<br />
Landes Brandenburg ist. Die Kraftwerksplanungen<br />
der Lausitz Energie Bergbau AG<br />
und Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG)<br />
würden bisher nicht angetastet. „Offenbar<br />
soll der Steuerzahler hier nicht die Folgen<br />
eines Kohleausstieges abfedern, sondern<br />
die Sparprogramme der LEAG-Eigner ausgleichen<br />
und den Landtagswahlkampf der<br />
beiden Ministerpräsidenten retten.“<br />
Die Kohlewirtschaft zeigte sich gleichwohl<br />
wenig erfreut. Der Vorstandsvorsitzende<br />
der LEAG, Helmar Rendez, monierte, dass<br />
der von der Firma „eingeforderte Planungshorizont<br />
für den Betrieb der Tagebaue und<br />
Kraftwerke im Lausitzer Revier nicht gegeben“<br />
sei. Denn bleibe es beim Ausstiegsdatum<br />
Ende 2038, werde dies das „Revierkonzept“<br />
der Firma, das bis über 2040<br />
hinausreicht, „ernsthaft infrage stellen“.<br />
Kritik äußerte auch RWE. Die Beschlüsse<br />
hätten „gravierende Folgen für das Braunkohlegeschäft“,<br />
das Enddatum im Jahr<br />
2038 sei „deutlich zu früh“. RWE-Chef<br />
Rolf Martin Schmitz sprach von „tiefen<br />
Einschnitten“. Doch während RWE noch<br />
lamentierte, hatte die Börse keine Probleme<br />
mit dem Kommissionsbeschluss: Die<br />
RWE-Aktie beendete den ersten Börsentag<br />
nach der Bekanntgabe der Pläne sogar ein<br />
wenig besser als der Dax.<br />
Während der Ausstieg nun den einen zu<br />
schnell, den anderen zu langsam geht, hob<br />
Patrick Graichen, Direktor von Agora Energiewende,<br />
diesen als „eine Sternstunde für<br />
unser politisches System“ hervor, denn er<br />
zeige, „dass sich gesellschaftliche Großkonflikte<br />
in Deutschland immer noch gemeinschaftlich<br />
lösen lassen“.<br />
Mit dem Ausstiegsbeschluss<br />
beginnt die eigentliche Arbeit<br />
Die eigentliche Aufgabe fange mit dem Beschluss<br />
der Kohlekommission aber erst an.<br />
Kohleausstieg, Versorgungssicherheit und<br />
bezahlbare Energie gemeinsam werde es<br />
nur geben, wenn die Bundesregierung sich<br />
unverzüglich daran mache, den Ausbau der<br />
Erneuerbaren Energien an der Stromversorgung<br />
von heute 38 Prozent bis 2030 auf 65<br />
Prozent zügig umzusetzen. Auch müsse der<br />
Strommarkt so flexibilisiert werden, dass<br />
die notwendigen Backup-Gas-Kraftwerke<br />
im Markt entstehen könnten. Der Branchenverband<br />
der Energiewirtschaft BDEW<br />
hob unterdessen als „eines der wichtigsten<br />
Instrumente zur Erreichung der Klimaziele“<br />
die Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung<br />
hervor.<br />
An einigen Stellen kam aber auch die Enttäuschung<br />
darüber durch, dass der Kohleausstieg<br />
von der Kommission eher als<br />
planwirtschaftliches Konstrukt mit definierten<br />
20-Jahres-Plänen denn als marktwirtschaftlicher<br />
Umbau gesehen wird.<br />
Einen solchen marktwirtschaftlichen Weg<br />
hätte man mit einer verbindlich von Jahr zu<br />
Jahr steigenden CO 2<br />
-Bepreisung schaffen<br />
können. Die Kohleblöcke wären so nach<br />
und nach aus dem Markt gedrängt worden,<br />
während die Erneuerbaren Energien sich<br />
in dem neuen Umfeld aufgrund ihrer CO 2<br />
-<br />
Neutralität immer besser hätten behaupten<br />
können.<br />
In diese Richtung argumentierte auch<br />
das Mercator Research Institute on Global<br />
Commons and Climate Change (MCC).<br />
Dessen Generalsekretärin Brigitte Knopf<br />
sagte: „Ob der deutsche Kohleausstieg als<br />
internationales Vorbild dienen kann, ist<br />
fraglich.“ Denn er könnte die Steuerzahler<br />
teuer zu stehen kommen aufgrund der<br />
vorgesehenen Entschädigungen, die nicht<br />
nur für die Kohleregionen, sondern auch für<br />
Kraftwerksbetreiber zu bezahlen seien.<br />
Sinnvoll sei ein Mindestpreis für CO 2<br />
im<br />
Stromsektor: „Ein solcher flankierender<br />
CO 2<br />
-Mindestpreis würde die Klimaschutzwirkung<br />
des beschlossenen Kompromisses<br />
absichern. Darüber hinaus<br />
würde man Einnahmen generieren, die den<br />
Strukturwandel finanzieren könnten.“ Die<br />
Politik müsse eine solche Maßnahme jetzt<br />
prüfen – als sinnvolle Ergänzung zu dem<br />
gefundenen Kompromiss.<br />
In den Sektoren, die nicht dem europäischen<br />
Emissionshandel unterliegen<br />
(speziell Verkehr und Gebäude), regt die<br />
Kohlekommission zwar die „Prüfung der<br />
Einführung einer CO 2<br />
-Bepreisung mit<br />
Lenkungswirkung“ an. Das würde aber<br />
im Stromsektor nicht unbedingt weitere<br />
Fortschritte bringen. Dass vielmehr eine<br />
sektorenübergreifende Bepreisung von<br />
CO 2<br />
-Emmissionen „das effektivste und<br />
vernünftigste Instrument“ sei, um den CO 2<br />
-<br />
Ausstoß schnell zu verringern, davon ist<br />
zum Beispiel der Ökostromanbieter Elektrizitätswerke<br />
Schönau (EWS) überzeugt.<br />
EWS fordert mit zahlreichen Unternehmen<br />
und Verbänden schon seit einiger Zeit die<br />
„Einführung eines wirksamen, sozialverträglichen<br />
CO 2<br />
-Preises für die Sektoren<br />
Strom, Wärme und Verkehr“.<br />
Strompreisentwicklung – wo geht<br />
die Reise hin?<br />
Was der aktuelle Beschluss der Kohlekommission<br />
für den Strommarkt bedeutet,<br />
haben unterdessen Energieökonomen der<br />
Enervis Energy Advisors GmbH berechnet –<br />
wenngleich, so die Analysten, aus energiewirtschaftlicher<br />
Sicht noch „eine Reihe offener<br />
Fragen und erheblicher Unsicherheiten“<br />
blieben. Modellierungen zeigten, dass<br />
das Strompreisniveau im Großhandel im<br />
Falle des Kohleausstiegs 2038 „moderat<br />
über dem Niveau eines Vergleichsszenarios<br />
ohne forcierten Kohleausstieg liegt“, sagte<br />
Mirko Schlossarczyk, Strommarktexperte<br />
der Enervis. Der mittlere Börsenpreis werde<br />
beim Kohleausstieg im Jahr 2022 um<br />
etwa 2,50 Euro pro Megawattstunde über<br />
den Prognosen des Referenzpfades liegen.<br />
Im Jahr 2030 liege der Preis im Szenario<br />
Kohleausstieg etwa 3 Euro höher.<br />
Damit aber würden die Erneuerbaren Energien<br />
ihre Position am Strommarkt nur geringfügig<br />
verbessern können. Und so bleibt<br />
weiterhin offen, mit welchen Instrumenten<br />
die geplanten 65 Prozent Erneuerbare am<br />
Strommix im Jahr 2030 erreicht werden<br />
sollen – ein Ziel, das übrigens auch die<br />
Kohlekommission bekräftigt hat.<br />
Autor<br />
Bernward Janzing<br />
Freier Journalist<br />
Wilhelmstr. 24a · 79098 Freiburg<br />
07 61/202 23 53<br />
bernward.janzing@t-online.de<br />
20
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Politik<br />
BIOGASBEHÄLTER – Fermenter, Gärrestlager, Vorgruben, ...<br />
WOLF SYSTEM GMBH | Am Stadtwald 20 | 94486 Osterhofen<br />
09932 37-0 | mail@wolfsystem.de | WWW.WOLFSYSTEM.DE<br />
Bauen mit System!<br />
Rotoren und Statoren<br />
für Excenterschneckenpumpen aller Hersteller.<br />
In Deutschland gefertigt im Originalmaß und aus<br />
demselben Material<br />
oft bis zu 40% billiger<br />
Alle Angebote unter www.ilmaco-vertrieb.de<br />
ILMACO Vertrieb oHG mb@ilmaco.de<br />
Fischerstr. 13 · 84137 Vilsbiburg · (0176) 476 494 69<br />
21
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Sicherheit ernst<br />
nehmen<br />
!<br />
22
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
praxis / Titel<br />
Das nach wie vor feststellbare Unfallgeschehen auf Biogasanlagen und die Erkenntnisse von Sachverständigenprüfungen<br />
zeigen weiterhin ein Optimierungspotenzial für die gesamte Biogasbranche auf.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Insbesondere die im letzten Jahr veröffentlichte<br />
Auswertung der Erfahrungsberichte<br />
der Sachverständigen nach<br />
§29a Bundes-Immissionsschutzgesetz<br />
(BImSchG) (KAS-46) für das Berichtsjahr<br />
2016 gab konkrete Hinweise zum<br />
weiteren Handlungsbedarf. Wie die Jahre<br />
zuvor überwiegen auch 2016 Prüfungen<br />
mit Mängeln auf Biogasanlagen (2016: 73<br />
Prozent) und zeigen die bereits seit längerem<br />
bekannten Problembereiche auf:<br />
ffAnlagenauslegung (zum Beispiel<br />
fehlender Blitzschutz etc.)<br />
ffDurchführung von Prüfungen (zum<br />
Beispiel fehlende Dokumentation/<br />
Durchführung von Prüfungen nach<br />
BetrSichV).<br />
ffProzessleittechnik (zum Beispiel<br />
fehlende Einstufung von Schutzeinrichtungen).<br />
ffBrandschutz (zum Beispiel<br />
Erstellung Feuerwehrplan).<br />
ffEx-Schutz (zum Beispiel fehlendes/<br />
mangelhaftes Ex-Schutzdokument).<br />
ffBetriebsorganisation (zum Beispiel fehlende<br />
Unterweisungen/Einweisungen,<br />
Freigaben etc.).<br />
Neben den festgestellten Mängeln bei<br />
Anlagenprüfungen waren im vergangenen<br />
Jahr 2018 leider auch Unfälle mit erheblichen<br />
Personenschäden an Biogasanlagen<br />
zu beklagen. Besonders auffällig war,<br />
dass die Ursachen bei den drei tödlichen<br />
Unfällen keine direkte Beziehung zum eigentlichen<br />
Biogasprozess hatten und alle<br />
weiteren Schadensfälle häufig in Bezug zu<br />
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten<br />
standen.<br />
Beim ersten tödlichen Unfall geriet ein Mitarbeiter<br />
eines Stromversorgungsunternehmens<br />
bei der Prüfung und dem Versuch, ein<br />
Foto eines defekten Verteilerkastens in einem<br />
Trafohaus zu machen, zu dicht an eine<br />
stromführende Leitung und erlitt tödliche<br />
Stromschläge und Verbrennungen. Beim<br />
zweiten Unfall mit Todesfolge wurde ein<br />
niederländischer LkW-Fahrer vermutlich<br />
beim Abladen von Gärsubstraten durch herabfallende<br />
Silage einer daneben befindlichen<br />
Fahrsiloanlage verschüttet und konnte<br />
nur noch tot geborgen werden.<br />
Ein ähnlicher Unfall mit zwei leicht verletzten<br />
Mitarbeitern passierte auf einer<br />
Biogasanlage in der Nähe von Günzburg.<br />
Auch dort war ein Teil der Anschnittsfläche<br />
einer Maissilage eingestürzt und hatte die<br />
Verletzten verschüttet. Der dritte tödliche<br />
Unfall ereignete sich auf einer Baustelle<br />
einer Biogasanlage, wo ein Monteur beim<br />
Anheben einer Betonverschalung durch einen<br />
in eine Antriebswelle geratenen Schal<br />
stranguliert wurde.<br />
Bei den sonstigen Schadensfällen ohne<br />
Personenschäden liegt der Schwerpunkt<br />
aus unserer Sicht derzeit bei zwei Problemfeldern:<br />
ffBrandereignisse (BHKW-Raum, Gärbehälter<br />
etc.) und<br />
ffHavarien (Freisetzung von Gärresten).<br />
Neben dem menschlichen Versagen zeigt<br />
sich derzeit, dass verstärkt Materialversagen<br />
und -ermüdungen als Unfallursachen<br />
in den Vordergrund rücken. Aus diesem<br />
Grund ist die geplante und ordnungs-<br />
Abbildung 1: Mängelschwerpunkte auf Biogasanlagen in 2016<br />
Foto: Caro_Seeberg_FOTOFINDER.COM<br />
Relative Anzahl der Mängelcode-Nennungen, normiert auf die Anzahl der Prüfungen<br />
1,500<br />
1,250<br />
1,000<br />
0,750<br />
0,500<br />
0,250<br />
-<br />
1<br />
1.<br />
Auslegung<br />
1.1<br />
1.2<br />
1.3<br />
2<br />
2.1<br />
2.<br />
Prüfungen<br />
2.2<br />
3<br />
4<br />
4.1<br />
4.<br />
PLT<br />
4.2<br />
5<br />
6<br />
8.<br />
Brandschutz<br />
7<br />
Mängelcode<br />
8<br />
9<br />
9.1<br />
9.<br />
Ex-Schutz<br />
9.1.1<br />
9.1.2<br />
9.2<br />
9.2.1<br />
9.2.2<br />
10.<br />
Organisationen<br />
10<br />
10.1<br />
10.2<br />
10.3<br />
10.4<br />
Quelle: KAS-46<br />
23
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
gemäße Wartung und Instandhaltung, insbesondere<br />
bei zunehmend älteren Anlagen,<br />
von besonderer Bedeutung (siehe Text auf<br />
Seite 32).<br />
Schwachpunkt „Mensch“<br />
immer wichtiger<br />
Da bereits beide Problemfelder Gegenstand<br />
umfangreicher technischer und organisatorischer<br />
Anforderungen (siehe Abbildung<br />
2) sind beziehungsweise im besonderen<br />
Fokus neuer Anforderungen stehen (TRAS<br />
120, AwSV, TRwS 793-1 etc.), nimmt der<br />
Schwachpunkt „Mensch“ eine zunehmend<br />
bedeutsamere Rolle ein. Aus diesem Grund<br />
ist die kontinuierliche Sensibilisierung und<br />
Schulung der Betreiber und ihrer Mitarbeiter<br />
sowie der Fachfirmen einer der wichtigsten<br />
Ansatzpunkte, Unfälle und Schadensfälle<br />
auf Biogasanlagen zu reduzieren.<br />
Der Schulungsverbund Biogas bietet hier<br />
mit seinen 14 anerkannten Bildungseinrichtungen<br />
umfassende Grund- und Auffrischungsschulungen<br />
an und wird zukünftig<br />
auch im Bereich der Instandhaltung und<br />
Errichtung Schulungen anbieten.<br />
Zum Themenbereich Brandschutz auf Biogasanlagen<br />
hatte der Fachverband Biogas<br />
bereits 2010 ein Merkblatt erstellt, das<br />
kontinuierlich angepasst und zuletzt im<br />
Herbst 2018 als Arbeitshilfe A-016 neu<br />
veröffentlicht wurde. Auch die TRAS 120<br />
(siehe Bericht auf Seite 28) behandelt das<br />
Thema Brandschutz ausführlich in verschiedenen<br />
Kapiteln (vorbeugender und<br />
abwehrender Brandschutz sowie Schutzabstände).<br />
Bei der Vermeidung von Havarien auf Biogasanlagen<br />
wird mit der im August 2017<br />
eingeführten Verordnung über Anlagen<br />
zum Umgang mit wassergefährdenden<br />
Stoffen (AwSV) und der gerade in Bearbeitung<br />
befindlichen Technischen Regel<br />
wassergefährdender Stoffe – Biogasanlagen<br />
(TRwS 793-1) die Errichtung und<br />
der Betrieb von Biogasanlagen umfassend<br />
beregelt. Aktuell deutet sich eine Novelle<br />
der AwSV an, die sicherlich auch für Biogas<br />
relevante Änderungen bringen kann. Einige<br />
wichtige Fragen zu der darin erforderlichen<br />
Fachbetriebspflicht werden auf Seite<br />
36 beantwortet.<br />
Unfall- und schadensfreien<br />
Betrieb sicherstellen<br />
Sowohl die Schadensfälle mit und ohne<br />
Personenschäden als auch die Auswertungen<br />
der Sachverständigenprüfungen<br />
zeigen weiteren Handlungsbedarf in der<br />
Biogasbranche auf. Damit dies nicht immer<br />
in neue und weitere Verschärfungen der<br />
rechtlichen und technischen Anforderungen<br />
mündet, ist es unabdingbar, dass Planer,<br />
Hersteller, Betreiber und Instandhalter<br />
einen unfall- und schadensfreien Betrieb<br />
sicherstellen und sich an den geltenden<br />
rechtlichen Rahmen halten.<br />
Seitens des Gesetzgebers beziehungsweise<br />
der regelsetzenden Behörden deuten sich<br />
aktuell weitere Entwicklungen bei den für<br />
Biogasanlagen relevanten Regelwerken an:<br />
ffÜberarbeitung der in 2015 veröffentlichten<br />
TRGS 529.<br />
ffneue DGUV-Regel zu gasbetriebenen<br />
BHKW.<br />
Der Fachverband Biogas ist in allen Diskussionen<br />
beteiligt und versucht hier mit<br />
seinen internen Gremien (AK-Sicherheit,<br />
- Prüfungen nach Anlagenverordnung<br />
wassergefährdende Stoffe (AwSV)<br />
- AwSV- Prüfung Eigenverbrauchstankstellen<br />
- AwSV- Prüfung Biogasanlagen<br />
- Abscheiderprüfungen gemäß DIN 1999-100<br />
- Behördenengineering<br />
- Dichtheitsprüfung Behälter<br />
- Dichtheitsprüfung Rohrleitungen<br />
- Erstellung Sanierungskonzepte<br />
- Ingenieurplanung Sanierung und<br />
Neubau von Fahrsiloanlagen<br />
- Beratung zur Auswahl geeigneter<br />
und zugelassener Bauprodukte<br />
- Entwässerungsplanung gemäß DWA A792<br />
- Wir begleiten Sie von der Planung<br />
bis zur Bauabnahme<br />
Ihre kompetenten Ansprechpartner in allen Fragen zur Prüfung,<br />
Entwässerungsplanung und Planung landwirtschaftlicher Anlagen<br />
Ing.-Büro<br />
Heisel<br />
ö.b.u.v. SV<br />
Sachverständigenbüro Thomas Heisel<br />
AwSV Sachverständiger der<br />
GTÜ-Sachverständigenorganisation<br />
Öffentlich bestellter und vereidigter<br />
Sachverständiger für Asphaltbau u.a.<br />
Buersche Str. 5<br />
32289 Rödinghausen<br />
Tel.: +49 5746 890 528<br />
mobil: +49 160 991 699 49<br />
24<br />
e-mail:info@Heisel-SV.de<br />
Steffen<br />
Umwelttechnik<br />
Sachverständigenbüro Thomas Steffen<br />
AwSV Sachverständiger der<br />
GTÜ-Sachverständigenorganisation<br />
Im Schierholz 2<br />
32457 Porta Westfalica<br />
Tel.: +49 5706 390 867<br />
Fax: +49 3212 141 6054<br />
mobil: +49 177 242 9754<br />
e-mail: steffen-umwelttechnik@gmx.de
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Aktivitäten der Gesetzgeber und<br />
Behörden<br />
Name der Veranstaltung am xx.yy.2016 in Musterstadt<br />
Abbildung 2: Aktivitäten des Gesetzgebers und der Behörden<br />
praxis / Titel<br />
BMUB<br />
BMAS<br />
Neu:<br />
44.<br />
BImSchV<br />
Novelle<br />
der TA-Luft<br />
Neu:<br />
Technische<br />
Regel für<br />
Anlagensicherheit<br />
(TRAS 120)<br />
AwSV<br />
TRWS 792<br />
Neu: TRWS 793<br />
- Teil 1: Neuanlagen<br />
- Teil 2: Bestandsanlagen<br />
BetrSichV<br />
2015<br />
Neu:<br />
Technische<br />
Regel für<br />
Betriebssicherheit:<br />
- TRBS 1203<br />
- TRBS 1201<br />
(beide 2018 geändert)<br />
GefStoffV<br />
2015<br />
Technische<br />
Regel für<br />
Gefahrstoffe<br />
TRGS 529<br />
(Überarbeitung <strong>2019</strong><br />
geplant)<br />
DGUV R113-001<br />
Beispielsammlung<br />
Ex-Zonen<br />
(neue Version im Frühjahr <strong>2019</strong>)<br />
DGUV Regel<br />
zu gasbetr.<br />
BHKW<br />
(neue AG in Gründung)<br />
Manuel Maciejczyk<br />
AK-Genehmigung) 17.11.2016 und der Kooperation mit<br />
dem Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches<br />
e.V. (DVGW) und der Deutschen<br />
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser<br />
und Abfall e.V. (DWA) praxistaugliche<br />
Anforderungen zur Umsetzung zu bringen.<br />
In Ergänzung zu den gesetzlichen Entwicklungen<br />
erarbeitet der Fachverband Biogas<br />
eigene Arbeitshilfen und Merkblätter, um<br />
notwendige praxistaugliche Konkretisierungen<br />
auf den Markt zu bringen.<br />
Aus der Kooperation mit den beiden Verbänden<br />
DVGW und DWA sind die in Abbildung<br />
3 dargestellten Merkblätter und Aktivitäten<br />
entstanden und werden kontinuierlich weiterentwickelt<br />
(Anmerkung: alle Merkblätter<br />
erscheinen auch inhaltsgleich als DVGW-<br />
Merkblatt). Bereits veröffentlicht sind die<br />
beiden Merkblätter DWA M-377 und DWA<br />
M-375, die den Gasspeicher hinsichtlich<br />
der Gebrauchstauglichkeit, Tragfähigkeit<br />
sowie technischen Dichtheit beschreiben.<br />
Das die Anforderungen an Gasfackeln beschreibende<br />
DWA Merkblatt M-305 steht<br />
kurz vor dem Weißdruck. Im Gelbdruck<br />
erschienen ist aktuell das DWA M-218<br />
zu den Rohrleitungen auf Biogasanlagen.<br />
Der Spezialist für Fermenter-Reinigung<br />
FERMENTER-REINIGUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU<br />
Unsere umfangreiche technische Ausstattung, hervorragend<br />
geschultes Personal sowie ein hoher Sicherheitsstandard<br />
machen uns europaweit zum führenden Unternehmen in<br />
Sachen Fermenter-Reinigung.<br />
Wir beraten Sie gerne!<br />
Tel.: 08075 1880<br />
Tel.: 08075 1 88 -0<br />
Fax: 08075 188 -81<br />
info@hoelzl.de<br />
Hölzl GmbH<br />
Rauhöd 2 • 83137 Schonstett<br />
25<br />
www.hoelzl.de
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Abbildung 3: Gemeinsame Aktivitäten der Verbände<br />
Gemeinsame<br />
Aktivitäten der<br />
Verbände<br />
Entwicklung neuer<br />
Merkblätter<br />
DWA-M 377<br />
- „Sicherstellung der<br />
Gebrauchstauglichkeit und<br />
Tragfähigkeit von<br />
Membranabdeckungen“<br />
– Weißdruck im Dez. 2016<br />
DWA-M 375<br />
- "Technische Dichtheit von<br />
Membranspeichersystemen“<br />
– Weißdruck im Sept. 2018<br />
Safety first!<br />
Sicherheit geht vor! Das gilt für Biogasanlagen<br />
genauso wie im Eiskanal. Natürlich wollte ich<br />
bei meinen Rennen immer so schnell wie möglich<br />
unten im Ziel sein – aber vor allem wollte ich<br />
heil und sicher ankommen.<br />
Wie im Spitzensport kann auch auf einer Biogasanlage<br />
jeder Fehler schlimme Folgen haben<br />
und im worst case die Gesundheit der Arbeiter<br />
gefährden. Wo an der falschen Stelle gespart<br />
wird, da können Unfälle passieren. Jeder Betreiber<br />
muss sich bewusst sein, dass er selbst für<br />
die Sicherheit auf seiner Anlage verantwortlich<br />
ist – so wie jeder Rodler für seine Fahrt selbst<br />
verantwortlich ist.<br />
Zum Glück gehen die allermeisten Betreiber<br />
sehr gewissenhaft mit ihrer Anlage um. Sie<br />
nehmen regelmäßig an Schulungen teil und<br />
veranlassen die erforderlichen Prüfungen und<br />
Sicherheitsübungen – zum Beispiel mit der<br />
örtlichen Feuerwehr. Damit sorgen sie für den<br />
sicheren Betrieb ihrer Biogasanlage.<br />
Jeder sollte sich bewusst sein: So wie wir als<br />
deutsche Rodler eine ganze Nation repräsentieren,<br />
so repräsentiert jeder Biogasanlagenbetreiber<br />
die gesamte Biogasbranche in Deutschland.<br />
Sichere und reibungslos funktionierende Anlagen<br />
sind das beste Aushängeschild.<br />
Pfiat euch,<br />
Euer<br />
DWA<br />
DVGW<br />
Fachverband<br />
Biogas<br />
Technisches<br />
Sicherheitsmanagementsystem<br />
(TSM) – Biogas<br />
Schulungsverbund<br />
Biogas<br />
Abbildung 4: Arbeitshilfen, Infopapiere und Handlungsempfehlungen<br />
des Fachverbandes Biogas e.V. zum Thema Sicherheit<br />
Sicheres Arbeiten in Fermentern<br />
DWA-M 305<br />
-"Gasfackelanlagen als<br />
zusätzliche<br />
Gasverbrauchseinrichtungen an<br />
Biogasanlagen“<br />
– Weißdruck Sommer <strong>2019</strong><br />
DWA-M 218<br />
- „Rohrleitungen auf<br />
Biogasanlagen“<br />
– Gelbdruck Februar <strong>2019</strong><br />
seit 2013 aktiv und über 6.700<br />
erfolgreich geschulte und<br />
geprüfte Teilnehmer<br />
A-002 Einweisungsprotokoll für Nachunternehmer<br />
A-002-X Mustereinweisungsprotokolle für 8 relevante Instandhaltungsarbeiten – in Abstimmung<br />
A-003 Checkliste für den sicheren Betrieb einer BGA<br />
A-004 Anforderungen an die betriebliche Organisation – überarbeitet<br />
A-005 Umgang mit Zuschlags- und Hilfsstoffen auf Biogasanlagen<br />
A-005-2 Arbeitsmedizinische Prävention – in Abstimmung<br />
A-006 Leitfaden Notstromkonzept<br />
A-008 Erstellung eines HACCP-Konzeptes beim Einsatz von Gülle in Biogasanlagen<br />
A-015 Netzanschluss<br />
A-016 Brandschutz auf Biogasanlagen – überarbeitet<br />
A-018 Einweisungsprotokoll – Sicherheitshinweise für Besucher – in deutsch und englisch<br />
A-XXX Beispielhafte PLT-Sicherheitseinrichtungen für Biogasanlagen – in Abstimmung<br />
A-XXX Checkliste Beauftragung von Nachunternehmern – in Abstimmung<br />
A-XXX Einteilung von Ex-Zonen in Biogasanlagen (DGUV Regel 113-001) – in Überarbeitung<br />
H-006 Handlungsempfehlung zur Überprüfung von Holzdecken<br />
Infopapier Prüf- und Dokumentationspflichten<br />
Infopapier Gewährleistung der Frostsicherheit auf Biogasanlagen<br />
Durch den Fachverband Biogas wurden die<br />
in Abbildung 4 aufgeführten Arbeitshilfen,<br />
Infopapiere und Handlungshilfen zum Thema<br />
Sicherheit veröffentlicht und ständig<br />
an neue Erkenntnisse und Erfordernisse<br />
angepasst.<br />
Zusammenfassung und Ausblick: Das aktuelle<br />
Unfall- und Schadensgeschehen auf<br />
Biogasanlagen zeigt weiterhin Handlungsbedarf<br />
für die Biogasbranche. Durch die<br />
jetzt weiter verschärften organisatorischen<br />
und technischen Anforderungen reagiert<br />
der Gesetzgeber. Der Fachverband Biogas<br />
wird sich für eine weitere Sensibilisierung<br />
der Branche einsetzen und praxistaugliche<br />
Hilfestellungen zur Umsetzung geben.<br />
Schlussendlich muss es uns als gesamte<br />
Biogasbranche gelingen, die Schäden<br />
und Mängel auf Biogasanlagen weiter zu<br />
reduzieren, um unnötige kostenträchtige<br />
Anforderungen und Personenschäden zu<br />
verhindern.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Geschäftsführer<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 · 85356 Freising<br />
0 81 61/98 46 60<br />
info@biogas.org<br />
26
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
praxis / Titel<br />
Doppelmembrangasspeicher | Emissionsschutzabdeckungen<br />
Gasspeicher | EPDM-Hauben<br />
Leckagefolien<br />
Baur Folien GmbH<br />
Gewerbestraße 6<br />
D-87787 Wolfertschwenden<br />
0 83 34 99 99 1-0<br />
0 83 34 99 99 1-99<br />
info@baur-folien.de<br />
d www.baur-folien.de<br />
Alter beschädigter Kolben Altes Gummi ist entfernt Der erneut vulkanisierte Kolben<br />
Segment-Kolben Linear-Kolben Flügel-Kolben<br />
Registrieren und sofort Kaufen in unserem Webshop<br />
WWW.BENEDICT-THO.NL | E: info@benedict-tho.nl | T: 0031 545 482157 |<br />
DIE BESTEN BIOGASANLAGEN<br />
mit getrennter Hydrolyse ...<br />
... nachhaltig wirtschaftlich<br />
Mehr Leistung durch zweistufige Vergärung.<br />
Wir garantieren die herstellerunabhängige<br />
Beratung und Planung.<br />
Optimierung bestehender Biogasanlagen.<br />
Durchführung von Abnahmeprüfungen nach<br />
§15 und wiederkehrender Prüfungen nach<br />
§16 BetrSichV und/oder § 29a BImSchG.<br />
INNOVAS Innovative Energie- & Umwelttechnik<br />
Anselm Gleixner und Stefan Reitberger GbR<br />
Margot-Kalinke-Str. 9 · 80939 München<br />
Tel.: 089 16 78 39 73 · Fax: 089 16 78 39 75<br />
info@innovas.com · www.innovas.com<br />
27
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Erste Bewertung der<br />
„Technischen Regel<br />
Anlagensicherheit – TRAS 120“<br />
Foto: Baur Folien<br />
Gurtverstärktes<br />
Tragluftdach.<br />
In über 35 Sitzungen hat die Kommission für Anlagensicherheit und der dazugehörige Arbeitskreis<br />
Biogas an einer Technischen Regel für Anlagensicherheit – TRAS 120 – zu sicherheitstechnischen<br />
Anforderungen an Biogasanlagen gearbeitet. Am 21. Januar <strong>2019</strong> wurde<br />
die TRAS 120 im Bundesanzeiger veröffentlicht und somit offiziell als Erkenntnisquelle zur<br />
Definition des Standes der Technik/Sicherheitstechnik veröffentlicht.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Bereits Anfang 2015 hatte das Bundesumweltministerium<br />
(BMU) der Kommission<br />
für Anlagensicherheit (KAS) den Auftrag<br />
gegeben, eine Technische Regel für Anlagensicherheit<br />
zu Biogasanlagen (TRAS<br />
120) zu entwickeln. Hintergrund waren Defizite in den<br />
Sicherheitsregeln für Biogasanlagen (TI 4) der Landwirtschaftlichen<br />
Berufsgenossenschaften (SVLFG) sowie<br />
die besondere Auffälligkeit von Biogasanlagen bei<br />
den Auswertungen der Erfahrungsberichte der Sachverständigen<br />
gemäß Paragraf (§) 29a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes<br />
(BImSchG).<br />
Zusammen mit dem aktuellen Unfall- und Schadensgeschehen<br />
auf Biogasanlagen ergaben sich akute Handlungsfelder<br />
für die KAS. Zur Bearbeitung der TRAS 120<br />
wurde aus Mitgliedern der KAS und relevanten Interessensgruppen<br />
ein Arbeitskreis Biogas gegründet. Neben<br />
dem Fachverband Biogas war nur noch ein weiterer ausgewiesener<br />
Biogas-Experte und Vertreter der Biogasbranche<br />
in dem Gremium vertreten. Der andere Teil des<br />
Arbeitskreises war geprägt durch drei Vertreter der Umweltverbände,<br />
drei Vertreter von Landesbehörden, den<br />
Berufsgenossenschaften und dem Umweltbundesamt.<br />
Diese aus unserer Sicht nicht den komplexen Fachdiskussionen<br />
angemessene Zusammensetzung und das<br />
komplizierte Verfahren, um externen Fachverstand einzubinden,<br />
waren regelmäßig Gegenstand unserer Kritik<br />
an der TRAS 120 und die Ursache für fragwürdige<br />
Mehrheitsentscheidungen bei heiklen Diskussionen.<br />
Grundsätzlich bemängelt wurde immer wieder die Vermischung<br />
des Standes der Sicherheitstechnik – relevant<br />
für Betriebsbereiche im Sinne der Störfallverordnung –<br />
und des Standes der Technik, der für alle genehmigungsbedürftigen<br />
Biogasanlagen von Relevanz ist.<br />
Aufgrund der besonderen Regelungstiefe und sehr<br />
detaillierten Beschreibung von Anforderungen wird<br />
insbesondere die Interpretation der TRAS 120 für<br />
Bestandsanlagen erhebliche Vollzugsprobleme mit<br />
sich bringen. Trotz massiver Kritik und zahlreicher<br />
Stellungnahmen des Fachverbandes Biogas wurde die<br />
TRAS 120 im Juni 2018 mit einer Gegenstimme in<br />
der KAS angenommen und nach einer Länderanhörung<br />
28
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Dokumentationsumfang wird<br />
zunehmen<br />
Die Schutzabstände zu Hochspannungsfreileitungen<br />
und Windkraftanlagen kön-<br />
praxis / Titel<br />
mit einigen notwendigen Änderungen im<br />
November 2018 final dem BMU zur Veröffentlichung<br />
übergeben.<br />
Fazit aus der Erarbeitung der<br />
TRAS 120<br />
Am Ende der Diskussionen lässt sich resümieren,<br />
dass unsere intensive Mitwirkung<br />
nicht erfolglos war und wichtige Änderungen<br />
in den zunächst zur Diskussion stehenden<br />
Texten erfolgt sind. Bei allen erzielten<br />
Kompromissen kann der finale Stand der<br />
TRAS 120 aber nicht zufriedenstellen und<br />
bedarf weiterer praxistauglicher Änderungen.<br />
Da die TRAS 120 „nur“ eine Erkenntnisquelle<br />
zum Stand der Technik beziehungsweise<br />
Stand der Sicherheitstechnik<br />
ist, obliegt es den zuständigen Vollzugsbehörden<br />
in den Ländern, die Umsetzung<br />
(zum Beispiel über Erlass, nachträgliche<br />
Anordnung oder bei Genehmigungen)<br />
durchzuführen.<br />
Eine einheitliche Anwendung in den Ländern<br />
ist bereits jetzt nicht absehbar. Eine<br />
besondere Rolle in diesem Zusammenhang<br />
werden auch die Sachverständigen<br />
nach §29a BImSchG und gegebenenfalls<br />
die zur Prüfung befähigten Personen einnehmen,<br />
da diese häufig als Gutachter<br />
der Vollzugsbehörden die Umsetzung des<br />
Standes der Technik beurteilen müssen.<br />
Somit empfehlen wir als Fachverband Biogas<br />
abzuwarten, ob und wie die TRAS 120<br />
in der Praxis durch die Behörden umgesetzt<br />
wird. Wenngleich sich jeder Anlagenbetreiber<br />
im Einzelfall Gedanken machen<br />
muss, ob nicht eine geplante Erweiterung<br />
beziehungsweise Änderung der Anlage<br />
auch gleich unter Berücksichtigung der<br />
TRAS 120 Sinn macht, um gegebenenfalls<br />
teurere Nachinvestitionen zu vermeiden.<br />
Inhalt der TRAS 120<br />
Die 43 Seiten umfassende, im Bundesanzeiger<br />
veröffentlichte TRAS 120 beschreibt<br />
nach einer Begriffsdefinition und Erläuterung<br />
von Gefahrenquellen auf Biogasanlagen<br />
im Kapitel 2 „grundsätzliche Anforderungen“<br />
(zum Beispiel Brandschutz,<br />
Betriebsorganisation, Dokumentation,<br />
Fachkunde etc.) und im Kapitel 3 „besondere<br />
Anforderungen an Anlagenteile“ (Gärbehälter,<br />
Gasspeicher, Maschinenräume,<br />
Aktivkohlefilter etc.).<br />
Insbesondere die explizite und ausführliche<br />
Beschreibung von Gefahrenquellen auf<br />
Biogasanlagen hat rein informativen Charakter<br />
und wäre in dem Regelwerk entbehrlich<br />
gewesen. Änderungsbedarf besteht<br />
aus unserer Sicht noch bei der Einstufung<br />
der Toxizität von Biogas aufgrund seiner<br />
potenziellen Schwefelwasserstoffgehalte.<br />
Hier muss nochmal eine Anpassung gemäß<br />
TRGS 529 stattfinden.<br />
Allgemeine Anforderungen<br />
Das Kapitel 2 zu den allgemeinen Anforderungen<br />
ist geprägt durch die Themen<br />
Brand- und Explosionsschutz, Schutzabstände,<br />
Betriebsorganisation und Dokumentation<br />
sowie zur Annahme von besonderen<br />
Einsatzstoffen. Als Reaktion auf<br />
fehlende Standsicherheitsnachweise in der<br />
Praxis hat der Betreiber zukünftig für alle<br />
tragenden sicherheitsrelevanten Anlagenteile<br />
entsprechende Nachweise zu führen.<br />
Bezüglich des Themas Brandschutz gibt<br />
die TRAS 120 umfangreiche Anforderungen<br />
an die Erstellung des Feuerwehrplans<br />
und des Brandschutzkonzeptes, an die<br />
brandschutztechnische Entkopplung von<br />
relevanten Anlagenteilen (Gärbehälter,<br />
BHKW- und Elektroräumen, Gärprodukttrocknern,<br />
Gasfackeln etc.), Brandalarmierung<br />
an den Betreiber und an den abwehrenden<br />
Brandschutz (Löschwassermenge,<br />
Wasserentnahmestelle etc.).<br />
Die Anforderungen beim Explosionsschutz<br />
überschneiden sich größtenteils mit der bereits<br />
bekannten TRGS 529 und der DGUV<br />
Regel 113-001 (EX-RL). Umfangreich neu<br />
geregelt ist in der TRAS 120 das Thema der<br />
Schutzabstände innerhalb der Biogasanlage<br />
und deren Anlagenkomponenten und<br />
zu externen Objekten (Anlagen, Bauwerke<br />
etc.). Im Anhang VII sind in Form einer Tabelle<br />
konkrete Abstände beschrieben, die<br />
in jedem Fall erhebliche Auswirkungen auf<br />
die Planung und den Platzbedarf neuer Biogasanlagen<br />
beziehungsweise von Anlagenerweiterungen<br />
(zum Beispiel 6 beziehungsweise<br />
10 Meter Schutzabstand zwischen<br />
Gärbehältern) haben können.<br />
Die Alternative<br />
Die 25 kg Säcke von FERRUM Scon nutze ich bei meinem Crossfit‐Training<br />
alternativ zur Hantel und in meinen Gasfiltern alternativ zur Aktivkohle. FERRUM Scon<br />
entschwefelt Biogas effizient und kostengünstig!<br />
www.schaumann-bioenergy.eu · Telefon +49 4101 218-5400<br />
29
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Ende Januar wurde die<br />
TRAS 120 im Bundesanzeiger<br />
veröffentlicht.<br />
nen zukünftig zu erheblichen Diskussionen beim Bauplanungsrecht<br />
führen. Als Reaktion auf immer wieder<br />
feststellbare Mängel bei der Betriebsorganisation, -dokumentation<br />
und Einhaltung von relevanten Prüffristen<br />
werden zukünftig noch umfangreichere Dokumentationsanforderungen<br />
auf die Betreiber zukommen.<br />
So ist neben einem Überwachungskonzept zur Eigenüberwachung<br />
ein Prüf- und Instandhaltungsplan, ein<br />
Notfall- und Alarmplan und ein Notstromkonzept zu<br />
erarbeiten beziehungsweise fortzuschreiben.<br />
Besonderen bürokratischen Aufwand wird auch die<br />
Anforderung bringen, dass die Freisetzung wesentlicher<br />
Mengen von gefährlichen Stoffen (Biogas, Gärreste<br />
etc.) durch den Betreiber der zuständigen Behörde<br />
mitzuteilen ist. Bei der Fachkunde der Betreiber ergeben<br />
sich maßgebliche Änderungen in<br />
Bezug auf die Schulungsverpflichtung<br />
von allen an der Biogasanlage beschäftigten<br />
Mitarbeitern. Neu ist in der TRAS<br />
120 auch die Fachkundeanforderung<br />
für technisch verantwortliche Personen<br />
im Bereich der Errichtung und Instandhaltung<br />
sowie die Empfehlung der<br />
Fachkunde bei der Anlagenplanung.<br />
Der Schulungsverbund Biogas bereitet<br />
aktuell die geänderten Schulungskonzepte<br />
vor und wird diese zeitnah zur<br />
Verfügung stellen. Konkretisiert wurde<br />
auch die Dichtheitsprüfung der Biogasanlagen<br />
alle drei Jahre und einer<br />
dazwischen stattfindenden wiederkehrenden<br />
Gaskamerabegehung. Ob sich<br />
die in der TRAS 120 geforderte Prüfung<br />
durch einen Sachverständigen gemäß<br />
§29a BImSchG in allen Bundesländern<br />
durchsetzt, bleibt abzuwarten.<br />
Bei der Prüfung von Holzunterkonstruktionen bei<br />
Gasspeichern konnte seitens des Fachverbandes ein<br />
anlassbezogener beziehungsweise 6-jährlich wiederkehrender<br />
Belastungstest als Kompromiss erreicht<br />
werden. Wie bereits aus der TRGS 529 bekannt, gibt<br />
auch die TRAS 120 weitere Anforderungen (Schnelltest<br />
zu Annahme, Dokumentation, technische Anforderungen<br />
bei der Annahme/Lagerung, Abluftabsaugung<br />
etc.) beim Umgang mit besonderen Einsatzstoffen<br />
(zum Beispiel Bioabfälle, tierische Nebenprodukte mit<br />
Ausnahme von Gülle und Mist) vor.<br />
Beim Blitzschutz wird explizit die Anforderung definiert,<br />
dass ein äußerer Blitzschutz bei Biogasanlagen<br />
im Regelungsbereich der Störfallverordnung notwendig<br />
ist, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass<br />
Foto: Manuel Maciejczyk<br />
Biogaskontor<br />
Köberle GmbH<br />
Wir können mit Druck umgehen<br />
Bullaugen für alle Einsatzfälle<br />
Für Kernbohrung<br />
oder Futterhülse<br />
Auf Stahlplatte nach<br />
Kundenmaß<br />
In Tauchhülse für<br />
Blick um die Ecke<br />
Über-/Unterdrucksicherung<br />
ÜU-TT<br />
Ø300 + Ø400 mm<br />
für Folienhauben<br />
Zubehör: Leuchten, Rosetten, Futterhülsen, Sonnenschutzhauben, etc.<br />
30<br />
Weitere Komponenten: Luftdosierstationen zur Entschwefelung, Füllstandsüberwachung, Messtechnik, Warnschilder<br />
Über-/Unterdrucksicherung<br />
ÜU-GD<br />
für Betondecken<br />
www.biogaskontor.de • info@biogaskontor.de • Germany 89611 Obermarchtal • Tel +49(0)737595038-0
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
praxis / Titel<br />
eine ernste Gefahr ausgeschlossen ist. Die Interpretation<br />
dieser Anforderung in der Praxis wird sicherlich zu<br />
einigen Diskussionen führen.<br />
Besondere Anforderungen an Anlagenteile<br />
Das Kapitel 3 der TRAS 120 beschreibt sehr detailliert<br />
Anforderungen an spezifische Anlagenteile, wie<br />
zum Beispiel die Substratvorbehandlung, Gärbehälter,<br />
Gasspeichersysteme, Maschinenräume, Aktivkohlefilter,<br />
Gasfackeln, Gärprodukttrockner, PLT (Prozessleittechnik/Anlagensteuerung)<br />
und Elektrotechnik. Als<br />
wesentliche Anforderung bei den Gärbehältern soll<br />
zukünftig eine Erfassung der Gasspeicher- und Substratfüllstände<br />
sowie eine alarmüberwachte Über- und<br />
Unterdrucksicherung verbaut werden.<br />
Ein Schwerpunktthema der TRAS 120 ist die technische<br />
Ausführung von Gasspeichersystemen. Erfreulicherweise<br />
wird hier auf die vom Fachverband Biogas<br />
maßgeblich erstellten DWA-Merkblätter M-375 und<br />
M-377 verwiesen. Darüber hinaus definiert die TRAS<br />
120 detaillierte Anforderungen an die Standsicherheit,<br />
Ableitfähigkeit, schwere Entflammbarkeit und<br />
die farbliche Ausgestaltung der Gasspeichersysteme.<br />
Bestehende Membransysteme sind zum Ende der vom<br />
Hersteller angegebenen Standzeit auszutauschen.<br />
Sofern keine Herstellerangabe vorliegt und eine sicherheitstechnische<br />
Prüfung der Membran kein positives<br />
Ergebnis bringt, sind diese Membranen nach spätestens<br />
sechs Jahren auszutauschen. Sicherlich eine der<br />
kostenträchtigsten Anforderungen in der TRAS 120<br />
stellt die zukünftige Forderung einer zweischaligen<br />
Gasmembran und der kontinuierlichen Zwischenraumüberwachung<br />
dar. Trotz umfangreicher Diskussionen<br />
konnte diese aus Sicht der Biogasbranche unverhältnismäßige<br />
Verschärfung der technischen Anforderungen<br />
nicht verhindert werden.<br />
Klemmschlauchverbot wurde verhindert<br />
Je nachdem wie die zuständige Vollzugsbehörde die<br />
TRAS 120 zur Umsetzung bringt, kann diese Anforderung<br />
zum Ende der einschaligen Gasspeichersysteme<br />
bei den relevanten Anlagen führen. Erfolgreich verhindert<br />
werden konnte das drohende gänzliche Verbot der<br />
Klemmschlauchanbringung der Gasspeichersysteme<br />
am Gärbehälter. Zukünftig sollen Klemmschlauchsysteme<br />
diverse zusätzliche Anforderungen (Überwachung<br />
Innendruck des Klemmschlauches, Rückschlagventil<br />
etc.) erfüllen und mit einer zusätzlichen mechanischen<br />
Einrichtung (zum Beispiel Gurte, Seile etc.) gegen<br />
spontanes Versagen ausgerüstet sein.<br />
Weitere spezifische Anforderungen sind bei der Überwachung<br />
von Maschinenräumen (BHKW-Räume), von<br />
Aktivkohlefiltern (inkl. Bereithaltung von Inertgas) und<br />
Gärprodukttrocknern (Brand- und Explosionsschutz)<br />
definiert. Bei Prozessleittechnik (PLT) wird auf die SIL-<br />
Klassifizierung verwiesen und bei der Elektrotechnik<br />
die notwendige Fachkunde beziehungsweise Überwachung<br />
von Elektroräumen gefordert.<br />
Abschließend lässt sich feststellen, dass auf die Betreiber<br />
und Hersteller neue umfangreiche Herausforderungen<br />
zukommen können, je nachdem wie die zuständigen<br />
Landesvollzugsbehörden die TRAS 120 als<br />
Erkenntnisquelle anwenden.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Geschäftsführer<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 · 85356 Freising<br />
0 81 61/98 46 60<br />
info@biogas.org<br />
Die Biogas Prüf GmbH Nord hat sich auf alle Themen rund um die Prüfungen<br />
auf Biogasanlagen, Biogasaufbereitungsanlagen sowie Biogaseinspeiseanlagen<br />
spezialisiert. Dies beinhaltet sicherheitstechnische und wasserrechtliche<br />
Prüfungen sowie die Durchführungen von Betreiberschulungen.<br />
Folgende Leistungen können wir den Betreibern anbieten:<br />
Sicherheitstechnische Prüfungen gem. § 29a BImSchG<br />
Prüfung des Explosionsschutzes und der Explosionssicherheit<br />
als „zur Prüfung befähigte Person“ gemäß BetrSichV<br />
Prüfung gemäß AwSV<br />
Dokumentationserstellung<br />
Betreiberschulung gemäß TRGS 529<br />
Unsere oberste Priorität ist es, gemeinsam mit den Betreibern individuelle, qualitative<br />
und kostengünstige Lösungen zu finden. Wir zeigen, dass Investitionen in die Sicherheit<br />
nicht nur Kosten bringen, sondern diese an anderer Stelle nachhaltig reduzieren und<br />
somit einen entscheidenden Faktor des Erfolges darstellen.<br />
Biogas Prüf GmbH Nord<br />
Stover Weg 2<br />
18198 Kritzmow /Landkreis Rostock<br />
038207-683300<br />
office@biogas-pruef-gmbh.de<br />
31<br />
www.biogas-pruef-gmbh.de
Der Anlagenbetreiber<br />
ist verpflichtet, Fremdunternehmen<br />
vor<br />
Aufnahme der Tätigkeit<br />
bezüglich der Gefährdungen<br />
auf der Anlage<br />
zu unterweisen.<br />
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Foto: Andreas Dittmer<br />
Rechtliche Anforderungen an<br />
die sichere Instandhaltung<br />
Instandhaltungsmaßnahmen bergen ein erhöhtes Gefahrenpotenzial, dienen aber nicht<br />
nur dem Schutz und der Sicherheit des Personals, sondern unterstützen auch die Langlebigkeit<br />
der Maschinen, Geräte und Arbeitsmittel. Nicht vorhersehbare Reparaturen und<br />
Neuanschaffungen können zum Betriebsausfall und damit zu erheblichen Kosten führen.<br />
Von Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Marion Wiesheu<br />
Nach der Betriebssicherheitsverordnung<br />
(BetrSichV) hat der Arbeitgeber Instandhaltungsmaßnahmen<br />
zu ergreifen, damit<br />
die Arbeitsmittel die gesamte Verwendungsdauer<br />
den für sie geltenden Sicherheits-<br />
und Gesundheitsanforderungen entsprechen<br />
[Paragraf (§)10 BetrSichV]. Die Instandhaltung dient<br />
aber nicht nur der Sicherheit, sie ist eine Grundvoraussetzung<br />
für die dauerhafte Betriebsbereitschaft der<br />
Anlage und damit auch entscheidend für einen wirtschaftlichen<br />
Betrieb. Eine schlecht Instandgehaltene<br />
Anlage hat unter Umständen hohe Ausfallzeiten und<br />
damit hohe finanzielle Einbußen.<br />
Bei Instandhaltungsmaßnahmen, aber auch durch nötige<br />
nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen<br />
sind in jüngster Vergangenheit einige teilweise schwere<br />
Unfälle in der Biogasbranche passiert. Diese erstreckten<br />
sich unter anderem über Brände – ausgelöst durch<br />
Schweißarbeiten an Behältern – bis hin zu Havarien,<br />
ausgelöst durch gealterte Gummimanschetten von<br />
Rührwerken, die ungenügend inspiziert und gewechselt<br />
wurden.<br />
Um diese Gefährdungen zu minimieren, hat der Gesetzgeber<br />
zahlreiche Regelungen und Vorgaben geschaffen.<br />
Diese sind unter anderem zu finden in der<br />
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), der Gefahrstoffverordnung<br />
(GefStoffV), der Technischen Regel<br />
für Gefahrstoffe (TRGS 529) und seit 21. Januar<br />
auch in der Technischen Regel für Anlagensicherheit<br />
(TRAS 120).<br />
Im Folgenden wird ein nicht abschließender Überblick<br />
über die wichtigsten Aspekte zur Instandhaltung auf<br />
Biogasanlagen gegeben. Die Instandhaltung lässt sich<br />
in vier Teilbereich untergliedern:<br />
ffInspektion: Prüfung und Bewertung des Istzustandes<br />
und Vergleich mit dem Sollzustand.<br />
ffWartung: pflegen, reinigen, schmieren, auffüllen,<br />
neu einstellen usw.<br />
ffInstandsetzung: Austausch und Ersatz defekter<br />
Maschinen, Geräte und Teile.<br />
f f Verbesserung: zusätzliche oder neue Geräte, Maschinen<br />
und Anlagen für mehr Sicherheit und eine<br />
höhere Effizienz.<br />
32
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
praxis / Titel<br />
Gefährdungsbeurteilung<br />
Nach den vorgenannten Regelwerken ist<br />
bereits in der Gefährdungsbeurteilung<br />
das Thema Instandhaltung explizit zu berücksichtigen.<br />
Für die Gewährleistung des<br />
bestimmungsgemäßen Betriebs ist zu prüfen,<br />
welche Instandhaltungsmaßnahmen<br />
regelmäßig erforderlich sind. Hierfür sind<br />
unter anderem die Angaben des jeweiligen<br />
Herstellers (Betriebsanleitungen), des<br />
geltenden Regelwerks, die Umgebungsbedingungen,<br />
das Bedienpersonal und die<br />
Nutzungsintensität zu berücksichtigen.<br />
Auf dieser Basis ist neben den möglichen<br />
Gefährdungen und den daraus resultierenden<br />
Schutzmaßnahmen auch ein Prüf- und<br />
Instandhaltungsplan zu erarbeiten und zu<br />
dokumentieren (§5 ArbSchG, §3 BetrSichV,<br />
§6 GefStoffV, TRGS 529, TRAS 120).<br />
Bestimmte Instandhaltungsmaßnahmen<br />
sind selten oder spontan durchzuführen<br />
und häufig mit einer erhöhten Gefährdung<br />
durch besondere Betriebszustände (Anund<br />
Abfahren von Behältern) verbunden,<br />
wie zum Beispiel bei dem Wechsel eines<br />
Tauchmotorrührwerks. In solchen Fällen<br />
ist stets eine Einzelfallbetrachtung (TRGS<br />
529 Teil 3.1) erforderlich, und die Gefährdungsbeurteilung<br />
ist immer vor Aufnahme<br />
der Tätigkeit durchzuführen und/oder zu<br />
aktualisieren.<br />
Unterweisung der Mitarbeiter<br />
Wie bei allen Tätigkeiten auf Biogasanlagen<br />
sind Mitarbeiter unter Berücksichtigung<br />
der Gefährdungsbeurteilung vor erstmaliger<br />
Arbeitsaufnahme zu unterweisen.<br />
Die Unterweisung ist regelmäßig zu wiederholen<br />
(mindestens jährlich) und vor allem<br />
bei Instandhaltungsmaßnahmen auch<br />
anlassbezogen durchzuführen (§14 Gef -<br />
StoffV, §12 BetrSichV, TRGS 555, TRGS<br />
529 Teil 5.3).<br />
Prüf- und Instandhaltungspläne<br />
Der aus der Gefährdungsbeurteilung hervorgehende<br />
und individuell für die Anlage<br />
erstellte Prüf- und Instandhaltungsplan<br />
sollte mindestens die Kontrollmaßnahme,<br />
die Kontrollhäufigkeit (täglich, wöchentlich,<br />
monatlich ...) und die Verantwortlichkeiten<br />
beschreiben sowie die Durchführung,<br />
Messungen und vorgefundene<br />
Mängel mit Datum und Unterschrift dokumentieren.<br />
Vorgefundene Mängel sind<br />
entsprechend ihrer Schwere direkt oder<br />
zeitnah zu beseitigen und mit dem Betriebsleiter<br />
zu besprechen. Die TRAS 120<br />
stellt hier zusätzliche Anforderungen an<br />
genehmigungsbedürftige Anlagen und<br />
Anlagen, die der Störfallverordnung unterliegen.<br />
Diese sollen zusätzlich ein Konzept<br />
zur Eigenüberwachung nach Anhang VI der<br />
TRAS 120 erstellen und umsetzen.<br />
Erhöhter Inspektions- und<br />
Wartungsbedarf bei alten Anlagen<br />
und -teilen<br />
Viele Biogasanlagen gehen mittlerweile auf<br />
die 20 Jahre zu oder sind schon älter. Durch<br />
einige Unfälle Ende letzten Jahres hat sich<br />
gezeigt, dass gerade bei älteren Anlagen<br />
ein großes Augenmerk auf die Inspektion<br />
gelegt werden muss. Das Material von Behältern,<br />
Rohren, Folienhauben usw. ist oft<br />
anspruchsvollen Umgebungsbedingungen<br />
ausgesetzt. Daher sollte in der regelmäßigen<br />
Überarbeitung und Aktualisierung der<br />
Prüf- und Instandhaltungspläne besonders<br />
bei alten Anlagenteilen eine erforderliche<br />
Erhöhung der Inspektionshäufigkeit und/<br />
oder ein vorbeugender Austausch geprüft<br />
werden.<br />
Änderungen an Geräten und<br />
Maschinen bei der Instandsetzung<br />
Werden Änderungen an Anlagenteilen oder<br />
Arbeitsmitteln vorgenommen, so ist die Gefährdungsbeurteilung<br />
für diese zu aktualisieren.<br />
Es ist weiter zu überprüfen, ob sich<br />
durch diese Änderungen Pflichten aus dem<br />
Produktsicherheitsgesetz für den Biogasanlagenbetreiber<br />
ergeben (Anpassung von<br />
Betriebsanweisungen, Wartungsplänen<br />
etc.) und ob die Instandsetzungsmaßnahme<br />
prüfpflichtig nach der Betriebssicherheitsverordnung<br />
ist.<br />
Werden Instandsetzungsmaßnahmen an<br />
Geräten vorgenommen, die sich in explosionsgefährdeten<br />
Bereichen befinden oder<br />
auf diese einwirken, so ist eine Prüfung<br />
durch eine zugelassene Überwachungsstelle<br />
oder eine zur Prüfung befähigte<br />
Person nach Anhang 2; Nr. 3.2 BetrSichV<br />
durchzuführen, diese finden Sie häufig<br />
beim beauftragten Serviceunternehmen.<br />
Beauftragung von Serviceunternehmen/Fremdfirmen<br />
Für bestimmte Instandhaltungsmaßnahmen<br />
ist oft die Unterstützung eines Serviceunternehmens<br />
beziehungsweise einer<br />
Fremdfirma nötig, wie zum Beispiel bei<br />
der Reinigung von Fermentern oder dem<br />
Modulares System zur<br />
Fremdkörperabscheidung<br />
und Zerkleinerung<br />
NEU: WANGEN<br />
+ =<br />
Die WANGEN X-UNIT kommt<br />
überall dort zum Einsatz, wo<br />
Fremdkörper und Störstoffe<br />
aus Fördermedien separiert<br />
und zerkleinert werden müssen.<br />
Link zum Video<br />
Pumpenfabrik<br />
Wangen GmbH<br />
Simoniusstrasse 17<br />
88239 Wangen i.A., Germany<br />
www.wangen.com · mail@wangen.com<br />
Die Pumpen Experten. Seit 1969.<br />
BiogasJournal_55x241_DE.indd 1 04.02.<strong>2019</strong>3307:55:07
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Wechsel einer Folienmembrane. Durch<br />
die Beauftragung einer Fremdfirma geht<br />
die Verantwortung im Arbeitsschutz aber<br />
nicht in Gänze an die Fremdfirma über. Die<br />
Verantwortung bleibt weiter grundsätzlich<br />
beim Anlagenbetreiber.<br />
Der Betreiber ist daher dazu verpflichtet:<br />
ffsich von der Fachkunde der Firma für<br />
die jeweilige Tätigkeit zu überzeugen,<br />
ffzusammen mit der Fremdfirma für die<br />
jeweilige Tätigkeit eine individuelle<br />
Gefährdungsbeurteilung zu erstellen,<br />
ffdie Fremdfirma auf der eigenen Anlage<br />
bezüglich möglicher Gefährdungen zu<br />
unterweisen und<br />
ffdurch einen Erlaubnisschein die Arbeiten<br />
freizugeben (§10 BetrSichV, TRGS<br />
529 Teil 3.3).<br />
Für Instandhaltungsmaßnahmen, die eine<br />
unmittelbare Bedeutung für die Anlagensicherheit<br />
hinsichtlich Gewässerschutz<br />
haben, hat der Betreiber einen Fachbetrieb<br />
nach §62 AwSV zu beauftragen und<br />
den Nachweis über das entsprechende<br />
Zertifikat einzufordern.<br />
Ausführende Unternehmen müssen für gefährliche<br />
Arbeitsverfahren einen mit den<br />
Gefährdungen, Schutzmaßnahmen und<br />
den zu beachtenden rechtlichen Anforderungen<br />
vertrauten Aufsichtführenden benennen.<br />
Können bei Zusammenarbeit von<br />
Beschäftigten mehrerer Arbeitgeber besondere<br />
Gefahren auftreten, so ist durch die<br />
Beteiligten ein Koordinator mit Weisungsbefugnis<br />
zu bestellen.<br />
Zur Unterstützung bei der Unterweisung<br />
steht Biogasanlagenbetreibern und Serviceunternehmen<br />
derzeit die Arbeitshilfe<br />
A-002 „Einweisungsprotokoll für Nachunternehmer“<br />
des Fachverbandes Biogas auf<br />
der Homepage zur Verfügung. Zusätzlich<br />
arbeitet im Moment die AG Instandhaltung<br />
im Fachverband Biogas an sechs Mustereinweisungsprotokollen<br />
inklusive Gefährdungsbeurteilung<br />
und Freigabeschein<br />
für besonders gefährliche Tätigkeiten auf<br />
Biogasanlagen. Des Weiteren wird ein Leitfaden<br />
zur Beauftragung von Fremdfirmen<br />
erarbeitet.<br />
Regelmäßige Inspektion, Wartung und Instandsetzung im Rahmen eines Prüf- und Instandhaltungsplanes.<br />
Alleinarbeit<br />
Unabhängig davon, ob Tätigkeiten von einem<br />
Mitarbeiter oder einem Serviceunternehmen<br />
durchgeführt werden, ist bereits<br />
im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung<br />
zu prüfen und zu dokumentieren, welche<br />
Tätigkeiten nicht in Alleinarbeit durchgeführt<br />
werden können. Gerade bei Instandhaltungsmaßnahmen<br />
ist nach der TRGS<br />
529 Nr. 5.5 Alleinarbeit bei Tätigkeiten<br />
in Behältern und engen Räumen sowie bei<br />
Tätigkeiten, bei denen eine Explosionsgefahr<br />
besteht oder entstehen kann, nicht<br />
zulässig.<br />
Die Anwesenheit eines Sicherungspostens<br />
senkt zum Beispiel das Risiko vieler Instandhaltungsmaßnahmen<br />
erheblich. Wird<br />
in der Gefährdungsbeurteilung Alleinarbeit<br />
zugelassen, so sind gegebenenfalls zusätzliche<br />
organisatorische, technische und persönliche<br />
Schutzmaßnahmen zu ergreifen<br />
und zu dokumentieren.<br />
Fachkunde<br />
Sowohl in der BetrSichV, der TRGS 529<br />
als auch in der TRAS 120 wird vorgegeben,<br />
dass Instandhaltungsmaßnahmen<br />
nur von fachkundigen, beauftragten und<br />
unterwiesenen Beschäftigten und Fremdfirmen<br />
durchgeführt werden dürfen. So ist<br />
der Anlagenbetreiber dazu verpflichtet, die<br />
Qualifikation seiner Mitarbeiter und der<br />
Mitarbeiter des Serviceunternehmens zu<br />
hinterfragen. Bei Beauftragung von Serviceunternehmen<br />
sollte nach Nachweisen<br />
zu Berufsausbildung, Erfahrung und Fortbildung<br />
gefragt werden.<br />
Die TRAS 120 geht nun noch einen Schritt<br />
weiter. Sie fordert, dass auf jeder Biogasanlage<br />
eine fachkundige, (inklusive Berufsausbildung)<br />
für die Instandhaltung<br />
verantwortliche Person vorhanden sein<br />
muss. Diese kann der Betreiber, eine von<br />
ihm benannte Person oder eine Person in<br />
einem mit der Instandhaltung beauftragten<br />
Unternehmen sein. Zur Erlangung der<br />
Fachkunde hat die für die Instandhaltung<br />
verantwortliche Person einmalig an einer<br />
Grundschulung und zur Aufrechterhaltung<br />
der Fachkunde entsprechend der Entwicklung<br />
des Standes der Technik und des Standes<br />
der Sicherheitstechnik mindestens alle<br />
vier Jahre an einer Fortbildung erfolgreich<br />
teilzunehmen. Da die TRAS 120 eine Erkenntnisquelle<br />
ist, bleibt abzuwarten inwieweit<br />
Länder und Behörden dies einfordern.<br />
Der Fachverband Biogas erarbeitet derzeit<br />
zusammen mit der AG Instandhaltung und<br />
dem Fachbeirat des Schulungsverbundes<br />
Biogas ein Lehrkonzept für die Instandhaltung<br />
verantwortlichen Personen von<br />
Biogasanlagen und Serviceunternehmen.<br />
Autorin<br />
Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Marion Wiesheu<br />
Leiterin des Referates Qualifizierung und Sicherheit<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12, 85356 Freising<br />
0 81 61/98 46 60<br />
marion.wiesheu@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
Foto: Baerwald<br />
34
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
praxis / Titel<br />
ASD<br />
ASD bietet<br />
folgende<br />
folgende<br />
Leistungen<br />
Leistungen<br />
für<br />
für<br />
Biogasanlagen<br />
ASD bietet folgende an: an:<br />
Leistungen für<br />
für<br />
Biogasanlagen<br />
ASD Biogasanlagen bietet folgende<br />
an:<br />
an: Leistungen für<br />
Biogasanlagen an:<br />
‣ Arbeitssicherheit<br />
‣ ‣ Arbeitssicherheit<br />
ASD Arbeitsmedizin bietet folgende Leistungen für<br />
‣ Gutachten durch einen Sachverständigen nach § 29a BimSchG<br />
‣ ‣ Arbeitsmedizin<br />
Arbeitssicherheit<br />
Gutachten durch einen Sachverständigen nach § 26 BimSchG<br />
‣<br />
Gutachten Gutachten Biogasanlagen ‣ Arbeitsmedizin<br />
Arbeitssicherheit<br />
ASD Prüfung gemäß bietet durch durch Betriebssicherheitsverordnung<br />
einen folgende einen an:<br />
Sachverständigen<br />
Sachverständigen Leistungen nach § für 29a BimSchG<br />
‣ Betreuung in der Bau- und Planungsphase durch einen<br />
‣ nach Gutachten Arbeitsmedizin<br />
Sicherheits-<br />
§ 29a BimSchG durch einen Sachverständigen nach § 29a 26 BimSchG<br />
und Gesundheitsschutzkoordinator<br />
Prüfung Biogasanlagen ASD bietet folgende<br />
gemäß<br />
durch einen<br />
Betriebssicherheitsverordnung<br />
an: Leistungen für<br />
‣ Gutachten Arbeitssicherheit durch einen Sachverständigen nach § 29a 26 BimSchG<br />
nach Betreuung Prüfung Gutachten<br />
Biogasanlagen § 26 gemäß BimSchG in durch der Betriebssicherheitsverordnung<br />
Bau- einen und an: Planungsphase durch einen<br />
‣ Arbeitsmedizin Sachverständigen nach § 26 BimSchG<br />
Sicherheits- Alles aus einer und Hand<br />
Gesundheitsschutzkoordinator<br />
‣ Prüfung<br />
Betreuung Prüfung Gutachten Arbeitssicherheit gemäß gemäß durch der Betriebssicherheitsverordnung<br />
Bau- einen Sachverständigen Planungsphase nach durch § 29a einen BimSchG<br />
Sicherheits- Haben wir Ihr Interesse und geweckt? Gesundheitsschutzkoordinator<br />
‣ Betreuung<br />
Betreuung Gutachten Arbeitsmedizin<br />
Arbeitssicherheit in<br />
in durch der<br />
der<br />
Bau-<br />
Bau- einen und Sachverständigen Planungsphase<br />
Planungsphase nach durch § 26 einen BimSchG<br />
‣ durch Sicherheits- Prüfung Gutachten Arbeitsmedizin<br />
Dann einen gemäß<br />
nehmen Sicherheits- durch und Betriebssicherheitsverordnung<br />
Gesundheitsschutzkoordinator<br />
Sie mit einen uns Sachverständigen Kontakt Gesundheitsschutzkoordinator<br />
Alles aus einer Hand<br />
auf nach § 29a BimSchG<br />
‣ Betreuung Gutachten in durch der Bau- einen und Sachverständigen Planungsphase nach durch § 29a 26 einen<br />
BimSchG<br />
Sicherheits- Alles info@asd-droege.de aus einer und Gesundheitsschutzkoordinator<br />
Hand www.asd-droege.de<br />
‣ Prüfung<br />
Alles Gutachten gemäß<br />
Haben aus wir einer durch Betriebssicherheitsverordnung<br />
Ihr Interesse Hand einen Sachverständigen nach § 26 BimSchG<br />
Betreuung Alles aus einer der Bau- Hand<br />
geweckt?<br />
‣ Prüfung gemäß Betriebssicherheitsverordnung<br />
und Planungsphase durch einen<br />
‣ Haben Sicherheits- Betreuung Haben wir wir Ihr Ihr Interesse in und Interesse der Gesundheitsschutzkoordinator<br />
Bau- geweckt? geweckt?<br />
Planungsphase durch einen<br />
Dann Haben Alles wir aus<br />
nehmen Ihr einer Interesse Sie<br />
Hand<br />
mit geweckt? uns Kontakt auf<br />
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator<br />
Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf<br />
Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf<br />
Dann Haben Alles info@asd-droege.de<br />
wir aus nehmen Ihr einer Interesse Sie Hand mit geweckt?<br />
www.asd-droege.de<br />
uns Kontakt auf<br />
Alles<br />
info@asd-droege.de<br />
aus einer Hand<br />
www.asd-droege.de<br />
Dann Haben info@asd-droege.de<br />
wir nehmen Ihr Interesse Sie mit geweckt? www.asd-droege.de<br />
uns Kontakt auf<br />
Haben wir Ihr Interesse geweckt?<br />
Dann info@asd-droege.de<br />
nehmen Sie mit www.asd-droege.de<br />
uns Kontakt auf<br />
Dann Anlagensicherheit nehmen Sie mit uns Kontakt an auf<br />
info@asd-droege.de<br />
Biogas- und JGS-Anlagen<br />
info@asd-droege.de<br />
www.asd-droege.de<br />
www.asd-droege.de<br />
Besuchen Sie unsere Schulungen,<br />
absolvieren Sie einen<br />
Grund- und Aufbaukurs für<br />
Arbeiten an JGS- und Biogasanlagen und<br />
werden Sie Fachbetrieb nach<br />
§ 62 WHG sowie § 62 AwSV<br />
Die aktuellen<br />
Schulungstermine, auch in Ihrer Nähe,<br />
finden Sie auf unserer Website<br />
www.geopohl.com<br />
Anlagenprüforganisation GEOPOHL AG<br />
Johannes-Reitz-Straße 6, 09120 Chemnitz<br />
Telefon 0371-844949-0<br />
www.geopohl.com<br />
office@geopohl.com<br />
35
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Interview<br />
Foto: Privat<br />
Auf die<br />
Fachbetriebspflicht<br />
achten!<br />
Zur Person<br />
Frau Blarr promovierte 2009 zur Doktorin der Agrarwissenschaften<br />
am Institut für Ressourcenmanagement<br />
der Universität Gießen zum Thema<br />
„Erkennung, Quantifizierung und Verminderung<br />
punktueller Pflanzenschutzmitteleinträge in<br />
Oberflächengewässer“. Ebenfalls 2009 erhielt<br />
sie ihre DAU-Zulassung als Umweltgutachterin<br />
für den Bereich „Stromerzeugung aus Erneuerbaren<br />
Energien“.<br />
Seit 2014 arbeitet Frau Blarr unter der Firmierung<br />
Fabicon freiberuflich. 2016 hat sie die<br />
Fachbetriebsgemeinschaft Maschinenbau e.V.<br />
(FGMA) als Prüferin und Sachverständige für<br />
alle Anlagen zum Umgang mit wassergefährden<br />
Stoffen aufgenommen. In ihrem Arbeitsalltag<br />
dreht sich alles um Gewässerschutz/AwSV, Umweltgutachten<br />
und Zertifizierung, Energiemanagementsysteme,<br />
betrieblicher Umweltschutz<br />
und Nachhaltigkeitsstrategien.<br />
Weitere Informationen unter:<br />
www.fabicon-umweltgutachten.de<br />
Die im August 2017 in Kraft getretene Verordnung über Anlagen zum<br />
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) schreibt für Biogasanlagen<br />
bundeseinheitlich die Fachbetriebspflicht vor. Dr. Annika Blarr,<br />
Sachverständige der Fachbetriebsgemeinschaft Maschinenbau (FGMA)<br />
mit Themenschwerpunkt anlagenbezogener Gewässerschutz, gibt<br />
Antworten auf das Ob und Wie sowie worauf Biogasanlagenbetreiber<br />
achten sollten.<br />
Interviewerin: Dipl.-Ing. agr. Steffi Kleeberg<br />
Biogas Journal: Was bedeutet<br />
die Fachbetriebspflicht für Biogasanlagen?<br />
Dr. Annika Blarr: Wenn man<br />
eine Biogasanlage durch eine<br />
AwSV-Brille betrachtet, stellt<br />
man fest, dass sie aus wasserrechtlicher<br />
Sicht in unterschiedliche<br />
Teilbereiche<br />
(sogenannte „Anlagen und Anlagenteile“)<br />
untergliedert wird.<br />
Anlagenteile sind klassischerweise:<br />
Abfüllplätze, Siloanlage,<br />
Sickersaftrohrleitungen,<br />
Sickersaftbehälter, Vorgrube,<br />
Fermenter, Gärbehälter, Gärproduktlager,<br />
Kondensatschacht.<br />
Aus Sicht der AwSV geht es in den einzelnen Teilbereichen<br />
um den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen,<br />
wie zum Beispiel Gülle, Silage, Gärrest, Alt- und Frischöl.<br />
Alle Anlagenteile unterliegen wasserrechtlichen Anforderungen,<br />
die in der AwSV und den dazugehörigen<br />
technischen Regelwerken präzisiert werden.<br />
Für die Errichtung der Anlage selber und der dazugehörigen<br />
Anlagenteile, die Innenreinigung von Behältern<br />
sowie die Instandsetzung und Stilllegung formuliert die<br />
AwSV eine generelle Fachbetriebspflicht. Das bedeutet,<br />
dass nur anerkannte Fachbetriebe bestimmte Tätigkeiten<br />
ausführen dürfen, die unmittelbare Bedeutung für<br />
die Anlagensicherheit haben. Das betrifft unter anderem<br />
den Behälter- und Rohrleitungsbau und die Sicherheitstechnik<br />
(Leckerkennung, Überfüllsicherung etc.).<br />
Die Fachbetriebspflicht erstreckt sich auch auf das<br />
Errichten und das Instandsetzen von Silolagerflächen<br />
(sogenannten JGS-Anlagen), sofern bestimmte Größen<br />
überschritten werden. So sind Silosickersaftbehälter<br />
>25 m³, Festmistplatten beziehungsweise Siloplatten<br />
>1.000 m³ sowie „sonstige JGS-Anlagen“ >500 m³<br />
fachbetriebspflichtig.<br />
Biogas Journal: Was sind die Voraussetzungen, um ein<br />
Fachbetrieb zu werden und zu bleiben?<br />
Dr. Blarr: Um als Fachbetrieb anerkannt zu werden, gibt<br />
es zwei unterschiedliche Wege: Man wird Mitglied in<br />
einer wasserrechtlich anerkannten Überwachungsgemeinschaft<br />
nach Paragraf (§)57 AwSV oder schließt einen<br />
Überwachungsvertrag mit einer Sachverständigenorganisation<br />
nach §52 AwSV. Details regelt §62 AwSV.<br />
Beide Möglichkeiten können mit der FGMA Fachbetriebsgemeinschaft<br />
Maschinenbau verwirklicht werden.<br />
Beim ersten Fall wird das Unternehmen Mitglied in<br />
einer Güte- und Überwachungsgemeinschaft und bestellt<br />
mindestens einen Mitarbeiter zum sogenannten<br />
„Fachbetriebsbeauftragten“, der für die fachbetriebspflichtigen<br />
Tätigkeiten des Unternehmens zuständig<br />
ist. Der Fachbetriebsbeauftragte macht sich sachkundig<br />
bezüglich der Regelungen des vorbeugenden<br />
Gewässerschutzes (WHG, AwSV usw.) und weist seine<br />
Kenntnisse im Rahmen einer Überprüfung nach. Dazu<br />
ist unter anderem die erfolgreiche Teilnahme an einem<br />
Seminar erforderlich sowie ein jährlicher oder zweijährlicher<br />
Auffrischungskurs.<br />
Der Fachbetriebsbeauftragte sorgt dafür, dass die ausführenden<br />
Mitarbeiter über die Anforderungen des vor-<br />
36
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
praxis / Titel<br />
beugenden Gewässerschutzes regelmäßig informiert<br />
werden (interne Mitarbeiterunterweisungen, Erstellen<br />
von schriftlichen Arbeitsanweisungen). Auf Anforderung<br />
des Mitgliedsunternehmens führt ein Prüfbeauftragter<br />
der Güte- und Überwachungsgemeinschaft<br />
die sogenannte Aufnahme-Überwachungsprüfung am<br />
Standort des Unternehmens durch.<br />
Bestandteile dieser Aufnahme-Überwachungsprüfung<br />
sind: Überprüfung der personellen Voraussetzungen,<br />
Überprüfung der Ausrüstungsgegenstände sowie die<br />
Überprüfung der Informationsweitergabe an Mitarbeiter.<br />
Innerhalb der Überwachungsgemeinschaft<br />
wird über die Verleihung des Überwachungszeichens<br />
entschieden. Mindestens alle zwei Jahre finden Regelüberwachungsprüfungen<br />
am Unternehmensstandort<br />
durch die Güte- und Überwachungsgemeinschaft statt.<br />
Der Fachbetrieb erhält ein Zertifikat. Die zweite Möglichkeit,<br />
ein Fachbetrieb nach AwSV zu werden, ist der<br />
Abschluss eines Überwachungsvertrages mit einer anerkannten<br />
Sachverständigenorganisation. Die Abläufe<br />
und Inhalte sind im Wesentlichen identisch.<br />
Biogas Journal: Der Betreiber hat die Pflicht, für die<br />
fachbetriebspflichtigen Tätigkeiten Firmen mit entsprechender<br />
Zertifizierung zu beauftragen. Wo finden<br />
die Betreiber solche Firmen?<br />
Dr. Blarr: Sachverständigenorganisationen und Güteüberwachungsgemeinschaften<br />
müssen Fachbetriebe,<br />
die für Dritte tätig werden, unverzüglich nach der Zertifizierung<br />
im Internet in geeigneter Weise bekanntgeben.<br />
In der Regel geschieht dies über Nennung auf der<br />
eigenen Internetseite. Vereinzelt stellen Sachverständigenorganisationen<br />
Online-Portale für „ihre“ Fachbetriebe<br />
zur Verfügung, die auf freiwilliger Basis genutzt<br />
werden können.<br />
Wenn ein Betreiber für ein bestimmtes Gewerk Unterstützung<br />
sucht, ist es wenig hilfreich, sich auf den<br />
Internetseiten der Sachverständigen-Organisationen<br />
zu tummeln. Es gibt keine offiziellen vollständigen<br />
„Listen“ von Fachbetrieben, die nach Branchen und<br />
Regionen sortiert sind. Im Zweifel muss der Betreiber<br />
leider die infrage kommenden Firmen abtelefonieren<br />
und den Nachweis einfordern.<br />
Biogas Journal: Gibt es hinsichtlich des Nachrüstungsbedarfs<br />
von Lagerkapazitäten beziehungsweise Umwallungen<br />
überhaupt ausreichend Firmen, die diese fachbetriebspflichtigen<br />
Arbeiten ausführen können? Oder<br />
läuft die Branche auf einen Engpass zu?<br />
Dr. Blarr: Der allgemein beschriebene Fachkräftemangel<br />
führt in manchen Regionen derzeit schon zu<br />
erheblichen Bauverzögerungen. Daher ist die logische<br />
AKTIVKOHLE WECHSELSERVICE<br />
Service und Dienstleistungen<br />
rund um Ihre Biogasanlage<br />
Über die Lieferung, den Einbau und die Entsorgung der Aktivkohle<br />
hinaus bieten wir Gasanalysen sowie Prozessoptimierungen an,<br />
die die Leistungsfähigkeit Ihrer Anlage weiter steigern.<br />
Bei AKTIVKOHLE24 erhalten<br />
Sie immer BESTLEISTUNG!<br />
Hotline: 0201 9999 5757 www.aktivkohle24.com<br />
Unsere Routen auf Facebook: #Aktivkohle24<br />
37
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Schlussfolgerung, dass die Fachbetriebspflicht zu zusätzlichen<br />
Engpässen führen könnte. Daher kann man<br />
an die Firmen nur appellieren, die Fachbetriebsqualifikation<br />
zu erwerben.<br />
Biogas Journal: Es gibt viele verschiedene Spezialisierungen<br />
von Fachbetrieben. Einschlägige Ausbildungseinrichtungen<br />
bieten Lehrgänge speziell für Arbeiten<br />
an Biogas- und JGS-Anlagen an. Da aber an solchen<br />
Anlagen auch fachübergreifende Arbeiten anfallen, wie<br />
zum Beispiel Beschichten von Beton und Schweißen<br />
von Rohrleitungen, stellt sich die Frage, ob zwingend<br />
ein auf Biogas zertifizierter Fachbetrieb beauftragt werden<br />
muss, um weniger spezielle Arbeiten auszuführen?<br />
Dr. Blarr: Es müssen Fachbetriebe beauftragt werden,<br />
die den Tätigkeitsbereich abdecken – also zum Beispiel<br />
„Schweißen von Rohrleitungen“ oder „Beschichten<br />
von Beton“. In der Zulassung muss zum Beispiel<br />
die Tätigkeit „Verlegen von Rohrleitungen auf Biogasanlagen“<br />
oder Ähnliches aufgeführt sein. Das heißt,<br />
die Zulassungsorganisation hat den Betrieb auf diesem<br />
Gebiet überprüft.<br />
In den Qualifizierungskursen werden allgemein die Tätigkeiten<br />
an verfahrenstechnischen Anlagen, in denen<br />
mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird,<br />
behandelt. Es gibt Lehrgänge, in denen das Thema<br />
Biogasanlagen aufgegriffen wird – jedoch gibt es keine<br />
speziellen Biogaskurse.<br />
Biogas Journal: Wenn ein zertifizierter Fachbetrieb fehlerhaft<br />
baut, wer haftet dann für eventuell entstandene<br />
Schäden beziehungsweise Nachbesserungen?<br />
Dr. Blarr: Die Zertifizierung sagt leider nichts darüber<br />
aus, inwieweit der Betrieb fehlerfrei arbeitet. Die Zertifizierung<br />
soll sicherstellen, dass eine gewisse Fachkenntnis<br />
in Bezug auf wasserrechtliche Grundlagen<br />
auf dem Betrieb vorhanden ist, die Mitarbeiter entsprechend<br />
unterwiesen werden und nötige Ausrüstungsgegenstände<br />
zur Verfügung stehen. Dies alles wird durch<br />
eine Sachverständigenorganisation oder eine Güteüberwachungsgemeinschaft<br />
regelmäßig überprüft.<br />
Wenn es zu Schäden in der Bauausführung kommt, die<br />
auf fehlerhaftes Handeln des Fachbetriebes zurückzuführen<br />
sind, haftet der Fachbetrieb.<br />
Biogas Journal: Können Betreiber von Biogasanlagen<br />
Fachbetrieb werden?<br />
Dr. Blarr: Prinzipiell ja, sofern alle personellen Voraussetzungen<br />
erfüllt sind und die entsprechende Geräte-<br />
Matthias Grünewald Str. 16 C<br />
27753 Delmenhorst<br />
Tel.: 04221 – 807981<br />
buero@ib-awater.de<br />
Beratung · Planung · Fertigung · Montage<br />
seit<br />
1946<br />
Erstmalige und<br />
wiederkehrende<br />
Prüfungen nach<br />
BetrSichV sowie<br />
Dichtheitsprüfungen<br />
an Biogasanlagen<br />
Engelsweg 5 I 97084 Würzburg<br />
Tel: 0931/6668161<br />
www.gasdet.de<br />
E-Mail: post@gasdet.de<br />
Schalldämpfer · Schallschutzwände<br />
Maschinen-Kapselungen · Lüftungsbauteile<br />
Telefon (0 21 71) 70 98-0 · Telefax (0 21 71) 70 98-30<br />
www.stange-laermschutz.de · info@stange-laermschutz.de<br />
38
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
praxis / Titel<br />
ausstattung vorhanden ist. Um ein Beispiel zu nennen:<br />
Beim Schweißen von Rohrleitungen reicht es nicht,<br />
schweißen zu können, sondern es bedarf des entsprechenden<br />
Schweißerpasses und der notwendigen persönlichen<br />
Schutzausrüstung sowie eines Havarie- und<br />
Notfallkonzeptes. Wie schon gesagt, haftet der Fachbetrieb<br />
vollumfänglich für sein fehlerhaftes Handeln.<br />
Die Kosten für eine solche Fachbetriebszulassung variieren<br />
je nach Schulungsanbieter beziehungsweise<br />
Überwachungsgemeinschaft und können sich schnell<br />
auf einen mittleren vierstelligen Betrag summieren. Sie<br />
setzen sich zusammen aus:<br />
ffder Qualifizierungsschulung zum Fachbetriebsbeauftragten<br />
(einmalig),<br />
ffder Erstprüfung und der Überwachungsprüfung (vor<br />
Beginn und dann alle zwei Jahre),<br />
ffder Auffrischungsschulung des Fachbetriebsbeauftragen<br />
(alle zwei Jahre) und<br />
ffdem jährlichen Mitgliedsbeitrag.<br />
Biogas Journal: Welche Tätigkeiten kann ein Betreiber<br />
noch selber – ohne Fachbetrieb – durchführen?<br />
Dr. Blarr: Die AwSV legt nur lapidar fest, dass „Tätigkeiten<br />
an Anlagenteilen oder Anlagen, die keine unmittelbare<br />
Bedeutung für die Anlagensicherheit haben, nicht<br />
von Fachbetrieben ausgeführt werden müssen“. Dazu<br />
zählen meines Erachtens Erdaushubarbeiten als Vorbereitung<br />
für den Havariewall, Rohrleitungsbau oder auch<br />
den Abtankplatz.<br />
Biogas Journal: Was ist Ihre persönliche Einschätzung:<br />
Wird die Fachbetriebspflicht – vor dem Hintergrund der<br />
bisherigen Schadensfälle – Abhilfe schaffen?<br />
Dr. Blarr: Ja. Da sich die Fachbetriebspflicht auf die<br />
sicherheitsrelevanten Anlagenteile bezieht, gehe ich<br />
davon aus.<br />
Biogas Journal: Frau Dr. Blarr, vielen Dank für das<br />
Gespräch.<br />
Anmerkung: Interessenten bezüglich der Zulassung<br />
als Fachbetrieb können sich gerne an Frau Dr. Blarr,<br />
Tel. 01 62/10 55 550 wenden.<br />
Interviewerin<br />
Dipl.-Ing. agr. Steffi Kleeberg<br />
Fachreferentin, Referat Genehmigung<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Invalidenstr. 91 · 10115 Berlin<br />
030/2 75 81 79-0<br />
berlin@biogas.org<br />
Wir machen Ihre Biogasanlage fit für die Zukunft.<br />
Die Schmack Service-Kompetenz:<br />
Lassen Sie sich beraten –<br />
kompetent und unverbindlich!<br />
Technischer<br />
Service<br />
Betriebsführung<br />
Modernisierung<br />
Biogasanlage<br />
Biologischer<br />
Service<br />
Profitieren Sie jetzt von mehr als 20 Jahren<br />
Biogas-Know-how.<br />
Schmack ist der kompetente Service-Partner rund<br />
um Ihre Biogasanlage. Von der Beratung über<br />
Optimierung bis hin zur Betriebsführung sind wir<br />
gerne für Sie da. www.schmack-biogas.de<br />
Schmack Biogas Service GmbH · 24-Stunden-Service-Hotline: Tel. +49 (0) 9431 751-277<br />
info@schmack-biogas.com<br />
39
praxis<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
2018er Dürre<br />
wirkt<br />
preistreibend<br />
Foto: www.landpixel.de<br />
Zum nunmehr neunten Mal wurden die Substratpreise der zurückliegenden Ernte des<br />
Jahres 2018 durch den Fachverband Biogas e.V. abgefragt. Die Auswirkungen der lang<br />
anhaltenden Trockenphase sind bei der Preisentwicklung deutlich sichtbar. Die knappe<br />
Substratverfügbarkeit führte zu steigenden Kosten beim Biomasseeinkauf.<br />
Von Dr. Stefan Rauh<br />
Abbildung 1: Anteil der Rückmeldungen im Vergleich der Substrate<br />
1% 3% 5%<br />
6%<br />
Silomais<br />
5%<br />
Grassilage<br />
41%<br />
Getreide-GPS<br />
6%<br />
Grünroggen<br />
Getreidekorn<br />
Zuckerrüben<br />
Riesenweizengras<br />
Durchw. Silphie<br />
20%<br />
Sonstige<br />
13%<br />
Quelle: FvB <strong>2019</strong><br />
In diesem Jahr haben sich erfreulicherweise wieder<br />
deutlich mehr Betreiber an der Umfrage beteiligt,<br />
sodass das Ergebnis mehr Aussagekraft bekommt.<br />
Mit 209 Datensätzen (Vorjahr 134) erreichten fast<br />
doppelt so viele Rückmeldungen zu den Preisen<br />
von Energiepflanzen und Wirtschaftsdüngern die Geschäftsstelle<br />
des Fachverbandes Biogas e.V. Die meisten<br />
Rückmeldungen bei den Energiepflanzen vereint,<br />
wie zu erwarten war, der Silomais auf sich. Wie in Abbildung<br />
1 zu sehen ist, hatte der Silomais einen Anteil<br />
von 41 Prozent an allen Rückmeldungen. Als nächstes<br />
folgen Getreide-GPS und Grassilage. Was hierbei auffällt,<br />
ist die Tatsache, dass im Vergleich zum Vorjahr<br />
weit weniger Datensätze zu Grassilage eingegangen<br />
sind. Dies lässt sich durch die Trockenheit begründen.<br />
Während im Jahr zuvor häufig der vierte und fünfte<br />
Schnitt an eine Biogasanlage abgegeben wurde, waren<br />
in manchen Regionen die Aufwüchse so schwach, dass<br />
ein Verkauf an eine Biogasanlage nicht infrage kam.<br />
Häufig war es sogar so, dass Betreiber Vieh haltenden<br />
Landwirten mit Futter aus ihren Lagern ausgeholfen<br />
haben oder nicht die komplette eigentlich vertraglich<br />
zugesagte Fläche gekauft haben. Die anderen Kulturen<br />
(Zuckerüben, Getreide, Grünroggen) konnten ihre Anteile<br />
in etwa behaupten.<br />
Trockenheit mit Folgen<br />
In Tabelle 1 auf Seite 43 sind die wichtigsten Ergebnisse<br />
der Umfrage für die Substrate mit ausreichend<br />
vielen Rückmeldungen zusammengefasst. Neben den<br />
Nettopreisen stehend ab Feld (oberer Teil der Tabelle)<br />
und frei Silo (unterer Teil der Tabelle) sind dort auch<br />
die Mittelwerte des Ertrags sowie des Trockenmasse-<br />
40
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
praxis<br />
Abbildung 2: Trockenmassepreise im Vergleich<br />
gehalts aufgelistet. Bei den Erträgen und<br />
Trockenmassegehalten werden die Folgen<br />
der Trockenheit ebenfalls sichtbar.<br />
Während die Trockenmassegehalte im<br />
Vergleich zum Vorjahr nur tendenziell anstiegen,<br />
ist der Ertragsrückgang über alle<br />
Kulturen hinweg sichtbar. Bei den beiden<br />
Leitkulturen im Biogasbereich – Silomais<br />
und Getreide-GPS – lagen die Erträge im<br />
Schnitt 20 Prozent unter denen im Vorjahr<br />
(Silomais: 41,2 Tonnen Frischmasse<br />
im Vergleich zu 51,6 Tonnen Frischmasse<br />
in 2017; Getreide-GPS: 30 Tonnen<br />
Frischmasse im Vergleich zu 36,3 Tonnen<br />
Frischmasse in 2017). Einzig Grünroggen<br />
konnte sogar leichte Ertragszuwächse<br />
verzeichnen. Hier konnten mit<br />
31,1 Tonnen Frischmasse etwa 2 Tonnen<br />
mehr als im Vorjahr geerntet werden.<br />
Der Grünroggen profitierte dabei von der<br />
frühen Ernte. Die in Tabelle 1 aufgelisteten<br />
Mittelwerte zeigen nur bedingt die<br />
katastrophalen Ernteergebnisse in einzelnen<br />
Regionen. Dies wird anhand der<br />
eingegangen Rückmeldungen zum Silomais<br />
verdeutlicht. Während einzelne Betreiber<br />
Erträge oberhalb von 50 Tonnen<br />
Frischmasse erzielen konnten, erreichten<br />
auch zahlreiche Einsendungen die<br />
Geschäftsstelle, bei denen die Erträge<br />
die 30-Tonnen-Marke nur knapp überschritten.<br />
Substratpreis in €/t TM<br />
200,0<br />
180,0<br />
160,0<br />
140,0<br />
120,0<br />
100,0<br />
80,0<br />
60,0<br />
40,0<br />
20,0<br />
0,0<br />
Mittlerer Preis stehend ab Feld [€/t TM]<br />
Mittlerer Preis frei Silo [€/t TM]<br />
98,7 101,9<br />
93,7<br />
89,1<br />
90,7<br />
69,9<br />
76,8<br />
173,6<br />
109,7<br />
Silomais Grassilage Getreide-GPS Grünroggen Getreidekorn Zuckerrüben Durchwachsene<br />
Silphie<br />
Anmerkung: Bei den Werten handelt es sich um korrigierte Mittelwerte<br />
Abbildung 3: Frischmassepreise im Vergleich<br />
Substratpreis in €/t TM<br />
40,0<br />
35,0<br />
30,0<br />
31,8<br />
Mittlerer Preis stehend ab Feld [€/t FM]<br />
Mittlerer Preis frei Silo [€/t FM]<br />
35,3<br />
25,0<br />
33,5<br />
33,0<br />
37,0<br />
21,3<br />
149,5<br />
Zuckerrüben nicht verteuert<br />
25,0<br />
Die schlechten Ernteergebnisse aufgrund<br />
der ungünstigen Witterung hatten direkten<br />
Einfluss auf die Substratpreise. Bis 20,0<br />
auf Zuckerrüben wurden alle Substrate<br />
teurer gehandelt als im Vorjahr. Der Grund<br />
für den Preisrückgang bei Zuckerrüben 15,0<br />
könnte möglicherweise mit der Entwicklung<br />
der fallenden Zuckerpreise und der<br />
schlechteren Vermarktungsmöglichkeit<br />
von Zuckerrüben zusammenhängen.<br />
Silomais als wichtigste Kultur wurde im<br />
Schnitt für 89 Euro je Tonne Trockenmasse ab Feld und<br />
106 Euro je Tonne Trockenmasse frei Silo gehandelt<br />
(siehe Abbildungen 2 und 3). Im gleichen Preisbereich<br />
liegt nach wie vor Getreide-GPS. Gerade beim aussagekräftigen<br />
Preis je Tonne Trockenmasse sind die Unterschiede<br />
marginal. Deutlich sichtbar wird die Wirkung<br />
der Erntekosten bei Grassilage. Während der Preis im<br />
Silo nur knapp unter dem von Silomais oder Getreide-<br />
GPS liegt, ist der Abstand ab Feld/Wiese folgerichtig<br />
größer.<br />
Bei einem Kauf ab Wiese sind die hohen Ernte- und<br />
Transportkosten zu berücksichtigen. Der Preisunterschied<br />
liegt bei etwa 25 Euro je Tonne Trockenmasse<br />
beziehungsweise 9 Euro je Tonne Frischmasse. Die<br />
Substrate mit einer hohen Energiedichte (Getreidekorn<br />
und Zuckerrüben) erreichen die höchsten Trockenmassepreise,<br />
wenn auch die Zuckerrübe sich dem<br />
Preis von Silomais annähert. Für die Durchwachsene<br />
Silphie konnte erstmals ein Preis ermittelt werden.<br />
Dieser liegt bei 26 Euro je Tonne Frischmasse und<br />
somit unterhalb von Silomais und Getreide-GPS, was<br />
dem vergleichsweise hohen Wassergehalt geschuldet<br />
ist. Bezogen auf die Tonne Trockenmasse relativiert<br />
sich dieser Effekt.<br />
26,9<br />
87,2<br />
Quelle: FvB <strong>2019</strong><br />
Silomais Grassilage Getreide-GPS Grünroggen Getreidekorn Zuckerrüben Durchwachsene<br />
Silphie<br />
Anmerkung: Bei den Werten handelt es sich um korrigierte Mittelwerte<br />
25,8<br />
Quelle: FvB <strong>2019</strong><br />
41
praxis<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Abbildung 4: Substratpreisindex für NawaRo<br />
135,7<br />
122,3<br />
Substratpreisindex<br />
120<br />
110<br />
100<br />
116,8<br />
115,4<br />
113,8 113,9<br />
111,9<br />
110,8<br />
108,3<br />
108,8 108,9<br />
107,6<br />
106,7<br />
105,9 106,4 106,3<br />
105,4<br />
102,9<br />
102,4<br />
100,6<br />
99,9<br />
97,1<br />
96,9 98,0<br />
94,8<br />
103,3<br />
100,7<br />
97,6<br />
94,7<br />
119,5<br />
112,2<br />
107,6<br />
103,0<br />
101,4<br />
100,6<br />
111,5<br />
111,3<br />
104,8<br />
100,3<br />
100,1 99,9<br />
109,1<br />
107,5 107,8<br />
106,0<br />
103,0<br />
101,1<br />
101,6<br />
100,1<br />
90<br />
91,7<br />
85,9<br />
91,2<br />
88,1<br />
86,1<br />
84,2<br />
80<br />
Index 2011 Index 2012 Index 2013 Index 2014 Index 2015 Index 2016 Index 2017 Index 2018<br />
Silomais Grassilage Getreide-GPS Getreidekorn Grünroggen Zuckerrüben Biomasseindex<br />
Anmerkung: Substratpreisindex im Vergleich zum Jahr 2010 (2010 = 100); Ausnahme: Zuckerrüben (2011 = 100)<br />
Quelle: FvB <strong>2019</strong>, Stand Januar<br />
Preise beeinflussen Stromgestehungskosten<br />
Wichtig für viele Anlagen ist gerade auch vor dem<br />
Hintergrund der Ausschreibungen, welche Stromgestehungskosten<br />
aus den genannten Preisen resultieren.<br />
Zuerst muss bedacht werden, dass die Kosten für<br />
Lagerung und Entnahme aus dem Silo und Transport<br />
zur Einbringung hinzugerechnet werden müssen. Hier<br />
können pauschal 6 Euro je Tonne Frischmasse angenommen<br />
werden.<br />
Die Kosten für Silomais frei Fermenter lagen damit<br />
2018 im Schnitt bei etwa 41 Euro je Tonne Frischmasse.<br />
Bei Standardgaserträgen und einem Nutzungsgrad<br />
von 39 Prozent resultieren daraus Stromgestehungskosten<br />
von 9,6 Cent je Kilowattstunde (ct/kWh). Getreide-GPS<br />
liegt etwas höher. Bei maximalen Vergütungen<br />
von unter 17 ct/kWh im Ausschreibungsmodell sind die<br />
Rohstoffkosten im Auge zu behalten.<br />
Die Entwicklung der Biomassepreise in Relation zu<br />
den Vorjahren zeigt Abbildung 4. Das Basisjahr für den<br />
dort gezeigten Substratpreisindex ist 2010. Die jeweils<br />
rechte Säule (in Schwarz) zeigt den Indexwert für das<br />
Jahr 2018 an. Dieser liegt mit Ausnahme der Zuckerrüben<br />
immer oberhalb des Wertes von 2017. Auch der<br />
Gesamtindex zeigt einen deutlichen Preissprung um<br />
6,2 Prozentpunkte von 101,6 auf 107,8 und erreicht<br />
damit annähernd das Allzeithoch aus dem Jahr 2013.<br />
Damals war ebenfalls die Witterung ein Grund für steigende<br />
Preise aufgrund schwacher Erträge. Anlass war<br />
damals ein langer Winter mit folgendem verregneten<br />
Frühjahr. Beim Blick auf die Einzelsubstrate fällt noch<br />
auf, dass Grassilage sogar ein Allzeithoch erreicht hat.<br />
Fazit: Die Biomassepreise haben sich deutlich nach<br />
oben bewegt. Da die Trockenheit sicher in das Jahr<br />
<strong>2019</strong> ausstrahlt, ist zu befürchten, dass weitere Preisanstiege<br />
auftreten können. Insbesondere, wenn erneut<br />
eine problematische Witterung keine normalen Erträge<br />
zulässt, würde sich die Versorgungssituation weiter verschärfen.<br />
Im letzten Jahr waren die Lager gut gefüllt,<br />
sodass das schlechte Jahr 2018 halbwegs abgepuffert<br />
werden konnte.<br />
Exkurs: Preise von Wirtschaftsdüngern –<br />
Düngeverordnung zeigt Wirkung<br />
Neben nachwachsenden Rohstoffen werden in den<br />
meisten Anlagen auch Wirtschaftsdünger (Gülle, Festmist,<br />
Geflügeltrockenkot) eingesetzt. In einigen Fällen<br />
steht Biogasanlagenbetreibern Gülle und Festmist zum<br />
Nulltarif zur Verfügung, in der Regel muss jedoch der<br />
Wirtschaftsdünger ebenfalls zugekauft werden – sicherlich<br />
auch aus steuerlichen Gründen.<br />
Im Mittel lag der Preis für Gülle zwischen 2,70<br />
(Schwein) und 2,88 Euro je Kubikmeter (Rind) (siehe<br />
42
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
praxis<br />
Biomassepreise 2018 Stand Januar <strong>2019</strong><br />
Tabelle 1: Biomassepreise 2018, Stand Januar <strong>2019</strong><br />
Substrat ab Feld<br />
Mittlerer Preis<br />
stehend ab Feld<br />
[€/t TM]<br />
Mittlerer<br />
TM-Gehalt<br />
[%]<br />
Mittlerer Preis<br />
stehend ab Feld<br />
[€/t FM]<br />
Mittlerer<br />
Ertrag<br />
[t FM/ha]<br />
Mittlerer Preis<br />
stehend ab Feld<br />
[€/ha]<br />
Silomais 1) 89,1 35,7 31,8 41,2 1.311<br />
Grassilage 2) 69,9 35,7 25,0 24,3 606<br />
Getreide-GPS 1) 90,7 36,3 33,0 30,0 990<br />
Grünroggen 3) 76,8 27,8 21,3 31,1 663<br />
Getreidekorn<br />
Zuckerrüben 2) 109,7 24,5 26,9 65,7 1.769<br />
Durchwachsene Silphie 3) 87,2 29,6 25,8 41,2 1.063<br />
Substrat frei Silo<br />
Mittlerer Preis<br />
frei Silo<br />
[€/t TM]<br />
Mittlerer<br />
TM-Gehalt<br />
[%]<br />
Mittlerer Preis<br />
frei Silo<br />
[€/t FM]<br />
Mittlerer<br />
Ertrag<br />
[t FM/ha]<br />
Mittlerer Preis<br />
frei Silo<br />
[€/ha]<br />
Silomais 2) 98,7 35,7 35,3 41,2 1.453<br />
Grassilage 3) 93,7 35,7 33,5 24,3 813<br />
Getreide-GPS 2) 101,9 36,3 37,0 30,0 1.112<br />
Grünroggen<br />
Getreidekorn 3) 173,6 86,1<br />
FvB <strong>2019</strong><br />
149,5 6,7 1.006<br />
Zuckerrüben<br />
Anmerkung:<br />
Nettopreise mit korrigierten Mittelwerten; je mehr Daten vorhanden sind, desto höher kann das Perzentil gewählt werden<br />
1) 10 % höchste und niedrigste Werte werden nicht berücksichtigt = 90 % Perzentil<br />
2) 20 % höchste und niedrigste Werte werden nicht berücksichtigt = 80 % Perzentil<br />
3) 40 % höchste und niedrigste Werte werden nicht berücksichtigt = 60 % Perzentil<br />
Tabelle 2: Preise für Wirtschaftsdünger und Gärprodukte 2018<br />
Substrat<br />
Daten [Anzahl]<br />
Mittlerer Preis frei<br />
Eintrag [€/t FM]<br />
Mittlerer TMGehalt<br />
[%]<br />
FvB <strong>2019</strong><br />
Gülle (Rind) 34 2,88<br />
Gülle (Schwein) 9 2,70<br />
Rinderfestmist 22 5,61<br />
Geflügelmist/HTK 9 10,78<br />
Gärprodukt 42 2,00 7,7% (37 mal angegeben)<br />
FvB <strong>2019</strong><br />
Tabelle 2). Der Unterschied beim Preis aufgrund der<br />
Tierart ist dabei überraschend gering. Beim Festmist<br />
lagen nur für Rinder ausreichend viele Rückmeldungen<br />
vor. Der Preis liegt dabei bei etwa der Hälfte des Preises<br />
von Geflügelmist/Geflügeltrockenkot. Die Preise liegen<br />
im Bereich der Vorjahre.<br />
Das Gärprodukt hingegen wurde mit 2 Euro der Kubikmeter<br />
deutlich günstiger als im Vorjahr (4 Euro der<br />
Kubikmeter) gehandelt. Hintergrund sind knappe Flächen<br />
aufgrund der neuen Vorgaben seitens der Düngeverordnung.<br />
Viele Betreiber haben auf dem Fragebogen<br />
explizit die Herausforderung der Düngeverordnung<br />
erwähnt.<br />
Hinweis: Wie jedes Jahr bestehen die vorgestellten<br />
Preis- und Mengenangaben aus Mittelwerten. Es bestanden<br />
bei den eingegangenen Fragebögen jedoch<br />
zum Teil erhebliche regionale Unterschiede. Die Zahlen<br />
dienen aus diesem Grund der besseren Orientierung<br />
und können nicht auf bestehende Lieferverträge angewandt<br />
werden.<br />
Der Fachverband Biogas e.V. wird auch dieses Jahr eine<br />
Umfrage unter seinen Betreibermitgliedern durchführen.<br />
Um auch in Zukunft eine transparente Preisverteilung<br />
darstellen und Trends beobachten zu können, sind<br />
wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.<br />
Vielen Dank noch einmal an alle Betreiber, die durch<br />
die Rücksendung des ausgefüllten Fragebogens dazu<br />
beigetragen haben, dass auch dieses Jahr eine aussagekräftige<br />
und hilfreiche Analyse der Substratpreise<br />
veröffentlicht werden konnte.<br />
Autor<br />
Dr. Stefan Rauh<br />
Geschäftsführer<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 ∙ 85356 Freising<br />
0 81 61/98 46 60<br />
info@biogas.org<br />
43
praxis<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Fotos: Dierk Jensen<br />
Blick von oben in den Reaktionsbehälter, der permanent belüftet wird.<br />
Als „Berliner Pflanze“ geht der phosphathaltige<br />
Langzeitdünger auch in kleinen Gebinden an<br />
private Gärtner.<br />
Phosphorrecycling aus Abwasser<br />
Im Klärwerk Waßmannsdorf werden die Abwässer von rund 1,5 Millionen Berlinern aufbereitet. Täglich<br />
strömen rund 180.000 Kubikmeter Abwässer aus dem weitverzweigten Kanalnetz der Hauptstadt hierher,<br />
wo die Berliner Wasserbetriebe seit vielen Jahren Pionierarbeit in der Phosphat-Rückgewinnung aus<br />
Klärschlämmen leisten.<br />
Von Dierk Jensen<br />
Die schwarze Suppe blubbert<br />
mächtig. Wasserdampf steigt<br />
auf, vernebelt die Sicht. „Wir<br />
belüften den Klärschlamm<br />
ständig mit Sauerstoff“, erklärt<br />
Andreas Lengemann mit Blick in den nach<br />
oben offenen Reaktor. „Außerdem geben<br />
wir Magnesium hinzu, damit der Phosphor<br />
sich löst und am Ende auskristallisiert“,<br />
fügt der verantwortliche Verfahrenstechniker<br />
der Berliner Wasserbetrieb auf der<br />
Treppe an der Außenwand der 15 Meter<br />
hohen Recycling-Anlage auf dem Klärwerk<br />
Waßmannsdorf stehend hinzu.<br />
Sie befindet sich direkt hinter der südlichen<br />
Stadtgrenze Berlins in Brandenburg<br />
und in unmittelbarer Nähe zum Flughafen<br />
Berlin-Schönefeld, wie die am Horizont<br />
unentwegt startenden und landenden Flugzeuge<br />
verraten. Die Idee zum Recyceln des<br />
sowohl endlichen als auch unentbehrlichen<br />
Nährstoffes war ursprünglich mehr aus der<br />
Not entstanden, verrät Lengemann zur Vorgeschichte.<br />
Denn das Mitte der Neunzigerjahre<br />
errichtete Klärwerk ist so konzipiert<br />
worden, dass die Aufbereitung der Abwässer<br />
auf den Einsatz von bindenden Metallen<br />
verzichten wollte und stattdessen mit einer<br />
organischen Ausfällung arbeitet.<br />
MAP-Verfahren entwickelt<br />
und patentiert<br />
Dieser Umstand verursachte jedoch in der<br />
Folgezeit erhebliche Probleme, weil das<br />
Phosphat bei einem pH-Wert von exakt 7,2<br />
plötzlich extrem ausfällt und sich auf dem<br />
Klärwerk innerhalb kurzer Zeit auf sämtlichen<br />
Rohren ablagerte und diese schließlich<br />
verstopfte. „Eine Katastrophe“, erinnert<br />
sich der 55-Jährige. Eine technische<br />
Lösung musste her. Über Jahre wurde deshalb<br />
experimentiert und getestet, bis die<br />
Berliner das sogenannte MAP-Verfahren<br />
mit den richtigen Dosierungen als auch mit<br />
der passenden Anlagentechnik entwickelt<br />
hatten und dazu zwei Patente anmeldeten.<br />
Damit war das Problem verstopfter Rohre<br />
passé. Überdies hatten die Abwasserspezialisten<br />
jetzt einen Dünger im Angebot, der<br />
Phosphat in den Kreislauf zurückgibt und<br />
für den sie schon 2008 eine düngemittelrechtliche<br />
Zulassung erhielten. Über die<br />
luftige, an der Außenwand befestigte Wendeltreppe<br />
geht es von der beindruckend<br />
blubbernden Oberfläche des Recycling-<br />
Reaktors wieder hinunter. Dicht nebenan<br />
stehen große Faulbehälter, in denen so viel<br />
Biogas entsteht, das fünf Motoren mit jeweils<br />
1,2 Megawatt Leistung angetrieben<br />
werden können.<br />
Lengemann öffnet ein Tor und gewährt<br />
Einblick in das Innenleben unterhalb des<br />
Recycling-Reaktors. Aus einem Fallrohr<br />
rieselt beständig Material heraus. Es sieht<br />
aus wie grobkörniger Sand. „Das ist unser<br />
Langzeitdünger“, sagt Lengemann, „in ihm<br />
sind in kristalliner Form die Nährstoffe Magnesium-Ammonium-Phosphat,<br />
kurz MAP,<br />
gebunden.“ Bis zu 3 Tonnen MAP-Dünger<br />
täglich erzeugt der im Jahr 2010 in Betrieb<br />
genommene Reaktor, also etwa 500 Tonnen<br />
im Jahr.<br />
44
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
praxis<br />
Das Klärwerk Wassmannsdorf bereitet das Abwasser von rund<br />
1,5 Millionen Berlinern auf.<br />
Wenig Nachfrage von Hobbygärtnern<br />
Obwohl die Medien dem nachhaltigen Düngeprodukt in der<br />
Vergangenheit viel Aufmerksamkeit schenkten und Lengemann<br />
& Co. im Jahr 2015 den GreenTec Award für ihre Pionierarbeit<br />
gewannen, ist der Absatz des Düngers aus Klärschlamm<br />
gewonnen speziell an Hobbygärtner mengenmäßig doch recht<br />
überschaubar geblieben. Lediglich 3 bis 4 Tonnen gelangen –<br />
in kleinen Gebinden abgefüllt – auf Beete und grüne Balkone.<br />
So geht der große Rest an die Landwirtschaft.<br />
Allerdings ist die Vermarktung des Düngers, der ohne eine<br />
ausreichende Einarbeitung in den Boden von den Kulturpflanzen<br />
nicht aufzunehmen ist, in den letzten Jahren in der Landwirtschaft<br />
kaum leichter geworden. Im Gegenteil: Die Preise<br />
sind in den Keller gestürzt. Daher setzt Lengemann auf neue<br />
Abnehmer, die die Vorteile des phosphathaltigen Düngers<br />
wertschätzen. So erhofft er sich aus Gesprächen mit dem ökologischen<br />
Anbauverband Bioland neue Absatzpartner, um die<br />
rund 2 Millionen Euro teure Anlage für den Phosphat-Recyclingprozess<br />
nicht ohne große Verluste betreiben zu müssen.<br />
Dabei hat das Recyceln für die Berliner Klärwerker einen weiteren<br />
positiven prozesstechnischen Nebeneffekt: Durch den<br />
Entzug des Phosphats, der chemisch betrachtet Wasser gut<br />
binden kann, wird das anschließende Entwässern des Klärschlamms<br />
auf 28 Prozent Trockensubstanz deutlich erleichtert.<br />
Das spart Zeit und Energie. Rund 200 Tonnen entwässerter<br />
Klärschlamm fallen im Klärwerk täglich an, der im Übrigen<br />
bislang nicht vor Ort verbrannt wird, sondern als Brennstoff<br />
den Braunkohlekraftwerken in der Lausitz beigemengt wird.<br />
Und zwar im Verhältnis von 1 zu 30, auf 30 Teile Kohle kommt<br />
ein Teil Klärschlamm. Diese Kombi ist nicht wirklich hipp,<br />
schon gar nicht nachhaltig und alles andere als klimafreundlich.<br />
Damit wird spätestens zum Kohleausstieg im Jahr 2038<br />
endgültig Schluss sein.<br />
Vollgas im Fermenter.<br />
Enzyme<br />
MethaFerm ® Mais liquid<br />
– Hochkonzentriertes Enzym<br />
zum Abbau von Cellulose,<br />
Hemicellulose und anderen<br />
Zellwandbestandteilen<br />
– Hervorragende Verteilung bei<br />
geringsten Aufwandmengen<br />
– Stabil auch in hohen pHund<br />
Temperaturbereichen<br />
– Geeigent für Mais und<br />
strukturreiche Substrate<br />
10 Prozent des Phosphors werden rausgeholt<br />
Ganz abgesehen davon schreibt die Ende 2017 verabschiedete<br />
Klärschlammverordnung ohnehin spätestens ab 2029 hohe<br />
Quoten für das Phosphat-Recycling vor, die mit dem Verfahren<br />
der MAP-Separierung alleine noch nicht erreicht werden<br />
können. „Wir bekommen mit unserem patentierten Verfahren<br />
rund 10 Prozent des Phosphats aus dem Klärschlamm her-<br />
Ideal bei trockengeschädigter<br />
Maissilage<br />
www.terravis-biogas.de<br />
45<br />
Ihr Ansprechpartner:<br />
Jens Petermann, Tel.: 0251 . 682-2438<br />
jens.petermann@terravis-biogas.de<br />
Benedikt Baackmann, Tel.: 0251 . 682-2645<br />
benedikt.baackmann@terravis-biogas.de<br />
FELD<br />
SILO<br />
FERMENTER<br />
ENERGIE
praxis<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Dipl.-Ing. Andreas Lengemann<br />
begutachtet<br />
den im Klärwerk Wassmannsdorf<br />
erzeugten<br />
Langzeitdünger.<br />
aus“, räumt Lengemann ein, „aber nicht mehr.“ Daher<br />
ist die mittelfristige Strategie der Verantwortlichen<br />
im Klärwerk Waßsmannsdorf, neben der bestehenden<br />
MAP-Anlage auch eine eigene Verbrennungsanlage zu<br />
errichten, um dann aus der anfallenden Asche die verbliebenen<br />
Phosphoranteile größtenteils zu recyceln.<br />
Doch ist die Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm-Aschen<br />
– trotz mehrerer Forschungsprojekte<br />
mit unterschiedlichen Methoden – immer noch<br />
technisches Neuland. Deshalb blickt die gesamte Abwasserbranche<br />
gebannt auf das, was gegenwärtig im<br />
Hamburger Hafen passiert. Dort befindet sich direkt<br />
an der Elbe gelegen das Klärwerk Köhlbrandhöft des<br />
städtischen Betreibers Hamburg Wasser: seit 2015 ist<br />
dort eine Testanlage zur Rückgewinnung von Phosphor<br />
aus Asche am Start.<br />
Phosphor aus Klärschlammasche<br />
„Aus Schiet Gold machen“ titelte eine lokale Boulevardzeitung<br />
euphorisch. Tatsächlich scheint der Testbetrieb<br />
gut verlaufen zu sein. „Der Probebetrieb hat<br />
die technische Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit<br />
bestätigt“, so Sabrina Schmalz von Hamburg Wasser;<br />
es sei damit das bisher einzige bekannte Verfahren am<br />
Markt, das Phosphor wirtschaftlich zurückgewinne.<br />
Konsequenterweise haben die Partner der Testanlage,<br />
Hamburg Wasser und das Abfall-Unternehmen Remondis,<br />
im März 2018 die Hamburger Phosphorrecyclinggesellschaft<br />
mbH gegründet, die derzeit die weltweit<br />
erste großtechnische Anlage zur Rückgewinnung von<br />
Phosphor baut. Schon im nächsten Jahr soll die Anlage<br />
laut Schmalz in Betrieb gehen und aus rund 20.000<br />
Tonnen Klärschlamm-Asche rund 6.500 Tonnen hochreine<br />
Phosphorsäure recyceln.<br />
„Die Beispiele in Berlin und Hamburg gehen in eine<br />
gute Richtung“, begrüßt indessen Prof. Dr. Ralf Otterpohl<br />
die wachsenden Bemühungen, den endlichen<br />
Nährstoff Phosphor aus dem urbanen Siedlungsabwasser<br />
in den Kreislauf zurückzugeben. Wenngleich der<br />
Leiter des Institutes für Abwasserwirtschaft und Gewässerschutz<br />
an der Technischen Universität Harburg<br />
das Berliner Verfahren der MAP-Fällung ausdrücklich<br />
begrüßt, betrachtet er deren Kosten bei einer vergleichsweise<br />
geringen Phosphat-Recycling-Quote doch<br />
kritisch: „Das ist schon sehr teuer.“ Trotzdem sei es<br />
ein wichtiger Anfang, obgleich Otterpohl ganz generell<br />
eine Trennung von Grauwasser (Dusche, Küche etc.)<br />
und Schwarzwasser „an der Quelle des Geschehens“<br />
nach wie vor für die nachhaltigste Strategie hält, nicht<br />
zuletzt, um auch Kalium und Spurenelemente mit geringerem<br />
Aufwand zurückgewinnen zu können.<br />
Aber zurück in den Süden von Berlin, wo Graues und<br />
Schwarzes der Hauptstadt nach wie vor ungetrennt ins<br />
Klärwerk nach Waßmannsdorf fließen. Dabei ist auch<br />
dem Abwasser-Ingenieur Lengemann vollkommen klar,<br />
dass sein patentiertes MAP-Verfahren keine ganzheitliche<br />
Lösung ist. Dennoch ist er überzeugt von dem in<br />
Waßmannsdorf seit Jahren funktionierenden und die<br />
Nährstofffracht der zu verbrennenden Fraktion minimierenden<br />
Recycling-Verfahren. „Zudem wächst das<br />
Interesse an unserem Verfahren“, freut er sich.<br />
Reaktor hinter Fermenter oder<br />
Nachgärer installieren<br />
Mit dem Hintergrund von 30 Jahren Betriebserfahrung<br />
ist er sogar der Auffassung, dass das MAP-Verfahren<br />
durchaus auch für die Biogasbranche anwendbar sei.<br />
Gerade an Standorten in den Regionen, in denen die<br />
Nährstoffeinträge schon heute deutlich zu hoch sind.<br />
„Am Ausgang des Fermenters müsste unser Reaktor installiert<br />
und dann eben mit vergorener Gülle beschickt<br />
werden“, sagt er.<br />
Der Vorteil läge auf der Hand: Die Nährstofffracht in<br />
den Gärdüngern würde deutlich verringert werden und<br />
zugleich erzeugt der Betreiber einen transport- und lagerfähigen<br />
Dünger, der in den Handel geht und in der<br />
Ursprungsregion für eine Nährstoff-Entlastung sorgt.<br />
Ob dies wirtschaftlich darstellbar ist, bleibt bei den<br />
aktuellen Rahmenbedingungen und Preisen allerdings<br />
zweifelhaft.<br />
Dennoch: Welche Rolle die Nährstoffaufbereitung auf<br />
Biogasanlagen in Zukunft im Kontext weiter sich verschärfenden<br />
Gewässerschutzes noch spielen wird, das<br />
Recycling von Phosphaten aus Siedlungsabwässern<br />
wird schon mittelfristig die Importe von Phosphaten für<br />
Düngerzwecke nach Deutschland bemerkbar mindern<br />
helfen können. Das ist gut so.<br />
Autor<br />
Dierk Jensen<br />
Freier Journalist<br />
Bundesstr. 76 · 20144 Hamburg<br />
040/40 18 68 89<br />
dierk.jensen@gmx.de<br />
www.dierkjensen.de<br />
46
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
praxis<br />
Mischpreisverfahren – und jetzt?<br />
Mitte Oktober wurde das Mischpreisverfahren (MPV) eingeführt, um sehr hohe Arbeitspreise in der<br />
Regelenergie, wie sie im Oktober 2017 aufgetreten sind, zu verhindern. Im MPV soll ein verstärkter<br />
Wettbewerbsdruck die Arbeitspreise senken. Um dies zu ermöglichen, fließt im MPV daher neben dem<br />
Leistungspreis nun auch anteilig der Arbeitspreis in den Zuschlagswert mit ein. In der praktischen<br />
Umsetzung zeigt sich, dass zwar die Arbeitspreise sinken, aber im gleichen Zuge die Leistungspreise<br />
wesentlich stärker steigen. Neben weiteren negativen Auswirkungen auf den Markt bedeutet dies,<br />
dass Biogas nur noch in Ausnahmesituationen zum Zuge kommt.<br />
Kurt Kretschmer<br />
Statements von Kurt Kretschmer,<br />
zuständig für Energy Policy<br />
beim Strom-Direktvermarkter<br />
Energy2market GmbH (e2m),<br />
und dem Gesellschafter Bodo<br />
Drescher zum eingeführten Mischpreisverfahren:<br />
Frage 1: Was bedeutet die Einführung des<br />
Mischpreisverfahrens für den Sekundärregelenergiemarkt<br />
(SRL) beziehungsweise<br />
den Minutenreserve-Regelenergiemarkt?<br />
Kretschmer: „Vordergründig hat sich der<br />
Preiswettbewerb vom Leistungspreis auf<br />
den Arbeitspreis verschoben. Während die<br />
Arbeitspreise also nach Einführung des<br />
Mischpreisverfahrens stark eingebrochen<br />
sind, haben die Leistungspreise extrem<br />
angezogen. Aufgrund des höheren Gewichtungsfaktors<br />
in der SRL ist diese Verschiebung<br />
dort deutlich ausgeprägter zu<br />
beobachten. Diese Rahmenbedingungen<br />
kommen vor allem Anbietern mit konventionellen<br />
Erzeugungstechnologien zugute,<br />
denn deren Grenzarbeitskosten sind<br />
weit niedriger als beispielsweise die von<br />
Erneuerbaren oder industriellen Letztverbrauchern.<br />
Aufgrund der übereilten Einführung<br />
des Mischpreisverfahrens hat die<br />
Fotos: Energy2market GmbH<br />
Bundesnetzagentur (BNetzA), trotz entsprechender<br />
Warnungen aus dem Markt,<br />
aus unserer Sicht jedoch wenig Rücksicht<br />
darauf genommen, welche Verwerfungen<br />
ein neuer Zuschlagsmechanismus am Regelenergiemarkt<br />
für das Gesamtsystem<br />
Strommarkt nach sich ziehen könnte. Im<br />
Ergebnis hat das Mischpreisverfahren zwar<br />
die Arbeitspreise und damit die Höhe des<br />
Ausgleichsenergiepreises stark gesenkt,<br />
dabei aber folgende deutliche Flurschäden<br />
verursacht:<br />
ffDie Gesamtkosten für Regelenergie<br />
sind gestiegen, die Kosten, die durch<br />
die Verbraucher über die Netzentgelte<br />
getragen werden, sogar deutlich.<br />
ffDie Ausgleichsenergiepreise sind so<br />
stark gesunken, dass sie nicht mehr genug<br />
Anreiz zur Bilanzkreistreue bilden.<br />
ffDamit wird im Ergebnis auch deutlich<br />
mehr Regelenergie abgerufen, um das<br />
Energiesystem stabil zu halten.<br />
ffDie häufigen Regelenergieabrufe mit<br />
oft über 80 Prozent der bereitstehenden<br />
Regelleistung führen tendenziell<br />
dazu, dass das System unsicherer wird,<br />
da nicht mehr genug Regelenergie für<br />
Extremereignisse in Reserve steht.<br />
ffDie Häufigkeit von Abrufen in Verbindung<br />
mit dem niedrigen Arbeitspreis<br />
führt dazu, dass vor allem dezentrale<br />
Technologiesegmente dem Regelenergiemarkt<br />
zukünftig den Rücken kehren<br />
und sich damit das Angebotspotenzial<br />
verknappt und auf Technologien<br />
eingrenzt, die im Rahmen der Energiewende<br />
und aufgrund klimapolitischer<br />
Vorgaben eigentlich rückgebaut werden<br />
sollen.<br />
In der Gesamtschau sind die Nachteile für<br />
den Strommarkt, die Systemstabilität und<br />
Bodo Drescher<br />
die Belastung des Endverbrauchers deutlich<br />
gestiegen, und die Vorteile für Bilanzkreisverantwortliche<br />
können dies in keiner<br />
Weise rechtfertigen. Zumal deren Entlastung<br />
auch noch zu Fehlanreizen führt, die<br />
die regulatorisch gewollte Pflicht zur Bilanzkreistreue<br />
unterwandern.“<br />
Frage 2: Welche Folgen hat das Mischpreisverfahren<br />
für Betreiber von Biogasanlagen?<br />
Drescher: „Die wirtschaftliche Attraktivität<br />
des Regelenergiemarktes hat sich für<br />
die Mehrheit der Biogasanlagen-Betreiber<br />
durch die neuen Rahmenbedingungen<br />
deutlich verschlechtert. Aus unserer Sicht<br />
liegt dies jedoch nicht ausschließlich an<br />
deren im Vergleich zu konventionellen<br />
Anbietern hohen Grenzarbeitspreiskosten,<br />
sondern auch an den häufigen Regelenergieabrufen<br />
von einem Großteil der vorgehaltenen<br />
Regelleistung.<br />
In Kombination wird es dadurch schwerer,<br />
attraktive Leistungspreise in Verbindung<br />
mit angemessener Abrufhäufigkeit zu erzielen.<br />
Das heißt, solange der Impuls durch<br />
Regelenergiearbeit auf die Ausgleichsenergiepreise<br />
weiterhin so schwach bleibt,<br />
fehlt es Biogasanlagen-Betreibern an den<br />
47
praxis<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
wirtschaftlichen Anreizen, ihre Flexibilität<br />
dem Übertragungsnetzbetreiber am Regel -<br />
energiemarkt anzubieten.<br />
Energy2market wirkt allerdings nachdrücklich,<br />
gerade auch im politischen Raum, auf<br />
die immer stärker zutage tretenden Marktverwerfungen<br />
hin und geht davon aus, dass<br />
mit steigendem Erkenntnisgewinn über die<br />
Auswirkungen des Mischpreisverfahrens<br />
bei den Entscheidern auch ein Anpassungsbedarf<br />
erkannt wird.“<br />
Frage 3: Ist die von der Bundesnetzagentur<br />
beschlossene vorübergehende Änderung<br />
des Zuschlagmechanismus für Sekundärregelung<br />
und Minutenreserve geeignet, um<br />
einen funktionsfähigen Wettbewerb zu gewährleisten?<br />
Kretschmer: „Nein, im Gegenteil. In der<br />
Vergangenheit konnte beobachtet werden,<br />
dass die Kostenreduzierung für Regelenergie<br />
im Wesentlichen auf die Erhöhung der<br />
Anzahl der Anbieter zurückzuführen war.<br />
Diese neuen Anbieter waren mehrheitlich<br />
Aggregatoren wie die Energy2market, mit<br />
deren Hilfe dezentrale Anlagen ihre Flexibilität<br />
am Regelenergiemarkt anbieten<br />
Seitz Electric GmbH GasManager BGJ 1_<strong>2019</strong>.pdf 1 07.12.18 13:56<br />
konnten. Der faktische Ausschluss von<br />
dezentralen Erzeugern und Verbrauchern<br />
aufgrund ihrer höheren Grenzarbeitspreise<br />
führt dazu, dass sich der Wettbewerb auf<br />
nur noch wenige große Anbieter von konventionellen<br />
Erzeugungsanlagen beschränken<br />
wird. Der mangelnde Wettbewerb zeigt<br />
sich bereits in den gestiegenen Gesamtkosten<br />
für Regelenergie.“<br />
Frage 4: Wie müsste das jetzige System<br />
weiterentwickelt werden?<br />
Kretschmer: „Die entscheidende Stellschraube<br />
ist dabei der dem Mischpreisverfahren<br />
zugrundeliegende Gewichtungsfaktor,<br />
der die beschriebenen<br />
Marktverzerrungen auslöst. Aus unserer<br />
Sicht können bereits geringe Anpassungen<br />
innerhalb des Mischpreisverfahrens dessen<br />
negative Auswirkungen für dezentrale<br />
Flexibilitätsanbieter und den Strommarkt<br />
als Ganzes deutlich abfedern, ohne Bilanzkreisbetreiber<br />
dem Risiko einer Wiederholung<br />
der Ausgleichsenergiepreise vom<br />
17.10.2017 auszusetzen. Im Grundsatz<br />
bietet das Mischpreisverfahren dann auch<br />
wieder ausreichend Anreiz für Anbieter<br />
von dezentraler Flexibilität. Um die negative<br />
Wirkung des Gewichtungsfaktors<br />
abzufedern, sind aus unserer Sicht mehrere<br />
Optionen denkbar. Dazu zählen die<br />
Absenkung des Faktors, die Erhöhung<br />
der Ausschreibungsmenge oder etwa die<br />
Einführung eines individuellen Gewichtungsfaktors,<br />
der nach Abrufwahrscheinlichkeiten<br />
unterscheidet, wie ihn bereits<br />
das Bundeskartellamt im Rahmen des<br />
BNetzA-Festlegungsverfahrens vorgeschlagen<br />
hat.“<br />
Statement von Alexander Krautz,<br />
Team Manager, Innovation &<br />
Development, beim Strom-Direktvermarkter<br />
Next Kraftwerke<br />
GmbH.<br />
„Das MPV verzerrt die Marktrealitäten –<br />
insbesondere zu Lasten von Biogasanlagen,<br />
die niedrige Leistungspreise, aber<br />
vergleichsweise hohe Arbeitspreise besitzen.<br />
Mit dieser Kostenstruktur haben Biogasanlagen<br />
in den vergangenen Jahren die<br />
Funktion von Spitzenlastkraftwerken in der<br />
Regelenergie übernommen und so einen<br />
wesentlichen Beitrag zur Kostensenkung<br />
BIOGAS<br />
SEITZ ELECTRIC<br />
messen · steuern · regeln<br />
Gas-Füllstand<br />
Für jeden Gasspeicher<br />
die richtige Füllstandsmessung<br />
GasHmeter XA oder XU<br />
GasManagement<br />
Gasspeicher-<br />
Füllstands-Abluftregelung<br />
Einen geregelten Füllstands-Ausgleich<br />
mehrerer Doppelmembran-Gasspeicher<br />
auf gleichen oder vordefinierten<br />
Füllstand<br />
.<br />
BHKW-Ansteuerung<br />
Flex,-/ Regelenergie-Betrieb über<br />
virtuelle Kraftwerksbetreiber<br />
48<br />
Multi-Analog-Wandler<br />
Verbindet mehrere 4-20mA Signale von<br />
verschiedenen Messungen und Gasspeichern<br />
zu einem Gasfüllstands-Signal<br />
+ BHKW 1/2 Soll-Leistung<br />
+ Fackelansteuerung<br />
+ Hoch-, Tief-Alarme<br />
Gasspeicher-<br />
Druck-Ausgleich<br />
Gastransport zwischen EPDM-Hauben<br />
oder Gassack und Druck-Gasspeichern<br />
wie Doppelmembrane<br />
oder 3/4 Kugel<br />
Seitz Electric GmbH Saalfeldweg 6 86637 Wertingen/Bliensbach 08272 993160 info@seitz-electric.de www.seitz-electric.de
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
praxis<br />
Alexander Krautz<br />
im Markt geleistet. Biogasanlagen haben<br />
vor der Einführung des MPV rund ein Drittel<br />
der insgesamt in Deutschland nachgefragten<br />
negativen Sekundärregelleistung<br />
bereitgestellt und in einem offenen Markt<br />
die Systemverantwortung übernommen,<br />
die von ihnen verlangt wird.<br />
Profiteure sind im Wesentlichen Anbieter<br />
mit konventionellen Kraftwerken. Den Preis<br />
dafür zahlen die Verbraucher über ihre<br />
Netzentgelte. Weitere Nutznießer sind aber<br />
auch Bilanzkreisverantwortliche (BKV) mit<br />
hohen Abweichungen in ihren Bilanzkreisen,<br />
da der Preis für Ausgleichs energie<br />
durch die sehr niedrigen Arbeitspreise sehr<br />
Foto: Next Kraftwerke GmbH<br />
stark gesunken ist. Wenn die Differenz des<br />
zu erwartenden Ausgleichsenergiepreises<br />
relativ nah am Intraday-Preis liegt, kann<br />
es für den BKV mit nicht ganz eindeutigen<br />
Prognosen rentabel sein, eher eine Risikoposition<br />
einzunehmen. Verzockt sich der<br />
BKV, muss er zwar den Ausgleichsenergiepreis<br />
zahlen – dank des MPV ist diese<br />
Strafzahlung jedoch im Verhältnis zum vorherigen<br />
Preismodell nicht mehr so hoch. So<br />
wird es für den BKV lukrativer, Risikopositionen<br />
einzugehen.<br />
Auch wenn alle Händler betonen, dass sie<br />
ihre Bilanzkreise weiter mit größter Sorgfalt<br />
bewirtschaften, lässt sich dieses Verhalten<br />
im Markt aktuell sehr gut beobachten und<br />
hat etwa am 14. Dezember 2018 auch zu<br />
einem Extremereignis geführt, das unter<br />
anderem zu sehr hohen Abrufen von abschaltbaren<br />
Lasten geführt hat. In einem<br />
Artikel der FAZ werden schlechte Prognosen<br />
der fluktuierenden Erneuerbaren Energien<br />
als eine der entscheidenden Ursachen<br />
ausgemacht. Wir sind jedoch der Meinung,<br />
dass dies vielmehr ein treffendes Beispiel<br />
für die Wechselwirkungen der Märkte ist<br />
und sich an diesem Beispiel zeigt, wie sich<br />
das MPV negativ auf den Anreiz auswirkt,<br />
Fehlprognosen handelsseitig auszugleichen.<br />
Anstatt dieser Komplexität entsprechend<br />
Rechnung zu tragen, wurde am 14.<br />
Dezember in verkürzter Weise den Erneuerbaren<br />
der schwarze Peter zugeschoben.<br />
Diese Darstellung suggeriert, dass unsere<br />
Netze nicht noch mehr Erneuerbare vertragen<br />
können. Im Zuge der Diskussion über<br />
den Kohleausstieg kommt diese Situation<br />
der konventionellen Kraftwerksbranche<br />
recht gelegen.<br />
Auch in den Antworten auf die Kleine Anfrage<br />
(19/7276) von MdB Ingrid Nestle<br />
(B`90/Grüne) wird deutlich, dass das Bundeswirtschaftsministerium<br />
diese neuen<br />
Spielregeln absurderweise als fair erachtet<br />
und nicht gewillt ist, an einer Wiederherstellung<br />
oder der Verbesserung der Marktregeln<br />
zu arbeiten und so wieder eine stärkere<br />
Partizipation von dezentralen Anlagen<br />
im Regelenergiemarkt zu ermöglichen. Es<br />
bleibt nur zu hoffen, dass die BNetzA sich<br />
mit der Einführung der Regelarbeitsmärkte<br />
nicht noch länger unnötig Zeit lässt. Denn<br />
diese würden definitiv eine Verbesserung<br />
zum aktuellen System darstellen.“<br />
APROVIS. Better Performance.<br />
ARBEITEN SIE MIT INNOVATIVER TECHNOLOGIE AUS DEUTSCHLAND!<br />
JETZT BEWERBEN!<br />
Energie ist unser Thema. Wir arbeiten an der effi zienten Energienutzung und damit an der Reduktion des CO 2 -Ausstoßes. Unser Schwerpunkt ist die Projektierung von kompletten Abgasanlagen und deren Komponenten<br />
für Blockheizkraftwerke, sowie von Systemen und Komponenten für die Brenngasaufbereitung (Bio-/Sondergase). Unsere Produkte vertreiben wir weltweit. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort:<br />
Service- und Wartungstechniker /<br />
Inbetriebnehmer (m/w)<br />
IHRE AUFGABEN:<br />
Service- und Wartungseinsätze sowie<br />
Störungsbehebung beim Kunden<br />
Schulung und Einweisung des<br />
Betreiberpersonals<br />
Dokumentation der ausgeführten Tätigkeiten<br />
WIR BIETEN:<br />
Hohe Beschäftigungssicherheit<br />
Berufseinsteigern eine fundierte Einarbeitung<br />
in unserer Unternehmenszentrale<br />
Eigenes Service- / Wartungsgebiet in<br />
Norddeutschland<br />
Home-Arbeitsplatz<br />
Permanente Weiterentwicklung<br />
UNSERE ERWARTUNGEN:<br />
Abgeschlossene elektrotechnische Ausbildung<br />
Erfahrung in Steuer-/ Regelungstechnik<br />
Hohe Service- und Dienstleistungsorientierung<br />
Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft,<br />
Zuverlässigkeit<br />
Reisebereitschaft<br />
IHRE RAHMENBEDINGUNGEN:<br />
Überstunden werden in Freizeit oder<br />
Geld abgegolten<br />
Geregelte Arbeitszeit Montag - Freitag<br />
Reisezeit ist Arbeitszeit<br />
Keine Rufbereitschaft<br />
Projekt- / Vertriebsingenieur (m/w)<br />
IHRE AUFGABEN:<br />
Entwicklung von Lösungs konzepten in enger<br />
Zusammenarbeit mit unseren Kunden<br />
Kundenakquisition und Kunden betreuung<br />
Projektierung wärmetechnischer Apparate<br />
und Anlagen<br />
Kalkulation und Angebotserstellung<br />
WIR BIETEN:<br />
Hohe Beschäftigungssicherheit<br />
Berufseinsteigern eine fundierte Einarbeitung<br />
Arbeiten im Team mit fl achen Hierarchien<br />
Eigenverantwortliches und selbstständiges<br />
Arbeiten in einem kollegialen Umfeld<br />
Permanente Weiterentwicklung<br />
UNSERE ERWARTUNGEN:<br />
Studium Maschinenbau / Verfahrenstechnik /<br />
Umwelttechnik / Wirtschaftsingenieurwesen<br />
Erste Berufserfahrungen im<br />
technischkommerziellen Vertrieb<br />
Thermodynamische Grundkenntnisse<br />
Reisebereitschaft<br />
Gute Englischkenntnisse<br />
Eine weitere Fremdsprache ist von Vorteil<br />
Wenn Sie gerne in unserem Team mitarbeiten möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie diese an:<br />
APROVIS Energy Systems GmbH · Frau Petra Zotikos · Ornbauer Str. 10 · 91746 Weidenbach · jobs@aprovis.com<br />
49<br />
www.aprovis.com
praxis<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Neue Herausforderungen beim<br />
Nährstoffmanagement<br />
Die gesetzlichen Anforderungen für die organische Düngung wurden verschärft. Auf manchen Biogasbetrieben<br />
wird der Lagerraum knapp. Die Düngung mit Gärprodukt im Herbst ist nur noch eingeschränkt möglich. Damit<br />
ist auch die zur Verfügung stehende Fläche zur Ausbringung begrenzt. Welche Möglichkeiten haben Betreiber,<br />
darauf zu reagieren? Gärprodukte sind ein wertvoller Dünger, der teuren und energieintensiv hergestellten<br />
Mineraldünger ersetzen kann.<br />
Von Thomas Gaul<br />
Die Gärproduktlager waren auf<br />
vielen Biogasbetrieben über<br />
den Winter wieder gut gefüllt.<br />
Mit Ende der Sperrfrist am 31.<br />
Januar darf das stickstoffhaltige<br />
Düngemittel bei günstigen Bodenverhältnissen<br />
zur Versorgung der Ackerkulturen<br />
ausgebracht werden. Mit der in 2017<br />
in Kraft getretenen Düngeverordnung ist<br />
es für Landwirte mit einer Biogasanlage<br />
jedoch komplizierter geworden. Wichtigster<br />
Punkt ist die Obergrenze von 170 Kilogramm<br />
(kg) Stickstoff (N) je Hektar und<br />
Jahr, die nun für alle Gärprodukte gilt.<br />
Hinzu kommt, dass der Lagerraum für Gärprodukte<br />
für sechs beziehungsweise neun<br />
Monate reichen soll.<br />
Außerdem müssen die Ergebnisse einer<br />
Bodenuntersuchung vorliegen, aus der der<br />
Düngebedarf an Stickstoff und Phosphat<br />
hervorgeht. Wer Gärprodukt abgibt, muss<br />
die Nährstoffgehalte und das Ausgangsmaterial<br />
des Wirtschaftsdüngers (Analysewerte<br />
oder Richtwerttabelle) mitliefern. In der<br />
Düngeplanung steckt nun entsprechend<br />
viel Arbeit.<br />
Gärdüngerausbringung per Lkw mit<br />
Schleppschlauchverteiler bei der Gutsgemeinschaft<br />
Lenthe. Der Lkw verfügt über<br />
spezielle Breitreifen und eine Reifendruckregelanlage.<br />
Nährstoffe aufbereiten<br />
Peter Schünemann-Plag, Berater bei der<br />
Landwirtschaftskammer Niedersachsen,<br />
bringt es auf den Punkt: „Es gibt zu viele<br />
Nährstoffe und zu wenig Lagerraum.“ In<br />
manchen Regionen sei die Ausbringfläche<br />
knapp: „Oft unterschätzen Betriebsleiter,<br />
wie viel Fläche sie wirklich benötigen. Für<br />
einen Hektar Silomais benötige ich auch<br />
einen Hektar Ausbringfläche.“ Den Bau<br />
neuer Gärprodukt-Lagerbehälter hält der<br />
Berater für die teuerste Variante, das Problem<br />
zu lösen.<br />
Das Thema Separation sei im Kommen,<br />
sagt Schünemann-Plag. Sinnvoller als das<br />
Gärprodukt zu separieren, sei allerdings die<br />
Möglichkeit, Gülle zu separieren. Der Feststoff<br />
ist dann transportwürdiger und kann<br />
auch in den Ackerbauregionen eingesetzt<br />
werden, um ihn dort in der Biogasanlage<br />
zu vergären. Um kurzfristig Lagerraum<br />
zu sparen, sind vermehrt leistungsstarke<br />
mobile Separatoren von Maschinenringen<br />
und Lohnunternehmern unterwegs. Die<br />
Investition in eigene Technik will dagegen<br />
gut überlegt sein: Ein Pressschnecken-<br />
Separator erfordert Investitionskosten von<br />
40.000 bis 50.000 Euro und spart etwa<br />
1.667 Kubikmeter Lagerraum.<br />
Um Lagerraum zu sparen, setzen viele Biogasanlagen<br />
auch auf die Trocknung der Gärprodukte.<br />
„Anfangs stand eher der Erhalt<br />
des KWK-Bonus im Vordergrund, doch jetzt<br />
geht es wirklich darum, effizient Wasser<br />
zu verdampfen“, sagt Schünemann-Plag.<br />
In seinem Biogas-Arbeitskreis haben 10<br />
von 24 Biogasanlagen eine Trocknung installiert,<br />
viele davon zunehmend leistungsstarke<br />
Vakuumverdampfer, berichtet der<br />
Berater: „Viele Trockner wurden gerade im<br />
vergangenen Jahr in Betrieb genommen.“<br />
Dabei ist die Trocknung nicht immer der<br />
Königsweg. Denn der Betreiber muss sich<br />
zuvor Gedanken machen, was mit dem<br />
getrockneten Gärrest passieren soll. Nachteilig<br />
ist der hohe Wärmebedarf, denn je<br />
Kilowatt kann höchstens ein Liter Wasser<br />
verdampft werden. Um den gesamten Gärrest<br />
einer 500-kW-Biogasanlage zu trocknen,<br />
ist fast keine andere Wärmenutzung<br />
möglich – es sei denn, die Trocknung läuft<br />
hauptsächlich in den Sommermonaten,<br />
wenn andere Wärmenutzer keinen Bedarf<br />
haben.<br />
50
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
praxis<br />
Full Service<br />
in Place<br />
Fotos: Thomas Gaul<br />
Der Gärdünger wird per Tankwagen zum Feldrand gebracht<br />
und dort in das Ausbringfahrzeug umgepumpt.<br />
Vollaufbereitung in Belgien und<br />
den Niederlanden<br />
Noch einen Schritt weiter geht die sogenannte<br />
Vollaufbereitung, wie sie in Gebieten<br />
mit intensiver Tierhaltung in den Niederlanden<br />
und Belgien etabliert ist. Das<br />
Wasser wird gegen die halbdurchlässigen<br />
Membranen der Umkehrosmose gepresst.<br />
Die Wassermoleküle dringen durch und<br />
die Verunreinigungen bleiben zurück. Das<br />
entstehende Wasser kann für betriebliche<br />
Zwecke verwendet oder ohne weitere<br />
Behandlung in einen Vorfluter eingeleitet<br />
werden.<br />
Die Kosten des Verfahrens beziffert Stephan<br />
Kühne von Agrikomp auf 3,20 Euro<br />
je Tonne Gärprodukt. Eine Erweiterung des<br />
Gärproduktlagers für eine 500-kW-Biogasanlage<br />
würde demgegenüber 11,60 Euro<br />
pro Kubikmeter kosten. „Die zweistufige<br />
Aufbereitung ist für eine solche Biogasanlage<br />
die günstigste Lösung“, so Kühne.<br />
Zumal mit der Ammonium-Sulfat-Lösung<br />
(ASL) ja auch ein hochkonzentrierter und<br />
wirksamer Pflanzendünger entsteht.<br />
Allerdings muss der Nährstoffgehalt exakt<br />
eingestellt werden, soll ein handelsfähiger<br />
Dünger entstehen. Sonst bleibt nur<br />
die Ausbringung auf eigenen Betriebsflächen.<br />
Und auch die erforderliche Investitionssumme<br />
ist ein Hemmnis, wie Kühne<br />
zugibt: „Viele Landwirte sind nicht bereit,<br />
diesen Weg zu gehen, weil damit hohe Kosten<br />
von 700.000 Euro für die Umkehrosmose<br />
verbunden sind.“ Mit dem Verfahren<br />
ist eine Verringerung der Gärproduktmenge<br />
um rund 70 Prozent möglich. Positiver<br />
Nebeneffekt im Ackerbau ist ein besseres<br />
Nährstoffmanagement. Durch die getrennten<br />
Nährstofffraktionen können die Nährstoffe<br />
gezielter und effizienter eingesetzt<br />
werden.<br />
Substratmix ändern<br />
Wenn die Fläche knapp ist, sollten nährstoffreiche<br />
Substrate herausgenommen<br />
werden. Das betrifft beispielsweise Hühnertrockenkot<br />
(HTK), der in Regionen mit<br />
Nährstoffüberschuss ohnehin nicht wieder<br />
in der Biogasanlage verflüssigt werden<br />
sollte. Auch wasserreiche Substrate wie<br />
die Zuckerrübe sollten trotz ihrer guten<br />
Eigenschaften bei der Vergärung lieber<br />
herausgenommen werden. Bei knappem<br />
Lagerraum wären energiereiche Substrate<br />
wie Getreide oder CCM eine gute Alternative.<br />
Allerdings sollte bei diesen Substraten<br />
der Preis nicht außer Acht gelassen werden,<br />
warnt Schünemann-Plag: „Sind die<br />
Substrate nicht zu teuer gemessen an der<br />
Vergütung, die ich am Ende bekomme?“<br />
Ein Baustein beim Nährstoffmanagement<br />
kann auch die Steigerung der Effizienz des<br />
Biogasprozesses sein. Dabei geht es nicht<br />
nur um den Einsatz von Spurenelementen<br />
und Enzymen, sondern auch um Technik<br />
zum Substrataufschluss, so Schünemann-<br />
Plag: „Durch den schnelleren Abbau bei<br />
einer kürzeren Verweilzeit habe ich auch<br />
weniger Substrat.“ Potenzial steckt auch<br />
in der Flexibilisierung. Durch die neuen<br />
Motoren mit einem höheren Wirkungsgrad<br />
wird auch Substrat eingespart und damit<br />
ebenfalls die Gärproduktmenge reduziert.<br />
Substrateinsparungen von mindestens 10<br />
Prozent sind nach Einschätzung des Beraters<br />
realistisch.<br />
Betreiber sollten vor allem daran denken,<br />
den Umgang mit Oberflächenwasser auf<br />
der Biogasanlage anders zu handhaben.<br />
51<br />
Erleichterte Wartung und Service:<br />
Freier Zugriff auf alle Verschleißteile<br />
Ab sofort können Sie NEMO® Exzenterschneckenpumpen<br />
komplett im eingebauten<br />
Zustand warten – ohne Spezialwerkzeug,<br />
und das in der Hälfte der Zeit.<br />
Fragen Sie nach unseren Umbau-Sets<br />
oder steigen Sie bei Neuanschaffung in<br />
die FSIP®-Baukastentechnologie ein.<br />
NETZSCH Pumpen im FSIP®-Design<br />
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH<br />
Geretsrieder Str. 1<br />
84478 Waldkraiburg<br />
Deutschland<br />
Tel.: +49 8638 63-0<br />
info.nps@netzsch.com<br />
www.netzsch.com
praxis<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Wenn es gelingt, dieses Wasser<br />
separat aufzufangen und zu behandeln,<br />
kann wertvoller Lagerraum<br />
für Gärprodukte gespart<br />
werden. Inzwischen stehen<br />
mehrere praxisreife technische<br />
Lösungen zur Verfügung, über<br />
die das Biogas Journal in den<br />
vergangenen Ausgaben berichtet<br />
hat.<br />
Als hochwertiger Naturdünger<br />
haben sich Gärprodukte auf<br />
reinen Ackerbaubetrieben bewährt.<br />
Der Nährstoffkreislauf<br />
wird geschlossen, der Humusgehalt<br />
des Bodens erhöht und<br />
die Erträge auf jeden Fall stabilisiert.<br />
Durch das Einsparen<br />
von Mineraldünger wird auch<br />
die Klimabilanz im Ackerbau<br />
verbessert.<br />
Mineraldünger durch<br />
Gärprodukt ersetzen<br />
Gute Erfahrungen mit dem<br />
Einsatz von Gärprodukten hat<br />
man bei der Gutsgemeinschaft<br />
Lenthe gemacht. Der 300-Hektar-Ackerbaubetrieb<br />
am südwestlichen<br />
Stadtrand von Hannover wird als Betriebsgemeinschaft<br />
der beiden Gesellschafterfamilien<br />
v. Richthofen und v. Lenthe geführt.<br />
Betrieben wird seit 2006 auch eine Biogasanlage<br />
mit 530 Kilowatt (kW), deren Leistung<br />
im Zuge einer Flexibilisierung auf 795<br />
kW el<br />
erweitert wurde.<br />
Als Substrat dient fast ausschließlich<br />
Mais, der überwiegend auf der eigenen Betriebsfläche<br />
angebaut wurde. Vor der Mais-<br />
Aussaat wurde schon immer Gärprodukt<br />
ausgebracht und umgehend in den Boden<br />
eingearbeitet. Doch auch vor der Aussaat<br />
der Zuckerrüben wird jetzt in Lenthe so verfahren.<br />
Diese Kultur ist auf den schweren<br />
Lößlehmböden des Calenberger Landes<br />
ein traditionell wichtiger Bestandteil der<br />
Fruchtfolge.<br />
„Die Rüben und der Mais verwerten den im<br />
Gärprodukt enthaltenen Stickstoff am besten“,<br />
hat Gutsverwalter Christian Ludden<br />
festgestellt. Ab Anfang Februar wäre zwar<br />
auch die Startdüngung im Weizen möglich.<br />
Der Ausnutzungsgrad wäre hier aber nur<br />
halb so hoch. Außerdem müsste man dann<br />
auf Nachtfrost warten, weil die schweren<br />
Böden druckempfindlich sind und die Ausbringfahrzeuge<br />
tiefe Spuren hinterlassen<br />
Gutsverwalter Christian Ludden bei der Bodenprobennahme zur Bestimmung<br />
des Nährstoffgehalts Anfang Februar. Er hat festgestellt, dass Mais und Rüben<br />
den Stickstoff im Gärdünger am besten verwerten.<br />
würden. „Optimal wäre bei unseren Böden<br />
die Verschlauchung“, meint der Gutsverwalter.<br />
Dann wäre auf dem Acker nur ein<br />
relativ leichter Schlepper mit der Ausbringtechnik<br />
unterwegs. Derzeit bringt ein<br />
Lohnunternehmer das Gärprodukt aus. Er<br />
setzt dazu spezielle Lkw mit Breitreifen und<br />
Reifendruck-Regelanlage ein. Mit Schleppschläuchen<br />
wird das Gärprodukt verteilt.<br />
Gärdünger statt Harnstoff bei<br />
Zuckerrüben<br />
Früher wurde vor der Aussaat der Zuckerrüben<br />
ausschließlich mineralisch gedüngt,<br />
über lange Jahre wurde Harnstoff gestreut.<br />
Der wird nun durch den Einsatz des Gärproduktes<br />
substituiert. Und das mit gutem Erfolg,<br />
denn die Erträge können sich wahrlich<br />
sehen lassen. Mit durchschnittlich 18,5<br />
Tonnen Zucker je Hektar wurden Spitzenwerte<br />
erzielt – und das angesichts der Trockenheit<br />
im vergangenen Jahr.<br />
Aber auch hier wirkt sich die Gärprodukt-<br />
Düngung positiv aus, so Christian Ludden:<br />
„Durch die organische Düngung halten<br />
die Bestände einfach länger durch.“ Die<br />
Wasserverfügbarkeit sei einfach höher. Die<br />
Rüben erhalten als einzigen mineralischen<br />
Dünger nur noch etwas Kali. Die Zuckerrüben<br />
folgen in Lenthe auf den<br />
Weizen, sodass der Anbau einer<br />
Zwischenfrucht vorgenommen<br />
werden kann.<br />
Vor der Aussaat der Gründüngung<br />
im Spätsommer wird<br />
ebenfalls Gärprodukt ausgebracht:<br />
„Bei der Menge sind<br />
wir allerdings durch den gesetzlichen<br />
Rahmen auf 60 kg<br />
N/ha begrenzt“, erläutert der<br />
Gutsverwalter: „Das entspricht<br />
bei uns einer Ausbringmenge<br />
von 12 Kubikmeter je Hektar.“<br />
Die letzten Flächen wurden im<br />
vergangenen Jahr erst am 15.<br />
September mit Zwischenfrüchten<br />
bestellt. Die Bestände konnten<br />
sich bis zum Wintereinbruch<br />
gut entwickeln. Dazu hat sicher<br />
die warme Witterung im Herbst<br />
beigetragen. Christian Ludden<br />
vermutet aber auch hohe N-<br />
Überhänge aus dem Weizen:<br />
„Seit der letzten Düngung hat<br />
es praktisch nicht mehr geregnet.“<br />
Denn die zulässige Menge<br />
für die Herbstdüngung sei eigentlich<br />
zu gering, um üppiges Wachstum<br />
erwarten zu lassen.<br />
Bei der Düngung der für dieses Jahr vorgesehenen<br />
78 Hektar Zuckerrüben und<br />
57 Hektar Mais wird daher angesichts der<br />
erwarteten N-Überhänge eher Zurückhaltung<br />
angebracht sein. Anfang Februar zog<br />
Christian Ludden Bodenproben auf dem<br />
Acker, um hier Gewissheit zu haben. Auch<br />
die Gärprodukte werden zwei- bis dreimal<br />
jährlich analysiert, sagt Ludden: „Mindestens<br />
einmal im Frühjahr und im Sommer.“<br />
Große Abweichungen gibt es hier allerdings<br />
nicht, da der Substrat-Input gleich bleibt.<br />
Durch den hohen TM-Gehalt vom Silomais<br />
und wenig Regenwasser im vergangenen<br />
Jahr ist im Gärproduktlager in Lenthe auch<br />
noch ausreichend Platz, sodass der Betrieb<br />
der Frühjahrsdüngung entspannt entgegensehen<br />
kann.<br />
Autor<br />
Thomas Gaul<br />
Freier Journalist<br />
Im Wehrfeld 19a · 30989 Gehrden<br />
01 72/512 71 71<br />
gaul-gehrden@t-online.de<br />
52
Um die Erderhitzung zu stoppen müssen wir auf Erneuerbare Energien umsteigen.<br />
Sonne und Wind stehen uns unbegrenzt und kostenlos zur<br />
Verfügung. Aber nicht immer. Deshalb brauchen wir zusätzliche regenerative<br />
Quellen, die verlässlich zur Verfügung stehen. So wie Biogas.<br />
Das in den Fermentern bei der Vergärung von Gülle, Bioabfall und<br />
Energiepflanzen entstehende Gas kann gespeichert und je nach Bedarf<br />
kurzfristig in Strom und Wärme umgewandelt werden. So wird der<br />
Wind- und Solarstrom genutzt, wenn er entsteht - und Biogas springt ein,<br />
sobald Sonne und Wind eine Pause machen.<br />
Die Biogasanlage Biogas GmbH hat zwei Blockheizkraftwerke (BHKW) mit<br />
einer Leistung von je 250 kW. Darin wird aus Biogas Strom und Wärme<br />
erzeugt.<br />
Die Kraftwerke werden von den Stadtwerken XY ferngesteuert. Je nach<br />
Strombedarf können sie an- oder abgeschaltet werden. Wenn das<br />
Stromnetz voll ist, wird das Biogas in der Kuppel des Fermenters<br />
gespeichert. Und wenn Strombedarf besteht, können die BHKWs<br />
innerhalb weniger Sekunden ihre maximale Leistung von 500 kW abrufen.<br />
Biogasanlage Biogas GmbH<br />
Die im Fermenter befindlichen Bakterien wandeln die Biomasse,<br />
z.B. biologische Abfälle, nachwachsende Rohstoffe und Gülle,<br />
zu Biogas und Gärprodukten um.<br />
Das erzeugte Biogas wird in der Gashaube aufgefangen<br />
und von hier über Gasleitungen zum<br />
Blockheizkraftwerk (BHKW) transportiert.<br />
Im BHKW wird aus dem Biogas<br />
Strom und Wärme erzeugt.<br />
1 Lager für die zu vergärende Biomasse<br />
(Silo, Annahmestelle, Güllegrube)<br />
2 ggf. Aufbereitung, Sortierungs- oder<br />
Reinigungssysteme für die zu vergärende<br />
Biomasse oder Reststoffe<br />
3 Einbring- / Pumptechnik transportiert<br />
die Biomasse in die Fermenter bzw.<br />
aus diesen heraus<br />
4 Rührwerke vermischen die Bakterien<br />
im Fermenter mit der frischen Biomasse<br />
5 Heizung – die übliche Gärtemperatur<br />
liegt bei 40 °C<br />
6 Gasspeicher zur kurz- und mittelfristigen<br />
Speicherung des Biogases<br />
7 Gasreinigungssysteme zur Entschwefelung<br />
und Entwässerung<br />
8 Pumpleitungen für Gärsubstrate<br />
und Biogasleitungen<br />
9 Sicherheitstechnik: Drucksicherungen,<br />
Sicherheitsventile<br />
10 Blockheizkraftwerk für die gleichzeitige<br />
Strom- und Wärmeproduktion<br />
11 ggf. Aufbereitungs technik für die<br />
Um wandlung von Biogas zu Biomethan<br />
12 Lagerbehälter für die ausgefaulten<br />
Gärprodukte (ggf. mit entsprechender<br />
Technik zur Weiterverarbeitung<br />
(Fest-/Flüssigtrennung, Trocknung,<br />
Pelletierung etc.)<br />
FV Schild - so funktioniert eine Anlage A0 quer.indd 1 16.06.16 11:00<br />
Planeten.<br />
Die im Fermenter befindlichen Bakterien wandeln die Biomasse, z.B. biologische Abfälle,<br />
nachwachsende Rohstoffe und Gülle, zu Biogas und Gärprodukten um. Das erzeugte Biogas<br />
wird in der Gashaube aufgefangen und von hier über Gasleitungen zum Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) transportiert. Im BHKW wird aus dem Biogas Strom und Wärme erzeugt.<br />
Bei der Ausgestaltung von Biogasanlagen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme,<br />
Techniken und Funktionsweisen. Der übliche Aufbau umfasst folgende Komponenten:<br />
1<br />
2<br />
6<br />
9<br />
3<br />
5 4<br />
3<br />
12<br />
8<br />
1 Lager für die zu vergärende Biomasse<br />
(Silo, Annahmestelle, Güllegrube)<br />
2 ggf. Aufbereitung, Sortierungs oder<br />
Reinigungssysteme für die zu vergärende<br />
Biomasse oder Reststoffe<br />
3 Einbring / Pumptechnik transportiert<br />
die Biomasse in die Fermenter bzw.<br />
aus diesen heraus<br />
4 Rührwerke vermischen die Bakterien<br />
im Fermenter mit der frischen Biomasse<br />
5 Heizung – die übliche Gärtemperatur<br />
liegt bei 40 °C<br />
6 Gasspeicher zur kurz und mittelfristigen<br />
Speicherung des Biogases<br />
7 Gasreinigungssysteme zur<br />
Entschwefelung und Entwässerung<br />
Strom<br />
Wärme<br />
8 Pumpleitungen für Gärsubstrate<br />
und Biogasleitungen<br />
9 Sicherheitstechnik: Drucksicherungen,<br />
Sicherheitsventile<br />
10 Blockheizkraftwerk für die gleichzeitige<br />
Strom und Wärmeproduktion<br />
11 ggf. Aufbereitungstechnik für die<br />
Umwandlung von Biogas zu Biomethan<br />
12 Lagerbehälter für die ausgefaulten<br />
Gärprodukte (ggf. mit entsprechender<br />
Technik zur Weiterverarbeitung<br />
(Fest/Flüssigtrennung, Trocknung,<br />
Pelletierung etc.)<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
8<br />
7<br />
5<br />
8<br />
11<br />
Erdgasnetz<br />
10<br />
1<br />
2<br />
9<br />
3<br />
5 4<br />
3<br />
12<br />
8<br />
1 Lager für die zu vergärende Bioma se<br />
(Silo, Annahmeste le, Gü legrube)<br />
2 gf. Aufbereitung, Sortierungs oder<br />
Reinigung systeme für die zu ver<br />
3 Einbring / Pumptechnik transportiert<br />
die Bioma se in die Fermenter bzw.<br />
4 Rührwerke vermischen die Bakterien<br />
im Fermenter mit der frischen Bio<br />
5 Heizung – die übliche Gärtemperatur<br />
liegt bei 40 °C<br />
6 Ga speicher zur kurz und mi telfristigen<br />
Speicherung des Biogases<br />
7 Gasreinigung systeme zur<br />
Entschwefelung und Entwässerung<br />
gärende Bioma se oder Reststo fe<br />
aus diesen heraus<br />
masse<br />
6<br />
Wärme<br />
8<br />
7<br />
5<br />
8<br />
12 Lagerbehälter für die ausgefaulten<br />
Gärprodukte ( gf. mit entsprechen<br />
methan<br />
der Technik zur Weiterverarbeitung<br />
(Fest/Flü sigtrennung, Trocknung,<br />
Pe letierung etc.)<br />
1<br />
Strom<br />
10<br />
www.biogas.org<br />
Erdgasnetz<br />
1<br />
2<br />
9<br />
3<br />
5 4<br />
3<br />
12<br />
8<br />
1 Lager für die zu vergärende Bioma se<br />
(Silo, Annahmeste le, Gü legrube)<br />
2 gf. Aufbereitung, Sortierungs oder<br />
Reinigung systeme für die zu vergärende<br />
Bioma se oder Reststoffe<br />
3 Einbring / Pumptechnik transportiert<br />
die Bioma se in die Fermenter bzw.<br />
aus diesen heraus<br />
4 Rührwerke vermischen die Bakterien<br />
im Fermenter mit der frischen Bioma<br />
se<br />
5 Heizung – die übliche Gärtemperatur<br />
liegt bei 40 °C<br />
6 Ga speicher zur kurz und mi telfristigen<br />
Speicherung des Biogases<br />
7 Gasreinigung systeme zur<br />
Entschwefelung und Entwä serung<br />
6<br />
8<br />
7<br />
5<br />
8<br />
Wärme<br />
Strom<br />
8 Pumpleitungen für Gärsubstrate<br />
und Biogasleitungen<br />
9 Sicherheitstechnik: Drucksicherungen,<br />
Sicherheitsventile<br />
10 Blockheizkraftwerk für die gleichzeitige<br />
Strom und Wärmeproduktion<br />
11 gf. Aufbereitungstechnik für die<br />
Umwandlung von Biogas zu Biomethan<br />
12 Lagerbehälter für die ausgefaulten<br />
Gärprodukte ( gf. mit entsprechender<br />
Technik zur Weiterverarbeitung<br />
(Fest/Flü sigtrennung, Trocknung,<br />
Pelletierung etc.)<br />
11<br />
10<br />
Erdgasnetz<br />
Fast jede Pflanze kann in Biogasanlagen vergoren und zu Strom<br />
und Wärme umgewandelt werden – auch jene, die in der Lebensund<br />
Futtermittelproduktion keine Verwendung finden.<br />
Das bei der Energieerzeugung freigesetzte CO 2 entspricht in etwa<br />
der Menge, die die Pflanzen während Ihres Wachstums gebunden<br />
haben.<br />
Durchwachsene Silphie<br />
Franken-Therme Bad Windsheim<br />
Biogasanlage Bad Windsheim<br />
Regionale Biogasanlage<br />
Biogas trägt dazu bei, dass unsere Felder bunter und artenreicher<br />
werden. Blühende Pflanzen sehen nicht nur schön aus, sie bieten<br />
vor allem Lebensraum für Insekten und Wildtiere und verbessern<br />
die Bodengesundheit.<br />
Die Pflanzen benötigen in der Regel keine Pflanzenschutzmittel,<br />
schonen die Umwelt und schützen den Boden vor Auswaschung.<br />
Wildpflanzenmischung<br />
Wärmeabnehmer Freibad<br />
Die im Fermenter befindlichen Bakterien wandeln die Biomasse, z.B. biologische Abfälle,<br />
nachwachsende Rohstoffe und Gülle, zu Biogas und Gärprodukten um. Das erzeugte Biogas<br />
wird in der Gashaube aufgefangen und von hier über Gasleitungen zum Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) transportiert. Im BHKW wird aus dem Biogas Strom und Wärme erzeugt.<br />
Bei der Ausgestaltung von Biogasanlagen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme,<br />
Techniken und Funktionsweisen. Der übliche Aufbau umfasst folgende Komponenten:<br />
1<br />
2<br />
9<br />
3<br />
5 4<br />
3<br />
12<br />
8<br />
1 Lager für die zu vergärende Biomasse<br />
(Silo, Annahmestelle, Güllegrube)<br />
2 ggf. Aufbereitung, Sortierungs oder<br />
Reinigungssysteme für die zu vergärende<br />
Biomasse oder Reststoffe<br />
3 Einbring / Pumptechnik transportiert<br />
die Biomasse in die Fermenter bzw.<br />
aus diesen heraus<br />
4 Rührwerke vermischen die Bakterien<br />
im Fermenter mit der frischen Biomasse<br />
5 Heizung – die übliche Gärtemperatur<br />
liegt bei 40 °C<br />
6 Gasspeicher zur kurz und mittelfristigen<br />
Speicherung des Biogases<br />
7 Gasreinigungssysteme zur<br />
Entschwefelung und Entwässerung<br />
Die im Fermenter befindlichen Bakterien wandeln die Biomasse, z.B. biologische Abfälle,<br />
nachwachsende Rohstoffe und Gülle, zu Biogas und Gärprodukten um. Das erzeugte Biogas<br />
wird in der Gashaube aufgefangen und von hier über Gasleitungen zum Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) transportiert. Im BHKW wird aus dem Biogas Strom und Wärme erzeugt.<br />
Bei der Ausgestaltung von Biogasanlagen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme,<br />
Techniken und Funktionsweisen. Der übliche Aufbau umfasst folgende Komponenten:<br />
1<br />
2<br />
9<br />
3<br />
5 4<br />
3<br />
12<br />
8<br />
1 Lager für die zu vergärende Biomasse<br />
(Silo, Annahmestelle, Güllegrube)<br />
2 ggf. Aufbereitung, Sortierungs- oder<br />
Reinigungssysteme für die zu vergärende<br />
Biomasse oder Reststoffe<br />
3 Einbring- / Pumptechnik transportiert<br />
die Biomasse in die Fermenter bzw.<br />
aus diesen heraus<br />
4 Rührwerke vermischen die Bakterien<br />
im Fermenter mit der frischen Biomasse<br />
5 Heizung – die übliche Gärtemperatur<br />
liegt bei 40 °C<br />
6 Gasspeicher zur kurz- und mittelfristigen<br />
Speicherung des Biogases<br />
7 Gasreinigungssysteme zur<br />
Entschwefelung und Entwässerung<br />
Die im Fermenter befindlichen Bakterien wandeln die Biomasse, z.B. biologische Abfälle,<br />
nachwachsende Rohstoffe und Gülle, zu Biogas und Gärprodukten um. Das erzeugte Biogas<br />
wird in der Gashaube aufgefangen und von hier über Gasleitungen zum Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) transportiert. Im BHKW wird aus dem Biogas Strom und Wärme erzeugt.<br />
Bei der Ausgestaltung von Biogasanlagen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme,<br />
Techniken und Funktionsweisen. Der übliche Aufbau umfasst folgende Komponenten:<br />
1<br />
2<br />
9<br />
3<br />
5 4<br />
3<br />
12<br />
8<br />
1 Lager für die zu vergärende Biomasse<br />
(Silo, Annahmestelle, Güllegrube)<br />
2 ggf. Aufbereitung, Sortierungs oder<br />
Reinigungssysteme für die zu vergärende<br />
Biomasse oder Reststoffe<br />
3 Einbring / Pumptechnik transportiert<br />
die Biomasse in die Fermenter bzw.<br />
aus diesen heraus<br />
4 Rührwerke vermischen die Bakterien<br />
im Fermenter mit der frischen Biomasse<br />
5 Heizung – die übliche Gärtemperatur<br />
liegt bei 40 °C<br />
6 Gasspeicher zur kurz und mittelfristigen<br />
Speicherung des Biogases<br />
7 Gasreinigungssysteme zur<br />
Entschwefelung und Entwässerung<br />
6<br />
6<br />
8 Pumpleitungen für Gärsubstrate<br />
und Biogasleitungen<br />
9 Sicherheitstechnik: Drucksicherungen,<br />
Sicherheitsventile<br />
10 Blockheizkraftwerk für die gleichzeitige<br />
Strom und Wärmeproduktion<br />
11 ggf. Aufbereitungstechnik für die<br />
Umwandlung von Biogas zu Biomethan<br />
12 Lagerbehälter für die ausgefaulten<br />
Gärprodukte (ggf. mit entsprechender<br />
Technik zur Weiterverarbeitung<br />
(Fest/Flüssigtrennung, Trocknung,<br />
Pelletierung etc.)<br />
8<br />
7<br />
5<br />
8<br />
Wärme<br />
8 Pumpleitungen für Gärsubstrate<br />
und Biogasleitungen<br />
9 Sicherheitstechnik: Drucksicherungen,<br />
Sicherheitsventile<br />
10 Blockheizkraftwerk für die gleichzeitige<br />
Strom- und Wärmeproduktion<br />
11 ggf. Aufbereitungstechnik für die<br />
Umwandlung von Biogas zu Biomethan<br />
12 Lagerbehälter für die ausgefaulten<br />
Gärprodukte (ggf. mit entsprechender<br />
Technik zur Weiterverarbeitung<br />
(Fest-/Flüssigtrennung, Trocknung,<br />
Pelletierung etc.)<br />
FV Anlagenschild A0 quer.indd 1 11.02.16 16:10<br />
6<br />
8<br />
7<br />
5<br />
8<br />
Wärme<br />
8<br />
7<br />
5<br />
8<br />
Wärme<br />
11<br />
Strom<br />
11<br />
11<br />
Erdgasnetz<br />
10<br />
Strom<br />
Strom<br />
Erdgasnetz<br />
8 Pumpleitungen für Gärsubstrate<br />
und Biogasleitungen<br />
9 Sicherheitstechnik: Drucksicherungen,<br />
Sicherheitsventile<br />
10 Blockheizkraftwerk für die gleichzeitige<br />
Strom und Wärmeproduktion<br />
11 ggf. Aufbereitungstechnik für die<br />
Umwandlung von Biogas zu Biomethan<br />
12 Lagerbehälter für die ausgefaulten<br />
Gärprodukte (ggf. mit entsprechender<br />
Technik zur Weiterverarbeitung<br />
(Fest/Flüssigtrennung, Trocknung,<br />
Pelletierung etc.)<br />
10<br />
10<br />
Erdgasnetz<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Materialien für Ihre Öffentlichkeitsarbeit<br />
Variable Schilder<br />
zu einem von Ihnen gewählten Thema<br />
mit unterschiedlichem Layout und<br />
unterschiedlicher Farbgebung inkl.<br />
einer Bescheinigung der Treibhausgaseinsparung<br />
Ihrer Anlage.<br />
DIN A0-Format<br />
Bestellnr.: FA-007<br />
Bitte kontaktieren Sie uns!<br />
100 Euro<br />
(zzgl. Versandkosten*)<br />
Diese Biogasanlage erzeugt Strom<br />
wenn er gebraucht wird<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
Biogas ist flexibel!<br />
Diese Biogasanlage<br />
schützt unser Klima<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
Klimaschutz .<br />
Die Erderhitzung ist die größte Bedrohung für den Fortbestand unseres<br />
Wir müssen unser Klima schützen und den Ausstoß von CO 2<br />
drastisch reduzieren. Jetzt.<br />
Mit den Erneuerbaren Energien haben wir die Chance, dies zu schaffen.<br />
Biogasanlagen leisten einen wichtigen Beitrag auf unserem Weg in eine<br />
klimafreundliche Zukunft.<br />
.durch Biogas<br />
Die Biogasanlage Biogas GmbH erzeugt im Jahr 300.000 Kilowattstunden<br />
Strom. Das entspricht dem Verbrauch von 100 durchschnittlichen<br />
Haushalten.<br />
Die bei der Stromerzeugung anfa lende Wärme wird im Sta l und im<br />
Wohnhaus eingesetzt und außerdem zur Holztrocknung genutzt. In der<br />
Summe spart diese Biogasanlage 450 Tonnen CO 2 ein, die beim Einsatz<br />
fossiler Energieträger wie Kohle und Öl freigesetzt worden wären.<br />
Das entspricht 380 Flügen von München nach New York und zurück.<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter. www.biogas.org<br />
So funktioniert eine Biogasanlage<br />
So funktioniert eine Biogasanlage<br />
Die im Fermenter befindlichen Bakterien wandeln die Bioma se, z.B. biologische Abfä le,<br />
nachwachsende Rohsto fe und Gü le, zu Biogas und Gärprodukten um. Das erzeugte Biogas<br />
wird in der Gashaube aufgefangen und von hier über Gasleitungen zum Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) transportiert. Im BHKW wird aus dem Biogas Strom und Wärme erzeugt.<br />
Bei der Ausgestaltung von Biogasanlagen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme,<br />
Techniken und Funktionsweisen. Der übliche Aufbau umfa st folgende Komponenten:<br />
Feldschilder<br />
Alternative Energiepflanzen<br />
DIN A0-Format<br />
Bestellnr.: FA-003<br />
50 Euro (zzgl. Versandkosten*)<br />
Dieses Feld liefert Energie<br />
und schützt das Klima<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
Energie pflanzen ...<br />
Energiepflanzen<br />
... Vielfalt ernten<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.<br />
www.farbe-ins-feld.de<br />
Maisfeld<br />
DIN A0-Format<br />
Bestellnr. FA-002<br />
50 Euro (zzgl. Versandkosten*)<br />
So funktioniert eine Biogasanlage<br />
www.biogas.org<br />
Shop<br />
Shop<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.<br />
Diese Biogasanlage schafft<br />
regionale Wertschöpfung<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
Energie für die Region…<br />
www.biogas.org<br />
Seit dem Jahr 2009 erzeugt die Biogasanlage Biogas GmbH Strom für 700<br />
Haushalte und versorgt außerdem 26 Privathaushalte, die Schule, das<br />
Altenheim und das Rathaus mit umweltfreundlicher Wärme. Die Substrate<br />
für die Energieerzeugung bezieht die Biogasanlage vo lständig von<br />
Landwirten aus der Umgebung. Das nach der Vergärung entstehende<br />
Gärprodukt geht als hochwertiger Dünger zurück auf die Felder.<br />
Die Kilowa tstunde Biogaswärme kostet die Haushalte im Schnitt zwei Cent weniger<br />
als die Wärme aus Heizöl.<br />
Durch das bei den Heizkosten gesparte Geld konnte Neustadt neue Sportgeräte für<br />
die Schule kaufen und den Gemeinschaftsraum im Altenheim renovieren.<br />
Der Bau der Anlagenteile, die Wartung und Erweiterung der Biogasanlage generiert<br />
weitere Jobs bei Handwerksbetrieben in der Umgebung.<br />
Vom Anbau vielfältiger Energiepflanzen profitieren die Bienen und mit ihnen die<br />
Imker in der Region.<br />
So funktioniert eine Biogasanlage<br />
Die im Fermenter befindlichen Bakterien wandeln die Bioma se, z.B. biologische Abfä le,<br />
nachwachsende Rohsto fe und Gü le, zu Biogas und Gärprodukten um. Das erzeugte Biogas<br />
wird in der Gashaube aufgefangen und von hier über Gasleitungen zum Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) transportiert. Im BHKW wird aus dem Biogas Strom und Wärme erzeugt.<br />
Bei der Ausgestaltung von Biogasanlagen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme,<br />
Techniken und Funktionsweisen. Der übliche Aufbau umfa st folgende Komponenten:<br />
8 Pumpleitungen für Gärsubstrate<br />
und Biogasleitungen<br />
9 Sicherheitstechnik: Drucksicherungen,<br />
Sicherheitsventile<br />
10 Blockheizkraftwerk für die gleichzeitige<br />
Strom und Wärmeproduktion<br />
11 gf. Aufbereitungstechnik für die<br />
Umwandlung von Biogas zu Bio<br />
Anlagenschild (individuell)<br />
Informieren Sie Wanderer und Gäste über Ihre Biogasanlage<br />
DIN A0-Format<br />
Bestellnr.: FA-001<br />
50 Euro (zzgl. Versandkosten*)<br />
Schild<br />
„So funktioniert eine Biogasanlage“<br />
Zeigen Sie Wanderern und Gästen die Funktionsweise<br />
einer Biogasanlage<br />
DIN A0-Format<br />
Bestellnr.: FA-008<br />
50 Euro<br />
(zzgl. Versandkosten*)<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter. www.biogas.org<br />
Franken-Therme Bad Winsheim<br />
Biogas Wärme<br />
Die Franken-Therme ist an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Bad<br />
Windsheim angeschlossen. 30 Prozent des Wärmeangebotes der Stadtwerke<br />
werden von der Biogasanlage der Bio-Energie Bad Windsheim<br />
erzeugt.<br />
Als Kunde der Stadtwerke profitiert die Franken-Therme direkt von der<br />
umwelt- und klimafreundlichen Wärmegewinnung aus Biogas. So<br />
werden die Thermal-Badelandschaft, das Dampferlebnisbad und die<br />
Sauna zu rund einem Drittel mit Biogaswärme beheizt.<br />
Vorteile<br />
– Die Biogaswärme wird in einer Biogasanlage in Bad Windsheim erzeugt:<br />
Dies stärkt die Unabhängigkeit von fossilen Energieimporten und fördert<br />
die Wirtschaftskraft in der Region.<br />
– Durch die umweltfreundliche Biogaswärme werden pro Jahr rund<br />
300.000 Liter Heizöl eingespart und damit knapp 800 Tonnen<br />
Kohlendioxid (CO 2 ) weniger ausgestoßen.<br />
– Neben der Wärme erzeugt die Biogasanlage der Bio-Energie<br />
Bad Windsheim jährlich Strom für mehr als 1.200 Haushalte.<br />
Diese Biogasanlage erzeugt<br />
Strom und Wärme<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
Biogasanlage Bad Windsheim<br />
Die Fakten …<br />
Leistung der Anlage<br />
400 kW el<br />
Mit Strom versorgte Haushalte 800<br />
Wärmebereitstellung<br />
Schwimmbad und Wärmenetz<br />
Eingesetzte Substrate Gülle, Mist,<br />
Landschaftspflegematerial,<br />
Maissilage, Grassilage<br />
Besonderheit an der Anlage<br />
Gärpoduktaufbereitung (Herstellung eines hochwertigen Düngers)<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.<br />
Logo<br />
… sprechen für sich!<br />
Die deutschen Biogasanlagen erzeugen schon heute<br />
Strom für Millionen Haushalte<br />
Biogasanlagen reduzieren den CO 2 -Ausstoß<br />
und produzieren nahezu klimaneutral Strom und Wärme<br />
Biogas-Strom stabilisiert das Stromnetz<br />
und sichert eine gleichmäßige Versorgung<br />
Biogasanlagen<br />
sichern vielen Landwirten die Existenz<br />
In Biogasanlagen vergorene Gülle stinkt nicht und ist<br />
ein hervorragender Dünger<br />
Biogasanlagen bringen<br />
Arbeitsplätze und Wertschöpfung<br />
in die ländliche Region<br />
So funktioniert eine Biogasanlage<br />
www.biogas.org<br />
So funktioniert eine Biogasanlage<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
1<br />
11<br />
2<br />
6<br />
8<br />
9<br />
7<br />
3<br />
Erdgasnetz<br />
5 4<br />
5<br />
10<br />
8<br />
3<br />
12<br />
8<br />
Strom<br />
Bei der Ausgestaltung von Biogasanlagen<br />
gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher<br />
Systeme, Techniken und<br />
Funktionsweisen. Der übliche Aufbau<br />
umfasst folgende Komponenten:<br />
Wärme<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern: Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.<br />
www.biogas.org<br />
Wärmeschild groß<br />
(allgemein)<br />
mit allgemeinen Informationen<br />
zum Einsatz von Biogaswärme<br />
DIN A0-Format<br />
Bestellnr.: FA-006<br />
50 Euro (zzgl. Versandkosten*)<br />
BIOGAS Wärme<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
(individuell)<br />
mit Ihren individuellen Angaben<br />
zum Wärmenutzungskonzept<br />
DIN A0-Format<br />
Bestellnr.: FA-005<br />
75 Euro (zzgl. Versandkosten*)<br />
So funktioniert eine Biogasanlage<br />
Wärmeschild klein<br />
(für Privathaushalte)<br />
DIN A5-Format, Blech<br />
Bestellnr.: KL-004<br />
Wir heizen mit<br />
BIOGAS<br />
Wärme<br />
Umweltfreundliche Wärme – vom Land, für’s Land<br />
Biogas Wärme …<br />
… aus der Region<br />
In Deutschland gibt es viele tausend Biogasanlagen, die umweltfreundliches<br />
Biogas erzeugen. Dieser Energieträger wird mittels eines Motors Unabhängigkeit von fossilen Energieimporten und fördert die Wirtschaftskraft in<br />
Biogaswärme wird in einer nahe gelegenen Biogasanlage erzeugt. Dies stärkt die<br />
im Blockheizkraftwerk in Strom umgewandelt. Die dabei frei werdende der Region.<br />
Wärme sichert die lokale Versorgung und dient als Heizenergie in:<br />
Viele Dörfer und Kommunen setzen auf Biogas, um eine autarke Energieversorgung<br />
• öffentlichen Einrichtungen, z.B. Schwimmbädern, Schulen, Turnhallen vor Ort anzubieten.<br />
• Wohngebieten und Bioenergie-Dörfern<br />
Mit Biogaswärme können die jährlichen Kosten für Wärmeenergie deutlich gesenkt<br />
• Ställen und Gewächshäusern<br />
und langfristig stabil gehalten werden.<br />
• Unternehmen, z.B. Gärtnereien, Gastronomie, Industrie<br />
Durch die umweltfreundliche Biogaswärme wird Heizöl bzw. Erdgas eingespart und<br />
damit weniger Kohlendioxid (CO 2 ) ausgestoßen.<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.<br />
www.biogas.org<br />
bis zu 35 Stck. kostenlos für Mitglieder<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
*Versandkosten für Schilder 22,90 Euro<br />
Bestellungen bitte per E-Mail an info@biogas.org<br />
53<br />
www.biogas.org
praxis<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Die Energielandwerker – starker<br />
Partner der Anlagenbetreiber<br />
Eine noch junge Genossenschaft im nördlichen Münsterland bringt<br />
Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen zusammen und kreiert<br />
damit Synergieeffekte, von denen alle Mitglieder profitieren.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Dass über den 110 Meter hohen<br />
Buchenberg, der östlich von<br />
Steinfurt (NRW) liegt, ein kräftiger<br />
Wind weht, davon zeugt die<br />
160 Jahre alte Kappenwindmühle<br />
am nördlichen Rand der geologischen<br />
Erhebung. Schon damals nutzten die<br />
Menschen die Kraft des Windes für sich – in<br />
diesem Fall zum Kornmahlen. Heute befindet<br />
sich das historische Schätzchen mit<br />
den vier Windfängern in guter Gesellschaft,<br />
denn in der nahen nördlich gelegenen Tiefebene<br />
drehen sich rund 50 moderne Dreiflügler<br />
im Wind und produzieren daraus<br />
umweltfreundlichen Strom. Allein 27 der<br />
Windenergieanlagen gehören zur Windpark<br />
Hollich Gruppe.<br />
Die Menschen in der Bauerschaft Hollich<br />
der Stadt Steinfurt sind insgesamt sehr<br />
aktiv in Sachen Energiewende. Zahlreiche<br />
Photovoltaikanlagen sind auf Dachflächen<br />
installiert und auch vier Biogasanlagen produzieren<br />
erneuerbares Gas. Auf der ehemaligen<br />
Hofstelle des Landwirtschaftsbetriebes<br />
Nefigmann haben sich im ehemaligen<br />
Stallgebäude einige Firmen niedergelassen.<br />
So auch die „Die Energielandwerker eG“.<br />
Betreiberschaft stärken<br />
„Wir haben die Genossenschaft im Sommer<br />
2017 gegründet. Sie hat das Ziel, kleine<br />
und mittelständische Betreiber nachhaltig<br />
und im Konsens gemeinsam zu unterstützen<br />
und weiterzuentwickeln. Aus der<br />
Energiewirtschaft und Politik kommen<br />
zunehmend höhere Anforderungen und<br />
mehr Möglichkeiten auf die Betreiber zu.<br />
Diese gilt es zu erfüllen und zu nutzen. Das<br />
kann für den Einzelnen sehr aufwendig und<br />
anstrengend sein“, hebt Thomas Voß, Geschäftsführer<br />
der Genossenschaft, hervor.<br />
Heute hat die Genossenschaft 40 Mitglieder,<br />
alles reine Anlagenbetreiber. Es handelt<br />
sich um eine sogenannte Unternehmergenossenschaft.<br />
Seit 2012 kooperieren<br />
die Energieerzeuger schon. 60 Betreiber<br />
mit 360 Megawatt installierter elektrischer<br />
Leistung sind aktuell in der Strom-<br />
Direktvermarktung. 90 Prozent Anteil hat<br />
der Windstrom, 20 Megawatt kommen<br />
durch Biogasanlagen zusammen, der Rest<br />
ist Solarstrom. Haupteinzugsgebiet sind<br />
die Kreise Steinfurt, Borken und Coesfeld.<br />
Es können aber auch Erzeugungsanlagen<br />
bundesweit eingebunden werden. Die Genossenschaft<br />
selbst als Rechtsform betreibt<br />
keine Erzeugungsanlagen.<br />
So unterstützt die Genossenschaft ihre<br />
Mitglieder beispielsweise in der Thematik<br />
Strom-Direktvermarktung. Es wird für alle<br />
Genossenschaftsmitglieder eine Ausschreibung<br />
der Strommenge vorgenommen. Auf<br />
der jährlichen Generalversammlung wird<br />
dann der Direktvermarktungspartner für<br />
die nächsten zwölf Monate ausgewählt.<br />
Die Vermarktung der Strommenge an der<br />
Börse macht die Genossenschaft somit<br />
nicht selbst. Zusätzlich zum Börsenstrompreis<br />
erhalten die Windstromerzeuger im<br />
sogenannten Marktprämienmodell die Managementprämie.<br />
Die Stromvermarktung<br />
geschieht unter Berücksichtigung von Wetterdaten.<br />
Unterstützung in<br />
Abrechnungsfragen<br />
Die Energielandwerker bringen zwar die<br />
Strommenge der Genossenschaft an den<br />
Markt, sehen sich aber nicht ausschließlich<br />
als Bündler für den Vertrieb von Direktvermarktungs-Dienstleistung.<br />
Darüber hinaus<br />
bietet die Genossenschaft Hilfestellung in<br />
Abrechnungsfragen, prüft Abrechnungen<br />
der Netzbetreiber für die Stromerzeuger<br />
und liefert Reports in nachvollziehbaren<br />
Darstellungsformen. Außerdem organisieren<br />
Die Energielandwerker den Stromeinkauf<br />
für die Anlagen der Mitglieder – im<br />
Thomas Voß, Geschäftsführer von<br />
Die Energielandwerker eG.<br />
Einzelfall auch für deren Landwirtschaftsbetriebe.<br />
Ein immer wichtiger werdendes Thema ist<br />
laut Voß der Weiterbetrieb der Ökostromanlagen<br />
nach dem Ende der EEG-Laufzeit.<br />
Daher soll die Direktvermarktung nicht der<br />
alleinige Schwerpunkt sein. 2021 würden<br />
die ersten Anlagen aus dem EEG laufen.<br />
Kritisch werde es ab 2022/2023, wenn für<br />
eine größere Anlagenzahl der Vergütungszeitraum<br />
endet. Für diese Anlagen gelte es,<br />
Zukunftsoptionen zu entwickeln. Erfreulich<br />
ist, dass in den letzten Jahren im Kreis<br />
Steinfurt neue Windenergieanlagen aufgestellt<br />
werden konnten. „Aufgrund der guten<br />
Vorplanung konnten alle Projekte realisiert<br />
werden“, betont Voß.<br />
Für ihn ist klar, dass zur Fortführung der<br />
Energiewende über den Bereich der Stromerzeugung<br />
hinausgedacht werden muss.<br />
Es müsse darüber nachgedacht werden,<br />
wie die Sektoren Wärme und Mobilität eingebunden<br />
werden können. Strom werde<br />
nicht nur für die Elektromobilität benötigt,<br />
sondern auch für die Bereitstellung von<br />
grünem Wasserstoff. Im Bereich der Wärmeerzeugung<br />
könnten nach seinen Worten<br />
Wärmepumpen eine Zukunftsoption sein.<br />
Der Strommarkt benötige Eingriffe, um den<br />
Technologien, die für die Energiewende notwendig<br />
seien, eine bessere Marktstellung zu<br />
bieten.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
0 54 09/90 69 426<br />
martin.bensmann@biogas.org<br />
Foto: Martin Bensmann<br />
54
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
praxis<br />
Anlagenbau<br />
Passende Rührtechnik für jedes Substrat<br />
– Alle Rührwerkstypen<br />
– Über 25 Jahre Erfahrung<br />
– Optimierung, Nachrüstung, Tausch<br />
Tel. +49.7522.707.965.0 www.streisal.de<br />
Sie möchten nicht länger Energie<br />
und Zeit verschwenden...<br />
Höchste Zeit für<br />
etwas Neues: Huning<br />
Feststoffdosierer<br />
Gas Technologie von APROVIS<br />
APROVIS. Better Performance.<br />
FriCon – Gaskühlsysteme<br />
ActiCo – Aktivkohlefilter<br />
Gaswärmeübertrager<br />
Verdichter<br />
Wartung & Service<br />
91746 Weidenbach-Triesdorf · Tel.: +49 9826 6583 - 0 · info@aprovis.com<br />
www.aprovis.com<br />
AGROTEL GmbH • 94152 NEUHAUS/INN • Hartham 9<br />
Tel.: + 49 (0) 8503 / 914 99- 0 • Fax: -33 • info@agrotel.eu<br />
55<br />
Ein UnTERnEHMEn<br />
DER HUninG GRUPPE<br />
HUNING Anlagenbau GmbH & Co. KG<br />
Wellingholzhausener Str. 6, D-49324 Melle<br />
Tel. +49 (0) 54 22/6 08-2 60<br />
Fax +49 (0) 54 22/6 08-2 63<br />
info@huning-anlagenbau.de<br />
www.huning-anlagenbau.de
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Die thermische Vorbehandlung (Desintegration)<br />
von Stroh – einweichen oder „kochen“?<br />
Zur Desintegration von Rohstoffen werden die unterschiedlichsten Maschinen/Verfahren<br />
angeboten. Egal, ob mit rotierenden Ketten, Zahnscheiben, Ultraschall usw. auf das Material<br />
eingewirkt wird, alle verfolgen das gleiche Ziel: die Vergrößerung der Oberfläche zur<br />
Steigerung der Rohstoffausbeute. Leistet die thermische Desintegration Vergleichbares?<br />
Von Dipl. Des. (FH) Rainer Casaretto und M. Eng. (FH) René Casaretto<br />
Dieser Artikel soll eine weitere Möglichkeit<br />
der Verwendung von Stroh darstellen – die<br />
Methode des „Light Cooking“. Hierbei<br />
soll unter geringem energetischen und<br />
technischen Aufwand ein möglichst hoher<br />
Gasertrag aus dem Rohstoff erzielt werden. Diese<br />
Herangehensweise ist entstanden durch die steigende<br />
Technisierung der Vorbehandlungsanlagen und die damit<br />
verbundene Komplexität. Der Wartungsaufwand<br />
bei dieser Methode ist gering, was insbesondere dort,<br />
wo die Biogas-Anlage „nur“ ein weiteres Standbein<br />
darstellt neben dem eigentlichen Brot- und-Butter-<br />
Geschäft – der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung<br />
von Flächen und/oder der Viehzucht und Nahrungsmittelproduktion<br />
–, von Bedeutung ist. Von daher erschien<br />
die Methode des „Light Cooking“ als zu präferierende<br />
Lösung, da sie viele Vorteile wie einfacher, modularer<br />
Aufbau und geringe Komplexität vereint.<br />
Kapitel I<br />
Thermische Vorbehandlung bei 99 °C<br />
2017 wurde an der Aalborg Universität eine Masterarbeit<br />
von Anwi Josephine Mundi und Markéta Kaderavkova<br />
eingereicht, die sich mit der thermischen Vorbehandlung<br />
von Stroh beschäftigt. Im Rahmen dieser Arbeit<br />
ergaben sich für das mit 99 Grad Celsius (°C) vorbehandelte<br />
Weizenstroh und einer anschließenden Vergärung<br />
bei 40 °C die folgenden Werte in Tabelle 1.<br />
Bezieht man den Mittelwert der Qualitätsmerkmale aus<br />
Tabelle 2 auf den Mittelwert des Gasertrages, so errechnen<br />
sich (278,35·0,8292·9,968 1 ) = 2.300 Kilowattstunden<br />
(kWh) je Tonne Gärmasse Stroh.<br />
Demnach ergibt die thermische Vorbehandlung durchaus<br />
Sinn, denn mit einer Tonne so vorbehandeltem<br />
Stroh können (ausgehend von den Faustzahlen Biogas,<br />
KTBL, 3. Ausgabe 2013) mit 340·0,35·0,95·9,968 =<br />
1.126,88 kWh 2,04 Tonnen Maissilage ersetzt werden.<br />
Um aber die 99 °C zu erreichen, werden ebenfalls eine<br />
(oft nicht vorhandene) erhebliche Menge an thermischer<br />
Energie und Investitionen in eine entsprechende<br />
Technik benötigt.<br />
Tabelle 2: Qualitätsmerkmale<br />
TR oTR oTR/TR<br />
a 93,39 % 90,40 % 84,42 %<br />
b 93,96 % 90,83 % 85,34 %<br />
c 94,16 % 91,04 % 85,73 %<br />
d 92,00 % 89,03 % 81,90 %<br />
e 91,87 % 88,69 % 81,48 %<br />
f 92,13 % 89,03 % 82,02 %<br />
g 91,88 % 88,44 % 81,26 %<br />
h 91,99 % 89,02 % 81,89 %<br />
i 92,44 % 89,03 % 82,30 %<br />
Mittelwerte 92,65 % 89,50 % 82,92 %<br />
Tabelle 3: Parameter d. Vorbehandlung u. Vergärung<br />
Strohlänge<br />
20-40mm<br />
Tabelle 1: Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) -1 , 2 Durchläufe mit je 3 Gärtests<br />
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3<br />
260,50 276,50 282,50 279,70 287,10 283,80<br />
Mittelwert: 278,35 Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) -1<br />
Stroh mit Wasser aufheizen bis 99 °C<br />
Haltezeit bei 99 °C<br />
60 Minuten<br />
Abkühlung auf 40 °C<br />
Zugabe zu dem Inokulum bei 40 °C<br />
Gärtestabbruch bei<br />
29 Tagen<br />
Foto: Fotolia_ rdnzl<br />
56
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Wissenschaft<br />
Abbildung 1: Stroh inklusive Lignin vs. reine Cellulose<br />
Abbildung 2: Alle 6 Strohproben im Gärtest<br />
325<br />
300<br />
Stroh<br />
Cellulose<br />
325<br />
300<br />
1.1<br />
1.2<br />
1.3<br />
2.1<br />
2.2<br />
2.3<br />
275<br />
275<br />
250<br />
250<br />
Nm3(CH4)t(oTR)1<br />
225<br />
200<br />
175<br />
150<br />
Nm3(CH4)t(oTR)1<br />
225<br />
200<br />
175<br />
150<br />
125<br />
125<br />
100<br />
100<br />
75<br />
75<br />
50<br />
50<br />
25<br />
25<br />
0<br />
1 2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29<br />
Tage<br />
0<br />
1 2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29<br />
Tage<br />
Laborteil<br />
Die in Kapitel II vorgestellten Ergebnisse wurden an<br />
der Aalborg University Esbjerg und die in Kapitel III an<br />
der Hochschule Flensburg – Dept. of Chemical Technologies<br />
– erhoben. Für die Basisparameterbestimmung<br />
wurden die Normen DIN 38414-2 / -3 verwendet. Eine<br />
Säurekorrektur für die Trockensubstanzbestimmung<br />
wurde nicht durchgeführt. Die Gärtests erfolgten in Anlehnung<br />
an die VDI 4630-2016. Hierbei wurde für die<br />
Ergebnisse aus Dänemark das AMPTS-2 System der<br />
Firma Bioprocess Control verwendet mit einer NaOH-<br />
Lösung zur Elimination des Kohlenstoffdioxides, die<br />
Prozesstemperatur wurde auf 40 °C gesetzt. Das Stroh<br />
wurde so vorbehandelt, wie die zugeordneten Tabellen<br />
jeweils ausweisen. Hierfür wurde der Rohstoff den Gärflaschen<br />
zugegeben, rund 100 Gramm Wasser hinzugefügt<br />
und im geschlossenen Gefäß bei den in den jeweiligen<br />
Tabellen genannten Temperaturen und Zeiten<br />
vorbehandelt.<br />
Abbildung 2 zeigt die 6 Verläufe aus den Gärtests, deren<br />
Werte in Tabelle 1 zu sehen sind. Der Versuch 1.3<br />
weist vom 19. bis zum 26. Tag eine „Schwächephase“<br />
gegenüber 2.2 auf.<br />
57
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Kapitel II<br />
Vorbehandlungen bei der Ernte und bei 80 °C<br />
Weitere Untersuchungen bezogen sich auf aufgefasertes<br />
und geschnittenes (PreChop), geschnittenes<br />
(Cut) und gemahlenes (Mühle) Weizenstroh sowie auf<br />
Strohpellets und zerbröckelte Strohpellets mit einer<br />
Vorbehandlungstemperatur von jeweils 80 °C und einer<br />
Haltedauer von 60 Minuten.<br />
Die Pellets stammen von der Firma Krone, die uns sowohl<br />
eine Probe der Pellets zur Verfügung stellte, die<br />
mit dem Premos 5000 erzeugt wurde, als auch eine<br />
Probe des unbehandelten Original-Strohs.<br />
Fotos: Maschinenfabrik Bernard KRONE<br />
Aufgefasert und geschnitten wurde das Stroh von dem<br />
Lohnunternehmen mit einem Krone-PreChop.<br />
Geschnitten wurde das Stroh von dem Lohnunternehmen<br />
mit dem Krone-Multi-Cut.<br />
Gemahlen wurde<br />
das Stroh von dem<br />
Lohnunternehmen<br />
mit einer Haybuster-<br />
Strohmühle. Hier im<br />
Bild ist ein anderes<br />
Fabrikat zu sehen.<br />
Foto: Landpixel.de<br />
Tabelle 4: Qualitätsmerkmale des Weizenstrohs Tabelle 5: Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) -1<br />
TR oTR oTR/TR<br />
PreChop 95,18 % 96,84 % 92,17 %<br />
Cut 94,17 % 94,53 % 89,02 %<br />
Mühle 94,55 % 95,39 % 90,19 %<br />
zerbröckelte Pellets 93,79 % 93,24 % 87,45 %<br />
Pellets 93,63 % 93,25 % 87,31 %<br />
PreChop Cut Mühle zerbröckelte Pellets Pellets<br />
231,35 170,30 180,13 248,31 250,95<br />
58
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Wissenschaft<br />
Nm3(CH4)t(oTR)1<br />
Tabelle 6: Parameter d. Vorbehandlung u. Vergärung<br />
Abbildung 3: Ernte-/Strohvarianten bei 80 °C<br />
325<br />
300<br />
275<br />
250<br />
225<br />
200<br />
175<br />
150<br />
125<br />
100<br />
Strohlänge<br />
75<br />
50<br />
25<br />
0<br />
PreChop<br />
Cut<br />
Mühle<br />
Wendet man die Qualitätsmerkmale aus<br />
Tabelle 4 auf die Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) -1 an, so<br />
errechnet sich pro Tonne Gärmasse Stroh<br />
eine Energie von:<br />
Tabelle 7: Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) -1<br />
20-40mm<br />
Stroh mit Wasser aufheizen bis 80 °C<br />
Haltezeit bei 80 °C<br />
60 Minuten<br />
Abkühlung auf 40 °C<br />
Zugabe zu dem Inokulum bei 40 °C<br />
Gärtestabbruch bei<br />
28 Tagen<br />
Pellets zerbr.<br />
Pellets<br />
PreChop Cut Mühle zerbröckelte Pellets Pellets<br />
2.126 1.511 1.619 2.164 2.184<br />
Die Energie aus pelletiertem Stroh liegt im<br />
Gärtest über den anderen, was nicht verwundert,<br />
da beim Pelletieren selbst schon<br />
einmal eine thermische Vorbehandlung mit<br />
Temperaturen zwischen 70 bis 99 °C bei<br />
bis zu 2.000 bar Druck 2 erfolgte. Unter<br />
Kostengesichtspunkten ist die aufgefaserte<br />
(PreChop) Variante mit 2.126 kWh je Tonne<br />
Gärmasse Stroh zu bevorzugen.<br />
59<br />
Qualität setzt sich durch – seit 1887<br />
Tradition und Qualität sind die Grundsätze der Franz<br />
Eisele u. Söhne GmbH & Co. KG. Wir sind bekannt als<br />
Hersteller verschiedener Pumpen und Rührwerke für die<br />
Landwirtschaft, die Industrie sowie für den Biogassektor.<br />
Derzeit beschäftigen wir rund 100 Mitarbeiter am<br />
Firmenstandort Laiz. Unsere Produkte „Made in<br />
Germany“ werden weltweit vertrieben, dabei greifen<br />
wir auf die Erfahrungen unserer über 130-jährigen<br />
Firmengeschichte zurück.<br />
Um unseren Erfolgskurs konsequent weiter zu verfolgen,<br />
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen fachlich<br />
wie persönlich überzeugenden<br />
Vertriebsmitarbeiter (m/w/d)<br />
Ihre Aufgaben<br />
• Qualifizierte, technische Beratung von Kunden<br />
• Neukundenakquise<br />
• Erstellung von Angeboten und Auftragsbestätigungen<br />
• Präsentation unserer Produkte auf Messen im In- und<br />
Ausland<br />
• Produktvorführungen auf den Betrieben<br />
Ihr Profil<br />
• Abgeschlossene technische Ausbildung, evtl. Studium<br />
in der Agrartechnik oder einen vergleichbaren Beruf<br />
• Mehrjährige Berufserfahrung im Vertrieb<br />
• Kundenorientiertes, unternehmerisches Denken<br />
und Handeln<br />
• Hohe Sozialkompetenz, Diskretion und Zuverlässigkeit<br />
• Sehr gute Kenntnisse in der englischen Sprache,<br />
Französisch von Vorteil<br />
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse<br />
• Sehr gute organisatorische Fähigkeiten<br />
Unsere Leistungen:<br />
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag<br />
• Vielfältiges Aufgabenspektrum mit einem hohen<br />
Maß an Eigenverantwortung<br />
• Leistungsgerechte Vergütung<br />
Ihre Bewerbung:<br />
Senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Unterlagen mit<br />
Angabe zu Ihrer Gehaltsvorstellung und möglichem<br />
Einstiegstermin zu.<br />
Bewerbungen per E-Mail bitte nur im pdf-Format senden.<br />
Franz Eisele u. Söhne GmbH & Co. KG<br />
Personalabteilung<br />
Hauptstr. 2 – 4<br />
72488 Sigmaringen<br />
bewerbung@eisele.de
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Kapitel III<br />
Vorbehandlungen mit verschiedenen<br />
Temperaturen<br />
Im Rahmen des LSBL II Projektes wurden (und werden<br />
noch) weitere Untersuchungen durchgeführt, wobei<br />
die Temperaturen und Vorbehandlungszeiten variiert<br />
wurden. Das Stroh wurde mit der Quaderballenpresse<br />
gepresst und weder vorher zerfasert noch gemahlen. Es<br />
wurde auf die Länge von 20-40mm mit dem Multi-Cut<br />
gekürzt. Die Ergebnisse sind im ersten Augenblick unerwartet<br />
und bedürfen sicher noch weiterer Untersuchungen.<br />
Den höchsten Wert ergeben 25°C bei einer Haltezeit<br />
von 60 Minuten (bei einer Haltezeit von 30 Minuten,<br />
die leider nicht ermittelt wurde, läge der Wert eventuell<br />
sogar höher). Eine mögliche Erklärung könnte in dem<br />
Erhalt flüchtiger Säuren liegen, die bei höheren Temperaturen<br />
und längeren Vorbehandlungszeiten verlorengehen<br />
können. Weiterhin spricht für eine kurze Haltedauer,<br />
dass in den Varianten 75 °C, 60‘ und 99 °C, 60‘ die<br />
Ausbeute geringer wurde als in den Varianten 75 °C, 30‘<br />
und 99 °C, 30‘. Bezieht man die Qualitätsmerkmale aus<br />
Tabelle 9 auf den Wert bei 25 °C des Gasertrages gem.<br />
Tabelle 8, so errechnen sich (268,94·0,8856·9,968) =<br />
2.374 kWh je Tonne Gärmasse Stroh.<br />
Tabelle 8: Erweiterte Untersuchungen Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) -1<br />
25 °C, 60‘ 50 °C, 30‘ 50 °C, 60‘ 75 °C, 30‘ 75 °C, 60‘ 99 °C, 30‘ 99 °C, 60‘<br />
268,94 217,58 221,21 207,94 195,64 249,49 197,69<br />
Abbildung 4: Strohvarianten mit Variationen der Temperatur<br />
Nm3(CH4)t(oTR)1<br />
325<br />
300<br />
25 °, 60‘ 50 °, 30‘ 50 °, 60‘ 75 °, 30‘ 75 °, 60‘ 99 °, 30‘ 99 °, 60‘<br />
275<br />
250<br />
225<br />
200<br />
175<br />
150<br />
125<br />
100<br />
75<br />
50<br />
25<br />
0<br />
Stroh in Vorbehandlungsvarianten<br />
Tabelle 10: Parameter d. Vorbehandlung u. Vergärung<br />
Unbehandeltes Weizenstroh<br />
TR oTR oTR/TR<br />
94,09 % 94,12 % 88,56 %<br />
Vorbehandlung des Weizenstrohs durch Verdünnung<br />
Strohlänge 20-40mm<br />
Stroh mit Wasser bis zur gewünschten Temp. aufheizen<br />
Haltezeit bei x°C für x Minuten<br />
Abkühlung auf Inokulumtemperatur<br />
Zugabe zu dem Inokulum<br />
Gärtestabbruch bei 30 Tagen<br />
Fazit<br />
Gemäß Faustzahlen Biogas, KTBL, 3. Ausgabe 2013<br />
ist für unbehandeltes Weizenstroh mit 86,00 % TR und<br />
90,00 % oTR ein Gasertrag von 210 Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) - ¹<br />
zu erwarten. Dies entspricht (210·0,86·0,90·9,968) =<br />
1.620,20 kWh pro Tonne Gärmasse. Betrachtet man die<br />
Ergebnisse unter ökonomischen Gesichtspunkten, dann<br />
führt das Streben nach „der letzten kWh“ zu weniger<br />
Gewinn als der Verzicht darauf.<br />
Beispiel:<br />
a) 231,35 Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) -1<br />
werden erreicht, es sollen z.B.<br />
b) 325,00 Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) -1 sein,<br />
was nun Investitionen erfordert. Auf Basis der KTBL-<br />
Qualitätsmerkmale für TR und oTR errechnen sich für<br />
a) (231,35·0,86·0,90·9,968) = 1.784,90<br />
kWh Bioenergie und für<br />
b) (325,00·0,86·0,90·9,968) = 2.507,45 kWh.<br />
Das Delta zwischen a) und b) beträgt demnach 722,55<br />
kWh Bioenergie je Tonne Gärmasse Stroh, die in einem<br />
BHKW mit einem Wirkungsgrad von zum Beispiel<br />
40 % verstromt werden. Pro Tonne Gärmasse Stroh<br />
entstehen bei b) (722,55·0,4) = 289,02 kWh mehr<br />
als bei a). Der Strom wird nach dem EEG vergütet, die<br />
Vergütung betrage 0,20 Euro. Bei 1.000 Tonnen Gärmasse<br />
Stroh entsteht somit ein Mehrerlös von jährlich<br />
60
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Wissenschaft<br />
Tabelle 9: Gemessene Gaserträge normiert auf 86 % TR und 90 % oTR<br />
ergeben pro Tonne Gärmasse:<br />
Kapitel I Mittelwert bei 99 °C 278,35 Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) -1 (278,35·0,86·0,90·9,968) = 2.147,53 kWh<br />
PreChop Variante aus Kapitel II 231,35 Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) -1 (231,35·0,86·0,90·9,968) = 1.784,92 kWh<br />
Cut Variante aus Kapitel II 170,30 Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) -1 (170,30·0,86·0,90·9,968) = 1.313,90 kWh<br />
gemahlene Variante aus Kapitel II 180,13 Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) -1 (180,13·0,86·0,90·9,968) = 1.389,74 kWh<br />
zerbröckelte Pellets aus Kapitel II 248,31 Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) -1 (248,31·0,86·0,90·9,968) = 1.915,77 kWh<br />
Pellets aus Kapitel II 250,95 Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) -1 (250,95·0,86·0,90·9,968) = 1.936,14 kWh<br />
25 °C, 60‘ aus Kapitel III 268,94 Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) -1 (268,94·0,86·0,90·9,968) = 2.074,94 kWh<br />
50 °C, 30‘ aus Kapitel III 217,58 Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) -1 (217,58·0,86·0,90·9,968) = 1.678,68 kWh<br />
50 °C, 60‘ aus Kapitel III 221,21 Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) -1 (221,21·0,86·0,90·9,968) = 1.706,69 kWh<br />
75 °C, 30‘ aus Kapitel III 207,94 Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) -1 (207,94·0,86·0,90·9,968) = 1.604,31 kWh<br />
75 °C, 60‘ aus Kapitel III 195,64 Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) -1 (195,64·0,86·0,90·9,968) = 1.509,41 kWh<br />
99 °C, 30‘ aus Kapitel III 249,49 Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) -1 (249,49·0,86·0,90·9,968) = 1.924,87 kWh<br />
99 °C, 60‘ aus Kapitel III 197,69 Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) -1 (197,69·0,86·0,90·9,968) = 1.525,22 kWh<br />
(289,02·0,2·1.000) = 57.803,66 Euro.<br />
Aus diesem Mehrerlös sind die spezifischen<br />
Mehrkosten für Strom, Personal, Wärme,<br />
Wartung, Unterhaltung, Zinsen, Tilgungen<br />
und Risikokosten zu erwirtschaften, weshalb<br />
man die mögliche Investitionssumme<br />
für beliebige Zeiträume berechnen kann.<br />
Scheidet die Anlage im Betrachtungszeitraum<br />
aus dem EEG aus und wechselt mit<br />
0,148 Euro in die Ausschreibung, ist dies<br />
zu berücksichtigen. Zumindest aus Betreibersicht<br />
ist die Devise: „höher, schneller,<br />
weiter, insolvent“ nicht erstrebenswert.<br />
Das aufgefaserte und geschnittene Stroh mit<br />
[231,35 Nm 3 (CH 4<br />
)·t(oTR) -1 ] – der PreChop<br />
zerfasert die Halme und beschädigt die<br />
Wachsschicht ganz ähnlich wie Stroh aus<br />
einem Tretmiststall – ist hinreichend für<br />
den Gärprozess „beschädigt“. Wird dieses<br />
Stroh in Gärrest für eine Stunde [268,94<br />
Nm 3 (CH 4 )·t(oTR) -1 ] in einem durchmischbaren<br />
Behälter eingeweicht, verursacht das<br />
geringe Investitions- und Betriebskosten.<br />
Die Kombination von beidem wurde bisher<br />
nicht gezielt untersucht, klingt aber vielversprechend<br />
und wird weiter verfolgt werden.<br />
Laut WEISER (2012) können, unter Beachtung<br />
einer ausgeglichenen Humusbilanz,<br />
jährlich etwa 8 bis 13 Millionen Tonnen<br />
Stroh in Deutschland ohne eine stoffliche<br />
Rückführung auf die Ackerflächen genutzt<br />
werden. Geht man von einer Nutzung in Biogasanlagen<br />
mit Gärrestrückführung auf die<br />
Ackerflächen aus, so steigert sich dieses Potenzial<br />
noch 3 . Kommt der Humus aus dem<br />
Stroh über den Gärrest auf die Flächen zurück,<br />
ist es sinnvoller, das Stroh zu vergären,<br />
statt unvergoren unterzupflügen.<br />
Die Ergebnisse wurden im Rahmen<br />
des LSBL 2 Projektes erhoben. Weitere<br />
Informationen über das Projekt unter<br />
www.interreg5a.eu<br />
1<br />
Heizwert in kWh je m 3 CH 4<br />
2<br />
https://www.google.com/url?q=https://www.energetischebiomassenutzung.de/fileadmin/Steckbriefe/<br />
dokumente/03KB081B-D_Effigest_Schlussbericht_TIB.<br />
pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiGz73L7IbgAhXNwKQKHYgD<br />
BiM4ChAWCB8wBA&usg=AOvVaw1CpOl61CBvrHxJOw<br />
NASdd3<br />
3<br />
Fraunhofer IKTS (Dresden) FK 03KB081B<br />
Autoren<br />
Dipl. Des. (FH) Rainer Casaretto<br />
B I O G A S - A K A D E M I E ®<br />
info@biogas-akademie.de<br />
M. Eng. (FH) René Casaretto<br />
PhD Student, Wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
Hochschule Flensburg . Kanzleistr 91-93<br />
24943 Flensburg<br />
04 61/80 51 524<br />
rene.casaretto@hs-flensburg.de<br />
Rührwerk<br />
optimieren,<br />
Kosten<br />
reduzieren!<br />
Steigern Sie die Effizienz Ihrer<br />
Bio gas anlage und reduzieren Sie<br />
Ihre Stromkosten. Tauschen Sie<br />
z. B. ein altes 18,5-kW-Tauchmotor-<br />
Rührwerk durch ein effizientes<br />
11-kW-Stallkamp-Modell aus und<br />
sparen Sie – bei gleicher Rührleistung<br />
– rund 4.000 Euro jährlich*.<br />
Der Tausch amortisiert sich meist<br />
schon im ersten Jahr.<br />
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten<br />
unter www.stallkamp.de !<br />
| pumpen<br />
| lagern<br />
| rühren<br />
| separieren<br />
* Die Höhe der tatsächlichen Ersparnis ist abhängig von<br />
Laufzeit, Strompreis, TS-Gehalt, Fermenterauslegung<br />
und Wirkungsgrad des Rührwerks.<br />
61<br />
MADE IN DINKLAGE
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Saubere Kraftstoffe<br />
aus schmutzigem<br />
Wasser<br />
Brüdenwasser, das bei der Trocknung von Klärschlamm anfällt, vor<br />
und nach der Plasmalyse. Verfahrensbedingt ist bei dieser Technologie<br />
die Gewinnung von Wasserstoff mit einer Reinigung des als Elektrolyt<br />
eingesetzten Schmutzwassers verbunden.<br />
Das Berliner Unternehmen Graforce entwickelt ein<br />
Verfahren, bei dem aus Abwasser oder Gärresten mittels<br />
gesteuerter Plasmaentladungen Wasserstoff sowie Ausgangsprodukte<br />
für weitere umweltfreundliche Kraftstoffe<br />
entstehen.<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Graforce-Geschäftsführer<br />
Dr. Jens Hanke<br />
am ersten Prototyp des<br />
Plasmalyzers zur Dissoziation<br />
von Abwasser<br />
und Gewinnung von<br />
Wasserstoff.<br />
Abwässer aus Siedlungen oder Industrieanlagen<br />
sind eine für die Gesellschaft teure<br />
Umweltlast. Und auch im Output von Biogasanlagen<br />
wird die Fracht aus Harnstoff,<br />
Aminosäuren, Nitraten und Ammonium<br />
zum Problem, wenn es nicht genügend Fläche gibt, um<br />
sie als Pflanzendünger zu nutzen. Für Dr. Jens Hanke<br />
können solcherart Flüssigkeiten als Input für die von<br />
ihm entwickelte Technologie gar nicht schmutzig genug<br />
sein. „Je mehr Ballast darin gelöst ist, desto breiter<br />
sind die Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der<br />
Endprodukte“, sagt der Gründer und Geschäftsführer<br />
der Graforce GmbH.<br />
Seine Unternehmensidee klingt ein wenig nach Zauberei.<br />
Denn das neuartige Verfahren der Plasmalyse soll<br />
es nicht nur ermöglichen, mit hoher Energieeffizienz<br />
Fotos: Carmen Rudolph<br />
Wasserstoff zu erzeugen und zusätzlich andere Gase,<br />
die sich für eine Weiterverarbeitung zu umweltfreundlichen<br />
Kraftstoffen eignen. Sondern das dafür eingesetzte<br />
Schmutzwasser wird bei diesem Prozess zugleich<br />
gereinigt und kann in den natürlichen Kreislauf zurück<br />
fließen. Mit Zauberei habe das aber nichts zu tun, versichert<br />
der studierte Mathematiker, Robotikexperte und<br />
Doktor im Bereich der theoretischen Medizin. Eher mit<br />
der Nutzung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, namentlich<br />
über die Wirkmechanismen bei der Auflösung<br />
und Entstehung chemischer Verbindungen.<br />
Gezähmtes Gewitter im Wasserglas<br />
Wie es funktioniert, veranschaulicht Hanke im Entwicklungslabor<br />
der Firma im dritten Obergeschoss des<br />
Zentrums für Photovoltaik und Erneuerbare Energien<br />
Berlin-Adlershof. Hier arbeiten die Graforce-Mitarbeiter<br />
an der Modifizierung des Plasmalyse-Verfahrens<br />
für unterschiedliche Anwendungsfälle. In einem der<br />
Räume schaut Dr. Simon Schneider gerade durch<br />
das Sichtfenster einer kühlschrankgroßen Apparatur,<br />
dem sogenannten Plasmalyzer. Ein Glasgefäß darin ist<br />
knapp zur Hälfte mit Brüdenwasser befüllt, das bei der<br />
Trocknung von Klärschlamm anfällt. Wegen der darin<br />
konzentrierten Umweltgifte erfordert Brüdenwasser einen<br />
besonders hohen Reinigungsaufwand.<br />
Hinter der Scheibe des Plasmalyzers herrschen Zustände,<br />
wie sie sich vermutlich vor Millionen Jahren auf dem<br />
Urmeer der Erde abgespielt haben. Über der Wasserfläche<br />
zucken Blitze in so hoher Zahl und Abfolge, dass<br />
sie das menschliche Auge als flackernde Plasmawolke<br />
über der brodelnden Flüssigkeit wahrnimmt. „Das sind<br />
Ladungsausgleiche wie beim Gewitter. Wir erzeugen<br />
die Blitze durch ein starkes elektrisches Feld von mehreren<br />
Tausend Kilovolt“, erläutert der 34-Jährige. Die<br />
Entladungen setzen unter anderem Wasserstoff frei.<br />
Dieser kann über eine Membrane aus dem Gasgemisch<br />
62
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Wissenschaft<br />
Herzstück der weitgehend automatisch arbeitenden Demonstrationsanlage von<br />
Graforce ist der Plasmalyzer, in dem der Wasserstoff freigesetzt wird.<br />
Der im Plasmalyzer freigesetzte Wasserstoff wird in der Demonstrationsanlage<br />
mit Biomethan vermischt. Geplant ist auch ein Gemisch mit Rohbiogas.<br />
separiert und beispielsweise als grüner Kraftstoff für<br />
eine emissionsfreie Mobilität eingesetzt werden.<br />
Wasserstoff aus der Schmutzfracht<br />
Doch wozu dieser Aufwand? Schließlich lässt sich mit<br />
der herkömmlichen Elektrolyse ebenfalls Wasserstoff<br />
herstellen. Dabei werden bekanntlich Elektroden in<br />
klares Wasser getaucht und wird dessen Leitfähigkeit<br />
durch die Zugabe von Säuren oder Salzen verbessert.<br />
Damit sich aber an der Kathode Wasserstoff und an<br />
der Anode Sauerstoff bildet, muss die zugeführte Energiemenge<br />
in Form von Elektrizität höher sein als die<br />
Bindungskräfte zwischen den Wasserstoff- und Sauerstoffatomen.<br />
Diese liegt bei 486 Kilojoule (kJ) pro mol.<br />
Das gilt im Prinzip auch für die Blitze im Plasmalyzer.<br />
Doch hier kommt nun das schmutzige Wasser als Elektrolyt<br />
ins Spiel. Denn wozu das reine Lebenselixier mit<br />
hohem Energieaufwand in seine Bestandteile zerlegen,<br />
wenn die Verunreinigungen darin, etwa Ammonium<br />
(NH 4<br />
), ebenfalls Wasserstoff enthalten. „Hilfreich ist<br />
dabei der Umstand, dass die Bindungskräfte in diesen<br />
chemischen Verbindungen schwächer sind als beim<br />
Wasser. Für die Aufspaltung von NH 4<br />
beispielsweise<br />
genügt eine Zersetzungsspannung von 90 kJ/mol,<br />
also weniger als ein Fünftel der Energie, die für den<br />
Aufbruch von H 2<br />
O aufgewendet werden muss. Ähnlich<br />
verhält sich das bei der Dissoziation anderer Verbindungen<br />
mit einem oder mehreren H-Atomen. Das machen<br />
wir uns bei der Plasmalyse zunutze“, beschreibt Hanke<br />
den Ansatzpunkt der Innovation.<br />
Über die Stärke des elektrischen Feldes, das die Plasmaentladungen<br />
hervorruft, lasse sich die Energieeinbringung<br />
so dosieren, dass nur die chemischen Verbindungen<br />
der Schmutzfracht im Elektrolyt aufbrechen,<br />
während die Wassermoleküle erhalten bleiben. Die aus<br />
der Flüssigkeit heraustretenden Gase werden über spezielle<br />
Membranen sortiert und ausgefiltert. Stickstoff<br />
und Sauerstoff gelangen zurück in die Atmosphäre. Der<br />
Wasserstoff wird aufgefangen und steht für verschiedene<br />
Anwendungsbereiche beispielsweise als emissionsfreier<br />
Kraftstoff oder Energiespeicher zur Verfügung.<br />
Die Herstellungskosten des Wasserstoffs im Plasmalyzer<br />
beziffert Graforce mit etwa 3 Euro pro Kilogramm<br />
(kg) (bei einem Strompreis von 8 Cent je Kilowattstunde).<br />
Dies sei deutlich günstiger als mittels Frischwasser-Elektrolyse.<br />
Hier lägen die Kosten gegenwärtig<br />
bei 6 bis 8 Euro kg Wasserstoff. Kommt Erneuerbarer<br />
Strom zum Einsatz, ist die Wasserstoffproduktion mittels<br />
Plasmalyse klimaneutral. Ansonsten verlasse den<br />
Prozess nur gereinigtes Wasser.<br />
Biogas mit Wasserstoff aufwerten<br />
Mit der Demonstrationsanlage, die im Oktober vergangenen<br />
Jahres am Firmensitz in Berlin-Adlershof<br />
den Betrieb aufnahm, will Graforce zeigen, dass die<br />
Plasmalyse-Technologie praxisreif ist. In dem weitgehend<br />
automatisch arbeitenden Komplex von der Größe<br />
eines Buswartehäuschens entsteht Wasserstoff durch<br />
die Dissoziation von Zentrat- und Brüdenwasser. Dies<br />
stellen die Berliner Wasserbetriebe, die als Projektpartner<br />
fungieren, zur Verfügung. Einen Teil des benötigten<br />
Stroms liefern die PV-Module am Gebäudekomplex des<br />
Zentrums für Photovoltaik und Erneuerbare Energien.<br />
Der gewonnene Wasserstoff wird direkt in der Demonstrationsanlage<br />
mit Biomethan vermischt. Das Gas<br />
enthält dann 30 Volumenprozent Wasserstoff und 70<br />
Volumenprozent Biomethan. „Als Kraftstoff eingesetzt,<br />
erhöht sich dadurch der Brennwert. Die Effizienz von<br />
Gasmotoren verbessert sich um 6 Prozent und beim<br />
Verbrennungsprozess in den ohnehin emissionsarmen<br />
Aggregaten entstehen nochmal deutlich weniger Stickoxide,<br />
CO 2<br />
und Kohlenwasserstoffe“, benennt Hanke<br />
die Vorteile des Gasgemischs. Die Berliner Wasserbetriebe<br />
betanken damit künftig einige Nutzfahrzeuge<br />
63
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Dr. Simon Schneider überwacht am Plasmalyzer im Entwicklungslabor von Graforce den<br />
Prozessablauf der Dissoziation von schadstoffbelastetem Brüdenwasser zur Gewinnung von<br />
Wasserstoff.<br />
Mit dem gezähmten Blitzgewitter im Plasmalyzer lassen sich<br />
gezielt chemische Verbindungen in Abwässern aufspalten und<br />
Gase für grüne Kraftstoffe erzeugen.<br />
An der Plasmalyse-<br />
Demonstrationsanlage<br />
von Graforce befindet<br />
sich eine Zapfstelle<br />
zum Betanken von<br />
Gasfahrzeugen mit<br />
einem Gemisch aus<br />
Biomethan und Wasserstoff.<br />
aus ihrem Fuhrpark. In einem nächsten Schritt will Graforce<br />
ein Gasgemisch aus Wasserstoff und Rohbiogas<br />
testen. Zur Vermeidung langer Transportwege wäre es<br />
nach Ansicht von Hanke denkbar, die kaskadenförmig<br />
erweiterbare Plasmalyse-Technologie an einer Biogasanlage<br />
anzusiedeln. Als Elektrolyt käme die flüssige<br />
Fraktion abgepresster Gärreste zum Einsatz. Der daraus<br />
gewonnene Wasserstoff könnte dem Rohbiogas direkt<br />
im Gasspeicher über dem Fermenter beigemischt werden.<br />
Versuche zeigen, dass dies die Bildung von zusätzlichem<br />
Methan anregt. Der Brennwert des Biogases<br />
ließe sich dann gegebenenfalls durch nachfolgend weitere<br />
Zumischung von Wasserstoff soweit anheben, dass<br />
das Gasgemisch vor Ort als Kraftstoff in Fahrzeugen<br />
oder Landmaschinen einsetzbar ist.<br />
Plasmalyse als Molekülbaukasten<br />
Zunächst sind jedoch Pilotanlagen in den Berliner<br />
Klärwerken Waßmannsdorf und Schönerlinde geplant.<br />
Hier steht die Kopplung von Abwasserreinigung und<br />
Wasserstoffproduktion im Vordergrund. Diese Kombinationsmöglichkeit<br />
stößt laut Hanke auch bei Kommunen<br />
auf Interesse, die durch ihr schnelles Wachstum<br />
zunehmend vor Entsorgungsproblemen stehen. Dies<br />
hätten Anfragen aus Neu Delhi und Peking gezeigt. Bei<br />
Graforce ist man überzeugt, dass die Plasmalyse-Technologie<br />
darüber hinaus weitere Perspektiven für eine klimafreundliche<br />
Energiebereitstellung und Mobilität eröffnet.<br />
Denn im 400 bis 600 Grad heißen Blitzgewitter<br />
des Plasmalyzers brechen auch Kohlenstoffketten auf<br />
und es entstehen unter Hinzuziehung von Elektronen<br />
aus anderen Molekülcrashs neue Bindungen.<br />
„Gegenwärtig arbeiten wir in Kooperation mit dem<br />
e-gas-Projekt von Audi daran, durch eine entsprechende<br />
Steuerung der Dissoziation von Abwässern im<br />
Plasmalyzer gezielt auch Kohlendi- beziehungsweise<br />
-monoxid zu erzeugen, das in einem nachfolgenden<br />
Prozessschritt mit Wasserstoff zu Methan (CH 4<br />
) oder<br />
synthetischen Kraftstoffen, beispielsweise grünem<br />
Kerosin, reagiert“, gibt der Graforce-Geschäftsführer<br />
einen Einblick in die aktuelle Entwicklungsarbeit.<br />
Autor<br />
Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Freier Journalist<br />
Rudolph Reportagen – Landwirtschaft,<br />
Umwelt, Erneuerbare Energien<br />
Kirchweg 10 · 04651 Bad Lausick<br />
03 43 45/26 90 40<br />
info@rudolph-reportagen.de<br />
www.rudolph-reportagen.de<br />
64
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Wissenschaft<br />
Wegen Betriebsumstellung VERKAUF von verschiedensten Anlagenteilen<br />
z.B. BHKW LIEBHERR 100kw; BJ 2006; incl. RESTLAUFZEIT EEG 2006<br />
(Gen.wirk.gr. 93,5; Stromkennzahl 0,56; Motor BG924TI_Re; )<br />
sowie viele weitere Anlagen, wie z.B.:<br />
Gasmessung INCA4001, Notkühler, Gasverdichter, Gasfackel,<br />
Perkolat-Pumpe Seepex, Perkolat-Pumpe Vogelsang<br />
Verfügbar ab April <strong>2019</strong><br />
Naturkraftwerk Störnstein<br />
J. Gleissner Mobil 0151-11925055<br />
C. Kraus Mobil 0170-9237995<br />
Biogasanlagen Service nach Maß<br />
Herstellungunabhängige Wartung nach DIN 31051 / DIN EN 13306<br />
BHKW Wartung<br />
Ersatzteile aller gängigen Hersteller<br />
Biologische Betreuung<br />
Separationstechnik<br />
Einbring – Beschickertechnik<br />
Flexibilisierung<br />
Neubau von 75 kW Hofanlagen<br />
Rührwerktechnik elektrisch und hydraulisch<br />
Eigene Herstellung von modifizierten Ersatzteilen<br />
NewTec Energy Solutions GmbH • Schulstraße 52 • 44534 Lünen<br />
Tel. 02306/7648822 • Mail. info@newtec-biogas.com • www.newtec-biogas.com<br />
ENERGIE-<br />
TECHNIK<br />
BHKW<br />
NEA<br />
USV<br />
SERVICE<br />
IHR PARTNER VON DER PLANUNG BIS ZUM RUND-UM-SERVICE<br />
KREFELD • WESSELING • MELLE • WUNSTORF • MÖSSINGEN<br />
65<br />
www.henkelhausen.de
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Biene und Biogas<br />
Aufwertung von<br />
Biogasfruchtfolgen<br />
mit Sorghum-<br />
Dualtypen<br />
Bienen nutzten sowohl im Experiment als auch unter<br />
Praxisbedingungen Sorghum als Pollentrachtpflanze.<br />
Sorghum in Biogasfruchtfolgen bereichert das Pollenangebot<br />
für Insekten. Eine Fruchtfolgeerweiterung ist<br />
aus pflanzenbaulicher und aus ökologischer Sicht zu<br />
begrüßen. Die Kombination Sorghum mit Silphie kann<br />
langfristig das Nahrungsangebot für Insekten aufwerten.<br />
Von Dr. Reinhold Siede, Björn Staub<br />
und Dr. Steffen Windpassinger<br />
<br />
Pollen sammelnde Biene<br />
an Sorghumblüte.<br />
Foto: Siede<br />
Knapp 50 Prozent der in Nawa-<br />
Ro-Biogasanlagen verwendeten<br />
Substrate werden auf dem Acker<br />
erzeugt. Mais ist wegen seines hervorragenden<br />
Gasertragspotenzials<br />
und der problemlosen Vergärung im Fermenter<br />
die wichtigste Frucht. Dies kann zu hohen<br />
Maisanteilen in Biogasfruchtfolgen führen.<br />
Enge, maislastige Fruchtfolgen stehen in der<br />
Kritik. Sie können zu Problemen mit Fruchtfolgeschädlingen<br />
oder auch mit Nährstoffverlagerungen<br />
in das Grundwasser beitragen.<br />
Während insbesondere große Maisschläge ideale<br />
Rückzugsmöglichkeiten und ein reichhaltiges<br />
Futterangebot für Wildschweine bieten, sind<br />
Maisflächen für die Insektenwelt geringwertig.<br />
Um die agrarökologische Wertigkeit klassischer<br />
Biogasfruchtfolgen zu erhöhen, bedarf es alternativer<br />
Energiepflanzen, die ertraglich mit dem<br />
Mais mithalten können und gute Ernte-, Silierund<br />
Vergäreigenschaften mit sich bringen.<br />
Sorghumhirsen (Sorghum bicolor L.) scheinen geeignete<br />
Kandidaten zu sein. Sorghum ist kein Wirt des<br />
Maiswurzelbohrers. Der Maiszünsler richtet bei Sorghum<br />
kaum Schaden an. Sorghum hat einen geringen<br />
Stickstoffbedarf und ein weitverzweigtes, tiefreichendes<br />
Wurzelsystem. Dies kann aus Sicht des Boden- und<br />
Grundwasserschutzes von Vorteil sein. Der vermutlich<br />
wichtigste Vorteil von Sorghum gegenüber Mais ist aber<br />
seine bessere Trockentoleranz, die beispielsweise im<br />
Das Projekt<br />
SoNaBi ist ein Verbundvorhaben der Partner:<br />
ffJustus Liebig Universität Gießen, Professur für Pflanzenzüchtung.<br />
ffDeutsche Saatveredelung AG (DSV), Lippstadt.<br />
ffNorddeutsche Pflanzenzucht Innovation GmbH, Hohenlieth.<br />
ffLandesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH), Bieneninstitut Kirchhain.<br />
Das Projekt ist auf drei Jahre von März 2017 bis März 2020 angelegt. Es<br />
wird von der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) gefördert<br />
(https://www.fnr.de/index.php?id=11150&fkz=22008816). Das<br />
SoNaBi-Konsortium bearbeitet die Aspekte Sorghumzüchtung und Nutzen<br />
für die Biene. Der Versuchsanbau von Sorghum in Kombination mit Silphie<br />
auf einer Großparzelle wird vom Fachgebiet „Fachinformation Biorohstoffnutzung<br />
– HessenRohstoffe (HeRo)“ des Landesbetriebs Landwirtschaft<br />
Hessen (LLH) umgesetzt. Die hieraus resultierenden Erkenntnisse fließen<br />
in die Beratungsarbeit ein.<br />
Jahr 2018 voll zum Tragen kam. An Sorghumblüten<br />
sind häufig pollensammelnde Honigbienen zu beobachten.<br />
Es ist zu vermuten, dass Sorghumpollen<br />
für Insekten eine wertvolle Eiweißquelle darstellen.<br />
Um das Potenzial von Sorghum zu prüfen, haben<br />
sich Pflanzenzüchter und Bienenkundler in dem<br />
„SoNaBi“-Projekt zusammengeschlossen. Unser Vorhaben<br />
soll einen Beitrag zur weiteren Verbesserung<br />
der Umweltbilanz des Energiepflanzenanbaus für Biogasanlagen<br />
leisten.<br />
66
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Wissenschaft<br />
Pflanzenzüchter arbeiten an der<br />
Verbesserung der Sorghumsorten<br />
Wissenschaftler der Norddeutschen Pflanzenzucht<br />
(NPZ), der Deutschen Saatveredelung (DSV) und der<br />
Professur für Pflanzenzüchtung der Justus Liebig<br />
Universität Gießen züchten bereits seit mehreren Jahren<br />
Sorghumhybriden, die unter mitteleuropäischen<br />
Klimabedingungen hohe Gaserträge liefern. Angestrebt<br />
werden Dualtypen, die einen wesentlichen Anteil der<br />
Energie im Korn enthalten.<br />
Die Pflanzen erreichen eine Höhe von nur etwa 2,50<br />
Meter, so dass sie leichter als die herkömmlichen langen<br />
Energiesorghumsorten beerntet werden können.<br />
Die Neigung, ins Lager zu gehen, ist gering. Ein wesentliches<br />
Selektionskriterium ist insbesondere eine<br />
gute Kältetoleranz. Der Kornansatz darf nicht durch<br />
niedrige Nachttemperaturen beeinträchtigt werden.<br />
Vielversprechende kompakte, kornbetonte Sorghum-<br />
Typen sind in der Entwicklung (siehe Foto 2).<br />
Foto: Windpassinger<br />
<br />
Sorghum-Dualtypen vor den klassischen, langen Biomassetypen.<br />
Abbildung 1: Mittlere Wabenanzahl mit gedeckelter Brut in<br />
Abhängigkeit der Pollenquelle für das Versuchsjahr 2018<br />
mittlere Anzahl Waben mit gedeckelter Brut<br />
4,0<br />
3,0<br />
2,0<br />
1,0<br />
0<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Zeit [Wochen nach Versuchsbeginn]<br />
Bienenkundler testen den Wert von<br />
Sorghumpollen<br />
Ziel der Versuche ist es, die Eignung von Sorghum als<br />
Pollentrachtpflanze für Bienen zu beurteilen. Deshalb<br />
wurde der Trachtwert einer Sorghumlinie, einer<br />
Sorghum-F1-Hybride, einer Maissorte und der hochattraktiven<br />
Bienentrachtpflanze Phacelia miteinander<br />
verglichen. Je Variante wurden in 2017 und in 2018<br />
jeweils vier Parzellen zu je 100 Quadratmeter Größe<br />
angelegt. Um die Blühdauer zu verlängern, wurde jede<br />
Parzelle zweigeteilt. Die Teilparzellen wurden als Staffelsaat<br />
im Abstand von 14 Tagen angelegt.<br />
Jede Parzelle war mit einem 3 Meter hohen, 25 Meter<br />
langen und 4 Meter breiten Flugzelt überspannt (siehe<br />
Foto 3). Kurz vor Beginn der Pflanzenblüte Ende Juli<br />
wurde in jedes Zelt ein Kleinstbienenvolk verbracht.<br />
Die Einheiten wurden mit etwa 5.000 Bienen im miniaturisierten<br />
„Mini-Plus“-Bienenkastenformat gestartet.<br />
Wegen der Einhausung konnten die Bienen nur den<br />
Pollen der Zielpflanzen sammeln. Die Bienenvölkchen<br />
der Nullkontrolle standen in Flugzelten ohne jedwede<br />
Vegetation. Der Energiebedarf der Versuchsvölkchen<br />
wurde durch Zufüttern von Zuckerwasser gedeckt.<br />
Im Abstand von sieben Tagen wurden über neun Wochen<br />
die Masse der erwachsenen Bienen, die Anlage<br />
von Eiern, die Aufzucht von offener und gedeckelter<br />
Brut sowie die Einlagerung der Pollen in Form von<br />
Bienenbrot gemessen. Die Bienen sammelten an Sorghumblüten<br />
Pollen (siehe Foto 1). Er wurde in Form<br />
von Bienenbrot gespeichert und zur Aufzucht von Brut<br />
verwendet. Dies ist an der Anzahl von Waben mit gedeckelten<br />
Brutzellen klar erkennbar (siehe Abbildung 1).<br />
Die Brutleistung der Bienen in den Sorghumzelten war<br />
etwas besser als die der Bienen in den Maiszelten. Die<br />
Unterschiede waren statistisch nicht signifikant (siehe<br />
Tabelle auf Seite 69). Unsere Ergebnisse zeigen, dass<br />
der Pollen beider Süßgräser von Bienen zur Brutaufzucht<br />
genutzt werden kann. Jedoch bricht mit dem<br />
Ende der Mais- beziehungsweise Sorghumblüte ungefähr<br />
vier Wochen nach Versuchsbeginn die Brutaktivität<br />
ein. Sorghum und Mais blühen rasch ab. Der in Form<br />
von Bienenbrot eingespeicherte Pollen war dann zu diesem<br />
Zeitpunkt bereits verbraucht.<br />
Die Völkchen in den Phaceliazelten waren erwartungsgemäß<br />
am produktivsten. Phacelia blühte wochenlang<br />
bis zum Ende des Versuchs. Die Phaceliavölkchen brüteten<br />
kontinuierlich durch. Inwiefern die Unterschiede<br />
zwischen Mais, Sorghum und Phacelia durch die Menge<br />
des Pollenangebotes oder durch deren Qualität verursacht<br />
sind, müssen weitere Untersuchungen klären.<br />
Versuchsgruppe<br />
Phacelia<br />
Sorghum F1<br />
Hybride<br />
Mais<br />
Sorghum Linie<br />
0-Kontrolle<br />
67
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
<br />
Foto: Siede<br />
<br />
Foto: Foltys<br />
Flugzelte mit Bienenvölkchen über den<br />
Sorghum-, Mais- und Phaceliaparzellen.<br />
Silphie-Aussaat nach dem Anbauverfahren der „Donau-Silphie“. Hier wird versuchsweise<br />
als Deckfrucht Sorghum anstelle der standardmäßig angebauten Deckfrucht Mais eingesetzt.<br />
Der Waldstandort zeichnet sich durch ein hohes Wildschweinvorkommen aus.<br />
Abbildung 2: Mittlere Anzahl Blüten besuchender Insekten in der<br />
Silphiebeobachtungsparzelle und im Sorghumschlag<br />
Anzahl Blütenbesuche<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
2 3 4 4,5 5 6 7<br />
Wochen nach Beobachtungstermin<br />
Silphie (10´, Beobachtungsparzelle, 10m x 10m)<br />
Sorghum (30´, Transsekt 490m)<br />
Sorghum – Pollenquelle frei<br />
fliegender Bienenvölker?<br />
Nachdem sich Sorghumpollen in den<br />
Flugzeltexperimenten als geeignete Proteinquelle<br />
erwiesen hatte, stellte sich die<br />
Frage, ob Bienen auch unter Praxisbedingungen<br />
Sorghumpollen sammeln. Um dazu<br />
Daten zu gewinnen, wurde am Landwirtschaftszentrum<br />
Eichhof in Bad Hersfeld,<br />
das zum Landesbetrieb Landwirtschaft<br />
Hessen gehört, eine Demonstrationsfläche<br />
im Praxismaßstab angelegt.<br />
Sorghum wurde hier als Deckfrucht für<br />
die Aussaat der Durchwachsenen Silphie<br />
(Silphium perfoliatum) angebaut (siehe<br />
Foto 4). Um die Blühdauer des Bestandes<br />
zu verlängern, wurde ein Gemisch aus drei<br />
Sorghumhybriden ausgesät. Die Aussaat<br />
erfolgte nach dem Anbauverfahren der Donau-Silphie<br />
durch die Metzler & Brodmann<br />
Saaten GmbH. Der Schlag liegt am Rand<br />
eines Waldes und wird erfahrungsgemäß<br />
BIOGASANALYSE<br />
GASANALYSENTECHNIK<br />
BIOGASANALYSENTECHNIK<br />
WASSERANALYSENTECHNIK<br />
AGRARMESSTECHNIK<br />
PRONOVA Analysentechnik GmbH&Co.KG<br />
Groninger Straße 25 I 13347 Berlin<br />
Tel +49 (0)30 455085-0 – Fax -90<br />
info@pronova.de I www.pronova.de<br />
FOS/TAC 2000<br />
automatischer Titrator zur Bestimmung<br />
von FOS, TAC und FOS/TAC<br />
SSM 6000 ECO<br />
SSM 6000<br />
der Klassiker für die Analyse<br />
von CH 4<br />
, H 2<br />
S, CO 2<br />
, H 2<br />
und O 2<br />
mit<br />
und ohne Gasaufbereitung<br />
mit proCAL für SSM 6000,<br />
die vollautomatische,<br />
prüfgaslose Kalibrierung<br />
68<br />
www.pronova.de
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Wissenschaft<br />
Anzahl der Waben mit gedeckelter Brut, gemittelt<br />
über beide Versuchsjahre 2017 und 2018.<br />
Versuchsgruppe N Untergruppen<br />
0-Kontrolle 4 0,194<br />
1 2 3<br />
Mais 8 1,174<br />
Sorghum- Linie 8 1,313<br />
Sorghum F1 Hybride 8 1,319<br />
Phacelia 8 2,785<br />
Versuchsgruppen einer Untergruppe sind statistisch nicht unterscheidbar<br />
(Tukey B Test, α = 0,05; allgemeines lineares Modell mit Messwertwiederholungen,<br />
analysiert mit dem Statistiksoftwarepaket SPSS).<br />
Foto: Staub<br />
<br />
Presse zur Herstellung der Wickelballensilage.<br />
Print LENZ520_210x99 11.02.19 16:06 Seite 1<br />
L-ENZ:<br />
Der flexible<br />
Schüttguttrockner<br />
stark von Wildschweinen besucht. Deswegen<br />
wurde anstelle der praxisüblichen<br />
Maisdeckfrucht Sorghum gewählt.<br />
In unmittelbarer Nachbarschaft steht ein<br />
bereits mehrjährig etablierter Silphiebestand,<br />
der üppig blühte. Die Bienenkundler<br />
haben im Sorghumschlag sechs Bienenvölker<br />
aufgestellt. Der Bestand wurde<br />
wöchentlich abgeschritten und die Anzahl<br />
Blüten besuchender Bienen und Insekten<br />
gezählt. Als Vergleichswert wurde zeitgleich<br />
der Insektenbesuch in der nahegelegenen<br />
Silphieparzelle erfasst. An den Sorghumblüten<br />
wurden viele pollensammelnde Honigbienen<br />
beobachtet (siehe Abbildung 2).<br />
Außerdem traten einige andere Hautflügler<br />
und Fliegen auf. Die zahlreichen goldgelben<br />
Silphieblüten lockten noch mehr<br />
Insekten an. Darunter waren auch viele<br />
Hummeln, Schwebfliegen und Schmetterlinge.<br />
Somit belegen die Beobachtungen,<br />
dass Sorghum auch unter Praxisbedingungen<br />
von Bienen als Proteinlieferant genutzt<br />
wird – ganz offensichtlich in Ergänzung<br />
verfügbarer, hochattraktiver nektar- und<br />
pollenliefernder Blütenpflanzen.<br />
Trotz des massiven Wildschweinvorkommens<br />
am Standort waren keine nennenswerten<br />
Schäden im Sorghumbestand feststellbar.<br />
Die Tiere kreuzten den Bestand<br />
bzw. hielten sich in der Kultur auf. Dies<br />
zeigten die zahlreichen Trittspuren am<br />
Boden. Die Ernte der Fläche erfolgte mit<br />
einem selbstfahrenden Feldhäcksler. Das<br />
Erntematerial wurde für anschließende<br />
Vergärungsversuche in Rundballen siliert<br />
(siehe Foto 5). Die Anlage weiterer<br />
Demonstrationsflächen mit Sorghum in<br />
Verbindung mit anderen Kulturpflanzen<br />
ist in den folgenden Jahren am Landwirtschaftszentrum<br />
Eichhof geplant, um Anbauerfahrungen<br />
für die Bereitstellung von<br />
Fachinformationen und Beratungsempfehlungen<br />
zu gewinnen.<br />
Autoren<br />
Dr. Reinhold Siede<br />
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH)<br />
FG 35 Bieneninstitut Kirchhain<br />
Erlenstr. 9 · 35274 Kirchhain<br />
0 64 22/94 06 40<br />
www.llh.hessen.de<br />
Björn Staub<br />
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH)<br />
Kompetenzzentrum HeRo<br />
Am Sande 20 · 37213 Witzenhausen<br />
0 55 42/303 83 51<br />
Dr. Steffen Windpassinger<br />
Justus-Liebig Universität<br />
Department of Plant Breeding<br />
IFZ Research Centre for Biosystems<br />
Land Use and Nutrition<br />
Heinrich-Buff-Ring 26-32<br />
35392 Gießen<br />
06 41/993 74 43<br />
Lauber-EnergieNutzZentrale mit Heizregisterbypass<br />
✔Ideale Fahrweise für Flex-BHKWs auch ohne Pufferspeicher<br />
✔Förderung hoher Luftmengen auch bei geringer Wärmeleistung<br />
✔Individuelle, wirtschaftliche Belüftungsmöglichkeiten<br />
für Trocknungsboxen,<br />
Container, Anhänger etc.<br />
✔Komplettsystem mit Heizungstechnik<br />
und SPS-Regelung<br />
✔Leistungsgrößen pro L-ENZ von 80 kW<br />
bis 1250 kW<br />
Neue<br />
Leistungsgröße:<br />
L-ENZ 520<br />
Erfahrung und Kompetenz in der Trocknungstechnik<br />
D-73553 Alfdorf<br />
Tel +49 7172-93 83 0-0<br />
www.lauber-holztrockner.de<br />
69
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Neues Gerät zur Online-Überwachung des<br />
FOS/TAC-Wertes ermöglicht repräsentative<br />
Probenentnahme<br />
Ein neu entwickeltes Probennahmegerät reduziert Probennahme- und Messfehler. Mit ihm<br />
kann eine höhere Datendichte erzeugt werden. Die Online-Überwachung ermöglicht einen<br />
sichereren Betrieb bei bedarfsgerechter Fütterung. Biologische Störungen werden schnell<br />
erkannt.<br />
Von M. Sc. Camilo Wilches, B. Eng. Maik Vaske, Prof. Dr. Kilian Hartmann<br />
und Prof. Dr. Michael Nelles<br />
Die Flexibilisierung von Biogasanlagen ist<br />
derzeit eine der größten Herausforderungen,<br />
die es zu bewältigen gilt, um eine vollständige<br />
Integration von Biogasanlagen in<br />
das Energieversorgungssystem der Zukunft<br />
gewährleisten zu können. Abgesehen von der Zunahme<br />
der installierten elektrischen Leistung und der Gasspeicherkapazität<br />
kann die flexible Erzeugung durch<br />
bedarfsgerechte Fütterung optimiert werden, um bei<br />
Bedarf Biogas bereitzustellen.<br />
Die bedarfsgerechte Fütterung erfordert eine intensivere<br />
Kontrolle des biologischen Systems. Aufgrund von<br />
Physikalischer Aufbau der drei Ventile zur Definition des Probenentnahmevolumens<br />
entsprechend dem eingeschlossenen Luftvolumen.<br />
Gärrest<br />
90 m 3 /h<br />
Ventil<br />
Ventil<br />
Variable<br />
Volumen zur<br />
Bestimmung<br />
der Unterprobe<br />
Volumen<br />
Ventil<br />
Sammelbehälter<br />
Schwankungen im Fütterungsplan können Prozessungleichgewichte<br />
erzeugt werden, die rechtzeitig erkannt<br />
werden müssen, um so große Störungen und einen<br />
möglichen wirtschaftlichen Verlust zu vermeiden.<br />
Heutige Probennahmen nicht repräsentativ<br />
für ganzen Behälter<br />
Die verfügbaren Geräte zur Überwachung des biologischen<br />
Prozesses konzentrieren sich auf analytische<br />
Messungen. Bei der Probenahme wird davon ausgegangen,<br />
dass die Probe den gesamten Behälter repräsentiert,<br />
ohne dass ein angemessenes Stichprobenverfahren<br />
genutzt wird. Eine repräsentative<br />
Probenahme ist jedoch erforderlich, da<br />
Gärrückstände aus einer Mischung verschiedener<br />
Substrate wie Energiepflanzen,<br />
Dung oder organischen Abfällen in<br />
verschiedenen Fermentationsstadien<br />
charakterisiert werden (Substratheterogenität,<br />
SH).<br />
Außerdem sind optimale Mischungsbedingungen<br />
in der Praxis schwer zu erreichen,<br />
da die Rührleistung auf der visuellen Überwachung<br />
der Fermentationsoberfläche<br />
beruht und es keine Informationen über<br />
die darunterliegenden Schichten gibt. Mit<br />
geeigneten Verfahren können Sedimentationsmuster<br />
in Fermenten bestimmt werden.<br />
Dabei zeigt sich, dass eine höhere Konzentration<br />
an Essigsäure in der Nähe der Substratzufuhr<br />
besteht, die mit der Entfernung<br />
abnimmt und eine ungleichmäßige Verteilung<br />
der Teilchengröße aufweist. Diese<br />
Ergebnisse zeigen, dass im Fermenter ein<br />
gewisser Grad an räumlicher Segregation<br />
vorliegt (Verteilungsheterogenität, VH).<br />
Substrat- und Verteilungsheterogenität im<br />
Substrat verzerren das Ergebnis der Probenahme.<br />
Durch Stichproben erzeugte Fehler<br />
70
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Wissenschaft<br />
Abbildung 1: Drei Monate Online-Überwachung. Zwei Fütterungsveränderungen können identifiziert werden. Von 1.300 kg<br />
fast alle zwei Stunden bis 6.500 kg alle zwölf Stunden und später einmal täglich 13.000 kg. Beide Veränderungen hatten<br />
keinen negativen Einfluss auf den biologischen Prozess<br />
Manure / [Kg]<br />
Maize Silage/ [Kg]<br />
VFA/TIC x 10000 / []<br />
14000<br />
13000<br />
12000<br />
11000<br />
10000<br />
9000<br />
8000<br />
7000<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
Calibration<br />
gas analizer<br />
VFA/TIC<br />
Single feedings pig manure<br />
Volume storage<br />
Methane<br />
Addition trace<br />
elements<br />
Modification<br />
feeding program<br />
Single feeding maize silage<br />
Volume digester<br />
CHP<br />
Modification<br />
feeding program<br />
Methane x 10 / [%]<br />
CHP / [kW]<br />
0<br />
0<br />
1.3.18 11.3.18 21.3.18 31.3.18 10.4.18 20.4.18 30.4.18 10.5.18 20.5.18 30.5.18<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
können 100 Mal größer sein als Fehler bei der Analyse<br />
der Probe. Die Theorie der Probennahme „Theory of<br />
Sampling“ (TOS) definiert ein korrektes Probenentnahmeverfahren<br />
wie folgt: Jeder Teil des Loses muss die<br />
gleiche Wahrscheinlichkeit ungleich null haben, um in<br />
der Stichprobe zu landen, während Elemente, die dem<br />
Los fremd sind, eine Wahrscheinlichkeit von null haben<br />
müssen, um in der Probe zu landen.<br />
Probe: milliardstel Teil des<br />
Fermentervolumens<br />
Aufgrund dieser Definition ist es offensichtlich, dass<br />
die traditionelle Praxis der Entnahme einer Probe aus<br />
einem Ventil an der Wand des Fermenters diese Wahrscheinlichkeitsbedingungen<br />
nicht erfüllt. Bei einer<br />
durchschnittlichen Biogasanlage entspricht das Volumen<br />
einer Probe dem milliardstel Teil des Fermentervolumens.<br />
Kleinste Fehler bei der Probenahme führen<br />
daher zu nicht repräsentativen Ergebnissen.<br />
Die titrimetrische Bestimmung des FOS/TAC-Verhältnisses<br />
wurde ausgewählt, um die Stabilität des Systems<br />
zu quantifizieren, sie wird aufgrund ihrer Einfachheit,<br />
der geringen Kosten und Robustheit am häufigsten in<br />
Biogasanlagen verwendet. Das Hauptproblem dieser<br />
Methode besteht darin, dass die Ergebnisse von der<br />
Probenentnahme-Methode und der Probenvorbereitung<br />
abhängen.<br />
Die Proben sollen vor der Analyse zentrifugiert werden,<br />
was in den meisten Anlagen jedoch keine gängige Praxis<br />
ist. Stattdessen werden die Proben einfach gefiltert,<br />
ohne eine Mindestpartikelgröße zu definieren. Dies und<br />
Unterschiede in der Probenentnahmepraxis führen zu<br />
Proben mit einer hohen Heterogenität, wodurch die Ergebnisse<br />
nicht reproduzierbar sind. Derzeit gibt es kein<br />
kommerzielles Produkt für die Online-Messung einer<br />
anaeroben Vergärung, das über ein repräsentatives Probenentnahmeverfahren<br />
verfügt.<br />
Neu entwickeltes Probennahmegerät<br />
Ein Probennahmegerät wurde an einer landwirtschaftlichen<br />
Biogasanlage entwickelt und implementiert. Das<br />
Gerät, siehe Bild auf Seite 70, sammelt automatisch<br />
eine repräsentative Probe des Fermenterinhalts gemäß<br />
den Richtlinien der TOS. Jede Probe besteht aus vielen<br />
Unterproben mit dem gleichen Volumen, die während<br />
eines Pumpvorganges entnommen werden. Sobald die<br />
Unterproben gesammelt wurden, werden sie gemischt,<br />
um die Heterogenität zu verringern.<br />
71
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Abbildung 2: Bedarfsgerechte Fütterung um den Strompreis anzupassen<br />
BHKW / [kW]<br />
Maissilage / 10 [kg]<br />
Schweinegülle / 10 [kg]<br />
800<br />
Einzelfütterung von Maissilage Einzelfütterung von Schweinegülle<br />
BHKW Leistung Gasproduktion<br />
Strompreis<br />
Gasproduktion / [m³/h]<br />
Strompreis / [€ / MWh]<br />
140<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
0 10 20 30 40 50 60 70<br />
Stunde / [h]<br />
0<br />
Die Probe wird dann auf eine Partikelgröße<br />
kleiner 0,1 Millimeter gefiltert und in eine<br />
Messzelle überführt, wo sie mit destilliertem<br />
Wasser vermischt wird. In diesem Fall<br />
wurde ein automatischer Titrator verwendet,<br />
um das FOS/TAC-Verhältnis zu bestimmen.<br />
Die Probe kann jedoch an ein beliebiges<br />
Messgerät wie NIRS, Raman, Redox<br />
oder ein anderes Verfahren gesendet werden.<br />
Wenn die Analyse abgeschlossen ist,<br />
reinigt sich das System automatisch und<br />
lagert die Elektrode in einer KCL-Lösung<br />
(3 Mol pro Liter), um sie für die nächste<br />
Titration aufzubewahren. Das System ist<br />
seit etwa zwei Jahren in Betrieb und dient<br />
zur Überprüfung der Stabilität des biologischen<br />
Prozesses unter verschiedenen Fütterungsprogrammen.<br />
Messungen an der Praxisanlage<br />
Das Probennahmegerät wurde während<br />
eines zweijährigen Zeitraums auf einer<br />
Biogasanlage getestet. In der zweijährigen<br />
Überwachungszeit dieser Arbeit trat nur<br />
eine Störung des biologischen Prozesses<br />
auf. Daten aus drei Monaten Online-Überwachung<br />
sind in Abbildung 1 auf Seite 71<br />
dargestell. Diese Zeitspanne wurde ausgewählt,<br />
weil sie die Prozessstörung, die Erholungsphase<br />
und den Wechsel von einer<br />
konstanten Fütterung zu einer bedarfsabhängigen<br />
Fütterung umfasst. Durch die<br />
Online-Analyse können die Auswirkungen<br />
Sie suchen einen verlässlichen Partner für die<br />
FLEXIBILISIERUNG<br />
IHRER BIOGASANLAGE?<br />
Dann sollten wir unbedingt ins Gespräch kommen!<br />
Als kompetenter Anbieter haben wir die passende Lösung für Sie.<br />
Seit über 20 Jahren bieten wir innovative und effiziente Systeme<br />
zur Reinigung, Trocknung, Kühlung und Verdichtung von Gasen –<br />
individuell von uns geplant, hergestellt und installiert.<br />
72<br />
SILOXA ENGINEERING AG<br />
Tel: 0201 9999 5727<br />
vertrieb@siloxa.com<br />
www.siloxa.com
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Wissenschaft<br />
der Fütterung auf die Biologie in Echtzeit<br />
verfolgt werden.<br />
Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, weist die<br />
Anlage vom 09.03.2018 bis 09.04.2018<br />
ein Prozessungleichgewicht auf, das wahrscheinlich<br />
durch einen Spurenelementmangel<br />
und nicht durch eine zu diesem<br />
Zeitpunkt Änderung der Fütterung erzeugt<br />
wird. Der erste Anstieg des FOS/TAC wurde<br />
zunächst wegen des charakteristischen stabilen<br />
Betriebs der Anlage und des üblichen<br />
Methangehalts von 53 Prozent ignoriert.<br />
Nach einer Kalibrierung der Gasanalyse betrug<br />
der Wert 43 Prozent, was die Störung<br />
des biologischen Prozesses bestätigte. Es<br />
war eine Zugabe von Spurenelementen und<br />
eine Reduzierung der Fütterung erforderlich,<br />
um das System wiederherzustellen.<br />
Externe Laborergebnisse bestätigten das<br />
Ergebnis des Online-Monitorings, wodurch<br />
eine hohe Datendichte zur Überprüfung<br />
der Prozessentwicklung ermöglicht wird.<br />
Die Erholung des Systems kann seit dem<br />
09.04.2018 beobachtet werden, da der<br />
FOS/TAC-Wert ab hier konstant bleibt. Die<br />
Identifikation eines stabilen Systems ist<br />
von hoher Bedeutung, um die Fütterung bei<br />
Bedarf in der Anlage erneut anzuwenden.<br />
Das Fütterungsprogramm wurde am<br />
23.04.2018 von einer Fütterung im<br />
2-Stunden-Rhythmus auf eine Fütterung<br />
im 12-Stunden-Rhythmus geändert. Diese<br />
Modifikation basierte auf der Erkenntnis,<br />
dass die meisten dynamischen Änderungen<br />
der Gasausbeute in den ersten 12 Stunden<br />
erkannt wurden. Das Ziel der Änderung<br />
ist, die Biogasproduktion an die beiden<br />
Stromkostenspitzen anzupassen, die in den<br />
durchschnittlichen jährlichen Strompreisen<br />
der Day-Ahead-Auktion der EPEX SPOT<br />
SE2 enthalten sind, siehe Abbildung 2.<br />
Am 11.05.2018 wurde die Anlage auf eine<br />
Fütterung am Tag umgestellt, um eine weitere<br />
Optimierung der Erlöse zu erzielen.<br />
Durch den Test konnte ein biologisch stabiler<br />
Betrieb nachgewiesen werden. Die diskontinuierliche<br />
Gasproduktion konnte von<br />
der Anlagentechnik (Speicher, Motor) nicht<br />
genutzt werden, sodass der Test nach vier<br />
Tagen beendet wurde.<br />
Fazit: Das entwickelte Probennahmegerät<br />
ermöglicht eine Online-Überwachung. Die<br />
Proben werden in einem repräsentativen<br />
Verfahren gewonnen und automatisch verarbeitet.<br />
Diese repräsentative Beprobung<br />
erlaubt einen tieferen Einblick in die biologische<br />
Stabilität des Prozesses als die übliche<br />
Probenahme. Biologische Störungen,<br />
die aufgrund von Probenahmefehlern keiner<br />
Ursache zugeordnet werden konnten,<br />
können nun wesentlich genauer analysiert<br />
werden. Mögliche vom Bediener erzeugte<br />
Messfehler werden vermieden und eine höhere<br />
Datendichte ist möglich. Die Online-<br />
Überwachung ermöglicht einen sichereren<br />
Betrieb bei einer bedarfsgerechten Fütterung.<br />
Biologische Störungen werden sofort<br />
erkannt, Korrekturmaßnahmen können<br />
ohne Verzögerung eingeleitet werden, Produktionsausfälle<br />
werden minimiert. Die Ergebnisse<br />
stehen unmittelbar nach der Messung<br />
zur Verfügung und ermöglichen eine<br />
schnellere Reaktionszeit, ohne die vom<br />
Labor benötigten zwei bis drei Tage warten<br />
zu müssen. Die Probenentnahmeeinheit<br />
kann auch von Anlagen verwendet werden,<br />
die mit organischen Abfällen arbeiten, bei<br />
denen die Variation der Eigenschaften des<br />
Ausgangsmaterials Prozessinstabilitäten<br />
erzeugen kann.<br />
Autoren<br />
M. Sc. Camilo Wilches<br />
camilo.wilches@bwe-energie.de<br />
B. Eng. Maik Vaske<br />
maik.vaske@bwe-energie.de<br />
bwe Energiesysteme GmbH & Co. KG<br />
Zeppelinring 12-16<br />
26169 Friesoythe<br />
0 44 91/93 800 10<br />
Prof. Dr. Kilian Hartmann<br />
Hochschule Aschaffenburg<br />
Fakultät Ingenieurwissenschaften<br />
Würzburger Str. 45 · 63743 Aschaffenburg<br />
0 60 21/42 06-933<br />
kilian.hartmann@h-ab.de<br />
Prof. Dr. mont. Michael Nelles<br />
Universität Rostock<br />
Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät<br />
Justus-v.-Liebig-Weg 6 · 18059 Rostock<br />
03 81/498-3400<br />
michael.nelles@uni-rostock.de<br />
Wachstumsmarkt<br />
Frankreich<br />
Nutzen Sie den Biogas-Boom<br />
In akkordierter Zusammen arbeit unterstützen wir Sie:<br />
→ Gestaltung des rechtlichen Rahmens:<br />
von der Firmengründung bis zum Genehmigungsverfahren<br />
→ Erstellung von Finanzierungskonzepten<br />
→Beantragung von Investitionszuschüssen<br />
→ Verhandlungen mit französischen Banken und Investoren<br />
→Bei Markteintritt und -erschließung<br />
→Deutsch-französische Steuerberatung<br />
Ihr Kontakt zu uns:<br />
biogas@sterr-koelln.com<br />
WWW.sterr-koelln.com<br />
RECHTSANWÄLTE<br />
WIRTSCHAFTSPRÜFER<br />
STEUERBERATER<br />
UNTERNEHMENSBERATER<br />
BERLIN<br />
PARIS<br />
FREIBURG<br />
STRASBOURG<br />
73
International<br />
Maximiliano Morrone,<br />
Biogas Journal Nationaldirektor | 2_<strong>2019</strong> der<br />
Förderung Erneuerbarer<br />
Energien, Unterstaatssekretariat<br />
für<br />
Erneuerbare Energien,<br />
Finanzministerium der<br />
Nation, spricht mit<br />
Giannina Bontempo,<br />
Fachverband Biogas,<br />
über die Möglichkeiten<br />
von Biogas im Vergleich<br />
zu anderen Erneuerbare<br />
Energien.<br />
Buenos Aires<br />
Argentinien will 20 Prozent<br />
Erneuerbare bis 2025<br />
Argentinien ist bei den meisten Menschen bekannt für seine Tango-Kultur und seine großen<br />
landwirtschaftlichen Betriebe, die gutes Fleisch produzieren. Das riesige Potenzial an<br />
Erneuerbaren Energien, über das Argentinien verfügt, besonders im Hinblick auf Biogas,<br />
ist hingegen noch weitgehend unbekannter. Auf dem Weg zu einer umweltfreundlicheren<br />
Energieversorgung gibt es allerdings noch einige Herausforderungen.<br />
Von Giannina Bontempo<br />
Im Rahmen der Exportinitiative Energie veranstaltete<br />
die Deutsch-Argentinische Handelskammer<br />
in Zusammenarbeit mit der Renewables Academy<br />
AG vom 29. Oktober bis 2. November 2018<br />
in Buenos Aires eine Geschäftsreise zum Thema<br />
Dezentrale Energieversorgung mit Erneuerbaren<br />
(Bio-, Solar- und Windenergie). Ein Höhepunkt der<br />
Geschäftsreise war die Konferenz, die am 30. Oktober<br />
stattfand. Maximiliano Morrone, dem nationalen<br />
Direktor für die Förderung Erneuerbarer Energien des<br />
Unterstaatssekretariats für Erneuerbare Energien, begrüßte<br />
die Teilnehmer.<br />
Morrone verwies in seinem Grußwort auf die Vision der<br />
Regierung für eine dezentrale Energieerzeugung, nach<br />
der bis 2025 20 Prozent aus Erneuerbaren Energien<br />
stammen sollen. Er wies zudem auf den Erfolg der ersten<br />
beiden Energieausschreibungen hin und beschrieb,<br />
wie die bereits vergebenen Projekte Argentinien helfen,<br />
2018 das Ziel von 8 Prozent Erneuerbarer Stromerzeugung<br />
zu erreichen.<br />
Ein Teil der Konferenz war speziell dem Thema Biogas<br />
gewidmet. Hier berichtete Giannina Bontempo, internationale<br />
Projektleiterin des Fachverbandes Biogas,<br />
über die deutsche Energiewende und die Biogastechnologie.<br />
Sie nahm auch an einer Diskussion über die<br />
Entwicklung des Bioenergiesektors in Argentinien teil.<br />
Außerdem präsentierten zwei Fachverbands-Mitgliedsunternehmen<br />
ihre Produkte und Dienstleistungen.<br />
Das latente Thema während der gesamten Konferenz<br />
war jedoch die Finanzierung. Unter der liberalen Regierung<br />
von Mauricio Macri versucht Argentinien, seine<br />
Infrastruktur durch private Investitionen (Public-<br />
Private-Partnerships, kurz: PPP) zu modernisieren.<br />
Diese Investitionen sind in vielen Bereichen notwendig,<br />
auch im Energiesektor, in dem Argentinien seit einigen<br />
Jahren mit Versorgungsengpässen konfrontiert<br />
ist 1 .<br />
Mittlerweile Nettoenergie-Importeur<br />
Die Stromnachfrage durch Haushalte und Industrie<br />
hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. In<br />
Kombination mit der rückläufigen Energieproduktion<br />
aufgrund fehlender Investitionen in die Energieinfrastruktur<br />
hat dies Argentinien zu einem Nettoenergie-<br />
Importeur gemacht, während Nachbarländer wie Chile<br />
und Uruguay ihre Kapazitäten für Erneuerbare Energien<br />
in den letzten Jahren ausgebaut haben 2 .<br />
Argentiniens Ziel ist, bis 2025 den Anteil an Erneuerbaren<br />
Energien in der Energiematrix auf 20 Prozent zu<br />
erhöhen. Zu diesem Zweck wurden im Gesetz 27191<br />
74
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
International<br />
von 2015 zwei Vertragsmechanismen<br />
definiert: das<br />
RenovAR-Programm sowie<br />
der Grundsatz, dass das<br />
Vertragsverhältnis zwischen<br />
Erzeugern und Großverbrauchern<br />
kostenlos und direkt<br />
ist. Das Programm RenovAR<br />
sieht die Einbeziehung Erneuerbarer<br />
Energiequellen<br />
wie Sonne, Wind, Wasserkraft<br />
oder Biomasse im Rahmen<br />
öffentlicher Ausschreibungen<br />
vor.<br />
Bisher gab es drei Runden,<br />
in denen 147 Projekte mit<br />
einer gesamten Kapazität<br />
von 4.466,5 Megawatt (MW)<br />
(davon 62 MW Biogas) vergeben<br />
wurden. Darüber hinaus<br />
kündigte die Regierung Ende 2018 das MiniRen-<br />
Programm an, das vor allem regionale Projekte fördern<br />
soll, die auf einen Anschluss an das Mittelspannungsnetz<br />
abzielen. Über das MiniRen-Programm sollen 400<br />
MW Leistung im ganzen Land geschaffen werden, wobei<br />
die maximale Leistung pro Projekt 10 MW und die<br />
minimale Leistung 0,5 MW beträgt. Für Biogas ist hier<br />
ein Gesamtanteil von 10 MW vorgesehen.<br />
Darlehen für Energieprojekte<br />
Weiterhin hat die Interamerikanische Entwicklungsbank<br />
Argentinien ein Darlehen von 100 Millionen US-<br />
Dollar für kleine Unternehmen gewährt, die in Projekte<br />
zur Energieeffizienz und in Erneuerbare Energien, insbesondere<br />
Biogas und Biomasse, investieren wollen.<br />
Dies ist eine Finanzierung aus dem Green Climate Fund<br />
(FVC), die von der argentinischen Bank BICE (Banco de<br />
Inversión y Comercio Exterior) durchgeführt wird.<br />
Trotz der beschriebenen Widrigkeiten scheint der argentinische<br />
Markt für Erneuerbare Energien im Allgemeinen<br />
und Biogas im Speziellen langsam an Dynamik<br />
zu gewinnen. Es bleibt abzuwarten, ob und inwieweit<br />
diese Entwicklungen fortgesetzt werden.<br />
Empfohlene aktuelle Publikationen:<br />
ffIm Fokus: Argentinien hält Reformkurs – Öffentlich-private<br />
Partnerschaften sollen Wachstum<br />
ankurbeln. Germany Trade & Invest, 2018.<br />
ffWirtschaftsausblick – Argentinien. Germany Trade<br />
& Invest, September 2018.<br />
ffArgentinien – Dezentrale Energieversorgung mit<br />
Erneuerbaren Energien. Zielmarktanalyse 2018<br />
mit Profilen der Marktakteure. AHK Argentinien.<br />
ffAnuario 2018 – Cámara Argentina de Energías<br />
Renovables (CADER), 2018 (bald auch auf<br />
Englisch verfügbar).<br />
Fotos: Mariano Magrini<br />
Exkurs<br />
Im Rahmen der AHK-Geschäftsreise traf sich Giannina<br />
Bontempo mit Vertretern der Argentinischen Kammer<br />
für Erneuerbare Energien (CADER). CADER ist ein<br />
gemeinnütziger Verein, der mehr als hundert Unternehmen<br />
aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien<br />
vereint. Der Verein ist ein wichtiger Akteur, der Dialoge<br />
und Projekte für die aktuelle und zukünftige Entwicklung<br />
von Energieunternehmen fördert.<br />
Die Kammer besteht aus Unternehmen mit nationalem<br />
und internationalem Sitz und umfasst die gesamte<br />
Erneuerbaren-Branche: Die Mitgliedsunternehmen<br />
stammen aus den Bereichen Bioenergie, Wind, Solar<br />
und anderen Formen der Erneuerbaren Energiequellen<br />
in Argentinien. Die Hauptaufgabe von CADER besteht<br />
darin, ein breites Spektrum von Akteuren aus dem<br />
öffentlichen und privaten Sektor sowie aus akademischen<br />
Einrichtungen zu vernetzen.<br />
1<br />
Im Fokus: Argentinien hält Reformkurs – Öffentlich-private Partnerschaften<br />
sollen Wachstum ankurbeln. Germany Trade & Invest<br />
2<br />
ARGENTINIEN - Dezentrale Energieversorgung mit Erneuerbaren<br />
Energien. Zielmarktanalyse 2018 mit Profilen der Marktakteure.<br />
AHK Argentinien.<br />
Autorin<br />
Giannina Bontempo<br />
Fachreferentin Internationales<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 · 85356 Freising<br />
0 81 61/98 46 60<br />
giannina.bontempo@biogas.org<br />
Podiumdiskussion zum<br />
Thema „Entwicklung<br />
des Bioenergiesektors<br />
in Argentinien“. Links:<br />
Nicolás García Romero,<br />
Provinzdirektor für<br />
Bioökonomie und<br />
ländliche Entwicklung,<br />
Provinz Buenos Aires.<br />
Mitte: Moderatorin<br />
Nanda Singh vom lokalen<br />
Magazin Energía<br />
Estratégica. Rechts:<br />
Giannina Bontempo<br />
vom Fachverband<br />
Biogas e.V.<br />
75
Aus der<br />
Verbandsarbeit<br />
Bericht aus der Geschäftsstelle<br />
<strong>2019</strong> mit hoher<br />
Taktung<br />
Die große Koalition hat das Jahr <strong>2019</strong> als „Arbeitsjahr“ ausgerufen<br />
und legt tatsächlich zum Jahresbeginn ein rasantes<br />
Tempo in Sachen Energiepolitik vor, das auch unser Hauptstadtbüro<br />
Bioenergie beziehungsweise das Referat Politik in<br />
Atem hält.<br />
Von Dr. Stefan Rauh und Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Im Rahmen einer parlamentarischen Arbeitsgruppe sollen bis März bislang<br />
in der Koalition strittige Punkte geklärt werden – darunter auch für<br />
uns die existenziell wichtige Klärung des weiteren Ausbaukorridors für<br />
die Biomasse-Ausschreibungen nach 2022, der bis dato noch nicht festgelegt<br />
ist. Dies wird nun auch vor dem Hintergrund der Erreichung des<br />
Ziels der Bundesregierung diskutiert werden, bis zum Jahr 2030 65 Prozent<br />
Erneuerbare Energien im Strommix zu erreichen.<br />
EEG-Novelle im Herbst <strong>2019</strong> und Klimaschutzgesetz<br />
Die Stabilisierung des Beitrags der Biomasse, die unter den aktuellen Rahmenbedingungen<br />
wegbrechen würde, durch eine Anpassung des für Herbst<br />
<strong>2019</strong> geplanten EEG ist dabei eine der zentralen Forderungen, die durch<br />
entsprechende Positionspapiere und eine parlamentarische Veranstaltung<br />
an unsere Unterstützer und andere interessierte Entscheidungsträger übermittelt<br />
wird.<br />
Daneben soll auch die Abschaffung beziehungsweise Anhebung des „Flexdeckels“<br />
beraten werden. Zusätzlich zu den Vorarbeiten rund um die EEG-<br />
Herbstnovelle beschäftigt sich der Fachverband mit dem Gebäudeenergiegesetz,<br />
das im Februar im Parlament beraten werden soll und in dem sich der<br />
Verband für Verbesserungen für den Einsatz von Biomethan im Wärmemarkt<br />
einsetzt.<br />
Des Weiteren steht die Lobbyarbeit für das Klimaschutzgesetz auf dem Programm,<br />
in die sich der Fachverband gemeinsam mit dem Bundesverband<br />
Bioenergie und dem Deutschen Bauernverband mit zahlreichen konstruktiven<br />
Maßnahmenvorschlägen einbringt, die sowohl die Branche als auch die<br />
Klimaschutzziele entscheidend voranbringen könnten. Nicht zuletzt liegt ein<br />
politisches Augenmerk für uns dieser Tage auf der Umsetzung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie<br />
der EU in nationales Recht. Dies zieht eine ganze<br />
76
Engagiert. Aktiv. Vor Ort. Und in Berlin: Der Fachverband Biogas e.V.<br />
Reihe von Gesetzesänderungen nach sich, die in den<br />
kommenden Jahren erfolgen werden und in die sich<br />
der Fachverband frühzeitig aktiv politisch einbringen<br />
will und muss, da teilweise weitreichende Änderungen<br />
für Biogas ins Haus stehen.<br />
Vergärung verpackter Lebensmittel<br />
im Fokus<br />
Das Referat Abfall, Düngung und Hygiene beschäftigt<br />
sich derzeit verstärkt mit dem Einsatz von verpackten<br />
Lebensmitteln in Biogasanlagen, da diese Praxis durch<br />
politische und gesellschaftliche Diskussionen infrage<br />
gestellt wird. Diese Substrate können nur nach vorheriger<br />
Aufbereitung mit Abtrennung der Fremd- und<br />
Störstoffe in Biogasanlagen eingesetzt werden.<br />
Um diese Diskussionen auf Bundes- und Länderebene<br />
zu begleiten, finden Treffen mit Betreibern der Anlagen<br />
und Herstellern der eingesetzten Aufbereitungstechniken<br />
statt. Dabei werden technische, politische und öffentliche<br />
Maßnahmen abgestimmt, um die Vergärung<br />
von Lebensmittelabfällen weiterhin auf hohem Niveau<br />
zu gewährleisten. Diese und viele weitere Themen werden<br />
auch auf dem Abfallvergärungstag vom 11. bis 13.<br />
März in Dresden diskutiert.<br />
Um besser über die Vorteile der Vergärung organischer<br />
Rest- und Abfallstoffe zu informieren, wurde ein Infopapier<br />
für Betreiber von Abfallanlagen erstellt, das im<br />
Kontakt mit Pressevertretern, Politikern und Nachbarn<br />
verwendet werden kann. Dabei stehen Kreislaufwirtschaft<br />
der Nährstoffe, Reinheit und Qualität der Gärprodukte<br />
sowie Vermeidung von Treibhausgasen aus<br />
unkontrollierter Abfallbehandlung, Erneuerbare Energieerzeugung<br />
und Einsparung von Mineraldüngern im<br />
Fokus. Das Infopapier kann im geschützten Mitgliederbereich<br />
heruntergeladen werden.<br />
Außerdem wird die Bioabfallbroschüre (www.biowasteto-biogas.com)<br />
neu aufgelegt und anschließend auch<br />
in deutscher Sprache publiziert. Die Broschüre ist erstmals<br />
auf der IFAT 2016 mit sehr großem Erfolg erschienen.<br />
Inzwischen sind 5.000 Exemplare an das Fachpublikum<br />
auf internationalen und nationalen Messen und<br />
Veranstaltungen sowie an mehr als 30 Delegationen<br />
in Freising und bei den durchgeführten Schulungen<br />
und Geschäftsreisen verteilt worden. Zudem wurde<br />
die Homepage zur Broschüre jährlich mehr als 1.500<br />
Mal besucht. Wenn Mitgliedsfirmen im Fachverband<br />
Biogas erneut die Chance nutzen wollen, ihr Portfolio<br />
in einem Firmenportrait zu präsentieren, um nationale<br />
und internationale Märkte stärker zu forcieren und<br />
weitere Potenziale für die Biogasbranche im In- und<br />
Ausland zu erschließen, können sie sich per E-Mail bei<br />
giannina.bontempo@biogas.org melden.<br />
Öffentlichkeitsarbeit <strong>2019</strong><br />
Die Öffentlichkeitsarbeiter im Fachverband Biogas<br />
haben sich Ende Januar zusammengesetzt und einen<br />
Plan für das Jahr <strong>2019</strong> erarbeitet. Themenschwerpunkt<br />
unserer diesjährigen Öffentlichkeitsarbeit ist<br />
der Klimaschutz – unser originäres Ziel, unsere Daseinsberechtigung<br />
und nicht zuletzt durch das Klimaschutzgesetz<br />
in diesem Jahr besonders im Fokus.<br />
Darüber hinaus konzentriert sich der Verband <strong>2019</strong> auf<br />
die Unterthemen Güllevergärung, Bioabfall und Grüne<br />
Gase (Biomethan/Kraftstoff). Natürlich werden situativ<br />
auch alle anderen Aspekte der Biogasnutzung, wie<br />
zum Beispiel die Flexibilisierung, Beachtung finden.<br />
Der zentrale Slogan soll „Mein Beitrag“ lauten. Dies<br />
bezieht sich auf den ganz unterschiedlichen Beitrag<br />
von Biogas/von jedem einzelnen Betreiber und jeder<br />
Firma zum Klimaschutz. Hier wollen wir die Mitglieder<br />
soweit wie möglich einbeziehen. Details dazu folgen.<br />
Für den Themenschwerpunkt Bioabfallvergärung erscheint<br />
bereits im Februar ein neues Booklet aus der<br />
Reihe „Biogas to go“. Darin wird leicht verständlich<br />
die Kreislaufwirtschaft bei der Abfallvergärung erklärt<br />
und der Weg vom biogenen Reststoff durch die Biogasanlage<br />
bis zur Energieerzeugung und dem Gärprodukt.<br />
Ideen und Vorschläge zur Öffentlichkeitsarbeit<br />
nimmt die Geschäftsstelle gerne entgegen. Und wer<br />
sich aktiv einbringen möchte, ist herzlich eingeladen<br />
zur Teilnahme an der AG Öffentlichkeitsarbeit,<br />
die sich zwei bis drei Mal im Jahr trifft, um konkrete<br />
Projekte zu erarbeiten. Bitte melden Sie sich bei<br />
andrea.horbelt@biogas.org<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich. Biogas kann‘s!<br />
77
Verband<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Gespräche mit<br />
Bundesnetzagentur<br />
zum Smart Meter<br />
Die Diskussionen im Referat<br />
Stromnetze und Systemdienstleistungen<br />
waren vorrangig von<br />
den Implementierungsvorschriften<br />
der System Operation Guidelines<br />
(SOGL) und der Einführung<br />
eines Smart Meter Gateways geprägt.<br />
Insbesondere durch die<br />
SOGL sind zukünftig umfangreiche<br />
Datenübermittlungspflichten<br />
von den Anlagenbetreibern an die<br />
Übertragungsnetzbetreiber vorgesehen.<br />
Leider sind diese nur zum Teil mit<br />
bereits geplanten Neuerungen wie<br />
der verpflichtenden Einführung<br />
von Smart-Meter-Geräten abgestimmt,<br />
sodass an dieser Stelle<br />
zahlreiche offene Fragen der<br />
Branche bestehen. Um diese zu<br />
klären, nahm der Fachverband im<br />
Februar Gespräche mit der Bundesnetzagentur<br />
sowie dem Bundeswirtschaftsministerium<br />
wahr,<br />
um hier für eine praxisgerechte<br />
Umsetzung zu plädieren.<br />
TRAS 120 im<br />
Bundesanzeiger<br />
veröffentlicht<br />
Wie bereits angekündigt, wurde die TRAS<br />
120 als neue Erkenntnisquelle zum Stand<br />
der Technik und dem Stand der Sicherheitstechnik<br />
am 21. Januar <strong>2019</strong> im Bundesanzeiger<br />
offiziell veröffentlicht (siehe auch<br />
Seite 28). Ob und wie die jeweiligen Landesbehörden<br />
die TRAS 120 zur Umsetzung<br />
bringen, bleibt abzuwarten. In zwei Fachgesprächen<br />
wird im Februar die Anwendung<br />
der TRAS 120 in der Praxis mit Firmen und<br />
Sachverständigen diskutiert. Den daraus<br />
ableitbaren Änderungs- und Konkretisierungsbedarf<br />
wird der Fachverband dann für<br />
seine weiteren Aktivitäten nutzen.<br />
Im Referat Qualifizierung und Sicherheit<br />
standen in den vergangenen Wochen die<br />
Überarbeitung bestehender und die Erstellung<br />
neuer Lehrpläne auf Basis der TRAS<br />
120 und die Organisation weiterer Qualifizierungen<br />
für zur Prüfung befähigte Personen<br />
im Vordergrund. Des Weiteren wurde<br />
intensiv an verschiedenen Arbeitshilfen<br />
gearbeitet, unter anderem zur arbeitsmedizinischen<br />
Prävention.<br />
Nachruf<br />
Der Fachverband Biogas e.V. trauert mit großer Betroffenheit um<br />
den Branchenexperten Ulrich Keymer, der an Silvester plötzlich und<br />
unerwartet im Alter von 63 Jahren verstarb. Der Diplom-Agraringenieur<br />
war nach einigen Stationen im öffentlichen Dienst seit 1995 an der<br />
Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in der Ökonomie für<br />
Erneuerbare Energien tätig. Sein ökonomischer Sachverstand, seine<br />
prägnante Art, diesen zu präsentieren und seine Leidenschaft für<br />
Biogas haben ihn im gesamten deutschsprachigen Raum als Biogasexperten<br />
bekannt gemacht.<br />
Seine Einschätzung und sein Rat waren auf vielen Ebenen – so auch<br />
im Fachverband Biogas – oft gefragt. Er war nicht nur Berater der<br />
Biogasproduzenten, sondern auch Autor vieler Fachartikel und Referent<br />
auf zahlreichen Veranstaltungen, so auch während verschiedener<br />
Jahrestagungen des Fachverbandes, die er regelmäßig mit seinen<br />
Vorträgen bereichert hat. Mit Ulrich Keymer verliert die Biogasfamilie in<br />
Deutschland ein engagiertes und charismatisches Mitglied.<br />
Seit Februar 2016 bis zu seinem Tod leitete Herr Keymer das Institut für<br />
Betriebswirtschaft und Agrarstruktur an der Bayerischen Landesanstalt<br />
für Landwirtschaft (LfL). Das boomende Thema Biogas war immer seine<br />
besondere Passion. Weichenstellungen in Politik und Gesellschaft und<br />
deren Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Unternehmen, die<br />
Flächennutzung und die Strukturentwicklung insgesamt waren Themen,<br />
die der LfL-Experte mit umfassenden Analysen und Modellrechnungen<br />
mitgestaltete.<br />
Wir werden seine Expertise, aber auch den Menschen Ulrich Keymer<br />
vermissen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.<br />
Horst Seide<br />
Präsident des<br />
Fachverbandes Biogas e.V.<br />
Dr. Claudius da Costa Gomez<br />
Hauptgeschäftsführer des<br />
Fachverbandes Biogas e.V.<br />
Viele Veranstaltungen zu<br />
Beginn des Jahres<br />
Kurz nach dem Jahreswechsel am 3. und<br />
4. Januar startete das Referat Veranstaltungen<br />
mit den Biogastagen Bad Waldsee in<br />
das neue Veranstaltungsjahr. Im Rahmen<br />
des Kongresses „Kraftstoffe der Zukunft“ in<br />
Berlin konnte der Fachverband das Thema<br />
„Biomethan“ den über 600 Teilnehmern<br />
aus aller Welt vorstellen. Mit einem Ausstellungsstand<br />
auf den Biogasinfotagen in<br />
Ulm und mit dem mit fast 50 Teilnehmern<br />
sehr gut gebuchten EEG-Zukunftsworkshop<br />
war der Januar gut gefüllt.<br />
Im Februar folgten zwei Fachgespräche<br />
zur TRAS 120, die innerhalb kürzester Zeit<br />
ausgebucht waren, ein Seminar zum Transport<br />
von Biomasse, die Unterstützung der<br />
Organisation des Gründungsfestes des<br />
LEE Bayern, die erstmalige Kooperation<br />
bei der Bayerischen Biogasfachtagung<br />
Stroh, Gas – Biogas in Dingol fing sowie<br />
die Organisation der diesjährigen Kuratoriumssitzung.<br />
Ein besonderes Highlight setzte<br />
die Filmvorführung des Unterrichtsfilms<br />
Erneuerbare Energien<br />
mit Georg Hackl in einem<br />
Kino vor Münchner Lehrern mit<br />
Unterstützung der anderen Verbände<br />
der Erneuerbaren Energien,<br />
hier konnten sich Lehrer<br />
Informationen aus erster Hand<br />
holen. Darüber hinaus standen<br />
die Vorbereitungen zur Abfallvergärungstagung<br />
vom 11. bis 13.<br />
März im Mittelpunkt der Tätigkeiten<br />
des Referats Veranstaltungen.<br />
Die Tagung wird erstmalig<br />
gemeinsam mit der TU Dresden<br />
organisiert.<br />
Erfolgreicher Kongress<br />
„Kraftstoffe der Zukunft“<br />
Das Leitthema für die Stabsstelle<br />
Kraftstoff und Biomethan Anfang<br />
dieses Jahres war die Vorbereitung<br />
für den 16. Internationalen<br />
Fachkongress „Kraftstoffe der<br />
Zukunft“, der am 21. und 22. Januar<br />
in Berlin über 600 Experten<br />
versammelte. Alexey Mozgovoy,<br />
Leiter der Stabsstelle, vertrat dabei<br />
die Geschäftsstelle im Kongressbeirat<br />
und gestaltete neben<br />
den anderen Ko-Veranstaltern<br />
das Kongressprogramm.<br />
Mit dem Impulsvortrag zur neuen Erneuerbare-Energien-Richtlinie<br />
(RED II) eröffnete<br />
der Fachverbandspräsident Horst Seide<br />
die Vortragsreihe. Dem folgten Berichte<br />
über aktuelle Industrie- und F&E-Projekte<br />
aus Deutschland und Europa sowie auch<br />
Vorträge zum politischen Rahmen bezüglich<br />
der Nutzung von Biomethan im Kraftstoffsektor<br />
in ausgewählten Regionen Europas.<br />
Die Stimmung im Forum war positiv<br />
und es kam sehr schnell zu einem intensiven<br />
und offenen Fachaustausch.<br />
44. BImSCHV verzögert sich<br />
Das nach der Beschlussfassung des Bundesrates<br />
am 14. Dezember 2018 für Januar<br />
erwartete Inkrafttreten der 44. Bundes-<br />
Immissionsschutzverordnung (BImSchV)<br />
verzögert sich. Die Bundesregierung beziehungsweise<br />
die am Verordnungsgebungsprozess<br />
beteiligten Ministerien haben den<br />
Änderungen im Bundesrat nicht zugestimmt.<br />
Es ist davon auszugehen, dass ein<br />
neuer Entwurf der 44. BImSchV zeitnah er-<br />
78
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Verband<br />
neut durch den Bundestag und Bundesrat<br />
gehen wird. Für die mit der 44. BImSchV<br />
befassten Referate Genehmigung beziehungsweise<br />
Hersteller und Technik ergibt<br />
sich gegebenenfalls nochmals die Möglichkeit,<br />
notwendige Änderungen und fehlende<br />
Verweise in der Verordnung einzubringen.<br />
Um die Überwachungsmethoden<br />
zu den in der 44. BImSchV definierten<br />
Emissionsgrenzwerten weiter zu konkretisieren,<br />
hat der VDMA einen Entwurf eines<br />
Einheitsblattes VDMA 6299 zur Stellungnahme<br />
veröffentlicht.<br />
Der Fachverband begleitet die Erstellung<br />
des Einheitsblattes und wird insbesondere<br />
bei der Ver- und Entplombung der Katalysatoren<br />
bei BImSchG-Anlagen nur durch<br />
zugelassene Messinstitute Einspruch<br />
einlegen. Weiterhin beschäftigt sich das<br />
Referat mit dem Entwurf der Technischen<br />
Regel wassergefährdende Stoffe – allgemeine<br />
technische Regelungen TRwS 779.<br />
Dieses Regelwerk beschreibt Anforderungen,<br />
die sich an Biogasanlagen richten<br />
werden, die nicht ausschließlich Gärsubstrate<br />
landwirtschaftlicher Herkunft einsetzen.<br />
Hierzu wird eine Stellungnahme<br />
erarbeitet. Ebenso wird auch zum Entwurf<br />
des nationalen Luftreinhalteprogramms<br />
Stellung genommen werden.<br />
Internationale Aktivitäten<br />
Die Kammer- und Verbandspartnerschaft<br />
zwischen dem Fachverband Biogas und<br />
dem indischen Biogasverband (IBA) ist in<br />
die zweite Phase gestartet. Zunächst findet<br />
in Indien ein Feinplanungsworkshop statt,<br />
um eine detaillierte Planung der Aktivitäten<br />
gemeinsam mit IBA durchzuführen.<br />
Der Einsatz von Markus Fürst als EZ-Scout<br />
beim Fachverband endet Mitte März. Wir<br />
sind derzeit in Gesprächen mit der GIZ, um<br />
eine Nachfolge zu organisieren.<br />
Sehr intensiv eingebunden ist das Referat<br />
International auch bei der Neuordnung<br />
des EU-Strommarktes. Am 18. Januar hat<br />
der Europäische Rat den ausgehandelten<br />
Kompromiss für eine Neuordnung des<br />
europäischen Strommarkts bestätigt. Die<br />
europäische Strommarktrichtlinie sowie<br />
die europäische Strommarktverordnung<br />
sind damit ihrer Verabschiedung einen<br />
entscheidenden Schritt näher gekommen.<br />
Im März wird das EU-Parlament über die<br />
beiden Gesetze abstimmen. Der EU-Rat<br />
gibt dann seine finale Zustimmung und<br />
20 Tage nach Veröffentlichung im öffentlichen<br />
Amtsblatt der EU wird die Strommarktverordnung<br />
unmittelbar in allen EU-<br />
Ländern gelten.<br />
Veranstaltungen der<br />
Service GmbH<br />
Im Januar und Februar fanden drei Veranstaltungen<br />
der Fachverband Biogas Service<br />
GmbH statt. Am 22. und 24. Januar<br />
fanden in Verden und Weichering EEG-Zukunftsworkshops<br />
statt. Hier konnten sich<br />
die über 70 Teilnehmer unter anderem<br />
über die Anforderungen des EEG 2017,<br />
Flexibilisierungsoptionen und Möglichkeiten<br />
des Wechsels in die Güllekleinanlagenklasse<br />
informieren. Dabei stand der<br />
intensive Austausch mit den Referenten<br />
im Vordergrund, sodass die Möglichkeit<br />
bestand, betriebsindividuelle Fragen in<br />
die Diskussion einzubringen.<br />
Weiterhin wurde am 13. Februar ein Biomassetransportseminar<br />
angeboten. Hier<br />
konnten sich interessierte Betreiber, Landwirte<br />
und Lohnunternehmer bezüglich des<br />
aktuellen Rechtsrahmens beim Transport<br />
von Substraten und Gärprodukten, steuerlichen<br />
Anforderungen und vertraglichen<br />
Gestaltungsoptionen fortbilden. Abgerundet<br />
wurde das Programm durch die ökonomische<br />
Bewertung einzelner Logistikkonzepte,<br />
sodass die Auswirkungen auf<br />
die Praxis anschaulich dargestellt werden<br />
konnten.<br />
Autoren<br />
Dr. Stefan Rauh<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Geschäftsführer<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 · 85356 Freising<br />
0 81 61/98 46 60<br />
info@biogas.org<br />
79
Verband<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Regionalgruppe Schwarzwald<br />
Biogas hat eine Zukunft nur mit sauberen,<br />
effizienten und sicheren Biogasanlagen!<br />
Foto: Christa Maier<br />
Der erste Fachberater<br />
Biogas im Landkreis<br />
Breisgau-Hochschwarzwald:<br />
Wolfram Wiggert<br />
(Mitte) vom Haslachhof<br />
in Löffingen, hier beim<br />
Pressetermin mit<br />
(von rechts) Bernhard<br />
Schwörer, Gesamtkommandant<br />
Löffingen,<br />
Gotthard Benitz,<br />
stellvertretender Kreisbrandmeister<br />
Breisgau-<br />
Hochschwarzwald, Toni<br />
Baumann und Otto<br />
Körner.<br />
Das jüngste Regionalgruppentreffen stand<br />
unter dem Motto „Sicherheit für Mensch<br />
und Umwelt“. Referent Toni Baumann, seit<br />
über 18 Jahren Sachverständiger für Biogasanlagen<br />
bei Gericht, den Betreibern und<br />
Versicherungen berichtete über Neues aus der TRAS<br />
120, wobei geschätzte 75 Prozent der Inhalte bereits in<br />
der bisherigen Ti4 enthalten sind. Es handelt sich also<br />
um ein Umsetzungsdefizit!<br />
Dem Grundsatz nach gelten die Regelungen für BIm-<br />
SchG-pflichtige BGA, eine sinngemäße Anwendung<br />
wird aber auch für kleinere BGA empfohlen. In Baden-<br />
Württemberg hat die Schulung der Gewerbeaufsichtsämter<br />
der Landkreise bereits stattgefunden. Jetzt steht<br />
die Umsetzung in einen ministeriellen Erlass oder eine<br />
vergleichbare Ausführungsanordnung an, mit der im<br />
Sommer gerechnet werden kann.<br />
Darauf zu warten, wäre aber nicht richtig: Stattdessen<br />
sollte an der Umsetzung der Ti4 auf der eigenen Anlage<br />
weiter gearbeitet werden. Beispiel 1 aus Baden-<br />
Württemberg: Temperaturüberhitzung trotz kaltem<br />
Dezember im BHKW-Schaltschrank führte zu Feuer,<br />
das auf eine benachbarte Hackschnitzeltrocknung, ein<br />
Strohlager und den Fermenter übergriff und insgesamt<br />
1,8 Millionen Euro Schaden verursachte. Einfache Verhinderung<br />
durch Temperaturkontrolle wäre möglich gewesen.<br />
Auch lose und gelockerte Kabel können solche<br />
Schäden verursachen!<br />
Beispiel 2: Ein von innen korrodierter Fermenter sackt<br />
in sich zusammen. Es laufen über 400 Kubikmeter Inhalt<br />
aus. Nachbarn helfen mit einer Kette aus Saugfässern<br />
und verhindern eine Verschmutzung der Donau<br />
in Nachbarschaftshilfe. Tolle Hilfestellung, aber zwingend<br />
ist hier die erforderliche Umwallung – gerade in<br />
umweltsensibler Umgebung.<br />
Aufruf: Wir brauchen mehr Fachberater<br />
in den Freiwilligen Feuerwehren!<br />
„Sie sind die qualifizierten Unterstützer der Feuerwehren,<br />
wenn es denn zum Einsatz kommt. Und sie sollten<br />
aus den Reihen der Anlagenbetreiber kommen – das<br />
wäre ideal, denn sie haben die höchste Kompetenz“,<br />
erläuterte der „spätberufene“ Feuerwehrmann Toni<br />
Baumann, selbst Fachberater in mehreren Landkreisen<br />
Südwürttembergs. Er schult auf Anfrage gerne Feuerwehren<br />
im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen –<br />
zuerst theoretisch (indoor) und dann praktisch an der<br />
Biogasanlage selbst.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. RU Otto Körner<br />
Regionalreferent Süd<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Gumppstr. 15 · 78199 Bräunlingen<br />
07 71/18 59 98 44<br />
otto.koerner@biogas.org<br />
80
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Verband<br />
Regionalgruppe Niederbayern<br />
47. Biogasstammtisch<br />
thematisierte Ausschreibungen,<br />
EEG-Änderungen<br />
und Elektromobilität<br />
Am Mittwoch, den 12. Dezember<br />
2018 fand in Rottersdorf<br />
bei Landau an der Isar der inzwischen<br />
47. Stammtisch der<br />
Regionalgruppe Niederbayern<br />
des Fachverbandes Biogas e.V. statt. Die<br />
Anlagenbetreiber konnten sich über die<br />
Ergebnisse und Schlussfolgerungen der<br />
zweiten Ausschreibung im Rahmen des<br />
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) informieren.<br />
Anschließend diskutierten die<br />
Teilnehmer mit Hubert Maierhofer von<br />
C.A.R.M.E.N. e.V. über die Elektromobilität<br />
in der Landwirtschaft, deren Möglichkeiten<br />
und Grenzen.<br />
Nach einer kurzen Begrüßung durch den<br />
Regionalgruppensprecher Franz Winkler informierte<br />
Dr. Stefan Rauh, Geschäftsführer<br />
des Fachverbandes Biogas e.V., über die Ergebnisse<br />
der zweiten EEG-Ausschreibung,<br />
bei der insgesamt 79 Biomasseanlagen<br />
einen Zuschlag erhalten haben. Das ausgeschriebene<br />
Volumen sei aber nur zu knapp<br />
40 Prozent ausgeschöpft worden, so Rauh.<br />
Der Fachverband fordere daher eine Überarbeitung<br />
des Ausschreibungsdesigns. Die<br />
Notwendigkeit sei nach einer Befragung<br />
der teilgenommenen Mitglieder bestätigt<br />
worden, da der Höchstgebotswert in vielen<br />
Fällen zu knapp sei, um eine Anlage wirtschaftlich<br />
zu betreiben.<br />
Ein weiteres Thema des Vortrags war das<br />
Energiesammelgesetz, das Ende November<br />
im Bundestag verabschiedet wurde.<br />
Darin wurden verschiedene Änderungen im<br />
EEG vorgenommen, zum Beispiel die Weiterentwicklung<br />
des Flexdeckels sowie des<br />
Ausschreibungsregimes oder Sonderausschreibungen<br />
für Wind und Photovoltaik.<br />
So werde es im Jahr <strong>2019</strong> für Biomasseanlagen<br />
zwei EEG-Ausschreibungen geben,<br />
am 1. April sowie am 1. November.<br />
Rauh betrachtete auch die Entwicklung<br />
des Flexdeckels. Ist das vorgegebene Volumen<br />
ausgeschöpft, können Betreiber die<br />
Flexibilitätsprämie nicht mehr in Anspruch<br />
nehmen. Mit der Flexibilisierung können<br />
Anlagen bedarfsgerecht und netzdienlich<br />
Strom erzeugen, was durch eine Prämie<br />
gefördert wird. Bis Oktober 2018 wurden<br />
792 Megawatt (MW) ausgeschöpft, dies<br />
seien 59 Prozent der Gesamtmenge von<br />
1.350 MW.<br />
Der im Rahmen des Energiesammelgesetzes<br />
auf 1.000 MW abgesenkte Deckel werde<br />
zwar schon früher erreicht, dafür habe<br />
man dann aber noch 16 Monate Zeit, die<br />
Prämie in beliebiger Höhe zu beanspruchen.<br />
Rauh gab den Betreibern in diesem<br />
Zusammenhang den Rat, bis Oktober<br />
2020 mit Projekten im Rahmen der Flexibilisierung<br />
fertig zu sein, um langfristig<br />
auch an Ausschreibungen erfolgreich teilzunehmen<br />
und so weiterhin eine Förderung<br />
zu erhalten.<br />
Hubert Maierhofer von C.A.R.M.E.N. e.V.<br />
sprach im zweiten Teil des Abends über die<br />
Elektromobilität und beleuchtete insbesondere<br />
die Möglichkeiten, die sich dem landwirtschaftlichen<br />
Betrieb bieten. Er stellte<br />
zahlreiche Fahrzeuge sowie Beispiele für<br />
die Nutzung vor und beantwortete allgemeine<br />
Fragen der Betreiber. In der Landwirtschaft<br />
könne durch die Einbindung<br />
einer PV-Anlage der Eigenstrom für die Mobilität<br />
genutzt werden. Denn: „Ein Elektro-<br />
Antrieb ist nur mit Erneuerbaren Energien<br />
sauber“, so Maierhofer.<br />
Text: C.A.R.M.E.N. e.V.<br />
Wir sorgen für sauberes Gas!<br />
Wir bieten mit der Donau Bellamethan Produktfamilie eine umfassende Lösung zur Grobentschwefelung an. Zusätzlich wird<br />
der Ammoniakgehalt verringert und die enthaltenen Spurenelemente gewährleisten eine Grundversorgung der Biologie.<br />
Donau Bellamethan – ein Qualitätsprodukt!<br />
» Verlässliche H 2<br />
S-Entfernung direkt im Substrat<br />
» freigegeben für den ökologischen Landbau,<br />
Eigenherstellung<br />
» langjährige Erfahrung und weitläufige Verbreitung<br />
» Geringe Einsatzmengen durch hochwertiges<br />
Eisen-II-chlorid mit 2,5 mol/kg Wirksubstanz<br />
» Lieferung auch in einzelnen IBC – Container möglich<br />
www.dcwatertech.com<br />
Ihr Donau Chemie Partner:<br />
Biogasberatung Sepp Lausch<br />
Petzenbichl 1<br />
83109 Tattenhausen<br />
Tel. 01 71 / 5 85 93 23<br />
www.biogasberater.com<br />
Betreiberschulung nach TRGS 529, Anmeldung auf unserer Website.<br />
DC_Inserat_LAUSCH_177x77_RZ.indd 1 29.11.18 15:31<br />
81
Verband<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Gesunder und<br />
ertragreicher Bestand<br />
eines Wintererbsen-<br />
Roggen-Gemenges.<br />
Foto: Wolfram Wiggert<br />
Regionalgruppe Schwarzwald<br />
Ergänzung, kein Mais-Ersatz:<br />
alternative Energiepflanzen<br />
Für das Winterprogramm hatten sich die<br />
Kreissprecher der Regionalgruppe Schwarzwald<br />
unter anderem vorgenommen, einen<br />
Erfahrungsaustausch zu den alternativen<br />
Energiepflanzen abzuhalten. Dazu kamen<br />
Anfang Januar über 30 Interessierte zusammen. Und<br />
sie wurden nicht enttäuscht: Philipp Ewald berichtete<br />
über seine vor- und nachteiligen Erfahrungen beim<br />
Einsatz von Zuckerrüben in seiner stark flexibilisierten<br />
Biogasanlage, wobei das Positive für seine Biogasanlage<br />
überwiegt und er auf eine aus seiner Sicht optimale<br />
15-Prozent-Quote der Rübe am Input hinarbeitet bei<br />
eigenem Anbau.<br />
Markus Traber schätzt die Kultur ebenfalls positiv ein<br />
mit seiner Zukauf-Lösung, Verfütterung in der Tierhaltung<br />
und dem Einsatz in der Biogasanlage (siehe<br />
Biogas Journal 1_<strong>2019</strong>, Seite 96). Er hatte außerdem<br />
mit der Wildpflanzenmischung von Saaten-Zeller, der<br />
zurzeit einzigen umfassend wissenschaftlich geprüften<br />
ihrer Art, in der Bioenergieregion Bodensee mehrjährige<br />
Erfahrungen sammeln können. Er geht von einem<br />
50-Prozent-Ertragsniveau im Vergleich zum Mais-Biogasertrag<br />
pro Hektar aus und ist deshalb ausgestiegen.<br />
Auf mit Steinen durchsetzten Böden hat Steffen Benne<br />
die Durchwachsene Silphie als Mais-Untersaat am Albtrauf<br />
der Schwäbischen Alb anbauen lassen. Sein Fazit:<br />
Als umweltfreundliche Kultur an landbaulich weniger<br />
interessanten Standorten zur Abdeckung der Greening-<br />
Pflicht ist sie empfehlenswert. Auch in Kooperation<br />
mit Imkern und Jägern ist die von Wildschweinen verschmähte,<br />
aber sehr schön blühende Kultur ein Gewinn<br />
für Artenvielfalt und für landschaftliche Ästhetik.<br />
Für alle mehrjährigen Kulturen ist noch besonders hervorzuheben<br />
der gute Erosionsschutz der Böden und der<br />
für unser Lebensmittel Nr. 1 – das Trinkwasser – herausragende<br />
Schutz vor unerwünschten Einträgen: die<br />
Nmin-Gehalte dieser Ackerstandorte entsprechen denen<br />
unter Grünland! Es schloss sich eine sehr lebhafte,<br />
auf hohem Niveau geführte Landbau-Diskussion an mit<br />
dem Wunsch, mehr Erfahrungsberichte aus der Betreiberschaft<br />
vorzustellen. Wenn auch zum Teil noch nicht<br />
überall verbreitet – die Technik für Anbau und Ernte ist<br />
für alle alternativen Kulturen vorhanden.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. RU Otto Körner<br />
Regionalreferent Süd<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Gumppstr. 15 · 78199 Bräunlingen<br />
07 71/18 59 98 44<br />
otto.koerner@biogas.org<br />
82
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Verband<br />
Mathias Waschka<br />
Beratung und Vertrieb<br />
für landwirtschaftliche Erzeugnisse<br />
Trocknungstechnik bis 1,5 MW<br />
Mobil schallged. Varianten<br />
bis 500 kW 45 dB(A)<br />
Schubboden-Trocknungscontainer<br />
Umwelt – Energie – Sicherheit<br />
Sie brauchen eine Prüfung:<br />
- durch eine befähigte Person nach BetrSichV §15 bzw §16<br />
- durch einen Sachverständigen nach BImSchG §29a<br />
- oder Sie brauchen eine Sicherheitsfachberatung<br />
Tel.<br />
Fax<br />
Mobil<br />
mw@m-waschka.de<br />
www.m-waschka.de<br />
04482 - 908 911<br />
04482 - 908 912<br />
0151 - 23510337<br />
Wenden Sie sich an die Ingenieurgruppe RUK GmbH. Prof. Dr. Rettenberger<br />
(ReSyMeSa) und weitere Mitarbeiter verfügen über Kompetenz und Erfahrung<br />
aus zahlreichen Prüfungen und der Mitarbeit an Regelwerken. Wir werden uns<br />
umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.<br />
Ingenieurgruppe RUK GmbH, Auf dem Haigst 21, 70597 Stuttgart<br />
Tel. +49 711 90 6780, info@ruk-online.de www.ruk-online.de<br />
Intensiv.<br />
Aktiv.<br />
Mitgestalten.<br />
Werden<br />
Sie<br />
Mitglied!<br />
Als Mitglied im Fachverband Biogas werden Sie Teil einer Interessen vertretung, die<br />
aktiv Einfl uss nimmt. Auf Gesetze und Verordnungen. Auf Länderebene und im Bund.<br />
Wir sind ansprechbar, hören zu, machen uns stark!<br />
Seien Sie dabei!<br />
www.biogas.org<br />
Zusammen.<br />
Stark.<br />
Einfl uss nehmen.<br />
Dem Klimaschutz verpflichtet.<br />
Engagiert. Aktiv. Vor Ort.<br />
Gesagt.<br />
Getan.<br />
Viel erreicht.<br />
83
Verband<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
LEE-Energietalk in Papenburg<br />
Regional<br />
büro<br />
NORD<br />
Der Landesverband Erneuerbare<br />
Energien Niedersachsen-Bremen<br />
e.V.<br />
hat sich zum Ziel gesetzt,<br />
die gemeinsame politische<br />
Kommunikation der<br />
Erneuerbaren Energien zu<br />
forcieren. Dazu wurde das Format Energietalk<br />
entwickelt, wo politische Themen<br />
mit Stakeholdern einer Region und dem<br />
regionalen Minister besprochen werden.<br />
Der erste Aufschlag fand in Papenburg mit<br />
dem niedersächsischen Energieminister<br />
Olaf Lies statt. Kooperationspartner war<br />
das Oldenburger Energiecluster, das schon<br />
seit Jahren energiepolitische Innovationen<br />
unterstützt. Lies betonte, dass die Energiewende<br />
unumkehrbar sei und die Innovationen<br />
der Branche von ihm unterstützt<br />
würden.<br />
Wilhelm Pieper, Vorsitzender des LEE,<br />
mahnte, dass es nicht nur bei Lippenbekenntnissen<br />
bleiben dürfe, sondern auch<br />
die konkrete Umsetzung auf allen Ebenen<br />
forciert werden müsste. „Genehmigungen<br />
für Windenergieanlagen dauern Jahre,<br />
die regionalen Raumordnungsprogramme<br />
dampfen die ohnehin zu geringen Ausbauflächen<br />
ein und die Bioenergie hat mit ständig<br />
neuen und unklaren Auflagen zu kämpfen.<br />
Sektorkopplung ist in der Umsetzung<br />
noch gar nicht im Fokus“, bemängelte er<br />
sehr deutlich. Der Minister bot ausdrücklich<br />
den Dialog an.<br />
In den Vorträgen wurden energiepolitische<br />
Themen der maritimen Wirtschaft durch<br />
die Meyer Werft angesprochen und Christoph<br />
Pieper von Agrowea stellte das Projekt<br />
der Versorgung der Stadt Haaren durch Verstetigung<br />
von Windkraft vor.<br />
Das Thema Güllevergärung stellte der<br />
stellvertretende Betreibersprecher aus<br />
Weser-Ems, Jens Geveke, vor. Er betreibt<br />
selbst eine Anlage, die überwiegend Mist<br />
vergärt, und erläuterte die Chancen der<br />
Güllevergärung und die Bedeutung als<br />
Dienstleistung für die Landwirtschaft. Er<br />
machte aber auch deutlich, dass auch hier<br />
klare Regelungen benötigt werden. „Ohne<br />
eine Gleichstellung externer Gärrestlager<br />
mit Güllelagern wird es keine Ausweitung<br />
der Güllevergärung geben“, stellte er fest.<br />
Eine Finanzierung könnte sich ohne weiteres<br />
über eine vernünftige CO 2<br />
-Bepreisung<br />
rechnen. „Hier müssen jetzt Entscheidungen<br />
getroffen werden“, gab er dem Minister<br />
mit auf den Weg.<br />
Autorin<br />
Dipl.-Ing. agr. Silke Weyberg<br />
Regionalbüro Nord im LEE Niedersachsen-Bremen e.V.<br />
Herrenstraße 6 · 30159 Hannover<br />
0 51 28/333 55 10<br />
05 11/89 85 86-194<br />
silke.weyberg@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
MAIS-HERBIZIDE <strong>2019</strong><br />
Stark und flexibel für<br />
ungestörtes Wachstum<br />
• Gegen Unkräuter und Hühnerhirse<br />
• Hervorragende Mischbarkeit<br />
• Verträglich in Grasuntersaaten<br />
• Flexibilität durch Splitting<br />
• Unverzichtbar gegen Kartoffeldurchwuchs<br />
• Wirkstoff: 100 g/l Mesotrione<br />
Der Primus gegen Ungräser<br />
und Co.<br />
• Optimierte OD-Formulierung für<br />
beste Verträglichkeit<br />
• Schnelle Wirkungsweise<br />
• Hervorragende Mischbarkeit<br />
• Außergewöhnliche Lagerstabilität<br />
• Wirkstoff: 40 g/l Nicosulfuron<br />
Stark gegen schwer<br />
bekämpfbare Unkräuter<br />
• Der Standard zur Bekämpfung<br />
von Problemunkräutern im Nachauflauf<br />
• Überzeugende Ergebnisse u.a<br />
gegen Wurzelunkräuter wie<br />
Windearten und Landwasserknöterich<br />
• Wirkstoff: 700g/kg Dicamba<br />
Produkte im Baukastenprinzip –<br />
Situationsbedingt kombinieren<br />
Rotam Maisherbizide – Guter Start für den Mais<br />
• Hervorragende Verträglichkeit<br />
• Nachhaltige Wirkung<br />
• Volle Flexibilität bei der Wahl der Mischpartner<br />
ROTAM Germany GmbH | 30159 Hannover | Tel. +49 511 93639469 | germany@rotam.com | www.rotam.com/germany<br />
Rotam_175x118mm_Biogas-Journal.indd 1 12.02.<strong>2019</strong> 14:23:48<br />
84
„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist sie zu gestalten.“ (Willy Brandt)<br />
www.biogas.org // www.schulungsverbund-biogas.de // www.biogas-convention.com<br />
– 1 –<br />
1<br />
Materialien für Ihre<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Sie planen ein Hoffest, bekommen eine Schulklasse<br />
zu Besuch oder werden zum Wärmelieferanten?!<br />
Der Fachverband bietet Ihnen für (fast) jede Gelegenheit<br />
die passenden Materialien.<br />
Immer wenn<br />
wir Energie brauchen,<br />
kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht,<br />
bei Wind und Wetter.<br />
Regional. Verlässlich.<br />
Klimafreundlich.<br />
Shop<br />
Fachverbands-Flyer<br />
Der Fachverband Biogas e.V. stellt sich vor<br />
DIN lang-Format, 6 Seiten<br />
Bestellnr.: KL-001<br />
für Mitglieder kostenlos<br />
Tel. 030 2758179-0<br />
Fax 030 2758179-29<br />
berlin@biogas.org<br />
Hauptstadtbüro<br />
Invalidenstr. 91<br />
10115 Berlin<br />
Dem Klimaschutz verpflichtet.<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstraße 12<br />
85356 Freising<br />
Tel. 08161 984660<br />
Fax 08161 984670<br />
info@biogas.org<br />
Engagiert. Aktiv. Vor Ort.<br />
Für Betreiber.<br />
Wissenschaftler.<br />
Hersteller.<br />
Institutionen.<br />
Interessierte.<br />
Biogas Journal<br />
Sonderhefte<br />
Die aktuellen Hefte finden Sie<br />
auf der Homepage (www.biogas.org)<br />
DIN A4-Format<br />
Bestellnr.: BVK-14<br />
Preis auf Anfrage<br />
Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 5 073 | 18. Jahrgang<br />
www.biogas.org März 2015<br />
Bi GaS Journal<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche<br />
Flexbetrieb: eine ökonomische<br />
Analyse S. 10 an den Fahrplanbetrieb S.<br />
Gasspeicher: Anforderungen<br />
30<br />
www.biogas.org Februar 2016<br />
Bi GaS Journal<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche<br />
Neue TRGS 529<br />
ernst nehmen S. 12<br />
SondeRheFt<br />
Stadtwerke Rosenheim bilden<br />
Kleinanlagenpool S. 65<br />
Direkt vermarktung<br />
BHKW<br />
Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 5 073 | 19. Jahrgang<br />
Sicherheitsrelevante<br />
dokumentationspflichten S. 24<br />
d<br />
SoNdeRheFT<br />
www.biogas.org April 2016<br />
Bi gAS Journal<br />
Statements zum einsatz<br />
von Prozesshilfsstoffen S. 38<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche<br />
Wildpflanzen: verbesserte<br />
Saatmischungen S. 6<br />
!<br />
SICHERHEIT<br />
Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 5 073 | 19. Jahrgang<br />
neues vom Mais-Silphie-<br />
Mischanbau S. 19<br />
BGJ Anlagensicherheit BUCH 2016.indd 1 25.01.16 12:10<br />
SonderheFt<br />
Sommersubstrat: Buchweizen<br />
und Quinoa S. 24<br />
EnErgiEpFlAnzEn<br />
BGJ Energiepflanzen 2016 BUCH.in d 1 18.03.16 14:36<br />
Broschüre<br />
Biogas-Wissen<br />
Grundlegende Informationen rund um<br />
die Biogasnutzung in Deutschland<br />
Biogas<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
Broschüren<br />
Die Biogas Know-how-Serie –<br />
auch online verfügbar<br />
DIN A5-Format, 28 Seiten<br />
Bestellnr.: BVK-23 (deutsch)<br />
bis zu 20 Ex. kostenlos<br />
darüber 50 Cent / Broschüre<br />
Biowaste<br />
to Biogas<br />
BIOGAS<br />
Safety first!<br />
Guidelines for the safe use<br />
of biogas technology<br />
Biogas to<br />
Biomethane<br />
Düngen mit<br />
Gärprodukten<br />
BIOGAS Wissen_Kompakt<br />
Aufkleber für Ihre Braune Tonne<br />
21 x 10 cm<br />
Bestellnr.: KL-020<br />
5 Stück kostenlos –<br />
bei größerer Menge<br />
bitte nachfragen<br />
Fachverband_Biotonnenaufkleber_RZ.pdf 3 03.05.16 13:43<br />
Vielen Dank, dass Sie trennen!*<br />
1kg Bioabfall Biogasanlage Dünger<br />
*Aus einem Kilogramm Bioabfä len produziert eine Biogasanlage 240 Wh Strom.<br />
Je weniger Plastik in der Biotonne landet, desto sauberer der Dünger und desto höher die Energieausbeute!<br />
6h Strom<br />
www.biogas.org<br />
BIOGAS Know-how_1<br />
DIN A4-Format,<br />
68 Seiten<br />
Best.Nr.: KL-021<br />
(englisch)<br />
BIOGAS Know-how_2<br />
DIN A4-Format,<br />
68 Seiten<br />
Best.Nr.: KL-024<br />
(englisch)<br />
DIN A4-Format,<br />
68 Seiten<br />
Best.Nr.: KL-018<br />
(englisch)<br />
ein Heft kostenlos<br />
bei mehreren Heften berechnen wir Versand und Verpackung<br />
BIOGAS Know-how_3<br />
BIOGAS Wissen_2<br />
DIN A4-Format,<br />
68 Seiten<br />
Best.Nr.: KL-025<br />
(deutsch)<br />
verzichten freiwillig auf einen Teil ihres Gasertrages und setzen<br />
ie einen ökologischen Mehrwert für Mensch und Natur haben.<br />
„Die Biogasnutzung bietet die Möglichkeit,<br />
unterschiedlichste Pflanzen sinnvoll anzubauen<br />
und damit einerseits den Boden und das<br />
Grundwasser zu schützen und andererseits die<br />
Artenvielfalt auf den Feldern zu erhöhen.<br />
Das sieht nicht nur schön aus – es ist auch<br />
ein wichtiger Beitrag für den dringend<br />
notwendigen Schutz unserer Insekten.“<br />
Peter Maske, Präsident Deutscher Imkerbund e.V.<br />
Über gezielte Agrar-Fördermaßnahmen könnte<br />
Biogas einen wichtigen Beitrag für die Artenvielfalt<br />
leisten.<br />
Eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden<br />
Alternativen Energiepflanzen bietet die Seite<br />
www.farbe-ins-feld.de<br />
Faltblatt<br />
- - - - - - 116 mm - - - - - - - - - - - > < - - - - - - - - - - - 118 mm - - - - - - - - - - - >< - - - - - - - - - - - 118 mm - - - - - - - - - - - > < - - - - - - - - - - - 116 mm - - - - - - - - - - - ><br />
tenreich<br />
Biogas ist bunt ...<br />
Biogas to go<br />
Der Fachverband Biogas e.V. ist mit über<br />
4.700 Mitgliedern die größte deutsche und<br />
europäische Interessenvertretung der<br />
Biogas-Branche.<br />
Ziel der Verbandsarbeit ist es, die Biogaserzeugung<br />
und -nutzung für die bundesweite<br />
Strom-, Wärme- und Kraftstoffversorgung zu<br />
erhalten und auszubauen<br />
Handliche Fakten zur<br />
Biogasnutzung<br />
11,8 x 11 cm<br />
Bestellnr.: BVK-37<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12<br />
85356 Freising<br />
A +49 (0)8161 984 660<br />
m info@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
bis zu 20 Ex. kostenlos<br />
darüber 50 Cent / Heft<br />
Wissen_to go<br />
BIOGAS<br />
Artenvielfalt<br />
mit Biogas<br />
Handliche Fakten<br />
zur Biogasnutzung<br />
DVD<br />
Biogas entsteht durch die Vergärung biogener Stoffe in einem luftdicht abgeschlossenen<br />
Behälter, dem sogenannten Fermenter. Vergoren werden kann fast alles,<br />
was biologischen Ursprungs ist: Gülle und Mist, Bioabfälle - oder Energiepflanzen.<br />
Letztere werden von den Landwirten extra angebaut. Ende 2017 wuchsen auf gut<br />
1,4 Millionen Hektar Energiepflanzen für den Einsatz<br />
in Biogasanlagen. Das sind rund acht Prozent<br />
der landwirtschaftlichen Nutzfläche.<br />
Fast jede Pflanze eignet sich für die Vergärung:<br />
bunte Wildblumen, weiß blühender Buchweizen<br />
oder die gelb blühende Durchwachsene Silphie.<br />
Sie unterscheiden sich jedoch in ihrem Gas- und<br />
damit Stromertrag. Aus einem Hektar Mais können<br />
ca. 21.000 Kilowattstunden Strom erzeugt<br />
werden. Bei der bunten Alternative Wildpflanzen<br />
liegt der Energieertrag etwa bei der Hälfte.<br />
Zahlreiche Institute und Hochschulen, aber auch<br />
viele Landwirte testen die verschiedensten Pflanzen<br />
auf ihre Biogastauglichkeit. In den letzten<br />
Jahren konnten dabei große Fortschritte erzielt<br />
werden und die Palette der potenziellen Energiepflanzen<br />
wächst kontinuierlich.<br />
Unterrichtsfilm<br />
Erneuerbare Energien<br />
Auch auf Youtube (FVBiogas)<br />
und zum Download auf Vimeo<br />
Eine DVD für Schulen kostenlos<br />
Bestellungen an:<br />
andrea.horbelt@biogas.org<br />
Jetzt<br />
neu<br />
1 11.04.18 16:27<br />
Bestellungen bitte per E-Mail an info@biogas.org<br />
www.biogas.org
Verband<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Erderhitzung stoppen,<br />
jedes Jahr zählt!<br />
Gastbeitrag zur Bewertung der Kohlekommission von Dr. Simone Peter,<br />
Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie (BEE) e.V.<br />
Die verschiedenen gesellschaftlichen<br />
Interessen, die in der<br />
Kohlekommission vertreten waren,<br />
haben sich auf einen Kompromiss<br />
für den Kohleausstieg<br />
verständigt. Der Einstieg in den Ausstieg<br />
ist nun besiegelt, der Gesamtpfad ist<br />
den Paris-Klimazielen entsprechend<br />
auszugestalten und konkrete Maßnahmenpakete<br />
sind zu schnüren.<br />
Spätestens 2038 – aus Sicht des<br />
BEE einige Jahre früher – sollen die<br />
letzten Kohlekraftwerke vom Netz<br />
gehen. Der Mix aus Erneuerbaren<br />
Energien, Speichern und gekoppelten<br />
Sektoren übernimmt sukzessive<br />
die Verantwortung für die sichere<br />
Energieversorgung. In diesen zunehmend<br />
flexiblen Energiemärkten<br />
wird Biogas eine wachsende Rolle<br />
spielen. Denn mit zuverlässiger und<br />
steuerbarer Produktion, die zudem<br />
an den Bedarf des Gesamtsystems<br />
angepasst werden kann, ist es der<br />
feste Partner an der Seite der fluktuierend<br />
einspeisenden Quellen Sonne und Wind.<br />
Für die Versorgungssicherheit ist das entscheidend,<br />
zumal es in Deutschland eine<br />
weit verzweigte Infrastruktur für Gas gibt –<br />
das entsprechend der Klimaziele auch grüner<br />
werden muss.<br />
Das Kapazitätspotenzial von Biogas ist<br />
noch lange nicht ausgeschöpft. Je mehr<br />
Biogas flexibilisiert wird, desto mehr kann<br />
es zur Versorgungssicherheit beitragen.<br />
Hierzu ist wichtig, dass noch in diesem<br />
Jahr der vorhandene Flexibilitätsdeckel<br />
beim Biogas gestrichen wird. Je höher die<br />
Anreize für die Flexibilität sind, desto mehr<br />
Kohlekraftwerke können kapazitätsseitig<br />
versorgungssicher durch Biogas ersetzt<br />
werden. Dies muss jetzt auch Bestandteil<br />
der Verhandlungen der AG Akzeptanz der<br />
Regierungsfraktionen werden. Darüber hinaus<br />
hat die Kohlekommission auch Akzente<br />
bei der Kraft-Wärme-Kopplung gesetzt.<br />
Auch hier kann Biogas seine spezifischen<br />
Vorteile ausspielen.<br />
Die Kommissionsempfehlungen für die<br />
Reduktion der Kohleverstromung und den<br />
Ausbau der Erneuerbaren Energien in<br />
den 2020er Jahren werden voraussichtlich<br />
dazu beitragen, das nationale Klimaschutzziel<br />
2030 zu erreichen. Die Ziele<br />
des Pariser Klimaschutzabkommens werden<br />
damit noch nicht erreicht. Nötig ist ein<br />
Abschaltplan, der ab 2023 die in Paris beschlossenen<br />
Vorgaben in den Fokus stellt.<br />
Spätestens dann sollten auch die weiteren<br />
konkreten Maßnahmen für die Jahre 2025<br />
bis 2030 beschlossen und sollte dem Klimaschutz<br />
Rechnung getragen werden.<br />
Seit der Ratifizierung des Vertrages hat die<br />
Bundesregierung keine Prozesse zur notwendigen<br />
Treibhausgaseinsparung in die<br />
Wege geleitet. Deshalb ist es jetzt umso<br />
dringender, dass Deutschland seinen Beitrag<br />
zu einer signifikanten Treibhausgasreduzierung<br />
leistet und damit dazu beiträgt,<br />
die Erderhitzung zu stoppen. Jedes Jahr<br />
zählt.<br />
Der vermeintliche Gegensatz – softer Klimaschutz<br />
auf der einen Seite und harte<br />
Wirtschaftsfakten auf der anderen Seite –<br />
ist durch die Energiewende schon lange<br />
aufgelöst. Denn sie schafft dauerhaft nachhaltige<br />
Wertschöpfung mit zigtausenden<br />
Arbeitsplätzen und wachsender heimischer<br />
Wertschöpfung. Nur Erneuerbare Energien<br />
verbinden Klimaschutz und die notwendige<br />
Modernisierung der Energiewirtschaft. Bürgerinnen<br />
und Bürger, Landwirte und neue<br />
Energieakteure sind dabei von Anbeginn<br />
die Treiber. Sie tragen zur großen Akzeptanz<br />
der Energiewende bei, wie Umfragen<br />
dies immer wieder belegen.<br />
Um neben dem beschleunigten Umstieg<br />
auf Erneuerbare Energien auf schnellem<br />
Wege mehr CO 2<br />
einzusparen, bietet sich<br />
als Ansatz an, die Volllaststunden in den<br />
im Übergangszeitraum noch verbleibenden<br />
Kraftwerken zu reduzieren. Marktwirtschaftlich<br />
– und zudem sehr effizient<br />
– ist ein Preis auf den Ausstoß<br />
von Kohlendioxid. Er würde faire<br />
Wettbewerbsbedingungen schaffen<br />
und somit saubere Technologien in<br />
den Vordergrund rücken.<br />
Dies würde notwendige Impulse für<br />
Erneuerbare Energien, Speicher und<br />
die Sektorenkopplung setzen. Es geht<br />
deshalb um mehr als um die Umsetzung<br />
des Vorschlags der Kohlekommission.<br />
Es geht um ein Gesamtkonzept,<br />
in dem auch die Bereiche<br />
Gebäude und Verkehr ihre Sektorziele<br />
für den Klimaschutz erreichen. Hier<br />
herrscht seit Jahren energiepolitischer<br />
Stillstand. Entsprechend ambitioniert<br />
müssen die Beschlüsse der beiden<br />
Kommissionen sein. Und auch hier liegen<br />
bereits gute Lösungen auf der Hand. So<br />
kann zum Beispiel zu Biomethan aufbereitetes<br />
Biogas neben anderen Erneuerbaren<br />
Energien im Gebäude- und Verkehrsbereich<br />
zur CO 2<br />
-Reduktion beitragen.<br />
Das Klimaschutzgesetz muss schließlich<br />
den regulatorischen Rahmen bilden, der<br />
die Energiewende aus dem Dickicht von<br />
Einzelmaßnahmen holt. Dafür braucht es<br />
Emissionseinsparziele für die einzelnen<br />
Sektoren, ebenso wie übergeordnete Pfade,<br />
darunter das Zeit- und Mengengerüst für<br />
das von der Kohlekommission bestätigte<br />
65-Prozent-Ziel für Erneuerbare Energien<br />
bis 2030. Für die Erneuerbaren-Industrie<br />
und ihre knapp 340.000 Beschäftigten<br />
muss endlich Planungssicherheit geschaffen<br />
werden. Die Kommission hat ihre Arbeit<br />
beendet, die politische Arbeit beginnt erst<br />
jetzt.<br />
86
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Verband<br />
Abgaskatalysatoren<br />
Für alle in Deutschland zugelassenen BHKWs<br />
Zur Einhaltung der neuen Abgasnorm von<br />
< 20mg Formaldehyd mit 120 mm Kat<br />
Zu sehr günstigen Preisen (netto inkl. Fracht)<br />
z.B. MAN bis 210 kW für 1.199 €<br />
Fordern Sie Ihr konkretes Angebot an unter<br />
www.ilmaco-vertrieb.de<br />
ILMACO Vertrieb oHG mb@ilmaco.de<br />
Fischerstr. 13 · 84137 Vilsbiburg · (0176) 476 494 69<br />
RÜHRTECHNIK<br />
Zapfwellenmixer, Hydraulikmixer,<br />
Elektromixer, Tauchmotormixer,<br />
Spaltenbodenmixer, Güllemixer<br />
für Slalomsysteme<br />
Tel. 07374-1882, www.reck-agrar.com<br />
Individuelle Beratung und Konzepte<br />
• Anlagenerweiterung und -flexibilisierung<br />
• Optimierung des Anlagenbetriebes<br />
• Genehmigungsplanung<br />
• Vorbereitung, Betreuung sämtlicher Prüfungen<br />
neutral, herstellerunabhängig, kompetent<br />
Tel +49 (0)5844 976213 | mail@biogas-planung.de<br />
Effiziente Komponenten und Konzepte für Ihre Flexibilisierung<br />
Aktivkohlefilter ∙ Gaskühlungen ∙ Leitungsbau ∙ Sanierung ∙ Wärmegewinnung ∙ Wartungsumläufe ∙ Aktivkohle ∙ Heizungsbau ∙ Katalysatoren<br />
Unser Dreamteam:<br />
∙ Bis zu 34% Kühlenergie-Einsparung !<br />
Aus EasyFlex wird BioBG!<br />
∙ Absolute Sicherheit für Ihr BHKW!<br />
DRBT Gas-Kühltrocknung &<br />
∙ 50% höhere Beladung der Aktivkohle bzw. Filtermedien!<br />
- Ein Wartungsumlauf für alle Biogasanlagen-Behälter.<br />
3-Kammer-Aktivkohle-Filtersystem!<br />
MAPRO International ∙ Aktivkohlewechsel LOGO.pdf in 1 Eigenregie, 12.11.13 ohne Kontakt 10:21 zur Kohle, möglich!<br />
- Umhängbar auf alle Behälter Ihrer Anlage!<br />
BioBG GmbH ∙ Webers Flach 1 ∙ 26655 Ocholt ∙ Tel.: 04409 666720 ∙ Email: info@biobg.de ∙ Internet: www.biobg.de<br />
MAPRO ® GASvERdIchTER<br />
volumenströme bis zu 3600 m³/h<br />
und drücke bis zu 3,2 bar g<br />
A Company of<br />
MAPRO ® INTERNATIONAL S.p.A.<br />
www.maproint.com<br />
WARTUNG ZUM FESTPREIS<br />
MAPRO ® Deutschland GmbH<br />
Tiefenbroicher Weg 35/B2 · D-40472 Düsseldorf<br />
Tel.: +49 211 98485400 · Fax: +49 211 98485420<br />
www.maprodeutschland.com · deutschland@maproint.com<br />
87
Verband<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Wo die Gülle die Hauptrolle spielt<br />
In Thüringen sind die Biogasanlagen zumeist direkt in die Landwirtschaftsbetriebe integriert.<br />
Nachwachsende Rohstoffe kommen wenig zum Einsatz, sodass steigende Pachtpreise durch<br />
die Substratproduktion nicht erkennbar sind.<br />
Von Bernward Janzing<br />
Noch kann der Anlagenbestand<br />
im Land sich sehen lassen:<br />
In Thüringen gibt es mehr<br />
als 260 landwirtschaftliche<br />
Biogasanlagen mit einer installierten<br />
Leistung von insgesamt 112,4<br />
Megawatt, ferner 8 Abfallanlagen mit zusammen<br />
10,4 Megawatt und 9 Biogaseinspeiseanlagen.<br />
Doch bei diesen Zahlen wird es nicht bleiben<br />
– sofern politisch nicht gegengesteuert<br />
wird. Denn das Ende der EEG-Vergütungen<br />
rückt näher. „Beginnend ab 2020 ist ein<br />
deutlicher Einbruch in der Bereitstellung<br />
von Biogasstrom zu erwarten, der dann<br />
auch noch mit der Abschaltung der letzten<br />
Atomkraftwerke in 2022 zusammenfällt“,<br />
schreibt das Thüringer Ministerium für Infrastruktur<br />
und Landwirtschaft. Mehrere<br />
Biogasanlagen wurden aus unterschiedlichen<br />
Gründen bereits stillgelegt.<br />
Dabei hat die Branche in Thüringen eigentlich<br />
eine ganz gesunde Struktur, weil<br />
mehr als 90 Prozent der Anlagen direkt<br />
in die Landwirtschaftsbetriebe integriert<br />
sind. Reine NawaRo-Anlagen – Investorenanlagen<br />
überhaupt, wie sie in anderen<br />
Ländern im deutschen Osten verbreitet<br />
sind – bleiben in Thüringen die Ausnahme.<br />
Reine Gülleanlagen gibt es aber auch praktisch<br />
nicht, da die Betriebe stets anfallende<br />
Reststoffe wie Siloabraum und Restfutter,<br />
mit verwerten. Die elektrische Leistung der<br />
Thüringer Anlagen (ohne die Einspeiseanlagen)<br />
liegt im Mittel bei 450 Kilowatt.<br />
Wirtschaftsdünger: hoher Anteil in<br />
Biogasanlagen<br />
„Mit der Orientierung der Errichtung der<br />
landwirtschaftlichen Biogasanlagen am<br />
Standort der Tierhaltung wurde ein zukunftsweisender<br />
Weg begangen“, bilanziert<br />
heute das Landwirtschaftsministerium.<br />
Bezogen auf die Frischmasse betrage der<br />
Wirtschaftsdüngeranteil am Substratmix in<br />
Thüringen 71,3 Prozent. Von der anfallenden<br />
Rindergülle werden bereits mehr als<br />
87 Prozent, von der Schweinegülle mehr<br />
als 43 Prozent und vom Stallmist mehr als<br />
37 Prozent energetisch genutzt.<br />
Aufgrund des nur geringen Einsatzes von<br />
Energiepflanzen finde in der Regel auch<br />
kein Substrathandel statt, was der Landwirtschaft<br />
in Thüringen – anders als in<br />
manchen anderen Regionen – einen entscheidenden<br />
Vorteil bringt: „Effekte der<br />
Substratproduktion auf die Höhe der Pachtzinszahlungen<br />
sind in Thüringen nicht festzustellen“,<br />
betont das Ministerium.<br />
Thüringen hatte bereits zu DDR-Zeiten dem<br />
Biogas viel Aufmerksamkeit gewidmet, unter<br />
anderem durch die Forschungsarbeiten<br />
der Landwirtschaftlichen Fakultät der Uni<br />
Jena. Bereits 1953 baute das Institut eine<br />
halbautomatisierte Anlage mit 3 Kubikmetern<br />
Faulraum auf dem Versuchsgut in<br />
Freienbessingen auf, die bereits mit der<br />
thermophilen Faulung experimentierte.<br />
Billiges Öl beendete aber in den folgenden<br />
anderthalb Jahrzehnten vorerst die<br />
Biogas-Ära im deutschen Osten. Die Thüringer<br />
Versuchsanlagen wurden ebenso<br />
stillgelegt wie jene im brandenburgischen<br />
Bornim und in Dresden. „Ursache hierfür<br />
waren auch die unter den Bedingungen der<br />
kleinbäuerlichen Produktion ungenügenden<br />
Substratanfallmengen sowie technologische<br />
Probleme“, sagt Gerd Reinhold vom<br />
Thüringer Landesamt für Landwirtschaft<br />
und Ländlichen Raum (TLLLR).<br />
Neue Pilotanlagen als Folge der<br />
Ölkrisen<br />
Anfang der Achtzigerjahre, als die erste<br />
und zweite Ölkrise die Preise der fossilen<br />
Energien zeitweise rapide steigen ließen,<br />
beschloss die DDR abermals eine Reihe<br />
von Pilotanlagen zu errichten. In Thüringen<br />
entstanden solche in Nordhausen, in<br />
Rippershausen bei Meiningen und in Himmelgarten<br />
bei Nordhausen. Eine Großversuchsanlage<br />
wurde zugleich in Berlstedt<br />
aufgebaut. In den benachbarten Bundesländern<br />
gab es Projekte im sächsischen<br />
Plauen und im brandenburgischen Frankenförde<br />
bei Luckenwalde, die auch von<br />
Forschern aus Thüringen begleitet wurden.<br />
Die Biogasgroßversuchsanlage in Berlstedt<br />
ging als erste 1982 in Betrieb, eine Pilotanlage<br />
auf Basis eines umgerüsteten 500<br />
Kubikmeter fassenden Güllelagerbeckens.<br />
Sie habe das Ziel gehabt, Erfahrungen und<br />
Erkenntnisse für den Betrieb der geplanten<br />
Großanlage am gleichen Standort mit drei<br />
mal 1.200 Kubikmeter Faulraumvolumen<br />
zu gewinnen, sagt Reinhold. In der Anlage<br />
seien vielfältige Untersuchungen zur Verfahrenstechnik<br />
der Biogaserzeugung vorgenommen<br />
worden.<br />
Die Großanlage ging 1986 in Betrieb, sie<br />
habe bis zur Wende erfolgreich gearbeitet,<br />
sagt Reinhold. Anfangs wurde das Gas lediglich<br />
in Warmwasserkesseln genutzt,<br />
die in einer Milchviehanlage in Berlstedt<br />
einen Kilometer entfernt beziehungsweise<br />
in einer Schweinemastanlage in Neumark<br />
aufgestellt waren. Die Verstromung wurde<br />
erst ab 1987 mit einem umgerüsteten ZT-<br />
300-Traktormotor getestet.<br />
Größte Gülleanlage der DDR<br />
Thüringen habe auch die größte landwirtschaftliche<br />
Biogasanlage der DDR gehabt,<br />
erinnert sich der Biogasexperte vom TLL-<br />
LR. Diese stand in Nordhausen und verfügte<br />
über ein Faulraumvolumen von zwei mal<br />
8.000 Kubikmeter. Sie wurde vom Institut<br />
für Düngungsforschung Potsdam wissenschaftlich<br />
betreut und arbeitete auf Basis<br />
von Schweinegülle. Bis 1991 lief die Anlage,<br />
die von den Schweinezuchtanlagen des<br />
Betriebes mit insgesamt 90.000 Tieren<br />
sowie Güllefiltrat aus einer benachbarten<br />
Schweinemastanlage mit 25.000 Tieren<br />
versorgt wurde. Die Anlage wurde allerdings<br />
Mitte der Neunzigerjahre stillgelegt und als<br />
neukonstruierte Anlage 2001 wieder in Betrieb<br />
genommen.<br />
88
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Verband<br />
Das Projekt in Himmelgarten am Standort<br />
einer Jungrinderanlage mit 2.600 Tieren<br />
war dagegen klein, es umfasste zwei Fermenter<br />
mit jeweils 360 Kubikmeter Faulraum<br />
und ging 1986 in Betrieb. Im Jahr zuvor<br />
war die Anlage Rippershausen mit vier<br />
mal 1.500 Kubikmeter Faulraumvolumen<br />
auf Basis der Gülle von 34.000 Schweinen<br />
einer Mastanlage in Betrieb gegangen.<br />
Technisch wurde immer wieder Neues getestet.<br />
„Hier erfolgte erstmals der Einsatz<br />
von Folienmaterialien zur Abdeckung der<br />
Reaktoren und zur Gasspeicherung, auch<br />
wurden hier erstmals Hohlwellenrührwerke<br />
aus der Kaliindustrie eingesetzt“, sagt<br />
Reinhold. Durch die umfangreiche Nutzung<br />
von Kosubstraten aus dem Bereich organischer<br />
Abfälle habe man den Betrieb auch<br />
über die wirtschaftlich schwierigen Zeiten<br />
der Nachwende aufrechterhalten können.<br />
Fast 60 Prozent Ökostrom<br />
Heute liegt Thüringen in Sachen Ökostrom<br />
deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt.<br />
Wie das Landesamt für Statistik<br />
errechnete, stammten im Jahr 2017 von<br />
den 10,15 Milliarden Kilowattstunden,<br />
die im Land erzeugt wurden, 59,2 Prozent<br />
aus Erneuerbaren Energien. Allerdings<br />
muss Thüringen auch Strom aus anderen<br />
Bundesländern importieren, weil die eigene<br />
Erzeugung nicht ausreicht. Unter den<br />
Erneuerbaren hat die Windkraft mit 2,79<br />
Milliarden Kilowattstunden (2017) den<br />
größten Anteil. Auf dem zweiten Platz steht<br />
die Biomasse mit 1,85 Milliarden, wovon<br />
wiederum die Hälfte aus Biogas stammt.<br />
Die andere Hälfte stammt aus flüssiger<br />
Biomasse wie Rapsöl, aus fester Biomasse<br />
wie Holz und Brennlauge (eingedampfte<br />
Schwarzlauge aus der Zellstoffproduktion)<br />
sowie aus dem biogenen Anteil der Abfälle.<br />
Seit dem EEG 2014 geht es aber auch in<br />
Thüringen kaum noch voran mit dem Biogas,<br />
seither erfolgte der bescheidene Zubau<br />
nur noch in Form von 75-Kilowatt-Gülleanlagen.<br />
Einzelne Bestandsanlagen wurden<br />
zuletzt auch flexibilisiert, doch so richtig<br />
zufrieden ist das Ministerium mit der bestehenden<br />
Regelung nicht. In seinem Abschlussbericht<br />
„Integration der Biogaserzeugung<br />
in die Landwirtschaft Thüringens“<br />
schreibt das Ministerium für Infrastruktur<br />
und Landwirtschaft von einer „Fehlanreizsetzung<br />
bei der Flexibilisierung“. Denn<br />
es werde nicht eine flexible Fahrweise,<br />
sondern die potenzielle Möglichkeit zur<br />
flexiblen Fahrweise gefördert – ein großer<br />
Unterschied.<br />
Die Flexibilität kann vielfältig sein. Herbert<br />
Markert vom Fachverband Biogas in Thüringen<br />
verweist auf den hohen Anteil von<br />
Biogasanlagen mit Nahwärmenetz, die es<br />
im Land gebe. Somit würden in Thüringen<br />
längst einige Anlagen flexibilisiert – auch<br />
ohne zusätzlichen Gasspeicher. Denn entsprechend<br />
dem Wärmebedarf werde Erzeugung<br />
vom Sommer in den Winter verlagert.<br />
„Man fährt den Reaktor über einige Wochen<br />
im Frühjahr um 20 bis 30 Prozent herunter<br />
und im Herbst wieder hoch“, sagt Markert.<br />
Damit liefere man bedarfsgerechte Wärme<br />
und auch Strom und müsse gar nicht<br />
in Gasspeicher investieren: „Der beste<br />
Speicher ist die Silage im Silo.“ Mitunter<br />
passe der Jahresgang der Biogaserzeugung<br />
auch perfekt zum Anfall der Gülle in den<br />
landwirtschaftlichen Betrieben: „Eine Mutterkuhherde<br />
ist ohnehin nur im Winter im<br />
Stall.“<br />
Biomethan aus kleineren Anlagen<br />
Auch mit neuen Konzepten versuchen<br />
die Akteure, das Biogas über die aktuelle<br />
politische Durststrecke und das Ende der<br />
EEG-Förderung zu retten. Ohra Energie,<br />
der Gasversorger in der Region Gotha-Eisenach,<br />
hat gerade eine Machbarkeitsstudie<br />
fertigstellen lassen, die zeigt, dass auch<br />
Biogas aus kleineren Anlagen als bisher zu<br />
Biomethan aufbereitet und wirtschaftlich<br />
als Kraftstoff verwendet werden kann. „Ab<br />
einer Erzeugung von 50 Kubikmeter Rohbiogas<br />
pro Stunde kann sich das lohnen“,<br />
sagt Volkmar Braune, Technischer Leiter<br />
des Unternehmens. Voraussetzung sei,<br />
dass in unmittelbarer Nähe eine Gastankstelle<br />
das Biomethan an Kraftfahrzeugfahrer<br />
verkaufen kann. Nun sei ein Demonstrationsprojekt<br />
geplant.<br />
Gleichzeitig gehört das Biogas natürlich<br />
auch auf die politische Agenda, nicht zuletzt<br />
weil im Oktober in Thüringen Landtagswahl<br />
ist. Die Bilanz der bisherigen Politik<br />
fällt nicht schlecht aus: „Die Thüringer<br />
Landesregierung engagiert sich beim Ausbau<br />
der Erneuerbaren Energien“, sagt Jana<br />
Liebe vom Thüringer Erneuerbare Energien<br />
Netzwerk (ThEEN).<br />
Aber bundesweit müsse mehr geschehen.<br />
Ende Januar haben die Thüringer Branchenverbände<br />
daher ein Papier vorgestellt,<br />
in dem sie den aus ihrer Sicht bestehenden<br />
Handlungsbedarf darstellen. Insbesondere<br />
werde die Begrenzung der Sondervergütungsklasse<br />
im EEG auf 75 Kilowatt Bemessungsleistung<br />
vielen Viehhaltungsbetrieben<br />
in Thüringen nicht gerecht, da auf<br />
diesen zum Teil deutlich mehr Gülle anfällt.<br />
„Die Grenze sollte deshalb auf 150 Kilowatt<br />
Bemessungsleistung erhöht werden“,<br />
fordern die Verbände.<br />
Um den Anreiz zur Flexibilisierung beizubehalten,<br />
sollte ferner die Begrenzung der<br />
installierten Leistung abgeschafft werden,<br />
und auch Güllekleinanlagen sollte ermöglicht<br />
werden, den Flexibilitätszuschlag zu<br />
erhalten. Bestandsanlagen, deren EEG-<br />
Vergütung ausgelaufen ist, sollten die Möglichkeit<br />
erhalten, durch einen Wechsel in<br />
die Sondervergütungsklasse einen zweiten<br />
Vergütungszeitraum zu erhalten.<br />
Geschieht nichts dergleichen, sehen die<br />
Branchenverbände eine fatale Entwicklung<br />
voraus: Eine Fortschreibung der heutigen<br />
Rahmenbedingungen werde dazu führen,<br />
dass im Jahr 2035 weniger als 20 Prozent<br />
der derzeitigen Biogasstrommenge erzeugt<br />
wird und dass zugleich mehr als 275 Gigawattstunden<br />
Wärme aus anderen Quellen<br />
bereitgestellt werden müssen.<br />
Autor<br />
Bernward Janzing<br />
Freier Journalist<br />
Wilhelmstr. 24a · 79098 Freiburg<br />
07 61/202 23 53<br />
bernward.janzing@t-online.de<br />
89
Verband<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Triesdorfer Biogastag<br />
Biogasanlagen – Spielball des EEG?<br />
Klimaschutzziele brauchen regionales Bewusstsein und Fläche.<br />
Mitte Januar trafen sich Fachleute<br />
auf dem 9. Biogastag<br />
in Triesdorf. Sie forderten,<br />
dass der Weg der Erneuerbaren<br />
Energien weiter verfolgt<br />
werden müsse. Die Biogasbranche<br />
leiste wichtige Beiträge für die regionale<br />
Energieerzeugung und die Erreichung der<br />
Klimaschutzziele. Einig sind sich die Experten<br />
darin, dass Deutschland die Klimaschutzziele<br />
nur mit einer Bündelung und<br />
konsequenten Umsetzung verschiedener<br />
Maßnahmen erreichen kann. Dabei spielen<br />
Sektor übergreifende und vernetzte Lösungen<br />
eine bedeutende Rolle. Die Erzeugung<br />
von Energie in der Region brauche Fläche<br />
und wird sichtbar sein.<br />
Das ist ein wunder Punkt für vieler ihrer Verbandskollegen,<br />
weiß Heide Schmidt-Schuh<br />
vom Arbeitskreis für erneuerbare Energien<br />
im Bund Naturschutz (BN). Die positive<br />
Einschätzung von regionaler Energieerzeugung<br />
hat für viele Bürger ihre Grenzen,<br />
wenn sie Maisflächen in ihrer Umgebung<br />
wahrnehmen und damit eine intensive Nutzung<br />
verbinden. Sie vertrat bei der Fachtagung<br />
der Biogasbranche die Meinung, dass<br />
für ein Weiterkommen im Klimaschutz das<br />
volle Spektrum der Erneuerbaren Energien<br />
genutzt werden müsse. Der BN setze auf<br />
eine konstante Gewinnung von Strom aus<br />
Biomasse, jedoch mit angepasstem Nutzungskonzept,<br />
wie der Reduzierung des<br />
Maisanteils.<br />
Dr. Peter Pluschke, Geschäftsführer des<br />
Forums Klimaschutz und Nachhaltige Entwicklung<br />
der Metropolregion Nürnberg,<br />
wies darauf hin, dass sich die Bürger der<br />
Stadt Nürnberg schon vor Fukushima zum<br />
Klimaschutz entschlossen hätten. Doch<br />
gerade sei die Energieeffizienz kritisch zu<br />
beurteilen. Häufig werde in energetisch ineffiziente<br />
und kostengünstige Mietbauten<br />
investiert. Er sieht jedoch auch positive<br />
Entwicklungen und geht davon aus, dass<br />
der Anteil der Erneuerbaren Energien in<br />
der Region weiter steigen werde. Durch<br />
die Verwertung von Rest- und Abfallstoffen<br />
ließen sich zudem neue Potenziale nutzen.<br />
Für ihn sind die Biogasanlagen ein wichtiger<br />
Baustein im Maßnahmenpaket zur Bekämpfung<br />
des Klimawandels.<br />
Rainer Kleedörfer, Bereichsleiter Unternehmensentwicklung<br />
der N-ERGIE AG, verdeutlichte<br />
das Maßnahmenpaket. Für eine<br />
erfolgreiche Energiewende gelte es insgesamt<br />
etwa 200 Maßnahmen einzuhalten.<br />
Er forderte die Bereitstellung<br />
von Flächen<br />
zur Erzeugung Erneuerbarer<br />
Energien,<br />
nicht nur für Biomasse,<br />
sondern auch für<br />
PV- und Windkraftanlagen.<br />
Für die Biogasbranche<br />
brauche<br />
es zudem politische<br />
Lösungen, wie zum<br />
Beispiel die finanzielle<br />
Belohnung der<br />
energiewirtschaftlichen<br />
Flexibilität von<br />
Biogasanlagen. Auch<br />
die Förderung für die<br />
Modernisierung und den Ausbau des Gebäudebestands<br />
gelte es weiter zu verfolgen.<br />
Dr. Claudius da Costa Gomez, Hauptgeschäftsführer<br />
des Fachverbandes Biogas<br />
e.V., erörterte, dass die Bemessungsleistung<br />
stagniere. Die Ursache dafür sieht er<br />
in der Positionierung von Gesellschaft und<br />
Naturschutzverbänden – man habe sich<br />
zunehmend kritisch gegenüber der Biogasentwicklung<br />
positioniert. Deshalb sei es<br />
wichtig, die Aufmerksamkeit auf die positiven<br />
Seiten der Branche zu lenken. Durch<br />
Biogas werden beispielsweise jährlich etwa<br />
20 Millionen Tonnen CO 2<br />
eingespart.<br />
Ebenso leiste Biogas durch den Anbau von<br />
alternativen Energiepflanzen einen wichtigen<br />
Beitrag zur Artenvielfalt. Und im<br />
Gegensatz zu anderen Erneuerbaren Energien<br />
können Biogasanlagen vergleichsweise<br />
bedarfsgerecht Strom und Wärme bereitstellen.<br />
Um die bestehenden Anlagen<br />
weiter betreiben zu können, setzt er auf<br />
die Weiterentwicklung des EEG sowie auf<br />
verbesserte politische Rahmenbedingungen.<br />
Eine Umstellung des Wärmemarktes<br />
auf CO 2<br />
-effiziente Vergütung sei ebenfalls<br />
ein richtiger Schritt für die Energiewende,<br />
nicht nur für die Biogasbranche.<br />
Herr Pfänder, Betreiber einer Biogasanlage,<br />
bestätigte, dass die Entwicklungen im<br />
Bereich Biogas viele positive Folgen bringe.<br />
So habe sich beispielsweise die Landnutzung<br />
durch Biogas deutlich vervielfältigt.<br />
Sein Biogasbetrieb mit Ackerbau und<br />
Schweinehaltung könne heute eine deutlich<br />
vielfältigere Fruchtfolge aufstellen<br />
und auch Wiesengras sinnvoll verwerten.<br />
Die Herausforderung sieht Pfänder bei den<br />
zunehmenden Anforderungen an Biogasanlagen,<br />
wie zum Beispiel Sanierungsarbeiten<br />
und Umwallungsauflagen. Gerade<br />
bei Anlagen mit begrenzten Restlaufzeiten<br />
sind zusätzliche Kosten nicht mehr zu<br />
amortisieren. Für die Zukunft müssen die<br />
Betriebe auf die Flexibilisierung und günstige<br />
Substrate, wie Gülle und Mist, setzen.<br />
Bezirkstagspräsident Armin Kroder bekannte<br />
sich in seinem Grußwort zur Energiewende.<br />
Der Ausstieg aus Kohle und Erdgas und<br />
die Ausrichtung auf Erneuerbare Energien<br />
stehen für ihn fest. Er forderte ein stärkeres<br />
Umdenken in der Gesellschaft. Jeder Verbraucher<br />
könne die eigene Energiebilanz<br />
und Einsparpotenzial überprüfen.<br />
Autorin<br />
Annette Schmid<br />
Fachzentrum für Energie und Landtechnik Triesdorf<br />
Sandrinaweg 4 · 91746 Weidenbach<br />
0 98 26/18 2003<br />
annette.schmid@triesdorf.de<br />
www.triesdorf.de<br />
90
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Verband<br />
Visuelle<br />
Kontrolle Ihrer<br />
Biogas-Produktion<br />
Lumiglas optimiert Ihren<br />
Biogas-Prozess<br />
• Fernbeobachtung mit dem<br />
Lumiglas Ex-Kamera-System<br />
• Lokale oder globale Paketlösungen<br />
schaffen kostengünstig Sicherheit<br />
... UND ALLES AUS EINER HAND! www.paulmichl-gmbh.de<br />
PAULMICHL GmbH Kisslegger Straße 13 · 88299 Leutkirch · Tel. 0 75 63/84 71 · Fax 0 75 63/80 12<br />
Wir lassen nichts<br />
an ihren Beton!<br />
neues System<br />
Fahrsilosanierung<br />
www.besatec.eu<br />
I Biogasbehälter<br />
I Fahrsilos<br />
I Güllebecken<br />
I Sanieren<br />
I Beschichten<br />
I WHD-Strahlen<br />
Besatec Holsten GmbH Fischerweg 2a · 38162 Cremlingen · 05306 99 050 10 · info@besatec.eu<br />
Geisberger Gesellschaft<br />
für Energieoptimierung mbH<br />
III Hassenham 4<br />
III 84419 Schwindegg<br />
III Tel.: +49(0)8082-27190-0<br />
III Tel.: +49(0)8082-27190-31<br />
III info@geisberger-gmbh.de<br />
550 kW<br />
Regelenergie-Aggregat auf Basis<br />
Regelenergie-Aggregat auf Basis<br />
Asynchrontechnik<br />
91<br />
Info-Material<br />
gleich heute anfordern!<br />
F.H. Papenmeier GmbH & Co.KG<br />
Telefon 0 23 04-205-0<br />
info.lumi@papenmeier.de<br />
www.lumiglas.de
Recht<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Umsatzsteuer aktuell im Biogasbereich<br />
Kostenlose Abgabe<br />
von Gärdünger birgt<br />
umsatzsteuerliche<br />
Probleme.<br />
In den Jahren 2017 und 2018 gab es eine Reihe von Gerichtsentscheidungen aus<br />
dem Bereich der Umsatzsteuer, die für Betreiber von Biogasanlagen interessant sind<br />
und nachfolgend näher beleuchtet werden.<br />
Von Annette Sieckmann<br />
AComeback der Gehaltslieferung<br />
Im weiten Feld der Umsatzsteuer hat<br />
die sogenannte „Gehaltslieferung“ (§ 3<br />
Abs. 5 UStG) lange ein Schattendasein<br />
geführt. Bei Recherchen datierte die aktuellste<br />
Entscheidung des Bundesfinanzhofes bisher<br />
aus 1990 im Bereich der Herstellung von Kartoffelschnaps.<br />
Nunmehr hat der Bundesfinanzhof mit Urteil<br />
vom 10.08.2017 (V R 3/16) die Tür weit aufgestoßen<br />
für eine Anwendung der Gehaltslieferung im Bereich<br />
des Betriebs von Biogasanlagen.<br />
1. Problemstellung<br />
Landwirte liefern Gülle und Frischsubstrat an Biogasanlagen,<br />
an denen sie häufig auch selbst beteiligt sind.<br />
Diese Lieferungen unterliegen unzweifelhaft der Umsatzsteuer,<br />
die der Landwirt an das Finanzamt abzuführen<br />
hat. Die Biogasanlage zahlt dem Landwirt für<br />
die Substratlieferungen ein Entgelt. Idealerweise ist im<br />
Liefervertrag festgehalten, dass die Biogasanlage die<br />
gesetzliche Umsatzsteuer auf das Entgelt zusätzlich an<br />
den Landwirt zu zahlen hat.<br />
Damit bleibt die Sache für beide Seiten wirtschaftlich<br />
neutral. Der Landwirt muss die Umsatzsteuer auf seine<br />
Lieferungen an das Finanzamt abführen, bekommt<br />
diese aber ja zusätzlich zum Entgelt von der Biogasanlage.<br />
Die Biogasanlage kann sich die mit dem Entgelt<br />
gezahlte Umsatzsteuer beim Finanzamt als Vorsteuer<br />
wiederholen. Voraussetzung ist regelmäßig eine ordnungsgemäße<br />
Rechnungsstellung durch den Landwirt<br />
beziehungsweise eine Gutschrift durch die Biogasanlage,<br />
die den Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes<br />
entspricht.<br />
Weniger klar geregelt ist oft die Gärrestrücknahme. Entweder<br />
ist bereits in den Gesellschaftsverträgen enthalten,<br />
dass die Kommanditisten das Substrat liefern und<br />
Gärdünger zurückzunehmen haben, oder die entsprechende<br />
Verpflichtung ergibt sich aus gesonderten Substratlieferverträgen.<br />
Zahlt der Landwirt für die Gärdünger<br />
ein Entgelt an die Biogasanlage, stellt die Abgabe<br />
der Gärdünger eine umsatzsteuerpflichtige Lieferung<br />
der Biogasanlage an den Landwirt dar. Die Verträge sollten<br />
die Pflicht des Landwirtes zur zusätzlichen Zahlung<br />
der Umsatzsteuer an den Betreiber der Biogasanlage<br />
enthalten. Die Biogasanlage führt die Umsatzsteuer<br />
dann an das Finanzamt ab.<br />
In vielen Regionen haben die Gärdünger jedoch mittlerweile<br />
keinen echten wirtschaftlichen Wert mehr. Die<br />
Neuregelung der Düngeverordnung sieht eine deutliche<br />
Einschränkung der Ausbringung von Gärresten vor und<br />
bedingt damit erhöhte Lagerkapazitäten. Die Biogasanlagen<br />
sind daher regelmäßig froh, wenn sie die Gärdünger<br />
noch loswerden. Es kommt daher vermehrt dazu,<br />
dass die Gärreste kostenlos abgegeben werden.<br />
Die Finanzämter sind dazu übergegangen, in Betriebsprüfungen<br />
eine solche kostenlose Abgabe des Gärdün-<br />
92
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Recht<br />
gers aufzugreifen. Gleiches gilt bei der Vereinbarung<br />
eines recht niedrigen Entgeltes<br />
für die Gärdünger. Das Finanzamt recherchiert<br />
angebliche Düngewerte der Gärdünger,<br />
die sich zwischen 2,00 Euro und 10,00<br />
Euro pro Tonne bewegen, und setzt diese<br />
als Wert der Lieferung an. Hintergrund ist §<br />
3 Absatz 1 b UStG, wonach eine unentgeltliche<br />
Zuwendung eines Gegenstandes einer<br />
Lieferung gegen Entgelt gleichgestellt wird.<br />
Bemessungsgrundlage ist hierbei gemäß §<br />
10 Absatz 4 Nr. 1 UStG der Einkaufspreis<br />
für den gelieferten Gegenstand, hier also<br />
des Gärdüngers.<br />
Die Biogasanlage hat dann auf diese Lieferungen<br />
Umsatzsteuer nachzuentrichten,<br />
obwohl sie tatsächlich ja kein Entgelt für<br />
die Gärdünger erhalten hat. Für mindestens<br />
vier Jahre zurück können sich da erhebliche<br />
Nachzahlungssummen ergeben.<br />
2. Lösung:<br />
Bei sauberer vertraglicher Gestaltung kann<br />
dieses Risiko in Zukunft vermieden werden.<br />
Wie der Bundesfinanzhof bestätigt hat,<br />
kann die Lieferung des Substrates unter<br />
Zurückbehaltung des Gärdüngers vereinbart<br />
werden. Unter dieser Voraussetzung<br />
besteht dann eine Gehaltslieferung, keine<br />
Hinlieferung des Substrates zzgl. Rücklieferung<br />
des Gärrestes. Die vertraglichen<br />
Lieferbeziehungen zwischen Landwirt und<br />
Biogasanlage sollten enthalten:<br />
ffEinigung, dass es sich um eine Gehaltslieferung<br />
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes<br />
handelt;<br />
ffder Landwirt liefert nur die im Substrat<br />
enthaltenen Inhaltsstoffe, die sich bei<br />
der Fermentation zu Biogas verarbeiten<br />
lassen, und erhält dafür sein Entgelt;<br />
ffder Landwirt behält sich das Eigentum<br />
an der eigentlichen Biomassesubstanz<br />
vor. Diese ist als Gärrest (Gärdünger)<br />
kostenlos zurückzugeben.<br />
Es muss nicht genau der Gärrest zurückgegeben<br />
werden, der bei der Verarbeitung<br />
des vom Landwirt gelieferten Substrates<br />
entstanden ist. Das Gesetz lässt schon die<br />
Rückgabe gleichartiger Erzeugnisse und<br />
Restabfälle zu. Die zurückgegebene Menge<br />
des Gärdüngers sollte aber ungefähr dem<br />
entsprechen, was aufgrund der Substratlieferungen<br />
des Landwirtes anfällt.<br />
Unter den Voraussetzungen des § 24 UStG<br />
ist weiterhin die Durchschnittssatzbesteuerung<br />
möglich. Die Finanzverwaltung<br />
ist mittlerweile dazu übergegangen, die<br />
neue Rechtsprechung anzuwenden (OFD<br />
Frankfurt am Main vom 5. März 2018, OFD<br />
Karlsruhe vom 15. August 2018).<br />
THERM<br />
Abgaswärmetauscher<br />
Dampferzeuger<br />
Gaskühler / Gaserwärmer<br />
Sonderanwendungen<br />
Zusatzkomponenten<br />
Energiepark 26/28 91732 Merkendorf<br />
+49 9826-65 889-0 info@enkotherm.de<br />
www.enkotherm.de<br />
DIE BESSERE<br />
SEPARATIONSTECHNIK<br />
Der Bioselect separiert Flüssigmist und<br />
Gärreste im geschlossenen System durchbruchsicher<br />
und geruchsneutral.<br />
Auf Wunsch liefern wir Separator, Drehkolbenpumpe<br />
und Steuerungstechnik perfekt aufeinander<br />
abgestimmt und anschlussfertig auf<br />
einem kompakten Grundgestell.<br />
Den Bioselect gibt es in vier Größen<br />
mit max. Durchsatzmengen von<br />
30 – 150 m³/h je Gerät.<br />
SEPARATIONSTECHNIK<br />
mehr unter:<br />
www.boerger.de<br />
Börger GmbH | D-46325 Borken-Weseke | Tel. 02862 9103 30<br />
93
Recht<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Fotos: www.landpixel.de<br />
B<br />
Umsatzsteuer auf<br />
Wärmelieferungen<br />
Schon wegen des KWK-Bonus<br />
existieren unterschiedliche<br />
Modelle, die bei der Stromerzeugung<br />
durch Biogas erzeugte Abwärme<br />
sinnvoll zu nutzen. Nicht immer kann<br />
jedoch für die Wärme auch ein Entgelt<br />
verlangt werden. Dies ist regelmäßig ein<br />
Einfallstor für das Finanzamt, in Betriebsprüfungen<br />
utopische Werte als Bemessungsgrundlage<br />
für die Wärmelieferung<br />
und die darauf entfallende Umsatzsteuer<br />
anzusetzen. Die Gerichte wurden in der<br />
jüngsten Zeit mehrmals mit der Rechtmäßigkeit<br />
dieses Vorgehens befasst. Folgende<br />
Fälle können unterschieden werden:<br />
1. Wärmelieferungen an<br />
fremde Dritte:<br />
Wird die entstehende Wärme gegen Entgelt<br />
an Personen abgegeben, die weder<br />
Gesellschafter noch Mitarbeiter des Biogasbetreibers<br />
sind und auch sonst keine<br />
nahen Angehörigen des Betreibers, ist Bemessungsgrundlage<br />
für die Umsatzsteuer<br />
nach § 10 Absatz 1 des UStG das vereinbarte<br />
Entgelt. Versuche des Finanzamtes,<br />
bei niedrigen Entgelten die Bemessungsgrundlage<br />
anhand von Selbstkosten oder<br />
durchschnittlichen Fernwärmepreisen<br />
nach oben zu setzen, sollte eine deutliche<br />
Absage erteilt werden. Der Umsatzsteueranwendungserlass<br />
der Finanzverwaltung<br />
bestimmt hierzu unter Ziff. 10.1 Absatz 2:<br />
„Das Entgelt ist auch dann Bemessungsgrundlage,<br />
wenn es dem objektiven Wert<br />
der bewirkten Leistung nicht entspricht.“<br />
2. Kostenlose Wärmeabgabe<br />
an Dritte<br />
Eine solche Gestaltung ist möglichst zu<br />
vermeiden. Folge ist, dass die Wärmeabgabe<br />
eine unentgeltliche Zuwendung ist,<br />
die nach § 3 Absatz 1b Nr. 3 UStG einer<br />
Lieferung gegen Entgelt gleichgestellt wird.<br />
Mangels Entgelt ist dann die Bemessungsgrundlage<br />
für die Umsatzsteuer nach §<br />
10 Absatz. 4 Nr. 1 UStG zu bestimmen:<br />
vorrangig Einkaufspreis, nachrangig die<br />
Selbstkosten. Der bestechenden Idee eines<br />
Biogasanlagenbetreibers, den KWK-Bonus<br />
als Entgelt eines Dritten im Sinne des § 10<br />
Absatz 1 S. 3 UStG für die Wärme anzusehen,<br />
hat der Bundesfinanzhof mit Urteil<br />
vom 31. Mai 2017 (XI R 2/14) eine Absage<br />
erteilt.<br />
Stattdessen sei zutreffende Bemessungsgrundlage<br />
nach § 10 Absatz 4 S. 1 UStG<br />
der übliche Einkaufspreis für Wärme vor Ort<br />
oder, mangels eines Einkaufspreises, die<br />
bei der Produktion der Wärme entstandenen<br />
Selbstkosten. Das Verfahren wurde vom<br />
Bundesfinanzhof an das Niedersächsische<br />
Finanzgericht zur weiteren Entscheidung<br />
zurückverwiesen (dortiges Aktenzeichen:<br />
11 K 195/17). Ein Termin zur mündlichen<br />
Verhandlung oder Entscheidung ist noch<br />
nicht anberaumt. Der Bundesfinanzhof<br />
hatte dem Finanzgericht mitgegeben, dass<br />
es die Bemessungsgrundlage für die unentgeltliche<br />
Wertabgabe der Wärme entsprechend<br />
den Grundsätzen der BFH-Urteile<br />
vom 12. Dezember 2012 (XI R 3/10) und<br />
vom 16. November 2016 (V R 1/15) zu ermitteln<br />
habe.<br />
Grundsätze aus dem Urteil vom<br />
12. Dezember 2012:<br />
ffEinkaufspreis ≠ durchschnittlicher<br />
Fernwärmepreis.<br />
ffDer Fernwärmepreis darf als Einkaufspreis<br />
nur dann angesetzt werden, wenn<br />
vor Ort ein Fernwärmenetz ist, das vom<br />
Verbraucher ebenso erreichbar und<br />
einsetzbar ist wie die selbsterzeugte<br />
Wärme.<br />
ffEinkaufspreis ≠ Kosten Wärmeproduktion<br />
durch Heizöl oder Gas.<br />
ffMangels Einkaufspreis sind Selbstkosten<br />
anzusetzen.<br />
Die Selbstkosten sind – vereinfacht gesagt –<br />
die Herstellungskosten, die die Biogasanlage<br />
bei der Erzeugung der Wärme hat. Da<br />
94
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Recht<br />
ja mit diesen Kosten regelmäßig nicht nur<br />
die Wärme erzeugt wird, sondern auch der<br />
Strom, ist eine Aufteilung vorzunehmen.<br />
Diese erfolgt nach Auffassung der Finanzverwaltung<br />
im Verhältnis der erzeugten<br />
Mengen an elektrischer und thermischer<br />
Energie. So ergibt sich dann ein Selbstkostenpreis<br />
je Kilowattstunde selbst erzeugter<br />
Wärme, der dann auf die Kilowattstunden<br />
gelieferte Wärme hochzurechnen ist.<br />
Da der Bundesfinanzhof in seinem Urteil<br />
vom 31. Mai 2017 auch auf sein Urteil vom<br />
16. November 2016 verwiesen hat, könnte<br />
auch eine Aufteilung der Selbstkosten nach<br />
dem Verhältnis der Marktpreise von Strom<br />
und Wärme sachgerecht sein. Dies hatte<br />
der Bundesfinanzhof in dem Urteil vom 16.<br />
November 2016 – allerdings im Bereich<br />
der Vorsteueraufteilung – so vorgenommen.<br />
Die Aufteilung der Selbstkosten nach produzierter<br />
Kilowattstunde Wärme und Strom<br />
sei nicht sachgerecht, da Strom und Wärme<br />
nicht miteinander vergleichbar seien.<br />
Der Rat bei Abgabe an Dritte kann daher<br />
immer nur lauten, ein Entgelt zu vereinbaren,<br />
das auch gering sein kann.<br />
3. Kostenlose Abgabe an<br />
nahestehende Personen/<br />
Gesellschafter/Mitarbeiter<br />
Das Finanzgericht Baden-Württemberg<br />
hat mit Urteil vom 9. Februar 2017 (1 K<br />
755/16) eindeutig entschieden, dass in<br />
solchen Fällen die Bemessungsgrundlage<br />
für die unentgeltliche Abgabe der Einkaufspreis<br />
sei und – mangels eines solchen – die<br />
Selbstkosten seien. Der Verkaufspreis, der<br />
mit einem daneben belieferten fremden<br />
Dritten vereinbart sei, sei nicht maßgeblich,<br />
weil der Verkaufspreis der Wärme eben<br />
nicht der Einkaufspreis im Sinne des § 10<br />
Absatz 4 UStG sei.<br />
4. Abgabe an nahestehende<br />
Personen/Gesellschafter/<br />
Mitarbeiter zu einem niedrigen<br />
Entgelt<br />
Wenn die Biogasanlage Wärme sowohl an<br />
fremde Dritte als auch an ihr nahestehende<br />
Personen/Gesellschafter/Mitarbeiter zum<br />
gleichen Entgelt liefert, ist dieses Entgelt<br />
Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer<br />
(Finanzgericht Niedersachsen, Urteil<br />
vom 12. Juli 2018, 11 K 276/17). Wichtig<br />
ist, dass die nahestehenden Personen tatsächlich<br />
das gleiche Entgelt für die Wärme<br />
zahlen wie die fremden Dritten, auch wenn<br />
dieses Entgelt niedriger ist, als das Finanzamt<br />
gerne hätte.<br />
Hintergrund ist, dass nach § 10 Absatz<br />
5 UStG zwar eine Mindestbemessungsgrundlage<br />
in Höhe des Einkaufspreises<br />
beziehungsweise der Selbstkosten gilt,<br />
wenn das vereinbarte Entgelt diese Mindestbemessungsgrundlage<br />
unterschreitet.<br />
Allerdings darf höchstens als Umsatz das<br />
marktübliche Entgelt angesetzt werden.<br />
Das Finanzgericht Niedersachsen sah diesen<br />
Nachweis des marktüblichen Entgeltes<br />
dadurch geführt, dass an fremde Dritte<br />
eben zum genau gleichen Preis die Wärme<br />
geliefert wurde.<br />
Fazit: Am günstigsten für den Betreiber<br />
der Biogasanlage ist es, wenn er die Wärme<br />
sowohl an fremde Dritte als auch an<br />
eigene Gesellschafter oder Mitarbeiter liefern<br />
kann. Dies ist dann auch zu Entgelten<br />
möglich, die die durchschnittlichen<br />
Fernwärmepreise in Deutschland oder die<br />
Selbstkosten bei der Herstellung der Wärme<br />
deutlich unterschreiten. Unter diesen<br />
Voraussetzungen kann Hinzuschätzungen<br />
des Finanzamtes erfolgreich entgegengetreten<br />
werden. Sofern die Wärme kostenlos<br />
abgegeben wird, bewegt sich der Betreiber<br />
auf dem unsicheren Feld der Selbstkosten<br />
als Bemessungsgrundlage für die<br />
Umsatzsteuer. Die zutreffende Ermittlung<br />
der Selbstkosten für Wärme ist noch nicht<br />
rechtssicher geklärt.<br />
Autorin<br />
Annette Sieckmann<br />
Rechtsanwältin<br />
Fachanwältin für Steuerrecht<br />
Kanzlei Ebert Rechtsanwaltsgesellschaft mbH<br />
Am Kiel-Kanal 2 · 24106 Kiel<br />
0431/530 52 330<br />
sieckmann@ebertrecht.de<br />
www.ebertrecht.de<br />
95
Recht<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Güllekleinanlagen – Neuregelungen<br />
ab Dezember <strong>2019</strong>!<br />
Blickwinkel: Recht – Praxis – Politik<br />
Auf der Grundlage des am 21.12.2018 in Kraft getretenen Energiesammelgesetzes wurde der Tatbestand<br />
für Güllekleinanlagen des EEG 2017 weiterentwickelt. So hat der Gesetzgeber die Voraussetzung „maximale<br />
installierte Leistung am Standort der Biogaserzeugung“ von 75 Kilowatt (kW) auf 150 kW erhöht. Zudem<br />
wurde bestimmt, dass eine Vergütung bis zu einer Bemessungsleistung von 75 kW (max. Produktionsmenge<br />
657.000 kWh, in Schaltjahren höher) erfolgt. Wir stellen hier die neue Rechtslage dar und bewerten diese.<br />
Weiter wird skizziert, wie das Recht über die Güllekleinanlagen weiterentwickelt werden sollte.<br />
Von René Walter und Dr. Andrea Bauer<br />
1. Einführung und<br />
Übergangsregelungen<br />
Mit dem EEG 2012 wurde ein neuer Förderanspruch<br />
für Strom aus Kleinanlagen, die<br />
einen hohen Anteil von Gülle einsetzen, in<br />
das EEG aufgenommen (§ 27b EEG 2012).<br />
Im Kern setzt der in das EEG 2012 eingefügte<br />
Vergütungstatbestand für Strom aus<br />
Güllekleinanlagen eine maximal installierte<br />
Leistung von 75 kW am Standort der Biogaserzeugung<br />
und den Einsatz eines Gülleanteils<br />
an den Substraten von mindestens<br />
80 Masseprozent voraus.<br />
Dieser mit dem EEG 2012 eingeführte<br />
Kerntatbestand wurde auch in das EEG<br />
2014 und das EEG 2017 (vor der jüngsten<br />
Änderung) unverändert übernommen. Auf<br />
der Grundlage des Energiesammelgesetzes<br />
wurde die maximale installierte Leistung<br />
am Standort der Biogaserzeugung von 75<br />
kW auf 150 kW erhöht und die vergütbare<br />
Strommenge auf 75 kW Bemessungsleistung<br />
festgelegt.<br />
Abbildung 1: Vergütungsfähige Bemessungsleistung in Abhängigkeit<br />
der installierten Leistung<br />
Vergütungsfähige Bemessungsleistung<br />
Y-Achse<br />
150 kW<br />
100 kW<br />
75 kW<br />
50 kW<br />
Doppelte Überbauung ab 100 kW<br />
50 kW<br />
75 kW<br />
100 kW<br />
150 kW<br />
1. Grenze doppelte Überbauung<br />
2. Grenze Einspeisemanagement<br />
3. Grenze Verpflichtung Direktvermarktung<br />
Installierte Leistung<br />
X-Achse<br />
96
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Aufgrund der Übergangssystematik<br />
des<br />
EEG 2012, des EEG<br />
Diese Neuregelung<br />
2014 und des EEG<br />
gilt für alle nach dem<br />
2017 ergeben sich<br />
die Voraussetzungen<br />
der Vergütung genommenen Anlagen.<br />
31.12.2016 in Betrieb<br />
einer Güllekleinanlage Bei diesen Anlagen ist<br />
grundsätzlich in die Regelung für nach<br />
Abhängigkeit vom Inbetriebnahmejahr<br />
und der<br />
dem 20.12.2018 aufgetretene<br />
Sachverhalte an-<br />
in diesem Inbetriebnahmejahr<br />
geltenden zuwenden. Rechtlich gut<br />
EEG-Fassung.<br />
begründbar ist, dass sich<br />
die Neuregelung damit<br />
auf das komplette Abrechnungsjahr<br />
2018 bezieht, da dieses nach<br />
dem 20.12.2018 seinen Abschluss findet.<br />
Für vor dem 01.01.2017 in Betrieb genommene<br />
Anlagen ist die Neuregelung<br />
leider nicht anzuwenden. Die Überschreitung<br />
der installierten Leistung von 75 kW<br />
führt daher bei diesen Anlagen weiterhin<br />
zum Verlust der Vergütung für Güllekleinanlagen.<br />
Der Grund liegt darin, dass der<br />
Gesetzgeber für das EEG 2012, das EEG<br />
2014 und in den Übergangsregelungen<br />
des EEG 2017 angeordnet hat, dass für<br />
die jeweilige Güllekleinanlage jeweils die<br />
EEG-Fassung weiter gilt, im Rahmen derer<br />
sie in Betrieb genommen worden ist.<br />
Daraus könnte man auf den ersten Blick<br />
schließen, dass sich der Vergütungstatbestand<br />
über die verschiedenen EEG-<br />
Fassungen nicht verändert hat. Dem ist<br />
aber nicht so. Es ergeben sich erhebliche<br />
Unterschiede, weil die sonstigen Regelungen,<br />
auf denen der Fördertatbestand<br />
aufbaut, durchaus geändert worden sind.<br />
So unterscheidet sich beispielsweise der<br />
Güllebegriff des EEG 2012 für Güllekleinanlagen<br />
von dem des EEG 2014 und des<br />
EEG 2017.<br />
Gülle im Sinne des EEG 2012 in Bezug<br />
auf Güllekleinanlagen umfasst Pferdemist,<br />
Rinderfestmist, Rindergülle, Schafmist,<br />
Ziegenmist, Schweinefestmist und<br />
Schweinegülle. Dagegen leitet sich der<br />
Güllebegriff für Güllekleinanlagen im Sinne<br />
des EEG 2014 und des EEG 2017 von<br />
der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des<br />
Europäischen Parlaments und des Rates<br />
vom 21.10.2009 ab. Der Güllebegriff dieser<br />
Definition ist erheblich weiter, da er jegliche<br />
Gülle von Nutztieren umfasst.<br />
Weitere wichtige Unterschiede ergeben<br />
sich zwischen den unterschiedlichen EEG-<br />
Fassungen im Hinblick auf die technischen<br />
Voraussetzungen (Abdeckung, Verweilzeit)<br />
sowie in Bezug auf die Seuchenregelungen.<br />
Im Übrigen sei angemerkt, dass deshalb<br />
auch nach der Änderung durch das<br />
Energiesammelgesetz die Regelungen<br />
über die Höchstbemessungsleistung auf<br />
Anlagen, die vor dem 01.08.2014 in Betrieb<br />
genommen worden sind, weiter anzuwenden<br />
sind.<br />
2. Allgemeine Bewertung<br />
der Neuregelung<br />
Auf der Grundlage des Energiesammelgesetzes<br />
wurden in den Fördertatbestand<br />
für Güllekleinanlagen des EEG 2017 (§<br />
44 EEG 2017) die vorgenannten beiden<br />
Änderungen eingefügt (Erhöhung der installierten<br />
Leistung auf 150 kW, wobei<br />
die vergütungsfähige Strommenge nur bis<br />
einschließlich 75 kW Bemessungsleistung<br />
besteht).<br />
Zur Begründung der Änderung wird in den<br />
Gesetzgebungsmaterialien des Bundestages<br />
nichts ausgeführt. Allerdings geht<br />
die Änderung wohl auf die Stellungnahme<br />
des Bundesrates zum Energiesammelgesetz<br />
vom 23.11.2018 zurück. Dort<br />
wird zum entsprechenden Vorschlag des<br />
Bundesrates ausgeführt, dass die Erhöhung<br />
der installierten Leistung auf eine<br />
Anlagengröße bis 150 kW bei gleichzeitig<br />
bestehend bleibender Vorgabe von 75<br />
kW Bemessungsleistung die Ziele des<br />
Klimaschutzfahrplans 2050 zum Ausbau<br />
der Güllevergärung umsetzen soll. Zudem<br />
solle eine flexiblere, saisonale und damit<br />
systemdienlichere sowie wirtschaftliche<br />
Fahrweise ermöglicht werden. Auch wären<br />
die gezieltere Nutzung von Wärme sowie<br />
die gezieltere Anreizung von Systemdienstleistungen<br />
beabsichtigt.<br />
Auch wenn festzustellen ist, dass die Neuregelung<br />
viele der Änderungswünsche der<br />
Branche nicht umsetzt und kaum eines der<br />
Ziele der Begründung erreicht wird, ist die<br />
Änderung als solche von der Branche zu<br />
begrüßen. Da der Fördertatbestand nicht<br />
mehr davon abhängt, dass die installierte<br />
Leistung maximal 75 kW beträgt, sondern<br />
dieser Grenzwert auf 150 kW erhöht wurde,<br />
kann die maximal vergütungsfähige Strommenge,<br />
die einer Bemessungsleistung von<br />
75 kW entspricht [657.000 Kilowattstunden<br />
(kWh), in Schaltjahren 658.800 kWh]<br />
viel einfacher erreicht werden. Ein weiterer<br />
Vorteil ist, dass größere Blockheizkraftwerke<br />
(BHKW) eingesetzt werden können, womit<br />
sich die Palette einsetzbarer BHKW vergrößert<br />
und unter Umständen auch Effizienzpotenziale<br />
erschlossen werden können.<br />
97<br />
INNOVATIVE Recht<br />
EINBRINGTECHNIK<br />
FÜR BIOGAS- UND<br />
RECYCLINGANLAGEN<br />
NEU!<br />
Jetzt auch als BIG-Mix Globe!<br />
Der BIG-Mix im ISO Seecontainer<br />
für den weltweiten Einsatz.<br />
BIG-Mix 35 bis 210m³<br />
effektiver Vorschub bei niedrigem<br />
Eigenstromverbrauch<br />
für 100% Mist und Grassilage<br />
mit Misch- und Aufbereitungsbereich<br />
komplett aus Edelstahl<br />
Biomischer 12 bis 80m³<br />
für 100% Mist und Grassilage<br />
massive Edelstahlkonstruktion<br />
mit Misch- und Aufbereitungsbereich<br />
auf Wunsch komplett aus Edelstahl<br />
KOMBI-Mix 8 und 12m³<br />
speziell für Kleinbiogasanlagen<br />
optional mit Vertikalmischschnecke<br />
für unterschiedlichste Substrate<br />
komplett aus Edelstahl<br />
Konrad Pumpe GmbH<br />
Fon +49 2526 93290<br />
Mail info@pumpegmbh.de<br />
www.pumpegmbh.de
Recht<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Für den schnellen Leser<br />
Übergangsbestimmungen:<br />
1. Anwendungsbereich: Die neuen Regelungen<br />
gelten für Strom aus Anlagen, die nach dem<br />
31.12.2016 in Betrieb genommen worden<br />
sind.<br />
2. Auf Anlagen, die nach dem 31.12.2016<br />
in Betrieb genommen worden sind, sind<br />
die Regelungen auf Sachverhalte ab dem<br />
21.12.2018 anzuwenden. Unter Zugrundelegung<br />
der Rechtsprechung zur unterjährigen<br />
Änderung der Voraussetzungen des Landschaftspflegebonus<br />
lässt sich schließen,<br />
dass die Änderungen zumindest teilweise<br />
Wirkung für das gesamte Abrechnungsjahr<br />
2018 entfalten.<br />
3. Aufgrund der Übergangssystematik des<br />
EEG 2012, des EEG 2014 und des EEG 2017<br />
ergeben sich die Voraussetzungen der Vergütung<br />
einer Güllekleinanlage grundsätzlich<br />
in Abhängigkeit vom Inbetriebnahmejahr<br />
und der in diesem Inbetriebnahmejahr<br />
geltenden EEG-Fassung. In Abhängigkeit von<br />
der EEG-Fassung sind die Voraussetzungen<br />
der Vergütung, die besonderen technischen<br />
Voraussetzungen und der maßgebliche Güllebegriff,<br />
der im Hinblick auf den Mindestgülleanteil<br />
Bedeutung entfaltet, herauszuarbeiten.<br />
Im Einzelfall kann die einschlägige<br />
EEG-Fassung durch eine Folgefassung<br />
überlagert sein.<br />
4. Für Strom aus vor dem 01.08.2014 in Betrieb<br />
genommene Anlagen sind weiterhin die<br />
Regeln über die Höchstbemessungsleistung<br />
anzuwenden.<br />
5. Bestandsanlagen mit einem vor dem<br />
01.01.2012 liegenden Inbetriebnahmedatum<br />
können nicht in diese Vergütung für Güllekleinanlagen<br />
wechseln.<br />
Die Neuregelung:<br />
1. Die maximale installierte Leistung am<br />
Standort der Biogaserzeugungsanlage wurde<br />
von 75 kW auf 150 kW erhöht.<br />
2. Es wird eine Strommenge in Höhe einer<br />
Bemessungsleistung von 75 kW vergütet.<br />
Dies entspricht einer Produktionsmenge von<br />
657.000 kWh (in Schaltjahren: 658.800 kWh).<br />
Soweit diese Strommenge überschritten<br />
wird, besteht die Gefahr, dass die Menge des<br />
vergüteten Stroms gekürzt wird. Letzteres<br />
ist zwar kaum nachvollziehbar, denn wer<br />
dem Direktvermarkter eine über die Menge<br />
von 657.000 kWh hinausgehende Menge zur<br />
Verfügung stellt oder die Übermenge selbst<br />
nutzt, bekommt weniger Vergütung, als wenn<br />
er genau die Menge von 657.000 kWh erzeugt<br />
hätte. Allerdings lässt sich eine Kürzung<br />
durchaus auf Rechtsprechung stützen.<br />
Wichtige vergütungstechnische<br />
und technische Rahmenbedingungen:<br />
1. Der Vergütungssatz beträgt im Jahr 2017<br />
23,14 Cent/kWh. Der Vergütungssatz unterliegt<br />
der Degression. Diese beträgt pro Jahr<br />
insgesamt 1 Prozent, wobei die Vergütungssätze<br />
zweimal pro Jahr um 0,5 Prozent (1.4.<br />
und 1.10.) um 0,5 Prozent sinken (§ 44a).<br />
Soweit der Strom der Anlage nicht direkt vermarktet<br />
wird, ist ein Abschlag von 0,2 Cent/<br />
kWh vorzunehmen (§ 53 Satz 1 EEG 2017).<br />
2. Der Flexibilitätszuschlag in Höhe von 40<br />
Euro pro installiertem kW und Jahr wird nicht<br />
gewährt.<br />
3. Ab einer installierten Leistung, die 100 kW<br />
übersteigt, besteht die Regel, dass nur<br />
eine Strommenge vergütet wird, die einer<br />
Bemessungsleistung in Höhe der Hälfte der<br />
installierten Leistung entspricht (doppelte<br />
Überbauung).<br />
4. Ab einer installierten Leistung, die 100<br />
kW übersteigt, muss die Anlage mit einer<br />
technischen Einrichtung für das Einspeisemanagement<br />
ausgerüstet werden.<br />
5. Zudem muss der Strom direkt vermarktet<br />
werden, wenn die installierte Leistung 100<br />
kW überschreitet.<br />
6. Aufgrund der drei vorstehenden Punkte<br />
wird es in der Regel wirtschaftlicher sein,<br />
wenn die installierte Leistung nicht 100 kW<br />
übersteigt.<br />
7. Die Vorschrift hebt nicht auf die eingespeiste<br />
Strommenge, sondern auf die produzierte<br />
Strommenge ab.<br />
8. Bestandsanlagen mit einem vor dem<br />
01.01.2012 liegenden Inbetriebnahmedatum<br />
können nicht in diese Vergütung für Güllekleinanlagen<br />
wechseln.<br />
3. Welche BHKW-Größe die Neuregelung<br />
begünstigt – sowie Doppelüberbauung,<br />
Flexibilitätszuschlag, Direktvermarktung<br />
und das Einspeisemanagement<br />
Wie Abbildung 1 verdeutlicht, wird es aber in den<br />
meisten Fällen nicht wirtschaftlich sein, BHKW einzusetzen,<br />
die über eine installierte Leistung von 100<br />
kW hinausgehen. Damit wird das Ziel des Bundesrates<br />
nach einer Flexibilisierung der Güllekleinanlagen kaum<br />
erreicht. Dies schon deshalb, weil das in § 44b Absatz<br />
1 EEG 2017 geregelte Doppelüberbauungsgebot auch<br />
für Güllekleinanlagen gilt. In der Norm ist sinngemäß<br />
bestimmt, dass ab einer installierten Leistung von 100<br />
kW die Bemessungsleistung, also die vergütungsfähige<br />
Strommenge, auf 50 Prozent der installierten Leistung<br />
abfällt.<br />
Juristisch ist dies so geregelt worden, dass für Strom,<br />
der in Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr<br />
als 100 kW erzeugt wird, nur für den Anteil der in einem<br />
Kalenderjahr erzeugten Strommenge, die einer<br />
Bemessungsleistung der Anlage von 50 Prozent des<br />
Wertes der installierten Leistung entspricht, ein Vergü-<br />
98
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Recht<br />
Abbildung 2: Vergütungsfähige Strommengen<br />
Y-Achse<br />
Bemessungsleistung<br />
150 kW<br />
100 kW<br />
75 kW<br />
X-Achse<br />
Dez.<br />
8.760 Stunden<br />
Berechnung 1:<br />
Berechnung 2:<br />
8.760 Stunden * 75 kW = 657.000 kWh = Bemessungsleistung von 75 kW<br />
8.760 Stunden * 150 kW = 1.314.000 kWh = maximal möglich Leistung<br />
aufgrund der höheren Stundenzahl von Schaltjahren sind die Leistungen in Schaltjahren höher.<br />
Durch energie+agrar habe ich einfach<br />
“<br />
mehr Spaß mit meiner Biogasanlage. ”<br />
tungsanspruch in voller Höhe besteht. Für<br />
den darüber hinausgehenden Anteil der<br />
Strommenge verringert sich der Anspruch<br />
in der Veräußerungsform der Marktprämie<br />
auf null und in den Veräußerungsformen<br />
einer Einspeisevergütung auf den Monatsmarktwert.<br />
Was dies praktisch bedeutet, verdeutlicht<br />
ebenfalls Abbildung 1. Bis zu einer installierten<br />
Leistung von 75 kW wird auch<br />
eine mit der installierten Leistung einhergehende<br />
Bemessungsleistung, die die<br />
vergütungsfähige Strommenge bestimmt,<br />
vergütet. Ab einer installierten Leistung<br />
von 75 kW stagniert die vergütungsfähige<br />
Strommenge bis 100 kW bei einer Bemessungsleistung<br />
von 75 kW. Ab einer installierten<br />
Leistung von mehr als 100 kW fällt<br />
die Bemessungsleistung auf 50 Prozent<br />
der installierten Leistung ab. Dies hat beispielsweise<br />
zur Konsequenz, dass die vergütungsfähige<br />
Strommenge in <strong>2019</strong> bei<br />
einem BHKW mit 100 kW 657.000 kWh<br />
beträgt. Bei einem BHKW mit 101 kW installierter<br />
Leistung würde dies jedoch nur<br />
442.380 kWh betragen.<br />
Die Problematik der Absenkung der vergütungsfähigen<br />
Strommenge ab einer über<br />
100 kW hinausgehenden installierten<br />
Leistung wäre nicht so groß, wenn ab einer<br />
solchen Leistung der Flexibilitätszuschlag<br />
in Höhe von 40 Euro pro kW und Kalenderjahr<br />
gewährt werden würde. Dann wäre es<br />
oft sinnvoll, Aggregate mit einer Leistung<br />
von 150 kW einzusetzen. Dieser Zuschlag<br />
wird aber leider nicht gewährt.<br />
Ferner verdeutlich Abbildung 1 auch, dass<br />
ab einer installierten Leistung von mehr als<br />
100 kW der Strom direkt vermarktet werden<br />
muss. Bei einer Direktvermarktung besteht<br />
zwar grundsätzlich die Möglichkeit,<br />
über den anzulegenden Wert hinaus Erlöse<br />
zu erzielen. Diese Möglichkeit ist bei<br />
Güllekleinanlagen aber schon aufgrund<br />
der Anlagengröße wohl rein theoretischer<br />
Natur. Daher besteht für Anlagenbetreiber<br />
in der Direktvermarktung nur der Vorteil,<br />
dass der anzulegende Wert nicht um 0,2<br />
Cent pro kWh gekürzt wird. Es erscheint<br />
fraglich, ob dieser Vorteil in jedem Fall die<br />
Direktvermarktungskosten decken kann.<br />
Zudem besteht ab einer installierten Leistung<br />
von mehr als 100 kW die Pflicht,<br />
eine Einrichtung für das Einspeisemanagement<br />
vorzuhalten. Dies ist aus drei<br />
Gründen nachteilig: Erstens sind mit einer<br />
solchen Einrichtung Kosten verbunden.<br />
Zweitens verliert der Betreiber seine Vergütung,<br />
solange er die Verpflichtung missachtet.<br />
Drittens kann der Netzbetreiber<br />
die Anlage viel einfacher herunterregeln,<br />
wenn diese dem Einspeisemanagement<br />
unterworfen ist.<br />
Konsequenz: Es wird regelmäßig nicht<br />
tragfähig sein, BHKW mit einer über 100<br />
kW hinausgehenden installierten Leistung<br />
99<br />
Oppmale Beratung<br />
und innovaave<br />
Produkte für Ihre<br />
Fermenter-Bakterien<br />
Höhere Substratausnutzung<br />
Bessere Rührfähigkeit<br />
Stabile biologische Prozesse<br />
Einsparung von Gärrestlager<br />
Senkung der Nährstoffmenge<br />
Repowering der Biologie<br />
Denn Ihre Biogas-Bakterien<br />
können mehr!<br />
energiePLUSagrar GmbH<br />
Tel.: +49 7365 41 700 70<br />
Web: www.energiePLUSagrar.de<br />
E-Mail: buero@energiePLUSagrar.de
Recht<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Ab einer installierten Leistung, die<br />
100 kW übersteigt, besteht die Regel,<br />
dass nur eine Strommenge vergütet<br />
wird, die einer Bemessungsleistung<br />
in Höhe der Hälfte der installierten<br />
Leistung entspricht (doppelte<br />
Überbauung).<br />
Fotos: Martin Bensmann<br />
Schubbodensanierung<br />
in verstärkter<br />
Edelstahl-Lösung<br />
Axel Hagemeier GmbH & Co. KG<br />
Am Wasserfeld 8 • 27389 Fintel<br />
Tel.: 04265 / 13 65<br />
Fax: 04265 / 83 94<br />
E-Mail: info@axel-hagemeier.de<br />
Web: www.axel-hagemeier.de<br />
einzusetzen. Damit gehen Potenziale für eine nachfrageorientierte<br />
und nachhaltige Strom- und Wärmebereitstellung<br />
aus Güllekleinanlagen verloren.<br />
4. Überschreitung der Bemessungsleistung<br />
von 75 kW und Stromeigennutzung<br />
Da nunmehr BHKW eingesetzt werden dürfen, deren<br />
installierte Leistung über die Bemessungsleistung hinausgeht,<br />
stellt sich die Frage, wie es sich vergütungstechnisch<br />
auswirkt, wenn der Anlagenbetreiber mehr<br />
als die vergütungsfähige<br />
Strommenge produziert und<br />
diesen Strom beispielsweise<br />
selber nutzt. In der Abbildung<br />
2 stellt der blaue Bereich<br />
die vergütungsfähige<br />
Bemessungsleistung dar.<br />
Diese Bemessungsleistung<br />
repräsentiert die Strommenge,<br />
die der Betreiber produzieren<br />
würde, wenn er über<br />
das gesamte Jahr 75 kW produziert.<br />
Allerdings steht es<br />
dem Betreiber frei, wann er<br />
die Strommenge erzeugt. Er<br />
kann den Leistungsbereich<br />
seiner Anlage an manchen<br />
Stunden voll ausnutzen und<br />
zu anderen Stunden unterschreiten.<br />
Diese Menge wird<br />
in der Abbildung 2 durch die Kurve und den Bereich<br />
unter der Kurve verdeutlicht.<br />
Problematisch ist, wenn der Betreiber eine höhere<br />
Bemessungsleistung als 75 kW erreicht. Theoretisch<br />
und praktisch könnte der Betreiber sogar eine Bemessungsleistung<br />
von 150 kW erreichen. Diese höhere<br />
Leistung wird durch den roten Bereich in Abbildung 2<br />
dargestellt. Ein Geschäftsmodell könnte so strukturiert<br />
werden, dass der über die Bemessungsleistung hinausgehende<br />
Strom selbst genutzt wird.<br />
Nach der Rechtsauslegung der Autoren sinkt die vergütungsfähige<br />
Strommenge nicht, wenn der Betreiber<br />
die über eine Bemessungsleistung von 75 kW hinausgehende<br />
Strommenge selbst nutzt. Aufgrund der<br />
Rechtsprechung zum KWK-Bonus steht jedoch zu befürchten,<br />
dass die vergütungsfähige Strommenge im<br />
Verhältnis zur Überschreitung gekürzt wird.<br />
Was dies praktisch bedeutet, verdeutlicht das folgende<br />
Beispiel: Im Jahr <strong>2019</strong> produziert der Betreiber<br />
900.000 kWh. Damit überschreitet er die Bemessungsleistung<br />
von 75 kW um 243.000 kWh. Nach der<br />
Auffassung der Autoren hat dies zur Folge, dass der<br />
Betreiber 657.000 kWh voll vergütet bekommt und<br />
den Rest ohne Nachteile selbst nutzen kann. Es steht<br />
jedoch zu befürchten, dass zumindest einzelne Netzbetreiber<br />
den Anteil der Überschreitung berechnen<br />
und um diesen Anteil die zu vergütende Strommenge<br />
kürzen. In dem vorliegenden Fall würde dies bedeuten,<br />
dass die zulässige Strommenge um 36,98 Prozent<br />
überschritten wurde. Daraus könnte folgen, dass die<br />
100
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Recht<br />
zu vergütende Strommenge um 332.820 kWh zu kürzen<br />
ist. Rein fachlich ist dies kaum nachvollziehbar,<br />
allerdings kann diese Rechtsauffassung auf Rechtsprechung<br />
gestützt werden.<br />
Im Ergebnis muss daher geraten werden, dass die produzierte<br />
Menge eine Bemessungsleistung von 75 kW<br />
nicht überschreitet.<br />
5. Fazit<br />
Die jüngste Novelle ist zu begrüßen. Sie bringt für Betreiber<br />
von Güllekleinanlagen, deren Anlagen nach dem<br />
31.12.2016 in Betrieb genommen worden sind und<br />
noch in Betrieb genommen werden, Erleichterungen.<br />
So können etwas größere BHKW eingesetzt werden, die<br />
Flexibilität steigt in engen Grenzen und die Gefahr des<br />
Vergütungsverlustes wegen einer Überschreitung der<br />
installierten Leistung sinkt. Hierfür ist den Bundesländern,<br />
die dies durchgesetzt haben, zu danken.<br />
Bewertet man die Novelle vor dem Hintergrund der<br />
vom Bundesrat genannten Ziele, so zeigt sich, dass<br />
noch weit größere Potenziale hätten gehoben werden<br />
können. So wäre es möglich gewesen, weit größere<br />
Flexibilisierungsgewinne anzustoßen. Dazu hätte allein<br />
der Flexibilitätszuschlag auch auf diese Anlagenklasse<br />
erweitert werden müssen. Denn dann hätten<br />
sich viele der zukünftigen Betreiber dafür entschieden,<br />
Anlagen mit einer installierten Leistung von 150<br />
kW zu errichten. Damit hätten auch diese Anlagen für<br />
eine flexible Strom- und Wärmebereitstellung genutzt<br />
werden können. Zumindest aber wäre es geboten gewesen,<br />
von der Doppelüberbauungsregel über 100 kW<br />
abzusehen, wenn schon der Flexibilitätszuschlag nicht<br />
gewährt wird.<br />
Sachlich kaum nachvollziehbar ist zudem, warum der<br />
Anlagenbetreiber die über die Bemessungsleistung hinausgehende<br />
Strommenge nicht ohne Vergütungsverluste<br />
für die Eigenversorgung nutzen können soll. Hier<br />
erscheint eine Änderung angezeigt.<br />
Das Recht über die Güllekleinanlagen kann für alle jetzigen<br />
und zukünftigen Anlagen transparent, chancengleich<br />
und vor allem einheitlich ausgestaltet werden.<br />
Stattdessen ist aber festzustellen, dass in Abhängigkeit<br />
von der EEG-Fassung, die bei der Inbetriebnahme galt,<br />
unterschiedliche Regelungen anzuwenden sind. Dies<br />
ist umso weniger verständlich, als der Gesetzgeber die<br />
Güllekleinanlagenregelung vorbehaltlich der Vergütung<br />
immer besser ausgestaltet hat. So wurde der Güllebegriff<br />
weiter und die technischen Vorgaben leichter. Daher<br />
wird dafür plädiert, ein einheitliches Recht für alle<br />
zu schaffen.<br />
Zu guter Letzt ist festzustellen, dass die Vergütungsregelung<br />
für Güllekleinanlagen in einigen Fällen eine<br />
wirtschaftliche Option für Bestandsanlagenbetreiber<br />
nach dem Ende der ersten Vergütungsperiode sein<br />
könnte. Daher sollten Regeln geschaffen werden, damit<br />
diese Anlagen durch eine Wechselmöglichkeit in<br />
die Güllekleinanlagenklasse einen hohen Beitrag zum<br />
Klimaschutz auf der Grundlage dieser Förderung erbringen<br />
können.<br />
Autor<br />
René Walter<br />
Leiter des Referats Energierecht und -handel<br />
Dr. Andrea Bauer<br />
Fachreferentin im Referat Energierecht und -handel<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 · 85356 Freising<br />
0 81 61/98 46 60<br />
info@biogas.org<br />
+++ JENBACHER +++ MWM +++ MAN +++ 2G +++ TEDOM +++ SCHNELL +++ DEUTZ +++<br />
WELTWEIT FÜHRENDER WEBSHOP<br />
FÜR BHKW ERSATZTEILE<br />
SONDERPREISE ONLINE »<br />
+++ ZÜNDKERZEN +++ FILTER +++ DICHTUNGEN +++ MOTORENTEILE +++ ORIGINAL & OEM +++<br />
101
IMPRESSUM<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Elektro<br />
Hagl<br />
Ihr Partner<br />
in Sachen<br />
BHKW<br />
Komplettmodule 50kW-530kW<br />
Gas & Diesel Service<br />
+ Motoren Generatoren<br />
+ Notstromaggregate<br />
+ Schaltanlagen<br />
www.biogas-hagl.de · T. 0 84 52 . 73 51 50<br />
Abgaskatalysatoren<br />
Für alle in Deutschland zugelassenen BHKWs<br />
Hohe Lebensdauer durch hervorragende<br />
Schwefelresistenz. In Deutschland gefertigt<br />
Zu sehr günstigen Preisen (netto inkl. Fracht)<br />
Schnell bis 265 kW ab 2.990 €<br />
Fordern Sie Ihr konkretes Angebot an unter<br />
www.ilmaco-vertrieb.de<br />
ILMACO Vertrieb oHG mb@ilmaco.de<br />
Fischerstr. 13 · 84137 Vilsbiburg · (0176) 476 494 69<br />
IMPRESSUM<br />
Herausgeber:<br />
Fachverband Biogas e. V.<br />
Dr. Claudius da Costa Gomez (V.i.S.d.P.)<br />
Andrea Horbelt (redaktionelle Mitarbeit)<br />
Angerbrunnenstraße 12 · 85356 Freising<br />
Tel. 0 81 61/98 46 60<br />
Fax: 0 81 61/98 46 70<br />
E-Mail: info@biogas.org<br />
Internet: www.biogas.org<br />
ISSN 1619-8913<br />
Redaktion:<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Fachverband Biogas e. V.<br />
Tel. 0 54 09/9 06 94 26<br />
E-Mail: martin.bensmann@biogas.org<br />
Anzeigenverwaltung & Layout:<br />
bigbenreklamebureau GmbH<br />
An der Surheide 29 · 28870 Ottersberg-Fischerhude<br />
Tel. 0 42 93/890 89-0<br />
Fax: 0 42 93/890 89-29<br />
E-Mail: info@bb-rb.de<br />
Internet: www.bb-rb.de<br />
Franz Eisele u. Söhne GmbH & Co. KG<br />
www.eisele.de<br />
Druck: Druckhaus Fromm, Osnabrück<br />
Das BIOGAS Journal erscheint sechsmal im Jahr auf Deutsch.<br />
Zusätzlich erscheinen zwei Ausgaben in englischer Sprache.<br />
Pumpen & Rührwerke<br />
Hauptstrasse 2-4 72488 Sigmaringen Tel.: +49 (0)7571 / 109-0 info@eisele.de<br />
Rechtsanwälte und Notare<br />
Seit vielen Jahren beraten und vertreten wir vornehmlich<br />
Betreiber und Planer kompetent und umfassend im<br />
- Recht der Erneuerbaren<br />
- Energien<br />
- Vertragsrecht<br />
- Gewährleistungsrecht<br />
- Energiewirtschaftsrecht<br />
- Umweltrecht<br />
- Immissionsschutzrecht<br />
- öffentlichen Baurecht<br />
- Planungsrecht<br />
Kastanienweg 9, D-59555 Lippstadt<br />
Tel.: 02941/97000 Fax: 02941/970050<br />
Ihre Ansprechpartner:<br />
RAuN Franz-Josef Tigges*<br />
RAuN Andreas Schäfermeier**<br />
RA W. Andreas Lahme*<br />
RA Dr. Oliver Frank*<br />
RA Martina Beese<br />
RA Dr. Mathias Schäferhoff<br />
RA Daniel Birkhölzer*<br />
RAuN Katharina Vieweg-Puschmann LL.M.<br />
Maîtrise en droit<br />
* Fachanwalt für Verwaltungsrecht<br />
** Fachanwalt für Insolvenzrecht<br />
kanzlei@engemann-und-partner.de<br />
www.engemann-und-partner.de<br />
Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich<br />
geschützt. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben<br />
die Meinung des Verfassers wieder, die nicht unbedingt mit der<br />
Position des Fachverbandes Biogas e.V. übereinstimmen muss.<br />
Nachdruck, Aufnahme in Datenbanken, Onlinedienste und Internet,<br />
Vervielfältigungen auf Datenträgern wie CD-Rom nur nach vorheriger<br />
schriftlicher Zustimmung. Bei Einsendungen an die Redaktion<br />
wird das Einverständnis zur vollen oder auszugsweisen Veröffentlichung<br />
vorausgesetzt. Für unverlangt eingehende Einsendungen<br />
wird keine Haftung übernommen. Die Redaktion behält sich vor,<br />
Leserbriefe sinnerhaltend zu kürzen.<br />
102
Denken Sie schon jetzt<br />
an Ihren Frühbezug!<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Recht<br />
Damit Technik funktioniert!<br />
Motorentechnik<br />
– Zündtechnik<br />
– Injektoren / PDE<br />
– Filtertechnik<br />
– Reparaturteile<br />
(für alle Fabrikate)<br />
– Turbolader<br />
TEC<br />
INNOVATIVE TECHNIK DURCH KOMPETENZ<br />
Anlagentechnik<br />
– Rührwerkstechnik / Separatoren<br />
– Pumpentechnik<br />
– Sensoren / Aktoren<br />
– Mess- und Dosiertechnik<br />
– Ersatzteile für Aggregate<br />
Einfach eine<br />
runde Sache!<br />
Hocheffiziente Spurenelemente mit<br />
höchster biologischer Verfügbarkeit<br />
Keine versteckten Gefahren wie<br />
Stäube oder versehentlich<br />
angerissene Säcke<br />
Transparente Zusammensetzung und<br />
Anpassung<br />
Schutz vor Ausfällung durch Schwefel<br />
fermentierbare Folie, staubfrei<br />
Einfache, CO2-freundliche<br />
Lieferung per Paketdienst,<br />
keine Palettierung mehr<br />
Einfache, sichere und<br />
kräfteschonende Anwendung<br />
Agrartechnik<br />
– Rührwerkstechnik<br />
– Gülletechnik<br />
(stationär / mobil)<br />
– Hydraulik- und<br />
Drucklufttechnik<br />
– Verschleißteile für<br />
Erntetechnik<br />
– Ersatzteile für<br />
Landtechnik<br />
blue<br />
OXY-BARRIER<br />
blue<br />
OXY-BARRIER<br />
Gewährleistet die UV-Stabilität<br />
Sorgt für eine extreme Dehn- und Reißfestigkeit<br />
Verleiht eine einzigartige Geschmeidigkeit<br />
Verbindet die Schichten miteinander<br />
Gewährleistet eine extrem hohe Sauerstoffbarriere<br />
Verbindet die Schichten miteinander<br />
Verleiht eine einzigartige Geschmeidigkeit<br />
Sorgt für eine extreme Dehn- und Reißfestigkeit<br />
Gewährleistet die UV-Stabilität<br />
ca. 100x gasdichter als erkömmliche<br />
– den DLG-Anforderungen<br />
entsprechende – Silofolie<br />
einfacheres, schnelleres Verlegen<br />
sehr hohe Energiedichte in der Silage<br />
normale Größe: bis 32 m Breite<br />
Überbreite: bis 64 m Breite<br />
bis 400 m Länge<br />
extrem belastbare und<br />
dehnfähige Folie<br />
weniger Nacherwärmung<br />
weniger Schimmelbildung<br />
18 Monate UV-stabil<br />
Beständig gegenüber Temperatur<br />
und Gärsäuren<br />
SaM-Power GmbH<br />
Schmiedestraße 9 · 27419 Sittensen - Lengenbostel<br />
Fon: (0 42 82) 6 34 99 - 10 · Fax: (0 42 82) 6 34 99 - 19<br />
Mail: info@sam-power.de · www.sam-power.de 103
Recht<br />
Biogas Journal | 2_<strong>2019</strong><br />
Buchen Sie Ihre Emissionsmessung<br />
bei Emission Partner!<br />
Sichern Sie sich jetzt einen Messtermin bei Emission Partner<br />
und profitieren Sie von folgenden Vorteilen:<br />
Sofortige Rückmeldung über<br />
Ergebnisse durch begleitende<br />
Formaldehyd-Direktmessung<br />
Um die Emissionsmessung sicher<br />
und stressfrei zu bestehen, muss<br />
diese optimal vorbereitet sein<br />
– Wir beraten Sie gerne!<br />
Reduzieren Sie Ihren Aufwand<br />
durch konstante Messtermine –<br />
damit sparen Sie jährlich 50 €<br />
je Motor mit unserem<br />
Dreijahresvertrags-Angebot<br />
Haben Sie Fragen?<br />
Wir helfen Ihnen gerne weiter.<br />
Sprechen Sie uns an!<br />
104<br />
Emission Partner GmbH & Co. KG<br />
Industriestraße 5<br />
D-26683 Saterland-Ramsloh<br />
Telefon: +49 4498 92 326 - 26<br />
E-Mail: info@emission-partner.de<br />
Web: www.emission-partner.de