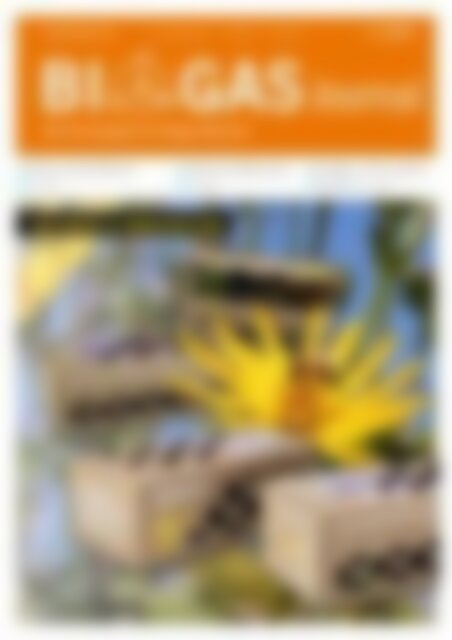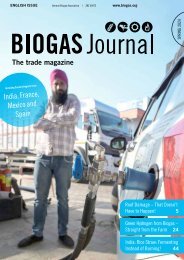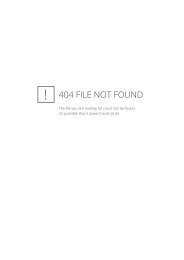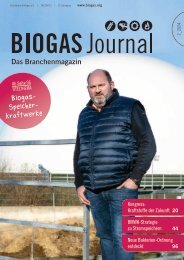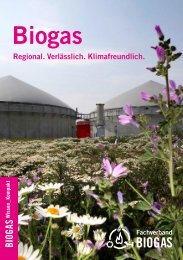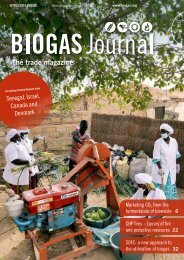6_2020 Leseprobe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
www.biogas.org Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 50073 | 23. Jahrgang<br />
6_<strong>2020</strong><br />
Bi<br />
GaS Journal<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche<br />
Status quo EEG-Novelle<br />
S. 52<br />
Biodiverser Maisanbau<br />
S. 86<br />
EinsMan: 100 % geltend<br />
machen S. 116<br />
Technik & Innovation<br />
ab Seite 56
Inhalt<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Alles aus einer Hand -<br />
Ihren Anforderungen entsprechend!<br />
Adsorber<br />
Produktion<br />
Flachbett- &<br />
Schüttbettadsorber<br />
auf Basis<br />
nachwachsender<br />
Rohstoffe<br />
Kunststoff &<br />
Edelstahl<br />
Aktivkohle-Wechsel<br />
kurze<br />
Reaktionszeit<br />
Entsorgung<br />
inkl. Nachweis<br />
kurze Lieferzeiten<br />
flexible<br />
Liefermengen<br />
Logistik<br />
Auslegung inkl.<br />
Standzeitberechnung<br />
Optimierungsberatung<br />
Qualitätskontrolle<br />
Service<br />
Labor<br />
Beladungsuntersuchung<br />
Natürlich besser!<br />
• Dotierte Aktivkohle<br />
zur Entschwefelung &<br />
Reinigung von technischen<br />
Gasen<br />
• entfernt zusätzlich in<br />
einem Schritt Siloxane,<br />
VOC´s und Mercaptane<br />
• hergestellt in Deutschland<br />
• lange Standzeiten, weniger<br />
Wechsel<br />
Sparen Sie Kohle und sichern Sie sich ihr Angebot!<br />
AdFiS products GmbH<br />
Am Kellerholz 14<br />
2<br />
D-17166 Teterow<br />
Telefon: +49 (0) 3996 15 97-0<br />
Fax: +49 (0) 3996 15 97-99<br />
E-Mail: sales@adfis.de<br />
web: www.adfis.de
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Editorial<br />
Es geht weiter!<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
wieder halten Sie ein Biogas Journal in den Händen, das<br />
prall gefüllt ist mit Berichten zu Innovationen der Branche:<br />
Papier aus Silphie-Fasern, Neues zur Gärproduktaufbereitung,<br />
Strohvergärung etc.<br />
Wahrscheinlich geht es Ihnen auch so, dass Sie nicht alles,<br />
was interessant wäre, lesen können, weil es ja auch<br />
noch so viel anderes zu tun gibt. Aber auch dieses Biogas<br />
Journal zeigt wieder, wie viel Kraft in der Branche steckt.<br />
Auch wenn die Zeiten für Biogas sehr lange alles andere<br />
als rosig waren, haben die Betreiber und die Firmen gezeigt,<br />
wie viele Ideen sie haben und vor allem, dass sie sie<br />
verwirklichen können.<br />
Und weil wir alle einen langen Atem haben, ist es auch gelungen,<br />
zum ersten Mal seit dem EEG 2012 substanzielle<br />
Verbesserungen im EEG 2021 zu erreichen. Während ich<br />
diese Zeilen schreibe, ist die Novelle nicht abgeschlossen,<br />
aber schon jetzt ist klar, dass es eine Anhebung der<br />
Gebotshöchstwerte geben wird, dass die Flexibilitätsprämie<br />
angehoben wird, der Flexdeckel weg ist und ein Pfad<br />
für die Ausschreibungsmenge festgelegt wurde. Das sind<br />
sehr gute Zeichen. Sicher, es fehlt noch an vielen Details<br />
und ganz sicher werden wir trotz intensiver Arbeit in<br />
Berlin im parlamentarischen Verfahren nicht alle unsere<br />
Forderungen durchsetzen können. Aber die Politik gibt<br />
uns das Signal, dass die Biogasbranche gebraucht wird.<br />
Darauf haben wir Jahre hin gearbeitet. Erst haben wir,<br />
trotz heftiger Diskussionen innerhalb der Branche, die<br />
Anschlussregelungen mit den ungeliebten Ausschreibungen<br />
im EEG 2017 durchgesetzt und nun ist es nach nochmal<br />
drei Jahren Arbeit gelungen, Verbesserungen in den<br />
Ausschreibungsbedingungen, den Gebotshöchstwerten<br />
und der Flexprämie zu erreichen. Das zeigt, dass sich ein<br />
langer Atem und Glaubwürdigkeit auszahlen.<br />
Der lange Atem zeigt sich auch daran, dass wir in diesem<br />
Jahr die 30. Biogas Jahrestagung – oder wie wir ja nun sagen<br />
– Biogas Convention erleben werden. Und in diesem<br />
für uns alle sehr besonderen Jahr erstmals digital. Gewünscht<br />
hätten wir alle uns das anders, aber: Wir können<br />
auch digital! Und so freuen wir uns, Sie vom 16. bis 20.<br />
November online zu Vorträgen, Diskussionen und Workshops<br />
einladen zu können. Ein wesentlicher Bestandteil,<br />
die persönlichen Kontakte, wird dieses Jahr etwas trockener<br />
sein, aber Informationsaustausch und Diskussionen<br />
können wir alle auch online. Das haben wir bereits seit April<br />
in vielen Gremiensitzungen, Vorträgen und Seminaren<br />
geübt und so nebenbei auch viel CO 2<br />
und Zeit gespart. Mit<br />
Corona wird es anders sein als ohne Corona. Wir machen<br />
gemeinsam das Beste daraus und werden uns auch in<br />
Zukunft gut vernetzen.<br />
Damit Sie noch leichter und überall auf dem Laufenden<br />
bleiben, bieten wir unseren Mitgliedern über die App<br />
Airfarm seit Mitte Oktober auch eine Plattform auf dem<br />
Smartphone an, mit der Sie alle aktuellen Mitgliederinformationen<br />
abrufen können. Die Mitglieder des Fachverbandes<br />
Biogas haben hierzu alle Informationen erhalten.<br />
Laden Sie sich die App auf Ihr Telefon, loggen Sie sich ein<br />
und seien Sie so immer up to date.<br />
Das Jahr <strong>2020</strong> wird für die Biogasbranche ein besonderes<br />
bleiben. Mit Corona haben wir gelernt, auch mit Abstand<br />
effizient zu arbeiten. Aber die wichtigste Biogas-Botschaft<br />
ist, dass es weitergeht. Die Politik hat verstanden, dass es<br />
nicht nur um Cent pro Kilowattstunde geht, sondern um<br />
Systemrelevanz – und auch die können wir!<br />
Herzlichst Ihr<br />
Dr. Claudius da Costa Gomez,<br />
Hauptgeschäftsführer<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
3
Inhalt<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
12 42<br />
titelcollage: OutNature GmbH, Fachverband Biogas e.v. i Fotos: www.landpixel.eu, Dierk Jensen, Christian Dany<br />
Editorial<br />
3 Es geht weiter!<br />
Von Dr. Claudius da Costa Gomez<br />
Hauptgeschäftsführer<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
AKTUELLES<br />
6 Meldungen<br />
8 Bücher & Termine<br />
10 Biogas-Kids<br />
12 Alternative Energiepflanzen sind<br />
gut für den Grundwasserschutz<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
18 Gärprodukte: Rohstoffe wiedergewinnen<br />
heißt Zukunft sichern<br />
Von Dipl.-Ing. Heinz Wraneschitz<br />
22 Strohtagung Teil 1<br />
Gärsubstrate – Nährstoffgehalte<br />
ermitteln ist sinnvoll<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
26 Strohtagung Teil 2<br />
Gülleausbringung: Ertragsunterschiede im<br />
Silomaisversuch aufgrund der eingesetzten<br />
Technik<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
30 Strohtagung Teil 3<br />
Körnermaisstroh als alternatives<br />
Gärsubstrat ernst nehmen<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
34 Strohtagung Teil 4<br />
Wildpflanzen sorgen für niedrige<br />
N min<br />
-Werte<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
36 Alle Ressourcen für null Emissionen<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
42 Grüne Wärme ganz normal<br />
Von Dierk Jensen<br />
46 Auf dem Weg zum „grünen“ Gas?<br />
Von Thomas Gaul<br />
50 BIOGAS Convention <strong>2020</strong> &<br />
BIOGAS Convention International <strong>2020</strong><br />
POLITIK<br />
52 Gesetzesentwurf EEG 2021:<br />
Verhaltene Aufbruchstimmung<br />
Von Sandra Rostek und Dr. Guido Ehrhardt<br />
Beilagenhinweis:<br />
Das Biogas Journal enthält Beilagen<br />
der Firmen agrikomp, AWITE,<br />
HR-Energiemanagement, ONERGYS, wattline<br />
und des Fachverbandes Biogas e.V.<br />
4
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Inhalt<br />
Technik<br />
und<br />
Innovation<br />
Titelthema<br />
56 Silphiefasern für Verpackungsmaterial:<br />
eine Riesenchance!?<br />
Von Christian Dany<br />
62 BioBF – ein biologischer Entschwefelungsfilter<br />
für Biogas<br />
Von EUR ING Marie-Luise Schaller<br />
66 Innovatives Verfahren zum<br />
Entfernen von Stickstoff<br />
Von Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ.<br />
Von Thomas Gaul<br />
PRAXIS<br />
72 Perspektiven für neue Generation?<br />
Von Dierk Jensen<br />
76 Versicherungen in der Landwirtschaft<br />
Von Hans-Gerd Behrens<br />
80 Projekt ZertGas – Halbzeitbericht<br />
Von Dr. Stefan Rauh<br />
82 Anlagen des Monats<br />
84 Alle Zuschüsse zum Nährstoffmanagement<br />
auf einen Blick<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
56<br />
WISSENSCHAFT<br />
86 Mischanbau kann den Silomaisanbau<br />
ökologisch verträglicher machen<br />
Von Vanessa Schulz<br />
INTERNATIONAL<br />
92 Netzausbau: Ein Missing Link weniger<br />
Von Dierk Jensen<br />
96 Grüne Regierung, (kein?) grünes Gasnetz<br />
Von Christian Dany<br />
VERBAND<br />
Aus der Geschäftsstelle<br />
102 EEG-Novelle: Notwendige Trendwende<br />
oder Strohfeuer?<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
106 Aus den Regionalbüros<br />
110 Bürgerenergie als tragende Säule<br />
der Energiewende ausbauen<br />
Von Dr. Simone Peter, BEE<br />
92<br />
111 Der Weg vom Rodler zum<br />
Biogasbotschafter<br />
112 Signifikanter Rückgang der Prüfungen<br />
mit Mängeln<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
RECHT<br />
116 EinsMan-Entschädigung: 100 Prozent<br />
der entgangenen Einnahmen geltend<br />
machen<br />
Von Pavlos Konstantinidis<br />
und Dr. Florian Valentin<br />
produktnews<br />
120 Produktnews<br />
122 Impressum<br />
5
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Klimaschutz im Verkehr: Anteil der Erneuerbaren<br />
stagniert auf niedrigem Niveau<br />
Berlin – Beim Einsatz Erneuerbarer Energien wurden im<br />
vergangenen Jahr keine Fortschritte erzielt. Deren Anteil<br />
stagnierte bei 5,6 Prozent. Das zeigt das neue Hintergrundpapier<br />
der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE). „Der<br />
Verkehr ist und bleibt das Sorgenkind beim Klimaschutz.<br />
Der Trend zeigt seit Jahren in die falsche Richtung. Im<br />
Jahr 2019 stiegen die CO 2<br />
-Emissionen in diesem Sektor<br />
um mehr als eine Million Tonnen“, sagt Dr. Robert Brandt,<br />
Geschäftsführer der AEE.<br />
Biokraftstoffe machen den Löwenanteil unter den klimafreundlichen<br />
Energieträgern aus. „Auch in Zukunft<br />
werden Elektromobilität und Wasserstoff alleine nicht ausreichen,<br />
um die CO 2<br />
-Emissionen im Verkehr schnell und<br />
nachhaltig zu senken. Biokraftstoffe werden weiterhin gebraucht<br />
und könnten sogar noch mehr leisten“, so Brandt<br />
weiter. Biodiesel und Bioethanol aus regionalen Quellen<br />
erbringen im Moment noch den größten Beitrag zur Einsparung<br />
von Klimagasen im Verkehr.<br />
Biokraftstoffe vermieden im Jahr 2019 fast 8 Millionen Tonnen<br />
CO 2<br />
. Der Klimavorteil von Diesel und Benzin aus Raps,<br />
Zuckerrüben, Altspeisefett, Stroh und Co. gegenüber den<br />
fossilen Kraftstoffen hat sich in den vergangenen Jahren<br />
immer weiter verbessert. Verursachten die Biokraftstoffe im<br />
Jahr 2014 im Durchschnitt nur etwa halb so viele Emissionen,<br />
so waren es im Jahr 2018 bereits 84 Prozent weniger.<br />
Biokraftstoffe leisten aber nicht nur einen wichtigen Beitrag<br />
zum Klimaschutz. In der Diskussion um Biokraftstoffe wird<br />
häufig übersehen, dass Biodiesel und Bioethanol Koppelprodukte<br />
sind. Der größte Teil des geernteten Rapses wird<br />
zu proteinreichem Futtermittel verarbeitet: Die Ernte wird<br />
in Ölmühlen gepresst. Zu etwa 40 Prozent entsteht Rapsöl,<br />
das als Nahrungsmittel dient oder zu Biodiesel veredelt werden<br />
kann. Die verbleibenden 60 Prozent werden als Eiweißfuttermittel<br />
an Schweine, Rinder und Hühner verfüttert. Die<br />
heimische Biokraftstoffproduktion macht Deutschland somit<br />
unabhängiger von Kraftfutterimporten. Statt 3,6 Millionen<br />
Tonnen Soja müssten 5,4 Millionen Tonnen importiert<br />
werden, vor allem aus den USA und Südamerika. Nicht zu<br />
vergessen ist, dass der Anbau von Raps, Zuckerrübe & Co. in<br />
Deutschland gentechnikfreie tierische Produkte ermöglicht.<br />
Zusätzlich liefern sie wertvolle Nebenprodukte wie hochwertiges<br />
Glycerin, das zum Beispiel eine wichtige Zutat in<br />
Waschmitteln oder Zahnpasta ist.<br />
Um die Klimaschutzziele im Verkehr zu erreichen, müssen<br />
neben dem Einsatz von Biokraftstoffen und dem Ausbau<br />
der Elektromobilität noch weitere Maßnahmen ergriffen<br />
werden. „Zur Verkehrswende gehören nicht nur neue Kraftstoffe<br />
und Antriebe. Damit die Erneuerbaren Energien voll<br />
durchschlagen können, müssen auch Verkehrsvermeidung<br />
und Verkehrsverlagerung stärker vorangebracht werden“, so<br />
Brandt.<br />
grafiken: AEE<br />
6
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Aktuelles<br />
CO 2<br />
-Emisionen in diesem Jahr<br />
um 22 Prozent gesunken<br />
Foto: Adobe Stock_Tierney<br />
Berlin – Der CO 2<br />
-Ausstoß der Stromerzeugung<br />
in Deutschland ist in den ersten<br />
drei Quartalen <strong>2020</strong> im Vergleich<br />
zum Vorjahr um 22 Prozent zurückgegangen.<br />
Wie vorläufige Berechnungen<br />
des Bundesverbandes der Energie- und<br />
Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) zeigen,<br />
wurden in den ersten drei Quartalen<br />
dieses Jahres in der Stromerzeugung<br />
36 Millionen Tonnen weniger CO 2<br />
ausgestoßen<br />
als im selben Zeitraum des<br />
Vorjahres. Dies bedeutet einen Rückgang<br />
von 22 Prozent.<br />
Verantwortlich dafür sind zum einen<br />
der durch die Corona-Pandemie gesunkene<br />
Stromverbrauch der Industrie,<br />
zum anderen aber auch der gestiegene<br />
Beitrag Erneuerbarer Energien an der<br />
Stromerzeugung. Auch die spezifischen<br />
Emissionen der Stromerzeugung<br />
sind gegenüber dem Vorjahr weiter gesunken:<br />
Wurden im Jahr 2019 noch 0,39 Kilogramm<br />
(kg) CO 2<br />
pro Kilowattstunde (kWh) Strom ausgestoßen,<br />
waren es in diesem Jahr bislang nur 0,33 kg CO 2<br />
/kWh.<br />
Hochgerechnet auf das Kalenderjahr könnte die Minderung<br />
bei der Stromerzeugung laut der Berechnung<br />
bei einem saisonal üblichen Verlauf der Emissionen<br />
im Vergleich zum Jahr 1990 47 Prozent betragen. Der<br />
Großteil dieser Minderung wurde durch die Kraftwerke<br />
der Energiewirtschaft erbracht. „Keine andere Branche<br />
hat es in den vergangenen Jahren geschafft, den<br />
CO 2<br />
-Ausstoß so stark zu reduzieren wie die Energiewirtschaft.<br />
Allerdings ist uns bewusst, dass ein großer<br />
Teil des diesjährigen Rückgangs der Corona-Pandemie<br />
zuzuschreiben ist. Es ist klar, dass wir uns auf dem bislang<br />
Erreichten nicht ausruhen können. Das gilt auch<br />
mit Blick auf die geplante Erhöhung des EU-Treibhausgas-Reduktionsziels<br />
auf 55 Prozent bis 2030“,<br />
sagt Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung.<br />
„Aber: Auch andere Sektoren müssen ihren Beitrag<br />
leisten: Das Sorgenkind bleibt weiterhin der Verkehrssektor.<br />
In diesem Bereich gab es seit 1990 so gut wie<br />
keine Minderung der CO 2<br />
-Emissionen.Hier sind E-Autos<br />
der Schlüssel. Die Energiewirtschaft steht bereit,<br />
mit der notwendigen Ladeinfrastruktur der Elektromobilität<br />
zum Durchbruch zu verhelfen. Im Wärmesektor,<br />
der im Jahr 2019 immerhin schon 42 Prozent Emissionsminderung<br />
gegenüber 1990 verzeichnete, gibt es<br />
noch erhebliches Einsparpotenzial. Deshalb brauchen<br />
wir eine konsequente Wärmewende.“<br />
Leserbrief<br />
Im Biogas Journal 5_20 ist auf den Seiten 52 bis 54 der Artikel „Gärprodukt<br />
– ein Reststoff mit Potenzial“ abgedruckt. Darin heißt es auf<br />
Seite 52, linke Spalte: […]„Bundesministerin Julia Klöckner hat erst<br />
Anfang August wieder darauf hingewiesen, dass die Nutzung von Torf<br />
mit 2 Prozent zum Ausstoß von klimawirksamen Gasen in Deutschland<br />
beitrage“[…].<br />
Unser Leser Dr. Arne B. Hückstädt vom Industrieverband Garten e.V.<br />
(www.ivg.org) merkt dazu an:<br />
„Um diese Aussage von Bundesministerin Julia Klöckner zu widerlegen,<br />
hat der Industrieverband Garten (IVG) e.V. eine Studie beim Ingenieurbüro<br />
Hofer & Pautz beauftragt. Ergebnis: Der Wert vom Bundeslandwirtschaftsministerium<br />
(BMEL) ist viel zu hoch angesetzt, der CO 2<br />
-Ausstoß<br />
durch Torf liegt nur bei 0,13 Prozent und beträgt damit ein Sechzehntel<br />
des veröffentlichten Werts. Die Studie weist unter anderem darauf hin,<br />
dass die vom BMEL zugrunde gelegten Berechnungen auf zu viel Abbauflächen<br />
beruhen und fälschlich auch Emissionen von importiertem Torf<br />
mit einfließen, die eigentlich dem Abbauland zugerechnet werden müssen.<br />
Zudem weist die Studie aus, dass sich das in Deutschland abgebaute<br />
Torfvolumen in den vergangenen Jahren stark reduziert hat, und damit<br />
auch die daraus resultierenden Treibhausgas-Emissionen. Sie lagen von<br />
2017 bis 2019 im Schnitt bei 1,13 Millionen Tonnen CO 2<br />
-Äquivalent,<br />
2012 noch bei über 1,7 Millionen Tonnen CO 2<br />
-Äquivalent.“<br />
7
Aktuelles Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Bücher<br />
Wie weiter nach dem EEG?<br />
Neu ist der Leitfaden<br />
„Biogas nach dem<br />
EEG – (wie) kann’s<br />
weitergehen? Handlungsmöglichkeiten<br />
für Anlagenbetreiber“.<br />
Darin werden im Detail<br />
sieben Zukunftskonzepte<br />
vorgestellt:<br />
--<br />
Teilnahme an Ausschreibung,<br />
--<br />
Bereitstellung von Kraftstoff,<br />
--<br />
Neubau Gülle-Kleinanlage,<br />
--<br />
Eigenverbrauch und Direktlieferung,<br />
--<br />
rohgasseitige Bündelung,<br />
--<br />
Zusammenschluss der Anlagenbetreiber<br />
--<br />
und Stoffliche Nutzung.<br />
Ein Kapitel widmet sich zudem dem Vorgehen<br />
bei der Stilllegung, Umnutzung und<br />
dem Rückbau einer Biogasanlage, wenn<br />
kein Weiterbetrieb möglich ist. Durch die<br />
praxisnahe Methodik können Anlagenbetreiber<br />
selbst Maßnahmen identifizieren,<br />
um den Zustand ihrer Biogasanlage zu<br />
bewerten, Zukunftsoptionen ableiten und<br />
die notwendigen Umsetzungsmaßnahmen<br />
ausarbeiten. Der Leitfaden soll allen Biogasanlageneigentümern,<br />
-betreibern und<br />
Beratern helfen, die Zukunftsfähigkeit der<br />
Anlagen abzuschätzen.<br />
68 Seiten, DIN A4, Klebebindung.<br />
Verfügbar unter: www.carmen-ev.de oder<br />
www.thi.de/go/energie oder www.ifeu.de<br />
BImSchG-Kommentar<br />
Der bewährte Handkommentar<br />
erläutert<br />
das Bundes-Immissionsschutzgesetz<br />
(BImSchG) aktuell,<br />
kompetent und zuverlässig.<br />
Er ist perfekt<br />
auf die Bedürfnisse<br />
des Praktikers zugeschnitten<br />
und bietet pragmatische, eng an<br />
der Rechtsprechung orientierte Lösungen.<br />
Ein ausführliches Sachverzeichnis rundet<br />
den Kommentar ab. Die 13. Auflage berücksichtigt<br />
die Auswirkungen des Planungssicherstellungsgesetzes<br />
vom 20. Mai <strong>2020</strong><br />
auf das Immissionsschutzrecht. Außerdem<br />
werden zahlreiche weitere aktuelle Neuerungen<br />
seit der Vorauflage behandelt:<br />
--<br />
Änderung des §47 BImSchG (Luftreinhaltepläne,<br />
Pläne für kurzfristig zu<br />
ergreifende Maßnahmen, Landesverordnungen)<br />
durch Gesetz vom 8. April<br />
2019.<br />
--<br />
Neue 44. BImSchV (Verordnung über<br />
mittelgroße Feuerungs-, Gasturbinenund<br />
Verbrennungsmotoranlagen) vom<br />
13. Juni 2019, die für viele Anlagenbetreiber<br />
zum Beispiel neue Anzeige-,<br />
Aufzeichnungs-, Nachweis- und Aufbewahrungspflichten<br />
mit sich bringt.<br />
--<br />
Änderung der 1. BImSchV (Verordnung<br />
zur Durchführung der Verordnung über<br />
kleine und mittlere Feuerungsanlagen)<br />
vom 13. Juni 2019.<br />
--<br />
Aktuelle Rechtsprechung zu Luftreinhaltung<br />
und Dieselfahrverboten.<br />
--<br />
Weitere aktuelle immissionsschutzrechtliche<br />
Rechtsprechung, zum<br />
Beispiel zu Windenergieanlagen und<br />
Störfallanlagen.<br />
Verlag C.H. Beck.<br />
BImSchG-Kommentar, Hans D. Jarass,<br />
13. Auflage, Buch Hardcover, 159 Euro.<br />
ISBN 978-3-406-75344-2<br />
termine<br />
2. bis 4. November<br />
Qualifizierung für Beschäftigte an<br />
Biogasanlagen<br />
www.klimaschutz-leb.de<br />
18. November<br />
Biogas-Fachtagung<br />
Westerheim<br />
www.renergie-allgaeu.de<br />
1. Dezember<br />
Web-Seminar: Strom- und Energiesteuer<br />
für Biogasanlagenbetreiber<br />
www.biogas.org/Verband Service GmbH<br />
3. November<br />
Web-Seminar: Typische BHKW-Schäden<br />
und ihre Vermeidbarkeit<br />
www.biogas.org/Verband/Service GmbH<br />
24. und 25. November<br />
13. Biogas-Innovationskongress<br />
ONLINE<br />
www.biogas-innovationskongress.de<br />
1. bis 4. Dezember<br />
pollutec<br />
Lyoon EUREXPO France<br />
www.reedexpo.de<br />
4. bis 5. November<br />
Biogas INTENSIV – Anlagensicherheit<br />
Kirchberg/Jagst<br />
www.ibbk-biogas.de<br />
5. November<br />
Auffrischungsseminar Betriebssicherheit<br />
gemäß TRGS 529 und TRAS 120<br />
Büdelsdorf bei Rendsburg<br />
www.heidehof.de<br />
9. bis 13. November<br />
AHK-Geschäftsreise Kuba – Erneuerbare Energien<br />
und Energieeffizienz in der Industrie<br />
Havanna<br />
www.energiewaechter.de<br />
23. bis 26. November<br />
AHK-Geschäftsreise „Biogas: Anlage, Gasaufbereitung<br />
und Effizienzsteigerung<br />
in China“<br />
www.german-energy-solutions.de<br />
18 – 20 November <strong>2020</strong>, Hanover, Germany<br />
16. bis 20. November<br />
BIOGAS Convention <strong>2020</strong> goes virtual<br />
ONLINE<br />
www.biogas-convention.com<br />
3. Dezember<br />
Biogas-BHKW – kostenoptimal fahren,<br />
auch im Flexbetrieb<br />
Seddiner See<br />
www. klimaschutz-leb.de<br />
8. bis 10. Dezember<br />
BIOGAS Convention <strong>2020</strong> International<br />
goes virtual<br />
www.biogas-convention.com<br />
8
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Aktuelles<br />
GOETZE ® Industrial Spark Plugs:<br />
Leading Lifetime and Durability.<br />
Designed for industrial gas engines and suitable for power generation<br />
applications, including natural gas, biogas, landfill gas and mine<br />
gas, the new GOETZE ® -branded industrial spark plugs provide a<br />
valuable solution to end users looking for a suitable and capable<br />
OE replacement part. Installation and removal are easier thanks<br />
to a design that makes the familiar 7/8-inch (22.2mm) hexagon<br />
much higher, giving installation tools a stronger grip. Large, smooth<br />
insulators using stronger ceramics and a more robust steel shell<br />
enable outstanding durability and industry leading lifetime in open<br />
chamber applications.<br />
9
Aktuelles<br />
BIOGAS-KIDS<br />
BIOGAS-KIDS Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Viele Landwirte machen sich Gedanken um das Tierwohl in ihren Ställen. Bei den Rindern oder Milchkühen<br />
ist dabei der Liegekomfort in den Boxen ein wichtiger Bereich. Und so wie der Mensch sich im Urlaub<br />
gerne an einen schönen Sandstrand legt, schätzen es auch die Kühe, auf Sand zu stehen, zu laufen und<br />
natürlich zu liegen. Außerdem schont der Untergrund das Euter vor Entzündungen und auch an den<br />
Klauen sorgt der Sand für gesunde Füße, wenn die Kühe immer auf weichem und trockenem Boden lau-<br />
fen. Denn der Sand saugt auch das weg, was die Kühe regelmäßig hinterlassen: Kot und Harn, die sich<br />
üblicherweise unter dem Spaltenboden als Gülle sammeln. Du weißt, Gülle ist ein prima Rohstoff für die<br />
Biogasanlage. Verschmutzt mit dem Sand geht das nicht so einfach, weil dieser bei der Biogasproduktion<br />
nichts zu suchen hat. Aber es funktioniert trotzdem!<br />
Der Nachteil bei dem Sandbett ist, dass<br />
es für die Tiere regelmäßig gegen frische Körner<br />
ausgetauscht werden muss. Also schmutziger<br />
Sand raus aus dem Stall – sauberer Sand<br />
wieder rein in den Stall. Das macht viel Arbeit<br />
und ist auch noch teuer. Besonders in einem<br />
Kuhbestand von 2.000 Tieren wie im Betrieb<br />
von Torbe Pedersen in Holsted. Der dänische<br />
Landwirt grübelte deshalb, wie er nicht ständig<br />
neuen Sand einsetzen müsste. Die Lösung fand<br />
er in einer neuartigen Sandwaschanlage. Teil<br />
dieser technischen Anlage ist ein sogenannter<br />
Zyklon. Wie in einem superschnellen Karussell<br />
wird darin die flüssige Gülle von dem festen<br />
Sand getrennt. Anschließend wird der Sand<br />
gewaschen und so wiederaufbereitet, dass er<br />
erneut als Sandbett in den Ställen genutzt werden kann. Gleichzeitig ist die Gülle nach diesem<br />
Reinigungsprozess entsandet und bereit für die Biogasanlage. Gut gemacht, Herr Pedersen!<br />
GEA<br />
20 Jahre Klimaschutz vor Ort<br />
Besonders interessant sind technische<br />
Anlagen nicht nur dann,<br />
wenn sie nagelneu sind. Erst<br />
wenn sie viele tausend Betriebsstunden<br />
absolviert haben, lässt<br />
sich richtig abschätzen, wie<br />
praxis tauglich sie sind. Das geht<br />
zum Beispiel besonders gut bei<br />
der Milcherzeugergenossenschaft<br />
Klötze eG in Sachsen-<br />
Anhalt. Der Betrieb, der – wie<br />
der Name schon sagt – mit seinen<br />
1.200 Kühen jährlich rund 11 Millionen Kilogramm Milch produziert,<br />
gehört zu den Pionieren der Biogas-Branche. Schon 2001 ist die<br />
Biogasanlage mit einer Gesamtleistung von 480 kW ans Netz gegangen.<br />
Aus 90 Prozent Gülle sowie 10 Prozent Mais und Anwelksilage<br />
wird in vier BHKW Jahr für Jahr klima freundliche Energie erzeugt.<br />
Pro Jahr sind das rund 4,1 Millionen kWh Strom. Die miterzeugte<br />
Wärme wird zum Beheizen der Betriebsgebäude genutzt: der Sozialtrakt,<br />
der Stall, die Werkstatt. Der positive Klimaeffekt durch die<br />
Anlage ist enorm: Pro Jahr vermeidet die Biogasanlage 1.290 Tonnen<br />
CO 2 . Weil sie ein besonders gutes Beispiel aus der klimafreundlichen<br />
Praxis ist, hat der Fachverband Biogas e. V. den Standort gerade<br />
zur „Biogasanlage des Monats“ gekürt, siehe Seite 78.<br />
Das Warten auf Weihnachten<br />
Um die Wartezeit zu Weihnachten zu verkürzen, gibt es den Adventskalender.<br />
Hast du dich mal gefragt, seit wann das so ist? Dieser Kalender<br />
ist noch nicht so alt. Den ersten Kalender gab es wahrscheinlich<br />
Mitte des 19. Jahrhunderts. Das war ein langes Stück Papier und<br />
die Kinder durften jeden Tag ein Stück davon abreißen. Verglichen<br />
mit den heutigen Adventskalendern würde ein solches Modell den<br />
Kindern wohl nicht gefallen.<br />
Kurz danach hatte eine Pfarrersfrau<br />
ihrem Sohn 24 kleine<br />
Schachteln vorbereitet, gefüllt<br />
mit leckeren Plätzchen. Jeden<br />
Tag durfte der Sohn ein Plätzchen<br />
naschen. Dieser Brauch<br />
blieb dem Kind im Gedächtnis<br />
und als erwachsener Mann<br />
stellte er die ersten Adventskalender<br />
im größeren Umfang<br />
her. Zunächst waren hinter<br />
den Türen schöne Weihnachts- und Winterbilder zu sehen. Anschließend<br />
gab es den Adventskalender zum Basteln und erst dann wurde<br />
der Kalender mit Schokolade gefüllt. Letztere hängen inzwischen in<br />
fast allen Kinderzimmern. Am besten aber sind die selbst gemachten<br />
Kalender. Jeden Tag eine echte Überraschung.<br />
www.agrarkids.de<br />
Landwirtschaft entdecken und verstehen –<br />
Die Fachzeitschrift für Kinder<br />
10
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Aktuelles<br />
ERFAHRUNG<br />
IST DIE BASIS<br />
JEDER INNOVATION<br />
Bei allem, was wir tun, verlieren wir nie aus den Augen, worum es für Sie geht:<br />
effiziente Technik und eine einfache Handhabe.<br />
Als Erfinder der elastomerbeschichteten Drehkolbenpumpe und Innovationstreiber für<br />
Einbring- und Aufbereitungstechnik sehen wir uns bei Vogelsang dem guten Ruf der deutschen<br />
Maschinenbauindustrie und ihrem Beitrag zur Energiewende verpflichtet. Seit der Gründung<br />
des Unternehmens 1929 liefern wir technische Lösungen, deren Funktionalität, Qualität<br />
und Zuverlässigkeit von unseren Kunden weltweit hoch geschätzt werden und unseren Wettbewerbern<br />
als Vorbild dienen.<br />
Unser umfassendes Know-how und die langjährige Erfahrung im Bereich Biogas nutzen<br />
wir, um unseren Kunden als kompetenter Partner zur Seite zu stehen. Mit schlagkräftiger<br />
Pump-, Zerkleinerungs-, Desintegrations- und Feststoffdosiertechnik ebenso wie mit unseren<br />
individuellen Beratungsleistungen.<br />
VOGELSANG – LEADING IN TECHNOLOGY<br />
vogelsang.info<br />
11
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Riesenweizengras liefert<br />
Trockenmasseerträge von 16<br />
bis 25 Tonnen pro Hektar. Es<br />
liegt damit auf Maisniveau.<br />
Der Methanertrag lag in Versuchen<br />
rund 30 Prozent unter<br />
dem vom Silomais.<br />
Alternative<br />
Energiepflanzen<br />
sind gut für den<br />
Grundwasserschutz<br />
Am 15. September fand in diesem Jahr erstmals die<br />
Tagung „Pflanzenbauliche Verwertung von Gärrückständen<br />
aus Biogasanlagen“ der Fachagentur Nachwachsende<br />
Rohstoffe e.V. als digitale Veranstaltung im Internet statt.<br />
Die 4. Fachtagung zeigte neue Erkenntnisse zur Aufbereitung<br />
und Nutzung von Gärdüngern auf. Dabei wurden<br />
auch neue Forschungsansätze aus dem Förderaufruf<br />
„Nachhaltige Verwertung und Aufbereitung von Gärrückständen“<br />
des Bundesministeriums für Ernährung und<br />
Landwirtschaft vorgestellt.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Einen der 14 Vorträge hielt Dr. Christine von<br />
Buttlar von der Ingenieurgesellschaft für<br />
Landwirtschaft und Umwelt (IGLU) in Göttingen.<br />
Sie zeigte unter anderem auf, wie<br />
umweltschonend der Anbau alternativer<br />
Energiepflanzen (Durchwachsene Silphie, Wildpflanzenmischungen,<br />
Riesenweizengras) hinsichtlich des<br />
Grundwasserschutzes ist. Sie stellte heraus, dass es<br />
durchaus Potenziale für den Gewässerschutz mit dem<br />
Anbau artenreicher Saatmischungen oder ökologisch<br />
vorteilhafter Energiepflanzen gibt. In Deutschland fielen<br />
pro Jahr rund 80 Millionen Tonnen Gärdünger an,<br />
die in Verbindung mit dem Energiepflanzenanbau gewässerschonend<br />
eingesetzt werden müssten.<br />
Im Weiteren präsentierte von Buttlar Ergebnisse aus<br />
dem Projekt „Minderung von Erosion und Auswaschung<br />
mit Durchwachsener Silphie (DS)“. Das Projekt<br />
lief von 2017 bis 2019. Die DS wurde im Vergleich<br />
zu Mais in Selbstfolge nach Ackergras angebaut. Ein<br />
weiterer Vergleich wurde mit dem Anbau von Feldgras<br />
vorgenommen. Die Versuche fanden auf einem lehmigen<br />
Sandboden bei Braunschweig statt. Dort fallen<br />
etwa 616 Liter Regen pro Quadratmeter, die Jahresdurchschnittstemperatur<br />
beträgt 9,4 Grad Celsius. Die<br />
Kulturen waren schon fünf Jahre vor Projektbeginn auf<br />
den Flächen etabliert.<br />
Untersucht wurden unter anderem die N min<br />
-Gehalte<br />
im Boden, Sickerwassermengen, die Stickstoff-Auswaschung,<br />
der Oberflächenabfluss und der Stickstoffabtrag<br />
durch Erosion. Zudem wurden laut von Buttlar<br />
Starkniederschläge simuliert mit 80 bis 120 Litern<br />
Regen pro Quadratmeter innerhalb von vier Tagen.<br />
„Der Boden nahm unter Mais am schlechtesten die<br />
Wassermenge auf. Die DS war deutlich besser. Jedoch<br />
hat der Boden mit Feldgrasaufwuchs die höchste Infiltrationsrate<br />
erreicht. Die DS und das Feldgras hatten in<br />
allen drei Jahren signifikant höhere Infiltrationsraten“,<br />
betonte von Buttlar.<br />
Als Gründe dafür nannte sie: bessere Durchwurzelung<br />
des Bodens, verbesserte Regenwurmaktivität, bessere<br />
Bodenstruktur aufgrund nicht praktizierter Bodenbearbeitung.<br />
Folgende N min<br />
-Werte nannte die Referentin<br />
aus dem Projekt:<br />
Mais: 2016: 28 Kilogramm (kg) N min<br />
.<br />
2017: 26 kg N min<br />
.<br />
2018: 40 kg N min<br />
.<br />
DS: 2016: 8 kg N min<br />
.<br />
2017: 12 kg N min<br />
.<br />
2018: 12 kg N min<br />
.<br />
Feldgras: 2016: 17 kg N min<br />
.<br />
2017: 10 kg N min<br />
.<br />
2018: 13 kg N min<br />
.<br />
Fotos: www.landpixel.eu<br />
12
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Aktuelles<br />
Laut von Buttlar sind die N min<br />
-Werte<br />
so niedrig, weil die Bodenbearbeitung<br />
nicht stattfindet, der Zeitraum für die<br />
Stickstoffaufnahme länger ist, DS und<br />
Feldgras nach der Ernte wieder aufwachsen<br />
und weil die Mineralisierungsrate<br />
geringer ist.<br />
Wildpflanzen bieten<br />
Lebensraum und sorgen für<br />
niedrige N min<br />
-Werte<br />
Danach präsentierte die Referentin Ergebnisse<br />
aus Versuchen mit Wildpflanzen.<br />
Die Versuche wurden von 2012<br />
bis 2015 durchgeführt. Für den Anbau<br />
von Wildpflanzenmischungen zur Nutzung<br />
als Gärsubstrat spricht, dass sie<br />
Lebensraum für viele Insekten, Vögel<br />
und Niederwild bieten. Als Dauerkulturen<br />
benötigen sie einen geringeren<br />
Aufwand an Arbeitszeit und einen geringeren<br />
Betriebsmitteleinsatz. Zudem<br />
genießen sie in der Bevölkerung eine<br />
hohe Akzeptanz.<br />
„Die Versuche haben gezeigt, dass die Stickstoffdüngung<br />
von maximal 120 kg N/ha ausreicht, um maximale<br />
Erträge zu erzielen. Mit höheren Stickstoff(N)-Gaben<br />
konnten keine Mehrerträge realisiert werden“, erklärte<br />
von Buttlar. Die Methanertragsleistung lag in den<br />
Versuchen bei 35 bis 45 Prozent des Hektarertrages<br />
von Mais. Auch die Wildpflanzenmischungen zeigten<br />
im Herbst mit N min<br />
-Werten um 20 kg/ha ein niedriges<br />
Niveau. Mais hingegen würde hohe Herbst-N min<br />
-Werte<br />
aufweisen, was im Winter zu Stickstoffverlusten durch<br />
Auswaschung führe. Fazit: Wildpflanzen bieten wertvollen<br />
Lebensraum, sie schonen das Grundwasser und<br />
bieten zudem Erosionsschutz.<br />
Dritte Energiepflanze, deren Versuchsergebnisse von<br />
Buttlar vorstellte, war das Riesenweizengras. Sie zeigte<br />
Ergebnisse aus Versuchen von Haus Düsse (NRW) und<br />
der Uni Gießen. Die Versuche wurden von 2012 bis<br />
2015 durchgeführt. Das Riesenweizengras (RWG) sollte<br />
mit 200 kg N/ha geführt und der Mais mit 190 kg N/<br />
ha geführt werden – abzüglich der N min<br />
-Werte. Vorfrucht<br />
für beide Kulturen war Ackergras. Das RWG wurde im<br />
Zweischnittregime getestet.<br />
Riesenweizengras – Hektarerträge wie bei<br />
Silomais erreicht<br />
Von Buttlar sagte, dass das Ackergras nach Umbruch in<br />
2012 die N min<br />
-Werte im ersten Anbaujahr 2013 beim<br />
RWG und Mais beeinflusst hat. Das RWG kennzeichne<br />
hohe Trockenheitstoleranz sowie eine langsame Jugendentwicklung<br />
mit geringer Stickstoffaufnahme. Ab<br />
der Ernte 2014 habe das RWG deutlich niedrigere N min<br />
-<br />
Werte von etwa 20 kg N/ha und weniger gezeigt. Die<br />
RWG-Erträge lägen am Standort Haus Düsse mit 16 bis<br />
Wildpflanzenmischungen bieten Lebensraum für viele Insekten, Vögel und Niederwild. Als Dauerkulturen<br />
benötigen sie einen geringeren Aufwand an Arbeitszeit und einen geringeren Betriebsmitteleinsatz. Im<br />
Herbst sorgen sie für niedrige Nmin-Werte im Boden.<br />
25 Tonnen Trockenmasse pro Hektar auf Maisniveau.<br />
Der Methanertrag lag rund 30 Prozent unter dem vom<br />
Silomais.<br />
Sie sagte außerdem, dass die Direkt- und arbeitserledigungskostenfreie<br />
Leistung (DAKfL) vergleichbar ist<br />
mit anderen Fruchtfolgen. Über einen Zeitraum von 16<br />
Jahren gemittelt lägen die DAKfL von RWG rund 13 Prozent<br />
niedriger als von Mais mit Zwischenfruchtanbau.<br />
Mais, Ackergras und Getreide stellten die wichtigsten<br />
Säulen der Substratbereitstellung dar. Sie empfahl,<br />
diese Kulturen zu ergänzen mit: Zwischenfrüchten,<br />
Untersaaten und der Integration von Ackergräsern. Die<br />
geringeren Ertragsleistungen und die geringere Wirtschaftlichkeit<br />
gegenüber Silomais gelte es auszugleichen.<br />
Agrar-Umweltmaßnahmen oder das sogenannte<br />
Greening wären hierfür geeignete Instrumente.<br />
Nährstoffrückgewinnung<br />
Sigfried Klose von der EuPhoRe GmbH referierte über<br />
die Nährstoffrückgewinnung von Stickstoff und Phosphor<br />
aus Gülle und Gärdüngern mittels thermochemischer<br />
Konversion und Kristallisation von Calcium-<br />
Silicat-Hydrat-Phasen. Um das Ziel der optimierten<br />
Nährstoffrückgewinnung aus Gülle und Gärdüngern zu<br />
erreichen, wird das P-RoC-Verfahren zur Behandlung<br />
der Flüssigphase der Substrate in Kombination mit<br />
dem EuPhoRe-Verfahren zur Behandlung der Festphase<br />
der Substrate eingesetzt, so dass die Nährstoffrückgewinnung<br />
in jeder Phase ansetzt.<br />
„Das KIT Karlsruhe hat das P-RoC-Verfahren entwickelt.<br />
Es ist experimentell auch in der Klärschlammaufbereitung<br />
im Einsatz. Unser thermochemisches<br />
Verfahren kann Biomasse insgesamt mineralisie-<br />
13
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Im November dieses Jahres<br />
startet in Norddeutschland<br />
ein Projekt, in dem Gülle und<br />
Gärreste mit Schwefelsäure<br />
angesäuert werden, um die<br />
Stickstoffverluste zu minimieren.<br />
Hier im Bild ist eine Verfahrensvariante<br />
zu sehen, bei der im<br />
Frontanbauraum des Schleppers<br />
ein IBC-Container in einem<br />
Sicherheitsrahmen transportiert<br />
wird. Der Schwefelwasserstoff<br />
wird auf dem Feld während der<br />
Gülleausbringung dem Wirtschaftsdünger<br />
hinzugegeben. In<br />
dem Projekt wird auch die Ansäuerung<br />
im Güllesilo sowie das<br />
Verhalten von angesäuerter Gülle<br />
in Biogasanlagen untersucht.<br />
ren. Das KIT behandelt mit dem P-RoC-Verfahren im<br />
Wesentlichen die flüssige Phase und extrahiert daraus<br />
den Phosphor. Es entsteht das Düngeprodukt Calcium-<br />
Silikat-Hydrat-Phosphat, dessen Pflanzenverfügbarkeit<br />
nachgewiesen ist“, führte Klose aus.<br />
Nach seinen Angaben wird die feste separierte Phase<br />
in einen sogenannten Leerrohrreaktor gegeben. Dann<br />
werde eine geringe Menge bestimmter Additive dazugegeben,<br />
um zum Beispiel bestimmte Metalle wie Kupfer<br />
und Zink zu entfrachten. Außerdem sollen die Additive<br />
mineralische Nährstoffe erzeugen. Klose sagte, dass<br />
sich später Monophosphate, aber auch Mischungen<br />
herstellen lassen. Das Projekt werde in Kürze gestartet.<br />
Kick-off werde an einer Biogasanlage in Rheinland-<br />
Pfalz sein. Im nächsten Jahr wird dann die Nährstoffseparation<br />
beginnen.<br />
Ansäuern von Gülle und Gärdünger<br />
Um die Ansäuerung von Gülle und Gärresten ging es<br />
im Vortrag von Dr. Andreas Gurgel von der Landesforschungsanstalt<br />
für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern.<br />
„Gärreste sind wertvolle Wirtschaftsdünger.<br />
Ihnen gemein ist jedoch ein relativ hoher<br />
Anteil an Ammonium-Stickstoff bei leicht basischem<br />
pH-Wert. Dies verursacht einen Verlust des Stickstoffs<br />
als gasförmiges Ammoniak. Zusätzlich gilt Ammoniak<br />
als Luftschadstoff, der durch Erhöhung der Feinstaubbelastung<br />
und Lachgasbildung klimaschädigend wirkt.<br />
Zum Erreichen der deutschen Minderungsziele für Ammoniakemissionen<br />
kann das Verfahren der Ansäuerung<br />
einen bedeutenden Beitrag leisten. Wenn der pH-Wert<br />
von Gärresten vor der Ausbringung durch Ansäuern abgesenkt<br />
wird, sinken der Dampfdruck des Ammoniaks<br />
und damit die Emissionen“, erklärte Dr. Gurgel.<br />
Eine Ansäuerung sei auf verschiedenen Ebenen möglich:<br />
im Stall, im Lager und/oder bei der Ausbringung.<br />
Ein entscheidender Vorteil der Maßnahmen zur Ansäuerung<br />
sei die bessere N-Effizienz der so behandelten<br />
Wirtschaftsdünger, da mehr verfügbarer Stickstoff die<br />
Pflanzen erreiche. Falls sich in Deutschland die Ansäuerung<br />
durchsetzen sollte, stelle sich die Frage, wie sich<br />
angesäuerte Gülle in der Biogasanlage einsetzen lässt,<br />
wie hoch die Minderungseffizienz bei der Düngung mit<br />
angesäuerten Gärresten ist und welche Effekte auf die<br />
Bodenfunktionen entstehen.<br />
Ziel des im November dieses Jahres startenden Projektes<br />
ist, Chancen und Risiken der Nutzung angesäuerter<br />
Wirtschaftsdünger in Biogasanlagen und bei der<br />
Gärrestedüngung zu erfassen und zu bewerten. Der<br />
Stickstoff liege als Lösungsgleichgewicht zwischen<br />
Ammonium- und Ammoniak-Ionen in Gülle und Gärresten<br />
vor. „Wir wollen das chemische Gleichgewicht<br />
mehr in Richtung Ammonium-Ionen verschieben, um<br />
den Dampfdruck des Ammoniaks in der Flüssigkeit zu<br />
verringern. Das geschieht bei einem pH-Wert von 6“,<br />
führte der Referent aus.<br />
Es gehe aber nicht nur um die Stickstoff-Stabilisierung,<br />
sondern auch Phosphate seien pH-abhängig löslich.<br />
„Wird der pH-Wert auf 5,5 bis 6 abgesenkt, führt das zu<br />
einer erhöhten Verfügbarkeit von Phosphor im Boden.<br />
Wir erwarten damit einen gewissen Grad an Ertragswirksamkeit<br />
aus dem verfügbaren Phosphor. Es steigt<br />
aber auch das Risiko, dass mehr Phosphor verfügbar<br />
ist, als die Pflanzen aufnehmen können“, ergänzte Dr.<br />
Gurgel.<br />
Angesäuert werden die Wirtschafts- und Gärdünger<br />
mit Schwefelsäure. Wenn man mit 96-prozentiger<br />
Schwefelsäure arbeite, die einen pH-Wert von 1,8 hat,<br />
dann würden in Abhängigkeit von der Pufferkapazität<br />
und den tatsächlichen Ammoniakgehalten in den<br />
Wirtschafts- beziehungsweise Gärdüngern etwa 2 bis<br />
6 Liter Säure pro Kubikmeter benötigt. In Dänemark<br />
Foto: Martin Bensmann<br />
14
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Aktuelles<br />
„Wird der pH-Wert auf 5,5<br />
bis 6 abgesenkt, führt das zu<br />
einer erhöhten Verfügbarkeit<br />
von Phosphor im Boden“<br />
Dr. Andreas Gurgel<br />
würden zurzeit etwa 20 Prozent der Gülle angesäuert.<br />
Das Verfahren sei dort zur Verlustminderung anerkannt.<br />
Geplant sind Feldversuche in Gülzow in Parzellen,<br />
wo die behandelten organischen Dünger sowohl mit<br />
Schleppschlauch appliziert als auch mit entsprechender<br />
Technik direkt in den Boden eingebracht werden.<br />
Gedüngt werden soll zunächst einmal Winterraps. Es<br />
finden Ammoniak-Messungen über den Parzellen statt,<br />
um die Ausgasung zu ermitteln. Bodenprobenanalysen<br />
werden ebenfalls durchgeführt.<br />
Dr. Gurgel sieht die Anreichung der Böden mit Schwefel<br />
als problemlos an. Er gab aber zu bedenken, dass<br />
Schwefel als negativ geladenes Ion eventuell der Auswaschung<br />
aus dem Boden unterliege. Zudem sollte der<br />
Calciumbedarf der Böden im Auge behalten werden.<br />
Anmerkung der Redaktion: Ob die angesäuerten Wirtschaftsdünger<br />
negative Einflüsse auf das Edaphon haben<br />
werden, sollte auch untersucht werden.<br />
Pyrolysiertes Filtermaterial reinigt<br />
Gärdüngerzentrat<br />
Einen Forschungsansatz zur Gärdüngeraufbereitung<br />
mit Pyrolyse separierten Feststoffen stellte Dr. René<br />
Casaretto von der Niersberger Wohn- und Anlagenbau<br />
GmbH & Co.KG vor. Geforscht wird auf der Biogasanlage<br />
der Bioenergie Schuby GmbH in Schuby in Schleswig-Holstein<br />
zusammen mit der Hochschule Flensburg.<br />
Dort ist bereits eine Gärdüngeraufbereitungsanlage<br />
in 2016 errichtet worden. Die Fest-Flüssig-Trennung<br />
geschieht mittels einer Dekanterzentrifuge. Die gewonnene<br />
flüssige Phase wird nach dem sogenannten<br />
Belebtschlammverfahren weiter aufbereitet, an dessen<br />
Verfahrensende einleitfähiges Klarwasser gewonnen<br />
wird. Dieses Verfahren wurde federführend von Prof. Dr.<br />
Wiktoria Vith vom Verbundpartner Hochschule Flensburg<br />
entwickelt.<br />
Nun gehe es vor allem darum, die festen Gärrückstände<br />
durch Pyrolyse zu veredeln. „Herausforderungen bei<br />
der Verfahrensführung liegen neben der Notwendigkeit<br />
des Einsatzes von getrockneten (zumeist mindestens<br />
85 Prozent Trockenmasse) Stoffen auch in der Vorbereitung<br />
hinsichtlich ihrer physikalischen Eigenschaften<br />
(u.a. Stückgröße). Am Schluss ist die Wahl des Temperaturniveaus<br />
von entscheidender Bedeutung, um die<br />
Bildung von Kohle und die Vermeidung von Po-<br />
Biogas Journal 210x140<br />
Runderneuerung von Gummikolben für Kolbenpumpen!<br />
Alter beschädigter Kolben Altes Gummi ist entfernt Der erneut vulkanisierte Kolben<br />
Technische Handelsonderneming<br />
Ersatzteile für die meisten üblichen Kolbenpumpen<br />
Registrieren und sofort kaufen in unserem Webshop!<br />
Tel.: 0031-(0)545-482157<br />
15<br />
eMail.: info@benedict-tho.nl WWW.BENEDICT-THO.NL
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Versuchsanlage, in der Holzkohlen mit Biomassepyrolysaten aus festen Gärresten und Klärschlämmen verglichen werden. Hierfür wird die flüssige Phase aus<br />
dem Gärprodukt über einen sogenannten Organischen Sorptionsfilter geleitet, der eine Mischung aus Stückgut (Holz, Süßgräser) und Pyrolysaten darstellt und<br />
semi-kontinuierlich mit dem flüssigen Produkt beaufschlagt wird.<br />
lyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK)<br />
zu begünstigen. Das Ausgangsprodukt sollte mindestens<br />
18 Megajoule pro Kilogramm an Energie enthalten,<br />
denn dann läuft der Prozess autotherm“, betonte<br />
Dr. Casaretto.<br />
Die Pyrolyse finde in einem Temperaturbereich von 400<br />
bis 700 Grad Celsius statt. Die Prozesstemperatur habe<br />
einen Einfluss auf die Produkte, die entstehen. „Bei<br />
einer höheren Temperatur hat die Gasphase einen höheren<br />
Anteil. Niedrigere Temperaturen führen eher zu<br />
einer öligen Phase“, fügte der Referent hinzu. Zur Entwässerung<br />
des Gärdüngers würden auch Polymere eingesetzt.<br />
Vorteil der Pyrolyse sei auch, dass sich die Polymere<br />
im Pyrolyseprozess auflösen. Der Energiegehalt<br />
entweiche als Pyrolysegas, das für die Prozessenergie<br />
verwendet werden könne. „Im Endprodukt der Pyrolyse<br />
ist dann kein Polymer mehr enthalten“, verdeutlichte<br />
Dr. Casaretto.<br />
Durch die Aufreinigung von flüssigen Gärprodukten mit<br />
der Pyrolysekohle können laut Dr. Casaretto die Nährstoffgehalte<br />
und der chemische Sauerstoffbedarf dieser<br />
signifikant reduziert werden. An der Versuchsanlage<br />
werden Holzkohlen mit Biomassepyrolysaten aus festen<br />
Gärresten und Klärschlämmen verglichen. Hierfür<br />
werde die flüssige Phase aus dem Gärprodukt über einen<br />
sogenannten Organischen Sorptionsfilter geleitet,<br />
der eine Mischung aus Stückgut (Holz, Süßgräser) und<br />
Pyrolysaten darstelle und semi-kontinuierlich mit dem<br />
flüssigen Produkt beaufschlagt werde.<br />
Gärprodukt Schuby nach Passage pyrolys. Klärschlammfilter:<br />
110 mg NH 4<br />
-N/l, 1,38 mg NO 3<br />
-N/l, 645 mg CSB/l.<br />
Gärprodukt Schuby nach Passage pyrolys. Klärschlammfilter,<br />
der mit Belebtschlamm geimpft wurde:<br />
109 mg NH 4<br />
-N/l, 1,29 mg NO 3<br />
-N/l, 634 mg CSB/l.<br />
„Bei der Versuchsanlage hat sich gezeigt, dass nach<br />
rund 30 Tagen eine verringerte Reinigungsleistung<br />
eingesetzt hat. Dies hat neben dem geänderten Zulauf<br />
auch seine Ursache in den Umgebungsbedingungen,<br />
wie zum Beispiel Temperatur, Regen etc., und einen<br />
Einfluss auf die Reproduktionsrate der Mikroorganismen<br />
(MO)“, resümierte Dr. Casaretto. Eine Beimpfung<br />
mit MO aus der Belebung habe zu einer verbesserten<br />
Reinigungsleistung geführt.<br />
Die wissenschaftliche Begleitung der Versuchsanlage<br />
wird durch die Hochschule Flensburg sichergestellt.<br />
Das Projekt „Easy2Clean“ ist gefördert durch die<br />
WT.SH Projektnummer: LPW-E/3.2.1/1234<br />
Kontakt: Dr. René Casaretto:<br />
rene.casaretto@niersberger.de<br />
Prof. Dr. Wiktoria Vith:<br />
wiktoria.vith@hs-flensburg.de<br />
Beispiel:<br />
Gärprodukt Schuby, Ausgangsmaterial:<br />
263 mg NH 4<br />
-N/l, 1,64 mg NO 3<br />
-N/l, 1.175 mg CSB/l.<br />
Gärprodukt Schuby nach Passage Pflanzenkohlefilter:<br />
104 mg NH 4<br />
-N/l, 2,54 mg NO 3<br />
-N/l, 718 mg CSB/l.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
0 54 09/90 69 426<br />
martin.bensmann@biogas.org<br />
Fotos: Dr. René Casaretto<br />
16
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Aktuelles<br />
FermWell ®<br />
Eisenhydroxid 50<br />
FermWell ® Eisenhydroxid 50 ist ein pulverförmiges<br />
Reaktionsmittel auf Basis von Eisen(III)-oxidhydrat, FeO(OH)<br />
mit mindestens 50 % Eisen, das den bei der anaeroben<br />
Vergärung in Biogasanlagen entstehenden Schwefelwasserstoff<br />
(H 2<br />
S) bereits im Gär substrat bindet.<br />
FermWell ® Eisenhydroxid 50 entspricht dem aktuellen<br />
Dünge mittelrecht (DüMV) als Fällungsmittel in Biogasanlagen,<br />
ist kein Gefahrgut und ist gelistet in der Betriebsmittelliste<br />
für den ökologischen Landbau in Deutschland.<br />
Liefermenge ab:<br />
1 Palette ca. 1,12 t 799,- €/t<br />
2 Paletten ca. 2,24 t 789,- €/t<br />
3 Paletten ca. 3,36 t 769,- €/t<br />
4 Paletten ca. 4,48 t 759,- €/t<br />
5 Paletten ca. 5,60 t 749,- €/t<br />
6 Paletten ca. 6,72 t 739,- €/t<br />
12 Paletten ca. 13,44 t 699,- €/t<br />
15 Paletten ca. 16,80 t 685,- €/t<br />
20 Paletten ca. 22,40 t 595,- €/t<br />
FermWell ®<br />
Aktivkohle J 2.5<br />
FermWell ® Aktivkohle ist eine mit Kaliumjodid imprägnierte<br />
Formkohle mit 4 mm Durchmesser, speziell für die Abscheidung<br />
von Schwefelwasserstoff aus Biogas oder Klärgas. Sie zeichnet<br />
sich durch perfekte Beladungskapazitäten, Sicherheit in den<br />
Anwendungen sowie durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus.<br />
Die FermWell ® Aktivkohle J 2.5<br />
Typische Eigenschaften J 2.5:<br />
Korndurchmesser (mm) 4<br />
Jod-Imprägnierung (Gew. %) ca. 2,5<br />
Rütteldichte (kg/m³) 515 ± 30<br />
Wassergehalt (Gew. %) ca. 10<br />
BET-Oberfläche (m²/g) ca. 1.100<br />
Liefermenge 0,5 t 3,05 €/kg<br />
1,0 t 2,99 €/kg<br />
1,5 t 2,95 €/kg<br />
2,0 t 2,90 €/kg<br />
3,0 t 2,87 €/kg<br />
10,0 t 2,75 €/kg<br />
16,0 t 2,59 €/kg<br />
Alle Angebote freibleibend einschließlich Transport<br />
frei Biogasanlage im Inland, zzgl. MwSt.<br />
Alle Angebote freibleibend einschließlich Transport<br />
frei Biogasanlage im Inland, zzgl. MwSt.<br />
Lieferform: 20 kg Papiersäcke, geklebt. Fermentierbar.<br />
Abgabe auf Paletten a 1,12 t. Lieferzeit ca. 7-10 Tage.<br />
Big Bags auf Anfrage.<br />
Unser FermWell ® Eisenhydroxid 50 ist ein natürlich<br />
vorkommendes, bergmännisch abgebautes, aufbereitetes<br />
Eisen(III)-oxidhydrat, FeO(OH) mit mindestens<br />
50 % Eisen anteil und einer geringen Belastung an<br />
Schwermetallen.<br />
Lieferform: 25 kg-Säcke auf Palette oder Big Bags<br />
à 500 kg, Lieferzeit ca. 10-14 Werktage<br />
Aktivkohle Rücknahme ab Hof<br />
Abtransport verbrauchter Aktivkohle aus der Biogasreinigung,<br />
inertisiert, mind. 500 kg, ordnungsgemäße<br />
Verwertung nach EN 15 02 03 im Zuge der freiwilligen<br />
Rücknahme, Abrechnung nach Verwiegung!<br />
Aktivkohlewechsel komplett mit Entsorgung<br />
der Altkohle zum Festpreis!<br />
Mindestens 50% Eisen!<br />
Großhandelspreise !<br />
Hohe Beladungskapazitäten!<br />
Transportkostenfrei!<br />
2,5 %ig mit kaliumjodiert!<br />
Bestellung per Telefon:<br />
02644 954071<br />
Onlineshop:<br />
www.fermwell.de<br />
per E-Mail:<br />
vertrieb@fermwell.de<br />
FermWell GmbH<br />
Ohlenberger Weg 17 24<br />
53545 Ockenfels
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Gärprodukte: Rohstoffe<br />
wiedergewinnen heißt Zukunft<br />
sichern<br />
90 anwesende Teilnehmer bei der Konferenz „Fortschritt bei der Aufbereitung und Nutzung<br />
von Gülle und Gärprodukten“: Eigentlich wäre diese Zahl schon für „normale“ Zeiten<br />
gar nicht so übel. Doch die Zeiten sind, wie wir alle wissen, nicht normal, sondern coronal.<br />
Und deshalb war diese Resonanz auf die gemeinsame Veranstaltung von IBBK Biogas und<br />
der Akademie Schloss Kirchberg im altertümlichen Neubausaal Schwäbisch Hall mehr als<br />
beachtlich. Zumal noch eine stattliche Zahl weiterer Gäste virtuell per Live-Übertragung an<br />
dieser „Hybrid-Konferenz“ teilnahm.<br />
Von Dipl.-Ing. Heinz Wraneschitz<br />
Mit dem Cultan-Verfahren<br />
lässt sich zum Beispiel<br />
auch Ammonium-<br />
Sulfatlösung gezielt<br />
in den Wurzelraum<br />
applizieren, wodurch<br />
sich die Stickstoffeffizienz<br />
verbessert.<br />
Die Zahl neuer Biogasanlagen nimmt mit<br />
Ausnahme der großen Biomethan-Produktionsanlagen<br />
in ganz Europa nicht mehr<br />
wirklich stark zu. An dieser Tatsache ändert<br />
auch nichts, dass Biogasanlagen eigentlich<br />
schon immer dazu beitragen, dass die Nutzung chemischer<br />
Dünger abnimmt. Diesen positiven Zusammenhang<br />
erwähnte Harm Grobrügge, Präsident des<br />
Europäischen Biogasverbandes (EBA), in seinem Einführungsvortrag<br />
ausdrücklich genauso, wie die massive<br />
Menge vermiedener Treibhausgase, die die Biogasproduktion<br />
realisiert.<br />
In der Vergangenheit wurde das bisherige Endprodukt<br />
der Vergärung oft als „Gärrest“ diskriminiert. Doch seit<br />
einiger Zeit steigt das Interesse an den Möglichkeiten,<br />
Rohstoffe aus ihm zu gewinnen. Dafür gibt es eine ganze<br />
Reihe von Gründen. Ein ganz wichtiger: die Düngeverordnung,<br />
die Bauern zwingt, Gülle oder Gärprodukte<br />
immer zielgerichteter und in bestimmten Monaten<br />
auszubringen. Deshalb denken Anlagenbetreiber wie<br />
-hersteller immer öfter darüber nach, wie sie die Gärprodukte<br />
besser nutzen können, als „nur“ auf Äckern<br />
oder Wiesen zu verteilen.<br />
Foto: www.landpixel.EU<br />
18
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Aktuelles<br />
Foto: Heinz Wraneschitz<br />
Die Aufbereitung des Gärdüngers in neue Fraktionen mit anderen Nährstoffkonzentrationen kann helfen,<br />
die Vorgaben der Düngeverordnung einzuhalten, insbesondere wenn Flächen knapp sind.<br />
Zumal ein solches Umdenken punktgenau<br />
zur „Strategie zur Unterstützung der<br />
anaeroben Vergärung“ der Europäischen<br />
Union passt, wie Grobrügge wissen ließ.<br />
Im aktuellen „JRC Science For Policy Report“<br />
wurden „Leitlinien aufgestellt zum<br />
Recycling von Nährstoffen aus Gülle in der<br />
Kreislaufwirtschaft“, wie Grobrügge erläuterte.<br />
Stickstoff könne zielgenauer genutzt<br />
werden, das Ernährungssystem könne sich<br />
mehr in Richtung nachhaltiger Kreislaufwirtschaft<br />
entwickeln, die Emissionen von<br />
Lachgas, Methan und NOx würden dadurch<br />
vor Ort deutlich sinken. „Biogas ist so viel<br />
mehr als nur Energie – alle Vorteile müssen<br />
der Öffentlichkeit deutlich gemacht<br />
werden, um das volle Potenzial von Biogas<br />
auszuschöpfen.“ Der europäische Biogas-<br />
Funktionär forderte also mehr Mut zur Eigenwerbung.<br />
Seltene Elemente in<br />
Gärsubstraten und -düngern<br />
Vielleicht würde es ja schon helfen, wenn<br />
alle wüssten, welche Mengen „Seltener<br />
Erden-Elemente“ (SEE) oder Germanium<br />
in den Substraten und Gärrückständen von<br />
Biogasanlagen stecken. „Es ist aussichtsreich,<br />
umweltfreundliche, nachhaltige und<br />
effiziente Techniken zur Extraktion von SEE<br />
aus Pflanzen-Biomasse zu entwickeln.“<br />
Dazu sei „allerdings ein Umdenken in Bezug<br />
auf das Ausgangsmaterial zwingend<br />
erforderlich“, wie der Agrarwissenschaftler<br />
Walter Frölich anmerkte. Gregor Maier von<br />
der Biogastechnik Süd aus Isny referierte<br />
zum Thema „Welche Rolle spielt die Flexbiogasanlage<br />
mit Gärproduktaufbereitung<br />
in einer regenerativen Landwirtschaft?“.<br />
Er fesselte die Zuhörenden im Saal mit<br />
Kinobestuhlung und großen Abständen.<br />
Denn er stellte ein „Speicherkraftwerk mit<br />
CO 2<br />
-neutraler Mineraldüngerproduktion“<br />
vor. Es gelte, „ein Gleichgewicht, ein optimales<br />
Verhältnis der Nährstoffe im Boden<br />
zu schaffen: Humusaufbau“. Und das<br />
alles durch „zielgenauen Einsatz vorhandener<br />
Stoffe“. Damit meinte er vor allem<br />
ASL, also Ammoniumsulfatlösung. Dieser<br />
Mineraldünger solle dann im „Cultan“-Verfahren<br />
per Unterfußdüngung an die Pflanzen<br />
gebracht werden, wodurch 15 bis 25<br />
Prozent des Stickstoffbedarfes eingespart<br />
werde.<br />
Mit der Produktion des Mineraldüngers<br />
werden in der Biogasanlage 20 bis 60<br />
Prozent der Ammoniak-Emissionen vermieden.<br />
Und durch die Speicherung des<br />
Biogases und die vier- bis sechsfache Leistungsüberbauung<br />
der Blockheizkraftwerke<br />
sei echt benötigter und demnach gut bezahlter<br />
Spitzenlaststrom zu produzieren.<br />
Optimal sei, wenn dazu die von Biogas<br />
Süd seit Jahren angebotene Gärdüngerverdampfung<br />
namens Vapogant zum Einsatz<br />
komme: Die reduziere den Bedarf an Gärproduktelager<br />
um immerhin 72 Prozent, so<br />
Maier. Und 3 Prozent der ursprüng-<br />
19<br />
NACHHALTIG<br />
I M VO RTE I L<br />
EINE MARKE FÜR<br />
DEN ENERGIE-MIX<br />
· ressourcenschonend<br />
· effizient<br />
· serviceorientiert<br />
www.addinol.de
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Gärdüngeraufbereitung: Großprojekt in Schleswig-Holstein geplant<br />
Ole Dammann und seine Mitstreiter aus Eggebek<br />
sind „von dem System überzeugt. Auch von den<br />
Leuten, die dahinterstecken. Ich bin sicher, dass<br />
die Anlage läuft.“ Schon im kommenden Jahr soll<br />
es so weit sein, berichtet der Geschäftsführer der<br />
Bürgerenergie Sauberes Wasser Eggebek GmbH<br />
(BSWE) in Schleswig-Holstein. In einem Gewerbegebiet<br />
auf einem ehemaligen Militär-Flugplatzgelände<br />
will die BSWE insgesamt 18 Millionen Euro<br />
investieren in eine Aufbereitungsanlage, die von<br />
der deutsch-holländischen Vapora-Gruppe entwickelt<br />
wurde.<br />
Nach Angaben von Vapora-Geschäftsführer Hans-J.<br />
P. Freiherr von Donop soll die Anlage eine „vollständige<br />
Kaskadennutzung von Gülle und Gärresten“ ermöglichen<br />
und diese Einsatzstoffe „zu NK-Dünger,<br />
einleitungsgenehmigtem Wasser, lebensmittelreiner<br />
Phosphorsäure für die chemische Industrie und<br />
Huminsäure für die Pflanzenerde-Industrie oder<br />
als chemischen Grundstoff“ umwandeln. Eine aus<br />
Mitteln des staatlichen Bürgerenergiefonds unterstützte<br />
Machbarkeitsstudie sei positiv ausgefallen;<br />
vor allem die immense CO 2<br />
-Reduktion sei dabei aufgefallen.<br />
Danach habe man die Planung konsequent<br />
vorangetrieben.<br />
Wichtig war eine Antragskonferenz mit den relevanten<br />
Behörden: „Es ist ja ein neues Verfahren. Da ist<br />
nicht automatisch allen klar, wie es zu genehmigen<br />
ist“, erklärt Dammann. Es folgte eine Projektskizze,<br />
die von den Projektträgern der Nationalen Klimaschutzinitiative<br />
positiv bewertet worden sei. Deshalb<br />
habe das Amt Eggebek einen Förderantrag für<br />
die geplante Gülle- und Gärrestveredelungsanlage<br />
gestellt; auf die Rückmeldung warte man noch,<br />
heißt es von Amt und BSWE unisono. „Die Investitionskosten<br />
sind so hoch, ohne Förderung kann die<br />
Anlage nicht gebaut werden“, ist Elena Zydek vom<br />
Klimaschutzmanagement im Amt Eggebek sicher.<br />
Doch warum ist die Investition überhaupt sinnvoll?<br />
Laut aktuellem Nährstoffbericht gibt es im Umkreis<br />
der geplanten Anlage 600.000 Kubikmeter (m³) Gülle<br />
zu viel, um sie auf Felder auszubringen. 120.000 m³<br />
davon will die BSWE künftig pro Jahr verarbeiten. Die<br />
Gülle stamme aus einem „Haupteinzugsgebiet von<br />
15 Kilometern. Damit können wir der Landwirtschaft<br />
und der Umwelt helfen, die Nährstoffüberschüsse<br />
gut umzuwandeln in vermarktbare Produkte“, so Ole<br />
Dammann. Das System eigne sich auch gut für andere<br />
Regionen mit hoher Viehhaltung. Und auf einer<br />
kleineren Testanlage in Holland habe er gesehen,<br />
dass das Verfahren funktioniert.<br />
Das Geschäftsmodell rechne sich für mehrere Seiten.<br />
Zum einen müssten die Landwirte einen Abnahmepreis<br />
an die BSWE bezahlen – ein weiterer<br />
Transport wäre für sie aber unwirtschaftlich. Zum<br />
anderen will die BSWE die entstehenden Produkte<br />
vermarkten, beispielsweise Pellets zum Verheizen<br />
in Wärmenetzen oder bei industriellen Abnehmern.<br />
Und mit der Einleitung des aus der Gülle produzierten<br />
naturalisierten Wassers – immerhin 70.000 der<br />
anfangs 120.000 m³ – würden gar die Wasserwerte<br />
des Vorfluters verbessert. Und nicht zuletzt sollen<br />
die 23 Gesellschafter der BSWE-Anlage davon profitieren,<br />
großteils wiederum Landwirte. Doch zuvor<br />
braucht es das Fördergeld der Nationalen Klimaschutzinitiative.<br />
lichen Flüssigkeit stehen am Ende als reine ASL zur<br />
Verfügung, ein handelbares, CO 2<br />
-neutrales Dünge-<br />
Produkt.<br />
Gleich drei handelbare Dünge-Produkte, nämlich ASL,<br />
Phosphatsalz und Kaliumkonzentrat, dazu noch Torfersatz<br />
und nährstoffarmes Wasser zur Verregnung können<br />
Biogasanlagenbetreiber gewinnen, die das NuTriSep-<br />
Verfahren der Firma Geltz aus dem schwäbischen<br />
Mühlacker einsetzen. Darüber haben wir im Biogas<br />
Journals 5_<strong>2020</strong> ausführlich berichtet.<br />
Fraktionierte Eindampfung weiterentwickelt<br />
Als nächstes war Stephan Kühne von agriKomp aus<br />
Merkendorf mit dem Thema „Gärrestaufbereitung<br />
der nächsten Generation“ angekündigt. Agrifer Plus<br />
sei „eine Problemlösung für die durch stickstoffhal-<br />
20
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Aktuelles<br />
tige Dünger und regionale Überschüsse an Gärresten<br />
und Gülle zunehmende Nitratbelastung des Grundwassers“.<br />
Das Problem gebe es „in Deutschland, der<br />
EU, sowie weltweit“. Aber das neue Verfahren, „eine<br />
Weiterentwicklung der ‚Fraktionierten Eindampfung‘,<br />
nutzt die unterschiedlichen Dampfdrücke von Ammoniak<br />
und Wasser, um sie in mehreren Stufen durch Eindampfung<br />
zu trennen“, so Kühne.<br />
Am Ende könne bis zu 50 Prozent des ursprünglich<br />
im Gärprodukt enthaltenen Stickstoffs „einer Verwertung<br />
außerhalb der Landwirtschaft zugeführt werden.<br />
„Ausschleusung“ nannte der Referent diese Technik.<br />
Und in Kombination mit Umkehrosmose werde eine<br />
konzentrierte Ammoniaklösung erzeugt mit einem bis<br />
zu 25-prozentigen Stickstoffanteil. Weshalb man bei<br />
agriKomp laut Stephan Kühne auf eine Stickstoffförderung<br />
der EU hofft.<br />
Eine wärmelose Vollaufbereitung zur Trennung von<br />
Wasser und Nährstoffen in zwei übereinander angeordneten<br />
40-Zoll-Containern hat die „Nährstofflenker<br />
GmbH“ um Tall Pressler aus Münster auf die Beine<br />
gestellt. „Wir stellen Ihnen die Anlage für 10 Euro pro<br />
Woche Bewirtschaftungspreis ohne Investitionskosten<br />
auf den Hof“, bot Pressler den Biogasbetreibern an.<br />
Mit dieser „Berthold“-Technik – weil erfunden und lizenziert<br />
von Hermann und Jürgen Berthold – werden<br />
18.000 Tonnen Inputmaterial – egal ob Gülle oder Gärprodukt<br />
– in ein Drittel Feststoff mit gut 25 Prozent<br />
Trockensubstanz und zwei Drittel Wasser zerlegt.<br />
Durch mehrere Filter- und Trennschritte plus Oxidation<br />
bleiben laut Pressler weniger als 1 Prozent der Nährstoffe<br />
Stickstoff, Phosphor und Kalium im Wasser.<br />
„Durch die Dauer-Messung kann immer eingeleitet<br />
werden“, ergänzte Pressler. Zumindest bei der ersten<br />
Pilot-Containeranlage, die kürzlich in Niedersachsen<br />
in Betrieb gegangen sein soll. Danach referierte Freiherr<br />
von Donop über die „Vollständige Kaskadennutzung<br />
von Gülle und Gärresten“ seiner Vapora-Gruppe<br />
(siehe auch Kasten). Er verwies auf „22 Standorte in<br />
Deutschland, die derzeit in der Genehmigungsplanung<br />
sind mit einem Investitionsvolumen von 450 Millionen<br />
Euro“. Die Anlagen selbst seien „gewinnbringend: RE-<br />
DII-Zertifikate für 30.000 Tonnen CO 2<br />
-Einsparung je<br />
Anlage“ seien dabei „der Turbolader für die Wirtschaftlichkeit“.<br />
Die stellte er mit einem Return of Invest (ROI)<br />
von „etwa 3 Jahren“ dar – bei „konservativ gerechneten<br />
Erlösen von 8,5 Millionen Euro“ und einem Gewinn von<br />
3,7 Millionen Euro pro Jahr.<br />
Ebenfalls nicht zu vergessen: Norbert Rossow von<br />
PRE Neubrandenburg. Er will mit dem sogenannten<br />
Kombi-Max, einem Kombigerät zur zielgerichteten<br />
chemophysikalischen Veränderung von Inhaltsstoffen<br />
in Suspensionen durch Ultraschall und kaltes Plasma,<br />
„versteckte Potenziale von Gülle und Gärresten<br />
zur Biogaserzeugung erschließen”. Konkret wird das<br />
Gärprodukt beim Durchlauf des Kombi-Max bis zu<br />
140 Sekunden lang mit Ultraschall behandelt und<br />
mit Mikrowellen beaufschlagt. Dadurch würde „die<br />
Effizienz im Biomasse-Aufschluss erhöht und würden<br />
Biogasausbeute und Abbaugeschwindigkeit gesteigert“.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. Heinz Wraneschitz<br />
Feld-am-See-Ring 15a<br />
91452 Wilhermsdorf<br />
0 91 02/31 81 62<br />
heinz.wraneschitz@t-online.de<br />
www.bildtext.de · www.wran.de<br />
21
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Strohtagung 1. Teil<br />
Gärsubstrate –<br />
Nährstoffgehalte<br />
ermitteln ist<br />
sinnvoll<br />
Wenn 50 bis 70 Prozent<br />
des in Deutschland anfallenden<br />
Wirtschaftsdüngers<br />
in Biogasanlagen<br />
eingesetzt<br />
werden, dann ist eine<br />
Treibhausgasreduktion<br />
von 2,8 bis 4 Millionen<br />
Tonnen CO 2<br />
-Äquivalent<br />
machbar.<br />
In diesem Jahr musste coronabedingt die Heidener Strohtagung ins Internet verlegt<br />
werden. So fanden die Teile 1 und 2 Ende August als webbasierte Tagung statt mit den<br />
Schwerpunktthemen Wirtschaftsdünger-Handling und Nährstoffmanagement. Die Teile<br />
3 und 4 fanden Mitte September – ebenfalls im Internet – statt. Sie behandelten die<br />
Themen Maisstroh vergären und Biodiversität.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Das digitale Auftaktreferat hielt Prof. Dr.<br />
Walter Stinner vom Deutschen Biomasseforschungszentrum<br />
(DBFZ) GmbH in<br />
Leipzig. Seinen Ausführungen zufolge<br />
wurde Ende 2018 in Deutschland in rund<br />
8.500 Biogasanlagen Wirtschaftsdünger vergoren. In<br />
etwa 5.600 Anlagen würden mehr als 30 Prozent Wirtschaftsdünger<br />
eingesetzt. Das seien die sogenannten<br />
Gülle-Bonusanlagen. Darüber hinaus würden rund 800<br />
Güllekleinanlagen der 75-kW-Klasse betrieben, in denen<br />
mindestens 80 Prozent Wirtschaftsdünger vergoren<br />
werden müssen.<br />
Laut einer Umfrage des DBFZ gaben 432 Anlagenbetreiber<br />
an, dass sie in ihren Anlagen zu 52 Prozent<br />
Wirtschaftsdünger vergären und zu 48 Prozent Energiepflanzen,<br />
wobei Silomais einen Anteil von 70 Prozent<br />
hat. Beim Wirtschaftsdünger dominiert laut Stinner die<br />
Rindergülle mit 65 Prozent. Der Anteil Schweinegülle<br />
betrage 15 Prozent. Auf Rinderfestmist entfielen 9 Prozent<br />
und auf Geflügelkot/HTK 4 Prozent.<br />
Die Stromproduktion aus Wirtschaftsdünger in<br />
Deutschland gab Stinner mit 4 Terawattstunden an;<br />
die Stromproduktion aus Güllekleinanlagen stelle 0,3<br />
Terawattstunden bereit. „Das Ziel der Bundesregierung<br />
ist, dass in 2030 rund 70 Prozent des in Deutschland<br />
anfallenden Wirtschaftsdüngers in Biogasanlagen genutzt<br />
werden. Das bedeutet, dass unter günstigen Rahmenbedingungen<br />
ein zusätzliches Wirtschaftsdünger-<br />
Potenzial von 50 Millionen Tonnen erschlossen werden<br />
sollen“, verdeutlichte Stinner.<br />
Die Entwicklung der Wirtschaftsdüngervergärung in<br />
Deutschland sei vor allem eine Geschichte der Steuerung<br />
durch die Rahmenbedingungen des jeweiligen<br />
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Im ersten EEG<br />
habe die Vergärung von organischen Abfallstoffen und<br />
Wirtschaftsdüngern dominiert. 2004 sei dann der<br />
Energiepflanzenanbau dazugekommen. Die Betriebskonzepte<br />
hätten auf der Vergärung von Energiepflanzen<br />
mit Wirtschaftsdünger (WD) beruht. 2009 ist laut Stinner<br />
die Wirtschaftsdüngervergärung verstärkt angereizt<br />
worden durch die Einführung des Güllebonus und eine<br />
einzusetzende Mindestmenge von massebezogen 30<br />
Prozent.<br />
2012 wurde nach den Angaben des Wissenschaftlers<br />
die Klasse der Güllekleinanlagen eingeführt. In dieser<br />
Klasse ist die installierte Leistung auf 75 Kilowatt<br />
Foto:www.landpixel.eu<br />
22
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Aktuelles<br />
begrenzt und es müssen mindestens 80 Prozent WD<br />
eingesetzt werden. Größere Anlagen hatten sich nach<br />
dem EEG an der Einsatzstoffvergütungsklasse 2 zu<br />
orientieren. Das 2017er EEG hat die Systematik der<br />
Güllekleinanlagen fortgeführt.<br />
„Schwerpunkte der Biogaserzeugung in Deutschland<br />
sind die Regionen, in denen die Tierhaltung stark vorhanden<br />
ist. In den östlichen Bundesländern werden<br />
Biogasanlagen mit besonders hohen WD-Mengen betrieben,<br />
die nicht in der Klasse der Güllekleinanlagen<br />
vergütet werden. In den östlichen Bundesländern sind<br />
die Großvieheinheiten pro Hektar sehr gering. Pro<br />
Betrieb werden aber so viele Tiere gehalten, so dass<br />
genügend WD anfällt, um größere Biogasanlagen mit<br />
höheren WD-Anteilen betreiben zu können“, informierte<br />
Stinner.<br />
Zwischen 8 und 10 Millionen Tonnen CO 2<br />
-Äquivalent an<br />
Treibhausgasen seien im Jahr 2017 in Deutschland allein<br />
durch die Lagerung und Ausbringung von WD emittiert<br />
worden. „Die WD-Vergärung ist eine relativ einfache<br />
Möglichkeit, diese Emissionen massiv zu minimieren.<br />
Wenn 50 bis 70 Prozent des in Deutschland anfallenden<br />
WD in Biogasanlagen eingesetzt werden, dann ist eine<br />
Treibhausgasreduktion von 2,8 bis 4 Millionen Tonnen<br />
CO 2<br />
-Äquivalent machbar“, betonte Stinner. Die Bundesregierung<br />
verfolge das Ziel, dass die Landwirtschaft in<br />
Deutschland in 2030 Treibhausgase nur noch in Höhe<br />
von 58 Millionen Tonnen CO 2<br />
-Äquivalent emittiert. Zum<br />
Vergleich: 2017 stieß die hiesige Landwirtschaft etwas<br />
über 63 Millionen Tonnen und in 1990 knapp über 79<br />
Millionen Tonnen CO 2<br />
-Äquivalent aus.<br />
„In den östlichen Bundesländern werden<br />
Biogasanlagen mit besonders hohen<br />
WD-Mengen betrieben, die nicht in der<br />
Klasse der Güllekleinanlagen vergütet<br />
werden“<br />
Prof. Dr. Walter Stinner<br />
Stallmist wird in Kleinanlage vergoren<br />
Jan Büdding, Betreiber einer Biogasanlage in Bocholt<br />
im Münsterland (NRW), berichtete, wie er seine 75-kW-<br />
Biogasanlage betreibt. Die sogenannte Güllekleinanlage<br />
ging im September 2018 in Betrieb und wird seitdem<br />
mit Rindermist und Futterresten betrieben. 6 bis<br />
10 Tonnen davon setzt er täglich ein. Zudem wird etwas<br />
Regenwasser oder dünne Flüssigkeit aus dem Gärproduktlager<br />
zum Verdünnen des Fermenterinhalts hinzugegeben.<br />
Die verschiedenen Mistarten schwanken<br />
nach Angabe des Anlagenbetreibers in den Trockensubstanzgehalten<br />
zwischen 20 und 50 Prozent.<br />
Der Fermenter hat einen Durchmesser von 16 Meter<br />
und eine Höhe von 6 Meter. Das Fermentervolumen beträgt<br />
1.200 Kubikmeter. Neben dem Fermenter befindet<br />
sich ein offenes Gärdüngelager. In den Fermenter<br />
sind ein Tauchmotorrührwerk und ein Paddelrührwerk<br />
eingebaut, die den Inhalt homogenisieren. Das 22-kW-<br />
Paddelrührwerk läuft dauerhaft mit niedriger Drehzahl<br />
und einer Stromaufnahme von 4 bis 5 Kilowatt. Der<br />
Trockensubstanzgehalt des Gärsubstrats im Fermenter<br />
beträgt 14,5 Prozent. Ähnlich hoch ist der TS-Gehalt<br />
im Gärdüngerlager. Die Verweilzeit in dem Behälter<br />
liegt zwischen 80 und 100 Tagen. Die Gärtemperatur<br />
beträgt 50 Grad Celsius. Im Schnitt liefert der Mist zwischen<br />
80 und 100 Normkubikmeter Biogas pro Tonne<br />
Frischmasse. Der Methangehalt liegt bei 51 bis 52<br />
Prozent.<br />
Aufgrund der relativ höheren Gärtemperatur findet laut<br />
Büdding ein thermischer Aufschluss statt, die Rührfähigkeit<br />
verbessert sich und der mechanische Verschleiß<br />
an den Rührwerken ist geringer. Die thermophile Gärtemperatur<br />
erhöht aber auch den Wasserdampfgehalt<br />
im Rohbiogas. Darum wurde eine 80 Meter lange Kondensatstrecke<br />
mit einem Kondensatschacht, in dem<br />
der Wasserdampf auskondensiert, an der tiefsten Stelle<br />
verbaut.<br />
„Vor dem Bau der Anlage habe ich in der Region ermittelt,<br />
wo überall Misthaufen auf dem Feld energetisch<br />
ungenutzt herumliegen. Dann habe ich mit den Tierhaltern<br />
gesprochen und abgefragt, wer Interesse hätte<br />
an der Abgabe des Stallmistes. Wir haben auch im<br />
Vorfeld des Baus die verschiedenen Miste im Labor auf<br />
Inhaltsstoffe analysieren lassen. Darüber hinaus haben<br />
wir die Miste beurteilt beispielsweise hinsichtlich des<br />
Kot-Stroh-Verhältnisses, der Strohhalmlänge oder ob<br />
es zerkleinert werden muss“, erläuterte Büdding.<br />
„Wir haben auch im Vorfeld<br />
des Baus die verschiedenen<br />
Miste im Labor auf Inhaltsstoffe<br />
analysieren lassen“<br />
Jan Büdding<br />
Er empfiehlt, dass das Stroh schon bei der Ernte oder<br />
beim Einstreuen geschnitten beziehungsweise gehäckselt<br />
werden sollte. Am liebsten nimmt er Mist an, der<br />
viel Futterreste enthält. Davon gebe es aber nicht so<br />
große Mengen. Büdding betonte, dass der Mist möglichst<br />
frisch in der Anlage vergoren werden müsse. Er<br />
hat außerdem festgestellt, dass der im Sommer angelieferte<br />
Mist weniger Biogas liefert. Es scheint so, als<br />
würden die höheren Außentemperaturen biologische<br />
Prozesse im Mist auslösen, die in der Folge eine geringere<br />
Gasausbeute bewirken.<br />
Werden sehr große Mengen auf einmal angeliefert,<br />
walzt er den Mist mit dem Schlepper fest so wie einen<br />
Silohaufen. Durch das Festwalzen wird Luft aus dem<br />
Misthaufen gedrückt. Die Folge daraus ist: Die<br />
23
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Wie und ob sich mehr<br />
Wirtschaftsdünger<br />
in Biogasanlagen<br />
einsetzen lassen,<br />
analysiert ein Projekt<br />
im Landkreis Rotenburg<br />
Wümme (Ostniedersachsen).<br />
biologische Umsetzung verzögert sich und Gasertragsverluste<br />
werden reduziert. Die Anlieferung des Mistes<br />
sollte aus tierseuchenhygienischen Gründen über eine<br />
eigene Zufahrt zur Biogasanlage geschehen.<br />
90 Prozent des zu vergärenden Mistes liefern Landwirte<br />
aus dem regionalen Umfeld der Biogasanlage an. Mit<br />
den Lieferanten hat Büdding zehnjährige Lieferverträge<br />
abgeschlossen. Die überwiegende Menge stammt<br />
aus sogenannten Tiefstreuställen. „Bei dem Vergären<br />
von Stallmist ist besonders darauf zu achten, dass die<br />
angelieferten Mengen keine Störstoffe wie Metallteile,<br />
Ballenbänder oder anderes enthalten. Sonst sind Störungen<br />
im Feststoffeintrag vorprogrammiert“, machte<br />
Büdding aufmerksam.<br />
Projekt Rotenburg-Wümme untersucht, wie<br />
mehr Wirtschaftsdünger in Biogasanlagen<br />
gelangen kann<br />
Wie und ob sich mehr Wirtschaftsdünger in Biogasanlagen<br />
einsetzen lassen, das analysiert ein Projekt im<br />
Landkreis Rotenburg Wümme (Ostniedersachsen). Federführend<br />
in dem Projekt ist die Bioenergieinitiative<br />
im Landkreis Rotenburg im Verbund mit dem Niedersachsen<br />
Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe (3N),<br />
dem Maschinenring Zeven und Landwirten der Region.<br />
Vorgestellt wurde es vom 3N-Mitarbeiter Sascha Hermus.<br />
Im Rahmen des Projektes seien 141 Anlagenbetreiber<br />
angeschrieben worden. Gut die Hälfte hätten<br />
geantwortet, was eine gute Rücklaufquote sei.<br />
Hermus berichtete, dass 28 Anlagenbetreiber sich vorstellen<br />
könnten, Rindergülle zu vergären. 23 würden<br />
auch Rinderfestmist als Gärsubstrat akzeptieren. 10<br />
könnten sich vorstelle, Schweinegülle einzusetzen, 8<br />
waren separierter Rindgülle und 6 Hähnchenmist gegenüber<br />
positiv eingestellt. „Keine Akzeptanz fanden<br />
Hühnertrockenkot und geschredderter Putenmist“,<br />
machte der Referent aufmerksam.<br />
Auf die Frage, ob WD separiert vorliegen müsse, sagten<br />
27 Anlagenbetreiber ja, 24 sagten nein und 9 machten<br />
keine Angaben dazu. 38 Betreiber sagten, dass<br />
die WD-Lieferanten Gärdünger zurücknehmen sollten.<br />
34 der Befragten teilten mit, dass sie sich vorstellen<br />
könnten, dass ihre Biogasanlagen in Zukunft als sogenannte<br />
Nährstoffdrehscheiben fungieren. 23 verneinten<br />
dies, 3 Befragte machten keine Angaben dazu.<br />
Hermus führte aus, dass von der Projektgruppe folgende<br />
Maßnahmen für wichtig erachtet würden:<br />
ffGüllebehälter als Lagerraum für Gärdünger<br />
anerkennen.<br />
ffGenehmigungsverfahren vereinfachen.<br />
ffLagerbehälter für WD/Gärdünger in<br />
Ackerbauregionen zulassen.<br />
ffEinsatz von Gülle und Mist in Biogas -<br />
anlagen rechtlich vereinfachen.<br />
ffFlexiblen Substrateinsatz genehmigungsrechtlich<br />
vereinfachen.<br />
ffGülle nicht unnötig auf die Straße bringen.<br />
ffDüngevorgaben für Grünland ändern.<br />
ffNährstoffimport in den Landkreis stoppen.<br />
ffMiteinander statt gegeneinander arbeiten.<br />
Der Referent wies nachdrücklich darauf hin, dass es<br />
wichtig ist, alle WD, aber auch Energiepflanzen etc., vor<br />
der Vergärung zu analysieren. Denn die Inputstoffe würden<br />
zum Teil erheblich abweichen hinsichtlich TS-Gehalten,<br />
oTS-Gehalten, des Anteils an Gesamtstickstoff,<br />
an Ammonium-Stickstoff sowie hinsichtlich der Phosphat-<br />
und Kaligehalte. Hermus zeigte dies beispielhaft<br />
an zehn verschiedenen Maissilagen auf. So schwankte<br />
der Wert für Gesamtstickstoff zwischen 3,8 und 6<br />
Kilogramm pro Kubikmeter. Bei Phosphat schwankten<br />
die Werte zwischen 1,5 und 2,2 Kilogramm pro Kubikmeter.<br />
Aber auch Werte für analysierte Gärrestproben präsentierte<br />
Hermus. Beim Gesamtstickstoff beispielsweise<br />
schwankten die Werte zwischen 1,9 und 8 Kilogramm<br />
pro Kubikmeter. Bei Phosphor zwischen 0,4 und 3,2<br />
Kilogramm je Kubikmeter. Zudem stellte er Modellkalkulationen<br />
anhand eines Exceltools vor. Dabei konnte<br />
errechnet werden, welcher Wirtschaftsdünger unter<br />
welchen Bedingungen wettbewerbsfähiger ist oder<br />
nicht als ein beispielhafter Silomais. Klar ist: Wer WD<br />
anstatt Silomais vergären will, der sollte genau betriebsindividuell<br />
kalkulieren.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
0 54 09/90 69 426<br />
martin.bensmann@biogas.org<br />
Foto: www.landpixel.eu<br />
24
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Aktuelles<br />
KRAMER ÜBERZEUGT<br />
AUF GANZER LINIE<br />
JETZT<br />
ANGEBOT<br />
ANFORDERN!<br />
Kramer Rad- und Teleskoplader - stark, standsicher, effizient.<br />
Teleskoplader<br />
Robust, vielseitig und effizient bis<br />
ins letzte Detail.<br />
Nutzlast: 2.700 - 5.500 kg<br />
Max. Stapelhöhe: 8.750 mm<br />
Geschwindigkeit: 0 - 20 km/h<br />
optional 30 - 40 km/h<br />
Teleskopradlader<br />
Mehr Flexibilität, Reichweite und<br />
Beweglichkeit.<br />
Kipplast: 2.500 - 5.500 kg<br />
Schaufeldrehpunkt: 4.270 - 5.225 mm<br />
Geschwindigkeit: 0 - 20 km/h<br />
optional bis 40 km/h<br />
Kontaktieren Sie Ihren Händler:<br />
www.kramer.de/haendlersuche<br />
25
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Strohtagung Teil 2<br />
Gülleausbringung:<br />
Ertrags unterschiede im<br />
Silomaisversuch aufgrund<br />
der eingesetzten Technik<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Mit der Düngewirkung von<br />
Gärresten zu Silomais unter<br />
Berücksichtigung verschiedener<br />
Applikationsverfahren<br />
beschäftigt sich<br />
Christian Sperger von der Bayerischen<br />
Landesanstalt für Landwirtschaft. Er stellte<br />
dreijährige Versuchsergebnisse aus den<br />
Jahren 2016 bis 2018 vor. Im Versuch<br />
waren auch Stickstoffsteigerungsvarianten<br />
enthalten. Den signifikant höchsten Ertrag<br />
brachte die Variante mit 150 Kilogramm<br />
mineralischem Stickstoff pro Hektar mit<br />
235 Dezitonnen (dt) Trockenmasse (TM) je<br />
Hektar (ha). Zwar seien mit 190 und 230<br />
Kilogramm Stickstoff pro ha etwas höhere<br />
Trockenmasseerträge erzielt worden, die<br />
ließen sich aber, so Sperger, statistisch<br />
nicht als signifikant bezeichnen.<br />
Der Versuch umfasste unter anderem sechs<br />
Varianten, bei denen Gärprodukte mit unterschiedlichen<br />
Ausbringtechniken ausgebracht<br />
wurden. In Variante 1 (V1) wurde<br />
das Gärprodukt auf dem Boden vor der<br />
Saat breit verteilt (analog nach unten abstrahlender<br />
Prallteller). Innerhalb von einer<br />
Stunde wurde das Gärprodukt in den Boden<br />
eingearbeitet. Gedüngt wurden in dieser<br />
Variante laut Sperger 170 Kilogramm Gesamtstickstoff<br />
über das Gärprodukt (organisch)<br />
und zusätzlich noch 30 Kilogramm<br />
(kg) mineralischer Stickstoff (N) als Unterfußdüngung.<br />
Ertrag: 238 dt TM/ha.<br />
V2: Breitverteilung vor der Saat in Kombination<br />
mit Schleppschuhtechnik –<br />
100 kg N/ha vor der Saat mittels Breitverteilung<br />
und sofortiger Einarbeitung<br />
und später 70 kg N/ha in den Bestand<br />
bei 40 Zentimeter Wuchshöhe mit<br />
Schleppschuhtechnik; wieder 30 kg N<br />
mineralisch als Unterfußdünger.<br />
Ergebnis: 229 dt TM/ha.<br />
V3: Breitverteilung vor der<br />
Saat in Kombination<br />
mit Schleppschuhtechnik<br />
– 150 kg N/ha vor<br />
der Saat mittels Breitverteilung<br />
und sofortiger<br />
Einarbeitung und 100 kg N/ha in<br />
den Bestand mit Schleppschuhtechnik;<br />
30 kg N mineralisch als Unterfußdünger.<br />
Achtung: wäre nicht konform<br />
mit Düngeverordnung! Versuch galt nur<br />
der Ergebnisrealisierung.<br />
Ertrag: wie Variante 1.<br />
V4: Gärdüngerausbringung mittels Breitverteilung<br />
in Kombination mit Scheibenscharen.<br />
100 kg N/ha vor der Saat<br />
mittels Breitverteilung und sofortiger<br />
Einarbeitung und später 70 kg N/ha in<br />
den Bestand mit Scheibentechnik; 30<br />
kg N mineralisch als Unterfußdünger.<br />
Ergebnis: 233 dt TM/ha.<br />
V5: Gärdüngerausbringung mit Schleppschuhtechnik:<br />
170 kg N/ha in den<br />
Bestand. 30 kg N mineralisch als<br />
Unterfußdünger.<br />
Ergebnis: 226 dt TM/ha.<br />
V6: Ausbringung des Gärdüngers mit<br />
Scheibenschartechnik. 170 kg N/ha<br />
in den Bestand. 30 kg N mineralisch<br />
als Unterfußdünger.<br />
Ergebnis: 233 dt TM/ha.<br />
Sperger informierte, dass die Variante 3<br />
einen positiven N-Saldo von plus 32 kg N/<br />
ha aufweist (erhöhte Dünung, nicht nach<br />
geltender Düngeverordung!).<br />
Alle anderen Varianten hätten negative N-<br />
Salden gezeigt. Variante 1 habe die beste<br />
Mineraldüngeräquivalenz erreicht. Alle<br />
anderen Varianten hätten die 60-Prozent-<br />
Anrechnung nach Düngeverordnung nicht<br />
erreicht.<br />
Gülleausbringung mit Scheibentechnik<br />
in den Maisbestand.<br />
Versuchsglieder zu Strip Tillund<br />
Scheibentechnik<br />
Weitere Versuchsglieder bestanden darin,<br />
das Gärprodukt mit Strip Till-Technik beziehungsweise<br />
mit Scheibentechnik auszubringen.<br />
In allen Varianten wurden 170 kg<br />
N/ha über Gärrest und 30 kg N/ha mineralisch<br />
gedüngt.<br />
V1: Strip Till: Gärdüngergabe 10 Zentimeter<br />
neben die Saatreihe und 18 bis 20<br />
Zentimeter tief.<br />
Ertrag: 220 dt TM/ha.<br />
V2: Strip Till: Gärdüngergabe 18 bis 20<br />
Zentimeter unter die Saatreihe.<br />
Ertrag: 234 dt TM/ha.<br />
V3: Strip Till: Gärdüngergabe 18 bis<br />
20 Zentimeter unter die Saatreihe.<br />
Gärprodukt mit Piadin versetzt – Aufwandmenge:<br />
6 Liter/ha. Sperger sagte,<br />
dass sie festgestellt haben, dass die<br />
Menge zu hoch ist.<br />
Ertrag: 225 dt TM/ha.<br />
V4: Scheibentechnik: Gärdünger 8 bis 10<br />
Zentimeter tief in den Boden eingebracht<br />
vor der Aussaat des Maises.<br />
Keine Bodenbearbeitung. Mais in<br />
Direktsaatverfahren gelegt.<br />
Ertrag: 232 dt TM/ha.<br />
V5: Scheibentechnik: Gärdünger 8 bis<br />
10 Zentimeter tief in den Boden<br />
eingebracht. Saatbettbereitung vor der<br />
Maisaussaat.<br />
Ertrag: 245 dt TM/ha. Diese Variante<br />
lieferte den höchsten Trockenmasseertrag<br />
pro ha.<br />
Fotos: Christian Sperger<br />
26
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Aktuelles<br />
Gülleausbringung mit Schleppschuhtechnik in den Maisbestand.<br />
Im aufgegrabenen Boden ist sehr schön zu sehen, wo<br />
per Strip Till-Technik die Gülle abgelegt worden ist.<br />
Gülledüngung in Streifen: Per Strip-Till-Verfahren<br />
wurde flüssiger Wirtschaftsdünger vor der<br />
Maissaat ausgebracht. Gut zu erkennen sind die<br />
drei Strip-Till-Reihen.<br />
Die genannten Varianten wiesen alle negative<br />
N-Salden auf. „Die Breitverteilung mit<br />
sofortiger Einarbeitung (Kreiselegge) des<br />
Gärprodukts mit 170 kg N und 30 kg N mineralisch<br />
als Unterfußgabe bringt die gleichen<br />
Erträge wie aufwändigere Verfahren,<br />
eine 65-prozentige N-Wirkung bei einem<br />
negativen Saldo. In puncto Erosionsschutz<br />
ist sie jedoch nicht ideal. Alle Strip-Till-<br />
Varianten waren im Hinblick auf die Trockenmasseerträge<br />
pro ha schlechter. Die<br />
Scheibentechnik mit Gärproduktablage<br />
komplett in den Boden und Saatbettbereitung<br />
war die beste Variante“, so das Fazit<br />
von Christian Sperger.<br />
27<br />
kraftpaket<br />
06473 411596 | www.aks-heimann.de | info@aks-heimann.de
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Rate der Grundwasserneubildung<br />
wichtiger Faktor<br />
Dr. Gerd Reinhold vom Thüringer Landesamt<br />
für Landwirtschaft und Ländlichen<br />
Raum erörterte in seinem Vortrag die Nährstoffsituation<br />
aus Wirtschaftsdüngern in<br />
Thüringen, er ging dabei aber auch auf die<br />
bundesweite Problematik ein. 90 Prozent<br />
der Biogasanlagen in Thüringen befänden<br />
sich in Landwirtschaftsbetrieben. Ein Substrathandel<br />
finde nicht statt. Die vorhandenen<br />
Biogasanlagen hätten keinen Einfluss<br />
auf den Pachtmarkt. Auch gebe es in Thüringen<br />
kaum sogenannte Trockenfermentationsanlagen.<br />
Der Wirtschaftsdüngeranteil am Substratmix<br />
liege bei knapp über 70 Prozent. Rindergülle<br />
werde zu 81 Prozent eingesetzt,<br />
Schweinegülle zu 47 Prozent, Mist zu 38<br />
Prozent und Hühnertrockenkot zu 116 Prozent<br />
aufgrund von Importen. Biogasanlagen<br />
würden lediglich 6,2 Prozent der landwirtschaftlich<br />
genutzten Fläche beanspruchen.<br />
Die Thüringer Biogasanlagen könnten rund<br />
340.000 Haushalte mit Strom versorgen<br />
bei 70-prozentiger Wärmenutzung.<br />
„In Thüringen sind Nährstoffüberschüsse<br />
kein Thema. Man kann auf Gesamtdeutschland<br />
bezogen nicht verallgemeinern, dass<br />
dort, wo hohe Stickstoffüberschüsse vorhanden<br />
sind, automatisch hohe Nitratgehalte<br />
im Grundwasser vorkommen. In Thüringen<br />
und Mitteldeutschland gibt es Regionen mit<br />
hohen Stickstoffüberschüssen, aber ohne<br />
nennenswerte Tierhaltung (nur 0,4 GV/ha)“,<br />
machte Reinhold deutlich.<br />
Im Alpenvorland gebe es auch hohe Nährstoffbelastungen,<br />
aber keine Nitratprobleme.<br />
Man dürfe sich das nicht zu einfach<br />
machen. Er hält die Rate der Grundwasserneubildung<br />
für einen wichtigen Faktor.<br />
In Nordwestdeutschland sei die Nitratbelastung<br />
hoch trotz hoher Grundwasserneubildungsraten.<br />
„Dort sind die Einträge von<br />
Stickstoff deutlich zu hoch“, betonte der<br />
Referent. Im Alpenvorland zeige sich das<br />
genaue Gegenteil. Dort sei der Tierbesatz<br />
hoch und die Grundwasserneubildungsrate<br />
auf sehr hohem Niveau, aber es gebe<br />
trotzdem kein Nitratproblem. Im mitteldeutschen<br />
Bereich sei die Rate der Grundwasserneubildung<br />
sehr gering. Größtes Problem<br />
laut Reinhold: „Wir vergleichen eine<br />
Konzentration mit einer Fracht. Das kann<br />
so nicht gemacht werden.“<br />
Kritik an neuen Sperrzeiten<br />
Er monierte auch die Ausdehnung der<br />
Sperrzeiten für die Ausbringung von Wirtschaftsdüngern<br />
nach der neuen Düngeverordnung.<br />
„Im Frühjahr ist die Befahrbarkeit<br />
von Böden oft schwierig und im Sommer<br />
haben wir wenig Fruchtarten mit einem<br />
Düngebedarf. Im Spätsommer und Herbst<br />
gibt es kaum noch die Möglichkeit, Wirtschaftsdünger<br />
auszubringen. 6 Monate<br />
Lagerkapazität reichen nun nicht mehr,<br />
weil im Herbst viele Behälter zu 20 bis<br />
40 Prozent gefüllt sind“, macht Reinhold<br />
deutlich.<br />
Bei der Vergärung von einem Hektar Silomais<br />
mit Gärdüngerrückführung würden<br />
100 Kilogramm Stickstoff im Kreislauf<br />
gefahren. 70 Kilogramm müssten extern<br />
zugeführt werden. Bei Winterweizen<br />
müssten beim Verkauf des Korns und dem<br />
Strohverbleib auf der Fläche sogar 160<br />
Kilogramm Stickstoff extern zugeführt<br />
werden. Zudem entziehe der Winterweizen<br />
der Fläche 25 Kilogramm Phosphor, die<br />
extern zugeführt werden müssten. Beim<br />
Silomais mit Biogasverwertung würden 32<br />
Kilogramm Phosphor im Kreislauf erhalten.<br />
Externe Phosphorgaben seien nicht<br />
notwendig.<br />
Die größten Hemmnisse für die Güllevergärung<br />
im Erneuerbare-Energien-Gesetz<br />
(EEG) seien die 150 Tage Verweilzeit des<br />
Gärsubstrats in der gasdichten Gärstrecke,<br />
die Übernahme der Entsorgungspflicht<br />
sowie die Stallgrößen in Verbindung mit<br />
Transportkosten. Reinhold schlug vor „50<br />
Tage Verweilzeit in Mehrbehältersystemen<br />
plus einen Tag zusätzlich pro Prozent<br />
Feststoffeinsatz“. Außerdem forderte er,<br />
den Restgaspotenzialnachweis im EEG<br />
zuzulassen. Darüber hinaus warb er dafür,<br />
den Einsatz von 100 Prozent Gülle für die<br />
Befreiung von der Pflicht zur 150-tägigen<br />
gasdichten Lagerung zu streichen.<br />
Gülle in Gemeinschaftsanlagen in<br />
Ackerbauregionen vergären<br />
„Die 75-kW-Grenze für Güllekleinanlagen<br />
ist für Süddeutschland zu hoch wegen<br />
zu kleiner Tierbestände. Sie ist für Ostdeutschland<br />
zu niedrig, da so nicht die gesamte<br />
Gülle eines Standortes aufgrund gro-<br />
28
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Aktuelles<br />
ßer Tierbestände verwertet werden kann“,<br />
gab der Referent zu bedenken. Er schlug<br />
vor, dass es bei der Vergärung von Gülle und<br />
Mist keine Leistungsgrenze geben sollte.<br />
Der Einsatz von 20 Prozent Feststoff sollte<br />
toleriert werden. Gegebenenfalls sei eine<br />
Vergütungsabstufung einzuführen.<br />
Auch sollte Gülle in Gemeinschaftsanlagen<br />
in Ackerbauregionen vergoren werden. Dies<br />
führe zu einer Steigerung der Stickstoff-<br />
Wirkung von 20 auf 70 Prozent. So könnten<br />
beispielsweise 2,5 Kilogramm Stickstoff<br />
pro Kubikmeter Rindergülle genutzt werden,<br />
die sonst emittiert würden. Würden 25<br />
Tonnen Rindergülle per Lkw 100 Kilometer<br />
weit transportiert (35 Liter Diesel/100 Kilometer),<br />
dann verursache der Transport 1,48<br />
Kilogramm CO 2<br />
-Emissionen pro Kilogramm<br />
Stickstoff. Bei der industriellen Harnstoffproduktion<br />
seien es laut KTBL-Daten 4,46<br />
Kilogramm, bei Ammonium-Harnstoff-Lösung<br />
(AHL) 6,81 Kilogramm und bei der<br />
Produktion von Kalkammonsalpeter 9,46<br />
Kilogramm CO 2<br />
je Kilogramm Stickstoff.<br />
Folgenden Handlungsbedarf skizzierte<br />
Reinhold:<br />
ffVereinheitlichung des Veredlungsbesatzes<br />
auf 1 GV plus kW NawaRo/ha in den<br />
Regionen.<br />
ffVermeidung von Nährstoffüberschüssen<br />
durch die kombinierte organisch-mineralische<br />
Düngung.<br />
ffVerbringung der Nährstoffe aus Überschussregionen<br />
zu zentralen Biogasanlagen<br />
in Ackerbauregionen.<br />
ffReduzierung des NawaRo-Einsatzes in<br />
Biogasanlagen in Überschussgebieten.<br />
ffGülleaufbereitung nur, wenn zum Beispiel<br />
die Biogasanlage die energetische<br />
Grundlage liefert und der technische<br />
Aufwand gering ist.<br />
ffErhalt der landwirtschaftlichen Primärproduktion<br />
in den Regionen.<br />
ffEntwicklung von Systemen zur Reduzierung<br />
des Stickstoffanfalls in der<br />
Tierhaltung.<br />
ffReduzierung des auf Futtermittelimporte<br />
basierenden Fleischexports.<br />
Niederlande: Strohballen<br />
separieren Gülle in feste und<br />
flüssige Phase<br />
Um die Reduzierung der Güllemenge ging<br />
es im Vortrag des Niederländers Jan Leemkuil.<br />
Er hat das sogenannte Strohfilterverfahren<br />
entwickelt. Bei diesem Verfahren<br />
werden Strohballen auf einer betonierten<br />
Fläche – am besten überdacht – verteilt.<br />
Die Strohballen, die unten von der Gülle<br />
durchströmt werden, separieren die festen<br />
Bestandteile von der flüssigen Phase ab. Es<br />
findet sozusagen eine passive Fest-Flüssig-<br />
Trennung statt. Nach Leemkuils Angaben<br />
können mit einer Grundfläche von 100<br />
Quadratmetern rund 1.000 Kubikmeter<br />
Gülle pro Jahr separiert werden.<br />
Das Verfahren benötigt 3 bis 5 Kilogramm<br />
Stroh pro Tonne Gülle. Die Strohqualität sei<br />
nicht entscheidend. „Das Stroh wird nur<br />
verwendet, um die Fließrichtung und die<br />
Fließgeschwindigkeit zu steuern“, erläuterte<br />
der Verfahrensentwickler. Die Tests<br />
mit Rindergülle sowie mit Gülle von Sauen<br />
und Mastschweinen hätten gute Ergebnisse<br />
geliefert. Im Prinzip handelt es sich<br />
um eine Art Kaltkompostierung des Strohs<br />
mit dem separierten Feststoff und etwas<br />
Flüssigkeit.<br />
Von 1.000 Kilogramm Input können 114<br />
Kilogramm Feststoff mit 21,4 Prozent<br />
Trockensubstanzgehalt (TS) gewonnen<br />
werden. Übrig bleibt eine dünne Fraktion<br />
mit einem Trockensubstanzgehalt von 1,3<br />
Prozent. Da auch etwas Verdunstung stattfindet,<br />
wird die Ausgangsmenge insgesamt<br />
um etwa 16 Prozent reduziert. Nach gut einem<br />
Jahr hat das Stroh-Feststoff-Gemisch<br />
einen TS-Gehalt von rund 74 Prozent mit<br />
1,3 Prozent Stickstoff, 2,1 Prozent Phosphor<br />
und 0,2 Prozent Kali. Insgesamt ein<br />
interessantes Verfahren. Ob es aber in<br />
Deutschland genehmigungsfähig ist, ist<br />
eine Frage, die es zu klären gilt.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
0 54 09/90 69 426<br />
martin.bensmann@biogas.org<br />
HEAVY-DUTY<br />
RÜHRWERKE<br />
Sichern Sie sich durch die<br />
effizientesten Rührwerke<br />
am Markt bis zu<br />
40% Förderung<br />
der Investitionskosten<br />
durch die BAFA
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Strohtagung Teil 3<br />
Körnermaisstroh als alternatives<br />
Gärsubstrat ernst nehmen<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
In Deutschland fallen pro Jahr etwa 30 Millionen<br />
(Mio.) Tonnen (t) Stroh an. Darin enthalten sind<br />
nicht erntbare Anteile wie die Stoppeln, aber auch<br />
die Spreu. Der Strohbedarf für die Humusreproduktion<br />
ist ein wichtiger Faktor, der das nutzbare<br />
Strohpotenzial einschränkt. Das entnehmbare Strohpotenzial<br />
ohne Gärdüngerrückführung beträgt 8 bis 20<br />
Mio. t pro Jahr, sagte Prof. Dr. Walter Stinner vom DBFZ<br />
in Leipzig, der unter anderem über Potenziale und Kosten<br />
der Strohvergärung referierte.<br />
„In Abhängigkeit vom Abbau der organischen Trockensubstanz<br />
(oTS) und den erzielten Gasausbeuten<br />
schwankt der Stabilitätsfaktor. Er steigt von etwa 0,6 –<br />
ohne Strohvergärung, das Stroh bleibt auf dem Acker –<br />
auf etwa 0,8 mit Strohvergärung an. Das heißt, die<br />
Stabilität der vergorenen Gärreste aus Stroh ist entsprechend<br />
höher“, informierte der Wissenschaftler.<br />
Die Humusreproduktionsleistung (HRL) der Gärreste<br />
aus Stroh variiere zwischen 55 und 75 Prozent. Bei<br />
Ertragslage je Hektar Feldreste, Biogasanlage Utzenaich (AUT)<br />
Material<br />
Tonnen<br />
TS/ha<br />
Gasertrag in Nl<br />
CH 4<br />
/kg oTS<br />
Einsparung in<br />
Liter Erdöl<br />
CO 2<br />
-Einsparung<br />
in Tonnen<br />
Maisstroh 3 - 8 260 - 320 800 - 2.500 3 - 8<br />
Getreidestroh 3 - 8 170 - 210 500 - 1.700 2 - 5<br />
Rapsstroh 2 - 5 180 - 230 350 - 1.150 1 - 4<br />
Zwischenfrüchte 3 - 8 220 - 280 650 - 2.200 2 - 7<br />
einem oTS-Abbau von 60 Prozent betrage die HRL 55<br />
Prozent, bei einem Abbau von 40 Prozent betrage sie<br />
75 Prozent.<br />
Stinner sagte, dass eine Nutzung von etwa 13 Mio. t.<br />
Stroh inklusive Spreu gut 430.000 Hektar Silomais<br />
entsprächen. Anmerkung der Redaktion: Laut Fachagentur<br />
Nachwachsende Rohstoffe (FNR) e.V. wird in<br />
Deutschland auf etwa 930.000 Hektar Silomais für die<br />
Biogasproduktion angebaut. Im Weiteren präsentierte<br />
Stinner beispielhaft Substratkosten beim Zukauf von<br />
Stroh und Silomais. Ausgangsbedingung war:<br />
a. Stroh, unbehandelt, trocken, gehäckselt mit<br />
Strohmühle, 86 Prozent Trockensubstanzgehalt<br />
(TS) – Methanertrag: 142,1 m³/t Frischmasse (FM).<br />
b. Stroh, behandelt, siliert, gehäckselt mit Strohmühle,<br />
30 Prozent TS – 68 m³/t FM.<br />
c. Silomais – 102 m³/t FM.<br />
Ergebnis:<br />
Stroh bei Zukauf<br />
a. Stroh 122,94 Euro/t FM oder 21,69 ct/kWh<br />
b. Stroh 128,88 Euro/t FM oder 16,95 ct/kWh<br />
c. Silomais 34,9 Euro/t FM oder 8,58 ct/kWh<br />
Substratkosten bei Ballenkette<br />
a. Stroh 53,08 Euro/t FM oder 9,37 ct/kWh<br />
b. Stroh 59,01 Euro/t FM oder 7,76 ct/kWh<br />
c. Silomais 34,9 Euro/t FM oder 8,58 ct/kWh<br />
Substratkosten bei Häckselkette<br />
a. Stroh 40,19 Euro/t FM oder 7,09 ct/kWh<br />
b. Stroh 46,12 Euro/t FM oder 6,06 ct/kWh<br />
c. Silomais 34,9 Euro/t FM oder 8,58 ct/kWh<br />
Die Silierung des Strohs hatte laut Stinner einen positiven<br />
Effekt auf den Substrataufschluss.<br />
Das gehäckselte Stroh wird zu einem Silagehaufen aufgestapelt. Sehr gut lassen<br />
sich auch Zuckerrüben in das Maisstroh einsilieren.<br />
Maisstroheinsatz in der Praxis<br />
Wie Maisstroh in der Praxis als Biogassubstrat verwendet<br />
wird, stellte Hannes Bogner von der BioG GmbH<br />
aus dem österreichischen Utzenaich vor. Das Unternehmen<br />
betreibt dort seit 2004 eine Biogasanlage und<br />
hat schon sehr früh auf landwirtschaftliche Reststoffe<br />
gesetzt. Parallel hat das Unternehmen Maschinen entwickelt<br />
wie den BioChipper, den BioFeeder oder den<br />
BioCrusher. Für die Verwendung von Maisstroh und<br />
Mist sprechen laut Bogner:<br />
30
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Aktuelles<br />
Fotos: Firma Geringhoff<br />
ffBilliger als Hauptfrüchte.<br />
ffHohe Wirtschaftlichkeit.<br />
ffKeine Flächen- und Lebensmittelkonkurrenz.<br />
ffReduktion von Fusarien und Schädlingen<br />
auf dem Feld.<br />
ffGärprodukt ist ein guter N-P-K-Dünger.<br />
ffKeine Stickstoffverluste durch Abbau von<br />
organischem Material.<br />
ffReduktion der Klimagase Kohlendioxid<br />
und Lachgas.<br />
ffNach der Feldräumung leichtere<br />
Bodenbearbeitung.<br />
Wie Bogner mitteilte, hat das Unternehmen weltweit<br />
über 250 Feststoffeintragsysteme installiert. Die Biogasanlage<br />
in Utzenaich produziert täglich 3.300 Kubikmeter<br />
Biomethan ausschließlich aus Reststoffen.<br />
Die Gasmenge kommt zu 67 Prozent aus Maisstroh, zu<br />
12 Prozent aus Rinder- und Pferdemist, zu 7 Prozent<br />
aus Getreidestroh und zu 5 Prozent aus Landschaftspflegematerial.<br />
„Wir nehmen nur frischen Pferdemist<br />
an, weil er sonst eine toxische Wirkung hat“, betonte<br />
Bogner. Von den vier Anlagenbetreibern haben zwei<br />
eine Schweinehaltung, sodass pro Jahr noch rund<br />
2.000 Kubikmeter Schweinegülle in der Anlage eingesetzt<br />
werden.<br />
Welche Trockensubstanzerträge pro Hektar und welche<br />
Gaserträge pro Tonne Trockensubstanz aus verschiedenen<br />
Reststoffen zu erwarten sind, zeigt die Tabelle<br />
auf Seite 30. In Utzenaich werden 4,1 bis 4,5 Tonnen<br />
Trockensubstanz aus Maisstroh je Hektar geerntet. Der<br />
Gasertrag aus Maisstroh erreicht 290 Normliter Methan<br />
pro Kilogramm organische Trockensubstanz.<br />
Die Erntekosten, wenn 3,5 Hektar pro Stunde beerntet<br />
werden und der Ernteradius 2 Kilometer beträgt,<br />
sind laut Bogner folgende: Der<br />
BioChipper, der die Maisstoppeln<br />
abschlegelt und und mit dem<br />
Maisstroh in einem Arbeitsgang<br />
schwadet, kostet 120 Euro pro<br />
Stunde, zwei Ladewagen zum<br />
Aufnehmen und Abtransportieren<br />
des Maisstrohs kosten 240<br />
Euro je Stunde. Die Arbeiten auf<br />
dem Silo werden mit 60 Euro pro<br />
Stunde kalkuliert. Pro Hektar betragen<br />
die Erntekosten somit 120<br />
Euro. Pro Tonne Trockensubstanz<br />
betragen die Erntekosten 29,30<br />
Euro. 0,10 Euro sind die Kosten<br />
pro Kubikmeter Methan. Je<br />
Megawattstunde bei 40 Prozent<br />
elek trischem Wirkungsgrad hat<br />
Bogner 25,2 Euro ausgerechnet.<br />
„Je trockner die Einsatzstoffe<br />
sind, umso mehr empfehlen wir,<br />
das Material über einen Flüssigeintrag einzudosieren.<br />
Wichtig ist, dass das Maisstroh zerfasert wird. Wir benötigen<br />
eine möglichst große Oberfläche. Der Trockeneintrag<br />
hat auf unserer Anlage einen Energiebedarf<br />
von 13,25 Kilowattstunden pro Tonne Frischmasse,<br />
der Flüssigeintrag von 13,65 Kilowattstunden pro Tonne<br />
Frischmasse. Besonderes Augenmerk benötigt die<br />
Fermenterbiologie. Es ist speziell auf das Kohlenstoff-<br />
Stickstoffverhältnis zu achten. Je trockner das Stroh<br />
ist, umso ligninhaltiger ist es und umso kohlenstofflastiger<br />
wird der Fermenterhinhalt“, ließ Bogner einblicken.<br />
Mit Gülle und Mist lasse sich gegensteuern.<br />
Maisstroh und Zuckerrüben sind<br />
gute Silagepartner<br />
Diana Andrade von der Bayerischen Landesanstalt für<br />
Landwirtschaft referierte ebenfalls zum Thema Maisstrohnutzung<br />
und präsentierte Forschungsergebnisse.<br />
Die Ernteverluste des Körnermaisstrohs (KMS) beim<br />
Schwaden bezifferte sie mit 40 Prozent, die Verluste<br />
bei der Strohbergung gab sie mit 8 Prozent an. Die Ernteverluste<br />
bei KMS seien somit relativ hoch.<br />
„Je nach Witterung bei der Ernte schwanken die Trockensubstanzgehalte<br />
zwischen 40 und 60 Prozent.<br />
Versuche haben gezeigt, das KMS gut silierbar ist.<br />
KMS ist ein großvolumiges Material. Die Lagerungsdichte<br />
beträgt rund 120 Kilogramm Trockenmasse pro<br />
Kubikmeter. Bei sehr guter Verdichtung und genügend<br />
Vorschub bei der Entnahme konnte nicht festgestellt<br />
werden, dass der Silagestapel nacherwärmt“, berichtete<br />
Andrade.<br />
Durch hohe Radlasten der Walzfahrzeuge auf dem Silo<br />
oder durch den Einsatz von Pistenraupen könne mehr<br />
Masse auf kleinem Raum untergebracht werden. Im<br />
Rahmen der Forschungsarbeiten wurde KMS a) zu 100<br />
Prozent monosiliert, b) im Verhältnis 3:1 mit Zu-<br />
Bei der Maisstrohernte sollte, wenn nicht separat geschwadet wird, der Häcksler hinter dem<br />
Mähdrescher fahren und das Stroh aufnehmen. So wird verhindert, dass der Mähdrescher<br />
das Maisstroh, insbesondere auf dem Vorgewende des Ackers, plattfährt, was sonst zu<br />
Ernteverlusten führen würde.<br />
31
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Maisstrohsilage nach<br />
viermonatiger Lagerung.<br />
Hier wurden auch<br />
Zuckerrüben einsiliert.<br />
ckerrüben siliert und c) im Verhältnis 3:1 mit Gras cosiliert.<br />
Dann wurden die Silagen so getestet, als würden<br />
sie in einer 75-kW-Biogasanlage (Beispiel 1) und in<br />
einer NawaRo-Anlage, 500 kW, (Beispiel 2) eingesetzt.<br />
Beispiel 1: Referenz: 80:20, Wirtschaftsdünger zu<br />
Silomais in Prozent der täglichen Frischmasse. In der<br />
Variante Mono-Sil: 80:20, statt Silomais wurde KMS<br />
Monosilage gefüttert. In der Variante Co-Sil: 80:20,<br />
statt KMS Monosilage wurde KMS-Co-Silage gefüttert.<br />
Im Beispiel 2 waren die Varianten:<br />
Referenz: 15 Prozent GPS, 19 Prozent Grassilage und<br />
66 Prozent Maissilage. In der Variante KMS-Monosilage<br />
wurden 15 Prozent GPS, 20 Prozent Grassilage und<br />
65 Prozent KMS statt Silomais, und in der Variante<br />
KMS-Co-Silage wurden 15 Prozent GPS, 20 Prozent<br />
Grassilage und 65 Prozent KMS-Co-Silage eingesetzt.<br />
Höhere Raumbelastung – geringere<br />
Gasproduktion<br />
Ergebnisse zu Beispiel 1: In der Referenz sank der spezifische<br />
Methanertrag kontinuierlich trotz steigender<br />
Raumbelastung. In dem Versuch mit KMS monosiliert<br />
sank der Gasertrag nach etwa 10 Tagen deutlich. Die<br />
Biologie brauchte weitere 30 Tage, bis sie sich stabilisierte.<br />
Dann wurde die Raumbelastung von 2,5 auf<br />
3,0 Kilogramm oTS pro Kubikmeter Fermentervolumen<br />
erhöht mit der Folge, dass die Gasproduktion einbrach.<br />
Sie brauchte etwa 20 Tage, um sich von der Futtersteigerung<br />
zu erholen. Eine Erhöhung der Raumbelastung<br />
am 80. Versuchstag von 3,0 auf 3,5 Kilogramm oTS<br />
pro Kubikmeter Fermentervolumen brachte keinen<br />
Gasmehrertrag. Vielmehr pendelte der spezifische<br />
Methanertrag vom 80. bis 120. Versuchstag um 240<br />
Normliter pro Kilogramm oTS.<br />
Im weiteren Verlauf ihres Vortrages ging sie auf die<br />
Frage ein, ob die Co-Silierung einen Einfluss auf den<br />
Biogasertrag in Beispiel 1 hat. Die Referenz zeigte<br />
über die Versuchsdauer von 200 Tagen insgesamt die<br />
beste Methanproduktiviät. KMS-Monosilage und KMS-<br />
Zuckerrübensilage hatten eine schlechtere Methanproduktivität<br />
als die Referenz. Beide Kurven<br />
hatten bezüglich der Methanproduktivität<br />
den gleichen Verlauf bei steigender Raumbelastung.<br />
Beide Varianten hatten einen<br />
Einbruch der Methanproduktivität um den<br />
10. Versuchstag. Ebenfalls zu einem Einbruch<br />
kam es nach der ersten Steigerung<br />
der Raumbelastung von 2,5 auf 3,0 Kilogramm<br />
oTS pro Kubikmeter Fermentervolumen.<br />
Die nächsten vier Steigerungen der<br />
Raumbelastung zeigten keine Beeinträchtigung<br />
der Methanproduktivität.<br />
Andrade: „Die KMS-Zuckerrübensilage verbessert<br />
die Methanproduktivität. Die silierten<br />
KMS-Varianten zeigten eine verbesserte<br />
Abbaukinetik der Biomasse. Die Co-Silierung<br />
mit Zuckerrüben hat einen stärkeren<br />
Effekt auf den Methanertrag gegenüber der KMS-Monosilage<br />
oder nicht siliertem Körnermaisstroh.“<br />
Ergebnisse zu Beispiel 2: Die Referenzvariante erreichte<br />
in den Raumbelastungsstufen 2,5, 3,0, 3,5 und 4,0<br />
kg oTS pro Kubikmeter Fermentervolumen gegenüber<br />
den anderen Varianten die höchsten spezifischen Methanerträge.<br />
Die Belastungsstufen hatten folgende<br />
abnehmende Reihenfolge: 2,5, 4,0, 3,5 und 3,0 kg<br />
oTS. Die Variante mit der KMS-Silage hatte insgesamt<br />
geringere spezifische Methanerträge als die Referenz.<br />
Die Methanerträge nahmen über die Belastungsstufen<br />
in folgender Reihenfolge ab: 2,5, 3,0, 3,5 und 4,0 kg<br />
oTS.<br />
KMS-Silage mit Rindergülle: auf dem Niveau von<br />
KMS-Silage. Sinkende spezifische Methanerträge mit<br />
steigender Raumbelastung. Die Variante 4 mit KMS-<br />
Zuckerrübensilage ergab bessere spezifische Methanerträge<br />
als die Variante 2 KMS-Silage und Variante<br />
3 KMS-Silage plus Rindergülle. In Variante 4 waren die<br />
Belastungsstufen 2,5 und 3,0 kg oTS besser als die<br />
beiden höheren Belastungsstufen. In Variante 5 wurde<br />
zur KMS-Silage und der Zuckerrübensilage noch Rindergülle<br />
eingemischt. Es wurden die gleichen spezifischen<br />
Methanerträge erreicht wie in Variante 4.<br />
Abschließend hob Andrade hervor, dass Körnermaisstroh<br />
im Durchschnitt etwa 88 Prozent des Methanpotenzials<br />
von Silomais besitzt. Körnermaisstroh mit<br />
Zuckerrübensilage erreicht durchschnittlich knapp<br />
über 90 Prozent des Methanpotenzials von Silomais.<br />
Die Zuckerrübe wirke positiv auf die Methanbildung.<br />
Die Körnermaisstrohsilage allein habe etwa 20 Prozent<br />
weniger Methanbildungspotenzial als Silomais.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
0 54 09/90 69 426<br />
martin.bensmann@biogas.org<br />
Foto: Martin Bensmann<br />
32
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
www.schaumann-bioenergy.eu<br />
Aktuelles<br />
Mee(h)r Kraft aus Algen<br />
Bringt Ihren Fermenter in Schwung<br />
Beschleunigt den biologischen Abbau<br />
Vermeidet Schwimmschichten<br />
Verringert Hemmungen durch Toxine<br />
Algeacell unterstützt die Mikroorganismen im Fermenter, steigert die Biogasproduktion<br />
und sichert volle Leistung.<br />
Mehr Infos erhalten Sie von Ihrem Schaumann BioEnergy-Spezialberater.<br />
Kompetenz in Biogas<br />
Schaumann BioEnergy GmbH<br />
An der Mühlenau 4 · 25421 Pinneberg<br />
Telefon +49 4101 218-5400<br />
info@schaumann-bioenergy.eu<br />
33
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Strohtagung 4. Teil<br />
Wildpflanzen sorgen für<br />
niedrige N min<br />
-Werte<br />
Wildpflanzen als Kosubstrat getestet<br />
Auch im vierten Teil der Strohtagung referierte Diana<br />
Andrade von der Bayerischen Landesanstalt für Land-<br />
Wildpflanzenmischungen<br />
liefern im Mittel<br />
rund 15 Tonnen<br />
Trockenmasse<br />
pro Hektar.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Dr. Andreas Kinser von der Deutschen Wildtierstiftung<br />
hielt einen Vortrag über die<br />
Nutzung von Wildpflanzenmischungen als<br />
Gärsubstrat. Er zeigte sich enttäuscht darüber,<br />
dass Wildpflanzenmischungen nicht<br />
als sogenannte Greening-Maßnahme anerkannt werden<br />
so wie beispielsweise die Durchwachsene Silphie. „Die<br />
Deutsche Wildtierstiftung propagiert ganz klar mehrjährige<br />
Anbausysteme. Dabei geht es uns vor allem um<br />
ertragreiche Blühmischungen für die Biogasproduktion“,<br />
sagte Dr. Kinser.<br />
Die echten Ertragsbildner in den Mischungen seien<br />
Rainfarn, Natternkopf, Wilde Möhre und Beifuß. In fünf<br />
bis sechs Jahre alten Pflanzenbeständen seien diese<br />
Arten genau diejenigen, die hohe Biomasseerträge lieferten.<br />
Die Felder für die Wildpflanzenansaat müssten<br />
ackerbaulich sehr sorgfältig vorbereitet werden – so als<br />
würde eine andere Hauptfrucht angebaut. Dr. Kinser<br />
empfahl die Direktsaat in ein Stoppelfeld wie nach der<br />
Wintergetreideernte oder nach der Ernte von Getreide-<br />
Ganzpflanzensilage.<br />
Langes Blühangebot<br />
Die Wildpflanzensaat müsse möglichst nahe an der Bodenoberfläche<br />
abgelegt werden. Im Winter böten die<br />
Wildpflanzenfelder hervorragende Deckungshabitate<br />
für Vögel und Niederwild. Geerntet werden die Wildpflanzen<br />
einmal im Jahr kurz vor der Hauptblüte, also<br />
etwa Mitte Juli. Ab dem zweiten Standjahr wird nur<br />
noch gedüngt und geerntet. „Mit Beginn des Frühjahrs<br />
fangen die ersten Arten an zu blühen. Dadurch haben<br />
die Insekten ein langes Blühangebot. Besonders positiv<br />
zu sehen ist auch, dass die N min<br />
-Werte im Boden<br />
unter den Pflanzenbeständen sehr niedrig sind“, hob<br />
Dr. Kinser hervor.<br />
Die durchschnittlichen Erträge ab dem zweiten Standjahr<br />
liegen zwischen 35 und 38 Tonnen Frischmasse<br />
pro Hektar. In der Spitze können auch mal 45 Tonnen<br />
Frischmasse je Hektar erzielt werden. Im Mittel werden<br />
rund 15 Tonnen Trockenmasse pro Hektar geerntet. Dr.<br />
Kinser berichtete, dass die Züchter noch ein großes<br />
Ertragssteigerungspotenzial sehen. Saaten Zeller beispielsweise<br />
habe die Ertragsbildner in den Mischungen<br />
identifiziert und züchte diese weiter (Anmerkung der<br />
Redaktion: mehr zum Thema „Bunte Biomasse“ siehe<br />
auch Biogas Journal 5_2019, Seite 12 f.). Dr. Kinser<br />
formulierte einige agrarpolitische Forderungen:<br />
1. Anerkennung der Nutzung von Blühflächen zur<br />
Biogasproduktion im Rahmen der zukünftigen Öko-<br />
Regelungen bzw. im Rahmen der Gemeinsamen<br />
Agrarpolitik (GAP) <strong>2020</strong>+.<br />
2. Zulassung der Nutzung von Blühflächen zur Biogasproduktion<br />
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe<br />
Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK).<br />
3. Formulierung von Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen<br />
(AUKM) in den Ländern zum Anbau von<br />
Blühflächen zur Biogasproduktion.<br />
4. Berücksichtigung der Nutzung von Blühflächen bei<br />
der Novellierung des EEG, zum Beispiel per Sonderregelung<br />
im zukünftigen Ausschreibungsmodell<br />
für den Einsatz alternativer Substrate.<br />
5. Etablierung von Blühflächen zur Biogasproduktion<br />
als produktionsintegrierte Kompensation.<br />
Foto: Martin Bensmann<br />
34
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Aktuelles<br />
wirtschaft. Sie stellte Versuchsergebnisse aus einem<br />
Projekt vor, in dem wesentliche gärbiologische als auch<br />
verfahrenstechnische Parameter einer Kofermentation<br />
von Wildpflanzenmischungen (Veitshöchheimer Hanfmix)<br />
untersucht wurden. Die Referenz enthielt auf die<br />
Frischmasse bezogen 36 Prozent Silomais, 32 Prozent<br />
Grassilage und 32 Prozent Rindergülle.<br />
Die Referenz wurde verglichen: a) mit einem kontinuierlich<br />
gefütterten Substratmix, in dem 5 Prozent<br />
Wildpflanzen, 36 Prozent Maissilage, 28 Prozent Grassilage<br />
und 32 Prozent Rindergülle enthalten waren.<br />
Außerdem wurde die Referenz verglichen mit b) einer<br />
saisonalen Fütterung zweier verschiedener Substratmischungen:<br />
1. 15 Prozent Wildpflanzen, 36 Prozent<br />
Maissilage, 15 Prozent Grassilage und 34 Prozent<br />
Rindergülle. 2. 30 Prozent Wildpflanzen, 36 Prozent<br />
Maissilage und 34 Prozent Rindergülle. Die Grassilage<br />
wurde in dieser Variante gestrichen.<br />
Ergebnisse: Die kontinuierliche Fütterung des Substratmixes<br />
mit 5 Prozent Wildpflanzenteil zeigte in der<br />
Methanproduktivität keine Unterschiede zur Referenz.<br />
Auch die gesteigerten Raumbelastungen von 2,5 bis<br />
5,0 Kilogramm oTS pro Kubikmeter Fermentervolumen<br />
zeigten keine Einbrüche in der Methanproduktivität.<br />
Jedoch nahm der spezifische Methanertrag sowohl bei<br />
der Referenz als auch beim Substratmix, der 5 Prozent<br />
Wildpflanzen enthielt, bei steigender Raumbelastung<br />
ab. Auffällig war jedoch, dass der spezifische Methanertrag<br />
der Wildpflanzenmischung bei den Raumbelastungen<br />
2,5, 3,0, 4,5 und 5,0 Kilogramm oTS pro<br />
Kubikmeter Fermentervolumen höher war als bei der<br />
Referenz. Bei 3,5 Kilogramm waren sie gleichauf und<br />
bei 4,0 Kilogramm oTS pro Kubikmeter Fermentervolumen<br />
waren die Wildpflanzen etwas schlechter.<br />
Beim Vergleich der Referenz mit dem Substratmix, der<br />
15 Prozent Wildpflanzen enthielt, war die Methanproduktivität<br />
identisch. Gleiches gilt für den Vergleich der<br />
Referenz mit dem Substratmix, der 30 Prozent Wildpflanzen<br />
enthielt. Auch beim spezifischen Methanertrag<br />
gab es keine gravierenden Unterschiede. Es wird<br />
deutlich, dass bezogen auf einen bestimmten konventionellen<br />
Substratmix die Integration bestimmter<br />
Wildpflanzenmischungen eine Interessante Alternative<br />
sein kann. Es muss wie immer betriebsindividuell<br />
überlegt werden, welche Wildpflanzenmischung in<br />
welchem Umfang einen Platz im Gärsubstratmix haben<br />
kann.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
0 54 09/90 69 426<br />
martin.bensmann@biogas.org<br />
Effizienz hoch, Kosten runter! REMEX ® jetzt mit bis zu 40 % BAFA-Förderung.<br />
Jetzt bis zu 40 %<br />
BAFA-Förderung sichern.<br />
+ Schmack REMEX ® zum Sonderpreis*<br />
*Bei Beauftragung bis 31.01.2021<br />
Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um Ihre Biogasanlage zu modernisieren.<br />
Mit einem REMEX ® Rührwerk von Schmack setzen Sie auf energieeffizienten<br />
und äußerst wartungsarmen Betrieb. Wir beraten Sie gern und unterstützen<br />
Sie bei der Antragstellung. www.schmack-biogas.de<br />
Schmack Biogas Service GmbH · 24-Stunden-Service-Hotline: Tel. +49 (0) 9431 751-277<br />
info@schmack-biogas.com<br />
35
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Alle Ressourcen für null Emissionen<br />
350 in- und ausländische Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik diskutierten<br />
auf der DBFZ-Jahrestagung über den Beitrag der Bioenergie für eine klimaneutrale Wirtschaft.<br />
Wegen der Corona-Situation fand die Veranstaltung erstmals online statt.<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Biogasanlagen betrachtet<br />
die Bundesregierung<br />
in der neuen<br />
Bioökonomiestrategie<br />
vor allem unter dem<br />
Gesichtspunkt der<br />
Minderung von Treibhausgasen<br />
auf dem<br />
Weg zu einer klimaneutralen<br />
Wirtschaft.<br />
Ich begrüße Sie aus dem Raumschiff in Leipzig.“<br />
Mit dieser Formulierung spielte der Wissenschaftliche<br />
Geschäftsführer des Deutschen Biomasseforschungszentrums<br />
(DBFZ) Prof. Dr. Michael Nelles<br />
darauf an, dass die Jahrestagung der Forschungseinrichtung<br />
am 16. und 17. September wegen der<br />
Corona-Situation erstmals virtuell stattfand und von einem<br />
improvisierten Internet-Knotenpunkt am Sitz des<br />
DBFZ moderiert wurde.<br />
Seine Forderung aber, unverzüglich auf allen Ebenen<br />
der Gesellschaft aktiv zu werden, bezog sich auf eine<br />
reale Herausforderung, nämlich auf die nach Ansicht<br />
der meisten Wissenschaftler vor allem menschengemachte<br />
Klimaerwärmung mit ihren Folgen für das<br />
Leben auf unserem Planeten. Die Notwendigkeit von<br />
schnellen und konsequenten Maßnahmen im Sinne<br />
einer klimaneutralen Bioökonomie ergebe sich hier<br />
schon aus der zeitlichen Relation.<br />
Denn die Bezugsgröße der europäischen und nationalen<br />
Bioökonomiestrategie zur Reduzierung der<br />
CO 2<br />
-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent sei das Jahr<br />
1990. Selbst wenn es gelinge, das Einsparungsziel bei<br />
den Klimagasen bis 2030, also nach 40 Jahren, zu erreichen,<br />
bliebe für die restlichen, vermutlich schwerer<br />
zu erreichenden 45 Prozent von heute bis 2050 nur<br />
noch ein Zeitraum von 20 Jahren.<br />
„An einer vollständigen Umstellung auf Erneuerbare<br />
Energien führt daher kein Weg vorbei“, so Nelles in<br />
seinem Statement. Zentrale Elemente klimaneutraler<br />
Bioökonomie seien die Koppel- und Kaskadennutzung<br />
biogener Ressourcen und die Bereitstellung der Bioenergie<br />
aus nachhaltigen Rohstoffen und Reststoffströmen.<br />
Der Einsatz müsse zudem im Zusammenspiel mit<br />
den anderen erneuerbaren Energiequellen erfolgen.<br />
Unter dem Titel „Bioenergie zwischen Klimapaket und<br />
Bioökonomiestrategie“ präsentierten hierzu Referenten<br />
aus Deutschland, Österreich, Polen, Irland, Brasilien,<br />
China und Kanada im Rahmen von zwei Plenen<br />
und vier Sessionen zahlreiche innovative Ideen und<br />
wissenschaftliche Ansätze.<br />
Deutschland soll führender Bioökonomie-<br />
Standort werden<br />
Im Plenum „Politische Sichtweise“ verwies Dr. Hans-<br />
Jürgen Froese vom Bundesministerium für Ernährung<br />
und Landwirtschaft auf die neue nationale Bioökonomiestrategie,<br />
die unter anderem darauf abzielt,<br />
Deutschland zu einem führenden Standort der Bioökonomie<br />
zu machen. Eine wichtige Rolle spiele dabei die<br />
Forschungsförderung, die methoden- und technologieoffen<br />
angelegt sei.<br />
Als Widerspruch erscheint hier allerdings die vom<br />
Referenten geäußerte Ansicht, wonach Biokraftstoffe<br />
lediglich als Nischen- und Übergangsanwendung angesehen<br />
werden. Insgesamt stehe in der Bewertung<br />
36
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
INNOVATIVE<br />
Aktuelles<br />
EINBRINGTECHNIK<br />
FÜR BIOGAS- UND<br />
RECYCLINGANLAGEN<br />
Fotos: Carmen Rudolph<br />
die Kreislaufwirtschaft<br />
vor der Kaskadennutzung<br />
und diese vor dem<br />
ausschließlichen Einsatz<br />
von Biomasse zur<br />
Energiegewinnung. Für<br />
die Untersetzung der<br />
Bioökonomiestrategie<br />
mit konkreten Maßnahmen<br />
konstituiert sich im<br />
November dieses Jahres<br />
ein Bioökonomierat.<br />
Die Rolle der Biomasse<br />
beim Klimaschutz aus<br />
Sicht des Bundesumweltministeriums<br />
erläuterte<br />
Berthold Goeke.<br />
Das Klimaschutzprogramm<br />
schreibe das<br />
Erreichen der Treibhausgasneutralität<br />
bis<br />
2050 fest. Dafür investiere der Staat in<br />
den nächsten Jahren 54 Milliarden (Mrd.)<br />
Euro. Zu den Kernpunkten zähle der Ausbau<br />
der Erneuerbaren Energie auf einen<br />
Anteil von 65 Prozent, die Umsetzung der<br />
Düngeverordnung und die stärkere Förderung<br />
des Ökolandbaus.<br />
Die energetische Nutzung von Biomasse<br />
dürfe nicht zu einer Ausweitung der Anbaufläche<br />
führen. Nachhaltig verfügbare<br />
Potenziale im Umfang von rund 900 Petajoule<br />
(PJ) pro Jahr (a) sieht das Ministerium<br />
in Abfall- und Reststoffen. Gegenwärtig<br />
liege man hier bei 760 PJ/a [1 Terawattstunde<br />
(TWh) = 3,6 PJ]. Der Einsatz von<br />
Biomasse zur Stromerzeugung spiele eine<br />
untergeordnete Rolle, da der Stromsektor<br />
Wind und Sonne zur Dekarbonisierung<br />
nutzen kann. Im Bereich Landwirtschaft<br />
strebe das Klimaschutzprogramm einen<br />
Ausbau der Vergärung tierischer Exkremente<br />
und von biogenen Reststoffen an. In<br />
diesem Zusammenhang ist eine Förderung<br />
der Güllevergärung und des Baus gasdichter<br />
Gärdüngerlager geplant.<br />
Prof. Dr. Daniela Thrän,<br />
UFZ/DBFZ/Universität Leipzig:<br />
„Aus dem Ziel einer klimaneutralen<br />
Wirtschaft leitet sich die<br />
Forderung ab, das Energiesystem<br />
zügig zu 100 Prozent auf erneuerbare<br />
Quellen umzustellen.“<br />
Neue Förderprogramme<br />
für erneuerbare Kraftstoffe<br />
angekündigt<br />
Dr. Joachim Hugo vom Bundesministerium<br />
für Verkehr und digitale Infrastruktur<br />
kündigte in seinem Vortrag zwei Förderprogramme<br />
zur Entwicklung erneuerbarer<br />
Kraftstoffe sowie zum Markthochlauf<br />
entsprechender Produktionsanlagen an.<br />
Die Richtlinien dazu würden noch in diesem<br />
Jahr veröffentlicht.<br />
Erste Projektausschreibungen<br />
sind für Anfang<br />
2021 geplant. Die Umsetzung<br />
des Klimapakets<br />
werde nach Ansicht<br />
von Hugo in verschiedenen<br />
Sektoren, darunter<br />
der Chemieindustrie,<br />
zu einem zunehmenden<br />
Bedarf an nachhaltigen<br />
Bioressourcen, etwa<br />
biogenen Abfällen oder<br />
Altholz, und damit zu<br />
einer Verknappung solcher<br />
Einsatzstoffe führen.<br />
Im Einführungsreferat<br />
zum Plenum „Wissenschaftliche<br />
Sichtweise“<br />
verwies Prof. Dr. Claudia<br />
Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsförderung<br />
(DIW Berlin) auf die Bedeutung<br />
der Bioökonomie in Deutschland.<br />
Jeder von den in diesem Wirtschaftsbereich<br />
tätigen 2 Millionen (Mio.) Menschen<br />
erbringe eine jährliche Wertschöpfung von<br />
rund 53.000 Euro. Dies liege deutlich über<br />
dem EU-Durchschnitt von 35.000 Euro.<br />
Insgesamt betrage die Wertschöpfung hier<br />
107 Mrd. Euro, was 17 Prozent der gesamten<br />
EU-Wertschöpfung in diesem Bereich<br />
ausmache.<br />
Im Unterschied zu den ansonsten durch<br />
Wachstum gekennzeichneten Sektoren<br />
im Markt der Bioökonomie, einschließlich<br />
biobasierter Chemikalien, konstatiert die<br />
Energieökonomin bei den flüssigen Biokraftstoffen<br />
einen Rückgang in der Wertschöpfung<br />
um 20 Prozent. Ursache sei die<br />
Fokussierung Deutschlands bei der Verkehrswende<br />
auf E-Mobilität.<br />
Möglichkeiten der Forschungsförderung<br />
im Rahmen des „Europäischen Grünen<br />
Deals“ stellten Dr. Inga Bödeker-Halfmann<br />
und Dr. Rolf Stratmann von den beim Projektträger<br />
Jülich angesiedelten Nationalen<br />
Kontaktstellen Energie und Bioökonomie<br />
vor. Zu den Topics zählten beispielsweise<br />
Wärme- und Kältenetze (DHC) und KWK-<br />
Lösungen (CHP), die auf verschiedenen<br />
regenerativen Energien basieren sowie<br />
robust, skalierbar und erschwinglich sind.<br />
Informationen zu den ausgeschriebenen<br />
Förderthemen gibt es unter www.nks-energie.de.<br />
Projektanträge sind bis zum 26 Januar<br />
2021 möglich.<br />
37<br />
BESUCHEN SIE UNS AUF DEN<br />
BIOGAS INFOTAGEN 2021<br />
13-14 JANUAR 2021 | HALLE 1 STAND 170<br />
MESSEGELÄNDE ULM<br />
BIG-Mix 35 bis 313m³<br />
effektiver Vorschub bei niedrigem<br />
Eigenstromverbrauch<br />
für 100% Mist und Grassilage<br />
mit Misch- und Aufbereitungsbereich<br />
komplett aus Edelstahl<br />
Biomischer 12 bis 80m³<br />
für 100% Mist und Grassilage<br />
massive Edelstahlkonstruktion<br />
mit Misch- und Aufbereitungsbereich<br />
auf Wunsch komplett aus Edelstahl<br />
KOMBI-Mix 8 und 12m³<br />
speziell für Kleinbiogasanlagen<br />
optional mit Vertikalmischschnecke<br />
für unterschiedlichste Substrate<br />
komplett aus Edelstahl<br />
Konrad Pumpe GmbH<br />
Fon +49 2526 93290<br />
Mail info@pumpegmbh.de<br />
www.pumpegmbh.de
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Die Kombination der<br />
energetischen und<br />
stofflichen Nutzung<br />
biogener Ressourcen,<br />
hier Hirsefasern in<br />
unterschiedlichen<br />
Verarbeitungsstufen,<br />
ist ein zentrales<br />
Element der angestrebten<br />
klimaneutralen<br />
Bioökonomie.<br />
China will Bau von Biogasanlagen<br />
unterstützen<br />
Einen Einblick in die Strategie Chinas bei der Nutzung<br />
seiner gewaltigen Bioenergieressourcen gab der live<br />
per Internet zugeschaltete Prof. Dong Renjie von der<br />
China Agricultural University. Im Gegensatz zur Energiegewinnung<br />
aus Wind und Sonne hinke der Einsatz<br />
von Biomasse für die Erzeugung von Strom und Wärme<br />
noch hinterher. Gegenwärtig betrage die Kapazität der<br />
überwiegend kleinen Biogasanlagen im Land insgesamt<br />
etwa 20 Mrd. Kubikmeter.<br />
Das chinesische Landwirtschaftsministerium plane<br />
den Ausbau des Bioenergiebereiches einerseits durch<br />
die Inbetriebnahme größerer Anlagen zur Vergärung<br />
beziehungsweise Verbrennung von Biomasse, aber<br />
ebenso durch die Unterstützung von Landwirten bei der<br />
Errichtung von Anlagen, in denen tierische Exkremente<br />
und Bioabfälle in Energie und Dünger umgewandelt<br />
werden. Ziel sei dabei auch eine Minderung der Nitrat-<br />
Belastung von Böden und Gewässern sowie Einsparungen<br />
chemischer Düngemittel. Berechnungen ergaben<br />
zudem eine mögliche Einsparung von jährlich 80 Mio.<br />
Tonnen des Treibhausgases CO 2<br />
.<br />
Zum Auftakt der Session „Beitrag der Bioenergie für<br />
Klimaschutz“ definierte Prof. Dr. Daniela Thrän vom<br />
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ/DBFZ/<br />
Universität Leipzig den Begriff der intelligenten Bioenergie<br />
und erläuterte deren Ansprüche und Ziele. Zwar<br />
mildere die Bioenergie die deutschen Emissionen an<br />
Treibhausgas (THG) durch Substitution fossiler Brennstoffe<br />
bereits um 10 Prozent. Aus dem Ziel einer klimaneutralen<br />
Wirtschaft leite sich jedoch die Forderung<br />
ab, das Energiesystem zu 100 Prozent auf erneuerbare<br />
Quellen umzustellen.<br />
Dazu müsse sich die Bioenergie intelligent mit den<br />
Wind und Sonne nutzenden Anlagen verknüpfen.<br />
Grundlage dafür bilde ein gemeinsamer Datenpool,<br />
etwa zu Wetterprognosen, Anlagenverfügbarkeit, Leistungsparameter,<br />
Netzkapazität oder dem zu erwartenden<br />
Energiebedarf. Der Übergang von der reinen zur<br />
38<br />
hgs_20_016_a_210x99_bj_bundesweit_a_01.indd 1 28.09.20 22:53
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Aktuelles<br />
integrierten Bioenergie beinhalte zudem die stärkere<br />
Beachtung von Rahmenbedingungen und sich gegenseitig<br />
beeinflussender Faktoren.<br />
Negative Folgen können beispielsweise durch eine<br />
nicht nachhaltige Landnutzung bei der Biomassegewinnung<br />
entstehen. Positiv in diesem Sinne sei dagegen<br />
die verstärkte energetische Nutzung von Gülle,<br />
durch die sich gleich zwei Effekte für den Klimaschutz<br />
ergeben. Erstens die CO 2<br />
-Einsparung durch Substitution<br />
von Erdgas und zweitens der Wegfall von Emissionen<br />
in der Landwirtschaft.<br />
Brasilien: 27 Prozent Erneuerbare-Anteil<br />
an Primärenergieverbrauch<br />
Über den Stand der Bioenergienutzung in Brasilien<br />
informierte Prof. Arnaldo Walter, Leiter der Fakultät<br />
Energiewirtschaft an der University of Campinas Brazil.<br />
Mit einem Anteil von 27 Prozent Erneuerbare am Primärenergiebedarf<br />
nimmt das Land eine Sonderstellung<br />
in Lateinamerika ein. Den Schwerpunkt bildet dabei<br />
die Ethanolproduktion, vornehmlich auf der Basis von<br />
Zuckerrohr, neuerdings aber zusätzlich aus Mais, um<br />
eine ganzjährige Auslastung der Raffinerien zu gewährleisten.<br />
Neben 35,3 Mrd. Liter Ethanol werden in Brasilien 6<br />
Mio. Liter Biodiesel aus Soja und Tierfetten produziert.<br />
Der Anteil der Stromerzeugung aus Biomasse liege<br />
bei 9 Prozent, hauptsächlich durch Verbrennung von<br />
Zuckerrohr. Der Input für die 40 Biogasanlagen im<br />
Land mit einer Gesamtkapazität von 215,8 Megawatt<br />
bestehe fast ausschließlich aus Bioabfällen. Noch in<br />
den Anfängen stecke die Herstellung von Biomethan,<br />
dessen Potenzial auf der Grundlage von Zuckerrohr,<br />
Wirtschaftsdünger, und Siedlungsabfällen auf 84 Mrd.<br />
Kubikmeter pro Jahr geschätzt wird. „Trotz der politischen<br />
und wirtschaftlichen Krise sind die Aussichten<br />
im Bioenergiebereich mittelfristig gut, da der brasilianische<br />
Kompromiss im Pariser Klimaabkommen eine<br />
signifikante Steigerung an Biokraftstoffen, teilweise<br />
der zweiten Generation, sowie einen Zuwachs bei der<br />
Bioelektrizität vorsieht“, wirbt Walter für Investitionen<br />
und Zusammenarbeit.<br />
Die energetische sowie stoffliche Verwertung von<br />
Reststoffen unter dem Gesichtspunkt der Emissionsminderung<br />
thematisierte die Session „Vom Reststoff<br />
zum Wertstoff“. Das noch ungenutzte und technisch<br />
verfügbare Potenzial an Rest- und Abfallstoffen bezifferte<br />
Dr. Peter Kornatz vom DBFZ mit 31 Mio. Tonnen<br />
Trockenmasse pro Jahr. So fallen bei der Produktion<br />
von Körnermais in Deutschland jährlich über 3 Mio.<br />
Kubikmeter Maisspindeln an. Mit dieser Menge ließe<br />
sich nach entsprechender Verarbeitung rechnerisch die<br />
Hälfte des hiesigen Dämmmaterialbedarfs decken. Mit<br />
den Spindeln von weniger als einem Hektar könnte ein<br />
komplettes Einfamilienhaus gedämmt werden.<br />
Biogene Reststoffe enthalten interessante<br />
chemische Verbindungen<br />
Dr. Steffi Formann vom DBFZ forscht an der kombinierten<br />
stofflich-energetische Nutzung von biogenen Reststoffen<br />
zur Gewinnung von Silica, seltenen Erden<br />
Prof. Dong Renjie von<br />
der China Agricultural<br />
University berichtete<br />
auf der erstmals im<br />
Internet veranstalteten<br />
DBFZ-Jahrestagung<br />
über die Pläne zur<br />
breiteren Verwertung<br />
der gewaltigen Bioenergieressourcen<br />
des<br />
Landes.<br />
MIT STROM, WÄRME & KRAFTSTOFF<br />
FLEXIBEL IN DIE ZUKUNFT<br />
Von der Planung bis zur Umsetzung alles aus einer Hand!<br />
Profitieren Sie von über 20 Jahren Biogas-Know-How unserer Experten:<br />
Optimierung der Erlösmöglichkeiten mit und ohne EEG<br />
Umrüstung von Vor-Ort-Verstromungs-Biogasanlagen<br />
Erzeugung von Kraftstoff<br />
Beratung zur RED II<br />
Wir machen gemeinsam mit Ihnen ihre Anlage zukunftssicher. Vereinbaren Sie<br />
schon jetzt einen individuellen Beratungstermin. Unser Team freut sich auf Sie.<br />
PlanET Biogastechnik GmbH Up de Hacke 26 48691 Vreden<br />
Telefon: 02564 / 3950-0 info@planet-biogas.com www.planet-biogas.de<br />
39
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Miscanthusernte auf<br />
einem Feld in Sachsen:<br />
Die Bereitstellung der<br />
Bioenergie aus nachhaltigen<br />
Rohstoffen<br />
und Reststoffströmen<br />
erfordert neben der<br />
Erschließung neuer<br />
Potenziale auch<br />
die Entwicklung<br />
innovativer Technologien<br />
zur Koppel- und<br />
Kaskadennutzung von<br />
Biomasse.<br />
und Edelmetallen. So entdeckte sie, dass die nach der<br />
thermischen Verwertung von Reisspelzen verbleibende<br />
Asche um die 15 Prozent Siliziumoxyd (SiO 2<br />
) mit einer<br />
Reinheit von 90 Prozent enthält. „Etwas geringer,<br />
aber unter dem Blickwinkel eines regionalen Produkts<br />
und der Kaskadennutzung durchaus lohnend, könnte<br />
in Europa die Gewinnung von biogenem Silica aus der<br />
Asche von Getreidespelzen sein“, äußerte die Wissenschaftlerin.<br />
Biogenes Silica mit seiner feinen Struktur dient in<br />
sogenannten Pre-Coat-Filtern als Filtermedium beim<br />
Entfernen von Feinstaub aus der Luft. Bemerkenswerte<br />
Anteile der besonders begehrten seltenen Erden Praseodymium<br />
und Neodymium analysierte Formann in<br />
Tomaten, Rettich und Rutenhirse, so dass es sich ihrer<br />
Ansicht nach lohnt, über eine kombinierte energetische<br />
und stoffliche Nutzung nachzudenken. Ähnlich verhalte<br />
es sich mit den von Miscanthus, Senf und Weide<br />
aufgenommenen Mengen an Paladium.<br />
Den erfolgreichen Abschluss eines in dieser Form bislang<br />
einmaligen Verbundprojekts mit dem Fraunhofer<br />
IGB sowie den Firmen Tilia und Gicon im Auftrag der<br />
Stadt Paris vermeldete Michael Dittrich-Zechendorf<br />
vom DBFZ. Gegenstand war die Entwicklung eines<br />
Verfahrens zur gemeinsamen Behandlung von Klärschlamm<br />
und Mischabfall sowie Pferdemist und Flotatfett.<br />
Die Anforderung ergibt sich aus dem Umstand,<br />
dass Bioabfall in Paris nicht getrennt erfasst wird.<br />
Die geplante großtechnische Anlage auf Basis eines<br />
Pfropfenstromreaktors ist für einen jährlichen Input<br />
von 76.000 Tonnen Mischabfall, 100.000 Tonnen<br />
Klärschlamm, 500 Tonnen Flotatfett und 20.000 Tonnen<br />
Pferdemist konzipiert. Innovativ ist insbesondere<br />
die Behandlung des Gärrestes aus dem Fermenter mittels<br />
hydrothermaler Carbonisierung mit nachfolgender<br />
Separation in Fest- und Flüssigphase.<br />
Die Feststoffe werden thermochemisch umgewandelt<br />
und das dabei entstehende Biogas der Aufbereitungsanlage<br />
zugeführt, die dem Pfropfenstromreaktor<br />
nachgeschaltet ist. Aus<br />
der verbleibenden Asche lässt sich eine<br />
breite Palette an Stoffen extrahieren,<br />
die Abfallströme üblicherweise mitführen.<br />
Ebenso besteht die Möglichkeit der<br />
Nährstoffrückgewinnung aus der Flüssigphase.<br />
Neben den bestehenden Wertschöpfungsketten<br />
zur Energiebereitstellung<br />
öffnet die Bioökonomie eine Vielzahl<br />
neuer Felder einer kreislauforientierten<br />
Biomassenutzung. Darauf machte Dr.<br />
Franziska Müller-Langer, Bereichsleiterin<br />
Bioraffinerien am DBFZ, in ihrer<br />
thematischen Einführung zur Session<br />
„Wertschöpfungsketten in der Bioökonomie“<br />
aufmerksam. Als Beispiel<br />
nannte sie Koppelprodukte. So liefert<br />
die in Deutschland für die Biokraftstoffproduktion genutzte<br />
Anbaufläche von 1 Mio. Hektar nicht nur 2 Mio.<br />
Tonnen Biokraftstoffe, sondern darüber hinaus 3 Mio.<br />
Tonnen Futtermittel.<br />
Wasserstoffnutzung nach Farben<br />
Cornelia Müller-Pagel von der VNG AG betrachtete das<br />
Potenzial „Grüner Gase“ aus der Sicht eines Gasnetzbetreibers.<br />
Unter Grünen Gasen versteht man bei VNG<br />
neben Biogas sowie daraus aufbereitetem beziehungsweise<br />
synthetisch aus Wasserstoff und CO 2<br />
hergestelltem<br />
Biomethan auch Wasserstoff, der entweder in einer<br />
Elektrolyse mit erneuerbarem Strom oder mittels<br />
Dampfreformierung aus Biomethan erzeugt wurde.<br />
„Dazu kommt bei uns jetzt noch blau und türkis als Farbensymbol<br />
für dekarbonierten Wasserstoff“, informierte<br />
Müller-Pagel. Blauer Wasserstoff entstehe bei der<br />
Dampfreformierung von Erdgas bei gleichzeitiger Nutzung<br />
oder Abspeicherung von CO 2<br />
, Türkiser Wasserstoff<br />
bei der Pyrolyse eines fossilen Ausgangsstoffes verbunden<br />
mit der Abscheidung von festem Kohlenstoff.<br />
Als Grund für die Erweiterung der Farbpalette nennt die<br />
Abteilungsleiterin die hohen Kosten bei der Herstellung<br />
von Grünem Wasserstoff etwa mittels Elektrolyse<br />
und deren begrenzte Produktionskapazität. Spätestens<br />
ab einem Emissions-Minderungsziel von über 85 Prozent<br />
entstehe eine Angebotslücke, die durch „Blaue<br />
und Türkise Gase“ geschlossen werden könne.<br />
Autor<br />
Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Freier Journalist ∙ Rudolph Reportagen – Landwirtschaft,<br />
Umwelt, Erneuerbare Energien<br />
Kirchweg 10 · 04651 Bad Lausick<br />
03 43 45/26 90 40<br />
info@rudolph-reportagen.de<br />
www.rudolph-reportagen.de<br />
40
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Aktuelles<br />
IHR FAHRPLAN<br />
ZU HÖHEREN ERLÖSEN<br />
Nutzen Sie jetzt die Flexibilität Ihrer Biogasanlage bestmöglich aus.<br />
Wir setzen Ihre Anlage genau da ein, wo sie die höchsten Erlöse erzielt<br />
– und sorgen gleichzeitig für eine BHKW-schonende Fahrweise.<br />
Erzielen Sie zusätzliche Erlöse im Fahrplanbetrieb<br />
Nutzen Sie alle Märkte für Ihre Erlösoptimierung: vom Day-Aheadüber<br />
den Intraday- bis hin zum Regelenergiemarkt<br />
Stellen Sie schon heute die Weichen für den Betrieb Ihrer<br />
Anlage außerhalb der Förderung<br />
Mit über 3400 Biogasanlagen sind wir einer der größten und<br />
erfahrensten Direktvermarkter im Biogasbereich. Wir freuen uns<br />
darauf, auch Sie bei der Flexibilisierung zu unterstützen!<br />
+49 221 82 00 85 70 | beratung@next-kraftwerke.de | www.next-kraftwerke.de<br />
41
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Grüne Wärme ganz normal<br />
Kleinstädte wie Schwarzenbek östlich von Hamburg gibt es überall in Deutschland:<br />
Wenig Altbau, dafür viele Neubauten. Das kleine bürgerliche Glück existiert hier in Form<br />
von Reihenhäusern ebenso wie aus dem Ei gepellten Einfamilienhäusern, davor Rasenfläche,<br />
die von emsigen Mährobotern kurzgehalten wird. Mittendrin in dieser vorstädtisch aufgeräumten<br />
Wohnidylle steht das Heizkraftwerk am Müllerweg, das 2004 errichtet worden<br />
ist und das ein großes Wohngebiet an über 950 Übergabestationen mit Wärme versorgt.<br />
Von Dierk Jensen<br />
Sektorenkoppelung in<br />
Schwarzenbek im Osten<br />
Hamburgs: Technisch<br />
durchaus möglich,<br />
klimafreundlich<br />
ohnehin, aber immer<br />
noch ohne ökonomische<br />
Perspektive.<br />
Michael Drube, Leiter des Betriebscenters<br />
Hohenhorst, ist zuständig für das<br />
Heizwerk. Er öffnet die Eisentür des<br />
mit Klinker verbauten und äußerlich<br />
unscheinbaren Gebäudes. Komplex<br />
und spannend dagegen, was sich hinter den Mauern<br />
befindet: ein Motor mit 637 Kilowatt (kW) elektrischer<br />
Leistung, der mit Biogas von der ungefähr zwei Kilometer<br />
entfernt liegenden Biogasanlage der Grove GmbH &<br />
Co.KG versorgt wird.<br />
Daneben steht ein weiteres Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW), das mit einer Leistung von 360 kW elektrisch<br />
mit Erdgas betrieben wird; außerdem sind noch drei<br />
mit Erdgas befeuerte Kessel mit einer Gesamtleistung<br />
von 10 Megawatt (MW) thermisch installiert. „Zudem<br />
haben wir Mitte 2018 noch einen weiteren Kessel<br />
eingebaut, und zwar einen E-Kessel mit 216 kW elektrischer<br />
Leistung, der direkt mit dem Erdgas-BHKW<br />
verschaltet ist“, erklärt Drube neben dem Heizstab<br />
stehend, der ziemlich unspektakulär daherkommt und<br />
in neudeutsch gemeinhin als Power-to-Heat-Anlage bezeichnet<br />
wird. „Das ist, wenn sie so wollen, an diesem<br />
Standort unser Beitrag für die Sektorenkoppelung, die<br />
eine schrittweise Wärmewende ermöglicht“, fügt Drube<br />
hinzu. Wieso ausgerechnet 216 kW Leistung? „Damit<br />
haben wir genau die Größe gewählt, mit der unser Erdgas-BHKW<br />
auf 60 Prozent Leistung läuft. Die 60 Prozent<br />
stellen für diesen Motor das untere Regelband dar.<br />
Wir könnten somit das Erdgas-BHKW in Teillast weiter<br />
betreiben und den Strom über den E-Kessel in Wärme<br />
umwandeln, ohne das BHKW herunterzufahren.“<br />
20 Gigawattstunden Wärme pro Jahr<br />
an Kunden<br />
Die Funktionsweise des E-Kessels ist leicht erklärt: Immer<br />
wenn das Stromnetz überlastet ist beziehungsweise<br />
wenn die Strompreise aufgrund hoher Erzeugungsangebote<br />
niedrig sind, kann der E-Kessel optional in<br />
Betrieb genommen und Wärme ans Wärmenetz abgegeben<br />
werden. Bisher geschieht das am Standort Schwarzenbek<br />
rund 300 Mal, durchschnittlich 18 Minuten<br />
lang. Insgesamt liefert der Betreiber des Wärmenetzes,<br />
die Hanse Werk Natur GmbH, jährlich<br />
rund 20 Gigawattstunden pro<br />
Jahr an seine Kunden.<br />
Allerdings ist die Power-to-Heat-Anlage,<br />
so offenbaren alle Beteiligten,<br />
unter den bestehenden energiepolitischen<br />
Rahmenbedingungen trotz<br />
systemdienlicher Einsetzbarkeit<br />
nicht wirtschaftlich zu betreiben.<br />
Und tatsächlich ist der Einbau des<br />
E-Kessels in das ausgeklügelte<br />
Nahwärmekonzept der Hanse Werk<br />
Natur GmbH für das Wohngebiet in<br />
Schwarzenbek erst durch die Beteiligung<br />
am Projekt Norddeutsche<br />
Energiewende (NEW 4.0) im Rahmen<br />
der SINTEG-Förderung des<br />
Bundeswirtschaftsministeriums<br />
realisiert worden.<br />
Außer in Schwarzenbek betreibt die<br />
Hanse Werk Natur GmbH auf der<br />
Fotos: Dierk Jensen<br />
42
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Aktuelles<br />
Nordseeinsel Föhr im dortigen Hauptort Wyk eine Power-to-Heat-Anlage.<br />
Gerade auf Föhr ist die Abschaltung<br />
der Erneuerbaren Energien inzwischen auf zweistellige<br />
Prozentsätze angestiegen, weshalb es gerade an solchen<br />
Standorten großen Sinn macht, den „überschüssigen“<br />
Strom in Wärme umzuformen. Außerdem sind<br />
noch zwei E-Kessel im Hamburger Stadtgebiet und ein<br />
Modul in Kaltenkirchen in Betrieb. Die Gesamtleistung<br />
aller E-Kessel-Anlagen beträgt dabei 2 MW.<br />
„Wir haben für den Einbau des Power-to-Heat-Moduls<br />
insgesamt rund 100.000 Euro inklusive der Bundesförderung<br />
in die Hand genommen“, erläutert Michael<br />
Ebert vom Mutterunternehmen Hanse Werk AG mit Sitz<br />
im schleswig-holsteinischen Quickborn. Ebert ist seit<br />
vier Jahren im Unternehmen und koordiniert die Aktivitäten<br />
der Hanse Werk hinsichtlich der Norddeutschen<br />
Energiewende 4.0.<br />
Power-to-Heat rechnet sich im<br />
aktuellen EEG nicht<br />
Der Umwelttechniker, der vor seiner Zeit bei Hanse<br />
Werk beruflich unter anderem im Energiehandel engagiert<br />
war, sagt, dass die Power-to-Heat-Technologie<br />
mit weiterentwickelter Software in bestehende Versorgungskonzepte<br />
gut integrierbar ist, darüber besteht<br />
kein Zweifel, aber es rechnet sich im aktuellen EEG<br />
einfach nicht. „Einfach schon<br />
deshalb, weil eine 40-prozentige<br />
EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch<br />
schon rund 3<br />
Cent pro Kilowattstunde Wärme<br />
ausmacht, was ungefähr auf der<br />
gleichen Höhe des aktuellen<br />
Preises von Erdgas liegt“, wendet<br />
Ebert kritisch ein.<br />
Damit reiht sich der Mitarbeiter<br />
für Produktentwicklung und<br />
Kundenlösungen auch in die<br />
Kritik ein, die Matthias Boxberger,<br />
Vorstandsvorsitzender der<br />
Hanse Werk AG äußert: „Die<br />
Bundesregierung muss den<br />
Rechtsrahmen ändern, damit<br />
Flexibilitätsplattformen helfen<br />
können, unsere Klimaziele zu erreichen.“ Wann auch<br />
immer Berlin den Hebel konsequent für die Wärmewende<br />
umlegt, hat sich der Wärmeversorger Hanse Werk<br />
AG ungeachtet dessen schon jetzt sehr sportliche Ziele<br />
gesetzt. „Wir wollen bis 2030 klimaneutral sein“, unterstreicht<br />
Ebert: „Immerhin erfolgt die Stromproduktion<br />
bei Hanse Werk Natur schon heute zu 60 Prozent<br />
auf Biogasbasis.“<br />
Michael Ebert ist bei<br />
Hanse Werk zuständig<br />
für Produktentwicklung<br />
und Kundenlösungen.<br />
Ein weiteres französisches<br />
„Denkmal“:<br />
Saatgut von Maize in France<br />
Ohne hochqualitatives Saatgut<br />
bringt auch die beste Genetik der<br />
Welt keine Top-Ergebnisse.<br />
Was Maissaatgut betrifft, so ist<br />
Frankreich - das Marktführer in<br />
Europa als Erzeuger und weltweit<br />
als Exporteur ist - seit über<br />
50 Jahren ein überall<br />
anerkannter Experte. Warum?<br />
Dank der großen Vielfalt seiner<br />
Anbaugebiete, in denen es<br />
möglich ist, alle verfügbaren<br />
Reifezahlen zu erzeugen. Dank<br />
der Erfahrung des Netzwerkes<br />
seiner Saatguterzeuger, seiner<br />
Vorschriften zur Saatguterzeugung,<br />
seiner hygienischen<br />
Qualität und Rückverfolgbarkeit ...<br />
Das Ergebnis: Saatgut höchster<br />
Qualität, das die Sorteninnovation<br />
optimal zum Audruck bringt.<br />
www.maizeinfrance.com/de<br />
43
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Michael Drube,<br />
Leiter Betriebscenter<br />
Hohenhorst der Hanse<br />
Werk Natur GmbH,<br />
neben dem E-Kessel<br />
im Technikgebäude in<br />
Schwarzenbek.<br />
Unabhängig von dieser Momentaufnahme verfügt die<br />
Hanse Werk Natur GmbH in ihrem Verbreitungsgebiet,<br />
also in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-<br />
Vorpommern und im nördlichen Niedersachsen, über<br />
rund 140 eigene Blockheizkraftwerke mit einer Leistung<br />
von 57,5 MW elektrisch und 63,9 MW thermisch;<br />
hinzu kommen noch BHKW mit einer Leistung von 80<br />
MW, bei denen die Hanse Werk Natur die Betriebsführung<br />
innehat.<br />
Biogas vom Hof Berling<br />
Darunter befinden sich aktuell auch 21 Biogasanlagen:<br />
in Summe rund 10 MW elektrisch und 11 MW thermisch.<br />
Dazu gehört eben auch Schwarzenbek, wo die<br />
Landwirtschaftsfamilie Berling das Biogas für die dortige<br />
Heizzentrale seit 2011 sicher liefert. „Ich bin sehr<br />
zufrieden mit der Zusammenarbeit“, sagt der 30-jährige<br />
Hofnachfolger Eike Berling. Er beliefert neben dem<br />
Aggregat in Schwarzenbek noch ein weiteres Satelliten-<br />
BHKW der Hanse Werk Natur mit Biogas und kommt<br />
somit auf eine Leistung von rund 1 MW elektrisch.<br />
Mais und Rindergülle vom eigenen Milchvieh und zwei<br />
weiteren Nachbarbetrieben landen im Fermenter. „Ich<br />
hoffe, dass die Kooperation mit der Hanse Werk Natur<br />
GmbH auch über das EEG-Ende hinaus weiter fortbestehen<br />
wird. Dann vielleicht mit anderen Inputstoffen<br />
und noch Wärme geführter“, setzt Berling langfristig<br />
auf Biogas. „Es wird auch nach dem EEG weitergehen,<br />
vielleicht etwas anders als jetzt, aber es geht weiter“,<br />
blickt er, der nicht in die Flexibilisierung einsteigen<br />
will, erstaunlich zuversichtlich nach vorne.<br />
Dabei werden im Aktionsradius des Wärmeversorgers<br />
Hanse Werk Natur GmbH in Zukunft nicht nur Biogas,<br />
„Wir haben doch<br />
schon die Konzepte für<br />
die Wärmewende in<br />
der Schublade“<br />
Michael Drube<br />
sondern auch vermehrt Wärmepumpen zum Einsatz bei<br />
der Wärmversorgung kommen. Neben Luft, Erde und<br />
Wasser wird auch über den Einsatz von Wärmepumpentechnik<br />
im Abwasser nachgedacht, so Ebert. Überdies<br />
wird auch grün erzeugter Wasserstoff eine zunehmende<br />
Bedeutung im Portfolio der Hanse Werk AG einnehmen.<br />
Noch in diesem Jahr geht ein Jenbacher Motor in einem<br />
BHKW im Hamburger Stadtteil Othmarschen an den<br />
Start, der mit Wasserstoff angetrieben werden soll. Dabei<br />
ist der Motor so konzipiert, dass er mit Wasserstoff<br />
und Erdgas in jedem Mischverhältnis<br />
betrieben werden kann.<br />
„Zudem plant die Hanse Werk<br />
AG einen Elektrolyseur mit einer<br />
Leistung von rund 25 MW<br />
im Hamburger Hafen“, blickt<br />
Ebert in einen Zeithorizont von<br />
einigen Jahren voraus.<br />
Allerdings ist die Seite des<br />
Versorgers aber letztlich nur<br />
eine von zweien der gleichen<br />
Medaille. „Unsere Kunden verlangen<br />
mittlerweile bei neuen<br />
Bauprojekten von sich aus eine<br />
klimaneutrale Wärmeversorgung“, weist Ebert auf veränderte<br />
Ansprüche hin, die oft schon weiter reichen<br />
als die Politik definiert. Apropos Politik: „Wir haben<br />
doch schon die Konzepte für die Wärmewende in der<br />
Schublade“, stellt Betriebsleiter Drube hinsichtlich einer<br />
zaudernden Energiepolitik klar.<br />
Und in der Tat wird zwar viel postuliert, aber doch geheuchelt,<br />
wenn es beim Umbau der Systeme richtig zur<br />
Sache gehen soll. Dies wird nirgendwo deutlicher als<br />
in Hamburg, wo ein Kohlekraftwerk mit einer Leistung<br />
von rund 2.000 MW, befeuert mit Steinkohle aus Übersee,<br />
erst vor sechs Jahren ans Netz ging und dessen<br />
gigantische Abwärmemengen obendrein bisher ungenutzt<br />
blieben und diese ganze Riesenkiste jetzt – vollkommen<br />
zurecht – alsbald abgeschaltet werden soll.<br />
Dies zeigt deutlich: Es braucht mehr Ehrlichkeit, dann<br />
kommt die grüne Wärme auch ganz unspektakulär und<br />
„ganz normal“ in der Mitte der Gesellschaft an – wie in<br />
Schwarzenbek.<br />
Autor<br />
Dierk Jensen<br />
Freier Journalist<br />
Bundesstr. 76 · 20144 Hamburg<br />
040/40 18 68 89<br />
dierk.jensen@gmx.de<br />
www.dierkjensen.de<br />
44
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Aktuelles<br />
BHKW-Synchron-Linie<br />
B-80 kW, B-99 kW, B-135 kW, B-200 kW, B-400 kW, B-500 kW, B-550 kW<br />
Frist für Flexprämie bis 31.07.2021 verlängert!<br />
Jetzt noch inv es lohnt sich!<br />
Netzausfälle nu noch eine F age de Zeit!<br />
Die Geisberger BHKW-Synchron-Linie bietet:<br />
Startsicherheit durch Gaseinspritzsystem<br />
Notstrom bei Stromausfällen für die Biogasanlage und den Betrieb<br />
Schwarzstartfähig = ohne Netz starten und Strom produzieren<br />
Das BHKW synchronisiert mit der Last wieder auf das Netz zurück<br />
Elektrisches Durchlauferhitzer-Modul (Heizschwert) für<br />
stabileren Lauf bei Stromausfall<br />
Wärmeversorgung bei Netzausfall<br />
Emissionsschonender minimalster Einsatz der Gasfackel,<br />
da das BHKW als Gasverbrauchseinrichtung funktioniert<br />
Geisberger Gesellschaft für<br />
Energieoptimierung mbH<br />
Hassenham 4<br />
84419 Schwindegg<br />
Tel.: +49 (0) 8082 - 27190 - 0<br />
Fax: +49 (0) 8082 - 27190 - 31<br />
info@geisberger-gmbh.de<br />
www.geisberger-gmbh.de
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Wasserstoff kann auch<br />
in Erdgaskavernen<br />
gespeichert werden.<br />
Aber nicht alle unterirdischen<br />
Speicher<br />
sind für einen häufigen<br />
Umschlag ausgelegt.<br />
Auf dem Weg zum „grünen“ Gas?<br />
Der Weg zur Klimaneutralität ist beim Erdgas noch weit. Biogas und Biomethan sind<br />
eigentlich prädestiniert für den „grünen Weg“. Doch die Gasbranche traut dem erneuerbaren<br />
Energieträger nicht allzu viel zu. Das wurde auf der Handelsblatt-Jahrestagung<br />
„Gas <strong>2020</strong>“ deutlich, die Ende September in Berlin stattfand.<br />
Von Thomas Gaul<br />
Wie sind die Klimaziele der EU zu erreichen?<br />
Welche Rolle können gasförmige<br />
Energieträger und damit auch<br />
Biogas in Zukunft spielen? Darum ging<br />
es auf der Handelsblatt-Jahrestagung<br />
Gas <strong>2020</strong>, die Ende September in Berlin stattfand. Mit<br />
der Rolle gasförmiger Energieträger in einer ambitionierten<br />
Klimapolitik beschäftigte sich in seinem Impulsvortrag<br />
Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesumweltministerium.<br />
„Der Weg zur Klimaneutralität darf Europa nicht<br />
spalten“, mahnte er, insbesondere mit Blick auf die<br />
östlichen EU-Länder, die noch in weitaus stärkerem<br />
Maße von fossiler Energie abhängig sind. Er plädierte<br />
für eine Stärkung des europäischen Emissionshandels<br />
und den Aufbau eines zweiten Bereiches, der auch die<br />
Sektoren Mobilität und Gebäude umfassen solle. „Das<br />
wird die Transformation im Energiesektor beschleunigen“,<br />
zeigte sich der Staatssekretär sicher. Mit der<br />
Novellierung des EEG solle das Ziel erreicht werden,<br />
schon vor 2050 Klimaneutralität in der Stromerzeugung<br />
zu erreichen. Flasbarth kündigte einen früheren<br />
Ausstieg aus fossilem Erdgas an.<br />
Größere „Baustellen“ der Klimapolitik gibt es noch im<br />
Gebäudebereich, räumte Flasbarth ein. „Wir müssen<br />
bei der Energieeffizienz von Gebäuden besser werden.“<br />
Zur Deckung des Wärmebedarfs solle künftig stärker<br />
„grüne“ Energie zum Einsatz kommen. Eine Dekarbonisierungsstrategie<br />
für gasförmige Energieträger solle<br />
es nicht geben. Bei Biogas sieht Flasbarth die Frage<br />
der Verfügbarkeit als begrenzenden Faktor, da es kein<br />
unbegrenztes Potenzial an Biomasse gebe.<br />
Das werde auch die Verfügbarkeit von „grünem“ Wasserstoff<br />
beschränken, erwartet der Staatssekretär:<br />
„Wir werden auch eine Knappheit an Ausgangsstoffen<br />
für grünen Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe<br />
haben. Wir müssen sie so effizient wie möglich einsetzen,<br />
denn wir brauchen sie zum Beispiel auch als<br />
Back-up für Speicher.“ Auch die bestehende Gas-<br />
Infrastruktur müsse an die neuen Herausforderungen<br />
angepasst werden und erfordere die Investitionen in<br />
Terminals.<br />
Foto: Adobe Stock_malp<br />
46
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Biogasfördertechnik<br />
„Wir müssen bei<br />
der Energieeffizienz<br />
von Gebäuden<br />
besser werden“<br />
Jochen Flasbarth<br />
60m³ Feststoffeintrag<br />
Feststoffeintrag in Edelstahlbauweise,<br />
die neue Schubboden-Generation:<br />
• echte wasserdichte Bodenwanne<br />
• geringer Stromverbrauch<br />
• einfacher Aufbau / geringe Ladehöhe<br />
• für alle stapelbaren Biomassen (bis 100% Mist)<br />
• effi zienter Vorschub bei schwierigen Substraten<br />
• hohe Austragsleistung auch bei Restmengen<br />
• Standardgrößen: 40m³, 60m³, 75m³, 100m³<br />
Dem stimmte Andreas Feicht, Staatssekretär<br />
im Bundeswirtschaftsministerium<br />
zu. Für eine Diversifizierung der Gasversorgung<br />
werde neben LNG-Terminals auch die<br />
in letzter Zeit wieder umstrittene Leitung<br />
Nord Stream 2 benötigt. Beim Gas sollten<br />
nicht die Fehler der Strom-Energiewende<br />
wiederholt werden, meinte Feicht: Erst<br />
die Erzeugung aufzubauen, um dann festzustellen,<br />
dass man mit dem Aufbau der<br />
Infrastruktur nicht hinterherkommt.<br />
Feicht zitierte die Aussage der Fernnetzbetreiber,<br />
dass 90 Prozent des Ferngasnetzes<br />
auf Wasserstoff umgestellt werden könnten.<br />
Zum Import von Wasserstoff sollten<br />
intensiv Kooperationen angestrebt werden,<br />
forderte der Staatssekretär. „Wir benötigen<br />
,blauen‘ Wasserstoff, weil er früh und kostengünstig<br />
bereitgestellt werden kann.“<br />
Damit könne es gelingen, die derzeit noch<br />
günstigeren Brennstoffe zu verdrängen.<br />
Wird Erdgas Schlusslicht in<br />
Sachen CO 2<br />
-Bilanz<br />
Für die heimische Erzeugung könnten bis<br />
2030 Elektrolyseure mit einer Leistung<br />
von 5 Gigawatt aufgestellt werden. Für den<br />
Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft dürfe<br />
die Farbe des Wasserstoffes keine Rolle<br />
spielen, betonte Ludwig Möhring, Vorstand<br />
des Bundesverbandes Erdgas, Erdöl<br />
und Geoenergie e.V. Er warnte zugleich vor<br />
der Einschätzung, dieser Hochlauf könne<br />
innerhalb kurzer Zeit geschehen: „Wir<br />
werden für die nächsten Jahrzehnte noch<br />
fossile Energieträger benötigen. Die Frage<br />
wird sein, wie wir sie so CO 2<br />
-arm wie möglich<br />
bekommen.“ Inzwischen befürchtet<br />
die Gaswirtschaft, nach dem Kohleausstieg<br />
das Schlusslicht in Sachen CO 2<br />
-Bilanz zu<br />
sein. Denn dazu tragen Methanleckagen<br />
bei der Erdgasförderung ebenso bei wie<br />
Leitungsverluste beim Transport des Erdgases.<br />
Auch die Angebotsseite sieht für Erdgas<br />
derzeit nicht allzu gut aus. So gibt es seit<br />
einiger Zeit durch LNG ein Überangebot<br />
am Weltmarkt für Gas. Der Preisdruck wird<br />
noch verstärkt durch die negativen Effekte<br />
der Covid-19-Pandemie. In Europa befindet<br />
sich LNG in einem massiven Preiswettbewerb<br />
mit russischem Pipeline-Gas. Die<br />
größten LNG-Abnehmer befinden sich derzeit<br />
im asiatischen Raum. Es handelt sich<br />
dabei um Japan, Südkorea und Taiwan.<br />
Da das Gas aber mit Tankschiffen angeliefert<br />
wird, lassen sich Handelsverkehre<br />
auch schnell umlenken. Friedbert Pflüger,<br />
Direktor des European Centre for Climate,<br />
Energy and Resource Security am Londoner<br />
Kings College, unterstützt diese These:<br />
„Allein die Existenz von LNG-Terminals in<br />
Europa übt Druck auf Russland aus, den<br />
Gaspreis zu senken.“ LNG aus den USA<br />
erweise sich in diesem Zusammenhang als<br />
„game changer“.<br />
47<br />
FSE Pico<br />
Den Pico bieten wir in den Größen<br />
12m³ bis 16m³ an.<br />
Er verfügt über eine Austragsschnecke, zwei Auflockerungsschnecken<br />
und überzeugt damit durch<br />
die gering benötigte Gesamtantriebskraft von nur<br />
11,5 KW.<br />
MaCBox<br />
MaCBox Flüssigeintrag:<br />
Mix and Cut in a Box<br />
Dieses reduziert die Bildung von Schwimm- und<br />
Sinkschichten im Fermenter. Selbst schwierige<br />
Feststoffe wie Putenkot, Rindermist und langfaserige<br />
Stoffe sind für die MaCBox kein Problem.<br />
Ostereistedter Straße 6 | 27404 Rockstedt<br />
Telefon: +49 (0) 42 85 - 9 24 99-0 | Fax: 9 24 99-20<br />
info@metallbaubrandt.de<br />
www.metallbaubrandt.de
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Wenn ab 2021 das<br />
Brennstoff-Emissionshandelsgesetz<br />
gilt,<br />
dann verteuert sich<br />
auch Erdgas um 30<br />
Prozent. Dadurch steigt<br />
die Wettbewerbsfähigkeit<br />
von Biomethan.<br />
Gasleitungen werden in Neubaugebieten<br />
nicht mehr verlegt<br />
Es kommt hinzu, dass die Gasspeicher in Europa<br />
nach zwei warmen Wintern gut gefüllt sind. Auch in<br />
der Wohnungswirtschaft dürfte der Absatz auf längere<br />
Frist sinken. In Neubauten kommt die Wärmepumpe<br />
zum Einsatz; Gasleitungen werden in Neubaugebieten<br />
schon gar nicht mehr verlegt. Trotz dieser Faktoren, die<br />
für eine sinkende Nachfrage sprechen, dürfte der Gasimport<br />
steigen, da die Produktion in Deutschland und<br />
in den Niederlanden rückläufig ist.<br />
Von höheren Preisen für den Verbraucher geht dagegen<br />
Matthias Kerner aus, Geschäftsführer der bmp Greengas<br />
Deutschland. Dafür werde das Brennstoff-Emissionshandelsgesetz<br />
sorgen, das 2021 in Kraft tritt. Der<br />
Aufschlag von 25 Euro je Tonne CO 2<br />
beim Erdgas werde<br />
dazu führen, dass der Erdgaspreis um 30 Prozent steigen<br />
wird.<br />
Foto: Adobe Stock_ShDrohnenFly<br />
Austausch von MAN- gegen V36-Zylinderköpfe von 2G<br />
Niedrigste Emissionen mit Köpfchen<br />
Einhaltung der 44. BImSchV in der Praxis bei gleichzeitig hohen Wirkungsgraden<br />
mit V36-Zylinderköpfen. Passend für MAN, MDE und Mercedes.<br />
• Bis zu 40.000 Bh Standzeit<br />
© Syda Productions | AdobeStock<br />
• 8.000 Bh Zündkerzenstandzeit<br />
• 4.000 Bh Wartungsintervall<br />
Wir beraten Sie: 02568 9347-0<br />
oder info@2-g.de<br />
Einhaltung<br />
von 44. BImSchV<br />
garantiert<br />
(ohne Leistungsverluste)<br />
48<br />
V36-Zylinderkopf<br />
2G Energy AG | www.2-g.de
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Aktuelles<br />
„Wo es Sinn macht,<br />
rüsten wir auf Biomethaneinspeisung<br />
um“<br />
Hans-Joachim Polk<br />
„Langfristig brauchen wir ein duales Energiesystem“,<br />
betonte Klaus-Dieter Borchardt, Vizepräsident der EU-<br />
Kommission. Eine Stromerzeugung aus Erneuerbaren<br />
Energien reiche allein nicht aus. Gas werde als zweites<br />
Standbein gebraucht, um Versorgungssicherheit und<br />
Bezahlbarkeit zu gewährleisten. Der Weg müsse vom<br />
Erdgas zu erneuerbaren Gasen führen, sagte Borchardt.<br />
Elektrolyse braucht günstige Strompreise<br />
Er mahnte: „Wir brauchen eine klare Strategie“. In<br />
einem strukturellen Prozess, der seiner Einschätzung<br />
nach etwa 30 Jahre dauern werde, würde fossiles Erdgas<br />
zunehmend durch erneuerbare Gase ersetzt. Notwendig<br />
sei aber auch ein weiterer Ausbau Erneuerbarer<br />
Energien: „Für die Elektrolyse brauchen wir Strom zu<br />
günstigen Preisen, deshalb müssen wir nachlegen beim<br />
Ausbau der Erneuerbaren.“<br />
Die Frage ist: Wie geht es weiter mit Biogas bzw. Biomethan?<br />
Für die Integration von Biogas in andere Sektoren<br />
plädierte Hans-Joachim Polk (VNG). „Es gibt kein<br />
Signal, in welchem Sektor Biogas künftig eingesetzt<br />
werden soll“, beklagte er. Derzeit bereiten 210 Anlagen<br />
Biogas zu Biomethan auf. Die so produzierte Menge<br />
deckt 1 Prozent des deutschen Erdgasverbrauchs.<br />
„Eine Biogasanlage ist ein regionales Kraftwerk“, verdeutlichte<br />
Polk. Sie sichere nicht nur Arbeitsplätze<br />
in der Landwirtschaft direkt, sondern im ländlichen<br />
Raum. Auch das örtliche Handwerk profitiere davon.<br />
„Biomethan sollte auch in bestehenden Gebäuden<br />
eingesetzt werden, um dort CO 2<br />
-neutral heizen zu können.“<br />
Die VNG setze sehr auf Biomethan und habe zuletzt<br />
mehrere Anlagen in Brandenburg übernommen.<br />
Auch bei weiteren Anlagen werde Standortentwicklung<br />
betrieben, kündigte Polk an: „Wo es Sinn macht, rüsten<br />
wir auf Biomethaneinspeisung um.“ Klare Anreize<br />
zum Ausbau der Biogasproduktion vermisst er jedoch<br />
im neuen EEG: „Was den Ausbau der Leistung betrifft,<br />
steht Biogas im Schatten von Solar und Wind.“<br />
Der Schwenk hin zum Wasserstoff hat auch Folgen für<br />
die Speicher-Infrastruktur. Das verdeutlichte Michael<br />
Kohl, kaufmännischer Geschäftsführer der RWE Gas<br />
Storage West. „Unsere Gasspeicher können auch Wasserstoff<br />
speichern.“ Der Gasspeicher Gronau-Epe beispielsweise<br />
könne als Wasserstoffspeicher für Deutschland<br />
und die Niederlande dienen.<br />
Allerdings sind nicht alle Speicher für häufige Umschläge<br />
ausgelegt, führte Kohl aus: Während die Speicher<br />
im Sommer mit Erdgas befüllt und im Winter<br />
entleert werden, geht er beim Wasserstoff von vier bis<br />
fünf Umschlägen im Jahr aus. Wenn Gaskraftwerke zunächst<br />
Kohle- und Kernkraftwerke ersetzen, erwartet<br />
er eine steigende Nachfrage nach Flexibilität aus Speichern.<br />
„Durch die gestiegene Volatilität sind Speicher<br />
werthaltiger geworden.“<br />
Autor<br />
Thomas Gaul<br />
Freier Journalist<br />
Im Wehrfeld 19a · 30989 Gehrden<br />
01 72/512 71 71<br />
gaul-gehrden@t-online.de<br />
ORIGINAL UND OEM FILTER<br />
ÜBER 15.000 FILTER ONLINE VERFÜGBAR<br />
MWM 1212 8936 CAT 1234 3124
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
<strong>2020</strong> goes<br />
virtual!<br />
16. – 20. November <strong>2020</strong><br />
08. – 10. Dezember <strong>2020</strong><br />
BIOGAS Convention <strong>2020</strong> & BIOGAS Convention International <strong>2020</strong><br />
Die 30. BIOGAS Convention, die vom 16. bis 20. November <strong>2020</strong> erstmals virtuell stattfinden wird, steht<br />
ganz im Zeichen der aktuellen Novelle des EEG 2021 sowie der anderen aktuellen Branchenthemen. Der<br />
internationale Teil der BIOGAS Convention findet drei Wochen später vom 8. bis 10.12.<strong>2020</strong> statt.<br />
Das gesamte Angebot der BIO-<br />
GAS Convention umfasst acht<br />
Themenblöcke. Gestartet wird<br />
am Montag, 16. November<br />
<strong>2020</strong> mit dem Zukunftsthema<br />
„Biomethan“. Dabei wird der Verkehrssektor<br />
als Absatzmarkt für Biomethan beleuchtet<br />
und es werden Zukunftsoptionen<br />
von der Vor-Ort-Verstromung bis hin zum<br />
Biomethan aufgezeigt. Dass klimafreundliche<br />
Stadtbusse und eine regionale Kraftstoffversorgung<br />
wirtschaftlich und effizient<br />
sind, belegt der Folgevortrag. Ein Ausblick<br />
in die Zukunft über die Integration von<br />
Power-to-Gas-Konzepten in Biogas- und<br />
Biomethananlagen soll zeigen, welche Geschäftsmodelle<br />
es gibt und wo die Kundenpräferenzen<br />
liegen.<br />
Der Dienstag, 17. November <strong>2020</strong>, steht<br />
ganz im Zeichen der politischen Entwicklungen.<br />
Für Frühaufsteher wird von 7.45<br />
Uhr bis 8.45 Uhr ein virtuelles parlamentarisches<br />
Frühstück übertragen. In einer<br />
tagesaktuellen Diskussionsrunde sollen gemeinsam<br />
mit Vertretern aus der Politik die<br />
Entwicklungen in Sachen Biogas beleuchtet<br />
werden. Um 10.00 Uhr wird das EEG<br />
2021 dann einem Praxistest unterzogen.<br />
Nach einer Einordnung des EEG 2021 in<br />
den Gesamtkontext der Erneuerbaren Energien<br />
durch Dr. Simone Peter, Präsidentin<br />
des Bundesverbandes Erneuerbare Energie<br />
e.V., wird Prof. Dr. Frank Scholwin vom<br />
Institut für Biogas, Kreislaufwirtschaft &<br />
Energie, beleuchten, was<br />
das EEG 2021 konkret<br />
für den Anlagenbetreiber<br />
bedeutet. Welche neuen<br />
Chancen sich bei der Flexibilisierung<br />
nach dem<br />
EEG 2021 ergeben, fragt<br />
Uwe Welteke-Fabricius<br />
vom Flexperten-Netzwerk.<br />
Horst Seide, Präsident des<br />
Fachverbandes Biogas<br />
e.V., wird dann mit seinem<br />
Vortrag „EEG 2021 – Wie<br />
packen wir‘s an?“ erste<br />
Strategien aufzeigen und<br />
in der anschließenden<br />
Fragerunde mit den Referenten<br />
und Teilnehmern diskutieren.<br />
Noch mehr Informationen zum EEG erhalten<br />
die Teilnehmer am Donnerstag, 19. November<br />
<strong>2020</strong> bei „Recht – Wie es Sie weiterbringt“.<br />
Hier erhalten Sie Informationen<br />
zur EEG-Umlage, deren Vorgaben, Chancen<br />
und Risiken sowie zur „EEG-Novelle<br />
und aktuellen Entscheidungen“. Ergänzt<br />
wird dieser Block mit einem Vortrag zur<br />
Veränderung an Anlagen und was es dabei<br />
von rechtlicher Seite zu beachten gilt.<br />
Am 17. November <strong>2020</strong> geht es ab 14.00<br />
Uhr um „Alternative Konzepte – Chancen<br />
für Anlagenbetreiber.“ Moderiert von Hinrich<br />
Neumann von top.agrar werden vier<br />
Beispiele für andere Wege im Rahmen der<br />
Biogasproduktion vorgestellt. Zwei Vorträge<br />
beschäftigen sich mit der Aufbereitung und<br />
Weiterverwertung von Gärprodukten. Zwei<br />
weitere zeigen die Chancen der Vernetzung:<br />
Die Stadt Trier und die Biogaspartner<br />
Bitburg stellen ihr Modell der Vernetzung<br />
dezentraler Biogasanlagen, die „Sammlung,<br />
Aufbereitung und Vermarktung von<br />
Biomethan in der Region Westeifel“ vor<br />
und Energy2market ergänzt dies mit „Bundesweit<br />
regional vernetzt – Strom von meinen<br />
Nachbarn“.<br />
Am 18. November <strong>2020</strong> stehen spezielle<br />
„Herausforderungen für die Biogas-Branche“<br />
im Mittelpunkt, so die „Roten Gebiete“,<br />
die TRAS 120, die 44. BImSchV<br />
und die TRGS 529. Die Brücke in die<br />
Praxis schlägt ein Vortrag zum Genehmigungsrecht.<br />
Am Nachmittag wird es noch<br />
konkreter. Hier werden Innovationen,<br />
Praxisbeispiele oder spannende Projekte<br />
vorgestellt, u.a. zur „Optimierung von Biogasanlagen<br />
– technische Voraussetzung für<br />
eine optimierte Stromvermarktung“ oder<br />
zur „Wartungsintervallverlängerung auf<br />
4.000 Betriebsstunden durch Predictive<br />
Maintenance“.<br />
Foto: Adobe Stock_Blue Planet Studio_bearbeitet von bigbenreklamebureau<br />
50
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Aktuelles<br />
Neue rechtliche Vorgaben an die Fremdstoffabscheidung<br />
in der Abfallvergärung<br />
stehen am 19. November <strong>2020</strong> auf dem<br />
Plan. Die Qualität von Einsatzstoffen und<br />
Produkten bei der Abfallvergärung beschäftigt<br />
die Branche, da sie entscheidend<br />
für die Betriebsprozesse und den Wert der<br />
Gärprodukte sind. Den „Stand der kleinen<br />
Novelle Bioabfallverordnung“ präsentiert<br />
Hans-Peter Ewens vom Bundesministerium<br />
für Umwelt, Naturschutz und nukleare<br />
Sicherheit. Mit einem Bericht zur Vergärung<br />
und Kompostierung von Bioabfällen<br />
findet dieser Block seinen Abschluss.<br />
Am letzten Tag (20. November) stehen<br />
dann die technischen Anforderungen im<br />
Mittelpunkt: Schadensfälle an Biogasanlagen<br />
zeigen einprägsam, warum Anlagenbetreiber<br />
von einer kontinuierlichen<br />
Prävention und der Einhaltung der Sicherheitsvorgaben<br />
profitieren. Die Umsetzung<br />
der TRAS 120 wird aus Sicht eines §29b-<br />
BImSchG-Sachverständigen vorgestellt<br />
und die Herausforderungen für Biogasanlagen<br />
durch die Umsetzung der AwSV<br />
und der TRwS 793-1 werden ausführlich<br />
erörtert.<br />
Die Mitgliederversammlung findet am 17.<br />
November ebenfalls virtuell statt, die Anmeldung<br />
erfolgt für Mitglieder über den<br />
regulären Ticketshop.<br />
Vom 8. bis 10. Dezember geht es in die<br />
zweite Runde mit der BIOGAS Convention<br />
16.11. - 20.11.<strong>2020</strong> BIOGAS Convention (deutschsprachige Vorträge)<br />
08.12. - 10.12.<strong>2020</strong> BIOGAS Convention International (englischsprachige Vorträge)<br />
Das gesamte Programm mit allen Vorträgen und dem Ticketshop finden Sie auf<br />
www.biogas-convention.com oder www.biogas-convention.com/en<br />
International (englischsprachige Vorträge).<br />
Hier startet der erste Tag mit Einblicken in<br />
die weltweiten Entwicklungen: allgemein<br />
im Bioenergiesektor, speziell in der Abfallvergärung<br />
sowie ganz konkret zur CO 2<br />
-Kompensation<br />
als zusätzlicher Einnahmequelle.<br />
Es folgen Europäische Themen: die RED II,<br />
die Rolle von Methanemissionen bei CO 2<br />
-<br />
Zertifikaten von Schweizer Biogasanlagen<br />
sowie die Rolle von Biogasanlagen in der<br />
Wasserstoffwirtschaft. Am Mittwoch zeigen<br />
die Vorträge der „German Biogas Competence“<br />
an Praxisbeispielen, wie deutsche<br />
Biogastechnologie die Entwicklungen weltweit<br />
mitträgt. Mit „Biowaste-to-Biogas“<br />
greift der Fachverband seine erfolgreiche<br />
Broschüre rund um die Bioabfallvergärung<br />
auf und zeigt drei Referenzanlagen aus verschiedenen<br />
Ländern mit unterschiedlichen<br />
Technologien.<br />
Natürlich steht auch im internationalen<br />
Teil „Biomethan“ im Blickpunkt. Das Potenzial<br />
für den Lieferverkehr, die Bio-LNG-<br />
Strategie eines Akteurs auf dem Kraftstoffmarkt<br />
und die Frage, wie Power-to-Gas die<br />
Methan ausbeute erhöhen kann, zeigen<br />
die ganze Bandbreite. Wie man aus Bioabfall<br />
Kraftstoff macht, zeigt ein Vorzeigeprojekt<br />
aus Jönköping, Schweden, unter<br />
Einbindung in die Kreislaufwirtschaft auf<br />
regionaler Ebene. Im letzten Block des internationalen<br />
Teils zeigen Standards, wie<br />
Qualität und Sicherheit bei Biogasanlagen<br />
erreicht und langfristig erhalten werden<br />
können. Vorgestellt werden die deutschen<br />
Standards, die Entwicklungen in Kenia und<br />
Südafrika sowie Maßnahmen zur Emissionskontrolle<br />
bei Biogasanlagen.<br />
Nicht zu kurz kommen wird der Austausch:<br />
Die BIOGAS Convention und die BIOGAS<br />
Convention International bieten eigene<br />
Event-Webseiten, die den Teilnehmern die<br />
interaktive Mitwirkung durch Fragen an die<br />
Referenten oder an andere Teilnehmer eröffnet.<br />
Außerdem bieten die Seiten die Möglichkeit,<br />
Termine zu vereinbaren oder zum<br />
1:1-Videochat mit anderen Teilnehmern.<br />
Unter www.biogas-convention.com finden<br />
Sie die Programme der BIOGAS Convention/BIOGAS<br />
Convention International <strong>2020</strong><br />
und den Ticketshop.<br />
Sichern Sie sich Ihre Tickets für beide<br />
Veranstaltungen. Der Fachverband Biogas<br />
freut sich auf Ihre Teilnahme!<br />
Programmübersicht*<br />
Montag,<br />
16.11.<strong>2020</strong><br />
Dienstag,<br />
17.11.<strong>2020</strong><br />
Mittwoch,<br />
18.11.<strong>2020</strong><br />
Donnerstag,<br />
19.11.<strong>2020</strong><br />
Freitag,<br />
20.11.<strong>2020</strong><br />
7.45 – 8.45<br />
Parlamentarisches<br />
Frühstück<br />
„Zukunft Biogas“<br />
Tagesaktuelle<br />
Diskussionsrunde<br />
10.00 – 12.00<br />
BLOCK 2<br />
EEG 2021<br />
Zukunftsperspektive<br />
oder<br />
Scherbenhaufen?<br />
BLOCK 4<br />
HERAUSFORDERUNGEN<br />
Aktuelle Anforderungen<br />
für die Biogasbranche<br />
BLOCK 6<br />
Abfallvergärung<br />
Neue rechtliche<br />
Vorgaben an die<br />
Fremdstoffabscheidung<br />
BLOCK 8<br />
Technik<br />
Aktuelle technische<br />
Anforderungen<br />
(TRwS, TRAS, AwSV)<br />
14.00 – 16.00<br />
BLOCK 1<br />
Biomethan<br />
BLOCK 3<br />
ALTERNATIVE KONZEPTE<br />
Chancen für<br />
Anlagenbetreiber<br />
BLOCK 5<br />
Innovationen<br />
Projekte & Produkte<br />
BLOCK 7<br />
Recht<br />
Wie es Sie<br />
weiterbringt<br />
17.00 – 20.00<br />
Mitgliederversammlung<br />
* Änderungen vorbehalten<br />
51
Politik<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Gesetzesentwurf<br />
EEG 2021: Verhaltene<br />
Aufbruchstimmung<br />
Im Gesetzgebungsverfahren zum EEG 2021 zeichnen sich für die Biogasbranche<br />
zukunftsweisende Signale ab – und dabei steht die heiße Phase sogar noch aus. Wir<br />
geben einen Überblick über den Stand des Verfahrens und die wesentlichen Inhalte<br />
des Kabinettsbeschlusses.<br />
Von Sandra Rostek und Dr. Guido Ehrhardt<br />
Nach jahrelanger Hängepartie und schier<br />
endlosem Warten ging es wie immer in der<br />
Politik plötzlich dann ganz schnell: Seit<br />
dem Abend des 31. August stecken wir<br />
mitten in der Novelle zum EEG 2021. Und<br />
es ging Schlag auf Schlag – nach einem ersten inoffiziellen<br />
Entwurf des Wirtschaftsministeriums, in dem<br />
zumindest schon ein paar positive Signale in Sachen<br />
Flexibilisierung von Biogas standen, über die Verbändeanhörung<br />
und die Abstimmung der Bundesressorts bis<br />
zum Kabinettsbeschluss am 23. September. Und dieser<br />
Entwurf stellt aus Perspektive der Bioenergie schon<br />
mal eine recht ordentliche Zwischenbilanz dar, auch<br />
wenn natürlich auch für das weitere Verfahren noch einiges<br />
zu tun bleibt.<br />
dafür sorgen, dass die Ausschreibungen für tausende<br />
Bestandsanlagen eine tragfähige Anschlussregelung<br />
nach Ende des ersten Vergütungszeitraums werden.<br />
Auch erste Neuanlagen könnten in Deutschland wieder<br />
möglich sein. Der Blick auf die Ziele der Bundesregierung<br />
im Bereich Biogas zeigt aber auch: Das reicht noch<br />
nicht. Weite Teile des Anlagenbestands können so nicht<br />
weiterbetrieben werden. Daher setzen wir uns weiterhin<br />
vehement für eine nochmalige Korrektur auf 19,4<br />
ct/kWh für den Bestand ein. Neu im EEG soll zudem<br />
eine eigene Ausschreibung für hochflexible Biomethan-<br />
Blockheizkraftwerke (BHKW) in südlichen Landkreisen<br />
sein, die einen besonderen Beitrag zur Sicherung der<br />
dortigen Stromnetze leisten sollen. Der Gebotshöchstwert<br />
soll hier bei 19 ct/kWh liegen.<br />
Gebotshöchstwerte in Ausschreibungen<br />
angehoben<br />
Bei einer unserer wichtigsten Forderungen geht es<br />
schon deutlich in die richtige Richtung: Im aktuellen<br />
Entwurf sollen die Gebotshöchstwerte für die EEG-Ausschreibungen<br />
für alle Anlagen um 2 Cent pro Kilowattstunde<br />
(ct/kWh) angehoben werden auf nun 16,4 ct/<br />
kWh für Neuanlagen und 18,4 ct/kWh für Bestandsanlagen.<br />
Nach unserer Analyse könnte diese Anpassung<br />
Ausschreibungsvolumina angehoben<br />
Auch im Bereich der Ausschreibungsvolumina gibt es<br />
Bewegung in die richtige Richtung. Im regulären Ausschreibungssegment<br />
für Neu- und Bestandsanlagen<br />
sollen gemäß Entwurf in den kommenden Jahren 350<br />
Megawatt (MW) jährlich ausgeschrieben werden. Zusätzlich<br />
werden jährlich 150 MW für die Biomethan-<br />
BHKW veranschlagt. In der Gesetzesbegründung wird<br />
gesagt, dass die Volumina so auszugestalten sind, dass<br />
Foto: Adobe Stock/snapshotfreddy<br />
52
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Politik<br />
Grafik: Fachverband Biogas e.V.<br />
bis 2030 die Stromerzeugung aus Biomasse<br />
auf einem Niveau von 42 Terawattstunden<br />
(TWh) stabilisiert wird.<br />
Dies deckt sich allerdings nach unserer Meinung<br />
nicht mit den geplanten Volumina, da im<br />
Wirtschaftsministerium offenbar die zunehmende<br />
Flexibilisierung des Anlagenparks nicht berücksichtigt<br />
wurde. Wir setzen uns daher für eine<br />
Anpassung der Volumina an reale Bedingungen<br />
ein sowie dafür, dass die Ziele für die Biomasse<br />
direkt im Gesetz verankert werden und nicht nur<br />
in der Begründung.<br />
Stärkung der Flexibilisierung<br />
Wenn es eine klare Botschaft aus diesem Entwurf an<br />
die Biogasbranche gibt, dann lautet diese: Flexibilisierung!<br />
Die besondere Rolle von Biogas im erneuerbaren<br />
Energiemix wird künftig stärker gefördert, aber<br />
auch stärker eingefordert werden. Die Deckelung der<br />
Flexibilitätsprämie für Bestandsanlagen wurde endlich<br />
gestrichen. Anlagen, die diese Prämie neu in Anspruch<br />
nehmen und mehr als ein BHKW besitzen, müssen an<br />
mindestens 1.000 Stunden pro Jahr mindestens 85<br />
Prozent ihrer Leistung abrufen.<br />
Der Flexibilitätszuschlag für neue und neu in Betrieb<br />
genommene Anlagen wurde erhöht von bislang 40 auf<br />
nun 65 Euro je Kilowatt (kW). Die Pflicht zur Flexibilisierung<br />
wird dabei verschärft. Zukünftig erhalten<br />
neue und neu in Betrieb genommene Biogasanlagen<br />
nur noch eine Vergütung für eine Bemessungsleistung,<br />
die 45 Prozent ihrer installierten Leistung entspricht.<br />
Gute Ansätze, aber noch Anpassungsbedarf<br />
bei der Güllevergärung<br />
Mit Abschluss der Ressortabstimmung konnten sich<br />
das Landwirtschaftsministerium und das Wirtschaftsministerium<br />
noch nicht abschließend auf Änderungen<br />
im Bereich der Güllevergärung einigen. Da dies aber<br />
auch eine wichtige Maßnahme im Klimaschutzprogramm<br />
ist, hoffen wir im weiteren Verfahren noch auf<br />
Verbesserungen. Die Ansätze sind bereits vorhanden:<br />
Die Sondervergütungsklasse wird im Kabinettsentwurf<br />
leicht überarbeitet: Zukünftig ist die Bemessungsleistung<br />
nicht mehr auf 75 kW begrenzt und Anlagen ab<br />
einer installierten Leistung von 100 kW können den<br />
Flexibilitätszuschlag erhalten.<br />
Da die Begrenzung der installierten Leistung von 150<br />
kW beibehalten sowie die Pflicht zur Flexibilisierung<br />
aufrechterhalten wird, können de facto jedoch keine<br />
Gülleanlagen mit deutlich höherer Bemessungsleistung<br />
als bisher gebaut werden. Wir halten daher an<br />
unserem Anliegen nach einer Umstellung auf 150 kW<br />
Bemessungsleistung fest. Zudem gibt es eine neue Verordnungsermächtigung,<br />
um Regelungen einzuführen,<br />
damit bestehende Biogasanlagen, die auf die Güllevergärung<br />
umrüsten und maximal 150 kW installiert aufweisen,<br />
eine Anschlussvergütung nach Auslaufen des<br />
ersten Vergütungszeitraum erhalten. Wir begrüßen das<br />
Aufgreifen unseres Vorschlags, setzen uns aber für eine<br />
Umsetzung im laufenden Verfahren ein.<br />
Neue Herausforderungen<br />
Neben vielen guten Ansätzen und positiven Signalen<br />
gibt es leider auch neue Herausforderungen, allen voran<br />
die sogenannte „Südquote“. Diese besagt, dass 50<br />
Prozent des Ausschreibungsvolumens von Anlagen aus<br />
der sogenannten Südregion vorrangig bezuschlagt werden<br />
sollen, um eine Lenkungswirkung hin zum Süden<br />
zu erzielen, der einen erhöhten Bedarf an gesicherter<br />
Leistung hat.<br />
53
Politik<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Voraussichtlicher weiterer<br />
Zeitplan EEG 2021<br />
Wird dieses Volumen<br />
aber nicht abgerufen,<br />
kann es auch nicht von<br />
„Nordanlagen“ unmittelbar<br />
genutzt werden,<br />
sondern soll für drei<br />
Jahre zurückgestellt<br />
werden. Dieser Plan ist<br />
aus unserer Sicht widersinnig,<br />
da gesicherte<br />
Leistung im Norden wie<br />
im Süden gebraucht<br />
wird und allein von der<br />
Quote auch keine Lenkungswirkung ausgehen würde.<br />
Wir lehnen diese daher strikt ab. Sollte es politisch<br />
nicht durchsetzbar sein, die Quote ganz abzuschaffen,<br />
plädieren wir für eine Angleichung der Regelung an den<br />
Windbereich, wo die Südquote nur bei 15 Prozent von<br />
2021 bis 2023 beziehungsweise 20 Prozent ab 2024<br />
liegen soll und nicht abgerufene Volumina in derselben<br />
Ausschreibung von den restlichen Landesteilen genutzt<br />
werden können.<br />
22. Oktober <strong>2020</strong>: Beratung im Wirtschaftsausschuss<br />
des Bundesrats.<br />
29. Oktober <strong>2020</strong>: 1. Lesung im Bundestag.<br />
06. November <strong>2020</strong>: Beratung im Bundesratsplenum.<br />
18. November <strong>2020</strong>: Öffentliche Anhörung im Wirt<br />
schaftsausschuss des Bundestags.<br />
27. November <strong>2020</strong>: 2./3. Lesung im Bundestag.<br />
18. Dezember <strong>2020</strong>: Abschlussberatung im Bundesrat.<br />
01. Januar <strong>2020</strong>: Inkrafttreten EEG 2021.<br />
Weitere Senkung des Maiseinsatzes wird<br />
wirtschaftliche Folgen haben<br />
Neben den beschriebenen verschärften Anforderungen<br />
an die Flexibilisierung dürfte zudem die Absenkung des<br />
sogenannten „Maisdeckels“ auf 40 Prozent Auswirkungen<br />
auf die Wirtschaftlichkeit von Anlagenkonzepten<br />
haben. Und natürlich ergeben sich auch aus den neuen<br />
Regelungen diverse Fragestellungen im Bereich<br />
der Übergangsbestimmungen. Hier wie auch in vielen<br />
anderen Bereichen haben wir noch etliche politische<br />
Anliegen sowie auch offene Fragen, die sich aktuell<br />
noch in der rechtlichen Prüfung befinden. Für eine<br />
detaillierte Darstellung sei an dieser Stelle auf unsere<br />
Langstellungnahme zum Kabinettsentwurf verwiesen.<br />
Unterm Strich ist der vorliegende Entwurf unserer<br />
Auffassung nach eine gute Grundlage, auf der wir nun<br />
aufsatteln können, um im weiteren parlamentarischen<br />
Verfahren hoffentlich nun noch weitere Verbesserungen<br />
zu erwirken. Unser Ziel ist nun, mehr denn je der<br />
gesamten Branche in dieser Novelle eine wirklich tragfähige<br />
und praxistaugliche Perspektive zu erarbeiten.<br />
Gemeinsam erreichen wir mehr –<br />
Jetzt sind wir alle gefragt!<br />
Oft hat man in der Politik ja den Eindruck, dass einige<br />
wenige im Elfenbeinturm über Dinge im Alleingang<br />
entscheiden. Viele haben das Gefühl, diese Entscheidungen<br />
nicht beeinflussen zu können. Aus jahrelanger<br />
Erfahrung in der politischen Arbeit können wir jedoch<br />
sagen: Das stimmt nicht. Klar, wir können nicht alles<br />
immer genauso haben, wie wir es gerne hätten, denn<br />
Politik ist immer auch ein Kompromiss. Aber wir haben<br />
es durchaus in der Hand, den politischen Handlungsträgern<br />
zu verdeutlichen, wo uns der Schuh drückt.<br />
Nichts wirkt dabei so gut und so nachhaltig wie das<br />
persönliche Gespräch. Diese führen wir natürlich regelmäßig<br />
in Berlin, insbesondere mit den für unsere<br />
Themen zuständigen Fachpolitikern. Aber vermutlich<br />
noch wichtiger als dieser Austausch in der Hauptstadt<br />
sind die Gespräche, die Sie vor Ort im Wahlkreis führen.<br />
Indem Sie Ihre eigene Betroffenheit am echten<br />
Beispiel deutlich machen, können Sie unsere Anliegen<br />
viel eindrücklicher vermitteln, als wenn wir in einem<br />
Büro im Bundestag sitzen.<br />
Also: Am besten gleich vor Ort einen Termin ausmachen,<br />
physisch oder – gerade in diesen Zeiten – zumindest<br />
telefonisch. Oder schreiben Sie einen Brief<br />
oder eine Postkarte! Im Verbund mit den anderen Bioenergieverbänden<br />
und dem Deutschen Bauernverband<br />
haben wir in unserem gemeinsamen „Hauptstadtbüro<br />
Bioenergie“ eine Postkarte für Sie entworfen (siehe<br />
Seite 53), die diesem Biogas Journal beiliegt und mit<br />
der Sie den Abgeordneten unsere Anliegen per kurzem<br />
Gruß mitteilen können. Wir bedanken uns im Voraus<br />
herzlich für Ihre Beteiligung an dieser Aktion!<br />
Autoren<br />
Sandra Rostek<br />
Leiterin des Berliner Büros<br />
im Fachverband Biogas e.V.<br />
Dr. Guido Ehrhardt<br />
Leiter des Referats Politik<br />
im Fachverband Biogas e.V.<br />
030/2 75 81 79-0<br />
berlin@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
54
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Politik<br />
Schreiber<br />
Anlagenbau<br />
Industrie | Biogas | Sondermaschinen | Klärtechnik<br />
DOSIER-MISCHERSCHNECKE 2.0<br />
mit einer Windung komplett V2A<br />
Unsere bewährte Mischerschnecke durch viel Erfahrung<br />
verbessert und weiterentwickelt<br />
durch verbesserte Geometrie der Windung,<br />
Reduzierung des Stromverbrauchs<br />
hergestellt aus V2A – 10 mm<br />
zwei Räumschwerter aus 15 mm V2A<br />
6 Messerhalter<br />
mit großer Serviceöffnung inkl. Abdeckung<br />
optional Ausräumer (rot) erhältlich<br />
für alle gängigen Hersteller lieferbar<br />
FERMENTER ZU DICK?<br />
GASERTRAG ZU NIEDRIG?<br />
RÜHRWERKE AM ANSCHLAG?<br />
AS COMPACT CRUSHER<br />
einfacher Einbau vor/nach einer Pumpe<br />
einfache Steuerung<br />
integrierter Fremdkörperabscheider<br />
einfacher Messeraustausch<br />
geringe Unterhaltskosten<br />
Messersatz für nur 24 € erhältlich<br />
bis zu 120 m³/h Durchsatz<br />
mehr Gasertrag aus Problemstoffen/Verkürzung der Verweilzeit<br />
IE3 oder wahlweise IE4 Elektromotor<br />
mechanische verschleißfreie Dichtung<br />
extrem starke langlebige Lagerung<br />
Fermenter wird homogener und fließfähiger – bessere Ausnutzung<br />
40 %<br />
BIS ZU<br />
ZUSCHUSS<br />
KFW 295<br />
problemloses vergasen von großen Mengen: Mist, Stroh, GPS<br />
oder andere Problemsubstrate<br />
zerkleinert/zerfasert<br />
- mechanisch durch extrem schnell drehende Messer<br />
- durch Kavitation, die bei der hohen Drehzahl entsteht<br />
verhindert Schwimmschichten<br />
dünnere Gülle beim Ausbringen<br />
verkürzt die Rührzeiten<br />
ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê<br />
55<br />
Gasaufbereitung | Substrataufbereitung | Separation | Trocknungsanlagen | Instandsetzungen | Sonderanfertigung<br />
Tel.: 07305 95 61 501 | info@schreiber-anlagenbau.de | www.schreiber-anlagenbau.de
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Silphiefasern für<br />
Verpackungsmaterial:<br />
eine Riesenchance!?<br />
Im Energiepark Hahnennest wird die Aufbereitung von Fasern der Durchwachsenen Silphie<br />
für die Papierherstellung erprobt, womit sich eine stofflich/energetische Kombinutzung<br />
ergibt. Mit an Bord ist ein führendes Lebensmittel-Handelsunternehmen. Für die Biogasbranche<br />
könnte ein Post-EEG-Modell entstehen!<br />
Von Christian Dany<br />
Technik<br />
und<br />
Innovation<br />
Anfang September herrscht in Hahnennest<br />
Hochbetrieb: Die 300 Hektar Durchwachsene<br />
Silphie rund um das 20 Kilometer<br />
nördlich des Bodenseeufers gelegene Dorf<br />
werden geerntet. Mehrere Feldhäcksler und<br />
Schlepper-Anhänger-Gespanne sind im Einsatz. In dem<br />
Energiepark geht es zu wie auf einem Taubenschlag. Die<br />
Fahrzeugwaage ist das begehrte Nadelöhr und<br />
nebenan hat auch schon das Einsilieren<br />
des Silphie-Erntegutes begonnen. „Die<br />
Silphie muss drei bis vier Wochen vor<br />
dem Mais geerntet werden“, sagt<br />
Alexandra Kipp, „denn eine zu späte<br />
Ernte kann zu einer schlechten<br />
Methanausbeute führen.“<br />
Die Agraringenieurin kümmert sich<br />
um Vertrieb und Marketing der Durchwachsenen<br />
Silphie, die zu einem wichtigen<br />
Geschäftszweig der Hahnennest-<br />
Landwirte geworden ist. Der Energiepark in<br />
dem 40-Einwohner-Dorf mit dem lustigen Namen war<br />
vorher schon in der Biogasszene weithin bekannt, weil<br />
hier die Landwirte in einer Großanlage zusammenarbeiten<br />
bis zur Einspeisung von Biomethan ins Gasnetz.<br />
Kipp organisiert deutschlandweit Feldtage, auf denen<br />
der Silphieanbau demonstriert wird. „Mittlerweile<br />
bauen in Deutschland über 1.000 Landwirte auf rund<br />
6.000 Hektar Silphie an“, erzählt sie. Vor allem in den<br />
vergangenen Jahren sei ein starkes Wachstum zu verzeichnen,<br />
wozu auch das in Hahnennest entwickelte<br />
Konzept zur Aussaat der Silphie unter der Deckfrucht<br />
Mais beigetragen habe (siehe auch Biogas Journal<br />
2_2018 und folgende).<br />
Einbringtechnik auf Silphie anpassen<br />
Kipp erklärt einige Eigenheiten der gelben Korbblütler-Pflanze,<br />
bevor sie auf den neuen Verwertungspfad<br />
zu sprechen kommt, der jetzt in Hahnennest getestet<br />
wird: die Faseraufbereitung. Im Mai sei hierzu eine<br />
Pilotanlage in Betrieb genommen worden. Der Testbetrieb<br />
verfolge das Ziel, die Fasern so aufzubereiten,<br />
dass sie als Rohstoff für die Papierherstellung taugen.<br />
Auf dem Weg zur Anlagenbesichtigung kommt Simon<br />
Rauch, einer von zwei Geschäftsführern des Energieparks<br />
Hahnennest dazu. „Die Silphie schüttet dichter<br />
als Mais. Deshalb haben wir eine darauf abgestimmte<br />
Einbringtechnik“, erklärt er beim Vorbeischreiten an einem<br />
neuen Silphie-Silagehaufen, der gerade von einem<br />
Traktor verdichtet wird.<br />
Der 100-Kubikmeter-Edelstahlbehälter<br />
steht am<br />
Anfang des Verfahrens.<br />
Die Anlage hat eine Verarbeitungskapazität<br />
von 2,5<br />
Tonnen pro Stunde pro Aufbereitungslinie.<br />
Sie verfügt<br />
über zwei parallele, identische<br />
Aufbereitungslinien<br />
und dadurch über eine Kapazität<br />
von 40.000 Jahrestonnen<br />
Frischmasse: „Das<br />
Herzstück ist jeweils der<br />
Container mit dem Reaktor<br />
für die Steam Explosion“,<br />
erläutert Rauch.<br />
Das auch Thermodruckhydrolyse<br />
genannte Verfahren<br />
sei kurz nach 1900 in der<br />
Papierindustrie erfunden<br />
worden. Das Funktionsprinzip<br />
des Reaktors, eines liegenden<br />
Zylinders, ähnle dem<br />
eines Schnellkochtopfs:<br />
„Das Substrat wird auf 150<br />
bis 180 Grad Celsius (°C)<br />
erhitzt. Durch das Kochen<br />
Fotocollage: OutNature GmbH, Fachverband Biogas e.v.<br />
56
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
praxis / Titel<br />
entsteht Dampf. Dabei wird Lignin flüssig, Zellulose und<br />
Hemizellulose werden freigesetzt. Nach zwölf Minuten<br />
sind 8 bar Druck erreicht: Dann geht ein Schieber auf<br />
und es kommt zu einer plötzlichen Entspannung. Die<br />
Zellen verlieren ihren Zusammenhalt und Fasern werden<br />
freigelegt“, schildert der Firmenchef.<br />
Die Anlage arbeite im Batch-Verfahren. „Pro Batch werden<br />
500 Kilogramm Material ausgeschleust. Die Wärme<br />
des entspannten Dampfs wird genutzt, um das Material<br />
für den nächsten Batch vorzuwärmen. Das bringt<br />
eine hohe thermische Effizienz“, erklärt Rauch weiter.<br />
Parallel zu den zwei Steam-Explosion-Linien sei der<br />
Container mit der Anlage für den Thermoöl-Kreislauf<br />
angeordnet. Das Thermoöl werde auf 220 °C erhitzt.<br />
Fasern werden gewaschen und entstippt<br />
Für den derzeitigen Testbetrieb komme die Wärme<br />
noch aus einem Erdgasbrenner. Das sei günstiger für<br />
die Datenerfassung und Auswertungen. Für den Dauerbetrieb<br />
sei aber geplant, Wärme aus den Biogas-<br />
Blockheizkraftwerken (BHKW) zu verwenden. Nach<br />
dem Herunterkühlen des Substrates auf 60 bis 70 °C<br />
werde dieses durch eine Fest/Flüssigtrennung in Fasern<br />
und Gärsubstrat für die Biogasanlage separiert.<br />
Die Fasern werden einem weiteren Behandlungsschritt<br />
unterzogen: In einem Wäscher werden sie gereinigt und<br />
im Entstipper aufgesplissen; das heißt, Faserbündel<br />
werden vereinzelt.<br />
Die Fasern kommen dann mit 40 Prozent Trockensubstanz-Gehalt<br />
aus der Anlage. Seit Mai sind etwa<br />
500 Tonnen Silphiefasern produziert worden.<br />
Rauch zufolge werde die Anlage bislang<br />
in gewissen Testzyklen gefahren – je<br />
nachdem, welche Mengen eine kooperierende<br />
Papierfabrik für ihre<br />
Entwicklungsarbeit abnehme.<br />
Deshalb könnten auch noch<br />
keine Aussagen zur Wirtschaftlichkeit<br />
respektive zu<br />
Kosten der Faseraufbereitung<br />
getroffen werden, weil<br />
die Anlage immer wieder extra<br />
hochgefahren werden müsse,<br />
was natürlich ineffizient sei.<br />
Ziel sei jedoch ein 24/7-Betrieb<br />
der Anlage.<br />
„Die im Projekt involvierte Papierfabrik ist<br />
mit der Qualität der bereits produzierten<br />
Fasern mehr als zufrieden“<br />
Alexandra Kipp<br />
57
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Deutsche Papierproduktion<br />
Die deutsche Papierindustrie war 2019 mit einem Produktionsvolumen von rund 22 Mio.t<br />
Papier, Karton und Pappe die Nummer eins in Europa und steht weltweit hinter China, den<br />
USA und Japan an vierter Stelle. Die Produktion gliedert sich in vier Hauptsortengruppen:<br />
ff55 % Verpackungspapiere und -karton.<br />
ff32 % grafische Papiere (Druck- und Schreibpapiere).<br />
ff7 % Hygienepapiere.<br />
ff6 % technische Papiere und Spezialpapiere.<br />
Alexandra Kipp mit einer<br />
Muster-Faltschachtel.<br />
Quelle: Verband Deutscher Papierfabriken (VDP)<br />
Papiermuster mit<br />
verschiedenen Dichten<br />
und Silphiefaser-<br />
Anteilen.<br />
Vorne der weiße Container mit dem<br />
Thermoöl-Kreislauf. Dahinter die zwei<br />
Aufbereitungslinien mit dem Steam-<br />
Explosion-Verfahren. Links quer<br />
angeordnet: die Nachbehandlung mit<br />
Wäscher und Entstipper. <br />
58
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
praxis / Titel<br />
Fotos: Christian Dany<br />
Der Testbetrieb wird von der Universität Hohenheim wissenschaftlich<br />
begleitet. Doktorand Benedikt Hülsenmann betreut<br />
das Forschungsprojekt „Verfahrenstechnische Untersuchungen<br />
zur Fasergewinnung aus Durchwachsener Silphie zur Papierherstellung<br />
bei gleichzeitiger energetischer Verwertung der<br />
aufgeschlossenen Pülpe“. Er ist nach Hahnennest gekommen,<br />
um Proben vom Silphie-Erntegut zu nehmen. Hülsenmann fragt<br />
nach dem Erntezeitpunkt des bereitliegenden Materials, denn<br />
er möchte mehrere Proben von verschiedenen Ernten, damit<br />
erforscht werden kann, wie sich die Faserqualität je nach Erntezeitpunkt<br />
ändert. „Die im Projekt involvierte Papierfabrik ist mit<br />
der Qualität der bereits produzierten Fasern mehr als zufrieden.<br />
Hier sind wir in einem fortgeschrittenen Stadium der Testproduktion“,<br />
ergänzt Alexandra Kipp.<br />
Neben der Uni Hohenheim haben die Hahnennester aber noch<br />
einen Partner – und zwar einen sehr gewichtigen: „Der Energiepark<br />
Hahnennest und die Schwarz-Gruppe haben gemeinsam<br />
rund 3 Millionen (Mio.) Euro in die Faseraufbereitungsanlage<br />
investiert. Mit der Schwarz-Gruppe als Partner haben wir den<br />
perfekten Zugang in den Lebensmittel-Einzelhandel. Ohne einen<br />
großen Konzern kriegt man da sonst keinen Fuß in die Tür“,<br />
stellt Rauch klar.<br />
Mit rund 12.000 Filialen und Fachmärkten in 30 Ländern, über<br />
400.000 Beschäftigten und mehr als 100 Milliarden Euro Jahresumsatz<br />
ist die Schwarz-Gruppe ein international führendes<br />
Handelsunternehmen. Bekannt sind vor allem die Lidl- und<br />
Kaufland-Märkte. Die Unternehmensgruppe will Plastik als<br />
Verpackungsmaterial vermeiden respektive ersetzen; und das<br />
sowohl in der Produktion von Eigenmarken als auch im Verkauf.<br />
2018 wurde hierfür die Strategie „Reset Plastic“ ins Leben gerufen.<br />
Ziel ist, bis in fünf Jahren 20 Prozent weniger Plastik zu<br />
verwenden, wobei auch alternative Materialien erforscht werden<br />
sollen; vor allem geeignetes Papier.<br />
Alte Papierfabrik wiederbelebt<br />
Die Schwarz-Gruppe hat deshalb nicht nur in die Faseraufbereitung<br />
in Hahnennest investiert: Sie schloss auch einen Vertrag<br />
zur strategischen Partnerschaft mit der Silphie Paper GmbH.<br />
Silphie Paper ist als Nachfolgefirma der 165 Jahre alten, insolventen<br />
Papierfabrik Scheufelen in Lenningen bei Kirchheim/<br />
Teck gegründet worden. Der verbliebene Maschinenpark der Papierfabrik<br />
ist mit einem Jahresdurchsatz bis zu 18.000 Tonnen<br />
(t) zu klein, um dauerhaft in der Massenproduktion konkurrenzfähig<br />
zu sein. Deshalb sollen hier Papierarten entwickelt werden,<br />
die Plastik in der Lebensmittelwirtschaft ersetzen können.<br />
Während eine Vorgänger-Gesellschaft Erfahrungen in der Entwicklung<br />
von Graspapier erworben hat, möchte Silphie Paper<br />
ein homogeneres und festeres Papier herstellen.<br />
Alternative Faserstoffe stehen in der Papierindustrie hoch im<br />
Kurs, denn Baumholz-Fasern haben ein Nachhaltigkeitsproblem:<br />
die Verwendung von Tropenholz. In Deutschland werden<br />
nur etwa 20 Prozent des Papierbedarfs aus heimischem<br />
Holz hergestellt. 80 Prozent werden importiert – entweder als<br />
Zellstoff oder als bereits fertiges Papier. Das regenwaldreiche<br />
Brasilien ist zum größten Ursprungsland für Zellstoff-Importe<br />
geworden. Alternative Fasern können aber nicht nur Ersatz<br />
sein, sondern haben auch Vorteile: Papier aus Silphie-<br />
Aktion:<br />
5 % zusätzlicher Rabatt auf<br />
die ersten 100 Bestellungen<br />
Besuchen Sie unseren Onlineshop<br />
unter: www.biogas1.de<br />
Spurenelementmischungen<br />
Für NaWaRo- und Kofermentanlagen<br />
Flüssig, auf Säure-Basis<br />
ab 8,30€/Kg<br />
Flüssig, auf EDTA-Basis<br />
ab 9,90€/Kg<br />
• Hohe biologische Verfügbarkeit<br />
• Geringe Aufwandmenge<br />
• TRGS Konform<br />
Dosierung: 1 kg/Tag pro 500 kWh elek. Leistung<br />
Gebinde: Kanister á 25 kg, Fass á 200 kg, IBC á 1100 kg<br />
Lieferzeit: 2-4 Werktage (Expressversand möglich)<br />
Individual-Mischungen auf Anfrage möglich.<br />
Eisenhydroxid „EH-Iron-Pro“<br />
• Nicht Wassergefährdend, Kein Gefahrstoff<br />
• DüMV Konform<br />
• Eisengehalt von 45-50 % in der Trockensubstanz<br />
1 x Palette = 785,-€ / Tonne<br />
2 x Paletten = 775,-€ / Tonne<br />
3 x Paletten = 755,-€ / Tonne<br />
4 x Paletten = 745,-€ / Tonne<br />
6 x Paletten = 725,-€ / Tonne<br />
12 x Paletten = 685,-€ / Tonne<br />
Dosierung: 5 kg/Tag pro 100 kWh elek. Leistung<br />
Verpackung: Fermentierbare Säcke, Palette á 1000 kg<br />
Lieferzeit: 2-4 Werktage (Expressversand möglich)<br />
Wir sind Mitglied im Fachverband<br />
Telefon: 05641 7769790<br />
Email: bestellung@biogas1.de<br />
59
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Von der Silphie-Pflanze zur nachhaltigen Verpackungslösung<br />
Silphie-Ernte in der<br />
Nähe von Hahnennest.<br />
Quelle: www.out-nature.de<br />
fasern verspricht bei der Fasererzeugung einen viel geringeren<br />
Bedarf an Wasser und Energie im Vergleich zu<br />
Holzzellstoff sowie den vollständigen Verzicht auf Chemikalien.<br />
Die Silphiefasern werden in der Papierfabrik<br />
Holzzellstoff-Fasern beigemischt. „Ein Silphieanteil von<br />
50 Prozent funktioniert bisher ganz gut“, sagt Michail<br />
Ginsburg, der in der Schwarz-Gruppe für die Entwicklung<br />
von Silphie-Verpackungsmaterial zuständig ist. Ein wichtiges<br />
Kriterium sei die Reißfestigkeit des Papiers. Falls<br />
sich der 50-Prozent-Anteil langfristig bewähre, hält er bis<br />
zu 70 Prozent Silphiefasern für möglich. Bei Grasfasern<br />
hätten dagegen die Erfahrungen gezeigt, dass sie wegen<br />
ihres hohen Fremdstoffgehaltes, vor allem an Lignin und<br />
Protein, auf maximal 30 Prozent beschränkt seien.<br />
Benedikt Hülsenmann von der Uni Hohenheim entnimmt Proben des Silphie-Ernteguts.<br />
Mit ihm ist Marzieh Eslami, am Thema interessierte Studentin der Umweltwissenschaften<br />
an der Universität Cottbus, gekommen.<br />
Packaging mit Silphiefasern<br />
Otto Normalverbraucher denkt bei Papier zuerst an<br />
Schreib- oder Zeitungspapier, doch der Löwenanteil<br />
der deutschen Papierproduktion entfällt längst auf Verpackungspapiere<br />
und -kartonagen (siehe Kasten). Der<br />
Bedarf an Schreib- und Druckpapieren ist wegen der<br />
Digitalisierung stark rückläufig. Am Packaging Campus<br />
Lenningen erforschen und entwickeln Experten für<br />
Verpackungstechnik und -design marktgerechte Verpackungssysteme,<br />
insbesondere auf Basis nachwachsender<br />
Rohstoffe. Der Campus ist Teil des Steinbeis-Transferzentrums,<br />
eines renommierten Unternehmens für den Wissens-<br />
und Technologietransfer in die Wirtschaft, das hier<br />
mit der Hochschule der Medien Stuttgart kooperiert. Er<br />
befindet sich in direkter Nachbarschaft zu Silphie Paper.<br />
So wie die Schwarz-Gruppe Recycling- und Aufbereitungstechnologien<br />
auch für andere Unternehmen anbietet,<br />
tritt sie auch beim Silphie-Verpackungsmaterial als<br />
60
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
praxis / Titel<br />
Im Vordergrund<br />
das Einsilieren von<br />
Silphie-Erntegut, im<br />
Hintergrund die Faseraufbereitungsanlage.<br />
Der Entstipper spleißt die Fasern auf. Das heißt,<br />
er vereinzelt Faserbündel durch ein Rührwerk.<br />
Liegender Schnellkochtopf: Für die Steam-Explosion werden<br />
pro Batchdurchgang 500 Kilogramm Material behandelt. <br />
Container mit dem Reaktor der Steam-Explosion. Oberhalb<br />
sind der Vorlage- sowie der Entspannungsbehälter zu<br />
sehen sowie hinten der Schnecken austrag.<br />
Hersteller für andere Lebensmittelerzeuger<br />
auf. Die Schwarz-Tochter OutNature<br />
GmbH bietet bereits Silphie-Produkte an:<br />
Silphiefasern selbst als loses Rohmaterial,<br />
Papier und auch fertig konfektioniertes<br />
Verpackungsmaterial aus Silphiepapier,<br />
wie Schalen oder Faltschachteln. Für das<br />
Vorhaben, aus Silphiefasern nachhaltige<br />
Verpackungen herzustellen, wurde Out-<br />
Nature mit dem diesjährigen Deutschen<br />
Verpackungspreis in der Kategorie „Neues<br />
Material“ ausgezeichnet.<br />
Simon Rauch glaubt an die große Chance<br />
der Silphie als Faserrohstoff – schon<br />
allein wegen des riesigen Potenzials, das<br />
der Markt für die Papierproduktion biete:<br />
Weltweit würden 180 Mio. t Faserstoffe<br />
zu Papier verarbeitet. Deutschland sei ein<br />
Netto-Importeur, der jedes Jahr rund 4 Mio.<br />
t Fasern einführe. „Die Entwicklung der Faseraufbereitung<br />
ist für uns ein Post-EEG-<br />
Geschäftsmodell“, sagt der Energiepark-<br />
Geschäftsführer. Technologie und Logistik<br />
sollten entwickelt werden, um vielen Biogasanlagen<br />
eine neue Chance zu eröffnen.<br />
Wichtig ist ihm dabei, mit den Silphiefasern<br />
bei Preis und Qualität mit Holzzellstoff<br />
mithalten zu können. Auch wenn noch<br />
keine belastbaren Zahlen zu Effizienz und<br />
Wirtschaftlichkeit vorliegen, ist sich Rauch<br />
sicher: „Die Zeichen stehen auf Grün.“<br />
Weitere Infos:<br />
www.energiepark-hahnennest.de<br />
www.reset-plastic.com<br />
www.out-nature.de<br />
Autor<br />
Christian Dany<br />
Freier Journalist<br />
Gablonzer Str. 21 · 86807 Buchloe<br />
0 82 41/911 403 · 01 60/97 900 831<br />
christian.dany@web.de<br />
61
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Technik<br />
und<br />
Innovation<br />
Gasaufbereitung in<br />
Gasströmungsrichtung<br />
von rechts nach links<br />
mit: BioSulfidEx –<br />
Biotrickling Filter zur<br />
biologischen Entschwefelung<br />
von Biogas.<br />
GasCon Gaskühlung<br />
mit Gaswärmetauscher<br />
und Kaltwassersatz.<br />
CarbonEx – Biogasaktivkohlefilter.<br />
BioBF – ein biologischer<br />
Entschwefelungsfilter für Biogas<br />
Biogas enthält je nach Substrat und Jahreszeit unterschiedlich hohe Anteile an Schwefelwasserstoff<br />
(H 2<br />
S). Während der H 2<br />
S-Gehalt im Biogas aus nachwachsenden Rohstoffen<br />
(NawaRo) bei 100 bis 1.500 ppm liegt, treten bei der Verarbeitung biogener Reststoffe<br />
höhere und stärker schwankende Schwefelwasserstoffgehalte von bis zu 5.000 ppm auf.<br />
Von EUR ING Marie-Luise Schaller<br />
Der H 2<br />
S-Gehalt muss vor der Verwertung im<br />
Blockheizkraftwerk (BHKW) oder bei der<br />
Aufbereitung zu Biomethan nahezu vollständig<br />
entfernt werden, denn er führt zu<br />
Beschädigungen an technischen Anlagen<br />
und zu immissionsschutzrechtlichen Problemen beim<br />
Einsatz von Oxidationskatalysatoren zur Einhaltung von<br />
niedrigen Formaldehyd-Grenzwerten.<br />
Während kleinere landwirtschaftliche NawaRo-Vergärungsanlagen<br />
mit einer in den Fermenter integrierten<br />
biologischen Entschwefelung auskommen können, bei<br />
der mit relativ geringem Aufwand Luft in den Fermenter<br />
eingeblasen wird, müssen größere, Reststoff verwertende<br />
Anlagen externe Verfahrensstufen einsetzen, die die<br />
Betriebsausgaben signifikant erhöhen können.<br />
Die Betreiber der Anlage im Kompostwerk am Standort<br />
des Entsorgungszentrums Großefehn (EZG), die<br />
Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft GmbH &<br />
Co. KG (MKW), haben sich lange mit Möglichkeiten<br />
beschäftigt, die hohen Kosten für Aktivkohlewechsel<br />
und Eisenadditive zu optimieren. Neben einer Anlage<br />
zur Kompostierung und zur biologischen Behandlung<br />
von Restabfall wird dort seit 2010 auch eine Vergärungsstufe<br />
für getrennt gesammelte Bioabfälle aus<br />
dem Landkreis Aurich betrieben.<br />
In einem Pfropfenstromfermenter mit 1.300 Kubikmeter<br />
(m³) Füllvolumen werden aus jährlich bis zu 20.000<br />
Tonnen Bioabfall zwischen 2 und 2,5 Millionen (Mio.)<br />
Normkubikmeter (Nm³) Biogas produziert. Der mittlere<br />
Biogasvolumenstrom liegt bei 250 Nm³ pro Stunde.<br />
Die Schwefelwasserstoffgehalte im Biogas schwanken<br />
jahreszeitlich bedingt zwischen 200 und 800 ppm.<br />
Mehrstufige Biogasaufbereitung<br />
Das Biogas wird in zwei Blockheizkraftwerken (BHKW)<br />
mit einer elektrischen Gesamtleistung von 590 Kilowatt<br />
sowie in der thermischen Abluftbehandlungsanlage der<br />
mechanisch-biologischen Restabfallbehandlungsanlage<br />
am Standort verwertet. Davor ist eine mehrstufige<br />
Biogasaufbereitung integriert, die aus biologischer<br />
Schwefelwasserstoff-Elimination, Gaswaschkühlung<br />
zur Ammoniakabtrennung sowie Aktivkohleadsorption<br />
zur vollständigen Abscheidung der restlichen Schadstoffe<br />
besteht. Unter extremen Verhältnissen betrugen<br />
die Standzeiten der Aktivkohlefilter weniger als einen<br />
Monat.<br />
Dr.-Ing. Andreas Maile, STRABAG UMWELTTECHNIK<br />
GmbH, dem Komplettanbieter von umwelttechnischen<br />
Anlagen, war als Projektleiter der Abteilung Forschung<br />
und Entwicklung mit den Problemen befasst und ging<br />
Foto: Züblin Umwelttechnik GmbH<br />
62
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Claus Bogenrieder von der ZÜBLIN Umwelttechnik GmbH.<br />
auf seinen Kollegen, Claus Bogenrieder,<br />
Züblin Umwelttechnik GmbH, zu, der ein<br />
innovatives und kostengünstiges Konzept<br />
für diese Problematik „in der Schublade“<br />
hatte: den Filter zur biologischen Schwefelwasserstoffreduktion,<br />
kurz ZÜBLIN<br />
BioBF genannt.<br />
Dr. Maile war schnell von der Eignung der<br />
Methode überzeugt, und er und Claus Bogenrieder<br />
starteten eine Kooperation, um<br />
im Dezember 2015 einen Prototyp des<br />
BioBF in Großefehn zu errichten. „Daraus<br />
wurde eine richtig gute Erfolgsgeschichte.<br />
Heute muss MKW die Aktivkohle statt 12<br />
bis 16 Mal pro Jahr nur noch alle zwei bis<br />
drei Monate wechseln“, bringt Dr. Maile<br />
den Effekt auf den Punkt. Zudem kann<br />
auf die zuvor erforderliche Zugabe von<br />
Eisenpräparaten komplett verzichtet und<br />
dadurch eine Kostenersparnis von bis zu<br />
20.000 Euro pro Jahr realisiert werden.<br />
ZÜBLIN bietet eine breite Produktpalette<br />
von Anlagen zur industriellen Aufbereitung<br />
an. Verfahren zur Schwefeleliminierung wie<br />
das Biotrickling-Filter-Verfahren sind leistungsfähig,<br />
aber relativ aufwändig und nur<br />
im großmaßstäblichen industriellen Einsatz<br />
rentabel. „Wir haben daher ein neues<br />
Konzept mit einfacheren Betriebsabläufen<br />
entwickelt, die besser in Biogasanlagen zu<br />
integrieren sind“, erläutert Claus Bogenrieder<br />
die grundsätzliche Intention. Gemäß<br />
Produktbeschreibung benötigt der ZÜBLIN<br />
BioBF nahezu keine Betriebsstoffe, ist somit<br />
eine kostengünstige Alternative zu den<br />
gängigen Biowäschersystemen, die als Vorreinigungsstufe<br />
vor dem herkömmlichen<br />
Aktivkohlefilter zum Einsatz kommen.<br />
Aufbau und<br />
Wirkungsweise<br />
Der ZÜBLIN BioBF besteht<br />
aus einem korrosionsbeständigen<br />
und wärmegedämmt<br />
ausgeführten HD-PE-Zylinder<br />
mit einem angeflanschten Deckel<br />
aus HD-PE, der bei einem<br />
Durchmesser von 2 Metern<br />
etwa 3,1 Meter hoch ist. Er ist<br />
somit für die Aufstellung im<br />
Freien konzipiert. Im unteren<br />
Teil des Behälters befindet<br />
sich unter einem aufgeständerten<br />
GFK-Gitterrost der<br />
Gasverteil- und Kondensat-<br />
Sammelraum.<br />
Der Zylinder ist mit stückigem<br />
und speziell konditioniertem<br />
organischen Filtermaterial befüllt, dessen<br />
Zusammensetzung auf dem speziellen<br />
Know-how von ZÜBLIN basiert. Auf dem<br />
Gitterrost ist eine etwa 20 Zentimeter starke<br />
Gasverteilschicht aus gröberem Material<br />
eingebaut. Das Filtermaterialvolumen<br />
beträgt rund 5 m³.<br />
Das Rohbiogas wird unvorbehandelt direkt<br />
aus dem Fermenter in den Sammelraum<br />
eingeleitet und durchströmt das Filtermaterial<br />
von unten nach oben. Der im Biogas<br />
enthaltene Schwefel wird dort abgeschieden<br />
und durch mikrobiologische Prozesse<br />
zu elementarem Schwefel oder Sulfat<br />
umgewandelt. Das im Prozess anfallende<br />
Kondensat wird am Behälterboden gesammelt,<br />
über einen Kondensatabscheider<br />
abgeführt und dann in das Prozesswassersammelsystem<br />
der Vergärungsanlage<br />
abgeleitet.<br />
Der Behälter ist für einen Biogasvolumenstrom<br />
von 250 Nm³ pro Stunde, einen<br />
Gasüberdruck von maximal 200 Millibar<br />
(mbar) und eine Gastemperatur von 50<br />
Grad Celsius ausgelegt. Verbrauchtes Filtermaterial<br />
wird der Gärrest-/Bioabfallmischung<br />
zugemischt und kompostiert, so<br />
dass keine Abfälle zu entsorgen sind.<br />
Wirtschaftlichkeit<br />
Gemäß den auf der Tagung Waste-to-Resources<br />
2019 veröffentlichten Erfahrungswerten<br />
wurden den Substraten bis 2016<br />
vor Eintrag in den Fermenter große Mengen<br />
Eisenhydroxidpulver (FeOH) zur internen<br />
Reduzierung der Schwefelwasserstoffgehalte<br />
im Biogas beigemischt. Im Jahr 2014<br />
wurden rund 21.000 Kilogramm<br />
63<br />
praxis / Titel<br />
Dreifache Standzeit und<br />
einfachste Wartung<br />
xLC® Einheit ergänzt FSIP® Konzept<br />
Die xLC® Stator-Einstelleinheit erhöht<br />
die Pumpenstandzeit auf das Dreifache:<br />
Bei auftretendem Verschleiß im Rotor-<br />
Stator-System wird durch simples Nachjustieren<br />
der Vorspannung zwischen den<br />
Förderelementen die Leistungsfähigkeit<br />
der Pumpe wieder hergestellt.<br />
Wird dann der Service-Eingriff fällig, lässt<br />
sich dieser dank des FSIP® Konzepts schnell<br />
und einfach in der Hälfte der üblichen Zeit<br />
durchführen. So servicefreundlich war der<br />
Betrieb einer Exzenterschneckenpumpe<br />
noch nie.<br />
NEMO® Exzenterschneckenpumpe mit xLC® Einheit<br />
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH<br />
Tel.: +49 8638 63-0<br />
info.nps@netzsch.com<br />
www.netzsch.com
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Roh- und Reinbiogaskonzentration an Schwefelwasserstoff vor und nach<br />
BioBF und Menge an abgeschiedenem Schwefel seit Filtermaterialwechsel<br />
H 2<br />
S-Gehalt [ppm]<br />
Züblin BioBF zur biologischen<br />
Schwefelwasserstoff-Reduktion.<br />
Dr.-Ing. Andreas Maile,<br />
Direktion Umwelttechnik,<br />
Entwicklung und<br />
Innovation, STRABAG<br />
UMWELTTECHNIK<br />
GmbH.<br />
BioBF-kumulierte Schwefelabscheidung<br />
H 2<br />
S v. BioBF H 2<br />
S n. BioBF / v. AK Schwefelabscheidung<br />
kumulierte Schwefelabscheidung [kg S]<br />
und 2015 etwa 22.800 Kilogramm FeOH eingesetzt.<br />
Die Kosten für die Anwendung unterschiedlicher Eisenhydroxidsubstrate<br />
von 2014 bis 2016 beliefen sich<br />
auf insgesamt zirka 48.500 Euro. Im Rahmen einer<br />
ersten wissenschaftlichen Untersuchung zur Wirksamkeit<br />
des neuen biologischen Reinigungsverfahrens<br />
wurden die Eisenhydroxidpräparate 2016 sukzessive<br />
von etwa 90 Kilogramm pro Tag auf 0 Kilogramm pro<br />
Tag zurückgefahren (WESSEL, 2016). Seit September<br />
2016 wird dem Vergärungsprozess in der VGA Großefehn<br />
kein FeOH mehr zugemischt. Die Aufwandmenge<br />
in 2016 lag bis zu diesem Zeitpunkt noch bei 11.900<br />
Kilogramm. Seit September 2016 erfolgt die Biogasvorentschwefelung<br />
bei der VGA Großefehn, vor der abschließenden<br />
adsorptiven Abscheidung an Aktivkohle,<br />
ausschließlich über das ZÜBLIN BioBF.<br />
Das Filtermaterial wird im langjährigen Praxisbetrieb<br />
des BioBF in Großefehn mit einer Standzeit zwischen<br />
7 bis 18 Monaten, je nach Rohgasbeladung, betrieben.<br />
Die Entnahme des Filtermaterials und die Befüllung erfolgt<br />
durch Bagger mit Zweischalengreifer. Die Entnahme<br />
des verbrauchten Filtermaterials und der Einbau des<br />
neuen Materials können von zwei Mitarbeitern innerhalb<br />
von vier bis sechs Stunden erledigt werden. In diesem<br />
Zeitraum wird das Biogas ohne biologische Vorreinigung<br />
über den vorhandenen Aktivkohlefilter gereinigt.<br />
Fazit und Ausblick: Bei hohen Schwefelfrachten im<br />
Biogas sind Standard-Aktivkohlefilter nicht wirtschaftlich<br />
zu betreiben. Hier bietet sich der Einsatz des ZÜB-<br />
LIN BioBF zur Vorreinigung an. Die Erfahrungen aus<br />
dem Betrieb des Prototyps in Großefehn zeigen, dass<br />
auf den Einsatz von Betriebshilfsstoffen zur Schwefelwasserstoffreduktion<br />
(zum Beispiel Eisenhydroxid)<br />
vollständig verzichtet werden kann und sich die Standzeit<br />
der Aktivkohle zur vollständigen Schwefelwasserstoffabscheidung<br />
signifikant erhöht. Damit steigt die<br />
Anlagenverfügbarkeit und sinken die Betriebskosten.<br />
Auf Basis der statistischen Auswertung der Messwerte<br />
des Prototyps in Großefehn können nun entsprechende<br />
Systeme für Anwendungsfälle mit hohen Schwefelfrachten<br />
ausgelegt werden. Die Technologie ist<br />
bereits in mehreren weiteren Anlagen im Einsatz. Die<br />
Einsatzfelder sind landwirtschaftliche Biogasanlagen,<br />
Abfall- und Bioabfallverarbeitungsanlagen aber auch<br />
Kläranlagen, bei denen die Schwefelwasserstoffkonzentration<br />
im Biogas so hoch ist, dass ein Betrieb mit<br />
dem Aktivkohlefilter durch häufigen Wechsel hohe<br />
Kosten verursacht. Die BioBF-Filterbehälter sind in<br />
unterschiedlichen Größen verfügbar, je nach zu behandelnder<br />
Biogasmenge. Das Spektrum reicht von etwa<br />
100 m³ pro Stunde bis etwa 1.000 m³ je Stunde. Die<br />
Behälter können im Bedarfsfalle auch an die jeweilige<br />
Anwendung angepasst werden.<br />
Derzeit untersucht die STRABAG Umwelttechnik GmbH<br />
verfahrenstechnische Möglichkeiten, die Wirkung zu<br />
steigern und die Filtersubstratwahl und -konfektionierung<br />
zu optimieren und analysiert die Zusammenhänge<br />
zwischen Temperatur und Reinigungsleistung. Auch<br />
die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Biogasreinigung<br />
bei mesophilen Vergärungsverfahren ist Gegenstand<br />
aktueller Forschung.<br />
Autorin<br />
EUR ING Marie-Luise Schaller<br />
ML Schaller Consulting<br />
mls@mlschaller.com<br />
www.mlschaller.com<br />
64
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
praxis / Titel<br />
Wir liefern alle<br />
Prozesschemikalien<br />
für Biogasanlagen<br />
Fermenter / Nachgärer<br />
/ Gärrestelager<br />
Entschwefelung: Eisenverbindungen<br />
Entschäumer (biologisch abbaubar)<br />
pH-Stabilisierung:<br />
Säuren und Laugen, fest und flüssig<br />
Zunehmend ermöglicht die Erzeugung und Nutzung von<br />
Biogas eine nachhaltige und bedarfsgerechte Energie. Für<br />
den gesamten Prozess liefern wir die Basischemikalien und<br />
auch alle speziellen Chemieprodukte.<br />
Heiz-/ Kühlkreislauf<br />
Frostschutz<br />
Wärmeträgerflüssigkeiten<br />
Kühlsolen<br />
Gasaufbereitung<br />
Aktivkohle<br />
Schwefelsäure<br />
Fest-/ Flüssigtrennung<br />
Gärreste<br />
Polymere Flockungshilfsmittel<br />
Ihr Ansprechpartner:<br />
Johannes Diehl<br />
Tel.: +49 611 92846-34<br />
Mail: jd@fischer-chemie.de<br />
A.+ E. Fischer-Chemie GmbH & Co. KG<br />
Storchenallee 49 . 65201 Wiesbaden . Tel.: +49 611 92846-01<br />
Fax: +49 611 92846-66 . Mail: info@fischer-chemie.de . Web: www.fischer-chemie.de<br />
65
praxis / Titel<br />
Technik<br />
und<br />
Innovation<br />
Innovatives Verfahren<br />
zum Entfernen<br />
von Stickstoff<br />
In einigen Regionen Deutschlands werden<br />
die Nährstoffüberschüsse in der Landwirtschaft<br />
zum Problem, das sich insbesondere<br />
durch die Düngeverordnung verschärft.<br />
Mehrere Anlagen zur zentralen Aufbereitung<br />
sind in Planung, eine ist im westlichen<br />
Münsterland im Betrieb. Der Wirtschaftsdünger<br />
wird hier auch zur Biogasproduktion<br />
genutzt. Zugleich kommt ein neues Verfahren<br />
zur Ammoniak-Strippung und Hygienisierung<br />
zum Einsatz.<br />
Von Thomas Gaul<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Gülle kann ein wertvoller Dünger sein. Aber<br />
in manchen Regionen Deutschlands gibt<br />
es einfach zu viel davon. Das ist vor allem<br />
dort der Fall, wo die landwirtschaftlichen<br />
Flächen zur Ausbringung knapp<br />
sind. Zugleich steigt der Bedarf an Lagerraum, weil<br />
die Zeitfenster für die Ausbringung kleiner werden. In<br />
diesen Regionen ist es unter anderem sinnvoll, die Gülle<br />
aufzubereiten und zur Biogasproduktion zu nutzen.<br />
Das entstehende Gärprodukt enthält die Nährstoffe in<br />
pflanzenverfügbarer Form und kann gezielt im Ackerbau<br />
eingesetzt werden.<br />
Ein Problem sind die Nährstofffrachten der Gülle. Eine<br />
Neuentwicklung setzt hier an: In einem zweistufigen<br />
Verfahren wird Stickstoff entfernt und eine nachgeschaltete<br />
Ammoniak-Strippung schleust einen großen<br />
Teil des Ammonium-Stickstoffs aus. Dabei wird ein<br />
Ammoniumkonzentrat gewonnen. Zugleich wird das<br />
Gärprodukt hygienisiert. Unter dem Aspekt des Seuchenschutzes<br />
ist das ein wichtiger Faktor.<br />
Anwendung findet das Verfahren an der Großanlage der<br />
NDM Naturdünger in Velen im westlichen Münsterland.<br />
In der Region sind die Nährstoffüberschüsse groß. So<br />
fallen allein im Kreis Borken jährlich über eine Million<br />
Kubikmeter (m³) Gülle an, die bisher über weite Strecken<br />
transportiert werden müssen. Nach langer Vorbereitungszeit<br />
und einigen Startschwierigkeiten konnte<br />
die Anlage 2019 in Betrieb gehen.<br />
Stickstoff und Phosphor gezielt gewinnen<br />
Die Anlage läuft noch nicht unter Volllast. Im Vollbetrieb<br />
sollen jährlich 200.000 m 3 Gülle als Rohstoff<br />
zur Biogasproduktion genutzt werden. Die Nährstoffe<br />
sollen in eine transportwürdige und marktfähige Form<br />
gebracht werden. Das Ziel ist, die bestehenden Nährstoffüberschüsse<br />
insbesondere bei Phosphor (P) und<br />
Stickstoff (N) zu reduzieren.<br />
Das komplexe Aufbereitungsverfahren umfasst mehrere<br />
Schritte: Die Gülle wird zur Anlage geliefert. Die<br />
Gülle wird bereits in den Betrieben mit Schwerkraft vorbehandelt.<br />
So gelangt nur die dicke, abgesetzte Gülle<br />
in die Anlage. Die Dünngülle, die nur wenig Phosphat<br />
und Stickstoff enthält, bleibt auf den Betrieben und<br />
wird in Hofnähe ausgebracht.<br />
Nach der Anlieferung wird die Gülle mit einem Schneckenseparator<br />
in eine dünne und in eine dicke Phase getrennt<br />
und bei unterschiedlichen Verweilzeiten in zwei<br />
Fermentern vergoren. Das entstehende Biogas wird in<br />
zwei Blockheizkraftwerken (BHKW) mit jeweils 1,5 Megawatt<br />
(MW) (bei 100 Prozent Überbauung) installierte<br />
elektrische Leistung verstromt. Die anfallende Wärme<br />
wird teilweise zur Erzeugung von 140 Grad Celsius heißem<br />
Dampf für die Hygienisierung verwendet und dient<br />
als Energiequelle für die weiteren Prozessschritte.<br />
Das Gärprodukt wird anschließend mit Flockungsmitteln<br />
versetzt und wiederum in eine feste und eine flüssige<br />
Phase aufgeteilt. Die flüssige Phase wird mit dem<br />
Fotos: ENVIMAC Engineering<br />
66
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
praxis / Titel<br />
von Prof. Dr. Jerzy Maćkowiak entwickelten neuen Verfahren<br />
der Firma ENVIMAC Engineering GmbH weiter<br />
aufbereitet. Die feste Phase wird zusammen mit den<br />
vergorenen Feststoffen weiter getrocknet. Diese feste<br />
Phase wird nach der Trocknung in großen Drehrohröfen<br />
verbrannt. Die bei der Verbrennung entstehende Wärme<br />
wird zum Trocknen der Feststoffe genutzt. Mit einem<br />
Gehalt von etwa 25 Prozent P 2<br />
O 5<br />
enthält die Asche nahezu<br />
den gesamten Phosphor.<br />
Komplexe Behandlung der flüssigen Phase<br />
In der flüssigen Phase sind überwiegend Stickstoff und<br />
Kali in gelöster Form enthalten. Im ENVIMAC-Verfahren<br />
wird die flüssige Phase zunächst dekarbonisiert, sodass<br />
der pH-Wert steigt. Bei der anschließenden Strippung<br />
wird die Flüssigkeit über Füllkörper verrieselt und<br />
im Gegenstrom Luft zugegeben und das Ammonium<br />
(NH 4<br />
) der Gülle als Ammoniak (NH 3<br />
) ausgetrieben.<br />
Das Ammoniak-Gas reagiert in einer nachgeschalteten<br />
Waschkolonne mit Schwefelsäure und wird zu Ammoniumsulfatlösung<br />
(ASL). Als konzentrierte ASL-Lösung<br />
kann es als Düngemittel in der Landwirtschaft vermarktet<br />
werden. Denkbar wäre auch, Ammoniakwasser zu<br />
produzieren, das zur Rauchgasreinigung in Kraftwerken<br />
eingesetzt werden kann. Es fällt dann eine Kali-<br />
Lösung an, die in einem derzeit noch nicht realisierten<br />
Schritt aufkonzentriert werden soll.<br />
„Es ist zwingend erforderlich, die Stickstofffracht zu<br />
entfernen“, betont Dr.-Ing. Jan Maćkowiak, Projektleiter<br />
von ENVIMAC Engineering. Die Strippung von<br />
Ammonium-Stickstoff findet nur bei hohen pH-Werten<br />
statt. Der pH-Wert des Gärproduktes muss also erhöht<br />
werden. „Üblicherweise wird dazu Lauge, zum Beispiel<br />
Natronlauge, zugegeben“, erläutert Dr. Maćkowiak.<br />
„Diese Laugenzugabe ist der Hauptkostenfaktor bei<br />
der Strippung und führt darüber hinaus zur Aufsalzung<br />
des Gärproduktes. Die Firma ENVIMAC Engineering hat<br />
daher ein Verfahren entwickelt, um diese Laugenzugabe<br />
sehr stark zu reduzieren. Mit unserem Verfahren<br />
können die Kosten erheblich gesenkt werden.“<br />
Dabei findet vor der eigentlichen Strippung eine Vorbehandlung<br />
des Gärproduktes mit der Bezeichnung<br />
Dekarbonisierung in einer weiteren Kolonne statt. Die<br />
Stickstoffentfernung erfolgt nach dem sogenannten<br />
DS-LSSW-Verfahren (siehe Abbildung auf Seite 68) in<br />
drei Stufen. Vor der eigentlichen Stickstoffentfernung<br />
erfolgt eine Abtrennung von Feststoffpartikeln. Dies<br />
dient der Erhöhung der Standzeit der Anlage.<br />
Thermische Dekarbonisierung des<br />
Gärproduktes<br />
In der ersten Stufe der Anlage zur Stickstoffentfernung<br />
(K01) findet die sogenannte thermische Dekarbonisierung<br />
des Gärproduktes statt. In der Stufe K01<br />
wird durch eine spezielle selektive Dampfstrippung<br />
von CO 2<br />
bei etwa 100 Grad Celsius der pH-Wert des<br />
Gärproduktes ohne Chemikalienzugabe erhöht. Damit<br />
kann man rund 70 bis 75 Prozent und mehr der zur<br />
pH-Wertanhebung erforderlichen 50-prozentigen Natronlauge<br />
einsparen und somit erheblich die jährlichen<br />
Betriebskosten reduzieren.<br />
Ein weiterer Aspekt der CO 2<br />
-Entgasung in der Stufe<br />
K01 ist ein Umweltschutzaspekt. Durch Reduzierung<br />
des Verbrauchs an Natronlauge wird gleichzeitig eine<br />
deutliche Reduzierung der Na+-Ionen in dem gereinigten<br />
Prozesswasser erzielt, das nach der Stickstoffelimination<br />
in Kolonne K02 als Kali-Lösung weiterverwendet<br />
wird. Auch Sicherheitsaspekte sprechen für eine<br />
Reduzierung des Natronlauge-Einsatzes, denn<br />
Nach den Fermentern<br />
verbleibt ein Gärprodukt,<br />
der Amonium-<br />
Stickstoff wird im<br />
ENVIMAC-Verfahren<br />
entfernt.<br />
67
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Schema Envimac-Verfahren<br />
Luft + NH 3<br />
Schwefelsäure<br />
Abwasser<br />
mit NH 3<br />
CO 2<br />
K1<br />
Dekarbonisierung<br />
&<br />
Hygienisierung<br />
Dampf<br />
K2<br />
Stripper<br />
K3<br />
Wäscher<br />
38%-ASL<br />
Luft<br />
Abwasser<br />
ohne NH 3<br />
In isolierten Rohrleitungen wird das Gärprodukt durch die Anlage gefördert. Die<br />
eingebrachte Wärme wird zur Vorheizung des Gärproduktes verwendet.<br />
Die Kolonnen K1-K3 des ENVIMAC-Verfahrens sind in einem Gerüst<br />
in Außenaufstellung aufgestellt.<br />
68
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
praxis / Titel<br />
wenn nicht mehr große Mengen der Lauge auf der Anlage<br />
vorgehalten werden müssen, gehen auch weniger<br />
Gefahren davon aus.<br />
Zudem findet in der Dekarbonisierung eine Hygienisierung<br />
des Gärproduktes statt, sodass mögliche Krankheitserreger<br />
sicher entfernt werden. Die Anforderungen<br />
der Hygienisierung wurden durch unabhängige Institute<br />
bestätigt. Das ist insbesondere bei Großanlagen wie<br />
in Velen von Bedeutung, weil hier Güllen aus unterschiedlichen<br />
Herkünften behandelt werden.<br />
Der Heizdampf für die Dekarbonisierung wird aus dem Abgas<br />
der BHKW gewonnen.<br />
Einwandfreie Hygienisierung<br />
Zusätzlich wurden durch das Institut für Nutztierwissenschaften<br />
der Universität Hohenheim in Stuttgart<br />
Laborversuche durchgeführt, die eindeutig belegen,<br />
dass bei den Betriebsbedingungen, also Temperatur,<br />
pH-Wert und Verweilzeit, wie sie in der Dekarbonisierungskolonne<br />
eingehalten werden, alle gemäß Verordnung<br />
EG Nr. 142/2011 geforderten Testkeime sicher<br />
abgetötet werden, im Einzelnen:<br />
ffSalmonella Senfetenberg,<br />
ffEnterococcus faecalis,<br />
ffBovines Parovirus.<br />
Nach der Dekarbonisation und Hygienisierung des Gärproduktes<br />
in der ersten Kolonne K01 erfolgt in<br />
69
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
der zweiten Stufe K02 nach dem weiteren, durch die<br />
Dekarbonisierung im Vergleich zu anderen Verfahren<br />
deutlich reduzierten Alkalisieren des Prozesswassers<br />
mit 50-prozentiger Natronlauge die Überführung der<br />
restlichen NH 4<br />
-Ionen in das molekulare Ammoniak-<br />
NH 3<br />
durch die Gleichgewichtsverschiebung. Somit<br />
wird aus dem Zentrat in der Strippkolonne K02 mittels<br />
Luft im Gegenstrom das Ammoniak entfernt.<br />
Die in Strippkolonne K02 mit NH 3<br />
beladene Luft wird<br />
mittels eines Ventilators in die dritte Waschstufe K03<br />
eingeleitet, in der im Gegenstrom zur aufsteigenden<br />
NH 3<br />
-beladenen Luft die Absorption von NH 3<br />
in die saure<br />
Waschlösung stattfindet. Bei diesem Vorgang wird<br />
Ammoniumsulfatlösung (ASL) hergestellt. In der Stufe<br />
K03 wird die Luft fast vollständig gereinigt und in die<br />
Strippkolonne zurückgeführt.<br />
Der Prozess der NH 3<br />
-Absorption in der Stufe K03 wird<br />
so lange geführt, bis die eingestellte ASL-Konzentration<br />
von etwa 38 Prozent erreicht wird. Dann wird das<br />
gewünschte Produkt 38-prozentige ASL-Lösung in den<br />
Lagertank gepumpt. Durch die spezielle Regelung der<br />
Anlage wird die 38-prozentige ASL-Lösung mit einer<br />
konstanten Konzentration und hoher Qualität erreicht.<br />
Die hohe Produktqualität wird auch durch die Vorbehandlung<br />
in der Dekarbonisierung erreicht.<br />
Rechtsanwälte und Notare<br />
Seit vielen Jahren beraten und vertreten wir vornehmlich<br />
Betreiber und Planer kompetent und umfassend im<br />
- Recht der Erneuerbaren<br />
- Energien<br />
- Vertragsrecht<br />
- Gewährleistungsrecht<br />
- Energiewirtschaftsrecht<br />
- Umweltrecht<br />
- Immissionsschutzrecht<br />
- öffentlichen Baurecht<br />
- Planungsrecht<br />
Kastanienweg 9, D-59555 Lippstadt<br />
Tel.: 02941/97000 Fax: 02941/970050<br />
Hygienisiert wird das Gärprodukt in einer speziellen Füllkörperkolonne.<br />
Die Temperaturen werden stets überwacht.<br />
Ihre Ansprechpartner:<br />
RAuN Franz-Josef Tigges*<br />
RAuN Andreas Schäfermeier**<br />
RA W. Andreas Lahme*<br />
RA Dr. Oliver Frank*<br />
RA Martina Beese<br />
RA Daniel Birkhölzer*<br />
RAuN Katharina Vieweg-Puschmann LL.M.<br />
Maîtrise en droit<br />
* Fachanwalt für Verwaltungsrecht<br />
** Fachanwalt für Insolvenzrecht<br />
kanzlei@engemann-und-partner.de<br />
www.engemann-und-partner.de<br />
Hocheffiziente Hochleistungs-Füllkörper<br />
Der Absorption-Desorption-Prozess findet ohne Emissionen<br />
statt. In allen Stufen K01 bis K03 werden moderne,<br />
hocheffiziente, druckverlustarme Hochleistungsfüllkörper<br />
„ENVIPAC“ und „Mc-Pac“ eingesetzt, die<br />
sehr geringe Druckverluste bei sehr hohen Belastungen<br />
aufweisen und durch die Gitterstruktur nicht zur<br />
schnellen Verblockung durch Verschmutzung neigen.<br />
„Sie haben sich bereits in vielen Anlagen in der Vergangenheit<br />
sehr gut bewährt“, sagt Dr. Maćkowiak. „Der<br />
Einsatz der modernen Füllkörper als Füllung für die<br />
neu geplante Anlage trägt auch zur deutlichen Reduzierung<br />
der Apparategröße und somit zur Reduzierung<br />
der Investitions- und Betriebskosten wegen der extrem<br />
kleinen Druckverluste bei.“<br />
Die Strippanlage ist für eine Reduzierung der Ammonium-Stickstoffbelastung<br />
im Gärprodukt bis zu 99<br />
Prozent geplant. Durch den Einsatz von Frequenzumrichtern<br />
an allen prozessrelevanten Pumpen und am<br />
Ventilator wird ein weiterer Beitrag zur Reduzierung<br />
der Betriebskosten geleistet, da der Stromverbrauch<br />
jeweils der aktuellen zur Anlage zugeführten Menge<br />
angepasst wird.<br />
Konzipiert ist die Anlage für einen Durchsatz von 25<br />
bis 30 Kubikmeter beziehungsweise Tonnen je Stunde,<br />
so Dr. Maćkowiak: „Bei der Leistungsabnahme wurden<br />
dieser Wert sowie alle anderen garantierten Werte und<br />
die Abscheideleistung von der Anlage auch erreicht.“<br />
Die ENVIMAC-Technologie ist ein Verfahren zur Entfernung<br />
und Rückgewinnung von Ammonium-Stickstoff,<br />
unabhängig von der Art des Abwassers. Egal, ob es Gärdünger<br />
ist, kommunales Abwasser oder industrielles<br />
Abwasser. Auch ist sie unabhängig von den Einsatzstoffen<br />
der Biogasanlage, also Mist, NawaRo, Gülle,<br />
Bioabfall etc. Die im ENVIMAC-Verfahren erzielten<br />
Stickstoffkonzentrate können nicht nur landwirtschaftlich<br />
als Dünger genutzt werden. Ein Zukunftsfeld, in<br />
dem momentan geforscht wird, ist die Gewinnung von<br />
Wasserstoff als Energieträger aus Ammoniak. Recyceltes<br />
Ammoniak aus dem Wirtschaftskreislauf gilt dabei<br />
als besonders nachhaltig.<br />
Autor<br />
Thomas Gaul<br />
Freier Journalist<br />
Im Wehrfeld 19a · 30989 Gehrden<br />
01 72/512 71 71<br />
gaul-gehrden@t-online.de<br />
70
Fachbetrieb nach WHG<br />
von der TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG betreut<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
praxis / Titel<br />
Doppelmembrangasspeicher | Emissionsschutzabdeckungen<br />
Gasspeicher | EPDM-Hauben<br />
Leckagefolien<br />
Baur Folien GmbH<br />
Gewerbestraße 6<br />
D-87787 Wolfertschwenden<br />
0 83 34 99 99 1-0<br />
0 83 34 99 99 1-99<br />
info@baur-folien.de<br />
d www.baur-folien.de<br />
Robuste beschichtungssysteme<br />
Wir lassen nichts an Ihren Beton!<br />
www.besatec.eu<br />
I Biogasbehälter<br />
I Fahrsilos<br />
I Güllebecken<br />
I Sanieren<br />
I Beschichten<br />
I WHD-Strahlen<br />
Besatec Holsten GmbH · Am Rübenberg 8 · 38104 Braunschweig · 0531 3557 3630 · info@besatec.eu<br />
WIR LÖSEN & BEWEGEN.<br />
www.suma.de<br />
Unsere Rührwerke<br />
setzen Festes in Bewegung:<br />
erst Ihr Substrat,<br />
dann Ihr Denken über Funktionalität,<br />
Zukunft und Nachhaltigkeit.<br />
71<br />
ARMATEC - FTS<br />
GmbH & Co. KG<br />
Friedrich-List-Strasse 7<br />
D-88353 Kisslegg<br />
+49 (0) 7563 / 909020<br />
+49 (0) 7563 / 90902299<br />
info@armatec-fts.de<br />
www.armatec-fts.com
praxis<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Perspektiven für<br />
neue Generation?<br />
Friedrich Hake und<br />
Sohn Jan-Erick vor<br />
dem Fermenter ihrer<br />
Biogasanlage.<br />
Biogasproduzent Friedrich Hake aus Hameln macht sich schon heute – fünf Jahre vor dem<br />
Ende seiner ersten EEG-Vergütungsperiode – Gedanken, ob er Zukunftschancen mit seiner<br />
Biogasanlage hat oder nicht. Sollte es sich nicht rechnen, legt er die Anlage still. Er wird<br />
damit leider kein Einzelfall sein.<br />
Von Dierk Jensen<br />
Friedrich Hake ist in der niedersächsischen<br />
Biogasszene kein Unbekannter. Er ist schon<br />
in einem frühen Stadium in die Direktvermarktung<br />
eingestiegen. Rund fünf Jahre vor<br />
dem Ende der EEG-Laufzeit macht er sich als<br />
Betreiber schon Gedanken, wie viele andere sicherlich<br />
auch, wie es denn mit der Biogasproduktion langfristig<br />
wirtschaftlich weitergehen kann. Obgleich sein Sohn<br />
motiviert in den Startlöchern steht, sind die Perspektiven<br />
noch nicht klar konturiert. Spätestens in zwei Jahren<br />
wollen die Hakes definitiv entscheiden, ob es für sie<br />
weitergeht oder nicht<br />
Früher, weit vor der Zeit der Biogaserzeugung, gab es<br />
an gleicher Stelle eine Tierkörperverwertungsanlage.<br />
Sie sollte am Stadtrand von Hameln für den Landkreis<br />
Hameln die Entsorgung verendeter Tiere übernehmen.<br />
Allerdings lief die Anlage nie richtig rund. Es stank<br />
oft gewaltig, eine Bürgerinitiative formierte sich und<br />
schließlich ging der private Betreiber in Konkurs. So<br />
standen Gebäude und Hallen leer und das befestigte<br />
Gelände auf kommunaler Fläche der Stadt Hameln lag<br />
über viele Jahre brach: Bis schließlich Landwirt Friedrich<br />
Hake auf das stillgelegte Objekt aufmerksam wurde<br />
und dort im Jahr 2004 mit anderen Mitstreitern eine<br />
von der Biogas Nord konzipierte Biogasanlage mit 500<br />
Kilowatt (kW) elektrischer Leistung baute.<br />
Der umtriebige Hake suchte damals für seinen Ackerbaubetrieb<br />
ein neues wirtschaftliches Standbein. Er<br />
informierte sich im Vorfeld bei den damals wenigen<br />
Biogasanlagenbetreibern in Niedersachsen, unter anderem<br />
auch bei denen aus Soltau, und gründete zusammen<br />
mit zwei weiteren Landwirten und zwei nichtlandwirtschaftlichen<br />
Akteuren die Alternative Energien<br />
Wesertal GmbH & Co. KG. Auf den letzten Drücker, wie<br />
in der damaligen Aufbruchzeit oft, speiste das Betreiber-Quartett<br />
im Zuge des damals gerade eingeführten<br />
NawaRo-Bonus Ende Dezember 2005 erstmals Strom<br />
ins Netz ein.<br />
Im darauffolgenden Jahr baute die Gesellschaft mutig<br />
ein 1 Megawatt leistendes Blockheizkraftwerk hinzu,<br />
das im November an den Start ging. Genau zum richtigen<br />
Zeitpunkt, denn die Getreideernte in Jahr 2006<br />
war wegen hoher Niederschläge und extremer Feuchtigkeitsgehalte<br />
extrem verpilzt, so dass viele Chargen<br />
aus dem Landkreis Hameln in jenem Jahr für den Ernährungs-<br />
und Futterbereich nicht mehr verwendbar<br />
Fotos: Dierk Jensen<br />
72
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
praxis<br />
waren. Stattdessen landete dieses Getreide im Fermenter<br />
der Biogasanlage von Hake & Co. und konnte damit<br />
energetisch sinnvoll verwertet werden.<br />
Anlage negativ flexibilisiert<br />
Sechs Jahre später wurde die Anlage an der Hildesheimer<br />
Straße flexibilisiert. „Und zwar negativ flexibilisiert“,<br />
erklärt der Zwei-Meter-Mann auf der Biogasanlage.<br />
„Wir stiegen in die Direktvermarktung ein.<br />
Während wir vorher immer auf Volllast fuhren, sind wir<br />
ab dann im Durchschnitt auf 700 bis 750 kW Leistung<br />
runtergegangen“. Eine gute Entscheidung, wie der Geschäftsführer<br />
im Beisein seines Sohnes unterstreicht.<br />
„Wir können wirklich nicht klagen, die Direktvermarktung<br />
über die Firma e2m ist bisher durchaus zufriedenstellend<br />
gelaufen“, fügt der 56-Jährige hinzu, „uns<br />
geht es ganz gut“.<br />
Neben der „negativen“ Flexibilisierung und der Direktstromvermarktung<br />
ist der Substratmix ein weiterer<br />
Garant des wirtschaftlichen Erfolgs. So werden die Fermenter<br />
aktuell mit jährlich sowohl rund 8.000 Tonnen<br />
Geflügelmist als auch 5.000 Tonnen Zuckerrüben und<br />
6.500 Tonnen Mais – größtenteils auf eigenen Flächen<br />
der Gesellschafter angebaut – gefüttert. Rund 25 bis<br />
zu 40 Hektar Mais pro Jahr steuert Hake von seinem<br />
50 Hektar großen konventionellen Ackerbaubetrieb zu.<br />
Neben diesem Betrieb bewirtschaftet die Familie noch<br />
„Rund die Hälfte unserer Einnahmen<br />
rühren aus der Energieproduktion“<br />
einen zweiten Ackerbaubetrieb mit rund 150 Hektar,<br />
der nach EU-Biorichtlinien zertifiziert ist und keinerlei<br />
NawaRo für die Vergärung liefert.<br />
Derweil muss sich dieses seltene, eigenwillige agrarbioenergetische<br />
Firmenkonstrukt um die Nachfolge<br />
keine Sorgen machen. Sohn Jan-Erick will den Betrieb<br />
weiterführen – inklusive Biogasproduktion. „Wenn es<br />
sich rechnet, würde ich das auf jeden Fall gerne weitermachen<br />
wollen“, unterstreicht der 21-Jährige, der<br />
Landwirt gelernt hat. Aufgrund von Personalmangel ist<br />
er auf der Biogasanlage zusammen mit drei Teilzeitkräften<br />
gegenwärtig voll eingebunden.<br />
Trotz der hohen Arbeitsanforderungen durch die Biogasanlage<br />
einerseits und den beiden landwirtschaftlichen<br />
Betrieben andererseits macht er den Eindruck,<br />
dass er mit hoher Motivation in den elterlichen Betrieb<br />
eingestiegen ist. Dabei spielt die Biogasanlage für das<br />
Familieneinkommen eine wichtige Rolle, wie Vater und<br />
Sohn zusammen bekräftigen. „Rund die Hälfte unserer<br />
Einnahmen rühren aus der Energieproduktion.“ Und<br />
das, obwohl die Nutzung der jährlich erzeugten 1,4 Millionen<br />
Kilowattstunden Wärme an ihrem Standort noch<br />
nicht mal optimal läuft.<br />
Friedrich Hake<br />
Biogas-<br />
Ertragsschadenversicherung<br />
–<br />
Sichern Sie Ihre<br />
Existenz.<br />
Unsere Leistungen:<br />
• Absicherung behördlicher Maßnahmen<br />
aufgrund anzeigepflichtiger Tierseuchen,<br />
wie z. B. Afrikanische Schweinepest<br />
• Flexible Wahl der Haftzeit<br />
• Individuelle Modelle und optionale Übernahme<br />
der Entsorgungs- und Hygienisierungskosten<br />
• Entschädigung der tatsächlich entstandenen<br />
Deckungsbeitragsverluste<br />
Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne.<br />
www.mmagrar.de<br />
73
praxis<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Die Abwärme der<br />
Biogasanlage der<br />
Familie Hake wird unter<br />
anderem zur Trocknung<br />
von Ackerbohnen<br />
genutzt.<br />
So wollte Hake in der Vergangenheit seine Wärme in ein<br />
benachbartes Gewerbegebiet abgeben, doch habe man<br />
preislich nie gegen die Abwärme der nicht weit entfernt<br />
liegenden Müllverbrennungsanlage konkurrieren können.<br />
Auch die im Jahr 2014 schon weit fortgeschrittenen<br />
Planungen, ein Satelliten-BHKW auf dem Produktionsgelände<br />
eines Holzbrikett-Herstellers zu errichten,<br />
scheiterten jäh, weil dieser Pleite ging.<br />
Ein weiterer Versuch, die anfallende Wärme langfristig<br />
besser zu nutzen, war der Erwerb einer Bandtrocknung,<br />
die im Jahr 2008 in Betrieb ging. Doch stellte<br />
sich schnell heraus, dass eine Gärrestetrocknung wenig<br />
Sinn machte, weil die flüssigen Gärreste wegen der<br />
kurzen Fahrstrecken zu den arrondierten Ackerflächen<br />
eigentlich gar kein Problem darstellten. Aus dieser Erkenntnis<br />
heraus wurde dann der Bandtrockner schnell<br />
umdisponiert und trocknet heute Späne und Holzhackschnitzel.<br />
Die übrige Wärme wird optional auch für die<br />
Container-Trocknung von Getreide oder Hülsenfrüchten<br />
genutzt, beispielsweise die in diesem Jahr sehr feucht<br />
geernteten Bio-Ackerbohnen.<br />
„Bei der positiven Flexibilisierung ist mir<br />
das Risiko der Investition einfach zu groß“<br />
Friedrich Hake<br />
Künftige CO 2<br />
-Bepreisung wirft Fragen auf<br />
Es läuft mit ausgeprägtem Improvisationsgeist und<br />
hohem Arbeitseinsatz. Dennoch sind die Perspektiven<br />
für Biogas nach der EEG-Zeit Ende 2025 noch nicht<br />
eindeutig für Hake absehbar. „Für mich ist nach wie<br />
vor noch nicht klar zu erkennen, wie sich die Anfang<br />
2021 in Kraft tretende CO 2<br />
-Bepreisung auf die Energiemärkte<br />
auswirken wird. Derzeit kann ich es daher<br />
betriebswirtschaftlich noch gar nicht einkalkulieren“,<br />
wirft Hake ein, der dem erweiterten Vorstand des Landesverbandes<br />
Erneuerbare Energien Niedersachsen/<br />
Bremen e.V. (LEE) angehört und sich dort für die Belange<br />
der Biogasbranche auf politischer Ebene engagiert.<br />
Nach einem langen Sommer der Unsicherheiten sieht<br />
Hake nun aber im jetzt vorliegenden Entwurf der EEG-<br />
Novelle eine Zukunftschance für seinen Betrieb. „Wenn<br />
es bei den ausgelobten 18,4 Cent pro Kilowattstunde<br />
bei kommenden Ausschreibungsrunden und es bei einer<br />
Bemessungsgrenze von 45 Prozent der installierten<br />
Leistung bliebe, dann können wir damit leben“, hält<br />
Hake auch nach 2025 einen Weiterbetrieb für möglich.<br />
Dass dies so sein würde, stand noch vor einigen Wochen<br />
auf der Kippe.<br />
Die Chancen für einen Weiterbetrieb schätzten Vater<br />
und Sohn Anfang September vor Mais- und Rübenernte<br />
auf gerade einmal Fifty-fifty ein. Trotz der pragmatischen<br />
Skepsis ließ der Hofnachfolger aber keinen Zweifel<br />
daran, dass er das Feld nicht einfach kampflos abgeben<br />
würde. „Wenn das Ganze betriebswirtschaftlich<br />
irgendwie gestaltbar bleibt, dann machen wir weiter“,<br />
entgegnete er entschlossen. Auch über eine Biogas-<br />
Tankstelle, die dann den Fuhrpark des landwirtschaftlichen<br />
Logistikunternehmens eines Mitgesellschafters<br />
mit Kraftstoff komplett versorgen könnte, wurde in der<br />
Vergangenheit schon mehrmals nachgedacht.<br />
Dagegen war eine „positive“ Flexibilisierung der<br />
1,5-MW-Anlage nie eine wirklich realistische Option,<br />
wie Friedrich Hake einwirft, „da ist mir das Risiko der<br />
Investition einfach zu groß.“ Dabei kommt den Hakes<br />
in den kommenden Ausschreibungsrunden sicherlich<br />
zugute, dass sie seit vielen Jahren ihre Anlage im „negativen“<br />
Flexibilisierungsmodus laufen ließen. Die Hakes<br />
müssten also bei einem Zuschlag über rund 750<br />
kW in den nächsten Jahren keine großen Zusatzinvestitionen<br />
tätigen. Sie könnten mit den bestehenden Aggregaten<br />
und dem besagten Substratmix weitere zehn<br />
Jahre arbeiten.<br />
Wenngleich der zeitliche Übergang vom bisherigen<br />
EEG-Tarif zum neuen Ausschreibungstarif noch nicht<br />
ganz genau definiert ist, würde Hake nach seinem<br />
Sachstand von Anfang Oktober <strong>2020</strong> weitermachen<br />
wollen und können. Unabhängig davon hält er es<br />
aber für unbedingt notwendig, dass die bisher strikte<br />
Trennung von NawaRo- und Abfallanlagen aus den zurückliegenden<br />
EEGs überwunden werden müsste, um<br />
vor allem die Reststoffe aus Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion<br />
besser als bisher verwerten zu<br />
können. Beispielsweise ließen sich dann Rübenabfälle<br />
von umliegenden Zuckerfabriken auch in seine Biogasanlage<br />
fahren. „Das würde doch Sinn machen“, meint<br />
Hake.<br />
Autor<br />
Dierk Jensen<br />
Freier Journalist<br />
Bundestr. 76 · 20144 Hamburg<br />
040/40 18 68 89<br />
dierk.jensen@gmx.de<br />
www.dierkjensen.de<br />
74
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
praxis<br />
Biogas, was sonst.<br />
Wir planen und bauen Biogas-Anlagen für alle Einsatzstoffe<br />
• Herstellerunabhängige Anlagenerweiterung und -umbau<br />
• Wir beraten und unterstützen bei der Teilnahme an der Ausschreibung<br />
• Neues zur EEG Reform 2021, fragen sie einfach nach!<br />
• 25 Jahre Erfahrung<br />
Biogas-Aufbereitungsanlagen<br />
• Biogas zur Tankstelle oder in das Erdgasnetz<br />
Monovergärung von Geflügelmist<br />
• Verfahren (patentiert)<br />
www.aev-energy.de<br />
AEV Energy GmbH®<br />
Hohendölzschener Str. 1a<br />
01187 Dresden<br />
+49 (0) 351 / 467 1301<br />
info@aev-energy.de<br />
AEV Energy GmbH ® – Büro Regensburg<br />
Gutweinstraße 5<br />
93059 Regensburg<br />
+49 (0) 941 / 897 9670<br />
info@aev-energy.de<br />
„Mit uns immer auf der<br />
Überholspur! Schnelle und<br />
effektive Schwefelbindung<br />
mit MethaTec® Detox S Direct.“<br />
Franz-Jakob Feilcke,<br />
Einer der Macher.<br />
TerraVis GmbH<br />
Industrieweg 110<br />
48155 Münster<br />
Tel.: 0251.682 - 2055<br />
info@terravis-biogas.de<br />
www.terravis-biogas.de<br />
FELD<br />
SILO<br />
FERMENTER<br />
ENERGIE
praxis<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Versicherungen in der Landwirtschaft<br />
Modernes Risikomanagement<br />
in der Landwirtschaft: Wie<br />
umgehen mit neuen Risiken?<br />
Die Hagelversicherung reicht aus oder eine Tierseuchenversicherung<br />
rechnet sich nicht – Grundsätze wie diese gelten nicht<br />
mehr in der Landwirtschaft. Gesetzliche Vorgaben und der<br />
fortschreitende Klimawandel ändern die Rahmenbedingungen<br />
und der Landwirt tut gut daran, das eigene Risikomanagement<br />
zu überdenken.<br />
Von Hans-Gerd Behrens<br />
Die Münchener & Magdeburger Agrar AG bietet eine Ertragsausfallversicherung,<br />
mit der sich Ertragsschäden aus der Betriebsunterbrechung beziehungsweise<br />
der Unterbrechung von Kundenbetrieben absichern. Zusätzlich zum Ertragsausfall<br />
kommen eventuell noch Kosten für die Entsorgung und Hygienisierung<br />
hinzu. Dafür gibt es ein Zusatzpaket.<br />
Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist<br />
in Deutschland angekommen.“ Auf diese<br />
Schlagzeile hat Deutschland gewartet, im<br />
September <strong>2020</strong> wurde das erste infizierte<br />
Wildschwein in Brandenburg entdeckt.<br />
Sofort haben die zuständigen Behörden die angekündigten<br />
Sperren errichtet, fieberhaft läuft seitdem die<br />
Suche nach weiteren infizierten Tieren, um die Verbreitung<br />
der Tierseuche zu verhindern. Die deutschen<br />
Schweinehalter haben sich vorbereitet, das sieht auch<br />
Petra Bauke, die bei der Münchener & Magdeburger<br />
Agrar AG als Vorstand für die Bereiche Versicherungsbetrieb<br />
und Schaden zuständig ist: „Wir haben in den<br />
vergangenen Monaten eine deutlich stärkere Nachfrage<br />
nach Ertragsschadenversicherungen für Schweine gesehen.<br />
Der Respekt vor der ASP ist groß, unsere Kunden<br />
sind sich des Risikos bewusst.“<br />
Viele Schweine haltende Betriebe haben sich für die<br />
Ertragsschadenversicherung entschieden und können<br />
sich jetzt auf ihre Versicherung verlassen. Nicht jedem<br />
ist aber bewusst, dass die Tierseuche außerdem auch<br />
Einfluss auf Betreiber von Biogasanlagen hat. Warum<br />
sollten Besitzer von Biogasanlagen die Nachrichten zur<br />
Afrikanischen Schweinepest genau verfolgen? Sobald<br />
der Erreger der Afrikanischen Schweinepest nachgewiesen<br />
wird, errichtet die zuständige Behörde Restriktionsgebiete<br />
mit einem Radius bis zu 15 Kilometer.<br />
Innerhalb dieser Zonen kann es beispielsweise verboten<br />
sein, Biomasse oder Gärsubstrate zu transportieren<br />
(direkte Betroffenheit). Biogasanlagen können nicht<br />
wie gewohnt befüllt werden, schlimmstenfalls fällt die<br />
Produktion aus.<br />
Eine indirekte Betroffenheit (Rückwirkungsschäden)<br />
liegt vor, wenn die vertraglich verbundenen Lieferanten<br />
eines Biogasanlagenbetreibers infolge einer Sperre<br />
durch eine anzeigepflichtige Tierseuche keine Biomasse<br />
oder Gülle etc. mehr liefern können. Mehrmonatige<br />
staatlich angeordnete Sperren können die Existenz von<br />
Biogasanlagen bedrohen und auch noch den Wegfall<br />
des wertvollen Güllebonus kosten.<br />
Die Münchener & Magdeburger Agrar AG bietet eine Ertragsausfallversicherung,<br />
die auf die Bedürfnisse eines<br />
Anlagenbetreibers zugeschnitten ist. Damit lassen sich<br />
Ertragsschäden aus der Betriebsunterbrechung beziehungsweise<br />
der Unterbrechung von Kundenbetrieben<br />
absichern. Zusätzlich zum Ertragsausfall kommen<br />
eventuell noch Kosten für die Entsorgung und Hygienisierung<br />
hinzu. Dafür gibt es bei der Münchener & Magdeburger<br />
Agrar AG ein Zusatzpaket. Hier können auf<br />
Nachweis und je nach gewählter Höchstentschädigung<br />
bis zu 50 Euro pro Kubikmeter von der Versicherung<br />
übernommen werden.<br />
Die Tierseuche ist auch auf dem Acker<br />
angekommen<br />
Um die Seuche möglichst schnell einzudämmen, wurde<br />
das Tiergesundheitsgesetz angepasst. Demnach ist<br />
es verboten, innerhalb des Restriktionsgebiets landwirtschaftliche<br />
Flächen zu bearbeiten oder abzuernten.<br />
Ackerbauern dürfen also nicht düngen, bewässern,<br />
pflügen oder ernten. Jeder Landwirt weiß, was das für<br />
eine Katastrophe für den Betrieb sein kann.<br />
Die Münchener & Magdeburger Agrar AG hat als erster<br />
Anbieter auf dem deutschen Markt mit der Versicherung<br />
gegen Ernteverbot eine pauschale Versicherung<br />
entwickelt, die pro Sperrtag leistet und für unterschiedlich<br />
lange Zeiträume abgeschlossen werden kann. Unabhängig<br />
von staatlichen Entschädigungen sichern<br />
Kunden so den entgangenen Gewinn ab. Ein wichtiger<br />
Schritt für Ackerbauern, um die Existenz zu sichern.<br />
Leider aber nicht das einzige Risiko, dessen sie sich<br />
bewusst sein müssen.<br />
Fotos: www.landpixel.eu<br />
76
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
praxis<br />
Wir sorgen für sauberes Gas!<br />
Wir bieten mit der Donau Bellamethan Produktfamilie eine umfassende Lösung zur Grobentschwefelung an. Zusätzlich wird<br />
der Ammoniakgehalt verringert und die enthaltenen Spurenelemente gewährleisten eine Grundversorgung der Biologie.<br />
Donau Bellamethan – ein Qualitätsprodukt!<br />
» Verlässliche H 2<br />
S-Entfernung direkt im Substrat<br />
» freigegeben für den ökologischen Landbau,<br />
Eigenherstellung<br />
» langjährige Erfahrung und weitläufige Verbreitung<br />
» Geringe Einsatzmengen durch hochwertiges<br />
Eisen-II-chlorid mit 2,5 mol/kg Wirksubstanz<br />
» Lieferung auch in einzelnen IBC – Container möglich<br />
www.dcwatertech.com<br />
Ihr Donau Chemie Partner:<br />
Biogasberatung Sepp Lausch<br />
Petzenbichl 1<br />
83109 Tattenhausen<br />
Tel. 01 71 / 5 85 93 23<br />
www.biogasberater.com<br />
DC_Inserat_LAUSCH_177x77_RZ.indd 1 29.11.18 15:31<br />
Entschwefeln Sie mit Eisenhydroxid!<br />
®<br />
FerroSorp DG<br />
H2S-Bindung im Fermenter<br />
®<br />
FerroSorp S<br />
Externe Entschwefelung<br />
®<br />
Klinopmin / Yara BPO<br />
(auf Basis von Gesteinsmehl / Calciumnitrat)<br />
Prozessoptimierung<br />
Frühkaufrabatt 50 €/ha*<br />
*bei Bestellung bis zum 31.12.<strong>2020</strong><br />
● Greeningkultur<br />
● Beste Befahrbarkeit der Flächen<br />
● Ideal für Bienen und andere Insekten<br />
● Ideal für erosionsgefährdete Steillagen<br />
● Ideal für Flächen am Waldrand<br />
(Wildschweinproblematik)<br />
● Klimaschutz:<br />
durch CO 2 -Speicherung<br />
noch höhere<br />
Deckungsbeiträge<br />
Tel: 07552/35 992 30<br />
oder Homepage:<br />
www.donau-silphie.de<br />
Gut versichert im<br />
Ernteertragsausfall<br />
Sichern Sie Ihre Ernte gegen Hagel-, Sturm-,<br />
Starkregen-, Frost- oder Trockenheitsschäden ab.<br />
Umfangreiche und detaillierte Beratung zu Ihrer<br />
Ernteertragsausfallversicherung erhalten Sie von<br />
unseren spezialisierten AGRAR–Mitarbeitern.<br />
Wir sind Ihr Ansprechpartner und stehen<br />
im Schadenfall auf Ihrer Seite!<br />
Oesterle GmbH<br />
www.oesterlegmbh.de<br />
Wilhelmstr. 1 I 88299 Leutkirch I T 0 75 61 / 988 73-0 I F 0 75 61 / 988 73-20 I M service@oesterlegmbh.de<br />
77
praxis<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Die Spezialisten<br />
der Münchener &<br />
Magdeburger Agrar<br />
entwickelten die<br />
pauschale Trockenheitsversicherung.<br />
Eiskalt überrascht – wie der Frost <strong>2020</strong><br />
Wein, Getreide und Mais traf<br />
Mai <strong>2020</strong>, ein Weinberg in Franken: Unser Schadenschätzer<br />
begeht gemeinsam mit dem Kunden den<br />
Weinberg, bleibt stehen und fährt mit der Hand über<br />
die knospenden Reben: „Alles erfroren.“ Recht viel<br />
mehr gibt es nicht zu sagen in diesem Frühjahr. „Wir<br />
hatten schon Frostjahre, aber nur selten ein solches.“<br />
Im Jahr <strong>2020</strong> schlug der Frost auch<br />
bei Ackerbauern zu, und das ist etwas<br />
wirklich Neues. „Ich hatte Ähren in der<br />
Hand, die nur zu 30 Prozent entwickelt<br />
waren. Davon kann sich der Roggen oder<br />
der Weizen nicht erholen“, so der erfahrene<br />
Schätzer. Zufall? Wohl kaum, denn<br />
mit den milderen Wintern und verfrühten<br />
Vegetationsperioden steigt das Risiko für<br />
Frostschäden enorm, auch in bisher weniger<br />
betroffenen Kulturen.<br />
Leider ist das Bewusstsein dafür noch<br />
zu wenig bei den Landwirten angekommen.<br />
Traditionell sind viele Landwirte<br />
gegen Hagel versichert, in Deutschland<br />
über zwei Drittel aller Betriebe. Nur ein<br />
Bruchteil ist aber gegen die sogenannten<br />
Mehrgefahren versichert – Sturm, Starkregen,<br />
Spätfrost und Trockenheit. Die Erfahrungen der<br />
vergangenen Jahre haben aber eines gezeigt: Nur traditionell<br />
denken hilft nicht. Wo es in der Vergangenheit<br />
genug geregnet hat, haben wir heute langanhaltende<br />
Dürre. Wo es nie zu Spätfrostereignissen kam, sind heute<br />
ganze Landstriche betroffen. Was bedeutet das für<br />
modernes Risikomanagement? Ganz einfach: Weiter<br />
denken als „das haben wir immer schon so gemacht“.<br />
25+ Jahre Erfahrung<br />
200+ Service Mitarbeiter/innen<br />
Ihr Premium Service Partner.<br />
Alles aus einer Hand!<br />
BHKW Service<br />
Anlagen Service<br />
NEU<br />
Gasleckagen &<br />
Elektrothermografie<br />
AKTIONEN, NEUHEITEN & MEHR!<br />
Sie wollen über Angebote und Neuheiten informiert werden? Anmeldung zum Newsletter unter: www.tedom-schnell.de<br />
Unser gesamtes Produktportfolio und unsere Service Dienstleistungen finden Sie auf unserer Webseite.<br />
TEDOM SCHNELL GMBH I D-31637 Rodewald I Tel.: +49 5074 9618-0 I info@tedom-schnell.de I www.tedom-schnell.de<br />
78
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
praxis<br />
Trockenheit – lange „unversicherbar“, heute<br />
Teil der Mehrgefahrenversicherung<br />
Landwirtschaftsversicherer beobachten deshalb das<br />
Wettergeschehen genau und analysieren, welche Gefahren<br />
für welche Gegenden die Risiken der Zukunft<br />
sind. Gut nachvollziehen ließ sich das an der Trockenheitsversicherung.<br />
Noch vor ein paar Jahren hatte kaum<br />
ein Versicherer die Absicherung gegen Trockenheit im<br />
Angebot. Die Gründe: Schwer versicherbar, vor allem<br />
aber kaum relevant für die Landwirtschaft.<br />
Die steigenden Temperaturen und lange ausbleibender<br />
Regen über mehrere Wochen hinweg brachten das Umdenken.<br />
Die Experten entwickelten unterschiedliche<br />
Modelle und Versicherungen, um das schwer umzusetzende<br />
Risiko abzusichern. Schwer deshalb, weil es<br />
sich um ein sogenanntes Kumulrisiko handelt. Im Gegensatz<br />
zu Hagelereignissen tritt Trockenheit regionsübergreifend<br />
auf und löst dementsprechend viel höhere<br />
Schäden aus als andere Katastrophen.<br />
Hinzu kommt, dass ein Trockenheitsschaden nur<br />
schwer zu regulieren ist, weil an der Pflanze selbst<br />
kaum unterscheidbar ist, was Dürre angerichtet hat<br />
oder beispielsweise eine falsche Düngung. Die Folge<br />
wären extrem teure Beiträge, die kaum ein Landwirt zu<br />
zahlen bereit wäre. Die Spezialisten der Münchener &<br />
Magdeburger Agrar entwickelten deshalb die pauschale<br />
Trockenheitsversicherung. Der Clou: Es ist keine<br />
Schadenbegutachtung nötig, denn die Versicherung<br />
greift, wenn vorab definierte Niederschlagsmengen unterschritten<br />
wurden. Heißt: Hat es zu wenig geregnet,<br />
erhält der Landwirt die Zahlung – schnell und unkompliziert.<br />
Für 2021 werden Upgrades und Premiumprodukte<br />
auf den Markt kommen.<br />
Wie also umgehen mit diesen modernen Risiken? Versicherungen<br />
entwickeln sich weiter, genau wie der<br />
landwirtschaftliche Betrieb. Wichtig ist, sich die Zeit<br />
zu nehmen, um über bestehende und möglicherweise<br />
notwendige Versicherungen nachzudenken und Informationen<br />
zum Vergleich einzuholen. Mit einem modernen,<br />
angepassten Risikomanagement lassen sich auch<br />
die aktuellen Risiken absichern, um die Existenz der<br />
Betriebe dauerhaft zu garantieren.<br />
Autor<br />
Hans-Gerd Behrens<br />
Erster Repräsentant/Agricultural Adviser<br />
Münchener & Magdeburger Agrar AG<br />
Hauptstraße 25 · 26209 Kirchhatten<br />
0 42 22/947 47 44<br />
hg.behrens@mmagrar.de<br />
PlurryMaxx, der Nasszerkleinerer<br />
Ihre Vorteile<br />
Wenig störungsanfällig<br />
• keine Gegenschneide<br />
• der Gärprozess läuft besser ab<br />
• der PlurryMaxx kann keine Unterbrechung der<br />
Anlagenfunktion verursachen<br />
• sehr variable Einsatzmöglichkeit<br />
• äußerst robust gegen Störstoffe<br />
40%<br />
Zuschuss vom<br />
Staat!<br />
PlurryMaxx:<br />
Vergleichsweise<br />
das allerbeste<br />
Gerät!<br />
Mehrertrag durch Kavitation<br />
• Oberflächenvergrößerung des organischen Material<br />
• weniger Eigenstromverbrauch der gesamte Biogasanlage<br />
Erhöhte Substrateffizienz<br />
• ein größerer Einsatz von Reststoffen aus der<br />
Landwirtschaft wird möglich<br />
• ermöglicht den verstärkten Einsatz von Mist, Stroh<br />
und Ganzpflanzensilage (GPS) als Faulsubstrate<br />
Erhöhter Ertrag, niedrigere Kosten.<br />
Vlijtstraat 9 - 7005 BN, Doetinchem | The Netherlands | +31 (0)314 369 225 | info@wopereisrvs.nl | wopereis.nl<br />
79
praxis<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Projekt ZertGas – Halbzeitbericht<br />
Mit der Verabschiedung der RED im Jahr 2009<br />
hat die EU Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe<br />
eingeführt. In der Konsequenz haben sich<br />
in der Praxis verschiedene Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme<br />
etabliert. Die Fortführung<br />
der Richtlinie (RED II) für den Zeitraum 2021<br />
bis 2030 sieht die Ausweitung der Nachhaltigkeitszertifizierung<br />
auf den Strom- und Wärmebereich<br />
ab einer Anlagengröße von 2 Megawatt<br />
Feuerungs wärmeleistung vor.<br />
Von Dr. Stefan Rauh<br />
Gemeinsam mit dem Deutschen<br />
Biomasseforschungszentrum<br />
(DBFZ) bearbeitet der Fachverband<br />
Biogas e.V. (FvB) seit<br />
September 2019 das Projekt<br />
ZertGas, um anhand einer Testzertifizierung<br />
mögliche Hemmnisse und Handlungsbedarfe<br />
für Biogas- beziehungsweise<br />
Biomethananlagen zu identifizieren. Diese<br />
Testzertifizierung, gemeinsam mit den theoretischen<br />
Vorarbeiten, erlaubt eine Bewertung<br />
des zukünftigen Zertifizierungsprozesses<br />
und einen Abgleich von vorhandenen<br />
Standardwerten und real erreichbaren<br />
Werten bei der Treibhaus-Bilanzierung für<br />
die ausgewählten Anlagen. Abschließend<br />
werden Handlungsempfehlungen herausgearbeitet<br />
und wird das vorhandene Optimierungspotenzial<br />
für die Treibhausgas-<br />
Vermeidung aus der Produktion von Biogas<br />
und Biomethan beschrieben.<br />
Im Winter 2019/<strong>2020</strong> wurde im ersten<br />
Arbeitspaket durch das DBFZ die Anzahl<br />
der Biogas- und Biomethananlagen im<br />
Bestand ermittelt, für die Nachhaltigkeitsanforderungen<br />
inklusive der Mindestanforderungen<br />
zur Treibhausgas-Vermeidung<br />
anhand der Vorgaben der RED II gelten. Je<br />
nach Umsetzung der RED II in nationales<br />
Recht sind zwischen 1.000 und 4.000<br />
der gut 9.000 Bestandsanlagen mehr oder<br />
weniger stark von einer neuen Nachhaltigkeitszertifizierung<br />
betroffen. Im ersten<br />
Arbeitspaket wurde zudem ein Methodenentwurf<br />
für die Nachhaltigkeitszertifizierung<br />
für Biogas- und Biomethananlagen<br />
erstellt.<br />
Parallel dazu wurden im Arbeitspaket 2<br />
durch den FvB für die Testzertifizierung wesentliche<br />
Anlagenparameter festgelegt und<br />
zehn geeignete Anlagen ausgewählt. Dazu<br />
wurde ein Fragebogen an die Mitglieder<br />
verschickt, in dem folgende Anlagenparameter<br />
abgefragt wurden:<br />
ffInbetriebnahmejahr,<br />
ffRohgasverwertung (Vor-Ort-KWK,<br />
Aufbereitung etc.),<br />
ffBiomethanverwertung (KWK, Kraftstoff,<br />
Therme),<br />
ffSatelliten-BHKW (ja/nein),<br />
ffAnlagengröße (inst. Leistung, Bemessungsleistung,<br />
Aufbereitungskapazität),<br />
ffUmfang Wärmeverwertung,<br />
ffInputstoffe,<br />
ffGasdichte Lagerbehälter,<br />
ffSonstige Besonderheiten.<br />
Der Rücklauf, der dem Rundschreiben folgte,<br />
war überraschend umfangreich. Insgesamt<br />
gingen 37 Interessensbekundungen<br />
ein. Die Variabilität der Konzepte war erfreulich<br />
hoch:<br />
ffAnlagen aus zehn Bundesländern<br />
vertreten,<br />
ffbreit verteilte Inbetriebnahmedaten,<br />
ffverschiedene Gasnutzungsoptionen<br />
(inkl. Kraftstoffnutzungen),<br />
ffAnlagengröße von 150 kW bis hin<br />
zu mehreren MW,<br />
ffAnlagen auf der Basis verschiedenster<br />
Substratkombinationen.<br />
Bei der Vorauswahl der Anlagen durch das<br />
Projektteam des FvB im Juni wurden die<br />
Anlagenparameter priorisiert. Die höchste<br />
Priorität erhielt der Substratmix, da dieser<br />
nach Erkenntnissen aus Arbeitspaket<br />
1 einen sehr hohen Einfluss auf die Höhe<br />
der THG-Einsparung hat, aber auch die<br />
Komplexität der Berechnung beeinflusst.<br />
Im ersten Schritt wurden die Anlagen nach<br />
folgenden Substratgruppen gegliedert<br />
ff100 % Abfälle,<br />
ffAbfälle und Gülle/Mist,<br />
ff100 % Gülle/Mist,<br />
ff100 % NawaRo,<br />
ffNawaRo und Gülle.<br />
Aktuell erfolgt nun die Umsetzung des theoretischen<br />
Methodenentwurfs in ein Berechnungstool<br />
auf Excel-Basis. Danach soll<br />
gemeinsam mit dem Betreiber auf den ausgewählten<br />
Praxisanlagen die Treibhausgasbilanz<br />
berechnet werden. Erste Ergebnisse<br />
und Erkenntnisse der Testzertifizierungen<br />
werden für den Winter erwartet. Die Projektlaufzeit<br />
endet im August 2021.<br />
Autor<br />
Dr. Stefan Rauh<br />
Geschäftsführer<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 · 85356 Freising<br />
0 81 61/98 46 60<br />
info@biogas.org<br />
Foto: www.landpixel.eu<br />
80
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
praxis<br />
Ist Ihr System noch fit?<br />
Gemeinschaftlich. Vorausdenkend.<br />
Engagiert.<br />
»Mit Hochdruck für unser Klima.«<br />
(unbekannt)<br />
BioBG Heizungsbau steht<br />
für innovative und<br />
effiziente Technik!<br />
Beratung // Anlagenanalyse //<br />
Aufstellungsplanung //<br />
HKS 07K<br />
Umsetzung<br />
= 0<br />
//<br />
60<br />
Servicekonzepte<br />
100 0 CMYK<br />
und Wartung aus einer Hand...<br />
Webers Flach 1 ∙ 26655 Ocholt ∙ 04409 666720 ∙ info@biobg.de ∙ www.biobg.de<br />
Kontakt<br />
Christian Falke<br />
Salomonstr. 19, 04103 Leipzig<br />
Telefon: 0341/978566-0<br />
Fax: 0341/978566-99<br />
E-Mail: kontakt@prometheus-recht.de<br />
www.prometheus-recht.de<br />
ATEX Ventilatoren<br />
für Biogas Zone 1 und2<br />
(Kat.II2G und II3G)<br />
• sicher<br />
• zuverlässig<br />
• unkompliziert<br />
• wirtschaftlich<br />
Meidinger AG Landstrasse 71<br />
4303 Kaiseraugst / Schweiz Tel. +41 61 487 44 11 info@meidinger.ch www.meidinger.ch<br />
Die Gutachtergemeinschaft Biogas ist ein<br />
Team selbstständiger Experten verschiedenster<br />
Fachrichtungen, das Sie umfassend<br />
und kompetent zu allen Fragen rund<br />
um Biogasanlagen beraten und unterstützen<br />
kann.<br />
Gutachter<br />
Gemeinschaft<br />
Biogas<br />
Gutachtergemeinschaft Biogas GmbH<br />
Lantbertstr. 50 . 85356 Freising<br />
Tel +49 / 8161/ 88 49 546<br />
E-Mail info@gg-biogas.de<br />
www.gg-biogas.de<br />
Zweigniederlassung Lübeck:<br />
Ovendorferstr. 35 . 23570 Lübeck<br />
Tel +49 / 4502 / 7779 05<br />
Sachverständigenbüros<br />
auch in Krefeld, Burscheid (Köln) und Lüneburg<br />
Wertgutachten (Ertrags-, Zeit- und Verkehrswert)<br />
Erneuerungsgutachten zur EEG-Laufzeitverlängerung<br />
Schadensgutachten (Technik, Bau, Biologie)<br />
Bescheinigungen von Umweltgutachtern<br />
Gutachten zu Investitionsentscheidungen<br />
81
praxis<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Anlage des Monats September<br />
Die Milcherzeugergenossenschaft<br />
Klötze eG aus Sachsen-<br />
Anhalt gehört zu den Pionieren<br />
der Branche. Bereits 2001 ist<br />
die in den landwirtschaftlichen<br />
Betrieb integrierte NawaRo-Anlage ans<br />
Netz gegangen.<br />
Aus 90 Prozent Gülle sowie 10 Prozent<br />
Mais und Anwelksilage entstehen in den<br />
vier Blockheizkraftwerken mit einer Gesamtleistung<br />
von 480 Kilowatt (kW) flexibel<br />
und klimafreundlich rund 4,1 Millionen<br />
Kilowattstunden Strom im Jahr, die<br />
ab 2021 in die Direktvermarktung gehen.<br />
Die Wärme wird im Sozialtrakt, im Stall<br />
und der Werkstatt verwendet. Insgesamt<br />
vermeidet die Biogasanlage rund 1.290<br />
Tonnen CO 2<br />
pro Jahr.<br />
Anlage des Monats Oktober<br />
Im südlichen Niedersachsen steht<br />
die Duderstädter BIO-Energieanlage<br />
GmbH & Co.KG. Bei der Planung der<br />
2008 in Betrieb genommenen Nawa-<br />
Ro-Anlage stand das Wärmekonzept<br />
im Mittelpunkt. Der Großteil der in den<br />
beiden Blockheizkraftwerken entstehenden<br />
Abwärme wird in einem Krankenhaus<br />
genutzt.<br />
Außerdem versorgt die Anlage eine Gärtnerei,<br />
vier Wohnhäuser und ein Stallgebäude.<br />
Die erzeugte Strommenge deckt den Bedarf<br />
von 1.600 Haushalten. Die mit Mais, Zuckerrüben,<br />
Ganzpflanzensilage und Hähnchenmist<br />
gefütterte Biogasanlage vermeidet<br />
pro Jahr etwa 8.000 Tonnen CO 2<br />
.<br />
82
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
praxis<br />
Rund, groβ und befüllbar<br />
Marktführer in der Herstellung und Montage von Stahlbeton-<br />
Fertigteilbehältern für die Biogas Industie.<br />
Hohe Qualität - Vorgefertigte Elemente<br />
in kontrollierter Umgebung<br />
Robuste Stahlbetonelemente - Auch in<br />
Erdreich eingebundene Varianten möglich<br />
Flexible Produktpalette - Durchmesser<br />
bis 70 m und Wandhöhe bis 14 m<br />
Optimierte Baumethode - Sichere und<br />
schnelle Vor-Ort-Montage<br />
Kurze Bauzeiten - Kalkulierbare und<br />
schnelle Realisierung<br />
Kostengünstig - Ausgelegt für eine<br />
Lebensdauer von 50 Jahren<br />
Biogas<br />
Infotage 2021<br />
A-CONSULT GmbH<br />
Werner-Von-Siemens-Str. 8 • D-24837 Schleswig<br />
Tel. 04621 855094 0 • Fax: 04621 855094 20<br />
info@aconsult.de • www.aconsult.de<br />
Messe<br />
Service rund um den Gasmotor<br />
Service vor Ort • Fachwerkstatt • Vertrieb Gasmotoren<br />
Tagung<br />
Der BHKW-Spezialist<br />
für Motoren mit<br />
Erd-, Bio- und<br />
Sondergasbetrieb<br />
Speller Str. 12 • 49832 Beesten<br />
Tel.: 05905 945 82-0 • Fax: -11<br />
E-Mail: info@eps-bhkw.de<br />
Internet: www.eps-bhkw.de<br />
Praxis<br />
Wissenschaft<br />
Innovation<br />
Neumodule für den<br />
Flexbetrieb<br />
von 75 - 3.000 kWel. im<br />
Container, Betonhaube oder als<br />
Gebäudeeinbindung<br />
Stützpunkte: Beesten • Rostock • Wilhelmshaven • Magdeburg<br />
Mittwoch & Donnerstag<br />
13. + 14. Januar 2021<br />
Messe Ulm 10 - 17 Uhr<br />
83<br />
www.renergie-allgaeu.de
praxis<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Alle Zuschüsse zum Nährstoffmanagement<br />
auf einen Blick<br />
In der vergangenen Ausgabe hatten wir darüber berichtet, wie der<br />
Bund und die Länder Landwirte finanziell bei der Einhaltung der neuen<br />
Düngeverordnung unterstützen. Schließlich erfordert diese neben<br />
einer Erweiterung der Güllelagerkapazität häufig auch Investitionen in<br />
Technik zur Separierung und zur emissionsarmen Ausbringung. Bei der<br />
Darstellung der Förderprogramme konnten aus Platzgründen nicht alle<br />
der doch recht unterschiedlichen Einzelmaßnahmen der Länder beschrieben<br />
werden. Darum hier ergänzend eine kompakte Darstellung.<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
ändern sich die Rahmenbedingungen in<br />
diesem Förderbereich umfassend, da über<br />
die sogenannte „Bauernmilliarde“ zusätzliche<br />
Mittel zur Verfügung stehen. Ein Bundesprogramm<br />
hierfür ist in Planung.<br />
So ist wohl angedacht, die Förderung der<br />
Ausbringungstechnik und abgedeckter<br />
Lager für flüssige Wirtschaftsdünger, die<br />
losgelöst von Stallbaumaßnahmen im Rahmen<br />
der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung<br />
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes<br />
(GAK) erfolgen, für die Jahre<br />
2021 bis 2024 über die Landwirtschaftliche<br />
Rentenbank mit einem Zuschuss von<br />
40 Prozent sowie wahlweise günstigen<br />
Rentenbankdarlehen für die restliche Finanzierung<br />
anzubieten.<br />
Die Übersicht bietet einen Vergleich<br />
zu den länderspezifischen<br />
Zuschüssen für Investitionen<br />
der Agrarbetriebe in die<br />
Verbesserung des Nährstoffmanagements.<br />
Sie verdeutlicht, welche<br />
Fördermaßnahmen gegenwärtig über die<br />
Programme der Flächenländer angeboten<br />
werden und in welchem Umfang Zuwendungen<br />
erfolgen. Ab dem kommenden Jahr<br />
Autor<br />
Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Freier Journalist<br />
info@rudolph-reportagen.de<br />
Neubau von abgedeckten<br />
Lagern für flüssigen WD an<br />
bestehenden Stallanlagen<br />
Neubau von abgedeckten<br />
Lagern für festen WD an<br />
bestehenden Stallanlagen<br />
Errichtung abgedeckter<br />
Lager im Zusammenhang mit<br />
Stallneubau<br />
Errichtung abgedeckter Lager im<br />
Zusammenhang mit der Erweiterung<br />
der Tierbestände<br />
Länder Programm Höhe Programm Höhe Programm Höhe Programm Höhe<br />
Bayern X X AFP<br />
abhängig von der<br />
Hauptmaßnahme 3)<br />
AFP<br />
abhängig von der<br />
Hauptmaßnahme 3)<br />
AFP<br />
(wenn Teil einer<br />
Baumaßnahme)<br />
abhängig von der<br />
Hauptmaßnahme 3)<br />
Niedersachen<br />
AFP<br />
20 %<br />
IVN 1) 35 %<br />
AFP<br />
20 %<br />
IVN 1) 35 %<br />
AFP 20 % AFP 20 %<br />
Baden-Württemberg AFP 40 % 9) AFP 20 % AFP 20 % 9) 10) 9) 10)<br />
AFP 20 %<br />
Nordrhein-Westfalen AFP 40 % AFP 40 % AFP<br />
Basis: 20 %<br />
Premium: 40 %<br />
AFP 40 %<br />
Brandenburg X X AFP 20 % AFP 40 % AFP 40 %<br />
Mecklenburg-Vorpommern AFP 40 % AFP 20 % AFP<br />
40 % für flüssigen WD<br />
20 % für festen WD<br />
AFP<br />
40 % für flüssigen WD<br />
20 % für festen WD<br />
Hessen AFP 40 % AFP 20 % AFP/ELER<br />
40 % für flüssigen WD<br />
20 % für festen WD<br />
AFP/ELER 40 %<br />
Sachsen-Anhalt AFP 20 % 9) AFP 20 % 10) AFP 20 % 9) 10) 9) 10)<br />
AFP 20 %<br />
Rheinland-Pfalz AFP 40 % 11) AFP 20 % AFP 20 % 10) AFP 20 % 10)<br />
Sachsen<br />
ELER<br />
40 %<br />
(plus 5 % in benacht.<br />
Gebieten) 2)<br />
ELER<br />
40 %<br />
(plus 5 % in benacht.<br />
Gebieten) 2)<br />
ELER<br />
40 %<br />
(plus 5 % in benacht.<br />
Gebieten) 2)<br />
ELER<br />
40 %<br />
(plus 5 % in benacht.<br />
Gebieten)<br />
Thüringen AFP 20 % 9) 10) AFP 20 % 10) AFP 20 % 9) 10) 9) 10)<br />
AFP 20 %<br />
Schleswig-Holstein AFP 40 % AFP 20 % AFP 40 %<br />
AFP<br />
(bis 12 Monate<br />
Lagerkapazität)<br />
40 %<br />
Saarland AFP 40 % AFP 20 % AFP 20 % AFP<br />
Basis: 20 %<br />
Premium: 40 %<br />
84
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
praxis<br />
1)<br />
Landesförderung von Investitionen landwirtschaftlicher Betriebe zur Verbesserung des<br />
Nährstoffeinsatzes (IVN).<br />
2)<br />
Sachsen unterscheidet bei der Fördervergabe nicht zwischen abgedeckten und unabgedeckten<br />
Lagerbehältern.<br />
3)<br />
Die Kosten für das Stallbauvorhaben müssen höher sein als die Investition für die Güllelager.<br />
4)<br />
Nur für WD aus dem eigenen Unternehmen. Nicht für Gärreste und mobile Anlagen.<br />
5)<br />
Reduzierung auf 20 %, wenn die betriebliche Mindestlagerkapazität nach Durchführung der<br />
Investition nicht mindestens 2 Monate über den betriebsindividuellen ordnungsrechtlichen<br />
Standard hinausgeht.<br />
6)<br />
Vergängliches Material nicht förderfähig.<br />
7)<br />
Nur in Kombination mit dem Kauf neuer Ausbringtechnik gem. GAK-Anlage 3.<br />
8)<br />
Förderung der Diversifizierung von Tätigkeiten im landwirtschaftlichen und landwirtschaftsnahen<br />
Bereich (EU „De-minimis“-Verordnung in Kombination mit GAK und Landesrichtlinie)<br />
vgl. www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/laendlicherraum/investition/diversifizierung.htm.<br />
9)<br />
Eine Förderung mit 40 Prozent ist möglich, wenn die Lager über eine feste Abdeckung und über<br />
eine Mindestlagerkapazität verfügen, die zwei Monate über die betriebsindividuellen ordnungsrechtlichen<br />
Vorgaben hinausgeht.<br />
10)<br />
Bei Investitionen in Stallbauten, bei denen die Investitionen zur Erfüllung der Premiumförderung<br />
überwiegen, kann der Fördersatz von 40 Prozent auf die Investitionen zur Lagerung von festen und<br />
flüssigen Wirtschaftsdüngern übertragen werden.<br />
11)<br />
Wenn es durch die Investition zu einer deutlichen Minderung von Emissionen bei der Lagerung<br />
von flüssigen Wirtschaftsdüngern kommt.<br />
12)<br />
Förderung von Investitionen in Spezialmaschinen und Umweltinvestitionen (FISU) unter Einsatz<br />
von Mitteln aus dem ELER-Entwicklungsprogramm (auch für Lohnunternehmen und Maschinenringe).<br />
Errichtung fester Abdeckungen<br />
auf bestehenden<br />
Behältern<br />
Einbau schwimmender<br />
Abdeckungen für<br />
bestehende Behälter<br />
Anlagen zur Separierung<br />
und Verbesserung der<br />
Transportwürdigkeit von<br />
Gülle und Gärresten<br />
Technik zur umweltgerechten und<br />
nährstoffeffizienten Ausbringung<br />
von Gülle und Gärresten<br />
NIR-Sensoren an Güllefässern<br />
zur Bestimmung der<br />
Inhaltsstoffe<br />
Programm Höhe Programm Höhe Programm Höhe Programm Höhe Programm Höhe<br />
X X X X X X KULAP<br />
Zuschuss für ausgebrachte<br />
Menge pro m 3<br />
BaySL digital<br />
Teil B<br />
(reine Landesmittel)<br />
40 %<br />
AFP<br />
20 %<br />
IVN 1) 35 %<br />
AFP 20 % IVN 1) 35 % AFP 20 % IVN 1) 35 %<br />
AFP 40 % 9) X X AFP 20 % AFP 20 % AFP 20 %<br />
ELER 70 % X X Diversifizierung 7) 20 % ELER<br />
Agrarbetriebe 30 %<br />
Lohnunternehmer 20 %<br />
X<br />
X<br />
X X X X AFP 20 % 4) X X X X<br />
X X X X AFP 20 % AFP 20 % AFP 20 %<br />
AFP 40 % 5) AFP 20 % 6) AFP 20 % 4) AFP 20 % 7) AFP 20 % 7)<br />
AFP 20 % 9) 10) X X X X AFP 20 % AFP 20 %<br />
AFP 40 % 11) X X AFP 20 % FISU 12) 40 % X X<br />
ELER<br />
40 %<br />
(plus 5 % in benacht.<br />
Gebieten)<br />
X<br />
X<br />
ELER<br />
(Nach Prüfung am<br />
Einzelfall)<br />
40 %<br />
GAK<br />
(Sondermittel)<br />
+ ELER<br />
25 % X X<br />
AFP 20 % 9) 10) X X AFP 20 % 10) AFP 20 % AFP 20 % 7)<br />
AFP 40 % AFP 20 % X X AFP 20 % X X<br />
AFP 20 % AFP 20 % AFP 20 %<br />
AFP (nur mit<br />
komplettem Fass)<br />
20 % AFP 20 %<br />
85
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Mischanbau kann den Silomaisanbau<br />
ökologisch verträglicher machen<br />
Hummel in der Blüte<br />
der Kapuzinerkresse im<br />
Maisbestand.<br />
Mit 2,6 Millionen (Mio.) Hektar (ha) wurden 2019 knapp 23 Prozent der deutschen<br />
Ackerfläche mit Mais bestellt. Silomais machte 2,2 Mio. ha aus (DESTATIS – Statistisches<br />
Bundesamt, <strong>2020</strong>). Besonders in Regionen mit einem hohen Anteil an Veredelungsbetrieben<br />
und Biogasanlagen kann es zu einem hohen Anteil an Mais auf den Ackerflächen<br />
und in der Fruchtfolge kommen. Da Maisbestände wenig Nahrung für Blüten besuchende<br />
Insekten bieten, wird derzeit in Baden-Württemberg der Einfluss von blühenden Gemengepartnern<br />
auf die Leistung von Silomais erforscht.<br />
Von Vanessa Schulz<br />
Das Projekt wird im Rahmen des Sonderprogramms<br />
zur Stärkung der biologischen<br />
Vielfalt der baden-württembergischen<br />
Landesregierung gefördert. Forschende<br />
des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums<br />
Augustenberg (LTZ), des Kompetenzzentrums<br />
Ökologischer Landbau Baden-Württemberg (KÖLBW),<br />
der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-<br />
Geislingen (HfWU) sowie des Landwirtschaftlichen<br />
Zentrums Baden-Württemberg (LAZBW) machten sich<br />
zum Ziel, ein leistungsfähiges und zugleich ökologisch<br />
aufwertendes Anbausystem für Mais zu entwickeln.<br />
Mais, der im 16. Jahrhundert aus Südamerika nach<br />
Europa kam, wurde in den Herkunftsregionen in traditioneller<br />
Subsistenzwirtschaft im Mischanbau kultiviert.<br />
Der Mischanbau sicherte den Nahrungsmittelbedarf<br />
einer Familie sowie einen kleinteiligen Handel. Besondere<br />
Verbreitung erlangte die Kombination von Mais,<br />
Stangenbohne und Ölkürbis, die man deshalb umgangssprachlich<br />
auch als die „drei Schwestern“ bezeichnete.<br />
Der Stärkelieferant Mais bot der Bohne eine Rankhilfe,<br />
während die Bohne als Leguminose ihren Stickstoff aus<br />
der Luft fixierte. Der Ölkürbis beschattete mit seinen<br />
großen Blättern den Boden und trug zur Unkrautunterdrückung<br />
bei. Auch für moderne Agrarsysteme kann der<br />
Mischanbau von Interesse sein. Durch zusätzliche Blüten<br />
können Nahrungsquellen für Insekten geschaffen<br />
werden, die in ausgeräumten Agrarlandschaften wenig<br />
Nahrung finden. Allerdings muss die Bewirtschaftung<br />
solcher Mischanbausysteme mit der Betriebstechnik<br />
und der Verwertung vereinbar sein. Daher gilt es, neben<br />
dem positiven Nutzen auch die Bewirtschaftung mit<br />
vorhandener Betriebstechnik im Auge zu behalten.<br />
Legume und nicht-legume Partner<br />
untersucht<br />
Um geeignete Mischungspartner zu finden, wurden Versuche<br />
mit verschiedenen legumen und nicht-legumen<br />
Partnern vorgenommen. Diese Partner wurden zeitgleich<br />
mit dem Mais etabliert und hinsichtlich ihres<br />
Fotos: Schulz/LTZ<br />
86
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Wissenschaft<br />
Anlagenbau<br />
Luzerne im Maisbestand.<br />
Blühaspektes sowie des Trockenmasse-<br />
(TM)-Ertrages und der Eignung als Biogassubstrat<br />
getestet. Gesät wurde der Mais<br />
(KWS Figaro, 8 Körner m 2 ) in Einzelkornsaat<br />
(EKS). Die Mischungspartner wurden<br />
am selben Tag in einem absätzigen Verfahren<br />
mittels Parzellentechnik und einer für<br />
die Reinsaat empfohlenen Aussaatstärke<br />
ausgebracht.<br />
Legume Partner waren Luzerne [Medicago<br />
sativa, 15 Kilogramm (kg) ha], Echter<br />
Steinklee (Melilotus officinalis, 4 kg ha),<br />
Sommerwicke (Vicea sativa, 70 kg ha)<br />
und Stangenbohnen (Phaseolus vulgaris,<br />
4,5 Körner m 2 ). Während Luzerne,<br />
Echter Steinklee und Sommerwicke als<br />
Mischungspartner in der Praxis nicht etabliert<br />
sind, wurden Mais-Stangenbohnen-<br />
Gemenge im Jahr 2019 deutschlandweit<br />
bereits auf 4.000 ha angebaut (Mund,<br />
2019). Dafür ist bereits fertig gemischtes<br />
Mais-Stangenbohnen-Saatgut im Handel<br />
erhältlich. Alternativ steht ein Saatgutmix<br />
mehrerer Stangenbohnen-Sorten als Einzelkomponenten<br />
zur Verfügung, der in Mischung<br />
mit der betriebseigenen Maissorte<br />
ausgesät werden kann. Als nicht-legume<br />
Partner wurden Mini-Kürbisse (Cucurbita<br />
pepo, 1,6 Körner m 2 ) und Kapuzinerkresse<br />
(Tropaeolum majus, 18 Körner m 2 ) getestet.<br />
Mischungspartner müssen<br />
zusätzliches Blühangebot<br />
bereitstellen<br />
Für eine ökologische Aufwertung der Bestände<br />
hinsichtlich der Insektenfreundlichkeit<br />
ist es wichtig, dass die Mischungspartner<br />
ein zusätzliches Blühangebot zur<br />
Verfügung stellen und von den heimischen<br />
Insekten genutzt werden. Daher musste<br />
der Steinklee ausgeschlossen werden,<br />
da er im Mais-Schatten nicht zur Blüte<br />
kommt. Ansonsten boten alle Partner ein<br />
zusätzliches Blühangebot.<br />
Die Sommerwicke kann in der untersuchten<br />
Aussaatstärke ebenfalls nicht empfohlen<br />
werden, da sie im Gemengebestand<br />
eine zu große Konkurrenz darstellt. Zwar<br />
überzeugte sie durch einen frühen Blühbeginn,<br />
doch die Blühphase dauerte nur<br />
knapp zwei Wochen. Zudem sondern Wicken<br />
allelopathische Substanzen über<br />
Wurzeln und absterbendes Pflanzenmaterial<br />
ab, die das Maiswachstum negativ<br />
beeinflussen. Kapuzinerkresse, Stangenbohne,<br />
Luzerne und Mini-Kürbisse sind<br />
potenziell geeignete Mischungspartner<br />
(siehe Tabelle).<br />
Die Kapuzinerkresse ist interessant, da sie<br />
bis zum ersten Frost beziehungsweise bis<br />
zum Umbruch der Maisstoppeln blühte.<br />
Damit schafft sie ein Blühangebot über die<br />
Silomaisernte hinaus. Mit 183 Dezitonnen<br />
(dt) ha lieferte die Mais-Kresse-Kombination<br />
2019 unter konventionellen Bedingungen<br />
TM-Erträge, die sich nicht von der<br />
Kontrolle (Mais ohne Mischungspartner)<br />
unterschieden. Der Biogasertrag von 560<br />
Normliter pro kg organische Trockensubstanz<br />
(Nl/kg oTS) und der Methangehalt von<br />
53,8 Prozent unterschieden sich ebenfalls<br />
nicht von einer reinen Maissilage.<br />
87<br />
Sie möchten nicht länger Energie<br />
und Zeit verschwenden...<br />
Höchste Zeit für<br />
etwas Neues: Huning<br />
Feststoffdosierer<br />
Ein UnTERnEHMEn<br />
DER HUninG GRUPPE<br />
HUNING Anlagenbau GmbH & Co. KG<br />
Wellingholzhausener Str. 6, D-49324 Melle<br />
Tel. +49 (0) 54 22/6 08-2 60<br />
Fax +49 (0) 54 22/6 08-2 63<br />
info@huning-anlagenbau.de<br />
www.huning-anlagenbau.de
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
TM-Erträge (dt ha), TM-Gehalte (%) sowie Biogasertrag (Nl/kg oTS) und Methangehalt (%) unter konventioneller und ökologischer<br />
Bewirtschaftung im Jahr 2019 für den Mischanbau mit Kapuzinerkresse, Stangenbohnen, Luzerne und verschiedenen Mini-Kürbissen<br />
konventionell<br />
ökologisch<br />
TM-Ertrag TM-Gehalt Biogasertrag Methangehalt TM-Ertrag TM-Gehalt Biogasertrag Methangehalt<br />
(dt ha) (%) (Nl/kg oTM) (%) (dt ha) (%) (Nl/kg oTS) (%)<br />
Mais (Kontrolle) 179 32,7 562 53,9 169 34,6 560 53,9<br />
Mais + Kapuzinerkresse 183 32,7 560 53,8 152 34,6 558 54,1<br />
Mais + Stangenbohne 186 29,5 555 53,9 157 33,1 560 54,1<br />
Mais + Luzerne 157 32,0 563 53,6 157 34,1 562 54,1<br />
Mais + Kürbis I 177 32,5 561 53,8 161 34,6 561 54,2<br />
Mais + Kürbis II 176 32,2 561 54,0 168 34,0 559 54,2<br />
Mais + Kürbis III 158 32,1 560 53,8 142 34,9 561 54,0<br />
Stange BGJ 4_2018.pdf 1 08.06.18 12:01<br />
Mais-Stangenbohnen-Gemenge so gut<br />
wie die Kontrollvariante<br />
Auch unter ökologischen Bedingungen lagen der TM-<br />
Ertrag mit 152 dt ha sowie Biogasertrag und Methangehalt<br />
mit 558 Nl/kg oTS und 54,1 Prozent im Bereich<br />
der Kontrolle. Die Stangenbohne blühte erst relativ<br />
spät, teilweise gleichzeitig mit dem Mais. Da die Blüten<br />
der Stangenbohne, anders als bei der Kapuzinerkresse,<br />
oberhalb der Häckslerschnitthöhe liegen, wird dieses<br />
Blühangebot durch die Ernte weitgehend beendet.<br />
Die TM-Erträge des Mais-Stangenbohnen-Gemenges<br />
von 186 dt ha im konventionellen und 157 dt ha im<br />
ökologischen Anbau waren vergleichbar mit denen der<br />
jeweiligen Kontrolle.<br />
Die Biogasausbeuten waren kaum niedriger als bei<br />
reiner Maissilage. Der Methangehalt wurde durch die<br />
Stangenbohnen nicht beeinflusst. Weitere interessante<br />
Mischungspartner können Luzerne und Mini-Kürbisse<br />
sein. Die Luzerne erzielte zwar geringere TM-Erträge als<br />
die Kontrolle, überzeugte aber durch das Blühangebot.<br />
Unter ökologischen Anbaubedingungen konnte sie sich<br />
allerdings aufgrund der mechanischen Unkrautregulierung<br />
nicht gut etablieren. Unterschiede in Biogasertrag<br />
und Methangehalten konnten nicht nachgewiesen<br />
werden.<br />
Beim Mischanbau mit Mini-Kürbissen wurde beobachtet,<br />
dass mit zunehmender Fruchtgröße (Kürbis I 0,2<br />
bis 0,4 kg, Kürbis II 0,1 kg, Kürbis III 2 bis 4 kg) der<br />
TM-Ertrag geringer als bei reiner Maissilage war. Unterschiede<br />
in Biogasertrag und Methangehalt im Vergleich<br />
zu den Kontrollen ließen sich nicht nachweisen. Unabhängig<br />
vom gewählten Mischungspartner lagen die<br />
TM-Gehalte alle in einem silierbaren Bereich.<br />
Herausforderungen<br />
Die Herausforderungen des Mischanbaus betreffen<br />
derzeit Saattechnik und Unkrautkontrolle. Eine systemangepasste<br />
Unkrautkontrolle ist im Mais-Mischanbau<br />
unerlässlich. Für den Mais-Stangenbohnen-Anbau<br />
ist bereits ein praxistaugliches System verfügbar; eine<br />
gemeinsame Aussaat mittels Einzelkornsaat und eine<br />
Pflanzenschutzbehandlung (2 bis 3 Tage nach der<br />
seit<br />
1946<br />
Schallschutz & Lufttechnik für Ihre BHKW-Anlage<br />
Schallschutz und Lufttechnik für Biogas-Anlagen<br />
Schalldämpfer · Schallschutzwände · Maschinen-Kapselungen · Lüftungsbauteile<br />
88<br />
seit<br />
1946<br />
Tel. 02171 7098-0 · Fax 02171 7098-30 · info@stange-laermschutz.de · www.stange-laermschutz.de
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Wissenschaft<br />
Fotos: links: Schulz/LTZ rechts: Stolzenburg/LTZ<br />
Wildbienen in Kürbisblüte unter Mais.<br />
Saat, 2,8 Liter Stomp/ha + 1 Liter Spectrum/ha) sind<br />
möglich. Der Bestand kann alternativ auch gestriegelt<br />
und gehackt werden.<br />
Bei der Verwendung von anderen Mischungspartnern<br />
gibt es mehrere verschiedene Aussaatoptionen. Die<br />
Abbildung auf Seite 86 fasst diese zusammen. Zum<br />
einen kann die Aussaat von Mais und Mischungspartner<br />
zeitgleich als Saatgutmischung erfolgen. Dadurch<br />
befinden sich Mais und Partner in einer Reihe, was<br />
ein Hacken zwischen den Reihen ermöglicht. Bei der<br />
chemischen Unkrautkontrolle müssen die eingesetzten<br />
Herbizide sowohl für Mais als auch für den Mischungspartner<br />
verträglich sein.<br />
Um eine Entmischung des Saatgutes im Säaggregat<br />
zu verhindern, muss die Tausendkornmasse (TKM) des<br />
Partners in etwa der des Maises entsprechen. Dies ist<br />
bei den Mischungspartnern Stangenbohne, Kapuzinerkresse<br />
und einigen Kürbissorten realisierbar.<br />
Bohnenblüte am Mais.<br />
89
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
regulierung ausschließt. Gemein ist diesen<br />
Verfahren, dass lediglich eine Überfahrt<br />
notwendig wird. Dies schont sowohl Boden<br />
als auch den Kraftstoffverbrauch.<br />
Bei einer Aussaat des Mischungspartners<br />
nach dem Abschluss aller Unkrautkontrollmaßnahmen<br />
im Mais können sowohl<br />
mechanische als auch chemische Unkrautregulierungsmaßnahmen<br />
praxisüblich<br />
durchgeführt werden. Die TKM des<br />
Mischungspartners kann sich von der des<br />
Maises unterscheiden. Der Vorteil einer<br />
späteren Aussaat ist, dass der Mais im ersten<br />
Abschnitt seiner Jugendphase keiner<br />
Konkurrenz durch einen Mischungspartner<br />
unterliegt. Durch eine spätere Aussaat<br />
verzögert sich allerdings der Eintritt des<br />
Blühangebots des Mischungspartners, der<br />
für die insektenfreundliche Aufwertung<br />
wichtig ist. Zudem sind zwei Überfahrten<br />
notwendig.<br />
Fazit: Der Anbau von Mais mit Mischungspartnern<br />
kann eine interessante Alternative<br />
gegenüber dem reinen Silomaisanbau sein.<br />
Es lohnt sich, diese zunächst in kleinem<br />
Umfang auf dem Betrieb zu erproben. Bei<br />
der richtigen Wahl der Mischungspartner<br />
entstehen keine Nachteile für den Ertrag<br />
oder die Biogasleistung, während der<br />
Maisbestand ökologisch aufgewertet wird.<br />
Derzeit sind die Kombination von Mais und<br />
Bohne sowie von Mais und Kapuzinerkresse<br />
besonders interessant und erfolgsversprechend.<br />
Mais-Stangenbohnen-<br />
Mischanbau: Beim Blick in<br />
die Maisreihe ist sehr gut zu<br />
sehen, wie die Stangenbohnen<br />
den Mais als Rankhilfe<br />
benutzen.<br />
Mischungspartner mit deutlich kleinerer<br />
TKM (hier: Wicke, Luzerne, Steinklee) können<br />
mittels eines auf der EKS aufgebauten<br />
Sägerätes bei der Maissaat als Band unterhalb<br />
oder direkt neben der Maisreihe ausgebracht<br />
werden.<br />
Herausforderungen bei der zeitlichen und räumlichen Etablierung von Mischungspartnern<br />
im Mais, wenn die Aussaat des Partners gemeinsam mit dem Mais oder<br />
getrennt erfolgen soll<br />
Räumlich<br />
gemeinsam<br />
getrennt<br />
gemeinsam<br />
EKS als Saatgutmischung<br />
– oder –<br />
EKS Mais + Ablage des Partners als Band<br />
unterhalb/direkt neben der Maisreihe<br />
ff<br />
Unkrautkontrolle:<br />
Mechanisch: möglich<br />
Chemisch: Pflanzenschutzmittel muss<br />
für beide Partner verträglich sein<br />
ff<br />
Eine Überfahrt<br />
ff<br />
Bei Saatgutmischung muss TKM des<br />
Partners dem des Maises entsprechen<br />
EKS Mais + Streuung des Partners<br />
ff<br />
Unkrautkontrolle<br />
Mechanisch: nicht mehr möglich, da Partner<br />
auch zwischen den Maisreihen steht<br />
Chemisch: Pflanzenschutzmittel muss für<br />
beide Partner verträglich sein<br />
ff<br />
Eine Überfahrt<br />
ff<br />
TKM des Mischungspartners kann von dem<br />
des Maises unterschiedlich sein<br />
Zeitlich<br />
getrennt<br />
Zu einem späteren Zeitpunkt kann<br />
der Mischungspartner nicht mehr in<br />
die Maisreihe gesät werden<br />
EKS Mais + Ausbringung des Partners nach<br />
Abschluss aller Unkrautkontrollmaßnahmen<br />
ff<br />
Unkrautkontrolle<br />
Mechanisch: möglich<br />
Chemisch: Pflanzenschutzmittel zeitlich<br />
vor der Mischungspartnersaat, daher keine<br />
Verträglichkeitsprobleme<br />
ff<br />
Zwei Überfahrten<br />
ff<br />
TKM des Mischungspartners kann von dem<br />
des Maises unterschiedlich sein<br />
In diesem Fall gelten dieselben Voraussetzungen<br />
für den Pflanzenschutz wie bei<br />
der Verwendung einer Saatgutmischung<br />
(mechanisch und chemisch). Alternativ<br />
kann das Saatgut breit gestreut werden,<br />
was allerdings eine mechanische Unkraut-<br />
Hinweis: Die Literaturquellen sind auf<br />
Anfrage bei der Autorin erhältlich.<br />
Autorin<br />
Vanessa Schulz<br />
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt<br />
Nürtingen-Geislingen<br />
Projekt „Diversifizierung Silomais“<br />
Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg<br />
Außenstelle Rheinstetten-Forchheim<br />
Kutschenweg 20 · 76287 Rheinstetten<br />
07 21/95 18-216<br />
vanessa.schulz@ltz.bwl.de<br />
www.ltz-augustenberg.de<br />
Foto: Weisenburger/ehe. LTZ<br />
90
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Wissenschaft<br />
KRAFTSTOFFE<br />
DER ZUKUNFT<br />
18. Internationaler Fachkongress<br />
für erneuerbare Mobilität<br />
18. – 22. Januar 2021,<br />
täglich 9:00 Uhr – 17:30 Uhr, MEZ<br />
DIGITAL &<br />
INTERNATIONAL<br />
VERNETZT!<br />
• Mehr als 600 Teilnehmer<br />
• 15 verschiedene Fachforen (davon 2 Biomethan-Sessions)<br />
• Mehr als 60 Referenten<br />
• Zahlreiche einzigartige Präsenzmöglichkeiten<br />
Im Januar 2021 werden auch online wieder mehr als 600 internationale Teilnehmer erwartet,<br />
darunter Vertreter aus der Rohstoffproduktion und Logistik, Biokraftstoffproduzenten,<br />
Vertreter der Mineralölwirtschaft, der Fahrzeugtechnologie und Automobilindustrie, der<br />
chemischen Industrie, der Politik, Auditoren und Umweltgutachter, der Zertifzierungssysteme<br />
und aus Wissenschaft und Forschung.<br />
PSM TAUCHRÜHRGERÄT + SERVICEBOX<br />
So macht Repowering noch mehr Sinn !<br />
» Erhebliche Reduzierung der Rührkosten dank PSM*<br />
» Mehr Rührleistung für günstigere Einsatzstoffe<br />
» Einfacher Zugang zur Rührtechnik – jederzeit<br />
» Keine Dachöffnung = minimaler Ertragsausfall<br />
» BMWi / BAFA-Zuschuss** von bis zu 40% möglich<br />
BETEILIGUNGS- UND PRÄSENTATIONSMÖGLICHKEITEN:<br />
Unternehmen und Organisationen, die ihr Engagement im Biokraftstoffsektor und für erneuerbare<br />
Mobilität öffentlichkeitswirksam und zielgruppengenau vermarkten möchten,<br />
können den Fachkongress als Partner unterstützen und sich im Rahmen des Kongresses<br />
präsentieren. Die Präsentation dient der<br />
• Anbahnung von Geschäftskontakten<br />
• Verbesserung der Informationsbasis und<br />
der Akzeptanz eigener Produkte und<br />
Dienstleistungen<br />
• Präsentation der Fortschrittlichkeit und des<br />
technischen Know-hows<br />
• Großen Breitenwirkung vor internationalem<br />
Fachpublikum und in der Fachpresse<br />
• Öffentlichen Wahrnehmung einer führenden<br />
Marktposition im Biokraftstoffbereich<br />
und bei der erneuerbaren Mobilität<br />
• Exklusiven Werbung im Direktmailing durch<br />
Logoabdruck im Kongressprogramm, auf<br />
der Website und online an allen 5<br />
Veranstaltungstagen<br />
www.kraftstoffe-der-zukunft.com<br />
Von Anfang an dabei<br />
Über 200 PSM Umrüstungen<br />
erfolgreich durch das BMWi<br />
gefördert!<br />
Tel.: 02923 - 610940 · www.uts-products.com<br />
* Permanentmagnet-Synchron-Motor ohne Getriebe<br />
** Bundesförderung Energieeffizienz in der Wirtschaft (Modul 4/295)<br />
Wir machen Ihr Biogas CLEAN und COOL!<br />
Individuelle Anlagen von Züblin Umwelttechnik<br />
zur Reinigung und Kühlung von Biogas<br />
• CarbonEx Aktivkohlefilter zur<br />
Feinentschwefelung von Biogas<br />
• GasCon Gaskühlmodul zur<br />
Kühlung von Biogas<br />
• BioSulfidEx zur biologischen<br />
Entschwefelung von Biogas<br />
• BioBF Kostengünstiges System zur<br />
biologischen Vorentschwefelung<br />
NEU!<br />
MAPRO International LOGO.pdf 1 12.11.13 10:21 Züblin Umwelttechnik GmbH, Maulbronner Weg 32, 71706 Markgröningen<br />
Tel. +49 7145 9324-209 • umwelttechnik@zueblin.de • zueblin-umwelttechnik.com<br />
MAPRO ® GASvERdIchTER<br />
volumenströme bis zu 3600 m³/h<br />
und drücke bis zu 3,2 bar g<br />
A Company of<br />
MAPRO ® INTERNATIONAL S.p.A.<br />
www.maproint.com<br />
WARTUNG ZUM FESTPREIS<br />
MAPRO ® Deutschland GmbH<br />
Tiefenbroicher Weg 35/B2 · D-40472 Düsseldorf<br />
Tel.: +49 211 98485400 · Fax: +49 211 98485420<br />
www.maprodeutschland.com · deutschland@maproint.com<br />
91
International<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Netzausbau:<br />
ein Missing Link weniger<br />
Im Drosselraum: Hier<br />
wird der Hochspannungsstrom<br />
auf die<br />
Frequenz von 50 Hertz<br />
gebracht.<br />
Nach vier Jahren Bauzeit und fast 2 Milliarden Euro Kosten ist es nun soweit: Die Stromverbindung<br />
NordLink zwischen Norwegen und Norddeutschland nimmt ihren Betrieb auf.<br />
Ein Meilenstein für eine effizientere Nutzung von Erneuerbaren Energien über Grenzen<br />
hinweg.<br />
Von Dierk Jensen<br />
Nortorf bei Wilster? Wer kennt südlich der<br />
Elbe schon diesen südholsteinischen Ort?<br />
Wohl kaum einer. Und doch wird eben<br />
dieses Nortorf bei Wilster mit seinen weniger<br />
als tausend Einwohnern, wie es der<br />
Übertragungsnetzbetreiber TenneT gerne kolportiert,<br />
„Dreh- und Angelpunkt für die Energiewende“ sein.<br />
Dieses Attribut hat triftige Gründe. Denn hier in der<br />
Landgemeinde westlich der Kleinstadt Wilster steht der<br />
schon von Weitem sichtbare Gebäudeklotz, in dem der<br />
Konverter untergebracht ist, der die durch die Nordsee<br />
verlegte Gleichstromtrasse (NordLink) mit dem deutschen<br />
Stromnetz verbindet.<br />
Und später, wenn das Vorhaben irgendwann fertig sein<br />
wird, soll auch hier nördlich der Elbe das Kabel der<br />
Trasse SüdLink einmal angeschlossen werden, um vom<br />
windreichen Norden die Erneuerbaren Energien in den<br />
Süden der Republik zu transportieren. Letzteres ist<br />
noch Zukunftsmusik, NordLink hingegen schon funktionstüchtige<br />
Gegenwart. Dabei muten die verschiedenen<br />
Räume der klobigen, grün gestrichenen Riesenhalle<br />
des Konverters wie eine Begegnung mit einer<br />
interstellaren Raumstation an.<br />
Senkrechte, spiralförmige Elemente, in denen dicke<br />
Kabel eintauchen, stehen in monochromem Silbergrau<br />
im Raum. „Das ist die Drosselhalle“, erklärt Frank<br />
Wehling, „hier wird der Wechselstrom geglättet, damit<br />
er am Ende eine saubere Frequenz von 50 Hertz<br />
aufweist und dann ins Übertragungsnetz eingespeist<br />
werden kann“. Diesem Bereich vorgelagert ist die sogenannte,<br />
ebenso spacig anmutende Ventilhalle, in<br />
der das eigentliche Umrichten von Gleich- in Wechselstrom<br />
erfolgt.<br />
Konverter braucht selbst auch viel Strom<br />
„Wenn das hier in Betrieb ist, dann muss diese Halle<br />
aktiv gekühlt werden, weil viel Wärme beim Umwandlungsprozess<br />
abgegeben wird“, erklärt der 40-jährige<br />
Elektrotechnik-Ingenieur stehend vor den über dem<br />
Boden aufgehängten meterlangen silbernen Ventilen.<br />
In diesen Ventilen stecke das Allerneueste einer Technologie,<br />
die Experten „VSC-HVDC“ abkürzen: Hochspannungsgleichstromübertragung<br />
in selbstgeführten<br />
Stromrichtern. Kleine Notiz am Rande: Auch das Umrichten<br />
von Strom braucht selbst Energie: Der Bedarf<br />
in Nortorf liegt bei rund 1 MW installierter Leistung.<br />
Fotos: Dierk Jensen<br />
92
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
International<br />
Im Ventilraum: Ein Mitarbeiter von TenneT steht<br />
vor einer Spindel, in der Gleichstrom in Wechselstrom<br />
umgewandelt wird.<br />
Ventilatorenpakete der Klimaanlage, die die sogenannte Ventilhalle kühlen,<br />
weil viel Wärme beim Umwandlungsprozess abgegeben wird.<br />
Wehling hat das Engineering der deutschen Seite des<br />
vom schwedisch-schweizerischen Technikkonzern ABB<br />
hergestellten Konverters seitens des zukünftigen Betreibers<br />
TenneT seit 2016 verantwortlich gemanagt.<br />
Der Konverter wandelt den Strom vom Nordlink-Kabel<br />
in Wechselstrom um, das sich von Norwegen bis Nortorf<br />
mit einer Gesamtlänge von 623 Kilometern erstreckt.<br />
Auf der Leitung liegt eine Spannung von 525 Kilovolt<br />
(kV) an. Wehling betrachtet den Bau gänzlich aus europäischer<br />
Perspektive, „es ist ein wichtiges Teil hin zu<br />
einer europäischen Vernetzung“.<br />
Obschon nun die Installationsarbeiten in Nortorf vollendet<br />
sind und Wehling vielleicht genau deshalb einen<br />
relativ entspannten Eindruck hinterlässt, war es für ihn<br />
in den vergangenen vier Jahren sicherlich nicht immer<br />
eine leichte Aufgabe, das Riesenprojekt immer auf<br />
Kurs zu halten. Unter anderem waren auch die Gründungsarbeiten<br />
im schwierigen Marschboden mit dem<br />
Einsatz von fast 20 Meter langen Pfählen kein technischer<br />
Spaziergang.<br />
Zudem galt es, in Spitzenzeiten über 100 Arbeiter, die<br />
auf einer Fläche von 3,5 Hektar am „Dreh- und Angelpunkt<br />
der Energiewende“ baggerten, bauten, schraubten<br />
und montierten, effizient zu koordinieren. Dabei<br />
ist die imposante Konverter-Station in der südholsteinischen<br />
Marsch letztlich auch nur eine Komponente<br />
eines Gesamtvorhabens, das am Ende ein Budget von<br />
fast 2 Milliarden Euro verschlungen hat. Realisiert hat<br />
es ein norwegisch-deutsches Konsortium, an dem zu<br />
jeweils 50 Prozent der norwegische Übertragungsnetzbetreiber<br />
Statnett sowie die DC Nordseekabel GmbH<br />
& Co.KG beteiligt sind. An der DC Nordseekabel, die<br />
den Bau und die Genehmigungen auf deutscher Seite<br />
verantwortete, halten TenneT und die Kreditanstalt für<br />
Wiederaufbau (KfW) jeweils 50 Prozent der Geschäftsanteile.<br />
Probebetrieb im Dezember<br />
Während Wehling nach getaner Arbeit westlich von<br />
Wilster peu à peu ins nächste Projekt von TenneT,<br />
nämlich BorWin 5, einsteigt, laufen gegenwärtig die<br />
Systemtests für NordLink an. „Es sieht ganz gut aus“,<br />
verrät der Technische Vorstand von TenneT, Tim Meyerjürgens,<br />
über den derzeitigen Check des „komplexen<br />
Systems“. Ab Dezember soll der Probebetrieb starten,<br />
mit Beginn des neuen Jahres sei die Konverter-Station<br />
dann voll in Betrieb, so Meyerjürgens.<br />
Offizielle Einweihung<br />
soll dann – hoffentlich<br />
mit weniger Corona-Drama als<br />
derzeit – im Frühjahr nächsten<br />
Jahres sein.<br />
Damit ist – zumindest von der<br />
Netzseite – auch ein wichtiger<br />
Baustein für eine weiter voranschreitende<br />
Energiewende in<br />
Deutschland gelegt. Denn mit<br />
dem Nordlink-Kabel besteht<br />
die Möglichkeit, sowohl Strom<br />
aus Erneuerbaren Energien in Überschuss-Situationen<br />
nach Norwegen zu transportieren als auch bei Bedarf<br />
norwegische Wasserkraft ins deutsche Netz einzuspeisen.<br />
Die Leitung bringt damit ein neues Speicherungspotenzial<br />
von 1.400 Megawatt ins Spiel.<br />
„Damit tragen wir im Zuge des fortschreitenden Ausbaus<br />
der Erneuerbaren Energien entscheidend zur<br />
zukünftigen Versorgungssicherheit bei“, unterstreicht<br />
Tim Meyerjürgens, „und dies ist für so ein ausgeprägtes<br />
Industrieland wie Deutschland ein enorm wichtiges<br />
und hohes Gut. Wir liegen zwar schon heute bei<br />
99,99 Prozent Sicherheit, aber wir streben die 100<br />
Prozent an.“ Angesichts dieses Aspektes betont auch<br />
Meyerjürgens, dass dies bei einem konsequenten<br />
Frank Wehling<br />
Der Elektrotechnik-<br />
Ingenieur hat den Bau<br />
der Konverterstation<br />
gemanagt.<br />
93
International<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Außenansicht der Konverterstation in Nortorf.<br />
Ausstieg aus der konventionellen Energieerzeugung<br />
ohne engere Zusammenarbeit<br />
der europäischen Länder oder mit anderen<br />
Worten ohne enge internationale Stromnetze<br />
nicht zu erreichen ist.<br />
„Elektronen interessieren sich ohnehin<br />
nicht für Politik“, entgegnet der TenneT-<br />
Vorstand beispielsweise auf die Frage, ob<br />
sich der Austritt Großbritanniens aus der<br />
Europäischen Union negativ auf die europäische<br />
Vernetzung der Offshore-Windenergie<br />
in der Nordsee auswirke. „Großbritannien<br />
spielt im Kontext zur Offshore-Windenergie<br />
in der Nordsee weiterhin eine große Rolle“,<br />
sagt Meyerjürgens und verweist auf die<br />
Chancen, die die geplanten niederländischen<br />
Gleichstromprojekte mit britischen<br />
Offshore-Parks böten.<br />
Ohnehin stehen alle im Netzgeschäft engagierten<br />
Akteure in den Nordsee-Anrainerstaaten,<br />
ob nun in Dänemark, Norwegen,<br />
Deutschland und den Niederlanden, schon<br />
seit Längerem in intensiven Konsultationen<br />
darüber, wie zukünftige Offshore-Windenergieprojekte<br />
miteinander durch Gleichstromtechnik<br />
am besten zu verbinden sind.<br />
„Denn wenn man die Dekarbonisierung<br />
wirklich will, dann brauchen wir Offshore-<br />
Windenergie in einer noch ganz anderen Dimension“,<br />
ist sich Meyerjürgens sicher, „es<br />
müssten dann schon 150 Gigawatt sein.“<br />
Im Zuge dessen wird auch die Erzeugung<br />
von Wasserstoff auf dem Meer zukünftig<br />
eine wachsende Bedeutung einnehmen;<br />
erste Projekte dazu gibt es schon, Aquaventus<br />
beispielweise, aber auch TenneT<br />
plant im ostfriesischen Diele mit Thyssen<br />
„Großbritannien spielt<br />
im Kontext zur Offshore-<br />
Windenergie in der<br />
Nordsee weiterhin eine<br />
große Rolle“<br />
Tim Meyerjürgens<br />
Gas und GasUnie die Netzanbindung von<br />
Elektrolyseuren, die den erzeugten Wasserstoff<br />
ins Gasnetz einspeisen sollen. Ohne<br />
in die Erzeugung einsteigen zu wollen, so<br />
Meyerjürgens, sei man als Netzbetreiber<br />
daran interessiert, dass „Elektronen und<br />
Gasmoleküle mehr und mehr zusammenwachsen“.<br />
Aktuell existiert in der europäischen Nordsee<br />
eine installierte Leistung aber erst von<br />
40 Gigawatt, zudem kommt noch kein<br />
grüner Wasserstoff von der Nordsee. Es<br />
liegt also noch viel Arbeit vor der Energiewirtschaft<br />
– auch für TenneT, weshalb der<br />
mächtige Konverter bei Wilster im Verhältnis<br />
zu den noch bevorstehenden Umbauaufgaben<br />
vor dem geistigen Auge zusammenschrumpft.<br />
NordLink: nur marginaler Einfluss<br />
auf deutschen Strommarkt<br />
Wie groß der Einfluss von NordLink und<br />
dem Konverter für den deutschen Strommarkt<br />
und die Strompreise direkt nach<br />
Inbetriebnahme tatsächlich sein wird, darüber<br />
äußert man sich in den Reihen des<br />
Übertragungsnetzbetreiber TenneT eher<br />
Mitarbeiter von ABB checken die Konverteranlage<br />
vor der Inbetriebnahme.<br />
spar sam. „Den Einfluss von NordLink auf<br />
das Gesamtgeschehen in Deutschland erachte<br />
ich aus Sicht der Netzbetreiber eher<br />
marginal“, so Meyerjürgens. Zudem mag<br />
er nur ungern Prognosen über die Entwicklung<br />
des Strommarktes abgeben, zumal in<br />
Zeiten, in denen sich der Energiemarkt fundamental<br />
verändere.<br />
Allerdings ist er sich sicher, dass der Verbraucher<br />
langfristig mit günstigeren Strompreisen<br />
rechnen kann, weil im Zuge einer<br />
besseren Vernetzung heute überschüssige<br />
Strommengen in Zukunft dann günstig im<br />
Netz aufgenommen werden können und<br />
zur Verfügung stehen. Das würde vielleicht<br />
auch helfen, heutige Hochpreisphasen im<br />
Strommarkt in Zukunft deutlich zu glätten.<br />
Was sicherlich auch das Geschäftsmodell<br />
von jetzt flexibilisierten Biogasanlagen<br />
in einer Post-EEG-Ära auf den Prüfstand<br />
stellen könnte. „Was die europäische<br />
Vernetzung für Auswirkungen auf einzelne<br />
Erzeugungsarten der Erneuerbaren in<br />
Deutschland haben wird, darüber spekuliere<br />
ich nicht, wenngleich klar ist, dass es für<br />
viele Bestandsanlagen echte Herausforderungen<br />
geben wird“, verdeutlicht TenneT-<br />
Vorstandsmitglied Meyerjürgens.<br />
Autor<br />
Dierk Jensen<br />
Freier Journalist<br />
Bundestr. 76 · 20144 Hamburg<br />
040/40 18 68 89<br />
dierk.jensen@gmx.de<br />
www.dierkjensen.de<br />
94
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
International<br />
ViscoPract®<br />
Enzymatischer<br />
Problemlöser 2.0<br />
Gas Technologie von APROVIS<br />
APROVIS. Better Performance.<br />
FriCon – Gaskühlsysteme<br />
ActiCo – Aktivkohlefilter<br />
Gaswärmeübertrager<br />
Verdichter<br />
Wartung & Service<br />
fotolia.com /<br />
© chrisberic<br />
fotolia.com /<br />
© TwilightArtPictures<br />
91746 Weidenbach-Triesdorf · Tel.: +49 9826 6583 - 030 · info@aprovis.com<br />
www.aprovis.com<br />
BIOGASSERVICE VOM<br />
FACHMANN<br />
Kompetent und Herstellerunabhängig<br />
Wir warten und reparieren die gesamte Technik Ihrer Biogas-Anlage. Dabei legen<br />
wir besonderen Wert auf Schnelligkeit, qualifizierte Mitarbeiter und herstellerunabhängige<br />
Beratung.<br />
■ Dächer, Pumpen, Rührwerkstechnik<br />
■ Behälterbau & Sanierung<br />
■ Reparatur & Ersatzteile<br />
■ Vermietung & Verkauf<br />
■ Leckageüberprüfung per Gaskamera<br />
■ Rohrleitungsbau<br />
„Alles aus einer Hand!“<br />
Im Garbrock 11a | 48683 Ahaus-Ottenstein | Tel.: 0 25 61 – 4 29 32 0 | info@lp-energy.de | www.lp-energy.de<br />
Senkt die Viskosität<br />
und stabilisiert den<br />
Gärprozess!<br />
Ihr Spezialist für technisch-textile Lösungen<br />
Doppelmembrangasspeicher<br />
Betonschutz WireTarp<br />
Güllebehälterabdeckungen<br />
» Beseitigt Schwimm- und<br />
Sinkschichten<br />
» Löst Substratablagerungen auf<br />
» Schont die Rühr-/Pumptechnik<br />
» Reduziert die Gärrestmenge<br />
+49 (0) 8503 914 99 0<br />
www.agrotel.eu<br />
info@agrotel.eu<br />
95<br />
+49 (0)30 6670 - 2056 » www.biopract-abt.de
International<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Biogasanlage in<br />
Niederösterreich.<br />
Wien<br />
Grüne Regierung,<br />
(kein?) grünes Gasnetz<br />
Der Biogassektor in Österreich sieht seine Zukunft in der Biomethaneinspeisung ins Gasnetz.<br />
Somit könnte Biogas zur Versorgungssicherheit beitragen und die Erneuerbaren Energien<br />
auch in den Städten voranbringen. Große Enttäuschung herrscht nun, nachdem die neue<br />
Bundesregierung unter Beteiligung der Grünen diese Strategie in einem richtungsweisenden<br />
Gesetzentwurf komplett ignoriert.<br />
Von Christian Dany<br />
Klimaschutzministerin<br />
Leonore Gewessler bei<br />
der Vorstellung des Begutachtungsentwurfs<br />
eines Erneuerbaren-<br />
Ausbau-Gesetzes.<br />
Österreich fährt zurzeit – in etwa parallel<br />
zu Deutschland – in eine neue Energiezukunft:<br />
Wie beim großen Nachbarn auch<br />
wurde im September der Entwurf eines Erneuerbare-Energien-Gesetzes<br />
vorgestellt,<br />
das in der Alpenrepublik Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz<br />
(EAG) heißt. Die Vorgeschichte ist hier aber um einiges<br />
turbulenter: Während in Deutschland seit 15 Jahren<br />
Angela Merkel regiert, werkelt in Österreich seit Jahresanfang<br />
schon die vierte Bundesregierung<br />
binnen drei Jahren<br />
an diesem Thema; darunter eine<br />
siebenmonatige Beamtenregierung<br />
mit einer Kanzlerin namens<br />
Brigitte Bierlein.<br />
Erst kam Ibiza, dann Corona: Nach<br />
einem Urlaubsvideo seines Vizekanzlers<br />
Strache entledigte sich<br />
Regierungschef und ÖVP-Obmann<br />
Sebastian Kurz – orchestral unterstützt<br />
von den Leitmedien des<br />
Landes – seines Koalitionspartners<br />
FPÖ, um sich nach den Neuwahlen<br />
vergangenen Herbst einen<br />
neuen Partner zu angeln: die Grünen.<br />
Das im Januar präsentierte<br />
Regierungsprogramm weist mit<br />
Foto: BMK/Cajetan Perwein<br />
dem Ziel „Klimaneutralität bis 2040“, unter anderem<br />
durch den anvisierten Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen,<br />
einen deutlichen grünen Schwerpunkt auf.<br />
Nachdem die Energiewende gut zweieinhalb Jahre auf<br />
Eis lag, dauerte es nun – auch pandemiebedingt – bis<br />
zum 16. September, ehe die Grazer Grünenpolitikerin<br />
Leonore Gewessler, jetzt Superministerin für vieles,<br />
vor allem Klimaschutz und Energie, der Presse mit<br />
dem EAG ein „Gesetzespaket, das den Energiemarkt<br />
für Jahrzehnte prägen wird“, präsentieren konnte. Das<br />
EAG soll die Grundlage sein, um Österreich bis 2030<br />
vollständig mit erneuerbarem Strom zu versorgen!<br />
Planung: 50 Prozent mehr Ökostrom<br />
in 10 Jahren<br />
Was nach einem großen Wurf klingt, muss relativiert<br />
werden: Schon heute hat Österreich einen Ökostromanteil<br />
von 78 Prozent und ist damit eindeutige Spitze<br />
in der EU. Rund 60 Prozent liefert die große Wasserkraft,<br />
18 Prozent steuern Anlagen bei, die nach dem<br />
Ökostromgesetz gefördert werden. Das Ziel 100 Prozent<br />
Ökostrom bis 2030 hatte bereits die ÖVP/FPÖ-<br />
Vorvorgängerregierung ausgegeben. Gewessler erläuterte,<br />
dass mit dem EAG die Ökostromproduktion in<br />
zehn Jahren um etwa 50 Prozent oder 27 Milliarden<br />
(Mrd.) Kilowattstunden pro Jahr erhöht werden soll.<br />
Davon entfallen 11 Mrd. kWh auf die Photovoltaik, 10<br />
Foto: Adobe Stock_fotofritz16<br />
96
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
International<br />
Die Entwicklung der erneuerbaren Stromerzeugung in Österreich<br />
Foto: BMK<br />
In der schwarzen<br />
Linie unter „Sonstige<br />
Erneuerbare“ verbirgt<br />
sich auch Biogas.<br />
Mrd. kWh auf die Windenergie und 5 Mrd. auf die Wasserkraft.<br />
Eine weitere Terawattstunde soll von Anlagen<br />
für feste Biomasse kommen.<br />
In den Medien und bei Verbänden löste der Gesetzentwurf<br />
Anerkennung bis Begeisterungsstürme aus: Da<br />
war die Rede von einem „Riesenschritt für den Klimaschutz“.<br />
Der Photovoltaikverband sieht den „Grundstein<br />
für eine echte Solar-Revolution“ gelegt. Dagegen<br />
äußerten der Gewerkschaftsbund ÖGB und die konventionelle<br />
Energiewirtschaft Skepsis wegen der entstehenden<br />
Kosten. Gewessler versprach, dass die Kosten<br />
im Dreijahresmittel 1 Mrd. Euro jährlich nicht überschreiten<br />
sollen, was die Belastungen pro Haushalt auf<br />
rund 100 Euro im Jahr eingrenzen sollte.<br />
Herbe Enttäuschung – Biogas unerwähnt<br />
gelassen<br />
Eine Erneuerbaren-Branche kam sich unter den Jubelstürmen<br />
aber wohl vor wie das vergessene Stiefkind:<br />
Biogas, das in den Ausbauzielen unerwähnt blieb! Norbert<br />
Hummel, Biogas-Obmann des Kompost & Biogas<br />
Verbands Österreich KBVÖ, zeigte in einer Presseaussendung<br />
seine große Enttäuschung über den EAG-Entwurf:<br />
Dieser liefere keine Grundlage für eine ganzheitliche<br />
Energiewende, da der notwendige Rechtsrahmen<br />
für „Grünes Gas“ fehle.<br />
„In Österreich soll nicht nur die Stromversorgung erneuerbar<br />
werden. Auch das Gasnetz, das die dreifache<br />
Übertragungsleistung des Stromnetzes aufweist<br />
Franz Eisele u. Söhne GmbH & Co. KG www.eisele.de • Flexibilisierung<br />
• Sanierung<br />
• Repowering<br />
• Genehmigungsmanagement<br />
• Engineering<br />
• Baubegleitung<br />
Pumpen & Rührwerke<br />
Hauptstrasse 2-4 72488 Sigmaringen Tel.: +49 (0)7571 / 109-0 info@eisele.de<br />
Greenline Energy GmbH & Co KG • Jägerweg 12 • 24941 Flensburg<br />
Tel. 0461 3183364-0 • E-Mail: info@greenline-energy.de<br />
www.greenline-energy.de<br />
KOMPONENTEN FÜR BIOGASANLAGEN<br />
QUALITÄT<br />
AUS<br />
VERANTWORTUNG<br />
■ Fermenterrührwerke für Wand- und<br />
Deckeneinbau Robuste und leistungsstarke Bauweise energieeinsparend<br />
+ hocheffizient.<br />
■ Separatoren für Biogasanlagen<br />
stationär / als mobile Einheit<br />
BIS ZU<br />
40%<br />
ZUSCHUSS<br />
DURCH KFW<br />
MÖGLICH<br />
■ Rührwerke für Nachgärbehälter<br />
und Endlager<br />
■ Pumptechnik für Biogasanlagen<br />
■ Panoramaschaugläser Nachrüstung möglich<br />
PAULMICHL GmbH<br />
Kisslegger Straße 13<br />
88299 Leutkirch<br />
Tel. 0 75 63/84 71<br />
Fax 0 75 63/80 12<br />
www.paulmichl-gmbh.de<br />
97
International<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Potenziale für ein grünes Gasnetz<br />
Die Universität Linz hat das Potenzial an erneuerbarem Methan bis zum Jahr 2050 auf 2 Mrd.<br />
m³ pro Jahr beziffert. Neben 500 Mio. m³ synthetischem Methan spielen 1,5 Mrd. m³ Biomethan<br />
die Hauptrolle. Bedingung ist hierbei, dass Biomethan ausschließlich aus Rest- und<br />
Abfallstoffen erzeugt wird. Das Forschungsunternehmen BEST – Bioenergy and Sustainable<br />
Technologies GmbH kommt mit seinen Berechnungen sogar auf 4 Mrd. m³ Biomethan pro Jahr.<br />
Hier ist allerdings eine beträchtliche Menge Forstbiomasse, Kurzumtriebsholz und Miscanthus<br />
eingerechnet. Diese Biomasse müsste über thermochemische Vergasung in Methan<br />
umgewandelt werden. Auf der mittlerweile stillgelegten Forschungsanlage Güssing ist die<br />
Machbarkeit dieser Technologie zwar nachgewiesen worden, kommerziell wird sie aber noch<br />
nirgends umgesetzt.<br />
Biogasanlage mit 250 kW el<br />
in der Nähe<br />
von Ried im Innkreis. Die Wärme der<br />
sehr kompakt ausgeführten Anlage wird<br />
sowohl für ein Wärmenetz als auch für<br />
Trocknungszwecke genutzt.<br />
und saisonale Speicherkapazitäten bietet, soll grün werden“,<br />
erinnert Hummel an das Regierungsprogramm.<br />
Demzufolge sollen bis 2030 eigentlich 5 Prozent des<br />
Gasverbrauchs aus erneuerbaren Quellen stammen.<br />
Längst hatten sich Biogasbranche, Gaswirtschaft und<br />
maßgebende Stellen in der Politik im Wesentlichen auf<br />
eine „Greening-the-Gas“-Strategie geeinigt, was auch<br />
Niederschlag ins türkis-grüne Regierungspapier fand.<br />
„Wir sind in letzter Minute rausgekickt worden“, kommentiert<br />
Franz Kirchmeyr, Fachbereichsleiter Biogas<br />
beim KBVÖ, was darauf schließen lässt, dass Biogas<br />
zum Spielball im Verhandlungspoker geworden ist.<br />
Stillstand: seit 2014 keine neuen<br />
Biogasanlagen<br />
Dabei soll das EAG für die Biogasbranche Österreichs<br />
so etwas wie der Auszug aus Ägypten sein: „Seit 2014<br />
herrscht absoluter Stillstand. Es wurden kaum noch<br />
Ökostrom-Biogasanlagen gebaut oder erweitert“, lässt<br />
Kirchmeyr einblicken. Zwischen Bregenz und Wien stehen<br />
rund 300 Biogasanlagen mit einer Anschlussleistung<br />
von etwa 90 Megawatt elektrischer Leistung.<br />
Das Gros der nach Einführung des Ökostromgesetzes<br />
2002 gebauten Anlagen setzt nachwachsende Rohstoffe<br />
und Wirtschaftsdünger ein. Mit Gesetzesnovellen<br />
sind die Wärmenutzung etabliert, die Anteile von<br />
Getreide und Mais im Substratmix begrenzt und die ursprüngliche<br />
Laufzeit der Einspeisevergütung von zwölf<br />
Jahren verlängert worden. „Schon seit 2005 wird bei<br />
uns an der Biogasaufbereitung und Biomethaneinspeisung<br />
geforscht“, sagt der Ingenieur.<br />
Die Technologie habe sich etabliert, der Gasnetzzugang<br />
sei geregelt und seit 2012 gebe es ein Biomethanregister.<br />
15 Biomethananlagen mit einer Einspeisekapazität<br />
von rund 3.000 Kubikmeter pro Stunde seien in Betrieb.<br />
„Die Anlagen verkaufen Herkunftsnachweise ins<br />
Ausland oder speichern sie“, beklagt er den fehlenden<br />
Markt im Inland.<br />
Wie Kirchmeyr schildert, habe sich der Verband zur<br />
Entwicklung seiner Zukunftsstrategie den Strommarkt<br />
genau angesehen. „Bereits heute können in einem<br />
regenreichen Sommer Laufwasserkraft- zusammen<br />
mit Pumpspeicher-Kraftwerken nahezu den gesamten<br />
Strombedarf decken.“ Darüber hinaus sei bis 2030 der<br />
Ausbau der Photovoltaik geplant von derzeit 1,6 Gigawatt<br />
elektrische Leistung (GW el<br />
) auf 11 GW el<br />
.<br />
„Das bedeutet, wir bekommen ein sommerliches Überangebot<br />
mit der Folge von negativen Strompreisen. Es<br />
gibt in Zukunft somit keinen Bedarf an zusätzlicher,<br />
verlässlicher Ökostromproduktion im Sommer. Darum<br />
müssen wir schauen, dass wir ins Gasnetz kommen“,<br />
argumentiert der Biogasexperte.<br />
Österreich verfüge über ein gut ausgebautes Gasnetz<br />
mit vielen Kavernenspeichern: „Der niedrigste Speicherinhalt<br />
der Pumpspeicher-Kraftwerke reicht bei<br />
Spitzenlast nur für drei Tage. Dagegen kann das Gasnetz<br />
mit seinen Speichern die Versorgungssicherheit<br />
für mindestens 28 Tage aufrechterhalten. Um die<br />
Foto: KBVÖ<br />
98
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
International<br />
ÜBERWACHUNG VON BIOGAS-ANLAGEN<br />
Biogas 401<br />
Mehrkanal-Gasanalysator<br />
Biogas 905<br />
Mehrkanal-Gasanalysator<br />
SENSOREN<br />
Die beiden Gas-Analysatoren Biogas 401<br />
und Biogas 905 über wachen kontinuierlich<br />
oder dis kon ti nuierlich die Qualität des<br />
Biogases auf die Gaskompo nenten hin.<br />
Optional warnen zusätzliche Umgebungsluft-Sensoren<br />
frühzeitig vor gesundheitsge<br />
fähr denden, explo sions fähigen und<br />
nichtbrenn baren Gasen und Dämpfen.<br />
❯❯❯ Biogas Know-how seit 2001 ❮❮❮<br />
EINSATZBEREICHE:<br />
■ Biogas-Produktionsanlagen<br />
■ Kläranlagen<br />
■ Deponien<br />
GTR 210 IR<br />
CH 4 + CO 2<br />
TOX 592<br />
O 2 + H 2 S<br />
Trierer Str. 23 – 25 · 52078 Aachen<br />
Tel. (02 41) 97 69-0 · www.ados.de<br />
s e i t 1 9 0 0<br />
®<br />
BHKW-Service<br />
· Regelwartungen<br />
· Teil- und Komplettrevisionen<br />
· Neu- und Ummotorisierungen<br />
· Lieferung von Austauschmotoren und Komponenten<br />
· Ersatzteilvertrieb<br />
Wir machen ihren Motor fit für die 44.BimSchV.<br />
NoX Überwachung/Regelung bis zum kompletten SCR System.<br />
Ihr Partner in Sachen Motorentechnik<br />
Industriestr. 7 · 49716 Meppen · Tel. 05931-9844-0 · kem@kloska.com<br />
99
International<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Enges Korsett<br />
Die Stromerzeugung aus Biogasanlagen soll künftig nur<br />
noch stark reglementiert für kleinere Anlagen mit einer<br />
Marktprämie wie in Deutschland gefördert werden. Der<br />
Begutachtungsentwurf des EAG nennt unter § 10 Allgemeine<br />
Förderbedingungen (Absatz 1, Punkt 5) die entscheidenden<br />
Kriterien:<br />
Durch Marktprämie förderfähig ist die Erzeugung von<br />
Strom aus neu errichteten Anlagen auf Basis von Biogas<br />
mit einer Engpassleistung bis 150 kW el<br />
, wenn die Anlage<br />
a) einen Brennstoffnutzungsgrad von über 70 Prozent<br />
erreicht,<br />
b) ausschließlich im Nahebereich der Anlage anfallende<br />
Biomasse in Form von biologisch abbaubaren Abfällen<br />
und Reststoffen, wovon mindestens 30 Prozent<br />
auf Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft entfallen,<br />
als Brennstoff einsetzt,<br />
c) zu mehr als 10 Prozent Strom für die Eigenversorgung<br />
erzeugt,<br />
d) mehr als 15 Kilometer vom nächsten Anschlusspunkt<br />
an das Gasnetz entfernt ist,<br />
e) über einen dem Stand der Technik entsprechenden<br />
Wärmezähler verfügt und<br />
f) über ein Konzept der Rohstoffversorgung zumindest<br />
über die ersten fünf Betriebsjahre verfügt.<br />
Die Marktprämie wird für eine Dauer von 20 Jahren gewährt.<br />
In § 49 ist das jährliche Vergabevolumen von 1,5<br />
MW, vorbehaltlich Kürzungen, festgehalten.<br />
Franz Kirchmeyr sagt: „Wenn es gelingt,<br />
den Gasverbrauch deutlich zu senken<br />
und nach Hochfahren des nationalen<br />
Versorgung mit erneuerbaren Energien<br />
Biomethanpotenzials irgendwann der<br />
internationale Handel in Schwung kommt, sicherstellen zu können, bedarf es verfügbarer<br />
Kapazitäten, die sehr kurzfris-<br />
weil auch die großen Länder Europas auf<br />
Biomethan setzen, ist der vollständige tig enorme Leistungen ins Stromnetz<br />
Umstieg auf grünes Gas nicht unrealistisch.“<br />
bringen oder auch vom Stromnetz nehmen<br />
können. Regelbare KWK-Anlagen,<br />
befeuert mit Erneuerbarer Energie aus<br />
saisonalen Speichern, können das.“<br />
Für die „Greening-the-Gas“-Strategie werden Biomethan,<br />
grüner Wasserstoff und synthetisches Gas auf<br />
Basis erneuerbaren Stroms (Power-to-Gas) zusammengefasst.<br />
Dass Österreich hier über ein beträchtliches<br />
Potenzial verfügt, belegen zwei Studien (siehe Kasten<br />
auf Seite 94). Davon ausgehend wagt Kirchmeyr eine<br />
Prognose: „Der Gasbedarf in ganz Österreich liegt zwischen<br />
8 und 9 Mrd. m³ pro Jahr. Wenn es gelingt, den<br />
Gasverbrauch deutlich zu senken und nach Hochfahren<br />
des nationalen Biomethanpotenzials irgendwann der<br />
internationale Handel in Schwung kommt, weil auch<br />
die großen Länder Europas auf Biomethan setzen, ist<br />
der vollständige Umstieg auf grünes Gas nicht unrealistisch.“<br />
Altanlagen von Strom- auf Gaseinspeisung<br />
umrüsten<br />
Ein dringendes Ziel für die nahe Zukunft sei es, Altanlagen<br />
nach Auslaufen der Ökostromgesetz-Förderung<br />
nach Möglichkeit auf Biomethaneinspeisung umzurüsten.<br />
Zwar wurde für Altanlagen jetzt im EAG-Entwurf<br />
die Weiterförderung mit einer „Nachfolgeprämie“ vorgesehen<br />
– dies aber nur für ein Jahr! Diese Förderdauer<br />
möchte der KBVÖ deutlich verlängern. Außerdem<br />
beteuert Kirchmeyr, der KBVÖ wolle alles versuchen,<br />
um in der Begutachtungsphase Biomethan doch noch<br />
ins EAG zu bringen. Der Verband favorisiere dabei Ausschreibungen,<br />
wie sie auch für feste Biomasse- und<br />
große Photovoltaikanlagen kommen sollen, während<br />
vonseiten der Politik auch immer wieder eine Quotenregelung<br />
angedacht werde.<br />
Bei Neuanlagen an gasnetzfernen Standorten soll die<br />
Stromerzeugung künftig mit einer gleitenden Marktprämie,<br />
wie sie auch in Deutschland bekannt ist, gefördert<br />
werden (siehe Kasten oben). Der für die Marktprämie<br />
relevante „anzulegende Wert“ wird in Österreich separat<br />
in einer Verordnung festgelegt. Allerdings müssen<br />
neue Biogasanlagen hier strenge Kriterien einhalten.<br />
Vor allem dürfen sie maximal 150 kW el<br />
haben. Der KBVÖ<br />
fordert, anstatt dieser Leistungs- eine Produktionsbegrenzung<br />
auf 2 Gigawattstunden pro Jahr einzuführen.<br />
Somit könnten die Anlagen flexibel betrieben werden<br />
und ein Maximum an Wärme verwerten. Das Kriterium<br />
der 15 Kilometer Entfernung vom Gasnetz solle auf 5<br />
Kilometer reduziert, außerdem das Fördervolumen von<br />
jährlich nur 1,5 MW el<br />
auf 3 MW el<br />
erhöht werden.<br />
Nach Abschluss der Begutachtungsphase bringt die<br />
Bundesregierung eine Regierungsvorlage ins Parlament,<br />
in der die Begutachtungen mehr oder weniger<br />
berücksichtigt werden. Für das EAG ist eine Zweidrittel-Mehrheit<br />
im Nationalrat und Bundesrat erforderlich,<br />
da Länderkompetenzen berührt werden. Es bedarf<br />
also der Zustimmung von Teilen der Opposition.<br />
Nachdem der Zeitplan bis zum Jahresende sehr eng<br />
gestrickt ist, rechnet der KBVÖ mit einem Inkrafttreten<br />
des Gesetzes im ersten Quartal 2021. Der bislang<br />
angestrebte Zeitpunkt 1. Januar 2021 erscheine sehr<br />
ambitioniert, da auch noch eine Genehmigung respektive<br />
Nichtuntersagung der Europäischen Kommission<br />
erforderlich sei.<br />
Autor<br />
Christian Dany<br />
Freier Journalist<br />
Gablonzer Str. 21 · 86807 Buchloe<br />
0 82 41/911 403 · 01 60/97 900 831<br />
christian.dany@web.de<br />
Foto: Österreichisches Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung<br />
100
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
International<br />
Der BHKW-Service von WELTEC.<br />
Immer in Ihrer Nähe.<br />
Ihre Vorteile<br />
• alle gängigen Motoren<br />
• langjährige & geschulte Mitarbeiter<br />
• 24/7 Notdienst<br />
Organic energy worldwide<br />
WELTEC BIOPOWER GmbH<br />
04441-999 78-0<br />
info@weltec-biopower.de<br />
Biogas-Ventilatoren<br />
im Austausch<br />
Meidinger AG<br />
Landstrasse 71<br />
4303 Kaiseraugst / Schweiz<br />
Tel. +41 61 487 44 11 service@meidinger.ch www.meidinger.ch<br />
Für die vorgeschriebene 3-Jahres-Revision:<br />
Minimale Stillstandszeit<br />
mit identischem, generalrevidiertem<br />
Austauschgerät.<br />
- geprüfte Qualität vom Hersteller<br />
- volle12 Monate Gewährleistung<br />
- kurzfristig verfügbar<br />
holen sie sich ihren individuellen Fahrplan!<br />
Anfragen gerne per E- Mail: kundencenter@e2m.energy<br />
Die besten Fahrpläne vom m arktF ührer<br />
www.e2m.energy<br />
101
Aus der<br />
Verbandsarbeit<br />
Bericht aus der Geschäftsstelle<br />
EEG-Novelle: Notwendige<br />
Trendwende oder Strohfeuer?<br />
Die derzeit laufende EEG-Novelle hält so manche Überraschung parat.<br />
Waren die ersten Entwürfe zum neuen EEG noch durch zurückhaltende<br />
Zukunftssignale für die Biogasbranche geprägt, hatte scheinbar die<br />
Ressortabstimmung zu einem Umdenken im Bundeswirtschaftsministerium<br />
geführt. Der am 23. September veröffentlichte Kabinettsentwurf<br />
enthielt endlich die ersten klaren Signale und positiven Bekenntnisse<br />
der Ministerien in Richtung Weiterentwicklung der Biogasbranche.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Das Berliner Büro des Fachverbandes<br />
engagiert sich sehr<br />
stark für weitere Verbesserungen<br />
im EEG, um eine tragfähige<br />
Perspektive für unsere gesamte<br />
Branche zu erreichen und den guten<br />
Schwung aus dem Kabinettsentwurf nun<br />
im parlamentarischen Verfahren zu nutzen.<br />
Auf Unterstützung hoffen wir dabei auch<br />
und insbesondere von allen Mitgliedern:<br />
Machen Sie Ihre Betroffenheit deutlich<br />
und kontaktieren Sie Ihren Bundestagsabgeordneten<br />
mit unseren Anliegen. Nutzen<br />
Sie dazu am besten die diesem Biogas Journal<br />
beigefügte Postkarte. Wenn bei jedem<br />
Abgeordneten in den kommenden Wochen<br />
hoffentlich mehrere Postkarten eintrudeln,<br />
können wir uns so miteinander mehr Gehör<br />
verschaffen!<br />
Erste ASP-Fälle in Deutschland<br />
Neben der EEG-Novelle sorgten auch die<br />
ersten bestätigten Fälle der Afrikanischen<br />
Schweinepest (ASP) in Deutschland (Landkreis<br />
Spree-Neiße/Brandenburg) für intensive<br />
Diskussionen hinsichtlich der Auswirkungen<br />
auf den Betrieb der Biogasanlagen.<br />
Aus diesem Grund hat das Referat Abfall,<br />
Düngung und Hygiene die Arbeitshilfe<br />
A-017 „Verhalten bei der Afrikanischen<br />
Schweinepest in Biogasanlagen“ nochmals<br />
in Abstimmung mit dem Friedrich-Loeffler-<br />
Institut (FLI) überarbeitet und im geschützten<br />
Bereich der Fachverbands-Homepage<br />
zum Download eingestellt. Im Bedarfsfall<br />
sollte hierzu Rücksprache mit dem zuständigen<br />
Veterinäramt genommen werden.<br />
Weiterhin war das Referat in den letzten<br />
Wochen mit dem Verfahren zur Verabschiedung<br />
der allgemeinen Verwaltungsvorschrift<br />
zur Ausweisung belasteter Gebiete<br />
beschäftigt. Diese wurde am 18. September<br />
vom Bundesrat beschlossen. Damit sind<br />
nun bis Ende des Jahres die Bundesländer<br />
angewiesen, anhand der Verwaltungsvorschrift<br />
die Gebietskulisse zu prüfen und<br />
neu auszuweisen und bekanntzugeben.<br />
Auf europäischer Ebene steht die Umsetzung<br />
der EU-Düngeprodukte-Verordnung<br />
im Fokus, da nun Düngemittel, Bodenverbesserungsmittel<br />
und Erden auf Basis von<br />
Gärprodukten und Kompost EU-Produkte<br />
102
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Verband<br />
mit CE-Kennzeichen mit Beendigung etwaiger<br />
Abfalleigenschaft werden können. Dazu<br />
wird am 7. Oktober <strong>2020</strong> ein Webseminar<br />
für alle Mitglieder des Europäischen Biogasverbandes<br />
(EBA) und des Europäischen<br />
Kompostnetzwerkes (ECN) angeboten, bei<br />
dem die Inhalte der Verordnung von der Generaldirektion<br />
(DG GROW) der EU-Kommission<br />
vorgestellt werden. Im Anschluss wird<br />
eine Onlinebefragung aller Mitgliedsstaaten<br />
unter der gemeinsamen Initiative beider Europäischer<br />
Verbände gestartet.<br />
Zudem sind die Broschüren www.biogasaus-bioabfall.de<br />
und www.biogas-to-biomethane.com<br />
nun auch online auf Serbisch<br />
und Russisch unter den angegebenen Links<br />
verfügbar.<br />
Umsetzung der RED-II<br />
Das Bundesumweltministerium hat im<br />
September einen Referentenentwurf für<br />
ein Gesetz zur Weiterentwicklung der Treibhausgasquote<br />
veröffentlicht. Aus Sicht des<br />
Fachverbandes Biogas e.V. (FvB) setzt der<br />
vorgelegte Gesetzesentwurf zwar neue Anreize<br />
für die THG-Minderung im Verkehr,<br />
wie zum Beispiel die Erhöhung der Pönale<br />
für die Nicht-Einhaltung des CO 2<br />
-Minderungsziels<br />
von 470 auf 600 Euro pro Tonne<br />
CO 2<br />
-Überschuss, definiert aber keinen<br />
ambitionierten Ausbaupfad für erneuerbare<br />
Kraftstoffe bis 2030, was wiederum mit<br />
den Klimazielen der Bundesregierung kaum<br />
vereinbar ist. Der FVB wird das Verfahren<br />
weiter intensiv begleiten und sich für ambitioniertere<br />
THG-Quoten einsetzen. Intensiv<br />
eingebunden ist der FvB auch in diverse<br />
Webkonferenzen zu den Themen Wasserstoff<br />
aus Biogas sowie zur Produktion und<br />
Nutzung von Biomethan im Verkehrssektor<br />
als Bio-CNG/LNG.<br />
Programm der Biogas-Convention<br />
fertiggestellt<br />
Im Referat Veranstaltungen wurden ab September<br />
die Weichen für die Durchführung<br />
der 30. BIOGAS Convention gestellt. Erstmals<br />
virtuell wird die BIOGAS Convention<br />
vom 16. bis 20. November <strong>2020</strong> mit den<br />
deutschen Vorträgen und Diskussionsrunden<br />
stattfinden. Vom 08. bis 10. Dezember<br />
<strong>2020</strong> findet die BIOGAS Convention<br />
International mit den englischsprachigen<br />
Präsentationen statt. Dafür wurde in den<br />
vergangenen Monaten das erforderliche<br />
Know-how aufgebaut, um eine technisch<br />
optimale und teilnehmerorientierte Lösung<br />
zu finden. So konnte erneut ein kostengünstiges<br />
Angebot aufgesetzt werden, das den<br />
Teilnehmern innerhalb weniger Tage einen<br />
breiten Überblick zu aktuellen Biogasthemen<br />
bieten wird. Neben den Vorbereitungen<br />
zur BIOGAS Convention wurden im September<br />
der 14. Erfahrungsaustausch der „Umweltgutachter<br />
im EEG“ und der 10. Erfahrungsaustausch<br />
für Sachverständige nach<br />
§29b BImSchG (siehe auch Bericht auf<br />
Seite 108) erfolgreich online veranstaltet.<br />
Beide Tagungen waren ausgebucht.<br />
Befragung der Inverkehrbringer<br />
von Spurenelementen<br />
Das Referat Hersteller und Technik beschäftigte<br />
sich in den zurückliegenden Wochen<br />
verstärkt mit der Begleitung und Kommentierung<br />
der aktuell in Bearbeitung befindlichen<br />
ISO-Standards zum Thema Biogas,<br />
des Standardentwurfs für Kenia und der<br />
Überarbeitung der TRAS 310, TRAS 320<br />
und der TRGS 529. Im Falle der TRGS 529<br />
fand eine Befragung von Inverkehrbringern<br />
von Spurenelementen bezüglich der Verwendung<br />
von fermentierbaren Säcken und<br />
des Umgangs mit EDTA-Komplexen statt,<br />
die nochmals in einer Webkonferenz der<br />
Arbeitsgruppe Spurenelemente im FvB diskutiert<br />
werden muss.<br />
Ebenfalls war das Referat in der Planung<br />
und Durchführung des 10. Erfahrungsaustausches<br />
der Sachverständigen eingebunden.<br />
In mehreren Webkonferenzen<br />
wurde der Firmenbeirat zur Positionierung<br />
der aktuell laufenden EEG-Novelle eingebunden<br />
beziehungsweise wurden erste Firmenwebkonferenzen<br />
in einigen Regionen<br />
gestartet, um einerseits den Austausch der<br />
Firmen mit dem FvB zu intensivieren und<br />
andererseits den Austausch der Firmen<br />
untereinander zu unterstützen. Im Referat<br />
Genehmigung ist nach wie vor die Änderung<br />
der AwSV ein Schwerpunktthema,<br />
wenngleich das Verordnungsgebungsverfahren<br />
deutlich an Fahrt verloren hat und<br />
somit andere Themen in den Vordergrund<br />
getreten sind. Dazu zählen unter anderem<br />
die aktuell anlaufende Überarbeitung des<br />
Biogashandbuchs Bayern, die regional<br />
weiterhin sehr unterschiedliche Auslegung<br />
einzelner Bestimmungen der 44. Bundes-<br />
Immissionsschutzverordnung (BImSchV)<br />
sowie die Sichtung und Kommentierung diverser<br />
Publikationen mit direktem oder indirektem<br />
Biogasbezug von Institutionen, aber<br />
auch Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaften.<br />
Erfahrungsaustausch der<br />
Umweltgutachter<br />
Das Referat Mitgliederservice beschäftigte<br />
sich auch mit der Organisation und Durchführung<br />
des 14. Erfahrungsaustausches<br />
„Umweltgutachter im EEG“. Die Veranstaltung<br />
wurde dieses Jahr als virtuelle Onlinekonferenz<br />
angeboten und war mit über<br />
60 Teilnehmern wieder ausgebucht. Wie in<br />
jedem Jahr bildete der Vortrag der Zulassungs-<br />
und Überwachungsbehörde der Umweltgutachter<br />
(DAU GmbH) zur Umweltgutachter-Leitlinie<br />
und zur Regelaufsicht<br />
den Kern der Veranstaltung. Dabei stand<br />
diesmal die Diskussion über Gutachten<br />
zum KWK-Bonus für die Holztrocknung im<br />
Wärmenetz im Mittelpunkt.<br />
Hierbei stellte Dr. Andrea Bauer (Referat<br />
Energierecht und -handel im FvB) die Position<br />
des Verbandes dar, die auch in einem<br />
Stellungnahmeverfahren gegenüber der<br />
Clearingstelle EEG geäußert wurde und<br />
unter www.biogas.org unter Fachthemen<br />
im Bereich EEG und Stromvermarktung<br />
zu finden ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt<br />
war die künftige Zertifizierung nach RED II.<br />
Hierzu führte Peter Jürgens (Geschäftsführer<br />
der REDcert GmbH) aus, welche Tätigkeitsfelder<br />
sich künftig für die Umweltgutachter<br />
ergeben können.<br />
Zusammenarbeit mit App-<br />
Anbieter Airfarm<br />
Einen weiteren Schritt Richtung Digitalisierung<br />
hat das Referat Mitgliederservice<br />
in Abstimmung mit der Digitalmanagerin<br />
Gudrun Kramer vollzogen. Es wurde die Zusammenarbeit<br />
mit dem App-Anbieter Airfarm<br />
beschlossen, die auch eine Kommunikation<br />
mit den Mitgliedern ermöglicht. Wir<br />
werden ab sofort auch Inhalte über Airfarm<br />
veröffentlichen. Um diese zu sehen, laden<br />
wir Sie ein, die App herunterzuladen und<br />
sich anzumelden. Zunächst werden Sie unsere<br />
öffentlichen Artikel sehen können. Die<br />
Airfarm-App ist kostenlos für Android und<br />
iOS verfügbar.<br />
Nach Ihrer Anmeldung können Sie in der<br />
App auch unseren Kanal finden. Im nächsten<br />
Schritt soll es auch einen geschlossenen<br />
Mitgliederbereich geben, zudem sollen<br />
Betreiber- und Firmenmitglieder Zugang<br />
erhalten und dann auch die Inhalte aus<br />
Betreiberrundschreiben beziehungsweise<br />
Firmenrundmails direkt über die App<br />
empfangen können. Sobald dies möglich<br />
ist, werden wir Sie genauer darüber<br />
103
Verband<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Neue Spezialberaterin Düngung<br />
Sophia Heinze unterstützt seit dem 15. Oktober die Fachverband<br />
Biogas Service GmbH, in der sie in Zukunft unsere Mitglieder als Spezialberaterin<br />
Biogas – Fokus Düngung begleiten wird. Perspektivisch wird<br />
sie den Mitgliedern des Verbandes Unterstützung bei der Erstellung von<br />
Düngebedarfsermittlungen, Stoffstrombilanzen etc. anbieten sowie als<br />
Qualitätsbetreuerin der Güte-Gemeinschaft Gärprodukte e.V. tätig sein.<br />
Bereits in ihrem Masterstudium der Agrarwissenschaften mit dem<br />
Schwerpunkt Agrarökonomie und Agribusiness beschäftigte sie sich<br />
intensiv mit den Vorteilen geschlossener hofeigener Nährstoffkreisläufe.<br />
Nach dem Studium war sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am<br />
Lehrstuhl für forstliche Wirtschaftslehre der Technischen Universität<br />
München tätig, wo sie unter anderem ökonomische Entscheidungsgrundlagen<br />
an Studierende vermittelte.<br />
Neues Ausbildungsjahr <strong>2020</strong>!<br />
Im Referat Verwaltung hat die dreijährige Ausbildung zur „Kauffrau für<br />
Büromanagement“ am 1. September begonnen. Unsere Auszubildende<br />
Maria Fischer bekommt ihre Ausbildungsinhalte in den folgenden<br />
Bereichen vermittelt: Mitgliederverwaltung, Assistenz und Buchhaltung.<br />
Die besten Voraussetzungen hat Frau Fischer bereits: Organisationsfähigkeit<br />
und Teamwork! Diese Eigenschaften kommen ihr auch<br />
bei der Freiwilligen Feuerwehr und als angehende Leiterin des Schützenvereins<br />
zugute.<br />
informieren. Im Referat Energierecht und<br />
-handel stand neben der EEG-Novelle auch<br />
das Thema Vergütung für Blindstrom im<br />
Fokus. Darüber hinaus hat sich das Referat<br />
in den vergangenen Monaten intensiv<br />
mit der Rechtsprechung des Landgerichts<br />
Frankfurt (Oder) zum Satelliten-BHKW<br />
befasst. In dem Verfahren wird es nun<br />
kein rechtskräftiges Urteil geben, da sich<br />
beide Parteien geeinigt haben. Aus Sicht<br />
der Branche ist dies eine gute Lösung. Zur<br />
weiteren Absicherung der Branche hat das<br />
Referat ein Clearingstellenverfahren zur<br />
Klärung des Anlagenbegriffs bei Satelliten-<br />
BHKW auf den Weg gebracht.<br />
Smart-Meter-Rollout<br />
Die Digitalisierung der Biogasbranche<br />
schreitet weiter voran. So haben wir uns<br />
zusammen mit unseren Partnerverbänden<br />
beim BMWi für eine praxisgerechte<br />
Ausgestaltung des Smart-Meter-Rollouts<br />
ausgesprochen. Dieses hat zahlreiche<br />
Dokumente zur Konsultation gestellt, wie<br />
EE-Anlagen in Zukunft bei Einspeisemanagement,<br />
Direktvermarktung etc. digital<br />
über Smart Meter angesteuert werden sollen.<br />
Auch wenn dieses wichtige Thema die<br />
Branche erst in den kommenden Jahren<br />
umfassend betreffen wird, setzen wir uns<br />
bereits jetzt für eine praxisgerechte und<br />
finanzierbare Ausgestaltung der Auflagen<br />
ein.<br />
EU-Politik und internationale<br />
Aktivitäten<br />
In der EU-Kommission werden im Zuge des<br />
Europäischen Green Deals bereits verabschiedete<br />
Gesetze im Lichte höherer Klimaschutzziele<br />
neu evaluiert. Auch die erst<br />
2018 neugefasste Erneuerbare-Energien-<br />
Richtlinie (RED II) und die Energieeffizienzrichtlinie<br />
werden im Herbst evaluiert,<br />
gegebenenfalls werden die Effizienz- und<br />
EE-Ziele sowie die Sektorziele erhöht. Im<br />
Rahmen von diversen Konsultationen beteiligt<br />
sich der FvB an der Neuevaluierung.<br />
Des Weiteren hat sich der FvB an Konsultationen<br />
zu Verkehrsthemen, wie „Smart<br />
Mobility“, „White Paper on Transport“ und<br />
„CO 2<br />
-emissions from shipping“ beteiligt.<br />
Im Auftrag der UNIDO hat der FvB Trainingsmaterialien<br />
zur Biogas-Schulung in<br />
Kenia entwickelt. Diese sollen hauptsächlich<br />
vom Kenya Industrial Research and<br />
Development Institute (KIRDI) zur Schulung<br />
von diversen Marktakteuren in Kenia<br />
genutzt werden. Zudem wurde ein Entwurf<br />
eines Biogasstandards für Kenia zur weiteren<br />
Professionalisierung der Biogasanlagen<br />
entwickelt und in die jetzt noch folgende<br />
Abstimmung eingebracht.<br />
Am 1. Mai 2019 startete eine neue Kurzmaßnahme<br />
zwischen dem FVB und dem<br />
serbischen Biogasverband (SBA) und endet<br />
nun äußerst erfolgreich zum 30. September<br />
<strong>2020</strong>. Die SBA hat von Anfang an enormen<br />
Einsatz geleistet und das Projekt mit<br />
großer Begeisterung umgesetzt, was zum<br />
Beispiel zu einer deutlichen Steigerung<br />
des Bewusstseins in Bezug auf Biogas in<br />
der serbischen Öffentlichkeit geführt hat.<br />
Das KVP-Projekt in Indien macht trotz der<br />
Corona-Pandemie Fortschritte. Vom 7. bis<br />
8. Oktober <strong>2020</strong> fand eine sehr gut besuchte<br />
virtuelle Trainingstour mit Beteiligung<br />
des FVB statt. Die indische Biomethan-<br />
Broschüre steht kurz vor der Fertigstellung<br />
und auch ein Online-Portal für Labordienstleistungen<br />
konnte in Zusammenarbeit mit<br />
der Universität in Varanasi erfolgreich eingerichtet<br />
werden. Vor kurzem wurde zudem<br />
die Lobbyarbeit der IBA (Indian Biogas Association)<br />
belohnt, denn Gärprodukte wurden<br />
endlich in die indische FCO (Fertilizer<br />
Control Order = Düngemittelverordnung)<br />
aufgenommen.<br />
Der FvB freut sich auch sehr, die Zusage<br />
für ein weiteres KVP-Projekt erhalten zu<br />
haben. Am 1. Dezember <strong>2020</strong> startet das<br />
Projekt mit dem ugandischen Biogas Verband<br />
UNBA (Uganda National Biogas Alliance).<br />
Ziel ist, die UNBA zu einem starken<br />
und kompetenten Biogasverband auszubauen<br />
sowie die Produktion und Nutzung<br />
von Biogas als alternative Energiequelle zu<br />
fördern.<br />
Aktivitäten der Service GmbH<br />
In der Service GmbH des FvB standen in<br />
den vergangenen Wochen zwei Webseminare<br />
im Fokus: Zum einen konnten wir ein<br />
auf Baden-Württemberg zugeschnittenes<br />
Web-Seminar bezüglich der landesspezifischen<br />
Umsetzung der Düngeverordnung<br />
anbieten.<br />
Zum anderen haben wir erneut ein Web-<br />
Seminar zur Vorbereitung auf die EEG-<br />
Ausschreibungsrunde im November angeboten.<br />
Hier konnten sich die Teilnehmer in<br />
der Diskussion mit unserem Referat Energierecht<br />
über die technischen Auflagen und<br />
insbesondere die formalen Auflagen bei der<br />
Gebotsabgabe austauschen.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Geschäftsführer<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 · 85356 Freising<br />
0 81 61/98 46 60<br />
info@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
104
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Verband<br />
Individuelle Beratung und Konzepte<br />
• Anlagenerweiterung und -flexibilisierung<br />
• Optimierung des Anlagenbetriebes<br />
• Genehmigungsplanung<br />
• Vorbereitung, Betreuung sämtlicher Prüfungen<br />
neutral, herstellerunabhängig, kompetent<br />
Tel +49 (0)5844 976213 | mail@biogas-planung.de<br />
BIOGASBEHÄLTER – Fermenter, Gärrestlager, Vorgruben, ...<br />
WOLF SYSTEM GMBH | Am Stadtwald 20 | 94486 Osterhofen<br />
09932 37-0 | mail@wolfsystem.de | WWW.WOLFSYSTEM.DE<br />
Bauen mit System!<br />
Gut zu wissen!<br />
Die Fachverband Biogas service GmbH kümmert sich um die Organisation<br />
und Durchführung von Schulungen und Fachveranstaltungen. Wir bieten<br />
Beratungsangebote im Bereich der Energieerzeugung durch Biogasanlagen<br />
für Hersteller, Dienstleister und Betreiber an.<br />
Unser aktuelles Veranstaltungsangebot finden Sie unter:<br />
www.service-gmbh.biogas.org<br />
Aktuelle<br />
Branchenthemen:<br />
eeG, Ausschreibungen,<br />
zukunftsoptionen, sicherheit,<br />
Düngerecht u.v.m.<br />
sPReCHen sie<br />
uns An!<br />
© Fotolia_Countrypixel<br />
Fachverband Biogas Service GmbH<br />
Angerbrunnenstr. 12<br />
85356 Freising<br />
0049 8161 / 984660<br />
service-gmbH@biogas.org<br />
105
Verband<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
LEE Niedersachsen/Bremen e.V.<br />
Wir haben es in der Hand! –<br />
Erneuerbaren-Branche traf sich in Hannover<br />
Henrik Borgmeyer, Geschäftsführer der BioConstruct GmbH.<br />
LEE-Geschäftsführerin Silke Weyberg und<br />
LEE-Vorstandsmitglied Thorsten Kruse.<br />
LEE-Vorsitzende Bärbel Heidebroeck.<br />
Der Klimawandel macht keine Pause. Deshalb<br />
lud der Landesverband Erneuerbare<br />
Energien (LEE) Niedersachsen/Bremen e.V.<br />
Anfang September zum 2. Branchentag<br />
Erneuerbare Energien nach Hannover ein.<br />
Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil wandte<br />
sich mit einer Videobotschaft an die Besucher, bevor<br />
Linus Steinmetz von der Fridays For Future-Bewegung<br />
ein deutlich höheres Tempo bei der Energiewende anmahnte.<br />
LEE-Vorsitzende Bärbel Heidebroek forderte von der<br />
Politik, den Ausbau der Bioenergie deutlich stärker<br />
zu unterstützen. „Die Biogasbranche steht an einem<br />
Kipppunkt. Wir brauchen eine Stabilisierung und eine<br />
Weiterentwicklung des Anlagenbestands, keinen Rückbau“,<br />
betonte Heidebroek. Die LEE-Vorsitzende mahnte<br />
an, der Biogas-Branche mehr Marktperspektiven<br />
zu bieten. So sei etwa der<br />
Einsatz von Biomethan als<br />
Kraftstoff im Schwerlastbereich<br />
eine interessante Perspektive<br />
für die Anlagenbetreiber.<br />
„Doch hier braucht<br />
es Anreize, genau wie bei<br />
der verstärkten Güllevergärung.<br />
Niedersachsen muss<br />
hier Vorreiter werden“, forderte<br />
Heidebroek weiter.<br />
Ansätze, die sich nahtlos<br />
in die Diskussionsrunde<br />
„Rolle von grünen Gasen<br />
im Energiesystem der Zukunft“<br />
einfügten. Die Teilnehmer<br />
des Forums zeigten<br />
auf, dass Biomethan eine<br />
wichtige Rolle bei der Wärme-<br />
und Verkehrswende<br />
spielen kann. Dr. Christoph<br />
Merkel, der für die MARI-<br />
KO LNG-Koordinierungsstelle<br />
sprach, erklärte,<br />
dass Schätzungen zufolge<br />
bis 2050 rund ein Viertel<br />
des Kraftstoffverbrauchs<br />
im Schwerlastverkehr über<br />
Bio-LNG abgebildet wird.<br />
Thorsten Kruse, LEE-Vorstandsmitglied<br />
und Biogasanlagenbetreiber,<br />
stellte<br />
klar, dass die Branche willens<br />
ist, ihre Biomethankapazitäten<br />
durch einen stärkeren<br />
Einsatz von Gülle und Mist zu erhöhen, es aber<br />
zu hohe regulatorische Hürden für die Betriebe gibt:<br />
„Unter diesen Bedingungen ist es besser, gar nichts zu<br />
verändern, weil wir es regulatorisch nicht hinbekommen“,<br />
kritisierte Kruse weiter. Um die Güllevergärung<br />
nach vorne zu bringen, müsse die AwSV dahingehend<br />
geändert werden, dass die vergorene Gülle in die Herkunftsbehälter<br />
zurückverbracht werden kann.<br />
Henrik Borgmeyer, Geschäftsführer der BioConstruct<br />
GmbH, wies auf den enormen Preisverfall bei Biomethan<br />
hin und begrüßte die Chance, Biogas als Kraftstoff<br />
auf den Markt zu bringen. Der Einsatz von Mais als<br />
nachwachsendem Rohstoff bleibe auch bei einer größeren<br />
Verwertung von Gülle zur Wärmeversorgung der<br />
Fermenter notwendig. Langfristig ist die EEG-Umlage<br />
verzichtbar, so Borgmeyer, wenn es eine vernünftige<br />
CO 2<br />
-Bepreisung gibt.<br />
Fazit des Branchentags: Der Bioenergiestandort Niedersachsen<br />
spielt als Wärme-, Strom- und Gaslieferant<br />
eine besondere Bedeutung bei der Energiewende. Die<br />
Teilnehmer wünschten sich einhellig eine stärkere politische<br />
Unterstützung beim Thema Gärdüngerlagerung<br />
und bei der Abschaffung des Verwertungskonzepts.<br />
Ebenso muss sich der Weiterbetrieb der Anlagen auch<br />
nach Auslaufen der EEG-Förderung wirtschaftlich lohnen<br />
und politisch unterstützt werden.<br />
Autor<br />
Lars Günsel<br />
Pressesprecher<br />
LEE Niedersachen/Bremen e.V.<br />
Herrenstraße 6 · 30159 Hannover<br />
05 11/72 73 67-330<br />
l.guensel@lee-nds-hb.de<br />
www.lee-nds-hb.de<br />
Fotos: LEE Niedersachsen/Bremen<br />
106
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Verband<br />
IHR PARTNER FÜR FÖRDER-,<br />
DOSIER- UND ZUFÜHRTECHNIK<br />
VARIO DOSIERCONTAINER<br />
Watchdog-Pi<br />
smarter, kompakter Problemlöser<br />
für Biogasanlagen<br />
• Überwachung der Funktionstüchtigkeit<br />
einer SPS Anlagensteuerung<br />
• Rauchwarnmelder Ereignis<br />
• Netzausfallmeldung<br />
• Zugangskontrolle<br />
• Verfügbarkeit der Internetverbindung<br />
• Fernreset per Knopfdruck<br />
(z. B. Reset von Geräten)<br />
Ökostrom Saar GmbH<br />
Mike Kientz<br />
mike.kientz@oekostrom-saar.de<br />
Tel.: 06861 - 8291236<br />
Preiswert<br />
Erweiterbar<br />
von 7m³ bis 265m³<br />
einzigartiges Vario Schubbodensystem<br />
für 100% Grassilage und Mist<br />
in Teil- und Volledelstahl Ausführung<br />
geringer Energiebedarf<br />
VARIO COMPACT<br />
Schubbodensanierung<br />
in verstärkter<br />
Edelstahl-Lösung<br />
KLEINE RL 350V<br />
Bj. 2011 55.000,- € *<br />
Bj. 2010 35.000,- € *<br />
Kontaktieren Sie uns noch heute!<br />
Tel. +49 (0)173/5202610<br />
michael.halcour@ropa-maschinenbau.de<br />
*zzgl. MwSt.<br />
www.ropa-maschinenbau.de<br />
Axel Hagemeier GmbH & Co. KG<br />
Am Wasserfeld 8 • 27389 Fintel<br />
Tel.: 04265 / 13 65<br />
Fax: 04265 / 83 94<br />
E-Mail: info@axel-hagemeier.de<br />
Web: www.axel-hagemeier.de<br />
... für den sicheren Betrieb<br />
Tel. 0172/513 43 91<br />
www.as-j.de<br />
7m³ | 11m³| 16m³<br />
speziell für Biogas-Kleinanlagen<br />
einzigartiges Vario Schubbodensystem<br />
für 100% Grassilage und Mist<br />
in Teil- und Volledelstahl Ausführung<br />
MOBILE NOTFÜTTERUNG<br />
9x in Deutschland<br />
weitere Produkte auf<br />
www.terbrack-maschinenbau.de<br />
107<br />
Terbrack Maschinenbau GmbH<br />
Tel.: +49 2564 394 487 - 0<br />
mail: technik@terbrack-maschinenbau.de<br />
www.terbrack-maschinenbau.de
– 1 –<br />
1<br />
1<br />
Verband<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Materialien für Ihre<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Sie planen ein Hoffest, bekommen eine Schulklasse<br />
zu Besuch oder werden zum Wärmelieferanten?!<br />
Der Fachverband bietet Ihnen für (fast) jede Gelegenheit<br />
die passenden Materialien.<br />
Shop<br />
Samentütchen<br />
Bunte Pflanzenmischung<br />
für Garten und Balkon<br />
Bestellnr.: KL-003<br />
bis 50 Stück für Mitglieder kostenlos<br />
FLOWER POWER — Blühstreifenmischung<br />
Biogas bringt Farbe ins Feld<br />
Bunt blühende Pflanzen auf dem Acker und im Garten sehen<br />
nicht nur hübsch aus, sie bieten auch vielen Insekten und<br />
Wildtieren wertvo len Lebensraum.<br />
Biogasanlagen können aus ihnen am Ende des Sommers sogar<br />
noch Strom und Wärme erzeugen.<br />
Treiben Sie’s bunt und säen Sie mit. Für mehr Artenvielfalt!<br />
Inhalt (4 gr) Ringelblume, Sonnenblume, Malve,<br />
Phacelia, u.a.<br />
Aussaat April bis Mai (1gr/ m²)<br />
www.biogas.org<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und We ter.<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich. Biogas kann’s!<br />
Machen Sie mit!<br />
www.farbe-ins-feld.de<br />
FLOWER POWER — Blühstreifenmischung<br />
FLOWER POWER — Blühstreifenmischung<br />
Biogas bringt Farbe ins Feld<br />
Bunt blühende Pflanzen auf dem Acker und im Garten sehen<br />
nicht nur hübsch aus, sie bieten auch vielen Insekten und<br />
Wildtieren wertvollen Lebensraum.<br />
Biogasanlagen können aus ihnen am Ende des Sommers sogar<br />
noch Strom und Wärme erzeugen.<br />
Treiben Sie’s bunt und säen Sie mit. Für mehr Artenvielfalt!<br />
Inhalt (4 gr) Ringelblume, Sonnenblume, Malve,<br />
Phacelia, u.a.<br />
Aussaat April bis Mai (1gr/ m²)<br />
www.biogas.org<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und We ter.<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich. Biogas kann’s!<br />
Machen Sie mit!<br />
www.farbe-ins-feld.de<br />
Biogas bringt Farbe ins Feld<br />
Bunt blühende Pflanzen auf dem Acker und im Garten sehen<br />
nicht nur hübsch aus, sie bieten auch vielen Insekten und<br />
Wildtieren wertvollen Lebensraum.<br />
Biogasanlagen können aus ihnen am Ende des Sommers sogar<br />
noch Strom und Wärme erzeugen.<br />
Treiben Sie’s bunt und säen Sie mit. Für mehr Artenvielfalt!<br />
Inhalt (4 gr) Ringelblume, Sonnenblume, Malve,<br />
Phacelia, u.a.<br />
Aussaat<br />
April bis Mai (1gr/ m²)<br />
www.biogas.org<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich. Biogas kann’s!<br />
Machen Sie mit!<br />
www.farbe-ins-feld.de<br />
DVD<br />
Unterrichtsfilm<br />
Erneuerbare Energien<br />
Auch auf Youtube (FVBiogas)<br />
und zum Download auf Vimeo<br />
eine DVD für Schulen kostenlos<br />
Bestellungen an:<br />
andrea.horbelt@biogas.org<br />
Broschüre<br />
Biogas-Wissen<br />
Grundlegende Informationen rund um<br />
die Biogasnutzung in Deutschland<br />
Biogas<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
Broschüren<br />
Die Biogas Know-how-Serie –<br />
auch online verfügbar<br />
DIN A5-Format, 28 Seiten<br />
Bestellnr.: BVK-23 (deutsch)<br />
bis zu 20 Ex. kostenlos<br />
darüber 50 Cent / Broschüre<br />
BIOGAS Wissen_Kompakt<br />
BIOGAS<br />
Safety first!<br />
Guidelines for the safe use<br />
of biogas technology<br />
Biogas to<br />
Biomethane<br />
Düngen mit<br />
Gärprodukten<br />
Biogas aus<br />
Bioabfall<br />
Biomethan-Aufkleber<br />
16 x 6,8 cm<br />
WV-017 (blau)<br />
WV-018 (weiß)<br />
Schrift auf<br />
transparentem<br />
Hintergrund<br />
ein Paar für Mitglieder kostenlos,<br />
regulär 2,50 Euro (zzgl. Versandkosten)<br />
Ich fahre mit Biomethan =<br />
50% weniger Kraftstoffkosten!<br />
www.biogas.org<br />
BIOGAS Know-how_2<br />
DIN A4-Format,<br />
68 Seiten<br />
Best.Nr.: KL-024<br />
(englisch)<br />
BIOGAS Know-how_3<br />
DIN A4-Format,<br />
68 Seiten<br />
Best.Nr.: KL-018<br />
(englisch)<br />
BIOGAS Wissen_2<br />
DIN A4-Format,<br />
68 Seiten<br />
Best.Nr.: KL-025<br />
(deutsch)<br />
ein Heft kostenlos<br />
bei mehreren Heften berechnen wir Versand und Verpackung<br />
BIOGAS Wissen_3<br />
DIN A4-Format,<br />
64 Seiten<br />
Best.Nr.: KL-022<br />
(deutsch)<br />
mer<br />
hert und je nach Bedarf in Energie umgewandelt<br />
mal kein Wind weht und keine Sonne scheint.<br />
e Stromnetze und ist für die technische Umsetde<br />
von entscheidender Bedeutung.<br />
... und artenreich<br />
Energiedörfer mit Biogas<br />
Biogas eignet sich hervorragend für die<br />
lokale Energieversorgung – und für neue<br />
Energiekonzepte in Kommunen und<br />
Regionen. Zahlreiche Wärmenetze, die<br />
teilweise genossenschaftlich betrieben<br />
werden, unterstreichen dieses Potenzial.<br />
Regionale Wertschöpfung<br />
Biogasanlagen produzieren dort Energie,<br />
wo sie gebraucht wird: In den Regionen.<br />
Das Geld für den Bau, den Betrieb und<br />
die Instandhaltung der Anlagen bleibt<br />
vor Ort – und fließt nicht in die Taschen<br />
der Ölmultis. Das sichert die regionale<br />
Energieversorgung und ist ein aktiver<br />
Beitrag zur Friedenspolitik.<br />
Faltblätter<br />
Viele Landwirte verzichten freiwillig auf einen Teil ihres Gasertrages und setzen<br />
Pflanzen ein, die einen ökologischen Mehrwert für Mensch und Natur haben.<br />
„Die Biogasnutzung bietet die Möglichkeit,<br />
unterschiedlichste Pflanzen sinnvo l anzubauen<br />
und damit einerseits den Boden und das<br />
Grundwasser zu schützen und andererseits die<br />
Artenvielfalt auf den Feldern zu erhöhen.<br />
Das sieht nicht nur schön aus – es ist auch<br />
ein wichtiger Beitrag für den dringend<br />
notwendigen Schutz unserer Insekten.“<br />
Der Fachverband Biogas e.V. ist mit über<br />
4.700 Mitgliedern die größte deutsche<br />
und europä ische Interessenvertretung der<br />
Biogas-Branche.<br />
to go<br />
Ziel der Verbandsarbeit ist es, die Biogaserzeugung<br />
und -nutzung für die bundes weite<br />
Strom-, Wärme- und Kraftstoff versorgung zu<br />
erhalten und auszubauen.<br />
Handliche Fakten zur<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12<br />
85356 Freising<br />
Biogasnutzung<br />
A +49 (0)8161 984 660<br />
m info@biogas.org<br />
Peter Maske, Präsident Deutscher Imkerbund e.V.<br />
www.biogas.org<br />
11,8 x 11 cm<br />
Über gezielte Agrar-Fördermaßnahmen könnte<br />
Biogas einen wichtigen Beitrag für die Artenvielfalt<br />
leisten.<br />
1_Bestellnr.: BVK-37<br />
2_Bestellnr.: BVK-44<br />
3_Bestellnr.: BVK-45<br />
4_Bestellnr.: BVK-46<br />
Eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden<br />
Alternativen Energiepflanzen bietet die Seite<br />
www.farbe-ins-feld.de<br />
Der Fachverband Biogas e.V. ist mit über<br />
4.700 Mitgliedern die größte deutsche und<br />
europäische Interessenvertretung der<br />
Biogas-Branche.<br />
Ziel der Verbandsarbeit ist es, die Biogaserzeugung<br />
und -nutzung für die bundesweite<br />
Strom-, Wärme- und Kraftstoffversorgung zu<br />
erhalten und auszubauen<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12<br />
85356 Freising<br />
A +49 (0)8161 984 660<br />
m info@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
bis zu 20 Ex. kostenlos<br />
darüber 50 Cent / Heft<br />
Wissen_to go_1<br />
BIOGAS<br />
Biogas to go<br />
Artenvielfalt<br />
mit Biogas<br />
Handliche Fakten<br />
zur Biogasnutzung<br />
Biogas kann alles<br />
- - - - - - - - - - - 116 mm - - - - - - - - - - - > < - - - - - - - - - - - 118 mm - - - - - - - - - - - >< - - - - - - - - - - - 118 mm - - - - - - - - - - - > < - - - - - - - - - - - 116 mm - - - - - - - - - - - ><br />
Das Recycling von Bioabfä len in Biogasanlagen findet über die Vergärung und Kompostierung<br />
statt. Durch biologische Abbauprozesse entsteht in den Fermentern aus<br />
den Kartoffelschalen, dem Pizzarest und dem abgelaufenen Joghurt der Energieträger<br />
Biogas. Übrig bleibt ein hochwertiger Dünger, das sogenannte Gärprodukt.<br />
Dieses liefert a le wichtigen Nähr- und Humusstoffe für das erneute Pflanzenwachstum.<br />
Damit schließt sich der Nährstoffkreislauf. Die Vergärung in Biogasanlagen<br />
steht damit ganz klar vor der Verbrennung oder Deponierung.<br />
tuFige<br />
ierAchie<br />
ndung<br />
eislauf)<br />
„Wenn unsere Nahrung<br />
schon in der Tonne statt<br />
auf dem Teller landet, dann<br />
sollte sie wenigstens noch<br />
sinnvoll genutzt werden“<br />
Georg Hackl, Rode legende<br />
Der Fachverband Biogas e.V. ist mit über<br />
4.700 Mitgliedern die größte deutsche und<br />
europäische Interessenvertretung der<br />
Biogas-Branche.<br />
Wissen_to go_2<br />
Ziel der Verbandsarbeit ist es, die Biogaserzeugung<br />
und –nutzung für die bundesweite<br />
Strom-, Wärme- und Kraftstoffversorgung zu<br />
erhalten und auszubauen.<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12<br />
85356 Freising<br />
BIOGAS<br />
Handliche Fakten<br />
zur Biogasnutzung<br />
Biogas ist der vielseitigste erneuerbare Energieträger. Das umweltfreundliche<br />
Gas kann sowohl zur Strom- und Wärmegewinnung wie<br />
auch als Kraftstoff eingesetzt werden. Damit ist Biogas eine wichtige<br />
Säule für die bürgernahe und bezahlbare Energiewende!<br />
Biogas ist bunt ...<br />
Strom aus Biogas<br />
Biogas versorgt schon heute Millionen Haushalte in<br />
Deutschland mit klimafreundlichem Strom. Bei der<br />
Stromgewinnung im Blockheizkraftwerk entsteht automatisch<br />
auch Wärme.<br />
Biogas entsteht durch die Vergärung biogener Stoffe in einem luftdicht abgeschlossenen<br />
Behälter, dem sogenannten Fermenter. Vergoren werden kann fast a les,<br />
was biologischen Ursprungs ist: Gü le und Mist, Bioabfä le - oder Energiepflanzen.<br />
Letztere werden von den Landwirten extra angebaut. Ende 2018 wuchsen auf gut<br />
1,4 Mi lionen Hektar Energiepflanzen für den Einsatz<br />
in Biogasanlagen. Das sind rund acht Prozent<br />
der landwirtschaftlichen Nutzfläche.<br />
Wärme aus Biogas<br />
Mit Biogaswärme können zum Beispiel private Haushalte,<br />
kommunale Einrichtungen wie Schulen, Schwimmbäder<br />
und Turnhallen, Gewerbebetriebe oder Gewächshäuser<br />
beheizt werden.<br />
Biogas aus<br />
Bioabfällen<br />
Fast jede Pflanze eignet sich für die Vergärung:<br />
bunte Wildblumen, weiß blühender Buchweizen<br />
oder die gelb blühende Durchwachsene Silphie.<br />
Sie unterscheiden sich jedoch in ihrem Gas- und<br />
damit Stromertrag. Aus einem Hektar Mais können<br />
ca. 21.000 Kilowattstunden Strom erzeugt<br />
werden. Bei der bunten Alternative Wildpflanzen<br />
liegt der Energieertrag etwa bei der Hälfte.<br />
Kraftstoff aus Biogas<br />
Zu Biomethan aufbereitetes Biogas kann als klimafreundlicher<br />
und effizienter Kraftstoff von jedem CNG<br />
(compressed natural gas)-Fahrzeug getankt werden. Mit<br />
dem Biomethanertrag von einem Hektar Wildpflanzen<br />
kann ein Pkw einmal um die Erde fahren.<br />
Zahlreiche Institute und Hochschulen, aber auch<br />
viele Landwirte testen die verschiedensten Pflanzen<br />
auf ihre Biogastauglichkeit. In den letzten<br />
Jahren konnten dabei große Fortschritte erzielt<br />
werden und die Palette der potenzie len Energiepflanzen<br />
wächst kontinuierlich.<br />
oklet-Artenvielfalt 2018.indd 1 11.07.19 13:48<br />
rgetische) Verwertung<br />
Potenzial und Perspektive<br />
Die erste Biomethananlage Deutschlands ging 2006 im bayerischen Pliening in<br />
Betrieb. Im Jahr 2018 waren es bereits über 200. So viele wie in keinem anderen<br />
europäischen Land. Zusammen speisen diese Anlagen rund zehn Terawattstunden<br />
Biomethan ins deutsche Gasnetz ein – das entspricht etwa zwölf Prozent der<br />
hierzulande geförderten Erdgasmenge bzw. etwa einem Prozent des nationalen<br />
Erdgasbedarfs. Biomethan verdrängt fossile Energieträger aus dem Markt und<br />
trägt damit zur Versorgungssicherheit bei.<br />
Die Einspeisung von Biomethan ins Gasnetz<br />
ermöglicht es, den Energieträger Biogas<br />
über mehrere Monate zu speichern.<br />
Damit ist Biogas eine hervorragende Ergänzung<br />
zu den fluktuierenden Erneuerbaren<br />
Energien Wind und Sonne und ein<br />
wichtiges Bindeglied der Energiewende.<br />
Auch für kleinere Biogasanlagen kann sich<br />
die Aufbereitung von Biogas zu Biomethan<br />
rechnen. Für den Anlagenbetreiber eröffnen<br />
sich damit vielversprechende Perspektiven<br />
– und auch die Wertschöpfung in<br />
der Region bekommt neue Impulse.<br />
A +49 (0)8161 984 660<br />
m info@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
Der Fachverband Biogas e.V. ist mit über<br />
4.700 Mitgliedern die größte deutsche<br />
und europä ische Interessenvertretung der<br />
Biogas-Branche.<br />
Ziel der Verbandsarbeit ist es, die Biogaserzeugung<br />
und -nutzung für die bundes weite<br />
Strom-, Wärme- und Kraftstoff versorgung zu<br />
erhalten und auszubauen.<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12<br />
85356 Freising<br />
A +49 (0)8161 984 660<br />
m info@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
Wissen_to go_3<br />
BIOGAS<br />
Wissen_to go_4<br />
BIOGAS<br />
u<br />
v<br />
Biomethan<br />
Handliche Fakten<br />
zur Biogasnutzung<br />
Handliche Fakten<br />
zur Biogasnutzung<br />
<br />
Gelebte Kreislaufwirtschaft<br />
Wo Lebensmittel erzeugt und verbraucht werden, entsteht immer auch Abfa l. Das<br />
wird sich nie ganz vermeiden lassen. Seien es die Kartoffelschalen bei der Chips-<br />
Herste lung, die nicht ganz aufgegessene Pizza im Restaurant oder der abgelaufene<br />
Joghurt im Kühlregal.<br />
In der 5-stufigen Abfa lhierarchie des Kreislaufwirtschaftgesetzes hat die<br />
Vermeidung von Abfä len höchste Priorität. Gefolgt von der Wiederverwendung<br />
von Lebensmitteln – beispielsweise durch die Tafeln.<br />
An dritter Ste le kommt das Recycling, um (Nährstoff)Kreisläufe zu<br />
schließen und das Abfa laufkommen zu reduzieren. Dann erst folgt<br />
die energetische Verwertung (z.B. in Müllverbrennungsanlagen)<br />
und ganz am Ende steht die Beseitigung, sprich die Ablagerung<br />
oder Deponierung, die zu vermeiden ist. FÜNFs<br />
Was ist Biomethan?<br />
Biogas besteht zu 50 – 60 Prozent aus dem brennbaren Gas<br />
Methan (CH 4 ); der Rest ist überwiegend Kohlendioxid (CO 2 ).<br />
Bei der Auf bereitung von Biogas zu Biomethan werden die nichtbrennbaren<br />
Gase abgetrennt, so dass möglichst reines Methan übrig bleibt. Dies kann über<br />
verschiedene Verfahren geschehen (siehe Innenteil). Das so erzeugte Biomethan<br />
hat die gleichen chemisch-physikalischen Eigenschaften wie Erdgas<br />
und kann problemlos ins Gasnetz eingespeist werden.<br />
Mit der Einspeisung von Biomethan ins<br />
Gasnetz kann der Ort der Erzeugung vom<br />
Ort der Nutzung entkoppelt werden. Das<br />
eingespeiste Biomethan kann an beliebiger<br />
Ste le aus dem Netz entnommen und<br />
entweder in einem Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) zu Strom und Wärme umgewandelt<br />
werden, in der Gasheizung eingesetzt<br />
oder an einer Gastankste le von<br />
jedem handelsüblichen CNG-Fahrzeug<br />
getankt werden.<br />
<br />
Comic<br />
Die kleine Geschichte von<br />
Julius & seinen Freunden<br />
… oder wie man ganz einfach<br />
Biogas gewinnen kann.<br />
A5 quer, Bestellnr.: BVK-21<br />
ABFALLh<br />
1. Vermeidung<br />
2. Wiederverwe<br />
bis 20 Hefte kostenlos,<br />
darüber 50 Cent / Heft<br />
3. Recycling (Kr<br />
4. Sonstige (ene<br />
5. Beseitigung<br />
108
Um die Erderhitzung zu stoppen müssen wir auf Erneuerbare Energien umsteigen.<br />
Sonne und Wind stehen uns unbegrenzt und kostenlos zur<br />
Verfügung. Aber nicht immer. Deshalb brauchen wir zusätzliche regenerative<br />
Quellen, die verlässlich zur Verfügung stehen. So wie Biogas.<br />
Das in den Fermentern bei der Vergärung von Gülle, Bioabfall und<br />
Energiepflanzen entstehende Gas kann gespeichert und je nach Bedarf<br />
kurzfristig in Strom und Wärme umgewandelt werden. So wird der<br />
Wind- und Solarstrom genutzt, wenn er entsteht - und Biogas springt ein,<br />
sobald Sonne und Wind eine Pause machen.<br />
Die Biogasanlage Biogas GmbH hat zwei Blockheizkraftwerke (BHKW) mit<br />
einer Leistung von je 250 kW. Darin wird aus Biogas Strom und Wärme<br />
erzeugt.<br />
Die Kraftwerke werden von den Stadtwerken XY ferngesteuert. Je nach<br />
Strombedarf können sie an- oder abgeschaltet werden. Wenn das<br />
Stromnetz voll ist, wird das Biogas in der Kuppel des Fermenters<br />
gespeichert. Und wenn Strombedarf besteht, können die BHKWs<br />
innerhalb weniger Sekunden ihre maximale Leistung von 500 kW abrufen.<br />
Biogasanlage Biogas GmbH<br />
Die im Fermenter befindlichen Bakterien wandeln die Biomasse,<br />
z.B. biologische Abfälle, nachwachsende Rohstoffe und Gülle,<br />
zu Biogas und Gärprodukten um.<br />
Das erzeugte Biogas wird in der Gashaube aufgefangen<br />
und von hier über Gasleitungen zum<br />
Blockheizkraftwerk (BHKW) transportiert.<br />
Im BHKW wird aus dem Biogas<br />
Strom und Wärme erzeugt.<br />
1 Lager für die zu vergärende Biomasse<br />
(Silo, Annahmestelle, Güllegrube)<br />
2 ggf. Aufbereitung, Sortierungs- oder<br />
Reinigungssysteme für die zu vergärende<br />
Biomasse oder Reststoffe<br />
3 Einbring- / Pumptechnik transportiert<br />
die Biomasse in die Fermenter bzw.<br />
aus diesen heraus<br />
4 Rührwerke vermischen die Bakterien<br />
im Fermenter mit der frischen Biomasse<br />
5 Heizung – die übliche Gärtemperatur<br />
liegt bei 40 °C<br />
6 Gasspeicher zur kurz- und mittelfristigen<br />
Speicherung des Biogases<br />
7 Gasreinigungssysteme zur Entschwefelung<br />
und Entwässerung<br />
8 Pumpleitungen für Gärsubstrate<br />
und Biogasleitungen<br />
9 Sicherheitstechnik: Drucksicherungen,<br />
Sicherheitsventile<br />
10 Blockheizkraftwerk für die gleichzeitige<br />
Strom- und Wärmeproduktion<br />
11 ggf. Aufbereitungs technik für die<br />
Um wandlung von Biogas zu Biomethan<br />
12 Lagerbehälter für die ausgefaulten<br />
Gärprodukte (ggf. mit entsprechender<br />
Technik zur Weiterverarbeitung<br />
(Fest-/Flüssigtrennung, Trocknung,<br />
Pelletierung etc.)<br />
FV Schild - so funktioniert eine Anlage A0 quer.indd 1 16.06.16 11:00<br />
Planeten.<br />
Die im Fermenter befindlichen Bakterien wandeln die Biomasse, z.B. biologische Abfälle,<br />
nachwachsende Rohstoffe und Gülle, zu Biogas und Gärprodukten um. Das erzeugte Biogas<br />
wird in der Gashaube aufgefangen und von hier über Gasleitungen zum Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) transportiert. Im BHKW wird aus dem Biogas Strom und Wärme erzeugt.<br />
Bei der Ausgestaltung von Biogasanlagen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme,<br />
Techniken und Funktionsweisen. Der übliche Aufbau umfasst folgende Komponenten:<br />
1<br />
2<br />
6<br />
9<br />
3<br />
5 4<br />
3<br />
12<br />
8<br />
1 Lager für die zu vergärende Biomasse<br />
(Silo, Annahmestelle, Güllegrube)<br />
2 ggf. Aufbereitung, Sortierungs oder<br />
Reinigungssysteme für die zu vergärende<br />
Biomasse oder Reststoffe<br />
3 Einbring / Pumptechnik transportiert<br />
die Biomasse in die Fermenter bzw.<br />
aus diesen heraus<br />
4 Rührwerke vermischen die Bakterien<br />
im Fermenter mit der frischen Biomasse<br />
5 Heizung – die übliche Gärtemperatur<br />
liegt bei 40 °C<br />
6 Gasspeicher zur kurz und mittelfristigen<br />
Speicherung des Biogases<br />
7 Gasreinigungssysteme zur<br />
Entschwefelung und Entwässerung<br />
8<br />
7<br />
5<br />
8<br />
11<br />
Erdgasnetz<br />
10<br />
Strom<br />
Wärme<br />
8 Pumpleitungen für Gärsubstrate<br />
und Biogasleitungen<br />
9 Sicherheitstechnik: Drucksicherungen,<br />
Sicherheitsventile<br />
10 Blockheizkraftwerk für die gleichzeitige<br />
Strom und Wärmeproduktion<br />
11 ggf. Aufbereitungstechnik für die<br />
Umwandlung von Biogas zu Biomethan<br />
12 Lagerbehälter für die ausgefaulten<br />
Gärprodukte (ggf. mit entsprechender<br />
Technik zur Weiterverarbeitung<br />
(Fest/Flüssigtrennung, Trocknung,<br />
Pelletierung etc.)<br />
1<br />
2<br />
9<br />
3<br />
5 4<br />
3<br />
12<br />
8<br />
1 Lager für die zu vergärende Bioma se<br />
(Silo, Annahmestelle, Gü legrube)<br />
2 gf. Aufbereitung, Sortierungs oder<br />
Reinigung systeme für die zu ver<br />
3 Einbring / Pumptechnik transportiert<br />
die Bioma se in die Fermenter bzw.<br />
4 Rührwerke vermischen die Bakterien<br />
im Fermenter mit der frischen Bio<br />
5 Heizung – die übliche Gärtemperatur<br />
liegt bei 40 °C<br />
6 Ga speicher zur kurz und mi telfristigen<br />
Speicherung des Biogases<br />
7 Gasreinigung systeme zur<br />
Entschwefelung und Entwä serung<br />
gärende Bioma se oder Reststo fe<br />
aus diesen heraus<br />
ma se<br />
6<br />
Wärme<br />
8<br />
7<br />
5<br />
8<br />
8 Pumpleitungen für Gärsubstrate<br />
und Biogasleitungen<br />
9 Sicherheitstechnik: Drucksicherungen,<br />
Sicherheitsventile<br />
10 Blockheizkraftwerk für die gleichzeitige<br />
Strom und Wärmeproduktion<br />
11 gf. Aufbereitungstechnik für die<br />
Umwandlung von Biogas zu Bio<br />
12 Lagerbehälter für die ausgefaulten<br />
Gärprodukte (ggf. mit entsprechen<br />
methan<br />
der Technik zur Weiterverarbeitung<br />
(Fest/Flü sigtrennung, Trocknung,<br />
Pelletierung etc.)<br />
1<br />
Strom<br />
10<br />
Erdgasnetz<br />
1<br />
2<br />
9<br />
3<br />
5 4<br />
3<br />
12<br />
8<br />
1 Lager für die zu vergärende Biomasse<br />
(Silo, Annahmeste le, Gü legrube)<br />
2 gf. Aufbereitung, Sortierungs oder<br />
Reinigung systeme für die zu vergärende<br />
Bioma se oder Reststo fe<br />
3 Einbring / Pumptechnik transportiert<br />
die Bioma se in die Fermenter bzw.<br />
aus diesen heraus<br />
4 Rührwerke vermischen die Bakterien<br />
im Fermenter mit der frischen Bioma<br />
se<br />
5 Heizung – die übliche Gärtemperatur<br />
liegt bei 40 °C<br />
6 Ga speicher zur kurz und mi telfristigen<br />
Speicherung des Biogases<br />
7 Gasreinigung systeme zur<br />
Entschwefelung und Entwä serung<br />
6<br />
8<br />
7<br />
5<br />
8<br />
Wärme<br />
Strom<br />
8 Pumpleitungen für Gärsubstrate<br />
und Biogasleitungen<br />
9 Sicherheitstechnik: Drucksicherungen,<br />
Sicherheitsventile<br />
10 Blockheizkraftwerk für die gleichzeitige<br />
Strom und Wärmeproduktion<br />
11 ggf. Aufbereitungstechnik für die<br />
Umwandlung von Biogas zu Biomethan<br />
12 Lagerbehälter für die ausgefaulten<br />
Gärprodukte ( gf. mit entsprechender<br />
Technik zur Weiterverarbeitung<br />
(Fest/Flü sigtrennung, Trocknung,<br />
Pe letierung etc.)<br />
1<br />
10<br />
Erdgasnetz<br />
Fast jede Pflanze kann in Biogasanlagen vergoren und zu Strom<br />
und Wärme umgewandelt werden – auch jene, die in der Lebensund<br />
Futtermittelproduktion keine Verwendung finden.<br />
Das bei der Energieerzeugung freigesetzte CO 2 entspricht in etwa<br />
der Menge, die die Pflanzen während Ihres Wachstums gebunden<br />
haben.<br />
Durchwachsene Silphie<br />
Franken-Therme Bad Windsheim<br />
Biogasanlage Bad Windsheim<br />
Regionale Biogasanlage<br />
Biogas trägt dazu bei, dass unsere Felder bunter und artenreicher<br />
werden. Blühende Pflanzen sehen nicht nur schön aus, sie bieten<br />
vor allem Lebensraum für Insekten und Wildtiere und verbessern<br />
die Bodengesundheit.<br />
Die Pflanzen benötigen in der Regel keine Pflanzenschutzmittel,<br />
schonen die Umwelt und schützen den Boden vor Auswaschung.<br />
Wildpflanzenmischung<br />
Wärmeabnehmer Freibad<br />
Die im Fermenter befindlichen Bakterien wandeln die Biomasse, z.B. biologische Abfälle,<br />
nachwachsende Rohstoffe und Gülle, zu Biogas und Gärprodukten um. Das erzeugte Biogas<br />
wird in der Gashaube aufgefangen und von hier über Gasleitungen zum Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) transportiert. Im BHKW wird aus dem Biogas Strom und Wärme erzeugt.<br />
Bei der Ausgestaltung von Biogasanlagen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme,<br />
Techniken und Funktionsweisen. Der übliche Aufbau umfasst folgende Komponenten:<br />
1<br />
2<br />
9<br />
3<br />
5 4<br />
3<br />
12<br />
8<br />
1 Lager für die zu vergärende Biomasse<br />
(Silo, Annahmestelle, Güllegrube)<br />
2 ggf. Aufbereitung, Sortierungs oder<br />
Reinigungssysteme für die zu vergärende<br />
Biomasse oder Reststoffe<br />
3 Einbring / Pumptechnik transportiert<br />
die Biomasse in die Fermenter bzw.<br />
aus diesen heraus<br />
4 Rührwerke vermischen die Bakterien<br />
im Fermenter mit der frischen Biomasse<br />
5 Heizung – die übliche Gärtemperatur<br />
liegt bei 40 °C<br />
6 Gasspeicher zur kurz und mittelfristigen<br />
Speicherung des Biogases<br />
7 Gasreinigungssysteme zur<br />
Entschwefelung und Entwässerung<br />
Die im Fermenter befindlichen Bakterien wandeln die Biomasse, z.B. biologische Abfälle,<br />
nachwachsende Rohstoffe und Gülle, zu Biogas und Gärprodukten um. Das erzeugte Biogas<br />
wird in der Gashaube aufgefangen und von hier über Gasleitungen zum Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) transportiert. Im BHKW wird aus dem Biogas Strom und Wärme erzeugt.<br />
Bei der Ausgestaltung von Biogasanlagen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme,<br />
Techniken und Funktionsweisen. Der übliche Aufbau umfasst folgende Komponenten:<br />
1<br />
2<br />
9<br />
3<br />
5 4<br />
3<br />
12<br />
8<br />
1 Lager für die zu vergärende Biomasse<br />
(Silo, Annahmestelle, Güllegrube)<br />
2 ggf. Aufbereitung, Sortierungs- oder<br />
Reinigungssysteme für die zu vergärende<br />
Biomasse oder Reststoffe<br />
3 Einbring- / Pumptechnik transportiert<br />
die Biomasse in die Fermenter bzw.<br />
aus diesen heraus<br />
4 Rührwerke vermischen die Bakterien<br />
im Fermenter mit der frischen Biomasse<br />
5 Heizung – die übliche Gärtemperatur<br />
liegt bei 40 °C<br />
6 Gasspeicher zur kurz- und mittelfristigen<br />
Speicherung des Biogases<br />
7 Gasreinigungssysteme zur<br />
Entschwefelung und Entwässerung<br />
Die im Fermenter befindlichen Bakterien wandeln die Biomasse, z.B. biologische Abfälle,<br />
nachwachsende Rohstoffe und Gülle, zu Biogas und Gärprodukten um. Das erzeugte Biogas<br />
wird in der Gashaube aufgefangen und von hier über Gasleitungen zum Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) transportiert. Im BHKW wird aus dem Biogas Strom und Wärme erzeugt.<br />
Bei der Ausgestaltung von Biogasanlagen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme,<br />
Techniken und Funktionsweisen. Der übliche Aufbau umfasst folgende Komponenten:<br />
1<br />
2<br />
9<br />
3<br />
5 4<br />
3<br />
12<br />
8<br />
1 Lager für die zu vergärende Biomasse<br />
(Silo, Annahmestelle, Güllegrube)<br />
2 ggf. Aufbereitung, Sortierungs oder<br />
Reinigungssysteme für die zu vergärende<br />
Biomasse oder Reststoffe<br />
3 Einbring / Pumptechnik transportiert<br />
die Biomasse in die Fermenter bzw.<br />
aus diesen heraus<br />
4 Rührwerke vermischen die Bakterien<br />
im Fermenter mit der frischen Biomasse<br />
5 Heizung – die übliche Gärtemperatur<br />
liegt bei 40 °C<br />
6 Gasspeicher zur kurz und mittelfristigen<br />
Speicherung des Biogases<br />
7 Gasreinigungssysteme zur<br />
Entschwefelung und Entwässerung<br />
6<br />
6<br />
8 Pumpleitungen für Gärsubstrate<br />
und Biogasleitungen<br />
9 Sicherheitstechnik: Drucksicherungen,<br />
Sicherheitsventile<br />
10 Blockheizkraftwerk für die gleichzeitige<br />
Strom und Wärmeproduktion<br />
11 ggf. Aufbereitungstechnik für die<br />
Umwandlung von Biogas zu Biomethan<br />
12 Lagerbehälter für die ausgefaulten<br />
Gärprodukte (ggf. mit entsprechender<br />
Technik zur Weiterverarbeitung<br />
(Fest/Flüssigtrennung, Trocknung,<br />
Pelletierung etc.)<br />
8<br />
7<br />
5<br />
8<br />
Wärme<br />
8 Pumpleitungen für Gärsubstrate<br />
und Biogasleitungen<br />
9 Sicherheitstechnik: Drucksicherungen,<br />
Sicherheitsventile<br />
10 Blockheizkraftwerk für die gleichzeitige<br />
Strom- und Wärmeproduktion<br />
11 ggf. Aufbereitungstechnik für die<br />
Umwandlung von Biogas zu Biomethan<br />
12 Lagerbehälter für die ausgefaulten<br />
Gärprodukte (ggf. mit entsprechender<br />
Technik zur Weiterverarbeitung<br />
(Fest-/Flüssigtrennung, Trocknung,<br />
Pelletierung etc.)<br />
FV Anlagenschild A0 quer.indd 1 11.02.16 16:10<br />
6<br />
8<br />
7<br />
5<br />
8<br />
Wärme<br />
8<br />
7<br />
5<br />
8<br />
Wärme<br />
11<br />
Strom<br />
11<br />
11<br />
Erdgasnetz<br />
10<br />
Strom<br />
Strom<br />
Erdgasnetz<br />
8 Pumpleitungen für Gärsubstrate<br />
und Biogasleitungen<br />
9 Sicherheitstechnik: Drucksicherungen,<br />
Sicherheitsventile<br />
10 Blockheizkraftwerk für die gleichzeitige<br />
Strom und Wärmeproduktion<br />
11 ggf. Aufbereitungstechnik für die<br />
Umwandlung von Biogas zu Biomethan<br />
12 Lagerbehälter für die ausgefaulten<br />
Gärprodukte (ggf. mit entsprechender<br />
Technik zur Weiterverarbeitung<br />
(Fest/Flüssigtrennung, Trocknung,<br />
Pelletierung etc.)<br />
10<br />
10<br />
Erdgasnetz<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Verband<br />
Variable Schilder<br />
Feldschilder<br />
zu einem von Ihnen gewählten Thema mit<br />
unterschiedlichem Layout und unterschiedlicher<br />
Farbgebung.<br />
DIN A0-Format<br />
Bestellnr.: FA-007<br />
Bitte kontaktieren Sie uns!<br />
80 Euro (inkl. Versand)<br />
Diese Biogasanlage<br />
schützt unser Klima<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
Klimaschutz .<br />
Die Erderhitzung ist die größte Bedrohung für den Fortbestand unseres<br />
Wir müssen unser Klima schützen und den Ausstoß von CO 2<br />
drastisch reduzieren. Jetzt.<br />
Mit den Erneuerbaren Energien haben wir die Chance, dies zu scha fen.<br />
Biogasanlagen leisten einen wichtigen Beitrag auf unserem Weg in eine<br />
klimafreundliche Zukunft.<br />
.durch Biogas<br />
Die Biogasanlage Biogas GmbH erzeugt im Jahr 300.000 Kilowattstunden<br />
Strom. Das entspricht dem Verbrauch von 100 durchschni tlichen<br />
Haushalten.<br />
Die bei der Stromerzeugung anfa lende Wärme wird im Sta l und im<br />
Wohnhaus eingesetzt und außerdem zur Holztrocknung genutzt. In der<br />
Summe spart diese Biogasanlage 450 Tonnen CO 2 ein, die beim Einsatz<br />
fossiler Energieträger wie Kohle und Öl freigesetzt worden wären.<br />
So funktioniert eine Biogasanlage<br />
Die im Fermenter befindlichen Bakterien wandeln die Bioma se, z.B. biologische Abfä le,<br />
nachwachsende Rohstoffe und Gü le, zu Biogas und Gärprodukten um. Das erzeugte Biogas<br />
wird in der Gashaube aufgefangen und von hier über Gasleitungen zum Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) transportiert. Im BHKW wird aus dem Biogas Strom und Wärme erzeugt.<br />
Bei der Ausgestaltung von Biogasanlagen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme,<br />
Techniken und Funktionsweisen. Der übliche Aufbau umfa st folgende Komponenten:<br />
Alternative Energiepflanzen<br />
DIN A0-Format<br />
Bestellnr.: FA-003<br />
80 Euro (inkl. Versand)<br />
Dieses Feld liefert Energie<br />
und schützt das Klima<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
Maisfeld<br />
DIN A0-Format<br />
Bestellnr. FA-002<br />
So funktioniert eine Biogasanlage<br />
Das entspricht 380 Flügen von München nach New York und zurück.<br />
Diese Biogasanlage erzeugt Strom<br />
wenn er gebraucht wird<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
Biogas ist flexibel!<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter. www.biogas.org<br />
So funktioniert eine Biogasanlage<br />
Energie pflanzen ...<br />
Energiepflanzen<br />
... Vielfalt ernten<br />
Diese Biogasanlage schafft<br />
regionale Wertschöpfung<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
So funktioniert eine Biogasanlage<br />
Die im Fermenter befindlichen Bakterien wandeln die Bioma se, z.B. biologische Abfä le,<br />
nachwachsende Rohsto fe und Gü le, zu Biogas und Gärprodukten um. Das erzeugte Biogas<br />
wird in der Gashaube aufgefangen und von hier über Gasleitungen zum Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) transportiert. Im BHKW wird aus dem Biogas Strom und Wärme erzeugt.<br />
Bei der Ausgestaltung von Biogasanlagen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme,<br />
Techniken und Funktionsweisen. Der übliche Aufbau umfa st folgende Komponenten:<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.<br />
www.farbe-ins-feld.de<br />
www.biogas.org<br />
Energie für die Region…<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.<br />
Schild<br />
„So funktioniert eine Biogasanlage“<br />
Zeigen Sie Wanderern und Gästen die Funktionsweise Franken-Therme Bad Winsheim<br />
einer Biogasanlage<br />
Biogas Wärme<br />
Vorteile<br />
Die Franken-Therme ist an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Bad<br />
Windsheim angeschlossen. 30 Prozent des Wärmeangebotes der Stadtwerke<br />
werden von der Biogasanlage der Bio-Energie Bad Windsheim<br />
DIN A0-Format<br />
erzeugt.<br />
Bestellnr.: FA-008<br />
Als Kunde der Stadtwerke profitiert die Franken-Therme direkt von der<br />
80 Euro<br />
(inkl. Versand)<br />
So funktioniert eine Biogasanlage<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
12<br />
1<br />
2<br />
9<br />
3<br />
5 4<br />
8<br />
3<br />
Seit dem Jahr 2009 erzeugt die Biogasanlage Biogas GmbH Strom für 700<br />
Haushalte und versorgt außerdem 26 Privathaushalte, die Schule, das<br />
Altenheim und das Rathaus mit umweltfreundlicher Wärme. Die Substrate<br />
für die Energieerzeugung bezieht die Biogasanlage vo lständig von<br />
Landwirten aus der Umgebung. Das nach der Vergärung entstehende<br />
Gärprodukt geht als hochwertiger Dünger zurück auf die Felder.<br />
6<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern: Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.<br />
5<br />
7<br />
Wärme<br />
www.biogas.org<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter. www.biogas.org<br />
8<br />
8<br />
Die Kilowa tstunde Biogaswärme kostet die Haushalte im Schni t zwei Cent weniger<br />
als die Wärme aus Heizöl.<br />
Durch das bei den Heizkosten gesparte Geld konnte Neustadt neue Sportgeräte für<br />
die Schule kaufen und den Gemeinschaftsraum im Altenheim renovieren.<br />
Der Bau der Anlagenteile, die Wartung und Erweiterung der Biogasanlage generiert<br />
weitere Jobs bei Handwerksbetrieben in der Umgebung.<br />
Vom Anbau vielfältiger Energiepflanzen profitieren die Bienen und mit ihnen die<br />
Imker in der Region.<br />
11<br />
Strom<br />
10<br />
Erdgasnetz<br />
umwelt- und klimafreundlichen Wärmegewinnung aus Biogas. So<br />
werden die Thermal-Badelandschaft, das Dampferlebnisbad und die<br />
Sauna zu rund einem Drittel mit Biogaswärme beheizt.<br />
Bei der Ausgestaltung von Biogasanlagen<br />
gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher<br />
Systeme, Techniken und<br />
Funktionsweisen. Der übliche Aufbau<br />
umfasst folgende Komponenten:<br />
www.biogas.org<br />
– Die Biogaswärme wird in einer Biogasanlage in Bad Windsheim erzeugt:<br />
Dies stärkt die Unabhängigkeit von fossilen Energieimporten und fördert<br />
die Wirtschaftskraft in der Region.<br />
– Durch die umweltfreundliche Biogaswärme werden pro Jahr rund<br />
300.000 Liter Heizöl eingespart und damit knapp 800 Tonnen<br />
Kohlendioxid (CO 2 ) weniger ausgestoßen.<br />
– Neben der Wärme erzeugt die Biogasanlage der Bio-Energie<br />
Bad Windsheim jährlich Strom für mehr als 1.200 Haushalte.<br />
Anlagenschild (individuell)<br />
Informieren Sie Wanderer und Gäste über Ihre Biogasanlage<br />
DIN A0-Format<br />
Bestellnr.: FA-001<br />
80 Euro (inkl. Versand)<br />
Diese Biogasanlage erzeugt<br />
Strom und Wärme<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
Biogasanlage Bad Windsheim<br />
Die Fakten …<br />
Leistung der Anlage<br />
400 kW el<br />
Mit Strom versorgte Haushalte 800<br />
Wärmebereitstellung<br />
Schwimmbad und Wärmenetz<br />
Eingesetzte Substrate Gülle, Mist,<br />
Landschaftspflegematerial,<br />
Maissilage, Grassilage<br />
Besonderheit an der Anlage<br />
Gärpoduktaufbereitung (Herstellung eines hochwertigen Düngers)<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.<br />
Logo<br />
… sprechen für sich!<br />
Die deutschen Biogasanlagen erzeugen schon heute<br />
Strom für Millionen Haushalte<br />
Biogasanlagen reduzieren den CO 2 -Ausstoß<br />
und produzieren nahezu klimaneutral Strom und Wärme<br />
Biogas-Strom stabilisiert das Stromnetz<br />
und sichert eine gleichmäßige Versorgung<br />
Biogasanlagen<br />
sichern vielen Landwirten die Existenz<br />
In Biogasanlagen vergorene Gülle stinkt nicht und ist<br />
ein hervorragender Dünger<br />
Biogasanlagen bringen<br />
Arbeitsplätze und Wertschöpfung<br />
in die ländliche Region<br />
Wärmeschild groß<br />
(allgemein)<br />
mit allgemeinen Informationen<br />
zum Einsatz von Biogaswärme<br />
DIN A0-Format<br />
Bestellnr.: FA-006<br />
80 Euro (inkl. Versand)<br />
So funktioniert eine Biogasanlage<br />
www.biogas.org<br />
(individuell)<br />
mit Ihren individuellen Angaben<br />
zum Wärmenutzungskonzept<br />
DIN A0-Format<br />
Bestellnr.: FA-005<br />
Jetzt<br />
alle Schilder<br />
80 Euro<br />
inkl. Versand<br />
Fermenter<br />
Banner<br />
2x3 m wetterfeste Folie<br />
Wahlweise mit Ihrem Logo<br />
und Ihrer Homepage<br />
Bestellnr.: WV-019<br />
Jetzt<br />
neu<br />
90 Euro<br />
(Versand inkl. innerhalb Deutschlands)<br />
Diese Biogasanlage<br />
liefert Energie<br />
und schützt das Klima!<br />
Diese Biogasanlage<br />
liefert Energie<br />
und schützt das Klima!<br />
www.biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
BIOGAS Wärme<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
Umweltfreundliche Wärme – vom Land, für’s Land<br />
Biogas Wärme …<br />
In Deutschland gibt es viele tausend Biogasanlagen, die umweltfreundliches<br />
Biogas erzeugen. Dieser Energieträger wird mittels eines Motors<br />
im Blockheizkraftwerk in Strom umgewandelt. Die dabei frei werdende<br />
Wärme sichert die lokale Versorgung und dient als Heizenergie in:<br />
• öffentlichen Einrichtungen, z.B. Schwimmbädern, Schulen, Turnhallen<br />
• Wohngebieten und Bioenergie-Dörfern<br />
• Ställen und Gewächshäusern<br />
• Unternehmen, z.B. Gärtnereien, Gastronomie, Industrie<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.<br />
… aus der Region<br />
Biogaswärme wird in einer nahe gelegenen Biogasanlage erzeugt. Dies stärkt die<br />
Unabhängigkeit von fossilen Energieimporten und fördert die Wirtschaftskraft in<br />
der Region.<br />
Viele Dörfer und Kommunen setzen auf Biogas, um eine autarke Energieversorgung<br />
vor Ort anzubieten.<br />
Mit Biogaswärme können die jährlichen Kosten für Wärmeenergie deutlich gesenkt<br />
und langfristig stabil gehalten werden.<br />
Durch die umweltfreundliche Biogaswärme wird Heizöl bzw. Erdgas eingespart und<br />
damit weniger Kohlendioxid (CO 2 ) ausgestoßen.<br />
So funktioniert eine Biogasanlage<br />
www.biogas.org<br />
Bestellungen bitte per E-Mail an info@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
109
Verband<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Bürgerenergie als tragende Säule<br />
der Energiewende ausbauen<br />
Gastbeitrag von Dr. Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie e.V. (BEE)<br />
Nach dem Atomausstieg im<br />
Jahr 2022 werden in einigen<br />
Jahren auch die Kohlekraftwerke<br />
in Deutschland vom<br />
Markt verschwunden sein,<br />
denn der wenig ambitionierte Ausstiegspfad<br />
der Bundesregierung bis zum Jahr<br />
2038 wird durch die marktwirtschaftliche<br />
Entwicklung überholt. Bereits im Jahr<br />
2019 deckten rund 90 Prozent der deutschen<br />
Kohlekraftwerke ihre Kosten nicht.<br />
Diese Entwicklung hat sich durch Corona<br />
beschleunigt.<br />
Jüngst kündigte der Energiekonzern Vattenfall<br />
an, das erst fünf Jahre alte Kraftwerk<br />
Moorburg vom Netz nehmen zu<br />
wollen. Weitere werden folgen, denn sie<br />
rentieren sich nicht mehr. Damit übernehmen<br />
Erneuerbare Energien die Verantwortung<br />
im Strommarkt, die nicht nur günstig,<br />
flexibel und versorgungssicher bereitgestellt<br />
werden können, sondern auch klimaund<br />
umweltfreundlich sind.<br />
Deutschland hat mit der Energiewende gezeigt,<br />
dass der Wechsel von konventionell<br />
zu erneuerbar bislang mit einer enormen<br />
Dezentralisierung und Demokratisierung<br />
des Energiesystems einherging. Bürgerinnen<br />
und Bürger installierten Solardächer<br />
auf ihren Häusern und engagierten sich<br />
in Bürgerenergiegenossenschaften oder<br />
Bürgerwindparks, Landwirte nutzten ihre<br />
Flächen für die Solar-, Wind- oder Bioenergieerzeugung,<br />
Quartiere suchten nach<br />
Lösungen für die gemeinsame Wärmeversorgung.<br />
Aber auch die Industrie ruft verstärkt nach<br />
Grüner Energie für die saubere Versorgung<br />
ihrer Prozesse und will sich selbst versorgen.<br />
Und das muss endlich erhört werden.<br />
Die Politik muss dem wachsenden Anteil<br />
von privaten oder gewerblichen Prosumern,<br />
die ihre eigene Energie erzeugen<br />
und auch verbrauchen und teilen möchten,<br />
endlich einen geeigneten Rahmen geben.<br />
Die europäische Agenda mit dem „Clean<br />
Energy Package“ und die Novellierung<br />
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)<br />
zum Jahresbeginn 2021 sind wichtige Hebel<br />
hierfür.<br />
Der Stromverbrauch in Deutschland wird<br />
in den nächsten Jahren aufgrund der Sektorenkopplung<br />
sukzessive steigen. Die<br />
verstärkte Nutzung von Strom aus Erneuerbaren<br />
Energien für Elektromobilität,<br />
Wärmepumpen und zur Wasserstoffherstellung<br />
für Industriebedarfe hat ein immenses<br />
Volumen. Allein in der Stahlindustrie<br />
schätzen Experten den Bedarf auf bis<br />
zu 170 Terawattstunden Grünen Strom,<br />
mehr als ein Viertel des heutigen öffentlichen<br />
Strombedarfs in Deutschland. Wollen<br />
wir die Klimaziele schaffen, muss dieser<br />
mit Grünem Strom gedeckt werden.<br />
Das Potenzial der Erneuerbaren Energien<br />
ist zur Deckung mehr als ausreichend<br />
vorhanden und dabei kostengünstig zu<br />
erschließen. Mit einer angemessenen<br />
CO 2<br />
-Bepreisung würde sich ein fairer<br />
Wettbewerb für viele weitere Klimaschutz-<br />
Technologien einstellen. Zudem sind im<br />
Rahmen der aktuellen EEG-Novellierung<br />
die Ausbauziele und die darauf aufsetzenden<br />
jährlichen Zielkorridore für Erneuerbare<br />
Energien so auszurichten, dass sie der<br />
wachsenden Nachfrage nach CO 2<br />
-freier<br />
Energie aus Mobilität, Wärme und Industrie<br />
gerecht werden.<br />
Der BEE hat deutlich gemacht, dass es<br />
nun ein Aufbruchssignal für die Erneuerbaren<br />
Energien braucht und deshalb<br />
erhebliche Nachbesserungen erforderlich<br />
sind, insbesondere bei den angestrebten<br />
Ausbaupfaden, bei zahlreichen Marktbarrieren,<br />
aber auch bei Flächenverfügbarkeit<br />
und Genehmigungen. Es liegt nun in der<br />
Verantwortung der Bundesregierung, den<br />
vorliegenden Entwurf nachzubessern, um<br />
einen geeigneten rechtlichen Rahmen<br />
zur Belebung des Ausbaus Erneuerbarer<br />
Energien zu schaffen, Perspektiven für ab<br />
2021 aus der Vergütung fallende Anlagen<br />
zu geben, die Vielfalt der Akteure zu stärken<br />
und den Herausforderungen unserer<br />
Zeit angemessen zu begegnen. Das Ziel<br />
von 100 Prozent Erneuerbaren Energien<br />
erreichen wir nur, wenn wir die Teilhabe an<br />
Erneuerbare-Energien-Anlagen weiter stärken.<br />
Deshalb hat der BEE gemeinsam mit<br />
einem breiten Bündnis aus Verbänden und<br />
Energiepolitik den Appell „Klimapolitik als<br />
Bürgerbewegung gestalten“ gestartet, aufzurufen<br />
unter: https://weact.campact.de/p/<br />
BEA. Es braucht einen guten Rahmen für<br />
Bürgerenergie, für die umfassende sozialökologische<br />
Transformation.<br />
Europa hat dies erkannt und vorgelegt: Es<br />
lässt lässt der Bürgerenergie eine starke<br />
Rolle im gemeinsamen Wirtschaftsraum<br />
zukommen. Sowohl der „Green New Deal“<br />
als auch das „Clean Energy Package“ der<br />
Europäischen Union ermöglichen echte<br />
Teilhabe durch die eigene Produktion und<br />
den Verbrauch von erneuerbarem Strom<br />
und durch die Möglichkeit zum Tauschen.<br />
Die Bundesregierung muss nun nachziehen,<br />
denn die erste Chance ist bereits verstrichen:<br />
Der Entwurf der EEG-Novelle wurde<br />
im Bundeskabinett beschlossen, ohne<br />
Antworten darauf zu liefern, wie die europäisch<br />
definierten Rechte bis Mitte 2021<br />
auch in die nationale Gesetzgebung Einzug<br />
finden können. Hier braucht es Nachbesserungen<br />
und eine aktive Stärkung der von<br />
Bürger*innen getragenen Energiewende.<br />
110
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Verband<br />
Der Weg vom Rodler zum<br />
Biogasbotschafter<br />
Warum ich mich als Rennrodler heute<br />
für den Ausbau der Biogasnutzung<br />
einsetze? Das ist eigentlich ganz einfach:<br />
Als ich damals als kleiner Junge<br />
mit dem Rodeln begonnen habe, war<br />
ich in einem Training schneller als meine Kameraden,<br />
beim nächsten wieder nicht. Warum? Weil ich an<br />
dem Tag einfach nicht gut war? Oder hatte das andere<br />
Gründe?<br />
Von meinem Trainer bekam ich einen hilfreichen Hinweis:<br />
„Kein Wunder, dass du langsamer bist – deine<br />
Kufen sind ja ganz verrostet und verkratzt.“ Nachdem<br />
ich diese dann fleißig geschmirgelt hatte, war ich<br />
plötzlich der allerschnellste. Das hat mir die Augen<br />
geöffnet für den Unterschied zwischen gutem und<br />
schlechtem Material.<br />
Im nächsten Schritt habe ich dann noch den Pullover<br />
in die Hose gesteckt und mir statt Turnschuhen aerodynamische<br />
Rodelschuhe besorgt. Ich habe gelernt: Man<br />
kann immer noch etwas optimieren. Schon in jungen<br />
Jahren begann so eine Art „Eifer“, der im Sport eigentlich<br />
nie endet und sich auch auf andere Lebensbereiche<br />
übertragen lässt. Es gibt immer irgendwo Stellschrauben,<br />
an denen sich drehen lässt und die dafür<br />
sorgen, dass der eigene Kosmos besser funktioniert.<br />
Diese Herangehensweise habe ich mir im Leben angeeignet<br />
– und so bin ich schließlich auch beim Biogas<br />
gelandet. Mir ist<br />
schon lange klar,<br />
dass wir auf Erneuerbare<br />
Energien<br />
umsteigen müssen,<br />
um diese Welt zu<br />
erhalten. Also habe<br />
ich mich viel damit<br />
beschäftigt und<br />
dachte zunächst: Wow,<br />
Solaranlagen, Energie<br />
aus der Sonne, das ist perfekt.<br />
Aber was ist ohne Sonne?<br />
Also Wind. Windräder drehen sich<br />
auch nachts – aber eben nur bei Wind.<br />
Aber Biogas – das funktioniert immer! Und es liefert<br />
nicht nur Strom, sondern auch Wärme und Kraftstoff.<br />
Biogas ist speicherbar und kann transportiert werden.<br />
Und dann sind da noch die Blühfelder, die unsere<br />
Landschaft bunter und artenreicher machen.<br />
Biogas hat mich schon immer wahnsinnig fasziniert<br />
und für mich kommt es der optimalen Energieerzeugungsart<br />
sehr nah. Natürlich gibt es auch bei Biogasanlagen<br />
noch viele Stellschrauben zur weiteren Optimierung.<br />
Es ist wie beim Rodeln: Ein bisschen besser<br />
geht immer noch. Aber wir sind schon nah dran am<br />
Optimum.<br />
EXCELLENCE – MADE TO LAST<br />
WEGWEISENDE<br />
SEPARATIONSTECHNIK<br />
• höchste Durchbruchsicherheit und<br />
TS-Gehalte bis zu 38 % dank<br />
Multi Disc Technik<br />
• Förderschnecke mit Faserstoffbürste<br />
verhindert metallische<br />
ANDERE REDEN.<br />
Reibung und sorgt für lange<br />
WIR MACHEN.<br />
Stand zeiten und kontinuierliche<br />
Reinigung des Filtersiebes<br />
• anschlussfertige Komplettaggregate<br />
mit perfekt aufeinander abgestimmten<br />
Komponenten: Separator, Pumpe und<br />
Steuerungstechnik „aus einer Hand“<br />
Börger GmbH • D-46325 Borken-Weseke • Tel. +49 2862 9103 0 • info@boerger.de<br />
111<br />
www.boerger.de
Verband<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Signifikanter Rückgang der<br />
Prüfungen mit Mängeln<br />
Ende September fand der 10. Meinungs- und Erfahrungsaustausch für sicherheitstechnische<br />
Prüfungen an Biogasanlagen statt. Eine wichtige Erkenntnis: Die Auswertung für das<br />
Berichtsjahr 2018 hat einen weiteren signifikanten Rückgang der Prüfungen mit Mängeln<br />
auf Biogasanlagen zum Ergebnis.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Leider fiel auch der diesjährige 10. Meinungsund<br />
Erfahrungsaustausch für Sachverständige<br />
gemäß §29 b Bundes-Immissionsschutzgesetz<br />
(BImSchG) für sicherheitstechnische<br />
Prüfungen an Biogasanlagen den Einschränkungen<br />
von Covid-19 zum Opfer und musste erstmals<br />
als Webkonferenz in Form von zwei Vormittagsblöcken<br />
(24. und 25. September <strong>2020</strong>) organisiert werden.<br />
Trotz dieser Umstände hatte das Bundesumweltministerium<br />
(BMU) den virtuellen Erfahrungsaustausch<br />
wieder als Veranstaltung im Sinne des Paragrafen (§)<br />
17 Absatz 1 Nr. 7b der 41. Bundes-Immissionsschutzverordnung<br />
(BImSchV) autorisiert. Die 50 Teilnehmer<br />
stammten überwiegend aus dem Kreis der Sachverständigen,<br />
wobei auch einige Hersteller, Anlagenbetreiber<br />
und Behördenvertreter mitwirkten.<br />
Nach einer Begrüßung durch den Geschäftsführer<br />
im Fachverband Biogas Manuel Maciejczyk startete<br />
Abbildung 1: §29b BImSchG-Prüfungen mit Mängeln<br />
Dr. Hans-Peter Ziegenfuß vom Regierungspräsidium<br />
Darmstadt in gewohnter Weise mit seinem Vortrag über<br />
die Ergebnisse der Auswertungen der Sachverständigen-Erfahrungsberichte<br />
der Kommission für Anlagensicherheit<br />
(KAS) den Erfahrungsaustausch. In seinen<br />
Ausführungen zeigte sich eine weiterhin erfreuliche<br />
Entwicklung bei den Biogasanlagen. Die Auswertung<br />
für das Berichtsjahr 2018 (siehe Abbildung 1) hat einen<br />
weiteren signifikanten Rückgang der Prüfungen<br />
mit Mängeln auf Biogasanlagen (Rückgang von 67,7<br />
Prozent in 2017 auf 60,9 Prozent in 2018) zum Ergebnis.<br />
Zwar überwiegen noch die Prüfungen mit Mängeln,<br />
aber die Branche hat sich den Problemen angenommen<br />
und ist auf gutem Wege, aus dem Fokus der Diskussionen<br />
zu kommen.<br />
Insgesamt hat sich die Zahl der geprüften Biogasanlagen<br />
weiter erhöht und die in den Vorjahren vorgefundenen<br />
Mängelursachen haben sich weiter verfestigt.<br />
Schwerpunkte der Mängel sind<br />
weiterhin fehlende oder nicht<br />
fristgerechte Prüfungen und<br />
Probleme bei der dazugehörigen<br />
Mängelbeseitigung, eine<br />
mangelhafte Umsetzung der<br />
PLT-Technik (fehlerhafte Funktionsmatrix<br />
beziehungsweise<br />
Schalthandlungen), Probleme<br />
beim Ex-Schutz (Auswahl exgeschützter<br />
Betriebsmittel)<br />
und der Betriebsorganisation<br />
(Arbeitsfreigabeverfahren,<br />
Schulungsnachweise), gefolgt<br />
von Problemen beim Brandschutz,<br />
Blitzschutz und der<br />
Auslegung der Biogasanlagen.<br />
In den abschließenden Empfehlungen<br />
der KAS zeigte sich,<br />
dass die Betreiber noch mehr<br />
Unterstützung durch die Hersteller,<br />
Sachverständigen und<br />
Behörden erhalten könnten.<br />
112
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Verband<br />
Abbildung 2: Einschätzung der TRAS 120 aus Sicht<br />
einer Vollzugsbehörde<br />
ff<br />
Man kann die TRAS als Betreiber nicht ignorieren.<br />
ff<br />
Was wie und wann zu tun ist, sollte zwischen Betreiber und Behörde abgestimmt<br />
werden.<br />
ff<br />
Die Entscheidung muss die Gegebenheiten des Einzelfalls berücksichtigen<br />
inkl. der Verhältnismäßigkeit.<br />
ff<br />
Die TRAS ist eine „Sicherheits-Vorschrift“. Die möglichen Folgen von Sicherheitsdefiziten<br />
oder Schadensfällen können nicht vernachlässigt werden z.B.:<br />
ZZ<br />
Ein altersbedingter infolge von Sturm entstehender Schaden<br />
am Membranspeicher kann Dritte gefährden.<br />
ZZ<br />
Die TRAS 120 enthält zu Membranspeichern klare Regelungen.<br />
f f Im Anwendungsbereich der StörfallV dient die TRAS zur Umsetzung der<br />
Betreiberpflichten der §§ 3-6 StörfallV.<br />
Kritische Betrachtung von<br />
„Wasserwänden“<br />
Im zweiten Vortrag berichtete der §29b<br />
BImSchG-Sachverständige Friso Reinecke<br />
von der EnviTec Biogas Betriebs GmbH &<br />
Co. KG über seine Erfahrungen aus der<br />
Prüftätigkeit. In seinen Ausführungen<br />
ging er auf einige aktuelle Themen wie den<br />
Einsatz von Schwefelsäuren bei der Gärproduktaufbereitung<br />
und die Umsetzung<br />
einiger kritischer Anforderungen aus der<br />
TRAS 120 ein. Insbesondere die alternativen<br />
technischen Maßnahmen zur Unterschreitung<br />
der Brandschutzabstände in<br />
der TRAS 120 in Form von Wasserwänden<br />
sah er kritisch, da erheblicher finanzieller<br />
Aufwand und auch große Mengen an Wasser<br />
notwendig sind.<br />
Im Vergleich zu den bisher vorhandenen<br />
Qualifikationsanforderungen in der TRGS<br />
529 begrüßte er die weitere Differenzierung<br />
der Qualifikationsanforderungen in<br />
der TRAS 120 auch in Richtung der Hersteller<br />
und Instandhalter. In Bezug auf die<br />
Anlagensicherheit sah er auch den zunehmenden<br />
„Subventionsdruck“ und die für<br />
einige Anlagen bald endende Vergütungsdauer<br />
als kritische Einflussfaktoren. Viele<br />
Anlagen fahren die Instandhaltung auf<br />
minimalem Niveau und riskieren damit<br />
steigende Ausfallraten.<br />
Wie die Anlagenhersteller auf die Anforderungen<br />
in der TRAS 120 reagieren, stellte<br />
Stefan Heins von der Firma Biogas-Service-<br />
Tarmstedt GmbH in seinen Ausführungen<br />
dar. Die Tragluftfolienabdeckungen erhalten<br />
beispielsweise einen Nachweis für eine<br />
Mindeststandzeit von sechs Jahren, sofern<br />
die Vorgaben der Betriebsanleitung beachtet<br />
werden. Auch werden die eingebauten<br />
Membranen mit einer rückverfolgbaren<br />
Nummerierung bezüglich des Herstellund<br />
Einbaudatums versehen.<br />
Der erste schwer entflammbare Klemmschlauch<br />
soll ab Herbst <strong>2020</strong> in die Testung<br />
gehen. Sowohl die Überwachung des<br />
Stützluftauslasses als auch der Über- und<br />
Unterdrucksicherung sind für Neuanlagen<br />
umsetzbar beziehungsweise bei Bestandsanlagen<br />
mit zusätzlichem Aufwand nachrüstbar.<br />
Die Nachrüstung von bestehenden<br />
Anlagen ist aber immer mit erheblichen<br />
Zusatzkosten verbunden, die im Einzelfall<br />
auf Verhältnismäßigkeit geprüft werden<br />
müssen. Bei Neuanlagen rechnet Heins<br />
mit zusätzlichen Investitionskosten von<br />
etwa 10 Prozent, um die Anforderungen<br />
der TRAS 120 einzuhalten.<br />
TRAS 120 ist reine<br />
Erkenntnisquelle<br />
Über die Erfahrungen der Vollzugsbehörden<br />
mit der TRAS 120 und den damit<br />
verbundenen Erwartungen an die Sachverständigen<br />
referierte Thomas Hackbusch<br />
vom LUBW in Karlsruhe. Er machte dabei<br />
nochmal deutlich, dass die TRAS 120 eine<br />
reine Erkenntnisquelle ist, die keine Vermutungswirkung<br />
in Richtung BImSchG besitze<br />
und andere Anforderungen aus dem<br />
Arbeitsschutz und dem anlagenbezogenen<br />
Gewässerschutz unberührt bleiben (siehe<br />
Abbildung 2).<br />
Nach einer Vorstellung von einigen beispielhaften<br />
Ländererlassen zur Umsetzung<br />
der TRAS 120 stellte er nochmal klar,<br />
dass die Umsetzung der TRAS 120 immer<br />
zwischen Betreiber und Behörde im<br />
113<br />
Durch energie+agrar habe ich einfach<br />
“<br />
mehr Spaß mit meiner Biogasanlage. ”<br />
Oppmale Beratung<br />
und innovaave<br />
Produkte für Ihre<br />
Fermenter-Bakterien<br />
Höhere Substratausnutzung<br />
Bessere Rührfähigkeit<br />
Stabile biologische Prozesse<br />
Einsparung von Gärrestlager<br />
Senkung der Nährstoffmenge<br />
Repowering der Biologie<br />
Denn Ihre Biogas-Bakterien<br />
können mehr!<br />
energiePLUSagrar GmbH<br />
Tel.: +49 7365 41 700 70<br />
Web: www.energiePLUSagrar.de<br />
E-Mail: buero@energiePLUSagrar.de
Verband<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Abbildung 3: Zeitstanddiagramm von PVC-U-Rohrleitungen<br />
97,5 % untere Vertrauensgrenze LCL<br />
(Lower Confidence Limit)<br />
Erforderliche Mindestfestigkeit MRS<br />
(Minimum Required Strength) bei 20 °C,<br />
Lebensdauer 50 Jahre, Wasser<br />
o s = Dimensionierungsspannung<br />
C = Designfaktor<br />
o s = MRS / C<br />
z.B. für PVC-U:<br />
o s = 25 MPa / 2.5 = 10 MPa<br />
Kesselformel<br />
Einzelfall abzustimmen ist und verhältnismäßig sein<br />
muss. Die Vollzugsbehörden werden sich eher auf<br />
formale Prüfungen fokussieren und insbesondere bei<br />
nicht umsetzbaren Anforderungen eine Einzelfallprüfung<br />
vornehmen. An die Sachverständigen stellte er die<br />
Forderung, dass diese in jedem Fall vertiefte Kenntnisse<br />
der TRAS 120 besitzen und in der Lage sein sollten,<br />
Defizite zu erkennen und zu benennen. Er machte aber<br />
auch klar, dass die zuständige Aufsichtsbehörde den<br />
Prüfrahmen dezidiert vorgeben muss. Zum Abschluss<br />
berichtete er von einem LAI-Papier mit Vollzugshinweisen<br />
zur Umsetzung der TRAS 120, das kurz vor der<br />
Veröffentlichung steht.<br />
Den zweiten Tag des Erfahrungsaustausches läutete der<br />
Sprecher des Arbeitskreises Sicherheit im Fachverband<br />
Biogas Josef Ziegler ein. In seinen Ausführungen berichtete<br />
er über die aktuellen Entwicklungen bei den technischen<br />
Anforderungen, über die Erfahrungen mit der<br />
TRAS 120 und die aktuellen Aktivitäten des Fachverbandes<br />
Biogas. Zu den Themenkomplexen TRAS 120,<br />
Prozessleittechnik und sichere Gärprodukttrocknung<br />
sind und werden entsprechende praxistaugliche Arbeitshilfen<br />
durch den Verband erarbeitet. Als Hilfestellung zu<br />
den Dokumentations- und Prüfpflichten hat der Fachverband<br />
auch seine Checkliste zum sicheren Betrieb überarbeitet<br />
und veröffentlicht (Arbeitshilfe A-003).<br />
Gasspeichermembranen: Musterproben<br />
der Werkstoffe aufbewahren<br />
Im nächsten Vortragsblock standen das Alterungsverhalten<br />
von Gasspeichermembranen und Kunststoffrohrleitungen<br />
im Fokus. Prof. Rosemarie Wagner vom<br />
KIT Karlsruhe gab einen fundierten Überblick über die<br />
Eigenschaften von Kunststoffen und Zuschlagsstoffen,<br />
die bei Gasspeichermembranen zum Einsatz kommen.<br />
Aufgrund der vielfältigen Aufgaben und Anforderungen<br />
(flexibel, dicht, witterungsfest etc.) können entsprechende<br />
zum Einsatz kommende Membrane je nach<br />
Einsatzsituation unterschiedlichen Alterungsentwicklungen<br />
ausgesetzt sein.<br />
Demzufolge ergeben sich in der Praxis auch unterschiedliche<br />
Haltbarkeiten der eingesetzten Membrane.<br />
Neben den sichtbaren Alterungserscheinungen<br />
wie Verfärbungen, zunehmende Versandung bis hin zur<br />
Rissbildung sind auch messbare Alterserscheinungen<br />
(Reißfestigkeit, Versprödung, mikrobiologischer Befall<br />
etc.) feststellbar. Dies betrifft sowohl die Wetterschutzmembrane<br />
als auch die im inneren verbauten eigentlichen<br />
Gasspeichermembrane. Grundsätzlich empfahl<br />
sie auch Musterproben der verwendeten Membranwerkstoffe<br />
als Rückstellprobe aufzubewahren.<br />
Achim Weiß von der Firma Georg Fischer DEKA GmbH<br />
berichtete in seinen Ausführungen über das Alterungsverhalten<br />
von Kunststoffen im Rohrleitungsbau auf<br />
Biogasanlagen. Besonderen Fokus richtete er dabei<br />
Biogaskontor<br />
Köberle GmbH<br />
Wir können mit Druck umgehen<br />
Bullaugen für alle Einsatzfälle<br />
Für Kernbohrung Auf Stahlplatte nach In Tauchhülse für Über-/Unterdrucksicherung<br />
oder Futterhülse<br />
Kundenmaß<br />
Blick um die Ecke<br />
ÜU-TT<br />
Ø300 + Ø400 mm<br />
für Folienhauben<br />
Zubehör: Leuchten, Rosetten, Futterhülsen, Sonnenschutzhauben, etc.<br />
114<br />
Weitere Komponenten: Luftdosierstationen zur Entschwefelung, Füllstandsüberwachung, Messtechnik, Warnschilder<br />
Über-/Unterdrucksicherung<br />
ÜU-GD<br />
für Betondecken<br />
www.biogaskontor.de • info@biogaskontor.de • Germany 89611 Obermarchtal • Tel +49(0)737595038-0
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Verband<br />
auf das rohrleitungsspezifische Zeitstandverhalten.<br />
Anhand spezifischer Zeitstanddiagramme (siehe Abbildung<br />
3) und entsprechender Abminderungsfaktoren<br />
lassen sich Aussagen zur Auslegung und Haltbarkeit<br />
der Rohrleitungen ableiten. In jedem Fall sollten die<br />
Rohrleitungen auch für die auf den Biogasanlagen vorhandenen<br />
Temperaturen ausgelegt werden. Neben der<br />
Temperatur wirken sich aber auch weitere chemische,<br />
mechanische und atmosphärische Belastungen auf das<br />
Alterungsverhalten der Rohrleitungen aus.<br />
DVGW-Regeln an Wasserstoffeinspeisung<br />
angepasst<br />
Über die entsprechenden Aktivitäten des DVGW zu den<br />
Zukunftsoptionen für Biogasanlagen im Erdgasnetz<br />
referierte der Sprecher des Arbeitskreises Gaseinspeisung<br />
im Fachverband Biogas Lars Klinkmüller. Er ging<br />
dabei auf die aktuellen Anpassungen bei der DVGW G<br />
260 (Anforderungen an die Gasbeschaffenheit für die<br />
Biomethaneinspeisung) und der DVGW G 265-2 (Anforderungen<br />
an den Betrieb und Instandhaltung von<br />
Biomethaneinspeiseanlagen) ein. Beide Regelwerke<br />
wurden an neue Erkenntnisse und rechtliche Rahmenbedingungen<br />
angepasst und fit für den Einsatz von<br />
Wasserstoff und anderen grünen Gasen gemacht.<br />
Auch gab er einen Ausblick zu zwei in Bearbeitung<br />
befindlichen neuen Regelwerken zu den Themen „Power-to-Gas-Energieanlagen“<br />
[DVGW G 220 (A)] und<br />
„Wasserstoffeinspeiseanlagen in Gasversorgungsnetze –<br />
Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme<br />
und Betrieb“ [DVGW G 265-3 (A)]. Trotz aller<br />
Euphorie beim Thema Wasserstoff warnte er vor einigen<br />
gravierenden Nachteilen (niedrigere Energiedichte, erhöhte<br />
Diffusion etc.) im Vergleich zum etablierten Methan<br />
und dessen vorhandener bewährter Infrastruktur.<br />
Zum Abschluss des Erfahrungsaustausches berichtete<br />
die Leiterin des Referates Genehmigung im Fachverband<br />
Biogas Gepa Porsche über die aktuellen Entwicklungen<br />
bei der AwSV und der dazugehörigen TRwS<br />
793-1. Hauptstreitpunkt bei der aktuellen Novelle der<br />
AwSV ist die aus Sicht der Biogasbranche mit dramatischen<br />
Folgen behaftete angedachte Streichung der<br />
bisher möglichen Gärproduktlagerung in bestehenden<br />
JGS-Behältern, die nicht im räumlich funktionalen Zusammenhang<br />
zur Biogasanlage stehen.<br />
Dies könnte zur Folge haben, dass diese Behälter zukünftig<br />
als Teil der Biogasanlagen eingestuft werden<br />
und somit die Umwallung und regelmäßigen Sachverständigenprüfungen<br />
ebenfalls erbringen müssten.<br />
Die politisch sehr gewünschte verstärkte Wirtschaftsdüngervergärung<br />
würde somit massiv konterkariert<br />
werden. Da einige Einwender, unter anderem auch der<br />
Fachverband Biogas, ihre Einsprüche zur TRwS 793-1<br />
aufrechterhalten haben, findet im Herbst ein entsprechendes<br />
Schlichtungsverfahren statt.<br />
Fazit: Trotz der diesjährigen virtuellen Umsetzung des<br />
Erfahrungsaustausches führten die sehr informativen<br />
Vorträge zu interessanten und konstruktiven Diskussionen<br />
der Teilnehmer. Die Teilnehmer bewerteten die Veranstaltung<br />
sehr positiv. Sofern es die Rahmenbedingungen<br />
zulassen, wird der 11. Erfahrungsaustausch wieder<br />
am 30. September 2021 in Kassel stattfinden.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Geschäftsführer<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 · 85356 Freising<br />
0 81 61/98 46 60<br />
info@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
RondoDry<br />
Rotationstrockner zur<br />
Verdunstung von Flüssigkeiten.<br />
Modular | Effizient | Leistungsstark<br />
• Bis zu 4.000 m 3 Massenreduzierung<br />
• Stromkostenneutral durch eingesparte<br />
Notkühlerlaufzeiten<br />
• Bis zu 80 % Abscheidung des org. NH4-N und<br />
daraus Herstellung von mineralischer ASL<br />
Infos unter +49 8631 307-0<br />
115
Recht<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
EinsMan-Entschädigung:<br />
100 Prozent der<br />
entgangenen Einnahmen<br />
geltend machen<br />
Entschädigung von Abregelungen durch den Netzbetreiber: nicht 95 und auch nicht<br />
99 Prozent, sondern 100 Prozent – die Regelungen zum Netzengpassmanagement seit<br />
dem 1. Januar <strong>2020</strong> und der neue Regierungsentwurf zum EEG 2021.<br />
Von Pavlos Konstantinidis und Dr. Florian Valentin<br />
Aus Brüssel kommt was Gutes: Seit dem 1.<br />
Januar <strong>2020</strong> gilt in Deutschland die neue<br />
EU-Elektrizitätsbinnenmarktverordnung<br />
[Verordnung (EU) 2019/943 vom 5. Juni<br />
2019 über den Elektrizitätsbinnenmarkt;<br />
im Folgenden: EBM-VO]. Die EBM-VO enthält unter<br />
anderem in Artikel 13 Bestimmungen zum Redispatch<br />
(Netzengpassmanagement). Aus Sicht der Erneuerbare-Energien-Branche<br />
enthält die Verordnung dabei<br />
eine hochinteressante Regelung: Für den Fall einer<br />
Abregelung von EEG-Anlagen durch den Netzbetreiber<br />
ist dort eine Entschädigung vorgesehen, die entgegen<br />
den aktuellen Regelungen im EEG auch für seit dem 1.<br />
Januar 2012 in Betrieb genommene Anlagen nicht nur<br />
95 Prozent (im Einzelfall) beziehungsweise 99 Prozent<br />
(auf das Jahr bezogen), sondern ab der ersten abgeregelten<br />
Kilowattstunde 100 Prozent der entgangenen<br />
Einnahmen umfasst. Auf diese Regelung können sich<br />
Anlagenbetreiber in Deutschland seit dem 1. Januar<br />
<strong>2020</strong> unmittelbar berufen und eine entsprechende<br />
vollständige Entschädigung verlangen.<br />
Nunmehr soll nach dem neuen Regierungsentwurf<br />
zum EEG 2021 (RegE-EEG 2021) die bisher mit der<br />
EBM-VO kollidierende nationale Vorschrift zur Entschädigung<br />
von Einspeisemanagementmaßnahmen<br />
abgeändert werden. Der neue § 15 EEG 2021 regelt<br />
nach der aktuellen Fassung des RegE-EEG 2021 eine<br />
100-prozentige Entschädigung im Falle einer Abregelung<br />
von EEG-Anlagen.<br />
Die Regelungen zum Einspeisemanagement<br />
im EEG<br />
Das Einspeisemanagement ist derzeit noch in den §§<br />
14 und 15 EEG 2017 geregelt (zu der ab dem 1. Oktober<br />
2021 geltenden Rechtslage siehe weiter hinten).<br />
Nach § 14 EEG 2017 sind Netzbetreiber abweichend<br />
vom Grundsatz des Einspeisevorrangs von Strom aus<br />
Erneuerbaren Energien unter bestimmten Voraussetzungen<br />
berechtigt, die Leistung von EEG-Anlagen vorübergehend<br />
zu reduzieren oder Anlagen auch vollständig<br />
abzuschalten.<br />
§ 15 EEG 2017 sieht sodann (noch) vor, dass der Netzbetreiber,<br />
an dessen Netz die Anlage angeschlossen ist,<br />
den von der Einspeisemanagementmaßnahme betroffenen<br />
Betreiber für 95 Prozent der entgangenen Einnahmen<br />
zuzüglich der zusätzlichen Aufwendungen und<br />
abzüglich der ersparten Aufwendungen entschädigen<br />
muss. Erst ab dem Zeitpunkt, zu dem die entgangenen<br />
Einnahmen eines Betreibers in einem Jahr 1 Prozent<br />
der Einnahmen des Jahres übersteigen, sind die-<br />
Foto: adobe stock_SB<br />
116
aMitglied iM Fachverb<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Unsere Leistungen für Ihren Erfolg: n Biogas n Landwirtschaft n Industrie<br />
Ökotec<br />
Anlagenbau GmbH<br />
nd biogas e.v.<br />
Passende Rührtechnik für jedes Substrat<br />
✔︎ Genehmigungsplanung / technische Ausführungsplanung<br />
✔︎ individuelle ingenieurtechnische Leistungen und Beratungen<br />
✔︎ Ausarbeitung energetischer Optimierungskonzepte<br />
✔︎ Wärmenutzungskonzepte<br />
✔︎ Neubau, Optimierung und Erweiterungen von Biogasanlagen<br />
✔︎ Planung und Bau von Gärrest- und Gülleaufbereitungsanlagen<br />
✔︎ Rohrleitungsbau<br />
✔︎ Wartung, Service, Instandhaltung<br />
✔︎ Anlagendokumentation<br />
Ökotec-Anlagenbau GmbH | Bahnhofstr. 13 | 04808 Thallwitz | Tel.: +49 (0) 34 25 / 85 65 8 - 0 | info@oekotec-anlagenbau.de<br />
www.oekotec-anlagenbau.de<br />
– Alle Rührwerkstypen<br />
– Über 25 Jahre Erfahrung<br />
– Optimierung, Nachrüstung, Tausch<br />
Rührtechnik<br />
optimieren,<br />
Förderung<br />
kassieren!<br />
Tel. +49.7522.707.965.0 www.streisal.de<br />
DIE BESTEN BIOGASANLAGEN<br />
Steigern Sie die Effizienz Ihrer<br />
Biogasanlage und reduzieren Sie<br />
Ihre Stromkosten. Tauschen Sie ein<br />
altes Tauchmotor-Rührwerk gegen<br />
ein effizientes Stallkamp-Modell<br />
aus und sparen Sie Stromkosten!<br />
Je nach Anlagenkonstellation kann<br />
die Rührtechnik von der BAFA mit<br />
bis zu 40%* gefördert werden.<br />
Sprechen Sie Ihren Energieberater<br />
an! Weitere Infos unter<br />
www.stallkamp.de/foerderung<br />
mit getrennter Hydrolyse ...<br />
... nachhaltig wirtschaftlich<br />
Mehr Leistung durch zweistufige Vergärung.<br />
Wir garantieren die herstellerunabhängige<br />
Beratung und Planung.<br />
Optimierung bestehender Biogasanlagen.<br />
Durchführung von Abnahmeprüfungen nach<br />
§15 und wiederkehrender Prüfungen nach<br />
§16 BetrSichV und/oder § 29a BImSchG.<br />
INNOVAS Innovative Energie- & Umwelttechnik<br />
Anselm Gleixner und Stefan Reitberger GbR<br />
Margot-Kalinke-Str. 9 · 80939 München<br />
Tel.: 089 16 78 39 73 · Fax: 089 16 78 39 75<br />
info@innovas.com · www.innovas.com<br />
| pumpen<br />
| lagern<br />
| rühren<br />
| separieren<br />
* Die Höhe der Förderung ist abhängig von der<br />
Stromeinsparung bzw. der jährlich eingesparten<br />
Tonne CO2.<br />
117<br />
Tel. +49 4443 9666-0<br />
www.stallkamp.de<br />
MADE IN DINKLAGE
BIOGASANALYSE<br />
Recht<br />
FOS/TAC<br />
SSM 6000<br />
automatischer Titrator<br />
zur Bestimmung<br />
von FOS, TAC und<br />
FOS/TAC<br />
der Klassiker für die Analyse<br />
von CH 4<br />
, H 2<br />
S, CO 2<br />
, H 2<br />
und O 2<br />
mit und ohne Gasaufbereitung<br />
SSM 6000 ECO<br />
www.pronova.de<br />
* proCAL für SSM 6000, ist<br />
die vollautomatische,<br />
prüfgaslose Kalibrierung<br />
für NO x<br />
, CO und O 2<br />
, mehrere<br />
Meßstellen (44. BlmSchV.)<br />
TRAS 120<br />
44. BlmSchV.<br />
sprechen<br />
Sie uns an!<br />
GASANALYSENTECHNIK<br />
BIOGASANALYSENTECHNIK<br />
WASSERANALYSENTECHNIK<br />
AGRARMESSTECHNIK<br />
PRONOVA Analysentechnik GmbH&Co.KG<br />
Groninger Straße 25 I 13347 Berlin<br />
Tel +49 (0)30 455085-0 I info@pronova.de<br />
*<br />
Recht<br />
se ab diesem Zeitpunkt zu 100 Prozent zu<br />
entschädigen.<br />
Die Bestimmungen in Artikel 13<br />
EBM-VO<br />
Seit dem 1. Januar <strong>2020</strong> gilt daneben allerdings<br />
die EBM-VO, deren Artikel 13 mit<br />
den Absätzen 6 und 7 ebenfalls Vorgaben<br />
zum sogenannten Redispatch sowie zur finanziellen<br />
Entschädigung im Fall der Abregelung<br />
von Anlagen zur Erzeugung von<br />
Strom aus Erneuerbaren Energien enthält.<br />
Nach Artikel 13 Absatz 7 Satz 1 EBM-VO<br />
hat – vergleichbar dem § 15 EEG 2017 –<br />
der Betreiber einer Anlage, mit der ein Redispatch<br />
erfolgt, Anspruch auf einen finanziellen<br />
Ausgleich durch den Netzbetreiber,<br />
der den Redispatch angefordert hat.<br />
Ein Redispatch im Sinne der EBM-VO<br />
ist dabei jede Maßnahme, mit der ein<br />
Netzbetreiber durch die Veränderung von<br />
Erzeugungs- oder Lastmustern physikalische<br />
Engpässe mindert oder anderweitig<br />
für Systemsicherheit sorgt. Auch eine<br />
Einspeisemanagementmaßnahme im<br />
Sinne des EEG fällt hierunter. Betreiber<br />
von EEG-Anlagen, die abgeregelt werden,<br />
haben also grundsätzlich auch nach der<br />
EBM-VO einen Entschädigungsanspruch<br />
gegen den Netzbetreiber. Etwas anderes<br />
gilt nur dann, wenn der Anlagenbetreiber<br />
einen Netzanschlussvertrag akzeptiert hat,<br />
der keine Garantie für eine verbindliche<br />
Lieferung von Energie enthält. Dies ist in<br />
Deutschland jedoch nur bei sehr wenigen<br />
Anlagen der Fall.<br />
100 % finanzieller Ausgleich für<br />
Redispatchmaßnahmen<br />
Ein solcher weiterer Anspruch hilft dem<br />
Betreiber zunächst einmal noch nicht so<br />
viel weiter. Entscheidend ist jedoch die<br />
Regelung zur Entschädigungshöhe in der<br />
EBM-VO. Diese muss nach Artikel 13 Absatz<br />
7 Satz 2 EBM-VO mindestens dem<br />
höheren der folgenden Beträge oder einer<br />
Kombination beider Beträge entsprechen,<br />
wenn die Anwendung nur des höheren<br />
einen ungerechtfertigt niedrigen beziehungsweise<br />
hohen finanziellen Ausgleich<br />
zur Folge hätte:<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
a. Betrag der zusätzlichen Betriebskosten,<br />
die durch den Redispatch entstehen,<br />
beispielsweise zusätzliche Brennstoffkosten<br />
im Fall von aufwärts gerichtetem<br />
Redispatch oder zusätzliche Wärmebereitstellung<br />
im Fall von abwärts<br />
gerichtetem Redispatch von Gesamteinrichtungen<br />
zur Stromerzeugung mit<br />
hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung.<br />
b. Nettoeinnahmen aus dem Verkauf von<br />
Elektrizität auf dem Day-Ahead-Markt,<br />
die die Anlage ohne die Aufforderung<br />
zum Redispatch erzielt hätte. Erhält die<br />
Anlage eine finanzielle Unterstützung<br />
auf der Grundlage der erzeugten oder verbrauchten<br />
Strommenge, so gilt die finanzielle<br />
Unterstützung, die ohne die Aufforderung<br />
zum Redispatch erteilt worden<br />
wäre, als Teil der Nettoeinnahmen.<br />
Überträgt man die Bestimmungen zum<br />
Beispiel auf eine Biogasanlage, die durch<br />
den Netzbetreiber abgeregelt wird, so muss<br />
die Höhe der Entschädigung den zusätzlichen<br />
Betriebskosten und den Nettoeinnahmen<br />
des Anlagenbetreibers entsprechen,<br />
die diesem durch die Abregelung entstanden<br />
beziehungsweise entgangen sind.<br />
Letztere setzen sich im Regelfall aus den<br />
Wärmeerlösen und der Einspeisevergütung<br />
einschließlich etwaiger Boni beziehungsweise<br />
den Erlösen aus der Direktvermarktung<br />
und der Marktprämie zusammen, und<br />
zwar in voller Höhe und nicht nur in Höhe<br />
von 95 Prozent.<br />
Auch wenn der Artikel 13 Absatz 7 Satz<br />
2 EBM-VO keine ausdrückliche Regelung<br />
zu den entgangenen Wärmeerlösen sowie<br />
zu den ersparten Aufwendungen enthält,<br />
muss eine Entschädigung von Einspeisemanagementmaßnahmen<br />
sowohl nach<br />
dem Wortlaut als auch nach Sinn und<br />
Zweck der Regelung auch diese beiden<br />
Kostenpositionen berücksichtigen. Denn<br />
der Artikel 13 Absatz 7 Satz 2 EBM-VO<br />
regelt das Recht des Anlagenbetreibers<br />
an einem nicht „ungerechtfertigt niedrigen<br />
beziehungsweise hohen finanziellen<br />
Ausgleich“ für die erfolgte Abregelung.<br />
Damit wird sichergestellt, dass der Anlagenbetreiber<br />
als Entschädigung genau das<br />
bekommt, was er erzielt hätte, wenn der<br />
Netzbetreiber keine Abregelung vorgenommen<br />
hätte.<br />
Was gilt dann in Deutschland seit<br />
dem 1. Januar <strong>2020</strong>?<br />
Im Rahmen der aktuellen Novelle des EEG<br />
plant der Gesetzgeber die Korrektur der<br />
Regelung in § 15 EEG, so dass ab dem 1.<br />
Januar 2021 auch das nationale Recht
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Recht<br />
Visuelle<br />
Kontrolle Ihrer<br />
Biogas-Produktion<br />
eine vollumfängliche Entschädigung des<br />
Anlagenbetreibers für Abregelungsmaßnahmen<br />
vorsehen soll. Diese Korrektur ist<br />
zwar aus Gründen der Rechtssicherheit zu<br />
begrüßen, führt allerdings nicht zu einer<br />
Änderung der bereits ab dem 1. Januar<br />
<strong>2020</strong> geltenden Rechtslage.<br />
Denn anders als Richtlinien bedürfen Verordnungen<br />
in den Mitgliedstaaten nicht<br />
der gesonderten Umsetzung. Das heißt:<br />
Die EU-Elektrizitätsbinnenmarktverordnung<br />
ist seit dem 1. Januar <strong>2020</strong> geltendes<br />
Recht in Deutschland.<br />
Soweit bisher das (ebenfalls im Grunde<br />
geltende) deutsche Recht, hier § 15 EEG<br />
2017, vom europäischen Recht abweicht,<br />
ist dieser Widerspruch nach den allgemeinen<br />
geltenden Bestimmungen des Geltungsvorrangs<br />
des Europarechts dadurch<br />
aufzulösen, dass nicht die deutsche, sondern<br />
die europäische Regelung Anwendung<br />
findet.<br />
Zukünftig: Neue Regelungen<br />
zum Redispatch im<br />
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)<br />
Am 1. Oktober 2021 sollen die §§ 14 und<br />
15 EEG 2017 aufgehoben und durch neue<br />
Regelungen zum Redispatch in §§ 13,<br />
13a EnWG ersetzt werden. Danach kann<br />
ein Netzbetreiber Redispatchmaßnahmen<br />
ergreifen, wenn die Sicherheit oder Zuverlässigkeit<br />
des Elektrizitätsversorgungssystems<br />
in der jeweiligen Regelzone gefährdet<br />
oder gestört ist (§ 13 Absatz 1 EnWG). Eine<br />
solche Gefährdung der Sicherheit oder Zuverlässigkeit<br />
des Elektrizitätsversorgungssystems<br />
in der jeweiligen Regelzone soll<br />
gemäß § 13 Absatz 4 EnWG (neu) immer<br />
dann vorliegen, wenn örtliche Ausfälle<br />
des Übertragungsnetzes oder kurzfristige<br />
Netzengpässe zu besorgen sind oder zu<br />
besorgen ist, dass die Haltung von Frequenz,<br />
Spannung oder Stabilität durch die<br />
Betreiber von Übertragungsnetzen nicht<br />
im erforderlichen Maße gewährleistet<br />
werden kann. Kommt es zu einer solchen<br />
Anpassung der Blindleistungs- oder Wirkleistungserzeugung,<br />
statuiert § 13a Absatz<br />
2 EnWG (neu) eine Entschädigungspflicht<br />
zugunsten des Anlagenbetreibers, ohne<br />
dass hierfür weitere Voraussetzungen erfüllt<br />
sein müssen.<br />
Im Übrigen entsprechen die Neuregelungen<br />
des EnWG zur Berechnung der Entschädigungshöhe<br />
der Anlagenbetreiber<br />
bei erfolgten Redispatchmaßnahmen den<br />
bisherigen EEG-Vorschriften zur Einspeisemanagement-Entschädigung.<br />
Der Gesetzgeber hat – wie bereits erwähnt –<br />
den Anpassungsbedarf des EEG im neuen<br />
RegE-EEG 2021 erkannt, so dass konsequenterweise<br />
auch eine entsprechende<br />
Anpassung der neuen, ab dem 1. Oktober<br />
2021 geltenden Entschädigungsregelung<br />
in § 13a Absatz 2 EnWG zu erwarten ist.<br />
Da allerdings die im EnWG geregelten<br />
Maßnahmen (ebenso wie die Einspeisemanagementmaßnahmen<br />
im Sinne des<br />
EEG) als Redispatchmaßnahmen nach<br />
der EBM-VO zu werten sind, würden die<br />
oberen Grundsätze zum vollumfänglichen<br />
Entschädigungsanspruch der Anlagenbetreiber<br />
ab dem 1. Oktober 2021 weiterhin<br />
Anwendung finden, auch wenn der Gesetzgeber<br />
es bis dahin versäumen sollte, den<br />
Wortlaut in der Änderung des EnWG zu<br />
korrigieren.<br />
Fazit: Anspruch auf 100 Prozent<br />
EinsMan-Entschädigung geltend<br />
machen!<br />
Im Ergebnis müssen Anlagenbetreiber<br />
deshalb im Fall von Einspeisemanagementmaßnahmen<br />
seit dem 1. Januar <strong>2020</strong><br />
nicht nur 95 Prozent (bei der jeweiligen<br />
EinsMan-Maßnahme) oder 99 Prozent (bezogen<br />
auf das jeweilige Jahr) erhalten, sondern<br />
eine Entschädigung von 100 Prozent<br />
der entgangenen Einnahmen ab der ersten<br />
abgeregelten Kilowattstunde.<br />
Allen Betreibern von seit dem 1. Januar<br />
2012 in Betrieb genommenen EEG-Anlagen,<br />
die bisher nur den verminderten<br />
Entschädigungsanspruch geltend machen<br />
konnten, ist vor diesem Hintergrund zu<br />
empfehlen, seit dem 1. Januar <strong>2020</strong> gegenüber<br />
dem Netzbetreiber stets ab der<br />
ersten abgeregelten Kilowattstunde 100<br />
Prozent der entgangenen Einnahmen geltend<br />
zu machen.<br />
Autoren<br />
Pavlos Konstantinidis, LL.M.<br />
Rechtsanwalt<br />
Dr. Florian Valentin<br />
Rechtsanwalt<br />
von Bredow Valentin Herz<br />
Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB<br />
Littenstr. 105 · 10179 Berlin<br />
030/809 24 82-20<br />
www.vbvh.de<br />
119<br />
Lumiglas optimiert Ihren<br />
Biogas-Prozess<br />
• Fernbeobachtung mit dem<br />
Lumiglas Ex-Kamera-System<br />
• Lokale oder globale Paketlösungen<br />
schaffen kostengünstig Sicherheit<br />
Info-Material<br />
gleich heute anfordern!<br />
F.H. Papenmeier GmbH & Co.KG<br />
Telefon 0 23 04-205-0<br />
info.lumi@papenmeier.de<br />
www.lumiglas.de<br />
119
Produktnews<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
BHS-Sonthofen:<br />
neue Version des<br />
Biogrinders<br />
BHS-Sonthofen hat eine neue, vollständig<br />
überarbeitete Version des<br />
erfolgreichen Biogrinders auf den<br />
Markt gebracht. Die nun mit einem<br />
Scheibenrotor und Edelstahlkomponenten<br />
ausgestatte Maschine<br />
zeichnet sich durch eine noch höhere<br />
Langlebigkeit und Flexibilität aus. Kunden<br />
von BHS-Sonthofen nutzen in ihren Biomüllaufbereitungsanlagen<br />
den BHS Biogrinder<br />
vom Typ RBG, um das biologische<br />
Material für den Fermentierungsprozess<br />
Besondere Flexibilität und eine noch höhere Langlebigkeit zeichnen<br />
die Neuausführung des Biogrinders aus.<br />
möglichst effizient aufzubereiten. Die jetzt<br />
verfügbare Neuversion des Biogrinders bietet<br />
dem Anwender vor allem im Hinblick<br />
auf eine noch höhere Langlebigkeit Vorteile.<br />
Der Rotor ist modular aufgebaut. Das<br />
heißt, der bisherige zweistufige Rotor wurde<br />
durch einen Scheibenrotor ersetzt.<br />
Jede Ebene kann in Abhängigkeit<br />
vom Verschleiß einzeln und flexibel<br />
getauscht werden. Der Grundkörper<br />
bleibt dabei über eine sehr lange Zeit<br />
erhalten. Auch die zweite Neuerung –<br />
die überwiegende Nutzung von Edelstahlkomponenten<br />
– fördert die Langlebigkeit<br />
der Maschine. Jetzt sind<br />
alle Bestandteile der Maschine, die<br />
mit dem Material direkt in Berührung<br />
kommen, aus Edelstahl. Das betrifft<br />
vor allem die inneren Auskleidungen, wie<br />
Rotor, Seitenwände oder Ein- und Auslauf.<br />
Der Edelstahl schließt die Korrosion aus –<br />
die Verschleißzeit verlängert sich erheblich.<br />
Weitere Informationen unter<br />
www.bhs-sonthofen.de<br />
Foto: BHS-Sonthofen GmbH<br />
MOTORTECH präsentiert das MOTORTECH-EasyNOx<br />
Das MOTORTECH-EasyNOx wurde für die<br />
Überwachung und Dokumentation der<br />
Emissionen an Stickoxiden (NOx) konstruiert.<br />
Erhältlich als smartes BASIC-Paket<br />
oder in der Variante EXTENDED ist das<br />
EasyNOx für alle Gasmotoren geeignet und<br />
erfüllt die Anforderungen der VDMA 6299<br />
(Methoden zur Überwachung der Emissionen<br />
von Verbrennungsmotoranlagen). Ob<br />
als BASIC- oder EXTENDED-Variante, im<br />
MOTORTECH-EasyNOx werden vom aktuell<br />
gemessenen NOx-Wert Tagesmittelwerte<br />
gebildet und im großzügigen on-board<br />
Datenspeicher dokumentiert. Die Visualisierung<br />
und Bedienung erfolgt über ein 7<br />
Zoll Touchpanel, das in ein verschraubtes<br />
Metallgehäuse eingebaut ist. Die überwachten<br />
Daten werden hier mit aktuellem<br />
NOx-Wert, Mittelwert, O 2<br />
-Wert, Temperaturen<br />
und auch Warnmeldungen angezeigt<br />
und gespeichert. Bei der BASIC-Variante<br />
wird die Normalbetrieb-Erkennung mittels<br />
4-20 mA MAP (Ladedruck) Eingangssignal<br />
sichergestellt. Mit der EXTENDED-Variante<br />
werden durch die Anbindung an eine übergeordnete<br />
Steuerung, wie zum Beispiel die<br />
ALL-IN-ONE, die Aggregate- und BHKW-<br />
Steuerung von MOTORTECH, analoge und<br />
binäre Meldungen ausgetauscht. Das Reporting<br />
der aufgezeichneten Werte ist für<br />
den Betreiber sehr einfach über die USB-<br />
Schnittstelle möglich.<br />
MOTORTECH-NOx-Monitoring zum Überwachen von<br />
Emissionen und für den Nachweis des effektiven<br />
Betriebes von Gas-Otto-Verbrennungsmotoranlagen.<br />
Weitere Informationen unter<br />
www.motortech.de<br />
Foto: MOTORTECH GmbH<br />
SUMA –neues Stabrührwerk FTX<br />
In den letzten Jahren hat sich ein klarer<br />
Trend in der Biogasbranche abgezeichnet.<br />
Betreiber tendieren zum Einsatz von<br />
Gärsubstraten mit immer höherem Trockensubstanzgehalt,<br />
um eine ergiebigere<br />
Gasausbeute zu erzielen und um preiswertere<br />
Substrate einsetzen zu können. SUMA<br />
kommt den veränderten Anforderungen<br />
nach und erweitert das Portfolio an langsam<br />
drehenden Stab- und Tauchmotorrührwerken<br />
um den neuen Rührgigant FTX.<br />
Bis 15 Prozent Trockensubstanzgehalt<br />
kann das Rührwerk eingesetzt werden. Der<br />
FTX hat eine Nennleistung von 15 Kilowatt.<br />
Beim Motor greift der Allgäuer Rührtechnik-Spezialist<br />
auf<br />
einen energieeffizienten<br />
IE4-Motor<br />
mit sehr hohem<br />
Wirkungsgrad von 93,3 Prozent zurück. Die<br />
Stromaufnahme ist dadurch deutlich reduziert.<br />
Darüber hinaus ist das Rührwerk aufgrund<br />
der hohen Effizienzklasse durch die<br />
Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle<br />
(Bafa) förderfähig, was zusätzlich<br />
Einsparpotenzial bietet.<br />
Neben der Energieeffizienz wurde der Fokus<br />
bei der Konstruktion des Rührwerks auf<br />
maximale Langlebigkeit gelegt. Die Rohrin-Rohr-Bauweise<br />
macht das Rührwerk<br />
Durch die hohe Schubkraft von 6,5<br />
Kilonewton meistert das Stabrührwerk<br />
Substrate mit hohem Feststoffanteil.<br />
äußerst robust. Ein Einbau bis 8 Meter unter<br />
Füllstand kann dank eines raffinierten<br />
Dichtungssystems realisiert werden. Das<br />
Stabrührwerk ist in vier Längen von 4,0,<br />
5,0, 5,5 und 6,0 Meter erhältlich. Somit<br />
ist der FTX für nahezu jede Behältergröße<br />
und -form einsetzbar. Die vertikale Neigungsverstellung<br />
von +5°/-30° mittels Hydraulikzylinder<br />
lässt zudem keine Wünsche<br />
in Hinblick auf Flexibilität im Einsatz offen.<br />
Weitere Informationen unter www.suma.de<br />
Foto: SUMA Rührtechnik GmbH<br />
120
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
Produktnews<br />
THERM<br />
Keine Korrosionsbeschichtung des Behälters<br />
Kein Gasvolumen gem. Störfall Verordnung<br />
www.n-e-st.de<br />
Tel.: 02561 449 10 10<br />
Abgaswärmetauscher<br />
Dampferzeuger<br />
Gaskühler / Gaserwärmer<br />
Sonderanwendungen<br />
Zusatzkomponenten<br />
Energiepark 26/28 91732 Merkendorf<br />
+49 9826-65 889-0 info@enkotherm.de<br />
www.enkotherm.de<br />
• Doppel- /Dreimembrangasspeicher<br />
• „Flex“- Reingasspeicher<br />
• Emissionsschutzabdeckungen<br />
• Behälterauskleidungen mit<br />
Leckagekontrolle<br />
• Erdbecken für Gülle- und<br />
Wirtschaftsdünger (JGS-Zulassung),<br />
Silosickersaft, Rübenmus<br />
ceno.sattler.com<br />
Sattler Ceno<br />
TOP-TEX GmbH<br />
Am Eggenkamp 14<br />
D-48268 Greven<br />
Tel.: +49 2571 969 0<br />
biogas@sattler.com<br />
Tank und Apparate Barth GmbH<br />
Werner-von-Siemens-Str. 36<br />
76694 Forst<br />
Tel. 07251 / 9151-0<br />
FAX 07251 / 9151-75<br />
info@barth-tank.de<br />
Tanks neu / gebrauchT<br />
Lösch-/Regenwasserbehälter, Pufferspeicher,<br />
Flüssigdüngertankanlagen,<br />
Diesel-, Heizöl- und Pflanzenölbehälter,<br />
Edelstahlbehälter<br />
von 1.000 – 300.000 Ltr. Inhalt<br />
zu verkaufen.<br />
- Industriedemontagen -<br />
Elektro<br />
Hagl<br />
Ihr Partner<br />
in Sachen<br />
BHKW<br />
Komplettmodule 50kW-530kW<br />
+ Motoren Generatoren<br />
+ Notstromaggregate<br />
+ Schaltanlagen<br />
Coole<br />
Lösung<br />
für feuchte<br />
Gase!<br />
Kosteneinsparpotenziale<br />
mit der richtigen Planung.<br />
Entfeuchtung / Erwärmung<br />
Der SILOXA-PowerDryer zur<br />
Trocknung von feuchten Gasen,<br />
in Kombination mit dem FAKA<br />
Aktivkohlefilter, ist die effiziente<br />
und wirtschaftliche Lösung.<br />
Gas & Diesel Service<br />
www.biogas-hagl.de · T. 0 84 52 . 73 51 50<br />
RÜHRTECHNIK<br />
Zapfwellenmixer, Hydraulikmixer,<br />
Elektromixer, Tauchmotormixer,<br />
Spaltenbodenmixer, Güllemixer<br />
für Slalomsysteme<br />
Tel. 07374-1882, www.reck-agrar.com<br />
www.siloxa.com • Tel.: 0201 9999 5727<br />
Rotoren und Statoren<br />
für Excenterschneckenpumpen aller Hersteller.<br />
In Deutschland gefertigt im Originalmaß und aus<br />
Original-Material<br />
25 % bis 40 % billiger<br />
Fordern Sie Ihr konkretes Angebot an unter<br />
www.ilmaco-vertrieb.de<br />
ILMACO Vertrieb oHG mb@ilmaco.de<br />
Fischerstr. 13 · 84137 Vilsbiburg · (0176) 476 494 69<br />
121
IMPRESSUM<br />
Biogas Journal | 6_<strong>2020</strong><br />
IMPRESSUM<br />
Herausgeber:<br />
Fachverband Biogas e. V.<br />
Dr. Claudius da Costa Gomez (V.i.S.d.P.)<br />
Andrea Horbelt (redaktionelle Mitarbeit)<br />
Angerbrunnenstraße 12 · 85356 Freising<br />
Tel. 0 81 61/98 46 60<br />
Fax: 0 81 61/98 46 70<br />
E-Mail: info@biogas.org<br />
Internet: www.biogas.org<br />
ISSN 1619-8913<br />
Redaktion:<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Fachverband Biogas e. V.<br />
Tel. 0 54 09/9 06 94 26<br />
E-Mail: martin.bensmann@biogas.org<br />
Abgaskatalysatoren<br />
Für alle in Deutschland zugelassenen BHKWs.<br />
Zur Einhaltung der neuen Abgasnorm von<br />
< 20mg Formaldehyd mit 120 mm Kat.<br />
Zu sehr günstigen Preisen (netto plus Fracht)<br />
z.B. MAN bis 210 kW für 1.299 €<br />
Fordern Sie Ihr konkretes Angebot an unter<br />
www.ilmaco-vertrieb.de<br />
ILMACO Vertrieb oHG mb@ilmaco.de<br />
Fischerstr. 13 · 84137 Vilsbiburg · (0176) 476 494 69<br />
Anzeigenverwaltung & Layout:<br />
bigbenreklamebureau GmbH<br />
An der Surheide 29 · 28870 Ottersberg-Fischerhude<br />
Tel. 0 42 93/890 89-0<br />
Fax: 0 42 93/890 89-29<br />
E-Mail: info@bb-rb.de<br />
Internet: www.bb-rb.de<br />
Druck: Druckhaus Fromm, Osnabrück<br />
Das BIOGAS Journal erscheint sechsmal im Jahr auf Deutsch.<br />
Zusätzlich erscheinen zwei Ausgaben in englischer Sprache.<br />
Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich<br />
geschützt. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben<br />
die Meinung des Verfassers wieder, die nicht unbedingt mit der<br />
Position des Fachverbandes Biogas e.V. übereinstimmen muss.<br />
Nachdruck, Aufnahme in Datenbanken, Onlinedienste und Internet,<br />
Vervielfältigungen auf Datenträgern wie CD-Rom nur nach vorheriger<br />
schriftlicher Zustimmung. Bei Einsendungen an die Redaktion<br />
wird das Einverständnis zur vollen oder auszugsweisen Veröffentlichung<br />
vorausgesetzt. Für unverlangt eingehende Einsendungen<br />
wird keine Haftung übernommen. Die Redaktion behält sich vor,<br />
Leserbriefe sinnerhaltend zu kürzen.<br />
122
Alter Schwede, ist der gut!<br />
Ausgewählte Sortenkombination<br />
#Ertragssicherheit<br />
#OptiplusBeizung<br />
TEC<br />
INNOVATIVE TECHNIK DURCH KOMPETENZ<br />
Denken Sie schon jetzt<br />
an Ihren Frühbezug!<br />
Damit Technik funktioniert!<br />
Wir bieten eine BImSchVkonforme<br />
NOx-Überwachung an!<br />
Motorentechnik<br />
– Zündtechnik<br />
– Injektoren / PDE<br />
– Filtertechnik<br />
– Reparaturteile<br />
(für alle Fabrikate)<br />
– Turbolader<br />
Anlagentechnik<br />
– Rührwerkstechnik /<br />
Separatoren<br />
– Pumpentechnik<br />
– Sensoren / Aktoren<br />
– Mess- und Dosiertechnik<br />
– Ersatzteile für<br />
Aggregate<br />
Agrartechnik<br />
– Rührwerkstechnik<br />
– Gülletechnik<br />
(stationär / mobil)<br />
– Hydraulik- und<br />
Drucklufttechnik<br />
– Verschleißteile für<br />
Erntetechnik<br />
– Ersatzteile für Landtechnik<br />
SaM-Power GmbH<br />
Schmiedestraße 9 · 27419 Lengenbostel<br />
Fon: (0 42 82) 6 34 99 - 0 · Fax: (0 42 82) 6 34 99 - 19<br />
Mail: info@sam-power.de · www.sam-power.de<br />
123
MADE I N<br />
clean air is our engine<br />
Selbst ist der MAN(N)<br />
Katalysatormontage leicht gemacht<br />
G E R M A N Y<br />
Ab 695 € *<br />
+<br />
Hochwertiger Universalkatalysator<br />
Plombenset<br />
+ +<br />
Handschuhe Drahtbürste Kupferpaste<br />
* Der Preis von 695 € je Unikat-Set gilt nur ab einer Bestellung von 4 Sets (= 4 Katalysatoren, 4 Plombensets, ein Paar Handschuhe, eine Drahtbürste, eine Kupferpaste),<br />
Einzelpreis des Unikat-Sets: 795 €<br />
Weitere Informationen finden Sie unter www.bhkwteile.de/unikat<br />
Haben Sie Fragen?<br />
Wir helfen Ihnen gerne weiter.<br />
Sprechen Sie uns an!<br />
Emission Partner GmbH & Co. KG<br />
Industriestraße 5<br />
D-26683 Saterland-Ramsloh<br />
Telefon: +49 4498 92 326 - 26<br />
E-Mail: info@emission-partner.de<br />
Web: www.emission-partner.de