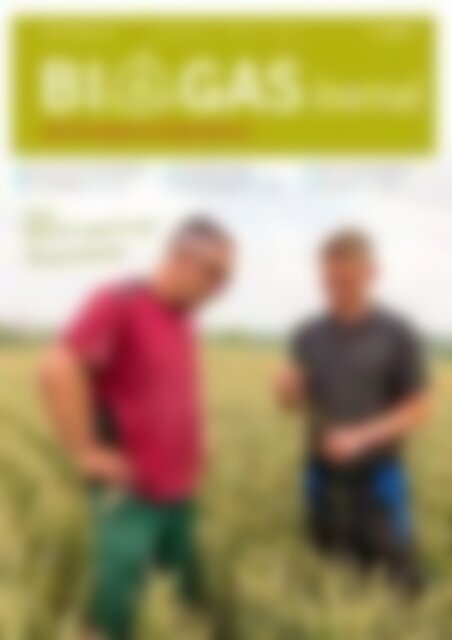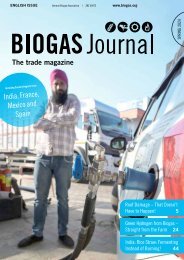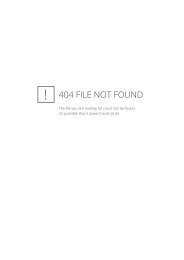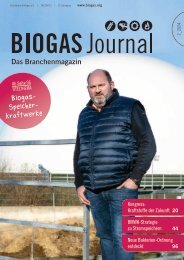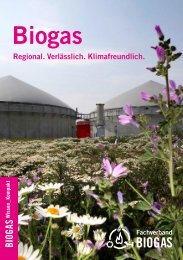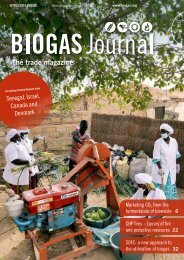5_2021 Leseprobe
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
www.biogas.org Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 50073 | 24. Jahrgang<br />
5_<strong>2021</strong><br />
BI<br />
GaS Journal<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche<br />
Energiepolitische Zukunft<br />
im Südwesten S. 32<br />
Österreich: neues<br />
Einspeisegesetz S. 80<br />
Votum Clearingstelle –<br />
was nun? S. 106<br />
Ab Seite 40<br />
Alternativer<br />
Ackerbau
Inhalt<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Alles aus einer Hand -<br />
Ihren Anforderungen entsprechend!<br />
Adsorber<br />
Produktion<br />
Flachbett- &<br />
Schüttbettadsorber<br />
auf Basis<br />
nachwachsender<br />
Rohstoffe<br />
Kunststoff &<br />
Edelstahl<br />
Aktivkohle-Wechsel<br />
kurze<br />
Reaktionszeit<br />
Entsorgung<br />
inkl. Nachweis<br />
kurze Lieferzeiten<br />
flexible<br />
Liefermengen<br />
Logistik<br />
Auslegung inkl.<br />
Standzeitberechnung<br />
Optimierungsberatung<br />
Qualitätskontrolle<br />
Service<br />
Labor<br />
Beladungsuntersuchung<br />
Natürlich besser!<br />
• Dotierte Aktivkohle<br />
zur Entschwefelung &<br />
Reinigung von technischen<br />
Gasen<br />
• entfernt zusätzlich in<br />
einem Schritt Siloxane,<br />
VOC´s und Mercaptane<br />
• hergestellt in Deutschland<br />
• lange Standzeiten, weniger<br />
Wechsel<br />
Sparen Sie Kohle und sichern Sie sich ihr Angebot!<br />
AdFiS products GmbH<br />
Am Kellerholz 14<br />
2<br />
D-17166 Teterow<br />
Telefon: +49 (0) 3996 15 97-0<br />
Fax: +49 (0) 3996 15 97-99<br />
E-Mail: sales@adfis.de<br />
web: www.adfis.de
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Editorial<br />
Wir haben<br />
die Wahl!<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
wenn Sie dieses Biogas Journal in den Händen halten,<br />
dann sind es nur noch ein paar Tage bis zur Bundestagswahl.<br />
Zum Redaktionsschluss Ende August war völlig<br />
offen, wer Bundeskanzler*in werden wird. Auch völlig<br />
offen war, welche Parteien koalieren und die nächste<br />
Bundesregierung stellen werden. Völlig klar ist aber das<br />
energie- und klimapolitische Resümee, das wir nach<br />
16 Jahren Kanzlerinnenschaft von Dr. Angela Merkel<br />
ziehen können.<br />
CDU und CSU haben in den vergangenen vier Legislaturperioden<br />
mal mit der FDP, mal mit der SPD regiert.<br />
Von den vier Parteien hat sich allenfalls noch die CSU<br />
für die Energiewende – insbesondere für den Erhalt der<br />
Biogasproduktion – eingesetzt. Die anderen drei haben<br />
weder energie- noch klimapolitisch geglänzt. Klar, es<br />
wurden immer wieder großmundig Ziele formuliert,<br />
aber am Willen, diese zu erreichen, fehlte es indes.<br />
Stattdessen wurde die Biokraftstoffbranche ausgebremst,<br />
der Solarmodulproduktion in Deutschland wurde<br />
der Todesstoß versetzt, die Rahmenbedingungen für<br />
die Biogasproduktion wurden mit jeder EEG-Novelle seit<br />
2014 verschlechtert. Es werden kaum noch neue Anlagen<br />
in Deutschland gebaut und der Anlagenbestand<br />
wird im heutigen Umfang nicht gehalten werden können.<br />
Und mittlerweile steckt die Windenergie angesichts<br />
ihrer stagnierenden Ausbauzahlen auch in der Krise.<br />
Das ist das Ergebnis politischer Kurzsichtigkeit und eines<br />
politischen Taktierens und Agierens auf Sicht. Die<br />
nächste Bundesregierung muss die Ärmel aufkrempeln<br />
und alle energie- und klimapolitischen Bremsen lösen.<br />
Sie muss politische Akzente setzen. Sie muss vorausschauend<br />
agieren und gestalten und nicht selbst Krisen<br />
erzeugen. Sie wird gemessen werden an dem Willen,<br />
Energiewendeziele in die Tat umzusetzen. Bleibt es<br />
bei der Politik der Lippenbekenntnisse, wird die Klimawandelhypothek<br />
unserer Kinder und Enkelkinder<br />
immer größer.<br />
Aber eines ist auch klar: Wir dürfen nicht glauben,<br />
dass es allein reicht, mit der Energiewende alle Sektoren<br />
CO 2<br />
-neutral zu machen. Das ist nur ein Schritt,<br />
ein Baustein. Die Energieträger grün anstreichen und<br />
die globale Weltwirtschaft so weiterbetreiben, führt in<br />
eine Sackgasse. Wir müssen uns jetzt vielmehr fragen,<br />
wie wir auf unserem Planeten künftig wirtschaften und<br />
mit Ressourcen umgehen wollen. Mittlerweile wird<br />
immer deutlicher, dass die ungehemmte Umnutzung<br />
und Belastung von Naturräumen keine enkeltaugliche<br />
Perspektive darstellt. Es braucht eine andere Haltung<br />
unserer Mitwelt gegenüber.<br />
Um neue Perspektiven geht es auch im Schwerpunktthema<br />
in dieser Ausgabe, das sich wieder einmal mit<br />
alternativem Ackerbau beschäftigt. Wir stellen beispielhaft<br />
Menschen vor, die explizit die Bodenfruchtbarkeit<br />
und die Bodengare in den Mittelpunkt ihrer ackerbaulichen<br />
Aktivitäten stellen und die Pflanzengesundheit<br />
unkonventionell denken. Dabei geht es um Systeme,<br />
die stressresistenter, resilienter sind hinsichtlich des<br />
Klimawandels.<br />
Es geht um Systeme, die Regenwasser besser in die<br />
Böden in tiefere Schichten eindringen und umgekehrt<br />
weniger verdunsten lassen. Um Systeme, in denen die<br />
Böden immer einen gewollten, gelenkten Bewuchs<br />
aufweisen. Photosynthese treibende Pflanzen – insbesondere<br />
artenreiche Zwischenfruchtgemenge – sind ein<br />
Baustein pro ganzjähriger Bodengare und einem aktiven,<br />
individuenreichen Edaphon. Wir brauchen also innovative<br />
Ackerbaustrategien, die dem sich wandelnden<br />
Klima angepasst sind. Wir sollten uns im Kopf fit machen<br />
und dann unsere Böden – auch für nachfolgende<br />
Generationen. Wir haben die Wahl!<br />
Herzlichst Ihr<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann,<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
3
Inhalt<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
40<br />
Titelthema<br />
Alternativer Ackerbau<br />
40 Bodenfruchtbarkeit verbessern<br />
Von Christian Dany<br />
titelFoto: Carmen Rudolph i Fotos: Carmen Rudolph, Heinz Wraneschitz, LEE Schleswig-Holstein<br />
Editorial<br />
3 Wir haben die Wahl!<br />
Von Martin Bensmann,<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
AKTUELLES<br />
6 Meldungen<br />
8 Bücher<br />
10 Termine<br />
12 Biogas-Kids<br />
14 Biogas-Innovationskongress <strong>2021</strong><br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
22 Biomethan billiger als Wasserstoff<br />
Von Thomas Gaul<br />
26 BIOGAS Convention & Trade Fair <strong>2021</strong><br />
POLITIK<br />
28 Das „Kabinett Merkel IV“ aus Sicht<br />
der Biogasbranche: energiepolitischer<br />
Rück- und Ausblick<br />
Von Sandra Rostek und Dr. Guido Ehrhardt<br />
Baden-Württemberg / Rheinland-Pfalz<br />
32 Biogas wird unterschiedlich betont<br />
Von Bernward Janzing<br />
36 Chance einer Ökologisierung verspielt<br />
Von Bernward Janzing<br />
Beilagenhinweis:<br />
Das Biogas Journal enthält eine Beilage<br />
der Firma agrikomp und das Tagungsprogramm<br />
der Biogas Convention <strong>2021</strong>.<br />
50 „An erster Stelle steht die<br />
Bodenchemie, dann kann die<br />
Biologie anspringen“<br />
Von Christian Dany<br />
56 Streben nach „enkeltauglicher“<br />
Landwirtschaft<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
64 Modifiziertes Strip-Till-Verfahren<br />
sichert die Erträge<br />
Von Thomas Gaul<br />
PRAXIS<br />
70 Veitshöchheimer Hanfmix im Test<br />
Von Heinz Wraneschitz<br />
74 Biogas ade – Nach zwei Jahrzehnten<br />
Erzeugung steht am Ende des Jahres<br />
endgültig das Aus<br />
Von Dierk Jensen<br />
78 Anlagen des Monats<br />
4
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Inhalt<br />
70 96<br />
INTERNATIONAL<br />
Österreich<br />
80 Das neue EAG und seine Konsequenzen<br />
für die Biogasbranche<br />
Von EUR ING Marie-Luise Schaller<br />
Indien<br />
84 Komprimiertes Biogas (CBG) – großes<br />
Potenzial aus landwirtschaftlichen<br />
Reststoffen<br />
Von Gaurav Kedia und Abhijeet Mukherjee<br />
90 DiBiCoo: Projekt zur Förderung der<br />
internationalen Zusammenarbeit im<br />
Bereich Biogas<br />
Von Frank Hofmann<br />
VERBAND<br />
Aus der Geschäftsstelle<br />
92 Brüssel: Entscheidende Weichenstellungen<br />
Von Dr. Stefan Rauh und<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
96 Aus den Regionalbüros<br />
98 Dekarbonisierung der Wärmenetze ist<br />
wichtiger Klimaschutzbeitrag<br />
Von Dr. Simone Peter, BEE<br />
100 Der Schulungsverbund Biogas gratuliert<br />
seinem 10.000sten Teilnehmer – eine<br />
Erfolgsgeschichte<br />
102 Rückblick Aktionswoche Artenvielfalt<br />
RECHT<br />
104 Zwei Voten zur (Neu-)Inbetrieb -<br />
nahme von Biogasanlagen und ein<br />
Schiedsspruch zur Mitnahme der<br />
Höchst bemessungsleistung<br />
Von Elena Richter<br />
106 Votum der Clearingstelle zur „Modernisierung“<br />
von Biogasanlagen – und jetzt?<br />
Von Dr. Helmut Loibl<br />
110 Herausforderung – BHKW-Tausch<br />
Von Dipl.-Betr. (BA) René Walter<br />
Produktnews<br />
112 Produktnews<br />
114 Impressum<br />
5
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
DBI-Studie: Grünes Flüssiggas spielt tragende<br />
Rolle bei der Energiewende im ländlichen Raum<br />
Berlin – Mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz<br />
hat die Bundesregierung für Deutschland<br />
das Ziel gesetzlich verankert, bis 2045<br />
Treibhausgas neutral zu sein. Im Auftrag<br />
des Deutschen Verbandes Flüssiggas e.V.<br />
(DVFG) untersuchte die renommierte DBI –<br />
Gastechnologisches Institut gGmbH die<br />
Potenziale von Grünem Flüssiggas.<br />
Grünes Flüssiggas kann insbesondere die<br />
CO 2<br />
-Emissionen von Wohngebäuden im<br />
ländlichen Raum kostengünstig senken, da<br />
Flüssiggas-Heizungsanlagen im Wohnungsbestand<br />
ohne technische Anpassungen mit<br />
dem regenerativen Energieträger betrieben<br />
werden können. „Die vom Deutschen Verband<br />
Flüssiggas vorgelegte Studie zeigt,<br />
dass Grünes Flüssiggas ein zentraler Baustein<br />
für eine erfolgreiche Energiewende<br />
sein wird“, sagt der DVFG-Vorstandsvorsitzende<br />
Jobst-Dietrich Diercks. „In den<br />
kommenden 10 bis 15 Jahren wird es unser<br />
Ziel sein, überwiegend Grünes Flüssiggas<br />
einzusetzen und damit die Defossilisierung<br />
von Energieerzeugung und Energieeinsatz<br />
voranzubringen.“<br />
Das Marktpotenzial für Grünes Flüssiggas ist<br />
enorm: Laut DBI könnten von den insgesamt<br />
5,87 Millionen Ölheizungen in Deutschland<br />
rund die Hälfte (3,08 Millionen)<br />
auf Flüssiggas umgestellt<br />
werden. „Jede zweite Ölheizung<br />
in Deutschland<br />
ist somit für einen Wechsel<br />
hin zu einer modernen<br />
Flüssiggas-Heizung<br />
prädestiniert. Das ist<br />
für kostenbewusste Heizungsmodernisierer<br />
eine<br />
attraktive Option“, sagt<br />
Diercks.<br />
Das DBI hat bis zum Jahr<br />
2050 ein Absatzpotenzial<br />
für Grünes Flüssiggas im<br />
Wärmemarkt in Deutschland<br />
von 3,7 Millionen<br />
Tonnen pro Jahr errechnet.<br />
Laut Einschätzung des DBI ließe sich<br />
der gesamte Bedarf an Grünem Flüssiggas<br />
für den Wärmemarkt aus heimischen Quellen<br />
decken.<br />
Grünes Flüssiggas ist klimafreundlich: Bei<br />
der Verbrennung wird nur CO 2<br />
aus biologischer<br />
Herkunft frei, sofern es aus Biogas<br />
synthetisiert wurde. Die wirtschaftlichste<br />
Methode, Grünes Flüssiggas herzustellen,<br />
ist der Prozess der trockenen Reformierung<br />
von Biogas mit anschließender Dimethylether-<br />
und Propylensynthese. Ein weiterer<br />
Von den insgesamt 5,87 Millionen Ölheizungen in Deutschland könnte<br />
rund die Hälfte (3,08 Millionen) auf Flüssiggas umgestellt werden.<br />
aussichtsreicher Weg, um Grünes Flüssiggas<br />
zu erzeugen, liegt in der Co-Elektrolyse<br />
von CO 2<br />
unter Verwendung von regenerativ<br />
erzeugtem Wasserstoff. Das CO 2<br />
fällt beispielsweise<br />
bei der Aufbereitung von Biogas<br />
zu einspeisefähigem Biomethan an. Die<br />
Erzeugung von Grünem Flüssiggas kann<br />
vielen Betreibern von Biogasanlagen eine<br />
zusätzliche Perspektive bieten. „Es sollte<br />
das Ziel sein, in möglichst vielen Bundesländern<br />
Demonstrations- und Pilotanlagen<br />
zu errichten“, sagt Diercks.<br />
Multi-Fuel-Traktor mit<br />
Biokraftstoffen erfolgreich<br />
Gülzow – Der Landmaschinenhersteller John Deere,<br />
das Technologie- und Förderzentrum Straubing und<br />
die Technische Universität Kaiserslautern haben<br />
gemeinsam ein Konzept für einen Multifuel-Traktor<br />
beziehungsweise für Multifuel-Motoren in Landmaschinen<br />
entwickelt. Das Motorsystem erlaubt<br />
den Einsatz zweier nachhaltiger Biokraftstoffe, wie<br />
Pflanzenölkraftstoff oder Biodiesel, oder konventionellem<br />
Dieselkraftstoff. Die Kraftstoffe können als<br />
Mischungen oder als Reinkraftstoffe genutzt werden.<br />
Neben dem Preisabstand zum Dieselkraftstoff ist die<br />
Beschränkung auf einen Kraftstoff für die gesamte<br />
Nutzungsdauer eines Schleppers ein Hemmnis für<br />
die Nutzung von Biokraftstoffen in der Landwirtschaft.<br />
In dem Projekt „Entwicklung und Feldtest<br />
eines Abgasstufe 5 Multi-Fuel-Traktors<br />
(Must5-Trak)“ wurden Pflanzenölkraftstoff,<br />
Biodiesel, aber auch konventioneller<br />
Dieselkraftstoff als Reinkraftstoffe<br />
und in diversen Mischungen erfolgreich<br />
getestet. Verschiedene Sensoren erkennen<br />
diese Kraftstoffmischungen, so<br />
dass über die Motorsteuerung die<br />
Wahl der optimalen Betriebspunkte<br />
erfolgt.<br />
Damit könnten Land- und Forstbetriebe<br />
CO 2<br />
-Emissionen senken und auf Preisvolatilität<br />
bzw. unterschiedliche Verfügbarkeit am Kraftstoffmarkt<br />
reagieren. Die Abgasvorschriften nach EU<br />
Stufe V werden mit allen Kraftstoffkombinationen<br />
Pflanzenölkraftstoff, Biodiesel, aber auch konventioneller Dieselkraftstoff<br />
wurden als Reinkraftstoffe und in diversen Mischungen<br />
erfolgreich in einem John-Deere-Schlepper getestet. Verschiedene<br />
Sensoren erkennen die Kraftstoffmischungen.<br />
eingehalten. Ein Hemmnis beim Einsatz von Biokraftstoffen<br />
wäre damit beseitigt, was Landwirten<br />
ermöglicht, hohe Anteile erneuerbarer, klimafreundlicher<br />
Kraftstoffe zu nutzen.<br />
Fotos: landpixel.eu<br />
6
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Aktuelles<br />
Heizkosten- und Kohlendioxid-<br />
Vergleich für erneuerbare Wärme<br />
Gülzow – Ob privater Gebäudeeigentümer,<br />
gewerblicher Immobilienverwalter oder Beschaffer<br />
für kommunale Liegenschaften:<br />
Wer die Heizung auf nachhaltige, erneuerbare<br />
Energie umstellen will, der kann mit<br />
dem Online-Wärmekostenrechner<br />
der Agentur für Erneuerbare<br />
Energien (AEE) die<br />
Treibhausgaseinsparung und<br />
die Kosten für das Heizen mit<br />
Biomasse- und Solarthermie<br />
sowie Wärmepumpen berechnen.<br />
Der Wärmekostenrechner<br />
ermöglicht den direkten Vergleich<br />
von Wirtschaftlichkeit<br />
und Klimabilanz verschiedener<br />
erneuerbarer Wärmeerzeuger<br />
und Hybridlösungen.<br />
Bei Eingabe von individuellen<br />
Daten unter anderem zu<br />
Gebäudetyp und Heizbedarf<br />
beziehungsweise bisherigem<br />
Heizölverbrauch kann mit<br />
dem Online-Wärmekostenrechner<br />
im Internet eine unabhängige<br />
Vollkostenanalyse auf Basis der<br />
tatsächlichen Verbrauchsdaten vorgenommen<br />
werden. Die Heizkostenberechnung<br />
berücksichtigt dazu Anschaffungs- und Betriebskosten<br />
sowie den CO 2<br />
-Ausstoß durch<br />
Brennstoffeinsatz, Vorketten und Betrieb<br />
von Heizungsanlagen.<br />
Die hier zugrundeliegenden Daten für die<br />
Berechnungen werden vom Institut für<br />
Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung<br />
an der Universität Stuttgart<br />
(IER, Universität Stuttgart) beigesteuert.<br />
Wer die Heizung auf nachhaltige, erneuerbare Energie umstellen will, der kann mit<br />
dem Online-Wärmekostenrechner der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) die<br />
Treibhausgaseinsparung und die Kosten für das Heizen mit Biomasse- und Solarthermie<br />
sowie Wärmepumpen berechnen.<br />
Für unterschiedlichste Gebäudetypen,<br />
wie Altbauten und Neubauten, Ein- und<br />
Mehrfamilienhäuser, Gewerbeimmobilien<br />
und größere Gebäudekomplexe, liefern<br />
die Berechnungsalgorithmen zuverlässige<br />
Werte für die Planung einer Energieträgerumstellung<br />
beziehungsweise Erneuerung<br />
der Heizung. Der auch als Wärmekompass<br />
bezeichnete Online-Wärmekostenrechner<br />
der AEE gibt einen Überblick über die<br />
nutzbaren Technologien und Brennstoffe<br />
sowie einen Einblick in die Vollkosten<br />
des Heizens und die damit verbundenen<br />
Treibhausgasemissionen. Er bietet so eine<br />
Orientierung, welche Optionen zum Heizen<br />
mit erneuerbaren Energien im Hinblick auf<br />
Treibhausgaseinsparung und Kosten in die<br />
engere Wahl genommen werden sollten.<br />
Aus stadtplanerischer und<br />
energietechnischer Sicht<br />
ist es dabei oft sinnvoll,<br />
die Planung über Einzelgebäude<br />
hinausgehend für<br />
Gebäudekomplexe beziehungsweise<br />
Quartiere vorzunehmen.<br />
Dazu ergänzt<br />
der AEE-Leitfaden „Wärmewende<br />
für Quartiere“ den<br />
Rechner. Mit den Leitfäden<br />
„Wärmewende für landwirtschaftliche<br />
Betriebe“<br />
und „Wärmewende in kommunalen<br />
Liegenschaften“<br />
zeigt die AEE zudem, wie<br />
die Wärmewende auch in<br />
Landwirtschaftsbetrieben<br />
und für kommunale Liegenschaften<br />
möglich und<br />
wirtschaftlich darstellbar ist. Das Bundesministerium<br />
für Ernährung und Landwirtschaft<br />
(BMEL) hat über die Fachagentur<br />
Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) das<br />
Verbundvorhaben „Wärmekostenrechner<br />
2.0“ (Förderkennzeichen: 2220NR050A,<br />
2220NR050B) gefördert.<br />
7
Aktuelles Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Bücher<br />
Schöpfung ohne Krone<br />
„Warum wir uns zurückziehen müssen, um<br />
die Artenvielfalt zu bewahren“ lautet der<br />
Untertitel der von Eileen Christ verfassten<br />
Kampfschrift gegen die ungebremste globale<br />
Zerstörung von Naturräumen zu Land und<br />
zu Wasser durch den Menschen. Das Buch<br />
gliedert sich in drei Hauptteile mit Unterkapiteln.<br />
Im ersten Teil beschreibt sie den weltweiten<br />
Zusammenbruch der Biodiversität<br />
anhand sich aneinanderreihender Beispiele.<br />
Dabei stellt sie Landwirtschaft und Fischerei<br />
besonders an den Pranger.<br />
Interessant sind ihre Ausführungen im zweiten Kapitel<br />
von Teil eins zu den Wurzeln des menschlichen Überlegenheitsdenkens<br />
und der daraus folgenden ökologischen<br />
Krise. Dieses althergebrachte Überlegenheitsdenken<br />
sei die Urquelle des Übels für die Unterwerfung<br />
der Natur, deren Ausbeutung und Zerstörung mit dem<br />
Verlust der Artenvielfalt und der Verödung ganzer Landstriche<br />
einhergeht. Sie entlarvt auch, dass die verantwortlichen<br />
Akteure im eigenen Interesse Sprache und<br />
Definition des eigenen Tuns kaschieren. So würden mit<br />
rhetorischen Finten aus auszubeutenden Bodenschätzen<br />
beispielsweise Ressourcen oder das Abholzen von<br />
Wäldern zur Umnutzung der Landschaft.<br />
Das Buch beinhaltet eine starke Vision, die heute wie<br />
eine Utopie klingt, dass die Menschengesellschaft auf<br />
maximal 3,5 Milliarden Menschen schrumpfen müsse,<br />
sodass den Naturräumen mehr vom Menschen ungenutzter<br />
Platz zur Renaturierung und Vermehrung der<br />
Artenvielfalt zur Verfügung steht. Bei ihr bekommt die<br />
globale „Wildnis“ mit den manigfaltigen Wundern der<br />
Schöpfung Vorrang. Sie kritisiert den menschlichen<br />
Expansionismus, der den biologischen Reichtum der<br />
Erde in katastrophalem Ausmaß verringere. Im dritten<br />
Teil des Buches nimmt sie dazu ausführlich Stellung.<br />
Eins steht als Fazit des Buches aber ganz klar fest:<br />
Wenn wir Menschen nicht anfangen, in allen Lebensbereichen<br />
nach der Weisheit der Selbstbeschränkung<br />
zu leben, sondern mit steigender Weltbevölkerung global<br />
genauso weiter wirtschaften, dann ist der ökologische<br />
und soziologische Kollaps auf diesem Planeten<br />
absehbar. Wenn das geschieht, hat die vermeintliche<br />
Krone der Schöpfung peinlich versagt. Die Grenzen der<br />
geographischen Ausdehnung und des ökonomischen<br />
Wachstums sind heute schon erreicht.<br />
Rezension: Martin Bensmann<br />
Bundes-Immissionsschutzgesetz, Kommentar<br />
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz<br />
(BImSchG)<br />
gilt als eines der praxisrelevantesten<br />
Regelwerke des<br />
Umweltrechts. Zugleich<br />
ist es aber auch sehr umfangreich<br />
und komplex: Die<br />
große Zahl an Vorschriften<br />
sowie das ausufernde untergesetzliche<br />
Regelwerk<br />
aus zahlreichen Durchführungsverordnungen<br />
und sonstigen konkretisierenden<br />
Regelwerken erschweren den Zugang und stellen hohe<br />
Ansprüche an den Umgang mit dem Gesetz.<br />
Immer die Bedürfnisse der Praxis im Fokus, bietet Ihnen<br />
der Berliner Kommentar BImSchG entscheidende<br />
Vorteile:<br />
ffAusgewogene Kommentierungen auf höchstem<br />
Niveau ohne überflüssigen Ballast, garantiert durch<br />
das große Expertenteam aus Rechtsanwälten,<br />
Syndikusanwälten, Richtern, Professoren und<br />
Ministerialbeamten.<br />
ffDirekte Einbindung der Erläuterungen zu allen<br />
BImSchVen sowie TA Luft, TA Lärm, AVV Baulärm<br />
und GIRL in die jeweiligen BImSchG-Kommentierungen<br />
– inkl. Synopse, die schnell zeigt, welche<br />
Vorschrift wo integriert ist.<br />
ffZahlreiche Praxisbeispiele, die typische Problemkonstellationen<br />
veranschaulichen und die Gesetzesanwendung<br />
im Einzelfall sehr erleichtern.<br />
ffEine umfangreiche, ständig aktualisierte Vorschriftendatenbank<br />
mit wichtigen immissionsschutzrechtlichen<br />
Vorschriften der EU, des Bundes und<br />
der Länder, bei der auch ein Vergleich mit früheren<br />
Rechtsständen möglich ist.<br />
Erich Schmidt Verlag, <strong>2021</strong>, XXVIII,<br />
1.826 Seiten, fester Einband, (D) 184,00 Euro,<br />
Berliner Kommentare<br />
ISBN 978-3-503-14183-8<br />
Bestellmöglichkeit online unter<br />
www.ESV.info/978 3 503 14183 8<br />
Oekom Verlag, München, Eileen Christ.<br />
Deutsche Erstausgabe, 2020, 355 Seiten,<br />
D: 28,00 Euro, A: 28,80 Euro.<br />
ISBN: 978-3-96238-178-3<br />
8
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
clean air is our engine<br />
Aktuelles<br />
Weitere Informationen unter<br />
www.katalysatorüberwachung.de<br />
Emissionsminderungsbonus <strong>2021</strong> sichern<br />
Für alle Fälle die richtige Lösung!<br />
EMI-LOG classic<br />
NO x -Sensor: Kontinuierliche<br />
Dokumentation der<br />
Stickoxidemissionen Ihres<br />
BHKW<br />
Temperatursensor: Nachweis<br />
des sachgemäßen<br />
Betriebs Ihres Abgasnachbehandlungssystems<br />
Für Anlagen im Anwendungsbereich<br />
der 44. BImSchV<br />
Unsere Alternative: EMI-LOG<br />
NO x -Sensor: Kontinuierliche Dokumentation der<br />
Stickoxidemissionen Ihres BHKW<br />
Temperatursensor: Nachweis des sachgemäßen<br />
Betriebs Ihres Abgasnachbehandlungssystems<br />
CO-Sensor: Monitoring zur Funktion der<br />
Abgasnachbehandlung<br />
Für Anlagen im Anwendungsbereich<br />
der 44. BImSchV + Abgasmonitoring<br />
Emission Partner GmbH & Co. KG<br />
Industriestraße 5<br />
D-26683 Saterland-Ramsloh<br />
Telefon: +49 4498 92 326 - 26<br />
E-Mail: info@emission-partner.de<br />
Web: www.emission-partner.de9
Aktuelles Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
termine<br />
22. bis 24. September<br />
Science Meets Practice - International<br />
Online Conference „Progress in Biogas V“<br />
Kirchberg<br />
ibbk-biogas.com<br />
24. und 25. November<br />
6 th Future of Biogas Europe<br />
Berlin<br />
www.wplgroup.com<br />
22. und 23. September<br />
3. Bayerische Biogasfachtagung: „Aufbereitung<br />
und Verwertung von Gärprodukten“<br />
Online<br />
www.messen-profair.de<br />
21. Oktober<br />
Web-Seminar: Prüf- und Dokumentationspflichten<br />
– Ein Überblick<br />
Online<br />
23. September<br />
5. Norddeutscher Biogas-Branchentreff<br />
Rendsburg<br />
www.biogas-branchentreff.de<br />
7. Oktober<br />
TRwS 793-1 – Biogasanlagen (Regelwerk<br />
aktuell) Web-Seminar<br />
Online<br />
eva.dwa.de<br />
Digital<br />
22. – 26. November <strong>2021</strong><br />
22. bis 26. November<br />
BIOGAS Convention Digital <strong>2021</strong><br />
Online<br />
Diese und weitere Termine rund um die<br />
Biogasnutzung in Deutschland und der Welt<br />
finden Sie auf der Seite www.biogas.org<br />
unter „Termine“.<br />
Gut zu wissen!<br />
Die Fachverband Biogas service GmbH kümmert sich um die Organisation<br />
und Durchführung von Schulungen und Fachveranstaltungen. Wir bieten<br />
Beratungsangebote im Bereich der Energieerzeugung durch Biogasanlagen<br />
für Hersteller, Dienstleister und Betreiber an.<br />
Unser aktuelles Veranstaltungsangebot finden Sie unter:<br />
www.service-gmbh.biogas.org<br />
Aktuelle<br />
Branchenthemen:<br />
eeG, Ausschreibungen,<br />
zukunftsoptionen, sicherheit,<br />
Düngerecht u.v.m.<br />
sPReCHen sie<br />
uns An!<br />
© Fotolia_Countrypixel<br />
Fachverband Biogas Service GmbH<br />
Angerbrunnenstr. 12<br />
85356 Freising<br />
0049 8161 / 984660<br />
service-gmbH@biogas.org<br />
10
ê<br />
ê<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Aktuelles<br />
Schreiber<br />
Anlagenbau<br />
Industrie | Biogas | Sondermaschinen | Klärtechnik<br />
DOSIER-MISCHERSCHNECKE 2.0<br />
mit einer Windung komplett V2A<br />
Unsere bewährte Mischerschnecke durch viel Erfahrung<br />
verbessert und weiterentwickelt<br />
durch verbesserte Geometrie der Windung,<br />
Reduzierung des Stromverbrauchs<br />
hergestellt aus V2A – 10 mm<br />
zwei Räumschwerter aus 15 mm V2A<br />
6 Messerhalter<br />
mit großer Serviceöffnung inkl. Abdeckung<br />
optional Ausräumer (rot) erhältlich<br />
für alle gängigen Hersteller<br />
lieferbar<br />
SEPARATORSCHNECKEN<br />
INDSTANDSETZUNG<br />
Wir warten und erhalten Separatorschnecken<br />
sämtlicher Hersteller!<br />
Aufarbeitung von abgenutzten Schnecken<br />
speziell entwickeltes Hartauftrag-Verfahren<br />
Rundschleifen auf Siebkorb-Maß<br />
mehr Pressleistung durch optimierte Geometrie<br />
hoher Verschleißschutz<br />
EGAL<br />
WELCHER<br />
HER-<br />
STELLER!<br />
FERMENTER ZU DICK?<br />
GASERTRAG ZU NIEDRIG?<br />
RÜHRWERKE AM ANSCHLAG?<br />
AS COMPACT CRUSHER<br />
einfacher Einbau vor/nach einer Pumpe<br />
einfache Steuerung<br />
integrierter Fremdkörperabscheider<br />
einfacher Messeraustausch<br />
geringe Unterhaltskosten<br />
Messersatz für nur 24 € erhältlich<br />
bis zu 120 m³/h Durchsatz<br />
mehr Gasertrag aus Problemstoffen/Verkürzung der Verweilzeit<br />
IE3 oder wahlweise IE4 Elektromotor<br />
mechanische verschleißfreie Dichtung<br />
extrem starke langlebige Lagerung<br />
Fermenter wird homogener und fließfähiger –<br />
bessere Ausnutzung<br />
problemloses vergasen von großen Mengen:<br />
Mist, Stroh, GPS oder andere Problemsubstrate<br />
zerkleinert/zerfasert<br />
- mechanisch durch extrem<br />
schnell drehende Messer<br />
- durch Kavitation, die bei der<br />
hohen Drehzahl entsteht<br />
verhindert Schwimmschichten<br />
dünnere Gülle beim Ausbringen<br />
verkürzt die Rührzeiten<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
BIS ZU<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
40 %<br />
ZUSCHUSS<br />
KFW 295<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
11<br />
Gasaufbereitung | Substrataufbereitung | Separation | Trocknungsanlagen | Instandsetzungen | Sonderanfertigung<br />
Tel.: 07305 95 61 501 | info@schreiber-anlagenbau.de | www.schreiber-anlagenbau.de
BIOGAS-KIDS<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Was heißt das eigentlich – klimaneutral?<br />
Alle reden darüber, jeder will<br />
es sein – je schneller, desto<br />
besser. Das Wort „klimaneutral“<br />
ist in aller Munde. Sogar<br />
Unternehmen werben damit:<br />
Der klimaneutrale Kaffeebecher,<br />
klimaneutraler Postversand<br />
oder Klamotten zum<br />
Anziehen, die klimaneutral<br />
sind. Sogar Deutschland will<br />
im Jahr 2050 klimaneutral<br />
sein – und das sorgt zurzeit<br />
für heftige Diskussionen. Und<br />
Pixabay<br />
ja, auch die Biogaserzeugung<br />
ist im besten Fall klimaneutral<br />
und deshalb zurecht eine zukunftsweisende Energieerzeugung.<br />
Aber was steckt eigentlich dahinter? Das<br />
Wort „neutral“ meint erst einmal, es gibt keine Auswirkungen.<br />
Logischerweise meint dann „klimaneutral“, dass<br />
es keine Auswirkungen auf das Klima gibt – weder gute<br />
noch schlechte. Immerhin. Denn der klimaneutrale Zustand<br />
besagt, dass durch ein Produkt, ein Verhalten oder<br />
eine Technik die Menge an klimaschädlichen Gasen in<br />
der Atmosphäre nicht erhöht wird. Bleiben wir bei der<br />
Energie. Biogas ist deshalb klimafreundlich, weil nachwachsende<br />
Rohstoffe eingesetzt werden und bei der<br />
Produktion kein zusätzliches schädliches CO2 erzeugt<br />
wird. Vielmehr setzen der Mais, das Gras oder andere<br />
Ananas schmeckt nicht nur<br />
Ananas ist eine leckere exotische Frucht – am besten natürlich<br />
frisch, schmeckt aber auch aus der Dose. Woher kommen die<br />
eigentlich? Von weit her – beispielsweise von den Philippinen.<br />
Das ist ein großer Inselstaat in Ostasien. Dort hat sich der<br />
Ananas- Lieferant Dole etwas Schlaues überlegt.<br />
Bei der Produktion des Dosenobsts gibt es<br />
nämlich Unmengen von Ananas-Schalen. Die<br />
wurden bisher kompostiert und dann als<br />
Dünger auf die Felder gebracht. Nachteil: Es<br />
entsteht sehr viel an klimaschädlichem<br />
Methan gas, das unkontrolliert in die Luft entweicht.<br />
Du weißt doch, wo Methan viel besser<br />
aufgehoben ist: genau, in einer Biogasanlage,<br />
um daraus Strom und Wärme zu erzeugen. Und<br />
das macht man jetzt dort auch mit den Ananas-<br />
Abfällen. 50.000 Tonnen weniger klimaschädliche<br />
Gase soll das pro Jahr bewirken. Strom<br />
und Dampf ersetzen in der Fabrik umweltschädliche<br />
Brennstoffe. Die Gärreste kommen<br />
dann weiter als Dünger auf die Felder –<br />
Biogas macht’s wieder besser! Pixabay<br />
Pflanzen in der Biogasanlage<br />
nur die Menge CO2 frei,<br />
die sie der Luft zuvor beim<br />
Wachsen auf dem Feld entzogen<br />
haben. Schließlich sorgen<br />
die Pflanzen für die Luft<br />
zum Atmen: Sie produzieren<br />
Sauerstoff und verbrauchen<br />
gleichzeitig CO2. Fairerweise<br />
muss man sagen, dass durch<br />
den Betrieb einer Biogasanlage<br />
trotzdem zusätzliches CO2<br />
entsteht – zum Beispiel durch<br />
die notwendigen Transporte<br />
mit Fahrzeugen vom Feld zur<br />
Anlage. Je mehr Wärme die Anlage für die Nachbarschaft<br />
erzeugt – und damit andere klimaschädliche Energieträger<br />
ersetzt –, desto näher kommt die<br />
Biogasanlage dem klimaneutralen<br />
Zustand. Es gibt dennoch ein großes<br />
ABER: weil für dein Leben und<br />
die Welt in Zukunft alles getan<br />
werden muss, damit weniger<br />
klimaschädliche Gase entstehen.<br />
Nur so kann die<br />
Aufheizung der Atmosphäre<br />
wirklich gestoppt werden.<br />
Shutterstock<br />
Klimaneutral reicht da nicht aus.<br />
Aroniabeeren<br />
Diese heimische Frucht wird<br />
auch Apfelbeere oder Schwarze<br />
Eber esche genannt und ist eine<br />
Wunder beere! Aroniabeeren<br />
ähneln vom Aussehen den Heidelbeeren,<br />
schwarzbläulich von außen<br />
und dunkelrot das Fruchtfleisch.<br />
Der Geschmack ist säuerlich. Sie<br />
hat viele heilende Inhaltsstoffe und<br />
gilt als Heilpflanze bei Bluthochdruck, Magen-Darm-Erkrankungen<br />
und Hautkrankheiten. Sie beeinflusst positiv viele bösartige Erkrankungen,<br />
z. B. auch Krebs.<br />
Es ist eine extrem anspruchslose Frucht. Ursprünglich kommt die<br />
Aroniabeere aus Nordamerika, wo sie den Indianern als Winterproviant<br />
diente. Im 18. Jahrhundert kam sie nach Europa und wurde<br />
kultiviert. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts wurde sie offiziell als<br />
Obst anerkannt. Aroniabeeren werden von Mitte August bis in den<br />
September geerntet und erfordern eine schnelle Verarbeitung zu<br />
Saft, Tee, Marmelade oder Gelee.<br />
www.agrarkids.de<br />
Landwirtschaft entdecken und verstehen –<br />
Die Fachzeitschrift für Kinder<br />
12
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Aktuelles<br />
ERFAHRUNG<br />
IST DIE BASIS<br />
JEDER INNOVATION<br />
Bei allem, was wir tun, verlieren wir nie aus den Augen, worum es für Sie geht:<br />
effiziente Technik und eine einfache Handhabe.<br />
Als Erfinder der elastomerbeschichteten Drehkolbenpumpe und Innovationstreiber für<br />
Einbring- und Aufbereitungstechnik sehen wir uns bei Vogelsang dem guten Ruf der deutschen<br />
Maschinenbauindustrie und ihrem Beitrag zur Energiewende verpflichtet. Seit der Gründung<br />
des Unternehmens 1929 liefern wir technische Lösungen, deren Funktionalität, Qualität<br />
und Zuverlässigkeit von unseren Kunden weltweit hoch geschätzt werden und unseren Wettbewerbern<br />
als Vorbild dienen.<br />
Unser umfassendes Know-how und die langjährige Erfahrung im Bereich Biogas nutzen<br />
wir, um unseren Kunden als kompetenter Partner zur Seite zu stehen. Mit schlagkräftiger<br />
Pump-, Zerkleinerungs-, Desintegrations- und Feststoffdosiertechnik ebenso wie mit unseren<br />
individuellen Beratungsleistungen.<br />
Deutschlands<br />
Innovationsführer<br />
Vogelsang Gmbh & Co. KG<br />
170. 0.000 untersuchte<br />
Unternehmen<br />
06 | <strong>2021</strong><br />
www.faz.net/Innovationsfuehrer<br />
VOGELSANG – LEADING IN TECHNOLOGY<br />
vogelsang.info<br />
13
Aktuelles Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Biogas-Innovationskongress <strong>2021</strong><br />
Neue Wertschöpfungspfade an<br />
Biogasanlagen anknüpfen<br />
Ende Juni fand auch der diesjährige Biogas-Innovationskongress – wie schon im Vorjahr –<br />
digital statt. Über 100 Teilnehmer*innen informierten sich über neue wirtschaftliche<br />
Standbeine an Biogasanlagen, über die stoffliche Nutzung von Gärrest-Feststoff, über die<br />
Nährstofffraktionierung der Gärreste, über die Biomethanerzeugung und vieles mehr.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Harald Wedwitschka vom Deutschen-Biomasseforschungszentrum<br />
(DBFZ) referierte<br />
über die Insektenmehlproduktion<br />
als Einkommensmöglichkeit zur Biogaserzeugung.<br />
„Insektenmehle könnten einen<br />
wichtigen Beitrag leisten, den Proteinbedarf in der<br />
Nutztierhaltung und Fischzucht zu decken. Insekten<br />
werden so zu Rohstofflieferanten der Bioökonomie“,<br />
erklärte der Referent.<br />
Das Konzept ziele darauf ab, eine hohe energetische<br />
und stoffliche Effizienz der Biomassenutzung durch<br />
eine Integration des Insektenherstellungsprozesses in<br />
bereits bestehenden Biogasanlagen zu realisieren. Auf<br />
diese Weise könne eine maximale Wertschöpfung aus<br />
organischen Rohstoffen erreicht, der Anfall von teuer<br />
zu entsorgenden Abfallprodukten vermieden und eine<br />
effizientere Verwertung von Biogasanlagenabwärme<br />
gelingen.<br />
Projektpartner war die Firma Hermetia Baruth GmbH,<br />
Insektenzüchter in Brandenburg. Das Unternehmen<br />
produziere in größerem Umfang Tierfuttermittel aus<br />
Insektenmehl der Schwarzen Soldatenfliege (Hermetia).<br />
Das getrocknete Mehl der Hermetialarven bestehe<br />
zu 35 bis 65 Prozent aus Protein und zu 30 bis 45<br />
Prozent aus Fett. Innerhalb der EU gebe es noch keine<br />
Freigabe für Insektenmehle in Nutztierfuttermitteln.<br />
Wedwitschka geht davon aus, dass die Zulassung in den<br />
nächsten zwei Jahren kommt. Außerhalb der EU sei die<br />
Vermarktung kein Problem, insbesondere in Ostasien<br />
und Nordamerika existierten Absatzmärkte.<br />
„Die Schwarze Soldatenfliege ist vielversprechend, da<br />
sie eine Futtergeneralistin ist. Auch in der Zucht ist sie<br />
robust. Sie gilt auch nicht unbedingt als Überträgerin<br />
von Pathogenen. Als Futterstoffe kommen Kohlenhydrate,<br />
Proteine und Fette infrage. Es sind nur Futterstoffe<br />
zugelassen, die eine Futtermitteltauglichkeit<br />
nachweisen“, berichtete Wedwitschka.<br />
Die Hermetiaproduktion habe einen geringen Wasserbedarf,<br />
Antibiotika würden seines Wissens nicht eingesetzt.<br />
Protein- und Fettgehalt der Hermetia hingen sehr<br />
stark vom Futter ab. Die Insektenproduktion bestehe<br />
aus zwei Stufen: zum einen der Insektenzucht und zum<br />
anderen der Insektenmast. Für die Insektenmehlproduktion<br />
werde die ausgewachsene Larve genutzt, die<br />
gemästet wird.<br />
Im Projekt wurde die Eignung unterschiedlicher Einsatzstoffe<br />
(zum Beispiel Mais-, Grassilage, Stroh, HTK,<br />
Gärreste) als Futterstoffe für die Insektenzucht untersucht.<br />
Ebenfalls wurden Reststoffe einer großtechnischen<br />
Insektenzucht als Biogassubstrat bewertet. Die<br />
untersuchten Reststoffe hätten sich als energiereiches<br />
Biogassubstrat erwiesen. In Langzeitgärversuchen im<br />
Labormaßstab seien Methanpotenziale von etwa 175<br />
Milliliter (ml) Methan (CH 4<br />
) pro Gramm organische Trockensubstanz<br />
(oTS) beziehungsweise 120 Kubikmeter<br />
CH 4<br />
pro Tonne Reststoff erzielt worden. Das Interesse<br />
nach neuen Wertschöpfungsketten für bestehende<br />
Biogasanlagen, wie der integrierten Insektenzucht am<br />
Standort einer Biogasanlage, nehme auch im internationalen<br />
Bereich zu. Auch in Entwicklungsländern habe<br />
diese Technologie in Zukunft ein hohes Anwendungspotenzial.<br />
Stallsystem mit Kot-Harn-Trennung<br />
Unternehmensberater Helmut Döhler von Döhler Agrar<br />
berichtete über ein Projekt, das von der Deutschen<br />
Bundesstiftung Umwelt seit 2017 gefördert wurde. Darin<br />
ging es um den Schweinestall der Zukunft. „Damals<br />
sind wir von der Hypothese ausgegangen, dass wir mit<br />
der Güllewirtschaft auf Dauer zu wenig stickstoffeffizient<br />
in der Landwirtschaft sind. Außerdem müssen wir<br />
feststellen, dass die Schweinehaltung die Bedürfnisse<br />
der Tiere nicht ausreichend berücksichtigt“, betonte<br />
Döhler zu Beginn seines Vortrages.<br />
Mit dem neuen Stallkonzept sollte die Stickstoff-Effizienz<br />
verbessert werden, sodass man nahe an die Mineraldüngerwirkung<br />
herankommt. Gleichzeitig sollten<br />
im Stall niedrigste Emissionen entstehen, also wenig<br />
Ammoniak und wenig Methan, sodass kaum Geruchsentwicklung<br />
stattfindet. Auf der Tierseite sollte ein<br />
tiergerechtes und gesellschaftlich akzeptiertes Stallsystem<br />
entwickelt werden, in dem bei den Tieren keine<br />
14
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Aktuelles<br />
Bild links und rechts: Kot-Harn-Sammelbecken unter dem perforierten Boden. Durch die Rinne<br />
in der Mitte fließt der Urin ab. Das Schiebersystem fördert den Kot heraus.<br />
Kot-Harn-Auffangbecken mit Trennsystem im Boden im Rohbau.<br />
Offener Außenklimabereich: Rechts im Bild ist ein Liegebereich mit Futtertrögen<br />
zu sehen, links im Bild sieht man den Spaltenboden, unter dem sich das<br />
neuartige Kot-Harn-Trennsystem befindet.<br />
Fotos: Döhler Agrar<br />
Schwänze mehr kupiert werden, die Tiere mehr Platz<br />
haben und in dem sie ihre artgerechte Verhaltensweise<br />
besser ausleben können.<br />
„Ergebnis des Ganzen war ein Konzeptstall ohne Mist<br />
und Gülle. Es ist ein Tierwohlstall mit Funktionsbereich,<br />
mit Außen- und Innenklima, innen klimatisierten Räumen,<br />
Komfortzone und einem‚ Toilettenbereich‘. Zum<br />
Ersatz der Güllewirtschaft wurde ein Kot-Harn-Trennsystem<br />
entwickelt und ein Urinstabilisierungssystem<br />
erdacht. Das heißt, dass der ausgeschiedene Harnstoff<br />
nur noch begrenzt in Ammoniak umgewandelt werden<br />
kann“, erläuterte Döhler.<br />
Schweinekot als Gärsubstrat<br />
Ferner wurde an einem Stickstoff-Rückgewinnungssystem<br />
gearbeitet, sodass sich aus dem Urin ein Düngerkonzentrat<br />
herstellen lässt. Der getrennt erfasste Kot<br />
kann laut Döhler einer Biogasanlage, der Kompostierung<br />
oder Verkohlung zugeführt werden. Die Fachagentur<br />
Nachwachsende Rohstoffe hat dann ein Projekt<br />
aufgesetzt, in dem es unter anderem um das Gasertragspotenzial<br />
aus Schweinekot geht.<br />
Hinsichtlich des Scheinekot wurde untersucht:<br />
Trockensubstanzgehalt (TS), organischer Trockensubstanzgehalt<br />
(oTS), pH-Wert, Makro- und Mikronährstoffe.<br />
Zudem wurden Gärtests nach VDI 4630<br />
vorgenommen. Untersucht wurde Schweinekot von<br />
Zuchtsauen und Mastschweinen, der sowohl mesophil<br />
als auch thermophil vergoren worden ist. Der Schweinekot<br />
enthielt nach Döhlers Angaben durchschnittlich:<br />
25 Prozent TS der Frischmasse (FM), 85,5 Prozent oTS<br />
der FM, 9 Kilogramm (kg) Stickstoff (fast ausschließlich<br />
organisch gebunden), 6,8 kg P2O5, 3,0 kg Kali,<br />
4,8 kg Kalzium und 1,7 kg Magnesium.<br />
Der Methanertrag des Schweinekots beläuft sich auf<br />
rund 300 Normliter pro kg oTS. 80 bis 85 Prozent<br />
15
Aktuelles Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
bei Zimmertemperatur lagert, dann sei ein deutlicher<br />
Abfall des Gasertrags zu verzeichnen.<br />
Im Stallinneren befinden sich Liegeboxen mit Stroheinstreu. Das Stroh wird über eine Rohrleitung<br />
(hinteres, dunkles Rohr unter der Stalldecke) in die Liegeboxen gefördert.<br />
des Gasertrages würden in den ersten 15 Tagen erreicht.<br />
Wenn Schweinekot (Mastschweine: Vor-, Mittelund<br />
Endmast) mesophil vergoren wird, dann erreichen<br />
die meisten Kotproben 500 Normliter (Nl) Biogas pro<br />
kg oTS. „Bei dem Kot von Zuchtsauen zeigt sich ein etwas<br />
anderes Bild, weil sie effizienter gefüttert werden.<br />
Sie scheiden nur noch wenig Kohlenhydrate aus, weil<br />
sie alles verstoffwechseln. Aber nach 44 Tagen kommt<br />
man auch hier auf etwa 500 Nl pro kg oTS“, erläuterte<br />
Döhler.<br />
Auffällig war nach seinen Worten, dass Kotproben dabei<br />
waren, die deutlich von dem 500-Nl-Wert abfielen.<br />
Er begründete dies damit, dass die Tierbestände medikamentös<br />
behandelt worden seien. Diese drei Proben<br />
wurden somit aus der Auswertung herausgenommen.<br />
Die thermophile Vergärung habe im Grund keine anderen<br />
Ergebnisse gezeigt. Jedoch sei – was nicht verwunderte<br />
– eine schnellere Gasbildung festzustellen<br />
gewesen. Wenn der Schweinekot aber mehrere Wochen<br />
Maissilage durch Schweinekot ersetzen<br />
Wie Schweinekot Maissilage ersetzen kann, zeigte Döhler<br />
an folgendem Beispiel:<br />
Maissilage: 35 Prozent TS, 95 Prozent oTs, 660 Nl<br />
Biogas/kg oTS, 52 Prozent CH 4<br />
, 40 Euro pro Tonne frei<br />
Fermenter.<br />
Schweinekot (frisch): 25 Prozent TS, 85 Prozent oTS,<br />
500 Nl Biogas/kg oTS, 60 Prozent CH 4<br />
.<br />
Dann ersetzen 1,8 Tonnen Schweinekot 1 Tonne Silomais<br />
beziehungsweise 1 Tonne Schweinekot ersetzt<br />
0,56 Tonnen Silomais. Unter diesen Bedingungen darf<br />
der Schweinekot nach Döhlers Angaben rund 23 Euro<br />
pro Tonne kosten und kann 250 bis 300 Kilometer weit<br />
transportiert werden.<br />
An folgendem Beispiel zeigte der Biogasexperte, wie<br />
sich eine Änderung der Substratinputmenge auf die<br />
Stromproduktion auswirkt. Basisdaten: 460-kW-Biogasanlage<br />
mit 60 Prozent Rindergülle und 40 Prozent<br />
Silomais als Inputstoffe. Dann werden 10.000 Tonnen<br />
Rindergülle und 7.200 Tonnen Silomais pro Jahr<br />
eingesetzt. Der Gärdüngeranfall pro Jahr beträgt rund<br />
15.000 Kubikmeter. Wird die Maismenge komplett<br />
durch Schweinekot ersetzt, dann fallen rund 700 Kubikmeter<br />
mehr Gärdünger an und die Gasproduktion<br />
reicht nur noch für 327 kW.<br />
Sollen die 460 kW weiter ausgereizt werden und<br />
Schweinekot soll ebenfalls Silomais komplett ersetzen,<br />
dann wären 11.230 Tonnen Schweinekot pro Jahr einzusetzen.<br />
Gleichzeitig fallen über 4.000 Kubikmeter<br />
mehr an Gärrest an. Dann ist mehr Lagerraum zu errichten,<br />
was zusätzliche Investitionen bedeuten würde.<br />
Wenn 1.000 Kubikmeter Methan erzeugt werden sollen,<br />
dann ergibt sich folgende Situation:<br />
a. Silomais: 8,9 Tonnen Substrat sind aufzuwenden.<br />
40 kg Stickstoff sind im Gärrest enthalten.<br />
17 kg P 2<br />
O 5<br />
sind im Gärrest enthalten.<br />
Biogas-Innovationspreise<br />
<strong>2021</strong><br />
Der Wissenschaftspreis, der mit 10.000 Euro<br />
dotiert ist und von der Landwirtschaftlichen<br />
Rentenbank gefördert wird, geht an ein<br />
chinesisch-deutsches Viererteam in einem<br />
Kooperationsprojekt des Deutschen Biomasseforschungszentrums<br />
Leipzig mit der China Agricultural<br />
University in Peking. Prof. Dr. Walter<br />
Stinner, Dr. Britt Schumacher, Hui Sun und Guo<br />
Jianbin wurden für ihre Forschung zur Strohsilierung<br />
mit flüssigem Gärrest geehrt. Die neuen<br />
Erkenntnisse ermöglichen eine kosteneffiziente<br />
Lagerung und Aufbereitung von Stroh zur Biogaserzeugung.<br />
Von links: Udo Hemmerling,<br />
stellvertretender Generalsekretär<br />
des Deutschen<br />
Bauernverbandes, Preisträger<br />
Prof. Dr. Walter Stinner<br />
vom DBFZ, Jurymitglied<br />
Prof. Dr. Michael Nelles<br />
vom DBFZ, Preisträger<br />
Christoph Hartmann von<br />
der BENAS Biopower GmbH<br />
und Jurymitglied Dr. Peter<br />
Kornatz vom DBFZ.<br />
Foto: DBFZ<br />
16
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Aktuelles<br />
Mischen – Fördern –<br />
Zerkleinern<br />
Foto: Döhler Agrar<br />
b. Schweinekot: 15,7 Tonnen sind<br />
aufzuwenden.<br />
141 kg Stickstoff enthält der Gärrest.<br />
107 kg P 2<br />
O 5<br />
enthält der Gärrest.<br />
Flächenbedarf bei<br />
a. N (wenn 170-kg-Grenze): 0,24 ha<br />
P (wenn 60-kg-Grenze): 0,28 ha<br />
b. N (wenn 170-kg-Grenze): 0,83 ha<br />
P (wenn 60-kg-Grenze): 1,78 ha<br />
Schlussfolgerung: Schweinekot ist erheblich<br />
wertvoller als Schweinegülle.<br />
Gasaufbereitung mit Kleinanlagen<br />
Jens Topa von Bright Biomethane aus<br />
den Niederlanden berichtete über eine<br />
neue kleine Biogasaufbereitungsanlage,<br />
die kürzlich in Belgien auf einer landwirtschaftlichen<br />
Biogasanlage errichtet<br />
worden ist. Dort wird Biomethan als CNG-<br />
Kraftstoff verkauft. Das Unternehmen hat<br />
nach eigenen Angaben über 100 Referenzanlagen<br />
errichtet in einem Leistungsbereich<br />
von 30 bis über 1.000 Normkubikmeter<br />
Biomethan pro Stunde.<br />
Im belgischen Houffalize (Wallonien) ist<br />
das Modell „PurePac Mini + CNG“ errichtet<br />
worden. Diese Kleinanlage wird im Werk<br />
vorgefertigt und ist in einem 40-Fuß-Container<br />
untergebracht. „Es sind modulierbare<br />
Anlagen mit kompaktem Design“, sagte<br />
Topa. Von der Minianlage seien inzwischen<br />
zwölf in der Praxis realisiert worden. Dieser<br />
Anlagentyp verarbeitet 60 Kubikmeter<br />
Rohbiogas pro Stunde. Der Standort in Belgien<br />
ist ein klassischer Landwirtschaftsbetrieb,<br />
auf dem in 2018 eine Biogasanlage<br />
errichtet worden ist. Vergoren wird hauptsächlich<br />
Festmist aus der Rinderhaltung.<br />
„Der Hauptgasstrom versorgt ein Blockheizkraftwerk.<br />
Nur ein kleinerer Teil der<br />
produzierten Biogasmenge wird zu Biomethan<br />
aufbereitet und als Kraftstoff genutzt.<br />
Ich bin davon überzeugt, dass jeder<br />
Anlagenbetreiber seine eigene Biomethan-<br />
Tankstelle haben kann“, betonte Topa. Das<br />
Rohgas hat einen Methangehalt von 52<br />
Prozent. Sein Unternehmen verspricht bezüglich<br />
der Membranen eine lange Lebensdauer,<br />
da Verschleiß kaum vorhanden sei.<br />
Das Verfahren komme ohne den Einsatz<br />
von Chemikalien, Wasser und ohne Wärme<br />
aus. Der Prozess benötige lediglich Strom<br />
und Aktivkohle.<br />
Das gereinigte Gas wird mit einem Verdichter<br />
auf 250 bar Druck verdichtet und<br />
kann so in zylinderförmigen Behältnissen<br />
gelagert werden. Die Membranmodule im<br />
Gastrennsystem seien so angeordnet, dass<br />
das Permeatgas aus den verschiedenen<br />
Stufen rezirkuliert wird, um den höchsten<br />
Wirkungsgrad (>99,5 Prozent) und den geringsten<br />
Methanverlust zu erreichen.<br />
Die Gasspeichertanks werden mit drei unterschiedlichen<br />
Druckstufen betrieben.<br />
Grund: Dadurch soll die Betankung so<br />
möglich sein, dass der Tank im Fahrzeug<br />
und auch der Speichertank immer optimal<br />
genutzt werden können. Die CNG-Tankstation<br />
sei eine normale Gaszapfsäule, genauso<br />
wie sie auch an öffentlichen Tankstellen<br />
vorhanden ist. Es sei ein Bezahlsystem<br />
hinterlegt. Für den CNG-Bereich genüge<br />
ein Gas mit 97 Prozent Methangehalt, was<br />
die Betriebskosten senke. Der Betrieb in<br />
Belgien betreibe einen neu angeschafften<br />
Futtermischwagen mit Gasmotor mit dem<br />
eigenen CNG.<br />
Kryo-Kühler verflüssigt<br />
Biomethan<br />
Um das Thema Biomethan ging es auch<br />
in dem Vortrag von Markus Grundke von<br />
der AB Energy Deutschland GmbH. Das<br />
Unternehmen hat auch Biogasaufbereitungsanlagen<br />
im Portfolio. Das Rohbiogas<br />
werde zunächst mit einem Rohrbündelwärmetauscher<br />
gekühlt. Danach erfolge die<br />
Verdichtung auf über 500 Millibar Überdruck.<br />
Anschließend durchströme das Gas<br />
zwei Doppelgasfilter mit Aktivkohle. Dabei<br />
handelt es sich um einen Arbeitsfilter, der<br />
flüchtige organische Verbindungen abreinigt,<br />
und einen weiteren Arbeitsfilter, der<br />
Schwefelwasserstoff abtrennt. Jeder Arbeitsfilter<br />
verfügt laut Grundke über einen<br />
sogenannten „Polizeifilter“.<br />
Nachdem das Biogas vorgereinigt worden<br />
ist, strömt es durch einen Kompressor, der<br />
das Gas auf 12 bar verdichtet. Danach werden<br />
die Membranen mit dem Gas beaufschlagt,<br />
die das CO 2<br />
durchlassen und das<br />
CH 4<br />
nicht. Am Ende liegen zwei getrennte<br />
Gasströme vor. Die einzelnen Membranen<br />
sind Polymer-Hohlfasern.<br />
Bei der späteren Verflüssigung des Gases<br />
sieht das Anlagenkonzept laut Grundke wie<br />
folgt aus: Nach der ersten Membranstufe<br />
wird das sogenannte Reingas einer zweiten<br />
Membranstufe zugeführt. Parallel dazu wird<br />
das sogenannte Offgas aus der ersten Stufe<br />
über einen zweiten Verdichter um 4 bar<br />
weiter komprimiert und in die dritte<br />
17<br />
Ihr Partner für die Energie<br />
der Zukunft<br />
Als Weltmarktführer von Exzenterschneckenpumpen<br />
und Spezialist in der<br />
Biogastechnologie bieten wir für die<br />
Biogasproduktion angepasste Misch- und<br />
Fördersysteme. Die Einsatzmöglichkeiten<br />
unserer NEMO® Exzenterschneckenpumpen,<br />
TORNADO® Drehkolbenpumpen<br />
sowie NETZSCH Zerkleinerungssysteme<br />
reichen vom Mischen über Fördern bis hin<br />
zum Zerkleinern.<br />
NEMO® B.Max®<br />
Mischpumpe<br />
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH<br />
Geschäftsfeld Umwelt & Energie<br />
Tel.: +49 8638 63-1010<br />
info.nps@netzsch.com<br />
www.netzsch.com
Aktuelles Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Membranstufe geschickt. „Dadurch erreichen wir eine<br />
optimiertere Abscheidung von CO 2<br />
mit der Folge, dass<br />
das Offgas reiner und das Reingas sauberer ist“, erklärte<br />
der Vortragende.<br />
Membranen aus dem Öl- und Gassektor<br />
Anschließend muss das Offgas mittels einer rekuperativ-thermischen-Oxidation<br />
behandelt werden. Danach<br />
kann es, so Grundke, an die Umgebung abgegeben<br />
werden. Der CH 4<br />
-Gehalt im Offgas liege maximal bei<br />
0,2 Prozent. „Wir verwenden japanische Membranen,<br />
die ursprünglich für den Öl- und Gassektor entwickelt<br />
worden sind. Die Membranen haben dadurch eine sehr<br />
hohe Schwefelwasserstofffestigkeit von bis zu 30.000<br />
ppm“, betonte der Referent. Die Membranen würde<br />
eine recht große Oberfläche kennzeichnen, sodass insgesamt<br />
weniger Membranen eingesetzt werden müssen.<br />
Aufgrund der Kompressoren-Rückkühlung kann noch<br />
Wärme zurückgewonnen werden, die sich zur Fermenterbeheizung<br />
verwenden lässt. Die Wärme habe eine<br />
Temperatur von 60 Grad Celsius. Grundke rechnet im<br />
Mittel mit 0,15 Kilowattstunden thermischer Energie<br />
pro Kubikmeter Rohgas. Wenn das Biomethan vorliege,<br />
dann könne es verflüssigt werden zu Bio-LNG. Die dafür<br />
notwendige Technik hat AB auch im Angebot. Die<br />
Anlage wird ebenfalls in einem Container installiert.<br />
Bei kleineren Anlagen komme ein sogenannter „Kryo-<br />
Kühler“ zum Einsatz. Bei größeren Produktionsmengen<br />
würden mehrere Apparate nebeneinander aufgestellt.<br />
In dem AB-Verfahren liegt das Bio-LNG bei minus 140<br />
Grad Celsius in flüssiger Form vor. Bei diesen Bedingungen<br />
ist das CO 2<br />
fest – also als Trockeneis. „Jeder<br />
Kryo-Kühler kann bis zu einer Tonne Bio-LNG pro Tag<br />
herstellen. Die Kryo-Kühler basieren auf der bekannten<br />
Stirling-Technologie. Es handelt sich um Kolbenmaschinen,<br />
die Helium in einem geschlossenen thermo-<br />
Fotos: Bright Biomethan<br />
Über - Unterdrucksicherung ÜU-TT<br />
Volle Kontrolle auf einen Blick<br />
Mich gibt es in<br />
verschiedenen Größen<br />
Bei Über- oder Unterdruck<br />
kann ich ein elektronisches<br />
Warnsignal geben<br />
Ich kann einen breiten<br />
Druckbereich abdecken<br />
Für den Frostschutz<br />
bin ich isoliert<br />
Ich bin DLG geprüft<br />
Wenn es mir zu kalt wird,<br />
kann eine elektrische<br />
Heizung angebaut werden<br />
18<br />
biogaskontor.de
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Aktuelles<br />
Das Unternehmen<br />
Bright Biomethan hat<br />
in Belgien auf einem<br />
Landwirtschaftsbetrieb<br />
an einer Biogasanlage<br />
eine kleine Gasaufbereitungsanlage<br />
errichtet, die bis zu 60<br />
Kubikmeter Rohgas<br />
pro Stunde aufbereiten<br />
und als Kraftstoff<br />
bereitstellen kann.<br />
dynamischen Kreislauf nutzen, um die Kälteleistung zu<br />
erzeugen. Wir haben inzwischen eine Anlage errichtet,<br />
die bis zu 12 Tonnen Bio-LNG pro Tag bereitstellen<br />
kann“, informierte Grundke am Ende seines Vortrages.<br />
Stickstoff mit Kalkmilch ausschleusen<br />
Dr. Daniel Baumkötter von der Fachhochschule Münster<br />
referierte zum Thema „Ammoniakrückgewinnung<br />
aus Gärprodukten von Biogasanlagen in Form von Ammoniakwasser<br />
mithilfe von Kalk“. An dem vom Bundeswirtschaftsministerium<br />
geförderten Projekt ist auch<br />
die Forschungsgemeinschaft Kalk und Mörtel beteiligt.<br />
Die umweltgerechte Verwertung von Gärdüngern aus<br />
Biogasanlagen stellt unter den gegebenen rechtlichen<br />
Rahmenbedingungen eine Herausforderung dar.<br />
Hauptaugenmerk dabei gilt dem Nährstoff Stickstoff<br />
aufgrund der Diskussionen um Nitrat im Grundwasser,<br />
das aus Stickstoff gebildet wird.<br />
„Unsere Motivation ist, den Stickstoff durch eine Aufbereitung<br />
des Gärdüngers gezielt auszuschleusen und<br />
anschließend effizient zu nutzen“, erklärte Dr. Baumkötter.<br />
Die anteilig größte Menge an Stickstoff liege<br />
anteilig als Ammonium-(NH 4<br />
)-Stickstoff vor. Je nach<br />
Art des Gärdüngers liege der NH 4<br />
-Gehalt bei 60 bis 70<br />
Prozent. Der NH 4<br />
-Anteil solle gezielt entfernt werden.<br />
Das Verfahren der Wahl zur NH 4<br />
-Ausschleusung sei die<br />
Strippung. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass das<br />
Ammonium als gelöstes Ammoniak (NH 3<br />
) vorliegt.<br />
Das heißt, NH 4<br />
und NH 3<br />
liegen im Gärdünger im Gleichgewicht<br />
vor – jedoch in Abhängigkeit von Temperatur<br />
und pH-Wert. „Je höher der pH-Wert und je höher die<br />
Temperatur, desto höher ist der Anteil des NH 4<br />
-Stickstoffs<br />
in Form von Ammoniak. Dieses NH 3<br />
wollen wir<br />
gezielt entnehmen“, führt Dr. Baumkötter weiter aus.<br />
Funktionsweise des Verfahrens: In einer Kolonne wird<br />
der Gärdünger von oben hineingegeben und Luft<br />
19
Aktuelles Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Gärdünger mit Kalkmilch aufwerten<br />
„Unsere erste Idee war, die Natronlauge zu ersetzen.<br />
Sie ist zwar sehr wirksam und kann sehr gut den pH-<br />
Wert anheben, sie hat aber irgendwie keinen richtigen<br />
Mehrwert. Es findet eher eine Aufsalzung des Gärdüngers<br />
statt. Wir wollten einen Ersatzstoff finden. Dabei<br />
sind wir zu Kalkmilch gekommen, die dann den Gegeneffekt<br />
hat, sodass der Gärdünger durch den zusätzlichen<br />
Kalkanteil aufgewertet wird“, machte Dr. Baumkötter<br />
deutlich.<br />
Weil die Wertschöpfung bei der Vermarktung des ASL<br />
eher gering sei und am Markt nicht die Preise zu erlösen<br />
seien, wie ein vergleichbarer Mineraldünger kostet,<br />
und der Einsatz der Schwefelsäure einen weiteren Kostenfaktor<br />
darstelle, entwickelte sich eine weitere Idee.<br />
So wurde die Frage aufgeworfen: Ist es auch möglich,<br />
Ammoniakwasser zu gewinnen für neue Absatzwege<br />
außerhalb der Landwirtschaft, wie zum Beispiel für die<br />
industrielle Rauchgasreinigung oder im Reinigungsmittelbereich?<br />
Dort seien deutlich höherwertigere Absatzmöglichkeiten<br />
vorhanden.<br />
Vorgehensweise beim Einsatz von Kalkmilch: Zuerst<br />
muss der Gärrest separiert werden. Das geschieht mittels<br />
einer Feinseparation. Dabei können etwa 20 bis<br />
25 Prozent der Feststofffracht abgetrennt werden. Das<br />
Restfiltrat hat dann noch einen Trockensubstanzgehalt<br />
von etwa 4 Prozent. Separiert wird, um die Fasern herauszubekommen,<br />
weil die in der Strippung hinderlich<br />
sind. Die Strippung habe keinen großen Einfluss auf<br />
die NH 4<br />
-Konzentration.<br />
Biogasaufbereitungsanlage<br />
von der AB<br />
Energy Deutschland<br />
GmbH mit Kryo-Kühler<br />
zur Bereitstellung von<br />
flüssigem Biogas als<br />
Bio-LNG.<br />
von unten im Gegenstrom durchgeleitet. Das dabei frei<br />
werdende Ammoniak wird anschließend mit der Strippluft<br />
ausgetragen und danach in einem Wäscher ausgewaschen.<br />
Meistens wird die Strippkolonne mit einer<br />
losen Schüttung gefüllt, um einen guten Flüssigkeits-<br />
Gasaustausch zu gewährleisten. Die FH Münster hat<br />
für das Projekt eine eigene Strippungsanlage errichtet<br />
mit einem Durchsatz von einem Kubikmeter Gärdünger<br />
pro Stunde. So können praxisrelevante Versuchsergebnisse<br />
erzeugt werden.<br />
Zwei in Reihe geschaltete Schwefelsäurewäscher waschen<br />
das NH 3<br />
aus der Strippluft heraus. Die Versuchsanlage<br />
wird im Umluftbetrieb gefahren, sodass keinerlei<br />
Emissionen entstehen. Die Versuchsanlage kann auf<br />
eine Temperatur von maximal 90 Grad Celsius beheizt<br />
werden. Dafür werden elektrische Durchlauferhitzer<br />
verwendet. Um das Dissoziationsgleichgewicht zu verschieben,<br />
wird Wärme benötigt. Die zweite Variante ist<br />
laut Dr. Baumkötter die Anhebung des pH-Wertes. Dazu<br />
wird in der Regel Natronlauge zugegeben. Am Ende des<br />
Prozesses entsteht Ammonium-Sulfat-Lösung (ASL) in<br />
Mineraldüngeräquivalent.<br />
Kalkmilcharten unterscheiden sich<br />
Die separierte flüssige Phase wird mit Kalkmilch versetzt.<br />
Die Kalkmilch muss sehr gut eingemischt werden.<br />
Im Labor sind drei verschiedene Gärreste mit<br />
Kalkmilch getestet worden. Gärrest a) aus Mais- und<br />
Güllevergärung, b) aus Mais, Gülle und Zuckerrüben,<br />
c) ist ein Gärrest aus Mais, Gülle, Zuckerrüben und<br />
Hühnertrockenkot. Im Versuch wurden diese Gärreste<br />
mit fünf verschiedenen Kalkmilcharten vermischt. Die<br />
Kalkmilcharten unterschieden sich hinsichtlich Korngrößenverteilung<br />
und Auflösegeschwindigkeit.<br />
Kalkmilch und Gärrest hätten sich gut miteinander vermischen<br />
lassen. Es habe keine Ausfällungen gegeben<br />
und keine Klümpchenbildung. Die Viskosität habe sich<br />
auch nicht signifikant verändert. Die pH-Wert-Anpassung<br />
habe ziemlich variiert, in Abhängigkeit von dem<br />
Gärdünger und der Kalkmilch. Kalkmilch müsse intensiv<br />
gerührt werden, weil sie sich sehr schnell absetzt.<br />
Es lässt sich im Wesentlichen festhalten, dass der<br />
Stickstoffgehalt im Filtrat nach der Strippung deutlich<br />
niedriger ist als davor. Der Kalziumgehalt im Filtrat<br />
nimmt nach der Strippung zu. Der pH-Wert ist nach<br />
der Strippung im Filtrat etwas höher. Den Ammoniumstickstoff<br />
im Gärrest habe man um bis zu 96 Prozent<br />
reduzieren können.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
0 54 09/90 69 426<br />
martin.bensmann@biogas.org<br />
Foto: AB Energy Deutschland GmbH<br />
20
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Aktuelles<br />
VERSTÄRKUNG GESUCHT<br />
» Servicetechniker (m/w/d)<br />
» Sales Manager (m/w/d)<br />
» Konstrukteur (m/w/d)<br />
» Mechatroniker, Elektriker,<br />
Industriemechaniker (m/w/d)<br />
Interessiert?<br />
Ausführliche Stellenbeschreibungen<br />
finden Sie auf unserer Website, oder<br />
Sie scannen unseren QR-Code.<br />
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!<br />
UTS Products GmbH · Tel. 02923 610940<br />
Oestinghausener Str. 12 · 59510 Lippetal<br />
www.anaergia-technologies.com<br />
Entschwefeln Sie mit Eisenhydroxid!<br />
®<br />
FerroSorp DG<br />
H2S-Bindung im Fermenter<br />
®<br />
FerroSorp S<br />
Externe Entschwefelung<br />
Klinopmin ®<br />
(auf Basis von Gesteinsmehl)<br />
Prozessoptimierung<br />
Ventile in modularer Bauform<br />
neue technologie ermöglicht kleinste ansprechdrücke<br />
für Biogasanlagen<br />
Für Anwender von Überdruck-, unterdruck-<br />
und Beatmungsventilen<br />
liefert die Schwing Verfahrenstechnik<br />
ab sofort eine optimierte, modulare<br />
Bauform. Wesentliche Vorteile der<br />
kubusförmigen Ventile sind:<br />
maximale modellflexibilität: Die<br />
modularen Ventile sind flexibel<br />
austausch- und kombinierbar –<br />
auch für seltene Ausführungen.<br />
optimale durchsatzleistung: Die<br />
kompakte Bauform sichert höhere<br />
Durchflussmengen mit geringeren<br />
Druckverlusten. Leckage-Raten<br />
werden auf ein Minimum reduziert.<br />
Kleinste ansprechdrücke: Die vakuumseitige<br />
Ausführung mit einer Feder<br />
(statt Gewicht) ermöglicht kleinste<br />
Ansprechdrücke bis zu 1 mbar.<br />
Schnelle Wartung: Dass die Ventile<br />
von allen Seiten zugänglich sind,<br />
vereinfacht die Wartung und das<br />
Überprüfen der Innenteile.<br />
integrierte flammensperren: Mit<br />
Flammensperren kombinierte Ventile<br />
garantieren beste Leistungen und<br />
minimalen Druckverlust.<br />
Hohe Wirtschaftlichkeit: Kurze Lieferzeiten<br />
und geringer Lageraufwand<br />
reduzieren Kosten.<br />
Kontakt<br />
Schwing Verfahrenstechnik GmbH<br />
Oderstraße 7<br />
47506 Neukirchen-Vluyn<br />
Tel. +49 2845 930-0<br />
mail@schwing-pmt.de<br />
www.schwing-pmt.de<br />
21
Aktuelles Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Biomethan billiger als Wasserstoff<br />
Laut Peter Schünemann-Plag<br />
ist zum<br />
aktuellen Zeitpunkt<br />
Biomethan (9 Cent/kWh<br />
aufbereitet nach RED<br />
II) noch deutlich billiger<br />
als Wasserstoff. Inklusive<br />
Fahrzeugtechnik<br />
und Tankstellennetz ist<br />
Biomethan ökonomisch<br />
noch hochattraktiv.<br />
Verhalten optimistisch zeigten sich die Energieexperten auf der 12. Biogastagung der<br />
Landwirtschaftskammer (LWK) Niedersachsen. Zum ersten Mal fand die Veranstaltung<br />
online statt und nicht wie traditionell in Verden. „Biogas – da geht noch was!“ – Dieses<br />
optimistische Motto hatten die Veranstalter für die Tagung gewählt. Die Energieberater der<br />
LWK hatten ein Programm mit wichtigen Themen zusammengestellt, die die Biogasbranche<br />
bewegen. Darüber hinaus blickten renommierte Energieexperten in die Zukunft.<br />
Von Thomas Gaul<br />
Wie können Folgekonzepte für Biogasanlagen<br />
aussehen? Das skizzierten Dr.<br />
Ludger Eltrop und Joshua Güsewell<br />
vom Institut für Energiewirtschaft und<br />
rationelle Energieanwendung der Universität<br />
Stuttgart. Mit dem weiteren Ausbau der „Erneuerbaren“<br />
tragen Wind und Photovoltaik künftig die<br />
Hauptlast der Stromproduktion. Für Bioenergie steigen<br />
damit die Anforderungen, Strom bedarfsgerecht – sowohl<br />
täglich als auch saisonal – bereitzustellen.<br />
Mit den höheren Anteilen aus der volatilen Erzeugung<br />
und einer weitergehenden Reduzierung von Treibhausgasen<br />
werde die Bioenergie zukünftig wichtiger. Die<br />
Gesamteffizienz der Anlagen lasse sich erhöhen, wenn<br />
mehr Wärme höherwertig genutzt und vermarktet werde.<br />
Zur Treibhausgaseinsparung trage auch die stärkere<br />
Verwendung landwirtschaftlicher Reststoffe bei, die<br />
anstatt Mais in den Biogasanlagen als Substrat eingesetzt<br />
werden. Auch die flankierenden Maßnahmen, die<br />
in letzter Zeit von der Politik ergriffen wurden, sind insgesamt<br />
für die Bioenergie günstig, urteilten die Experten.<br />
Als Auswahl nannten sie die CO 2<br />
-Bepreisung, die<br />
Umsetzung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED<br />
II) sowie den Ausstieg aus der Atom- und Kohleenergie.<br />
Die Energiepolitik und das landwirtschaftliche Umfeld<br />
beschreiben die beiden Experten als stark reguliert.<br />
Zunehmend werde es unübersichtlich, so Eltrop: „Zugleich<br />
drängen professionelle Anbieter als Betreiber<br />
von Biogasanlagen in den Markt.“ Das passt auch zu<br />
der Forderung, die Bioenergie müsse nach 20 Jahren<br />
EEG-Laufzeit wirtschaftlich auf eigenen Füßen stehen.<br />
Für die Betreiber stellt sich dann die Frage, wie es nach<br />
dem Ende der gesicherten Vergütung weitergehen soll.<br />
Die Laufzeitverlängerung nach dem EEG ist an steigende<br />
Anforderungen geknüpft. Neue Geschäftsfelder<br />
müssen zur bestehenden oder einer geplanten neuen<br />
Anlage passen. Verknüpft ist das mit der Frage, welche<br />
Rolle die Bioenergie in den Jahren 2030 und 2050 im<br />
Gesamtsystem einnehmen soll.<br />
Ausgehend von Befragungen von Anlagenbetreibern,<br />
wurde von den Wissenschaftlern eine Zusammenfassung<br />
von Anlagentypen zu Clustern vorgenommen und<br />
die mögliche Entwicklung modelliert. Bei der regionalen<br />
Entwicklung des Bestandes auf Basis des EEG<br />
Foto:Adobe Stock_Countrypixel<br />
22
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Aktuelles<br />
2017 wird für Niedersachsen ein Einbruch<br />
bei der Anzahl an Bestandsanlagen<br />
durch zunehmende Stilllegung prognostiziert.<br />
Die Leistung bleibt jedoch durch die<br />
Flexibilisierung der übrigen Anlagen weitgehend<br />
erhalten. Außerdem werden mehr<br />
Anlagen von der Vor-Ort-Verstromung auf<br />
die Aufbereitung zu Biomethan und die<br />
Gaseinspeisung umgestellt.<br />
Große Anlagen haben günstigere<br />
Kostenstruktur<br />
Der Anlagenpark in Baden-Württemberg<br />
leide durch die kleinteilige Struktur unter<br />
hohen Kosten. Die gegenteilige Situation<br />
stellten die Wissenschaftler bei den Anlagen<br />
in Thüringen und Sachsen fest. Durch<br />
die Größe der Anlagen sei die Kostenstruktur<br />
günstig. Durch den überdurchschnittlichen<br />
Einsatz von Mist und Gülle<br />
sind auch die THG-Emissionen gering. Bei<br />
den Treibhausgas-Emissionen ist jedoch<br />
in allen Szenarien ein starker Rückgang zu<br />
verzeichnen. Begründet wird dies mit einer<br />
Steigerung der Effizienz der Anlagen,<br />
einem Substratwechsel weg vom reinen<br />
NawaRo-Einsatz und einer technischen<br />
Optimierung der Anlagen. Dazu gehören<br />
gasdichte Gärproduktlager und eine Reduktion<br />
des Methanschlupfs.<br />
Als erfolgreichste Maßnahmen für den<br />
Weiterbetrieb nannte Eltrop die Saisonalisierung<br />
und den Substratwechsel. Um<br />
die Flexibilität der Stromerzeugung zu<br />
erhalten, sei eine hohe Überbauung bei<br />
der Saisonalität erforderlich. Allerdings<br />
gebe es nur wenig Anreize für den Substratwechsel,<br />
zumal dieser mitunter mit<br />
höheren Kosten verbunden ist, die allerdings<br />
nur in seltenen Fällen ausgeglichen<br />
werden.<br />
Bei Biomethan ließe sich eine höhere<br />
Marge erzielen, wenn dies direkt als Bio-<br />
CNG an Endkunden vermarktet würde.<br />
Dies gelte umso mehr, je stärker sich der<br />
Erdgaspreis erhöht und die CO 2<br />
-Bepreisung<br />
weitere Sektoren erfasst. Als wichtige<br />
Stellschraube sieht er neben dem<br />
Ausschreibungs- und Marktvolumen einen<br />
CO 2<br />
-Preis von 200 Euro pro Tonne.<br />
Bei den Rahmenbedingungen sieht Eltrop<br />
Niedersachsen eher in einer nachteiligen<br />
Ausgangslage. Zwar kann die Leistung erhalten<br />
bleiben, die Stromproduktion sinkt<br />
bis zum Jahr 2035 jedoch auf 45 bis 55<br />
Prozent. Ein Teil des Biogases wandere in<br />
den Biomethanbereich.<br />
Biomethan preiswerter als<br />
Wasserstoff<br />
Eine optimistische Prognose für Biogas<br />
aus wirtschaftlicher Sicht zeichnete Peter<br />
Schünemann-Plag, Biogasberater bei der<br />
LWK Niedersachsen. Denn solange die<br />
Energiewende mit einem Anteil von mehr<br />
als 95 Prozent Erneuerbarer Energie noch<br />
nicht vollständig umgesetzt ist, behalte<br />
Biogas in diesem Transformationsprozess<br />
eine wichtige Rolle. Bei der individuellen<br />
Suche nach einem Entwicklungspfad muss<br />
Biogas aber den Spagat zwischen gesicherter<br />
Vergütung im EEG und am Markt konkurrenzfähigen<br />
Produkten machen.<br />
„Langfristig entscheidet der Markt“, so<br />
Schünemann-Plag. Er ist überzeugt, dass<br />
der Energieträger Wasserstoff eine Zukunft<br />
hat. Knackpunkt ist allerdings der<br />
Preis. Er rechnete vor: Schon Wasserstoff<br />
selbst ist nicht billig [12 bis 15 Cent pro<br />
Kilowattstunde (kWh)]. Die notwendige<br />
Rückverstromung liefert Strom bei geringer<br />
Gesamteffizienz zu Preisen von über<br />
30 Cent/kWh. Zum aktuellen Zeitpunkt ist<br />
Biomethan (9 Cent/kWh aufbereitet nach<br />
RED II) noch deutlich billiger als Wasserstoff.<br />
Inklusive Fahrzeugtechnik und Tankstellennetz<br />
ist Biomethan ökonomisch<br />
noch hochattraktiv.<br />
Auch Schünemann-Plag geht vor dem<br />
Hintergrund des Wachstumstreibers Kraftstoffmarkt<br />
davon aus, dass ein Umstieg<br />
vom Stromproduzenten zum Gasaufbereiter<br />
wirtschaftlich sinnvoll sein kann, am<br />
ehesten für größere Anlagen beziehungsweise<br />
Gemeinschaftsanlagen. Skeptisch<br />
sieht er dagegen die Investition in neue<br />
Wärmenetze, zumindest bei einer kürzeren<br />
(Rest-)Laufzeit der Anlage. Denn bei<br />
Neubauten ist der Wärmebedarf geringer,<br />
hier kommt die Wärmepumpe bei der Wärmeversorgung<br />
zum Einsatz. Bestehende<br />
Wärmenetze könnten nach Stilllegung der<br />
Biogasanlage mit einer alternativen Wärmequelle,<br />
beispielsweise einem Holzhackschnitzel-Kessel,<br />
betrieben werden.<br />
Biogas gemeinsam aufbereiten<br />
und einspeisen<br />
Eine der Zukunftsoptionen für die Biogasbranche<br />
können Rohbiogasleitungen<br />
sein. Mit den Aspekten von Technik und<br />
Wirtschaftlichkeit befasste sich in seinem<br />
Vortrag Jürgen Neuss, Ingenieurbüro Berg<br />
& Partner in Aachen. Der Ingenieur rief zu<br />
vernetztem Denken auf: „Biomethan<br />
23<br />
“<br />
Durch energie+agrar habe ich einfach<br />
mehr Spaß mit meiner Biogasanlage. ”<br />
Oppmale Beratung<br />
und innovaave<br />
Produkte für Ihre<br />
Fermenter-Bakterien<br />
Höhere Substratausnutzung<br />
Bessere Rührfähigkeit<br />
Stabile biologische Prozesse<br />
Einsparung von Gärrestlager<br />
Senkung der Nährstoffmenge<br />
Repowering der Biologie<br />
Denn Ihre Biogas-Bakterien<br />
können mehr!<br />
energiePLUSagrar GmbH<br />
Tel.: +49 7365 41 700 70<br />
Web: www.energiePLUSagrar.de<br />
E-Mail: buero@energiePLUSagrar.de
Aktuelles Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Als erfolgreichste Maßnahmen für den Weiterbetrieb in der Verstromung nannte Dr. Ludger Eltrop die<br />
Saisonalisierung und den Substratwechsel weg von Silomais hin zu landwirtschaftlichen Reststoffen.<br />
kombiniert mit Wasserstoff macht das Erdgasnetz<br />
grün.“ Allerdings sollte der Wasserstoff ausschließlich<br />
mit Grünstrom erzeugt werden.<br />
Um die Technik der Aufbereitungs- und Einspeiseanlagen<br />
auch für kleinere Biogasanlagen nutzbar zu machen,<br />
sollten diese über Rohbiogasanlagen zusammengefasst<br />
und an eine effiziente zentrale Aufbereitungsanlage angeschlossen<br />
werden. Neuss stellte das Projekt in Bitburg<br />
vor, über das bereits im Biogas Journal berichtet<br />
wurde. Sieben Biogasanlagen wurden mit einer Rohgas-<br />
Sammelleitung zusammengefasst. Die Einspeisung erfolgt<br />
in das Bitburger Erdgasnetz. Versorgt wird damit<br />
vor allem eine bekannte Großbrauerei.<br />
Wichtig ist, dass die Kompetenzen und<br />
die Verantwortungen klar benannt und<br />
getrennt werden, betonte Neuss. So<br />
erzeugen die Biogasanlagen der Betreiber<br />
aus Mist, Gülle und NawaRo<br />
das Rohbiogas. In einer Biogaspartnerschaft<br />
wurde das Rohrleitungsnetz mit<br />
den sieben Übergabestationen gebaut.<br />
Auch die Aufbereitungsanlage wird<br />
gemeinsam betrieben. Der Vertrieb<br />
der Bioenergie erfolgt durch die Stadtwerke<br />
Trier. Seitdem die Anlage im<br />
August 2020 in Betrieb ging, läuft sie<br />
technisch störungsfrei, blickte Jürgen<br />
Neuss zufrieden auf das erste Betriebsjahr<br />
zurück.<br />
Motorgrenzwerte einhalten<br />
Neben wirtschaftlichen Fragen kam<br />
auch die Technik auf der 12. Biogastagung<br />
der LWK Niedersachsen nicht<br />
zu kurz. Christian Langermann von der<br />
2G Energietechnik machte deutlich,<br />
was auf die Anlagenbetreiber mit der 44. BImSchV<br />
zukommt. Obwohl sie seit Juni 2019 gilt, sind viele<br />
Details Langermann zufolge noch immer unklar. Der<br />
Geltungsbereich umfasst Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung<br />
von 1 bis 50 Megawatt. Sie regelt unter<br />
anderem Abgasgrenzwerte und Überwachungspflichten.<br />
Neu ist die kontinuierliche Überwachung der Emissionen<br />
neben der jährlichen offiziellen Emissionsmessung.<br />
Neben der Kat-Temperatur müsse der NOx-<br />
Tagesmittelwert überwacht werden. „Das Denken von<br />
Messung zu Messung ist Vergangenheit“, so Christian<br />
Foto: Adobe Stock_ingo Bartussek<br />
Ultraschall Reinigungsset<br />
passend für alle Zündkerzen<br />
Art.Nr. 60000178<br />
Vorher<br />
Nachher<br />
Eine saubere Verbrennung sorgt für stabile Abgaswerte (Nox) und ein stabiles Laufverhalten des BHKW. Durch die rasant<br />
steigenden Rohstoffkosten für Zündkerzen und die damit verbundenen Anschaffungskosten, wird die Reinigung via Ultraschall<br />
noch wirtschaftlicher. Die Lebensdauer Ihrer Zündkerze kann durch eine professionelle Reinigung verlängert werden.<br />
Das Ultraschall Reinigungsset ist auch für geschirmte Zündkerzen und Vorkammerzündkerzen geeignet.<br />
24
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Aktuelles<br />
Christian Langermann von der 2G Energietechnik referierte über die Anforderungen der 44. BImSchV. Er machte aufmerksam, dass ein<br />
Ausfall der Abgasreinigungsanlage innerhalb von 24 Stunden behoben werden muss, weil sonst die Abschaltung des Motors droht.<br />
Foto: Adobe Stock_minzpeter<br />
Langermann. Ein Ausfall der Abgasreinigungsanlage<br />
muss innerhalb von 24 Stunden behoben werden, sonst<br />
droht die Abschaltung des Motors. Um die Stickoxide<br />
der Abgase zu reduzieren, ist der Einbau eines SCR-<br />
Katalysators erforderlich.<br />
Das aus dem Fahrzeugbereich bekannte System arbeitet<br />
mit Harnstoff zur Abgasreinigung. Dass die benötigten<br />
Mengen nicht gering sind, machte Christian<br />
Langermann deutlich: Für einen 1-MW-Motor werden<br />
5.000 bis 10.000 Liter Harnstoff im Jahr benötigt.<br />
Die Tanks für die Harnstoff-Versorgung sollten frostfrei<br />
im Innenbereich aufgestellt werden, riet Langermann.<br />
Mit einer größeren Abnahmemenge ließe sich der Preis<br />
deutlich senken. Bei der Versorgung mit Tankwagen<br />
könne ein Preis von weniger als 15 Cent je Liter Harnstoff<br />
vereinbart werden. Ausfälle des SCR-Systems<br />
sollten vermieden werden – deshalb sollte die Wartung<br />
möglichst zeitgleich mit der BHKW-Wartung terminiert<br />
werden, riet Langermann. Auf einen wichtigen Aspekt<br />
machte der Ingenieur, der sich auf die Abgasnachbehandlung<br />
spezialisiert hat, zum Schluss aufmerksam:<br />
Geringere Emissionen verbessern die gesellschaftliche<br />
Akzeptanz von Biogas.<br />
Autor<br />
Thomas Gaul<br />
Freier Journalist<br />
Im Wehrfeld 19a · 30989 Gehrden<br />
01 72/512 71 71<br />
gaul-gehrden@t-online.de<br />
25
Aktuelles Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Zwei Events – Zwei Treffpunkte<br />
für die Biogasbranche<br />
22. – 26. November <strong>2021</strong><br />
Digital<br />
BIOGAS Convention & Trade Fair <strong>2021</strong><br />
Die negativen Folgen des Klimawandels<br />
werden immer<br />
drastischer: Flutkatastrophen,<br />
Waldbrände, Hitze und Dürre<br />
betreffen Menschen auf der<br />
ganzen Welt. Unsere Ressourcen schwinden<br />
und werden zerstört. Nur konsequentes<br />
nachhaltiges Handeln kann sie retten.<br />
Für die Biogasbranche bedeutet dies, ihre<br />
Rolle als unverzichtbarer Teil der Erneuerbaren<br />
Energien, als Klimaschützer, als<br />
Teil einer nachhaltigen Wirtschaft aktiv zu<br />
gestalten. Welche Aufgaben die Branche<br />
erwarten, dies will der Fachverband Biogas<br />
vom 22. bis 26. November <strong>2021</strong> auf der<br />
BIOGAS Convention Digital und vom 7. bis<br />
9. Dezember <strong>2021</strong> auf der BIOGAS Trade<br />
Fair live mit den Aktiven der Biogasbranche<br />
diskutieren.<br />
22. bis 26.November <strong>2021</strong><br />
BIOGAS Convention<br />
DIGITAL<br />
(Deutsches Hauptprogramm mit<br />
BIOGAS Fachforum Digital)<br />
7. bis 9. Dezember <strong>2021</strong><br />
BIOGAS Trade Fair<br />
Live in Nürnberg<br />
(mit BIOGAS Fachforum Live)<br />
Der Ticketshop für Tagung und<br />
Messe öffnet Mitte/Ende September.<br />
Frühbucher rabatt für das Hauptprogramm<br />
bei Anmeldung bis Freitag,<br />
den 15. Oktober <strong>2021</strong>.<br />
Aktuelle Informationen:<br />
www.biogas-convention.com<br />
Die Jahrestagung <strong>2021</strong> wird nicht nur<br />
durch die dramatischen Entwicklungen<br />
des Weltklimas, sondern erneut durch die<br />
Corona-Pandemie geprägt. Um persönliche<br />
Begegnungen zu ermöglichen und zugleich<br />
das Risiko für alle Teilnehmer zu minimieren,<br />
wurde in Abstimmung mit Mitgliedern<br />
und Firmen ein Konzept mit vielfältigen Angeboten<br />
im digitalen Raum und in Präsenz<br />
entwickelt:<br />
22. bis 26. November <strong>2021</strong>: BIOGAS Convention<br />
Digital<br />
7. bis 9. Dezember <strong>2021</strong>: BIOGAS Trade<br />
Fair Live in Nürnberg<br />
Das Hauptprogramm startet digital am<br />
Montag, den 22. November <strong>2021</strong>, 14.00<br />
Uhr mit Block 1, Thema: „Abfallvergärung<br />
- Schwerpunkt Kunststoffe“. Die Ziele<br />
der Bundesregierung zur zukünftigen<br />
Reduktion von Kunststoffeinträgen in die<br />
Umwelt adressieren auch die Bioabfälle<br />
als möglichen Eintragspfad. Der Bogen<br />
spannt sich von der Anfallstelle bis zum<br />
Gärprodukt. Betrachtet werden Aspekte<br />
zur biologischen Abbaubarkeit alternativer<br />
Kunststoffe, Analysemethoden von Mikrokunststoffen<br />
sowie die Vermeidung von<br />
Fremdstoffeinträgen bereits an der Quelle.<br />
Die „Perspektiven und Herausforderungen<br />
von Biogas im Strommarkt“ (Block 2 am<br />
23. November <strong>2021</strong>) beschäftigen die<br />
Branche bereits seit langem. Das derzeitige<br />
Strommarktdesign führt trotz sinkender<br />
Kosten in der Produktion durch Erneuerbare<br />
Energien zu einer sehr hohen EEG-Umlage,<br />
gleichzeitig werden diese Vorteile nur<br />
bedingt an die Endkunden weitergegeben.<br />
Das bestehende System muss daher der<br />
steigenden Leistungsfähigkeit der Erneuerbaren<br />
Energien angepasst werden.<br />
Der Bundesverband Erneuerbare Energie<br />
hat vor diesem Hintergrund <strong>2021</strong> eine<br />
Strommarktdesignstudie erstellen lassen,<br />
deren Ergebnisse präsentiert und in<br />
den Kontext der aktuellen Energiepolitik<br />
gestellt werden. Die neuen Vorgaben der<br />
Nachhaltigkeitsverordnung als Umsetzung<br />
der EU-Richtlinie RED II sind Thema<br />
des Block 3. Die Zertifizierung gemäß der<br />
Nachhaltigkeitsverordnung wird für viele<br />
Biogasanlagen verpflichtend sein. Wichtige<br />
Einblicke liefern erste Erfahrungen<br />
aus der Sicht eines Zertifizierungssystems<br />
und ein Praxisbericht eines Auditors. Aus<br />
dem Projekt ZertGas, in dessen Rahmen<br />
praktikable Zertifizierungslösungen und<br />
Handlungsoptionen für Betreiber entwickelt<br />
wurden, werden die Ergebnisse zu<br />
THG-Berechnungen auf Praxisbetrieben<br />
vorgestellt.<br />
Der Mittwoch, 24. November, widmet sich<br />
dem Dauerbrenner „Emissionen“ auf Biogasanlagen.<br />
Wie ist der Status quo, welcher<br />
Handlungsbedarf besteht aktuell?<br />
Nach fast 20 Jahren wird im Herbst die<br />
neue TA Luft in Kraft treten. Die biogasspezifischen<br />
Anforderungen der TA Luft <strong>2021</strong><br />
werden vorgestellt. Aus der Praxis berichten<br />
Fachleute über das Erkennen und<br />
Vermeiden von Methanleckagen und über<br />
Minderungsmaßnahmen für Ammoniakemissionen.<br />
Block 5 „Status quo Stoffstrombilanz &<br />
Potenziale für die Bodenfruchtbarkeit“<br />
präsentiert als Einstieg den Evaluierungsbericht<br />
zur Stoffstrombilanzverordnung,<br />
die nun bereits seit über zwei Jahren gültig<br />
ist. Welche Erkenntnisse haben sich<br />
in der Praxis gezeigt? Des Weiteren steigt<br />
mittlerweile das Interesse nach Torfersatzprodukten.<br />
Welche Anforderungen sind an<br />
Gärprodukte zu stellen, um mit Champost<br />
als Torfersatz zu fungieren? Wie sind die<br />
Rahmenbedingungen für die Vermarktung<br />
von Gütegesicherten Gärprodukten einzustufen?<br />
Der vierte Tag (25. November) beginnt<br />
ebenfalls mit einem Klassiker: „Recht – wie<br />
es Sie weiterbringt“. Neben aktuellen Urteilen<br />
und Entscheidungen wird die spezi-<br />
26
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Aktuelles<br />
Wichtiger Hinweis:<br />
Online-Anmeldung <strong>2021</strong><br />
obligatorisch<br />
Die Registrierung zur BIOGAS Convention Digital vom 22. bis<br />
26.11.<strong>2021</strong> und für die BIOGAS Trade Fair in Nürnberg vom<br />
7. bis 9.12.<strong>2021</strong> muss vorab online durchgeführt werden. Dies<br />
gilt auch für Mitglieder, für die der Messebesuch kostenfrei ist<br />
oder für andere kostenfreie Teilnahmen. Aufgrund von Teilnahmebegrenzungen<br />
muss der Tag für den Messebesuch vorab<br />
festgelegt werden. Anmeldung über den Ticketshop ab Mitte/<br />
Ende September auf<br />
www.biogas-convention.com<br />
elle öffentlich-rechtliche Sicht beziehungsweise<br />
die Sicht vom EEG auf den Austausch<br />
von BHKW dargestellt. Wie aber geht man<br />
mit Behördenentscheidungen um? Wie<br />
wird ein nicht genehmigter Anlagenbetrieb<br />
vermieden? Fachjuristen geben Hinweise<br />
und praxisbezogene Tipps. Einem der<br />
zunehmend an Bedeutung gewinnenden<br />
Zukunftsfelder widmet sich im Anschluss<br />
Block 7: „Grüne Gase“. Biomethan ist in<br />
aller Munde, aber wird die Biomethanausschreibung<br />
im EEG<br />
<strong>2021</strong> daraus ein zukunftsfähiges<br />
Geschäftsmodell machen?<br />
Wird die Treibhausgasminderungsquote<br />
im neuen BIm-<br />
SchG Biomethan als Kraftstoff<br />
aus seiner Nische holen? Und<br />
wo ist Grüner Wasserstoff einzuordnen, ist<br />
er eine weitere Zukunftsoption für Biogas?<br />
Am letzten Tag (26. November) beschäftigt<br />
sich die Tagung mit dem Störfallrecht<br />
in der Praxis. Eine Übersicht der aktuellen<br />
technischen Regeln aus dem Störfallrecht<br />
bringt die Teilnehmenden auf den aktuellen<br />
Stand, Schwellen und Hürden in der<br />
Praxis werden aufgezeigt und diskutiert.<br />
Zum Abschluss wird vorgestellt, wie sie<br />
07. – 09. Dezember <strong>2021</strong><br />
Messe Nürnberg<br />
als Betreiber ein funktionierendes Sicherheitsmanagementsystem<br />
mit Anlagendokumentation<br />
umsetzen.<br />
Rund um die Vortragsblöcke finden<br />
Teilnehmer*innen auf der BIOGAS Convention<br />
Digital die Möglichkeit, mit Fachleuten,<br />
Firmen und anderen Teilnehmern<br />
via Chat, Video-Chat, in Gruppenchats, in<br />
Diskussionsräumen oder im BIOGAS-Treff<br />
in Kontakt zu treten.<br />
Unter www.biogas-convention.com finden<br />
Sie das aktuelle Hauptprogramm. Das Programm<br />
des BIOGAS Fachforum digital &<br />
live wird nach und nach ebenfalls dort veröffentlicht.<br />
Sichern Sie sich frühzeitig Ihre Tickets,<br />
der Fachverband Biogas freut sich auf Ihre<br />
Teilnahme!<br />
Programmübersicht 22. bis 26.11.<strong>2021</strong> BIOGAS Convention DIGITAL<br />
Montag<br />
22.11.<strong>2021</strong><br />
Dienstag<br />
23.11.<strong>2021</strong><br />
Mittwoch<br />
24.11.<strong>2021</strong><br />
Donnerstag<br />
25.11.<strong>2021</strong><br />
Freitag<br />
26.11.<strong>2021</strong><br />
BIOGAS<br />
Convention<br />
Deutsch<br />
BIOGAS<br />
Convention<br />
Deutsch<br />
BIOGAS<br />
Convention<br />
Deutsch<br />
BIOGAS<br />
Convention<br />
Deutsch<br />
BIOGAS<br />
Convention<br />
Deutsch<br />
9.00 –<br />
10.30<br />
10.30 –<br />
12.30<br />
12.30 –<br />
14.00<br />
BIOGAS Fachforum Digital<br />
BLOCK 2<br />
Perspektiven<br />
und Herausforderungen<br />
von Biogas im<br />
Strommarkt<br />
BIOGAS Fachforum Digital<br />
BLOCK 4<br />
Emissionen<br />
BIOGAS Fachforum Digital<br />
BLOCK 6<br />
Recht –<br />
Wie es Sie<br />
weiterbringt<br />
BIOGAS Fachforum Digital<br />
BLOCK 8<br />
Störfallrecht<br />
in der Praxis:<br />
Anforderungen,<br />
Erfahrungen<br />
und<br />
beispielhafte<br />
Umsetzung<br />
BIOGAS Fachforum Digital<br />
14.00 –<br />
16.00<br />
BLOCK 1<br />
Abfallvergärung:<br />
Schwerpunkt<br />
Kunststoffe<br />
BLOCK 3<br />
Umsetzung der<br />
Nachhaltigkeitsverordnung<br />
durch die<br />
Biogasbranche<br />
BLOCK 5<br />
Status quo<br />
Stoffstrombilanz<br />
&<br />
Potenziale für<br />
die Bodenfruchtbarkeit<br />
BLOCK 7<br />
Grüne Gase:<br />
Neue Chancen<br />
für Biogas<br />
27
Politik<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Das „Kabinett Merkel IV“ aus Sicht<br />
der Biogasbranche: energiepolitischer<br />
Rück- und Ausblick<br />
Die energie- und klimapolitische Bilanz der „GroKo“ in der zurückliegenden Legislaturperiode<br />
insgesamt fällt allenfalls gemischt aus – doch aus Sicht der Biogasbranche konnte<br />
der Fachverband Biogas etliche wichtige Weichen für die Zukunft der Biogastechnologie<br />
stellen. Hier unser energiepolitischer Rückblick sowie ein erster Ausblick auf die<br />
kommenden vier Jahre.<br />
Von Sandra Rostek und Dr. Guido Ehrhardt<br />
Der Fachverband und seine Verbündeten waren<br />
voller Tatendrang und mit einer langen<br />
und dringlichen Liste an Verbesserungswünschen<br />
in diese nun zu Ende gehende<br />
Legislaturperiode gestartet. Es ging uns um<br />
nichts weniger als um eine Zukunftsperspektive für die<br />
Biogasbranche im Strom- und Wärmebereich. In der<br />
EEG-Novelle 2014 sollten wir noch nahezu abgeschafft<br />
werden, in der EEG-Reform 2017 war uns zumindest<br />
holzschnittartig eine Anschlussregelung geglückt für<br />
die Biogasanlagen, deren erster Vergütungszeitraum<br />
nach 20 Jahren zu Ende gehen würde.<br />
Doch diese Regelung griff in der Praxis nicht – die Rahmenbedingungen<br />
der Ausschreibungen waren viel zu<br />
restriktiv. Eine weitere EEG-Novelle musste also her,<br />
in der wir zudem die Flexibilisierung unseres Anlagenparks<br />
vorantreiben, die Güllevergärung mobilisieren<br />
und auch wieder Neuanlagen ermöglichen wollten.<br />
Klimapäckchen statt Klimapaket<br />
Im Koalitionsvertrag der Groko fanden sich bereits die<br />
richtigen Stichpunkte und damit auch Arbeitsaufträge<br />
an die neue Regierung: Die Stabilisierung des Biogasanlagenbestands<br />
wurde angestrebt. Trotz dieses vielversprechenden<br />
Bekenntnisses im „KoaV“ setzte sich<br />
erst einmal fort, was sich in den mehr als zähen Koalitionsverhandlungen<br />
bereits abzeichnete – die Groko<br />
ließ sich Zeit.<br />
Foto: Adobe Stock_Kopterdienstleistung<br />
28
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Politik<br />
29
Politik<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Vollmundigen Ankündigungen folgten lange<br />
Diskussionsprozesse und Streitereien.<br />
Wenn dann schließlich Beschlussvorlagen<br />
vorgelegt wurden, so waren diese aufgrund<br />
der vielen Kompromisse häufig so weichgespült,<br />
dass sie nicht mehr den Anspruch<br />
einlösen konnten, Energiewende und Klimaschutz<br />
entscheidend voranzubringen.<br />
Das mit Spannung erwartete „Klimapaket“<br />
entpuppte sich in den Augen vieler wohl<br />
eher als „Klimapäckchen“ – indes, für die<br />
Bioenergie fanden sich einige wichtige Anknüpfungspunkte,<br />
allen voran eine klare<br />
Bezifferung des Beitrags zu den Zielen der<br />
Bundesregierung im Strom- und Wärmebereich.<br />
Darauf konnte man aufbauen und wir wollten<br />
diesen Schwung mitnehmen in die<br />
EEG-Novelle. Die Reform, die nach Bekunden<br />
der Koalitionäre bald nach Beginn<br />
der Legislatur eigentlich schon hätte erfolgen<br />
sollen, zog sich jedoch bis Ende 2020<br />
hin und wurde erst mit dem Änderungsgesetz<br />
zum EEG <strong>2021</strong> in der allerletzten<br />
Sitzungswoche der Regierungsperiode abgeschlossen.<br />
Achterbahnfahrt EEG <strong>2021</strong><br />
Die EEG-Novelle war für uns wahrlich eine<br />
Achterbahnfahrt. Die Liste unserer Forderungen<br />
war sehr lang und sehr dringend.<br />
Und bis kurz vor Schluss lief es eigentlich<br />
wie am Schnürchen: Für die Biomasse sollte<br />
erstmals ein eigenes Ausbauziel verankert<br />
werden, das unserem Ziel des Erhalts<br />
auf heutigem Niveau weitestgehend entsprach,<br />
und die Ausschreibungsvolumina<br />
sollten dementsprechend angehoben werden.<br />
Zudem war geplant, die Höchstgebotsgrenze<br />
zu erhöhen und den Flexdeckel<br />
abzuschaffen.<br />
Alles also Verbesserungen, die wir von<br />
langer Hand gefordert hatten. Doch quasi<br />
in letzter Minute sollte dann plötzlich der<br />
Flexibilitätszuschlag für Biogasanlagen im<br />
zweiten EEG-Vergütungszeitraum de facto<br />
gestrichen werden. Denn auch das ist<br />
leider Teil des Vermächtnisses der Groko:<br />
Den schier endlosen Verzögerungen folgten<br />
plötzliche Gesetzesvorlagen, die mit extrem<br />
kurzen Fristen (teilweise weniger als 24<br />
Stunden) mit den Verbänden konsultiert<br />
und dann durch den Bundestag gepeitscht<br />
wurden. Fehlentwicklungen und handwerkliche<br />
Schnitzer mit gravierenden Auswirkungen<br />
inklusive. Dass es uns doch noch<br />
gelang, im Änderungsgesetz die eben beschlossene<br />
Streichung des Flexzuschlags<br />
wieder zurückzunehmen, zählt für uns zu<br />
den wichtigsten Erfolgen der Legislatur. Wir<br />
durften erleben, wie viel Unterstützung wir<br />
in der Politik trotz aller Widrigkeiten doch<br />
haben und was wir mit der geballten Kraft<br />
unserer großen Mitgliedschaft, flankiert<br />
durch die befreundeten Verbände, erreichen<br />
können.<br />
Neue Chancen im Wärme- und<br />
Kraftstoffmarkt<br />
Auch wenn der Strombereich unsere politische<br />
Arbeit natürlich primär bestimmte,<br />
war uns auch die Erschließung neuer<br />
Märkte für Biogas abseits des EEG ein<br />
großes Anliegen. Gesetzesvorhaben und<br />
Anlässe gab es genug: Gebäudeenergiegesetz,<br />
Kohleausstiegsgesetz, Novelle des<br />
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, Brennstoffemissionshandelsgesetz,<br />
die neuen<br />
Bundesförderungen für effiziente Gebäude<br />
und Wärmenetze, die Novelle der Treibhausgasminderungsquote<br />
(u.v.m.) – all diese<br />
Regelwerke standen auf der politischen<br />
Tagesordnung.<br />
Und es ist uns gelungen, an einigen Stellen<br />
deutliche neue Akzente für Biogas zu<br />
setzen. So etwa im Gebäudeenergiegesetz,<br />
wo wir erreichen konnten, dass Biomethan<br />
in Neubauten nun auch bei Einsatz im<br />
Brennwertkessel eine anerkannte Erfüllungsoption<br />
ist. Oder im Kraftstoffbereich,<br />
wo wir künftig eine steigende Nachfrage<br />
nach Biomethan erwarten dürfen und zudem<br />
eine weitere neue Zukunftsoption, den<br />
biogenen Wasserstoff, erfolgreich ins Spiel<br />
bringen konnten.<br />
Zwischenfazit: Es geht wieder was<br />
Die Politik der Groko mag in Sachen Klimaschutz<br />
und Energiewende insgesamt<br />
eher nur ein kleiner Schritt in die Richtung<br />
des eigentlich Notwendigen gewesen sein –<br />
aus Sicht der Biogasbranche konnten wir<br />
jedoch summa summarum große Schritte<br />
machen, die uns wieder auf den richtigen<br />
Weg gebracht haben. Wir ziehen daher eine<br />
positive Bilanz zur zurückliegenden Legislatur.<br />
Unsere Strategie des gemeinsamen Auftritts<br />
der Bioenergie unter dem Dach des<br />
„Hauptstadtbüro Bioenergie“ hat sich<br />
ausgezahlt. Das „HBB“ hat sich als anerkannter<br />
politischer Gesprächspartner<br />
in Berlin etabliert. Egal ob Strom, Wärme<br />
oder Kraftstoff – das HBB war als Sachverständiger<br />
zu den öffentlichen Anhörungen<br />
geladen und diente auch hinter den Kulissen<br />
als Ansprechpartner Nr. 1.<br />
Ausblick: Neues Spiel, neues<br />
Glück<br />
Diese Bilanz kann aber allenfalls ein Zwischenfazit<br />
darstellen. Wir können und<br />
wollen uns keinesfalls ausruhen, sondern<br />
auch in der nächsten Regierungsperiode<br />
weitere Verbesserungen für eine nachhaltige<br />
Zukunftsperspektive für Biogas, Energiewende<br />
und den Klimaschutz insgesamt<br />
erreichen. Mit dem „HBB“ befinden wir<br />
uns daher auf Sommertour mit politischen<br />
Gesprächen in ganz Deutschland, um die<br />
Botschaft zu vermitteln, was Biogas alles<br />
kann.<br />
In der nächsten Etappe der Energiewende<br />
geht es um Weichenstellungen hin zur<br />
Treibhausgas neutralen Volkswirtschaft.<br />
Die EU hat die Fahne mit ihrem „Fit for<br />
55-Programm“ schon gehisst – Deutschland<br />
muss nachziehen. Wer immer die<br />
neue Regierung stellen wird (was nun,<br />
Ende August, noch völlig offen ist), eines<br />
ist klar: Biogas ist durch die vielfältigen<br />
Einsatzmöglichkeiten ein wesentliches<br />
Puzzleteil.<br />
Dieses Angebot werden wir auch in den<br />
kommenden vier Jahren der Politik unterbreiten.<br />
Und dabei deutlich machen: Wer<br />
grüne Energie will, der muss auch den Rahmen<br />
passend setzen: der Abbau von Investitionshemmnissen<br />
im EEG (insbesondere<br />
endogene Mengensteuerung und Südquote),<br />
die Flexibilisierung des Anlagenbestands,<br />
neue Anreize für die Güllevergärung<br />
und ein praktikables Genehmigungsrecht<br />
etwa stehen ganz oben auf unserer Liste.<br />
Autoren<br />
Sandra Rostek<br />
Leiterin des Berliner Büros<br />
Dr. Guido Ehrhardt<br />
Leiter des Referats Politik<br />
im Fachverband Biogas e.V.<br />
030/2 75 81 79-0<br />
berlin@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
30
Höre-Combi<br />
www.hoere-biogas.de<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Politik<br />
Bis zu 40% Energie-Förderung<br />
beim Tausch für den neuen Dosierer erhalten<br />
Wir beraten Sie gerne<br />
Biogas Höre GmbH<br />
78359 Orsingen<br />
Tel. : 07774 - 6910<br />
www.hoere-biogas.de<br />
Mail: info@hoere-biogas.de<br />
Individuelle Projektierung<br />
Dosiersysteme von 8 – 150m³<br />
Flächendeckendes Servicenetz<br />
Hervorragende Ersatzteilversorgung<br />
Durch Combi-System geringe Energiekosten<br />
Minimaler Verschleiß durch Edelstahlauskleidung<br />
Vorführmaschinen vorhanden<br />
Sprechen Sie uns an!<br />
IHR SPEZIALIST FÜR MULCHGERÄTE.<br />
FÜR JEDEN EINSATZBEREICH DAS RICHTIGE MODELL<br />
bertima.it<br />
Vertriebsbüro Deutschland<br />
Werksvertretung Höre • 78359 Orsingen<br />
31<br />
Tel.: 07774 - 6910 • Mail: info@hoere-werksvertretung.de
Politik<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz<br />
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz<br />
Biogas wird unterschiedlich betont<br />
Stuttgart: In der<br />
Energiepolitik<br />
bewegt vor allem das<br />
Thema Windkraft das<br />
Ländle. Es solle eine<br />
„Vergabeoffensive<br />
für die Vermarktung<br />
von Staatswald- und<br />
Landesflächen für die<br />
Windkraftnutzung“<br />
geben, heißt es im<br />
Koalitionsvertrag.<br />
Nach den Landtagswahlen trägt in Stuttgart der Koalitionsvertrag mit der CDU eine<br />
grüne Handschrift, in Mainz definiert die Ampelkoalition einen Ausbau der Erneuerbaren<br />
mit Einschränkungen.<br />
Von Bernward Janzing<br />
In Baden-Württemberg legt sich die neue Landesregierung<br />
in ihrem Koalitionsvertrag mächtig ins Zeug:<br />
Man wolle „Baden-Württemberg als Klimaschutzland<br />
zum internationalen Maßstab machen“, haben<br />
Grüne und CDU darin formuliert. Es ist einer von vielen<br />
Sätzen, die belegen, dass der Vertrag ein Dokument<br />
vor allem mit grüner Handschrift geworden ist.<br />
Alles andere wäre auch überraschend gewesen. Denn<br />
wo eine Partei unangefochten die Regierung stellen<br />
kann und zuvor verschiedene Mitbewerber um die<br />
Chance buhlen, als Juniorpartner erwählt zu werden –<br />
neben der CDU einerseits waren das die SPD und die<br />
FDP andererseits – liegt es nahe, dass der Platzhirsch<br />
viel herausholt.<br />
Die CDU hatte sich nach einer recht reibungslos absolvierten<br />
vorangegangenen gemeinsamen Legislaturperiode<br />
den Grünen erneut frühzeitig angedient. Und<br />
so setzte vor allem Ministerpräsident Winfried Kretschmann<br />
auf die Fortführung der seit fünf Jahren währenden<br />
Farbkonstellation. Andere in der Partei hätten<br />
gerne eine Ampelkoalition gesehen, doch man darf vermuten,<br />
dass der Landesvater als altgedienter Politstratege<br />
sehr genau weiß, dass eine im Laufe der Jahre glatt<br />
geschliffene CDU ihm mehr Freiraum lassen wird als<br />
eine vielleicht doch eher mal aufmuckende FDP.<br />
Passend dazu hatte CDU-Landeschef Thomas Strobl<br />
das Thema Klimaschutz massiv propagiert; die Grünen<br />
hätten mit ihren Klimaschutzplänen bei seiner Partei<br />
„offene Türen eingerannt“, ließ er verlauten. In der<br />
Energiepolitik bewegt vor allem das Thema Windkraft<br />
das Ländle. Es solle eine „Vergabeoffensive für die Vermarktung<br />
von Staatswald- und Landesflächen für die<br />
Windkraftnutzung“ geben, heißt es im Koalitionsvertrag.<br />
Und weiter: „So können wir die Voraussetzungen<br />
für den Bau von bis zu 1.000 neuen Windkraftanlagen<br />
schaffen.“<br />
Die Landesregierung will ferner den Ausbau von Freiflächen-Photovoltaik<br />
vorantreiben, etwa „entlang von<br />
Autobahnen, Zugstrecken, auf ehemaligen Mülldeponien<br />
und auf Baggerseen“. Insgesamt 2 Prozent der<br />
Landesfläche sollen für Windenergie- und Photovoltaik-<br />
Freiflächenanlagen freigegeben werden. Zugleich soll<br />
die Solarpflicht, die für neue Nichtwohngebäude bereits<br />
im Mai 2020 beschlossen wurde, künftig auch auf<br />
Wohngebäude und für den Fall grundlegender Dachsanierungen<br />
ausgedehnt werden.<br />
Regierung pro naturverträglicher<br />
Biogasproduktion<br />
Das Biogas unterdessen wird im Koalitionsvertrag zweimal<br />
nur jeweils kurz erwähnt. Die Landesregierung will<br />
„die Bedeutung einer naturverträglichen Erzeugung<br />
von Biogas und Solarthermie für den Wärmebereich<br />
erhöhen“, heißt es. Sie sichert zu, Ansätze zu stärken,<br />
„die die Erzeugung von Biogas mit dem Erhalt der Biodiversität<br />
verbinden“.<br />
Zugleich haben beide Parteien sich darauf verständigt,<br />
einen „Kohleausstieg bis 2030 unter Berücksichtigung<br />
der Versorgungssicherheit“ anzustreben. Da Baden-<br />
Württemberg ohne die Kohle und ohne das heute noch<br />
Foto: Adobe Stock_Tobias Arhelger<br />
32
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Politik<br />
laufende Atomkraftwerk Neckarwestheim dann vermutlich<br />
mehr als 60 Prozent seines Stroms wird importieren<br />
müssen, dürfte es darüber aber wohl noch einige<br />
Debatten geben.<br />
Ohnehin sind Koalitionspapiere geduldig, wie man gerade<br />
in Baden-Württemberg weiß. Als die Grünen in<br />
Baden-Württemberg im Jahr 2011 erstmals eine Landesregierung<br />
anführten, damals in der Koalition mit der<br />
SPD, besagte der wohl meistzitierte Satz im Koalitionsvertrag,<br />
man wolle bis 2020 mindestens 10 Prozent<br />
des Strombedarfs aus heimischer Windkraft decken.<br />
Erreicht wurden jedoch gerade 4,4 Prozent.<br />
Und so wird man auch diesmal erst abwarten müssen,<br />
was von den vielen grünen Ideen wirklich umgesetzt<br />
wird – beziehungsweise umgesetzt werden kann. Denn<br />
der Ausbau der Windkraft in den vergangenen zehn Jahren<br />
scheiterte im Südwesten weniger am politischen<br />
Willen der Landesregierung als vielmehr einerseits<br />
an der Bundespolitik und andererseits sehr oft auch<br />
schlicht an Fragen des Artenschutzes.<br />
Ambitioniertes Vorhaben –<br />
flächendeckender ÖPNV<br />
Solche Unsicherheiten haben die Koalitionäre aber<br />
erneut nicht von ambitionierten Plänen abgehalten.<br />
Die vielleicht spektakulärste Idee ist jene zum Thema<br />
„klimafreundliche Mobilität und Verkehrswende“: Ausgerechnet<br />
das Autoland will nämlich „eine Garantie für<br />
den öffentlichen Nahverkehr“ geben. Es sollen künftig –<br />
wobei der Zeitpunkt der Realisierung offenbleibt –<br />
„alle Orte in Baden-Württemberg von fünf Uhr früh bis<br />
Mitternacht mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar<br />
sein“. In einem Flächenland, in dem es heute noch<br />
unzählige Orte gibt, von denen man nach einer Abendveranstaltung<br />
mit den Öffentlichen nicht mehr nach<br />
Hause kommt, wäre das revolutionär.<br />
Finanziert werden soll das Konzept auch über einen<br />
„Mobilitätspass“, für den das Land den Kommunen<br />
den Rechtsrahmen schaffen will. Die Grundidee: Die<br />
Halter eines Kraftfahrzeugs müssen einen Beitrag für<br />
den Nahverkehr bezahlen. Dessen Höhe könnte im Extremfall<br />
an die Größenordnung eines Monatstickets für<br />
den Nahverkehr heranreichen.<br />
Im Gebäudesektor will die Landesregierung unterdessen<br />
einen „CO 2<br />
-Schattenpreis“ von 180 Euro pro Tonne<br />
für die Sanierung und den Neubau von Landesliegenschaften<br />
einführen. Das heißt, man wird künftig bei<br />
Berechnungen der Wirtschaftlichkeit von Baumaßnahmen<br />
immer davon ausgehen, CO 2<br />
habe bereits einen<br />
solchen Preis erreicht. Dieses Konzept hatte unter<br />
anderem der Bund für Umwelt und Naturschutz stark<br />
propagiert – eine urgrüne Idee also.<br />
33
Politik<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Die rheinland-pfälzische Regierungskoalition bekennt sich zu Biogas-Bestandsanlagen. Sie will den Sektor unter anderem<br />
„durch beschleunigte Genehmigungsverfahren und verbindliche Genehmigungsleitfäden, vor allem im Rahmen des Repowering<br />
sowie beim Bau von Gülle-Kleinanlagen“, unterstützen.<br />
Auch Rheinland-Pfalz will sich „auf den<br />
Pfad der Klimaneutralität begeben“<br />
Anders als in Baden-Württemberg war die Farbkonstellation<br />
in Rheinland-Pfalz nach der Wahl unstrittig –<br />
es fand sich erneut eine SPD-geführte Ampelkoalition<br />
unter Ministerpräsidentin Malu Dreyer zusammen. Der<br />
Koalitionsvertrag klingt streckenweise etwas technokratisch.<br />
Etwa, wenn es heißt: „Als Landesregierung<br />
wirken wir in unseren Zuständigkeitsbereichen darauf<br />
hin, dass sich alle für die Zielerreichung relevanten<br />
Sektoren (Energie, Verkehr, Wärme etc.) auf den Pfad<br />
der Klimaneutralität begeben.“<br />
Aber das Papier wird auch konkreter. So peilt die Landesregierung<br />
in Mainz einen „Netto-Ausbau von 500<br />
Megawatt Photovoltaik und 500 Megawatt Windkraft<br />
pro Jahr“ an. Die Regierung sei sich „darin einig, dass<br />
bei Gewerbeneubauten und für neue Parkplatzflächen<br />
mit mindestens 50 Stellplätzen“ künftig „eine Pflicht<br />
zur Installation von Photovoltaikanlagen gesetzlich vorgeschrieben<br />
wird“.<br />
Freiflächen-Photovoltaik soll unterdessen limitiert<br />
bleiben: Die Landesregierung will Kommunen empfehlen,<br />
den Bau von PV-Anlagen außerhalb des EEG auf<br />
Ackerflächen lediglich dort zu ermöglichen, wo eine<br />
durchschnittliche Ertragsmesszahl (EMZ) von maximal<br />
35 gegeben ist. Landesweit soll die Nutzung von Ackerflächen<br />
für den Bau von PV-Anlagen im Außenbereich<br />
im Landesentwicklungsplan auf 2 Prozent begrenzt<br />
werden.<br />
Auch die Windkraft im Wald soll Restriktionen unterliegen:<br />
„Dort wo es möglich ist, wollen wir uns beim Bau<br />
von Windkraftanlagen im Wald auf Kalamitätsflächen<br />
fokussieren.“ Der Unesco-Welterbestatus im Biosphärenreservat<br />
Pfälzerwald sei „von<br />
zentraler Bedeutung und darf<br />
nicht gefährdet werden“. Kernund<br />
Pflegezonen des Biosphärenreservats<br />
Pfälzerwald seien<br />
daher von der Windenergienutzung<br />
ausgenommen.<br />
Positive Haltung zur<br />
Biogasproduktion<br />
Dem Biogas widmet man sich<br />
in Rheinland-Pfalz unterdessen<br />
ausführlicher als in Baden-Württemberg:<br />
„Wir bekennen uns zu<br />
den Biogas-Bestandsanlagen<br />
und unterstützen deren Umbau<br />
zu flexiblen Biokraftwerken in<br />
netzdienlicher Betriebsweise“,<br />
heißt es in dem Papier. Dies<br />
solle unter anderem „durch beschleunigte<br />
Genehmigungsverfahren<br />
und verbindliche Genehmigungsleitfäden,<br />
vor allem im<br />
Rahmen des Repowering sowie<br />
beim Bau von Gülle-Kleinanlagen“, erfolgen.<br />
Das Land propagiert auch den Einsatz nachwachsender<br />
Rohstoffe für die Energiegewinnung. Konkret gehe es<br />
um „die Förderung des naturnahen Anbaus mehrjähriger<br />
Pflanzungen (z.B. Durchwachsene Silphie)“ um<br />
die „Biogaserzeugung mit Insekten-, Gewässer- und<br />
Grundwasserschutz zu verbinden“. Das Potenzial der<br />
Gülle-Kleinanlagen solle erschlossen werden, „um<br />
auch die positiven Klimaschutzeffekte für den Gewässer-<br />
und Emissionsschutz zu aktivieren“. Bis 2030 sollen<br />
„mindestens 65 Prozent aller in Rheinland-Pfalz<br />
anfallenden landwirtschaftlichen Wirtschaftsdünger<br />
aus Betrieben mit mehr als 200 Großvieheinheiten<br />
energetisch-stofflich genutzt werden“.<br />
Auch Rheinland-Pfalz ist wie Baden-Württemberg<br />
Stromimportland. Etwa 30 Prozent des verbrauchten<br />
Stroms wird heute importiert – mit einem Unterschied<br />
freilich zum Nachbarn im Südwesten der Republik:<br />
Während in Baden-Württemberg der Anteil der Eigenerzeugung<br />
im Land in den letzten Jahren zurückging,<br />
stieg er in Rheinland-Pfalz stetig an: Vor 15 Jahren hatte<br />
das Land noch die Hälfte seines Stroms importieren<br />
müssen, inzwischen haben die Erneuerbaren den Importanteil<br />
bereits auf unter 30 Prozent gesenkt.<br />
Autor<br />
Bernward Janzing<br />
Freier Journalist<br />
Wilhelmstr. 24a · 79098 Freiburg<br />
07 61/202 23 53<br />
bernward.janzing@t-online.de<br />
Foto: Adobe Stock_Branko Srot<br />
34
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Politik<br />
Kein Gefahrstoff, kein Risiko: Spurenelementmischung novoDYN ® .<br />
Jetzt kostenlose<br />
Analyse sichern! *<br />
* Mindestabnahme eine Palette novoDYN ®<br />
Optimale Versorgung, sicherer Einsatz – novoDYN ® von Schmack.<br />
Die leistungssteigernde Spurenelementmischung von Schmack<br />
lässt sich einfach und sicher handhaben, denn sie fällt nicht unter die<br />
Gefahrstoffverordnung und ist konform mit der TRGS 529. Individuell<br />
abgestimmt auf Ihre BGA, sorgt sie für einen stabilen Gärprozess.<br />
Wir beraten Sie gern. www.schmack-biogas.de<br />
Schmack Biogas Service GmbH · 24-Stunden-Service-Hotline: Tel. +49 (0) 9431 751-277<br />
info@schmack-biogas.com<br />
HOLEN SIE MEHR<br />
RAUS AUS IHRER<br />
BIOGASANLAGE<br />
WANGEN<br />
Das modulare System zum<br />
zuverlässigen Schutz von Anlagen.<br />
MAX.<br />
DURCHFLUSSMENGE<br />
m 3 /h<br />
MAX.<br />
DREHZAHL<br />
DER SCHNEIDEMESSER<br />
MAX.<br />
DIFFERENZDRUCK<br />
bar 6<br />
1.250 *<br />
min -1 3.000<br />
* Angaben gelten bei Wasser als Medium<br />
Geringe Verschleißkosten und<br />
niedriger Energieeinsatz optimieren<br />
die Effizienz Ihrer Anlage.<br />
Das modulare System besteht aus dem X-TRACT (Fremdkörperabscheider)<br />
und dem X-CUT (Zerkleinerer), läuft wie geschmiert, scheidet extrem gut<br />
ab und bietet mehr Schutz vor schädigenden Störstoffen wie z.B. Steine.<br />
Die hochbelastbare Heavy-Duty-Dichtung, der Hochleistungs-Zerkleinerer<br />
und der großvolumige Absetzbehälter garantieren den optimalen Einsatz<br />
und die maximale Servicefreundlichkeit.<br />
Qualität entsteht im Detail. Und in WANGEN.<br />
35<br />
WWW.WANGEN.COM
Politik<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Chance einer<br />
Ökologisierung<br />
verspielt<br />
Die artenreichen Flächen<br />
sind laut Stefan Rauh,<br />
Geschäftsführer des<br />
Fachverbandes Biogas<br />
e.V., eine elementar<br />
wichtige Grundlage für<br />
das Überleben vieler<br />
heimischer Insekten und<br />
Wildtiere. Deshalb müssten<br />
solche Energiepflanzen,<br />
die für mehr Artenvielfalt<br />
sorgen, bei den<br />
Öko-Regelungen dringend<br />
berücksichtigt werden, so<br />
seine Forderung.<br />
Die EU hatte über die Regeln zur Vergabe von Agrarsubventionen in den kommenden<br />
sieben Jahren zu entscheiden – am Ende blieb wenig übrig im Sinne des Klima- und<br />
Umweltschutzes.<br />
Von Bernward Janzing<br />
Klimaschutz könnte so einfach sein – dort<br />
nämlich, wo ohnehin regelmäßig Milliarden<br />
Euro an Steuergeldern verteilt werden.<br />
Im Agrarsektor in der Europäischen Union<br />
zum Beispiel. Unter dem Titel „Gemeinsame<br />
Agrarpolitik“ (GAP) stellt die EU für Landwirte und<br />
ländliche Regionen allein in Deutschland jährlich 6,2<br />
Milliarden Euro zur Verfügung. Die Rahmenbedingungen<br />
der GAP gelten als wichtige Leitplanken für die<br />
landwirtschaftliche Praxis in den Mitgliedsländern. Die<br />
Forderung, beim Verteilen der Gelder verstärkt Kriterien<br />
des Umwelt- und Klimaschutzes zu berücksichtigen,<br />
wurde von Umweltverbänden schon in der Vergangenheit<br />
immer wieder erhoben.<br />
Alle sieben Jahre wird die GAP fortgeschrieben – nun<br />
war es wieder so weit. Ende Juni einigten sich Vertreter<br />
des Europäischen Parlaments, des EU-Rats und der Europäischen<br />
Kommission – der sogenannte Trilog – auf<br />
eine neue GAP bis zum Jahr 2027. Diese regelt, nach<br />
welchen Kriterien die Gelder künftig verteilt werden.<br />
Vom Ergebnis zeigen sich Umweltorganisationen nun<br />
enttäuscht: Die beschlossene Agrarpolitik bringe „viel<br />
zu wenig für den Klima- und Artenschutz in der europäischen<br />
Landwirtschaft“, kommentiert Tobias Reichert,<br />
Referent für Agrarpolitik bei der Umwelt- und<br />
Entwicklungsorganisation Germanwatch. Denn nur ein<br />
Viertel der Direktzahlungen müsse durch die sogenannten<br />
Eco-Schemes an zusätzliche ökologische Kriterien<br />
geknüpft werden – und bei denen sei noch nicht einmal<br />
klar, wie wirksam sie ausgestaltet werden. In vielen<br />
Ländern drohe damit ein „Weiter so“ – statt eines ökologischen<br />
Wandels.<br />
Bei den Eco-Schemes handelt es sich um Umweltmaßnahmen,<br />
die dem Schutz des Klimas, der Umwelt oder<br />
der Biodiversität dienen. Zu diesen Aspekten kommen<br />
ferner der Tierschutz und der reduzierte Einsatz von<br />
Antibiotika hinzu. Der Fachverband Biogas hatte im<br />
März in der Verbändeanhörung die Berücksichtigung<br />
artenreicher Energiepflanzen bei den Öko-Regelungen<br />
gefordert, doch bei den Entscheidungsträgern konn-<br />
Foto: landpixel.eu<br />
36
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
INNOVATIVE<br />
Politik<br />
EINBRINGTECHNIK<br />
FÜR BIOGAS- UND<br />
RECYCLINGANLAGEN<br />
te er damit kaum durchdringen. Stefan<br />
Rauh, Geschäftsführer des Fachverbandes<br />
Biogas, verweist aber darauf, dass die<br />
„Diskussion zur Ausgestaltung der Öko-<br />
Regelungen noch nicht abgeschlossen“<br />
sei. Aktuell gebe es die Tendenz, dass sich<br />
Förderungen in den Länderprogrammen<br />
wiederfinden könnten. Denn die EU lässt<br />
ihren Mitgliedsstaaten Freiheiten bei der<br />
Umsetzung.<br />
Biodiversität fördernde<br />
Energiepflanzen in Öko-<br />
Regelungen berücksichtigen<br />
Für Deutschland ergebe sich „über die<br />
energetische Verwertung von Energiepflanzen<br />
in Biogasanlagen die Möglichkeit, Ökologie<br />
und Ökonomie auf landwirtschaftlichen<br />
Flächen miteinander zu verbinden“,<br />
betont der Fachverband. Diese Chance<br />
müsse ergriffen werden, zumal sich auch<br />
große Teile der Bevölkerung bunte und<br />
artenreiche Ackerflächen wünschten, wie<br />
Volksbegehren in verschiedenen Bundesländern<br />
gezeigt hätten. Die artenreichen<br />
Flächen seien „eine elementar wichtige<br />
Grundlage für das Überleben vieler heimischer<br />
Insekten und Wildtiere“. Deshalb<br />
müssten solche Energiepflanzen, die für<br />
mehr Artenvielfalt sorgen, bei den Öko-Regelungen<br />
dringend berücksichtigt werden,<br />
fordert Rauh.<br />
Welche Energiepflanzen in Zukunft verstärkt<br />
angebaut werden, entscheide nämlich<br />
auch die GAP, sagt Rauh. Vergoren<br />
werden kann schließlich fast jede Pflanze –<br />
allerdings mit recht unterschiedlichem<br />
Gasertrag; beim Mais ist dieser etwa doppelt<br />
so hoch wie beispielsweise bei Wildpflanzenmischungen.<br />
„Mit der gezielten<br />
Berücksichtigung von Wildpflanzen in den<br />
Öko-Regelungen könnte diese monetäre<br />
Differenz ausgeglichen und gleichzeitig<br />
ein Beitrag für den Umweltschutz geleistet<br />
werden“, so der Fachverband. Ein bunter<br />
Mix aus Energiepflanzen für Biogasanlagen<br />
biete die Chance, steigende Umweltleistungen<br />
und produktive Landwirtschaft<br />
zu verbinden: „Die breite Palette an Substraten<br />
bietet hervorragende Voraussetzungen<br />
für eine Ökologisierung im Sinne<br />
der Landwirtschaft und der Gemeinsamen<br />
Agrarpolitik.“<br />
Die Verhandlungen über die GAP in den<br />
vergangenen Monaten waren zäh gewesen.<br />
Ende Mai waren sie sogar vorübergehend<br />
auf Eis gelegt worden, weil das Parlament<br />
die Minischritte nicht mehr mitzutragen<br />
bereit war, die seitens der Mitgliedstaaten<br />
unter Vorsitz der portugiesischen Ratspräsidentschaft<br />
immer wieder angeboten wurden.<br />
Das Parlament bestand vielmehr auf<br />
einer wirkungsvollen Neufassung der Kriterien<br />
zur Vergabe der europäischen Agrargelder<br />
in den kommenden Jahren, konnte<br />
sich am Ende aber kaum durchsetzen.<br />
Zu wenig Geld in zweiter Säule<br />
Ein wichtiges Kriterium bei der Festlegung<br />
der Agrarpolitik ist stets die Mittelausstattung<br />
der beiden Säulen der GAP. Bei der<br />
ersten Säule geht es um Direktzahlungen<br />
an die Landwirte; sie werden bei Erfüllung<br />
der jeweiligen Voraussetzungen je Hektar<br />
landwirtschaftlicher Fläche gewährt.<br />
Für Deutschland waren das zuletzt 4,85<br />
Milliarden Euro, also fast 80 Prozent der<br />
Gesamtsumme, die hierzulande ausgeschüttet<br />
wird. Für die zweite Säule – sie<br />
umfasst gezielte Förderprogramme für die<br />
nachhaltige und umweltschonende Bewirtschaftung<br />
und die ländliche Entwicklung –<br />
bleibt der Rest.<br />
Eine schlichte Umschichtung der Gelder<br />
von Säule eins zu Säule zwei könnte einiges<br />
im Sinne der Ökologie bewirken. Doch<br />
auch in der kommenden Förderperiode<br />
bis 2027 dominiert das Budget der ersten<br />
Säule. Maria Noichl, landwirtschaftspolitische<br />
Sprecherin der Europa-SPD und für<br />
ihre Fraktion Verhandlungsführerin bei der<br />
Agrarreform, findet das allzu lange schon<br />
praktizierte Verfahren, Förderungen nur<br />
nach Größe der Fläche zu verteilen, abwegig:<br />
„Das wäre, als würde man die Höhe<br />
des Kindergeldes an der Fläche des Kinderzimmers<br />
bemessen.“<br />
Kurz bevor das EU-Parlament die Verhandlungen<br />
im Mai zeitweise demonstrativ aussetze,<br />
hatte auch ein Zusammenschluss<br />
von 25 deutschen Agrar-, Umwelt- und<br />
Tierschutzorganisationen seine Forderungen<br />
vorgelegt. Es müssten künftig<br />
„mindestens 70 Prozent der gesamten<br />
GAP-Mittel für freiwillige Maßnahmen im<br />
Bereich Umwelt-, Klima- und Tierschutz“<br />
verwendet werden, hieß es darin. Hierfür<br />
sei es notwendig, deutlich schneller als<br />
bislang geplant Gelder von der ersten zur<br />
zweiten Säule umzuschichten. Alle Mittel<br />
seien „zweckgebunden für nachhaltige<br />
Landwirtschaft, insbesondere Agrarumwelt-<br />
und Klimaschutzmaßnahmen, die<br />
Stärkung besonders tiergerechter<br />
37<br />
BESUCHEN SIE UNS BEIM<br />
BIOGAS-BRANCHENTREFF <strong>2021</strong><br />
23. SEPTEMBER <strong>2021</strong> | STAND 42 | RENDSBURG<br />
BIG-Mix 35 bis 313m³<br />
effektiver Vorschub bei niedrigem<br />
Eigenstromverbrauch<br />
für 100% Mist und Grassilage<br />
mit Misch- und Aufbereitungsbereich<br />
komplett aus Edelstahl<br />
Biomischer 12 bis 80m³<br />
für 100% Mist und Grassilage<br />
massive Edelstahlkonstruktion<br />
mit Misch- und Aufbereitungsbereich<br />
auf Wunsch komplett aus Edelstahl<br />
KOMBI-Mix 8 und 12m³<br />
speziell für Kleinbiogasanlagen<br />
optional mit Vertikalmischschnecke<br />
für unterschiedlichste Substrate<br />
komplett aus Edelstahl<br />
Konrad Pumpe GmbH<br />
Fon +49 2526 93290<br />
Mail info@pumpegmbh.de<br />
www.pumpegmbh.de
Politik<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Eine schlichte Umschichtung der Gelder von Säule eins zu Säule zwei könnte einiges im Sinne der Ökologie<br />
bewirken. Doch auch in der kommenden Förderperiode bis 2027 dominiert das Budget der ersten Säule.<br />
Haltung und des Tierwohls, Maßnahmen zum Schutz<br />
der Ressource Wasser sowie den ökologischen Landbau<br />
zu verwenden“, fordern die Verbände.<br />
Knapp 300 Euro je Hektar werden heute in Deutschland<br />
an Fördergeldern an die Landwirtschaft ausgeschüttet,<br />
ohne dass der Geldgeber dafür eine Leistung<br />
einfordert. Mit dem gleichen Geld, nur spezifischer verteilt,<br />
könnten jedoch wichtige<br />
Verbesserungen für die<br />
Umwelt – für Klima, Boden,<br />
Wasser und Artenvielfalt –<br />
angereizt werden.<br />
EU-Mitgliedsstaaten:<br />
rückwärts gerichtete<br />
agrarpolitische Haltung<br />
Doch die EU-Staaten sind,<br />
was die Sensibilität für das<br />
Thema betrifft, noch lange<br />
nicht so weit wie das Europäische<br />
Parlament – auch das<br />
wurde in den Verhandlungen<br />
der vergangenen Monate einmal<br />
mehr deutlich. Martin<br />
Häusling, agrarpolitischer<br />
Sprecher der Grünen im<br />
Parlament und Mitglied im<br />
Umweltausschuss, beklagt<br />
bei den Mitgliedsstaaten<br />
eine „rückwärts gerichtete,<br />
aus der Zeit gefallene und zu<br />
keinem Kompromiss fähige<br />
Haltung“. Den jüngsten Beschluss<br />
kommentierte er mit<br />
den Worten: „Schöne Überschriften,<br />
wenig Inhalt“.<br />
Die Einigung bleibe „weit hinter den Ankündigungen<br />
des Grünen Deals zurück, weniger Pestizide einzusetzen,<br />
Umwelt, Klima und Biodiversität zu schützen und<br />
ökologischen Landbau zu fördern“, so Häusling. Der<br />
Beschluss sei „nicht geeignet, die Klimawende einzuleiten“.<br />
Erst kurz zuvor hatte auch der Europäische<br />
Foto: Adobe Stock_adrian_ilie825<br />
ZUKUNFT? SICHER!<br />
Mit tragfähigen Flex-Konzepten sichern wir die<br />
Wirtschaftlichkeit Ihrer Bestandsanlage auch über<br />
die EEG-Förderung hinaus.<br />
Sprechen Sie<br />
uns an:<br />
T 02568 9347-0<br />
© PointImages | fotolia.de<br />
38<br />
2G Energy AG | www.2-g.de
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Politik<br />
Rechnungshof bemängelt, dass die europäischen Agrarsubventionen<br />
den Klimawandel weiter befeuerten.<br />
Häusling äußert auch Kritik am Auftreten des Europäischen<br />
Rates in den nächtlichen Verhandlungen. So,<br />
wie dieser sich aufgeführt habe, habe er persönlich<br />
nur den Eindruck gewinnen können, dass einige Länder<br />
auch nach zweieinhalb Jahren überhaupt keine<br />
Einigung gewollt hätten. Einige Länder, so Häusling,<br />
schienen „nach der Devise zu verfahren, weiter ihren<br />
Landwirten möglichst viel Geld zuschustern zu wollen,<br />
ohne dass sie irgendwelche nennenswerten Auflagen<br />
zu erfüllen hätten“. Agrarpolitik dürfe „nicht mehr länger<br />
als reine Einkommenssicherung“ betrachtet werden,<br />
sondern es müsse das Ziel sein, öffentliches Geld<br />
für öffentlich gewünschte Leistungen auszugeben.<br />
Völlig unverständlich sei auch die Rolle der deutschen<br />
Agrarministerin Julia Klöckner (CDU), die während der<br />
Verhandlungen überdies vorzeitig abgereist sei, sagt<br />
Häusling.<br />
Für die Sozialdemokraten zeigt sich Maria Noichl ebenfalls<br />
enttäuscht von dem Ergebnis: „Mit dieser Agrarreform<br />
sind die europäischen Klima- und Umweltziele<br />
nicht erreichbar.“ Die europäische Agrarpolitik könne<br />
mehr. Sie müsse dazu beitragen, dem Klimawandel<br />
und dem Verlust der Artenvielfalt entgegenzuwirken:<br />
„Alle sieben Jahre haben wir die Möglichkeit, über<br />
die Vergabe von fast 400 Milliarden Euro neu zu entscheiden.“<br />
Diese Option sei nicht hinreichend genutzt<br />
worden.<br />
Dass Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner,<br />
zusammen mit den anderen 26 EU-Mitgliedstaaten im<br />
Rat, geschlossen jeden großen Veränderungsschritt<br />
blockiert habe, sei „eine vertane Chance“, sagt Noichl.<br />
Der Kompromiss, wonach künftig immerhin ein Viertel<br />
der Flächenzahlungen für Umwelt- und Klimamaßnahmen<br />
bereitgestellt werden soll, gehe zwar in die<br />
richtige Richtung, werde aber durch eine Reihe an<br />
Ausnahmen für die EU-Staaten verwässert. Das mache<br />
es den Mitgliedstaaten für die gesamte Periode abermals<br />
möglich, nur wenige<br />
klimafreundliche Anreize<br />
zu setzen: „Aus grünen<br />
Geldern werden graue Gelder<br />
– diese Mogelpackung<br />
lehnen wir ab.“<br />
Nun liegt die Verantwortung<br />
bei den Mitgliedsländern.<br />
Diese müssten jetzt<br />
ihre nationalen Pläne so<br />
auslegen, dass sie den Klima-<br />
und Biodiversitätszielen<br />
der EU gerecht werden,<br />
fordert auch die Umweltorganisation Germanwatch.<br />
Die Staaten hätten „bereits versprochen, 40 Prozent<br />
der Agrarausgaben am Klimaschutz auszurichten. Jetzt<br />
müssen sie auch liefern!“, so deren Referent Reichert.<br />
Trotz der schwachen Vorgaben aus Brüssel gebe es jedoch<br />
Spielräume, die nun genutzt werden müssen –<br />
insbesondere auch in Deutschland.<br />
Autor<br />
Bernward Janzing<br />
Freier Journalist<br />
Wilhelmstr. 24a · 79098 Freiburg<br />
07 61/202 23 53<br />
bernward.janzing@t-online.de<br />
„Mit dieser Agrarreform<br />
sind die europäischen<br />
Klima- und Umweltziele<br />
nicht erreichbar“<br />
Maria Noichl<br />
RondoDry<br />
Rotationstrockner zur<br />
Verdunstung von Flüssigkeiten.<br />
Modular | Effizient | Leistungsstark<br />
• Bis zu 4.000 m 3 Massenreduzierung<br />
• Stromkostenneutral durch eingesparte<br />
Notkühlerlaufzeiten<br />
• Bis zu 80 % Abscheidung des org. NH4-N und<br />
daraus Herstellung von mineralischer ASL<br />
Infos unter +49 8631 307-0<br />
39
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Bodenfruchtbarkeit<br />
verbessern<br />
Live dabei beim „Bodenkurs im Grünen“ mit Dietmar Näser und Friedrich Wenz! Auf einem<br />
Betrieb am Lechrain lernen 23 Landwirte die Prinzipien der Regenerativen Landwirtschaft:<br />
Untersaaten, Zwischenfruchtanbau, die Aufbereitung von Wirtschaftsdünger, flache und<br />
tiefe Bodenbearbeitung sowie den Umgang mit Fermenten und Komposttee.<br />
Von Christian Dany<br />
Die Fruchtfolge verbessern und von Chemie<br />
wegkommen.“ „Den Betrieb unabhängiger<br />
machen.“ „Die Unkräuter richtig lesen können.“<br />
„Den Grundstein legen, um wieder auf<br />
Vollerwerb umzustellen.“ So unterschiedlich<br />
wie ihre Motive sind, ist auch die Zusammensetzung<br />
der Teilnehmer des „Bodenkurs im Grünen“ für<br />
Bayern: Aus ganz Südbayern und Baden-Württemberg<br />
sind an diesem Juni-Freitag 21 Landwirte und zwei<br />
Landwirtinnen nach Epfenhausen bei Landsberg am<br />
40
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
praxis / Titel<br />
Lech gereist. Aus Neben- und Vollerwerbs- und aus<br />
spezialisierten Betrieben für Kartoffeln und Legehennen.<br />
Ökologische und konventionelle Betriebe sind darunter<br />
und auch drei Biogaserzeuger. Wie jedes Jahr<br />
lehren Dietmar Näser und Friedrich Wenz (Porträt auf<br />
Seite 42, Interview auf Seite 44) auf Betrieben früherer<br />
Kursteilnehmer. Die beiden gelten als die großen<br />
Lehrmeister der regenerativen Landwirtschaft – eines<br />
Anbausystems, das sich in letzter Zeit stark verbreitet.<br />
In Epfenhausen sehen sich die 23 Teilnehmer zum<br />
ersten Mal persönlich zum Praxisteil – dem dritten Modul<br />
des umfassenden Bodenkurses. Die ersten beiden<br />
Module mit den „Grundlagen fruchtbarer, lebender Böden“<br />
und der Theorie zu Flächenrotte, Fermenten und<br />
Komposttee fanden online mit Videoschaltungen statt.<br />
Auch den Vor-Ort-Termin hat das Corona-Regime noch<br />
im Griff: Zuerst müssen alle einen Corona-Schnelltest<br />
machen und sich dann auf mitgebrachten Stühlen in<br />
sicheren Abständen niederlassen. Peter Thoma hat<br />
hierfür seine Maschinenhalle freigeräumt. Der Biobauer<br />
und Schweinemäster war vor drei Jahren auf dem<br />
Bodenkurs und setzt seitdem fleißig die gelernten Maßnahmen<br />
um.<br />
„Die Böden sollten im Sommer und<br />
Winter durch Zwischenfruchtanbau<br />
bewachsen gehalten werden, um das<br />
mikrobielle Bodenleben zu erhalten“<br />
Friedrich Wenz<br />
Fotos: Christian Dany<br />
Dietmar Näser begutachtet<br />
die entnommenen Bodenproben<br />
und bewertet sie.<br />
Der Vorstellungs- schließt sich eine Fragerunde zur<br />
bisher vermittelten Theorie an. Die meisten Fragen<br />
kommen zu Zwischenfrüchten, zur Flächenrotte und<br />
organischen Düngung: „Die Böden sollten im Sommer<br />
und Winter durch Zwischenfruchtanbau bewachsen<br />
gehalten werden, um das mikrobielle Bodenleben zu<br />
erhalten“, sagt Wenz, „so lassen sich Kohlenstoff- und<br />
Nährstoffverluste durch biogene Einbindung weitgehend<br />
vermeiden. Es stellt sich ein ausgewogeneres Verhältnis<br />
von Bakterien und Pilzen ein, um Huminstoffe<br />
erzeugen und alle Bodenfunktionen nutzen zu können.<br />
Junge Pflanzen bringen die meisten Wurzelausscheidungen.<br />
Diese füttern die Bodenbiologie am besten.“<br />
Sofern nicht mit Untersaaten gearbeitet werde, keine<br />
Unterbodenlockerung nötig und die entsprechende<br />
Technik vorhanden sei, plädieren Näser und Wenz für<br />
die Direktsaat in die Stoppel. „Sind bis zur Schälung<br />
im Herbst weniger als sechs Wochen Wachstumszeit<br />
nutzbar, kann eine artenreiche Untersaat als Quasi-<br />
Zwischenfrucht stehenbleiben“, erläutert Wenz. Für<br />
die Zwischenfruchtgemenge empfiehlt er eine möglichst<br />
große Vielfalt, mindestens aus den drei Pflanzenfamilien<br />
Gräser, Leguminosen und Kreuzblütler.<br />
Wintergrüne Gemenge könnten auch nach später Ernte<br />
im September und Oktober noch angebaut werden: „Im<br />
Winter bewachsene Felder halten die Nährstoffe, speichern<br />
Wasser und sind zur Düngung im Frühjahr besser<br />
befahrbar.“<br />
Flächenrotte mit Fermenten<br />
„Zur Einleitung der Flächenrotte müssen wir technisch<br />
relativ flach arbeiten, etwa 3 bis 5 Zentimeter flach abschälen“,<br />
erklärt Wenz, „wir brauchen lebendes, grünes<br />
Pflanzenmaterial. Das liefert die Energie für den Rotteprozess.“<br />
Das Ziel sei eine feinkrümelige Erde. Je<br />
41
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
„Kleiner“ Wessi, „großer“ Ossi<br />
Mittlerweile sind Friedrich Wenz und Dietmar Näser<br />
ein gut eingespieltes Duo als Bodenkunde-Lehrer<br />
und Verfechter der Regenerativen Landwirtschaft.<br />
Dabei könnten die beiden gegensätzlicher kaum sein:<br />
Hier Wenz, der Kleinbauer aus der Oberrhein-Ebene,<br />
dort Näser, der frühere Leiter eines ostdeutschen<br />
2.000-ha-Betriebs; hier der Biobauer, dort der Agrarchemiker.<br />
Wenz‘ eigener Betrieb ist sowohl<br />
Bioland als auch Demeter zertifiziert. Sein<br />
Vater war einer der Gründer des Bioland-<br />
Verbandes. Der Nebenerwerbsbetrieb dient<br />
heute viel für Versuche. Vier Jahre lang war<br />
Wenz in Südamerika, wo er sich mit Windund<br />
Wassererosion sowie Bodenversalzung<br />
beschäftigte. Dort erfuhr er von den Boden<br />
belebenden Maßnahmen des Australiers<br />
Alex Podolinsky, die sein Leben vorzeichnen<br />
sollten.<br />
Näser hat in der ehemaligen DDR eine Ausbildung<br />
zum Diplomingenieur für Agrochemie<br />
und Pflanzenschutz gemacht. Jeweils<br />
acht Jahre arbeitete er als Agraringenieur<br />
in einer LPG und dann als Berater im Landwirtschaftsamt.<br />
Vor 20 Jahren machte er<br />
sich als freier Berater selbstständig, wobei<br />
er sich als Trainer und Systementwickler in<br />
der Regenerativen Landwirtschaft versteht.<br />
Seine Schwerpunkte sind Bodenfruchtbarkeit<br />
sowie die Ursachen von Pflanzenkrankheiten<br />
und Unkrautauftreten. Letztes Jahr<br />
hat er das Lehrbuch „Regenerative Landwirtschaft“<br />
veröffentlicht.<br />
Friedrich Wenz (links) und Dietmar Näser mit Leindotter<br />
und Ackerhellerkraut in den Händen.<br />
Wenz und Näser besuchten gegenseitig ihre Vorträge.<br />
Als Näser dann mal bei Wenz wegen einer<br />
Direktsaatmaschine vorbeischaute, lernten sie sich<br />
kennen. „Mir war klar, dass ich nicht alles abdecken<br />
kann“, sagt Wenz, „ich bin Techniker. Zu Fermenten,<br />
Komposttee und allgemein zur Bodenfruchtbarkeit<br />
kann ich alle Fragen beantworten“, meint der Südbadener.<br />
Näser bleibe auch keine Antwort zu Tiefgründigem<br />
in der Bodenchemie schuldig. So bahnte sich<br />
die Zusammenarbeit an. Seit 2012 geben die beiden<br />
gemeinsam Kurse. Das umfassende Paket mit drei<br />
Modulen heißt seit 2016 „Bodenkurs im Grünen“. Inzwischen<br />
seien laut Wenz 1.200 Landwirte ausgebildet<br />
worden. Zu ihren wissenschaftlichen Vorbildern<br />
zählen die zwei den US-Amerikaner John<br />
Kempf mit seiner „Pyramide der Pflanzengesundheit“<br />
und die Bodenbiologin<br />
Dr. Christine Jones. Wie die Australierin<br />
plädieren sie für Humusaufbau nur mit<br />
Verbesserung des Bodenlebens.<br />
Näser und Wenz sind Teil eines großen<br />
Netzwerks aus Wissenschaftlern, Landtechnik-<br />
und Ferment-Herstellern, Landwirten<br />
und sonstigen Gleichgesinnten,<br />
wobei intensive Kontakte nach Österreich<br />
und in die Schweiz gepflegt werden. Die<br />
beiden haben das gemeinwohlorientierte<br />
Unternehmen Positerra mitgegründet, das<br />
zur CO 2<br />
-Kompensation „Humusprämien“<br />
an Landwirte auszahlt. „Gewinne werden<br />
in Forschung und Ausbildung für Landwirte<br />
reinvestiert. Das war für mich der Impuls,<br />
mich hier zu engagieren“, sagt Näser. Außerdem<br />
gehören die zwei zum Team der in<br />
der Schweiz basierten Bildungsplattform<br />
regenerativ.eu.<br />
Friedrich Wenz: www.humusfarming.de<br />
Dietmar Näser: www.gruenebruecke.de<br />
Text: Christian Dany<br />
größer die Kationen-Austauschkapazität (KAK), desto<br />
mehr Pflanzenmaterial könne eingearbeitet werden.<br />
Leichte Böden hätten eine niedrige KAK, also weniger<br />
Puffer. Hier sei eine größere Arbeitstiefe zu empfehlen.<br />
Das Pflanzenmaterial müsse reduziert oder nötigenfalls<br />
abgefahren werden. „Sonst verschluckt sich der Boden,<br />
das heißt, er kann die Nährstoffe nicht alle einbinden“.<br />
Die beiden „Regenerativ-Lehrer“ empfehlen, möglichst<br />
gleich beim Abschälen – und auch beim Tiefenlockern<br />
– ein Ferment auszubringen, um durch eine<br />
Milieusteuerung die Bodenbiologie zu fördern, Zeit zu<br />
sparen und damit Sicherheit zu gewinnen. „Der Boden<br />
braucht Zeit, um das Grünmaterial zu verstoffwechseln.<br />
Wird der Aufwuchs abgefahren, gibt es nicht viel<br />
Material zu ‚verdauen‘. Dann kann bereits am nächsten<br />
Tag gesät werden. Wird viel Grünmaterial eingearbeitet<br />
und damit der Boden ‚gefüttert‘, braucht es etwa sieben<br />
bis zehn Tage, bis das Material abgebaut ist und<br />
keine Gefahr von Keimhemmungen oder Wachstumsdepressionen<br />
mehr besteht“, sagt Wenz.<br />
Das Ferment solle organische Masse, bevor sie unkontrolliert<br />
abgebaut werde und durch Ausgasungen<br />
und Mineralisierung Inhaltsstoffe verlorengehen, auf<br />
der Fläche fermentieren; also die Flächenrotte so gestalten,<br />
dass sie zum Humusaufbau beitrage und den<br />
Kohlenstoff fixiere. Zur Flächenrotte sollten 100 Liter<br />
Ferment pro Hektar verwendet werden.<br />
In Flaschen haben die Teilnehmer eigene Fermente mitgebracht<br />
und auf einer Bank nacheinander aufgestellt.<br />
Zum Teil ist das reine Handelsware, zum Teil sind es wie<br />
im zweiten Modul gelernt selbst angesetzte Fermente<br />
mit Pflanzenmaterial. In einem Durchgang inspiziert<br />
Wenz die Proben: „Da hat jemand Erde mit rein gekriegt.<br />
Es riecht faulig“, sagt er. „Fermente haben extrem<br />
starke reduktive Eigenschaften. Der pH-Wert muss<br />
unter 3,8 liegen. Krankheitserreger können sich in dem<br />
Milieu nicht halten und Fäulnis wird unterdrückt oder<br />
sogar umgekehrt“, erklärt der Südbadener. Er verweist<br />
auf Prof. Monika Krüger von der Uni Leipzig, bei deren<br />
Versuch Milzbranderreger in einem fermentativ reduktiven<br />
Milieu nicht überleben konnten.<br />
Die Fermente enthalten die sogenannten „effektiven<br />
Mikroorganismen“. Das seien Wenz zufolge im Wesentlichen<br />
Milchsäurebakterien, Hefepilze und Foto-<br />
42
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
praxis / Titel<br />
„Fermente haben extrem starke<br />
reduktive Eigenschaften“<br />
Friedrich Wenz<br />
synthesebakterien. Der Anwender könne die Fermente<br />
entweder fertig anwendbar kaufen oder er beziehe sogenannte<br />
Starterpakete und führe die rund drei Wochen<br />
dauernde Fermentation selbst durch. Das habe den<br />
Vorteil, dass sekundäre Pflanzenstoffe in die Fermente<br />
eingebracht werden könnten.<br />
„Werden zum Beispiel Ampfer-Blätter mit fermentiert,<br />
geht der Wachstumsimpuls für Ampfer zurück. Aber<br />
es darf nicht vernachlässigt werden, die Ursache für<br />
den Ampfer zu bekämpfen.“ Der Landwirt könne sich<br />
hier etwas von der Naturheilkunde abschauen. So helfe<br />
etwa Beinwell gegen Strukturschäden, Baldrian fördere<br />
die Blüte und Wolfsmilchgewächse mobilisierten Bor.<br />
Es sollten immer Mischungen gemacht werden. Eine<br />
Pflanze dürfe nie mehr als 50 % ausmachen. Die Fermente<br />
könnten bis zu einem Jahr lang lagern.<br />
Kali-Anreicherung durch Gärrest<br />
Ein Biogaserzeuger fragt, wie und wann er seinen Gärdünger<br />
aufbereiten soll. Näser und Wenz sehen sowohl<br />
Gülle als auch Gärrest problematisch fürs Bodenleben<br />
aufgrund der Fäulnisbildung<br />
durch hohe Eiweißgehalte und<br />
den Luftabschluss. „Das gilt besonders,<br />
wenn Fäulnisgülle direkt<br />
in den Boden injiziert wird“, erläutert<br />
Wenz, „die Gülle kann dann nicht<br />
durch Sonneneinstrahlung und Sauerstoffeinfluss<br />
entschärft werden. Unsere<br />
Empfehlung ist hier, lieber kleine und<br />
mehrere Gaben.“<br />
Bei Biogasbetrieben käme eine schleichende<br />
Anreicherung von Kalium hinzu,<br />
weil Kali im Gärdünger besser verfügbar<br />
sei und besser wirke. Das führe zu einer<br />
Verschlechterung der Bodenstruktur.<br />
Der Boden werde erosionsanfälliger.<br />
„Deshalb ist hier die Albrecht/Kinsey-<br />
Bodenanalyse-Methode so wichtig: Man<br />
sieht es und kann gegensteuern.“<br />
Gülle und Gärdünger sollten mit Ferment, Pflanzenkohle<br />
und Gesteinsmehl aufbereitet werden. Die Güllebelebung<br />
brauche mindestens drei Wochen. „Es sollte also<br />
nicht erst angefangen werden, wenn die Grube schon<br />
fast voll ist“, erklärt Näser, der oft Side-Kicks zu Wenz‘<br />
Erklärungen gibt: „Die Belebung bewirkt eine komplette<br />
Milieuänderung: Aufbereitete Gülle ätzt nicht. Sie<br />
Dietmar Näser mit<br />
Bodenprobe auf einem<br />
Klapptisch im Feld<br />
und einer Bodensonde<br />
zur Bestimmung der<br />
Lagerungsdichte des<br />
Bodens.<br />
KRAMER ÜBERZEUGT<br />
AUF GANZER LINIE.<br />
JETZT<br />
ANGEBOT<br />
ANFORDERN!<br />
Die Kramer Rad- und Teleskopradlader<br />
KL60.8/KL70.8/KL55.8T<br />
Eindrucksvolle Leistungsdaten, technische Innovation und<br />
hochwertige Qualität machen das Kramer Produktportfolio<br />
zu etwas Einzigartigem. Überzeugen Sie sich selbst!<br />
Kontaktieren Sie Ihren Händler: www.kramer.de/haendlersuche<br />
43
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Mit dem Salzsäure-Test weist Dietmar Näser nach,<br />
ob es dem Boden an Kalk mangelt oder nicht.<br />
„Disteln saugen Nitrat<br />
aus dem Boden raus.<br />
Ich krieg sie über ihren<br />
Pilotcharakter. Durch die<br />
Vitalisierung nimmt die<br />
Distel zu viele Nährstoffe<br />
aus dem Boden auf. Sie<br />
verkümmert. Wir haben<br />
dann eine Mischkultur<br />
mit Unkraut, das den<br />
Kulturerfolg aber nicht<br />
stört. Die Distel mag keine<br />
Bodengare“, erläuterte<br />
Dietmar Näser.<br />
Interview zu regenerativer Landwirtschaft,<br />
Biogas und Bodenleben<br />
Am Rande des Bodenkurses haben sich Dietmar Näser und Friedrich Wenz kurz Zeit genommen, um über<br />
ihr Verständnis von regenerativer Landwirtschaft und über die Biogaserzeugung Stellung zu beziehen.<br />
Biogas Journal: Herr Näser, Herr Wenz, Sie verstehen<br />
als regenerative Landwirtschaft Maßnahmen, um den<br />
Humusgehalt anzuheben und eine funktionierende<br />
Bodenbiologie wiederherzustellen. Die Maßnahmen<br />
teilen Sie in sechs Gruppen ein. Können Sie für uns<br />
diese Gruppen kurz zusammenfassen?<br />
Friedrich Wenz: Erstens muss ich mir einen Überblick<br />
über die chemischen Zustände und Nährstoffverhältnisse<br />
im Boden verschaffen. Anhand einer umfassenden<br />
Bodenuntersuchung nach dem Albrecht-System<br />
sollen die Nährstoffe ins Gleichgewicht gebracht werden.<br />
Als Zweites müssen wir uns um den Unterboden<br />
kümmern, weil wir hier oft Verdichtung haben. Unterbodenlockerung<br />
ist wie ein Einatmungseffekt des<br />
Bodens. Hinter dem Lockerungszinken sprühen wir<br />
milchsaure Fermente ein. Damit können wir das Milieu<br />
im Boden positiv beeinflussen. Drittens brauchen wir<br />
eine ganzjährige Bodenbedeckung durch Untersaaten<br />
und Zwischenfrüchte. Nur lebende Pflanzen können<br />
die Bodenbiologie mit Energie versorgen. Viertens<br />
sollen die Gründüngungen flachgründig eingearbeitet<br />
werden ohne Rückverfestigung, in Flächenrotte<br />
gebracht und die Rotte fermentativ gelenkt werden.<br />
Fünftens müssen die Wirtschaftsdünger belebt<br />
werden und Punkt 6 ist, die Kulturen durch Stress<br />
vermeidende, vitalisierende Behandlungen zur maximalen<br />
Fotosyntheseleistung zu bringen.<br />
Biogas Journal: Sie haben vorher erwähnt, dass das<br />
Ausbringen von Biogas-Gärrest zu schleichender<br />
Kalium-Anreicherung führt. Ist das in der Fachwelt<br />
bekannt oder ist es eine Einzelthese von Näser und<br />
Wenz?<br />
Dietmar Näser: Aufgrund seines Nährstoffgehalts<br />
ist Gärrest natürlich ein Dünger. Meistens wird aber<br />
nur der Stickstoffgehalt beachtet. Der Kaligehalt<br />
bleibt unbeachtet. In der Bodenuntersuchung sieht<br />
man es dann. Der Kaligehalt drückt den pH fast um<br />
das Doppelte nach oben im Vergleich zu Kalk. Das ist<br />
schon lange belegt. Wenn ich mich nur nach dem pH-<br />
Wert richte, könnte ich mich in falscher Sicherheit<br />
wiegen. Ich laufe damit in die Gefahr von Mikronährstoff-Verdrängung<br />
und von Versalzung. Die Düngung<br />
wird immer ineffizienter.<br />
Wenz: Das ist ein schleichender Prozess und die Erosionsgefahr<br />
steigt zusätzlich.<br />
Näser: Und das nicht linear, sondern exponentiell.<br />
Dass es regnet, können wir nicht ändern. Ändern<br />
können wir aber den Umgang mit dem Boden und<br />
dem organischen Dünger.<br />
Biogas Journal: Was können Sie den Biogaserzeugern<br />
sonst noch Positives mitgeben?<br />
Näser: Dass es sinnvoll wäre, wenn sie mehr Kulturen<br />
als Mais hätten. Der Trend geht ja da hin.<br />
Zum Beispiel könnten Getreide, Getreide-Leguminosen<br />
oder GPS-Gemenge mit Gras-Untersaaten<br />
im Wechsel zu Mais angebaut werden. Der Gärrest<br />
sollte aufbereitet und es sollte mit Untersaaten<br />
und wintergrünen Zwischenfrüchten gearbeitet<br />
werden, damit ausreichend Wurzelmasse im Boden<br />
bleibt. Auch die Mikroben im Fermenter leiden<br />
unter Salzstress durch den zerlegten Mais. Wenn<br />
ich beim Füttern eine Substanz einbringe, die Salz<br />
gut bindet, kann ich den Gasertrag steigern. Das<br />
schaff ich mit Pflanzenkohle. Bei Tierhaltungsbetrieben<br />
ist die Pflanzenkohle auch schon zur Fütterung<br />
interessant. Weil Durchfall abnimmt, kann bei<br />
Geflügel und Schweinen damit die Futtereffizienz<br />
gesteigert werden.<br />
Biogas Journal: Herr Näser, Herr Wenz, vielen Dank<br />
für die Beantwortung der Fragen und noch eine schöne<br />
Zeit am Lechrain!<br />
Interviewer Christian Dany<br />
44
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
praxis / Titel<br />
kann in den wachsenden Pflanzenbestand<br />
ausgebracht werden, verringert durch Ammoniakausgasung<br />
und Auswaschung verursachte<br />
Stickstoffverluste und sie fördert<br />
ein stabiles positives Mikrobenmilieu im<br />
Boden.“ Als nicht so hochwertige „Just-intime“-Lösung<br />
könne Inwa-Quarz eingerührt<br />
werden, ergänzt Wenz.<br />
Noch vor der ersten Mittagspause beginnt er<br />
mit dem Aufbau einer kleinen Demo-Komposttee-Maschine:<br />
Sie nutzt den Vortex-Effekt,<br />
bei dem das Wasser in einen Kreiswirbel<br />
versetzt wird. Die Komposttee-Mischung<br />
braucht fünf Zutaten: Zuckerrohr-Melasse,<br />
Malzkeimdünger mit Mykorrhiza-Pilzen, Gesteinsmehl,<br />
eine „Bioaktiv“-Mischung mit<br />
Pflanzenspurenelementen zur Wirkungsverstärkung<br />
und natürlich den Kompost.<br />
Während ein Heizstab die Temperatur auf<br />
25 Grad Celsius hält, sorgt eine Umwälzpumpe<br />
für die Belüftung des Behälters. Im Gegensatz<br />
zur anaeroben Fermentation läuft die Komposttee-Herstellung<br />
also aerob ab. Die Maschine sollte mindestens<br />
24 Stunden laufen. Nach der Herstellung muss der<br />
Komposttee zügig, innerhalb höchstens vier Stunden,<br />
ausgebracht werden.<br />
Tee statt Gift<br />
„Wir haben es beim biologisch aktiven Boden mit einem<br />
selbstregulierenden System zu tun“, erläutert<br />
Näser, „ich muss die Selbstregulierung anreizen.“ Das<br />
gelinge durch vitalisierende Blattspritzungen mit Komposttee,<br />
was der Pflanze einen Impuls gebe, um<br />
Friedrich Wenz setzt in<br />
einer kleinen Apparatur<br />
Komposttee an.<br />
Strom vermarkten mit E.ON<br />
Saubere Erzeugung,<br />
sichere Rendite<br />
Vermarkten Sie jetzt einfach und sicher<br />
den Strom aus Ihrer EEG-Anlage. Ganz<br />
gleich ob Sie eine Anlage mit oder ohne<br />
Förderung im Neubau oder Bestand haben:<br />
Wir machen Ihnen ein individuelles Angebot<br />
– auch für eine KWK-Anlage.<br />
Übrigens: Mit unseren Regionalstromangeboten<br />
bleibt der Strom in der Region,<br />
in der er auch erzeugt wird.<br />
www.eon.de/<br />
eeg-direktvermarktung<br />
45
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Zum Abschluss des ersten Tags holen die<br />
Teilnehmer ihre in Gläsern mitgebrachten<br />
Bodenproben heraus, füllen sie mit Wasser<br />
auf, schütteln sie in vorgegebener Weise und<br />
lassen sie dann stehen. „Je trüber, desto<br />
mehr nicht in die Bodenaggregate eingebundene<br />
Tonmineralien enthält die Probe. Das<br />
bedeutet, der Boden ist auswaschungsgefährdet“,<br />
erklärte Friedrich Wenz.<br />
Die Kursteilnehmer haben von ihren Betrieben<br />
Proben von selbst hergestellten Fermenten mitgebracht,<br />
die im Kurs bewertet worden sind.<br />
Friedrich Wenz demonstriert die Herstellung eines Feststoff-Ferments aus Ernteresten in der<br />
Betonmischmaschine. Hierzu haben die Teilnehmer Ausputzgetreide und andere Reststoffe<br />
mitgebracht.<br />
die Photosynthese-Leistung anzukurbeln. Dies könne<br />
bereits einige Stunden nach der Behandlung mittels<br />
Zuckermessung im Blattsaft nachgewiesen werden.<br />
Die Pflanze werde vitaler und das Immunsystem gestärkt,<br />
was der Abwehr von Schadpilzen und Schädlingen<br />
zugutekomme. Die höhere Assimilationsleistung<br />
führe zu mehr Wurzelausscheidungen, wovon die Bodenbiologie<br />
profitiere. „Mit dem Komposttee haben die<br />
Bauern ein Betriebsmittel an der Hand, das sie selbst<br />
herstellen und auf das sie für wenige Cent pro Hektar<br />
zurückgreifen können“, sagt Wenz.<br />
Nachmittags geht’s dann auf Besichtigungstour auf die<br />
Felder von Peter Thoma. Auf dem ersten Feld schildert<br />
der Biobauer sein Problem mit „Distelnestern“. Trotzdem<br />
wagte er sich an die Saat von Ackerbohnen mit<br />
Hafer-Untersaat: „Nach der Flächenrotte mit Fräse und<br />
Fermenten hab ich Ende März ausgesät. Dann folgte<br />
eine lange Kälte- und Regenperiode. Letzte Woche hab<br />
ich dann Komposttee zur Vitalisierung gespritzt.“<br />
Näser und Wenz sind gleich mit Spaten und Bodensonde<br />
zugange und bauen einen Klapptisch auf, auf<br />
dem die Boden- und Pflanzenproben platziert werden.<br />
Unter den widrigen Umständen sehe der Bestand ganz<br />
gut aus, doch Näser entdeckt „Schokoflecken“ auf den<br />
Bohnenblättern – eine Bakteriose. Acker-Kratzdisteln<br />
und Schokoflecken legten den Verdacht der Bodenverdichtung<br />
nahe. Dafür spreche auch die Wurzelbildung<br />
entlang des Säschlitzes.<br />
„Disteln drücken sich durch jeden Beton. Sie saugen<br />
Nitrat aus dem Boden raus“, klärt der Ackerbau-Experte<br />
auf, „ich krieg sie über ihren Pilotcharakter: Durch<br />
46
A LL E S. LÄ U FT.<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
praxis / Titel<br />
Peter Thoma hat eine 5.000-Liter-Komposttee-<br />
Maschine angeschafft.<br />
die Vitalisierung nimmt die Distel zu viele<br />
Nährstoffe aus dem Boden auf. Sie verkümmert.<br />
Wir haben dann eine Mischkultur mit<br />
Unkraut, das den Kulturerfolg aber nicht<br />
stört. Die Distel mag keine Bodengare:<br />
Deshalb sind Flächenrotte, Untersaat und<br />
Vitalisierung die richtigen Maßnahmen.“<br />
Mit dem Salzsäure-Test weist er nach, dass<br />
es dem Boden an Kalk mangelt. Der Sachse<br />
rät, die Boden- und Bestandsansprache<br />
immer schriftlich zu dokumentieren und zu<br />
fotografieren.<br />
Maßnahmenkontrolle<br />
Als die Autos zur zweiten Feld-Station fahren,<br />
beginnt es zu regnen. Hier hat Thoma<br />
Erbsen mit Hafer-Untersaat angebaut. Vorfrucht<br />
war Roggen. Einmal pro Jahr lockert<br />
er den Boden 25 cm tief mit seinem Tiefengrubber.<br />
Letzte Woche habe er auch hier<br />
eine Vitalisierungsspritzung verabreicht.<br />
Diesmal wird vor allem die Begleitflora<br />
inspiziert. Näser: „Es sind Leindotter und<br />
Acker-Hellerkraut drin. Kreuzblütler passen<br />
zur Erbse. Ich krieg keine Schwierigkeiten<br />
mit Schadinsekten.“<br />
Auf dem dritten Schlag steht Wintertriticale<br />
mit einer Untersaat-Mischung. Auch<br />
hier ist hoher Disteldruck. Der Anbauberater<br />
des Verbands habe ihm geraten, höchstens<br />
Kleegras anzubauen. „Die Vorwinterentwicklung<br />
war dürftig“, sagt Thoma. Im<br />
Frühjahr folgten eine 15 m³ Güllegabe und<br />
eine Vitalisierungsspritzung mit Komposttee,<br />
Kalk, Bor und Zeolith. Jetzt schaut der<br />
Bestand ganz gut aus. „Ein hoher Siliziumgehalt<br />
macht die Pflanze widerstandsfähig<br />
gegenüber Krankheitserregern. Silizium<br />
sollte deshalb bei der Vitalisierung dabei<br />
sein – mit einer Zeolith-Gabe“, so Näser.<br />
Er zeigt einen einfachen Kniff: In einem<br />
schnell mit dem Meterstab gefalteten<br />
Rechteck zählt er 130 Ähren pro Viertelquadratmeter.<br />
„Sauber. Es ist auch kein<br />
für schwächliche Triticale typischer Gelbrost<br />
zu erkennen.“ „Glückwunsch, super<br />
gemacht“, ergänzt Wenz.<br />
Später bekommt Thoma noch Lob für seine<br />
auf die regenerative Landwirtschaft ausgerichtete<br />
Betriebsausstattung: Sowohl der<br />
Unterboden-Lockerer als auch der große<br />
Flachgrubber wurden mit einem<br />
OPTIMAL<br />
Betrieb Thoma: Raum zur Fermentation mit Stromanschlüssen,<br />
um darin bis zu zehn IBC-Container beheizen zu können.<br />
HOCHLEISTUNGS-<br />
SCHMIERSTOFFE<br />
made in Germany<br />
47 www.addinol.de
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Mit der Presse wird Blattsaft in das Refraktometer<br />
geträufelt. Das Refraktometer dient zur Messung des<br />
Blattsaft- (Brix-)wertes.<br />
Pflanzenmaterial wird gemörsert und so für<br />
die Brixwertmessung vorbereitet.<br />
Dietmar Näser schaut in das Refraktometer<br />
und ermittelt so den Brixwert.<br />
Leitungssystem zum Ausbringen der Fermente direkt<br />
hinter die Schare versehen. Außerdem hat Thoma eine<br />
5.000-Liter-Komposttee-Maschine angeschafft und<br />
einen Raum zur Fermentation eingerichtet mit Stromanschlüssen,<br />
um darin bis zu zehn IBC-Container<br />
beheizen zu können. Zwar betont der Oberbayer den<br />
Arbeitsaufwand, doch glaubt er, dass sich bald alles<br />
ohne großen Mehraufwand im Arbeitsalltag einspielen<br />
werde. Für eine Gesamtbewertung des Systems Regenerative<br />
Landwirtschaft sei es bei ihm noch zu früh.<br />
Zum Abschluss des ersten Tags holen die Teilnehmer<br />
ihre in Gläsern mitgebrachten Bodenproben heraus,<br />
füllen sie mit Wasser auf, schütteln sie in vorgegebener<br />
Weise und lassen sie dann stehen. Am nächsten<br />
Morgen steht wieder Theorie auf dem Programm. Kurz<br />
vor Mittag macht sich Näser auf, um mit einer Sprühflasche<br />
Komposttee auf eine 20 Quadratmeter große<br />
Fläche auszusprühen.<br />
Nachmittags demonstriert Wenz die Herstellung eines<br />
Feststoff-Ferments aus Ernteresten in der Betonmischmaschine.<br />
Hierzu haben die Teilnehmer Ausputzgetreide<br />
und andere Reststoffe mitgebracht. „Jedes organische<br />
Material außer Holz, das noch nicht in einem<br />
Fäulnis- oder Verpilzungsprozess ist, kann fermentiert<br />
werden. Durch die Fermentation werden organische<br />
Säuren gebildet und fäulnisgefährdete Eiweißverbindungen<br />
stabilisiert“, erläutert er.<br />
Das Material werde auf etwa 40 Prozent Feuchte gebracht.<br />
Als zusätzliche Energiequelle, falls nötig, eigne<br />
sich entweder ein Masseprozent Getreideschrot oder<br />
48
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
praxis / Titel<br />
Zuckerrohrmelasse in gleicher Menge wie<br />
das Ferment (3 Liter/m³). Das fertige Produkt<br />
müsse luftdicht abgedeckt werden. Es<br />
sei die ideale Grundlage für eine schnelle<br />
Humusbildung.<br />
Brix-, pH- und COND-Wert<br />
Dann geht es an die Überprüfung der Wirksamkeit<br />
der Komposttee-Flaschenspritzung.<br />
Hierzu geht Näser nochmal aufs Feld<br />
und holt besprühte und nicht behandelte<br />
Blätter aus dem Ackerbohnen-Feld. Dann<br />
packt er seinen „Bodenkoffer“ auf dem<br />
Tisch aus. Darin sind das Refraktometer zur<br />
Messung des Blattsaft- (Brix-)wertes, Schere,<br />
Presse, Mörser und Messgeräte für den<br />
pH-Wert und die elektrische Leitfähigkeit<br />
(COND-Wert). Einige Kursteilnehmer übernehmen<br />
die Vorbereitung: Sie zerschneiden<br />
die Blätter von Bohnen und Disteln und<br />
zerstampfen sie im Mörser. Mit der Presse<br />
wird Blattsaft in das Refraktometer und die<br />
Messgeräte geträufelt. Zum Vergleich werden<br />
Limonade und Heutee gemessen.<br />
„In Gegenden ohne Agrarförderung, zum<br />
Beispiel Australien, ist das Refraktometer<br />
ein alltägliches Werkzeug“, sagt Näser.<br />
Hier müsse der Kulturerfolg ständig überwacht<br />
werden, weil sich der Landwirt keinen<br />
Totalausfall leisten könne. Auch Imker<br />
würden das Refraktometer zur Bestimmung<br />
des Wasseranteils im Honig einsetzen.<br />
Grundsätzlich sei der pflanzliche Stoffwechsel<br />
bei einem Blattzuckergehalt zwischen<br />
10 und 20 Prozent und undeutlicher<br />
Brechgrenze gut.<br />
„Die Bohnen reagieren wenig, weil zurzeit<br />
optimale Bedingungen herrschen und wenig<br />
Stress besteht“, interpretiert der Agrarchemiker<br />
das Zusammenspiel von Brix-,<br />
pH- und COND-Wert, „die Disteln reagieren<br />
jedoch bei gleich günstigen Bedingungen<br />
deutlich. Man sieht ihre Stoffwechselstärke<br />
an der über doppelt so hohen Leitfähigkeit.<br />
Eine Vitalisierungsbehandlung ist hier<br />
wegen des Distelwachstums sinnvoll. Bei<br />
der Limonade sieht man den hohen, auch<br />
deklarierten, Zuckergehalt. Heutee enthält<br />
keinen Zucker. Der ist beim Trocknen veratmet.<br />
Die Leitfähigkeit zeigt, dass gelöste,<br />
salzförmige Nährstoffe enthalten sind.“<br />
Beurteilung der Boden-<br />
Schwenkproben<br />
Schließlich werden gemeinsam die Boden-<br />
Schwenkproben beurteilt. „Je trüber, desto<br />
mehr nicht in die Bodenaggregate eingebundene<br />
Tonmineralien enthält die Probe.<br />
Das bedeutet, der Boden ist auswaschungsgefährdet.<br />
Je farbiger, desto mehr organische<br />
Säuren. Je mehr Schaum, desto mehr<br />
mikrobielle Aktivität“, erklärt Wenz. „Das<br />
Bodenleben ist Mikrobiologie. Damit muss<br />
ich mich auseinandersetzen. Wir lernen in<br />
der Ausbildung oft nur Symptombehandlung“,<br />
lautet Näsers Abschlussstatement.<br />
Ein Teilnehmer erkundigt sich, ob es nach<br />
dem Kurs Aufbaukurse oder Hilfe bei der<br />
Umsetzung gebe. „Die ‚horizontale Vernetzung‘<br />
ist ein wichtiger Bestandteil der Bodenkurse“,<br />
beteuert Wenz, „da sind schon<br />
wertvolle Kooperationen entstanden.“ Es<br />
Sowohl der Unterboden-Lockerer als auch der große<br />
Flachgrubber wurden mit einem Leitungssystem<br />
zum Ausbringen der Fermente direkt hinter die<br />
Schare versehen.<br />
gebe ein Online-Anwenderforum, in dem<br />
sich die Teilnehmer einmal monatlich austauschen<br />
und beraten lassen können. Wir<br />
haben alle die gleichen Interessen: Wir<br />
wollen die Bodenfruchtbarkeit verbessern,<br />
um unseren Kindern und Enkeln einen Betrieb<br />
zu hinterlassen, von dem sie gut leben<br />
können.“<br />
Autor<br />
Christian Dany<br />
Freier Journalist<br />
Gablonzer Str. 21 · 86807 Buchloe<br />
0 82 41/911 403<br />
christian.dany@web.de<br />
HEAVY-DUTY<br />
RÜHRWERKE<br />
Sichern Sie sich durch die<br />
effizientesten Rührwerke<br />
am Markt bis zu<br />
40% Förderung<br />
der Investitionskosten<br />
durch die BAFA
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Bodenprobe aus einem Rapsfeld:<br />
Um eine gute Krümelstruktur mit<br />
intaktem Bodenleben – inklusive<br />
Regenwürmern – zu bekommen,<br />
arbeitet Hägler mit Untersaaten und<br />
Zwischenfrüchten.<br />
„An erster Stelle steht die<br />
Bodenchemie, dann kann die<br />
Biologie anspringen“<br />
Aufbauende Landwirtschaft in der Praxis: Mit Luzerne-Gras, Untersaaten und Zwischenfrüchten<br />
baut Josef Hägler Humus auf und fördert das Bodenleben. Seinen Kalbinnen-Mist<br />
bereitet er nach dem System Witte auf. Hägler ist wichtig, die bodenchemischen Verhältnisse<br />
genau zu kennen. Er setzt weder Fermente noch Präparate ein, dafür hochgerüstete,<br />
schlagkräftige Landtechnik.<br />
Von Christian Dany<br />
Viele „ou“ in der Aussprache, schräge Witze –<br />
wer auf den Hof von Josef Hägler kommt,<br />
muss sich auf ein „Oberpfälzer Urgestein“<br />
(Hägler über Hägler) gefasst machen. Der<br />
Betriebsleiter ist gerade noch mit Aufräumen<br />
beschäftigt. Er bespricht sich mit der Praktikantin<br />
Verena Lottner. Die Agrarstudentin möchte ihre Bachelorarbeit<br />
über die Luzerne schreiben, einer Leguminosenart,<br />
die auf Häglers Betrieb (Daten siehe Infokasten)<br />
eine wichtige Rolle einnimmt.<br />
„Wir bauen Luzerne an, trocknen es, pressen es in Ballen<br />
und verkaufen es als Eiweiß- und Strukturfutter“,<br />
erklärt er. Die Wärme für die Heutrocknung bezieht er<br />
von einer benachbarten, direkt am Ortsrand von Deindorf<br />
bei Wernberg-Köblitz gelegenen Biogasanlage. Auf<br />
der Gegenseite führt er mit seinem Agrarservice Lohnarbeiten<br />
für den Biogaserzeuger aus.<br />
2017 hat Hägler den Hof auf Ökolandbau und in dem<br />
Zuge die Tierhaltung von Milchvieh auf Kalbinnenaufzucht<br />
und -mast auf Stroh umgestellt. Er füttert seine<br />
Tiere hauptsächlich mit Heu. Hinzu komme nur wenig<br />
Kraftfutter und Mais, den er siliert und dann trocknet.<br />
„Dadurch ist die Futteraufnahme höher. Ich hab seit<br />
vier Jahren keinen Tierarzt mehr auf dem Hof gehabt.<br />
Das führe ich drauf zurück, dass im Boden alle Mineralien<br />
und Spuren-Nährstoffe in einem ausgewogenen<br />
Verhältnis drin sind“, sagt der Oberpfälzer, der damit<br />
bei seinem Lieblingsthema angekommen ist: dem gesunden<br />
Boden.<br />
Zum Bodenexperten über Umwege<br />
Der 60-Jährige ist im Lauf der Jahre zum Bodenexperten<br />
geworden. Er hält Vorträge zu Bodenfruchtbarkeit<br />
und Humusaufbau und er gehört zu den Referenten der<br />
vom Bioland-Verband organisierten „Bodenpraktiker“-<br />
Kurse. Sein Weg zum Bodenkenner war aber kein geradeaus<br />
führender: „Ich bin kein gelernter Landwirt.<br />
20 Jahre lang hab ich in der Glasbranche gearbeitet“,<br />
Fotos: Christian Dany<br />
50
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
praxis / Titel<br />
Betriebsspiegel Josef Hägler<br />
Geographische Lage: Mittlere Oberpfalz/Bayern, Landkreis Schwandorf<br />
Höhenlage: 560 m ü. NN<br />
Jahresniederschlag: 600 mm<br />
Betriebliche Ausrichtung: Kalbinnen-Aufzucht, Heutrocknung,<br />
Lohnunternehmen, Ackerbau<br />
Betriebsgröße: 110 ha<br />
Bodenart: sandiger Lehm, lehmiger Sand, 20 bis 35 Bodenpunkte<br />
Bodennutzung: 100 ha Ackerbau, 9 ha Dauergrünland<br />
Einzelne Betriebsteile: s.o., Ackerbau: Marktfrucht und Futterbau, Anbau<br />
von Luzerne-Gras, Raps, Körnermais, Braugerste, Weizen, Soja, Lein<br />
Familie: Betriebsleiter Josef Hägler (60 Jahre), verheiratet,<br />
drei Töchter<br />
Arbeitskräfte: 1 AK Betriebsleiter, 3 AK (zwei feste Mitarbeiter plus<br />
Familienmitglieder)<br />
„Die KAK entspricht nicht der<br />
Bodenfruchtbarkeit, sondern der<br />
Größe eines Kühlschranks. Es<br />
kommt drauf an, wie der Kühlschrank<br />
bestückt ist“<br />
Sepp Hägler<br />
erzählt Hägler, der sich einst zum „Industriemeister<br />
Glas“ ausbilden lassen hat.<br />
In der Glasindustrie habe er viel über Spurenelemente<br />
und Chemie gelernt. Anfang der 2000er Jahre nahm<br />
er fünf Jahre lang als Praxisbetrieb an einem Versuch<br />
der Lufa Augustenberg zur Gülleaufbereitung teil, bei<br />
dem die Auswirkungen auf Tier und Boden untersucht<br />
wurden. Das weckte sein Interesse am Mikrokosmos<br />
unter unseren Füßen. Der nächste Schritt war dann,<br />
sich mit den Albrecht/Kinsey-Bodenuntersuchungen<br />
zu beschäftigen. Seit 2009 beprobt Hägler seine Böden<br />
nach den Methoden der Wissenschaftler William<br />
Albrecht und Neal Kinsey und düngt sie dementsprechend.<br />
„Die Standard-Bodenprobe mit pH-Wert, Phosphor und<br />
Kali reicht nicht aus, um die Ursache eines Problems<br />
zu finden. Wichtig sind auch Elemente wie Schwefel,<br />
Bor, Magnesium, Natrium oder Zink und ihr Verhältnis<br />
zueinander“, argumentiert Hägler. Er strebe an, Nährstoff-Unter-<br />
und auch -Überversorgung zu vermeiden:<br />
„Die ist schlechter als Unterversorgung, weil sich Nährstoffe<br />
gegenseitig blockieren können. Darum muss ich<br />
eine Bodenanalyse machen lassen, um zu wissen, was<br />
zu viel ist. Die meisten Landwirte denken: ‚Viel hilft<br />
viel‘. Aber das ist falsch.“<br />
Bei der Albrecht-Methode werde die Kationen-Austauschkapazität<br />
(KAK) ermittelt. Hägler vergleicht<br />
den Boden hier mit einem Kühlschrank: „Die KAK<br />
entspricht nicht der Bodenfruchtbarkeit, sondern der<br />
Größe eines Kühlschranks. Es kommt drauf an, wie<br />
der Kühlschrank bestückt ist: mit Wurst, Käse, Eiern,<br />
Gemüse und Obst. Die Pflanzen können sich an den<br />
Nährstoffen bedienen, die sie für ihr Wachstum brauchen.<br />
Dann müssen die entnommenen Nährstoffe wieder<br />
nachgefüllt werden. Dabei geht es aber nicht, dass<br />
zum Beispiel Käse mit Gemüse ersetzt wird.“<br />
Außerdem seien Ton-Humus-Komplexe wichtig für die<br />
Bodenfruchtbarkeit: „Die Tonmineralien sind gottgegeben,<br />
aber den Humus können wir aufbauen“, stellt<br />
Hägler klar. Humus könne sämtliche Kationen (Kalzium,<br />
Magnesium, Kalium, Natrium) und auch Anionen<br />
(Stickstoff, Phosphor und Schwefel, aber auch Bor)<br />
binden und der wachsenden Pflanze zur Verfügung stellen.<br />
Das Nährstoff-Haltevermögen sei dreimal höher als<br />
bei der gleichen Menge Ton.<br />
Zudem könne Humus das Zehnfache seines Eigengewichts<br />
an Wasser halten. Er erzählt von einem Test auf<br />
seinem Feld, bei dem auf einem Quadratmeter 100<br />
Liter Wasser ausgeschüttet wurden und innerhalb von<br />
sechs Minuten versickert seien. In Bezug auf manch<br />
fantastische Humusaufbaurate gibt Hägler zu denken:<br />
„Man muss genau schauen, ob es wirklich Humus ist,<br />
der da aufgebaut wird, oder nur organische Substanz,<br />
die mit dem Kohlenstoff-Gehalt C org<br />
gemessen wird.“ Es<br />
gehe auch um Wurzelausscheidungen und das richtige<br />
Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis. Ideal wären 10:1.<br />
Die Zusammensetzung müsse stimmen, damit der Humus<br />
auch seine Funktionen erfüllen könne. Sonst sei es<br />
kein Dauerhumus, sondern nur Kohlenstoff.<br />
„Wichtig für den Humusaufbau ist, keine Fäulnis in<br />
den Boden reinzukriegen“, rät Hägler, „deshalb sollte<br />
kein Grünmaterial in den Boden eingearbeitet und der<br />
Wirtschaftsdünger aufbereitet werden.“ Gärrest und<br />
Gülle müssten behandelt werden, damit sie für den<br />
Boden verträglich seien. „Gärrest hat ein sehr enges<br />
C:N-Verhältnis. Die Biogasproduktion zieht den Kohlenstoff<br />
raus. Der Stickstoff ist nicht gebunden<br />
Links hat Hägler eine<br />
Bodenprobe aus einem<br />
Nachbarfeld. Die<br />
lockerere Bodenkrümelung<br />
und bessere<br />
Durchwurzelung seines<br />
Bodens rechts ist gut<br />
zu erkennen.<br />
51
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Der Feinboden liegt bei dieser Art des Fräsens unten,<br />
das organische Grobmaterial locker oben auf. Die<br />
noch grünen Reste können so sicher absterben.<br />
Die Untersaat im<br />
Raps besteht aus<br />
Weidelgras und Klee.<br />
Es bleibt eine gewisse<br />
Frässohle. Was<br />
andere kritisieren,<br />
findet Hägler positiv:<br />
Die Bodenkapillaren<br />
werden geschlossen,<br />
die Verbindung vom<br />
Boden zum aufliegenden<br />
Grünmaterial wird<br />
unterbrochen. Dieses<br />
stirbt ab. <br />
Den Stallmist bereitet Sepp<br />
Hägler nach dem System von<br />
Walter Witte auf.<br />
und dadurch schnell verfügbar. Wenn er nicht sofort<br />
von der Pflanze verwertet werden kann, geht er verloren.“<br />
Ein weiterer Aspekt beim Wirtschaftsdünger sei<br />
das Kalium: „Es ist wasserlöslich, tauscht Kalzium aus<br />
und löst dadurch die Krümelstruktur auf.“ Früher setzte<br />
der Landwirt zur Gülleaufbereitung Leonardit ein,<br />
ein huminstoffreiches Koppelprodukt aus dem Braunkohleabbau.<br />
Mistbehandlung nach System Witte<br />
Heute hat Hägler keine Gülle mehr, dafür Mist, den<br />
er nach dem System von Walter Witte aufbereitet. Der<br />
Kalb innenmist enthalte viel Stroh, damit er nicht zu<br />
nass sei. „Mit dem Miststreuer abstreuen, damit Luft<br />
reinkommt, und eine zwei Meter hohe Miete aufsetzen“,<br />
erklärt er. Das Ganze werde dann mit dem Radlader<br />
angedrückt, damit es außen verschlossen sei.<br />
Es stelle sich eine Temperatur von bis zu 55 Grad Celsius<br />
ein: „Nährstoffe gehen so nicht verloren. Huminstoffe<br />
bilden sich. Die Miete wird nicht abgedeckt und auch<br />
nicht umgesetzt, damit das CO 2<br />
nicht in die Luft geht.<br />
Ich hab mit einem CO 2<br />
-Messgerät schon über 20.000<br />
ppm CO 2<br />
gemessen. Also: Das CO 2<br />
bleibt drin.“ Nach<br />
rund zwölf Wochen Reifezeit könne der aufbereitete<br />
Mist mit bis zu 10 Tonnen pro Hektar und Jahr ausgebracht<br />
werden. Er habe ein für das Pflanzenwachstum<br />
optimales C/N-Verhältnis von 16:1: „Das heißt, er wirkt<br />
schnell.“<br />
Seit 2014 bearbeitet Hägler seine Böden ohne Pflug:<br />
„Wir müssen die Bakterien im Boden erhalten; die,<br />
die Sauerstoff wollen, bleiben oben und die anderen<br />
unten.“ Um Kleegras, Untersaaten, wintergrüne Zwischenfrüchte<br />
und auch Maisstoppeln in Flächenrotte<br />
oder zur schnelleren Umsetzung zu bringen, setzt er<br />
eine „Hackfräse“ ein. Die Maschine habe eine andere<br />
Messerstellung als herkömmliche Bodenfräsen, erläutert<br />
der Lohnunternehmer.<br />
Fotos: Christian Dany<br />
52
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
praxis / Titel<br />
Fräsvorführung: Der Deckel der Hackfräse bleibt in der Regel offen. So wird das abgeschälte<br />
Pflanzenmaterial aufgewirbelt und es verbleibt organisches Grobmaterial.<br />
Sepp Hägler mit abgeschältem<br />
Gras in der Hand.<br />
Hackfräse selbst weiterentwickelt<br />
Er zeigt die Arbeit der Maschine an einem gemähten<br />
Luzerne-Grasbestand: Die Fräse schneidet den Boden<br />
in 3 bis 4 Zentimeter flach ab und wirft das Material<br />
durch den offenen Deckel aus. Der Feinboden<br />
liegt dann unten, das organische Grobmaterial oben,<br />
wodurch es sicher absterben soll. „Damit das funktioniert,<br />
haben wir die Maschine weiterentwickelt“, sagt<br />
der Oberpfälzer. Für die modifizierte Fräse des italienischen<br />
Herstellers Celli hat er den Exklusivvertrieb in<br />
Deutschland.<br />
Häglers Fräse hat eine Arbeitsbreite von 5,50 Meter<br />
und 10 Millimeter dicke Messer. Der Leistungsbedarf<br />
liegt über 200 PS. „Wenn man viele Steine auf<br />
„Mit uns immer auf der<br />
Überholspur! Schnelle und<br />
effektive Schwefelbindung<br />
mit MethaTec® Detox S Direct.“<br />
Franz-Jakob Feilcke,<br />
Einer der Macher.<br />
TerraVis GmbH<br />
Industrieweg 110<br />
48155 Münster<br />
Tel.: 0251.682 - 2055<br />
info@terravis-biogas.de<br />
www.terravis-biogas.de<br />
FELD<br />
SILO<br />
FERMENTER<br />
ENERGIE<br />
53
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Artenreiche Zwischenfruchtmischung:<br />
Zu<br />
erkennen sind Phacelia,<br />
Inkarnatklee und<br />
Ramtillkraut.<br />
Zur Rückverfestigung des Bodens, zum Beispiel nach dem Grubbern, setzt Hägler eine 8,5<br />
Tonnen schwere Cambridge-Walze ein. Trotz des Arbeitsgewichtes zeigt der Boden eine gute<br />
Durchkrümelung.<br />
Raps im Frühjahr mit Lupinen und Klee in der Zwischenfrucht.<br />
Im Frühjahr werden die Leguminosen rausgehackt.<br />
dem Acker hat, so wie bei uns in der Oberpfalz, müssen<br />
die Messer so dick sein“, sagt Hägler. Wichtig sei, Rotordrehzahl<br />
und Fahrgeschwindigkeit genau aufeinander<br />
abzustimmen, damit der Boden nicht verschmiere.<br />
Außerdem solle nur im völlig trockenen Boden gefräst<br />
werden. Auch die nächsten zwei Tage sollte schönes<br />
Wetter sein.<br />
Nach fünf Tagen sei das Fräsmaterial dann abgestorben<br />
und könne mit dem Grubber eingearbeitet werden.<br />
„Damit werden meine zigtausende Mikroorganismen<br />
im Boden gefüttert. Durch die Zusammensetzung<br />
des Pflanzenbestands und die Arbeitsweise der Fräse<br />
brauch ich keine Fermente zur Rottelenkung. Ich bin<br />
nicht überzeugt davon, dass die Arten an Mikroorganismen<br />
in einem Ferment genau meine Mikroorganismen<br />
abbilden können.“<br />
Mit Untersaaten und Zwischenfrüchten<br />
Bodenfruchtbarkeit beeinflussen<br />
Ohnehin sei er kein Freund von Präparaten: „Ich kann<br />
die Bodenfruchtbarkeit mit Untersaaten und Zwischenfrüchten<br />
beeinflussen. Mir ist es wichtig, die Ursache<br />
von Problemen im Boden zu finden und dementsprechend<br />
zu handeln. Das muss gehen, ohne öfters mit der<br />
Spritze rauszufahren. Ich gebe da kein Geld aus.“ Untersaaten<br />
und Zwischenfrüchte würden immer auf die<br />
Folgefrucht abgestimmt. Wo es passe, bringe er eine<br />
Untersaat aus: „Bei der Rapssaat zum Beispiel bringen<br />
wir zuerst eine leguminosenreiche Zwischenfrucht aus.<br />
Im Frühjahr wird diese rausgehackt und wir bringen<br />
dann eine Untersaat ein.“<br />
Hägler kann die Zwischenfrucht in einem Arbeitsgang<br />
zwischen die Reihen säen. Er hat eine 6 Meter breite<br />
Horsch-Drillmaschine, die auch modifiziert ist: Neben<br />
den Zwischenreihensaaten könne sie auch das Saatgut<br />
direkt bei der Saat flüssig beimpfen. Vor der Saat und<br />
beim Grubbern empfiehlt er, den Boden rückzuverfestigen.<br />
Hägler hat eine Nachlaufwalze an der Sämaschine<br />
und eine 8,5 Tonnen schwere Cambridge-Walze. „Wir<br />
haben trotz des Arbeitsgewichtes eine gute Bodendurchkrümelung“,<br />
sagt er und zeigt eine Spatenprobe<br />
auf einem Rapsfeld. Hier ist auch die Untersaat mit<br />
Fotos: Sepp Hägler<br />
54
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
praxis / Titel<br />
Anlagenbau<br />
Jetzt Energiefresser<br />
tauschen, CO 2 einsparen<br />
und bis zu 40 % BAFA<br />
Förderung sichern!<br />
Die Drillmaschine hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern. Die Maschine ist modifiziert zur Zwischenreihensaat<br />
und zur Flüssigimpfung des Saatgutes direkt bei der Saat. Statt Scheiben schneiden Gänsefußschare vor<br />
der Saat den Boden auf Höhe des Saatgutes ab, um Beikraut zu unterdrücken.<br />
90 Prozent Weidelgras und 10 Prozent Klee<br />
schön aufgegangen.<br />
„Die Vielfalt macht’s“, lautet Häglers Leitspruch<br />
bei Zwischenfrüchten. Er verwendet<br />
Mischungen mit über 20 Arten, zum Teil<br />
abfrierend und zum Teil wintergrün. „Bei<br />
Zwischenfrüchten immer die Wurzeln anschauen“,<br />
rät er, „auf die kommt es an.<br />
Wurzel-Kohlenstoff hat das 2,3-fach stärkere<br />
Humusbildungspotenzial als Kohlenstoff<br />
aus oberirdischer Biomasse.“ Kleegras<br />
und Luzerne-Gras würden auf Böden<br />
mit Phosphor- und Kali-Überschüssen<br />
angebaut: „Hier düngen wir mit Schwefel<br />
und Bor. Das Kleegras fördert die Bodenstruktur.“<br />
Kapieren statt Kopieren<br />
Trotz der vielen Empfehlungen warnt Hägler<br />
davor, Vorbilder kopieren zu wollen.<br />
„Jeder Boden ist anders. Jeder hat andere<br />
Voraussetzungen bezüglich des Klimas,<br />
zum Beispiel hat einer mehr Nordhänge<br />
als ein anderer.“ Konkret sei das ideale<br />
Kalzium:Magnesium-Verhältnis von 68:12<br />
abhängig von der Bodenart: „Sandige Böden<br />
können etwas mehr Magnesium haben,<br />
bei tonigen Böden sollte es unter 12<br />
Prozent liegen. Zusammen sollen es aber<br />
immer 80 Prozent sein.“<br />
Auch die Unterschiede in der Tierhaltung<br />
müssten immer berücksichtigt werden:<br />
„Deshalb funktioniert es nicht, eine Art<br />
‚Mustersystem‘ zu stricken und das jedem<br />
Bauern überzustülpen.“ Wichtig ist ihm,<br />
kompetente Partner an der Seite zu haben:<br />
Hägler arbeitet mit Christoph Felgentreu<br />
von der IG gesunder Boden und der Bodenberaterin<br />
Dr. Sonja Dreymann zusammen.<br />
Er rät: „Wer umstellen will, soll auf kleinen<br />
Flächen anfangen und das dann in kleinen<br />
Schritten ausweiten.“<br />
„Wenn die Nährstoffe im Gleichgewicht<br />
sind und mit bodenschonender Bearbeitung<br />
die Bodenstruktur gut ist, läuft der<br />
Betrieb“, sagt Hägler. So lange auf trockenem<br />
Boden gearbeitet werde, sei auch das<br />
Gewicht von Maschinen nicht so entscheidend.<br />
Bei einer guten Struktur stecke der<br />
Boden viel weg. „Bodenchemie, -physik<br />
und -biologie müssen als Gesamtsystem<br />
betrachtet werden. Das ist wie ein Getriebe,<br />
bei dem die Räder ineinander greifen“, lautet<br />
sein Fazit. An erster Stelle steht für ihn<br />
die Bodenchemie: „Sie muss zuerst stimmen.<br />
Dann kann die Biologie anspringen<br />
und der Kreislauf geschlossen werden.“<br />
Autor<br />
Christian Dany<br />
Freier Journalist<br />
Gablonzer Str. 21 · 86807 Buchloe<br />
0 82 41/911 403<br />
christian.dany@web.de<br />
55<br />
Huning Feststoffdosierer –<br />
wir informieren Sie gern:<br />
Süd: Georg Mittermeier, 0163-6080418<br />
g.mittermeier@huning-anlagenbau.de<br />
Nord: Martin Esch, 0163-6080420<br />
m.esch@huning-anlagenbau.de<br />
EIN UNTERNEHMEN<br />
DER HUNING GRUPPE<br />
HUNING Anlagenbau GmbH & Co. KG<br />
Wellingholzhausener Str. 6, D-49324 Melle<br />
Tel. +49 (0) 54 22/6 08-2 60<br />
www.huning-anlagenbau.de
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Streben nach „enkeltauglicher“<br />
Landwirtschaft<br />
Der Spaten ist immer<br />
dabei. Bodenkontrollen<br />
gehören für Geschäftsführer<br />
Heiko Hölzel<br />
(links) und Pflanzenbauchef<br />
Phillip Weinitzke<br />
zur Arbeitsroutine.<br />
Wenn es gut ist für den Boden und der Umwelt hilft, sind die Landwirte der Marienhöher<br />
Milchproduktion Agro Waldkirchen GmbH zu vielen Experimenten bereit. Von Fehlschlägen<br />
lassen sie sich nicht entmutigen.<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Vielfalt ist hier Programm. Das wird bereits<br />
bei der Anfahrt zur Marienhöher Milchproduktion<br />
Agro Waldkirchen GmbH sichtbar.<br />
Auf dem Weg zum Verwaltungssitz des Betriebes<br />
auf der Marienhöhe in der Gemarkung<br />
Waldkirchen, knapp 500 Meter über Null, inmitten<br />
des sächsischen Vogtlandes passiert der Besucher<br />
eine Weide mit Schafen, einen großen Hofladen mit<br />
angeschlossener Fleischverarbeitung und einer Käserei,<br />
durch deren Fenster Regale mit großen runden<br />
Käselaiben zu sehen sind. Darüber hinaus eine, nach<br />
der Bauart zu urteilen, betagte Biogasanlage und einige<br />
Milchviehställe.<br />
Die Direktvermarktung von Fleisch, Wurst und vornehmlich<br />
aus Schafsmilch hergestelltem Käse geschieht<br />
über ein eng kooperierendes, aber wirtschaftlich<br />
eigenständiges Unternehmen. Das Halten von 680<br />
Kühen, die selbst bestimmen können, wann sie einen<br />
der zehn Melkroboter aufsuchen, sowie von 180 Friesischen<br />
Milchviehschafen und, wie später zu erfahren<br />
ist, von 150 Stück Damwild in einem Gehege obliegt<br />
dem Agrarbetrieb, der zudem 1.000 Hektar (ha) Ackerfläche<br />
und 500 ha Grünland für die Produktion von Futter<br />
und Marktfrüchten bewirtschaftet. Ausgenommen<br />
die vergangenen drei Trockenjahre bewegen sich die<br />
Erträge beim Getreide zwischen 60 bis 70 Dezitonnen<br />
(dt) pro ha und beim Mais zwischen 350 bis 400 dt/ha.<br />
Auf dem Grünland werden vier Schnitte in der Saison<br />
zur Produktion von Heu und Silage angestrebt.<br />
Die Landschaft mit ihren zahlreichen, oft bewaldeten<br />
Hügeln ist schön, die Anbaubedingungen sind schwierig.<br />
Auf den heterogenen Verwitterungsböden bringen<br />
es die sandigen Flächenteile auf gerade mal elf<br />
Bodenpunkte. An den besten Standorten steht unter<br />
dieser Rubrik eine 36 in der Ackerschlagkartei. Dafür<br />
regnet es mit 700 Millimeter ausreichend, zumindest<br />
in normalen Jahren und für ostdeutsche Verhältnisse.<br />
Kehrseite ist die Erosionsgefahr bei Starkregen, insbesondere<br />
an keilförmig eingeschnittenen Hanglagen.<br />
Dem wirken die Landwirte durch Verzicht auf wendende<br />
Bodenbearbeitung, durch Zwischenfrüchte und weitere<br />
Maßnahmen entgegen – erfolgreich, wie Geschäftsführer<br />
Heiko Hölzel versichert.<br />
Weitgehender Verzicht auf<br />
Pflanzenschutzmittel<br />
Doch der konventionell arbeitende Betrieb will deutlich<br />
mehr. „Es gibt da zwei Dinge, die wir seit Jahren sehr<br />
zielstrebig verfolgen“, betont der 48-Jährige. Das sei<br />
zum einen die nachhaltige Verbesserung der Boden-<br />
Fotos: Carmen Rudolph<br />
56
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
praxis / Titel<br />
vollgas<br />
für kohle.<br />
Die Triticale auf diesem 30 ha großen Schlag wurde nach dem notwendig gewordenen Abspritzen<br />
der Grasuntersaat direkt eingedrillt<br />
dank unseres eigenen lagers<br />
bieten wir ihnen schnelle<br />
reaktionszeiten und sind<br />
mit geschultem fachpersonal<br />
schnellstmöglich vor ort.<br />
Pflanzenbauchef Phillip Weinitzke:<br />
„Regenerative Landwirtschaft muss<br />
unbedingt die örtlichen Gegebenheiten<br />
berücksichtigen.“<br />
fruchtbarkeit, zum anderen der weitgehende<br />
Verzicht auf Herbizide und Insektizide<br />
durch natürlichen Pflanzenschutz. Als<br />
ackerbauliche Maßnahmen kommen in<br />
diesem Zusammenhang Anpassungen in<br />
der Fruchtfolge, der verstärkte Zwischenfruchtanbau<br />
zur dauerhaften Begrünung<br />
sowie Bei- und Untersaaten zur Anwendung.<br />
Mit der Direktsaatmaschine Claydon Hybrid<br />
T6 steht hierfür die entsprechende<br />
Drilltechnik zur Verfügung. Das gezogene<br />
6 Meter breite Gerät ermöglicht durch den<br />
geteilten, insgesamt 5.500 Liter fassenden<br />
Tank und die doppelte Zinkenreihe die<br />
gleichzeitige Ablage entweder von zwei verschiedenen<br />
Saaten in unterschiedlichen<br />
Bodenhorizonten beziehungsweise von<br />
einem Saatgut in Kombination mit einer<br />
Unterfußdüngung.<br />
Zusätzlich ist die Maschine mit einem Säaggregat<br />
von APV ausgestattet, mit dem<br />
sich über Prallteller Feinsämereien für Beiund<br />
Untersaaten ausbringen lassen. Beim<br />
Drillen öffnen zunächst Schneidscheiben<br />
in der Wurzel- und Saatzone den Boden<br />
und lockern ihn auf. Die Fläche zwischen<br />
den Saatreihen bleibt jedoch unbearbeitet.<br />
Hier können Regenwurmpopulationen<br />
in den bestehenden Gängen gedeihen. Der<br />
unbearbeitete Zwischenraum dient darüber<br />
hinaus als Feuchtigkeitsreservoir für<br />
die Pflanzen. Die Claydon Hybrid T6 setzt<br />
der Betrieb in fast allen Kulturen ein. Nur<br />
den Zwischenfruchtanbau erledigt teilweise<br />
eine Kreiselegge von Lemken mit aufgebauter<br />
Sämaschine.<br />
Düngebedarf: Haupt- und<br />
Mikronähstoffe ermitteln<br />
Bei der Realisierung ihrer Ziele im Pflanzenbau<br />
experimentieren die Waldkirchener<br />
Landwirte außerdem mit Komposttee und<br />
Fermenten. Dem war eine Konsultation bei<br />
Dietmar Näser vorausgegangen. Näser, der<br />
im angrenzenden sächsischen Erzgebirge<br />
das europaweit vernetzte Beratungsbüro<br />
„Grüne Brücke“ leitet, zählt zu den Pionieren<br />
der regenerativen Landwirtschaft. Er<br />
war es auch, der zu Bodenuntersuchungen<br />
nach der Kinsey-Methode anregte,<br />
57<br />
Siemensstr. 32, 35638 Leun<br />
06473 411596<br />
info@aks-heimann.de
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
An den Streifen in der Kultur erkennt man die 15 Zentimeter (cm) breite Bandablage<br />
mit der Direktsaatmaschine von Claydon. Die 15 cm breiten Bereiche<br />
dazwischen bleiben unbearbeitet.<br />
Vor dem sehr gut entwickelten Weizen auf diesem Schlag stand erstmals ein<br />
Zwischenfruchtgemenge, das nach der Ernte der Vorkultur Winterraps gesät<br />
wurde. Die Nachlieferung an Nährstoffen durch die Zwischenfrucht macht sich<br />
in der Fruchtentwicklung des Weizens deutlich bemerkbar.<br />
Erbsenkultur mit den Beisaaten Sommergerste und Leindotter für die Futtergewinnung.<br />
Zuvor stand auf dem Feld Wickroggen, der eingearbeitet wurde.<br />
Durch eine regenerative Landwirtschaft gelang den Landwirten bereits auf vielen<br />
Flächen eine Verbesserung der Bodenstruktur. Hier ein Pflanzenbestand aus<br />
Erbsen und Roggen.<br />
bei denen die Ermittlung des Verhältnisses der Hauptund<br />
Mikronährstoffe untereinander eine zentrale Rolle<br />
spielt. Die daraus abgeleiteten Düngeempfehlungen<br />
zielen auf die Einstellung der für die Pflanzenernährung<br />
optimalen Nährstoffverhältnisse.<br />
„Die Analyse ergab unter anderem eine Magnesiumsättigung<br />
der Böden, was wiederum zu Kalziummangel<br />
führt“, berichtet Phillip Weinitzke. Der 32-jährige<br />
Landwirtschaftsmeister leitet seit 2015 den Bereich<br />
Pflanzenbau. Als Schlussfolgerung plane er nach der<br />
Rapsernte und dem Drusch der Wintergerste, die zum<br />
Zeitpunkt des Betriebsbesuches, Mitte Juli, unmittelbar<br />
bevorstand, die Ausbringung größerer Mengen magnesiumfreien<br />
Kalks. Mit dem Lohnunternehmen AIS<br />
stehe für diese Arbeiten einen Dienstleister zur Seite,<br />
der eine teilflächenspezifische Kalkung auf der Grundlage<br />
von Bodenproben anbietet. „Unsere ohnehin relativ<br />
weite Fruchtfolge mit verschiedenen Getreidesorten,<br />
einschließlich Dinkel und Hafer, Mais, Raps sowie<br />
den Leguminosen Erbsen, Bohnen und Lupine lockern<br />
wir, wann immer es irgend geht, mit Zwischenfrüchten<br />
auf“, informiert der Pflanzenbauchef. Neben der Förderung<br />
der Hauptkultur, dem Erosionsschutz und der<br />
Erfüllung von Greening-Auflagen habe der Bewirtschafter<br />
dabei den Humusaufbau und die Verbesserung der<br />
Bodenstruktur im Blick. Die über die Zwischenfrüchte<br />
in den Boden eingebrachte organische Substanz nutzten<br />
Regenwürmer als Nahrung, deren Aktivität wiederum<br />
zu stabilen Bodenaggregaten mit durchgehenden<br />
Poren für die Aufnahme von Niederschlägen führe.<br />
58
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
praxis / Titel<br />
Zum Drillen der Marktfrüchte<br />
mit und ohne<br />
Untersaaten sowie für<br />
die Anlage von Zwischenfrucht-<br />
und Mischkulturen<br />
kommt überwiegend die<br />
Direktsaatmaschine<br />
Claydon Hybrid T6 zum<br />
Einsatz. <br />
Sudangras: Notlösung war<br />
erfolgreich<br />
„Manchmal treffen wir hier kurzfristig Entscheidungen,<br />
sozusagen aus der Situation<br />
heraus“, sagt Hölzel. Als Beispiel nennt er<br />
den Anbau von Sudangras im vergangenen<br />
Jahr. Dies sei zunächst eine Notlösung<br />
gewesen. Spätfröste hatten<br />
die Ähren der Wintergerste<br />
geschädigt. Daher fiel der<br />
Entschluss, die betroffene<br />
Kultur frühzeitig als Ganzpflanzensilage<br />
(GPS) zu ernten<br />
und als Überbrückung<br />
bis zur geplanten Nachfolgekultur<br />
Raps erstmals Sudangras<br />
zu säen. Eine glückliche<br />
Entscheidung. Nach acht<br />
Wochen stand die Pflanze aus<br />
der Gattung der Sorghumhirsen<br />
2 Meter hoch. Die eingefahrene<br />
Ernte des „Maises ohne Kolben“, wie einige<br />
Dorfbewohner monierten, lieferte reichlich Substrat für<br />
die Biogasanlage, während den Rindern das entsprechende<br />
Äquivalent vom „echten“ Maisvorrat zusätzlich<br />
als Futter vorbehalten blieb. „Besser hätten wir die Zeit<br />
bis zur Rapsaussaat kaum nutzen können“, ist der Geschäftsführer<br />
überzeugt. „Wir werden Sudangras jetzt<br />
immer mal einsetzen, wenn es sich anbietet. Zumal die<br />
Die Sämaschine Claydon Hybrid T6 verfügt über<br />
eine doppelte Zinkenreihe zur Ausbringung von unterschiedlichem<br />
Saatgut bzw. Saatgut in Kombination mit<br />
Dünger (vorn) sowie über ein zusätzliches Säaggregat für<br />
Feinsämereien über Prallteller (rechts oben).<br />
Kultur recht pflegeleicht ist und, ganz in dem von uns<br />
angestrebten Sinne, keinen Herbizideinsatz erfordert“,<br />
ergänzt Weinitzke.<br />
In der aktuellen Saison wächst Sudangras auf einem 42<br />
ha großen Schlag. Die Aussaat erfolgte in der zweiten<br />
Juniwoche im Anschluss an die Ernte von Wickroggen.<br />
Nach dem Schnitt soll dann im September Winterroggen<br />
folgen. Ähnliche Beweggründe wie beim<br />
59
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Die Claydon-Drillmaschine im Praxiseinsatz.<br />
In einem umfunktionierten alten Milchtank werden aus<br />
verschiedenen Ansatzstoffen Fermente zur Bodenverbesserung<br />
hergestellt. Die benötigte Wärme liefert die Biogasanlage.<br />
Wartungsarbeiten am<br />
Claas-Mähdrescher mit<br />
7,5 Meter Schnittbreite<br />
kurz vor dem Start in<br />
die Getreideernte.<br />
Sudangras führten im vergangenen Jahr zum Anbau<br />
eines Gemenges, um auf einem Feld das vergrößerte<br />
Zeitfenster zwischen Rapsernte und Weizenaussaat zu<br />
nutzen. In diesem Falle war es die Ölfrucht, die wegen<br />
Frostschäden und Käferbefall sehr früh geerntet wurde.<br />
„Nach sechs Wochen haben wir die auf 1,50 Meter<br />
herangewachsenen Zwischenfrüchte eingearbeitet und<br />
in der ersten Oktoberwoche Weizen gedrillt“, berichtet<br />
Weinitzke. Die Nährstoffnachlieferung machte sich<br />
deutlich bemerkbar. Der Weizen auf dem betreffenden<br />
Feld stehe besser als auf allen anderen Schlägen.<br />
Manchmal zweimal Zwischenfrüchte<br />
direkt nacheinander<br />
Teilweise legt der Betrieb zwei Zwischenfruchtkulturen<br />
hintereinander an, etwa nach der Wintergerstenernte.<br />
„Das Gemenge grubbern wir im Herbst ein und drillen<br />
Wickroggen, den wir dann wiederum im Frühjahr vor der<br />
Maisaussaat einarbeiten“, erläutert der Pflanzenbauchef.<br />
Das bringe echten Humuszuwachs, insbesondere<br />
wenn Fermente (von denen später noch die Rede sein<br />
wird) die Rotte der Zwischenfrüchte forcieren.<br />
„Solche Maßnahmen sind allerdings immer mit zusätzlichen<br />
Kosten verbunden, die beim Landwirt hängenbleiben“,<br />
wirft Hölzel ein. Die jetzt diskutierte Vergütung<br />
für die CO 2<br />
-Speicherung durch Humusaufbau sei<br />
schön und gut, aber nach seiner Ansicht bislang nicht<br />
praktikabel. So müsse der CO 2<br />
-Speichereffekt exakt<br />
nachgewiesen werden. Angesichts der wechselnden<br />
politischen Stimmungen sei ungewiss, ob sich die zusätzlichen<br />
Investitionen am Ende rechnen.<br />
Überhaupt die Kosten. Die darf Hölzel bei allem Engagement<br />
für eine „enkeltaugliche“ Landwirtschaft<br />
nicht aus dem Blick verlieren. Der Agrarbetrieb muss<br />
sich in einem volatilen Marktumfeld behaupten. Die<br />
35 Mitarbeiter brauchen jeden Monat ihren Lohn. Die<br />
Pachten müssen gezahlt, notwendige Investitionen getätigt<br />
werden.<br />
Pause für die Untersaaten<br />
Kostenerwägungen waren auch der Grund, warum der<br />
Geschäftsführer bei den Untersaaten erst mal die Notbremse<br />
zog. Untersaaten wie Kleegras und Leindotter<br />
im Getreide betrachten die Waldkirchener Landwirte<br />
vor allem als eine Möglichkeit zur Herbizideinsparung<br />
durch schnelle Bodenbedeckung, die dem Aufwuchs<br />
von Unkräutern entgegenwirkt.<br />
Weitere Aspekte sind die Förderung der Bodenfruchtbarkeit,<br />
Vermeidung von Erosion und die Nährstoffkonservierung<br />
durch Aufnahme von Luftstickstoff über<br />
die Wurzelknöllchen der Leguminosen. Der schnelle<br />
Aufwuchs einer bereits etablierten Futterkultur nach<br />
der Ernte der Hauptfrucht spielt dagegen, wegen des<br />
reichlich vorhandenen Grünlands, eine untergeordnete<br />
Rolle.<br />
„Neben den Schwierigkeiten beim Dreschen durch<br />
mehr Feuchte im Bestand und einem höheren Reinigungsaufwand<br />
besteht unsere Sorge vor allem darin,<br />
die auf dem Acker verbleibenden Untersaaten so in<br />
den Griff zu bekommen, dass in der Folgekultur kei-<br />
60
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
praxis / Titel<br />
Arma Mix HYBRID<br />
Mais ohne Kolben. Mit dem Anbau von Sudangras nutzen die Landwirte Freiräume in der Fruchtfolge<br />
ne Probleme entstehen. Da wir ohne Glyphosat<br />
auskommen wollen und wegen der<br />
Erosionsgefahr nicht pflügen, bleibt nur<br />
die aufwändige mechanische Aufwuchsbeseitigung,<br />
beispielsweise mit einer Fräse,<br />
deren Werkzeuge bei unseren steinigen Böden<br />
jedoch einem enormen Verschleiß ausgesetzt<br />
sind. Das haben wir in Versuchen<br />
gesehen“, begründet Hölzel das vorläufige<br />
Aussetzen der Untersaaten.<br />
Eine zufriedenstellende flächige Beseitigung<br />
des Grases habe man nur mit einem<br />
ausgeliehenen Schälpflug erreicht. Hier<br />
würden allerdings die hohen Investitionskosten<br />
und die geringe Schlagkraft gegen<br />
einen umfassenden Einsatz sprechen. Auf<br />
einem letzten, 30 ha umfassenden Weizenschlag<br />
mit Gras-Untersaat ergriffen<br />
die Landwirte vergangenen Herbst dann<br />
schließlich doch den „Strohhalm“ Glyphosat<br />
und drillten direkt in die abgespritzte<br />
Grasdecke Triticale, die sich nach anfänglichem<br />
Schwächeln gut entwickelte. „Ganz<br />
beiseitegelegt haben wir die Untersaat<br />
nicht. Vielleicht finden wir noch ein Verfahren<br />
zur Aufwuchsbeseitigung, das zu<br />
unseren Verhältnissen passt“, hofft Hölzel.<br />
Mischkulturen bei Leguminosen<br />
erfolgreich<br />
Licht und Schatten zeigen sich ebenso bei<br />
den Mischkulturen mit Beisaaten. Außer<br />
den Zielen, die mit der Untersaat verfolgt<br />
werden, ist hier die Idee noch ausgeprägter,<br />
dass die als Gründüngung verbleibenden<br />
Begleitpflanzen die Hauptkultur während<br />
der Vegetationsperiode fördern, beispielsweise<br />
wenn deren Pfahlwurzeln den Boden<br />
lockern oder indem sie Schädlinge durch<br />
Duftirritationen vertreiben bzw. Nützlinge<br />
anlocken und so als natürlicher Pflanzenschutz<br />
wirken.<br />
„Im besten Falle stehen ein Kreuzblütler,<br />
eine Leguminose und eine Grasart auf<br />
dem Feld“, betont Weinitzke. Während<br />
sich das etwa bei den Mischkulturen aus<br />
Sommergerste mit Phacelia und Leindotter<br />
oder Mais mit Ackerbohne wegen des<br />
schwierigen Handlings bei Kulturführung,<br />
Ernte und Nacherntemanagement unter<br />
den konkreten Bedingungen rund um die<br />
vogtländische Marienhöhe als wenig praktikabel<br />
erwies, helfen Beisaaten zu den<br />
Grobleguminosen seit drei Jahren beim<br />
Verzicht auf Herbizide.<br />
Beisaaten zur Hauptfrucht<br />
Auslöser war, so berichtet Hölzel, dass der<br />
Leguminosenanbau zunächst generell als<br />
Greeningmaßnahme galt. Die Regelung<br />
wurde dann aber mit der Auflage eines herbizidfreien<br />
Anbaus verschärft. „Da haben<br />
viele aufgegeben. Aber bei uns klappt es,<br />
da wir das gewachsene Futter im eigenen<br />
Betrieb verwerten und das Erntegut nicht<br />
für den Verkauf gereinigt werden muss“,<br />
sagt Hölzel. Erbsen ergänze man mit Sommergerste<br />
und Leindotter. Zu Boh-<br />
61<br />
Keine Störanfällige Drahtseile<br />
und Stromkabel im Behälter<br />
Automatische Verstellung - auch<br />
zyklusgesteuert zum Füllstandslevel<br />
Kombination aller Vorteile von Tauchrührwerke<br />
und Langwellenrührwerke<br />
ARMATEC - FTS<br />
GmbH & Co. KG<br />
Friedrich-List-Strasse 7<br />
D-88353 Kisslegg<br />
+49 (0) 7563 / 909020<br />
+49 (0) 7563 / 90902299<br />
info@armatec-fts.de<br />
www.armatec-fts.com
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
nen und Lupine gesellen sich<br />
Kleegras, Hafer und Leindotter<br />
als Beisaat.<br />
Expertise erlangten die Vogtländer<br />
mittlerweile ebenso<br />
beim Thema Komposttee und<br />
Fermente. Beides kann im<br />
Betrieb in größeren Mengen<br />
selbst hergestellt werden. Der<br />
Komposttee entsteht, indem<br />
ein mit Kompost, Gesteinsmehl<br />
und Mikronährstoffen befülltes<br />
Netz für 24 Stunden in ein auf<br />
28 bis 30 Grad Celsius erwärmtes<br />
und belüftbares Wasserbad<br />
getaucht wird. Auf der Marienhöhe<br />
benutzt man dafür ein<br />
entsprechend ausgerüstetes<br />
1.000-Liter-Shuttle. Im „gezogenen“<br />
Komposttee tummeln<br />
sich jede Menge Bakterien, die<br />
das Bodenleben befördern.<br />
Das Verdünnungsverhältnis für die Ausbringung mit<br />
der Feldspritze, die innerhalb von wenigen Stunden<br />
nach Fertigstellung des Komposttees erfolgen muss,<br />
hängt unter anderem davon ab, in welchem Umfang<br />
Heiko Hölzel, Geschäftsführer der Marienhöher<br />
Milchproduktion Agro Waldkirchen GmbH:<br />
„Bodenfruchtbarkeit rauf, Chemie<br />
runter. Das sind unsere Ziele.“<br />
sich auf dem Feld bereits eine<br />
Kultur etabliert hat. „Die kurze<br />
Verbrauchsfrist erschwert die<br />
Sache schon mal. Und dann hat<br />
uns die Wirkung, abgesehen von<br />
einigen kurzfristig beobachtbaren<br />
Effekten, nicht so wahnsinnig<br />
überzeugt“, urteilt Hölzel.<br />
Anders bei den Fermenten.<br />
Diese stellen die Landwirte in<br />
einem alten, 6.000 Liter fassenden<br />
Milchtank her, bei dem<br />
sie die Kühlung zur Heizung<br />
umfunktionierten. Die Ansatzlösung<br />
aus verschiedenen von der<br />
Firma EM-Chiemgau bezogenen<br />
Komponenten (Milchsäurebakterien,<br />
Hefepilze, Melasse,<br />
Kräuter u.a.) muss etwa eine<br />
Woche gären, bis sie einen pH-<br />
Wert von 3,8 erreicht. Die fertige<br />
Fermentbrühe ist bei kühler Lagerung<br />
ein Jahr haltbar. „Wir bringen die Fermente beispielsweise<br />
vor der Einarbeitung von Zwischenfrüchten<br />
aus, um deren Rotte zu beschleunigen und Fäulnis zu<br />
unterbinden, die den Humusaufbau behindert“, infor-<br />
Fachfirma der Bauwerksabdichtung<br />
Ich bin Erfinder der Auffangwanne aus Kunststoffbahnen und habe über 60 Jahre Berufserfahrung als Selbstständiger.<br />
Die Auskleidung mit HDPE ist nachhaltig, weil sie keine Nachbehandlung oder Pflege benötigt. Sie hat eine Haltbarkeit<br />
von mindestens 100 Jahren.<br />
Wir kleiden nach meinem System Behälter jeglicher<br />
Größen und Formen aus und versehen sie mit einem<br />
Leckage-Erkennungs-System (LES). Einwandige Behälter<br />
können zu doppelwandigen umgerüstet werden. Das<br />
Verfahren ist geeignet für Fermenter, Nachgärer und<br />
Endlager.<br />
Die Auskleidung ist gegen aggressive Medien beständig.<br />
Vorkonfektionierte HDPE - Bahnen; Montage , verschweißen vor Ort<br />
Unsere Leistungen:<br />
• Bodenabdichtungen (Tiefbau)<br />
• Behälterabdichtungen, Leckschutzauskleidung<br />
• Schwimmbad- und Teichabdichtungen<br />
Kontakt:<br />
Dipl.-Ing. Franz Kerner<br />
Hohewartstr. 131<br />
70469 Stuttgart<br />
62<br />
Tel.: 0711 – 81 44 59<br />
Fax: 0711 – 85 34 19<br />
E-Mail: info@dr-ing-kerner.de<br />
DR. KERNER<br />
Denken und Handeln für die Zukunft
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
praxis / Titel<br />
„Wir bringen die Fermente beispielsweise<br />
vor der Einarbeitung von Zwischenfrüchten<br />
aus, um deren Rotte zu beschleunigen<br />
und Fäulnis zu unterbinden“<br />
Heiko Hölzel<br />
miert der Geschäftsführer. Die positive Wirkung auf das<br />
Bodengefüge zeige sich an der Farbveränderung des<br />
Ackers und dessen Krümeligkeit.<br />
Ein wichtiger Aspekt bei der Nährstoffversorgung der<br />
Kulturen und des Grünlands ist zudem der Kreislauf<br />
Pflanze-Tier-Boden. Bei der Marienhöher Milchproduktion<br />
Agro Waldkirchen führt der über die Biogasanlage,<br />
in der die gesamte Gülle aus den Rinderställen, insgesamt<br />
etwa 16.000 Kubikmeter im Jahr, energetisch verwertet<br />
wird. Die Applikation der Gärprodukte – teilweise<br />
in stehende Kulturen – übernimmt der Nachbarbetrieb<br />
mit einem 15 Meter breiten Schleppschuhgestänge<br />
von Bomech. Die jährlich anfallenden 4.000 Tonnen<br />
Festmist bringen die Landwirte mit eigener Technik von<br />
Annaburger und Bergmann selbst als Dünger aus.<br />
Auf einem Erbsenfeld mit den Beisaaten Sommergerste<br />
und Leindotter hebt Weinitzke mit dem Spaten eine<br />
Erdscholle heraus. Ein dicker<br />
Regenwurm ist unschlüssig, ob<br />
er sich vom Spatenblatt fallen<br />
lassen oder wieder in dem krümeligen<br />
Klumpen verschwinden<br />
soll. „Nicht alle unsere<br />
Versuche waren so erfolgreich<br />
wie hier die Mischkulturen<br />
mit den Leguminosen. Aber<br />
wir verstehen jetzt, was bei uns geht und wo man Verfahren<br />
noch an die hiesigen Bedingungen anpassen<br />
muss“, sagt der Pflanzenbauchef. „Und wir bleiben<br />
dran“, ergänzt Geschäftsführer Hölzel. Im nächsten<br />
Jahr will er zum Beispiel die Cultan-Düngung testen,<br />
also die Injektion von flüssigem Ammoniumdünger in<br />
Getreidekulturen.<br />
Autor<br />
Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Freier Journalist ∙ Rudolph Reportagen – Landwirtschaft,<br />
Umwelt, Erneuerbare Energien<br />
Kirchweg 10 · 04651 Bad Lausick<br />
03 43 45/26 90 40<br />
info@rudolph-reportagen.de<br />
www.rudolph-reportagen.de<br />
63
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Modifiziertes<br />
Strip-Till-<br />
Verfahren<br />
sichert die<br />
Erträge<br />
Gärprodukte sind im Ackerbau ein wertvoller<br />
Dünger. Ein experimentierfreudiger<br />
Landwirt im nördlichen Sachsen-Anhalt<br />
lässt sie vor der Aussaat von Mais und Raps<br />
ausbringen. Dabei kommt ein modifiziertes<br />
Strip-Till-Verfahren zum Einsatz. Die<br />
Gärprodukte werden dabei in zwei unterschiedlichen<br />
Tiefen abgelegt.<br />
Von Thomas Gaul<br />
Michel Allmrodt ist zufrieden:<br />
„Der Mais wächst deutlich<br />
besser als in den vergangenen<br />
Jahren.“ Sicher, in diesem<br />
Jahr hat es mehr geregnet<br />
und die Niederschläge sind auch besser<br />
verteilt. Doch daran allein liegt es nicht.<br />
Der junge Landwirt greift zum Spaten und<br />
hebelt eine Maispflanze aus dem Boden.<br />
Vorsichtig legt er die Wurzeln von der Erde<br />
frei. „Das Wurzelwerk ist gut entwickelt“,<br />
freut er sich. Ein Effekt, der seine Ursache<br />
in der Umstellung auf eine bodenschonende<br />
und wassersparende Wirtschaftsweise<br />
hat. Auch die Kolben sind gut entwickelt<br />
und versprechen eine gute Ernte.<br />
Michel Allmrodt wirtschaftet in der Nähe<br />
von Tangerhütte im nördlichen Sachsen-<br />
Anhalt. Der Betrieb ist etwa eine gute Autostunde<br />
von Magdeburg entfernt. Seine<br />
Eltern haben den Betrieb im Jahr 1990<br />
neu gegründet. „Wir waren keine Wiedereinrichter“,<br />
wie Michel Allmrodt betont.<br />
Wie bei vielen Betrieben in der Altmark war<br />
die Milchviehhaltung ein Schwerpunkt des<br />
Michel Allmrodt ist mit<br />
dem Maiswachstum in<br />
diesem Jahr zufrieden.<br />
Betriebes. Doch die niedrigen Milchpreise<br />
führten bei vielen Betrieben zur Aufgabe<br />
der Rinderhaltung. 150 Milchkühe standen<br />
bei Allmrodts in den Ställen. „2019<br />
haben auch wir mit der Milchviehhaltung<br />
aufgehört“, berichtet Michel Allmrodt.<br />
Doch dann stellte sich das Problem, wie der<br />
Aufwuchs vom Grünland künftig am besten<br />
verwertet werden kann.<br />
Gras für Biogas<br />
Dies geschieht in einer Biogasanlage, die<br />
von der Firma EnviTec gebaut wurde. Die<br />
500-kW-Anlage versorgt über ein Nahwärmenetz<br />
alle Wohnhäuser des benachbarten<br />
Dorfes. Seit der Aufgabe der Milchviehhaltung<br />
landet der Aufwuchs der 150 Hektar<br />
(ha) Grünland im Fermenter. Als Betreiber<br />
versorgt Michel Allmrodt die Anlage mit den<br />
Fotos: Thomas Gaul<br />
64
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
praxis / Titel<br />
benötigten Rohstoffen. Die anfallenden<br />
Gärprodukte werden als wertvoller<br />
Dünger im Ackerbau eingesetzt. „Das<br />
funktioniert am besten vor der Aussaat<br />
von Mais“, hat Allmrodt festgestellt.<br />
Bei der Düngung von Getreide würden<br />
aufgrund der geringeren Arbeitsbreite<br />
neben den Fahrgassen zusätzliche<br />
Fahrspuren entstehen. Und die könnten<br />
bei der zeitigen Ausbringung im<br />
Frühjahr auch tiefer geraten – schlecht<br />
für die Bodenstruktur und schlecht<br />
für den Ertrag. „2020 haben wir ein<br />
anderes Strip-till-Patent ausprobiert,<br />
das war nicht schwerer und hat auch<br />
keine Schadverdichtungen gemacht.<br />
Der Nachteil von dem Patent war jedoch<br />
der schmale Lockerungsstreifen,<br />
wo die Wurzeln schwächer entwickelt<br />
waren.“<br />
Gülleband in zwei<br />
verschiedenen Tiefen<br />
Seither wird auf dem Betrieb ein modifiziertes Strip-<br />
Till-Verfahren eingesetzt. Der Lohnunternehmer kommt<br />
nun mit einem Gerät der Firma Volmer. „Die Besonderheit<br />
ist die Parabelform der Schare“, erläutert Allmrodt:<br />
„ Sie heben den Boden an und lockern ihn. Es<br />
findet aber keine Durchmischung statt.“ Besonders ist<br />
auch, dass die Ablage des Gärproduktes in zwei unterschiedlichen<br />
Tiefen erfolgt: einmal in 15 Zentimeter<br />
und zusätzlich noch in 30 Zentimeter Tiefe. „Das gibt<br />
dem Mais einen optimalen Start“, hat der findige Landwirt<br />
festgestellt.<br />
Die Maiswurzeln wachsen so zu den Düngerbändern<br />
hin – ein Effekt, der beim Ausgraben der Wurzeln ins<br />
Auge fällt. Der Lohnunternehmer arbeitet bei der Ausbringung<br />
für die exakte Arbeit mit RTK-GPS. „RTK nutze<br />
ich nicht“, sagt Allmrodt: „Das ist auch gar nicht<br />
notwendig. Ich kann den Spuren im Feld auch so folgen.“<br />
Die Mais-Aussaat erledigt er mit einer eigenen<br />
sechsreihigen Monosem-Einzelkornsämaschine. Über<br />
eine Teleskopschiene lässt sich der Abstand der Säreihen<br />
verändern.<br />
So kann die Maschine mit einem Reihenabstand von<br />
45 cm auch zur Rapsaussaat eingesetzt werden. Früher<br />
hat Allmrodt den Mais auch mit einer Universaldrillmaschine<br />
ausgesät, doch war ihm die Standraumverteilung<br />
der Pflanzen zu ungenau: „Da standen<br />
Der gute Zustand des<br />
Bodens zeigt sich auch<br />
in der Wurzelentwicklung<br />
der Pflanzen.<br />
Weniger Aufwand, mehr Ertrag!<br />
Dank flexibler Vermarktung Ihrer Biogasanlage.<br />
+ Direktvermarktung<br />
+ Fahrplanoptimierung<br />
+ Regelenergie-Vermarktung<br />
Mehr erfahren unter www.trianel.com/biogas<br />
Trianel GmbH | Krefelder Straße 203 | 52070 Aachen<br />
Offizieller Vertriebs partner<br />
+49 241 413 20-340<br />
vertrieb-vermarktung@trianel.com<br />
013.0121012_Trianel_Biogas_AZ_175x77_BiogasJournal_RZ.indd 1 29.03.21 11:19<br />
65
praxis / Titel Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
vier, fünf Pflanzen auf einem Haufen und dann kam<br />
eine Lücke.“ Nun stehen die Maispflanzen in einem<br />
exakten Abstand von 18 Zentimeter in der Reihe. Das<br />
Volmer-Gerät hinterlässt einen ebenen Acker. „Der Boden<br />
läuft wie eine Welle durch das Gerät“, umschreibt<br />
der Ackerbauer die Arbeitsweise.<br />
In diesem Jahr experimentiert er auch mit dem Anbau<br />
von Wickroggen. Er hat sich in diesem Jahr bei der<br />
feuchteren Witterung gut entwickelt. „Das Ziel ist, den<br />
Maisanbau zu reduzieren. Wir haben bislang 150 ha<br />
Mais für die Biogasanlage angebaut. Künftig sollen es<br />
nur noch 100 ha sein. Nach der Ernte des Wickroggens<br />
lässt sich noch Mais als Zweitfrucht säen. „Das hat zumindest<br />
2020 gut funktioniert“, hat Allmrodt erfreut<br />
festgestellt. Beim Mais setzte er früher ausschließlich<br />
auf 240er Sorten. Mittlerweile befindet sich aber ein<br />
Spektrum von S 270 bis S 210 im Anbau.<br />
Entscheidend für die Ertragsentwicklung sind die Niederschläge.<br />
„In den letzten Jahren waren das durchschnittlich<br />
440 Liter pro Quadratmeter und Jahr“,<br />
berichtet Allmrodt. In diesem Jahr fielen bereits bis<br />
Anfang August 320 Liter, im für den Mais relevanten<br />
Zeitraum bis Mai waren es 190 Liter. Wie sehr der Ertrag<br />
von den Niederschlagsmengen abhängt, zeigt sich<br />
mit Blick auf das nasse Jahr 2017. „Das war bisher das<br />
beste Maisjahr. Wir haben 43 Tonnen (t) Frischmasse<br />
(FM) pro ha geerntet. In den folgenden, trockenen Jahren<br />
waren es nur 25 t FM/ha.“<br />
Zwischenfrüchte gehören zum System<br />
Großen Raum nimmt der Zwischenfruchtanbau ein.<br />
Allmrodt sät die Zwischenfruchtmischungen der DSV<br />
aus, insbesondere die Saatgutmischung „Mais-Pro“.<br />
Sie wird nach Getreide ausgesät und dient als Vorfrucht<br />
für den Mais. Da das Stroh nicht abgefahren<br />
wird, kommt es zu einer N-Fixierung im Boden. „Der<br />
Stickstoff ist erforderlich, um das Stroh im Boden umzusetzen.“<br />
Zur Zwischenfrucht wird daher noch einmal<br />
Gärprodukt ausgebracht.<br />
Allmrodt orientiert sich dabei an der für die Herbstdüngung<br />
erlaubten Stickstoff-(N)-Menge von 60 Kilogramm<br />
(kg) N/ha. Das entspricht einer Gabe von 15<br />
Kubikmeter (m 3 )/ha. Zum Vergleich: Bei der Unterfußdüngung<br />
im Mais werden 35 m 3 ausgebracht. Rund 80<br />
Prozent des N-Bedarfs können mit dem Stickstoff aus<br />
dem Gärprodukt gedeckt werden. Der Bedarf an Phosphat<br />
und Kali wird – sofern erforderlich – durch eine mineralische<br />
Unterfußdüngung ergänzt. Auch das Grünland<br />
erhält im Frühjahr eine Gabe vom Gärprodukt. Die<br />
Leguminosen in der Zwischenfruchtmischung liefern<br />
weiteren Stickstoff. Auf rund 100 ha werden jährlich<br />
Zwischenfrüchte angebaut. Die Nährstoffversorgung<br />
der Pflanzen stellt Allmrodt mit einer Blattanalyse fest.<br />
Die vorherrschende Bodenart auf dem Standort ist lehmiger<br />
Sand. Die Bodenpunkte reichen von 25 bis 50.<br />
„Der Durchschnitt liegt bei 30 bis 35 Bodenpunkten“,<br />
ergänzt der Agrarier. Ein Problem ist der geringe<br />
Fotos: Michel Allmrodt<br />
Strip-Till-Verfahren zu Mais: Der Lohnunternehmer verwendet ein Gerät der Firma Volmer.<br />
„Die Besonderheit ist die Parabelform der Schare“, erläutert Michel Allmrodt: „ Sie heben den<br />
Boden an und lockern ihn. Es findet aber keine Durchmischung statt.“ Besonders ist auch,<br />
dass die Ablage des Gärproduktes in zwei unterschiedlichen Tiefen erfolgt: einmal in 15<br />
Zentimeter und zusätzlich noch in 30 Zentimeter Tiefe.<br />
66
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
praxis / Titel<br />
Der Mais wurde in die Stripp-Till-Reihe gelegt.<br />
Der junge Mais im Zweiblatt-Stadium.<br />
Der Mais hat sich gut entwickelt.<br />
Der Pflanzenabstand in der<br />
Reihe beträgt 18 Zentimeter. Der<br />
Abstand zwischen den Reihen<br />
beträgt 45 Zentimeter.<br />
67
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Auch die Maiskolben<br />
haben sich in diesem<br />
Jahr gut entwickelt.<br />
Bodenhorizont. Unterhalb von 40 Zentimeter kommt<br />
schon der Kies. „Umso wichtiger ist es daher, das Wasser<br />
im Boden zu halten. Wenn es erst einmal versickert<br />
ist, ist es weg und kann von den Wurzeln der Pflanzen<br />
nicht mehr erreicht werden.“<br />
Strip-Till auch zu Raps<br />
Ein vordringliches Ziel ist es somit, die Fruchtfolge weiter<br />
aufzulockern. Der Getreideanbau umfasst derzeit<br />
Roggen und Wintergerste, auf den besseren Standorten<br />
auch Weizen. Auf den schlechteren Standorten steht<br />
auch Raps. „Das ist zumindest noch in der Versuchsphase.<br />
Auch hier bringe ich zur Saat Gärprodukt im<br />
Strip-Till-Verfahren aus.“ Fest geplant ist eine Ausweitung<br />
des Leguminosenanbaus. Denn neben der Auflockerung<br />
der Fruchtfolge und den positiven Faktoren für<br />
den Boden spricht aus der Sicht des Landwirtes auch<br />
die Umgestaltung der Agrarpolitik dafür.<br />
So rechnet Allmrodt damit, dass der Leguminosenanbau<br />
Bestandteil der künftigen Agrarförderung werden könnte.<br />
In diesem Jahr fielen die Erfahrungen mit dem Anbau<br />
von Erbsen allerdings weniger positiv aus: In den heißen<br />
Tagen im Juni vertrockneten die Pflanzen und trieben<br />
nach den anschließenden Regenfällen wieder aus.<br />
Seit 2020 arbeitet der Betrieb pfluglos: „Den Pflug haben<br />
wir inzwischen verkauft.“ Zur tieferen Lockerung<br />
wird ein Grubber eingesetzt. Die flache Bodenbearbeitung<br />
erledigt er mit einer Federzinkenegge. Bei der<br />
Aussaat verlässt er sich auf die Universaldrillmaschine<br />
Rapid von Väderstad. Die Arbeitsbreite von 3 Meter<br />
reicht angesichts einer zu drillenden Fläche von 450<br />
ha gerade noch so aus. Das Bodenleben und der Bodenzustand<br />
haben sich durch die Umstellung auf die<br />
pfluglose Bewirtschaftung sehr verbessert. Das stellt<br />
Michel Allmrodt nicht nur bei der Bodenuntersuchung<br />
mit einer Sonde fest. „Auch die Regenwürmer fühlen<br />
sich anscheinend wohl. Ihre Zahl hat jedenfalls deutlich<br />
zugenommen.“<br />
Kniffelig ist die Direktsaat von Mais, räumt Allmrodt<br />
ein. „Der Boden muss warm sein. Der Mais braucht,<br />
um keimen zu können, eine Bodentemperatur von 8 bis<br />
10 Grad Celsius.“ Bei der pfluglosen Bearbeitung hat<br />
sich die Maisaussaat um rund eine Woche nach hinten<br />
verschoben. „In diesem Jahr kam der Mais am 5. Mai in<br />
den Boden.“ Auf die Vorteile des Strip-Till-Verfahrens<br />
will Michel Allmrodt auf keinen Fall wieder verzichten.<br />
Und das, obwohl das Verfahren auf den ersten Blick<br />
teurer erscheint: „Die Ausbringung des Gärproduktes<br />
im Strip-Till-Verfahren kostet mich 4,60 Euro je Kubikmeter.<br />
Mit dem Schleppschlauch sind es im Vergleich<br />
nur 3 Euro. Das Verfahren ist dennoch wesentlich effizienter,<br />
da ich keine weitere Bodenbearbeitung habe<br />
und der Mais die Nährstoffe mit seinen Wurzeln in der<br />
richtigen Tiefe erreichen kann.“<br />
Autor<br />
Thomas Gaul<br />
Freier Journalist<br />
Im Wehrfeld 19a · 30989 Gehrden<br />
01 72/512 71 71<br />
gaul-gehrden@t-online.de<br />
Foto: Thomas Gaul<br />
Individuelle Beratung und Konzepte<br />
• Anlagenerweiterung und -flexibilisierung<br />
• Optimierung des Anlagenbetriebes<br />
• Genehmigungsplanung<br />
• Vorbereitung, Betreuung sämtlicher Prüfungen<br />
neutral, herstellerunabhängig, kompetent<br />
Tel +49 (0)5844 976213 | mail@biogas-planung.de<br />
Nicht<br />
vergessen!<br />
BI<br />
Der Anzeigenschluss<br />
für die Ausgabe 6_<strong>2021</strong><br />
ist am 1. Oktober<br />
GaS Journal<br />
68
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
praxis / Titel<br />
Siliermittel für<br />
Klimaschutz? Ja!<br />
Eine sehr schnelle und intensive Substratvergärung mit der Schwerpunktproduktion<br />
von Essigsäure bringt sicheren Schutz vor Nacherwärmung und Verderb.<br />
Und ganz nebenbei reduzieren Sie Ihren CO 2<br />
-Fußabdruck in bemerkenswerter Dimension!<br />
Derzeit gibt es kein vergleichbares Produkt am Markt.<br />
WIR MACHEN ES VOR. NICHT NACH.<br />
Mehr Infos zum innovativsten Siliermittel-Programm erhalten Sie unter:<br />
Tel: 04101 218 54 00 // www.schaumann-bioenergy.eu<br />
69
praxis<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Veitshöchheimer Hanfmix im Test<br />
Im Mai des vergangenen Jahres begann in Mittelfranken ein interessanter Feldversuch<br />
im wörtlichen Sinne. Extrem auffällig war er zudem. Denn im von Landwirten ausgesäten<br />
Blühpflanzenmix mit insgesamt 30 heimischen Pflanzenarten waren auch Hanfsamen<br />
enthalten. Und der Hanf dominierte im ersten Jahr deutlich.<br />
Von Heinz Wraneschitz<br />
Veitshöchheimer<br />
Hanfmix im Testanbau<br />
als alternative zum<br />
Maisanbau im ersten<br />
Anbaujahr. Die Gaserträge<br />
blieben deutlich<br />
hinter den Erwartungen<br />
zurück. Die Hanfpflanzen<br />
verursachten<br />
zudem massive<br />
Ernteprobleme.<br />
Mit dem Projekt werden neue Akzente gesetzt,<br />
um die regionale Bedeutung von<br />
Biogasanlagen zu stärken und gleichzeitig<br />
den Nutzen für die Allgemeinheit<br />
herauszustellen.“ So beschrieb Mittelfrankens<br />
Bezirkstagspräsident Armin Kroder im Sommer<br />
2020 die Zielsetzung. Dafür haben sich mehrere<br />
Einrichtungen der bezirklichen Triesdorfer Anstalten<br />
mit dem regionalen Energiekonzern N-ERGIE und neun<br />
Landwirten in Mittelfranken zusammengefunden.<br />
Landauf, landab wird der heute oft zur Produktion von<br />
Biogas-Substrat eingesetzte Mais von Kritikern als „optischer<br />
Schandfleck“ gebrandmarkt. Oder wie es Josef<br />
Hasler, der Vorstandsvorsitzende der N-ERGIE AG bei<br />
der damaligen Projektpräsentation ausdrückte: „Das<br />
Stirnrunzeln wird immer größer.“ Wohl auch, weil großflächig<br />
angelegte Maisfelder nur wenig Nahrung für<br />
Bienen und andere Insekten bieten. Der Regionalversorger<br />
N-ERGIE – Hasler: „Wir haben uns der Nachhaltigkeit<br />
verschrieben“ – unterstützt deshalb das Projekt<br />
mit Ausgleichszahlungen an die Landwirte.<br />
Als Armin Kroder im Juli 2020 mitten in einem über<br />
zwei Meter hohen „Blühmix“ stand, war für ihn klar:<br />
So lassen sich „Regionalität, Klimaschutz und Biodiversität<br />
miteinander verbinden. Das ist nicht nur ein gesellschaftlicher<br />
Wunsch, sondern gleichzeitig ein neuer<br />
Denkansatz für die zukünftige Ausrichtung der Biogasbranche.“<br />
Daraus ragte der Hanf noch hervor. N-ERGIE-<br />
Mann Hasler war „verwundert, dass das Gewächs schon<br />
so übermächtig ist“. Und das noch lange vor der Ernte.<br />
Manuel Westphal, Landrat des Kreises Weißenburg-<br />
Gunzenhausen und Vorsitzender der „Mittelfränkischen<br />
Gesellschaft zur Förderung Erneuerbarer Energien und<br />
nachwachsender Rohstoffe e.V.“, kurz MER, sah sich<br />
in seinem Wunsch nach einer „Auflockerung der Landschaft“<br />
bestätigt. Und auch Bauer Markus Sandmann,<br />
auf dessen Feld im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad<br />
Windsheim der Pressetermin stattfand, gab sich ob der<br />
teils riesigen und bunten Gewächse optimistisch: „Der<br />
Gasertrag ist hoffentlich nahe am Mais.“ Denn die Biogasanlagen<br />
müssen sich rentieren – und dazu gehört<br />
ein möglichst hoher Anteil Trockenmasse an der Ernte.<br />
Der Veitshöchheimer Hanfmix<br />
Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, in<br />
Veitshöchheim ansässig, hat diese Biogas-Saatgutmischung<br />
entwickelt. Der Mix enthält 30 verschiedene Pflanzen. Darunter<br />
sind ein- und zweijährige Pflanzen – beispielhaft genannt seien<br />
das Schmuckkörbchen, der Faserhanf, die Nachtkerze. Aber auch<br />
mehrjährige Stauden wie die Wegwarte, Stockrose oder das Echte<br />
Labkraut sind enthalten. Alle zusammen bieten Lebensraum<br />
und Nahrung für Insekten, Vögel und Kleintiere.<br />
70
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
flexibele Lager- und<br />
Abdecksysteme<br />
Ihr Partner für<br />
Ernte des Veitshöchheimer Hanfmixes mit dem Feldhäcksler. Die Restpflanzen bedecken den Boden noch gut.<br />
Klärung ökologischer Fragen<br />
Die Fragestellung für den Feldversuch<br />
war also klar umrissen: „Wie gut lässt<br />
sich der weit verbreitete Mais als Biogasanlagen-Futter<br />
ersetzen?“ Dafür hatten<br />
neun Biogasbauern auf zehn ihrer Felder<br />
in Mittelfranken den von der Bayerischen<br />
Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau<br />
(BLAWG) entwickelten „Veitshöchheimer<br />
Hanfmix“ ausgesät. Untersucht werden<br />
sollten laut N-ERGIE-Vorstand Josef Hasler<br />
„zwei Aspekte: einerseits, wie sich die<br />
Blühpflanzen unter verschiedenen regionalen<br />
Bedingungen idealerweise für die<br />
Biogas-Anlagen einsetzen lassen. Und andererseits,<br />
welchen Effekt sie auf die Population<br />
von Insekten, Vögeln und Kleintieren<br />
sowie die Boden- und Grundwasserqualität<br />
haben.“ Laut BLAWG-Informationen soll<br />
ihr „Hanfmix für eine mehrjährige Blühfläche<br />
mit üppigem Nahrungsangebot für<br />
Insekten sorgen“.<br />
Emmissionsabdeckung<br />
Auch für<br />
TRAS120<br />
Triesdorf als Umwelt- und Energie-Nukleus<br />
Fotos: Heinz Wraneschitz<br />
In Triesdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Weidenbach, hat der Bezirk Mittelfranken seinen klaren<br />
Klimaschutz- und Energieschwerpunkt gesetzt. Vor mehreren Jahrzehnten begannen dort engagierte<br />
Lehrkräfte wie Johann Sedlmeier an den – damals noch landwirtschaftlichen – Lehranstalten, Nachhaltigkeit<br />
nicht nur in den Anbaumethoden, sondern auch in der Energieversorgung zu erkunden und<br />
den Lernenden nahezubringen.<br />
So gründete sich zum Beispiel schon 1987 unter Beteiligung des Bezirks Mittelfranken die MER, die<br />
Mittelfränkische Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe e.V.<br />
Um die MER herum entstand auch das Netzwerk Erneuerbare Energien Westmittelfranken. Viele dessen<br />
Mitglieder sind Bildungseinrichtungen, die wiederum ebenfalls hauptsächlich den Sitz in Triesdorf<br />
haben. Meist haben die sich aus dem landwirtschaftlichen Bildungszentrum heraus entwickelt.<br />
Eindrucksvolles Beispiel: Das „Fachzentrum für Energie und Landtechnik“ (FEL). Insgesamt 17 Mio.<br />
Euro hat der Bezirk in jüngerer Zeit in zwei neue Bauabschnitte der früheren Landmaschinenschule<br />
gesteckt. Im Herbst 2019 öffnete das gewaltige „Forum für Energie und Landtechnik“ seine Tore. Mit<br />
den bezirklichen Einrichtungen sind noch viele andere mit dabei, zum Beispiel der hier angesiedelte<br />
fränkische Teil der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf.<br />
In Triesdorf kümmert man sich einerseits um Boden, Wasser und Abfallwirtschaft. Das sogenannte<br />
„Fachzentrum für Energie und Landtechnik (FEL)“ andererseits widmet sich den Themen Öffentlichkeitsarbeit,<br />
Fortbildung und Praxiserprobung. Die Praxis steht beim FEL ganz oben. So hat es ein komplettes<br />
„Energiewendemodell“ entwickelt, das „die komplexen Zusammenhänge der Energiewende<br />
anschaulich erklärt. Wir machen das Modell einer breiten Öffentlichkeit zugänglich“, erläutert Hans-<br />
Jürgen Frieß vom Kompetenzteam Erneuerbare Energien.<br />
Das fällt in Triesdorf umso leichter, als fast das ganze Bildungszentrum von einer Biogasanlage<br />
nebst Hackschnitzelheizung über ein Nahwärmenetz versorgt wird. Dass dazu viel Strom von der<br />
Sonne kommt, und zwar nicht nur für Gebäude und Werkstätten, sondern auch für landwirtschaftliche<br />
Nutzung, braucht fast nicht mehr erwähnt zu werden.<br />
WRA<br />
71<br />
Doppelmembrangasspeicher<br />
Gasspeicher<br />
Wiefferink B.V.<br />
Oldenzaal - Niederlande<br />
telefon < +31 541 571 616<br />
e-mail < info@wiefferink.nl<br />
internet < www.wiefferink.nl 71<br />
Auch für<br />
TRAS120
praxis<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
In Biogasanlagen könnten künftig statt Mais Blühpflanzen als Futter für die Bakterien dienen. Auf zehn Feldern in<br />
Mittelfranken bauen Bauern für drei Jahre den „Veitshöchheimer Hanfmix“, der aus Hanf und vielen Blühpflanzen<br />
besteht, an, um den tatsächlichen Energieertrag herauszufinden. Hinter dem Projekt steckt der Bezirk Mittelfranken<br />
mit seinen Lehranstalten Triesdorf und als Finanzier die N-ERGIE AG Nürnberg.<br />
Mitte August 2020 am Feld des Biogasproduzenten Markus Sandmann zwischen Baudenbach und Hambühl fand<br />
ein Open-Air-Pressegespräch statt mit Prominenz und Fachleuten. Von links: Bezirkstagspräsident Armin Kroder,<br />
Norbert Bleisteiner (Lehranstalten Triesdorf), Josef Hasler von der N-ERGIE AG, Landwirte Markus und Marvin<br />
Sandmann, Reinhard Streng, Stellvertretender Landrat Kreis NEA, Landrat Manuel Westphal, Kreis WUG und<br />
Vor s itzender des MER e.V.<br />
Nach der jährlichen Ernte der insgesamt 30 ein-, zweiund<br />
mehrjährigen heimischen Pflanzenarten gelte es,<br />
jeweils „festzustellen, wie viel Biomasse, wie viel Trockensubstanz,<br />
wie viel Methanausbeute dieser Veitshöchheimer<br />
Hanfmix hat“, erklärte Norbert Bleisteiner<br />
zu Beginn des Feldversuchs. Drei Jahre soll der erst<br />
einmal dauern.<br />
Laut Landwirt Sandmann war „für die Aussaat eine Bodenbearbeitung<br />
wie für Mais notwendig. Ich war selber<br />
überrascht, dass die Mischung besser als Mais gewachsen<br />
ist.“ Überrascht worden sei er aber auch von der<br />
Polizei. Denn „der Hanf war im ersten Jahr dominant“.<br />
Weshalb nicht wenige Vorbeikommende den Anbau von<br />
doppelt mannshohem Cannabis vermuteten. Dabei ist<br />
in der Veitshöchheimer Mischung nur eine Hanf-Variante<br />
ohne berauschende Wirkung enthalten.<br />
Mit der Analyse der Biomasse-Erträge<br />
ist das „Fachzentrum für Energie und<br />
Landtechnik“ (FEL) betraut. Norbert<br />
Bleisteiner, dessen Leiter, ordnet seine<br />
Bezirks-Einrichtung so ein: „Wir<br />
kommen nach der Wissenschaft und<br />
kurz vor dem Markt.“ Was nach der<br />
ersten Ernte in den FEL-Laboren passieren<br />
sollte, beschrieb er im Sommer<br />
2020 so: „Wir machen keine hochwissenschaftliche<br />
Auswertung, sondern<br />
eine, die Tendenzen aufzeigt und<br />
verständlich sein soll.“<br />
TM-Erträge überzeugten nicht<br />
Die Ernte selber – unser Autor war<br />
auf einem Acker in Großhabersdorf,<br />
Landkreis Fürth, selbst dabei – lief<br />
in weiten Bereichen unproblematisch<br />
ab. Verwendet wurden meist Maisernter<br />
von Lohnunternehmern. Doch laut<br />
nun veröffentlichtem ersten Bericht<br />
war auffällig: „Die Ernteergebnisse<br />
schwanken zwischen 3,0 und 8,3<br />
Tonnen (t) Trockenmasse (TM) pro<br />
Hektar (ha), im Durchschnitt erreichen<br />
sie 4,5 t TM pro ha.“ Zumindest<br />
im ersten Anbaujahr sei das weit weniger gewesen, als<br />
man bei Silomais (17 t TM/ha) hätte erwarten können.<br />
Selbst im Vergleich zu einem Vorläufer-Versuch<br />
in Veitshöchheim aus dem Jahr 2012 mit ebendieser<br />
Blühmix-Mischung war das Ergebnis ernüchternd: Dort<br />
sei im ersten Standjahr rund 9 t TM pro Hektar eingefahren<br />
worden, ist im Bericht zu lesen. Doch die Triesdorfer<br />
Auswerter geben zu: „Der Grund für die deutlichen<br />
Ertragsunterschiede beider Studien kann nicht<br />
ausgemacht werden.“ Diese im Juli <strong>2021</strong>, also gut ein<br />
Jahr nach dem Start des Feldversuchs bekannt gewordenen<br />
ersten Ergebnisse zeigen aber auf jeden Fall jetzt<br />
Veitshöchheimer Hanfmix<br />
im zweiten Anbaujahr.<br />
Die Hanfpflanzen sind<br />
verschwunden und<br />
mehrjährige Blühpflanzen<br />
erobern das Feld.<br />
72
von der TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG betreut<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
praxis<br />
bereits: Ganz so einfach ist es nicht, aus<br />
der Blühmix-Ernte wirtschaftlich Biogas zu<br />
erzeugen. Weshalb FEL-Chef Norbert Bleisteiner<br />
klarstellt: „Die Bauern werden das<br />
nur machen, wenn sie für die Biodiversitätseffekte<br />
einen entsprechenden Ausgleich<br />
bekommen. Denn eine Differenz von 30 bis<br />
50 Prozent war und ist zu erwarten.“<br />
Bleisteiner hat aber auch noch einen Vorschlag<br />
an die Veitshöchheimer Blüh-Mixer.<br />
Selbst wenn die einjährigen Pflanzen in den<br />
Folgejahren nicht mehr stark zu sehen sein<br />
werden: „Der Hanf sollte gleich draußen<br />
bleiben. Denn im ersten Jahr war der Aufwand<br />
für die Bauern sehr hoch: Einerseits<br />
wegen der langen Fasern. Und andererseits<br />
wegen der teils mehrfachen Polizeibesuche<br />
am Hof.“<br />
Ernteprobleme<br />
Die genannten „langen Hanf-Fasern“<br />
führten zu nicht ganz unbedeutenden<br />
technischen Problemen. „Nach der Mahd<br />
im Herbst sollen die bunten Blühwiesen<br />
nämlich zur Produktion von grünem Strom<br />
beitragen“, schrieb die Pressestelle des Bezirks<br />
Mittelfranken in der Ankündigung des<br />
Fototermins 2020 im Blüh„wald“. Ja, der<br />
Großteil der Ernte wurde später in Biogasfermentern<br />
genutzt. Doch das Wort „Mahd“<br />
war für die oft recht dickstieligen und faserigen<br />
Pflanzen nicht das passende Wort:<br />
Um den Blühmix zu ernten, waren schon<br />
ausgewachsene Maishäcksler notwendig.<br />
Und selbst die hatten teilweise Probleme.<br />
Vor allem zwei Ernteschwierigkeiten beschreibt<br />
der „Bericht zum ersten Anbaujahr<br />
2020 Blütenreiche Energiepflanzen“,<br />
verfasst gemeinsam von MER und FEL.<br />
Die eine: „Mehrmals hat sich der Beförderungskanal<br />
zwischen Häckselwerk und<br />
Wurfgebläse der Erntemaschine verstopft.<br />
Immer wieder setzte sich das Wurfrohr zu<br />
und musste freigeräumt werden, wodurch<br />
die Ernte 2,5 Stunden je Hektar dauerte.“<br />
Aber immerhin: „Die Häckselqualität<br />
selbst war gut.“<br />
Anders bei jenem Betrieb, der schon<br />
Ende August die Ernte durchzog: „Das<br />
Häckselergebnis des Ernteguts lag nicht<br />
im erwünschten Bereich. Die Fasern der<br />
Hanfpflanze wurden nicht abgeschnitten,<br />
stattdessen waren im Erntegut bis zu 50<br />
Zentimeter lange Fasern zu finden.“ Deshalb<br />
wurde „das Erntegut nicht als Substrat<br />
in der Biogasanlage verwendet. Durch die<br />
Zerfaserung des Hanfes bestand die Gefahr,<br />
dass Anlagenteile wie Pumpen oder<br />
Rührwerke beschädigt werden.“ Die Ernte<br />
wurde stattdessen als organischer Dünger<br />
wieder auf das Feld ausgebracht.<br />
Andere Projekt-Landwirte mit ähnlicher<br />
Erntetechnik bei Ernte-Fabrikat und<br />
-Schneidwerk hatten dagegen keine Faser-<br />
Probleme. „Bei Hanf ist wichtig, dass alle<br />
Häckslermesser und die Gegenschneide<br />
scharf sind und jeweils perfekt aufeinander<br />
abgestimmt sind“, steht als wichtige<br />
Erkenntnis im Projektbericht.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. Heinz Wraneschitz<br />
Feld-am-See-Ring 15a<br />
91452 Wilhermsdorf<br />
0 91 02/31 81 62<br />
heinz.wraneschitz@t-online.de<br />
www.bildtext.de · www.wran.de<br />
Robuste beschichtungssysteme<br />
Wir lassen nichts an Ihren Beton!<br />
Fachbetrieb nach WHG<br />
www.besatec.eu<br />
Sanieren und Beschichten<br />
I Biogasbehälter<br />
I Fahrsilos<br />
I Futtertische<br />
I Luftwäscher<br />
Besatec Holsten GmbH · Am Rübenberg 8 · 38104 Braunschweig · 0531 3557 3630 · info@besatec.eu<br />
73
praxis<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Energiewende?<br />
Biogas ade –<br />
Nach zwei<br />
Jahrzehnten<br />
Erzeugung<br />
steht am Ende<br />
des Jahres<br />
endgültig<br />
das Aus<br />
Der Hof Eggert steht beispielhaft<br />
für die aktuelle Entwicklung, dass<br />
immer mehr Landwirtschaftsbetriebe<br />
nicht weitergeführt werden.<br />
Vor allem haben Politik und<br />
Gesellschaft zu verantworten, dass<br />
im Sektor Landwirtschaft Menschen<br />
auf ihren Höfen keine Zukunft<br />
sehen. Hier geht ein kulturelles<br />
Erbe den Bach runter.<br />
Die Biogasanlage von Wolfram Eggert im schleswig-holsteinischen Bornhöved ist ein<br />
schillernder Spiegel der Pionierzeit. Sie war eine der ersten im nördlichsten Bundesland<br />
und gehört nun zu den ersten, die stillgelegt werden. Wieso eigentlich? Die Gründe<br />
dafür sind vielschichtig. Ein Hofbesuch.<br />
Von Dierk Jensen<br />
Ende des Jahres ist endgültig Schluss. Ende,<br />
aus, vorbei. Nach 20 Jahren bewegender<br />
Biogaserzeugung wird Wolfram Eggert seine<br />
Anlage am Ortsrand von Bornhöved im Kreis<br />
Segeberg stilllegen. Ohne Gram, ohne Lamento,<br />
ohne Bedauern. Das ist sowieso nicht sein Stil.<br />
„Sie müssen nicht nach hinten schauen, sondern gucken<br />
Sie nach vorne!“, ist die Lebenslosung des engagierten<br />
Landwirts und Biogasproduzenten. Dabei ist er<br />
74 Jahr alt und trotzdem, so der nachhaltige Eindruck,<br />
fit wie ein Turnschuh.<br />
Die Entscheidung, seine Anlage stillzulegen, liegt<br />
schon ein paar Jahre zurück. Sein Sohn hatte sich gegen<br />
den Hof und für den Job als Tierarzt entschieden.<br />
So war schon seit Längerem klar, dass die Gülle- und<br />
Abfallvergärungsanlage mit einer elektrischen Leistung<br />
von 150 Kilowatt (kW) zum Ende der 20-jährigen EEG-<br />
Laufzeit nicht weiterbetrieben wird. Während der Motor<br />
noch läuft und Strom in die Leitungen der SH-Netz<br />
speist und draußen an der neuen Lagune gearbeitet<br />
wird, ist der Stall schon seit 2019 leer. Früher hat Eggert<br />
hier 3.000 Ferkel in einem Außenklimastall aufgezogen,<br />
beheizt mit der Abwärme seiner Biogasanlage.<br />
Betriebsbeginn 2001<br />
Heute strahlt der Ferkelstall eine bizarre Stille aus. Obwohl<br />
es einige Anfragen von Berufskollegen gab, den<br />
Stall zu nutzen, ist er leergeblieben. Umso engagierter<br />
schildert Eggert beim Rundgang über seinen Hof über<br />
die anfänglichen Motive und das sich über die Zeit<br />
immer wieder verändernde Betreiberkonzept seiner<br />
Anlage. Diese war bei Betriebsbeginn im Jahr 2001<br />
nach seinen Aussagen erst die dritte oder vierte Anlage<br />
überhaupt in Schleswig-Holstein.<br />
Die ersten Gedanken zum Bau seiner Anlage entstanden<br />
Ende der Neunzigerjahre. Damals hatte er,<br />
Sohn vorpommerscher Eltern, die als Flüchtlinge zum<br />
Kriegsende in den Westen kamen und nach einigen<br />
Umwegen Ende der Fünfzigerjahre den Aussiedlerhof<br />
bei Bornhöved mit langjähriger Schuldlast erwarben,<br />
sich entschieden, seine Milchquote mit 360.000 Liter<br />
zu verkaufen. Da er neben der Milcherzeugung parallel<br />
Fotos: Dierk Jensen<br />
74
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
praxis<br />
auch schon 300 Schweine mästete, optierte er den<br />
Bau eines neuen Außenklima-Stalls, in dem er Ferkel<br />
aufziehen wollte. Genauer gesagt 3.000 Jungtiere.<br />
„Bei so einer Zahl fällt eine Menge Gülle an“, erinnert<br />
er sich an jene Zeit, als viele Leute über Biogas redeten,<br />
aber die wenigsten es tatsächlich machten. Ganz<br />
abgesehen davon, dass wohl noch weniger wirklich<br />
wussten, wovon sie eigentlich sprachen.<br />
Aber Eggert informierte sich, erkundigte sich über das<br />
damals noch neue Thema und wagte schließlich den<br />
Sprung ins Abenteuer namens Biogasgewinnung. Dabei<br />
dachte er damals, das räumt er aus der Sicht von<br />
heute ein, weniger an die erneuerbare Stromproduktion,<br />
sondern vielmehr an die energetische Verwertung<br />
der Gülle und den zu deckenden Wärmebedarf in seinem<br />
Ferkelstall.<br />
Umstellung auf Abfallvergärung<br />
Dass die Ferkelgülle aber alleine zu wenig Energie enthält,<br />
um eine Biogasanlage wirtschaftlich betreiben zu<br />
können, war allerdings schnell klar. Und das obwohl<br />
seine Investitionen von 360.000 Euro von der damaligen<br />
Bundesregierung zu einem Drittel bezuschusst<br />
worden ist. Für die Kilowattstunde Strom hat er damals<br />
umgerechnet in Euro rund 10 Cent bekommen. Und<br />
weil die Energieausbeute aus der Gülle nicht reichte<br />
und ihm seine Berater Krieg & Fischer zu fettreichen<br />
Inputstoffen rieten, orderte Eggert fortan aus allen<br />
Richtungen organische Abfallstoffe, die er in seinen<br />
800 Kubikmeter großen Fermenter einbrachte.<br />
Beispielsweise Mandelschalen, die bei der Lübecker<br />
Marzipanproduktion in großen Mengen anfallen. Aber<br />
auch Chargen aus der bunten Palette der übrigen Lebensmittelerzeugung<br />
waren dabei. Dabei kam es aufgrund<br />
der Wechsel der Inputstoffe manchmal zu bösen<br />
Überraschungen im Fermentationsprozess. „Einmal<br />
gab es eine Fehlgärung, bei der so viel Schaum entstand,<br />
dass fast der ganze Hof davon überdeckt war“,<br />
schmunzelt Eggert mit dem ausreichenden Abstand<br />
von einigen Jahren über eine vollkommen aus der Kontrolle<br />
geratene anaerobe Gärung. Es war kein Einzelfall<br />
– in manchen Jahren kippte die Biologie mehr als<br />
einmal um.<br />
Und dennoch: Eggert hat mit der Biogasanlage trotz<br />
aller Schwierigkeiten in längeren Phasen Geld verdienen<br />
können. Viele Inputstoffe bekam er gratis auf den<br />
Hof. Nachdem der erste Motor mit 75 kW elektrischer<br />
Leistung nach rund 45.000 Betriebsstunden durch<br />
ein 150 kW großes Aggregat ersetzt wurde, hätte es<br />
wirklich rund laufen können. Doch dann brannte der<br />
neue Motor, weil beim Einbau ein fataler Fehler begangen<br />
wurde. Sechs Wochen lang stand alles still.<br />
Teure Wochen für ihn als Anlagenbetreiber, weshalb<br />
er gegen die Haftpflichtversicherer des Motorlieferanten<br />
prozessierte. Und tatsächlich bekam Eggert nach<br />
einigen Jahren zähen Streites vor den Gerichten eine<br />
Entschädigung ausgezahlt.<br />
Ungeplante Kosten kurz vor Betriebsschluss<br />
„Ich habe mit Biogas so ziemlich alles erlebt, was<br />
man sich so vorstellen kann“, bekennt Eggert. Die<br />
Herausforderungen reichen bis in die Gegenwart. So<br />
verfing sich in diesem Frühjahr das Rührwerk in der<br />
Abdeckung seiner Lagune; ein Malheur, das inklusive<br />
Abpumpen des Gärrestes, Auslegen einer neuen gummiartigen<br />
Beschichtung am Ende fast 40.000 Euro<br />
kostete – und das ungefähr ein halbes Jahr vor dem<br />
geplantem Betriebsschluss! Aber als einer der Pioniere,<br />
die wertvolle Vorarbeit geleistet haben und manchmal<br />
schmerzhafte Erfahrungen machen mussten, von der<br />
die Biogasbranche mittlerweile profitiert, bringt ihn<br />
auch so eine Havarie nicht mehr aus der Ruhe.<br />
Dabei ist ihm, dem Noch-Bioenergieerzeuger aus dem<br />
Kreis Bad Segeberg, in der Vergangenheit auch vonseiten<br />
der Behörden nichts geschenkt worden. Als er<br />
im Zuge der Novellierung des Abfallwirtschafts-<br />
150 Kilowatt elektrische<br />
Leistung hat das<br />
Blockheizkraftwerk<br />
von Wolfram Eggert.<br />
Ab Jahresende steht<br />
es still.<br />
Leerer Schweinestall –<br />
schon seit 2019: Früher<br />
hat Wolfram Eggert<br />
hier 3.000 Ferkel in<br />
einem Außenklimastall<br />
aufgezogen, beheizt<br />
mit der Abwärme seiner<br />
Biogasanlage.<br />
75
praxis<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
„Überall, wo man hinschaut, geben Betriebe auf,<br />
das ist dramatisch, das ist für den ländlichen<br />
Raum ein Drama“<br />
Wolfram Eggert<br />
gesetzes vor einigen Jahren die Auflage erhielt, den<br />
Gärrest auf 70 Grad Celsius zu hygienisieren, beendete<br />
er kurzerhand die Abfallvergärung. „Das wollte<br />
ich nicht mitmachen, weil ich das fachlich für nicht<br />
sinnvoll hielt. Außerdem hätte ich dann nicht mehr genug<br />
Wärme für meine Ferkel übrig gehabt“, erklärt Eggert.<br />
Stattdessen meldete er beim Netzbetreiber seine<br />
Abfallanlage als NawaRo-Anlage um. Fortan vergor er<br />
Mais & Co. zusammen mit der Ferkelgülle in der Anlage.<br />
Mit KWK-, Gülle- sowie NawaRo-Bonus erhielt er<br />
rund 21 Cent pro Kilowattstunde.<br />
In diesem Frühjahr verfing<br />
sich das Rührwerk<br />
in der Abdeckung seiner<br />
Lagune; ein Malheur,<br />
das inklusive Abpumpen<br />
des Gärrestes, Auslegen<br />
einer neuen gummiartigen<br />
Beschichtung<br />
am Ende fast 40.000<br />
Euro kostete – und das<br />
ungefähr ein halbes<br />
Jahr vor dem geplanten<br />
Betriebsschluss!<br />
Als er sich nach dem Tod seiner an Parkinson<br />
erkrankten Frau entschied, die<br />
Ferkelproduktion endgültig einzustellen<br />
und mit seiner Biogasanlage wieder<br />
zur Kofermentation zu wechseln,<br />
lehnte die zuständige Abfallbehörde<br />
in Bad Segeberg dies brüsk ab. Wenn<br />
ihm auch der Ärger über die Ablehnung<br />
noch heute anzumerken ist, hat er sich<br />
auch davon nicht beeindrucken lassen.<br />
Statt Mandelschalen lässt er eben die<br />
Gülle vom benachbarten Milchviehbetrieb<br />
in den Fermenter fahren; wie<br />
es aussieht, wird dieser Güllelieferant<br />
nach Aufgabe der Biogasanlage die<br />
Wirtschaftsgebäude von Eggert erwerben<br />
und dann für seine Zwecke nutzen.<br />
Auch soll der Betrieb einen Großteil der<br />
60 Hektar Eigenland, die gegenwärtig<br />
noch von einem anderen Milchviehbetrieb<br />
bewirtschaftet werden, der aber<br />
auch aufgibt, künftig an den Güllelieferanten<br />
verpachtet werden. „Überall,<br />
wo man hinschaut, geben Betriebe auf,<br />
das ist dramatisch, das ist für den ländlichen<br />
Raum ein Drama“, stellt er im<br />
großräumigen Wintergarten seines in den Fünfzigerjahren<br />
gebauten Aussiedlerhofes fest. „Man fühlt sich als<br />
Mitglied eines ganzen Berufsstandes betrogen von der<br />
Gesellschaft, überall ist man der Buhmann und arbeitet<br />
doch mehr als alle anderen und am Ende reicht es nicht<br />
mal für die Existenz. Da geht in meinen Augen etwas<br />
schief.“<br />
Doch will er nicht beim Klagen stehenbleiben. Er<br />
blickt, ganz sein Lebensmotto, lieber nach vorne. So<br />
erntet er weiterhin den Solarstrom auf dem Stalldach<br />
und betreibt einen 70-kW-Kessel, den er mit Holzhackschnitzel<br />
von den eigenen Knicks beschickt. Zudem<br />
will er zusammen mit anderen Landwirten eine Freiflächen-Solaranlage<br />
errichten. Von insgesamt 30 Hektar<br />
ist die Rede, die die Hamburger Projektierungsfirma<br />
Enerparc AG sich schon vertraglich gesichert hat. Ob<br />
am Ende auch gebaut wird, steht zwar noch nicht fest,<br />
aber jemanden wie Eggert mit seinen Erfahrungen im<br />
Biogasbereich kann, egal was passiert, wahrlich nur<br />
noch wenig erschüttern.<br />
Autor<br />
Dierk Jensen<br />
Freier Journalist<br />
Bundesstr. 76 · 20144 Hamburg<br />
040/40 18 68 89<br />
dierk.jensen@gmx.de<br />
www.dierkjensen.de<br />
76
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
praxis<br />
PSM TAUCHRÜHRGERÄT<br />
MINIMALER ENERGIEBEDARF.<br />
MAXIMALE RÜHRLEISTUNG.<br />
Biogas, was sonst.<br />
Wir planen und bauen Biogas-Anlagen für alle Einsatzstoffe<br />
• Herstellerunabhängige Anlagenerweiterung und -umbau<br />
• Wir beraten und unterstützen bei der Teilnahme an der Ausschreibung<br />
• Neues zur EEG Reform <strong>2021</strong>, fragen sie einfach nach!<br />
• 25 Jahre Erfahrung<br />
Biogas-Aufbereitungsanlagen<br />
• Biogas zur Tankstelle oder in das Erdgasnetz<br />
Monovergärung von Geflügelmist<br />
• Verfahren (patentiert)<br />
www.aev-energy.de<br />
AEV Energy GmbH®<br />
AEV Energy GmbH ® – Büro Regensburg<br />
Hohendölzschener Str. 1a<br />
Gutweinstraße 5<br />
01187 Dresden<br />
93059 Regensburg<br />
+49 (0) 351 / 467 1301<br />
+49 (0) 941 / 897 9670<br />
MAPRO International info@aev-energy.de LOGO.pdf 1 info@aev-energy.de<br />
12.11.13 10:21<br />
»<br />
Permanentmagnetmotor für maximale Effizienz<br />
und Langlebigkeit<br />
»<br />
Erhebliche Reduzierung der Rührkosten um bis zu 50%<br />
»<br />
Mehr Rührleistung für mehr TS im Fermenter<br />
»<br />
BMWi / BAFA-Zuschuss* von bis zu 40% möglich<br />
* Bundesförderung Energieeffizienz in der Wirtschaft (Modul 4/295)<br />
UTS Products GmbH · Telefon: 02923 - 610940<br />
www.anaergia-technologies.com<br />
MAPRO ® GASvERdIchTER<br />
volumenströme bis zu 3600 m³/h<br />
und drücke bis zu 3,2 bar g<br />
A Company of<br />
MAPRO ® INTERNATIONAL S.p.A.<br />
www.maproint.com<br />
WARTUNG ZUM FESTPREIS<br />
MAPRO ® Deutschland GmbH<br />
Tiefenbroicher Weg 35/B2 · D-40472 Düsseldorf<br />
Tel.: +49 211 98485400 · Fax: +49 211 98485420<br />
www.maprodeutschland.com · deutschland@maproint.com<br />
KOMPONENTEN FÜR BIOGASANLAGEN<br />
QUALITÄT<br />
AUS<br />
VERANTWORTUNG<br />
■ Fermenterrührwerke für Wand- und<br />
Deckeneinbau Robuste und leistungsstarke Bauweise energieeinsparend<br />
+ hocheffizient.<br />
■ Separatoren für Biogasanlagen<br />
stationär / als mobile Einheit<br />
BIS ZU<br />
40%<br />
ZUSCHUSS<br />
DURCH KFW<br />
MÖGLICH<br />
■ Rührwerke für Nachgärbehälter<br />
und Endlager<br />
■ Pumptechnik für Biogasanlagen<br />
■ Panoramaschaugläser Nachrüstung möglich<br />
PAULMICHL GmbH<br />
Kisslegger Straße 13<br />
88299 Leutkirch<br />
Tel. 0 75 63/84 71<br />
Fax 0 75 63/80 12<br />
www.paulmichl-gmbh.de<br />
77
praxis<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Anlage des Monats Juli:<br />
Vergärungsanlage der<br />
RETERRA Service GmbH<br />
Die im Jahr <strong>2021</strong> in Betrieb gegangene Teilstromvergärungsanlage<br />
der Firma RETERRA in Erftstadt vergärt<br />
pro Jahr rund 25.000 Tonnen Bioabfälle aus den<br />
Biotonnen des Einzugsgebietes. Mit einer installierten<br />
elektrischen Leistung von 2.100 Kilowatt (kW)<br />
(946 kW Bemessungsleistung) erzeugt die Anlage in den zwei<br />
Blockheizkraftwerken am Standort rund 5 Millionen Kilowattstunden<br />
Strom, der über den Direktvermarkter Next Kraftwerke<br />
vermarktet wird.<br />
Das am Ende des Gärprozesses übrigbleibende Gärprodukt wird<br />
komplett zu hochwertigem Kompost weiterverarbeitet und größtenteils<br />
als landwirtschaftlicher Dünger eingesetzt. Insgesamt<br />
vermeidet die Biogasanlage pro Jahr rund 2.300 Tonnen CO 2<br />
.<br />
Anlage des Monats August:<br />
Biomethan Mühlacker GmbH & Co. KG<br />
Die Aufbereitungsanlage ist 2007 in Betrieb gegangen.<br />
Mit einer Gaseinspeiseleistung von umgerechnet<br />
5 Megawatt und einer installierten elektrischen<br />
Leistung von 400 kW erzeugt sie pro Jahr etwa 46<br />
Millionen Kilowattstunden (kWh) Gas und 7 Millionen<br />
kWh Strom. Das<br />
Gas wird in das Gasnetz<br />
der Stadtwerke Mühlacker<br />
eingespeist, die<br />
Verstromung erfolgt über<br />
ein Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) an der Anlage<br />
und verschiedene Satelliten-BHKW.<br />
Der Strom<br />
wird über Südweststrom<br />
direkt vermarktet.<br />
Die Wärme wird zur Hallen- und Gebäudeheizung und für die<br />
Gärprodukttrocknung eingesetzt: Aus 3.000 Kubikmeter Flüssigsubstrat<br />
entstehen dabei 300 Tonnen Pellets, die anschließend<br />
verkauft werden. Insgesamt vermeidet die Biogasanlage<br />
pro Jahr rund 10.000 Tonnen CO 2<br />
.<br />
78
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
praxis<br />
Anzeige<br />
Ulrike Stephan (Nord) • Mobil: 01 51 / 18 85 56 36<br />
Nils Albrecht (Mitte) • Mobil: 01 51 / 18 85 57 03<br />
Sebastian Schaffner (Süd) • Mobil: 01 51 / 18 85 53 16<br />
Ihre Berater KWS Biogas und<br />
KWS Feedbeet informieren:<br />
Rüben für Biogas:<br />
Ernte-Tipp<br />
Die Rübe ist ein energetisch hochwertiges<br />
Substrat für die Biogasanlage.<br />
Je nach Lagerungsart beginnen Ernte<br />
und Verwertung der Rüben auf den Höfen<br />
im September. Für einen guten Ernteverlauf<br />
und eine hohe Substratqualität<br />
empfehlen wir auf folgende Aspekte zu<br />
achten:<br />
Baur Folien GmbH<br />
Gewerbestraße 6<br />
D-87787 Wolfertschwenden<br />
0 83 34 99 99 1-0<br />
0 83 34 99 99 1-99<br />
info@baur-folien.de<br />
d www.baur-folien.de<br />
Schubbodensanierung<br />
in verstärkter<br />
Edelstahl-Lösung<br />
Axel Hagemeier GmbH & Co. KG<br />
Am Wasserfeld 8 • 27389 Fintel<br />
Tel.: 04265 / 13 65<br />
Fax: 04265 / 83 94<br />
E-Mail: info@axel-hagemeier.de<br />
Web: www.axel-hagemeier.de<br />
Doppelmembrangasspeicher | Emissionsschutzabdeckungen<br />
Gasspeicher | EPDM-Hauben<br />
Leckagefolien<br />
Die Ertragszuwächse sind von Anfang<br />
September bis Ende Oktober enorm:<br />
Unsere Erfahrungen zeigen 10-20 %<br />
Mehrertrag und je nach TS einen TME-<br />
Anstieg um bis zu 30 %.<br />
Während der Ernte sollten die Rüben<br />
möglichst wenig beschädigt und optimal<br />
geköpft werden. Es ist vorteilhaft, wenn<br />
sie trocken und frostfrei gerodet und<br />
etwa zwei Wochen in der Feldrandmiete<br />
gelagert werden. Beim Verladen lässt sich<br />
die anhaftende Erde gut abreinigen und<br />
die Rüben können in der Regel direkt<br />
verwertet werden. Auf steinigen Standorten<br />
kann eine Nassreinigung nötig sein.<br />
Werden die Rüben nicht frisch verfüttert,<br />
ist es oberstes Ziel eine qualitativ hochwertige<br />
Silage herzustellen. Eine gute<br />
Alternative zu reinen Rübensilagen sind<br />
Mischsilagen mit Silomais oder trockeneren<br />
Grasschnitten. Auch Körnermaisstroh<br />
ist ein interessanter Mischungspartner:<br />
Erntezeitpunkt und Beschaffenheit passen<br />
sehr gut zur Rübe. Mit dem Stroh kann<br />
eine saugfähige Unterschicht im Silo<br />
hergestellt werden, die den Sickersaft der<br />
oben aufgelegten Rübenschicht bindet.<br />
Gleichzeitig wird das Maisstroh durchfeuchtet<br />
und aufgeweicht wodurch der<br />
Gärprozess erleichtert wird. Mischsilagen<br />
sollten einen TS-Gehalt von 30 % in der<br />
Gesamtmischung haben.<br />
KWS unterstützt Sie bei der Planung:<br />
Gerne bestimmen wir den TS-Gehalt Ihrer<br />
Rüben stichprobenartig im KWS Labor.<br />
Sprechen Sie uns einfach an.<br />
Weitere Infos unter<br />
www.kws.de/energierueben<br />
79
International<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Biogasanlage der<br />
Ökoenergie Utzenaich,<br />
Oberösterreich.<br />
Österreich<br />
Wien<br />
Das neue EAG und seine Konsequenzen<br />
für die Biogasbranche<br />
Nach langjährigen Diskussionen ist am 27. Juli <strong>2021</strong> der erste Teil des Erneuerbaren-<br />
Ausbau-Gesetzes (EAG) in Kraft getreten, das dem Ökostromgesetz als Förderprogramm für<br />
den Ausbau der Erneuerbaren Energien nachfolgt. Österreich will Strom aus erneuerbaren<br />
Quellen bis 2030 um insgesamt 27 Terawattstunden (TWh) ausbauen. Davon entfallen<br />
11 TWh auf Photovoltaik, 10 TWh auf Wind, 5 TWh auf Wasserkraft und 1 TWh auf Biomasse.<br />
Das Ziel für erneuerbare Gase wird auf 5 TWh festgelegt.<br />
Von EUR ING Marie-Luise Schaller<br />
Der Österreichische Biomasse-Verband erwartet,<br />
dass es bei der Strom- und Gaserzeugung<br />
aus fester Biomasse auch zu einem<br />
Zubau kommen wird und Holzgas eine<br />
wesentliche Rolle bei der Produktion von<br />
erneuerbarem Gas spielen wird. Verhalten positiv bis<br />
kritisch sehen Vertreter der Biogas-Branche den leider<br />
unvollständigen Rechtsrahmen für die Gaseinspeisung.<br />
Als wesentlicher Baustein fehlt neben der Gasnetzzugangsregelung<br />
und der Investitionsförderung<br />
der Rechtsrahmen für Betriebsförderungen oder eine<br />
verpflichtende Quotenregelung samt Strafzahlung bei<br />
Nichterfüllung.<br />
Franz Kirchmeyr, Fachbereichsleiter Biogas beim Kompost<br />
& Biogas Verband Österreich, erläutert die Entwicklung<br />
und energiewirtschaftliche Bedeutung aus<br />
Sicht des Verbandes: „Das bisherige Ökostromgesetz<br />
regelt die Rahmenbedingungen wie Ausbaupfade und<br />
Konditionen für die Technologien der Erneuerbaren<br />
Energien. Die einzelnen konkreten Tarife wiederum<br />
werden in der dazugehörigen Verordnung durch den<br />
Minister festgelegt, basierend auf Gutachten. Bei der<br />
letzten kleineren Novelle gab es die politische Übereinkunft,<br />
dass ein neuer gesetzlicher Rahmen zu schaffen<br />
sei. Das EAG-Paket soll diesen Zweck erfüllen.“<br />
Für seine Ausgestaltung haben auch die EU-Leitlinien<br />
für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen<br />
von 2014 eine maßgebliche Rolle gespielt. Einerseits<br />
ermöglichten diese die Nachfolgetarife für Bestandanlagen<br />
mit der Verwertung von fester Biomasse und<br />
Biogas. Gleichzeitig forderte die EU, dass die Höhe der<br />
Vergütungen per Ausschreibung zu ermitteln sei und<br />
dass bei negativen Marktpreisen keine Anreize für die<br />
Einspeisung ins Stromnetz gegeben werden dürften.<br />
Die Umsetzung habe gewisse Konsequenzen, so dass<br />
die unterschiedlichen Akteure die Zielsetzungen für die<br />
Entwicklung anhand möglicher Entwicklungsszenarien<br />
diskutierten. Dabei wirke die Tank-Teller-Diskussion in<br />
Österreich schon länger als in Deutschland.<br />
Die Gaseinspeisung als Favorit<br />
Kirchmeyr stellt fest: „Österreich hat bedeutende Wasserkraftkapazitäten,<br />
Photovoltaik wird immer günstiger.<br />
Künftig ergibt sich damit im Sommer eine hohe<br />
Foto: Ökoenergie Utzenaich GmbH<br />
80
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
International<br />
Foto: Franz Kirchmeyr<br />
Franz Kirchmeyr, Fachbereichsleiter Biogas,<br />
Kompost & Biogas Verband Österreich.<br />
Stromaufbringung aus Wasserkraft, PV und Wind.<br />
Negative Preise werden schätzungsweise in der Mitte<br />
des Jahrzehnts eine signifikante Rolle spielen. Dieses<br />
Damoklesschwert schwebt über den Betreibern, die wir<br />
frühzeitig informiert haben.“ Denn mit der fehlenden<br />
Planbarkeit für die Stromabnahme ergibt sich ein unkalkulierbares<br />
Risiko.<br />
Gleichzeitig habe man bereits sehr früh begonnen, die<br />
Potenziale der Gaseinspeisung mit der Gaswirtschaft<br />
zu diskutieren. Hier sind Fachwelt wie Politik sich weitestgehend<br />
einig, dass Reststoffe zu verwerten sind,<br />
Biogas bevorzugt ins Erdgasnetz einzuspeisen ist und<br />
eine Vor-Ort-Verstromung von Biogas nur an gasnetzfernen<br />
Standorten zu unterstützen ist.<br />
Förderkulissen für Biogas und Biomethan<br />
Zwei Förderinstrumente stehen zur Verfügung, für die<br />
Ökostromerzeugung die Marktprämie zuzüglich zum<br />
Referenzmarktpreis und für die Gaseinspeisung der Investitionszuschuss.<br />
Die Nachfolgeprämie für Bestandsanlagen<br />
ist eingeschränkt auch weiterhin möglich. Die<br />
Förderung mittels Marktprämie erfolgt für Anlagen auf<br />
Basis von Biomasse und Biogas auf Basis einer gleitenden<br />
Prämie, die zusätzlich zum Jahresreferenzmarktpreis<br />
gewährt wird.<br />
Während die Einspeisetarife für Ökostrom aus Biogas in<br />
der Ökostromverordnung 2018 bei 19,14 beziehungsweise<br />
18,97 Cent pro Kilowattstunde (kWh) lagen, ist<br />
die Höhe der Markprämie noch ungewiss. Die Festlegung<br />
erfolgt erneut in einer noch zu erlassenden Verordnung.<br />
Allerdings verpflichtet das EAG die Betreiber von Bestandsanlagen<br />
mit einer installierten Leistung von<br />
über 250 kW el<br />
, die nicht mehr als zehn Kilometer vom<br />
nächsten Gasnetzanschlusspunkt entfernt sind, nach<br />
dem Auslaufen des Tarifes innerhalb von 24 Monaten<br />
in die Gaseinspeisung zu wechseln. Eine Verlängerung<br />
ist im Falle begründeter Verzögerungen um weitere 24<br />
Monate möglich. Die übrigen Biogasanlagen erhalten<br />
die Nachfolgeprämie bis zum Ablauf des 30. Betriebsjahres.<br />
Ursprünglich waren im Ökostromgesetz 15 Jahre<br />
verankert.<br />
Darüber hinaus ist eine Investitionsförderung von<br />
maximal 45 Prozent für die Umrüstung bestehender<br />
Biogasanlagen auf Gaseinspeisung vorgesehen. Voraussetzung<br />
ist, dass bei den Substraten der Anteil von<br />
Getreide und Mais maximal 50 Prozent beträgt. Ab<br />
Antragstellung 2025 dürfen nur noch höchstens 30<br />
Prozent und ab 2027 nur 15 Prozent an Getreide und<br />
anderen Kulturpflanzen mit hohem Stärkegehalt, Zuckerpflanzen<br />
und Ölpflanzen eingesetzt werden.<br />
Die Neuerrichtung einer Anlage zur Erzeugung und<br />
Aufbereitung von erneuerbarem Gas kann durch einen<br />
Investitionszuschuss von maximal 30 Prozent gefördert<br />
werden, wenn diese Substrate höchstens 25 Prozent<br />
ausmachen. Ab Antragstellung 2025 dürfen nur mehr<br />
organische Reststoffe eingesetzt werden. Kirchmeyr<br />
weist darauf hin, dass für neue Biogasanlagen die Ausrichtung<br />
auf Gaseinspeisung Vorrang hat, obwohl der<br />
entsprechende Rechtsrahmen leider noch nicht fertig<br />
ist. Ausgenommen sind Anlagen von bis zu 250 kW el<br />
,<br />
die mindestens zehn Kilometer von der nächstgelegenen<br />
Gasleitung entfernt sind und örtlich vorhandene<br />
Reststoffe aus Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe<br />
sowie Haushalten verwerten. Sie dürften weiterhin zur<br />
Vor-Ort-Verstromung betrieben werden.<br />
Entwicklung des rechtlichen Rahmens<br />
für die Gaseinspeisung<br />
„In mehreren Gesprächen gelang es, die Gaswirtschaft<br />
davon zu überzeugen, dass im Endeffekt die Aufbereitung<br />
auf Erdgasqualität das Gassystem unnötig verteuert<br />
und vielmehr die technischen Anforderungen der<br />
Kundenanlagen die Richtung vorgeben müssten. Dies<br />
vor allem auch deshalb, weil es künftig nur noch erneuerbare<br />
Gase geben soll“, lässt Kirchmeyr einblicken. In<br />
einem ersten Schritt wurden daher Brennwertbezirke<br />
eingerichtet. Die Aufbereitungspflicht auf Erdgasqualität<br />
wurde durch die Formulierung „der anwendbaren<br />
Regeln der Technik“ ersetzt.<br />
Hinsichtlich der Übernahme der Kosten für den Anschluss<br />
an das Gasnetz wurden die Gasnetzbetreiber<br />
verpflichtet, die Kosten für bis zu 60 laufende Meter<br />
(lfm) pro Kubikmeter (m³) zu tragen, womit sich je 100<br />
m³ Einspeisemenge sechs Kilometer Leitungslänge ergeben.<br />
Der Gasnetzbetreiber trägt die Kosten für den<br />
Netzanschluss, die Mengenmessung, die Qualitätsüberwachung<br />
und Odorierung sowie die Kosten für die<br />
kontinuierliche Einspeisung notwendiger Verdichterstationen<br />
oder Leitungen.<br />
81
International<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Verteilung der Biomethananlagen in Österreich<br />
Quelle: Eigene Darstellung<br />
Ein Vergütungsschema beziehungsweise eine Quotenregelung<br />
samt Strafzahlung bei Nichterzielung sei<br />
bisher noch nicht fertig, weil die politischen Parteien<br />
uneins seien über die künftige Gasverwendung. Hinsichtlich<br />
der Raumwärme wird von manchen Akteuren<br />
angestrebt, nicht nur aus dem Heizöl, sondern auch<br />
aus der Gasheizung auszusteigen, was sehr kontrovers<br />
diskutiert werde.<br />
„Dabei wird ausgeblendet, dass das Gasnetz eine<br />
Winterspitzenlast von 28 Gigawatt (GW) aufweist,<br />
während die Spitzenlast beim Stromnetz bei 11 GW<br />
liegt. Weder die Stromnetze noch die erneuerbaren<br />
Stromerzeugungstechnologien können diese Lücke<br />
füllen. Speicherwasserkraft kann bei Niedrigstand im<br />
Winter etwa 6 GW über drei Tage liefern, anschließend<br />
müssen die Speicher wieder gefüllt werden. Der derzeitige<br />
Importbedarf an Strom liegt zu Winterspitzenzeiten<br />
schon bei 8 GW. Die Gasnetzspeicher können<br />
hingegen etwa einen Monat die gesamte Versorgung<br />
abdecken. Diese könnten sehr gut für die saisonale<br />
Speicherung von Biomethan genutzt werden“, argumentiert<br />
Kirchmeyr.<br />
Zudem seien steigende Grüngasverbräuche in Industrie<br />
und Gewerbe zu erwarten, wolle man das<br />
gegenwärtige wirtschaftliche Niveau halten. Und<br />
Kirchmeyr ergänzt: „In Richtung Klimaschutz leistet<br />
Biogas nachhaltige Systemleistungen. Damit ist der<br />
Wärmebedarf in der Industrie und der Strombedarf<br />
in Spitzenzeiten zu decken. Aber man gewinnt den<br />
Eindruck, dass man in eine Sackgasse hineinmanövriert<br />
wird.“<br />
Rückgang statt Ausbau?<br />
Aktuell gibt es gemäß ÖMAG-Vertragsregister 279<br />
Biogasanlagen mit 84,5 Megawatt (MW) elektrischer<br />
Leistung und 570 Gigawattstunden (GWh el<br />
) Jahresstromeinspeisung.<br />
Laut Biomasse-Verband wurden<br />
Ende 2018 etwa 350 GWh als Wärme genutzt und<br />
170 GWh Biomethan ins Erdgasnetz eingespeist.<br />
Demgegenüber produzierten Biomasse-KWK-Anlagen<br />
aus Holz jährlich mehr als 2.000 GWh Ökostrom und<br />
4.000 GWh Fernwärme (17 Prozent der gesamten<br />
Fernwärmeerzeugung). 2019 wurden rund 85 Prozent<br />
des in Österreich produzierten Biogas für Strom- und<br />
Wärmeerzeugung eingesetzt. Die restlichen 15 Prozent<br />
dienten direkt dem energetischen Endverbrauch, der<br />
zu fast 80 Prozent in der Industrie lag. Ins Erdgasnetz<br />
wurden 2019 rund 152 GWh biogener Gase eingespeist.<br />
Damit war nach langjähriger Zunahme erstmals<br />
ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen,<br />
der bei 11 Prozent lag. Die Einspeisung von erneuerbaren<br />
Gasen – derzeit fast ausschließlich Biomethan –<br />
soll stark ausgebaut werden und 2030 rund 5 TWh<br />
erreichen. Der Einsatz als Kraftstoff ist jedoch noch<br />
relativ unbedeutend. Die Abbildung zeigt die Lage der<br />
Biomethananlagen gemäß den Angaben auf der Internetseite<br />
von Kompost & Biogas. Die 15 Einrichtungen,<br />
die ins öffentliche Gasnetz einspeisen, besitzen eine<br />
Kapazität von 3.000 Normkubikmeter pro Stunde. Die<br />
erste Anlage ist allerdings bereits außer Betrieb, zwei<br />
weitere sind inzwischen dazugekommen. Überwiegend<br />
werden entweder Membranverfahren oder PSA als Aufbereitungstechnologie<br />
eingesetzt.<br />
82
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
International<br />
Foto: Ökoenergie Utzenaich GmbH<br />
Mehr Fragen als Antworten<br />
Josef Höckner betreibt seit 16 Jahren eine<br />
Biogasanlage in Oberösterreich mit 500<br />
kW el<br />
, die Feldreste, Stroh und Mist verwertet.<br />
Parallel entwickelt und vertreibt er<br />
technische Komponenten und biologische<br />
Verfahren zur Biomethanproduktion aus<br />
Stroh und Mist. Er beschäftigt 40 Mitarbeiter<br />
und bietet seine Produkte weltweit an.<br />
Für ihn als Betreiber ist das EAG einerseits<br />
ein Fortschritt, da nun Bestandsanlagen<br />
bis 250 kW el<br />
bis zu 30 Betriebsjahre lang<br />
gefördert werden können. Ein Problem ist<br />
allerdings, dass diese Verlängerung für Anlagen<br />
über 250 kW nicht gilt. Die Konzentration<br />
auf Reststoffe beurteilt er aufgrund<br />
der großen Rohstoff- und Klimaschutzpotenziale<br />
positiv. Doch sollten Hauptfrüchte<br />
nicht völlig ausgeschlossen sein. Insgesamt<br />
sieht er mehr Fragen als Antworten,<br />
vor allem wegen ungeklärter Biomethanvergütungsstrukturen.<br />
„Die Anlagenbetreiber wollen auf Biomethan<br />
umsteigen und sehen in der Erzeugung<br />
von Kraftstoff eine große Chance,<br />
die aber durch die einseitige Bevorzugung<br />
der Elektromobilität nicht genutzt werden<br />
kann. Nur wenn es für Biogas eine Gleichstellung<br />
in der Förderstrategie auf Basis<br />
der CO 2<br />
-Einsparung gibt, kann der Klimaschutz<br />
auch im Schwerlastverkehr vorankommen“,<br />
macht Höckner deutlich.<br />
Doch der Ausbau stagniere aufgrund der<br />
fehlenden Investitionssicherheit. Altanlagen<br />
drohe das Aus, wenn Nachfolgetarife<br />
enden. „Auf politischer Ebene ist Biogas<br />
nicht wirklich gewollt, nur geduldet.<br />
Hauptproblem ist, dass alle Verbrennungsmotoren<br />
in einen Topf kommen, schon auf<br />
EU-Ebene. Den Politikern kann es nicht<br />
ernst mit dem Klimaschutz sein, wenn der<br />
einzige technisch ausgereifte CO 2<br />
-neutrale<br />
Kraftstoff nicht verwendet wird, der spitzenlastfähig<br />
und sofort einsetzbar ist“,<br />
kritisiert Höckner. Dagegen müsse rigoros<br />
gegengearbeitet werden, ansonsten werde<br />
Biogas in der Versenkung verschwinden.<br />
Ausblick<br />
Zur Erfüllung der Klimaziele aus dem Pariser<br />
Abkommen ist eine 100-Prozent-Quote<br />
für grüne Gase erforderlich, ein geeignetes<br />
Umsetzungs- und Abwicklungssystem für<br />
die Biomethaneinspeisung dringend nötig.<br />
Die Bundesministerin Leonore Gewessler<br />
hat zugesagt, innerhalb eines halben<br />
Jahres dem Parlament den entsprechenden<br />
Rechtsrahmen zur Beschlussfassung<br />
vorzulegen. Die bisherige Nichtberücksichtigung<br />
des zweiten Energietransportnetzes<br />
für die Energiewende und die jetzt<br />
diskutierten Ausstiegsszenarien für Gas<br />
kennzeichnen die Problematik. Es bleibt<br />
abzuwarten, wie bei diesen Kontroversen<br />
die Rahmenbedingungen und die konkrete<br />
Wirkung auf die Ausbauaktivität aussehen<br />
werden.<br />
Autorin<br />
EUR ING Marie-Luise Schaller<br />
Freie Journalistin<br />
ML Schaller Consulting<br />
mls@mlschaller.com<br />
www.mlschaller.com<br />
Josef Höckner,<br />
Geschäftsführer<br />
BioG GmbH.<br />
Rührtechnik<br />
optimieren,<br />
Förderung<br />
kassieren!<br />
Steigern Sie die Effizienz Ihrer<br />
Biogasanlage und reduzieren Sie<br />
Ihre Stromkosten. Tauschen Sie ein<br />
altes Tauchmotor-Rührwerk gegen<br />
ein effizientes Stallkamp-Modell<br />
aus und sparen Sie Stromkosten!<br />
Je nach Anlagenkonstellation kann<br />
die Rührtechnik von der BAFA mit<br />
bis zu 40%* gefördert werden.<br />
Sprechen Sie Ihren Energieberater<br />
an! Weitere Infos unter<br />
www.stallkamp.de/foerderung<br />
| pumpen<br />
| lagern<br />
| rühren<br />
| separieren<br />
* Die Höhe der Förderung ist abhängig von der<br />
Stromeinsparung bzw. der jährlich eingesparten<br />
Tonne CO2.<br />
83<br />
Tel. +49 4443 9666-0<br />
www.stallkamp.de<br />
MADE IN DINKLAGE
International<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Dezentrale Abfallvergärungsanlage<br />
in Arcot im südindischen<br />
Bundes -<br />
staat Tamil Nadu.<br />
Neu-Delhi<br />
Bei einem derartigen Ausmaß an landwirtschaftlicher<br />
Aktivität fällt natürlich eine erhebliche Menge an Abfall<br />
in Form von Ernterückständen an. Auf die verschiedenen<br />
gegenwärtigen Praktiken zur Nutzung dieser Ernterückstände<br />
in Indien wird etwas später eingegangen.<br />
An dieser Stelle sei allerdings betont, dass sich die<br />
Aussichten auf indische Bioenergie- oder Biokraftstoffprogramme<br />
im Wesentlichen auf den Agrarsektor<br />
beziehen.<br />
Laut den Studien des IARI (Indian Agricultural Research<br />
Institute) aus dem Jahr 2018 entspricht der Anteil der<br />
Ernterückstände (auf trockener Basis) bei einigen ausgeindien<br />
Komprimiertes Biogas (CBG) –<br />
großes Potenzial aus landwirtschaftlichen<br />
Reststoffen<br />
Um seine Wirtschaft anzukurbeln, ist Indien derzeit in hohem Maße vom Import von Rohöl<br />
(etwa 80 Prozent des gesamten Ölbedarfs) und LNG (etwa 55 Prozent des gesamten Erdgasbedarfs)<br />
abhängig. Ein solch hohes Maß an Energieabhängigkeit fordert das Land dazu auf,<br />
alternative „einheimische“ Optionen zu erforschen und seine Energiesicherheit zu stärken.<br />
Von Gaurav Kedia und Abhijeet Mukherjee<br />
Mit seinen rund 168 Millionen Hektar<br />
Ackerland steht Indien, was den Anteil<br />
an der gesamten landwirtschaftlich genutzten<br />
Fläche angeht, nach den USA<br />
an zweiter Stelle. Der Agrarsektor trägt<br />
allerdings, wenngleich der Produktions- und Dienstleistungssektor<br />
in Indien auf dem Vormarsch sind, derzeit<br />
nur einen relativ geringen Anteil von etwa 15 Prozent<br />
zum indischen BIP (Bruttoinlandsprodukt) bei. Dennoch<br />
stellt dieser Sektor für über 50 Prozent (%) der<br />
Bevölkerung die Existenzgrundlage/den Arbeitsplatz<br />
und damit das Rückgrat der indischen Wirtschaft dar.<br />
Fotos: Indischer Biogasfachverband<br />
84
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
International<br />
wählten Kulturen im Land der Abbildung 1.<br />
Aus dem Tortendiagramm geht hervor, dass<br />
Reisstroh und -schalen (33 %), Weizenstroh<br />
(22 %), Zuckerrohrspitzen und Bagasse<br />
(17 %) und Baumwollstängel (10 %) fast<br />
80 % der Ernterückstände ausmachen. Von<br />
den verbleibenden 20 % fällt der Großteil<br />
auf Rückstände von Mais, Hülsenfrüchten<br />
(Straucherbsen, Pferdebohnen) und<br />
Ölsaaten (Soja, Raps-Senf, Erdnuss und<br />
Rizinus). Außerdem ist zu beachten, dass<br />
hinsichtlich der Erzeugung von Ernterückständen<br />
die fünf wichtigsten Staaten Uttar<br />
Pradesh, Maharashtra, Punjab, Madhya<br />
Pradesh und Gujarat sind.<br />
Für das Jahr 2019 schätzt das MNRE (Ministry<br />
of New and Renewable Energy, Indien),<br />
dass es sich bei zirka 178 Millionen<br />
Tonnen (~26 %) der gesamten Ernterückstände<br />
(682 Millionen Tonnen pro Jahr) um<br />
überschüssige Ernterückstände handelt,<br />
die potenziell für industrielle Energie genutzt werden<br />
könnten. Der Schätzwert dieses Ernteüberschusses<br />
ergab sich unter Berücksichtigung der verschiedenen<br />
Verwendungszwecke der Bruttoernterückstände, insbesondere<br />
als Viehfutter, zur Rückführung auf die abgeernteten<br />
Felder zur Wiederversorgung des Bodens (als<br />
Nährstoffe) sowie unter Berücksichtigung anderer lokaler<br />
Verwendungszwecke und bestehender Industrieprojekte,<br />
die für Ernterückstände vorgesehen waren.<br />
65 Prozent der Ernterückstände<br />
werden verbrannt<br />
Aus Berichten des CPCB (Central Pollution Control<br />
Board), einer Einrichtung unter dem Vorsitz des indischen<br />
Umweltministeriums, geht allerdings hervor,<br />
dass rund 65 % der überschüssigen Rückstände von<br />
den Landwirten auf den Feldern verbrannt werden.<br />
Dabei variieren die Gründe für das Verbrennen von<br />
Rückständen auf dem Feld von Region zu Region. Der<br />
Hauptbeweggrund scheint allerdings zu sein, dass die<br />
Felder sofort für die nächste Aussaat vorbereitet werden<br />
müssen.<br />
Abbildung 2 zeigt die schrittweise Nutzung der Erntereste<br />
und die letztendliche praktische Verfügbarkeit<br />
von überschüssigen Ernterückständen, gegebenenfalls<br />
für CBG-Projekte. Das technische Bruttopotenzial<br />
an Rückständen (GTP) entspricht der jährlichen<br />
Reststoffmenge (auf trockener Basis), die nach der<br />
Ernte der Feldfrüchte auf dem Feld anfällt und durch<br />
die Summierung der Bruttoreststoffe aller Feldfrüchte<br />
berechnet wird. Ausgehend von diesem geschätzten<br />
GTP werden dann verschiedene Wege der lokalen<br />
Nutzung aufgezeigt, insbesondere in Form von Viehfutter,<br />
der Rückführung auf die abgeernteten Felder<br />
zur erneuten Versorgung mit Bodennährstoffen und<br />
zur Verbesserung der Bodenqualität (wie vom DACFW,<br />
Abhijeet Mukherjee<br />
Gaurav Kedia<br />
dem Landwirtschaftsministerium, für ein effizientes<br />
Management von Ernterückständen empfohlen) und<br />
für Haushaltszwecke.<br />
So kann nach Bewertung des lokalen Bedarfs das technische<br />
Nettopotenzial (NTP) von Ernterückständen<br />
ermittelt werden. Für die Abschätzung individueller<br />
Bedürfnisse, die durchaus sehr ortsspezifisch sein<br />
können und den statistischen Durchschnitt möglicherweise<br />
verfälschen könnten, empfiehlt es sich, die Meinungen<br />
und Erfahrungen der betreffenden Landwirte<br />
(eine repräsentative Stichprobe) einzuholen. Im Rahmen<br />
von Programmen des IARI wurden bereits einige<br />
solcher Erhebungen in verschiedenen Bundesstaaten<br />
und Distrikten durchgeführt. Dazu zählt etwa das von<br />
der GIZ organisierte „Assessment towards the setting<br />
of biomass exchange“ (Bewertung zur Definition des<br />
Biomasseaustausches) mit den entsprechenden durchgeführten<br />
Studien.<br />
Abbildung 1: Prozentueller Anteil diverser Feldfrüchte<br />
in der Herstellung von Trockenrückständen<br />
Erdnuss 2%<br />
Senf 3%<br />
Mais 4%<br />
Sojabohne 4%<br />
Kichererbse 4%<br />
Baumwolle 10%<br />
Zuckerrohr 17%<br />
Straucherbse (Linse) 1%<br />
Rizinus 1%<br />
Weizen 21%<br />
Reis 33%<br />
85
International<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Kleine indische Haushalts-Biogasanlage.<br />
Darüber hinaus umfasst das praktische Potenzial (PP)<br />
von Ernterückständen aus dem im vorherigen Schritt<br />
geschätzten NTP im Wesentlichen den Überschuss an<br />
Rückständen, der unter Berücksichtigung aller anderen<br />
existierenden Verwendungsarten der Reststoffe<br />
über die vorgenannten lokalen Verwendungen hinaus<br />
verfügbar ist. Zu diesen bestehenden Verwendungen<br />
oder Anwendungen für Ernterückstände zählen:<br />
a) Die traditionelle Nutzung<br />
Abgesehen von der lokalen Nutzung im Haushalt,<br />
zum Beispiel als Brennstoff zum Kochen in Privathaushalten<br />
oder für den Bau und die Reparatur von<br />
Hausdächern aus Stroh, kann Biomasse auch in verschiedenen<br />
traditionellen und ländlichen Betrieben<br />
in großem Umfang genutzt werden: zum Beispiel als<br />
Wärmequelle für Ziegel-/Kalköfen, zum Parboilen<br />
von Reis, zur Herstellung von Holzkohle etc.<br />
b) Die moderne industrielle Nutzung<br />
Die moderne Nutzung von Biomasse bedient sich<br />
der Vorteile moderner Biomassetechnologien wie<br />
Verbrennung, Verdichtung, Pyrolyse, Vergasung,<br />
Vergärung und anaerobe Vergärung. Die aus diesen<br />
Prozessen resultierenden Produkte sind Briketts/<br />
Biopellets, RDF (refuse-derived fuel oder Ersatzbrennstoffe)<br />
oder Biokraftstoffe, wie Bioethanol<br />
und Biogas (CBG ist komprimiertes Biogas). Weitere<br />
innovative Verwendungsmöglichkeiten sind zum<br />
Beispiel die Pilzzucht oder die Verwendung als Flugasche<br />
im Straßenbau etc.<br />
Während die traditionelle lokale Nutzung von Biomasse<br />
voraussichtlich nur einen winzigen Teil ausmachen<br />
wird, sollte der Schwerpunkt auf die Einschätzung der<br />
Nutzung von Ernterückständen in eingetragenen Industrieprojekten<br />
gelegt werden. Das heißt, im Rahmen<br />
Biogas Journal 210x140<br />
Runderneuerung von Gummikolben für Kolbenpumpen!<br />
Alter beschädigter Kolben Altes Gummi ist entfernt Der erneut vulkanisierte Kolben<br />
86<br />
Technische Handelsonderneming<br />
Ersatzteile für die meisten üblichen Kolbenpumpen<br />
Registrieren und sofort kaufen in unserem Webshop!<br />
Tel.: 0031-(0)545-482157<br />
eMail.: info@benedict-tho.nl<br />
WWW.BENEDICT-THO.NL
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
International<br />
verschiedener Regierungsprogramme für<br />
die effektive industrielle Nutzung von<br />
Biomasse.<br />
Großer Forschungsbedarf<br />
hinsichtlich Reststoffnutzung<br />
An dieser Stelle sei angemerkt, dass die<br />
wachsende Erfahrung Indiens in der Erzeugung<br />
von industrieller Energie aus<br />
Biomassereststoffen erst wenig erforscht<br />
wurde und es deshalb diesbezüglich definitiv<br />
an Strukturstatistiken/Datenpunkten<br />
fehlt. Dennoch gibt es umfassende<br />
Informationen über Energieprojekte, die<br />
landwirtschaftliche Reststoffe verbrauchen<br />
oder dies planen, da sich ein großer<br />
Teil dieser Projekte auf staatlich geförderte<br />
Programme wie den Clean Development<br />
Mechanism bezieht, der über die UNFCCC (UN-<br />
Klimakonferenz) umgesetzt wird. Im Rahmen eines<br />
weiteren derartigen Förderprogramms stellt das MNRE<br />
finanzielle Unterstützung für die Errichtung von Anlagen<br />
zur Herstellung von Biomassepellets, -briketts und<br />
RDF zur Verfügung, was umgekehrt die Verarbeitung<br />
von landwirtschaftlichen Ernterückständen und festen<br />
Siedlungsabfällen begünstigt. Laut der Jahresberichte<br />
(2019) des MNRE wurden bisher 288 Projekte mit<br />
einer Gesamtleistung von 2.665 Megawatt aus Ernterückständen<br />
unterstützt.<br />
In jedem Fall könnten jedoch mehr Informationen auf<br />
Bundesstaatenebene über die Verbreitung dieser Projekte,<br />
wie etwa aus den Aufzeichnungen des MNRE<br />
sowie der betroffenen staatlichen Knotenpunkte<br />
(State Nodal Agencies, SNAs) für Energie und<br />
Biogasanlage in<br />
Ahmedabad, die das<br />
Biogas aufbereitet zu<br />
Erdgasqualität und in<br />
Gasflaschen abfüllt.<br />
Ahmedabad ist mit 5,6<br />
Millionen Einwohnern<br />
die fünftgrößte Stadt<br />
Indiens und das wirtschaftliche<br />
Zentrum in<br />
Gujarat.<br />
Just Premium<br />
NEU: Vertikal- und Blockpumpen mit IE4-Motoren<br />
· Elektromotoren der Effizienzklasse IE4 mit<br />
entsprechenden Frequenzumrichtern<br />
· Förderfähig nach BAFA Modul 1 (garantiert 40%)<br />
· Hohe Standzeiten<br />
Franz Eisele u. Söhne GmbH & Co. KG<br />
Hauptstr. 2-4 · 72488 Sigmaringen · Tel. +49 7571 109-0<br />
www.eisele.de<br />
87<br />
Knowledge in motion
International<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Abbildung 2: Schrittweise Bewertung der praktischen Nettoverfügbarkeit von Ernterückständen<br />
Pflanzenproduktion<br />
Technisches<br />
Bruttopotenzial von<br />
Rückständen (GTP)<br />
Technisches<br />
Nettopotenzial<br />
(NTP)<br />
Praktisches<br />
Potenzial<br />
(PP)<br />
Verwendung zur<br />
Bodenverbesserung,<br />
als Tierfutter und für andere<br />
lokale Zwecke<br />
Sonstige<br />
wettbewerbsfähige<br />
industrielle<br />
Nutzung<br />
Bild oben:<br />
Bioabfallvergärungsanlage<br />
in Indien.<br />
Unten: Preiswerte<br />
und skalierbare Mikrovergärungsanlage.<br />
Landwirtschaft, einen besseren Einblick in den Status<br />
der installierten und bevorstehenden Projekte geben.<br />
Diese Informationen sollten wiederum eine genauere<br />
Abschätzung der derzeit erfassten Ernterückstände (je<br />
nach Bundesland) und damit der aktuellen Verfügbarkeit<br />
für die Verarbeitung ermöglichen.<br />
Fazit: Trotz der Tatsache, dass die Bioenergie-Programme<br />
in Indien nicht das gewünschte Niveau erreicht haben,<br />
bietet Indien dank seiner reichlich vorhandenen<br />
überschüssigen Ernterückstände umfangreiche Möglichkeiten<br />
für die CBG-Produktion. Um genau zu sein,<br />
bewegen sich diese, selbst wenn die für die unmittelbare<br />
lokale Nutzung vorgesehenen Reststoffe und andere<br />
registrierte Industrieprojekte auf Biomassebasis<br />
berücksichtigt werden, in der Größenordnung von 178<br />
Millionen Tonnen pro Jahr (Millionen TPA). Das praktisch<br />
aus diesen Ernterückständen verfügbare Energiepotenzial<br />
entspricht etwa 18 Millionen TPA CBG (laut<br />
dem Bureau of Indian Standards), was ausreichen würde,<br />
um rund 10 Prozent der indischen Rohölimporte<br />
auszugleichen oder etwa 80 Prozent des derzeitigen<br />
Bedarfs des Landes an LPG (Flüssiggas) zu decken.<br />
Die tatsächliche Leistungsfähigkeit dieses geschätzten<br />
praktischen Potenzials der Ernterückstände hängt aber<br />
immer von mehreren anderen Faktoren ab, die betrieblicher,<br />
sozialer, wirtschaftlicher oder gesetzlicher Natur<br />
sein können. Der Einfachheit halber blieben diese Variablen<br />
jedoch im vorliegenden Artikel unberücksichtigt.<br />
Er soll klar machen, welche großartigen Möglichkeiten<br />
im gesamten noch unerschlossenen Potenzial der landwirtschaftlichen<br />
Reststoffe Indiens schlummern. Diese<br />
Möglichkeit verheißt auch Gutes für die angestrebten<br />
10 Gigawatt (über den Bioenergie-Kurs im indischen<br />
Energiemix) bis 2022, die von der indischen Regierung<br />
als Teil ihres NDC (national festgelegten Beitrags) vorgesehen<br />
wurden.<br />
Autoren<br />
Gaurav Kedia<br />
IBA-Vorsitzender<br />
Abhijeet Mukherjee<br />
IBA-Programmleiter<br />
Indian Biogas Association<br />
224, Spaze i-Tech Park, Sector 49,<br />
Gurugram, Haryana, Indien<br />
+91 124-4988 622<br />
info@biogas-india.com<br />
88
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
International<br />
Rund, schnell und flexibel<br />
Marktführer in der Herstellung und Montage von Stahlbeton-<br />
Fertigteilbehältern für die Biogas Industie.<br />
Hohe Qualität - Vorgefertigte Elemente<br />
in kontrollierter Umgebung<br />
Robuste Stahlbetonelemente - Auch ins<br />
Erdreich eingebundene Varianten möglich<br />
Flexible Produktpalette - Durchmesser<br />
bis 70 m und Wandhöhen bis 14 m<br />
Optimierte Baumethode - Sichere und<br />
schnelle Vor-Ort-Montage<br />
Kurze Bauzeiten - Kalkulierbare und<br />
schnelle Realisierung<br />
Kostengünstig - Ausgelegt für eine<br />
Lebensdauer von 50 Jahren<br />
Service rund um den Gasmotor<br />
Service vor Ort • Fachwerkstatt • Vertrieb Gasmotoren<br />
Der BHKW-Spezialist<br />
für Motoren mit<br />
Erd-, Bio- und<br />
Sondergasbetrieb<br />
Speller Str. 12 • 49832 Beesten<br />
Tel.: 05905 945 82-0 • Fax: -11<br />
E-Mail: info@eps-bhkw.de<br />
Internet: www.eps-bhkw.de<br />
A-CONSULT GmbH<br />
Werner-Von-Siemens-Str. 8 • D-24837 Schleswig<br />
Tel. 04621 855094 0 • Fax: 04621 855094 20<br />
info@aconsult.de • www.aconsult.de<br />
Neumodule für den<br />
Flexbetrieb<br />
von 75 - 3.000 kWel. im<br />
Container, Betonhaube oder als<br />
Gebäudeeinbindung<br />
Stützpunkte: Beesten • Rostock • Wilhelmshaven • Magdeburg<br />
Wir machen Ihr Biogas CLEAN und COOL!<br />
Individuelle Anlagen von Züblin Umwelttechnik<br />
zur Reinigung und Kühlung von Biogas<br />
• CarbonEx Aktivkohlefilter zur<br />
Feinentschwefelung von Biogas<br />
• GasCon Gaskühlmodul zur<br />
Kühlung von Biogas<br />
• BioSulfidEx zur biologischen<br />
Entschwefelung von Biogas<br />
• BioBF Kostengünstiges System zur<br />
biologischen Vorentschwefelung<br />
NEU!<br />
Züblin Umwelttechnik GmbH, Maulbronner Weg 32, 71706 Markgröningen<br />
Tel. +49 7145 9324-209 • umwelttechnik@zueblin.de • zueblin-umwelttechnik.com<br />
WIR FÖRDERN<br />
DIE BIOGASWIRTSCHAFT<br />
VON MORGEN.<br />
www.saveco-water.de<br />
CHIOR TM SE - Rührwerke<br />
Bis zu 40%<br />
BAFA-Förderung<br />
+ Exzellentes Rührergebnis mit Schub
International<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
DiBiCoo: Projekt zur Förderung der internatio nalen<br />
Zusammenarbeit im Bereich Biogas<br />
DiBiCoo (www.dibicoo.org) ist ein internationales Projekt, das von der Europäischen<br />
Union im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon 2020<br />
gefördert wird. Ziel des Projektes ist die Unterstützung der europäischen Biogas- und<br />
Biomethan-Industrie durch eine für Biogas geeignete Marktentwicklung in Entwicklungs-<br />
und Schwellenländern sowie das Zusammenbringen von europäischen Biogas-<br />
Anbietern mit außereuropäischen Interessenten.<br />
Von Frank Hofmann<br />
Im Projektkonsortium sind sieben Europäische<br />
Firmen und Organisationen<br />
aus Deutschland, Österreich, Lettland<br />
und Belgien sowie sechs außereuropäische<br />
Projektpartner aus Argentinien,<br />
Äthiopien, Ghana, Indonesien und Südafrika<br />
vertreten. DiBiCoo ist im Oktober 2019<br />
gestartet und endet im Juni 2022.<br />
Im Projekt werden diverse Maßnahmen<br />
zur Erreichung der Projektziele vorgenommen.<br />
Diese sind der Ausbau von<br />
Biogasanlagen und Biogas-Know-how,<br />
Reduktion von Treibhausgasemissionen,<br />
technische und wirtschaftliche<br />
Entwicklung, Arbeitsplatzbeschaffung –<br />
besonders in ländlichen Regionen – sowie<br />
diverse andere Ziele.<br />
Entwicklung einer Biogasplattform<br />
Die Biogasplattform (https://www.biogasplatform.eu/)<br />
hat drei Funktionsbereiche:<br />
1. Den als „Company profiles“ bezeichneten<br />
Bereich, in dem sich Biogas-<br />
Marktakteure kostenlos registrieren<br />
können. Dieser soll Akteuren weltweit<br />
helfen, passende Partner zu finden. Es<br />
gibt Filter zur Sortierung angebotener<br />
Technogien und Serviceleistungen sowie<br />
Filter, die die geographische Suche<br />
ermöglichen. Der Fachverband Biogas<br />
empfiehlt allen Biogasfirmen, die international<br />
tätig sind, sich unter diesen<br />
„Companie profiles“ zu registrieren.<br />
2. Der zweite Funktionsbereich wird als<br />
„Business opportunities“ bezeichnet.<br />
Hier sollen sich Interessenten von Biogasprojekten<br />
zusammenfinden. Das<br />
können beispielsweise Firmen außerhalb<br />
Europas sein, die Kontakte zu europäischen<br />
Herstellern suchen. Es gibt<br />
eine große Bandbreite der Vermittlungsmöglichkeiten,<br />
zum Beispiel auch von<br />
innereuropäischen Projektpartnern, da<br />
diese „Business opportunities“ vielfältig<br />
genutzt werden können.<br />
3. Der dritte Funktionsbereich wird „Knowledge<br />
base“ genannt. Hier liegen diverse<br />
Studien, Broschüren und andere Dokumente,<br />
um der Allgemeinheit Biogaswissen<br />
anzubieten.<br />
Menschen, denen die Internetseite des<br />
Fachverbandes Biogas e.V. (FvB) vertraut<br />
ist, finden in der DiBiCoo Biogasplattform<br />
ähnliche Funktionen wie unsere<br />
„Firmenliste“ beziehungsweise den FvB-<br />
„Marktplatz“. Die DiBiCoo-Biogasplattform<br />
ist jedoch wesentlich servicereicher,<br />
bietet eine erweiterte Funktionalität sowie<br />
benutzerfreundliche Filter und ist internationaler<br />
aufgestellt. Kurzum, es handelt<br />
sich um ein modernes Update. Die Plattform<br />
ist zurzeit noch mit dem DiBiCoo-Projekt<br />
verknüpft, soll aber nach Abschluss<br />
des Projektes vom Fachverband Biogas<br />
weitergeführt werden.<br />
Wissensaufbau und -verbreitung,<br />
Capacity Building<br />
Ein weiteres wesentliches Element von<br />
DiBiCoo ist die Verbreitung von Biogaswissen.<br />
Dies wird durch diverse Maßnahmen<br />
erreicht:<br />
ffIn einer Serie von Web-Seminaren (https://dibicoo.org/?p=942)<br />
wird in diversen<br />
Sessions Biogas-Know-how verbreitet.<br />
Die äthiopische Organisation<br />
ICEADDIS (https://www.iceaddis.<br />
com/) hat einen zweitägigen DiBi-<br />
Coo-Capacity-Building-Workshop<br />
durchgeführt. Dabei handelte es<br />
sich um eine Biogas-Schulung, in<br />
Addis Addeba. Sie fand am 15. und<br />
16. Februar <strong>2021</strong> im Hybrid-Format<br />
statt. Sowohl die Teilnehmer als<br />
auch die Fachreferenten waren<br />
teils vor Ort, teilweise per Online-<br />
Meeting zugeschaltet.<br />
Frank Hofmann vom Fachverband<br />
Biogas e.V. hat zwei Vorträge<br />
gehalten.<br />
90
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
International<br />
Angefangen von grundsätzlichem Biogaswissen<br />
über Anwendungsfelder (wie<br />
beispielsweise Einsatzstoffe) und Gärproduktnutzung<br />
oder über Biomethan<br />
und Sicherheit wird eine sehr große<br />
Bandbreite an Themen abgedeckt. Die<br />
Web-Seminare sind weiterhin online verfügbar<br />
und die meisten Präsentationen<br />
sind von der DiBiCoo-Webseite abrufbar.<br />
ffAuf der DiBiCoo-Internetseite sind<br />
diverse Länderinformationen zu den<br />
Biogasmärkten und Finanzierungsmöglichkeiten<br />
in Europa, aber auch in den<br />
Partnerländern Argentinien, Äthiopien,<br />
Ghana, Indonesien und Südafrika einsehbar<br />
(https://dibicoo.org/?cat=8).<br />
ffEs gibt eine Reihe von lokalen Capacity-<br />
Building-Workshops in den Partnerländern.<br />
Diese sind inhaltlich für die lokalen<br />
Marktakteure ausgelegt. Es werden<br />
Themen, die in den jeweiligen Ländern<br />
besonders relevant sind, präsentiert und<br />
diskutiert.<br />
ffZudem wurden einige Matchmaking-<br />
Events organisiert. Weitere sind aktuell<br />
in der Planung. Ziel dieser Veranstaltungen<br />
ist, dass internationale Akteure mit<br />
Europäischen Biogasfirmen zusammengebracht<br />
werden.<br />
ffDiBiCoo wird zudem auf diversen nationalen<br />
und internationalen Konferenzen<br />
präsentiert – unter anderem auch auf der<br />
Biogas Convention des FvB.<br />
DiBiCoo Kick-Off Meeting in Brüssel im Oktober 2019 mit Teilnehmern von allen 13 beteiligten Organisationen.<br />
Vom Fachverband Biogas e.V. war Sebastian Stolpp dabei. Ziel war es, sich im Konsortium kennenzulernen<br />
und inhaltliche Abstimmungen zum Projekt vorzunehmen.<br />
Weltkarte mit DiBiCoo-Projektpartnern: Länder, die Biogas-/Biomethan-Technologie<br />
exportieren (blau) und potenzielle Importländer (grün)<br />
ffGeschäftsreisen und „Study Tours“<br />
sollen Biogasinteressenten aus dem<br />
Ausland europäische Technologien vorstellen.<br />
Demo- und Follower-Projekte<br />
In jedem Partnerland (Argentinien, Äthiopien,<br />
Ghana, Indonesien und Südafrika) wurde<br />
je ein Demo-Projekt ausgewählt, das besondere<br />
Unterstützung von DiBiCoo erhält.<br />
Dies beinhaltet unter anderem Studien zur<br />
Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der<br />
Projekte. Zudem wurden mehrere Follower-<br />
Projekte unterstützt. Es ist geplant, die Demo-Projekte<br />
als „Business opportunities“<br />
in der DiBiCoo-Plattform zu präsentieren<br />
Wissensverbreitung<br />
Aktuelle Nachrichten zu DiBiCoo und Aktivitäten<br />
werden über diverse Medien verbreitet.<br />
Das sind die Firmen-Rundmail des<br />
Fachverbandes Biogas sowie soziale Medien<br />
wie LinkedIn, Facebook und Twitter. Auf<br />
der DiBiCoo-Seite ist auch ein Video verlinkt,<br />
in dem das Projekt vorgestellt wird .<br />
DiBiCoo in der Covid-19-Situation<br />
Viele DiBiCoo-Aktivitäten wurden als physische<br />
Veranstaltung geplant. Aufgrund der<br />
Covid-19-Pandemie konnten diese nur in<br />
seltenen Fällen stattfinden. Infolgedessen<br />
bietet das DiBiCoo-Team fast alle Aktivitäten<br />
online oder in Hybridform an.<br />
Autor<br />
Frank Hofmann<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Referat International<br />
Euref-Campus 16 · 10829 Berlin<br />
030/27 58 179-18<br />
frank.hofmann@biogas.org<br />
91
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Aus der<br />
Verbandsarbeit<br />
Bericht aus der Geschäftsstelle<br />
Brüssel: Entscheidende<br />
Weichenstellungen<br />
Waren die vergangenen Wochen noch durch diverse Aktivitäten des<br />
Gesetzgebers und der „alten Bundesregierung“ geprägt, erfordern jetzt<br />
laufende Aktivitäten der EU-Kommission in Brüssel zum Maßnahmenpaket<br />
„Fit for 55“ und zur Notifizierung der deutschen Nachhaltigkeitsverordnung<br />
die volle Konzentration.<br />
Von Dr. Stefan Rauh und Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Nach den ersten Ankündigungen<br />
im sogenannten „Green<br />
Deal“ konkretisiert die EU-<br />
Kommission jetzt im Maßnahmenpaket<br />
„Fit for 55“<br />
ihre Ambitionen, Europa zum ersten klimaneutralen<br />
Kontinent zu machen. Aufgrund<br />
der umfangreichen Details der zwölf<br />
Gesetzesentwürfe und der Auswirkungen<br />
auf den Biogassektor (Überarbeitung der<br />
RED-II, der Energiesteuerrichtlinie und<br />
Ausweitung des Emissionshandels auf den<br />
Verkehr/Gebäude) sind sowohl der Fachverband<br />
Biogas als auch die European Biogas<br />
Association (EBA) in besonderem Maße<br />
gefordert.<br />
Aus diesem Grund wurde auch eine Task<br />
Force „Fit for 55“ aufgestellt, in der verschiedene<br />
Fachreferate des Fachverbandes<br />
das Paket intensiv bearbeiten. Während die<br />
Parteien auf die Bundestagswahl hin fiebern,<br />
laufen die Diskussionen zu einzelnen<br />
Fachthemen wie beispielsweise zur Nachhaltigkeitsverordnung<br />
und der Überarbeitung<br />
der TRGS 529 weiter auf Hochtouren.<br />
Nachhaltigkeitsverordnungen zur<br />
Notifizierung in Brüssel<br />
Am 11. August hat die Bundesregierung<br />
ohne weitere Information der Branche die<br />
Nachhaltigkeitsverordnungen nach Brüssel<br />
zur Notifizierung durch die EU-Kommission<br />
gegeben. Ein Blick in den neuen Entwurf<br />
zeigt, dass das Bundesumweltministerium<br />
an vielen Stellen nachgebessert hat, auch<br />
im Sinne der Branche. Leider sind die vorgesehenen<br />
neuen Übergangsfristen aus<br />
Sicht der Branche in keiner Weise ausreichend.<br />
Der Fachverband Biogas e.V. wird auf der<br />
Basis des neuen Entwurfs seine Arbeitshilfe<br />
anpassen und demnächst veröffentlichen.<br />
Darin werden die Einzelheiten für<br />
die Umsetzung aufgearbeitet. Außerdem<br />
sind für den Herbst Informationsworkshops<br />
geplant. Weiterhin werden alle Optionen<br />
geprüft, die viel zu kurze Übergangsfrist zu<br />
verlängern. Da aber ungewiss ist, ob eine<br />
Fristverlängerung gelingt, sollten betroffene<br />
Anlagen unbedingt den Zertifizierungsprozess<br />
beginnen.<br />
RED II/III und nationale<br />
Umsetzung<br />
Am 1. Juli nahm die Stabsstelle „Erneuerbare<br />
Gase“ unter der Leitung von Dirk<br />
Bonse ihre Arbeit im Berliner Büro auf.<br />
Umfasste die ursprüngliche Stabsstelle<br />
noch das Aufgabengebiet „Biomethan und<br />
Kraftstoffe“, so wurden nun die Themenkreise<br />
erweitert und allgemeiner gefasst:<br />
Biomethan im Transportsektor wird weiter<br />
eines der Kernthemen sein, nunmehr ergänzt<br />
um „biogenen Wasserstoff“, Synthese-<br />
und Pyrolysegase sowie die stoffliche<br />
und thermische Verwertung zum Beispiel<br />
in der Industrie.<br />
Aktuell liegt ein Themenschwerpunkt bei<br />
der Umsetzung der europäischen Renewable<br />
Energy Directive (RED II), deren Novellierung<br />
im Zuge des „Fit for 55“-Programms<br />
sowie deren Umsetzung in nationales<br />
Recht. Hierzu wurden bereits Stellungnahmen<br />
und Handlungsstrategien insbesondere<br />
zu fortschrittlichen Kraftstoffen und der<br />
resultierenden Treibhausgasminderungsquoten<br />
erarbeitet. Die Stabsstelle erreicht<br />
92
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Verband<br />
vermehrt Anfragen von Mitgliedern, die ihre<br />
Biogasproduktion auf Biomethan zur Gasnetzeinspeisung<br />
umstellen beziehungsweise<br />
erweitern wollen.<br />
Aktionen und Veranstaltungen im<br />
Bereich Mobilität<br />
Nachdem sich die Sommerpause national<br />
und international dem Ende neigt, beteiligt<br />
sich die Stabsstelle erneuerbare Gase an<br />
Veranstaltungen und Arbeitskreisen zu den<br />
Themen Kraftstoffe und Verkehr: So wurde<br />
die Biogas2Drive-Woche organisatorisch<br />
unterstützt und wurden namhafte Aktionsund<br />
Diskussionsteilnehmer akquiriert. Gegenüber<br />
verschiedenen Politikern konnte<br />
im Rahmen eines Webinars der Kollegen<br />
vom Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik<br />
und Entsorgung (BGL) e.V. die Position<br />
des Fachverbandes und die Wichtigkeit<br />
im Energiemix für das Verkehrs- und Transportwesen<br />
dargelegt werden.<br />
Gespräch mit dem BMU zur<br />
Stoffstrombilanzverordnung<br />
In den vergangenen Wochen standen im<br />
Referat Abfall, Düngung und Hygiene die<br />
Stoffstrombilanzverordnung beziehungsweise<br />
dessen Evaluierungsbericht, die<br />
Planung der Biogas Convention, die Vorbereitungen<br />
einiger Vorträge im Rahmen von<br />
verschiedenen Veranstaltungen im Mittelpunkt<br />
der Tätigkeiten. Besonders erwähnenswert<br />
ist ein Gespräch mit dem BMU, in<br />
dem der Fachverband Biogas e.V. mit dem<br />
BMU Praxisdaten diskutieren konnte, die<br />
zeigen, dass die Bilanzierung mit dem derzeitigen<br />
System bei flächenlosen Biogasanlagen<br />
überwiegend zu Abweichungen führt<br />
und einer Änderung bedarf. Des Weiteren<br />
fanden mehrere Gespräche mit den zuständigen<br />
Behörden zum Düngevollzug statt.<br />
Dafür gab es unter anderem auf einem Betrieb<br />
eines Mitgliedes eine Besichtigung<br />
mit einem fachlichen Austausch.<br />
Informationspapier zur<br />
Anschlussregelung für<br />
güllebetonte Kleinanlagen<br />
Das Referat Energierecht und -handel beschäftigte<br />
sich intensiv mit der Thematik<br />
der Stromdirektlieferung als Option nach<br />
dem EEG. Hierzu wurde im Juli ein Intensivworkshop<br />
angeboten. Ebenso wurden<br />
Workshops vorbereitet für Schulungen<br />
für Betreiber, die an den EEG-Ausschreibungen<br />
im September teilnehmen wollen.<br />
Neuer<br />
Mitarbeiter<br />
Stabsstelle<br />
Erneuerbare<br />
Gase<br />
Dirk Bonse hat zum<br />
1. Juli die Leitung der<br />
Stabsstelle Erneuerbare<br />
Gase in Berlin übernommen. Zu seinem Aufgabenbereich<br />
zählen die Koordination der Arbeit in<br />
den Bereichen Biomethan (CNG), Bio-LNG und grünem<br />
Wasserstoff für die Nutzung in den Sektoren<br />
Strom, Kraftstoff und Wärme, Abfrage der Bedürfnisse<br />
sowie Beratung der Biogasanlagenbetreiber<br />
und Firmenmitglieder, Erstellen von Konzepten zur<br />
Verbesserung der Rahmenbedingungen. Bonse ist<br />
der Branche seit mehr als zehn Jahren verbunden:<br />
Als Sales- und Projektmanager sowie als unabhängiger<br />
Berater sind erneuerbare Gase, inklusive<br />
biogener Wasserstoff, aus Bio- und Synthesegas<br />
sein Spezialgebiet. Auch die stoffliche bzw. energetische<br />
Nutzung zum Beispiel von Gärresten zählt<br />
zu seiner Expertise. Mit seinem naturwissenschaftlichen<br />
Hintergrund und der Erfahrung im Vertrieb<br />
von Biomasse umsetzenden Anlagen freut sich Dirk<br />
Bonse auf den regen Austausch mit den Mitgliedern<br />
des Fachverbandes und darauf, diese bei der<br />
Umsetzung der Energiewende zu unterstützen.<br />
Neben den Ausschreibungen gibt es eine<br />
weitere Möglichkeit einer Anschlussförderung<br />
für güllebetonte Kleinanlagen. Hierzu<br />
wurde ein Informationspapier erstellt. Darin<br />
werden die Rahmenbedingungen für die<br />
Nutzung dieser im Juni verabschiedeten<br />
Regelung zur Verlängerung des ersten Vergütungsabschnittes<br />
erläutert.<br />
Zwei Landgerichtsurteile zum Anspruch<br />
auf den Technologiebonus in ORC-Anlagen<br />
haben das Referat Energierecht intensiv<br />
beschäftigt. Für diejenigen, die noch mehr<br />
zu dieser Entscheidung wissen möchten,<br />
wird ein Seminar angeboten werden.<br />
Neue<br />
Mitarbeiterin<br />
im Referat<br />
Landwirtschaft<br />
Berenika Lewicka unterstützt<br />
seit dem 1.<br />
Juli das Referat Landwirtschaft<br />
im Bereich<br />
Nachhaltigkeitszertifizierung in Berlin. Zu ihrem<br />
Aufgabenbereich zählen das Beantworten von<br />
Mitgliederanfragen, die Erstellung von Fachinformationen<br />
und die Begleitung der Novellierung<br />
der EU-Richtlinien zur Förderung Erneuerbarer<br />
Energien. Das letzte Jahr war sie als Biokraftstoff-Expertin<br />
tätig. Zu ihren Aufgaben gehörten<br />
die systematische Vorbereitung von Dokumenten<br />
für nachhaltige Biomasse sowie Audits und die<br />
Umsetzung der neuen deutschen und europäischen<br />
Umwelt-Regelungen. Sie beschäftigte<br />
sich intensiv mit rechtlichen und technischen<br />
Fragestellungen rund um die Erneuerbaren<br />
Energien und Biokraftstoffe. Während ihres<br />
Umweltstudiums an der TU Berlin sammelte sie<br />
erste Kenntnisse im Bereich Biogas, da sie als<br />
studentische Projektassistentin an verschiedenen<br />
Biogasprojekten des Fachgebiets Kreislaufwirtschaft<br />
und Recyclingtechnologie und der<br />
Herbst Umwelttechnik GmbH mitarbeitete.<br />
LAI, TRAS 120 und TRGS<br />
529-Novelle<br />
Seit über einem Jahr wartet die Biogasbranche<br />
auf weitere Vollzugshinweise zum<br />
Erhalt des Luftreinhaltebonus durch die<br />
zuständige Bund-Länder-Arbeitsgruppe<br />
(LAI/AISV). Im Juli wurde zwar ein erster<br />
inoffizieller Entwurf veröffentlicht, der aber<br />
nochmal abgeändert werden musste, um<br />
praxistauglichere Nachrüstfristen (NOx-<br />
Sensor, Temperatursensor etc.) für die betroffenen<br />
Biogasanlagen sicherzustellen.<br />
Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Vergütungsjahr<br />
2022 die neuen Anforderungen<br />
für den Erhalt des Luftreinhaltebonus<br />
anzuwenden sind.<br />
Da die Umsetzung der TRAS 120 insbesondere<br />
in Bayern erhebliche Probleme bereitet,<br />
wurde jetzt in diversen Gesprächen mit<br />
dem zuständigen Umweltministerium und<br />
relevanten Politikern auf die Probleme hingewiesen<br />
und Lösungsvorschläge erörtert.<br />
Die Überarbeitung der TRGS 529 schreitet<br />
weiter voran und bedarf insbesondere beim<br />
Einsatz von Bioabfällen einer intensiven<br />
Diskussion bezüglich der Testung von allen<br />
Einsatzstoffen vor jeder Abnahme und der<br />
notwendigen Fachkunde des eingesetzten<br />
Personals.<br />
Der Fachverband Biogas hatte deshalb<br />
nochmals eindringlich die Einbindung von<br />
betroffenen Abfallanlagenbetreibern in die<br />
anstehenden Diskussionen eingefordert.<br />
Im Oktober findet daher ein Expertengespräch<br />
zu den kritischen Punkten der Überarbeitung<br />
der TRGS 529 statt.<br />
Die Arbeitsgruppe „Sichere Trocknungsanlagen“<br />
hat den Entwurf einer Arbeitshilfe<br />
(A-029) zur Kommentierung veröffentlicht.<br />
Dieser Entwurf wird derzeit in verschiedenen<br />
Gremien und Verbänden gesich-<br />
93
Verband<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
tet. Im Oktober will die Arbeitsgruppe die<br />
Anmerkungen diskutieren und im November<br />
soll dann eine finale Version veröffentlicht<br />
werden.<br />
Aktivitäten im Referat<br />
Veranstaltungen<br />
Die Arbeiten im Referat Veranstaltungen<br />
waren in den letzten Wochen durch die Erstellung<br />
des Programms der digitalen Tagung<br />
(22. bis 26.11.<strong>2021</strong>) und die Vorbereitung<br />
der Fachmesse in Nürnberg (7. bis<br />
9.12.<strong>2021</strong>) geprägt (siehe auch Beileger).<br />
Nach aktuellem Stand freuen sich über 130<br />
Aussteller wieder live ihre neuen Produkte<br />
und Dienstleistungen vorstellen zu können.<br />
Weiterentwicklung des<br />
Schulungsverbundes Biogas<br />
Anfang August hat sich der Fachbeirat im<br />
Schulungsverbund Biogas mit Vertretern<br />
fast aller Bildungseinrichtungen zu seiner<br />
zweiten Sitzung im Jahr <strong>2021</strong> zusammengefunden.<br />
Dabei hat der Fachbeirat<br />
einstimmig beschlossen, dass es weiterhin<br />
neben den Präsenzveranstaltungen auch<br />
Online-Schulungen gemäß TRGS 529<br />
und TRAS 120 geben soll. Das Format der<br />
Online-Schulungen war im letzten Jahr aufgrund<br />
der Corona-Pandemie, ursprünglich<br />
für einen begrenzten Zeitraum, eingeführt<br />
worden. Da aber sowohl die Rückmeldung<br />
der Bildungseinrichtungen als auch der<br />
Teilnehmer sehr positiv war, hat man sich<br />
für eine Beibehaltung des Angebotes ausgesprochen.<br />
Zur Vereinfachung der Prüfungsabnahme<br />
soll zukünftig auch ein Online-<br />
Prüfungstool angeschafft werden.<br />
Smart-Meter Rollout vorerst von<br />
untergeordneter Bedeutung<br />
In den vergangenen Monaten hat sich im<br />
Rahmen des Referats Stromnetze und Systemdienstleistungen<br />
abgezeichnet, dass<br />
der Rollout von Smart-Metern die Biogasbranche<br />
nach aktuellem Stand vorerst nicht<br />
umfangreich betreffen wird. Auch nach<br />
prozessualen und technischen Weiterentwicklungen<br />
wird der Fokus in absehbarer<br />
Zeit auf Anlagen mit einer installierten<br />
Leistung von unter 100 kW liegen. Damit<br />
sind neben Güllekleinanlagen vorrangig<br />
PV-Anlagen von den Anforderungen des<br />
Rollouts betroffen. Da die entsprechenden<br />
Markterklärungen zum aktuellen Zeitpunkt<br />
jedoch noch nicht vorliegen, besteht noch<br />
kein Handlungsbedarf für die Branche.<br />
Wir sind auf der Suche<br />
nach Verstärkung!<br />
Der Fachverband Biogas e.V. sucht eine(n)<br />
Fachreferenten/in<br />
Abfall, Düngung und Hygiene<br />
(m/w/d)<br />
Für unser Referat Abfall, Düngung und Hygiene<br />
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n<br />
Fachreferenten/in für unsere Geschäftsstelle in<br />
Freising im Rahmen einer Vollzeitbeschäftigung.<br />
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung<br />
bis zum 01.10.<strong>2021</strong>.<br />
Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet,<br />
wird aber mit der Perspektive, danach in eine unbefristete<br />
Stelle umgewandelt zu werden, vergeben.<br />
Nähere Informationen zur ausgeschriebenen Stelle<br />
finden Sie auf unserer Homepage biogas.org<br />
unter den Stellenausschreibungen.<br />
Wahlen in den Regionalgruppen<br />
starten<br />
Angelaufen sind im August auch die Wahlen<br />
in unseren Regionalgruppen. Es gab<br />
erste digitale Vorstellungsrunden der Kandidaten<br />
und in einzelnen Regionalgruppen<br />
starten die Briefwahlen. In anderen Regionalgruppen<br />
stehen Termine für physische<br />
Wahlen an.<br />
Internationale Aktivitäten<br />
Neben der bereits genannten Bearbeitung<br />
des EU-Pakets „Fit for 55“ erstellte das<br />
Referat International unter Mitwirkung anderer<br />
Fachreferate im Auftrag der UNIDO<br />
(United Nations Industrial Development<br />
Organization) englischsprachige Videos<br />
von Biogas Trainings. Insgesamt wurden<br />
zwölf Sessions von je 60 bis 90 Minuten<br />
Trainingsmaterial aufgenommen. Thematisch<br />
umfassen die Videos das gesamte<br />
Spektrum von Einführung in Biogas bis hin<br />
zu spezielleren Themen wie Nachhaltigkeit<br />
und Sicherheit.<br />
Die Videos wurden zur Schulung von Akteuren<br />
im Biogassektor in Kenia entwickelt<br />
und sind bisher noch nicht öffentlich<br />
verfügbar. Teil dieser Beauftragung durch<br />
die UNIDO war auch die Erstellung eines<br />
Biogasstandards (Code of practice) für das<br />
„Kenian Bureau of Standards“ (KEBS). Der<br />
Standardentwurf wird bis Ende November<br />
einer Öffentlichkeitsbeteiligung unterzogen<br />
und soll Anfang 2022 dann veröffentlicht<br />
werden.<br />
Die Kammer- und Verbandspartnerschaft<br />
(KVP) mit dem indischen Biogas-Verband<br />
(IBA) geht in die Verlängerung. Nach sechs<br />
gemeinsamen Jahren sollte das Projekt<br />
am 30. November <strong>2021</strong> seinen Abschluss<br />
finden. Ein entsprechender Antrag an das<br />
Bundesministerium für wirtschaftliche<br />
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)<br />
wurde positiv beschieden und das Projekt<br />
bis zum 31. Mai 2022 verlängert. Aktivitäten,<br />
die bedingt durch die Pandemie bislang<br />
nicht durchgeführt werden konnten,<br />
sollen so nachgeholt werden können.<br />
Das KVP in Uganda kommt nach dem Lockdown<br />
im Juli/August <strong>2021</strong> in Uganda endlich<br />
etwas mehr in Fahrt. Die im Juli bereits<br />
angestellte lokale Projektassistentin wird<br />
zum 1. September <strong>2021</strong> das Projektbüro im<br />
DesignHub Kampala beziehen können. Ab<br />
Oktober <strong>2021</strong> wird ein lokaler Projektkoordinator<br />
das Team vervollständigen. Bereits<br />
im August wurde eine Needs Assessment<br />
mit den Mitgliedern der Uganda National<br />
Biogas Alliance (UNBA) durchgeführt und<br />
an einer Internetpräsenz gearbeitet.<br />
Service GmbH – Testlauf für<br />
Düngeberatungen<br />
In der Fachverband Biogas Service GmbH<br />
wird derzeit intensiv daran gearbeitet,<br />
pünktlich zum Herbst die geplanten Düngeberatungen<br />
anbieten zu können. Dafür<br />
werden aktuell Unterlagen, Abläufe etc.<br />
im Rahmen von Testberatungen ausgearbeitet.<br />
Sobald die Vorbereitungen erfolgreich<br />
abgeschlossen sind, können die<br />
Düngeberatungen über die Service GmbH<br />
kostenpflichtig als Zusatzdienstleistung zur<br />
Verbandsmitgliedschaft wahrgenommen<br />
werden.<br />
Weiterhin wird sich die Service GmbH<br />
zukünftig in der Qualitätsbetreuung der<br />
Güte-Gemeinschaft Gärprodukte e.V. engagieren.<br />
Dazu durchläuft Sophia Heinze,<br />
die auch die späteren Düngeberatungen<br />
durchführen wird, aktuell das Prüfungsund<br />
Zulassungsverfahren. So kann zukünftig<br />
eine fundierte fachliche Beratung und<br />
Unterstützung der Mitglieder vor Ort für die<br />
RAL-Gütesicherung angeboten werden.<br />
Autoren<br />
Dr. Stefan Rauh<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Geschäftsführer<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 · 85356 Freising<br />
0 81 61/98 46 60<br />
info@biogas.org<br />
94
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Verband<br />
BIOGASBEHÄLTER – Fermenter, Gärrestlager, Vorgruben, ...<br />
WOLF SYSTEM GMBH | Am Stadtwald 20 | 94486 Osterhofen<br />
09932 37-0 | mail@wolfsystem.de | WWW.WOLFSYSTEM.DE<br />
Bauen mit System!<br />
Biogasanlagen<br />
zu verkaufen<br />
640 kw Bj. 2007<br />
350 kw Bj. 2004<br />
Standort: 73111 Lauterstein<br />
Kontakt:<br />
t.schlegel@eberhardt-bewehrungsbau.de<br />
Mobil 0162/9285226<br />
Ist Ihr System noch fit?<br />
BioBG Heizungsbau steht<br />
für innovative und<br />
effiziente Technik!<br />
Beratung // Anlagenanalyse //<br />
Aufstellungsplanung //<br />
HKS 07K<br />
Umsetzung<br />
= 0<br />
//<br />
60<br />
Servicekonzepte<br />
100 0 CMYK<br />
und Wartung aus einer Hand...<br />
Webers Flach 1 ∙ 26655 Ocholt ∙ 04409 666720 ∙ info@biobg.de ∙ www.biobg.de<br />
95
Verband<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
LEE Niedersachsen/Bremen e.V.<br />
Aktionswoche Artenvielfalt:<br />
Biogas anlagen in Niedersachen<br />
tragen zum Artenschutz bei<br />
Auf Christian Rehses Feldern mit Honigbrachen,<br />
Blühstreifen, Kulturpflanzengemengen<br />
und der Durchwachsenen Silphie bei<br />
Goslar finden fliegende und krabbelnde<br />
Insekten einen reich gedeckten Tisch: Unzählige<br />
Käfer und saugende Insekten tummeln sich das<br />
ganze Jahr über auf diesen Flächen, die Rehse extra für<br />
sie angelegt hat. „Mit solchen Flächen unterstützen wir<br />
die heimische Tierwelt, denn ihr Erhalt liegt uns am Herzen.<br />
Die blühenden Flächen werden teilweise abgeerntet<br />
und anschließend in unserer Biogasanlage verwertet.<br />
Es werden aber nicht alle Flächen beerntet, auf einem<br />
Großteil verbleibt der Aufwuchs auf den Feldern bis in<br />
„Es ist 5 vor 12“ – Biogasbranche<br />
in der Krise<br />
Während Käfer und Bienen ein neues<br />
Habitat besiedeln, stellen sich viele<br />
Biogasanlagenbetreiber in Niedersachsen<br />
die Frage, wie es für sie in<br />
den in nächsten Jahren weitergeht. „Es fehlen die Perspektiven<br />
für Anlagen, deren erster EEG-Vergütungszeitraum<br />
endet. Ob wir dann noch wirtschaftlich weiterarbeiten<br />
können, ist die große Frage. Unser Vertrauen in<br />
die Politik geht verloren. Viele Anlagenbetreiber werden<br />
den Betrieb einstellen,“ so Rehses Prognose.<br />
„Aktuell sehen wir kein Licht am Ende des Tunnels.<br />
Die Politik stellt sich nicht konsequent hinter den<br />
Weiterbetrieb und Ausbau der Anlagen. Unter diesen<br />
Bedingungen nehmen viele Betreiber kein Geld mehr<br />
für Investitionen in die Hand,“ so Rehse weiter. Auch<br />
volkswirtschaftlich ist der zu erwartende Rückbau der<br />
Anlagen ein Desaster: Mit viel Geld wurde über Jahrzehnte<br />
eine verlässliche Regenerative-Energien-Infrastruktur<br />
geschaffen, die mit dem Ende der EEG-Förderung<br />
schlagartig aufgelöst wird. Aufgrund gesetzlicher<br />
Vorgaben wird Kapital vernichtet.<br />
Christian Rehse, Biogasanlagenbetreiber,<br />
kritisiert die Politik:<br />
Diese unterstütze nicht<br />
konsequent den Weiterbetrieb<br />
der Anlagen.<br />
LEE-Geschäftsführerin<br />
Silke Weyberg fehlt<br />
die Perspektive für die<br />
Branche.<br />
den Spätherbst hinein und bietet der Tierwelt Schutz<br />
und Nahrung,“ so der Geschäftsführer der Biogasanlage<br />
REGO GmbH & Co. KG.<br />
Inzwischen gehen immer mehr Landwirte und Biogasanlagenbetreiber<br />
in Niedersachsen dazu über, Ackerflächen<br />
mit Blühpflanzen anzulegen, um die heimische<br />
Tier- und Pflanzenwelt zu unterstützen und um dem Artensterben<br />
zu begegnen. Um erfolgreich wirtschaften zu<br />
können, müssen die Anlagenbetreiber beim Einsatz von<br />
Blühpflanzen auf eine angemessene Vergütung achten.<br />
Deshalb begrüßt der LEE die finanzielle Förderung des<br />
Anbaus mehrjähriger Wildpflanzenkulturen zur Biomasseproduktion<br />
durch das Land Niedersachsen. Dies<br />
gleicht die im Vergleich zu Mais deutlich geringeren<br />
Methanerträge pro Hektar aus. Doch trotz großem persönlichen<br />
Engagement läuft es für die niedersächsische<br />
Biogasbranche zurzeit nicht rund.<br />
Schleichendes Sterben der Biogasbranche –<br />
allem Klimaschutz zum Trotz<br />
Silke Weyberg, LEE-Geschäftsführerin, sieht die Situation<br />
der niedersächsischen Biogasanlagen ebenfalls<br />
kritisch: „Als Landesverband begrüßen wir die Förderung<br />
von Blühpflanzenprojekten. Doch darf das Thema<br />
nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir es gleichzeitig<br />
mit einem schleichenden Sterben der Biogasbranche<br />
zu tun haben. Konkrete genehmigungsrechtliche Hürden<br />
durch Land und Bund nehmen den Biogasanlagen<br />
die Perspektive. Ein Desaster für die Energiewende,<br />
gerade im Hinblick auf den Ausgleich der volatilen Erneuerbaren,<br />
der Wärmeversorgung und der Schwerlastmobilität.<br />
Diskussionen um die Umsetzung der Düngeverordnung<br />
und der AwSV sowie die Anpassung des Verwertungskonzeptes<br />
verunsichern die Branche und führen gerade<br />
in Nährstoffunterschussregionen dazu, dass statt<br />
Diversifizierung der Inputstoffe und verstärkter Wirtschaftsdüngervergärung<br />
eher der Maisanteil steigt, um<br />
die geforderte Lagerkapazität von neun Monaten ohne<br />
Zubau einhalten zu können.“<br />
Autor<br />
Lars Günsel<br />
Pressesprecher<br />
LEE Niedersachsen-Bremen e.V.<br />
Foto: LEE Niedersachsen/Bremen e.V.<br />
96
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Verband<br />
LEE Schleswig-Holstein (LEE SH)<br />
Mit Minister Jan Philipp Albrecht<br />
auf Energietour<br />
Fotos: LEE Schleswig-Holstein<br />
Auf einer Energietour in Nordfriesland hat<br />
der LEE SH Minister Jan Philipp Albrecht<br />
(Minister für Energiewende, Landwirtschaft,<br />
Umwelt, Natur und Digitalisierung)<br />
vorgestellt, dass Solarenergie und<br />
Landwirtschaft sowie Biogas und Wärmewende Hand<br />
in Hand gehen können. Denn mit Solar- und Biogasanlagen<br />
lassen sich Land- und Energiewirtschaft verbinden.<br />
Sie erzeugen nicht nur erneuerbaren Strom und<br />
Wärme, sondern können auch zur Senkung der klimaschädlichen<br />
Emissionen der Landwirtschaft beitragen.<br />
Doch die aktuelle Gesetzgebung und Förderung sieht<br />
dies noch nicht ausreichend vor und muss daher zügig<br />
angepasst werden, fordert der LEE SH.<br />
In Sprakebüll erläuterte Christian Andresen, Solarvorstand<br />
des LEE SH, dass unter Freiflächensolaranlagen<br />
verschiedene weitere Nutzungsformen möglich sind.<br />
Gerade extensive Landwirtschaft kann dort betrieben<br />
werden. Die Flächen lassen sich dabei sowohl zur Beweidung<br />
als auch zum Anbau von Obst, Gemüse oder<br />
anderen Sonderkulturen nutzen. Landwirtschaftliche<br />
Flächen mit mangelnder Produktivität könnten durch<br />
Solaranlagen höhere Erträge bringen. „Das aktuelle Agrarrecht<br />
und die Förderung berücksichtigen dies leider<br />
noch nicht. Hier ist also Handlungsbedarf, denn Erneuerbare<br />
Energien sind ein wichtiger Baustein für den<br />
Klimaschutz in der Landwirtschaft“, betonte Andresen.<br />
Das Konzept der Biogasanlage in Sönnebüll beeindruckte<br />
auch Minister Albrecht: „Diese Anlage zeigt,<br />
dass Biogas ein wichtiger Baustein für die Wärmewende<br />
in der Fläche ist und auch sensible Infrastruktur wie<br />
das Krankenhaus in Breklum mit erneuerbarer Wärme<br />
versorgen kann.“ Laut LEE SH könnten Biogasanlagen<br />
außerdem durch vermehrte Güllevergärung zum Klimaschutz<br />
in der Landwirtschaft und zur Verringerung des<br />
Nitrateintrags ins Grundwasser beitragen.<br />
„Dazu muss jedoch das EEG angepasst werden, um<br />
den Gülleeinsatz anzuregen. Zugleich gilt es, im Land<br />
geeignete Rahmenbedingungen für die Lagerung von<br />
Gülle und Gärresten zu schaffen“, fordert LEE SH-Geschäftsführer<br />
Dr. Fabian Faller. Hans-Ulrich Martensen,<br />
LEE SH-Vorstand und Betreiber der Biogasanlage,<br />
wies daraufhin, dass er gerne noch mehr Blühpflanzen<br />
statt Mais einsetzen und so auch den Artenschutz fördern<br />
würde. „Doch erstmal muss die Politik die Rahmenbedingungen<br />
anpassen, damit den Landwirten<br />
durch mehr Artenschutz keine wirtschaftlichen Nachteile<br />
entstehen“, forderte Martensen.<br />
Autorin<br />
Margrit Hintz<br />
Referentin Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit<br />
LEE SH<br />
Hopfenstr. 71 · 24103 Kiel<br />
04 31/22 181 450<br />
info@lee-sh.de www.lee-sh.de<br />
Von links: Minister Jan<br />
Philipp Albrecht, LEE<br />
SH-Geschäftsführer<br />
Dr. Fabian Faller und<br />
Hans-Ulrich Martensen<br />
von der Martensen<br />
Energie GmbH & Co. KG.<br />
Von links: Christian<br />
Andresen, Solarvorstand<br />
des LEE SH,<br />
Reinhard Christiansen,<br />
Vorsitzender LEE SH,<br />
Hans-Christian Andresen,<br />
Firmengründer<br />
Solar Andresen und<br />
Hans Ulrich Martensen<br />
97
Verband<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Dekarbonisierung der Wärmenetze ist<br />
wichtiger Klimaschutzbeitrag<br />
Gastbeitrag von Dr. Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie e.V. (BEE)<br />
Der Gebäudesektor hat im vergangenen<br />
Jahr als einziger<br />
Sektor seine Ziele zur Einsparung<br />
von Treibhausgasen nicht<br />
erreicht, und das mit einem<br />
Überschuss von etwa 2 Millionen Tonnen<br />
CO 2<br />
gegenüber den Vorgaben aus dem Klimaschutzgesetz.<br />
Dieses Jahr wird zudem<br />
eine erhebliche Steigerung des Treibhausgasausstoßes<br />
gegenüber 2020 erwartet.<br />
Das zeigt die enormen Herausforderungen<br />
für den Wärmesektor.<br />
Denn mit einem Anteil von etwa 55 Prozent<br />
am Endenergiebedarf ist der Wärmesektor<br />
der energieintensivste Anwendungsbereich.<br />
Ein entsprechendes Potenzial zur<br />
Einsparung bietet die Beschleunigung<br />
des Ausbaus der Erneuerbaren Energien.<br />
Bislang hinkt der Wärmesektor mit einem<br />
Anteil von etwa 14 Prozent Erneuerbaren<br />
Energien bei der Energiewende allerdings<br />
stark hinterher.<br />
Immer noch wird ein großer Anteil der Wärmegewinnung<br />
aus fossilen Brennstoffen<br />
produziert oder importiert. Das ist nicht<br />
nachhaltig, zudem ist es teuer. Eine systemische<br />
Förderung für die Dekarbonisierung<br />
der Wärmenetze ist neben der Wärmewende<br />
im privaten Heizungskeller und dem<br />
Umstieg auf Solar- und Geothermie, Bioenergie<br />
und Wärmepumpen daher längst<br />
überfällig.<br />
Richtlinienentwurf – zu kleiner<br />
Finanzierungsplan<br />
Mit der Veröffentlichung des Entwurfs für<br />
die „Richtlinie für die Bundesförderung<br />
effiziente Wärmenetze“ wurden kürzlich<br />
neue Vorschläge vorgelegt. Leider enthält<br />
er im Widerspruch zur Zielsetzung,<br />
einen Beitrag zur Erreichung der Treibhausgasneutralität<br />
von Energie- und Wärmeversorgung<br />
zu leisten, einen zu niedrig<br />
angesetzten Finanzierungsplan, der dem<br />
Umfang der zu transformierenden und<br />
auszubauenden Wärmenetze nicht gerecht<br />
wird. Die bedeutende Rolle, die die<br />
Wärmenetze für den Klimaschutz spielen<br />
können, wird somit weiterhin unterschätzt.<br />
Insbesondere für die Planungssicherheit ist<br />
eine ausreichende Mittelausstattung von<br />
zentraler Bedeutung. Diese ist für den Investitionswillen<br />
von kommunalen und privatwirtschaftlichen<br />
Betreibern unentbehrlich.<br />
Eine entsprechende Aufstockung der<br />
Haushaltsmittel muss durch den Bundestag<br />
angestoßen werden, gleichzeitig muss<br />
ein Rechtsanspruch für die Gewährung der<br />
Förderung eingeführt werden.<br />
Eine Überarbeitung ist auch hinsichtlich<br />
kleiner Wärmenetzprojekte erforderlich.<br />
Diese werden im Entwurf der Richtlinien<br />
benachteiligt, obwohl die Inanspruchnahme<br />
der Förderung für Wärmenetze im<br />
Marktanreizprogramm in den vergangenen<br />
Jahren gezeigt hat, dass besonders die kleinen<br />
Wärmenetzprojekte den Markt prägten.<br />
Hier hilft kein Verweis auf die Bundesförderung<br />
für effiziente Gebäude (BEG), denn<br />
diese beschränkt sich auf die Errichtung<br />
oder Erweiterung von Gebäudenetzen, die<br />
ausschließlich der Versorgung von Gebäuden<br />
des Anlagenbetreibers dienen.<br />
BEG: kleinere Projekte<br />
werden nicht gefördert<br />
Kleinere Projekte, die auch die Gebäude<br />
anderer Eigentümer versorgen,<br />
werden nicht durch die BEG<br />
gefördert. Hier entsteht eine sensible<br />
Förderlücke, die kleine Wärmenetze<br />
massiv gegenüber großen<br />
Projekten benachteiligt. Wenn diese<br />
Lücke durch die BEG geschlossen<br />
werden soll, dann sollte hier<br />
schnellstmöglich Rechtssicherheit<br />
erfolgen und Wärmenetze bis 15<br />
Gebäude und 99 Anschlüsse in der<br />
BEG aufgenommen werden.<br />
Zusätzlich müssen die Richtlinien<br />
auch hinsichtlich der zu starken<br />
Reglementierung durch die vorgegebene<br />
Betriebsstundendauer angepasst<br />
werden. Diese Regelung beschneidet<br />
das Potenzial von Bioenergie und sorgt<br />
dafür, dass die Kosten für Erneuerbare Wärme<br />
unnötig nach oben getrieben werden.<br />
Auch die Begrenzung der Jahresbetriebszeit<br />
in Form der Betriebsstundendauer ist<br />
unwirtschaftlich und erhöht den Personalaufwand,<br />
der nur die Hälfte des Jahres benötigt<br />
wird.<br />
Stattdessen sollte die Begrenzung wie in<br />
vorherigen Entwürfen über Volllaststunden<br />
geregelt werden. Positiv hervorzuheben ist<br />
hingegen, dass Netze unter 20 Kilometer<br />
Länge von den Regelungen der Biomassebegrenzung<br />
ausgenommen wurden, hier<br />
fehlt allerdings noch eine konkrete Formulierung<br />
in der Richtlinie.<br />
Insgesamt sind bei den Förderprogrammen<br />
schnell Nachbesserungen erforderlich,<br />
aber auch stärkere Marktanreize wie der<br />
CO 2<br />
-Preis und ein Ordnungsrecht wie ein<br />
Erneuerbares Fernwärmegesetz und die<br />
Überarbeitung des Gebäudeenergiegesetzes,<br />
um den großen Herausforderungen der<br />
Wärmewende gerecht zu werden. Für die<br />
Energiewende im Wärmebereich müssen<br />
jetzt alle Hebel umgelegt werden.<br />
98
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Verband<br />
Elektro<br />
Hagl<br />
+ Motoren Generatoren<br />
+ Notstromaggregate<br />
+ Schaltanlagen<br />
Ihr Partner<br />
in Sachen<br />
BHKW<br />
Komplettmodule 50kW-530kW<br />
Gas & Diesel Service<br />
www.biogas-hagl.de · T. 0 84 52 . 73 51 50<br />
THERM<br />
Unsere Leistung – Ihr Erfolg<br />
Abgaswärmetauscher<br />
Gaskühler / Gaserwärmer<br />
Energiepark 26/28 91732 Merkendorf<br />
+49 9826-65 889-0 info@enkotherm.de<br />
www.enkotherm.de<br />
• Doppel- /Dreimembrangasspeicher<br />
• „Flex“- Reingasspeicher<br />
• Emissionsschutzabdeckungen<br />
• Behälterauskleidungen mit<br />
Leckagekontrolle<br />
• Erdbecken für Gülle- und<br />
Wirtschaftsdünger (JGS-Zulassung),<br />
Silosickersaft, Rübenmus<br />
ceno.sattler.com<br />
Sattler Ceno<br />
TOP-TEX GmbH<br />
Am Eggenkamp 14<br />
D-48268 Greven<br />
Tel.: +49 2571 969 0<br />
biogas@sattler.com<br />
Interimsmanagement<br />
für Biogasanlagen<br />
ÜBERWACHUNG VON BIOGAS-ANLAGEN<br />
Im Insolvenzfall oder bei Betreiberwechsel<br />
übernehmen wir lang- oder kurzfristig die<br />
technische/ kaufmännische Betriebsführung<br />
Biogas 401<br />
Mehrkanal-Gasanalysator<br />
Biogas 905<br />
Mehrkanal-Gasanalysator<br />
SENSOREN<br />
Die beiden Gas-Analysatoren Biogas 401<br />
und Biogas 905 über wachen kontinuierlich<br />
oder dis kon ti nuierlich die Qualität des<br />
Biogases auf die Gaskompo nenten hin.<br />
Optional warnen zusätzliche Umgebungsluft-Sensoren<br />
frühzeitig vor gesundheitsge<br />
fähr denden, explo sions fähigen und<br />
nichtbrenn baren Gasen und Dämpfen.<br />
❯❯❯ Biogas Know-how seit 2001 ❮❮❮<br />
EINSATZBEREICHE:<br />
■ Biogas-Produktionsanlagen<br />
■ Kläranlagen<br />
■ Deponien<br />
WELTEC BIOPOWER GmbH<br />
Zum Langenberg 2 • 49377 Vechta<br />
www.weltec-biopower.de<br />
Organic energy worldwide<br />
GTR 210 IR<br />
CH 4 + CO 2<br />
TOX 592<br />
O 2 + H 2 S<br />
Ihr Ansprechpartner: Andre Zurwellen<br />
Tel. 04441-999 78-900<br />
a.zurwellen@weltec-biopower.de<br />
Trierer Str. 23 – 25 · 52078 Aachen<br />
Tel. (02 41) 97 69-0 · www.ados.de<br />
s e i t 1 9 0 0<br />
99
Verband<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Der Schulungsverbund Biogas<br />
gratuliert seinem 10.000sten<br />
Teilnehmer – eine Erfolgsgeschichte<br />
Im Juni <strong>2021</strong> war es so weit, der Schulungsverbund<br />
Biogas konnte einen nächsten Meilenstein<br />
seit seiner Gründung feiern und dem 10.000sten<br />
Teilnehmer zur bestandenen Prüfung gratulieren.<br />
Johannes Reitter aus dem südbadischen Ottenheim<br />
absolvierte erfolgreich die Grundschulung „Betreiberqualifikation<br />
– Anlagensicherheit von Biogasanlagen<br />
gemäß TRGS 529 und TRAS 120“. Er betreibt<br />
Johannes Reitter hat als 10.000ster Teilnehmer die<br />
Prüfung zur Betreiberqualifikation im Schulungsverbund<br />
Biogas bestanden. Neben der Prüfungsurkunde erhielt<br />
er ein kleines Präsentkästchen.<br />
Foto: Fachverband Biogas e.V.<br />
mit seinen Eltern eine Anlage mit 1.780 Kilowatt (kW)<br />
installierter elektrischer Leistung, die mit einer Bemessungsleistung<br />
von etwa 630 kW auf den flexiblen<br />
Anlagenbetrieb ausgelegt ist. Als Substrate dienen Rindermist<br />
aus dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb<br />
und nachwachsende Rohstoffe.<br />
Um den seit 2015 in der TRGS 529 vorgeschriebenen<br />
Anforderungen an die Fachkunde des verantwortlichen<br />
Betriebspersonals gerecht zu werden, hat Johannes<br />
Reitter an einer Schulung im Schulungsverbund Biogas<br />
teilgenommen. Hier bieten mittlerweile 15 anerkannte<br />
und qualitätsgesicherte Bildungseinrichtungen entsprechende<br />
Schulungen an.<br />
Bereits 2013 hat der Fachverband Biogas in<br />
Kooperation mit dem Deutschen Verein des<br />
Gas- und Wasserfaches (DVGW) und der<br />
Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft,<br />
Abwasser und Abfall (DWA)<br />
den Schulungsverbund Biogas<br />
gegründet und somit den Grundstein<br />
für diese Erfolgsgeschichte<br />
gelegt.<br />
Um den im Laufe der Zeit gestiegenen<br />
Fachkundeanforderungen<br />
gerecht zu werden, wurde<br />
das Schulungsangebot im Jahr<br />
2019 um die neuen Anforderungen<br />
der TRAS 120 ergänzt.<br />
Hierzu wurde speziell für die<br />
Mitarbeitenden auf Biogasanlagen<br />
die „Mitarbeiterqualifikation“<br />
entwickelt und für Unternehmen<br />
zur Errichtung und Instandhaltung<br />
zusätzlich das Schulungskonzept<br />
„Qualifikation - Fachkunde Sichere<br />
Instandhaltung/Errichtung gemäß TRAS<br />
120“ entworfen.<br />
Weitere Informationen zum Schulungsverbund<br />
Biogas und den Schulungskonzepten finden Sie<br />
unter: www.schulungsverbund-biogas.org<br />
100
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Verband<br />
Unsere Kompetenz für Ihren Erfolg<br />
• Rohrleitungsbau<br />
• Sanierung und Beschichtung von Biogasbehältern<br />
• Dachkonstruktionen für Biogasbehälter<br />
• Hochwertige Rührwerks- und Pumpentechnik<br />
• Externe Gasspeicherung<br />
• Wartungs- und Kontrollgänge<br />
• Hochwertige Ersatz- und Anbauteile<br />
• Montage & Service mit geschultem Fachpersonal<br />
Nesemeier GmbH<br />
Industriestraße 10 | 32825 Blomberg<br />
Tel.: +49 5235 50287 0<br />
info@nesemeier-gmbh.de<br />
www.nesemeier-gmbh.de<br />
Tank und Apparate Barth GmbH<br />
Werner-von-Siemens-Str. 36<br />
76694 Forst<br />
Tel. 07251 / 9151-0<br />
FAX 07251 / 9151-75<br />
info@barth-tank.de<br />
Tanks neu / gebrauchT<br />
Lösch-/Regenwasserbehälter, Pufferspeicher,<br />
Flüssigdüngertankanlagen,<br />
Diesel-, Heizöl- und Pflanzenölbehälter,<br />
Edelstahlbehälter<br />
von 1.000 – 300.000 Ltr. Inhalt<br />
zu verkaufen.<br />
- Industriedemontagen -<br />
Keine Korrosionsbeschichtung des Behälters<br />
Kein Gasvolumen gem. Störfall Verordnung<br />
www.n-e-st.de<br />
Tel.: 02561 449 10 10<br />
schlüsselfertige Komplettanlage<br />
Wir bewegen jegliche Art<br />
von Gasen bei allen Drücken<br />
und allen Volumenströmen.<br />
Von Biogas über Erdgas bis<br />
hin zu Synthesegasen –<br />
dafür erhalten Sie Maßgeschneiderte<br />
Lösungen<br />
mit modernster Steuerung<br />
und Sensorik nach SIL<br />
Klassifizierung. Vollständig<br />
integrierbar oder als StandaloneAnlage<br />
inklusive CE.<br />
Besuchen Sie uns auf der Messe:<br />
7.-9. Dez. <strong>2021</strong><br />
an-umwelttechnik.com<br />
Johannes-Eberlin-Str. 36 | 91578 Leutershausen | Tel. +49 (0) 9823 9263242<br />
101
Verband<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Rückblick Aktionswoche<br />
Artenvielfalt<br />
Wie schon zur Premiere 2020 haben<br />
sich auch in diesem Jahr zahlreiche<br />
Verbände, Firmen und Privatpersonen<br />
an der 2. Aktionswoche Artenvielfalt<br />
beteiligt. Gemeinsam haben die<br />
Akteure darauf hingewiesen, dass das Spektrum an<br />
Energiepflanzen sehr groß ist – und dass viele dieser<br />
Pflanzen einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt und<br />
Biodiversität auf den Ackerflächen leisten.<br />
„Grundsätzlich kann so gut wie jede Pflanze in Biogasanlagen<br />
vergoren und zu Energie in Form von Strom<br />
und Wärme oder Kraftstoff umgewandelt werden“, sagte<br />
Horst Seide, Präsident des Fachverbandes Biogas<br />
e.V. Der Unterschied liege allein in der Gasausbeute<br />
und damit letztendlich im Einkommen des Betreibers.<br />
Von einem Hektar Wildpflanzen beispielsweise könne<br />
in einer Biogasanlage nur etwa die Hälfte der Strommenge<br />
erzeugt werden wie von einem Hektar Mais.<br />
Dennoch sieht der Verbandspräsident im Anbau alternativer<br />
Energiepflanzen eine große Chance – sowohl für<br />
die Artenvielfalt auf den Ackerflächen als auch für die<br />
Zukunft der Biogasbranche.<br />
Artenreiche Energiepflanzenfelder wünscht sich auch<br />
Dr. Andreas Kinser, stellvertretender Leiter Natur- und<br />
Artenschutz bei der Deutschen Wildtier Stiftung. Und er<br />
forderte schnelles Handeln. „Das Rebhuhn als typischer<br />
Bewohner der Feldflur ist seit 1980 europaweit um 94<br />
Prozent zurückgegangen“, mahnte Kinser. Er schätzt,<br />
dass auf den knapp 12 Millionen Hektar Ackerfläche<br />
in Deutschland gerade einmal 1.500 Hektar Wildpflanzenmischungen<br />
zur Biomasseproduktion angebaut werden.<br />
Mit bunter Biomasse als Teil des landwirtschaftlichen<br />
Mainstreams könne jedoch eine Trendwende beim<br />
Artenrückgang in der Feldflur gelingen.<br />
Gut 200 Hektar dieser Wildpflanzenflächen stammen<br />
von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau<br />
Veitshöchheim (LWG). Die dortige Wildpflanzenspezialistin<br />
Kornelia Marzini betonte: „Die Herausforderung<br />
besteht darin, eine Mischung zu finden, die<br />
an den Klimawandel angepasst ist, eine hohe Biodiversität<br />
garantiert und zudem ausreichend Ertrag für<br />
die Biogasanlage ermöglicht.“ Die Veitshöchheimer<br />
Mischung erfülle diese Anforderungen seit 2014 und<br />
sei unter anderem vom BUND und dem Bauernverband<br />
anerkannt.<br />
Das späte Erntefenster ab Mitte Juli ermögliche den Vögeln<br />
ein erfolgreiches Brutgeschäft. Untersuchungen<br />
102
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Verband<br />
hätten ergeben, dass bedrohte Arten wie die Braun-,<br />
Schwarz- und Blaukehlchen in den Blühflächen vorkommen<br />
und die Brutreviere über die Jahre immer<br />
weiter zunehmen, berichtet Marzini. Die Basis hierfür<br />
sei eine ausreichend große Insektennahrung.<br />
Bei Untersuchungen<br />
mit einem Insektensauger wurden<br />
auf den Blühflächen in einer<br />
Viertelstunde 225 verschiedene<br />
Insektenarten festgestellt – was<br />
selbst renommierte Biologen verblüfft<br />
habe.<br />
Für den dreifachen Rodel-Olympiasieger<br />
Georg Hackl ist der<br />
Klima- und Umweltschutz eine<br />
Herzensangelegenheit: „Als<br />
Wintersportler merke ich ganz<br />
massiv die Auswirkungen des<br />
Klimawandels. Ich sehe in der<br />
Biogasnutzung eine große Chance,<br />
dem entgegenzuwirken – ganz<br />
besonders, wenn der Anbau der<br />
Energiepflanzen auch noch Artenvielfalt<br />
und Insektenschutz<br />
mit sich bringt.“<br />
„Mit Biogas haben wir die Chance,<br />
Ökologie und Ökonomie unter<br />
einen Hut zu bringen“, resümierte<br />
der Präsident des Fachverbandes<br />
Biogas Horst Seide. Und er<br />
weiß, dass viele Betreiber von<br />
Biogasanlagen bereit sind, alternative<br />
Energiepflanzen anzubauen.<br />
Wichtig sei aber ein Ausgleich<br />
der finanziellen Nachteile, die<br />
der Anbau bunter Blumenwiesen<br />
für den Landwirt bedeuten. „Bei uns in Niedersachsen<br />
regelt seit diesem Sommer die Förderrichtlinie<br />
‚Mehrjähriger Wildpflanzenanbau‘ die finanzielle Unterstützung.<br />
Bis zu 500 Euro pro Hektar gibt es für<br />
den Anbau von Blühpflanzen. Das ist ein realistischer<br />
Ansatz und ein gutes Beispiel für andere Bundesländer“,<br />
sagte Seide.<br />
103
Recht<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Zwei Voten zur (Neu-)Inbetriebnahme<br />
von Biogasanlagen und<br />
ein Schiedsspruch zur Mitnahme<br />
der Höchstbemessungsleistung<br />
Die Clearingstelle EEG|KWKG hat ein Votum zur Erneuerung und<br />
Neu-Inbetriebnahme einer Biogasanlage unter dem EEG 2004 und<br />
damit verbundener Rückabwicklungsfragen, ein Votum zur Inbetriebnahme<br />
einer neugeschaffenen Biogasanlage unter dem EEG 2009<br />
sowie einen Schiedsspruch zur anteiligen Mitnahme der Höchstbemessungsleistung<br />
veröffentlicht.<br />
Von Elena Richter<br />
I. Votum 2020/62-IV zur<br />
Neuinbetriebnahme nach<br />
Erneuerung gemäß § 3 Absatz 4<br />
EEG 2004<br />
In diesem Votum 1 mit grundsätzlicher Bedeutung<br />
hat die Clearingstelle geprüft, ob<br />
im konkreten Fall die Biogasanlage im Jahr<br />
2008 gemäß Paragraf (§) 3 Absatz 4 Alternative<br />
2 EEG 2004 erneuert wurde (im<br />
Ergebnis bejaht). Insbesondere war zu klären,<br />
ob und inwieweit aufgrund dessen eine<br />
Neubestimmung des Inbetriebnahmedatums<br />
sowie der Vergütungsdauer und -höhe<br />
für Vergangenheit und Zukunft möglich ist.<br />
Denn die Betreiberin der Biogasanlage hatte<br />
der Netzbetreiberin erst im Jahr 2018<br />
die Umstände der Erneuerung mitgeteilt<br />
und eine Neuinbetriebnahme geltend gemacht.<br />
Die Clearingstelle ist dabei zu folgenden<br />
Ergebnissen gekommen: Die (Neu-)Inbetriebnahme<br />
ist eine Rechtsfolge, die bei<br />
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen<br />
eintritt. Das Geltendmachen der (Neu-)<br />
Inbetriebnahme ist daher kein Gestaltungsrecht<br />
im zivilrechtlichen Sinn, das verwirkt<br />
werden und damit endgültig ausgeschlossen<br />
sein kann. Etwas anderes ergibt sich<br />
auch nicht aus den Mitteilungspflichten<br />
des EEG. Jedoch können aufgrund der<br />
Neuinbetriebnahme entstandene (Nach-)<br />
Zahlungsansprüche der Anlagenbetreiberinnen<br />
und -betreiber verwirken.<br />
Im vorliegenden Fall bestanden allerdings<br />
nur Rückforderungsansprüche der Netzbetreiberin,<br />
da sich durch die Neuinbetriebnahme<br />
die EEG-Vergütung der Höhe nach<br />
verringert hat. Soweit diese Rückforderungsansprüche<br />
nach § 35 Absatz 5 EEG<br />
2012/§ 57 Absatz 5 EEG 2014 (kenntnisunabhängige<br />
zweijährige Verjährungsfrist)<br />
bereits verjährt sind, kann die Anlagenbetreiberin<br />
die Einrede der Verjährung<br />
nach dem Grundsatz von Treu und Glauben<br />
(§ 242 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB)<br />
aber nicht wirksam erheben. Denn die Verjährung<br />
ist aufgrund ihres widersprüchlichen<br />
Verhaltens eingetreten – also durch<br />
das unwidersprochene Hinnehmen der<br />
bislang ausgezahlten Vergütung und das<br />
Geltendmachen der geänderten Vergütung<br />
erst nach Eintritt der Verjährung.<br />
Die Netzbetreiberin kann daher auch die<br />
verjährten Rückforderungsansprüche geltend<br />
machen. Sie ist gemäß § 35 Absatz<br />
5 Satz 2 EEG 2012/§ 57 Absatz 5 Satz 2<br />
EEG 2014 aufgrund des Ablaufs der Verjährungsfrist<br />
aber nicht mehr dazu verpflichtet.<br />
Die Clearingstelle hat bei der<br />
Erstellung des Votums die Stellungnahmen<br />
der von den Parteien ausgewählten Verbände<br />
berücksichtigt.<br />
II. Votum 2019/37 zur<br />
Inbetriebnahme einer wertungsgemäß<br />
neugeschaffenen Anlage<br />
gemäß § 3 Nr. 5 EEG 2009<br />
In dem Votum 2 war zu entscheiden, ob<br />
die Anlagenbetreiberin im Jahr 2010 am<br />
Standort ihrer Bestandsanlage eine Neuanlage<br />
im Sinne von § 3 Nummer 1 EEG<br />
2009 errichtet und gemäß § 3 Nummer 5<br />
EEG 2009 erstmals in Betrieb genommen<br />
hat. Die Clearingstelle hat dies im Ergebnis<br />
bejaht, da die Anlagenbetreiberin die<br />
Bestandsanlage stillgelegt, von dieser nur<br />
sehr geringfügige Bestandteile fortgenutzt<br />
und im Übrigen eine neue Anlage – unter<br />
anderem bestehend aus einem neuem<br />
Fermenter und einem neuem BHKW – geschaffen<br />
hat.<br />
Auch hier haben sich Rückabwicklungsfragen<br />
gestellt. Diese waren jedoch teils anders<br />
zu bewerten als im vorgenannten Votum<br />
2020/62-IV, da sich die Voraussetzungen<br />
der anzuwendenden Inbetriebnahmeregelungen<br />
unterscheiden. Insbesondere hat<br />
im vorliegenden Fall die Anlagenbetreiberin<br />
der Netzbetreiberin rechtzeitig zum 28.<br />
Februar 2011 die Umstände der Schaffung<br />
und Inbetriebnahme einer Neuanlage mitgeteilt<br />
und geltend gemacht.<br />
III. Schiedsspruch<br />
<strong>2021</strong>/4-IV zur Mitnahme der<br />
Höchstbemessungsleistung<br />
Im vorliegenden Fall wurde ein BHKW aus<br />
einer Biogasanlage der Schiedsklägerin<br />
aufgrund einer Fermenterhavarie und der<br />
anschließenden Stilllegung dieser Biogasanlage<br />
an eine naheliegende, andere<br />
Biogasanlage der Schiedsklägerin angeschlossen.<br />
Im Schiedsspruch 3 hat die Clearingstelle<br />
im Rahmen einer sogenannten<br />
Billigkeitsentscheidung entschieden, dass<br />
dieses BHKW die Höchstbemessungsleistung<br />
der stillgelegten Biogasanlage zur<br />
neuen Biogasanlage „mitnehmen“ kann.<br />
1<br />
Abrufbar unter: https://www.clearingstelleeeg-kwkg.de/votv/2020/62-IV.<br />
2<br />
Abrufbar unter: https://www.clearingstelleeeg-kwkg.de/votv/2019/37.<br />
3<br />
Abrufbar unter: https://www.clearingstelleeeg-kwkg.de/schiedsrv/<strong>2021</strong>/4-IV.<br />
Autorin<br />
Elena Richter<br />
Mitglied der Clearingstelle EEG | KWKG<br />
Charlottenstr. 65 · 10117 Berlin<br />
030/206 14 16-0<br />
post@clearingstelle-eeg-kwkg.de<br />
104
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Recht<br />
IHR PARTNER FÜR FÖRDER-, DOSIER-<br />
UND ZUFÜHRTECHNIK<br />
Passende Rührtechnik für jedes Substrat<br />
VARIO DOSIERCONTAINER<br />
– Alle Rührwerkstypen<br />
– Über 25 Jahre Erfahrung<br />
– Optimierung, Nachrüstung, Tausch<br />
von 7m³ bis 265m³<br />
einzigartiges Vario Schubbodensystem<br />
für 100% Grassilage und Mist<br />
in Teil- und Volledelstahl Ausführung<br />
geringer Energiebedarf<br />
Tel. +49.7522.707.965.0 www.streisal.de<br />
VARIO COMPACT<br />
7m³ | 11m³| 16m³<br />
speziell für Biogas-Kleinanlagen<br />
MOBILE NOTFÜTTERUNG<br />
10x in Deutschland<br />
weitere Produkte auf<br />
www.terbrack-maschinenbau.de<br />
105<br />
Terbrack Maschinenbau GmbH<br />
Tel.: +49 2564 394 487 - 0<br />
mail: technik@terbrack-maschinenbau.de<br />
www.terbrack-maschinenbau.de
Recht<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Votum der Clearingstelle zur „Modernisierung“<br />
von Biogasanlagen – und jetzt?<br />
Es ist sehr zu begrüßen, dass die Clearingstelle auch heute noch eine Modernisierungsanerkennung<br />
für möglich erachtet. Anlagenbetreibern ist jedoch dringend anzuraten,<br />
vor der Beauftragung oder Einreichung eines Modernisierungsgutachtens mit dem<br />
Netzbetreiber abzuklären, wie viel an Rückforderung für in der Vergangenheit zu viel<br />
ausgezahlter Vergütung im Raum steht, da ansonsten ein solches Gutachten schnell<br />
zum Bumerang werden kann.<br />
Von Dr. Helmut Loibl<br />
Sowohl das EEG 2000 als auch das EEG<br />
2004 sahen eine sogenannte „Modernisierungsregelung“<br />
vor: Falls nach der ersten<br />
Inbetriebnahme einer Biogasanlage weiter<br />
viel Geld investiert wurde, konnte die gesamte<br />
Anlage ein neues Inbetriebnahmejahr erwirken:<br />
Dies wäre zum einen positiv, weil sich damit letztendlich<br />
die Laufzeit der Anlage verlängert (mit der Neuinbetriebnahme<br />
würde die Anlage ab dem Zeitpunkt der<br />
Modernisierung wieder 20 Jahre zuzüglich Inbetriebnahmejahr<br />
erhalten), andererseits ist es negativ, weil<br />
bei der Vergütungshöhe die zwischenzeitlich eingetretene<br />
Degression zu berücksichtigen ist (im EEG 2004:<br />
1,5 Prozent pro Jahr auf die Grundvergütung).<br />
Die Modernisierungsregelung war dabei im Gesetz<br />
etwas komplex ausgestaltet: Letztlich musste nach<br />
Durchführung der Modernisierung ein fiktiver Neuanlagenwert<br />
ermittelt werden. Bei Wiederinbetriebnahme<br />
der modernisierten Anlage waren sämtliche zu diesem<br />
Zeitpunkt vorhandenen Komponenten einer Biogasanlage<br />
zu Neupreisen zu bewerten. Sodann war dieser<br />
100-Prozent-Wert mit den nach Inbetriebnahme getätigten<br />
Investitionen zu vergleichen. Wurde mit den<br />
Investitionen ein Anteil von 50 Prozent überschritten,<br />
galt die Anlage als neu in Betrieb genommen, bei Unterschreitung<br />
verblieb es bei der bisherigen Vergütungshöhe<br />
und Vergütungsdauer.<br />
Diese Regelung wurde mit dem EEG 2009 und für die<br />
nachfolgenden EEG-Regelungen ersatzlos aufgehoben.<br />
Mit anderen Worten: Eine Modernisierung war nur möglich<br />
für Anlagen, die vor 1. Januar 2009 ausreichend<br />
viel investiert hatten. Seit einigen Jahren war nun in<br />
der Praxis höchst umstritten, ob Anlagenbetreiber<br />
auch heute noch solche „Modernisierungen“ anerkennen<br />
lassen können, da der Zeitraum der Investition,<br />
der zwingend vor 1. Januar 2009 liegen muss, schon<br />
viele Jahre vorbei ist. Manche Netzbetreiber haben in<br />
den vergangenen Jahren solche Modernisierungen anerkannt,<br />
andere hingegen waren skeptisch. Nunmehr<br />
liegt ein Votum der Clearingstelle EEG mit einigen<br />
Foto: Adobe Stock_Animaflora PicsStock<br />
106
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
grundsätzlichen Aussagen<br />
hierzu vor (Votum 2020/62-<br />
IV): Die grundsätzlichen Aussagen<br />
dieses Votums finden<br />
Sie in diesem Biogas Journal<br />
auf Seite 104.<br />
Netzbetreiber muss<br />
Entscheidung der<br />
Clearingstelle nicht<br />
akzeptieren<br />
Da diese Entscheidung der<br />
Clearingstelle für Biogasanlagenbetreiber<br />
sowohl positive<br />
als auch nicht ganz so<br />
positive Aussagen enthält,<br />
sollten betroffene Anlagenbetreiber<br />
einen Schritt<br />
nach dem anderen gehen:<br />
In einem ersten Schritt ist<br />
Kontakt mit dem eigenen<br />
Netzbetreiber aufzunehmen<br />
und zu ermitteln, ob er das<br />
Votum der Clearingstelle<br />
so akzeptieren kann. Zwar<br />
ist die Grundsatzaussage<br />
der Clearingstelle, dass das<br />
Recht auf „Modernisierung“ ein gesetzliches<br />
Recht wäre und daher weder verjähren<br />
noch verwirkt werden könne, sehr positiv.<br />
Allerdings gibt es keinerlei gesetzliche<br />
Verpflichtung für Netzbetreiber, dass diese<br />
solche Entscheidungen der Clearingstelle<br />
akzeptieren oder gar umsetzen müssen.<br />
Zwar kann grundsätzlich davon ausgegangen<br />
werden, dass der Netzbetreiber<br />
hierdurch keinerlei Nachteil hat, weil bei<br />
der Wälzung der EEG-Zahlungen die Entscheidungen<br />
der Clearingstelle zu beachten<br />
sind. Es kann also davon ausgegangen<br />
werden, dass der Netzbetreiber die insoweit<br />
ausgezahlte EEG-Vergütung komplett<br />
vom Übertragungsnetzbetreiber erstattet<br />
erhält. Gleichwohl kann der Netzbetreiber<br />
frei entscheiden, ob er dieser Entscheidung<br />
der Clearingstelle EEG folgen möchte<br />
oder nicht. Daher sollte diese Frage in<br />
einem ersten Schritt abgeklärt werden.<br />
Sollte der Netzbetreiber sich der Auffassung<br />
der Clearingstelle anschließen, muss<br />
im zweiten Schritt folgende Aussage der<br />
Clearingstelle kritisch beleuchtet werden:<br />
Der Anlagenbetreiber soll sich gegenüber<br />
Rückforderungsansprüchen des Netzbetreibers<br />
nicht auf die Verjährung berufen<br />
können. Grundsätzlich führt nämlich<br />
die nachträgliche Anerkennung der Modernisierung<br />
tatsächlich dazu, dass die<br />
Grundvergütung um 1,5 Prozentpunkte je<br />
Kalenderjahr abgesenkt wird und in der Regel<br />
damit jährlich ein nicht unerheblicher<br />
Rückforderungsanspruch des Netzbetreibers<br />
aufgelaufen ist.<br />
Ein solcher verjährt grundsätzlich innerhalb<br />
einer Zweijahresfrist, allerdings erklärt<br />
die Clearingstelle in nachvollziehbarer<br />
Weise, dass derjenige, der erst viele Jahre<br />
widerspruchslos die Vergütung akzeptiert<br />
und dann eine Modernisierung anerkennen<br />
lässt, sich nicht auf eine Verjährung<br />
berufen können soll. Das bedeutet: Lässt<br />
ein Anlagenbetreiber nun tatsächlich zum<br />
Beispiel das Kalenderjahr 2008 als neues<br />
Inbetriebnahmejahr anerkennen, müsste<br />
er damit volle 13 Jahre den entsprechend<br />
zu viel erhaltenen Betrag zurückzahlen.<br />
Sechsstellige<br />
Rückzahlungsbeträge<br />
So hat beispielsweise eine Anlage mit dem<br />
Inbetriebnahmejahr 2004 bis 150 Kilowatt<br />
elektrische Leistung (kW) 11,5 Cent<br />
pro Kilowattstunde (ct/kWh) und bis 500<br />
kW 9,9 ct/kWh erhalten. Wenn diese Anlage<br />
im Schnitt 300 kW installiert hat und<br />
jetzt im Nachgang eine Modernisierung für<br />
2008 anerkennen lässt, wäre seither die<br />
Grundvergütung auf 10,83 ct/kWh bis 150<br />
kW und auf 9,31 ct/kWh bis 500 kW gesunken,<br />
wobei zu beachten ist, dass das<br />
EEG 2009 die Vergütung für alle Anlagen<br />
bis 150 kW auf 11,67 ct/kWh angehoben<br />
hat (insoweit wäre also nur bis 1. Januar<br />
2009 ein Vergütungsnachteil gegeben).<br />
Diese Anlage müsste also Stand heute –<br />
wenn sie durchgängig weiterhin 300 kW<br />
jährlich produziert hätte – insgesamt etwa<br />
110.000 Euro netto (bis 150 kW: 8.830<br />
Euro für 2008, danach keine Rückzahlung;<br />
ab 150 kW: 7.752 Euro pro Jahr x<br />
13 Jahre) zurückzahlen. Hätte die Anlage<br />
im Zuge der Modernisierung auch erweitert<br />
und seit 2008 jährlich 500 kW eingespeist,<br />
würde der gesamte theoretische<br />
Rückzahlungsbetrag sogar auf 244.000<br />
Euro netto anwachsen.<br />
Ob umgekehrt eine eventuell höhere Bonusvergütung<br />
(zum Beispiel 2 ct für KWK<br />
oder Trockenfermentation, was eine Anlage<br />
nach EEG 2000 nicht hat geltend machen<br />
können, aber nach dem Wechsel ins EEG<br />
2004 durchaus kann) hier gegengerechnet<br />
werden kann, muss im Einzelfall geprüft<br />
werden. Das könnte aber kritisch<br />
NEU:<br />
Recht<br />
UltraPract® PG<br />
Der Beschleuniger für<br />
schwer vergärbare<br />
Substratmischungen!<br />
Hochwirksam, mit<br />
patentiertem Enzymprofil<br />
Steigern Sie die<br />
Wirtschaftlichkeit<br />
Ihrer Biogasanlage.<br />
» Stabilisiert den Anlagenbetrieb<br />
beim Einsatz von<br />
„Problem-Substraten”<br />
(Mist + GPS, Grassilage).<br />
» Maximiert die Geschwindigkeit<br />
der Biogasbildung.<br />
» Optimiert die Substratverwertung<br />
und damit die<br />
Wirtschaftlichkeit der Biogasanlage.<br />
stock.adobe.com / © JonathanSchöps<br />
107<br />
+49 (0)30 6670 - 2056 » www.biopract-abt.de
Recht<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Anlagenbetreiber,<br />
die Modernisierungsansprüche<br />
geltend<br />
machen wollen, sollten<br />
das Für und Wider<br />
genau prüfen.<br />
sein, weil die Clearingstelle die Frage, ob ein solcher<br />
nachträglicher Zahlungsanspruch gegen den Netzbetreiber<br />
verjährt oder verwirkt sein könnte, ausdrücklich<br />
offengelassen hat.<br />
Netzbetreiber darf, muss aber nicht<br />
rückfordern<br />
Das kann schnell unwirtschaftlich werden. Vor diesem<br />
Hintergrund ist dem betroffenen Anlagenbetreiber<br />
dringend anzuraten, Kontakt mit seinem Netzbetreiber<br />
aufzunehmen und zu klären, welchen Zeitraum<br />
der Netzbetreiber tatsächlich rückabwickeln möchte.<br />
Es ist nämlich nach Auffassung der Clearingstelle so,<br />
dass der Netzbetreiber zwar berechtigt ist, die Rückforderungsansprüche<br />
geltend zu machen, ihn hierzu<br />
aber keinerlei Pflicht trifft. Letztlich entscheidet der<br />
Netzbetreiber damit im freien Ermessen.<br />
In der Vergangenheit war es im Regelfall so, dass grundsätzlich<br />
das aktuelle Jahr rückabgewickelt wird, regelmäßig<br />
auch das Vorjahr, wenn der Belastungsausgleich<br />
noch nicht erfolgt ist. Da der Netzbetreiber aber – wie<br />
gezeigt wurde – auch weit über zehn Jahre zurückfordern<br />
könnte, muss dieser Punkt bereits im Vorfeld geklärt<br />
werden.<br />
Sofern der Netzbetreiber die Clearingstellenentscheidung<br />
anwenden möchte und zudem der in Aussicht<br />
gestellte Rückforderungszeitraum für den Anlagenbetreiber<br />
akzeptabel ist, wäre in einem dritten Schritt ein<br />
Modernisierungsgutachten zu beauftragen beziehungsweise<br />
gegebenenfalls zu überarbeiten: Ein Fachgutachter<br />
muss nicht nur kritisch prüfen, welche Investitionen<br />
tatsächlich für eine solche Modernisierung zu berücksichtigen<br />
sind, vor allem muss er zum Zeitpunkt des<br />
Abschlusses der Arbeiten den fiktiven Neuherstellungswert<br />
der damals vorhandenen Biogasanlage ermitteln.<br />
Nur wenn hier die 50 Prozent Reinvestitionskosten<br />
überschritten sind, macht nach entsprechender Ermittlung<br />
der Zahlen und Fakten die Fertigstellung des<br />
Gutachtens Sinn.<br />
Für diese Begutachtung klärt das Clearingstellenvotum<br />
einige kritische Punkte: So stellt die Clearingstelle<br />
beispielsweise klar, dass eine Modernisierung auch<br />
unmittelbar nach der Erstinbetriebnahme eingeleitet<br />
werden kann. Weiterhin ist es nicht nötig, dass die Anlage<br />
bei Fertigstellung der Modernisierung außer Betrieb<br />
gesetzt werden musste. Das heißt, der Gutachter<br />
hat insoweit einen gewissen Spielraum, wann genau die<br />
Modernisierung abgeschlossen ist.<br />
Modernisierung sollte zusammenhängender<br />
Vorgang sein<br />
Allerdings neigt die Clearingstelle der Auffassung zu,<br />
dass es sich bei der Modernisierung um einen in gewisser<br />
Weise zusammenhängenden Vorgang handeln<br />
muss. Letztlich wäre es also sehr hilfreich, wenn der<br />
Modernisierung ein Gesamtkonzept zugrunde liegt, das<br />
dann auch über einen längeren Zeitraum verfolgt werden<br />
kann. Das beste Beispiel ist, wenn zwar möglicherweise<br />
die Reinvestitionskosten sich über mehrere Jahre<br />
erstreckt haben, aber auf der Basis einer zunächst<br />
eingeholten Genehmigung erfolgen, die nach und nach<br />
abgearbeitet wurde.<br />
108
Foto: Adobe Stock_Countrypixel<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Falls es sich um mehrere Genehmigungsschritte<br />
handelt oder die Modernisierung<br />
gegebenenfalls gar keine Genehmigung<br />
benötigt hat, wäre ein damals erstelltes<br />
schriftliches Konzept hilfreich. Hier müssen<br />
– ebenso wie bei der Ermittlung der tatsächlichen<br />
Investitionen – die Unterlagen<br />
vor 1. Januar 2009 kritisch durchgesehen<br />
werden.<br />
Sofern bereits ein Modernisierungsgutachten<br />
vorliegt, das der Netzbetreiber vor der<br />
Clearingstellenentscheidung nicht anerkannt<br />
hat, muss in vielen Fällen gleichwohl<br />
im Hinblick auf diese Vorgaben nun eine<br />
Überarbeitung des entsprechenden Gutachtens<br />
erfolgen. Erst wenn das Gutachten<br />
auch unter Beachtung der Vorgaben der<br />
Clearingstelle gesichert eine Überschreitung<br />
der 50-Prozent-Marke ergibt, sollte<br />
es dem Netzbetreiber vorgelegt werden.<br />
In besonderer Weise ist jedoch Vorsicht geboten,<br />
wenn nach der Modernisierung noch<br />
Zündstrahlaggregate vorhanden waren: Die<br />
Nutzung eines fossilen Zündstrahls war<br />
und ist bis heute zulässig für Anlagen, die<br />
im Sinne des EEG das Inbetriebnahmejahr<br />
2006 oder früher haben. Ab 1. Januar<br />
2007 war als Zündstahl nur noch Pflanzenölmethylester<br />
zulässig. Wenn nun eine<br />
Biogasanlage beispielsweise auch in den<br />
Kalenderjahren 2007 und 2008 noch fossilen<br />
Zündstrahl eingesetzt hat und über<br />
ein Modernisierungsgutachten nun eine<br />
Neuinbetriebnahme im Kalenderjahr 2008<br />
festgestellt wird, wäre damals in unzulässiger<br />
Weise fossiler Zündstrahl eingesetzt<br />
worden.<br />
Diese unzulässige Mischfeuerung führt für<br />
den entsprechenden Zeitraum zum Komplettverlust<br />
der Vergütung, zudem muss<br />
damit gerechnet werden, dass der Nawa-<br />
Ro-Bonus endgültig verloren ist. Im Ergebnis<br />
heißt dies: Eine Anlage, die fossilen<br />
Zündstrahl eingesetzt hat, darf grundsätzlich<br />
zwar auch eine Modernisierung durchführen,<br />
diese müsste jedoch spätestens<br />
Ende 2006 abgeschlossen gewesen sein.<br />
An Ausschreibung schon<br />
teilnehmen oder nicht<br />
Eine heikle Frage für viele Anlagenbetreiber<br />
ist, ob sie jetzt in Verhandlungen mit<br />
dem Netzbetreiber hinsichtlich der Modernisierung<br />
treten oder aber am Ausschreibungsverfahren<br />
teilnehmen sollen. Aus<br />
juristischer Sicht erscheint beides parallel<br />
nicht möglich zu sein: Hintergrund ist, dass<br />
eine Biogasanlage an der Folgeausschreibung<br />
bereits dann teilnehmen kann, wenn<br />
die Restlaufzeit der Erstvergütungsperiode<br />
weniger als acht Jahre ausmacht. Da eine<br />
Modernisierung bestenfalls für das Kalenderjahr<br />
2008 angesetzt werden kann, sodass<br />
diese modernisierte Anlage dann eine<br />
Vergütungsdauer bis 31. Dezember 2028<br />
innehätte, könnte diese Anlage auch nach<br />
erfolgter Modernisierung schon heute wirksam<br />
an einer Ausschreibung teilnehmen.<br />
Ein konkretes Beispiel: Eine Biogasanlage<br />
ist 2004 in Betrieb gegangen und hat<br />
damit das Vergütungsende 31. Dezember<br />
2024. Nunmehr möchte die Anlage eine<br />
Modernisierung im Jahr 2008 anerkennen<br />
lassen. Zur Sicherheit geht der Betreiber<br />
dieser Anlage jedoch im März 2022 in die<br />
Ausschreibung und erhält einen Zuschlag.<br />
Wird dann im Nachgang die Modernisierung<br />
für das Kalenderjahr 2008 anerkannt,<br />
hat der Anlagenbetreiber im Ergebnis<br />
nichts gewonnen: Das EEG sieht vor, dass<br />
drei Jahre ab Zuschlagsveröffentlichung<br />
der Wechsel in die Ausschreibungsvergütung<br />
automatisch erfolgt.<br />
Das heißt, diese Anlage wechselt spätestens<br />
im April 2025, unabhängig davon,<br />
ob sie das Inbetriebnahmejahr 2005 oder<br />
2008 hat, in die Ausschreibungsvergütung.<br />
Wie dieses Beispiel zeigt, sollte jemand,<br />
der noch auf eine Modernisierung baut,<br />
derzeit noch nicht an einer Ausschreibung<br />
teilnehmen. Umgekehrt muss kritisch geprüft<br />
werden, ob noch ausreichend Zeit ist,<br />
um die Teilnahme an einer Ausschreibung<br />
zu schieben: Dies ist grundsätzlich nur für<br />
solche Anlagen zu empfehlen, die noch<br />
innerhalb ihrer Erstvergütungsdauer aus<br />
zeitlicher Sicht eine Modernisierung anerkennen<br />
lassen können.<br />
Autor<br />
Dr. Helmut Loibl<br />
Rechtsanwalt und Fachanwalt<br />
für Verwaltungsrecht<br />
Sprecher des Juristischen Beirats<br />
im Fachverband Biogas e.V.<br />
loibl@paluka.de<br />
www.paluka.de<br />
BIOGASANALYSE<br />
FOS/TAC<br />
SSM 6000<br />
automatischer Titrator<br />
zur Bestimmung<br />
von FOS, TAC und<br />
FOS/TAC<br />
Recht<br />
der Klassiker für die Analyse<br />
von CH 4<br />
, H 2<br />
S, CO 2<br />
, H 2<br />
und O 2<br />
mit und ohne Gasaufbereitung<br />
SSM 6000 ECO<br />
www.pronova.de<br />
* proCAL für SSM 6000, ist<br />
die vollautomatische,<br />
prüfgaslose Kalibrierung<br />
für NO x<br />
, CO und O 2<br />
, mehrere<br />
Meßstellen (44. BlmSchV.)<br />
TRAS 120<br />
44. BlmSchV.<br />
sprechen<br />
Sie uns an!<br />
GASANALYSENTECHNIK<br />
BIOGASANALYSENTECHNIK<br />
WASSERANALYSENTECHNIK<br />
AGRARMESSTECHNIK<br />
PRONOVA Analysentechnik GmbH&Co.KG<br />
Granatenstraße 19-20 I 13 4 0 9 BERLIN<br />
Tel +49 30 455085-0 I info@pronova.de<br />
*<br />
109
Recht<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Herausforderung – BHKW-Tausch<br />
Jeder Betreiber steht früher oder später vor der Herausforderung, dass er eines oder<br />
mehrere Blockheizkraftwerke (BHKW) austauschen oder reparieren muss. Oft wird<br />
verkannt, welche Aufgaben und Herausforderungen mit einem solchen Austausch oder<br />
einer Reparatur verbunden sind. Dieser Aufsatz gibt einen sehr groben Überblick über<br />
die Fallgestaltungen des Austauschs und die jeweils betroffenen Themenbereiche.<br />
Von Dipl.-Betr. (BA) René Walter<br />
Neben verschiedenen Kernbotschaften sind<br />
die beiden Hauptbotschaften dieses Aufsatzes,<br />
dass entsprechende Maßnahmen<br />
sehr sorgfältig zu planen und die betroffenen<br />
Themenbereiche, die nachfolgend<br />
dargestellt werden, abzuarbeiten sind. Dabei wird Sie<br />
die neue Arbeitshilfe des Fachverbandes Biogas e.V.<br />
und das Seminar des Autors im Rahmen des Schulungsangebotes<br />
des Fachverbandes Biogas e.V., das<br />
im September stattfinden wird, äußerst hilfreich unterstützen.<br />
Als erste Kernbotschaft kann hier auf den Weg gegeben<br />
werden, dass die Herausforderungen grundsätzlich<br />
mit der zeitlichen Länge des Austauschs- oder<br />
Reparaturvorgangs steigen. Zu unterscheiden sind die<br />
Reparatur, der Austausch einzelner Teile eines BHKW,<br />
des Generators, des Motors und der Gesamtaustausch<br />
eines einzelnen BHKW oder mehrerer BHKW. Von<br />
maßgeblicher Bedeutung ist auch, ob es sich um ein<br />
Satelliten-BHKW oder eine Vor-Ort-Verstromungsanlage<br />
handelt. Insbesondere dann, wenn an einem<br />
Satelliten-Standort nur ein BHKW vorhanden ist, ergeben<br />
sich erhebliche Herausforderungen. Darüber<br />
hinaus ist es für verschiedene Punkte bedeutsam, ob<br />
das BHKW gegen ein baugleiches oder ein anderes<br />
BHKW ausgetauscht wird.<br />
Für alle Konstellationen ist allerdings festzustellen,<br />
dass ein EEG-Vergütungsverlust möglich ist. Auch<br />
dies ist eine Kernbotschaft. Im Rahmen der Projektplanung<br />
ist zu überlegen, wer einzubeziehen ist.<br />
Neben den ausführenden Unternehmen ist daran zu<br />
denken, den Direktvermarkter, den Umweltgutachter,<br />
den Netzbetreiber und die zuständige Behörde anzusprechen.<br />
Aus dem Blickwinkel des Erneuerbare-Energien-<br />
Gesetzes (EEG) führen vor allem vier Gründe in der<br />
Praxis dazu, dass der Anlagenbetreiber Vergütung<br />
verliert. So kann ein Austausch dazu führen, dass<br />
eine Neuinbetriebnahme vorliegt, dass eine Pönale<br />
aufgrund der fehlenden Einbindung in das Einspeisemanagement/in<br />
die Fernsteuerbarkeit ausgesprochen<br />
wird oder dass die Vergütung aufgrund fehlender oder<br />
falscher Meldung zum Marktstammdatenregister gekürzt<br />
wird.<br />
Boni und Genehmigung können<br />
betroffen sein<br />
Darüber hinaus ist aus EEG-Sicht festzustellen, dass<br />
der Kraft-Wärme-Kopplungs-Bonus, der Luftreinhaltungs-Bonus<br />
und die Prämien für die Flexibilität betroffen<br />
sein können. Neben dem EEG ist auch das Genehmigungsrecht<br />
von tragender Bedeutung. So ist genau<br />
darauf zu achten, dass der Austauschvorgang auch den<br />
Vorgaben der Genehmigung entspricht. Zudem ist in jedem<br />
Fall zu prüfen, inwieweit die Behörde einbezogen<br />
werden sollte. Darüber hinaus ist auch die 44. Bundes-<br />
Immissionsschutzverordnung im Blick zu behalten.<br />
Soweit sich die elektrischen Eigenschaften der Anlage<br />
verändern, sind auch die Auswirkungen auf das Einheiten-<br />
und Anlagenzertifikat zu prüfen. Deshalb sollte<br />
schon im Vorfeld sehr frühzeitig mit dem Zertifizierer<br />
und dem Netzbetreiber Kontakt aufgenommen werden.<br />
Idealerweise sollte dieser Kontakt vor dem Kauf des<br />
neuen BHKW erfolgen, weil Zertifizierer derzeit sehr<br />
ausgelastet sind.<br />
Darüber hinaus sollte nicht vergessen werden, dass<br />
schon bei der Planung die relevanten Maßgaben aus<br />
der Arbeitssicherheit (siehe Arbeitshilfe A-021 des<br />
Fachverbandes Biogas e.V.) zu berücksichtigen sind.<br />
Entsprechende Vorgaben sollten auch beim Abschluss<br />
der Kaufverträge und Werkverträge berücksichtigt werden.<br />
Zudem wird empfohlen, den Austausch mit der<br />
zur Prüfung befähigten Person/zugelassenen Überwachungsstelle<br />
vorab abzustimmen und die notwendigen<br />
Anpassungen in der Dokumentation vorzunehmen.<br />
Die genannten und weitere Aspekte werden in der<br />
Arbeitshilfe A-030 des Fachverbandes Biogas e.V.<br />
weiter erläutert. Zudem empfehlen wir, aufgrund der<br />
Komplexität das vorgenannte Seminar zu besuchen.<br />
Autor<br />
Dipl.-Betr. (BA) René Walter<br />
Syndikusrechtsanwalt ∙<br />
Leiter des Referats Energierecht und -handel<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 ∙ 85356 Freising<br />
0 81 61/98 46 60<br />
info@biogas.org<br />
110
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Recht<br />
Wenden Sie sich an Ihren<br />
Raiffeisenpartner vor Ort
Produktnews<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
CHIOR ® SE-Rührwerke in ATEX-Ausführung<br />
Um seine Rührwerkstechnik auch in explosionsgefährdeten<br />
Gasatmosphären sicher<br />
einsetzen zu können, bringt SAVECO seine<br />
CHIOR ® SE-Rührwerke in einer ATEX-Ausführung<br />
auf den Markt.<br />
Neben vielen kleinen Modifikationen, wie<br />
besonders druckresistenten Dichtungen,<br />
hat das Unternehmen ein neues Getriebe<br />
speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten<br />
Gasatmosphären entwickelt, mit<br />
dem die Tauchmotorrührwerke entsprechend<br />
der ATEX-Richtlinien in Zone 2 betrieben<br />
werden dürfen.<br />
Vor allem in Vorgruben und Nachgärern<br />
von Biogasanlagen gewährleistet die ATEX-<br />
Ausführung der CHIOR ® SE-Rührwerke<br />
den sicheren Betrieb. Aufgrund der Energieeffizienz<br />
der CHIOR SE-Rührwerke sind<br />
sie für die Förderung durch die BAFA zertifiziert<br />
und können mit bis zu 40 Prozent<br />
der Anschaffungskosten gefördert werden.<br />
Die Rührwerke leisten einen Schub von<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
NOTSTROMANLAGE SCHWERE AUSFÜHRUNG<br />
FÜR SCHLEPPER VON 90 BIS 200 PS<br />
®<br />
BHKW-Service<br />
· Regelwartungen<br />
· Teil- und Komplettrevisionen<br />
· Neu- und Ummotorisierungen<br />
· Lieferung von Austauschmotoren und Komponenten<br />
· Ersatzteilvertrieb<br />
Wir machen ihren Motor fit für die 44.BimSchV.<br />
NoX Überwachung/Regelung bis zum kompletten SCR System.<br />
Ihr Partner in Sachen Motorentechnik<br />
Industriestr. 7 · 49716 Meppen · Tel. 05931-9844-0 · kem@kloska.com<br />
Save the dates!<br />
» Energie- & Klimapolitik<br />
» Zukunftsprojekte<br />
» Recht & Regelwerke<br />
» Abfallvergärung<br />
» Praxisberichte<br />
» BIOGAS Fachforum<br />
digital & live<br />
22. – 26. November <strong>2021</strong><br />
Digital<br />
Save<br />
the dates!<br />
7. – 9. Dezember <strong>2021</strong><br />
NCC Mitte, Messegelände Nürnberg<br />
Aktuelle Informationen und Anmeldung:<br />
www.biogas-convention.com<br />
113
IMPRESSUM<br />
Biogas Journal | 5_<strong>2021</strong><br />
Rechtsanwälte und Notare<br />
Seit vielen Jahren beraten und vertreten wir vornehmlich<br />
Betreiber und Planer kompetent und umfassend im<br />
- Recht der Erneuerbaren<br />
- Energien<br />
- Vertragsrecht<br />
- Gewährleistungsrecht<br />
- Energiewirtschaftsrecht<br />
- Umweltrecht<br />
- Immissionsschutzrecht<br />
- öffentlichen Baurecht<br />
- Planungsrecht<br />
Kastanienweg 9, D-59555 Lippstadt<br />
Tel.: 02941/97000 Fax: 02941/970050<br />
Ihre Ansprechpartner:<br />
RAuN Franz-Josef Tigges*<br />
RAuN Andreas Schäfermeier**<br />
RA W. Andreas Lahme*<br />
RA Dr. Oliver Frank*<br />
RA Martina Beese<br />
RA Daniel Birkhölzer*<br />
RAuN Katharina Vieweg-Puschmann LL.M.<br />
Maîtrise en droit<br />
* Fachanwalt für Verwaltungsrecht<br />
** Fachanwalt für Insolvenzrecht<br />
kanzlei@engemann-und-partner.de<br />
www.engemann-und-partner.de<br />
IMPRESSUM<br />
Herausgeber:<br />
Fachverband Biogas e. V.<br />
Dr. Claudius da Costa Gomez (V.i.S.d.P.)<br />
Andrea Horbelt (redaktionelle Mitarbeit)<br />
Angerbrunnenstraße 12 · 85356 Freising<br />
Tel. 0 81 61/98 46 60<br />
Fax: 0 81 61/98 46 70<br />
E-Mail: info@biogas.org<br />
Internet: www.biogas.org<br />
ISSN 1619-8913<br />
Redaktion:<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Fachverband Biogas e. V.<br />
Tel. 0 54 09/9 06 94 26<br />
E-Mail: martin.bensmann@biogas.org<br />
07374-1882 www.reck-agrar.com<br />
RÜHRTECHNIK<br />
Rotoren und Statoren<br />
für Excenterschneckenpumpen aller Hersteller.<br />
In Deutschland gefertigt im Originalmaß und aus<br />
Original-Material<br />
25 % bis 40 % billiger<br />
ACHTUNG neue Adresse!<br />
Fordern Sie Ihr konkretes Angebot an unter<br />
ILMACO Vertrieb oHG mb@ilmaco.de www.ilmaco.de<br />
Ebenhauser Str. 8 · 84155 Bonbruck · (0176) 476 494 69<br />
Biogas-<br />
Additive<br />
www.aat-substrathandel.de<br />
038852 - 6040<br />
Anzeigenverwaltung & Layout:<br />
bigbenreklamebureau GmbH<br />
An der Surheide 29 · 28870 Ottersberg-Fischerhude<br />
Tel. 0 42 93/890 89-0<br />
Fax: 0 42 93/890 89-29<br />
E-Mail: info@bb-rb.de<br />
Internet: www.bb-rb.de<br />
Druck: Druckhaus Fromm, Osnabrück<br />
Das BIOGAS Journal erscheint sechsmal im Jahr auf Deutsch.<br />
Zusätzlich erscheinen zwei Ausgaben in englischer Sprache.<br />
Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich<br />
geschützt. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben<br />
die Meinung des Verfassers wieder, die nicht unbedingt mit der<br />
Position des Fachverbandes Biogas e.V. übereinstimmen muss.<br />
Nachdruck, Aufnahme in Datenbanken, Onlinedienste und Internet,<br />
Vervielfältigungen auf Datenträgern wie CD-Rom nur nach vorheriger<br />
schriftlicher Zustimmung. Bei Einsendungen an die Redaktion<br />
wird das Einverständnis zur vollen oder auszugsweisen Veröffentlichung<br />
vorausgesetzt. Für unverlangt eingehende Einsendungen<br />
wird keine Haftung übernommen. Die Redaktion behält sich vor,<br />
Leserbriefe sinnerhaltend zu kürzen.<br />
114
Einfach ein runde Sache!<br />
Hocheffiziente Spurenelemente mit höchster biologischer<br />
Verfügbarkeit<br />
Keine versteckten Gefahren wie Stäube oder versehentlich<br />
angerissene Säcke<br />
Transparente Zusammensetzung und Anpassung<br />
Fermentierbare Folie, staubfrei<br />
Einfache, CO2-freundliche Lieferung per Paketdienst<br />
Stabiliesiert den Fermentationsprozess<br />
Einfache, sichere und kräfteschonende Anwendung<br />
Maximierung des Gras-Anteils im<br />
Substratmix<br />
Verbesserte Substartausnutzung<br />
Vermeidung von Schwimm- und<br />
Sinkschichten<br />
Verbesserung der Fließfähigkeit<br />
Reduzierter Verschleiß an der Technik<br />
Verringerung des Eigenstrombedarfs<br />
Einsparung von Substraten und Gärrest<br />
Mehr Flexibilität im Substratmanagement<br />
Nutzen Sie das Potential Ihrer Grassilage voll aus !<br />
GRAS<br />
Zusammensetzung Grassilage nach DLG<br />
Cellulose 24,0 %<br />
Hemicellulose 18,2 %<br />
Lignin 5,3 %<br />
Zucker 3,2 %<br />
Protein 15,5 %<br />
Stabiler Anlagenbetrieb<br />
GMO-frei<br />
Fett 3,9 %<br />
Sonstiges 29,9 %<br />
Zeofex reduziert durch Adsorption Schadstoffe<br />
wie zum Beispiel Ammoniak, Schwefelwasserstoff<br />
und Schwermetalle.<br />
Durch die Pufferwirkung werden Gärsäuren<br />
teilweise in die Zwischenschichten eingelagert und<br />
verzögert in dosierter Form wieder abgegeben.<br />
Somit pendelt sich die Gärsäurenkonzentration<br />
im Fermenter optimal ein und sorgt für einen<br />
stabilen pH-Wert.<br />
Probleme mit hohen Stickstofffrachten?<br />
NH4-N<br />
Mist<br />
Naturprodukt, ungefährlich für<br />
Biogasanlage, Mensch, Tier und Umwelt<br />
Reduktion kontinuierlicher,<br />
substratbedingter Schaumbildung<br />
Reduktion von Ammoniumstickstoff<br />
Rückhaltung von Ammoniak durch<br />
Kationenaustauschkapazität<br />
Reduzierung des Geruchs<br />
Regulierung von Gärsäuren; Minimierung<br />
von Sickstoffverlusten im Gärrest<br />
Stabilisierung des pH-Wertes im schwach<br />
basischen Bereich<br />
SaM-Power GmbH<br />
Schmiedestraße 9 · 27419 Lengenbostel<br />
Fon: (0 42 82) 6 34 99 - 0 · Fax: (0 42 82) 6 34 99 - 19<br />
Mail: info@sam-power.de · www.sam-power.de 115
FAKA – der Filter für<br />
Gasaufbereitung<br />
A<br />
[ Einfaches Befüllen,<br />
integrierte Staubabsaugung –<br />
Arbeitssicherheitskonform<br />
[ Ablassen einfach in Big Bags –<br />
schnell, bequem und günstig<br />
F<br />
A<br />
K<br />
[ Messstellen zur Überwachung –<br />
bodennah zugänglich<br />
[ Werkstoff Edelstahl / Stahl<br />
robust und sicher und<br />
mit Wärmeisolierung – beste<br />
Bedingungen für die Aktivkohle<br />
[ Krananlage optional<br />
QR-Code scannen<br />
für weitere<br />
Informationen.<br />
Filtersystem in 11 Größen<br />
bis 20 000 Liter<br />
von 1 500 Liter<br />
Rausholen, was drin ist.<br />
Anlagenbau | Kältetechnik<br />
Lieferung | Wechselservice | Entsorgung<br />
SILOXA Engineering AG Tel: 0201 9999 5727 vertrieb@siloxa.com www.siloxa.com