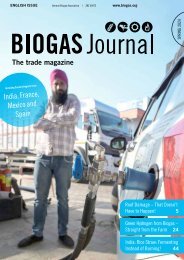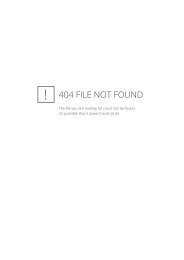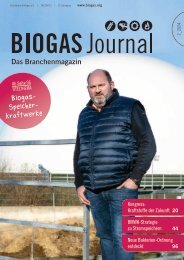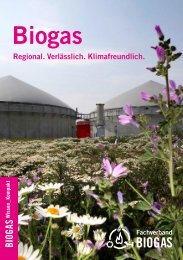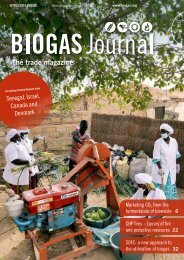3_2017 Leseprobe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
www.biogas.org Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 50073 | 20. Jahrgang<br />
3_<strong>2017</strong><br />
Bi<br />
seit 20 jahren<br />
GaS Journal<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche<br />
Update Biomassepreise<br />
S. 38<br />
Zubau Biomethananlagen<br />
2016 S. 42<br />
Brasilien: neue<br />
Perspektiven S. 76<br />
Regionale<br />
Wertschöpfung<br />
aus Erneuerbaren
Inhalt<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Alles aus einer Hand - Ihren Anforderungen entsprechend!<br />
Adsorber<br />
Produktion<br />
Flachbett- &<br />
Schüttbettadsorber<br />
auf Basis<br />
nachwachsender<br />
Rohstoffe<br />
Kunststoff &<br />
Edelstahl<br />
Aktivkohle-Wechsel<br />
kurze<br />
Reaktionszeit<br />
Entsorgung<br />
inkl. Nachweis<br />
kurze Lieferzeiten<br />
flexible<br />
Liefermengen<br />
Logistik<br />
Auslegung inkl.<br />
Standzeitberechnung<br />
Optimierungsberatung<br />
Qualitätskontrolle<br />
Service<br />
Beladungsuntersuchung<br />
Labor<br />
Natürlich besser!<br />
• Dotierte Aktivkohle<br />
zur Entschwefelung &<br />
Reinigung von technischen<br />
Gasen<br />
• entfernt zusätzlich in<br />
einem Schritt Siloxane,<br />
VOC´s und Mercaptane<br />
• hergestellt in Deutschland<br />
• lange Standzeiten, weniger<br />
Wechsel<br />
Sparen Sie Kohle und sichern Sie sich ihr Angebot!<br />
AdFiS products GmbH<br />
Am Kellerholz 14<br />
D-17166 Teterow<br />
2<br />
Telefon: +49 (0) 3996 15 97-0<br />
Fax: +49 (0) 3996 15 97-99<br />
E-Mail: sales@adfis.de<br />
web: www.adfis.de
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Editorial<br />
Viele offene Fragen<br />
im Wahljahr<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
im Frühjahr werden in drei Bundesländern die Landtage<br />
neu gewählt. Der Startschuss fiel am 26. März<br />
im kleinsten Flächenland Deutschlands, dem Saarland.<br />
Knapp zwei Monate später folgen die Wahlen in<br />
Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen (Berichte<br />
dazu auf den Seiten 20 bzw. 22). Bei diesen Wahlen<br />
lassen sich sicher schon Hinweise zur Bundestagswahl<br />
ableiten und mit welchen Koalitionen es ab dem Herbst<br />
weitergehen könnte.<br />
Mit der Bundestagswahl und den anschließenden Verhandlungen<br />
zum Koalitionsvertrag werden gleichzeitig<br />
wichtige Weichen für die Biogasbranche gestellt: Setzt<br />
die künftige Regierung auf die Biomasse bei der Energiewende?<br />
Wie engagiert werden Klimaschutzziele verfolgt?<br />
Bereits jetzt gilt es, die Politik von den Stärken<br />
der Biomasse zu überzeugen. Neben der verlässlichen<br />
Bereitstellung von klimafreundlicher Energie darf der<br />
große Beitrag der Biogasbranche zur lokalen Wertschöpfung<br />
nicht außer Acht gelassen werden.<br />
In diesem Heft wird anhand von zwei Beispielen anschaulich<br />
verdeutlicht, welche Bedeutung eine Biogasanlage<br />
im ländlichen Raum hat. Jeder einzelne aus der<br />
Biogasbranche hat nun die Möglichkeit, diese Stärken<br />
seinem Abgeordneten vor Ort näherzubringen und damit<br />
zu einer positiven Aussage im Koalitionsvertrag beizutragen<br />
– egal ob auf Länder- oder Bundesebene.<br />
Die neu gewählte Bundesregierung wird sich auch mit<br />
den Ergebnissen der ersten Ausschreibungsrunden für<br />
Biomasse auseinandersetzen müssen. Die erste Runde<br />
findet kurz vor dem Gang zu den Urnen am 1. September<br />
statt. Auch der Ausgang der Ausschreibung wird<br />
mit Spannung in der Branche verfolgt werden: Welche<br />
Anlagen haben mit welchem Gebotswert den Zuschlag<br />
erhalten? Wird das ausgeschriebene Volumen von 150<br />
MW ausgeschöpft? Welche Schlüsse zieht die Politik<br />
daraus? Das große Interesse an den Intensivschulungen,<br />
die die Fachverband Service GmbH im Frühjahr<br />
angeboten hat, zeigt zumindest, dass die Branche die<br />
Herausforderung „Ausschreibungen“ annimmt und gut<br />
vorbereitet ins Rennen geht.<br />
Gleichzeitig muss die Branche in diesem Frühjahr weitere<br />
zusätzliche Herausforderungen meistern. Auch<br />
hier warten zahlreiche offene Fragen: Welche neuen<br />
Anforderungen bringen die Düngeverordnung sowie die<br />
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden<br />
Stoffen (AwSV), die am 31. März im Paket<br />
im Bundesrat verabschiedet worden sind? Wie viele Monate<br />
müssen Anlagen zukünftig lagern können? Muss<br />
die Fruchtfolge verändert werden?<br />
Fragen über Fragen, bei denen auch insbesondere der<br />
Verband gefordert ist, seine Mitglieder entsprechend zu<br />
unterstützen. Ein wichtiges Informationsmittel ist auch<br />
immer das Biogas Journal. So wird in dieser Ausgabe unter<br />
anderem die Frage beantwortet, welche Maissorten<br />
sich am besten zur Vergärung eignen und ob Maisstroh<br />
eine Alternative ist. Auch die Frage nach den Biomassepreisen<br />
für das zurückliegende Erntejahr wird geklärt.<br />
Weitere Antworten zu den aufgeworfenen Fragen gibt es<br />
vielleicht erst in einer der nächsten Ausgaben. In diesem<br />
Sinne viel Spaß beim Lesen und beim Finden von Antworten<br />
auf die eine oder andere Frage.<br />
Herzlichst Ihr<br />
Dr. Stefan Rauh,<br />
Geschäftsführer des Fachverbandes Biogas e.V.<br />
3
Inhalt<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Regionale<br />
26<br />
14<br />
26<br />
Wertschöpfung<br />
aus Erneuerbaren<br />
Editorial<br />
3 Viele offene Fragen im Wahljahr<br />
Dr. Stefan Rauh, Geschäftsführer des<br />
Fachverbandes Biogas e.V.<br />
AKTUELLES<br />
6 Meldungen<br />
8 Bücher & Termine<br />
10 Biogas-Kids<br />
11 Marktstrategien für Gärprodukte<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
14 Biogas aus Wasserpflanzen<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
17 Messe Nürnberg – Der Pflichttermin<br />
für die gesamte Branche<br />
18 Fest- und Direktkosten sind gestiegen<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
26 Der lange Weg zur Autarkie<br />
Von Dipl.-Ing. Heinz Wraneschitz<br />
30 Willebadessen: Musterbeispiel<br />
für Strom- und Wärmewende<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH)<br />
Martin Bensmann<br />
34 Energiewende – und das Geld<br />
bleibt im Dorf<br />
POLITIK<br />
20 Das Kohleland löst sich nur schwer<br />
von seiner Vergangenheit<br />
Von Bernward Janzing<br />
22 Schleswig-Holstein: Beim Strom<br />
zu 115 Prozent erneuerbar<br />
Von Bernward Janzing<br />
PRAXIS<br />
38 Biomassepreisvergleich<br />
Substratpreisindex wieder auf<br />
dem Niveau von 2010<br />
Von Dr. Stefan Rauh<br />
42 Biomethan<br />
Noch Zubau bei Einspeiseanlagen<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
46 Zuckerrübe versüßt Maisstrohsilage<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
52 Biogas-Sorten-Portal nutzen<br />
Von Dr. Jürgen Rath und Martin Bensmann<br />
54 Düngeverordnung bringt Einschränkungen<br />
für Biogasbetriebe<br />
Von M.Sc. Florian Strippel<br />
58 Biogas-Vermarktung auf die<br />
konsequente Art<br />
Von Dipl.-Ing. Heinz Wraneschitz<br />
62 Kohle machen – aus Gärresten<br />
Von Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
4
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Inhalt<br />
titelFoto: www.Landpixel.de i Fotos: Carmen Rudolph, Martin Bensmann, Martina Bräsel und IWES<br />
62<br />
72<br />
WISSENSCHAFT<br />
68 „SoilCare“ für fruchtbare Böden<br />
Von Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
72 Flexible Gasproduktion im Test<br />
Von Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
INTERNATIONAL<br />
Brasilien<br />
76 Biogas in Brasilien – neue Perspektiven<br />
in Zeiten der Krise<br />
Von Jens Giersdorf und Wolfgang Roller<br />
Indien<br />
80 KVP-Projekt: Tagebuch Indien<br />
Von Antje Kramer<br />
VERBAND<br />
Aus der Geschäftsstelle<br />
82 Neue Herausforderungen durch<br />
DüV, AwSV, StörfallV, TA-Luft ...<br />
Von Dr. Stefan Rauh und<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
86 Aus den Regionalgruppen<br />
89 Aus den Regionalbüros<br />
95 Deutschland verfehlt alle Ziele<br />
im Wärmesektor<br />
Von Harald Uphoff, BEE<br />
Produktnews<br />
96 Produktnews<br />
98 Impressum<br />
Beilagenhinweis:<br />
Das Biogas Journal enthält Beilagen<br />
der Firmen agrikomp, BetonSeal<br />
und greentec.<br />
5
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Electrochaea erhält Patent auf<br />
Einzeller für Biomethanproduktion<br />
München / Kopenhagen – Die Electrochaea<br />
GmbH hat einen speziell auf die effektive<br />
biokatalytische Methanproduktion gezüchteten<br />
Mikroorganismen-Stamm patentieren<br />
lassen. Die Validierung des Patents für die<br />
EU erfolgte in Dänemark, wo Electrochaea<br />
seit 2016 die weltweit erste biologische Methanisierungsanlage<br />
mit einer Leistungsaufnahme<br />
von 1 Megawatt betreibt.<br />
Elektronenmikroskopische Aufnahmen der von<br />
Electrochaea patentierten Archaeen – einer<br />
Variante des Stammes Methanothermobacter<br />
thermautotrophicus.<br />
Bioreaktor mit den von Electrochaea patentierten<br />
Archaeen im Labormaßstab in München. Ein großer<br />
Reaktor mit einer Leistungsaufnahme von 1 Megawatt<br />
steht bereits in der Nähe von Kopenhagen.<br />
Foto: Prof. Andreas Klingl<br />
Foto: Electrochaea<br />
Bei den einzelligen Mikroorganismen von<br />
Electrochaea handelt es sich um Archaeen,<br />
genauer um eine Variante des Stammes<br />
Methanothermobacter thermautotrophicus.<br />
Archaeen bilden neben Bakterien und<br />
Eukaryoten den dritten Ast des Stammbaums<br />
des Lebens. Sie sind die ältesten<br />
Lebewesen auf der Erde, außerhalb der<br />
Wissenschaft jedoch recht unbekannt. Die<br />
von Electrochaea entwickelte Methode<br />
der biologischen Methanisierung ist eine<br />
Schlüsseltechnologie, um CO 2<br />
sinnvoll zu<br />
nutzen und überschüssigen Strom aus erneuerbaren<br />
Energiequellen, wie Wind- und<br />
Sonnenkraft, als Gas speicherbar zu machen.<br />
Der Strom wird in einem ersten Schritt zur<br />
Herstellung von Wasserstoff genutzt (Elektrolyse).<br />
Der Wasserstoff und zugeführtes<br />
CO 2<br />
aus industriellen Abgasen oder anderen<br />
Quellen werden daraufhin von den Archaeen<br />
in einem biokatalytischen Prozess<br />
in Biomethan umgewandelt. Das von den<br />
Mikroorganismen produzierte Gas kann<br />
zeitlich und räumlich unabhängig für die<br />
Erzeugung von Wärme oder auch als Treibstoff<br />
genutzt werden. Speicherung und<br />
Transport des Biomethans erfolgen über<br />
das bestehende Erdgasnetz.<br />
Der wissenschaftliche Durchbruch gelang<br />
Prof. Laurens Mets am Department für<br />
Molekulare Genetik und Zellbiologie der<br />
Universität Chicago, der die Effizienz des<br />
Archaeen-Stammes durch einen gezielten<br />
Selektionsprozess deutlich steigern konnte.<br />
Aufbauend auf dieser Forschungsleistung<br />
und in enger Zusammenarbeit mit<br />
Prof. Mets ist es dem Team um Geschäftsführer<br />
Dr. Mich Hein 2014 gelungen, die<br />
Technologie so weiterzuentwickeln, dass<br />
eine kommerzielle Nutzung im industriellen<br />
Maßstab jetzt möglich ist. „Das<br />
Ergebnis unserer Archaeen-Kultivierung<br />
hat uns selber überrascht. Wir haben die<br />
Raum-Zeit-Ausbeute der Archaeen um<br />
den Faktor zwanzig gesteigert und das bei<br />
stabiler Netzqualität des Methans“, sagt<br />
Dr. Mich Hein.<br />
Das ist gerade dann wichtig, wenn die Methode<br />
im industriellen Maßstab eingesetzt<br />
wird. Genau das hat Electrochaea nun vor.<br />
„Wir können jetzt sehr schnell nach oben<br />
skalieren und das zu betriebswirtschaftlich<br />
sehr vernünftigen Kosten“, erklärt Dr. Hein.<br />
In Ungarn ist bereits eine Anlage mit 10<br />
Megawatt Leistungsaufnahme in Planung.<br />
Weitere Anlagen in der Schweiz und in den<br />
USA sind im Bau. Bis 2025 sind Anlagen<br />
im Gigawattbereich realistisch.<br />
Windgas-Elektrolyseure<br />
könnten Verbraucher bei<br />
Stromkosten entlasten<br />
Hamburg – Die Nutzung von überschüssigem<br />
Strom in besonders windreichen Regionen Norddeutschlands<br />
könnte Verbraucher um hohe Millionenbeträge<br />
entlasten, zeigt eine Analyse von<br />
Energy Brainpool im Auftrag von Greenpeace<br />
Energy. Statt wie bisher an windreichen Tagen<br />
Windkraftanlagen in Regionen mit schlecht ausgebauten<br />
Netzen abzuregeln und die Betreiber<br />
über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)<br />
dafür zu entschädigen, wird nach einem neuen<br />
Vorschlag von Greenpeace Energy bislang ungenutzter<br />
Strom durch Elektrolyseure in Wasserstoff<br />
umgewandelt und ins Gasnetz eingespeist.<br />
Für den Strombezug zahlen die Windgas-Elektrolyseure<br />
einen Preis an die Netzbetreiber, die<br />
so zusätzliche Einnahmen erzielen und zugleich<br />
Entschädigungszahlungen an Windparkbetreiber<br />
einsparen. Dadurch sinken wiederum die<br />
Netzentgelte, die deutsche Verbraucher mit ihrer<br />
Stromrechnung bezahlen. Energy Brainpool hatte<br />
in seiner Analyse drei Netzgebiete untersucht, in<br />
denen fast 60 Prozent der deutschen Stromüberschüsse<br />
anfallen, wie viel Strom dort im Jahr 2015<br />
nicht genutzt werden konnte und welche Kosten<br />
dadurch anfielen.<br />
Zum Vergleich berechnete das Berliner Analyseinstitut<br />
Einsparungen durch den Einsatz von<br />
Windgas-Elektrolyseuren. Schon bei einem relativ<br />
geringen Zubau von Elektrolyseuren mit insgesamt<br />
100 Megawatt (MW) Leistung hätten in den drei<br />
untersuchten Gebieten 13 Prozent der Stromüberschüsse<br />
genutzt und Verbraucher um gut 10 Millionen<br />
Euro entlastet werden können. Beim maximalen<br />
Elektrolyseur-Ausbau mit 2.000 MW Leistung<br />
wären sogar 96 Prozent der Überschüsse genutzt<br />
und 64 Millionen Euro eingespart worden.<br />
6
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Aktuelles<br />
Biogas-Atlas in neuem Layout<br />
Freising – Bereits seit einigen Jahren gibt es auf der<br />
Homepage des Fachverbandes Biogas unter www.biogas.org<br />
einen Atlas, auf dem all jene Anlagen verzeichnet<br />
sind, die interessierten Besuchern zur Verfügung<br />
stehen. An 54 Standorten in ganz Deutschland finden<br />
sich diese Biogasanlagen. Und weil diese „offene Biogasanlage“<br />
eine sehr effiziente und effektive Form der<br />
Öffentlichkeitsarbeit darstellt, wurde der Atlas nun<br />
überarbeitet und dabei gleichzeitig umbenannt.<br />
Um nicht den Eindruck zu vermitteln, dass die 54<br />
Punkte den Anlagenbestand in Deutschland widerspiegeln,<br />
heißt der Atlas ab sofort „Referenzanlagen“, und<br />
er ist Google-basiert, was vor allem die Handhabung<br />
und die Erweiterung erleichtert. Zu finden sind die Referenzanlagen<br />
unter „Biogas“ – sowohl als Punkte auf<br />
der Deutschlandkarte als auch in einer Liste mit kurzer<br />
Beschreibung.<br />
Die Suchfunktion soll demnächst noch verbessert werden,<br />
ein paar Anlagen befinden sich in der Pipeline<br />
und werden in Kürze ergänzt. Sollten auch Sie Ihre<br />
Biogasanlage interessierten Besuchern zeigen wollen<br />
und damit einen aktiven Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit<br />
leisten, dann wenden Sie sich gerne an andrea.<br />
horbelt@biogas.org.<br />
Karte Referenzanlagen<br />
Eine hoffnungsvolle Partnerschaft<br />
München – Auf einer Presseveranstaltung in München haben<br />
die tschechische Tedom Group und die Schnell GmbH ihre Partnerschaft<br />
vorgestellt. Der deutsche BHKW-Hersteller musste zu<br />
Beginn des letzten Jahres Insolvenz anmelden. Mit rund 3.000<br />
installierten Modulen gehört Schnell zu den Marktführern in<br />
Deutschland. Das Allgäuer Unternehmen hat bislang vor allem<br />
Kraftwerke im Leistungsbereich von 200 bis 500 Kilowatt (kW) für<br />
den deutschen Biogasmarkt verkauft.<br />
Seit Oktober 2016 ist die Tedom Group neuer Eigentümer der<br />
Schnell GmbH. Beide Unternehmen sind bereits seit einem Vierteljahrhundert<br />
im BHKW-Geschäft aktiv und bringen entsprechende<br />
Erfahrungen mit in die Partnerschaft. Im Gegensatz zu Schnell,<br />
die im deutschen Biogasmarkt aktiv sind, konzentriert sich der<br />
tschechische Partner auf den Erdgasmarkt. Im Angebot hat Tedom<br />
Blockheizkraftwerke von 75 kW bis 2 MW.<br />
Mit der Übernahme von Schnell verspricht sich Tedom einen stärkeren<br />
Einfluss auf den deutschen Markt. Sowohl im Biogas-Sektor<br />
als auch im Erdgas-Bereich. Ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidung<br />
für die Übernahme der Schnell GmbH war das gute und<br />
breit aufgestellte Service Netz der Allgäuer Firma.<br />
„Für Schnell ist die Partnerschaft das Beste, was uns passieren<br />
konnte“, erklärt Bernd Brendel, der Leiter Service der Schnell<br />
GmbH. „Mit der Finanzspritze aus Tschechien konnten wir unsere<br />
Technologieführerschaft am deutschen BHKW-Markt für Biogas<br />
Von links: Bernd Brendel, Leiter Service der Schnell Motoren<br />
GmbH, Josef Jeleček, Chairman und CEO von TEDOM, Marek<br />
Rosenbaum, Geschäftsführer der SCHNELL Motoren GmbH, und<br />
Rajib Pal, Leiter Vertrieb der Schnell Motoren GmbH.<br />
fortsetzen. Das ganze Team ist hoch motiviert und blickt optimistisch<br />
in die Zukunft. Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr<br />
bis zu 20 neue Mitarbeiter einstellen werden.“<br />
Für Marek Rosenbaum, Anteilseigener von Tedom und Geschäftsführer<br />
der Schnell Motoren GmbH, ist besonders wichtig, dass<br />
mit den Tedom-BHKW die Produktpalette von Schnell in Richtung<br />
Erdgas erweitert wurde. Hier erwarten die Tschechen das größte<br />
Marktwachstum in den nächsten Jahren.<br />
Foto: Fachverband Biogas e.V.<br />
7
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Bücher<br />
Bauen im Außenbereich<br />
Die umfänglichen<br />
Ausarbeitungen der<br />
Außenbereichsregelungen<br />
sind sehr<br />
strukturiert aufgebaut<br />
und die Planungsbeispiele<br />
anhand<br />
von Originalplan-<br />
und Kartenmaterial<br />
anschaulich<br />
dargestellt. Einleitend<br />
werden Möglichkeiten vorgestellt, wie<br />
Vorhaben im Außenbereich (privilegiert,<br />
teilprivilegiert, mithilfe von Außenbereichssatzungen)<br />
realisiert werden können.<br />
Das Kapitel III behandelt dann verständlich<br />
und detailliert die privilegierten Außenbereichsvorhaben<br />
nach § 35 Absatz 1 BauGB<br />
und der Unterabschnitt III.6 speziell „privilegierte“<br />
Biogasanlagen (§ 35 Absatz 1<br />
Nr. 6 BauGB).<br />
Leider wird in diesem Kapitel auf Regelungen<br />
der sogenannten BauGB-Klimanovelle<br />
(Gesetz zur Stärkung des Klimaschutzes<br />
bei der Entwicklung in den Städten und<br />
Gemeinden und weiteren Fortentwicklung<br />
des Städtebaurechts, 11. Juli 2011) abgestellt.<br />
Hier wurden für Biogasanlagen<br />
als Privilegierungsvoraussetzung im § 35<br />
Absatz 1 Nr. 6 Buchstabe d die Grenzen<br />
der jährlichen Biogas-Produktionskapazität<br />
von 2,3 Mio. Nm³ und einer Feuerungswärmeleistung<br />
von 2 MW eingeführt. Mit der<br />
nachfolgenden Änderung des BauGB (Gesetz<br />
zur Stärkung der Innenentwicklung in<br />
den Städten und Gemeinden und weiteren<br />
Fortentwicklung des Städtebaurechts, 11.<br />
Juni 2013) hat der Gesetzgeber die Beschränkung<br />
der Feuerungswärmeleistung<br />
aufgehoben, damit auch privilegierte Biogasanlagen<br />
im Außenbereich bedarfsorientiert<br />
Strom erzeugen können.<br />
Für diese Änderung hatte sich der Fachverband<br />
Biogas e.V. im Gesetzgebungsverfahren<br />
intensiv eingesetzt, um diesen Anlagen<br />
die Flexibilisierung bauplanungsrechtlich<br />
zu ermöglichen. Das Kapitel Biogasanlagen<br />
bedarf hinsichtlich des Privilegierungstatbestandes<br />
Absatz 1 Nr. 6 Buchstabe d des<br />
§ 35 dringend Überarbeitungsbedarf. Die<br />
Ausführungen zu den anderen privilegierten<br />
Außenbereichsvorhaben wurden nicht<br />
weiter detailliert geprüft.<br />
In den folgenden Kapiteln werden weitere<br />
(auch nicht privilegierte) Außenbereichsvorhaben<br />
vorgestellt sowie Belange, die ihnen<br />
entgegenstehen können. Abschließend<br />
wird das Thema mit Sonderregelungen einzelner<br />
Länder für Flüchtlingsunterkünfte,<br />
Auswertungen der entsprechenden Rechtsprechung<br />
sowie mit einer Einführung in<br />
das Naturschutzrecht abgerundet.<br />
C.H.Beck Verlag, 400 Seiten, <strong>2017</strong><br />
89 Euro, ISBN 978-3-406-70617-2<br />
Biogas – Macht – Land: Ein politisch<br />
induzierter Transformationsprozess<br />
und seine Effekte<br />
In ländlichen Regionen<br />
finden einschneidende<br />
Veränderungen<br />
statt. Ein<br />
Beispiel dafür sind<br />
die Entwicklungen<br />
bei der Energieerzeugung<br />
aus Biomasse,<br />
die den Umbau<br />
konventioneller<br />
Agrarwirtschaft hin zur Energiewirtschaft<br />
vorantreiben. Es handelt sich nicht nur um<br />
eine wirtschaftliche, sondern auch um eine<br />
kulturelle Transformation. Was passiert,<br />
wenn sich Quantität oder Qualität der Energieflüsse<br />
ändern, und mit ihr die sozialen<br />
Arrangements und kulturellen Verständnisse?<br />
Diese Studie verdeutlicht, wie vielfältig<br />
die Chancen und Risiken einer Strategie der<br />
Erneuerbaren Energien aussehen und wie<br />
deren langfristige Konzepte in kurzfristige,<br />
lokale Umsetzungsprozesse entflochten<br />
werden müssen.<br />
Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, 331 Seiten<br />
50 Euro, ISBN: 978--8471-0679-1<br />
Warum nicht auch bei Ihnen?<br />
Fördern Sie Ihr Image und das der Branche!<br />
von der Biogasanlage Erdmann<br />
QR-Code scannen oder unter:<br />
Installieren Sie eine Ladebox<br />
an Ihrer EE-Anlage!<br />
8
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Aktuelles<br />
Termine<br />
Alle Termine finden Sie auch auf der Seite www.biogas.org/Termine<br />
9. bis 10. Mai<br />
Biogas Innovationskongress<br />
Osnabrück<br />
www.biogas-innovationskongress.de<br />
9. bis 11. Mai<br />
Qualifizierung für Angestellte<br />
Nienburg<br />
www.klimaschutz-leb.de<br />
15. bis 18. Mai<br />
Exportinitiative Energie: AHK-Geschäftsreise<br />
nach Estland und Litauen<br />
Tallinn<br />
www.energiewaechter.de<br />
30. Mai <strong>2017</strong><br />
Energieeffizienz und Eigenversorgung mit<br />
Erneuerbaren Energien für Industriekunden<br />
in Indien<br />
Düsseldorf<br />
www.oav.de/termine/aktuelle-veranstaltungen<br />
31. Mai bis 1. Juni<br />
Tagung Biomass to Power and Heat<br />
Zittau<br />
www.energetische-biomassenutzung.de/<br />
de/aktuelles<br />
12. bis 16. Juni<br />
AHK-Geschäftsreise „Erneuerbare Energien<br />
und Energieeffizienz in Belarus“<br />
Minsk<br />
www.energiewaechter.de<br />
19. bis 23. Juni<br />
AHK-Geschäftsreise Erneuerbare<br />
Energien und Energieeffizienz in der<br />
Englischsprachigen Karibik<br />
Jamaika<br />
www.german-energy-solutions.de<br />
22. Juni <strong>2017</strong><br />
Informationsveranstaltung „Effizienzsteigerung<br />
im Biogassektor in Nordchina“<br />
Darmstadt<br />
www.oav.de/termine<br />
26. bis 30. Juni<br />
AHK-Geschäftsreise: Biogas und Reststoffverwertung<br />
USA/Sacramento<br />
www.energiewaechter.de/aktuelles<br />
28. bis 29. Juni<br />
interCOGEN ®<br />
Karlsruhe<br />
www.intercogen.de<br />
28. bis 30. Juni<br />
Qualifizierung für Beschäftigte an<br />
Biogasanlagen<br />
Lüchow<br />
www.klimaschutz-leb.de<br />
26. bis 27. September<br />
FNR-Tagung<br />
Biogas in der Landwirtschaft –<br />
Stand und Perspektiven<br />
Bayreuth<br />
https://veranstaltungen.fnr.de/biogaskongress/programm/<br />
12. bis 14. Dezember <strong>2017</strong><br />
BIOGAS Convention & Trade Fair<br />
Nürnberg.<br />
www.biogas-convention.com<br />
interCOGEN ®<br />
Die Kraft-Wärme-Kopplungs-Messe<br />
70 Aussteller<br />
2.000 Besucher<br />
300 Kongressteilnehmer<br />
28. - 29. Juni <strong>2017</strong><br />
Messe Karlsruhe<br />
Freikarte: www.intercogen.de/biogas-journal<br />
Veranstalter<br />
9
Aktuelles<br />
BIOGAS-KIDS<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Viel mehr als nur Energie<br />
Bild: FNR/Hagenguth<br />
Boden fühlen<br />
In vielen Dörfern sind Biogasanlagen bereits fester Bestandteil<br />
der Energieversorgung geworden. Strom und<br />
Wärme kommen also nicht mehr von entfernt liegenden<br />
großen Kraftwerken. Das funktioniert, weil mit Biogas<br />
ständig Energie erzeugt werden kann. Die Rohstoffe<br />
für die Erzeugung müssen auch nicht weit transportiert<br />
werden. Schließlich sind es meist die<br />
Landwirte, die nachwachsende Rohstoffe<br />
auf ihren Feldern in der nahen<br />
Umgebung anbauen oder aus der<br />
Tierhaltung liefern. Beträgt der Anteil<br />
der Energie aus Biogas mehr als<br />
50 Prozent, spricht man von einem<br />
„Bioenergiedorf“. Schon jetzt gibt es<br />
etwa 180 solcher Bioenergiedörfer. In<br />
vielen Fällen ergänzen Solaranlagen<br />
auf Hausdächern und Windkraftanlagen<br />
die umweltfreundliche Energieerzeugung.<br />
In immer mehr Dörfern<br />
wird dadurch sogar eine Selbstversorgung<br />
möglich. Das heißt, Strom und die benötigte Wärme<br />
werden zu 100 Prozent vor Ort erzeugt. Weil das eine gute<br />
Sache ist, fördert der Staat die Entstehung und Weiterentwicklung<br />
solcher Bioenergiedörfer mit Geld. Es geht aber<br />
nicht nur um die Erzeugung von Energie. Weitere Effekte<br />
sollen dabei dem Dorf und der Umgebung zugutekommen.<br />
So müssen beispielsweise Leitungs netze und Anlagen<br />
gebaut werden, um die einzelnen Häuser oder auch<br />
Schwimmbäder, Schulen und Kindergärten mit Wärme zu<br />
versorgen. Das können Unternehmen und Handwerksbetriebe<br />
aus der Region übernehmen und damit Geld verdienen.<br />
Wird Geld gebraucht, um größere Anschaffungen zu<br />
finanzieren (zum Beispiel eine Solaranlage auf dem Dach<br />
oder den Ausbau eines Betriebes, damit dieser mit mehr<br />
Arbeitskräften mehr produzieren kann), profitieren die<br />
örtlichen Banken davon, die Geld in Form von Krediten<br />
verleihen. Und schließlich wird oft auch Geld gespart, weil<br />
Strom und Wärme in Bioenergiedörfern für die Menschen<br />
vor Ort weniger kosten. Diese genannten Zusatz effekte<br />
werden als „Regionale Wertschöpfung“ bezeichnet. Biogas<br />
erzeugt also viel mehr als nur Energie!<br />
Gewinnen<br />
mit Biogas<br />
Kinder fassen Erde gern an. Das Erfühlen und Ertasten von Boden<br />
ist eine spannende Aufgabe, Bodenarten kennenzulernen. Ein<br />
Sand- oder Erdhaufen und Beete bieten dazu interessante Möglichkeiten.<br />
Du kannst auch verschiedene Bodenarten (Sand, Lehm,<br />
Humus) in Gefäße oder in eine Fühlbox füllen. Durch Zerreiben<br />
von Bodenbestandteilen zwischen den Fingerspitzen ertastest du<br />
die Unterschiede der Bodenarten. Wie fühlt sich der Boden an,<br />
wenn du ihn zwischen den Fingern zerreibst? Was war beim Sand<br />
anders als beim Lehm? Woran kann man den Sand erkennen?<br />
War es komisch, den Lehm anzufassen? Nach dem Experiment<br />
kannst du diese Fragen beantworten.<br />
Es gibt in Deutschland einen Wettbewerb speziell für Bioenergiedörfer. Dabei geht es alle<br />
zwei Jahre darum, welches das interessanteste Konzept und die besten Ideen zur Umsetzung<br />
hat. Auch die Mitwirkung der Dorfbewohner wird dabei besonders bewertet. Im letzten Jahr<br />
wurde der Wettbewerb „Bioenergie-Kommune 2016“ durchgeführt. Drei Sieger dörfer konnten<br />
sich im Feld der vielen Teilnehmer durchsetzen: Willebadessen in Nordrhein-Westfalen,<br />
Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern und Ascha in Bayern. Schau dir mal online an, warum<br />
diese Dörfer gewonnen haben: www.bioenergie-kommunen.de/sieger-2016/<br />
Bild: garten-landschaft.de<br />
www.agrarkids.de<br />
Landwirtschaft entdecken und verstehen –<br />
Die Fachzeitschrift für Kinder<br />
10
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Aktuelles<br />
Marktstrategien für Gärprodukte<br />
Wissenschaftler und Praktiker diskutierten in Leipzig über die Erschließung alternativer Erlöspotenziale,<br />
etwa durch die Veredlung von Gärprodukten zu Designdünger oder Faserplatten.<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Die Biogasbranche erfindet sich gerade neu.<br />
„Nicht ganz freiwillig“, wie der Vorsitzende<br />
der Gütegemeinschaft Gärprodukte e.V.<br />
(GGG), Thomas Karle, einräumt. Zugleich<br />
zeigt sich der Biogaspionier aber davon überzeugt,<br />
dass es durch Prozessverbesserungen und einen<br />
stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeit gelingen wird, die<br />
gesellschaftliche Akzeptanz für die Biogastechnologie<br />
zurückzugewinnen. Tatsächlich befördert der Wind, der<br />
den Biogasakteuren gegenwärtig ins Gesicht bläst, offensichtlich<br />
frische Ideen. Das war jedenfalls auf der von<br />
der GGG organisierten Fachtagung am 14. und 15. März<br />
in Leipzig zu spüren. Unter dem Motto „Gärprodukte<br />
im Wandel der Zeit“ diskutierten hier etwa 80 Experten<br />
über Veredlungstechnologien für jenen Stoffstrom, der<br />
nach der Biogasproduktion verbleibt.<br />
„Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit<br />
gewinnen wir die<br />
gesellschaftliche Akzeptanz<br />
für die Biogastechnologie<br />
zurück.“<br />
Thomas Karle, Gütegemeinschaft<br />
Gärprodukte e.V.<br />
Fotos: Carmen Rudolph<br />
„Das Verfahren zur Störstoffabtrennung<br />
muss auf<br />
die Art des organischen<br />
Abfalls abgestimmt sein,<br />
der als Input zum Einsatz<br />
kommt.“<br />
Tobias Finsterwalder, Finsterwalder<br />
Umwelttechnik GmbH Co.<br />
Ausgangspunkt der Vorträge und Wortmeldungen waren<br />
die aktuellen Änderungen bei den Rechtsvorschriften.<br />
Kern des EEG <strong>2017</strong> ist die weitgehende Umstellung<br />
auf Ausschreibungen in einem Marktprämienmodell.<br />
Dass es gelungen ist, auf diesem Wege Bestandsanlagen<br />
die Chance auf einen zweiten Zeitraum mit einer<br />
festen Stromvergütung einzuräumen, wertete der<br />
Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes Biogas e.V.,<br />
Dr. Claudius da Costa Gomez, als wichtigen Erfolg.<br />
Dagegen seien eine ganze Reihe von Detailregelungen<br />
bislang vollkommen unbefriedigend ausgestaltet. Als<br />
Beispiel nannte er unter anderem die Begrenzung des<br />
Gebotes auf die durchschnittliche Vergütung in den drei<br />
Kalenderjahren vor der Ausschreibung. In der Praxis bedeute<br />
dies, dass sich gerade Abfallanlagen oft nicht an<br />
dem im EEG festgelegten Gebotshöchstwert von 16,9 ct/<br />
kWh orientieren können, da ihre aktuelle durchschnittliche<br />
Vergütung zum Teil erheblich darunter liegt.<br />
Alle Anlagen, die einen weiteren zehnjährigen Vergütungszeitraum<br />
anstreben, müssen an den Ausschreibungen<br />
teilnehmen. Anhand verschiedener Beispielszenarien<br />
erläuterte da Costa Gomez, welche<br />
Einflussmöglichkeiten Betreiber von Bestandsanlagen<br />
haben, um möglichst<br />
nahtlos in den zweiten<br />
Vergütungsabschnitt<br />
zu wechseln.<br />
Ebenfalls einen großen<br />
Einfluss auf die<br />
weitere Entwicklung<br />
der Biogasbranche<br />
hat die Düngeverordnung,<br />
deren Neufassung<br />
in diesem Jahr<br />
Gesetzeskraft erlangen<br />
soll. „Auch Gärprodukte aus pflanzlichen Rohstoffen<br />
müssen dann als Wirtschaftsdünger in die Berechnung<br />
der betrieblichen Obergrenze von 170 Kilogramm<br />
Stickstoff pro Hektar einbezogen werden“, erläuterte<br />
Dr. Gerd Reinhold von der Thüringer Landesanstalt für<br />
Landwirtschaft. Diese und weitere Vorgaben, etwa zu<br />
den Sperrzeiten für die Ausbringung, schränken den<br />
Handlungsspielraum der Landwirte ein und erschweren<br />
teilweise die sinnvolle<br />
Einbeziehung<br />
von Gärprodukten in<br />
geschlossene Nährstoffkreisläufe.<br />
Erwartete Folgen<br />
seien mehr Transporte<br />
und eine höhere<br />
Bodenbelastung im<br />
Frühjahr. Strittig ist<br />
noch, ob die Forderung<br />
nach ausreichenden Flächen für die Ausbringung<br />
der Gärprodukte auch eine rechtliche Zuordnung der<br />
Felder zu gewerblichen Biogasanlagen erfordert. „Praktisch<br />
läuft das aber wohl in vielen Fällen auf eine Erweiterung<br />
der Lagerkapazität um drei Monate hinaus“,<br />
befürchtete Reinhold.<br />
Störstoffe entfernen<br />
Um Biogasanlagen unter den veränderten Rahmenbedingungen<br />
wirtschaftlich betreiben zu können, müssen<br />
alternative Erlöspotenziale erschlossen werden. Dazu<br />
gehört die Vermarktung der Gärprodukte. Darum stellte<br />
Tobias Finsterwalder, Geschäftsführer der Finsterwalder<br />
Umwelttechnik GmbH & Co. KG (FITEC), Lösun-<br />
„Betreiber sollten sich<br />
langfristig und wohlüberlegt<br />
auf die Ausschreibung<br />
und die zweite Vergütungsphase<br />
vorbereiten.“<br />
Dr. Claudius da Costa Gomez,<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
11
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
„Auch Gärprodukte aus<br />
pflanzlichen Rohstoffen<br />
müssen künftig in die betriebliche<br />
Stickstoffbilanz<br />
einbezogen werden.“<br />
Dr. Gerd Reinhold, Thüringer<br />
Landesanstalt für Landwirtschaft<br />
gen zur Entfernung<br />
von Störstoffen aus<br />
Bioabfällen und<br />
Gärprodukten vor.<br />
Den Maßstab setzt<br />
hier die Düngemittelverordnung,<br />
die<br />
Grenzwerte für den<br />
Gewichtsanteil der<br />
Fremdstoffe im Gärprodukt<br />
vorgibt. Bei plastisch verformten Kunststoffpartikeln<br />
über 2 mm beträgt dieser Wert zum Beispiel<br />
0,1 Prozent.<br />
Die Art des organischen Abfalls und die darin typischerweise<br />
enthaltenen Störstoffe bestimmen die Technologie<br />
der Abtrennung. Nach der meist nassmechanischen<br />
Aufbereitung mittels Sinkbädern, Separationsmühlen<br />
oder Siebpressen empfiehlt der Experte eine Substratfeinreinigung<br />
im Anschluss an die Hygienisierung.<br />
„Während der Temperaturerhöhung auf 70 Grad verändert<br />
sich die Konsistenz des Substrats. Dies ermöglicht<br />
spezielle Techniken zur weiteren Störstoffabtrennung“,<br />
so Finsterwalder.<br />
unterschiedliche Optionen der Wärmenutzung und des<br />
Transportaufwandes. „Sowohl die Kosten als auch die<br />
Umweltwirkung sind unmittelbar abhängig von der Verfügbarkeit<br />
an Wärme, einschließlich einer möglichen<br />
Generierung des KWK-Bonus sowie von der vor Ort<br />
gegebenen Nährstoffsituation und der daraus abgeleiteten<br />
Notwendigkeit einer Entfrachtung“, fasst Wulf<br />
die Ergebnisse zusammen. Bei einem regionalen Phosphorüberschuss<br />
seien Trocknungsverfahren sinnvoll.<br />
Stickstoff verbessere seine Transportwürdigkeit durch<br />
die Herstellung von ASL-Dünger. Sollen alle Nährstoffe<br />
aus einer Region entfrachtet werden, stehe die Volumenreduzierung<br />
im Vordergrund.<br />
„Mit unserer Technologie<br />
lassen sich 90 Prozent des<br />
Phosphors und Stickstoffs<br />
aus Gärprodukten zurückgewinnen.“<br />
Dr. Jennifer Bilbao, Fraunhofer-<br />
Institut für Grenzflächen- und<br />
Bioverfahrenstechnik<br />
„Die Verfügbarkeit von<br />
Wärme und die örtliche<br />
Nährstoffsituation<br />
bestimmen sowohl die<br />
Wirtschaftlichkeit als auch<br />
die Umweltwirkung der<br />
Gärproduktaufbereitung.“<br />
Dr. Sebastian Wulf, Kuratorium<br />
für Technik und Bauwesen in der<br />
Landwirtschaft<br />
Jedes Verfahren habe allerdings Stärken und Schwächen.<br />
Man müsse damit rechnen, dass trotz Aufbereitung<br />
2 Prozent des Inputgewichts Störstoffe sind. Für<br />
den Fermenter hat Finsterwalder, der selbst seit 2000<br />
eine Anlage zur Speiserestvergärung betreibt, eine Reinigungstechnologie<br />
entwickelt. Sie besteht aus einem<br />
Bodenräumer für Sinkstoffe und einer gasdicht abgeschlossenen<br />
Siebanlage für die Entfernung aufschwimmenden<br />
Materials.<br />
Wenn Phosphorüberschüsse, dann<br />
Trocknungsverfahren sinnvoll<br />
Dr. Sebastian Wulf vom Kuratorium für Technik und<br />
Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) gab einen<br />
Überblick über vornehmlich physikalische Aufbereitungsverfahren<br />
für Gärprodukte und verglich deren<br />
Wirtschaftlichkeit und Folgen für die Umwelt. Die<br />
Daten ermittelten Wissenschaftler im Rahmen des<br />
kürzlich abgeschlossenen gemeinsamen Forschungsprojekts<br />
GärWERT. Als Berechnungsgrundlage dienten<br />
Nährstoffe separieren, Fasern in Form<br />
bringen<br />
Bereits seit einigen Jahren beschäftigt sich Dr. Jenniffer<br />
Bilbao vom Fraunhofer-Institut für Grenzflächenund<br />
Bioverfahrenstechnik Stuttgart mit der Rückgewinnung<br />
von Phosphor und Stickstoff aus flüssigen<br />
Gärprodukten. Ausgangspunkt ist neben dem Nährstoffüberschuss<br />
in einigen Regionen der Umstand,<br />
dass das Verhältnis der Nährstoffanteile im Gärprodukt<br />
nicht auf den konkreten Bedarf der Kultur zugeschnitten<br />
werden kann.<br />
Im Projekt „Gobi“ entwickelten die Wissenschaftler<br />
daher eine modular aufgebaute Anlage zur Extraktion<br />
von Phosphor und Stickstoff in Pulverform. Aus den<br />
Komponenten können bedarfsgerechte Designdünger<br />
gemischt und vermarktet werden. Bei der Technologie<br />
wird durch Ansäuerung des Gärprodukts erreicht, dass<br />
bei der Grobfiltration nicht nur der größte Teil an Stickstoff<br />
und Kalium, sondern auch des Phosphors in der<br />
flüssigen Fraktion verbleibt. Die festen Stoffe werden<br />
mit überhitztem Dampf getrocknet.<br />
Die Abtrennung letzter Feststoffe aus der Flüssigkeit<br />
erfolgt mittels Mikrofiltration. Nachfolgend lässt sich<br />
dann unter Einsatz von Lauge Phosphor sowie mittels<br />
spezieller Membrankontaktoren, die nur Gase passieren<br />
lassen, Stickstoff zurückgewinnen. Das verbleibende<br />
Wasser hat einen hohen Kaliumgehalt und eignet<br />
sich zum Beispiel für die Beregnung.<br />
Im Ergebnis entstehen drei Produkte: „P-salt“ mit einem<br />
hohen Anteil Phosphor, „N-salt“ mit viel Stickstoff<br />
und Schwefel sowie ein Bodenverbesserer, bei dem die<br />
Konzentration dieser Nährstoffe jeweils weit unter 1<br />
12
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Aktuelles<br />
Prozent liegt. „Mit unserem Verfahren werden 90 Prozent<br />
des Phosphors und Stickstoffs aus den Gärprodukten<br />
herausgelöst“, sagt Bilbao. Die Düngewirkung sei<br />
vergleichbar oder – wie Feldversuche an der Universität<br />
Hohenheim gezeigt hätten – im Mais sogar besser als<br />
mit Triple Superphosphat.<br />
Faserverbundstoffe aus Gärresten<br />
Einen anderen Ansatz der Veredlung von Gärprodukten<br />
verfolgen Wissenschaftler am Deutschen Biomasseforschungszentrum<br />
(DBFZ) in Leipzig. Ihnen geht es um<br />
die Erschließung von Fasern für eine stoffliche Nutzung<br />
als Spanplatten oder Dämmmaterial. Durch Auswertung<br />
verschiedener Datenpools und durch Erhebungen<br />
ermittelten sie zunächst das dafür aus den Gärprodukten<br />
erschließbare Rohstoffpotenzial.<br />
Dabei wurden nur NawaRo-Anlagen einbezogen. Ergebnis:<br />
Ausgehend von den reichlich 108 Mio. t Gärprodukten,<br />
die deutschlandweit jährlich anfallen, stehen<br />
theoretisch zwischen 4,5 bis 6,8 Mio. t Fasermaterial<br />
für eine Verarbeitung in der Holzindustrie zur Verfügung.<br />
„Unser Projektpartner Kronspan bezifferte den<br />
Bedarf für sein Werk in Lampertswalde mit bis zu<br />
80.000 t Gärproduktfasern. Diese Menge könnten<br />
Biogasanlagen in einem Umkreis von 120 Kilometern<br />
bereitstellen“, informierte DBFZ-Wissenschaftlerin Velina<br />
Denysenko.<br />
AUF in<br />
die Zukunft mit der<br />
richtigen Technik<br />
für jedes<br />
Substrat!<br />
Clever Optimieren<br />
BIOGAS<br />
„Der Faseranteil der<br />
Gärprodukte kann stofflich<br />
genutzt werden, ohne die<br />
Humusreproduktion zu<br />
gefährden.“<br />
Velina Denysenko, Deutsches<br />
Biomasseforschungszentrum<br />
Optimieren Sie jetzt Ihre Substrat-Einbringung<br />
und Aufbereitung<br />
Wir analysieren Ihre Substrate und erarbeiten mit Ihnen eine effiziente<br />
Lösung. Unser umfangreiches Leistungsspektrum bietet technische<br />
Lösungen für die effiziente Feststoffaufbereitung und -dosierung –<br />
auch für Ihren speziellen Mix. Dahinter stehen unser Biogas-Knowhow<br />
sowie kompetente Beratung und Service.<br />
Alles aus einer Hand und mit System!<br />
Im Rahmen des Forschungsprojektes erfolgte auch eine<br />
Bewertung unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit.<br />
Ein zentrales Kriterium ist dabei die Sicherung der<br />
Humusreproduktion, da ein Teil der organischen Masse<br />
wegen der stofflichen Nutzung nicht zurück aufs Feld<br />
gelangt. Hier zeigte sich, dass bei einem Anbau humusmehrender<br />
Energiepflanzen die gesamte Fasermenge<br />
aus den Gärprodukten verwertet werden kann, ohne dadurch<br />
die Nachhaltigkeit zu gefährden.<br />
Autor<br />
Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Freier Journalist<br />
Rudolph Reportagen – Landwirtschaft,<br />
Umwelt, Erneuerbare Energien<br />
Kirchweg 10 · 04651 Bad Lausick<br />
Tel. 03 43 45/26 90 40<br />
E-Mail: info@rudolph-reportagen.de<br />
www.rudolph-reportagen.de<br />
NEU:<br />
DisRuptor Feinzerkleinerer<br />
Gewinner des Innovation Award<br />
EnergyDecentral 2016.<br />
Aufgrund individuell anpassbarer<br />
Einstellungen bereitet der<br />
DisRuptor unterschiedlichste<br />
Substrate optimal auf. Er reduziert<br />
den Eigenenergiebedarf<br />
und steigert die Gasausbeute.<br />
Erfahren Sie mehr: vogelsang-biogasmax.de<br />
13<br />
ENGINEERED TO WORK
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Biogas aus<br />
Wasserpflanzen<br />
Das Forschungsprojekt AquaMak widmet sich<br />
der energetischen Nutzung von Wasserpflanzen. Erstmals<br />
fand dazu in Leipzig eine Tagung statt.<br />
Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Fotos: Carmen Rudolph<br />
Bei der notwendigen Pflege von<br />
Flüssen und Seen fallen Jahr<br />
für Jahr große Mengen Wasserpflanzen<br />
an. Deren Entsorgung<br />
verursacht bei Gewässerbetreibern<br />
und Kommunen erhebliche Kosten.<br />
Wäre es da nicht besser, die störende und<br />
ohne Nutzungskonkurrenz heranwachsende<br />
Biomasse als Input für Biogasanlagen<br />
zu nutzen? Genau damit beschäftigen<br />
sich Wissenschaftler im Forschungsprojekt<br />
AquaMak. Die bisherigen Ergebnisse<br />
wurden auf einer Tagung am 30. und 31.<br />
März in Leipzig vorgestellt, die erstmals<br />
Gewässerbetreiber, Wissenschaftler und<br />
Dienstleister für Entkrautungsmaßnahmen<br />
zusammenführte.<br />
Insgesamt etwa 40 Eimer, so erfuhren die<br />
Tagungsteilnehmer, trafen bis Sommer<br />
letzten Jahres bei Dr. Lucie Moeller im<br />
Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung<br />
(UFZ) ein. Die gut verschlossenen<br />
Behälter kamen aus ganz Deutschland,<br />
enthielten aber alle das Gleiche – einen<br />
Klumpen frisch abgefischter Wasserpflanzen.<br />
„Nachdem wir zunächst deutschlandweit<br />
ermittelt hatten, wo und aus welchem<br />
Grund Entkrautungsmaßnahmen in Seen,<br />
EEG-Konformität noch unklar<br />
Flüssen und Kanälen<br />
durchgeführt<br />
werden, baten wir<br />
ausgesuchte Akteure um die Zusendung<br />
von Ernteproben“, erläutert die Wissenschaftlerin.<br />
Stark schwankende TS-Gehalte<br />
Die Analyse der Proben, in denen insgesamt<br />
16 verschiedene Pflanzenarten<br />
identifiziert wurden, habe gezeigt, dass<br />
aquatische Biomasse prinzipiell als Substrat<br />
in Biogasanlagen geeignet ist. Das<br />
C/N-Verhältnis bewege sich in der für die<br />
anaerobe Vergärung als optimal geltenden<br />
Spanne. Die Konzentration von Stickstoff<br />
und Phosphor ist mit der von Grassilage<br />
vergleichbar. Der Trockensubstanzgehalt<br />
(TS) des Erntegemischs beträgt durchschnittlich<br />
10 Prozent. „Je nachdem, welche<br />
Pflanzenarten darin dominieren, ist<br />
die Schwankungsbreite allerdings relativ<br />
hoch“, räumt Moeller ein. So habe das Große<br />
Nixenkraut einen TS-Gehalt von 5 Prozent<br />
und der Teich-Schachtelhalm von über<br />
19 Prozent. Positiv seien dagegen die kaum<br />
vorhandenen Störstoffe und der geringe Sedimentanteil<br />
von unter 1 Prozent.<br />
Bei der Gewässerpflege fallen oft große Mengen von Wasserpflanzen an. Statt<br />
diese Biomasse teuer zu entsorgen, könnte sie als Substrat in Biogasanlagen<br />
energetisch genutzt werden.<br />
„Ziel des Verbundprojektes ist, ökonomisch,<br />
ökologisch und sozial vorteilhafte<br />
Nutzungsstrategien für Wasserpflanzen zu<br />
entwickeln“, sagte der am UFZ tätige Leiter<br />
des AquaMak-Projektes Prof. Dr.-Ing.<br />
Andreas Zehnsdorf. Priorität habe dabei<br />
die Vergärung in Biogasanlagen. Die Bioenergiebranche<br />
stehe unter einem hohen<br />
Kosten- und Akzeptanz-Druck. Anlagenbetreiber<br />
seien daher an neuen Substraten<br />
interessiert, deren Bereitstellung keine<br />
Flächen benötigen, auf denen auch Nahrungs-<br />
und Futtermittel angebaut werden<br />
könnten.<br />
Ein besonderes Highlight: In den Untersuchungen<br />
zeigte sich, dass Wasserpflanzen<br />
neben dem Methanpotenzial wertvolle<br />
Spurenelemente wie Eisen, Magnesium<br />
und Phosphor mitbringen. So ließen sich<br />
entsprechende Additive beim Input einsparen<br />
und gleichzeitig der Düngewert der<br />
Gärreste insbesondere für den Ökolandbau<br />
erhöhen. „Wenn Seenbetreiber, statt Entsorgungsgebühren<br />
zu zahlen, die Krautberge<br />
kostenlos abgeben, wäre das also nicht<br />
nur eine ökologisch sinnvolle Verwertung,<br />
sondern könnte trotz geringer TS-Gehalte<br />
für beide Seiten auch wirtschaftlich sein“,<br />
überlegte der Umweltforscher.<br />
Marion Wiesheu vom Fachverband Biogas e. V. verwies in ihrem Vortrag auf<br />
Unsicherheiten bei der Biogasproduktion aus Wasserpflanzen unter dem<br />
Gesichtspunkt der EEG-Vergütung. Da oft schwer zu bestimmen sei, ob die<br />
Entkrautung aus Gründen des Naturschutzes erfolgte oder ob die Maßnahme<br />
zum Beispiel eher dem Hochwasserschutz diente, gefährde der Einsatz<br />
dieser Biomasse den NawaRo- als auch den Landschaftspflegebonus. Hier<br />
müsse gegebenenfalls eine Klärung durch die Clearingstelle erfolgen. Die<br />
Verwendung von Wasserpflanzen als Substrat in Abfallvergärungsanlagen<br />
sei dagegen in dieser Hinsicht unproblematisch.<br />
Wachsende Kosten für<br />
Gewässer-Entkrautung<br />
Wasserpflanzen gehören zu den wertvollen<br />
Mitgliedern der Biotope in fließenden und<br />
stehenden Gewässern. Allerdings führt ihr<br />
übermäßiges Wachstum häufig zu Problemen.<br />
Meist behindert es die Nutzung,<br />
etwa für die Binnenschifffahrt oder für<br />
Sport und Erholung. Bei der Wasserkraftnutzung<br />
verursachen zugesetzte Turbi-<br />
14
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Aktuelles<br />
Vollgas im Fermenter.<br />
Spurenelemente<br />
MethaTec ® EcoPlex<br />
– Flüssige, komplexierte Spurenelementmischung<br />
– Individuelle Abstimmung auf den Bedarf<br />
der Biogasanlage<br />
– Schnelle Verfügbarkeit durch gelöste<br />
Spurenelementverbindungen<br />
– Exakte Dosierung mit dem TerraVis SpurEn Schrank<br />
www.terravis-biogas.de<br />
Ihre Ansprechpartner:<br />
Johannes Joslowski<br />
Telefon 0251 . 682-2056<br />
johannes.joslowski@terravis-biogas.de<br />
Jens Petermann<br />
Telefon 0251 . 682-2438<br />
jens.petermann@terravis-biogas.de<br />
FELD SILO FERMENTER ENERGIE<br />
15
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Dr. Markus Röhl von der Hochschule<br />
für Wirtschaft und Umwelt<br />
Nürtingen-Geislingen ermittelte<br />
die Mengen, die bei Entkrautungen<br />
von Fließ- und Stillgewässern<br />
anfallen.<br />
nengitter Leistungsabfälle von bis zu 20<br />
Prozent. Auch der Hochwasserschutz ist<br />
ein Grund für die Beseitigung der Wasserpflanzen.<br />
Sie werden von den Wasserverbänden,<br />
Kommunen und Betreibern selbst oder<br />
von beauftragten Dienstleistern mit Mähbooten<br />
durchgeführt. Experten schätzen,<br />
dass allein die Entkrautung von naturfernen<br />
Fließgewässern in Deutschland, zum<br />
Beispiel von Kanälen, pro Jahr etwa 100<br />
Millionen Euro kostet. Bezieht man die<br />
Flüsse und Stillgewässer mit ein, dürften<br />
die finanziellen Aufwendungen erheblich<br />
höher liegen. In den Nebenflüssen von<br />
Rhein, Donau, Elbe und Oder besteht zum<br />
Beispiel regelmäßig Bedarf zur Gewässerpflege.<br />
Als Kostentreiber erweisen sich hier eingewanderte<br />
Wasserpflanzenarten wie die<br />
Schmalblättrige Wasserpest, einige Tausendblattarten<br />
und Wasserlinsen. Die Wirkung<br />
dieser invasiven Neophyten durch<br />
Massenvermehrung ist nicht selten verheerend.<br />
So wurde 2016 einer der Ruhrstauseen,<br />
der Kemnader See, wegen nicht<br />
mehr zu bewältigender Verkrautung für die<br />
touristische Nutzung aufgegeben.<br />
Dr. Walter Stinner vom Deutschen<br />
Biomasseforschungszentrum<br />
testete Wasserpflanzen als<br />
Co-Substrat von Stroh bei der<br />
Biogasproduktion.<br />
Prof. Dr.-Ing. Andreas Zehnsdorf<br />
vom Helmholtz-Zentrum für<br />
Umweltforschung koordiniert das<br />
Forschungsprojekt AquaMak.<br />
Biomasse nutzen, statt teuer<br />
entsorgen<br />
Die beim Entkrauten anfallenden Wasserpflanzen<br />
werden heute in der Regel am Ufer<br />
abgelegt oder als Bioabfall entsorgt. Da<br />
Pflanzen im Wasser kaum Stützgewebe benötigen,<br />
gehen sie an Land jedoch schnell<br />
in Fäulnis über. Bei größeren Ablagerungen<br />
führt das wegen des verwesungsähnlichen<br />
Geruchs zu Belästigungen. Außerdem können<br />
durch Nährstoffauswaschungen sowie<br />
Methan- und Lachgasemissionen erhebliche<br />
Umweltbelastungen entstehen.<br />
In Deutschland gibt es fast 170.000 Kilometer<br />
Fließgewässer und mehr als 15.600<br />
Seen mit einer Gesamtfläche von rund<br />
388.000 Hektar. Im Rahmen des Forschungsprojektes<br />
AquaMak untersuchte<br />
Dr. Markus Röhl von der Hochschule für<br />
Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen<br />
(HfWU), wie viel Biomasse bei der<br />
Gewässerpflege in Deutschland insgesamt<br />
anfällt, wo und in welcher Qualität die<br />
Stoffe zur Verfügung stehen, wann das<br />
günstigste Erntefenster ist und ob Zielkonflikte<br />
zum Beispiel mit dem Naturschutz<br />
entstehen können. Dazu nutzten die Wissenschaftler<br />
vorhandenes Datenmaterial<br />
und werteten Fragebögen aus, die sie an<br />
Besitzer und Nutzer von Gewässern wie<br />
Anglerverbände, Touristikveranstalter, Gemeindeverwaltungen<br />
und Landesbehörden<br />
versandt hatten.<br />
Ergebnis: Pro Jahr fallen bei den Entkrautungsmaßnahmen<br />
im Schnitt rund<br />
100.000 Tonnen Biomasse an. „Diese<br />
Angabe basiert wegen der schwierigen<br />
Datenlage zum Teil auf Hochrechnungen.<br />
Zudem schwankt der Ertrag saisonal<br />
stark und lässt sich daher schwer planen“,<br />
räumt der Wissenschaftler auf der Aqua-<br />
Mak-Tagung ein.<br />
Elodea als Co-Substrat bei der<br />
Strohvergärung<br />
Viele Betreiber zeigen Interesse, die Entsorgungskosten<br />
durch energetische Nutzung<br />
der Biomasse zu senken. Dafür galt<br />
es jedoch erst ein Problem zu lösen: Da die<br />
wasserhaltige, zuckerarme Pflanzenmasse<br />
bei den Entkrautungskampagnen in großen<br />
Mengen anfällt, muss sie konserviert<br />
werden, um über eine längere Zeit als Input<br />
für den Biogasprozess zur Verfügung<br />
zu stehen. Hier konnte Dr. Walter Stinner<br />
mit Versuchsreihen am DBFZ nachweisen,<br />
dass eine Silage sowohl einzeln als auch<br />
im Gemisch mit anderem Pflanzenmaterial<br />
möglich ist.<br />
Besonders vielversprechend ist eine gemeinsame<br />
Silierung mit landwirtschaftlichen<br />
Reststoffen. „Tests zeigen, dass zum<br />
Beispiel bei Stroh eine Silierung von Elodea<br />
deutliche Vorteile gegenüber einer reinen<br />
Wasseranmaischung bringt“, berichtet der<br />
DBFZ-Forscher. Am deutlichsten zeige sich<br />
dies bei einer Einstellung der Mischsilage<br />
auf einen TS-Gehalt von 30 Prozent, was<br />
massenmäßig etwa halb Stroh, halb Elodea<br />
bedeutet. Durch die Beimengung von<br />
Wasserpflanzen sinke der pH-Wert. Dies befördere<br />
den Aufschluss des Strohs für die<br />
Vergärung.<br />
Bei einem TS-Gehalt<br />
von 30 % erzielte<br />
die Mischsilage aus<br />
der Wasserpflanze<br />
Elodea und Stroh die<br />
beste Methanausbeute.<br />
Autor<br />
Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />
Freier Journalist<br />
Rudolph Reportagen – Landwirtschaft,<br />
Umwelt, Erneuerbare Energien<br />
Kirchweg 10 · 04651 Bad Lausick<br />
Tel. 03 43 45/26 90 40<br />
E-Mail: info@rudolph-reportagen.de<br />
www.rudolph-reportagen.de<br />
16
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Aktuelles<br />
Messe Nürnberg – Der Pflichttermin<br />
für die gesamte Branche<br />
12.–14. Dezember <strong>2017</strong>, Nürnberg<br />
Über 130 Firmen haben sich bereits für die weltweit größte reine Biogasfachmesse angemeldet.<br />
An drei Tagen können sich die Besucher über aktuelle Produkte und Dienstleistungen informieren<br />
und mit Experten austauschen.<br />
Die Partnerschaft zwischen dem<br />
Fachverband Biogas und der<br />
DLG bringt neuen Service für<br />
Aussteller: Das brandneue Anmelde-<br />
und Serviceportal www.<br />
biogas-convention.com/Ausstellerservice<br />
ermöglicht eine einfache und schnelle<br />
Online-Anmeldung. Über 130 Aussteller<br />
haben dieses Angebot bereits genutzt und<br />
sich ihre Standfläche gesichert. Anfang Mai<br />
hat die Aufplanung der bis dahin angemeldeten<br />
Unternehmen begonnen, natürlich<br />
kann sich weiterhin jede Firma anmelden,<br />
solange Flächen zur Verfügung stehen.<br />
Der Fachverband Biogas bietet Mitgliedsunternehmen<br />
auch die Möglichkeit, im<br />
Rahmen eines Gemeinschaftsstandes<br />
aufzutreten. Das neue Konzept mit dem<br />
„Biogas-Treff“ war auf der EnergyDecentral<br />
in Hannover so erfolgreich, dass es in<br />
Nürnberg fortgeführt wird.<br />
Parallel wird der Fachverband Biogas mit<br />
der 27. Jahrestagung erneut den wichtigsten<br />
Treffpunkt für die Branche und Mitglieder<br />
organisieren. Im Mittelpunkt stehen die<br />
Auswirkungen der Bundestagswahl, die Erkenntnisse<br />
aus der ersten Ausschreibungsrunde<br />
und Fragen zur Flexibilisierung. Weitere<br />
Leitthemen werden sein: EEG <strong>2017</strong>,<br />
DüV, AwSV, TA Luft, Sicherheit, Abfallvergärung,<br />
Genehmigung, Gärprodukteaufbereitung.<br />
Für internationale Gäste wird ein<br />
englischsprachiges Programm angeboten,<br />
Workshops widmen sich zum Beispiel den<br />
Themen EEG, Energiepflanzen, Abfallvergärung,<br />
Motoren.<br />
Am 12. Dezember wird die Mitgliederversammlung<br />
<strong>2017</strong> stattfinden. Am 13. Dezember<br />
wird auf der Abendveranstaltung<br />
das 25-jährige Jubiläum des Fachverband<br />
es Biogas gefeiert. Den Abschluss bildet<br />
eine Lehrfahrt zu Biogasanlagen in der Region<br />
um Nürnberg.<br />
Unter www.biogas-convention.com können<br />
Firmen online ihre Standfläche buchen. Das<br />
Programm für Teilnehmer und Besucher der<br />
BIOGAS Convention & Trade Fair wird ab<br />
Juni/Juli <strong>2017</strong> hier veröffentlicht.<br />
Save the date!<br />
» Aktuelle Vorträge aus der Branche<br />
für die Branche<br />
» Exklusive Workshops für Mitglieder<br />
» Biogas worldwide<br />
» Plenarvorträge, Best Practice<br />
» Lehrfahrt & Abendveranstaltung<br />
Hauptveranstalter:<br />
Mitveranstalter:<br />
12. – 14. Dezember <strong>2017</strong><br />
Halle 9 und 10, NCC Mitte, Messegelände Nürnberg<br />
Weltweit größter Treff der Biogasbranche<br />
mit internationaler Biogas Fachausstellung<br />
Buchen Sie<br />
jetzt Ihren<br />
Messestand!<br />
Aktuelle Informationen und Anmeldung:<br />
www.biogas-convention.com<br />
17
Aktuelles<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Fest- und Direktkosten sind gestiegen<br />
Mitte März fand in Verden die 8. Biogastagung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen statt. Ihr Thema<br />
lautete: „Flexibel in die Zukunft – ein Morgen für Biogas!“. Aber auch Themen wie Flüssigfütterung statt Feststoffeintrag<br />
sowie Erkenntnisse und Zahlen aus der Betriebsberatung wurden behandelt.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Aus dem Biogasarbeitskreis berichtete<br />
Andreas Freytag von<br />
der Landwirtschaftskammer<br />
Niedersachsen aus Hannover.<br />
Dem Arbeitskreis gehören 37<br />
Biogasanlagen an. 8 Anlagen davon bekommen<br />
die sogenannte Flexprämie, 22 Anlagen<br />
liefern Regelenergie. In 2015 haben<br />
die Anlagen rund 263 Millionen Kilowattstunden<br />
(kWh) an Strom produziert. Die<br />
Direktvermarktungserlöse beliefen sich in<br />
Summe auf 718.475 Euro.<br />
Seit 2013 mussten die Anlagen für Silomais<br />
zwischen 27 und 29 Euro pro Tonne<br />
Frischmasse bezahlen. Der Gewinn liegt<br />
über die Vergleichsgruppen zwischen 4 und<br />
5,5 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh). „Die<br />
erforderlichen Nachrüstungen auf den Anlagen<br />
durch zusätzliche Gärrestlager, Gasfackel,<br />
Umwallungen etc. verteuern den<br />
Herstellungsaufwand pro kWh. Die Kosten<br />
sind dadurch um 20 Prozent angestiegen“,<br />
betonte Freytag.<br />
Die Reparaturkosten betrugen im Arbeitskreis<br />
im Jahr 2009 noch 1,39 ct/kWh el<br />
. In<br />
2015 lagen sie bei 2,17 ct/kWh el<br />
. Die Betriebe<br />
erlösen etwas mehr durch die Nutzung<br />
des KWK-Bonus, des Emissionsbonus<br />
und des Güllebonus. Zur Optimierung des<br />
Güllebonus wird mehr Mist eingesetzt. Die<br />
Direktkosten lagen bei den Anlagen der<br />
Gruppe 1 des Arbeitskreises bei 8,24 ct/<br />
kWh und bei den Anlagen der Gruppe 6 bei<br />
7,84 ct/kWh, wobei die Ziffern der Gruppen<br />
keine Aussagen zur Höhe der Direktkosten<br />
zulassen. Die Direktkosten sind laut Freytag<br />
vor allem wegen höherer Futterkosten angestiegen.<br />
Die Abschreibungskosten (AfA) sind ebenfalls<br />
angestiegen. Sie betrugen in Gruppe 1<br />
Foto: Landwirtschaftskammer Niedersachsen/Wolfgang Ehrecke<br />
im Jahr 2010 3,2 ct/kWh und in 2015 4,11<br />
ct/kWh. In Gruppe 6 betrug die AfA im Jahr<br />
2010 3,41 ct/kWh und 2015 3,49 ct/kWh.<br />
Die Zinslasten der Biogasanlagen sinken.<br />
Es werde, so der Referent, „flott getilgt“.<br />
Erste Zinsfestschreibungszeiten laufen aus.<br />
Die Gruppe 1 hatte 2010 Reparaturkosten<br />
von 1,8 ct/kWh und 2015 von 2,82 ct/kWh.<br />
Gruppe 6 hatte 2010 Reparaturkosten von<br />
1,56 ct/kWh und in 2015 von 1,92 ct/kWh.<br />
Die Gehälter haben sich auf den Anlagen in<br />
den vergangenen Jahren ebenfalls erhöht.<br />
Die aufgeführten Werte sind inklusive des<br />
Lohnansatzes für die Betreiber. In 2010 lagen<br />
die Lohnkosten in Gruppe 1 bei 0,58 ct/<br />
kWh und in 2015 bei 1,05 ct/kWh. In Gruppe<br />
6 war die Steigerung nicht so stark. 2010<br />
betrugen die Lohnkosten noch 0,53 ct/kWh,<br />
in 2015 0,68 ct/kWh. Die Versicherungskosten<br />
der Anlagen haben sich auch im Laufe<br />
der Jahre erhöht. In Gruppe 1 betrugen<br />
sie in 2010 0,19 ct/kWh und in 2015 0,38<br />
ct/kWh. In Gruppe 6 betrugen sie in 2010<br />
0,15 ct/kWh und in 2015 0,21 ct/kWh.<br />
Zu den Festkosten: Gruppe 1, 2010, 16,26<br />
ct/kWh und in 2015 20,09 ct/kWh. Gruppe<br />
6, 2010, 16,44 ct/kWh und in 2015 17,83<br />
ct/kWh. Die Betreiber der Gruppe 1 hatten<br />
nach Abzug aller Kosten ein Saldo von 6 ct/<br />
kWh in 2010 und in 2015 von 3,98 ct/kWh.<br />
Die Betreiber der Gruppe 6 hatten nach Abzug<br />
aller Kosten ein Saldo von 7,67 ct/kWh<br />
in 2010 und in 2015 von 5,57 ct/kWh.<br />
Flexible, lokale Objektversorgung<br />
Simon Tappen von der Bayerischen Landesanstalt<br />
für Landwirtschaft, Institut für<br />
Landtechnik und Tierhaltung, referierte über<br />
„Flex-Betrieb lokal: Die Biogasanlage als<br />
Bestandteil einer Hof basierten Energieversorgung“.<br />
Er stellte dabei die Biogasanlage<br />
an der Versuchsstation in Grub vor, die im<br />
Intervallbetrieb flexibel Strom und Wärme<br />
für die Versuchsstation bereitstellen soll.<br />
Vor dem Intervallbetrieb erzeugte ein 75-kW-<br />
Gas-Ottomotor aus Biogas Strom. Die selbsterzeugte<br />
Biogasstrommenge betrug 630.000<br />
kWh pro Jahr. Die Selbstversorgungsquote<br />
der Versuchsstation durch Biogasstrom lag<br />
bei 38 Prozent. Im Zuge der Umstellung auf<br />
Intervallstromerzeugung wurde ein 203-kW-<br />
Gas-Ottomotor angeschafft. Es wird eine<br />
wöchentliche Prognose erstellt. Es sind nun<br />
bis zu 278 kW elektrische Leistung möglich.<br />
Das Spitzenlast-BHKW wird auf variablen<br />
Laststufen gefahren (60 bis 100 Prozent).<br />
Das Grundlast-BHKW wird entweder an- oder<br />
ausgeschaltet. Die Einstellungen erfolgen in<br />
4-Stunden-Zyklen. „Das Ziel ist, den Stromfremdbezug<br />
im nächsten Jahr um mindestens<br />
70 Prozent zu reduzieren“, erklärte Tappen.<br />
Bei der Auswahl des flexiblen Motors ist<br />
18
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Aktuelles<br />
darauf zu achten, dass dieser einen hohen<br />
elektrischen Wirkungsgrad hat. Wichtig ist<br />
auch der Wirkungsgrad in Teillastbereichen.<br />
Bekannt sollten auch der Methanschlupf<br />
sowie das Emissionsverhalten unter Vollund<br />
Teillast sein. Es ist zu klären, ob eine<br />
externe Gasentschwefelung notwendig ist.<br />
Zu klären ist auch die Systematik der Motorvorwärmung<br />
während der Stillstandszeit.<br />
Seit Ende November 2016 konnte laut<br />
Tappen das Spitzenlast-BHKW erfolgreich<br />
in den Betriebsablauf integriert werden.<br />
Hierbei lassen sich verschiedene Fahrweisen<br />
während der Woche realisieren. Durch<br />
die Einstellung der wöchentlichen Fahrweise<br />
der BHKW-Motoren als Anteil an der<br />
Gesamtlast während einer Kalenderwoche<br />
habe der Verbrauch der Liegenschaft Grub<br />
weiter reduziert werden können. Obwohl die<br />
Fütterung intensiviert und die Einführung<br />
von Gülle aufgrund des Gärrestlagervolumens<br />
zurückgefahren worden sei, sei bisher<br />
keine Gefährdung der Fermenterbiologie<br />
festgestellt worden. Unter Berücksichtigung<br />
prozessbiologischer Grenzen konnte<br />
Tappen bereits erfolgreich die Spitzen während<br />
der Arbeitswoche abfahren und eine<br />
Versorgung bis zu 278 kW elektrischer Leistung<br />
realisieren. Durch ein Prognosemodell<br />
wurde dabei die Stromproduktion wöchentlich<br />
angepasst und die Überproduktion<br />
(Stromeinspeisung anstatt Inselbetrieb)<br />
weitläufig vermieden.<br />
Zukünftig soll die Stromproduktion weiterhin<br />
erhöht und angepasst werden, um<br />
eine möglichst zielgenaue Produktion des<br />
benötigten Stroms im Rahmen eines „intelligenten<br />
Stromnetzes“ zu verwirklichen.<br />
Durch das Hinzuziehen des Zuckerrübenmus<br />
sowie einer erhöhten Substratzufuhr<br />
sollen die Möglichkeiten einer biologischen<br />
Flexibilisierung schrittweise (wöchentlich)<br />
ausgeweitet und bewertet werden.<br />
Flüssigfütterung statt<br />
Pressschnecke<br />
Ralf Blanck von der Blanck/Harms Biogas<br />
OHG in Ahausen im Kreis Rotenburg berichtete<br />
über die Umrüstung des Substrateintrages.<br />
Auf der 2005er-Anlage wurden die<br />
Feststoffe bislang mit einer sogenannten<br />
Pressschnecke in den Fermenter gedrückt.<br />
Das hatte zur Folge, dass dicke, schwer auflösbare<br />
„Futterwürste“ in den Gärbehälter<br />
gefördert wurden. Mit diesen Futterwürsten<br />
hatten die Rührwerke ihre Probleme, sie<br />
aufzulösen und unterzurühren.<br />
Nun wurde der Feststoffeintrag auf Flüssigfütterung<br />
umgestellt. Eine Börger Powerfeed<br />
sorgt nun stündlich dafür, dass<br />
vollautomatisch gefüttert wird. Das eingebrachte<br />
Material wie Mais- und Grassilage,<br />
Roggen-GPS, Rindergülle, Putenmist und<br />
Hühnertrockenkot lässt sich jetzt viel besser<br />
im Fermenter untermixen. Weiterer positiver<br />
Effekt ist, dass der Energieverbrauch der<br />
Anlage leicht gesunken ist.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Tel. 0 54 09/90 69 426<br />
E-Mail: martin.bensmann@biogas.org<br />
IHR PLUS AN<br />
ERFAHRUNG.<br />
Individuelle Beratung und umfassende<br />
Absicherung für Ihre Biogasanlagen.<br />
Ina Christiansen (R+V) berät Herrn Dr. Brodersen hinsichtlich der<br />
Absicherung seiner Biogasanlage.<br />
Weitere Informationen erhalten Sie unter 0611 533 98751 oder<br />
auf www.kompetenzzentrumEE.de<br />
19
Politik<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Das Kohleland löst sich nur<br />
schwer von seiner Vergangenheit<br />
Selbst nach vielen Jahren grüner Regierungsbeteiligung ist der Energiemix in NRW<br />
aus Sicht des Klimaschutzes noch immer katastrophal.<br />
Von Bernward Janzing<br />
Vor allem die SPD in NRW<br />
ist der Kohlenutzung<br />
zugewandt. Nur die Grünen<br />
und die Linken sind für<br />
einen Ausstieg aus der<br />
Kohleverstromung. Die<br />
Windenergieanlagen im<br />
Hintergrund symbolisieren<br />
zwar den Einstieg in die<br />
Energiewende, aber der<br />
Windstromanteil in NRW<br />
liegt nur bei 4 Prozent.<br />
Foto: fotolia_ted007<br />
Die Ausgangsbedingungen sind<br />
bekanntlich ganz speziell in<br />
Nordrhein-Westfalen. Fast jede<br />
zweite Kilowattstunde Kohlestrom,<br />
die in Deutschland erzeugt<br />
wird, stammt aus diesem Bundesland.<br />
Im landesspezifischen Stromerzeugungsmix<br />
macht die Kohle satte 75 Prozent aus.<br />
Entsprechend liegen dort Windkraft und<br />
Biomasse mit jeweils 4 Prozent ebenso<br />
deutlich unter dem deutschen Mittelwert<br />
wie die Photovoltaik, die im Land gerade<br />
auf 2 Prozent kommt. Bei der Wärme sieht<br />
es nicht besser aus: Während auf Bundesebene<br />
der Anteil der regenerativen Wärmeerzeugung<br />
bei etwa 14 Prozent liegt,<br />
dümpelt er in NRW noch deutlich unter 10<br />
Prozent. „Der in der Wirtschaft schon stark<br />
vorangeschrittene Umwandlungsprozess<br />
findet sich in der Energieversorgung nicht<br />
so ganz wieder“, urteilt sehr zaghaft die<br />
Agentur für Erneuerbare Energien in ihrem<br />
jüngsten Statusreport Föderal Erneuerbar.<br />
Man hätte es auch schärfer formulieren<br />
können: Es ist noch verdammt viel zu tun,<br />
wenn man die Wirtschaft des Landes klimafreundlich<br />
umbauen will. Doch das Bewusstsein<br />
dafür ist eher mäßig; im Vorfeld<br />
der Landtagswahl am 14. Mai zieht sich<br />
das Bekenntnis zur Kohle noch durch die<br />
meisten Wahlprogramme.<br />
Bei der SPD heißt es, man könne „nicht<br />
gleichzeitig aus der Atomenergie und der<br />
Kohleverstromung aussteigen“. Zugleich<br />
freut sich die Partei über „Planungssicherheit<br />
für den Tagebau im Revier“ und erklärt,<br />
sie wolle „die Wertschöpfung aus den genehmigten<br />
Abbauflächen sichern und ausbauen“.<br />
In gleichem Stil betont die CDU,<br />
das Land werde „auch weiterhin moderne<br />
Kohle- und Gaskraftwerke benötigen“,<br />
ebenso wie die FDP, nach deren Wille „der<br />
Abbau von Braunkohle in NRW weiterhin<br />
möglich bleiben“ soll. Die AfD bezieht sogar<br />
noch die Atomkraft mit ein: „Grundlastversorgung<br />
kann nicht auf die Kernenergie<br />
und die auch in NRW vorhandene Braunkohle<br />
verzichten.“<br />
Kohleende – nur Grüne und Linke<br />
dafür<br />
Für ein Ende der Kohlenutzung sind unter<br />
jenen Parteien, die Chancen auf einen Einzug<br />
in den Landtag haben, nur die Grünen<br />
und die Linke. „Eine erfolgreiche Energiewende<br />
kann es nur geben, wenn wir die<br />
Weichen für einen Kohleausstieg stellen“,<br />
heißt es im Programm der Grünen. Die<br />
Partei trete „für einen Kohlekonsens ein,<br />
der am Ende in einem Kohleausstiegsgesetz<br />
alle Kohlekraftwerke in Deutschland<br />
umfasst“. Es sei wichtig, die ältesten und<br />
damit klimaschädlichsten Kohlemeiler<br />
schnellstmöglich vom Netz zu nehmen.<br />
Daher wollen die Grünen „die Geschwindigkeit<br />
des Abschaltens von Kohlekraftwerken<br />
beschleunigen“ und „auf einen konkreten<br />
Schließungsplan mit Jahreszahlen für alle<br />
Kohlekraftwerke in NRW drängen“.<br />
Die Linke wird dagegen bereits konkreter,<br />
und benennt explizit Jahreszahlen in ihrem<br />
Wahlprogramm: „Der letzte Kohlekraftwerksblock<br />
soll in Deutschland spätestens<br />
im Jahr 2035 stillgelegt werden.“ Das Konzept<br />
der Linken sieht „ein bundesweites<br />
Kohleausstiegsrahmengesetz vor, das die<br />
immissionsschutzrechtliche Privilegierung<br />
der Verstromung von Kohle aufhebt und<br />
CO 2<br />
als Umweltschadstoff definiert“. Der<br />
Anteil Erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch<br />
solle im Gegenzug gesteigert<br />
werden auf 43 Prozent bis 2020, 55<br />
Prozent bis 2025, 70 Prozent bis 2030,<br />
85 Prozent bis 2035 und 100 Prozent bis<br />
2040.<br />
Bisher hatte die Landesregierung das Ziel<br />
formuliert, bis zum Jahr 2020 mindestens<br />
15 Prozent des Strombedarfs mit der Windenergie<br />
zu decken. Das wären gut 20 Milliarden<br />
Kilowattstunden. Der letzte verfügbare<br />
Wert von 2015 lag bei 6,8 Milliarden –<br />
da ist also noch viel Luft nach oben. Bis<br />
2025 sollen mindestens 30 Prozent des<br />
20
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Politik<br />
Strombedarfs mit Erneuerbaren Energien<br />
gedeckt werden, was nochmals ein großer<br />
Sprung wäre.<br />
LEE fordert 40 Prozent<br />
Erneuerbare bis 2030<br />
Gleichwohl reichen selbst diese Ziele nicht,<br />
wenn man den Klimaschutz ernst nimmt.<br />
Der Landesverband Erneuerbare Energien<br />
NRW (LEE) fordert, die Ziele müssten<br />
„zeitlich fortgeschrieben und ehrgeiziger<br />
gefasst werden“. Bis zum Jahr 2030 sollte<br />
NRW, gemessen am heutigen Strombedarf,<br />
einen Anteil Erneuerbarer Energien<br />
von mindestens 40 Prozent erreichen. Für<br />
die Photovoltaik sollte ein Ziel von mindestens<br />
10 Prozent des Strombedarfs in NRW<br />
für das Jahr 2030 formuliert werden, was<br />
angesichts der vorhandenen Potenziale<br />
auf den Dach- und Gewerbeflächen sowie<br />
der erheblichen Kostensenkungen in<br />
den letzten Jahren realistisch sei. Für die<br />
Kohle müsse es „einen klaren zeitlichen<br />
Ausstiegsplan“ geben,<br />
der gesetzlich verankert<br />
werden müsse. Erste<br />
Vorschläge, die ein Ende<br />
der Braunkohletagebaue<br />
bis spätestens zum Jahr<br />
2040 vorsehen, müssten<br />
„weiterentwickelt und<br />
konkretisiert werden“.<br />
Die Transformation des<br />
Energiesystems, bilanziert der LEE, stelle<br />
„zweifelsohne für den Industrie- und Wirtschaftsstandort<br />
NRW große Herausforderungen<br />
dar“, sie eröffne zugleich aber auch<br />
enorme Chancen: „Mit einer konsequenten<br />
Energiewende sind hohe Wertschöpfungspotenziale<br />
und die Schaffung neuer Arbeitsplätze<br />
– besonders im Mittelstand – verbunden.“<br />
In NRW arbeiteten rund 50.000<br />
Beschäftigte im Bereich der regenerativen<br />
Energien – deutlich mehr Menschen, als in<br />
der Kohleindustrie.<br />
Die Tatsache, dass in den vergangenen 20<br />
Jahren die meiste Zeit Rot-Grün in Düsseldorf<br />
regierte, hatte auf den Energiemix im<br />
Land wenig Einfluss. Aus diesem Grund<br />
erwartet auch Hendrik Keitlinghaus, Regionalgruppensprecher<br />
des Fachverbandes<br />
Biogas, keine allzu großen Auswirkungen<br />
der Landtagswahl auf die Energiepolitik in<br />
NRW.<br />
Vor allem für öffentlichkeitswirksame Aktionen<br />
war die Landesregierung in der Vergangenheit<br />
gut. Per Kabinettsbeschluss<br />
vom März 2016 trat Nordrhein-Westfalen<br />
der Allianz der Regionen für einen europaweiten<br />
Atomausstieg bei. „Wir müssen<br />
einen Kontrapunkt gegen die Renaissance<br />
der Atomkraft in der EU setzen“, sagte<br />
der grüne NRW-Umweltminister Johannes<br />
Remmel. „Laufzeitverlängerungen für sicherheitstechnisch<br />
höchst problematische<br />
Reaktoren wie Doel und Tihange in Belgien<br />
sind nicht mehr zeitgemäß. Auch eine<br />
Einspeisevergütung für Atomstrom, wie am<br />
Beispiel Hinkley Point C durchexerziert,<br />
können wir in Europa nicht wollen.“ Dass<br />
nach wie vor die Urananreicherungsanlage<br />
im westfälischen Gronau auch den Brennstoff<br />
für europäische Schrottreaktoren<br />
anreichert, konnten aber auch die Grünen<br />
noch nicht ändern.<br />
Immerhin kleine Schritte gab es bei der<br />
Kohle. Im Sommer 2016 fasste die Landesregierung<br />
eine neue Leitentscheidung<br />
für das rheinische Braunkohlerevier: „Der<br />
Tagebau Garzweiler II wird so verkleinert,<br />
„Wir müssen einen Kontrapunkt<br />
gegen die Renaissance der<br />
Atomkraft in der EU setzen“<br />
Johannes Remmel<br />
dass die Ortschaft Holzweiler, die Siedlung<br />
Dackweiler und der Hauerhof nicht umgesiedelt<br />
werden.“ Es soll also ein bisschen<br />
weniger Braunkohle als bisher geplant abgebaut,<br />
ein bisschen weniger Landschaft<br />
weggefräst werden. Es ist vor allem ein<br />
symbolischer Schritt.<br />
Und den heben die Grünen gerne hervor:<br />
„Erstmals wird nun aufgrund der veränderten<br />
energiepolitischen Grundannahmen in<br />
Deutschland ein Braunkohleplan verkleinert“,<br />
sagte Minister Remmel. Er ist überzeugt<br />
davon, dass „ab den 2020er Jahren<br />
der Bedarf deutlich zurückgeht“. Auch<br />
mit dem Klimaschutzgesetz, dem Klimaschutzplan<br />
oder auch der Neufassung des<br />
Landesentwicklungsplans ging das Land<br />
immerhin kleine Schritte der Energiewende<br />
in NRW. Nun müssten für die Windkraft<br />
die Regionalpläne zeitnah überarbeitet<br />
werden und dabei Vorranggebiete entsprechend<br />
den vorgesehenen Vorgaben des<br />
neuen Landesentwicklungsplans festgesetzt<br />
werden, fordert der LEE.<br />
LEP behindert Biogasanlagen im<br />
Außenbereich<br />
Hinsichtlich der Biomasse beziehungsweise<br />
des Biogases behindere der Landesentwicklungsplan<br />
(LEP) in seiner derzeitigen<br />
Form eine Erweiterung für privilegierte Anlagen<br />
im Außenbereich, moniert der LEE.<br />
Die Landesregierung beziehungsweise die<br />
Bezirksregierungen sollten daher die Gemeinden<br />
bei ihren planerischen Möglichkeiten<br />
unterstützen.<br />
Mit dem Biogas ging es, wie in ganz<br />
Deutschland, auch in NRW zuletzt kaum<br />
voran. Nach den letzten vorliegenden Zahlen<br />
der Landwirtschaftskammer sind in<br />
Nordrhein-Westfalen 623 Biogasanlagen<br />
mit einer installierten elektrischen Gesamtleistung<br />
von 295 Megawatt in Betrieb.<br />
Damit hat die durchschnittliche Biogasanlage<br />
in NRW eine Leistung von gut 470<br />
Kilowatt. Die meisten Anlagen gibt es nach<br />
wie vor im Landkreis Borken.<br />
Die Aufteilung der Leistungsklassen hat<br />
sich laut der Auswertung der Betreiberdatenbank<br />
im Jahr 2015 nur geringfügig<br />
geändert. Die Anlagen zwischen 151 und<br />
500 Kilowatt (elektrisch) bilden nach wie<br />
vor die größte Klasse (61 Prozent). Es hat<br />
sich zuletzt eine leichte Verschiebung zugunsten<br />
höherer Leistungsklassen ergeben,<br />
was sich hauptsächlich durch die Flexibilisierungsprämie<br />
erklären lässt.<br />
Wie aber geht es nun weiter, nach der Wahl<br />
in NRW? Die Wahlprognosen machen viele<br />
Optionen möglich, denn sechs Parteien<br />
haben die Chance, in den Landtag einzuziehen.<br />
Bei Fünfen davon ist der Einzug<br />
nach den aktuellen Prognosen so gut wie<br />
sicher, lediglich die Linken müssen mit<br />
Prognosen um die 5 Prozent noch bangen.<br />
Wahrscheinlich wird eine Koalition mit zwei<br />
Partnern (von einer Großen Koalition einmal<br />
abgesehen) am Ende rechnerisch gar<br />
nicht möglich sein. Es werden sich also<br />
vermutlich drei Partner zusammenfinden<br />
müssen. Das Regieren dürfte damit nicht<br />
einfacher werden.<br />
Autor<br />
Bernward Janzing<br />
Freier Journalist<br />
Wilhelmstr. 24a<br />
79098 Freiburg<br />
Tel. 07 61/202 23 53<br />
E-Mail: bernward.janzing@t-online.de<br />
21
Politik<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Schleswig-Holstein: Beim Strom<br />
zu 115 Prozent erneuerbar<br />
Foto: fotolia_Kara<br />
Das Atomkraftwerk<br />
Brokdorf an der Elbe<br />
in Schleswig-Holstein<br />
hat hat 2015 noch<br />
11,2 Terawattstunden<br />
Strom produziert und<br />
damit die Netze für<br />
Erneuerbare Energien<br />
verstopft. 2021 ist<br />
damit jedoch Schluss.<br />
Dann wird das AKW<br />
abgeschaltet.<br />
Immer wieder muss Windkraft abgeregelt<br />
werden, weil Strom aus Atom und Kohle die<br />
Leitungen verstopft.<br />
Von Bernward Janzing<br />
Die Energiepolitik von Schleswig-Holstein<br />
kennt vor allem ein Thema: Die Abregelung<br />
von Windkraftanlagen aufgrund von Netzengpässen.<br />
Fast 3.000 Gigawattstunden<br />
(3 Milliarden Kilowattstunden) Strom aus<br />
Erneuerbaren Energien wurden im Jahr 2015 abgeregelt,<br />
im Jahr zuvor lag die Menge erst bei knapp 1.100<br />
Gigawattstunden. Für 2016 sind noch keine Zahlen<br />
bekannt, doch es ist mit einem weiteren Anstieg zu<br />
rechnen.<br />
Ab <strong>2017</strong> dürfte es zumindest vorübergehend eine Entspannung<br />
geben, weil der Netzausbau voranschreitet.<br />
Mit acht Planfeststellungsbeschlüssen in den letzten<br />
knapp fünf Jahren sei das Baurecht für 283 Leitungskilometer<br />
geschaffen worden, ist aus dem Ministerium<br />
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und<br />
ländliche Räume zu hören. Und das sei gut die Hälfte<br />
dessen, was in den nächsten Jahrzehnten an Höchstspannungsleitungen<br />
in Schleswig-Holstein neu gebaut<br />
werden müsse. „Damit sind wir im Bundesvergleich<br />
weit vorn“, sagt Minister Robert Habeck.<br />
Schließlich hat Schleswig-Holstein auch mit einer Herausforderung<br />
zu kämpfen, die andere Länder, wenn<br />
überhaupt, erst später treffen wird: mit Stromüberschuss.<br />
Denn das Land erzeugt bereits mehr Strom aus<br />
Erneuerbaren Energien, als es selbst benötigt: Einem<br />
landesweiten Verbrauch von 15,7 Terawattstunden<br />
(15,7 Milliarden Kilowattstunden) steht eine Erzeugung<br />
aus Erneuerbaren von 17,9 Terawattstunden gegenüber<br />
(Zahlen von 2015). Die größten Anteile haben<br />
der Wind (13,7 Terawattstunden), das Biogas (2,6) und<br />
die Photovoltaik (1,3). Gemessen am Verbrauch ergibt<br />
sich eine Erneuerbaren-Quote von 115 Prozent.<br />
Reaktor Brokdorf produziert, während<br />
Erneuerbare abgedreht werden<br />
Doch es sind bei weitem nicht alleine die Erneuerbaren,<br />
die für die enge Netzsituation verantwortlich sind. Oft<br />
sind die Leitungen durch die nicht-erneuerbare Erzeugung<br />
verstopft. So wurden alleine 11,2 Terawattstunden<br />
im Jahr 2015 aus Atomkraft erzeugt (Reaktor Brokdorf) –<br />
selbst zu Zeiten, in denen Windstrom im Überfluss vorhanden<br />
war. Wenn das Kraftwerk Ende 2021 stillgelegt<br />
wird, dürfte sich damit auch die Netzbelastung im hohen<br />
Norden entspannen. Immerhin fällt dann ein Drittel<br />
der landesweiten Erzeugung weg.<br />
Neben dem Atomstrom wurden im Land außerdem noch<br />
4,3 Terawattstunden aus fossilen Energien erzeugt. Insgesamt<br />
erzeugte Schleswig-Holstein nach Zahlen des<br />
Statistikamtes Nord im Jahr 2015 rund 33,7 Terawattstunden<br />
Strom – mehr als das Doppelte des landesweiten<br />
Verbrauchs.<br />
Die Erneuerbaren haben im nördlichsten Bundesland<br />
längst viele Arbeitsplätze geschaffen. Nach Zahlen<br />
der Staatskanzlei waren im Land im Jahr 2015 rund<br />
18.400 Beschäftigte im Bereich der Erneuerbaren<br />
Energien tätig, davon 12.200 in der Windkraft –<br />
Onshore und Offshore zusammengenommen. 5.100<br />
Arbeitsplätze gab es im Sektor der Biomasse, 700 in<br />
der Photovoltaik, die verbleibenden 400 entfallen auf<br />
die Solar- und Geothermie.<br />
22
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Politik<br />
Recht. Engagiert. MASLATON.<br />
Auch aus Steinen,<br />
die einem in den<br />
Weg gelegt werden,<br />
kann man etwas<br />
Schönes bauen.<br />
nach Erich Kästner<br />
Dr. Christoph Richter<br />
AGROTEL GmbH • 94152 NEUHAUS/INN • Hartham 9<br />
Tel.: + 49 (0) 8503 / 914 99- 0 • Fax: -33 • info@agrotel.eu<br />
Passende Rührtechnik für jedes Substrat<br />
Schubbodensanierung<br />
in verstärkter<br />
Edelstahl-Lösung<br />
– Alle Rührwerkstypen<br />
– Über 25 Jahre Erfahrung<br />
– Optimierung, Nachrüstung, Tausch<br />
Mobile Werkstatt Hagemeier e.K.<br />
Am Wasserfeld 8 • 27389 Fintel<br />
Tel.: 04265 / 13 65<br />
Fax: 04265 / 83 94<br />
E-Mail: info@axel-hagemeier.de<br />
Web: www.axel-hagemeier.de<br />
Tel. +49.7522.707.965.0 www.streisal.de<br />
Bautenschutztechnik<br />
mit getrennter Hydrolyse…<br />
...der Turbo für jede Biogasanlage<br />
Silo- und Gasanlagen<br />
mit Ökopox-Lackierung<br />
säure- / chemikalienbeständig<br />
T e l . : 0 8 2 3 7 / 9 6 0 2 0<br />
www.polysafe.de<br />
Mehr Leistung durch zweistufige Vergärung.<br />
Ertüchtigung und Optimierung bestehender<br />
Biogasanlagen.<br />
Nachrüstung der Hydrolyse bei NAWARO<br />
Biogasanlagen.<br />
Wir garantieren die herstellerunabhängige<br />
Beratung und Planung.<br />
INNOVAS Innovative Energie- & Umwelttechnik<br />
Anselm Gleixner und Stefan Reitberger GbR<br />
Margot-Kalinke-Str. 9 80939 München<br />
Tel.: 089 16 78 39 73 Fax: 089 16 78 39 75<br />
info@innovas.com www.innovas.com<br />
23
Politik<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Nord-SPD will atomar-fossiles<br />
Energiezeitalter schnell beenden<br />
Entsprechend positiv bewerten die meisten<br />
Parteien die Erneuerbaren. Die SPD etwa,<br />
die in NRW (siehe Seite 20) noch vehement<br />
für die Kohle eintritt, positioniert sich in<br />
Schleswig-Holstein dagegen: „Wir wollen<br />
das atomar-fossile Energiezeitalter schnell<br />
beenden“, heißt es im Wahlprogramm zur<br />
Landtagswahl. Und weiter: „Umwelt-, Ressourcen-<br />
und Klimaschutz verlangen von<br />
uns auch einen Ausstieg aus der Kohleenergienutzung.“<br />
Die Grünen gehen noch<br />
detaillierter auf das Thema Energiepolitik<br />
ein: „Wir wollen das Ende der Öl- und Kohleheizung,<br />
ihr verbreiteter Einsatz ist mit<br />
den Klimaschutzzielen nicht vereinbar.“<br />
Bei Neubauten ab 2020 und bei Heizungstausch<br />
ab 2025 sollten „erneuerbare Alternativen<br />
gewählt und weitgehend durchgesetzt<br />
werden“.<br />
Bundesweit wollen die Grünen „einen verbindlichen<br />
Pfad für den zügigen Ausstieg<br />
aus der Kohle bis 2025 festlegen“ und<br />
dafür sorgen, dass „besonders dreckige<br />
Altmeiler schnellstmöglich vom Netz“ gehen.<br />
Neuere Kraftwerke sollen „Schritt für<br />
Schritt abgeschaltet“ werden. Und während<br />
in manchen Teilen Deutschlands der Netzausbau<br />
auch von Umweltverbänden kritisch<br />
gesehen wird, propagieren die Grünen diesen<br />
in Schleswig-Holstein offensiv: „Wir<br />
werden weiter Verantwortung übernehmen<br />
für einen zügigen und transparenten Netzausbau<br />
mit optimaler Planung für Mensch<br />
und Natur.“<br />
Zugleich lehnen die Grünen das Fracking<br />
und die Endlagerung von CO 2<br />
durch Verpressung<br />
in unterirdische Lagerstätten<br />
„weiterhin entschieden und gemeinsam mit<br />
vielen engagierten Menschen vor Ort“ ab.<br />
Und sie positionieren sich auch zur internationalen<br />
Atompolitik: „Wir machen uns<br />
dafür stark, dass die Bundesregierung eine<br />
Ablösung des Euratom-Vertrags erficht.“<br />
Über diesen Kontrakt nämlich fließen nach<br />
wie vor gigantische Subventionen in die<br />
Atomindustrie.<br />
Christdemokraten fordern<br />
mehr Verantwortung von den<br />
Erneuerbaren<br />
Die CDU unterdessen betont, dass die „erneuerbaren<br />
Energien Schritt für Schritt<br />
mehr Verantwortung für die Versorgungssicherheit<br />
und für das Gesamtsystem übernehmen“<br />
müssten. Damit das gelinge,<br />
müssten „erneuerbare Energien wie ein<br />
Kraftwerk funktionieren und die vielen dezentralen<br />
Anlagen mit modernen IT-Lösungen<br />
zusammengeschaltet werden“. Was nebenbei<br />
gesagt, längst in wachsendem Maße<br />
geschieht.<br />
Auch will die CDU „gemeinsam mit allen<br />
Beteiligten den Netzausbau im Land weiter<br />
voranbringen“. Zur Kohlepolitik äußert sich<br />
das Programm unterdessen nicht, abgesehen<br />
vom allgemeinen Satz, man habe das<br />
Ziel, „nach Möglichkeit bis zum Jahr 2050<br />
ohne die fossilen Energieträger Kohle, Öl<br />
und Gas auszukommen“. Die Christdemokraten<br />
wollen außerdem „die Potenziale<br />
der Biomasse für den flexiblen Einsatz und<br />
für die Nahwärmeversorgung stärken“,<br />
während sie zugleich bei der Windkraft auf<br />
die Bremse treten wollen: „Wir werden zu<br />
Wohnsiedlungen höhere Abstände bei höheren<br />
Windkraftanlagen vorsehen“; die<br />
Rede ist von „bis zu 1.200 Metern bei geschlossenen<br />
Siedlungen“.<br />
Die größte Distanz zu den Erneuerbaren unter<br />
den bisher im Kieler Landtag vertretenen<br />
Parteien lässt die FDP erkennen. An Stelle<br />
eines „symbolischen Landes-Klimaschutzgesetzes<br />
mit willkürlichen Ausbauzielen“<br />
bedürfe es „einer Debatte über wirkliche<br />
CO 2<br />
-Einsparpotenziale“, betonen die Liberalen.<br />
Die größten Anstrengungen müssten<br />
zunächst Forschung und Entwicklung von<br />
Speicherlösungen gelten sowie dem Netzausbau,<br />
bevor der Ausbau von Erzeugungseinheiten<br />
weiter politisch forciert werde.<br />
Und bei der Windkraft entdeckt die FDP<br />
dann sogar noch die Themen Landschaftsschutz<br />
und Artenschutz, die bei der Partei<br />
an anderen Stellen keine Rolle spielen.<br />
AfD ist Energiewende ein<br />
Dorn im Auge<br />
Während die Linke zum Thema Energie in<br />
ihrem Wahlprogramm recht wortkarg bleibt,<br />
sich im Wesentlichen auf die Forderung<br />
nach einer „dezentralen Organisation der<br />
Energieversorgung“ beschränkt und zur<br />
Kohle gar kein Wort verliert, ist der AfD die<br />
gesamte „kopflose“ Energiewende ein Dorn<br />
im Auge. Die Energiepolitik, die sich bislang<br />
durch Versorgungssicherheit, Netzstabilität<br />
und Bezahlbarkeit ausgezeichnet habe,<br />
werde damit „auf eine ideologisch gewollte<br />
Schaukelversorgung umgestellt“. Das EEG<br />
sei, „weil nicht reformierbar, ersatzlos zu<br />
streichen“. Auch die Energieeinsparverordnung<br />
im Gebäudesektor sei „ersatzlos aufzuheben“<br />
und eine Laufzeitverlängerung<br />
für die Atomkraftwerke zu beschließen.<br />
Die Landesarbeitsgemeinschaft Erneuerbare<br />
Energien in Schleswig-Holstein hat nun<br />
Wahlprüfsteine zum Thema Energiewende<br />
erstellt für all jene Parteien, die aktuell im<br />
Landtag sind und Chancen haben, wieder<br />
einzuziehen. Während die SPD fordert, das<br />
Ausbauziel für Erneuerbare im Strombereich<br />
von 40 bis 45 Prozent im Jahr 2025<br />
bundesweit auf mindestens 50 Prozent anzuheben,<br />
ist bei der CDU das Motto: „Nicht<br />
so viel oder so schnell wie es geht“.<br />
Und jede Partei hat ihre spezifischen Vorschläge<br />
im Zusammenhang mit der Energiewende.<br />
Die Grünen stellen als einen<br />
wichtigen Punkt heraus, dass die Biomasseverstromung<br />
„von Grundlast auf flexible,<br />
stromnetzgeführte Leistung umgebaut<br />
werden“ sollte. Beim Thema Netzengpässe<br />
will die FDP das Verbandsklagerecht bei<br />
bestimmten Planfeststellungsverfahren begrenzen,<br />
und bei Erneuerbaren denken die<br />
Liberalen vor allem an eine Ansiedlungsstrategie<br />
für Firmen. Die SPD setzt sich für<br />
eine angemessene CO 2<br />
-Bepreisung ein, um<br />
damit die Erneuerbaren Energien wettbewerbsfähig<br />
zu machen, und der SSW propagiert<br />
bundeseinheitliche Netzentgelte.<br />
Silke Weyberg, Regionalreferentin Nord<br />
des Fachverbandes Biogas zeigt sich optimistisch:<br />
„Die Parteien stehen unisono<br />
dazu, dass man das Biogas braucht, um<br />
die Energiewende zu gestalten“ – eben<br />
als Ausgleich der fluktuierenden Erzeuger.<br />
Aber bei der Anbaubiomasse gebe es Einschränkungen.<br />
Laut den aktuellen Umfragen<br />
ist es möglich, dass die rot-grüne Koalition<br />
weiterhin regieren kann. Sollte auch<br />
die Linke in den Landtag kommen, die in<br />
den jüngsten Umfragen zwischen 4 und 5<br />
Prozent steht, könnte es für Rot-Grün aber<br />
eng werden. Denn dann wären vermutlich<br />
sieben Parteien im Parlament vertreten, darunter<br />
auch der Südschleswigsche Wählerverband<br />
(SSW), der als Partei der dänischen<br />
Minderheit von der Fünf-Prozent-Klausel<br />
befreit ist und in den Umfragen bei etwa 3<br />
Prozent steht.<br />
Autor<br />
Bernward Janzing<br />
Freier Journalist<br />
Wilhelmstr. 24a<br />
79098 Freiburg<br />
Tel. 07 61/202 23 53<br />
E-Mail: bernward.janzing@t-online.de<br />
24
Sonic Cut Thru Heavy<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Politik<br />
P<br />
HAN T<br />
O M<br />
Das Rührwerk<br />
Sie ziehen ihre Kreise.<br />
Effizient. Zuverlässig. Legendär.<br />
Heavy-Duty Rührwerke<br />
PTM GmbH ۰ D-87719 Mindelheim<br />
+49 82 61 ⃒ 738 182<br />
info@propeller-technik-maier.de<br />
www.propeller-technik-maier.de<br />
Motiv2015_85x118 15.06.2015 16:25 Seite 1<br />
Der STORM-Service<br />
für Ihre Biogas-Anlage<br />
- Störungsbehebung<br />
- Instandsetzung<br />
- Wartung/Inspektion<br />
- Ersatzteilversorgung<br />
August Storm GmbH & Co. KG<br />
August-Storm-Straße 6 · 48480 Spelle<br />
Fon: +49 5977 73-0<br />
Fax: +49 5977 73-138<br />
Email: info@a-storm.com<br />
Spelle · Duisburg · Berlin · Leipzig · Mannheim · Speyer · Hannover<br />
Delmenhorst · Hamburg · Kiel · Achenkirch (A) · Geldermalsen (NL)<br />
Für die Revision nach BetrSichV §15(15)<br />
Austauschgeräte und Ersatzbaugruppen vom Original-Hersteller<br />
› passgenau<br />
› sicher, da ATEX-konform<br />
› wirtschaftlich durch kurze Stillstandszeit<br />
› mit voller Garantie<br />
› kurze Lieferzeit<br />
ATEX Ventilatoren<br />
für Biogas Zone 1 und 2<br />
(Kat.II 2G und II 3G)<br />
Anfragen bitte stets mit Ihrer Gerätenummer. Bezug und<br />
Installation in Deutschland über unsere Servicepartner möglich.<br />
MEIDINGER AG<br />
Landstrasse 71 4303 Kaiseraugst / Schweiz<br />
Tel. +41 61 487 44 11 service@meidinger.ch www.meidinger.ch<br />
EPDM - Gasspeichermembranen<br />
für Biogasanlagen<br />
NOVOPROOF ® DA-P<br />
Werkseitig vorkonfektionierte Planen aus EPDM-Kautschuk für Biogasanlagen<br />
Gesamtdicke: nacktes Material 1,5 mm / 2,0 mm vollbeschichtet 1,4 mm<br />
Formate: Planen bis 900 m²<br />
Farbe: Schwarz (Grau auf Anfrage in 1,5 mm)<br />
hochwertig &<br />
bewährtes Produkt<br />
Einsatzgebiete:<br />
Einlagige Gasspeicherfolien für die Abdeckung von Fermenter, Nachgärer, Gärproduktelager, Gärrestelager.<br />
Robuste Planen für die Erdbeckenauskleidung und den bautechnischen Gewässerschutz z.B. für Sicker-,<br />
Schmutz- und Brauchwasserbecken, Löschwasser- und Regenrückhaltebecken.<br />
Serviceleistung deutschlandweit: Fachgerechte Reparatur durch homogene Schweißtechnik<br />
ESTNordhausen<br />
www.est-nordhausen.de<br />
25
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Bioenergiedorf Ascha<br />
Der lange Weg zur Autarkie<br />
„Bürgermeister Wolfgang Zirngibl (CSU) hat Pionierarbeit in seiner Gemeinde Ascha<br />
geleistet: Die Kommune ist weitgehend energieautark.“ So lobte die regionale Passauer<br />
Neue Presse die Gemeinde anlässlich der Auszeichnung während der Grünen Woche <strong>2017</strong><br />
in Berlin als Bioenergie-Kommune 2016. Doch was passiert dort tatsächlich? Wir haben<br />
uns in der niederbayerischen 1.600-Einwohner-Gemeinde umgesehen.<br />
Von Dipl.-Ing. Heinz Wraneschitz<br />
Dass Ascha irgendwann als Bioenergie-<br />
Kommune ausgezeichnet werden würde,<br />
ist eigentlich nur logisch und konsequent:<br />
Von der „Umweltbewussten Gemeinde“<br />
im Jahre 2000 über den „CO2NTRA-<br />
Klimaschutzpreis 2009“, der Auszeichnung mit dem<br />
„Gold“-Label des european energy award im Jahre<br />
2010 und der Einordnung in den TOP 3 des Deutschen<br />
Nachhaltigkeitspreises 2016 soll der Weg des Dorfes irgendwann<br />
in die echte Energieunabhängigkeit führen.<br />
Mehr Strom, als dort selbst verbraucht wird, und einen<br />
Großteil der Wärme erzeugen die „Aschinger“, wie sie<br />
sich selbst nennen, bereits heute. Bioenergie ist dabei<br />
zwar nur ein Baustein, aber ein wesentlicher.<br />
Ascha zählt deshalb auch schon seit Jahren als offizielles<br />
„Bioenergiedorf“ und nimmt für sich die „Besonderheit:<br />
Heizölfreie Gemeinde“ in Anspruch. Schon<br />
2013 hat das Institut für Angewandtes Stoffmanagement<br />
IfaS errechnet: „88 Prozent des gesamten Energieverbrauchs<br />
stammen aus NawaRo“, wobei damit sicherlich<br />
der Wärmekonsum gemeint ist. Aber 100.000<br />
Liter gespartes Heizöl jährlich – das hörte sich schon<br />
damals sehr beachtlich an.<br />
Eindrucksvoll anzuschauen sind die Solarmodule mit<br />
876 kW installierter Leistung , die ein einziger Investor<br />
für 4,2 Millionen (Mio.) Euro auf 285 Nachführständern<br />
direkt vor dem Ortseingang hat montieren lassen.<br />
Die produzieren – wie so viele Photovoltaikanlagen auf<br />
Regionale<br />
Wertschöpfung<br />
aus Erneuerbaren<br />
26
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
praxis / Titel<br />
den Häusern im Dorf – bestimmt mehr Strom, als die<br />
Bürger und Firmen im Ort übers Jahr verbrauchen: Hier<br />
ist die theoretische Eigenversorgung also schon lange<br />
erreicht.<br />
Doch Bürgermeister Wolfgang Zirngibl wollte von Anfang<br />
an mehr: echte Nachhaltigkeit nämlich. Oder wie<br />
er es lachend und ernst zugleich formuliert: „die Erde<br />
retten.“ Damit haben die „Aschinger“ 1989 angefangen.<br />
Der Grund: „Der Zweckverband Abfallwirtschaft<br />
Straubing wollte hier die größte Deponie des Landes<br />
bauen, wollte also die Natur zerstören. Wir haben daraufhin<br />
alternative Lösungen gesucht und beispielsweise<br />
den ersten Wertstoffhof im Landkreis errichtet.“ Der<br />
übrigens bis heute gut funktioniert, trotz der Anfangszweifel<br />
des damaligen Landrats.<br />
1990 wurde Zirngibl zum ehrenamtlichen Bürgermeister<br />
der Gemeinde Ascha gewählt. Und danach kamen<br />
die Arbeitskreise, bei denen bis heute „immer noch<br />
die gleichen Bürger engagiert“ sind, wie er verrät. In<br />
der Euphorie jener Zeit wurden auch Fehler gemacht,<br />
die aber korrigiert wurden. Zirngibl gibt ein Beispiel:<br />
„Das erste Bioheizwerk in Bayern war mit 1,5 Megawatt<br />
völlig überdimensioniert.“ Dennoch sei es der richtige<br />
Schritt gewesen: Die Wärme verursache den größten<br />
Verbrauch, den wollten die Bürger möglichst regional<br />
decken. Weg vom Öl, hin zum Holz. Denn davon wächst<br />
im Bayerischen Wald immer noch wesentlich mehr<br />
nach, als geerntet wird.<br />
Mit einst 25 Landwirten wurden damals „lose Vereinbarungen<br />
zur Holzlieferung getroffen. Bis heute machen<br />
noch sieben von ihnen mit. Und die Gemeinde ist auch<br />
dabei“ bei der Nahwärmeversorgungsgesellschaft mit<br />
inzwischen 100 Kunden. Dass die Zahl der Holzlieferanten<br />
abnahm, liegt auch am Strukturwandel, so der<br />
Bürgermeister: „Früher hatten wir 88 Landwirte am<br />
Ort, heute sind es nur noch 17.“<br />
Maximal 200 Anschließer würde die 2011 komplett sanierte<br />
Wärmebereitstellung versorgen können, erläutert<br />
der Bürgermeister. Und die baut heute eben nicht mehr<br />
nur auf das Verbrennen von Hackschnitzeln: Mit dem<br />
Holzheizwerk wird nun vor allem im Winter geheizt. Den<br />
Bedarf deckt ein Kessel mit 650 kW. Zusätzlich gibt es<br />
im Ort noch zwei Blockheizkraftwerke. Das eine hängt<br />
am Netz der Nahwärme Ascha GmbH. Es wird mit Holzgas<br />
aus Holzpellets betrieben, das daraus Wärme und<br />
Strom generiert. Die Anlage des Oberpfälzer Herstellers<br />
Burkhardt liefert 180 kW Elektrizität als Grundlast und<br />
deckt den Sommerbedarf an Wärme im Dorfnetz. Eine<br />
eigentlich gewünschte, serienmäßig produzierte Holzvergasung<br />
für Hackschnitzel habe man damals leider<br />
nicht am Markt gefunden, erklärt der Bürgermeister.<br />
Beim Betreiber S.W.A.G. Strom-Wärme-Ascha-GmbH<br />
hat man sich eine Eon-Tochter mit ins Boot geholt.<br />
Denn Gemeindewerke gibt es nicht in Ascha.<br />
Parallel dazu läuft eine bäuerliche Biogasanlage: Sie<br />
verfügt über 250 kW installierte elektrische Leistung.<br />
Panoramablick über<br />
die Gemeinde Ascha,<br />
Bioenergiekommune<br />
2016.<br />
„Die Erde retten“<br />
Wolfgang Zirngibl<br />
27
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Ascha-Altort: Gemeindehaus<br />
und Kirche.<br />
250-kW-Biogasanlage,<br />
die ein paar Häuser<br />
direkt mit Wärme<br />
versorgt.<br />
Sie liefert neben Strom auch Wärme für einige direkt<br />
versorgte Häuser. Bei deren Genehmigung gab es Probleme;<br />
Bürgermeister Zirngibl erinnert sich an die aus<br />
seiner Sicht „dunkelste Zeit in Ascha 2011. Eine Bürgerinitiative<br />
war dagegen: Von 1.200 Wahlberechtigten<br />
hatten 500 unterschrieben. Aber wenn man überzeugt<br />
ist, muss man den Weg weitergehen.“ Letztlich war die<br />
Mehrheit im Gemeinderat dafür, wenn auch „Spitz auf<br />
Knopf“. Für Zirngibl „zeigt das wieder: Jeder ist für<br />
die Energiewende, aber nicht bei mir vor der Haustür.<br />
Heute aber kommen Leute zu mir, die damals dagegen<br />
unterschrieben haben, und sagen: Das war ein Fehler<br />
gewesen.“<br />
Für die Koordination der vielfältigen Aufgaben auf dem<br />
Weg zur nachhaltigen und energieautarken Gemeinde<br />
wurde 1998 das Zukunftsforum Ascha (ZFA) gegründet.<br />
Mit dem ZFA wurde „eine Organisationsstruktur<br />
zur Steuerung und Koordination der Dorferneuerung<br />
und Agenda 21“ aufgebaut. Wolfgang Zirngibl, im<br />
Hauptberuf Bauleiter beim Staatlichen Bauamt, jedenfalls<br />
sieht die Gemeinde bis heute in der Pflicht,<br />
Vorreiter zu spielen. So sei man gerade dabei, das Rathaus<br />
komplett stromautark zu machen: Die Suche nach<br />
der passenden Speichertechnik laufe schon. „Wir probieren<br />
es aus und zeigen, dass es funktioniert.“ In der<br />
Hoffnung auf Nachahmer in der Bürgerschaft.<br />
„Wir nehmen die Bürger mit“, ist ein Lieblingssatz des<br />
Bürgermeisters – doch der ist ernst gemeint. „Ist das<br />
wirtschaftlich? Diese Frage stellen wir nicht, sondern<br />
wir machen.“ Zum Beispiel einen Stromsparwettbewerb<br />
in der Gemeinde, mit Zuschüssen für Heizungspumpen<br />
oder Elektroroller. 70.000 Euro für Projekte<br />
Fotos: Heinz Wraneschitz<br />
ist der Haushaltsposten dafür im Jahr. „Wenn man eine<br />
Straße baut, braucht man auch 300.000 Euro. Da ist<br />
das Geld doch stattdessen hier besser angelegt“, sagt<br />
er mit Überzeugung.<br />
Dass alle bestehenden Straßenlaternen auf LED umgestellt<br />
sind – keine Frage in Ascha. Und wenn ein neuer<br />
Mast aufgestellt werden muss, dann ist es einer mit<br />
Solarleuchte. 50 stehen bereits. „Am Anfang waren die<br />
Bürger irritiert, weil kein Kabel mehr reinkam“, jetzt<br />
hat man sich dran gewöhnt im niederbayerischen Dorf.<br />
Doch scheint es für Bürgermeister Zirngibl ein größeres<br />
Problem gewesen zu sein, diese Technik auch im Rahmen<br />
der Dorferneuerung öffentlich gefördert zu bekommen:<br />
Da habe er viel Überzeugungsarbeit bei Behörden<br />
leisten müssen.<br />
So wie er sich über „die Halbwertszeit des EEG“, des<br />
Erneuerbare-Energien-Gesetzes, ziemlich aufregen<br />
kann. „Wegen der ständigen Veränderungen im EEG<br />
bin ich gerade wieder gefordert“, sagt er im Zusammenhang<br />
mit Solarstromspeicherung und Mieterstrom,<br />
Hölzernes Wasserrad am<br />
ehemaligen Mühlenbach. Das<br />
Wasserrad hat ein örtlicher<br />
Handwerker gebaut. Der Strom,<br />
den das Wasserrad liefert, durfte<br />
nicht verschenkt werden.<br />
28
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
praxis / Titel<br />
aber auch bei Bioenergie. „Das kann man den Bürgern<br />
gar nicht mehr klarmachen“, sagt er traurig. Und dann<br />
nennt der Ortschef das Beispiel eines hölzernen Mühlrads:<br />
Das hat die Gemeinde in den Wasserlauf eines<br />
ehemaligen Mühlbachs gebaut. Doch den Strom einfach<br />
verschenken, das ging nicht. Jahrelang dauerte<br />
deshalb die Genehmigung.<br />
Weil die Leute mitgenommen wurden, konnte Zirngibl<br />
auch eine Veränderung in deren Wahrnehmung feststellen.<br />
„Als wir anfingen, die Nahwärme zu planen,<br />
kamen Gegenargumente bis hin zu dem, das Holz könne<br />
ja ausgehen. Später konnten wir problemlos eine<br />
Ökosiedlung ausweisen, die gut angenommen wurde.“<br />
Zuletzt wurde eine Energiesiedlung mit Nahwärmeanschluss<br />
gebaut – trotz des heute äußerst geringen Energieverbrauchs<br />
der Gebäude, die noch in den 1980er<br />
Jahren „Energiefresser waren. Die Zeit hat sich brutal<br />
gewandelt“, resümiert der Bürgermeister. „Wenn wir<br />
heute Baugebiete ausweisen, legen wir zuerst ein Energiepaket<br />
drüber.“<br />
Holzheizwerk und rechts daneben im Container<br />
befindet sich das Holzgas-BHKW. Es wird mit<br />
Holzgas aus Holzpellets betrieben, das daraus<br />
Wärme und Strom generiert. Die Anlage des<br />
Oberpfälzer Herstellers Burkhardt liefert 180<br />
kW Elektrizität als Grundlast und deckt den<br />
Sommerbedarf an Wärme im Dorfnetz.<br />
Das sieht jeder, der durch die Neubau-Siedlungen<br />
läuft: Da liegen Solarkollektoren und Photovoltaikmodule<br />
auf den Dächern. Und selbst bei älteren Gebäuden,<br />
die nicht an das Wärmenetz angeschlossen werden<br />
können, „baut der Besitzer auf keinen Fall mehr<br />
einen Ölbrenner ein, wenn er die Heizung saniert“, ist<br />
Zirngibl sicher.<br />
Besucher aus aller Welt informieren<br />
sich in Ascha<br />
Selbst internationale Besucher wie Kazuya Kitamura,<br />
Leiter des Japan Renewable Energy Research Institute,<br />
„Wenn man<br />
überzeugt ist,<br />
muss man<br />
den Weg<br />
weitergehen“<br />
Wolfgang Zirngibl<br />
sind begeistert, wenn sie das Bioenergiedorf Ascha besuchen:<br />
Er war 2011 mit einer „Besichtigungsgruppe<br />
aus Ingenieuren und anderen Fachleuten von großen japanischen<br />
Firmen“ dort, ist auf Deutschland.de nachzulesen.<br />
Ob Kitamura vielleicht wie der Reporter mit<br />
dem Elektroauto auf die umliegenden Hügel gefahren<br />
wurde und sich den Ort von oben betrachten konnte?<br />
Wer weiß. Jedenfalls glänzt es von vielen Dächern, und<br />
nur aus den wenigen Abgasanlagen der Biokraftwerke<br />
steigt der Dampf in den niederbayerischen Himmel.<br />
Das Lob der Besucher, ob aus Chile, Norwegen, Polen,<br />
Japan oder Franken scheint dem Bürgermeister als<br />
heimlicher Lohn zu reichen, „denn uns geht es eigentlich<br />
um die Umwelt. Dafür nimmt man viel in Kauf.“<br />
„Wir, also die Gemeinde, haben dabei noch nie Gewinn<br />
gemacht“, beteuert er jedenfalls. Aber ansonsten<br />
bleibe ja oft die gesamte Wertschöpfung im Ort. Ob<br />
die Lieferanten von Hackschnitzeln, die Betreiber von<br />
Photovoltaikanlagen, der Bauer mit Biogasanlage, die<br />
Bauhandwerker, nicht zuletzt die Bürger mit günstigen<br />
Wärmeverträgen: Viele profitierten davon. Statt Geld für<br />
Öl auszugeben, bleiben auch die Energieausgaben im<br />
Dorf; „1 Million Euro bleibt da schon übrig“, hat Wolfgang<br />
Zirngibl ausgerechnet bei 9 Mio. kWh Stromerzeugung<br />
und 2,5 Mio. kWh Wärmeverbrauch. Und sogar<br />
das Wasserrad habe ein örtlicher Schreiner gezimmert.<br />
Am Schluss sagt er noch einen Satz, der hängenbleibt:<br />
„Nachhaltigkeit, das ist nicht einfach ein Kuchen, den<br />
man schnell mal backt. Nein, das ist ein langer Weg,<br />
und man muss ihn immer wieder hinterfragen.“<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. Heinz Wraneschitz<br />
Freier Journalist<br />
Feld-am-See-Ring 15a<br />
91452 Wilhermsdorf<br />
Tel. 0 91 02/31 81 62<br />
E-Mail: heinz.wraneschitz@t-online.de<br />
www.bildtext.de und www.wran.de<br />
Bürgermeister Wolfgang<br />
Zirngibl vor den<br />
zahlreichen Urkunden,<br />
die Asche für sein Energiewende-Engagement<br />
bekommen hat. Unten<br />
links an der Wand<br />
die Auszeichnung als<br />
Bioenergiekommune<br />
2016.<br />
29
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Willebadessen: Musterbeispiel<br />
für Strom- und Wärmewende<br />
Regionale<br />
Wertschöpfung<br />
aus Erneuerbaren<br />
Fotos: Martin Bensmann<br />
Eine Kommune in Ostwestfalen hat den fossilen CO 2<br />
-Emissionen den Kampf angesagt.<br />
Politische Unterstützung und Bürgerwille schaffen die Energiewende mit lokaler Wertschöpfung.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Urwüchsige Bergwälder, steile Felsklippen,<br />
Naturquellen, kleine mäandrierende<br />
Bäche und Flüsse, die sich durch grüne<br />
Talauen schlängeln, prägen die Erholungslandschaft<br />
des staatlich anerkannten Luftkurortes<br />
Willebadessen im Kreis Höxter – so wirbt die<br />
Stadt selbst. Westlich grenzt der Naturpark Teutoburger<br />
Wald/Eggegebirge und östlich das Weserbergland<br />
den schönen Naturraum ab. 13 Ortsteile gehören zum<br />
Stadtgebiet, in dem rund 8.300 Menschen leben.<br />
„Der Biomassehof ist der Hauptinitiator<br />
der Wertschöpfungskette Restholz“<br />
Norbert Hofnagel<br />
Und genau die Menschen sind es, die die Region zu etwas<br />
Besonderem machen. Sie sind bodenständig, aber<br />
nicht rückständig. Sie sind mutig und gestalten so ihre<br />
Zukunft. Das wird in der Kommune Willebadessen, die<br />
im Januar dieses Jahres von Bundeslandwirtschaftsminister<br />
Christian Schmidt – neben zwei weiteren Preisträgern<br />
– zur Bioenergiekommune 2016 gekürt wurde,<br />
in allen Ortsteilen sichtbar. Hier wird die Energiewende<br />
aktiv gestaltet. Bürger, Stadt- und Kreisverwaltung ziehen<br />
hier an einem Strang.<br />
Wichtige Drehscheibe für Informationen und Rohstoffhandel<br />
vor Ort ist der 2006 gegründete Biomassehof<br />
in Borlinghausen. Dabei handelt es sich um ein Tochterunternehmen<br />
des Maschinenrings Höxter-Warburg.<br />
Der Biomassehof befindet sich auf dem Gelände der<br />
ehemaligen Eisenhütte Teutonia. Mitten auf dem Gelände<br />
steht ein Blockhaus, das als Bürogebäude dient.<br />
Drumherum lagern in Hallen und im Freien zu riesigen<br />
Halden aufgeschüttete Holzhackschnitzel.<br />
Dabei handelt es sich um Restholz aus der Waldbewirtschaftung,<br />
aus der Verkehrssicherung sowie der Landschaftspflege.<br />
28.000 Tonnen dieser kleingehäckselten<br />
Holzstücke fallen pro Jahr in der Region an. 16.000<br />
Tonnen vermarktet allein der Biomassehof. Etwa zwei<br />
Drittel davon werden energetisch genutzt „Der Biomassehof<br />
ist der Hauptinitiator der Wertschöpfungskette<br />
Restholz“, betont Maschinenring-Geschäftsführer Norbert<br />
Hofnagel.<br />
2.500 Tonnen verbraucht allein das Biomasseheizwerk<br />
in der benachbarten Stadt Brakel. Die Bruttowertschöpfung<br />
dieser Menge beträgt rund 120.000<br />
30
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
praxis / Titel<br />
Biogasanlage der JSJ Energie Peckelsheim GbR. Sie hat<br />
heute eine installierte Leistung von 1.000 kW. Sie wurde<br />
in vier Stufen auf diese Größe ausgebaut. Sie ist ein<br />
wesentlicher Wärmelieferant in Peckelsheim. Versorgt<br />
werden 21 Wohnhäuser, die Stadtverwaltung, die<br />
Rettungswache, ein Kindergarten eine ehemalige Schule<br />
sowie der neben der Anlage befindliche Schweinemaststall.<br />
Zudem liefert sie noch Wärme an einen Betrieb mit<br />
Sauenhaltung.<br />
Euro pro Jahr. „Der Nahwärmeverbund Brakel, im Jahr<br />
2001 gegründet, betreibt seit 2002 die Heizanlage,<br />
die mehrere Schulen und öffentliche Gebäude mit<br />
Wärme aus nachhaltiger Biomasse versorgt. Die Wärme<br />
wird auf Contractingbasis geliefert. Die Abnehmer verpflichten<br />
sich, die Wärme über einen Zeitraum von 20<br />
Jahren abzunehmen“, erläutert Hofnagel.<br />
Nach seinen Angaben wird die Wirtschaftlichkeit durch<br />
regionale Rohstoffe, kurze Wege, geringe Logistikkosten<br />
und durch die Wertschöpfung im ländlichen Raum sichergestellt.<br />
Die zwei verbauten Holzkessel mit je 1,2<br />
Megawatt (MW) Leistung produzieren jährlich 6,5 bis<br />
7,5 Millionen (Mio.) Kilowattstunden (kWh) Wärme,<br />
wodurch 650.000 bis 750.000 Liter Heizöl ersetzt<br />
werden. Die produzierte Wärme gelangt über ein 1.400<br />
Meter langes unterirdisches Wärmenetz zu den Endverbrauchern,<br />
wo sie zum Heizen der Gebäude genutzt wird.<br />
Brennstoffkosten bleiben in der Region<br />
Wenn die vorgenannte Heizölmenge eingespart wird,<br />
dann heißt das auch, dass zum Beispiel bei einem<br />
Heizöl-Kundenpreis von 52,20 ct/Liter (inklusive<br />
Energiesteuer, Mehrwertsteuer, Deckungsbeitrag Handel<br />
und Einkaufspreis Mineralölhändler 32,27 ct/Liter)<br />
rund 220.000 Euro nicht zurückfließen in die vorgelagerten<br />
Stufen wie beispielsweise Großhändler, Raffinerie,<br />
Tanklager, Transportschiffe und Ölquelle. Jedoch<br />
steht den Verbrauchern dieser Betrag nicht komplett<br />
netto zur Verfügung, da ja die Hackschnitzel eingekauft<br />
werden müssen.<br />
Die Nettoersparnis des Heizwerkes Brakel im Vergleich<br />
zum Brennstoff Heizöl beträgt 15.000 Euro pro Jahr.<br />
Dazu kommen noch bei den Wärmekunden die Einsparungen,<br />
wie zum Beispiel vermiedene Schornsteinfegerkosten<br />
oder die vermiedenen variablen und festen<br />
Kosten der nicht mehr vorhandenen Einzel-Feuerstätten.<br />
Aufgrund der regen Aktivitäten hat die Stadt Brakel<br />
mehrfach den european energy award gewonnen (siehe<br />
www.brakel.de/Leben/Leben-in-Brakel/Energie-Klima/<br />
european-energy-award).<br />
Im Jahr 2009 wurde der Kreis Höxter im Wettbewerb<br />
der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) e.V.<br />
zur Bioenergieregion. „Der Kreis hat sich nur unter der<br />
Bedingung beworben, wenn der Maschinenring das<br />
Projekt umsetzt“, hebt Hofnagel den Stellenwert des<br />
Maschinenrings hervor. In der ersten Projektlaufzeit bis<br />
2012 hat der Maschinenring (MR) Effizienzverbesserungen<br />
der vorhandenen Biogasanlagen erarbeitet. Der<br />
MR ist der Frage nachgegangen, wie sich der Maisanbau<br />
für Biogasanlagen lokal auf die Landwirtschaft, die<br />
Bevölkerung und die Biodiversität auswirkt. „Mit dem<br />
Ergebnis, dass Mais per se nicht böse ist“, betont der<br />
MR-Geschäftsführer. Das habe die Maisgegner überrascht.<br />
Auch ein Versuchsstandort für schnellwachsende<br />
Baumarten wurde initiiert.<br />
Auf dem Biomassehof<br />
in Borlinghausen vor<br />
dem Bürogebäude, von<br />
links: MR-Geschäftsführer<br />
Norbert Hofnagel<br />
und die beiden Projektkoordinatoren<br />
Micha<br />
Loewen und Alexander<br />
Hake.<br />
31
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Biogas: externe Investoren waren<br />
nicht gewollt<br />
Laut Hofnagel konnte der MR vor Ort viele Vorbehalte<br />
gegenüber der Bioenergienutzung durch aktive Arbeit<br />
zerstreuen. Beim Thema Biogas habe der MR schon<br />
früh Position bezogen, indem man Investorenanlagen<br />
ablehnte. Zudem habe der MR empfohlen, Biogasanlagen<br />
keine Baugenehmigungen zu erteilen, wenn diese<br />
nicht mindestens neun Jahre die notwendigen Flächen<br />
sicher bewirtschaften würden. EEG-Anlagen hat der MR<br />
selbst nicht projektiert, wohl aber beratend begleitet.<br />
In der zweiten Förderperiode (2012 bis 2015) des<br />
Projektes Bioenergieregion ging es mehr um die Nutzung<br />
Erneuerbarer Energien im Wärmesektor. „Wir<br />
wollten unter anderem das Biomasseaufkommen aus<br />
Reststoffen erhöhen“, macht Projektkoordinator Alexander<br />
Hake deutlich, der bei der<br />
Biomasse Energie Maschinenring<br />
GmbH angestellt ist. Zur Zeit erarbeite<br />
der Kreis Höxter ein Klimakonzept.<br />
Willebadessen erstelle<br />
parallel zudem ein Integriertes<br />
kommunales Entwicklungskonzept<br />
(IKEK), in das Klimaziele<br />
gesondert eingebettet werden<br />
sollen.<br />
Energiewende in Zahlen<br />
„In Willebadessen wird fast dreimal<br />
mehr Grünstrom erzeugt,<br />
als die Menschen verbrauchen.<br />
28 Mio. Kilowattstunden Wärme<br />
werden durch Biogas, Holz und<br />
Wärmepumpen bereitgestellt. Damit<br />
werden 2,8 Mio. Liter Heizöl<br />
150-kW-Hackschnitzelheizung im Ortsteil Löwen,<br />
die über ein Mikro-Wärmenetz ein paar Häuser ersetzt. Darin sind die einzelnen<br />
versorgt. Von solchen Kleinversorgungseinheiten privaten Solarthermieanlagen<br />
gibt es viele in Willebadessen. Manchmal tun jedoch nicht enthalten, da diese<br />
sich zwei oder drei Nachbarn zusammen und<br />
schwer zu erfassen sind. Im Kreis<br />
organisieren die Wärmeversorgung.<br />
Höxter befinden sich 37 Biogasanlagen,<br />
6 davon stehen im Stadtgebiet<br />
von Willebadessen. Die 6<br />
Anlagen haben eine installierte elektrische Leistung<br />
von 3,3 Megawatt. 5 Anlagen nutzen ihre überschüssige<br />
Wärme extern, mit der sie 1,5 Millionen Liter Heizöl<br />
ersetzen. Fast 10 Wärmenetze der Biogasanlagen erstrecken<br />
sich über insgesamt 5 Kilometer“, zählt Micha<br />
Loewen, ebenfalls Projektkoordinator, auf.<br />
Weitere 1,48 Mio. Liter Heizöl würden durch Hackschnitzel-<br />
und Pelletsheizungen substituiert. Allein die<br />
Biogasanlagen generieren rund 5,3 Mio. Euro an Einspeisevergütung,<br />
die den Anlagen zufließen. Im Kreis<br />
Höxter drehen 200 Windenergieanlagen ihre Flügel im<br />
Wind; in Willebadessen stehen davon 22 Windstromer.<br />
614 Photovoltaikanlagen fangen Sonnenstrahlen ein<br />
und wandeln sie in Elektrizität um. 183 zentrale Holzheiz-<br />
sowie 2.000 private Stückholzheizanlagen sind<br />
in Betrieb. 3.200 Haushalte haben auf verschiedene<br />
Weise mit Erneuerbaren Energien zu tun. Vier Anlagen<br />
liefern Strom aus Wasserkraft. Allein die EEG-Anlagen<br />
im Stadtgebiet haben im Jahr 2014 der Atmosphäre<br />
rund 30.000 Tonnen CO 2<br />
erspart.<br />
Aktuell arbeiten Micha Loewen und Alexander Hake<br />
im Projekt LANDbrauchtWÄRME. Im Sommer 2015<br />
wurde der Kreis Höxter zu einer von 13 Gewinnerregionen<br />
im Modellvorhaben Land(auf)Schwung des<br />
Bundeslandwirtschaftministeriums ernannt. Ziel des<br />
Vorhabens ist, strukturschwache ländliche Regionen<br />
beim Umgang mit dem demografischen Wandel aktiv zu<br />
unterstützen, die regionale Wertschöpfung zu erhöhen<br />
und die Beschäftigung im ländlichen Raum zu sichern.<br />
Dazu hat der Kreis Höxter mit LANDbrauchtWÄRME<br />
eines von vier Startprojekten ins Leben gerufen. Träger<br />
des Projektes ist die Biomasse Energie Maschinenring<br />
GmbH mit ihrem Betriebsgelände, dem Biomassehof<br />
Borlinghausen. Das Projekt hat drei Schwerpunkte beziehungsweise<br />
Ziele:<br />
a. Wissenstransfer im Bereich Bioenergie im Kreis<br />
Höxter.<br />
b. Unabhängige Wärmeberatung für Bürgerinnen und<br />
Bürger, insbesondere zur Unterstützung von privaten,<br />
nachbarschaftlichen Mikronetzstrukturen.<br />
c. Konfliktmanagement: Gezielte Kommunikation<br />
der Kontroversen durch öffentliche Führungen,<br />
Infoveranstaltungen oder Exkursionen. Sie sollen<br />
bestehende und aufkeimende Konflikte rund um<br />
die Erzeugung Erneuerbarer Energien entschärfen<br />
helfen und für gegenseitiges Verständnis sorgen.<br />
Kürzlich hat zum Beispiel eine Sicherheitsschulung<br />
für Biogasanlagenbetreiber nach TRGS 529 als<br />
Präventionsmaßnahme stattgefunden.<br />
LANDbrauchtWÄRME läuft noch bis Ende Juni 2018.<br />
„Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat uns dafür<br />
180.000 Euro zur Verfügung gestellt. 100.000 Euro<br />
bringt die Region selbst auf. Der Kreis, örtliche Banken<br />
und MR-Verbundunternehmen bringen 35 bis 40 Prozent<br />
an Eigenmitteln ein“, freut sich Hofnagel. Über<br />
das Modellvorhaben Land(auf)Schwung fließen insgesamt<br />
1,5 Mio. Euro Bundesmittel in den Kreis Höxter.<br />
Fazit: Die Energiewende lohnt sich – nicht nur wegen<br />
der lokalen Wertschöpfung. Sie ist auch Bremse des<br />
Klimawandels. Wird der nicht aufgehalten, verändern<br />
sich lokal nicht nur liebgewonnene Landschaftsbilder –<br />
global sind die Auswirkungen viel dramatischer.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Tel. 0 54 09/90 69 426<br />
E-Mail: martin.bensmann@biogas.org<br />
32
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
praxis / Titel<br />
ÜBERWACHUNG VON BIOGAS-ANLAGEN<br />
Sie denken über einen weiteren Behälter oder<br />
ein optimiertes BHKW-Konzept nach?<br />
Sprechen Sie uns an. Wir sind Ihr Partner für<br />
Anlagenoptimierungen und Service.<br />
Biogas 401<br />
Mehrkanal-Gasanalysator<br />
Biogas 905<br />
Mehrkanal-Gasanalysator<br />
GTR 210 IR<br />
CH 4 + CO 2<br />
SENSOREN<br />
TOX 592<br />
O 2 + H 2 S<br />
Die beiden Gas-Analysatoren Biogas 401<br />
und Biogas 905 über wachen kontinuierlich<br />
oder dis kon ti nuierlich die Qualität des<br />
Biogases auf die Gaskompo nenten hin.<br />
Optional warnen zusätzliche Umgebungsluft-Sensoren<br />
frühzeitig vor gesundheitsge<br />
fähr denden, explo sions fähigen und<br />
nichtbrenn baren Gasen und Dämpfen.<br />
❯❯❯ Biogas Know-how seit 2001 ❮❮❮<br />
Trierer Str. 23 – 25 · 52078 Aachen<br />
Tel. (02 41) 97 69-0 · www.ados.de<br />
EINSATZBEREICHE:<br />
■ Biogas-Produktionsanlagen<br />
■ Kläranlagen<br />
■ Deponien<br />
s e i t 1 9 0 0<br />
WELTEC BIOPOWER GmbH<br />
Zum Langenberg 2<br />
49377 Vechta<br />
info@weltec-biopower.de<br />
www.weltec-biopower.de<br />
Tel. 0 44 41 - 999 78 - 0<br />
Organic energy worldwide<br />
Wir machen Ihr Biogas CLEAN und COOL!<br />
Individuelle Anlagen von Züblin Umwelttechnik<br />
zur Reinigung und Kühlung von Biogas<br />
CarbonEx ® Aktivkohlefilter zur<br />
Feinentschwefelung von Biogas<br />
GasCon Gaskühlmodul zur Kühlung von Biogas<br />
BioSulfidEx zur biologischen Biogas-Entschwefelung<br />
BioBF Kostengünstiges System<br />
zur biologischen Vorentschwefelung<br />
NEU!<br />
Züblin Umwelttechnik GmbH<br />
Otto-Dürr-Straße 13 · 70435 Stuttgart<br />
Telefon 0711 8202-0<br />
umwelttechnik@zueblin.de<br />
www.zueblin-umwelttechnik.com<br />
Stuttgart Berlin Chemnitz Dortmund Hamburg Nürnberg<br />
akf bank<br />
agrarfinanz<br />
Wir finanzieren Wachstum<br />
Besuchen Sie uns auf der agra<br />
in Leipzig vom 04. – 07. Mai <strong>2017</strong>,<br />
Halle 2, Stand A17<br />
Tel. +49 202 25727-3351<br />
agrarfinanz@akf.de, www.akf.de<br />
bgj_03-17.indd 1 24.03.17 15:01<br />
33
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Energiewende – und das Geld bleibt im Dorf<br />
Wenn Kommunen und ihre Einwohner gemeinsam auf Erneuerbare Energien setzen, dann profitieren die<br />
Menschen auf verschiedenen Ebenen davon. Monetär am meisten spüren das die Leute bei der regenerativen<br />
Wärmenutzung, da Wärme im Vergleich zu Strom vor Ort leichter zu verkaufen ist. Nachfolgend ein paar<br />
Beispiele aus verschiedenen Gemeinden für lokale Wertschöpfung und lokalen Klimaschutz.<br />
Lokale<br />
Wertschöpfung<br />
Elke Gerick und der<br />
Betreiber der Biogasanlage<br />
Peter Mette.<br />
Ellerau<br />
Die Biogasanlage Ellerau im<br />
Süden Schleswig-Holsteins<br />
wurde vor 10 Jahren am Ortsrand<br />
von den Kommunalbetrieben<br />
Ellerau errichtet. Sie<br />
verfügt aufgrund der Lage über<br />
ein hervorragendes Wärmekonzept.<br />
So wird die gesamte<br />
überschüssige Wärme aus dem<br />
537-kW-Biogas-Blockheizkraftwerk<br />
in das errichtete<br />
Fernwärmenetz eingespeist.<br />
Hiervon profitiert in erster Linie<br />
unser Freibad. Bereits am<br />
1. Mai jedes Jahres eröffnen<br />
wir die Badesaison. Davor haben wir erst Mitte Mai die<br />
Saison eröffnet. Doch mit angenehmen 26 Grad Wassertemperatur<br />
begeistern wir viele Besucher, auch aus<br />
dem weiteren Umland, nach der langen Winterpause<br />
endlich wieder ins Nass zu springen. Durch die Schließung<br />
vieler Freizeitbäder und die späte Öffnung umliegender<br />
Bäder macht sich Ellerau als Dorfgemeinde mit<br />
6.000 Einwohnern hier einen positiven Namen.<br />
Zusätzlich werden auch weitere Einrichtungen, wie<br />
zum Beispiel die gemeindlichen Kindergärten, die<br />
beiden Seniorenwohnanlagen, das Bürgerhaus, die<br />
Kirche, die Tennisanlage und ein Wohngebiet mit 80<br />
Wohneinheiten versorgt. Die Einnahmen bleiben letztendlich<br />
in der Gemeinde und konnten über die 10 Jahre<br />
auch konstant gehalten werden.<br />
Die Maissilage wird von den Landwirten aus der näheren<br />
Umgebung geliefert. Die vertraglichen Lieferbeziehungen<br />
bedeuten auch für die Landwirte eine gesicherte<br />
zusätzliche Einnahmequelle. Nicht zu vergessen ist die<br />
durch die BHKW erzeugte Strommenge, die bereits ein<br />
Drittel der Ellerauer Haushalte mit „Grünstrom“ versorgt.<br />
Auch Ellerau denkt an die Zukunft. Derzeit gehen Planungen<br />
in die bedarfsgerechte „flexible“ Erzeugung<br />
von Strom und Wärme.<br />
Elke Gerick<br />
Kommunalbetriebe Ellerau<br />
Übergabe des Wärmeschildes an das Freibad.<br />
Samtgemeinde Tarmstedt<br />
In der Samtgemeinde Tarmstedt in Niedersachsen<br />
wird seit etwa zehn Jahren durch<br />
mehrere Biogasanlagenbetreiber Biogas<br />
produziert. Seit 2010 nutzt die Samtgemeinde<br />
in mehreren Teilbereichen die klimafreundliche<br />
Wärme dieser Anlage und<br />
beheizt damit ein Freibad, mehrere Schulen,<br />
Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshäuser.<br />
In den ersten fünf Jahren wurde die Wärme<br />
für das Freibad in Wilstedt noch kostenlos<br />
zur Verfügung gestellt. Seit 2015 wird die<br />
bezogene Wärme mit einem Arbeitspreis,<br />
der sich an dem durchschnittlichen Jahreserdgaspreis<br />
des vor Ort befindlichen<br />
Energieversorgers richtet, vergütet. Dieser<br />
Arbeitspreis beträgt 50 Prozent des<br />
durchschnittlichen Jahreserdgaspreises<br />
zuzüglich der gültigen Umsatzsteuer. Mit<br />
den so erzielten Einsparungen konnte die<br />
Samtgemeinde weitere Anschaffungen und<br />
Instandsetzungen im Freibad Wilstedt tätigen<br />
sowie den Haushalt insgesamt entlasten.<br />
Die Schulgebäude einer Grundschule<br />
und einer Kooperativen Gesamtschule, die<br />
Platz für rund 1.500 Schüler bieten, werden<br />
seit dem Jahr 2012 von einem mit Biogas<br />
betriebenen BHKW beheizt. Jedes Jahr<br />
konnten so etwa 80.000 Liter Heizöl durch<br />
Lokale<br />
Wertschöpfung<br />
weitgehend klimaneutrales Biogas ersetzt<br />
werden, was eine erhebliche Einsparung an<br />
CO 2<br />
-Emissionen und finanziellen Mitteln<br />
bedeutet.<br />
Frank Holle<br />
Samtgemeindebürgermeister<br />
34
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
praxis / Titel<br />
Markt Indersdorf<br />
Das Schulzentrum des Zweckverbands Grund- und Mittelschule<br />
Markt Indersdorf ist eine der größten Schulen<br />
Oberbayerns. Im Jahr 2013 wurde ein Wärmeliefervertrag<br />
mit der ortsansässigen Firma Götz Biowärme<br />
GmbH & Co. KG geschlossen. Die Firma Götz erzeugt in<br />
Ried bei Markt Indersdorf Biogas und leitet dieses über<br />
eine rund 4 Kilometer lange Leitung bis zum Schulzentrum.<br />
Dort erfolgt die Strom- und Wärmeerzeugung in<br />
einem Blockheizkraftwerk, das hinter dem Turnhallengebäude<br />
steht (siehe Foto).<br />
Mit der klimafreundlichen Biogaswärme werden die mit<br />
200 Kindern belegte Kindertagesstätte, das Schulzentrum<br />
mit angegliedertem Hallenbad, die Dreifachsporthalle<br />
und eine Hausmeisterwohnung versorgt. Sehr positiv<br />
wird der Anfang 2016 eingeführte sonntägliche<br />
Warmbadetag mit 31 Grad Wassertemperatur im Hallenbad<br />
von der Bevölkerung angenommen. Durch die<br />
Wochenendabsenkung im Schulgebäude wird die nicht<br />
benötigte, kostengünstige Wärme zur Aufheizung des<br />
Schwimmbades verwendet. Der Schulzweckverband<br />
Markt Indersdorf profitiert von CO 2<br />
-neutraler Wärme<br />
und konnte seinen jährlichen Aufwand für die Wärmeversorgung<br />
um rund 25 Prozent reduzieren. Die Kosteneinsparung<br />
in Höhe von rund 30.000 Euro setzt sich<br />
zusammen aus dem günstigeren Bezugspreis für die<br />
regenerative Wärme und der Reduzierung des eigenen<br />
Lokale<br />
Wertschöpfung<br />
Personalaufwandes. Die eingesparten Mittel setzt der<br />
Schulzweckverband vollumfänglich für eine qualitativ<br />
hochwertige Ausbildung seiner Grund- und Mittelschüler<br />
ein. Nicht nur die politisch Verantwortlichen, sondern<br />
auch die Lehrer- und Elternschaft sowie die über<br />
800 Schüler der Verbandsschule begrüßen das Vorzeigeprojekt,<br />
da es sich hier um regenerative Energie handelt,<br />
die quasi vor der Haustür entsteht.<br />
Klaus Mayershofer<br />
Geschäftsleiter Markt Indersdorf<br />
Markt Indersdorfs<br />
Erster Bürgermeister<br />
und Zweckverbandsvorsitzender<br />
Franz Obesser<br />
vor dem Blockheizkraftwerk.<br />
Intensiv.<br />
Aktiv.<br />
Mitgestalten.<br />
Werden<br />
Sie<br />
Mitglied!<br />
Als Mitglied im Fachverband Biogas werden Sie Teil einer Interessen vertretung, die<br />
aktiv Einfl uss nimmt. Auf Gesetze und Verordnungen. Auf Länderebene und im Bund.<br />
Wir sind ansprechbar, hören zu, machen uns stark!<br />
Seien Sie dabei!<br />
www.biogas.org<br />
Zusammen.<br />
Stark.<br />
Einfl uss nehmen.<br />
Dem Klimaschutz verpflichtet.<br />
Engagiert. Aktiv. Vor Ort.<br />
Gesagt.<br />
Getan.<br />
Viel erreicht.<br />
35
praxis / Titel<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Lokale<br />
Wertschöpfung<br />
Pro Seniore Wohnpark Ebersbach<br />
Als vor über zehn Jahren unser Wohnpark<br />
in Weichs-Ebersbach (Oberbayern) an die<br />
Biogasanlage des benachbarten Landwirts<br />
Geisenhofer angeschlossen wurde, war ich<br />
zunächst noch etwas skeptisch. Rechnet<br />
sich das? Kann man sich zu 100 Prozent<br />
Lidija Schicht und der<br />
Betreiber der Biogasanlage,<br />
Alfred Geisenhofer.<br />
auf die Anlage verlassen? Ein<br />
Ausfall der Wärmeversorgung<br />
wäre gerade für unsere Seniorinnen<br />
und Senioren fatal.<br />
Darum haben wir unsere alte<br />
Ölheizung auch erst mal im<br />
Keller stehen lassen – sicher ist<br />
sicher, dachte ich.<br />
Diese Ölheizung ist heute<br />
längst Geschichte. Die Biogasanlage hat<br />
sich bewährt: Unsere Bewohner haben<br />
es rund um die Uhr schön warm, wir sind<br />
komplett unabhängig vom Öl und vor allem<br />
vom Ölpreis – und unsere Energie<br />
kommt buchstäblich von „um die Ecke“.<br />
Was uns aber besonders wichtig ist, ist<br />
der Umweltaspekt. Wir sprechen uns klar<br />
für Erneuerbare Energien aus und leben<br />
gerne mit dem guten Gefühl, durch den<br />
Bezug von natürlich hergestelltem Biogas<br />
wertvolle Ressourcen zu schonen. Das versuchen<br />
wir auch unseren Bewohnern und<br />
Gästen zu vermitteln – darum informiert<br />
eine Infotafel im Eingangsbereich über<br />
unser Engagement.Wir freuen uns außerdem<br />
darüber, dass nicht nur wir, sondern<br />
auch viele weitere Wohnanlagen in unserer<br />
Nachbarschaft von der Biogasanlage versorgt<br />
werden. Es wäre schön, wenn in Zukunft<br />
noch mehr Haushalte klimaneutral<br />
heizen würden – denn davon profitieren wir<br />
am Ende alle.<br />
Lidija Schicht<br />
Residenzleiterin<br />
Günter Schmihing GmbH<br />
Die Firma Schmihing im niedersächsischen<br />
Melle wurde 1999 als Handelsvertretung<br />
für Strautmann Landtechnik<br />
gegründet. Bereits hierdurch wurden<br />
Rinderfütterung und Mischtechnik zu<br />
Kernkompetenzen des Unternehmens, die<br />
letztlich auch den Grundstein für die Fütterung<br />
von Biogasanlagen legten.<br />
Mit dem Inkrafttreten des EEG zu Beginn<br />
des Jahrtausends ist der Biogasmarkt zu<br />
einem zunehmend wichtigeren Standbein<br />
für die Schmihing GmbH geworden. Im<br />
Jahr 2003 wurde eine stationäre, elektrisch<br />
angetriebene Einheit in Kooperation<br />
mit der Firma Präzi-Fördertechnik<br />
entwickelt<br />
und in Betrieb genommen.<br />
Die Änderung des<br />
EEG führte zur steigenden<br />
Nachfrage größerer<br />
Anlagen, wodurch ein<br />
Schubbodensystem mit<br />
der Firma Präzi-Fördertechnik<br />
entwickelt wurde,<br />
das die Einbringung<br />
größerer Futtermengen<br />
ermöglichte. Neben<br />
Mais entwickelte sich<br />
insbesondere auch die<br />
Lokale<br />
Wertschöpfung<br />
Das Messeteam der Günter Schmihing GmbH auf der EuroTier 2016<br />
zusammen mit Mitarbeitern eines Lieferanten.<br />
BIOGASANALYSE<br />
GASANALYSENTECHNIK<br />
BIOGASANALYSENTECHNIK<br />
WASSERANALYSENTECHNIK<br />
AGRARMESSTECHNIK<br />
PRONOVA Analysentechnik GmbH&Co.KG<br />
Groninger Straße 25 I 13347 Berlin<br />
Tel +49 (0)30 455085-0 – Fax -90<br />
info@pronova.de I www.pronova.de<br />
FOS/TAC 2000<br />
automatischer Titrator zur Bestimmung<br />
von FOS, TAC und FOS/TAC<br />
SSM 6000 ECO<br />
SSM 6000<br />
der Klassiker für die Analyse<br />
von CH 4<br />
, H 2<br />
S, CO 2<br />
, H 2<br />
und O 2<br />
mit<br />
und ohne Gasaufbereitung<br />
mit proCAL für SSM 6000,<br />
die vollautomatische,<br />
prüfgaslose Kalibrierung<br />
36<br />
www.pronova.de
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
praxis / Titel<br />
Zuckerrübe als attraktives Substrat für<br />
die Fütterung von Biogasanlagen. Nach<br />
ersten Versuchen im Jahr 2007 wurde das<br />
Produktprogramm für die Rübenbearbeitung<br />
stetig erweitert, sodass dem Kunden<br />
heute vom einfachen Rübenschnitzler<br />
bis zur mobilen Rübenwäsche vielfältige<br />
Lösungen angeboten werden können. Die<br />
neueste Innovation bildet hierbei eine<br />
Trockenreinigung mit automatischer Entsteinung.<br />
Das Biogasgeschäft ermöglichte bis 2014<br />
einen Jahresumsatz von etwa 5 Mio. Euro,<br />
der durch sechs Mitarbeiter erwirtschaftet<br />
wurde. Durch die Erschließung weiterer<br />
Geschäftsbereiche wie die Einstreu-,<br />
Silage- und Fütterungstechnik konnte der<br />
Umsatz bei gleicher Mitarbeiterzahl bis<br />
heute in etwa gehalten werden. Hierbei<br />
wurde von den wichtigen internationalen<br />
Kundenbeziehungen aus der Biogasbranche<br />
profitiert.<br />
Günter Schmihing<br />
Geschäftsführer<br />
Bioenergiedorf Wettesingen<br />
Seit Ende 2014 wird der Ortsteil Wettesingen (1.250<br />
Einwohner) der Gemeinde Breuna im Landkreis Kassel<br />
mit Nahwärme durch die Wettesinger Energiegenossenschaft<br />
(WEG) versorgt. Ab dem Jahr 2009 hatten<br />
sich Bürger aus Wettesingen aufgrund steigender Energiepreise<br />
damit beschäftigt, ob man aus der Gas- und<br />
Wärmeproduktion einer privaten Biogasanlage eine<br />
Win-Win-Situation für ihr Dorf machen könne. Nach<br />
drei Jahren intensiver Planung und mit finanzieller<br />
Unterstützung der Gemeinde Breuna kam es zur Gründung<br />
der WEG. Danach begann die Verlegung von über<br />
10 Kilometer Nahwärmeleitung sowie der Bau eines<br />
Blockheizkraftwerkes und eines nachgelagerten Heizkraftwerkes<br />
auf Pellet-Basis zur Spitzenlast- und Redundanzabdeckung.<br />
Wettesingen ist das erste Bioenergiedorf, das ausschließlich<br />
mit Erneuerbarer Energie beheizt wird.<br />
Knapp zwei Drittel der 360 Haushalte sind Mitglied<br />
der WEG und haben sich autark von fossilen Brennstoffen<br />
gemacht. Darüber hinaus wird der Ort bilanziell<br />
zu weit über 100 Prozent mit erneuerbarem Strom<br />
versorgt. Auch Breuna ist Mitglied der WEG und hat<br />
alle kommunalen Gebäude wie die Mehrzweckhalle, die<br />
„Alte Schule“, das Feuerwehrhaus und die Rathaus-<br />
Gaststätte an das Nahwärmenetz angeschlossen. Die<br />
Kilowattstunde Biogaswärme lag anfänglich bei 7 Cent<br />
(Vollkosten) und ist damit auch heute konkurrenzfähig.<br />
Neben der Nahwärmeleitung wurden gleichzeitig Glasfaserkabel<br />
für schnelles Internet verlegt. Beide Maßnahmen<br />
machen unseren zweitgrößten Ortsteil sehr<br />
attraktiv für seine Bürger. Damit wird im Kleinen etwas<br />
für den Klimaschutz und die Umwelt getan. Gleichzeitig<br />
bleibt das Geld, das für Energie aufgebracht wird,<br />
vor Ort und in der Region. Ich bin stolz darauf, was<br />
in Wettesingen durch bürgerschaftliches Engagement<br />
geschaffen worden ist.<br />
Klaus-Dieter Henkelmann<br />
Bürgermeister der Gemeinde Breuna<br />
Lokale<br />
Wertschöpfung<br />
Spatenstich für das<br />
Nahwärmenetz.<br />
37
Praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Biomassepreisvergleich<br />
Substratpreisindex wieder<br />
auf dem Niveau von 2010<br />
Zum nunmehr siebten Mal wurden die Substratpreise der zurückliegenden Ernte des Jahres<br />
2016 durch den Fachverband Biogas e.V. abgefragt. Nach einem Jahr mit Frühsommertrockenheit<br />
war 2016 wieder ein Jahr mit in der Regel guten Erträgen (insbesondere beim<br />
Grünland). Die Preise haben sich als Folge normalisiert und liegen wieder auf dem Niveau<br />
der allerersten Umfrage.<br />
Von Dr. Stefan Rauh<br />
Im Vergleich zu den Vorjahren war die Anzahl der<br />
Rückmeldungen deutlich rückläufig! Trotzdem<br />
erreichten die Geschäftsstelle 92 ausgefüllte Fragebögen<br />
mit immerhin 230 Preisangaben zu verschiedensten<br />
Substraten. Das bedeutet im Umkehrschluss,<br />
dass im Bereich der Energiepflanzen im<br />
Schnitt mehr als zwei unterschiedliche Pflanzen eingesetzt<br />
werden. Die größte Zahl an Rückmeldungen vereint<br />
wie in den Vorjahren der Silomais auf sich, gefolgt<br />
Biomassepreise 2016 Stand Februar <strong>2017</strong><br />
Tabelle 1: Biomassepreise 2016<br />
Substrat ab Feld<br />
Mittlerer Preis<br />
stehend ab Feld<br />
[€/t TM]<br />
Mittlerer<br />
TM-Gehalt<br />
[%]<br />
von Getreide-GPS und Grassilage. Wie in Abbildung 1<br />
links zu sehen ist, sind lediglich 40 Prozent der eingegangenen<br />
Datensätze Preisangaben zu Silomais. Neben<br />
klassischen Substraten, wie zum Beispiel Grassilage,<br />
Getreide-GPS und Zuckerüben, wurden auch vereinzelt<br />
Preise für sogenannte alternative Energiepflanzen<br />
übermittelt. Insgesamt entfallen 8 Prozent der Preisangaben<br />
auf alternative Energiepflanzen. Dieses Bild<br />
wird allerdings etwas relativiert, wenn die zugehörigen<br />
Mittlerer Preis<br />
stehend ab Feld<br />
[€/t FM]<br />
Mittlerer<br />
Ertrag<br />
[t FM/ha]<br />
Mittlerer Preis<br />
stehend ab Feld<br />
[€/ha]<br />
Silomais 1) 81,7 36,0 29,4 45,2 1.329<br />
Grassilage 2) 49,1 34,8 17,1 24,4 416<br />
Getreide-GPS 1) 86,4 35,8 30,9 36,2 1.120<br />
Grünroggen 3) 64,3 30,0 19,3 25,6 495<br />
Getreidekorn<br />
Zuckerrüben 3) 115,9 23,1 26,7 94,4 2.522<br />
Riesenweizengras 3) 86,6 35,5 30,7 37,5 1.153<br />
Wildpflanzen 3)<br />
Substrat frei Silo<br />
Mittlerer Preis<br />
frei Silo<br />
[€/t TM]<br />
Mittlerer<br />
TM-Gehalt<br />
[%]<br />
Mittlerer Preis<br />
frei Silo<br />
[€/t FM]<br />
Mittlerer<br />
Ertrag<br />
[t FM/ha]<br />
Mittlerer Preis<br />
frei Silo<br />
[€/ha]<br />
Silomais 1) 99,0 36,0 35,6 45,2 1.611<br />
Grassilage 2) 84,1 34,8 29,3 24,4 713<br />
Getreide-GPS 3) 97,2 35,8 34,8 36,2 1.260<br />
Grünroggen<br />
Getreidekorn 2) 144,6 85,7 123,9 11,7 1.446<br />
Zuckerrüben 2) 136,6 23,1 31,5 94,4 2.973<br />
Riesenweizengras<br />
Wildpflanzen<br />
Anmerkung:<br />
Nettopreise mit korrigierten Mittelwerten; je mehr Daten vorhanden sind, desto höher kann das Perzentil gewählt werden<br />
1) 10 % höchste und niedrigste Werte werden nicht berücksichtigt = 90 % Perzentil<br />
2) 20 % höchste und niedrigste Werte werden nicht berücksichtigt = 80 % Perzentil<br />
3) 40 % höchste und niedrigste Werte werden nicht berücksichtigt = 60 % Perzentil FvB <strong>2017</strong><br />
38
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Praxis<br />
Abbildung 1: Anteile der Substrate (links Anzahl der Rückmeldungen, rechts Fläche der Rückmeldungen)<br />
2% 3% 2% 3% 66% 66%<br />
7%<br />
8%<br />
7%<br />
3%<br />
8%<br />
3%<br />
40%<br />
40%<br />
Silomais Silomais<br />
Grassilage Grassilage<br />
11%<br />
0% 0%<br />
0% 4% 0% 4%<br />
2% 3%2% 2% 3%2%<br />
11%<br />
Silomais Silomais<br />
Grassilage Grassilage<br />
5%<br />
5%<br />
Getreide-GPS Getreide-GPS<br />
Grünroggen Grünroggen<br />
Getreidekorn Getreidekorn<br />
12%<br />
12%<br />
Getreide-GPS Getreide-GPS<br />
Grünroggen Grünroggen<br />
Getreidekorn Getreidekorn<br />
Zuckerrüben Zuckerrüben<br />
Zuckerrüben Zuckerrüben<br />
19%<br />
19%<br />
Riesenweizengras<br />
Wildpflanzen Wildpflanzen<br />
Riesenweizengras<br />
Wildpflanzen Wildpflanzen<br />
13%<br />
13%<br />
Sonstige Sonstige<br />
Sonstige Sonstige<br />
Abbildung 2: Trockenmassepreise im Vergleich<br />
Substratpreis in €/t TM<br />
160,0<br />
Mittlerer Preis stehend ab Feld [€/t TM]<br />
Mittlerer Preis frei Silo [€/t TM]<br />
144,6<br />
140,0<br />
120,0<br />
100,0<br />
99,0<br />
97,2<br />
81,7<br />
84,1<br />
86,4<br />
80,0<br />
64,3<br />
Tabelle 2: Preise Wirtschaftsdünger und Gärprodukte 2016<br />
136,6<br />
115,9<br />
86,6<br />
60,0<br />
49,1<br />
40,0<br />
20,0<br />
0,0<br />
Silomais Grassilage Getreide-GPS Grünroggen Getreidekorn Zuckerrüben Riesenweizengras Wildpflanzen<br />
Quelle: FvB <strong>2017</strong> Anmerkung:<br />
Bei den Werten handelt es sich um korrigierte Mittelwerte<br />
Flächen mit einbezogen werden. In diesem<br />
Fall kommt Silomais auf zwei Drittel der<br />
Preisangaben (siehe Abbildung 1 rechts).<br />
Trotzdem wird auch hier deutlich, dass<br />
daneben weitere Substrate den Weg in die<br />
Biogasanlage finden. Hier dominieren eindeutig<br />
Getreide-GPS und Grassilage. Alternative<br />
Energiepflanzen werden eher nur auf<br />
kleinen Restflächen angebaut.<br />
In Tabelle 1 sind die wichtigsten Ergebnisse<br />
der Umfrage für die Substrate mit ausreichend<br />
vielen Rückmeldungen zusammengefasst.<br />
Neben den Nettopreisen stehend<br />
ab Feld (oberer Teil der Tabelle) und frei Silo<br />
(unterer Teil der Tabelle) sind dort auch die<br />
Mittelwerte des Ertrags sowie des Trockenmassegehalts<br />
aufgelistet. Im Vergleich zum<br />
Trockenjahr wurden 2016 wieder deutlich<br />
stabilere Erträge erreicht. Bei Silomais,<br />
Getreide-GPS und Grassilage liegen die Erträge<br />
bei etwa 5 Tonnen Frischmasse über<br />
dem Vorjahr.<br />
Damit werden zwar nicht die Erträge aus<br />
2014 erreicht, trotzdem hat sich die Versorgungslage<br />
deutlich entspannt. Insbesondere<br />
Zuckerrüben mit im Schnitt knapp<br />
95 Tonnen Frischmasse weisen sogar Rekorderträge<br />
auf. Auch Riesenweizengräser<br />
konnten ihren Ertrag um mehr als fünf<br />
Tonnen auf knapp 38 Tonnen Frischmasse<br />
steigern. Dies ist sicher ein sehr erfreulicher<br />
Wert. Leider gab es nicht ausreichend Rückmeldungen<br />
zu Wildpflanzen oder zur Durchwachsenen<br />
Silphie, so dass hier keine Werte<br />
angegeben werden können.<br />
39
Praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Abbildung 3: Frischmassepreise im Vergleich<br />
Substratpreis in €/t FM<br />
40,0<br />
35,0<br />
30,0<br />
25,0<br />
20,0<br />
15,0<br />
Quelle: FvB <strong>2017</strong><br />
29,4<br />
35,6<br />
17,1<br />
29,3<br />
30,9<br />
34,8<br />
Erträge wirkten preisdämpfend<br />
Die wieder besseren Ertragsverhältnisse<br />
wirken sich direkt auf die Preise aus, zu denen<br />
die Biomasse eingekauft wird. Da ein<br />
19,3<br />
136,4<br />
26,7<br />
Mittlerer Preis stehend ab Feld [€/t FM]<br />
Mittlerer Preis frei Silo [€/t FM]<br />
Silomais Grassilage Getreide-GPS Grünroggen Getreidekorn Zuckerrüben Riesenweizengras Wildpflanzen<br />
Anmerkung:<br />
Bei den Werten handelt es sich um korrigierte Mittelwerte<br />
31,5<br />
30,7<br />
großer Teil über Verträge längerfristig fixiert<br />
ist, musste anscheinend weniger Biomasse<br />
auf dem teuren Spotmarkt zugekauft<br />
werden. Nachdem im Vorjahr die niedrigen<br />
Erträge preistreibend wirkten,<br />
war dies in 2016 umgekehrt. Silomais<br />
wurde im Schnitt für 82<br />
Euro je Tonne Trockenmasse ab<br />
Feld und 99 Euro je Tonne Trockenmasse<br />
frei Silo gehandelt<br />
(siehe Abbildungen 2 und 3).<br />
Umgerechnet auf die Frischmasse<br />
ergeben sich Preise in Höhe<br />
von 29 beziehungsweise 36 Euro<br />
je Tonne. Silomais und Getreide-<br />
GPS liegen dabei weiterhin etwa<br />
in der gleichen Preislage. Günstiger<br />
angeboten wird Grassilage.<br />
Bei einem Kauf ab Wiese sind die<br />
hohen Ernte- und Transportkosten<br />
zu berücksichtigen. Die Substrate<br />
mit einer hohen Energiedichte<br />
(Getreidekorn und Zuckerrüben)<br />
erreichen die höchsten Trockenmassepreise.<br />
Bei den alternativen<br />
Energiepflanzen konnte nur<br />
für Riesenweizengras (87 Euro<br />
je Tonne Trockenmasse ab Feld) ein repräsentativer<br />
Wert erfasst werden. Dieser liegt<br />
überraschenderweise über 15 Euro je Tonne<br />
Trockenmasse höher als im Vorjahr. Die Aus-<br />
Abbildung 4: Substratpreisindex für NawaRo<br />
122,3 135,7<br />
113,8<br />
111,5<br />
105,9<br />
108,8<br />
108,9<br />
107,6<br />
106,0<br />
100,6<br />
102,9<br />
98,0<br />
100,7<br />
97,6<br />
101,4<br />
100,3<br />
100,1<br />
101,1 100,1<br />
94,8<br />
94,7<br />
91,7<br />
86,1<br />
84,2<br />
40
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
®<br />
WDV MOLLINÉ<br />
Messtechnik die zählt<br />
sagekraft der Preisauswertung ist jedoch zu<br />
relativieren, da diese auf vergleichsweise<br />
wenigen Rückmeldungen basiert.<br />
Stromgestehungskosten Substrate<br />
Wichtig für viele Anlagen ist gerade auch<br />
vor dem Hintergrund der zukünftigen Ausschreibungen,<br />
welche Stromgestehungskosten<br />
aus den genannten Preisen resultieren.<br />
Zuerst muss bedacht werden, dass<br />
die Kosten für Lagerung und Entnahme<br />
aus dem Silo und Transport zur Einbringung<br />
hinzugerechnet werden müssen. Hier<br />
können pauschal 6 Euro je Tonne Frischmasse<br />
angenommen werden. Die Kosten<br />
für Silomais frei Fermenter lagen damit<br />
2016 im Schnitt bei etwa 42 Euro je Tonne<br />
Frischmasse. Bei Standardgaserträgen<br />
und einem Nutzungsgrad von 39 Prozent<br />
resultieren daraus Stromgestehungskosten<br />
von 10,2 Cent pro Kilowattstunde (kWh).<br />
Getreide-GPS liegt in ähnlicher Höhe.<br />
Die Entwicklung der Biomassepreise in<br />
Relation zu den Vorjahren zeigt Abbildung<br />
4. Das Basisjahr für den dort gezeigten<br />
Substratpreisindex ist 2010. Die jeweils<br />
rechte Säule zeigt den Indexwert für das<br />
Jahr 2016 an. Dieser liegt mit Ausnahme<br />
der Säule für Zuckerrüben unterhalb des<br />
Wertes für 2015, was eine Preisreduktion<br />
zeigt. Der Preisindex für Silomais ist<br />
beispielsweise um fast 10 Prozentpunkte<br />
gefallen, der von Getreide-GPS um 4 Prozentpunkte.<br />
Sehr auffällig ist der Index für<br />
Getreidekorn, der nochmals weiter gefallen<br />
ist.<br />
Nach den zwei Hochpreisjahren 2011 und<br />
2012 liegt Getreidekorn mittlerweile relativ<br />
deutlich unter dem Vergleichswert aus<br />
dem Jahr 2010. Getreidekorn wird häufig<br />
zu Marktpreisen gehandelt, und diese waren<br />
auch 2016 nicht wirklich positiv. Der<br />
Preisindex über alle Substrate hinweg ist<br />
fast genau beim Vergleichswert aus dem<br />
Jahr 2010 angekommen und liegt bei<br />
100,1. Dies entspricht einem Rückgang<br />
um gut sieben Prozentpunkte im Vergleich<br />
zum Vorjahr.<br />
Fazit: Es scheint, als ob das Jahr 2015 ein<br />
Ausnahmejahr war und auch die Biomassepreise<br />
eher dem allgemeinen Trend auf den<br />
Agrarmärkten folgen. Angesichts steigender<br />
sonstiger Kosten, fixer Vergütungserlöse<br />
und der knappen Vergütung in der Anschlussförderung<br />
wäre es für die Branche<br />
gut, wenn sich die Preise in der Tat auf dem<br />
jetzigen Niveau stabilisieren würden.<br />
Exkurs: Preise für Wirtschaftsdünger<br />
und Gärprodukte<br />
Wenig Bewegung im Vergleich zu den<br />
Vorjahren gab es bei den Preisen für Wirtschaftsdünger<br />
oder Gärprodukte (siehe<br />
Tabelle 2). Rindergülle wechselt für durchschnittlich<br />
3 Euro je Kubikmeter den Besitzer,<br />
während Schweinegülle leicht günstiger<br />
gehandelt wird. Etwas überraschend<br />
ist, dass Rinderfestmist trotz des höheren<br />
Energiegehalts nur unwesentlich teurer gehandelt<br />
wird (4 Euro je Tonne). Deutlich<br />
teurer ist hingegen der „energiereiche“<br />
Hühnertrockenkot (etwa 18 Euro je Tonne).<br />
Auf der Outputseite der Biogasanlage wird<br />
das Gärprodukt mit nur 2 Euro die Tonne<br />
abgegeben, was angesichts der höherwertigen<br />
Düngewirkung doch verwundert.<br />
Der Mittelwert ist vor allem deswegen so<br />
niedrig, weil zahlreiche Betreiber angegeben<br />
haben, dass das Gärprodukt kostenlos<br />
abgegeben wird.<br />
Hinweis: Wie jedes Jahr bestehen die vorgestellten<br />
Preis- und Mengenangaben aus<br />
Mittelwerten. Es bestanden bei den eingegangenen<br />
Fragebögen jedoch zum Teil erhebliche<br />
regionale Unterschiede. Die Zahlen<br />
dienen aus diesem Grund der besseren<br />
Orientierung und können nicht auf bestehende<br />
Lieferverträge angewandt werden.<br />
Der Fachverband Biogas e.V. wird auch dieses<br />
Jahr eine Umfrage unter seinen Betreibermitgliedern<br />
durchführen. Um auch in<br />
Zukunft eine transparente Preisverteilung<br />
darstellen und Trends beobachten zu können,<br />
sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.<br />
Vielen Dank noch einmal an alle Betreiber,<br />
die durch die Rücksendung des ausgefüllten<br />
Fragebogens dazu beigetragen haben,<br />
dass auch dieses Jahr eine aussagekräftige<br />
und hilfreiche Analyse der Substratpreise<br />
veröffentlicht werden konnte.<br />
Autor<br />
Dr. Stefan Rauh<br />
Geschäftsführer<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 ∙ 85356 Freising<br />
Tel. 0 81 61/98 46 60<br />
E-Mail: info@biogas.org<br />
41<br />
Auszug aus unserem<br />
Produktsortiment<br />
Kompaktzähler<br />
Kompaktzähler<br />
Funk<br />
Großzähler<br />
Stromzähler<br />
Gaszähler<br />
Biogaszähler<br />
Ölzähler<br />
Systemtechnik<br />
INFOS ANFORDERN – Fax: 07 11 / 35 16 95 - 29<br />
E-Mail: info@molline.de<br />
www.molline.de/kontakt<br />
www.molline.de
Praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Biomethan<br />
Noch Zubau bei Einspeiseanlagen<br />
Der Neubau von Anlagen, die Biomethan ins Erdgasnetz einspeisen, ging in Deutschland im Jahr 2016 auf<br />
kleiner Flamme weiter. Im Bestand wird auch die eine oder andere Anlage ans Erdgasnetz angeschlossen.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Im Jahr 2016 wurden 10 neue<br />
Anlagen, die Biomethan ins<br />
Erdgasnetz einspeisen, in Betrieb<br />
genommen (siehe Abbildung<br />
1). Das sind 6 Anlagen<br />
weniger als 2015. Damit setzt sich<br />
die 2013 begonnene Negativentwicklung<br />
weiter fort. Ende 2016<br />
speisten 193 Anlagen Biomethan<br />
in das deutsche Erdgasnetz ein.<br />
Die neu errichtete Rohgasaufbereitungskapazität<br />
erreichte im vergangenen<br />
Jahr 12.200 Normkubikmeter<br />
pro Stunde (siehe Abbildung 2).<br />
Die Zahl der Gesamtanlagen verteilt<br />
sich auf die Bundesländer wie folgt:<br />
ffNiedersachsen: 30<br />
ffSachsen-Anhalt: 31 (+1)<br />
ffBayern: 18<br />
ffBrandenburg: 24 (+4)<br />
ffHessen: 13<br />
ffNordrhein-Westfalen: 14 (+1)<br />
ffMecklenburg-Vorpommern: 16 (+1)<br />
ffSachsen: 13 (+1)<br />
ffBaden-Württemberg: 13<br />
ffThüringen: 9<br />
ffSchleswig-Holstein: 4<br />
ffRheinland-Pfalz: 5 (+2)<br />
ffBerlin, Saarland, Hamburg: je 1<br />
15<br />
Abbildung 1: Entwicklung der Zahl der Biomethaneinspeiseanlagen in Deutschland,<br />
jährlicher Zubau seit 2006<br />
Entwicklung der Zahl der Biomethaneinspeiseanlagen in Deutschland, jährlicher Zubau seit 2006<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
10<br />
5<br />
0<br />
2 3<br />
7<br />
17<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Der stärkste Zubau hat in Brandenburg<br />
stattgefunden. Die kleinste im vergangenen<br />
Jahr errichtete Einspeiseanlage verfügt<br />
über eine Rohgasaufbereitungskapazität<br />
von 700 Normkubikmetern pro Stunde.<br />
Die größten im vergangenen Jahr errichteten<br />
Einspeiseanlagen können 1.400 Normkubikmeter<br />
Rohgas pro Stunde verarbeiten.<br />
Die Rohgasaufbereitungskapazität beträgt<br />
in Summe für das zurückliegende Jahr<br />
12.200 Normkubikmeter pro Stunde. Sie<br />
liegt damit 3.100 Normkubikmeter niedriger<br />
als in 2015. Die gesamte in Deutschland<br />
errichtete Rohgasaufbereitungskapazität<br />
stieg bis Ende 2016 auf 201.865<br />
Normkubikmeter pro Stunde an.<br />
Von den 2016er Einspeiseanlagen vergären<br />
9 nachwachsende Rohstoffe (NawaRo).<br />
Eine Anlage nutzt Wasserstoff und CO 2<br />
, um<br />
synthetisches Biomethan zu produzieren.<br />
Folgende Häufigkeit ergibt sich 2016 bei<br />
der Wahl der Gasaufbereitungsverfahren:<br />
ffDruckwasserwäsche: 3<br />
ffMembranverfahren: 3<br />
ffAminwäsche: 0<br />
ffDruckwechseladsorption: 1<br />
ffOrgan.-physikal. Wäsche: 2<br />
ffPolyglycol-Wäsche: 1<br />
ffBiologische Methanisierung: 1<br />
Bei einer durchschnittlichen jährlichen<br />
Laufzeit von rund 8.500 Stunden können die<br />
193 am Erdgasnetz befindlichen Anlagen<br />
1,71 Milliarden (Mrd.) Kubikmeter Rohbiogas<br />
verarbeiten. Setzt man einen Methangehalt<br />
des Rohbiogases von durchschnittlich<br />
55 Prozent an, weil die überwiegende Zahl<br />
der Anlagen nachwachsende Rohstoffe vergärt,<br />
so können jährlich theoretisch rund<br />
940 Millionen Kubikmeter Biomethan ins<br />
19<br />
32<br />
35<br />
29<br />
23<br />
16<br />
Quelle: Fachverband Biogas e.V., Stand: 1. April <strong>2017</strong><br />
Quelle: Fachverband Biogas e.V., Stand: 1. März <strong>2017</strong><br />
deutsche Erdgasnetz eingespeist werden.<br />
Das entspricht etwa 12,3 Prozent (%) des<br />
2016 in Deutschland geförderten Erdgases.<br />
Die heimische Erdgasförderung ist in 2016<br />
um 8 % auf 76,5 Mrd. Kilowattstunden<br />
(kWh) zurückgegangen. Bezogen auf den<br />
Erdgasverbrauch in Deutschland im vergangenen<br />
Jahr hat Biomethan einen Anteil<br />
von 1 %. Die aktuelle Produktionsmenge<br />
reicht zudem, um rund 2,6 Millionen deutsche<br />
Haushalte (Verbrauch von 3.500 kWh<br />
Wärme pro Jahr) mit Biomethan voll zu versorgen.<br />
Ausblick: Der Zubau von Biomethaneinspeiseanlagen<br />
wird <strong>2017</strong> voraussichtlich im<br />
einstelligen Bereich stattfinden. Drei Anlagen<br />
sind in der Umsetzung, die demnächst<br />
ans Netz angeschlossen werden können.<br />
2016 stieg Erdgasverbrauch an<br />
Der Erdgasverbrauch in Deutschland nahm<br />
2016 laut AG Energiebilanzen um rund 9,5<br />
Prozent auf 930 Mrd. kWh zu. Dieser Zuwachs<br />
sei durch verschiedene Faktoren beeinflusst.<br />
So habe die Durchschnittstemperatur<br />
des Jahres 2016 mit 9,5 Grad Celsius<br />
zwar um 0,6 Grad über dem langjährigen<br />
10<br />
2013 2014 2015 2016<br />
42
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Praxis<br />
Primärenergieverbrauch<br />
in Deutschland 2016<br />
Wichtigster Primärenergieträger blieb auch 2016<br />
das Mineralöl mit einem Anteil von rund 34 Prozent<br />
(%). Es folgte das Erdgas mit einem auf 22,6 % gestiegenen<br />
Anteil (2015: 20,9 %). Sinkende Anteile<br />
gab es bei der Steinkohle (von 13,0 % auf 12,2 %)<br />
und bei der Braunkohle (von 11,8 % auf 11,4 %).<br />
Deutlicher ist der Anteil der Kernenergie zurückgegangen,<br />
und zwar von 7,6 % auf 6,9 %. Die Erneuerbaren<br />
Energien konnten dagegen abermals ihren<br />
Anteil vergrößern, wenn auch nur leicht von 12,4 %<br />
auf 12,6 %. Gleichwohl rangieren die erneuerbaren<br />
Energieträger inzwischen an dritter Stelle aller<br />
Energieträger. Die sonstigen Energieträger trugen<br />
wie im Vorjahr weniger als 2 % zur Deckung der<br />
Energienachfrage bei. Quelle: AG Energiebilanzen<br />
Abbildung<br />
Entwicklung<br />
2: Entwicklung<br />
der Rohgasaufbereitungskapazität<br />
der Rohgasaufbereitungskapazität<br />
in Nm 3 /h<br />
in Nm<br />
in Deutschland, 3 /h in Deutschland,<br />
jährlicher<br />
Zubau seit 2006 und kumuliert<br />
jährlicher Zubau seit 2006 und kumuliert<br />
28.250 19.830<br />
3.150<br />
1.000 2.150<br />
4.635 7.785<br />
2006 2007 2008 2009<br />
36.035 55.865<br />
Quelle: Quelle: Fachverband Biogas e.V., Biogas Stand: e.V., 1. März Stand: <strong>2017</strong>1. April <strong>2017</strong><br />
89.065<br />
33.200 35.200<br />
2010 2011<br />
Mittel von 1981 bis 2010,<br />
250.000<br />
aber deutlich unter der des<br />
Vorjahres (2015: 9,9 °C)<br />
200.000<br />
gelegen. Allerdings sei die<br />
unterjährige Entwicklung<br />
150.000<br />
der Witterung uneinheitlich<br />
gewesen. Die AG<br />
100.000<br />
Energiebilanzen schreibt<br />
weiter: „So gab es vor allem<br />
zu Beginn des Jahres<br />
50.000<br />
starke Abweichungen zu<br />
den Vorjahrestemperaturen:<br />
Der Januar war zwar<br />
0<br />
kälter als 2015, der Februar<br />
hingegen war sowohl<br />
im Vorjahresvergleich als<br />
im Vergleich zum langjährigen<br />
Mittel deutlich zu warm. Ein zweiter<br />
Aspekt, der zu einem höheren Erdgasverbrauch<br />
führte, war der verstärkte Einsatz<br />
von Erdgas in den Anlagen der Energieversorger<br />
zur Strom- und Wärmeversorgung.<br />
Preisentwicklung und Effizienz sind dafür<br />
die beiden maßgeblichen Gründe: Der<br />
Anteil des aus Erdgas erzeugten Stroms<br />
bezogen auf die Bruttostromerzeugung in<br />
Deutschland wuchs um knapp 3 Prozentpunkte<br />
auf 12,4 %.“<br />
Bei der Verwendung von Erdgas in den einzelnen<br />
Verbrauchssektoren zeichnen sich<br />
wie im Jahresbericht der AG Energiebilanzen<br />
aufgeführt für 2016 bisher folgende<br />
Entwicklungen ab:<br />
ffIm Raumwärmemarkt konnte nach dem<br />
starken Rückgang im Jahr 2014 und<br />
dem moderaten Anstieg 2015 wiederholt<br />
eine deutliche Absatzsteigerung verzeichnet<br />
werden. Der Erdgasverbrauch<br />
der privaten Haushalte sowie der Gewerbe-<br />
und Dienstleistungsunternehmen<br />
stieg um 11 %. Die Zahl der Erdgasheizungen<br />
nahm weiter zu. Insgesamt waren<br />
zum Jahresende 2016 knapp 20,5 Mio.<br />
Wohnungen oder 49,4 % des Wohnungsbestands<br />
mit einer Gasheizung ausgestattet.<br />
ffDie Nachfrage der Industrie nach Erdgas<br />
als Rohstoff und als Brennstoff in den<br />
Industriekraftwerken nahm nach ersten<br />
Schätzungen leicht um 1 % zu.<br />
ffDer Einsatz von Erdgas in den Kraft- und<br />
Heizwerken der allgemeinen Versorgung<br />
verzeichnete einen starken Zuwachs:<br />
Aufgrund der für Erdgas günstigen<br />
Preisentwicklung im Vergleich zu anderen<br />
Energieträgern und der punktuell<br />
weniger guten Verfügbarkeit Erneuerbarer<br />
Energien nahm die Verstromung<br />
von Erdgas erstmals wieder deutlich zu.<br />
In den Kraft- und Heizkraftwerken der<br />
Stromversorger wurde nach vorläufigen<br />
Zahlen 33 % mehr Erdgas als Brennstoff<br />
genutzt.<br />
ffIn den Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen<br />
der allgemeinen Versorgung wurden<br />
2016 gut 20 % mehr Erdgas eingesetzt,<br />
in der ungekoppelten Stromerzeugung,<br />
wo es sich allerdings nur um geringe Mengen<br />
handelt, waren es sogar 125 %. Die<br />
bereits erwähnten kühleren Temperaturen<br />
in der Heizperiode und die steigende<br />
Anzahl von Fernwärmeanschlüssen führten<br />
zu einem verstärkten Einsatz in Heizwerken.<br />
In Summe wurde ein Anstieg von<br />
32,5 % beim Erdgaseinsatz in der Stromund<br />
Wärmeversorgung verzeichnet.<br />
124.265<br />
151.115<br />
26.850 23.250<br />
2012 2013<br />
174.365<br />
15.300<br />
189.665<br />
12.200<br />
201.865<br />
2014 2015 2016<br />
Jährl. Zubau d. Rohgasaufbereitungskapazität in Nm³/h<br />
Kumulierter Zubau d. Rohgasaufbereitungskapazität<br />
In dem Bericht der AG Energiebilanzen<br />
heißt es weiter: „Der Anteil von Erdgas am<br />
gesamten Primärenergieverbrauch stieg verglichen<br />
mit 2015 um 1,7 Prozentpunkte auf<br />
22,6 % im Jahr 2016. Das Erdgasaufkommen<br />
in Deutschland ging 2016 gegenüber<br />
dem Vorjahr leicht um 1,3 % auf 1.178<br />
Mrd. kWh zurück. Gut 6 % des Erdgasaufkommens<br />
in Deutschland stammten aus inländischer<br />
Förderung, knapp 94 % wurden<br />
importiert. Die inländische Förderung sank<br />
um 8,0 % auf 76,5 Mrd. kWh. Die Erdgasimporte<br />
Deutschlands nahmen um 1 %<br />
ab. Die Erdgasexporte Deutschlands gingen<br />
nach einem deutlichen Plus im Jahr 2015<br />
im Berichtsjahr um rund 29 % zurück.<br />
Ersten Zahlen zufolge wurden im Berichtsjahr<br />
9,4 Mrd. kWh auf Erdgasqualität aufbereitetes<br />
Biogas in das deutsche Erdgasnetz<br />
eingespeist. Im Jahr 2015 waren es 8,4<br />
Mrd. kWh. Rund 8 Mrd. kWh davon gingen<br />
in die Stromerzeugung, rund 0,4 Mrd. kWh<br />
wurden als Kraftstoff eingesetzt, rund 0,3<br />
Mrd. kWh fanden im Raumwärmemarkt<br />
Absatz. Weitere 0,7 Mrd. kWh wurden zum<br />
Beispiel stofflich genutzt, exportiert oder<br />
fanden sonstigen Einsatz.“ Entsprechend<br />
dem Bilanzierungsschema der AG Energiebilanzen<br />
werden diese Mengen sowohl<br />
auf der Aufkommens- als auch auf der Verbrauchsseite<br />
unter Erneuerbaren Energien<br />
und nicht unter Erdgas erfasst.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Tel. 0 54 09/90 69 426<br />
E-Mail: martin.bensmann@biogas.org<br />
43
Praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Biomethan-Aufbereitungsanlagen in Deutschland, nur Zubau 2016 Stand: April <strong>2017</strong><br />
Standort,<br />
Bundesland<br />
Thierbach,<br />
Sachsen<br />
Neuhardenberg,<br />
Brandenburg<br />
Lenzen,<br />
Brandenburg<br />
Bergheim-<br />
Paffendorf,<br />
NRW<br />
Beerfelde,<br />
Brandenburg<br />
Genthin,<br />
S-A<br />
Penkun,<br />
M-V<br />
Platten,<br />
Rheinland-Pfalz<br />
Pirmasens/Winzeln,<br />
Rheinland-Pfalz<br />
Vettin,<br />
Brandenburg<br />
Eigentümer<br />
Eigentümerin Biogasanlage: UDI Biogas Thierbach GmbH & Co.KG.<br />
Eigentümerin Aufbereitungsanlage: UDI Biogas Thierbach GmbH & Co.KG.<br />
Eigentümerin Einspeiseanlage: UDI Biogas Thierbach GmbH & Co.KG.<br />
Eigentümerin Biogasanlage: Biogas Neuhardenberg GmbH.<br />
Eigentümerin Aufbereitungsanlage: Biogas Neuhardenberg GmbH.<br />
Eigentümerin Einspeiseanlage: Biogas Neuhardenberg GmbH.<br />
Eigentümerin Biogasanlage: Rinderzucht Lenzen AG, ARGE Cumlosen GmbH, Schönberger<br />
Gemüsehof GmbH und Biogas Osters & Voß Beteiligungs GmbH & Co.KG.<br />
Eigentümerin Aufbereitungsanlage: Rinderzucht Lenzen AG, ARGE Cumlosen GmbH, Schönberger<br />
Gemüsehof GmbH und Biogas Osters & Voß Beteiligungs GmbH & Co.KG.<br />
Eigentümerin Einspeiseanlage: Hansewerk AG.<br />
Eigentümerin Biogasanlage: RWE Innogy GmbH,<br />
Eigentümerin Aufbereitungsanlage: RWE Innogy GmbH.<br />
Eigentümerin Einspeiseanlage: Thyssengas<br />
Eigentümerin Biogasanlage: BKW Beerfelde GmbH & Co. KG.<br />
Eigentümerin Aufbereitungsanlage: BKW Beerfelde GmbH & Co.KG.<br />
Eigentümerin Biogasanlage: Enertec Biogas Genthin GmbH.<br />
Eigentümerin Aufbereitungsanlage: Enertec Biogas Genthin GmbH.<br />
Eigentümerin Einspeiseanlage: avacon.<br />
Eigentümerin Biogasanlage: GENO Bioenergie Leasindfonds Erste GmbH & Co.KG.<br />
Eigentümerin Aufbereitungsanlage: Biomethan Penkun GmbH.<br />
Eigentümerin Einspeiseanlage: E.DIS AG.<br />
Eigentümerin Biogasanlage: Enagra Biogas Eins GmbH & Co.KG und Enagra Biogas Zwei GmbH & Co.KG.<br />
Eigentümerin Aufbereitungsanlage: NatürlichEnergie GmbH.<br />
Eigentümerin Einspeiseanlage: Creos Deutschland GmbH.<br />
Eigentümerin Biogasanlage: Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.<br />
Eigentümerin Aufbereitungsanlage: Prüfu. Forschungsinstitut Pirmasens e.V.<br />
Eigentümerin Einspeiseanlage: Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH.<br />
Eigentümerin Biogasanlage: Biogas Osters & Voß Beteiligungs GmbH & Co.KG.<br />
Eigentümerin Aufbereitungsanlage: Biogas Osters & Voß Beteiligungs GmbH & Co.KG.<br />
Eigentümerin Einspeiseanlage: E.DIS AG.<br />
Betreiber<br />
Betreiberin Biogasanlage: UDI Biogas Thierbach GmbH & Co.KG.<br />
Betreiberin Aufbereitungsanlage: UDI Biogas Thierbach GmbH & Co.KG.<br />
Betreiberin Einspeiseanlage: Ontras Gastransport GmbH.<br />
Betreiberin Biogasanlage: Biogas Neuhardenberg GmbH.<br />
Betreiberin Aufbereitungsanlage: Biogas Neuhardenberg GmbH.<br />
Betreiberin Einspeiseanlage: EWE.<br />
Betreiberin Biogasanlage: Biogas Osters & Voß Service GmbH & Co.KG.<br />
Betreiberin Aufbereitungsanlage: Biogas Osters & Voß Service GmbH & Co.KG.<br />
Betreiberin Einspeiseanlage: Hansewerk AG.<br />
Betreiberin Biogasanlage: BayWa r.e. Bioenergy GmbH.<br />
Betreiberin Aufbereitungsanlage: BayWa r.e. Bioenergy GmbH.<br />
Betreiberin Einspeiseanlage: Gasversorgung Dessau GmbH.<br />
Betreiberin Biogasanlage: BKW Beerfelde GmbH & Co. KG.<br />
Betreiberin Aufbereitungsanlage: BKW Beerfelde GmbH & Co.KG.<br />
Betreiberin Biogasanlage: Enertec Biogas Genthin GmbH.<br />
Betreiberin Aufbereitungsanlage: Enertec Biogas Genthin GmbH.<br />
Betreiberin Einspeiseanlage: avacon<br />
Betreiberin Biogasanlage: NAWARO Bioenergiepark Klarsee GmbH.<br />
Betreiberin Aufbereitungsanlage: Biomethan Penkun GmbH.<br />
Betreiberin Einspeiseanlage: E.DIS AG.<br />
Betreiberin Biogasanlage: Enagra Biogas GmbH.<br />
Betreiberin Aufbereitungsanlage: NatürlichEnergie GmbH.<br />
Betreiberin Einspeiseanlage: Creos Deutschland GmbH.<br />
Betreiberin Biogasanlage: Prüf- u. Forschungsinstitut Pirmasens e.V.<br />
Betreiberin Aufbereitungsanlage: Prüf- u. Forschungsinstitut Pirmasens e.V.<br />
Betreiberin Einspeiseanlage: Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH.<br />
Betreiberin Biogasanlage: Biogas Osters & Voß Service GmbH & Co.KG.<br />
Betreiberin Aufbereitungsanlage: Biogas Osters & Voß Service GmbH & Co.KG.<br />
Betreiberin Einspeiseanlage: E.DIS AG.<br />
Im Juli Mais säen!<br />
PYROXENIA<br />
FAO ~130<br />
ZWISCHEN-<br />
FRUCHTMAIS<br />
3-jährig<br />
erfolgreich<br />
& ausverkauft!<br />
• Aufgang – Ernte: Nur 105 Tage<br />
• Aussaatfenster: 20. Mai – 15. Juli<br />
• Mais nach Grünroggen und GPS-Getreide<br />
• Bis zu 40 t Ertrag<br />
PYROXENIA-Clip<br />
anschauen<br />
44<br />
www.agasaat-mais.de<br />
Kontakt: agaSAAT-Team<br />
Tel.: +49 2845 - 381 90 27<br />
agnann@agasaat-mais.de
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Praxis<br />
Einspeisung Rohstoff Rohgas-Aufbereitungskapazität<br />
Art der Gas aubereitung<br />
Erdgasnetz<br />
Feb 16 NawaRo 1.400 Nm³/h Druckwäsche<br />
(Polyglykolwäsche)<br />
63 bar, Netz der Ontras<br />
Gastransport GmbH.<br />
Mrz 16 NawaRo u. Mist 700 Nm³/h Membranverfahren, dreistufig,<br />
PlanET eco ® gas<br />
Niederdrucknetz von EWE<br />
Apr 16 NawaRo 1.400 Nm³/h Organisch-physikalische Wäsche 25 bar, Erdgasnetz der Hansewerk AG.<br />
Mai 16 NawaRo 1.400 Nm³/h Druckwasserwäsche k.A.<br />
Mai 16 NawaRo 1.400 Nm³/h Druckwasserwäsche k.A.<br />
Mai 16 NawaRo 1.000 Nm³/h Druckwasserwäsche k.A.<br />
Jul 16 NawaRo 1.400 Nm³/h Membrantrennverfahren DP 4/DP 25, Netz der E.DIS AG.<br />
Jul 16 NawaRo 1.400 Nm³/h Druckwechseladsorption 50 bar, Netz der Creos Deutschland<br />
GmbH.<br />
Sep 16 NawaRo 700 Nm³/h Biotechnologische Methan-Synthese<br />
mittels Bakterien in einem Rieselstromreaktor<br />
Dez 16<br />
Festmist, Gülle,<br />
NawaRo<br />
Druckstufe im Erdgasnetz: 560 mbar.<br />
Netz der Stadtwerke Pirmasens<br />
Versorgungs GmbH.<br />
1.400 Nm³/h Organisch-physikalische Wäsche 3 bar, Netz von E.DIS AG.<br />
Quelle: Fachverband Biogas e.V.<br />
BHKW im Container: 800 kW, 999 kW, 1.169 kW, 1.562 kW, 1.950 kW el. Leistung<br />
BHKW im Container: 800 kW, 999 kW, 1.169 kW, 1.562 kW, 1.950 kW el. Leistung<br />
500 kW, 525 kW el. Leistung<br />
500 kW, 525 kW el. Leistung<br />
Das passende BHKW für die Flexibilisierung:<br />
250 – 2.000 kW mit Motoren von Scania, Liebherr und MTU.<br />
Setzen<br />
Setzen<br />
Sie<br />
Sie<br />
auf<br />
auf<br />
zuverlässige<br />
zuverlässige<br />
Blockheizkraftwerke<br />
Blockheizkraftwerke<br />
sowie<br />
sowie<br />
auf<br />
auf<br />
ein<br />
ein<br />
flächendeckendes<br />
flächendeckendes<br />
Servicenetz<br />
Servicenetz<br />
und<br />
und<br />
sichern<br />
sichern<br />
Sie<br />
Sie<br />
sich<br />
sich<br />
den<br />
den<br />
maximalen<br />
maximalen<br />
Ertrag<br />
Ertrag<br />
aus<br />
aus<br />
Ihrer<br />
Ihrer<br />
Biogasanlage.<br />
Biogasanlage.<br />
Gerne<br />
Gerne<br />
informieren<br />
informieren<br />
wir<br />
wir<br />
Sie<br />
Sie<br />
auch<br />
auch<br />
über<br />
über<br />
unser<br />
unser<br />
komplettes<br />
komplettes<br />
Produktportfolio<br />
Produktportfolio<br />
von<br />
von<br />
25<br />
25<br />
kW<br />
kW<br />
- 2 MW.<br />
MW.<br />
SCHNELL Motoren GmbH | Tel: +49 7520 9661-0<br />
SCHNELL Motoren GmbH Tel: +49 7520 9661-0<br />
www.schnellmotoren.de | Ein Unternehmen der TEDOM Group.<br />
www.schnellmotoren.de Ein Unternehmen der TEDOM Group.<br />
45
Praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Fotos: Martin Bensmann<br />
Silierte Zuckerrübenstücke<br />
aus der<br />
Maisstrohsilage.<br />
Zuckerrübe versüßt Maisstrohsilage<br />
Das Vergären von Stroh, insbesondere von Maisstroh, wird zurzeit viel diskutiert und von<br />
einigen Praktikern erprobt. Erste Erfahrungen sind vielversprechend.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Von links: Dietrich<br />
Baye, Produktmanager<br />
der Firma Geringhoff,<br />
Lohnunternehmer<br />
Michael Klapprott<br />
und Anlagenbetreiber<br />
Hermann-Josef Pieper.<br />
Jedes Jahr im Herbst rollen die Mähdrescher<br />
über die Maisäcker, schneiden die trockenen<br />
Maispflanzen ab, pflücken dabei den Kolben<br />
vom Stängel und dreschen die Körner aus.<br />
Dabei bleibt die gesamte Pflanze – bis auf die<br />
Körner – klein gehäckselt auf dem Feld zurück. Bislang<br />
blieben die großen Strohmengen ungenutzt, wurden lediglich<br />
eingegrubbert beziehungsweise untergepflügt,<br />
was ackerbauliche Probleme mit sich bringen kann.<br />
So entsteht zum Beispiel beim Pflügen in der Furche<br />
eine sogenannte Strohmatratze, die unerwünscht ist.<br />
Strohreste an der Bodenoberfläche können von Fusarien<br />
befallen werden, die in nachfolgenden Getreidekulturen<br />
zu Pilzinfektionen führen können. Außerdem ist<br />
das Stroh in der Nährstoffbilanz voll anzurechnen, was<br />
in Nährstoffüberschussregionen die Notwendigkeit des<br />
Nährstoffexports weiter erhöht.<br />
Da das Maisstroh aber noch einen gewissen Energiegehalt<br />
besitzt, kann es sinnvoll in Biogasanlagen vergoren<br />
werden. Gleichzeitig mildert die Verwertung in Biogasanlagen<br />
die ackerbaulichen Probleme des Maisstrohs.<br />
Untersuchungen der Bayerischen Landesanstalt für<br />
Landwirtschaft zeigen, dass das Maisstroh rund 80<br />
bis 90 Prozent des Methanertrages von Silomais liefert<br />
(siehe Biogas Journal 2_17). In Deutschland wurde laut<br />
Deutschem Maiskomitee in 2016 auf rund 416.200<br />
Hektar Körnermais inklusive CCM angebaut.<br />
Körnermaisanbau regional stark verbreitet<br />
Auf der Suche nach preiswertem Ersatz für Silomais<br />
war im vergangenen Jahr auch Hermann-Josef Pieper,<br />
der in Dörpen im nördlichen Emsland (Niedersachsen)<br />
Geschäftsführer von zwei Biogasanlagen ist – die BERD<br />
und BERDZWO GmbH & Co.KG, ein Zusammenschluss<br />
von sechs Landwirten. „Wir haben bereits vor vier Jahren<br />
begonnen, durch den Einsatz von Zuckerrüben den<br />
Silomaisanteil zu verringern. Wir haben auch versucht,<br />
Grassilage aus Ackergrasmischungen einzusetzen, aber<br />
deren Verwendung ist aufgrund der hohen Flächen- beziehungsweise<br />
Pachtkosten wirtschaftlich nicht darstellbar“,<br />
verdeutlicht Pieper. Da es neben Silomais<br />
auch reichlich Körnermaisanbau in seiner Region gibt,<br />
begann er in diese Richtung Überlegungen anzustellen.<br />
Auf einer Tagung Ende August letzten Jahres in Heiden<br />
in Nordrhein-Westfalen sammelte Pieper Infos und<br />
knüpfte zudem einen wichtigen Kontakt zu Dietrich<br />
Baye, Produktmanager bei der Firma Geringhoff, die<br />
unter anderem Maispflückvorsätze für Mähdrescher<br />
entwickelt und herstellt. Der neuartige Pflückvorsatz<br />
MS Collect, der im vergangenen Jahr den Biogas-Innovationspreis<br />
2016 in Osnabrück erhalten hat (sie-<br />
46
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
INNOVATIVE Praxis<br />
EINBRINGTECHNIK<br />
FÜR BIOGAS- UND<br />
RECYCLINGANLAGEN<br />
BIG-Mix 35 bis 210m³<br />
Maisstroh-Zuckerrübensilage nach viermonatiger Lagerdauer. Die Silage sieht hervorragend aus.<br />
he Biogas Journal 4_16), schwadet das<br />
Maisstroh. Die gekröpften Häckslermesser<br />
unter dem Pflücker häckseln die Restpflanzenteile<br />
nach dem Pflückvorgang. Ohne<br />
Bodenkontakt werden die Pflanzenteile in<br />
eine dahinter angebrachte Mulde geworfen.<br />
Eine in der Mulde befindliche Schnecke<br />
fördert das Maisstroh zur Mitte und legt<br />
es kompakt zu einem Schwad unter dem<br />
Mähdrescher ab. Die Kolben werden vom<br />
Dreschwerk ausgedroschen. Spindeln und<br />
Lieschen fallen nach dem Dreschvorgang<br />
auf das Schwad. So kommt zusätzlich<br />
Energie in das Biogassubstrat.<br />
Die Vorteile des Verfahrens liegen auf der<br />
Hand: Ein separater Arbeitsschritt für das<br />
Schwaden entfällt, was sich günstig in den<br />
Bergekosten niederschlägt. Außerdem<br />
gelangt so mehr Maisstroh ins Schwad,<br />
was mit separat eingesetzten Geräten so<br />
nicht gelingt. 50 bis 60 Prozent des im<br />
Schwad liegenden Strohs lassen sich anschließend<br />
technisch ernten, wie Praxiserfahrungen<br />
inzwischen belegen. Auf sehr<br />
steinigen Standorten scheidet die separate<br />
Schwadtechnik im Grunde aus, weil Steine<br />
im Schwad Häcksler oder Ladewagen<br />
beschädigen können oder zumindest den<br />
Verschleiß stark erhöhen.<br />
Stroh direkt hinter Drescher<br />
ernten<br />
Baye hat Pieper vorgeschlagen, die Zuckerrüben<br />
in die Maisstrohsilage hineinzuschnitzeln.<br />
Und so wurde es im letzten<br />
Herbst auch gemacht. Laut Pieper wurde<br />
der Körnermais am 21./22. Oktober gedroschen.<br />
Am Drescher war ein 8-reihiger<br />
Pflückvorsatz montiert worden. An der<br />
Vorderachse war der Drescher mit einem<br />
Gummiraupenlaufwerk ausgerüstet, das<br />
den Bodendruck des Dreschers reduzieren<br />
hilft. „Trotz des Raupenlaufwerks mussten<br />
wir auf dem Vorgewende das Stroh sofort<br />
ernten, weil beim Überfahren des Strohs<br />
das Material plattgedrückt wird“, erklärt<br />
Lohnunternehmer Michael Klapprott. Das<br />
Stroh lasse sich dann kaum noch ernten.<br />
Der Lohnunternehmer hat das Maisstroh<br />
mit einem Claas Jaguar 970 mit Grassilage-<br />
Pickup gehäckselt und auf Häckselwagen<br />
übergeladen. Klapprott: „Wir müssen mit<br />
dem Häcksler immer in gleicher Richtung<br />
fahren wie der Mähdrescher. Die Maisstoppeln<br />
sind dann schon in Fahrtrichtung angekippt,<br />
sodass der Pickup besser arbeiten<br />
kann. Die Maisstoppeln haben eine Länge<br />
von 15 bis 20 Zentimetern. Der Pflückvorsatz<br />
spleist die Stängel auf, was positiv ist<br />
für die Maiszünslerbekämpfung.“ Klapprott<br />
weist darauf hin, dass der Boden schon<br />
beim Maislegen gut eingeebnet sein sollte,<br />
damit später das Stroh vernünftig abgeerntet<br />
werden kann.<br />
Baye fügt hinzu: „Der Mähdrescher mit<br />
dem achtreihigen Pflücker schafft etwa<br />
3,5 Hektar pro Stunde. Wir haben 14 bis<br />
15 Tonnen Körnermais pro Hektar geerntet.<br />
Der Häcksler könnte theoretisch etwas<br />
schneller sein als der Drescher.“ Pieper<br />
ergänzt: „Wir haben das Maisstroh aus<br />
7 bis 10 Kilometern Entfernung zur Biogasanlage<br />
gefahren. Drei Abfuhrgespanne<br />
wurden für den Transport eingesetzt.<br />
Drei Gespanne sind allerdings zu wenig.<br />
Zwischen 8 und 11,5 Tonnen Maisstroh<br />
transportierten die Anhänger pro Fuhre.<br />
14 Tonnen Stroh mit durchschnittlich 30<br />
Prozent Trockensubstanz haben wir pro<br />
Hektar geerntet.“<br />
47<br />
effektiver Vorschub bei niedrigem<br />
Eigenstromverbrauch<br />
für 100% Mist und Grassilage<br />
mit Misch- und Aufbereitungsbereich<br />
komplett aus Edelstahl<br />
Biomischer 12 bis 80m³<br />
für 100% Mist und Grassilage<br />
massive Edelstahlkonstruktion<br />
mit Misch- und Aufbereitungsbereich<br />
auf Wunsch komplett aus Edelstahl<br />
KOMBI-Mix 8 und 12m³<br />
speziell für Kleinbiogasanlagen<br />
optional mit Vertikalmischschnecke<br />
für unterschiedlichste Substrate<br />
komplett aus Edelstahl<br />
Konrad Pumpe GmbH<br />
Fon +49 2526 93290<br />
Mail info@pumpegmbh.de<br />
www.pumpegmbh.de
Praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Kennzahlen Biogasanlage BERD ZWO GmbH & Co.KG<br />
BHKW: 550 kW Jenbacher, Modell 312er.<br />
1 Fermenter: 2.000 m³ Nettovolumen.<br />
1 Nachgärer: 2.000 m³ Nettovolumen.<br />
1 Gärproduktlager: 4.800 m³ Lagervolumen.<br />
Ø Methangehalt: 51,5 Prozent.<br />
Gärresttrocknung.<br />
Fütterung: Maissilage, wenig Grassilage, Bullentretmist,<br />
Schweinemist, Rinder- und Schweinegülle, Zuckerrüben,<br />
Maisstroh-Zuckerrübensilage.<br />
Stromproduktion: 4,6 Mio. kWh, 8 Prozent Eigenbedarf.<br />
Foto: Martin Bensmann<br />
Maisstroh saugt Rübensaft auf<br />
Das gehäckselte Maisstroh wurde wie Silomais zu einem<br />
Haufen aufgeschichtet und mit einem Walzschlepper<br />
verdichtet. Ein Teleskoplader mit Schnitzelschaufel<br />
hat die Zuckerrüben in das Maisstroh eingearbeitet.<br />
Die Schaufel fasst 1,6 Tonnen Rüben. Mit dem Schnitzeln<br />
wird erst begonnen, wenn auf dem Boden eine<br />
20 Zentimeter starke Strohschicht vorhanden ist. Die<br />
Rüben kommen ungewaschen aus der Feldmiete in<br />
das Maisstroh. Die Maisstroh-Zuckerrübensilage hat<br />
gewichtsmäßig ein Verhältnis von 70 Prozent Stroh zu<br />
30 Prozent Rüben. Sickersaft ist aus dem Silohaufen<br />
nicht ausgetreten, weil das Stroh den Rübensaft sehr<br />
gut aufsaugt. Wenn das Maisstroh einen höheren TS-<br />
Gehalt hat, können auch mehr Zuckerrüben eingebracht<br />
werden. Zu den Kosten, 25 Hektar Maisstroh geerntet:<br />
Anlagenbau<br />
Ihr starker Partner für:<br />
NEU<br />
l mobile Feststoffbeschickung<br />
besonders geeignet für<br />
Umbau-/Sanierungsarbeiten<br />
und in Störfällen<br />
Substrat-Aufbereitungsund<br />
Zerkleinerungstechnik<br />
für jedes Substrat die richtige<br />
48 Aufbereitungstechnik:<br />
l Prallzerkleinerer<br />
HPZ 1200<br />
l speziell für verschleißintensive<br />
Substrate oder<br />
organische Abfälle<br />
Schubbodencontainer<br />
in Stahlbauweise<br />
l Volumen 40 m 3 – 200 m 3 ,<br />
als Twin bis 300 m 3<br />
l VA-Schubrahmen,<br />
Kunststoffauskleidung<br />
l wahlweise Dosier- oder<br />
Fräswalzen<br />
l mit Walkingfloor-System<br />
ausrüstbar<br />
Zugbodensystem in<br />
Betonbauweise<br />
l Ober-/Unterflur befahrbar<br />
l Volumen 80 – 175 m 3<br />
l VA-Schubrahmen,<br />
Kunststoffauskleidung<br />
l hydr. Verschlussrampe<br />
l hydraulische Abdeckung<br />
Kompaktsystem<br />
l komplett aus Edelstahl<br />
l Volumen 13 – 33 m 3<br />
l mit 2 Dosierwalzen<br />
Ein UnTERnEHMEn<br />
DER HUninG GRUPPE<br />
HUNING Anlagenbau GmbH<br />
& Co. KG<br />
Wellingholzhausener Str. 6<br />
D-49324 Melle<br />
Tel. +49 (0) 54 22/6 08-2 60<br />
Fax +49 (0) 54 22/6 08-2 63<br />
info@huning-anlagenbau.de<br />
www.huning-anlagenbau.de
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Praxis<br />
ffMähdrescher, 8-reihiger Schwad-Pflücker:<br />
157 Euro pro Hektar, inkl. Fahrer<br />
und Diesel.<br />
ffMaishäcksler: 195 Euro pro Stunde,<br />
inkl. Fahrer und Diesel.<br />
ffAbfuhrgespann: Schlepper mit Häckselwagen<br />
(55 m³ Ladevolumen) inkl.<br />
Fahrer und Diesel, je Gespann pro Stunde<br />
85 Euro.<br />
ffWalzschlepper pro Stunde komplett:<br />
62 Euro.<br />
ffSilo abdecken (3 Personen, Stundenlohn:<br />
15 Euro, Aufwand: 3 Stunden)<br />
inkl. Folie: 380 Euro.<br />
ff30 Prozent Zuckerrüben massenmäßig<br />
einschnitzeln ins Silo – Telelader, Fahrer,<br />
Diesel, Schnitzelschaufel – Kosten von 65 Euro<br />
pro Stunde, Kosten insgesamt: 520 Euro.<br />
ffDie Kosten pro Tonne Zuckerrüben bis Siloplatte<br />
Biogasanlage betragen 30 Euro.<br />
ffKosten pro Tonne einsilierter Trockensubstanz<br />
Maisstroh: 60 Euro, ohne Mähdruschkosten. Das<br />
Reinschnitzeln der Rüben und das Zudecken<br />
kommt noch hinzu.<br />
Weil auf der Messertrommel des Häckslers nicht alle<br />
Messer montiert waren, fanden sich im Häckselgut<br />
vermehrt Lieschblätter und auch längere Stängelteile.<br />
Lohnunternehmer Klapproth empfiehlt daher, das Maisstroh<br />
mit möglichst vielen Messern zu häckseln. So will<br />
er es in diesem Jahr machen. Den Einsatz eines Kurzschnittladewagens<br />
hält er für ungünstig, da wegen der<br />
Schnittlänge auch mehr Lieschblätter und Stängelteile<br />
durchgehen – ähnlich wie jetzt bei der messerreduzierten<br />
Trommel im Häcksler. Gleichwohl räumt er ein, dass<br />
Foto: Firma Geringhoff<br />
bei gleichem Volumen mehr Stroh auf den Ladewagen<br />
passt und die Erntekosten gegenüber dem Häcksler<br />
niedriger sind. Pieper will aber auf den Häcksler nicht<br />
verzichten, weil er vor dem Fermenter keine separate<br />
Substrataufschlusstechnik installieren will, die den Eigenstrombedarf<br />
der Biogasanlage erhöht. Er will lieber<br />
die Biologie im Gärbehälter arbeiten lassen. Die Zuckerrübe<br />
liefert in der Region etwa 90 Tonnen Frischmasse<br />
pro Hektar. Pieper will mehr Zuckerrüben anbauen,<br />
„weil die hervorragend in die Fruchtfolge passen. Die<br />
Zuckerrübe steigert zudem den Körnermaisertrag um<br />
bis zu 2 Tonnen pro Hektar.“<br />
Nach elf Wochen Lagerdauer hat der Biogasproduzent<br />
Mitte Januar den Silagehaufen geöffnet, der sich in einem<br />
sehr guten Zustand darbot. Als am 1. März das<br />
Biogas Journal für die Berichterstattung vor Ort war, war<br />
zwar schon ein Teil der Silage an die Methanbakterien<br />
verfüttert worden. Beim Herantreten an den noch vorhandenen<br />
Futterstapel roch die Silage immer noch sehr<br />
gut nach Milchsäuregärung und es waren keine Schimmelstellen<br />
zu sehen. Auch die Rübenstückchen in der<br />
Der Claas-Mähdrescher<br />
mit dem Geringhoff<br />
Maispflückvorsatz legt<br />
das Maisstroh mittig<br />
unter dem Drescher im<br />
Schwad ab. Der Häcksler<br />
fährt direkt hinter<br />
dem Drescher her, um<br />
möglichst viel von dem<br />
Stroh aufnehmen zu<br />
können.<br />
„ Energie sparen?<br />
Na klar, das mach ich<br />
mit SILASIL ENERGY.XD“<br />
www.schaumann-bioenergy.eu<br />
„Die verkürzte Reifezeit mit SILASIL ENERGY.XD bringt meinem Silo sicheren Schutz vor Nacherwärmung<br />
und Verderb. So werden Energieverluste während der Lagerphase drastisch reduziert!“<br />
Mehr Infos zu dem führenden Siliermittel-Programm erhalten Sie unter Tel. 04101 218-5400<br />
Kompetenz in Biogas<br />
49
Praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Bild oben: Abladen des gehäckselten Strohs auf dem Silohaufen.<br />
Bild Mitte: Mit dem Teleskoplader werden die Zuckerrüben in das Maisstroh geschnitzelt.<br />
Bild unten: Der Walzschlepper arbeitet mit dem Silageverteilgerät die geschnitzelten<br />
Rübenstückchen in das Stroh ein.<br />
Fotos: Firma Geringhoff<br />
Mischsilage sahen sehr gut aus. An der<br />
Entnahmeseite des Silos war auch schön<br />
zu erkennen, wie stark das Stroh durch das<br />
Festwalzen verdichtet werden konnte.<br />
Eine der spannenden Fragen war: Wie viel<br />
Biogas liefert die Mischsilage? Zur Beantwortung<br />
dieser Frage hatte Pieper Mitte<br />
Januar Proben genommen und sie zur<br />
LUFA Nord-West in Oldenburg geschickt.<br />
Ergebnis: Die Maisstroh-Zuckerrüben-Silage<br />
liefert 559 Normliter (Nl) Biogas pro<br />
Kilogramm (kg) organische Trockensubstanz<br />
(oTS) mit 51 Prozent Methangehalt!<br />
Zum Vergleich: Die analysierten Zuckerrübenschnitzel<br />
liefern 549 Nl/kg oTS mit<br />
ebenfalls 51 Prozent Methan und die reine<br />
Maissilage des Betriebes bringt es auf<br />
563 bis 565 Nl/kg oTS mit 52,5 Prozent<br />
Methananteil.<br />
Fazit: Die Maisstroh-Zuckerrüben-Silage<br />
erreicht theoretisch rund 99 Prozent des<br />
Biogasertrages reiner Maissilage aus 2016.<br />
Damit hat dieser Biomassemix voll und<br />
ganz seine Berechtigung als Gärsubstrat<br />
und Silomaisersatz. Zu beachten ist, dass<br />
etwa 4 Hektar Körnermaisstroh notwendig<br />
sind, um einen Hektar Silomais zu ersetzen.<br />
Grund: Nur rund die Hälfte des anfallenden<br />
Körnermaisstrohs lässt sich technisch ernten.<br />
Die andere Hälfte bleibt auf der Fläche.<br />
Sie kann für die Humusreproduktion angerechnet<br />
werden.<br />
Es hat sich gezeigt: Maisstroh ist der perfekte<br />
Konservierungspartner der Zuckerrübe.<br />
In dem beschriebenen Verfahren<br />
wurde deutlich, dass es keines Erdbeckens<br />
oder eines anderen Lagerbehälters bedarf,<br />
um die Zuckerrübe lagerfähig zu machen.<br />
Durch die Strohabfuhr findet ein Nährstoffabfluss<br />
statt, wodurch die abgebenden<br />
Betriebe mehr eigenen Wirtschaftsdünger<br />
ausbringen können. Für das Stroh sollten<br />
Biogasproduzenten kein Geld bezahlen.<br />
Laut Baye ist der Körnermaisanbau mit<br />
Grasuntersaaten greeningfähig. Dadurch<br />
sollen die Stroh abgebenden Betriebe<br />
pro Hektar 90 bis 120 Euro einstreichen<br />
können. Der Betrag würde die kostenfreie<br />
Stroh abgabe sogar überkompensieren.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Tel. 0 54 09/90 69 426<br />
E-Mail: martin.bensmann@biogas.org<br />
50
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Praxis<br />
Kloska<br />
Group<br />
Thomsen & Co.GmbH<br />
Engine Power Systems<br />
Service rund um den Gasmotor<br />
Service vor Ort ·Fachwerkstatt · Vertrieb Gasmotoren<br />
HAFFMANS<br />
BIOGASAUFBEREITUNG<br />
Der BHKW- Spezialist<br />
für Motoren mit<br />
Erd-, Bio- und<br />
Sondergasbetrieb<br />
Speller Straße12 · 49832 Beesten<br />
Tel.: 05905 - 945 82-0 · Fax: -11<br />
Email: mail@eps-kloska.com<br />
Internet: www.eps-kloska.com<br />
Neumodule für den<br />
Flexbetrieb<br />
von 100-1.500 kW<br />
im Container, Betonhaube<br />
oder als<br />
Gebäude-Einbindung<br />
CO 2<br />
Servicestützpunkte: Beesten, Wilhelmshaven, Lübeck, Magdeburg, Rostock<br />
Beratung · Planung · Fertigung · Montage<br />
seit<br />
1946<br />
Schalldämpfer · Schallschutzwände<br />
Maschinen-Kapselungen · Lüftungsbauteile<br />
Telefon (0 21 71) 70 98-0 · Telefax (0 21 71) 70 98-30<br />
www.stange-laermschutz.de · info@stange-laermschutz.de<br />
51<br />
Maximaler Ertrag<br />
Minimale Umweltbelastung<br />
Mit den kompakten skid-montierten CO 2<br />
-<br />
Systemen von Pentair Haffmans können Sie<br />
jede bestehende Biogasaufbereitungsanlage<br />
nachrüsten. CO 2<br />
wird aus dem Biogasstrom<br />
zurückgewonnen und steht für verschiedenste<br />
Einsatzzwecke zur Verfügung. Anlagenbetreiber<br />
können das verflüssigte CO 2<br />
auch an einen<br />
externen Abnehmer verkaufen und so eine<br />
zusätzliche Einnahmequelle erschlieβen.<br />
Die Menge an Treibhausgasen, die in die<br />
Atmosphäre gelangen, geht gegen Null.<br />
Das macht diese Technologie zu einer<br />
zukunftsweisenden Investition.<br />
BESUCHEN SIE UNS:<br />
Regatec 22.-23. Mai <strong>2017</strong><br />
Parchi del Garda, Pacengo (Verona), Italien<br />
ExpoBiogaz 31.5.-1.6.<strong>2017</strong><br />
Bordeaux, Frankreich<br />
UK AD & Biogas 5.-6. Juli <strong>2017</strong><br />
Birmingham, Großbritannien<br />
WWW.HAFFMANS.NL
Praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Biogas-Sorten-Portal nutzen<br />
Mais ist das wichtigste Substrat in Biogasanlagen<br />
mit nachwachsenden<br />
Rohstoffen. Die Maiszüchtung stellt<br />
zunehmend spezifisch für die Nutzungsrichtung<br />
Biogas selektiertes<br />
Sortenmaterial zur Verfügung. Unternehmensübergreifend<br />
werden seit 2014 Versuche zur Bewertung<br />
der Eignung von Maissorten für die Biogasproduktion<br />
durchgeführt.<br />
Das Portal „Biogas Sorten“ (www.biogas-sorten.de) –<br />
ein Service der Pro-Corn GmbH und der Züchtungsunternehmen<br />
für Mais im Deutschen Maiskomitee e.V.<br />
Die grünen Punkte im Hintergrund stellen die Standorte der in Betrieb befindlichen Biogasanlagen<br />
und Satelliten-BHKW in Deutschland auf Postleitzahlebene dar (Quelle: DBFZ 2012).<br />
Die Anbaugebiete [1 bis 22] für Mais sind durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet.<br />
Die farbigen Punkte (gelb, blau, orange, pink) stellen die Versuchsstandorte für Biogas dar<br />
(Quelle: Rath, J.: Versuchsstandorte Biogas, www.biogas-sorten.de).<br />
(DMK) – bietet dem Landwirt die Möglichkeit zur Optimierung<br />
seiner Sortenwahl für Mais in der Nutzungsrichtung<br />
Biogas sowie einen neutralen Überblick über<br />
die Versuchsergebnisse – regional, überregional und<br />
bundesweit.<br />
Sortenversuche leisten grundsätzlich einen wichtigen<br />
Beitrag zur zügigen Einführung des züchterischen<br />
Fortschritts in die landwirtschaftliche Praxis. Die<br />
Ergebnisse im Portal „Biogas Sorten“ ermöglichen<br />
durch die biometrische Vorgehensweise eine fundierte<br />
Aussage zum Leistungsvermögen einer Sorte im regionalen<br />
Anbaugebiet beziehungsweise in aggregierten<br />
Anbaugebieten (überregional – Großraum). Ergebnisse<br />
von einzelnen Standorten werden bewusst nicht veröffentlicht,<br />
da hiermit nur die Frage nach der besten<br />
Sorte im vergangenen Jahr an dem jeweiligen Ort beantwortet<br />
wird.<br />
Um die Frage zu beantworten: „Welche Sorte verspricht<br />
eine hohe und stabile Leistung in der nächsten<br />
Saison zu sein?“, sind Versuche an vielen Orten und<br />
möglichst aus mehreren Jahren notwendig. Ein Ergebnis<br />
von einem Standort bildet also keine Basis für<br />
eine Sortenentscheidung. Es ist an den Ergebnissen<br />
im „Biogas-Sorten-Portal“ zu erkennen, dass bereits<br />
nach der Zulassung einer Maissorte im Jahr 2016 im<br />
tertiären Hügelland (Anbaugebiet 14) 21 bzw. im südlichen<br />
Weser-Ems-Bereich (Anbaugebiet 4) 18 Ortsergebnisse<br />
als Basis der Sortenentscheidung <strong>2017</strong> zur<br />
Verfügung standen.<br />
Es liegt somit ein hocheffizientes Prüfsystem mit einer<br />
soliden Datenbasis für die Sortenwahl des Landwirts<br />
vor. Die im Prüfsystem ermittelten Ergebnisse werden<br />
nach Auskunft des Betreibers des Portals den Landwirtschaftskammern<br />
und Landesanstalten zur Beratung<br />
und Empfehlung zur Verfügung gestellt. Das Ziel<br />
ist, die Einrichtungen der Länder in der Erhebung von<br />
Daten zu unterstützen, damit langfristig die unabhängige<br />
Beratung bei den Ländereinrichtungen bleibt.<br />
EU-Biogassortenprüfung (EUB)<br />
Die EU-Biogassortenprüfung (EUB) stellt eine Vorprüfung<br />
für die Anbaugebietsprüfung für Biogas (AGB)<br />
dar. In der EUB werden also nur Sorten geprüft, über<br />
die keine oder unzureichende Informationen bezüglich<br />
Anbaueignung und Ertragsleistung als Biogasmais<br />
unter den Klimabedingungen der Bundesrepublik<br />
Deutschland vorliegen. Es handelt sich um Sorten, die<br />
in einem EU-Land zugelassen wurden oder zur Zulassung<br />
anstehen. Für den Landwirt bedeutet dies, dass<br />
er hier die Ergebnisse von den neuesten Sorten bzw.<br />
sogar Stämmen sieht.<br />
Die Ergebnisse der Sorten in der EU-Biogassortenprüfung<br />
werden demzufolge nach dem ersten Prüfjahr<br />
52
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Praxis<br />
zusammenfassend über alle Standorte<br />
in Deutschland getrennt nach den Reifebereichen<br />
(B1, B2, B3) dargestellt. Nach<br />
der zweijährigen Prüfung und der Verfügbarkeit<br />
von einer noch größeren Anzahl<br />
von Standorten erfolgt die Auswertung<br />
bundesweit (67 Versuche) als auch überregional<br />
(Großräume; 11 bis 31 Versuche)<br />
für die Regionen Nordwest-maritim (West),<br />
Kontinental-feucht (Süd) und Kontinentaltrocken<br />
(Ost).<br />
Anbaugebietsprüfung für Biogas<br />
(AGB)<br />
Die Anbaugebietsprüfung für Biogas (AGB)<br />
ist das Biogas-Sorten-Prüfsystem „in der<br />
Region für die Region“. Es werden nur<br />
Sorten geprüft, die über die nationale<br />
Wertprüfung in Deutschland zugelassen<br />
wurden, in der EU-Biogassortenprüfung<br />
(EUB) überdurchschnittliche Leistungen<br />
gezeigt oder sich beim Landwirt bereits als<br />
Biogasmais bewährt haben. Hiermit wird<br />
noch kleinräumiger über eine noch größere<br />
Anzahl von Versuchen das regionale Leistungsvermögen<br />
von Maissorten zur Biogasproduktion<br />
getestet.<br />
Die Ergebnisse der Anbaugebietsprüfung<br />
für Biogas (AGB) werden nach dem ersten<br />
Prüfjahr getrennt nach den Reifebereichen<br />
(B1, B2, B3) als Mittelwert über alle<br />
Standorte in Deutschland dargestellt. Je<br />
nach Datenverfügbarkeit aus den Vorjahren<br />
erfolgen weitere detaillierte regionale Darstellungen<br />
auf der Basis agroklimatischer<br />
Anbaugebiete für Mais (siehe Abbildung 1)<br />
regional und/oder überregional (Großraum).<br />
Die geografische Lage der Biogasanlagen<br />
ist hierbei berücksichtigt.<br />
Es bleibt festzuhalten, dass die Bereitstellung<br />
von kostengünstigem Substrat<br />
essentiell für den wirtschaftlichen Betrieb<br />
von Biogasanlagen ist. Das heißt, es sind<br />
Maissorten mit einer hohen spezifischen<br />
Biogasausbeute aus 1 Kilogramm organischer<br />
Trockensubstanz [Normliter (lN)<br />
kg -1 oTM] und einem hohen Gesamttrockenmasseertrag<br />
(dt ha -1 ) gefordert. Beide<br />
Parameter werden in tabellarischer und<br />
grafischer Form den Nutzern als PDF-Datei<br />
angeboten. Die Anzahl der Dateien überrascht<br />
den Nutzer zunächst. Eine gezielte<br />
Einschränkung über die Suchmaske nach<br />
Reifebereich, Prüfsystem bzw. Region ist<br />
dem Nutzer zu empfehlen.<br />
BENEDICT<br />
Technischer Handelsunternehmen<br />
Parts<br />
www.benedict-tho.nl<br />
www.benedict-tho.nl<br />
Erneutes Vulkanisieren Ihrer alten Gummi-Kolben!<br />
Pumpen-Ersatzteile<br />
Rührtechnik für Biogasanlagen<br />
seit 1957<br />
for profs !<br />
Vorher<br />
Flügel-Kolben<br />
Nach erneutem<br />
Vulkanisieren<br />
Jetzt online Registrieren und sofort kaufen in unserem Webshop<br />
WWW.BENEDICT-THO.NL<br />
T: +31 54 54 82 157 | M: +31 65 51 87 118 | E: info@benedict-tho.nl<br />
Segment-Kolben<br />
ANDERE RÜHREN - WIR LÖSEN.<br />
SUMA Rührtechnik GmbH • Martinszeller Str. 21 • 87477 Sulzberg<br />
+49 8376 / 92 131-0 • www.suma.de • info@suma.de<br />
Doppelmembrangasspeicher | Emissionsschutzabdeckungen<br />
Gasspeicher | EPDM-Hauben<br />
Folienbecken | Leckagefolien<br />
Baur Folien GmbH<br />
Gewerbestraße 6<br />
D-87787 Wolfertschwenden<br />
+49 83 34 / 25 99 19 0<br />
+49 83 34 / 25 99 19 19<br />
info@baur-folien.de<br />
d www.baur-folien.de<br />
Text: Dr. Jürgen Rath und Martin Bensmann<br />
53
praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Foto: Fotolia_Countrypixel<br />
Auf Ackerland mit<br />
herkömmlichen<br />
Feldfrüchten besteht<br />
keine Möglichkeit, die<br />
Ausbringmenge durch<br />
eine Sondergenehmigung<br />
zu erhöhen, was<br />
die Biogasbranche im<br />
Vergleich zur herkömmlichen<br />
Landwirtschaft<br />
unverhältnismäßig<br />
stärker trifft.<br />
Düngeverordnung bringt<br />
Einschränkungen für Biogasbetriebe<br />
Am Freitag, dem 31. März, wurde der neue Entwurf der Düngeverordnung (DüV) im Bundesrat<br />
verabschiedet. Nach mehreren Jahren der Verhandlung wurde damit das Düngerecht<br />
in Deutschland novelliert. Doch mit Inkrafttreten dieser neuen Verordnung am Tag nach ihrer<br />
Veröffentlichung wird die gesamte Landwirtschaft mit einem deutlich höheren bürokratischen<br />
Aufwand konfrontiert und muss zum Teil erhebliche Einschränkungen im Vergleich<br />
zur bisherigen Praxis hinnehmen.<br />
Von M.Sc. Florian Strippel<br />
Zwar begrüßt der Fachverband Biogas e.V.<br />
zunächst den Abschluss dieses Verfahrens,<br />
das der Landwirtschaft die nun dringend benötigte<br />
Planungssicherheit verschafft, doch<br />
zum aktuellen Zeitpunkt wird der Betrieb<br />
von Biogasanlagen im Vergleich zur herkömmlichen<br />
Landwirtschaft unverhältnismäßig stärker vor neue Herausforderungen<br />
gestellt.<br />
Eine deutliche Einschränkung ergibt sich aus der Begrenzung,<br />
maximal 170 Kilogramm Gesamtstickstoff<br />
aus organischen und organisch-mineralischen Düngemitteln<br />
je Hektar ausbringen zu dürfen. Speziell der<br />
Stickstoffbedarf von Grünland oder Fruchtfolgen, die<br />
auf eine hohe Biomasseproduktion ausgelegt sind, liegt<br />
in vielen Fällen über dieser Grenze und die Differenz<br />
muss mineralisch zugedüngt werden.<br />
Zwar besteht die Möglichkeit, für Jauche, Gülle und Mist<br />
eine Ausnahmeregelung, eine sogenannte Derogation,<br />
nach Zustimmung der Europäischen Kommission zu gewähren,<br />
um diese mit einem Stickstoffgehalt von über<br />
170 Kilogramm je Hektar ausbringen zu können. Für<br />
Gärprodukte ist in der Verordnung jedoch nur eine Ausnahme<br />
für Grünland, Dauergrünland und Ackerland mit<br />
mehrjährigem Feldfutter vorgesehen. Auf Ackerland mit<br />
herkömmlichen Feldfrüchten besteht keine Möglichkeit,<br />
die Ausbringmenge durch eine Sondergenehmigung zu<br />
erhöhen, was die Biogasbranche im Vergleich zur herkömmlichen<br />
Landwirtschaft unverhältnismäßig stärker<br />
trifft. Fraglich ist zudem, bis wann die Genehmigung der<br />
Kommission für die Derogation vorliegen wird.<br />
Verlängerte Sperrfrist vermindert<br />
Herbstausbringung<br />
Die durch die Düngeverordnung geforderten Lagerkapazitäten<br />
basieren auf der Sperrfrist, die während<br />
der Wintermonate herrscht und die es Betreibern von<br />
Biogasanlagen und landwirtschaftlichen Betrieben<br />
verbietet, nährstoffreiche Dünger zu diesem Zeitpunkt<br />
auszubringen. Zukünftig dürfen Gärprodukte mit einem<br />
wesentlichen Gehalt an Stickstoff auf Ackerland nach<br />
Ernte der letzten Hauptfrucht bis zum Ablauf des 31.<br />
Januar nicht mehr ausgebracht werden.<br />
Davon ausgenommen ist die Düngung von Zwischenfrüchten,<br />
Winterraps oder Feldfutter bei einer Aussaat<br />
bis zum 15. September oder von Wintergerste nach einer<br />
Getreidevorfrucht bis zum 1. Oktober. In diesem<br />
Fall gilt eine Sperrfrist vom 1. Oktober bis zum 31.<br />
Januar. Allerdings dürfen in diesem Zeitraum nicht<br />
mehr als 30 Kilogramm Ammoniumstickstoff oder 60<br />
Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar zusätzlich ausgebracht<br />
werden. Aus Sicht der Landwirtschaft stellt<br />
sich an dieser Stelle jedoch die generelle Frage, warum<br />
ausschließlich Wintergerste und nicht weitere Wintergetreidearten<br />
wie Winterroggen oder Wintertriticale<br />
berücksichtigt wurden, welche ebenfalls einen Stickstoffbedarf<br />
im Herbst aufweisen.<br />
Auf Grünland, Dauergrünland und Ackerland mit mehrjährigem<br />
Feldfutteranbau wird die Sperrfirst vom 15.<br />
November bis ebenfalls zum 31. Januar herrschen. Zukünftig<br />
darf die Sperrfrist von der zuständigen Behörde<br />
nur noch verschoben, nicht aber verkürzt werden. Ab<br />
54
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
praxis<br />
Arnold Eindampfer für flüssige Gärreste<br />
= +<br />
Flüssige Gärreste<br />
100% Nährstoffe<br />
Eindampfer<br />
Klares Wasser<br />
0% Nährstoffe<br />
Konzentrat<br />
99,99% Nährstoffe<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Volumenreduktion bis 90% Endlagerausbau wird unnötig<br />
Einleitfähiges Kondensat<br />
Reduktion der Transportkosten<br />
Abwärme nutzen KWK Bonus<br />
Aufkonzentrierung der Nährstoffe<br />
Absolut geruchsfrei durch Vakuum-Betrieb<br />
Kein zusätzlicher Personalaufwand durch autonome Steuerung<br />
Arnold Eindampfer statt Endlagerausbau<br />
Energieverbrauch pro<br />
1000 l Wasserverdampfung:<br />
• 250 kWh thermisch<br />
• 15 kWh elektrisch<br />
Bild:<br />
Anlage Niedersachsen<br />
Reservieren Sie einen Besuchstermin oder verlangen Sie ein unverbindliches Preisangebot<br />
Arnold & Partner AG<br />
Eistrasse 3 CH-6102 Malters + 41 (0) 41 499 60 00 www.arnoldbiogastechnik.ch info@arnoldbiogastechnik.ch<br />
55
praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
dem 1. Februar 2020 dürfen flüssige Gärprodukte auf<br />
Ackerland außerhalb der Sperrfristen nur noch streifenförmig<br />
ausgebracht oder direkt in den Boden eingebracht<br />
werden. Für Grünland, Dauergrünland oder<br />
Flächen mit mehrschnittigem Feldfutteranbau gelten<br />
diese Auflagen ab dem 1. Februar 2025.<br />
Einen weiteren Sonderfall gibt es bei Kompost und<br />
Festmist, mit Ausnahme von Geflügelmist. Bei diesen<br />
wird eine verkürzte Sperrfrist vom 15. Dezember bis<br />
zum Ablauf des 15. Januar angesetzt. An dieser Stelle<br />
wurden feste Gärprodukte, im Gegensatz zum vorhergehenden<br />
Verordnungsentwurf, nicht berücksichtigt.<br />
Dies bedeutet, dass der Aufbereitungsgrad von Gärprodukten<br />
keine Rolle spielt und Gärprodukte aus Biogasanlagen<br />
grundsätzlich wie flüssige Wirtschaftsdünger<br />
behandelt werden.<br />
Neun Monate Lagerkapazität für<br />
flächenlose Betriebe<br />
Um ausreichend Rückhaltevolumen für die vorgestellten<br />
Sperrfristen bereitstellen zu können, muss eine Lagerkapazität<br />
für mindestens sechs Monate vorgehalten<br />
werden. Wenn jedoch keine eigenen Flächen zur Ausbringung<br />
der Gärprodukte zur Verfügung stehen oder<br />
mehr als drei Großvieheinheiten je Hektar gehalten<br />
werden, erhöht sich die benötigte Lagerkapazität ab<br />
2020 auf neun Monate.<br />
Diese unklare Definition hinsichtlich eigener Flächen<br />
und damit zusammenhängend die zukünftig benötigte<br />
Lagerkapazität für Gärprodukte können die Biogasbranche<br />
jedoch vor große Herausforderungen stellen<br />
und zu empfindlichen finanziellen Belastungen führen.<br />
Für gewerbliche Biogasanlagen, die von dem zugehörigen<br />
landwirtschaftlichen Betrieb rechtlich getrennt<br />
sind, stellt sich hier die Frage, was als eigene Fläche<br />
zu bewerten ist.<br />
Nach Aussage des Bundeslandwirtschaftsministeriums<br />
fallen Flächen, die dem landwirtschaftlichen Betrieb<br />
zugeordnet werden können sowie Pachtflächen oder<br />
Flächen in Gärproduktabnahmeverträge auch unter die<br />
Definition der eigenen Flächen. Grund: Weil so ausreichend<br />
Möglichkeiten für die Ausbringung der Gärprodukte<br />
zur Verfügung stehen würden – was vertraglich<br />
auch klar geregelt werden kann. Diese Auslegung wird<br />
auch vom Fachverband Biogas e.V. unterstützt, der<br />
vor einer Fehlinterpretation beim Vollzug in der Praxis<br />
warnt. Es besteht daher an dieser Stelle Nachbesserungsbedarf<br />
beziehungsweise die Notwendigkeit, die<br />
Anforderungen zum Beispiel in Vollzugshinweisen zu<br />
spezifizieren, um Betreiber von Biogasanlagen vor einer<br />
Lagerpflicht von neun Monaten zu bewahren.<br />
Für Festmist und Kompost ist eine verkürzte Mindestlagerkapazität<br />
von zwei Monaten ab 2020 vorgesehen.<br />
Problematisch ist, dass auch an dieser Stelle feste Gärprodukte<br />
nicht berücksichtigt wurden und somit nicht<br />
mehr zwischen den einzelnen Aufbereitungsstufen von<br />
Gärprodukten differenziert wird. Damit ist fraglich, ob<br />
auch für feste Gärprodukte ebenfalls eine Lagerkapazität<br />
von sechs oder neun Monaten nachgewiesen werden<br />
muss, obwohl diese vergleichbare Eigenschaften<br />
wie Festmist oder Kompost aufweisen, die ab 2020 für<br />
zwei Monate gelagert werden müssen.<br />
Ein Abschwemmen in angrenzende Flurstücke oder<br />
Bäche ist auch im Fall von festen Gärprodukten nicht<br />
zu befürchten. Durch die Verordnung wird damit kein<br />
deutlicher Anreiz für die Betreiber von Biogasanlagen<br />
geschaffen, die anfallenden Gärprodukte durch eine<br />
Separation aufzubereiten und so auch das Transportvolumen<br />
signifikant zu verringern, was ebenfalls im Sinne<br />
des Umweltschutzes berücksichtigt werden sollte.<br />
Einzig weiterführende Aufbereitungstechnologien wie<br />
beispielsweise die Vakuumverdampfung von Gärprodukten<br />
können dazu beitragen, das benötigte Lagervolumen<br />
deutlich zu reduzieren.<br />
Große Herausforderungen für<br />
die Biogasbranche<br />
Die neue Fassung der DüV ist daher aus Sicht des Gewässerschutzes<br />
grundsätzlich als positiv zu beurteilen.<br />
Allerdings steht ein Teil der Anforderungen entgegen<br />
der fachlichen Praxis und erschwert unnötig eine dem<br />
Gewässer- und Klimaschutz angepasste Landwirtschaft.<br />
Speziell die gegebenenfalls notwendigen Investitionen<br />
in die Infrastruktur der Biogasanlagen, wie der<br />
Bau zusätzlicher Lagerkapazitäten, werden die Betreiber<br />
vor deutliche Herausforderungen stellen.<br />
Gerade in Kombination mit sinkenden Vergütungssätzen<br />
im EEG und den festgelegten Höchstgebotswerten<br />
in den Ausschreibungen werden die finanziellen Möglichkeiten<br />
in Zukunft stärker eingeschränkt. Ökologisch<br />
sinnvolle Konzepte, wie eine Gärproduktaufbereitung,<br />
sollten jedoch mit dem Ziel einer Verbesserung des Klimaschutzes<br />
in der Landwirtschaft gefördert werden.<br />
Eine Ungleichbehandlung von Gärprodukten und Wirtschaftsdüngern<br />
– wie in der Verordnung vorgesehen ist –<br />
steht dieser Entwicklung jedoch entgegen.<br />
Detailliertere Informationen zur DüV und den daraus<br />
resultierenden Anforderungen und Auflagen können<br />
Mitglieder des Fachverbandes Biogas e.V. der Arbeitshilfe<br />
„Anforderungen der Düngeverordnung an<br />
Biogasanlagenbetreiber“ entnehmen, welche im Mitgliederbereich<br />
auf der Homepage des Fachverbandes<br />
zu finden ist.<br />
Autor<br />
M.Sc. Florian Strippel<br />
Referat Abfall, Düngung und Hygiene<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 · 85356 Freising<br />
Tel. 0 81 61/98 46 60<br />
E-Mail: florian.strippel@biogas.org<br />
56
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
praxis<br />
Machen Sie mehr aus Ihrer Biogasanlage<br />
Installation und Reparatur von Pumpen,<br />
Rührwerken, Separatoren und Edelstahlbehältern.<br />
Als autorisierte Servicewerkstatt setzen wir auf<br />
hochwertige Komponenten unseres Partners<br />
• Nasserkleinerung mit interner<br />
Rückführung<br />
• Freier Durchlauf bei Stillstand<br />
• Wartungsarm ohne Gegenschneide<br />
• Feinstzerkleinerung von FestMist,<br />
Gras und Stroh<br />
• Aufschluss mit Kavitationseffekten<br />
• Mehr Gas, weniger Rührenergie<br />
• 75 KW Gülle-Biogasanlagen<br />
• UDR – Festbett-Fermenter<br />
• Doppelschalige Fermenter<br />
und Lagersilos<br />
• Ertüchtigung defizitärer<br />
Biogasanlagen<br />
• Flexibilisierung von Biogasanlagen<br />
Vlijtstraat 9<br />
Vertreter: Jos Hulink<br />
7005 BN Doetinchem ☎: 0031-(0)6-48139326<br />
☎: 0031-(0)314-335941 Berater: Wilhelm Gantefort<br />
☎: 0049-(0)1726688496<br />
HARMS Systemtechnik GmbH · Alt Teyendorf 5 · 29571 Rosche<br />
Telefon: 0 58 03.98 72 77 · www.harms-system.de<br />
57
praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Biogas-Vermarktung<br />
auf die konsequente Art<br />
Biogasanlagen Ott in<br />
Polsingen-Ursheim: In<br />
der Bildmitte befindet<br />
sich das Gärrestlager<br />
mit Gasspeicher – das<br />
ist das weiße Gebäude<br />
mit dem roten Dach.<br />
Eigentlich war der Ott-Hof in Ursheim,<br />
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen im<br />
fränkisch-schwäbischen Grenzgebiet, ein<br />
Milchviehbetrieb. Doch nachdem Martin Ott<br />
als Jungbauer eingestiegen war, gab sein<br />
Vater nach und nach die Rinderhaltung auf.<br />
Und heute leben vor allem Bakterien – in<br />
der Biogasanlage – am Hof, aber es gibt<br />
keine Kühe mehr.<br />
Von Dipl.-Ing. Heinz Wraneschitz<br />
2010 fiel der Startschuss für die Biogasanlage<br />
(BGA). Die hatte eine elektrische Leistung<br />
von 190 Kilowatt (kW), wurde aber<br />
schon 2011 auf 290 kW erweitert. Das passierte<br />
in Verbindung mit einem Wärmenetz,<br />
das Martin Ott damals in dem zentralen Ortsteil der<br />
Gemeinde am Höhenzug des Hahnenkamm aufzubauen<br />
begann.<br />
„In allen vier Ortsteilen gibt es jeweils eine Biogasanlage<br />
und ein Wärmenetz. Alle anderen sind genossenschaftlich<br />
betrieben. Nur hier in Ursheim wollten die<br />
Leute, dass ich es alleine mache“, erinnert sich der<br />
Biogasbauer. Im Nachhinein erwies es sich „als die<br />
beste Lösung. Die Baukosten blieben niedriger. Und<br />
bei der Planung mussten keine Kompromisse gemacht<br />
werden“, so sein Fazit. Damals waren es 58 Anschlüsse,<br />
zu denen er die Wärmeleitungen legen ließ. „4.000<br />
Euro pro Anschlussnehmer, 180 Euro Grundgebühr pro<br />
Jahr, ein saisonaler Wärmepreis von 2 Cent von April bis<br />
September und von Oktober bis März von 4 Cent, alles<br />
brutto“, nennt er als Konditionen für die Kunden.<br />
Warum der Preisunterschied? „Ich wollte im Winter<br />
eher weniger Wärme verkaufen, im Sommer möglichst<br />
Biogas im Fahrplanbetrieb<br />
Biogasbauer Martin Ott setzt auf einen regelrechten Fahrplanbetrieb,<br />
damit die Anlage wärme- und stromwirtschaftlich optimal<br />
genutzt werden kann. Im Wesentlichen unterscheidet er den<br />
Sommer- und den Winterfahrplan.<br />
Winter – das ist von November bis April – läuft das 2014 installierte<br />
530-kW-BHKW in Grundlast, also möglichst dauernd. Mit<br />
dem 210-kW-Modul fährt er im täglichen Fahrplanbetrieb, den<br />
er „möglichst an den wöchentlichen Wetterbericht“ im Voraus<br />
anpasst. Dabei fährt er die Anlagen normalerweise nicht in Volllast,<br />
sondern mit 90 Prozent Leistung, „um möglichst immer 10<br />
Prozent Reserve vorzuhalten“.<br />
Bei Spitzenbedarfen für Wärme können die Heizungen in Gärdüngerlager<br />
und Nachgärer abgeschaltet werden: „Das Gärdüngerlager<br />
ist komplett abschaltbar, der Nachgärer drei bis vier Tage“,<br />
womit die meisten Kälteperioden abzudecken sind. Sollte der<br />
Wetterbericht längere Eiszeiten voraussagen, erhöht er „die Fütterung.<br />
Es dauert etwa zwei bis drei Tage, bis mehr Gas kommt“,<br />
dann können die täglichen Betriebsstunden des 210-kW-BHKW<br />
erhöht oder ein weiteres hochgefahren werden. Im Sommer läuft<br />
die 255-kW-Maschine in Grundlast, das 210-kW-BHKW „wird je<br />
nach Wärmebedarf im Flexbetrieb gefahren“. Zusätzlich steht<br />
die weitere BHKW-Leistung als positive Regelenergie für die Vermarktung<br />
zur Verfügung.<br />
Martin Ott betont aber: Er sei nicht verpflichtet, den Fahrplanbetrieb<br />
über längere Zeit zu garantieren. Der Vermarkter schicke<br />
jeweils am Tag zuvor um 8.15 Uhr einen vorgesehenen Fahrplan,<br />
auf den er bis 9 Uhr noch reagieren könne. „Restriktionen kommen<br />
aber von mir, ob Einsatzstunden oder wie viele Starts pro Tag<br />
ich will.“ Wann gefahren wird, entscheide zwar der Vermarkter,<br />
„aber wenn ich früh und abends je drei Stunden wünschen würde,<br />
dann würde er das auch berücksichtigen. Das funktioniert<br />
sehr gut, da braucht man keine Angst zu haben“, beruhigt Ott.<br />
Doch Ott gibt auch zu: „Wenn ich den abgestimmten Fahrplan<br />
nicht erfülle, zum Beispiel weil ich nur sieben statt acht Stunden<br />
verfügbar bin, muss ich einen sehr geringen Ausgleich zahlen.“<br />
viel, damit ich den 600-kW-Öl-Notkessel möglichst wenig<br />
betreiben muss.“ Sprich: Die Kunden sollten dazu<br />
gebracht werden, ihre vorhandenen Holzheizungen im<br />
Sommer auszulassen, um möglichst viel Biogas-Abwärme<br />
zu verbrauchen. „Das war 2012 von Vorteil“, in dem<br />
Jahr, in dem das Ott`sche Wärmenetz in Betrieb ging.<br />
Fotos: Heinz Wraneschitz<br />
58
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
praxis<br />
Technikgebäude und rechts die neue Trafostation.<br />
Das Gärproduktlager auf der Biogasanlage Ott.<br />
BHKW-Gebäude, Feststoffeintrag, Gasfackel und die beiden Gärbehälter.<br />
Der Fermenter ist befahrbar, siehe Auto.<br />
Biogasanlagenbetreiber<br />
Martin Ott im BHKW-<br />
Raum.<br />
Doch dann ging es eigentlich erst richtig los mit dem<br />
Biogaskonzept des Bauern: Im Oktober 2012 ersetzte<br />
er das 100-kW-Aggregat durch ein neues Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) mit 255 kWel Leistung. 2013 baute<br />
er ein neues Gärproduktlager mit einem 1.800-m³-<br />
Gasspeicher obendrauf; der verfünffachte die im Betriebsgebäude<br />
eingebauten ursprünglichen 500 m³<br />
fast. Mit seiner Anlage wurde Ott 2013 Teil des Vermarkternetzes<br />
Biogaspool Bayerisch-Schwaben Nord<br />
(BSN), das sich bis weit nach Mittelfranken erstreckt.<br />
Schnell kam der Ursheimer auch ins BSN-Orgateam,<br />
das die Vermarktungsideen für Biogasstrom immer weiter<br />
perfektioniert – das ist bis heute so. Später tauschte<br />
er auch noch das 190er BHKW gegen ein 210er.<br />
2,5-fach überbaut<br />
Für Martin Ott spielt seit Herbst 2014 das Wort „Flexibilisierung“<br />
eine Hauptrolle: Um nicht vom EEG 2014,<br />
dem damals wieder einmal runderneuerten Erneuerbare-Energien-Gesetz,<br />
in den Möglichkeiten ausgebremst<br />
zu werden, sicherte er sich vor dem Stichtag 1. August<br />
2014 eine Gesamt-Bemessungsleistung von 1.000 kW<br />
für seinen Standort und somit auch für die dazugehörige<br />
Flex-Prämie. Dafür baute Ott zwei weitere BHKW<br />
hinzu, eines mit 530 kW, ein zweites mit 100 kW elektrischer<br />
Leistung; insgesamt stehen also theoretisch<br />
1.095 kW zur Stromproduktion bereit. Aber im Jahresdurchschnitt<br />
werden laut dem Betreiber nur 500 kW<br />
Strom ins örtliche 20-kV-Verteilnetz eingespeist.<br />
Für die neue Anlagengröße wurde zwar eine komplett<br />
neue BImSch-Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz<br />
notwendig. Doch die war „unproblematisch,<br />
weil nur die elektrische Maximalleistung erhöht<br />
wurde, die Durchschnittsleistung ging dabei nicht<br />
hoch“. Das 530-kW-Aggregat läuft dabei im Winter<br />
üblicherweise in der Grundlast, das BHKW mit 210 kW<br />
liefert im Flex-Betrieb pro Tag etwa acht Stunden lang<br />
Strom. Ansonsten richten sich dessen Betriebsstunden<br />
nach der Wärmebedarfsprognose und dem konkreten<br />
Bedarf.<br />
Die beiden anderen Maschinen mit 255 und 100 kW<br />
„werden in der positiven Regelenergie vermarktet –<br />
vorwiegend als Sekundärregelleistung (SRL). Da gibt<br />
es wöchentliche Ausschreibungen, die Abrufe liegen<br />
bei etwa zwei pro Woche und sind nur sehr kurz.“ Was<br />
bedeutet: Mittels Fernsteuerung des Regelenergievermarkters<br />
– Ott arbeitet mit Clean Energy Sourcing<br />
(CES) zusammen – produzieren die Maschinen kurzfristig<br />
Strom, um unvorhergesehene Spitzenbedarfe im<br />
Netz abzufangen.<br />
59
praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Feststoffeintrag über den Gärbehältern, im Hintergrund befindet sich das Fahrsilo.<br />
Power-to-Heat-Modul, das im Wärmespeicher steckt.<br />
„Bei der negativen Regelenergie dagegen sind die Abrufdauern<br />
sehr unterschiedlich. Mal wird gar nicht,<br />
mal wird drei Stunden pro Woche abgeregelt, zwei bis<br />
fünf Minuten durchschnittlich“ seien diese Perioden,<br />
so Ott. Offensichtlich lohnen sich beide Geschäftsmodelle<br />
für ihn und für den Vermarkter. Ott erhält von den<br />
Erlösen 80 Prozent, 20 Prozent bleiben bei CES.<br />
Ein neuer Trafo musste her<br />
Was für die Flexibilisierung aber notwendig war: ein<br />
eigener Einspeisetrafo. Vorher nahm der Verteilnetzbetreiber<br />
Main-Donau-Netz MDN aus Nürnberg den<br />
Strom über die Ortsnetzstation mit 630 kVA Leistungsfähigkeit<br />
auf. Doch nach einer Netzverträglichkeitsanalyse<br />
wurde Ott ein eigener Transformator empfohlen.<br />
Ansonsten hätte er 150 Meter neue Leitung verlegen<br />
und eine Extra-Übergabestation anschaffen müssen.<br />
Er entschloss sich für den 100.000 Euro teuren Trafokauf.<br />
„Und ich würde die Flexibilisierung auf jeden Fall<br />
immer wieder machen. Denn durch die hohe mögliche<br />
positive Sekundärregelleistung (SRL) bleiben unterm<br />
Strich Erlöse übrig.“ Ott denkt sogar schon „an die Zeit<br />
nach dem EEG: Da ist die Leistungsüberbauung unabdingbar.“<br />
Wärmekunden hat der Bauer inzwischen fast 100, das<br />
Netz wurde 2015 auf 5,5 Kilometer erweitert, quasi<br />
das ganze Dorf ist angeschlossen. Dafür hat Ott einen<br />
25 m³ großen Pufferspeicher im Betriebsgebäude installiert,<br />
und an jedem Hausanschluss steht noch einmal<br />
ein 1.000-Liter-Puffer. Weil sich so tägliche und<br />
saisonale Verbrauchsspitzen übers ganze Jahr ausgleichen<br />
lassen, „passen flexibler Anlagenbetrieb und<br />
Wärmenetz gut zusammen“, lautet die Erfahrung nach<br />
fast drei kompletten Heizperioden und Sommern mit<br />
weniger Wärmeverbrauch.<br />
„Die saisonale Fahrweise ist für mich unabdingbar“,<br />
ergänzt Ott (siehe Kasten). Denn so gelinge es ihm,<br />
„übers Jahr 70 Prozent der BHKW-Abwärme ins Netz<br />
zu liefern. Etwa 10 bis 15 Prozent braucht die Anlage<br />
selber.“ Die Gaserzeugung läuft über die Substrate Mist<br />
und Gülle (35 Prozent), Mais (40 Prozent), der Rest<br />
sind Gras- und Ganzpflanzensilage GPS. Zwei Drittel<br />
des Futters produziert er selber auf 150 Hektar, überwiegend<br />
Pachtfläche.<br />
Sein angehäuftes Wissen behält Martin Ott nicht für<br />
sich, sondern gibt es mit den vier anderen Sprechern<br />
auch alle vier Wochen über Rundschreiben des Vermarkterpools<br />
BSN weiter. Beim Fachverband Biogas<br />
ist Ott ebenfalls aktiv: In der „BEX“, der Betreiberexpertengruppe<br />
des AK Direktvermarktung sprechen<br />
derzeit „12 Betreiber über die Optimierung der Flexibilisierung<br />
und der Biogasanlagen generell. Und was<br />
vermarktungstechnisch geht.“<br />
Ott hat 2014 eine Power-to-Heat-Anlage (P2H) mit<br />
480 kW Heizleistung in den Pufferspeicher eingebaut,<br />
um mehr negative Regelleistung anzubieten. Das habe<br />
sich bis heute nicht groß wirtschaftlich ausgezahlt, gibt<br />
er zu: „Das Modul wird zurzeit kaum mehr eingesetzt.<br />
Bis es installiert war, sind die guten Preise der negativen<br />
SRL verfallen.“ Doch Ott hat die Hoffnung nicht<br />
aufgegeben: „Das P2H-Modul könnte in den 2020er<br />
Jahren wieder interessant werden, wenn die Kernkraftwerke<br />
weg sind und die Regenerativerzeugung noch<br />
mehr steigt.“ Eine Zukunftsinvestition also. Zuletzt hat<br />
er 2016 das Fahrsilo auf den neuesten Stand gebracht.<br />
Doch aktuell steht an der Biogasanlage nichts an:<br />
„Heuer will ich mein Haus renovieren“, erzählt Martin<br />
Ott lachend von seinen Plänen.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. Heinz Wraneschitz<br />
Freier Journalist<br />
Feld-am-See-Ring 15a<br />
91452 Wilhermsdorf<br />
Tel. 0 91 02/31 81 62<br />
E-Mail: heinz.wraneschitz@t-online.de<br />
www.bildtext.de und www.wran.de<br />
60
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
praxis<br />
Flexibel, verlässlich<br />
und innovativ<br />
Ich finde es immer wieder bemerkenswert, mit welcher Begeisterung<br />
und Innovationskraft, aber auch mit wie viel Risikobereitschaft<br />
die Akteure der Biogasbranche auf die immer neuen<br />
Anforderungen des Marktes reagieren.<br />
Vor gerade mal zehn Jahren erzeugte eine Biogasanlage im<br />
24-Stunden-Betrieb Strom; die Wärme ... mei, die war halt auch<br />
da und wurde teilweise im Stall und im Wohnhaus eingesetzt. Und<br />
heute? Da läuft die Anlage je nach aktuellem Strombedarf, liefert<br />
klimafreundliche Wärme an ganz viele Haushalte in der Nachbarschaft,<br />
wird dafür im Sommer etwas weniger und im Winter etwas<br />
mehr gefüttert – und ist darüber hinaus auch bei der Stromerzeugung<br />
noch flexibel. Flexible Anlagen, flexible Betreiber. Das<br />
beeindruckt mich. Und das macht Biogas und die Biogasbranche<br />
so wichtig für das Gelingen unserer Energiewende.<br />
Ihr braucht Strom, auch wenn kein Wind weht und keine Sonne<br />
scheint? Bitte schön, Biogas liefert. Ihr wollt die Energiewende<br />
endlich auch im Wärmemarkt voranbringen und mit<br />
klimafreundlicher Energie heizen? Biogaswärme steht bereit.<br />
Selbst an wirklich kalten Tagen und Wochen wie zu Beginn dieses<br />
Jahres musste in Polsingen niemand frieren. Denn eines ist<br />
Biogas darüber hinaus auch noch: verlässlich!<br />
Mir macht das Mut. All die vielen jungen und dynamischen<br />
Landwirte, die einfach loslegen und unsere Zukunft damit Stück<br />
für Stück wieder lebenswerter machen. Denn die globale Klimaveränderung<br />
ist mittlerweile überall und für jeden offensichtlich<br />
und wir dürfen deshalb das große Ziel nicht aus den Augen verlieren,<br />
nämlich diesem Prozess entgegenzuwirken!<br />
Vielen Dank für euer Engagement. Macht’s weiter so!<br />
Euer<br />
61
praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Kohle machen – aus Gärresten<br />
Die „Suppe“ nach dem<br />
HTC-Prozess enthält<br />
Wasser mit Feststoffteilchen.<br />
Das Unternehmen SmartCarbon verkocht die Gärreste einer Biogasanlage mit Chemikalien<br />
wie Zitronensäure und macht daraus erfolgreich Biokohle. Diese hat viele Qualitäten, kann<br />
Böden fruchtbarer machen, als CO 2<br />
-neutraler Brennstoff oder auch zum Düngen dienen.<br />
Das Verfahren steht kurz vor der Markteinführung.<br />
Von Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
Seit 2010 gibt es die Firma SmartCarbon,<br />
die ihren Sitz seit kurzem im baden-württembergischen<br />
Willstätt hat. „Gegründet<br />
haben wir uns aus dem Erfinderclub an der<br />
Uni“, erzählt Dave Tjiok, der gemeinsam<br />
mit Burkhard von Stackelberg zu den Firmengründern<br />
gehört. Viel Zeit und Arbeit hat das Unternehmen investiert<br />
und den Prozess der hydrothermalen Carbonisierung<br />
immer weiter optimiert.<br />
Biokohle eignet sich als<br />
CO 2<br />
-neutraler Brennstoff<br />
und auch als<br />
Bodenverbesserer. Sie<br />
kann aber auch als Trägerstoff<br />
für Düngemittel,<br />
zur Absorption von<br />
Altlasten, als Filterstoff<br />
für Abwasserreinigung,<br />
Torfersatz, Kompostierhilfe,<br />
Güllezusatz<br />
und Bindemittel für<br />
Ammonium verwendet<br />
werden.<br />
Im Jahr 2013 bauten die Jungunternehmer eine Pilotanlage<br />
im baden-württembergischen Leonberg auf. In<br />
der ehemaligen Rottehalle der dortigen Vergärungsanlage<br />
verwandelte SmartCarbon drei Jahre lang Gärrückstände<br />
in Biokohle. Das Pilotprojekt wurde durch die<br />
Universitäten Hohenheim und Stuttgart sowie mehrere<br />
Firmen und den Abfallwirtschaftsbetrieb aus dem Kreis<br />
Böblingen unterstützt.<br />
„Durch die gemeinsamen Kooperationen konnten wir<br />
sehr viele Erfahrungen sammeln“, fügt von Stackelberg<br />
hinzu, denn Gärreste seien ein anspruchsvoller Einsatzstoff.<br />
Im Prinzip könne die HTC-Anlage aber praktisch<br />
alles zu Biokohle umwandeln. Verwertet werden<br />
könnten Biomassesorten aller Art, die von pflanzlichen<br />
Abfall- und Reststoffen bis zu organischen Hausabfällen,<br />
Gärresten von Biogasanlagen und Klärschlämmen<br />
reichten. Wichtig sei aber, dass der Einsatzstoff feucht<br />
und ungetrocknet sei. „Wir bevorzugen die abgetrennte<br />
Flüssigphase mit einem TS-Gehalt von 15 bis 20 Prozent“,<br />
sagt er, denn dies sei besonders wirtschaftlich.<br />
pH-Wert muss stimmen<br />
Und so funktioniert das Verfahren: Wenn nötig, wird<br />
der Einsatzstoff zuerst aufbereitet, also zerkleinert,<br />
angefeuchtet und mit Additiven vermengt. Denn: Eine<br />
62
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Burkhard von Stackelberg<br />
an der Technikumsanlage,<br />
die die<br />
Studierenden von der<br />
Hochschule Hohenheim<br />
für die bodenkundlichen<br />
Versuche nutzen.<br />
praxis<br />
Mischen – Fördern –<br />
Zerkleinern<br />
Fotos: Martina Bräsel<br />
wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen<br />
HTC-Prozess ist der richtige pH-<br />
Wert. „Weil dieser kleiner sechs sein soll,<br />
mischen wir Zitronen- oder Schwefelsäure<br />
hinzu“, verdeutlicht Dave Tjiok. Je<br />
nach späterem Verwendungszweck könnten<br />
weitere Stoffe beigemischt werden.<br />
Nach der Homogenisierung werde das<br />
vorbehandelte Substrat von oben in den<br />
Batchreaktor gefüllt. Je nach Konsistenz<br />
geschehe dies mit einem Förderband<br />
oder einer Pumpe. „Wir haben uns für<br />
einen diskontinuierlichen Betrieb entschieden,<br />
da der Einsatzstoff immer<br />
auch Störstoffe enthält“, erklärt er. Im<br />
dicht verschlossenen Reaktor laufe<br />
der Prozess „ähnlich ab wie in einem<br />
Schnellkochtopf, nur komplizierter“.<br />
Damit die Gärreste bei Temperaturen<br />
zwischen 200 und 220 Grad Celsius verkocht<br />
werden können, heizt ein Dampferzeuger<br />
die Brühe auf bis zu einem<br />
Druck von maximal 28 bar.<br />
Sobald die vorgesehenen Druck- und<br />
Temperaturniveaus erreicht sind, erfolgt<br />
die Regelung des Systems über Dampferzeuger<br />
und das Wärmeübertragungssystem.<br />
Nach der Aufheizung der Biomasse<br />
kann Energie in Form von Dampf<br />
zurückgewonnen werden. „Wir kondensieren<br />
den Dampf wieder und gewinnen<br />
Energie zurück, die wir nutzen können“,<br />
berichtet von Stackelberg. Bei einer<br />
Mehrkessel anlage könnte sie beispielsweise<br />
den nächsten Kessel aufheizen.<br />
Exakte Bedingungen für das<br />
gewünschte Produkt<br />
Die Vorgänge wurden wissenschaftlich von<br />
verschiedenen Forschungsinstituten begleitet.<br />
Die Wissenschaftler fanden heraus,<br />
dass der Aufheiz- und Abkühlvorgang einen<br />
wesentlichen Einfluss auf den Prozess<br />
hat. Auch die Verweildauer variiert je nach<br />
gewünschtem Endprodukt. Ein Durchlauf<br />
kann zwischen 6 und 18 Stunden dauern.<br />
Nach der gewünschten Verweilzeit erfolgt<br />
die Entnahme und Kondensation des Prozessdampfes<br />
aus dem Reaktor, bis die<br />
Temperatur unter 100 Grad Celsius sinkt.<br />
Nun ist der Reaktionsbehälter ohne Druck<br />
und kann geöffnet und entleert werden.<br />
„Nach dem HTC-Prozess erhalten wir eine<br />
Art Suppe, die aus Wasser und Feststoffteilchen<br />
besteht“, erklärt Tjiok. Sie müsse<br />
in der Kammerfilterpresse separiert werden.<br />
Im Rahmen zahlreicher Versuche ermittelten<br />
die Forscher auch den richtigen<br />
Pressdruck. Für eine Tonne Gärrest werden<br />
500 bis 600 Liter Wasser in Form von<br />
Dampf benötigt, die nun zum großen Teil<br />
als Prozessflüssigkeit anfallen.<br />
Das Leibniz-Institut für Agrartechnik und<br />
Bioökonomie in Potsdam untersuchte die<br />
Prozesswasserproben und fand heraus,<br />
dass es pflanzliche Nähr- und Huminstoffe<br />
in wässriger Lösung enthält. „Wir möchten<br />
die Prozessflüssigkeit als Flüssigdünger<br />
nutzen, deshalb entwickeln wir gerade ein<br />
Konzept zur Schnellfermentation“, berichtet<br />
Tjiok, zudem würden noch verschiede-<br />
63<br />
Ihr Partner für die Energie<br />
der Zukunft<br />
Als Weltmarktführer von Exzenterschneckenpumpen<br />
und Spezialist in der<br />
Biogastechnologie bieten wir für die<br />
Biogasproduktion angepasste Misch- und<br />
Fördersysteme. Die Einsatzmöglichkeiten<br />
unserer NEMO® Exzenterschneckenpumpen,<br />
TORNADO® Drehkolbenpumpen<br />
sowie NETZSCH Zerkleinerungssysteme<br />
reichen vom Mischen über Fördern bis hin<br />
zum Zerkleinern.<br />
NEMO® B.Max®<br />
Mischpumpe<br />
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH<br />
Geschäftsfeld Umwelt & Energie<br />
Tel.: +49 8638 63-1010<br />
Fax: +49 8638 63-2333<br />
info.nps@netzsch.com<br />
www.netzsch.com
praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Auf eine Tonne Gärrest kommen 500<br />
bis 600 Liter Wasser, die als Presswasser<br />
behandelt werden müssen.<br />
„Es enthält pflanzliche Nähr- und<br />
Huminstoffe in wässriger Lösung“,<br />
sagt Dave Tjiok.<br />
Damit die Gärreste<br />
bei Temperaturen<br />
zwischen 200 und 220<br />
Grad Celsius verkocht<br />
werden können, heizt<br />
ein Dampferzeuger die<br />
Brühe auf.<br />
ne andere Verfahrensansätze erprobt. Nach Ende des<br />
Prozesses ist aus der festen Biomasse, je nach Verweildauer<br />
im Kochtopf, ein Produkt entstanden, das<br />
Eigenschaften von Humus-, Braun- oder Steinkohle<br />
besitzt. Es kann nun, je nach gewünschtem Verwendungszweck,<br />
aufbereitet werden.<br />
Unerlässlich: das richtige „Rezept“!<br />
„Die Kohlen enthalten alle Nährstoffe der Pflanzen“,<br />
erklärt Dr. Wolf-Anno Bischoff. Im Sinne einer Kreislaufwirtschaft<br />
sollten diese wieder auf landwirtschaftliche<br />
Flächen ausgebracht werden. Zudem töte der<br />
HTC-Prozess Krankheitserreger und Schimmelpilze,<br />
verschone jedoch die wertvollen Inhaltsstoffe. Bischoffs<br />
Unternehmen TerrAquat führte drei Jahre lang<br />
gemeinsam mit der Universität Hohenheim Feldversuche<br />
mit der Biokohle durch und erzielte wichtige Erkenntnisse.<br />
So machten manche Kohlen sogar beschädigte<br />
Böden wieder fruchtbar. Der Gutachter erklärt die<br />
Hintergründe: „In China, der Ukraine und den USA ist<br />
Erosion ein großes Problem“. In den Kornkammern unserer<br />
Welt gebe es den sogenannten Lössboden. Dieser<br />
sei sehr ertragreich – bis seine Oberschicht abgetragen<br />
sei. „Ohne den fruchtbaren Mutterboden kann er weder<br />
Wasser noch Nährstoffe aufnehmen“, so der Geoökologe.<br />
Deshalb führten die Forscher ihre Untersuchungen<br />
mit diesem ertragsarmen Boden durch.<br />
Um die reine Wirkung der Kohle zu testen, wurden<br />
alle Böden vor den eigentlichen Versuchen optimal<br />
mit Dünger und Wasser versorgt. „So konnten wir den<br />
reinen Fruchtbarkeitseffekt ermitteln“, verdeutlicht Bischoff.<br />
Wegen seiner kurzen Vegetationszeit und Empfindlichkeit<br />
säten die Wissenschaftler Gemüse aus.<br />
„Hier kommt es sehr auf die Qualität an“, erklärt der<br />
Alles beginnt im Herzen:<br />
OPTIMIERUNG, SANIERUNG, REPOWERING<br />
RÜHRWERK-<br />
TECHNIK<br />
VOM PROFI<br />
seit 1990<br />
64<br />
• Ohne<br />
Substrat-Entleerung:<br />
• Kontrolle<br />
• Wartung<br />
• Wechsel<br />
• Betriebssicherheit<br />
durch optimale Bauweise<br />
• hohe Langlebigkeit<br />
Euregiostraße 7<br />
4700 Eupen<br />
Belgien<br />
Tel. +32 (0)87 74 44 57<br />
info@peters-mixer.be<br />
www.peters-mixer.com
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
praxis<br />
In eine Ecke der<br />
ehemaligen Rottehalle<br />
der Vergärungsanlage<br />
Leonberg befindet sich<br />
die HTC-Pilotanlage der<br />
Firma smart carbon.<br />
Geoökologe, „die Pflanzen müssen gesund entwickelt<br />
sein, damit sie überhaupt vermarktbar sind“.<br />
Danach verabreichten sie den fruchtlosen Böden unterschiedliche<br />
Arten von Biokohle. Bei manchen Kohlen<br />
keimte kein einziger Samen, während der Boden bei<br />
anderen gedeihte. „Die besten Ergebnisse lieferten<br />
die Gärreste“, so der Gutachter. Allerdings hätten die<br />
Versuche gezeigt, dass die Qualität der Kohle auch bei<br />
diesem Substrat sehr unterschiedlich sein kann. „Es<br />
kommt nicht nur auf den Einsatzstoff an“, betont der<br />
Wissenschaftler ausdrücklich, „sondern auch darauf,<br />
wie gekocht wird“. Zudem sei auch die Nachbehandlung<br />
wichtig, sie könne die Produkteigenschaften noch<br />
verstärken.<br />
Es gab zahlreiche Rückschläge, bis das „Rezept“<br />
stimmte. Nachdem dieses für die Gärreste gefunden<br />
war, überzeugten die Resultate. „Die Pflanzen entwickelten<br />
sich sehr gut“, so der Geoökologe. Die Forscher<br />
testeten zudem noch weitere Einsatzstoffe, dabei<br />
brachten „reine Bioabfälle und Klärschlamm bislang<br />
keine guten Ergebnisse“. Doch bei unvergorenem Biomüll<br />
seien die „Prognosen“ sehr gut und auch Gülle<br />
gibt er eine „Chance“. „Bei diesen Stoffen haben wir<br />
das richtige Kochrezept aber noch nicht entwickelt.“<br />
Biokohle vielfältig nutzbar<br />
Durch den HTC-Prozess wird fast der gesamte Kohlenstoff<br />
des Rohstoffes an die Kohle gebunden. „Wird sie<br />
in den Boden eingearbeitet, wird das von Pflanzen aufgenommene<br />
CO 2<br />
langfristig der Atmosphäre entzogen“,<br />
erklärt Tjiok, das wirke sich positiv auf den Klimawandel<br />
aus. Zudem blieben der Kohle ein Großteil des ursprünglichen<br />
Brennwerts erhalten. Der Rest, etwa ein<br />
Drittel, würde als Prozesswärme abgegeben. Deshalb<br />
Der Fermenter der Vergärungsanlage<br />
ist ein<br />
geschlossener Stahlbehälter<br />
mit einer Höhe<br />
von rund 25 Metern. Er<br />
kann 30.000 Tonnen<br />
Bioabfall pro Jahr<br />
verarbeiten und daraus<br />
Biogas produzieren.<br />
65
praxis<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Der Reaktor ist ein<br />
großer Schnellkochtopf.<br />
Er verkocht die Gärreste<br />
mit Chemikalien wie<br />
Zitronensäure und<br />
macht daraus Biokohle.<br />
Durch den Prozess wird<br />
fast der gesamte Kohlenstoff<br />
des Rohstoffes<br />
an die Kohle gebunden<br />
und rund 66 Prozent<br />
des ursprünglichen<br />
Brennwerts bleiben<br />
erhalten.<br />
eigne sich das Produkt als CO 2<br />
-neutraler Brennstoff<br />
ebenso wie auch als Bodenverbesserer. Die Biokohle<br />
könnte aber auch als Trägerstoff für Düngemittel, zur<br />
Absorption von Altlasten, als Filterstoff für Abwasserreinigung,<br />
Torfersatz, Kompostierhilfe, Güllezusatz<br />
und als Bindemittel für Ammonium verwendet werden.<br />
Vor allem liegt den Jungunternehmern der Umweltaspekt<br />
am Herzen, deshalb strebt SmartCarbon die EU-<br />
Zulassung für den Bodenverbesserer auf Gärrestebasis<br />
an. Tjiok und von Stackelberg sind optimistisch, denn<br />
die Kohlen aus Leonberg entsprechen allen Anforderungen<br />
und Richtlinien. Konkurrenz auf dem Markt gibt<br />
es kaum: Im Bereich Biokohle gibt es in Europa derzeit<br />
nur wenige Produkte. Meist werden sie durch Pyrolyse<br />
aus Holz hergestellt.<br />
Wirtschaftlich, wenn der Rahmen stimmt<br />
„Die Vorserienanlage sollte zeigen, dass die Technik<br />
funktioniert und wirtschaftlich ist“, sagt Dave Tjiok.<br />
Zurzeit laufen die Vertragsverhandlungen für eine<br />
Großanlage. Neben der kleinen Demonstrationsanlage,<br />
die bis zu 1.000 Tonnen Jahresdurchsatz mit einem<br />
einzigen Reaktorbehälter schafft, soll, wenn alles optimal<br />
läuft, bald eine große Schwester stehen. Durch das<br />
Zusammenschalten mehrerer Druckbehälter (Multi-<br />
Batch) soll der Jahresdurchsatz der Mehrkesselanlage<br />
10.000 Tonnen feuchter Gärreste betragen.<br />
Die Chancen für die Großanlage stehen gut, denn<br />
momentan werden die Gärreste aus Leonberg noch<br />
mühsam mit Lastkraftwagen weit weg zu Kompostieranlagen<br />
gekarrt. „Das ist ein hoher Kostenaufwand.<br />
Deshalb sind wir sehr interessiert an dem Projekt“, erklärt<br />
Wolfgang Bagin, der Chef des Abfallwirtschaftsbetriebs.<br />
Die Biokohle müsse aber auch vermarktbar sein.<br />
Zudem sei die Frage zu klären, was mit dem Wasser aus<br />
der chemischen Aufbereitung passiert. Etwa, ob und<br />
wie es gereinigt werden muss, bevor es in die Kanalisation<br />
eingeleitet wird.<br />
Die Mehrkesselanlage, die hier in Leonberg entstehen<br />
soll, wird zwischen 3,5 und 4 Millionen Euro kosten.<br />
Wie viel eine Anlage an einem anderen Standort kosten<br />
würde, kann Tjiok pauschal nicht sagen. „Das hängt<br />
maßgeblich von den Rahmenbedingungen ab“, sagt<br />
er. Würden Kosten für eine Vorverarbeitung anfallen,<br />
verteuere das den Prozess. Müssten eine zusätzliche<br />
Bodenplatte oder ein Förderband installiert werden,<br />
erhöhe auch dies die Gesamtkosten deutlich. Zudem<br />
müsse die Abluft behandelt werden, das sei in Leonberg<br />
unproblematisch, denn ein Biofilter sei bereits<br />
vorhanden. „Wirtschaftlich ist das Verfahren vor allem<br />
für Standorte, die bereits über eine gute Infrastruktur<br />
verfügen“, so der Jungunternehmer.<br />
Autorin<br />
Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
Freie Journalistin<br />
Hohlgraben 27 · 71701 Schwieberdingen<br />
Tel. 0 71 50/9 21 87 72<br />
Mobil: 01 63/232 68 31<br />
E-Mail: braesel@mb-saj.de<br />
www.mb-saj.de<br />
66
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Visuelle praxis<br />
Kontrolle Ihrer<br />
Biogas-Produktion.<br />
PAULMICHL GmbH<br />
Kisslegger Straße 13 · 88299 Leutkirch<br />
Tel. 0 75 63/84 71 · Fax 0 75 63/80 12<br />
www.paulmichl-gmbh.de<br />
■ Fermenterrührwerke für wand- und Deckeneinbau<br />
robuste und Leistungsstarke Bauweise, energieeinsparend + hocheffizient.<br />
■ separatoren für Biogasanlagen stationär / als mobile einheit<br />
■ rührwerke für nachgärbehälter und endlager<br />
■ Pumptechnik für Biogasanlagen<br />
■ Panoramaschaugläser nachrüstung möglich<br />
Gas Technologie von APROVIS<br />
Qualität<br />
aus<br />
Verantwortung<br />
info.lumi@papenmeier.de · www.lumiglas.de<br />
F.H. Papenmeier GmbH & Co.KG · Telefon 0 23 04-205-0<br />
FriCon – Gaskühlsysteme<br />
ActiCo – Aktivkohlefilter<br />
Gaswärmeübertrager<br />
Verdichter<br />
Wartung & Service<br />
91746 Weidenbach-Triesdorf · Tel.: +49 (0) 9826 / 6583 - 0 · info@aprovis.com<br />
www.aprovis.com<br />
Lumiglas optimiert Ihren Biogas-Prozess.<br />
Fernbeobachtung mit dem Lumiglas<br />
Ex-Kamera-System.<br />
Lokale oder globale Paketlösungen<br />
schaffen kostengünstig<br />
Sicherheit.<br />
Unser<br />
Info-Material:<br />
Paketlösung für<br />
die Biogaserzeugung.<br />
Gleich heute anfordern!<br />
67
Wissenschaft Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Unter einem Quadratmeter eines intakten<br />
Bodens leben Hunderttausende bis Millionen von<br />
Bodentieren. Je intensiver landwirtschaftliche<br />
Böden bewirtschaftet werden, desto geringer sind<br />
Artenzahl und Vorkommen der Bodenorganismen.<br />
„SoilCare“ für fruchtbare Böden<br />
Fotos: Martina Bräsel<br />
Beim EU-Projekt SoilCare arbeiten Wissenschaftler, Landmaschinenhersteller und Landwirte Hand in Hand.<br />
Gemeinsam wollen sie die Fruchtbarkeit der Äcker mit bodenverbessernden Anbausystemen nachhaltig erhöhen.<br />
Die Ergebnisse sollen einen schnellen Weg in die Praxis finden.<br />
Von Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
In Deutschland wird etwa die Hälfte<br />
der Bodenfläche landwirtschaftlich<br />
genutzt, und die Landwirte wissen von<br />
der vitalen Wichtigkeit des Bodens für<br />
ihre Zukunft. „Leider werden die zur<br />
Zeit hohen Erträge oft nur noch durch erhöhte<br />
Inputs wie synthetische Düngemittel,<br />
Pestizide und Technologie erhalten“, sagt<br />
Dr. Ellen Kandeler vom Institut für Bodenkunde<br />
und Standortslehre der Universität<br />
Hohenheim. Mit diesen Maßnahmen würde<br />
aber oft eine sinkende Produktivität durch<br />
Bodendegradation (Verschlechterung des<br />
Bodens) überdeckt. Dr. Ellen Kandeler<br />
vertritt gemeinsam mit Prof. Dr. Carola<br />
Pekrun (HfWU Nürtingen-Geislingen) das<br />
„SoilCare“-Projekt in Deutschland.<br />
Die Zahlen des Umweltbundesamtes bestätigen<br />
die Aussage der Professorin: So stieg<br />
laut UBA der Inlandsabsatz an Pflanzenschutzmitteln<br />
von knapp 30.000 Tonnen<br />
(1994) auf über 46.000 Tonnen (t) im Jahr<br />
2014. In den zehn Jahren dazwischen hatte<br />
der Verbrauch bei jährlich etwa 35.000 t<br />
Wirkstoff gelegen, doch seit 2006 erhöhte<br />
er sich kontinuierlich. Den größten Anteil an<br />
den ausgebrachten Spritzmitteln stellte bei<br />
uns die Gruppe der Herbizide. Sie machte<br />
2014 rund 39 Prozent aus (siehe Abbildung<br />
1).<br />
Beim europäischen Verbrauch stehen wir<br />
damit aber nicht an erster Stelle. Europaweit<br />
werden laut Eurostat die höchsten<br />
Pflanzenschutzmittelmengen in Malta, den<br />
Niederlanden, Portugal, Italien, Belgien,<br />
Slowenien und Spanien verkauft. Dabei<br />
zeichnet sich der Trend ab, nach dem die<br />
Verwendung von Düngemitteln direkt mit<br />
dem Verkauf von Pflanzenschutzmitteln zusammenhängt.<br />
Doch das Problem der Bodendegradation<br />
umspannt die ganze Erde. Weltweit gehen<br />
jährlich etwa 10 Millionen (Mio.) Hektar<br />
Ackerfläche verloren – eine Fläche von<br />
rund 14 Mio. Fußballfeldern. Ein Viertel der<br />
globalen Bodenfläche enthält heute schon<br />
deutlich weniger Humus und Nährstoffe als<br />
vor 25 Jahren oder lässt sich gar nicht mehr<br />
als Ackerland nutzen. „Fruchtbare und gesunde<br />
Böden sind die Voraussetzung für<br />
unsere Nahrungsmittelversorgung. Die Bodendegradation<br />
ist eine Ursache für Hunger<br />
und Unterernährung – und damit auch für<br />
Konflikte und Migration“, so Maria Krautzberger,<br />
Präsidentin des Umweltbundesamtes<br />
(UBA).<br />
Böden verbessern, um nachhaltig<br />
die Produktivität zu sichern<br />
Das wissenschaftliche Projekt „SoilCare“<br />
will diesen Trend umkehren. Dazu untersucht<br />
es Möglichkeiten, wie sich die Bodenfruchtbarkeit<br />
durch Anbausysteme und<br />
-techniken verbessern lässt. Gleichzeitig<br />
sollen dabei Vorteile für die Wirtschaftlichkeit<br />
der Landwirtschaft und für die Umwelt<br />
entstehen. Das multidisziplinäre Team vereint<br />
Partner aus 18 EU-Ländern. Mit dabei<br />
sind neben Universitäten und Forschungsinstituten<br />
auch viele Firmen und Landwirte.<br />
So arbeiten die Projektpartner aus den verschiedenen<br />
europäischen Ländern gemeinsam<br />
an Feldversuchen. Sie testen verschiedene<br />
Anbausysteme, um herauszufinden<br />
wie eine Verbesserung des Bodens die Pro-<br />
68
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Wissenschaft<br />
Nutzen Sie<br />
Nutzen das Sie<br />
ganze<br />
das ganze<br />
Potenzial<br />
Potenzial<br />
Ihrer Biogasanlage<br />
Ihrer Biogasanlage<br />
Quelle: SoilCare<br />
Bodenverbessernde Anbausysteme werden an 16 Standorten in Europa mit verschiedenen Böden,<br />
Klimata und sozioökonomischen Bedingungen getestet.<br />
duktivität erhöhen und vor allem erhalten<br />
kann. Mit 16 Versuchsstandorten in ganz<br />
Europa, die sowohl diverse klimatische Bedingungen<br />
als auch Bodenarten und Landwirtschaftssysteme<br />
repräsentieren, sucht<br />
das Projekt nach Lösungen, die möglichst<br />
einfach von Landwirten angewandt werden<br />
können.<br />
Der Projektkoordinator von „SoilCare“, Dr.<br />
Rudi Hessel (Wageningen Environmental<br />
Research, Niederlande), erklärt: „Farmer<br />
wussten schon seit langem, dass das Geheimnis<br />
für ihren Erfolg im Boden liegt, und<br />
wir als Wissenschaftler arbeiten aktiv mit<br />
ihnen zusammen, um Antworten zu finden,<br />
die sowohl dem Boden gut tun als auch die<br />
Wirtschaftlichkeit erhöhen.“ Dieser Ansatz,<br />
verbunden mit der engen Zusammenarbeit<br />
mit Stakeholdern und Interessengruppen,<br />
ermögliche, dass erfolgversprechende Systeme<br />
oder Techniken schnell den Landwirten<br />
zur Verfügung gestellt werden könnten.<br />
Die 16 Versuchsstandorte wurden deshalb<br />
ausgewählt, weil es bei ihnen einen Zugang<br />
zu den Datensätzen einer großen Anzahl<br />
von historischen Experimenten gibt, mit<br />
ihnen sollen die Versuche ergänzt werden.<br />
„Durch dieses Projekt können wir Probleme<br />
wie Bodenverdichtung, Erosion, Beikrautregulierung<br />
und Wasserverfügbarkeit an<br />
Standorten angehen, von denen wir jahrzehntelange<br />
Daten besitzen“, erklärt Hessel.<br />
Die Feldversuche würden von warmen<br />
und trockenen Gebieten bis in den kalten<br />
Norden reichen. Die Bandbreite sei groß,<br />
deshalb könnten unterschiedliche Kulturpflanzen<br />
berücksichtigt werden.<br />
Bodenfruchtbarkeit sinkt<br />
„In einigen südlichen Ländern versalzen<br />
die Böden, andere haben Probleme mit<br />
Erosion“, erklärt Dr. Ellen Kandeler. In Mitteleuropa<br />
seien Bilder komplett erodierter<br />
Landoberflächen zum Glück unbekannt,<br />
jedoch würde ein Bodenverlust durch Wasser<br />
auf vielen Ackerflächen in Deutschland<br />
auftreten. Durch sturzflutartige Regenfälle<br />
kann in Hanglagen der ungeschützte Ackerboden<br />
erodieren. Dadurch geht fruchtbarer<br />
und humoser Boden verloren, der die landwirtschaftlichen<br />
Erträge garantiert. Der<br />
teilweise wenig sichtbare und in der Mehrzahl<br />
der Fälle schleichende Bodenverlust<br />
gefährdet langfristig die Bodenfruchtbarkeit,<br />
da weniger neuer Boden entsteht als<br />
verlorengeht.<br />
69<br />
Spurenelemente<br />
Gepresste<br />
Spurenelemente<br />
Gepresste<br />
Spurenelemente<br />
▪ gemäß TRGS 529<br />
▪ kein Pulver<br />
▪ keine Investitionskosten<br />
▪ keine Wartungskosten<br />
S&K Chemical Trading and Production GmbH<br />
S&K Chemical Trading and Production GmbH<br />
Rothenbaumchaussee 58, 20148 Hamburg<br />
Rothenbaumchaussee 58, 20148 Hamburg<br />
Gerrit Warncke, g.warncke@sk-chemical.de<br />
Gerrit<br />
Telefon: Warncke,<br />
04122-710916<br />
g.warncke@sk-chemical.de<br />
Telefon: www.sk-chemical.de<br />
04122-710916<br />
www.sk-chemical.de
(05)<br />
Wissenschaft<br />
Abbildung Inlandsabsatz 1: einzelner Inlandsabsatz Wirkstoffgruppen einzelner in Wirkstoffgruppen Pflanzenschutzmitteln in Pflanzenschutzmitteln<br />
Tonnen Wirkstoff<br />
50.000<br />
45.000<br />
40.000<br />
35.000<br />
30.000<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
29.769<br />
Bodenstruktur – Erosion und<br />
Verdichtung<br />
Zu den Belastungen durch Einwirken von schädlichen Substanzen<br />
und Elementen, die den Chemismus der Böden verändern,<br />
gesellen sich Beeinträchtigungen mit negativen Folgen für die<br />
Bodenstruktur. Die Bodenerosion, ob durch Wasser- oder Wind-<br />
45.527<br />
46.103<br />
43.420<br />
43.865 43.765<br />
40.744<br />
40.844<br />
einwirkung 38.883 und die Verdichtung der<br />
38.786<br />
Bodenstruktur<br />
38.757<br />
resultieren<br />
aus 34.647der menschlichen Bodenbewirtschaftung<br />
34.531 35.085 35.403 35.594<br />
33.663 34.678 35.755 35.131 oder werden<br />
35.494<br />
durch diese um ein vielfaches beschleunigt und verstärkt.<br />
5.1 Bodenerosion durch Wasser<br />
vielen Ackerflächen in Deutschland auf. Der<br />
teilweise wenig sichtbare und in der Mehrzahl<br />
der Fälle schleichende Bodenverlust gefährdet<br />
langfristig die Bodenfruchtbarkeit, da neuer<br />
Boden langsamer entsteht als sein Verlust.<br />
Treten sturzflutartige Regenfälle auf, kann in<br />
10.000<br />
Hanglagen der ungeschützte Ackerboden erodieren.<br />
Dadurch geht fruchtbarer und humoser<br />
Boden verloren, der die landwirtschaftli-<br />
5.000<br />
chen Erträge garantiert. Die an Bodenpartikel Es gibt natürliche Einflussfaktoren für die Entstehung<br />
von Erosion wie die Intensität der Nie-<br />
0<br />
gebundenen Nähr- und Schadstoffe gelangen<br />
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014<br />
in angrenzende Gewässer oder Ökosysteme. In derschläge, die Zusammensetzung des Bodens<br />
Einzelfällen werden Straßen und Wohngebiete und das Gefälle des Geländes (vgl. Abb. 5.6).<br />
Herbizide Fungizide Insektizide, Akarizide als Spritzmittel im Freiland Inerte Gase im Vorratsschutz * Sonstige Wirkstoffe (ohne inerte Gase)<br />
mit Erde überflutet mit negativen Auswirkungen Schon ab einem Gefälle von zwei Prozent<br />
auf die öffentliche Sicherheit (vgl. Abb. 5.5). kann Bodenerosion einsetzen. Besonders die<br />
* Kohlenstoff und Stickstoff<br />
Quelle: Industrieverband Agrar e. V.; Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel; Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und<br />
Verbraucherschutz (BMELV), Statistisches Jahrbuch über Ernährung, feinkörnigen Landwirtschaft Lößböden und Forsten, fortlaufende sind Jahrgänge. sehr empfindlich.<br />
Daten für 2012 bis 2014:<br />
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel, Absatz an Pflanzenschutzmitteln in der Bundesrepublik Deutschland. Ergebnisse der Meldungen<br />
In Mitteleuropa sind Bilder komplett erodierter<br />
Landoberflächen zum Glück unbekannt, flussgrößen entscheiden über das tatsächliche<br />
Die von gemäß der § 19 Bewirtschaftung Pflanzenschutzgesetz für die Jahre abhängigen 2012 bis 2014, Braunschweig. Ein-<br />
Der Inlandsabsatz jedoch an Pflanzenschutzmitteln tritt die Bodenerosion stieg durch von Wasser knapp auf 30.000 Auftreten Tonnen und (1994) Ausmaß auf über der Erosion. 46.000 Tonnen Die Vielfalt<br />
(2014) an. Den größten Anteil an den ausgebrachten Spritzmitteln stellte in Deutschland die Gruppe der<br />
Herbizide. Sie machte 2014 rund 39 Prozent aus.<br />
Abbildung 5.1<br />
Bundesweite Abbildung 2: Erosionsgefährdung Bundesweite Erosionsgefährdung durch Wasser der Böden von Ackerflächen durch Wasser<br />
in unterschiedlichen Bestellweisen<br />
Szenario 100 %<br />
konservierend /<br />
pfluglos<br />
Status Quo in<br />
2007 50 %<br />
konservierend /<br />
pfluglos<br />
Szenario 25 %<br />
konservierend /<br />
pfluglos<br />
Szenario<br />
konventionell /<br />
Pflug<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100<br />
Flächenanteil in Prozent<br />
Erosionsgefährdung nach DIN 19708<br />
keine bis sehr gering sehr gering gering mittel<br />
hoch<br />
sehr hoch<br />
Quelle: Wurbs, D. und Steininger, M., 2011<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
„Bei einer hohen Beigabe von Pestiziden<br />
ist zudem die Biodiversität im Boden<br />
gestört“, weiß die Forscherin. Dies<br />
sei in vielen europäischen Ländern der<br />
Fall. Ein Gramm eines gesunden Bodens<br />
enthält Milliarden von Mikroorganismen:<br />
Bakterien, Pilze, Algen und Einzeller.<br />
Unter einem Quadratmeter eines<br />
intakten Bodens leben Hunderttausende<br />
bis Millionen von Bodentieren, wie<br />
Fadenwürmer, Regenwürmer, Milben,<br />
Asseln, Springschwänze und Insektenlarven.<br />
Je intensiver landwirtschaftliche<br />
Böden bewirtschaftet werden, desto geringer<br />
sind Artenzahl und Vorkommen<br />
der Bodenorganismen.<br />
SoilCare in Deutschland<br />
„Eine Bodenverbesserung ist notwendig,<br />
um die Negativspirale aus Bodenverschlechterung<br />
(Degradation),<br />
erhöhten Inputs, Kosten und Umweltschäden<br />
zu durchbrechen“, erklärt<br />
Kandeler. Eine Möglichkeit sei der<br />
Konservierende Ackerbau, mit dem in<br />
Deutschland schon gute Erfolge erzielt<br />
worden seien (siehe Abbildung 2). Diese<br />
Anbauart besteht aus drei Säulen:<br />
eine minimale Bodenbearbeitung, eine<br />
weite Fruchtfolge und ein intensiver<br />
Zwischenfruchtanbau.<br />
„Weil die Ziele gut zueinander passen,<br />
ist das deutsche Forschungsprojekt<br />
„Konservierender Ackerbau“ in<br />
das EU-Projekt eingebettet“, erklärt<br />
die Hohenheimer Professorin. Bereits<br />
46<br />
www.zortea.at<br />
.zortea.atwww.zortea.at<br />
Die Marke für optimale Hydraulik<br />
Die Marke für Die optimale Marke für Hydraulik optimale Hydraul<br />
70<br />
Effizientes Sammeln und Verteilen vo<br />
Effizientes Sammeln Effizientes und Sammeln Verteilen und von Verteilen<br />
Wärme und Kält<br />
Wärme und Wärme Kälte und K<br />
1<br />
Einfache, wartungsfreie Hydrauli<br />
Einfache, wartungsfreie Einfache, wartungsfreie Hydraulik Hydr<br />
20<br />
1<br />
20 2<br />
Jeder Kreis mit der richtigen Temperatu<br />
Jeder Kreis Jeder mit der Kreis richtigen mit der Temperatur richtigen Tempe<br />
„ausgeglichene Druckverhältnisse<br />
„ausgeglichene „ausgeglichene Druckverhältnisse“ Druckverhältn
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Wissenschaft<br />
2013 wurde das Forschungsprojekt als Kooperationsprojekt<br />
mit Wissenschaftlern von<br />
Hochschulen und Universitäten, Landratsämtern,<br />
landwirtschaftlichen Beratern und<br />
17 Landwirten aus Baden-Württemberg ins<br />
Leben gerufen. Ziel des vom Ministerium<br />
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz<br />
Baden-Württemberg geförderten<br />
Projekts ist die Erprobung und Einführung<br />
von Anbautechniken des konservierenden<br />
Ackerbaus in Baden-Württemberg.<br />
Das bedeutet eine reduzierte Bodenbearbeitung<br />
bis hin zur Direktsaat sowie der<br />
Anbau von Zwischenfrüchten. „Die Anwendung<br />
dieser Techniken wirkt sich positiv auf<br />
die Bodenfruchtbarkeit aus“, erklärt Kandeler.<br />
Die Erosion und die Belastung des<br />
Grundwassers würden reduziert, das CO 2<br />
in<br />
den Böden gebunden und die Artenvielfalt<br />
auf den Äckern erhöht. In der zweiten Projektphase,<br />
die sich gerade in der Antragstellung<br />
befindet, wollen die Forscherinnen<br />
und Forscher gemeinsam mit den Landwirten<br />
untersuchen, inwieweit beim konservierenden<br />
Ackerbau auf Glyphosat verzichtet<br />
werden kann.<br />
Dabei sei es ganz wichtig, dass Wissenschaftler,<br />
Landmaschinenhersteller und Landwirte<br />
Hand in Hand arbeiten. Mit den Firmen Amazone<br />
(Bodenbearbeitungsgeräte) und Deutsche<br />
Saatenveredelung (DSV) wird auch das<br />
Know-how von zwei innovativen mittelständischen<br />
Unternehmen mit eingebracht. Die<br />
Erkenntnisse sollen in die Politik gelangen,<br />
damit sie so schnell wie möglich praktisch<br />
umgesetzt werden können.<br />
In einigen südlichen Ländern versalzen die Böden,<br />
andere haben Probleme mit Erosion. In den letzten<br />
Jahren setzte in Deutschland die Trockenheit den<br />
Böden stark zu. Etwa die Hälfte der Pflanzen auf<br />
dem Versuchsfeld überlebte die Dürrezeit nicht.<br />
Hilfe für Landwirte<br />
Eine wichtige Aufgabe von SoilCare besteht<br />
darin, die Vor- und Nachteile verschiedener<br />
Anbausysteme zu identifizieren und mögliche<br />
Folgen auf Bodenqualität und Umwelt<br />
abzuschätzen. Es soll ein Maßnahmenkatalog<br />
ausgearbeitet werden, der den Landwirten<br />
eine echte Hilfestellung bietet, wenn<br />
sie ihre Böden verbessern möchten. Die<br />
Forscher wollen auch eine Methode entwickeln,<br />
die es ermöglicht, die Ergebnisse der<br />
einzelnen Standorte auf ganz Europa „hochzuskalieren“.<br />
„Wir wollen ein interaktives Tool entwickeln,<br />
das eine Hilfestellung bei der Auswahl von<br />
bodenverbessernden Anbausystemen bietet“,<br />
erklärt die Professorin und nennt ein<br />
Beispiel: „Ein Bauer könnte nach der Eingabe<br />
verschiedener Parameter, wie Standortdaten<br />
und mittlere Jahrestemperatur,<br />
Anbauvorschläge erhalten.“ Wenn er also<br />
normalerweise Mais anbaut, würde das Tool<br />
ihm vielleicht Alternativen vorschlagen. Das<br />
Projektteam will auch ermitteln, welche<br />
Hindernisse für die Nutzung dieser besseren<br />
Systeme bestehen und wie Landwirte durch<br />
geeignete Förderinstrumente bei der Umsetzung<br />
unterstützt werden können. Ein ganz<br />
wichtiger Aspekt ist in dem EU-Projekt die<br />
Öffentlichkeitsarbeit. „In der Vergangenheit<br />
sind die Wissenschaftler davon ausgegangen,<br />
dass alleinige Forschung ausreicht“,<br />
ergänzt Prof. Dr. Pekrun von der Hochschule<br />
in Nürtingen-Geislingen. „Durch „SoilCare“<br />
arbeiten wir mit Landwirten, aber auch mit<br />
Landmaschinenfabrikanten und Politikern,<br />
um sicherzugehen, dass diese von unseren<br />
Resultaten Kenntnis nehmen.“<br />
SoilCare wird über das EU-Programm „HO-<br />
RIZON 2020“ finanziert. Es startete Anfang<br />
März 2016 und endet im Februar 2021.<br />
Autorin<br />
Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
Freie Journalistin<br />
Hohlgraben 27 · 71701 Schwieberdingen<br />
Tel. 0 71 50/9 21 87 72<br />
Mobil: 01 63/232 68 31<br />
E-Mail: braesel@mb-saj.de<br />
www.mb-saj.de<br />
ik<br />
Fit für die Anschlussförderung:<br />
Jetzt die Chance zur Anlagenflexibilisierung<br />
nutzen!<br />
n<br />
von<br />
e<br />
älte<br />
1<br />
k<br />
aulik<br />
0<br />
r<br />
ratur<br />
“<br />
isse“<br />
Clean Energy Sourcing | Katharinenstraße 6 | 04109 Leipzig<br />
Telefon +49 341 30 86 06-00 | Fax -06 | info@clens.eu | clens.eu<br />
n Direktvermarktung<br />
n Anlagenflexibilisierung (Contracting)<br />
n Flexibilitätsvermarktung<br />
n Optionsprämie<br />
n Regelenergie<br />
n Fahrplanbetrieb<br />
n Marktübergreifende Optimierung<br />
n Eigenstromversorgung<br />
71
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Biogasanlage HBFZ und<br />
aufgeständerte PV-Module,<br />
die Sonnenlicht in Ökostrom<br />
umwandeln.<br />
Flexible Gasproduktion<br />
im Test<br />
Wie lässt sich die Gasproduktion in Biogasanlagen<br />
optimieren? Diese Frage untersuchen<br />
Wissenschaftler im Rahmen eines<br />
Forschungsprojektes. Ihr Ziel: Die Bakterien<br />
so zu versorgen, dass sie bedarfsgerecht<br />
produzieren. Dadurch könnten die Gasspeicher<br />
kleiner werden.<br />
Von Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
Wir wollen bestehende Biogasanlagen<br />
fit für die Zukunft machen“, erklärt<br />
Dr. Henning Hahn vom Fraunhofer<br />
Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik<br />
(IWES). Das Forschungsprojekt<br />
mit dem Kürzel UBEDB beinhalte das<br />
Upgrading von Bestandsbiogasanlagen ebenso wie die<br />
flexible Energieerzeugung für die bedarfsorientierte<br />
Biogasproduktion. „Mit über 8.000 Bestandsanlagen<br />
haben wir in Deutschland den weltgrößten Bioenergiepark<br />
aufgebaut“, so Hahn. Das Projekt habe es sich<br />
zur Aufgabe gestellt, herauszufinden, wie diese ohne<br />
großen Kostenaufwand zukunftsfähig werden können.<br />
„Bislang produzierten die Anlagen als Grundlastkraftwerke<br />
Strom möglichst an vielen Stunden im Jahr“,<br />
berichtet der Wissenschaftler, nun würden neue Anforderungen<br />
an den Biogasanlagenbestand gestellt.<br />
Im Wesentlichen gehe es um die Integration der Bioenergie<br />
ins Versorgungssystem: „Erneuerbare Energien<br />
müssen zunehmend flexibler werden“, berichtet er.<br />
Wind und Sonne könnten das nur begrenzt. „Wir schauen<br />
deshalb, wie Biogasanlagen Versorgungslücken am<br />
besten füllen können“, betont Hahn. Dabei verfolgen<br />
die Forscher Lösungsansätze, die für die Anlagenbetreiber<br />
einen möglichst geringen finanziellen und technischen<br />
Aufwand bedeuten. Das Ergebnis sollen hochflexible<br />
Anlagen sein, die auch über längere Zeiträume<br />
mit der Stromproduktion pausieren können.<br />
Trotz dieser Eigenschaften soll der Gasspeicher nicht<br />
überproportional wachsen: „Für eine bedarfsgerechte<br />
Einspeisung ist die Installation elektrischer Überkapazitäten<br />
notwendig, doch ein übergroßer Gasspeicher<br />
nicht“, erklärt Henning Hahn, denn dieser habe<br />
deutliche Nachteile: Neben dem größeren Investitionsaufwand<br />
und dem höheren Platzbedarf seien ab bestimmten<br />
Kapazitätsgrenzen auch zusätzliche Sicherheits-<br />
und Genehmigungsauflagen zu erfüllen. „Mit<br />
dem Forschungsprojekt wollen wir diese Minuspunkte<br />
abmildern“, verdeutlicht er.<br />
Besonders wichtig: die Wirtschaftlichkeit<br />
Das Projekt UBEDB wird vom Hessischen Biogasforschungszentrum<br />
(HBFZ) durchgeführt. Das HBFZ ist<br />
eine Kooperation des Fraunhofer IWES mit dem Landesbetrieb<br />
Landwirtschaft Hessen (LLH) und dem Landesbetrieb<br />
Hessisches Landeslabor (LHL). „Durch diesen<br />
Zusammenschluss können wir die komplette Kette<br />
vom Feld über die Biogasanlage bis hin zur Steckdose<br />
abbilden“, berichtet Hahn.<br />
Die Forschungsanstalt sei aufgebaut wie ein kleines<br />
Dorf. So gibt es die verschiedensten Erzeuger und Verbraucher,<br />
dazu gehören eine Biogasanlage, eine PV-<br />
Anlage, ein Heizwerk und ein Nahwärmenetz. „Die Versuchsbiogasanlage<br />
ist eine konventionelle BGA, wie es<br />
viele gibt“, berichtet der Forscher. Die „Mutterbiogasanlage“<br />
habe eine Größe von etwa 180 Kilowatt (kW),<br />
der Forschungsfermenter liefere Gas für 60 kW. „Auf<br />
dem Versuchsgelände testen wir, wie Anlagen gefahren<br />
oder aufgerüstet werden sollten“, so Hahn.<br />
Das Ziel sei, dass die BGA künftig einen „Mehrwert<br />
für das Energiesystem, die Landwirtschaft und den<br />
ländlichen Raum bringen“. Klaus Anduschus vom Maschinenring<br />
Kommunalservice Kassel ergänzt: „Da die<br />
72
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Wissenschaft<br />
Fotos: IWES<br />
Forschungsfermenter mit Futterdosierstation davor.<br />
Forschungsbiogasanlage nicht kommerziell<br />
betrieben wird, können Anlagenbetreiber<br />
von den Ergebnissen profitieren, ohne<br />
dabei selbst das Risiko von Prozessstörung<br />
oder reduzierten Gaserträgen auf sich zu<br />
nehmen.“<br />
Neben der Suche nach dafür geeigneten,<br />
im landwirtschaftlichen Umfeld anfallenden<br />
Substraten interessieren sich die Wissenschaftler<br />
vor allem dafür, in welchen<br />
Mengen und wie oft diese Substrate der<br />
Anlage zugeführt werden müssen. Darüber<br />
hinaus wollen sie unter Berücksichtigung<br />
verschiedener Anlagengrößen die Wirtschaftlichkeit<br />
einer dynamischen Biogasproduktion<br />
untersuchen.<br />
Anforderung an die Substrate<br />
durch Flexibilisierung<br />
Die Laborversuche, die rund ein Jahr dauerten,<br />
führte der Landesbetrieb Hessisches<br />
Landeslabor (LHL) durch. „Eine bedarfsgerechte<br />
Fahrweise stellt andere Anforderungen<br />
an die Fütterung“, betont Dr. Fabian<br />
Jacobi (LHL). So solle die Gasproduktion<br />
Luftbild HBFZ<br />
deutlich sinken, wenn die Strompreise<br />
im Keller seien, und bei höheren Erlösen<br />
schnell abrufbar sein. „Dies können wir<br />
einerseits erreichen, indem wir die Menge<br />
der gefütterten Substrate variieren“, aber<br />
auch über die Auswahl der Substrate könne<br />
dies geschehen.<br />
Um auf große Gasspeicher zu verzichten,<br />
sei eine Voraussetzung, dass die Gasproduktion<br />
zügig einsetze und zuverlässig<br />
ansteige. Wie langsam oder schnell eine<br />
Pflanze dabei abgebaut werde, hänge im<br />
Wesentlichen von ihren Inhaltsstoffen ab.<br />
Zucker- und stärkehaltige Pflanzen würden<br />
prinzipiell schneller vergoren und eigneten<br />
sich deswegen gut für einen schnellen und<br />
flexiblen Einsatz in Biogasanlagen.<br />
Die Forscher wählten für die Versuche typische<br />
Substrate, die im landwirtschaftlichen<br />
Umfeld anfallen, und auch alternative<br />
Energiepflanzen. Getestet wurden<br />
unter anderem: Mais, Gülle und Mist,<br />
Getreideschrot und Ganzpflanzensilage,<br />
es kamen aber auch Wildpflanzenmischungen,<br />
Silphie und Zuckerrüben zum<br />
Einsatz. In verschiedenen<br />
Versuchsreihen wurden<br />
unterschiedliche Substrate<br />
zusammengestellt und<br />
erprobt. Verwendet wurden<br />
dabei einerseits Kombinationen<br />
mit den klassischen<br />
Substraten wie<br />
Mais, Festmist und Gülle,<br />
getestet wurden aber auch<br />
„exotischere Mischungen“.<br />
Diese sollen, wenn<br />
sie sich bewähren, zur<br />
Vielfalt im Feld beitragen.<br />
73
Wissenschaft<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Simulierte und gemessene Biogasproduktion im Vergleich<br />
Biogasproduktion (l/h)<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
Summe simulierte Produktion<br />
gemessene Gasproduktion<br />
0<br />
Mo Di Mi Do Fr Sa So<br />
Die Grafik zeigt, wie sich die Gasproduktion im Wochenverlauf in Abhängigkeit der Fütterung<br />
ändert. Durch die forcierte Fütterung zu Wochenbeginn treten hier die höchsten Gasproduktionsraten<br />
auf. Mit Abnahme der Fütterung sinkt die Gasproduktion zum Wochenende hin. Die<br />
simulierte Produktion stimmt – bis auf den Montag – gut überein.<br />
„Um die optimale Gasproduktionsverteilung zu erhalten,<br />
erstellten wir exemplarische Verbrauchsszenarien“,<br />
erklärt Fabian Jacobi. Betrachtet wurde einmal<br />
ein Gasverbrauch über zwölf Stunden an Wochentagen<br />
und mit einem Stillstand am Wochenende. Das zweite<br />
Szenario war gleich bis auf einen geringen aber kontinuierlichen<br />
Grundverbrauch. Im Versuchsverlauf veränderten<br />
die Forscher die täglichen Futtermengen so,<br />
dass die Gasproduktion am Wochenende nur minimal<br />
war. Zu diesem Zweck erhielt die Anlage zu Wochenanfang<br />
die größte Substratmenge. Die Gasproduktion<br />
stieg an und erreichte dienstags den höchsten Wert.<br />
Im Lauf der Woche wurde die Fütterung verringert,<br />
damit sank auch die Gasproduktion. Am Samstag und<br />
Sonntag wurde die BGA sogar auf Nulldiät gesetzt. „Die<br />
im Labor nicht anders durchführbare hohe Dosierung<br />
Quelle: Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL)<br />
der vollen Tagesmenge am Montagmorgen führte im Zusammenhang<br />
mit der vorangehenden Fütterungspause<br />
zu einer Überlastung der Biologie“, erklärt Jacobi. Diese<br />
habe sich in einer verzögerten Gasproduktion gezeigt.<br />
Es zeigte sich aber auch, dass dieser „Peak“ durch die<br />
Vorabdosierung einer geringen Substratmenge vermindert<br />
werden kann. „Eventuell führt diese Zugabe zu<br />
einer Stoffwechselaktivität der Mikroorganismen, die<br />
dann die zugeführten Mengen besser bewältigen können“,<br />
vermutet der Experte. Durch eine häufigere und<br />
über den Tag verteilte Fütterung könne dieser Effekt<br />
wohl vollends ausgeschlossen werden.<br />
„Obwohl noch nicht alle Simulationen durchgeführt<br />
wurden, zeigte sich, dass der Einsatz einer flexibilisierten<br />
Gasproduktion den notwendigen Speicherbedarf<br />
massiv reduzieren kann“, resümiert Jacobi. Weiterhin<br />
wurde deutlich, dass die Bilanzierung aus den gemessenen<br />
und den simulierten Daten zu vergleichbaren<br />
Ergebnissen kommt. „Dies erlaubt uns den Einsatz von<br />
simulierten Gasproduktionsraten für die Berechnung<br />
weiterer Fütterungs- und Gasproduktionsszenarien“,<br />
erläutert der Experte.<br />
Viele Vorteile<br />
„Die Ergebnisse der Laborversuche sind sehr vielversprechend<br />
und haben unsere anfänglichen Wünsche noch<br />
übertroffen“, freut sich Lena Vogel, die für die nun folgenden<br />
großtechnischen Biogasversuche verantwortlich<br />
ist. Weiter geht es nur für die drei vielversprechendsten<br />
Kandidaten. Durchgesetzt hat sich ein Substratmix aus<br />
Mais und Gülle und ein weiterer aus Silphie, Getreideschrot<br />
und Gülle. Die dritte Mischung, die großtechnisch<br />
erforscht wird, besteht aus Zuckerrüben, Mais, Festmist<br />
und Gülle. „Mit diesen Zusammensetzungen wurden<br />
gute Laborergebnisse erzielt, zudem haben sie eine hohe<br />
Praxisrelevanz“, erklärt die IWES-Wissenschaftlerin.<br />
SICHERHEIT, QUALITÄT, SERVICE UND INNOVATION<br />
Speicherkonzepte für Biogas-, Substrat, Gülle, Sickerwasser, Rübenmus- und Gärrestelagerung.<br />
Egal ob Doppelmembran-Gasspeicher, mastgestütztes Biogasdach,<br />
Folienerdbecken, Behältersanierung mit Innenauskleidung, Emissionsschutz für<br />
Güllelager mit Stützendächer oder schwimmende Abdeckung - wir haben für jede<br />
Anforderung die passende Lösung.<br />
Setzen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und Kompetenz!<br />
BIO<br />
GAS<br />
SPEICHER<br />
HOCH<br />
SILO<br />
DÄCHER<br />
ERD<br />
BECKEN<br />
GASDICHT<br />
Sattler Ceno TOP-TEX GmbH<br />
74<br />
Sattlerstrasse 1, A-7571 Rudersdorf Am Eggenkamp 14, D-48268 Greven<br />
T: +43 3382 733 0 T: +49 2571 969 0<br />
biogas@sattler-global.com<br />
www.sattler-ceno-toptex.com
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Wissenschaft<br />
Über den dritten Projektpartner, den Maschinenring<br />
Kommunalservice aus Kassel,<br />
der über 300 Biogasanlagenbetreiber berät,<br />
werden die Ergebnisse im Rahmen des Forschungsprojektes<br />
direkt in die Praxis übertragen.<br />
Aus dem Pool wurden zwei Anlagen<br />
ausgewählt, die direkt die Praxistauglichkeit<br />
der Ergebnisse testen. Zum Schluss soll der<br />
Anlagenbetreiber ganz praktisch Anregungen<br />
für ein alternatives Flexibilisierungskonzept<br />
erhalten. Die Ergebnisse sollen die Flexibilisierung<br />
kleiner und großer Biogasanlagen wirtschaftlicher<br />
machen.<br />
„Spannend ist das Projekt vor allem für größere<br />
BGA“, führt Hahn aus, doch auch kleine<br />
Anlagen könnten von den Ergebnissen profitieren.<br />
Diese seien zwar unter 100 kW von der<br />
Flexibilisierungspflicht befreit, doch eine bedarfsgerechte<br />
Fütterung würde auch bei ihnen durchaus<br />
Sinn machen. Letztendlich müsse aber jeder Landwirt<br />
selbst schauen, welche Substrate ihm regional und saisonal<br />
vorliegen, und die beste Lösung individuell für sich<br />
herausfinden.<br />
„Neben der erfolgreichen Flexibilisierung erhoffen wir<br />
uns eine Auflockerung der Fruchtfolgen“, erklärt Klaus<br />
Wagner vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen. „Es<br />
wird interessant sein zu beobachten, wie schnell und<br />
zuverlässig sich die Biogasproduktion aus bisher noch<br />
nicht so weit verbreiteten Einsatzstoffen wie Silphie und<br />
Zuckerrüben steigern lässt.“ Dies könne wichtige Impulse<br />
für vielfältigere Energiefruchtfolgen in der Praxis<br />
geben. Die größere Kulturvielfalt würde dann zu einer<br />
Steigerung der Biodiversität im ländlichen Raum beitragen.<br />
Auf diese Weise will das Projekt der Kritik „Biogasanlagen<br />
vermaisen die Landschaften“ die Grundlage<br />
entziehen.<br />
„Ohne Netzausbau und übergroße Gasspeicher bringen<br />
Biogasanlagen dann nicht nur einen Mehrwert für das<br />
Energieversorgungssystem, sondern bereichern auch<br />
den ländlichen Raum“, resümiert Hahn. Die Zunahme<br />
der Biodiversität sei dann ein schönes Nebenprodukt<br />
der Flexibilisierung. „Wir schaffen das mit unseren Biogasanlagen<br />
und vielleicht sogar in einem wirtschaftlich<br />
guten Rahmen“, vermutet er.<br />
Autorin<br />
Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />
Freie Journalistin<br />
Hohlgraben 27 · 71701 Schwieberdingen<br />
Tel. 0 71 50/9 21 87 72<br />
Mobil: 01 63/232 68 31<br />
E-Mail: braesel@mb-saj.de<br />
www.mb-saj.de<br />
IWES-Mitarbeiterin<br />
Lena Vogel, die die Versuchsdurchführung<br />
betreut,<br />
bei der Fütterung<br />
der Versuchsanlage.<br />
DIE BESSERE<br />
SEPARATIONSTECHNIK<br />
Der Bioselect separiert Flüssigmist und<br />
Gärreste im geschlossenen System durchbruchsicher<br />
und geruchsneutral.<br />
Auf Wunsch liefern wir Separator, Drehkolbenpumpe<br />
und Steuerungstechnik perfekt<br />
aufeinander abgestimmt und anschlussfertig<br />
auf einem kompakten Grundgestell.<br />
Den Bioselect gibt es in vier Größen<br />
mit max. Durchsatzmengen von<br />
30 – 150 m³/h je Gerät.<br />
www.boerger.de Börger GmbH | D-46325 Borken-Weseke | Tel. 02862 9103 30<br />
75
International<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Biogas in Brasilien – neue<br />
Perspektiven in Zeiten der Krise<br />
Brasilia<br />
Seit ein paar Jahren durchlebt Brasilien eine wirtschaftliche und politische Krise,<br />
die auch Investitionen in Biogasanlagen erschwert. Trotzdem sind Technologieanbieter<br />
gefragt und einige deutsche beziehungsweise europäische Unternehmen<br />
haben mit brasilianischen Partnern bereits erfolgreich Lösungen entwickelt, um<br />
das theoretisch große Potenzial zu nutzen.<br />
Von Jens Giersdorf und Wolfgang Roller<br />
Die brasilianische Regierung hat im Dezember<br />
vergangenen Jahres ein Biokraftstoffprogramm<br />
lanciert, das ausdrücklich auch<br />
Biomethan nennt. Eine Verbesserung der<br />
Förder- und der Finanzierungsbedingungen<br />
könnte dem Biogasmarkt in Brasilien endgültig<br />
zu einem Durchbruch verhelfen. Das Programm „RenovaBio”<br />
hat zum Ziel, den Anteil von erneuerbaren<br />
Kraftstoffen kompatibel mit dem Marktwachstum und<br />
den internationalen Klimaschutzverpflichtungen Brasiliens<br />
zu erhöhen. Das Bemerkenswerte ist, dass Biogas<br />
erstmals in einem Atemzug mit Ethanol und Biodiesel<br />
genannt wird, die traditionell eine starke Lobby haben.<br />
Ricardo Gomide vom brasilianischen Energieministerium<br />
bestätigt, dass Biogas auf der Agenda der brasilianischen<br />
Regierung sei. Laut brasilianischem Biogasverband<br />
Abiogás könnte Brasilien 71 Millionen (Mio.)<br />
Kubikmeter (m³) Biomethan pro Tag produzieren, was<br />
44 Prozent des Diesel- beziehungsweise 73 Prozent<br />
des nationalen Erdgasverbrauchs entspräche.<br />
Der überwiegende Teil dieses Potenzials ist in São Paulo<br />
und angrenzenden Bundesstaaten zu finden, in denen<br />
Nebenprodukte der Zucker- beziehungsweise Ethanolindustrie<br />
wie Filterkuchen, Vinasse und Zuckerrohrstroh<br />
zur Biogaserzeugung genutzt werden können. Eine Anlage<br />
im Nordwesten des Bundesstaats Paraná erzeugt<br />
bereits seit 2011 auf Basis dieser Substrate Biogas,<br />
das derzeit in mehreren BHKW mit insgesamt 10 MW el<br />
installierter Leistung verstromt wird. Dass die Verstromung<br />
von Biogas auf der Basis von Nebenprodukten der<br />
Zucker- und Ethanolherstellung in Brasilien nicht nur<br />
technisch möglich, sondern auch wettbewerbsfähig ist,<br />
bewies die Stromauktion im April vergangenen Jahres.<br />
21-MW-Anlage soll ab 2021 Strom liefern<br />
Neben Projekten der Verstromung fester Biomasse (Zuckerrohrbagasse<br />
und Holzhackschnitzel) konnte sich<br />
auch ein Biogasprojekt aus São Paulo durchsetzen, das<br />
mit einer geplanten installierten Kapazität von 21 MW el<br />
Strom zum Preis von 251 Brasilianischen Real pro<br />
Bild 1: Anlage in<br />
Castro, Paraná<br />
76<br />
Foto: Catharina Vale
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Nutzen Sie International<br />
die Flexibilisierungsprämie<br />
und sichern Sie sich<br />
neue Einkünfte neben der Landwirtschaft!<br />
Foto: Jens Giersdorf<br />
Bild 2: Anlage in Pomerode,<br />
Santa Catarina<br />
Megawattstunde (entspricht<br />
etwa 72 Euro/MWh) angeboten<br />
hatte und ab Januar 2021<br />
Strom liefern muss. Die Stromlieferverträge<br />
werden für 25<br />
Jahre abgeschlossen, sodass die<br />
Stromauktionen für Anlagen mit<br />
mehr als 5 MW el<br />
installierter Kapazität Planungssicherheit<br />
bieten und die Finanzierung<br />
der Investitionen erleichtern.<br />
In den offiziellen Statistiken der brasilianischen<br />
Stromregulierungsbehörde ANEEL<br />
spiegeln sich diese Fortschritte aber noch<br />
nicht wider. Zwischen 2014 und 2016 sind<br />
lediglich sieben Biogasverstromungsanlagen<br />
neu hinzugekommen mit einer zusätzlichen<br />
installierten Kapazität von 36,8 MW el<br />
(siehe Tabelle).<br />
Da in Brasilien nicht zwischen Deponie-,<br />
Klär- und Biogas unterschieden wird und<br />
einzig im Deponiegasbereich neue Anlagen<br />
hinzugekommen sind, stagniert die Entwicklung<br />
auf den ersten Blick. Allerdings<br />
gibt es Projekte, die sich diese fehlende<br />
Differenzierung, die auch eine größere regulatorische<br />
Freiheit bedeutet, zunutze machen.<br />
Die direkt neben der größten Kläranlage<br />
der Landeshauptstadt Curitiba im Bau<br />
befindliche Anlage des Wasserversorgungsunternehmens<br />
SANEPAR soll mit einer<br />
geplanten installierten Kapazität von 2,8<br />
MW el<br />
Klärschlamm zusammen mit Gemüseund<br />
Marktabfällen co-vergären. Sie wäre in<br />
dieser Hinsicht nicht nur für Brasilien eine<br />
technologische Innovation. Unter Nutzung<br />
der Kraft-Wärme-Kopplung wird der Gärrest<br />
getrocknet und zu pelletiertem Dünger weiterverarbeitet.<br />
Insgesamt wird dadurch eine<br />
hohe Entlastung der Deponie erreicht. Die<br />
so eingesparten Entsorgungskosten tragen<br />
wesentlich zur Wirtschaftlichkeit des Geschäftsmodells<br />
bei.<br />
4. Biogasforum im Herbst<br />
Vom 17. bis 18. Oktober <strong>2017</strong> wird das 4. Biogasforum in São<br />
Paulo stattfinden. Am 3. Biogasforum 2016 nahmen 250 Interessenten<br />
und 20 Aussteller teil und deutsche Unternehmen<br />
hatten Gelegenheit, Kontakte zu brasilianischen Firmen und Ingenieurbüros<br />
anzubahnen. Mehr Informationen in Kürze unter:<br />
http://www.abiogas.org.br<br />
Verbesserte Rahmenbedingungen<br />
durch deutsche Unterstützung<br />
Damit diese und andere Geschäftsmodelle in<br />
konkrete Projekte umgesetzt werden können,<br />
wurden zahlreiche regulatorischen Rahmenbedingungen<br />
für Biogasanlagen in den letzten<br />
Jahren mit Unterstützung der deutschbrasilianischen<br />
Kooperation geschaffen<br />
beziehungsweise deutlich verbessert:<br />
ffDie Regulierungsbehörde für Erdöl,<br />
Erdgas und Biokraftstoffe ANP hat<br />
im Januar 2015 mit der Resolution<br />
8/2015 Biomethan spezifiziert, sodass<br />
dieses – sofern Substrate aus der<br />
Landwirtschaft beziehungsweise der<br />
Agrarindustrie benutzt werden – ins<br />
Erdgasnetz eingespeist und als Kraftstoff<br />
verkauft werden kann.<br />
ffDie Umweltgenehmigungsbehörde des<br />
Bundesstaats Minas Gerais hat das<br />
Umweltgenehmigungsverfahren für<br />
Anlagen bis 10 MW, die Biogas verstromen,<br />
vereinfacht.<br />
ffDie Stromregulierungsbehörde ANEEL<br />
hat die Resolution 482/2012, die die<br />
Möglichkeit des Net Meterings für Strom<br />
aus erneuerbaren Energiequellen beinhaltete,<br />
im März 2016 angepasst und<br />
die Rahmenbedingungen für die dezentrale<br />
Biogaserzeugung und Stromnutzung<br />
verbessert. So können nun Anlagen<br />
mit bis zu 5 MW el<br />
von Kooperativen<br />
betrieben und mit dem Stromverbrauch<br />
77<br />
Mit PlanET <strong>2017</strong><br />
in die Flexprämie<br />
Mit dem PlanET Rendite-Konzept<br />
„BHKW Flex“ sind Sie auf der<br />
sicheren Seite:<br />
• Rendite finanziert Ihre Investition<br />
• Stabiles Ertragsmodell für<br />
Altanlagen<br />
• Sicherer Einstieg in die Flexibilitätsprämie<br />
Unsere Lösung für Bestandsanlagen:<br />
Das PlanET Gasmanagement.<br />
PlanET eco ® Gasakku<br />
• Herstellerunabhängige<br />
Flex-Technik<br />
• Einfache Nachrüstung<br />
• Kostengünstiger Speicherraum<br />
www.planet-biogas.com<br />
Telefon 02564 3950 - 166
International<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Biogaskarte Brasilien<br />
Quelle: CI Biogas, http://mapbiogas.cibiogas.org<br />
relativ flexibel verrechnet werden beziehungsweise<br />
kann ein Stromguthaben bis<br />
zu 60 Monate angespart werden.<br />
ffDas Städteministerium hat im März<br />
2016 die Klärgaserzeugung und -nutzung<br />
ausdrücklich in die Liste finanzierbarer<br />
Maßnahmen bei Kläranlagen<br />
aufgenommen.<br />
ffIm Dezember 2016 hat die Regulierungsbehörde<br />
des Bundesstaats São<br />
Paulo für Abwasser, Abfall und Energie<br />
ARSESP den Entwurf einer Einspeiseregelung<br />
für Biomethan ins Erdgasnetz in<br />
São Paulo vorgestellt.<br />
Insgesamt stellen sich also die Rahmenbedingungen<br />
heute wesentlich besser dar und<br />
eine Multiplizierung erfolgreicher Pilotprojekte<br />
ist vor allem im landwirtschaftlichen<br />
Bereich zu erwarten. Insbesondere die Nutzung<br />
von Biomethan im mit der Agrarwirtschaft<br />
verknüpften Transportsektor zeigt<br />
sich vielversprechend und lässt in Brasilien<br />
Skaleneffekte zu, die durch internationale<br />
Technologiekooperationen mit Europa jetzt<br />
zugänglich sind und bei weiterer Marktentwicklung<br />
vor Ort für Investitionen interessante<br />
Möglichkeiten bieten.<br />
Unternehmen wie AAT, Archea, Awite, ME-<br />
LE Biogas GmbH, Eco-GmbH, Suma und<br />
andere deutsche beziehungsweise europäische<br />
Biogasunternehmen sind bereits<br />
78
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
International<br />
Biogasanlagen (Anzahl und installierte Leistung in MW) 2014 und 2016 in Brasilien<br />
Anlagenzahl<br />
Biogasanlagen in Betrieb<br />
Installierte Leistung in MW<br />
2014 2016 2014 2016<br />
Abfall/Deponiegas 7 12 77 113<br />
Klärgas 3 3 4 4<br />
Landwirtschaft 10 11 2 2<br />
Agrarindustrie 2 3 0,9 1,8<br />
Gesamt 22 29 84 120,8<br />
jahrelang in Brasilien engagiert und haben<br />
brasilianische Partnerfirmen gefunden oder<br />
eigene Vertretungen gegründet. Es gibt bereits<br />
größere Referenzanlagen, die zumeist<br />
zusammen mit lokalen Partnern umgesetzt<br />
werden (siehe Bild 1 und Bild 2). Alessandro<br />
Gardemann, Vizepräsident der Abiogás,<br />
betont: „Die gesetzlichen und regulatorischen<br />
Grundlagen, die wir brauchten, damit<br />
Biogas in Brasilien ein Industriezweig<br />
werden kann, sind geschaffen. Jetzt müssen<br />
wir die Anlagen bauen. Wir brauchen<br />
mehr Investitionen, mehr Forschung und<br />
Entwicklung, mehr Projektentwickler und<br />
mehr Ideen für neue Geschäftsmodelle.“<br />
Damit sind natürlich auch deutsche Technologieanbieter<br />
aufgefordert, in Brasilien zu<br />
investieren.<br />
Projekt PROBIOGAS<br />
Die GIZ hat im Auftrag des Bundesministeriums<br />
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und<br />
Entwicklung (BMZ) von Anfang 2013 bis Anfang<br />
<strong>2017</strong> gemeinsam mit dem brasilianischen<br />
Städteministerium das deutsch-brasilianische<br />
Projekt zur Förderung der Nutzung von Biogas –<br />
PROBIOGAS (DKTI) implementiert. Im Rahmen<br />
des Projekts wurden in 39 Maßnahmen mehr<br />
als 2.000 Personen fortgebildet, 1.300 Personen<br />
nahmen an Projektevents teil und 17 Publikationen<br />
wurden erstellt. Auf der Website des Projekts<br />
können alle Publikationen heruntergeladen werden:<br />
http://www.cidades.gov.br/saneamentocidades/probiogas<br />
Es gibt zwei voneinander unabhängige Biogasverbände<br />
Die ABiogás (Associação Brasileira de Biogás e Biometano) hat sich Ende 2013 gegründet und besteht aus 31<br />
Mitgliedsunternehmen, Sitz ist São Paulo. Kontakt: Camila Agner D‘Aquino, Tel. +55 (11) 2655-1802, E-Mail:<br />
abiogas@abiogas.org.br, Website: www.abiogas.org.br<br />
Die ABBM (Associação Brasileira de Biogás e Metano ) hat sich Anfang 2014 gegründet und besteht aus<br />
Firmen und Privatpersonen, Sitz ist Santa Cruz im Bundesstaat Rio Grande do Sul. Kontakt: Mario Coelho, Tel.<br />
+55 (51) 3715-9542, E-Mail: www.abbiogasemetano.org.br, Website: http://www.abbiogasemetano.org.br<br />
Autoren<br />
Jens Giersdorf<br />
Wolfgang Roller<br />
Deutsche Gesellschaft für<br />
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH<br />
SCN Quadra 01, Bloco C<br />
Sala 1501, 70.711-902 Brasília-DF, Brasilien<br />
E-Mail: jens.giersdorf@giz.de<br />
E-Mail: wolfgang.roller@giz.de<br />
DIE BESSERE<br />
EINTRAGTECHNIK<br />
Der Powerfeed twin bringt große Mengen<br />
variierender Biomasse im geschlossenen<br />
System geruchsneutral und sicher in Ihre<br />
Biogasanlage. Die Flüssig-Eintragtechnik ist<br />
mit einer integrierten Zerkleinerungseinheit<br />
ausgestattet und sorgt so für eine erhöhte<br />
Energieverfügbarkeit der Biomasse und<br />
weniger Rühraufwand im Behälter.<br />
Eine einfache und bedienerfreundliche<br />
Steuerung regelt den Betrieb sämtlicher<br />
Anlagenkomponenten<br />
– einfach einschalten und<br />
eintragen.<br />
www.boerger.de Börger GmbH | D-46325 Borken-Weseke | Tel. 02862 9103 30<br />
79
International<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
KVP-Projekt: Tagebuch Indien<br />
Wir Deutsche sind Meister im Planen.<br />
Im Kalender sind noch Termine für die<br />
nächsten zwei Monate frei? Vergiss es!<br />
Vielleicht im zweiten Halbjahr. Projektplan<br />
für die nächsten zwei Jahre<br />
schon aufgestellt? Aber klar! Urlaub für das aktuelle<br />
Jahr schon eingereicht? Schon im Februar! In Indien<br />
sieht das ein bisschen anders aus: „Wir würden gerne<br />
Herrn Kumar zu der Messe XY im November als Sprecher<br />
einladen.“ Antwort: „Er weiß nicht, ob er da Zeit<br />
haben wird.“ Projektplan für die kommenden vier Monate<br />
schon aufgestellt? Vier Monate? Das ist eine sehr<br />
lange Zeit ...<br />
Eine große Herausforderung für eine Deutsch-Indische<br />
Partnerschaft! Das Kammer- und Verbandspartnerschaftsprojekt<br />
zwischen dem Fachverband Biogas<br />
(FvB) und der Indian Biogas Association (IBA) muss<br />
im Laufe seiner drei Jahre diverse Maßnahmen umsetzen.<br />
Projektziel ist der nachhaltige Aufbau und Betrieb<br />
der IBA, damit dieser die Interessen des Biogassektors<br />
sowie seiner Mitglieder kompetent und zielgerichtet gegenüber<br />
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vertreten<br />
kann.<br />
Anfang Februar <strong>2017</strong> fand als eine dieser Maßnahmen<br />
eine Biogastour durch drei indische Städte statt, mit<br />
jeweils einem offenen Biogas Basics-Workshop und einem<br />
Workshop für Behördenvertreter. Während uns in<br />
Deutschland Anfang Januar hinsichtlich des Anmeldestands<br />
(und so ziemlich allem anderen) die Schweißperlen<br />
auf der Stirn standen, war man in Indien noch<br />
die Ruhe selbst. Selbst eine Woche vor Beginn der Tour<br />
waren weder alle Locations sicher, noch der Anmeldestand<br />
im „sicheren“ Bereich. „No problem! This is India!<br />
Alles passiert in der letzten Woche!“ Und wahrlich,<br />
es war so. In einem Fall sogar ganz extrem: Während<br />
am Vortag gerade einmal 14 Anmeldungen vorlagen,<br />
erschienen zum Workshop 79 Personen, alle noch am<br />
Vortag mobilisiert!<br />
Kurzfristiges Handeln und Entscheiden ist in Indien<br />
die Normalität. Dies hat Vorteile (zum Beispiel ist man<br />
generell flexibler), aber gerade im Bereich Biogas auch<br />
Konfliktpotenzial. Internationale Teams bestehend aus<br />
Deutschen (den Planungsspezialisten) und Indern (den<br />
Spezialisten in der flexiblen und kurzfristigen Problemlösung)<br />
könnten sich optimal ergänzen. Eine Voraussetzung<br />
dafür ist, dass beide sich der eigenen Stärken,<br />
aber auch Schwächen bewusst sind. Keine leichte<br />
Sache, aber machbar. Ein erster Schritt: Für deutsche<br />
Unternehmen, die sich für Indien interessieren, wird<br />
der FvB auf der diesjährigen Biogas Convention im Dezember<br />
ein Indien-Panel anbieten, um erste Eindrücke<br />
und Informationen zu vermitteln.<br />
Gute Idee, ich trag’s mir schon mal<br />
in den Kalender ein.<br />
Autorin<br />
Antje Kramer<br />
Projektmanagerin KVP Indien<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 · 85356 Freising<br />
Tel. 0 81 60/98 46 60<br />
E-Mail: info@biogas.org<br />
Biogaskontor<br />
Köberle GmbH<br />
Wir können mit Druck umgehen<br />
NEU ÜU-ST<br />
für Drücke bis<br />
20mbar<br />
Bullaugen für alle Einsatzfälle<br />
Für Kernbohrung Auf Stahlplatte nach In Tauchhülse für Über-/Unterdrucksicherung<br />
oder Futterhülse<br />
Kundenmaß<br />
Blick um die Ecke<br />
ÜU-TT<br />
Ø300 + Ø400 mm<br />
für Folienhauben<br />
Zubehör: Leuchten, Rosetten, Futterhülsen, Sonnenschutzhauben, etc.<br />
Weitere 80 Komponenten: Luftdosierstationen zur Entschwefelung, Füllstandsüberwachung, Messtechnik, Warnschilder<br />
Über-/Unterdrucksicherung<br />
ÜU-GD<br />
für Betondecken<br />
www.biogaskontor.de • info@biogaskontor.de • Germany 89611 Obermarchtal • Tel +49(0)737595038-0
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
International<br />
Mathias Waschka<br />
Beratung und Vertrieb<br />
für landwirtschaftliche Erzeugnisse<br />
Trocknungstechnik bis 1,5 MW<br />
Mobil schallged. Varianten<br />
bis 500 kW 45 dB(A)<br />
Intelligent, individuell, kompetent<br />
Systemlösungen aus einer Hand<br />
von 7kW bis 2.000kW<br />
www.michael-kraaz.de<br />
Tragluftdächer<br />
Separatoren<br />
auch mobil<br />
Wärmekonzept<br />
Gärrest-Eindicker<br />
Tel. 05132 / 588 663<br />
Siebkörbe<br />
Schubboden-Trocknungscontainer<br />
Wolf Power Systems, Industriestr.1,<br />
D-84048 Mainburg, Tel.: 08751/74-0,<br />
wolf-power-systems.de<br />
Tel.<br />
Fax<br />
Mobil<br />
info@m-waschka.de<br />
www.m-waschka.de<br />
04482 - 908 911<br />
04482 - 908 912<br />
0151 - 23510337<br />
Rechtsanwälte und Notare<br />
Seit vielen Jahren beraten und vertreten wir vornehmlich<br />
Betreiber und Planer kompetent und umfassend im<br />
- Recht der Erneuerbaren<br />
- Energien<br />
- Vertragsrecht<br />
- Gewährleistungsrecht<br />
- Energiewirtschaftsrecht<br />
- Umweltrecht<br />
- Immissionsschutzrecht<br />
- öffentlichen Baurecht<br />
- Planungsrecht<br />
Kastanienweg 9, D-59555 Lippstadt<br />
Tel.: 02941/97000 Fax: 02941/970050<br />
Ihre Ansprechpartner:<br />
RAuN Franz-Josef Tigges*<br />
RAuN Andreas Schäfermeier**<br />
RA W. Andreas Lahme*<br />
RA Dr. Oliver Frank*<br />
RA‘in Martina Beese<br />
RA Dr. Mathias Schäferhoff<br />
RA Daniel Birkhölzer*<br />
RA‘in Katharina Vieweg-Puschmann LL.M.<br />
* Fachanwalt für Verwaltungsrecht<br />
** Fachanwalt für Insolvenzrecht<br />
kanzlei@engemann-und-partner.de<br />
www.engemann-und-partner.de<br />
BEST % PRICE<br />
BEST % PRICE<br />
81
Aus der<br />
Verbandsarbeit<br />
Bericht aus der Geschäftsstelle<br />
Neue Herausforderungen durch<br />
DüV, AwSV, StörfallV, TA-Luft ...<br />
In den vergangenen Tagen sind nach intensiven Diskussionen und<br />
Verhandlungen die Düngeverordnung (DüV) in novellierter Form und<br />
die neue Bundesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden<br />
Stoffen (AwSV) durch den Bundesrat beschlossen<br />
worden. Zusammen mit der seit Anfang des Jahres in Kraft getretenen<br />
Störfallverordnung (StörfallV) stehen somit wesentliche Neuerungen<br />
für die gesamte Branche in diesem Jahr an.<br />
Von Dr. Stefan Rauh und Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Die seit fast acht Jahren in Vorbereitung<br />
befindliche AwSV<br />
wurde am 31. März vom Bundesrat<br />
beschlossen und tritt –<br />
in Abhängigkeit davon, ob die<br />
Verkündung im Bundesgesetzblatt noch<br />
im April oder erst im Mai erfolgt – am 1.<br />
August oder 1. September in Kraft. Inhaltlich<br />
ergeben sich aus dem Bundesratsbeschluss<br />
keine Überraschungen, da für<br />
den bereits im März 2016 von Bayern und<br />
Rheinland-Pfalz vorgelegten Entwurf „sofortige<br />
Sachentscheidung“ beantragt war.<br />
Die mit der AwSV nun bundeseinheitlichen<br />
Maßgaben zum anlagenbezogenen<br />
Gewässerschutz greifen für Biogasanlagen<br />
im Wesentlichen bereits geltendes Länderrecht<br />
auf. Welche konkreten Auswirkungen<br />
die AwSV aber zum Beispiel auf den Anlagenbestand<br />
haben wird, ist noch nicht klar<br />
bestimmbar. Entscheidend dafür werden<br />
die endgültigen Inhalte der „Technischen<br />
Regeln wassergefährdende Stoffe (TRwS)“<br />
der DWA sein, die mit der AwSV eingeführt<br />
werden. Quasi alle einschlägigen TRwS<br />
sind aber aktuell in der Überarbeitung.<br />
Eine „TRwS 793 – Biogasanlagen mit Gärsubstraten<br />
landwirtschaftlicher Herkunft“<br />
wird in diesem Jahr im ersten Schritt nur<br />
im Gelbdruck (Entwurf) vorliegen.<br />
Die Umsetzung der Seveso III-Richtlinie<br />
(Änderung von BImSchG und 12.<br />
BImSchV) in nationales Recht sowie die<br />
Novelle der TA Luft sind die beiden großen<br />
Arbeitspakete, mit denen sich aktuell das<br />
Referat Genehmigung befasst. Aufgrund<br />
der erkennbaren enormen Streubreite<br />
bei der Umsetzung des Vollzugs liegt ein<br />
Schwerpunkt der Arbeit in der Klärung offener<br />
beziehungsweise strittiger Fragen.<br />
Bezüglich der Novelle der TA Luft ist aktuell<br />
die heiße Phase erreicht. Das Bundesumweltministerium<br />
verfolgt einen ambitionierten<br />
Zeitplan, in dem die neue TA Luft noch<br />
in diesem Sommer die „Bundesratshürde“<br />
nehmen soll, um dann im Januar 2018 in<br />
Kraft zu treten. Der aktuell nicht öffentliche<br />
Entwurf der TA Luft gibt weder inhaltlich<br />
noch handwerklich Anlass zur Freude –<br />
denn mit den Änderungen wurde in den<br />
wenigsten Fällen der Kritik beziehungsweise<br />
Diskussion aus der Verbändebeteiligung<br />
entsprochen. Neben den beiden<br />
„dicken Brocken“ auf Bundesebene gilt<br />
82
Engagiert. Aktiv. Vor Ort. Und in Berlin: Der Fachverband Biogas e.V.<br />
die Aufmerksamkeit des Referats Genehmigung<br />
auch den Aktivitäten der Länder –<br />
wie der Initiative des Landes Schleswig-<br />
Holstein, alle Biogasanlagen in den nächsten<br />
zwei Jahren umfänglich zu überprüfen,<br />
oder dem Merkblatt zur Gasdichtigkeit von<br />
Biogasanlagen im Zuge des Klimaplans in<br />
NRW.<br />
Arbeitshilfe zur DüV<br />
Mit der AwSV wurde am 31. März auch die<br />
DüV im Bundesrat verabschiedet. Für die<br />
Ausbringung von Gärprodukten ergeben<br />
sich einige äußerst relevante Änderungen.<br />
Die wichtigsten Neuerungen sind im Beitrag<br />
auf Seite 54 zusammengefasst. Bis<br />
zuletzt hatte sich der Fachverband Biogas<br />
e.V. für weitere Erleichterungen eingesetzt.<br />
Höchste Priorität in einem an die Bundesländer<br />
verschickten Brief – anlässlich der<br />
Ausschusssitzungen im Bundesrat – hatte<br />
die sachgerechte Auslegung der Lagerkapazität.<br />
Laut DüV muss das Fassungsvermögen für<br />
flüssige Wirtschaftsdünger, darunter auch<br />
Gärprodukte, mindestens sechs Monate<br />
betragen. Verschärfte Anforderungen sieht<br />
die Verordnung für Betriebe vor, die mehr<br />
als drei Großvieheinheiten je Hektar halten<br />
oder über keine eigenen Ausbringungsflächen<br />
verfügen. In diesen Fällen erhöht sich<br />
die geforderte Lagerkapazität ab 2020 auf<br />
neun Monate. Unklar war und ist in diesem<br />
Zusammenhang die Definition von „eigener<br />
Ausbringfläche“.<br />
Nach Aussage des Bundeslandwirtschaftsministeriums<br />
sollen Flächen des zugehörigen<br />
landwirtschaftlichen Betriebs, Pachtflächen<br />
oder Gärproduktabnahmeverträge<br />
auch unter die Definition der eigenen Flächen<br />
fallen. Diese Auslegung wird auch<br />
vom Fachverband unterstützt. Im Länderbrief<br />
hatte der Fachverband dafür plädiert,<br />
eine Klarstellung im Verordnungstext beziehungsweise<br />
der Begründung zu integrieren.<br />
Leider wurde dies so nicht umgesetzt.<br />
Wir warnen daher eindringlich vor Fehlinterpretationen<br />
beim Vollzug in der Praxis.<br />
Um dies zu vermeiden, sind weitere Gespräche<br />
mit den Ländern geplant. Um den<br />
Mitgliedern die neue Verordnung näherzubringen,<br />
wurde vom Fachverband die Arbeitshilfe<br />
„A-012 Anforderungen der DüV<br />
an Biogasanlagenbetreiber“ erstellt.<br />
Konformitätserklärung mit<br />
neuer Steuerproblematik – neue<br />
Rechtslage seit 1. April<br />
Wie jedes Jahr im Februar hat die Abgabefrist<br />
für die EEG-Konformitätserklärung zu<br />
zahlreichen Anrufen in der Geschäftsstelle<br />
geführt. Die Arbeit des Mitgliederservice<br />
wurde zusätzlich dadurch erschwert, dass<br />
Biogasanlagenbetreiber erstmals Angaben<br />
zur Stromsteuerbefreiung machen mussten.<br />
Hintergrund war eine Änderung im<br />
EEG, die zur Folge hatte, dass die gewährte<br />
Stromsteuerbefreiung mit der EEG-Vergütung<br />
zu verrechnen ist.<br />
Aufgrund der komplexen Rechtslage war es<br />
nicht immer einfach zu erläutern, welche<br />
Betreiber überhaupt betroffen sind und<br />
welche Folgen dies nach sich zieht. Seit<br />
1. April gibt es im Bereich der Stromsteuer<br />
eine neue Rechtslage, die wieder Veränderungen<br />
für den Biogasbereich bereithält. In<br />
der Geschäftsstelle wird hierzu aktuell ein<br />
umfangreiches Informationspapier für die<br />
Mitglieder erstellt.<br />
Am 29. März wurde das 1. Fachgespräch<br />
zum Thema „Sichere Instandhaltung von<br />
Biogasanlagen“ in Würzburg veranstaltet.<br />
Zielgruppe dieser Veranstaltung waren insbesondere<br />
Serviceunternehmen, befähigte<br />
Personen sowie Behörden. In Vorträgen zu<br />
den rechtlichen Grundlagen der Instandhaltung,<br />
zu den besonderen Gefahren sowie<br />
Nachruf<br />
Am 14. Februar <strong>2017</strong> verstarb unser<br />
langjähriger stellvertretender Regionalgruppensprecher<br />
aus Nordrhein-<br />
Westfalen, Karl-Heinz Ertl.<br />
Bereits seit dem Jahr 2006 war Karl-<br />
Heinz Ertl Kassenprüfer unseres Verbandes,<br />
seit Januar 2009 auch stellvertretender<br />
Regionalgruppensprecher<br />
in Nordrhein-Westfalen. Karl-Heinz<br />
Ertl hat sich sowohl in seinen Funktionen<br />
im Fachverband Biogas als auch<br />
als Privatperson für den Verband und<br />
die Branche hoch engagiert eingesetzt.<br />
Als Geschäftsführer des Instituts Novum<br />
Energy, aber auch in seiner Arbeit<br />
im Fachbereich Energietechnik der<br />
Fachhochschule Aachen hat er sich<br />
auch regelmäßig mit den Fragen rund<br />
um die Biogastechnologie auseinandergesetzt<br />
und dabei viele Dinge auch<br />
kritisch hinterfragt. Karl-Heinz Ertl hat<br />
in den letzten Jahren regelmäßig Diskussionsveranstaltungen<br />
in der Regionalgruppe<br />
organisiert und so den so<br />
wichtigen Wissensaustausch der Branche<br />
aktiv gefördert.<br />
Trotz schwerer Krankheit war Karl-<br />
Heinz Ertl bis zuletzt für die Branche<br />
aktiv und voller Pläne. Wir verlieren mit<br />
ihm einen engagierten und sehr kompetenten<br />
Mitstreiter, den wir gerne so<br />
in Erinnerung behalten werden.<br />
Präsidium und Geschäftsführung<br />
des Fachverband Biogas e.V.<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich. Biogas kann‘s!<br />
83
Verband<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Die Unterzeichner des Wasserpaktes Bayern. Umweltministerin Ulrike Scharf und Landwirtschaftsminister<br />
Helmut Brunner präsentieren die Unterschriften auf dem Plakat.<br />
Foto: Baumgart/StMELF<br />
soll und die die bis dato gültige BDEW-Mittelspannungsregel<br />
ablösen wird. Sie konnte<br />
bis zum 17. April kommentiert werden.<br />
Nachdem dazu zahlreiche und sehr vielfältige<br />
Änderungs- und Ergänzungsvorschläge<br />
eingereicht worden waren, fand sich am<br />
5. April die Arbeitsgruppe Stromnetze des<br />
FvB in einer Sondersitzung in Hamburg<br />
zusammen, um die Einwände eingehend<br />
und abschließend zu diskutieren. Dabei<br />
konnten alle Punkte abgearbeitet und<br />
schließlich in eine Kommentierungsliste<br />
eingetragen werden, die fristgerecht an das<br />
bearbeitende Gremium innerhalb des VDE<br />
gesendet wurde.<br />
Wasserpakt in Bayern<br />
vom Fachverband<br />
Biogas unterzeichnet<br />
Am 21. März unterzeichneten der Bayerische Landwirtschaftsminister<br />
Helmut Brunner, Umweltministerin<br />
Ulrike Scharf und zwölf bayerische Verbände<br />
den sogenannten Wasserpakt. Inhalt dieses Paktes<br />
sind konkrete Vereinbarungen und Selbstverpflichtungen<br />
zum Gewässer- und Bodenschutz – mit dem<br />
Ziel, die schon heute hohe Qualität des Trinkwassers<br />
und der Gewässer zu erhalten und zu verbessern.<br />
Stellvertretend für den Fachverband Biogas e.V.<br />
unterzeichnete der Geschäftsführer Dr. Stefan Rauh<br />
den Wasserpakt.<br />
Mit dem Wasserpakt sollen freiwillige Maßnahmen<br />
über die gesetzlichen Vorgaben hinaus umgesetzt<br />
werden, um die Einträge von Stickstoff und Phosphor<br />
und anderen Schadstoffen zu reduzieren. Hierzu soll<br />
unter anderem die Beratung verbessert, die Bildung<br />
intensiviert, die Forschung verstärkt und die Öffentlichkeitsarbeit<br />
ausgebaut werden. Im Rahmen des<br />
Wasserpaktes will der Fachverband Biogas e.V. konkret<br />
dazu beitragen, die Anforderungen der neuen<br />
Düngeverordnung sowie der Verordnung über Anlagen<br />
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen<br />
(AwSV) praxisgerecht und mit zeitgleich größtmöglichem<br />
Beitrag zum Gewässerschutz umzusetzen.<br />
Dabei sollen unter anderem Multiplikatorschulungen<br />
angeboten werden, die gute Beispiele zeigen<br />
und zum Nachahmen anregen sollen.<br />
zu Erfahrungen von Sachverständigen, Betreibern und<br />
Serviceunternehmen wurden einem Teilnehmerkreis<br />
von etwa 40 Personen wesentliche Aspekte bezüglich<br />
der Planung und der Durchführung von Instandhaltungsarbeiten<br />
vermittelt.<br />
In der anschließenden Diskussion wurden notwendige<br />
Lösungsansätze für sichere und effiziente Instandhaltungsmaßnahmen<br />
erörtert. Hierzu soll eine Arbeitsgruppe<br />
„Instandhaltungsmaßnahmen“ gegründet<br />
werden, die gezielte Hilfestellungen zur sicheren Umsetzung<br />
von Instandhaltungsmaßnahmen erarbeiten<br />
wird. Auch spezielle Qualifikationsmaßnahmen für<br />
Serviceunternehmen werden in dieser AG zukünftig<br />
erörtert. Aufgrund der positiven Resonanz der Teilnehmer<br />
wird diese Veranstaltung in Zukunft regelmäßig<br />
stattfinden.<br />
Nachfolgeregel für die<br />
Mittelspannungsrichtlinie<br />
Im Fokus des Referates Hersteller und Technik stand<br />
der Entwurf der neuen VDE-Anwendungsregel (AR)<br />
4110, die noch in diesem Jahr in Kraft gesetzt werden<br />
„Safety Guide“ in fünf<br />
Sprachen verfügbar<br />
Mit zwei Workshops im Rahmen des EU-<br />
BIOSURF Projekts beschäftigte sich das<br />
Referat International. Im Februar fand ein<br />
Praxisworkshop zur Berechnung der THG-<br />
Einsparung statt und im März ein Workshop<br />
mit dem Thema „Biomethane as fuel“<br />
anlässlich des „Berlin Energy Transition<br />
Dialogues“. Daneben war das Referat mit<br />
Vorträgen auf verschiedenen Veranstaltungen<br />
mit Delegationen aus Mexiko, von den<br />
Philippinen und aus Zentralamerika vertreten.<br />
Ferner hat das Referat eine Informationsveranstaltung<br />
über Biogas in Japan<br />
organisiert.<br />
Die Zusammenarbeit mit der GIZ Serbien<br />
und dem dortigen Verband wurde durch einen<br />
Vortrag im Rahmen eines Biogasworkshops<br />
weiter intensiviert. Die Sicherheitsbroschüre<br />
„Safety first! Guidelines for the safe use of biogas technology“,<br />
die der Fachverband Biogas mit Unterstützung<br />
der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit<br />
(GIZ) GmbH erstellt hat, steht seit Ende<br />
März in weiteren vier Sprachen (Französisch, Spanisch,<br />
Portugiesisch, Indonesisch) neben der seit November<br />
verfügbaren englischen Ausgabe zum Download bereit.<br />
Weitere Übersetzungen in andere Sprachen sind derzeit<br />
in Vorbereitung.<br />
Autoren<br />
Dr. Stefan Rauh<br />
Geschäftsführer<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Geschäftsführer<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 ∙ 85356 Freising<br />
Tel. 0 81 61/98 46 60<br />
E-Mail: info@biogas.org<br />
84
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Verband<br />
Nicht<br />
vergessen!<br />
Der Anzeigenschluss<br />
für die Ausgabe 4_<strong>2017</strong><br />
ist am 24. Mai<br />
A.A.T. Agrarservice, Transport und Handel GmbH<br />
Steintor 2a<br />
19243 Wittenburg<br />
BI<br />
www.michael-kraaz.de<br />
A.A.T. .....GmbH Steintor 2a 19243 Wittenburg<br />
Frau<br />
«Name_Zeile_1»<br />
«Name_Zeile_2»<br />
«Brief_Anrede»<br />
«Straße»<br />
«Postleitzahl» Separatorenauch<br />
«Ort»<br />
mobil<br />
GAS Journal<br />
Siebkörbe<br />
Schub-<br />
boden-<br />
Trockner<br />
Wärmekonzept<br />
Gärrest-Eindicker<br />
Tel. 051 32 / 588 663<br />
Maissilage<br />
sicher handeln<br />
Geschäftsführer: Christian Scharnweber<br />
Handelsregister Schwerin HRB 3377<br />
GMP + - B2 und GMP + - B4.1<br />
UST-Id-Nr.: DE 162151753<br />
Commerzbank AG, Schwerin<br />
Kreissparkasse Ludwigslust<br />
Raiffeisenbank Mölln e.G.<br />
038852 - 6040<br />
Christian 038852 Scharnweber - 6040<br />
www.aat24.de<br />
Telefon: 038852 – 604 0<br />
Telefax: 038852 – 604 30<br />
E-mail: mail@aat24.de<br />
URL: www.aat24.de<br />
THERM<br />
Unsere Leistung - Ihr Erfolg<br />
Abgaswärmetauscher<br />
an: «Faxnummer»<br />
Dampferzeuger<br />
Gaskühler / Gaserwärmer<br />
Sonderanwendungen<br />
Zusatzkomponenten<br />
Energiepark 26/28 91732 Merkendorf<br />
+49 9826-65 889-0 info@enkotherm.de<br />
www.enkotherm.de<br />
Schwingungsmessungen<br />
am Biogasmotor<br />
und<br />
«Brief_Anrede_komplett»<br />
Lärmgutachten für die<br />
Gesamtanlage<br />
6. Februar 2013<br />
@F211«Faxnummer»@<br />
@F599@<br />
bundesweiter Einsatz<br />
Ingenieurbüro Braase<br />
040 - 64917028<br />
www.Braase.de<br />
Fax serienfax aat 58 mit Feldfunktion Stand 21.01.2009<br />
85<br />
WWW.TERBRACK-MASCHINENBAU.DE
Verband<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Regionalgruppe Mecklenburg-Vorpommern<br />
Landesverband Erneuerbare Energien gegründet<br />
Am 31. Januar hat sich der Landesverband<br />
Erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern<br />
(LEE-MV) gegründet. Der Verein<br />
hat sich in seiner Satzung „zur Aufgabe<br />
gestellt, das Gedankengut der<br />
Erneuerbaren Energien sowie der<br />
Energieeinsparung und -effizienz<br />
sowie des Klimaschutzes zur Umsetzung<br />
der Energiewende in Mecklenburg-Vorpommern<br />
allgemein zu<br />
verbreiten“. Die Vorbereitung der<br />
Gründung erfolgte durch aktive<br />
Mitarbeit des ehemaligen Regionalgruppensprechers<br />
Dr. Horst Ludley<br />
und des neuen Regionalgruppensprechers<br />
Maik Orth, da die 92 Mitglieder<br />
der Regionalgruppe als maßgebliche<br />
Akteure zu einer erfolgreichen Umsetzung<br />
der Energiewende und zur Verbesserung<br />
der regionalen Wertschöpfung beitragen.<br />
Der formalen Gründungsveranstaltung<br />
schloss sich die offizielle Vorstellung des<br />
Landesverbandes durch den gewählten<br />
Vorsitzenden des LEE-MV Rudolf Borchert,<br />
ehemaliger Landtagsabgeordneter und Vorsitzender<br />
des Energieausschusses, unter<br />
Gründungsmitglieder des LEE-MV.<br />
Beisein von Energieminister Christian Pegel<br />
an. Der Energieminister unterstützt die<br />
Gründung des Vereins nachdrücklich und<br />
hob in seinem Grußwort die Bedeutung der<br />
Erneuerbaren Energien für das Land hervor.<br />
Im Rahmen der Vorstellung unterzeichnete<br />
Maik Orth mit weiteren Branchenvertretern<br />
und engagierten Privatpersonen die sogenannte<br />
Schweriner Erklärung. Darin geben<br />
die Vereinsgründer an, „ein Gesamtkonzept<br />
entwickeln [zu wollen], das mit<br />
Energieeinsparung, Netzausbau,<br />
Speicherung sowie mit der Kopplung<br />
der Sektoren Strom, Wärme<br />
und Verkehr einen Weg zu einer<br />
weitgehend klimaneutralen und<br />
partizipativen Energieversorgung<br />
aufzeigt.“ Eine der ersten gemeinsamen<br />
Aktivitäten unter dem Dach<br />
des Landesverbandes LEE-MV ist<br />
eine Fachtagung am 24. Mai, auf<br />
der durch die Akteure auf den aktuellen<br />
Stand der Energiewende in<br />
MV unter anderem auch im Bereich Biogas<br />
aufmerksam gemacht werden soll.<br />
Foto: Fachverband Biogas e.V.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. Maik Orth<br />
Regionalgruppensprecher<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Regionalgruppe Nordschwaben<br />
Nordschwäbischer Biogastag sehr stark besucht<br />
Seit vielen Jahren arbeitet unsere Regionalgruppe<br />
hervorragend mit dem Fachzentrum<br />
für Diversifizierung des Landwirtschaftsamtes<br />
Nördlingen zusammen, das der<br />
nordschwäbische Stützpunkt im Rahmen<br />
des bayerischen Beraternetzwerks „Land-<br />
SchafftEnergie“ darstellt.<br />
So war auch der diesjährige „Nordschwäbische<br />
Biogastag“ am 21. Februar in der alten<br />
Brauerei in Mertingen wieder ein voller Erfolg.<br />
Wenn auch die Themen diesmal harte<br />
Kost waren. Die Organisatoren, allen voran<br />
Hannes Geitner vom Landwirtschafts amt<br />
Nördlingen sowie die Regionalgruppenvertreter<br />
Bayrisch-Schwaben-Nord, hatten<br />
sich entschieden, die derzeitigen Problemfelder<br />
offen anzusprechen.<br />
Natürlich war das derzeit beherrschende<br />
Thema der Laufzeitverlängerung zentral,<br />
daher wurde dies zu Beginn der Veranstaltung<br />
ausführlich behandelt. Regionalgruppensprecher<br />
Rainer Weng stellte hierzu<br />
Ablauf und Voraussetzungen vor. Hannes<br />
Geitner stellte im Anschluss betriebswirtschaftliche<br />
Betrachtungen rund um die<br />
Ausschreibungsobergrenze und Praxiszahlen<br />
an Stromgestehungskosten aus seiner<br />
täglichen Vor-Ort-Beratung dar.<br />
Im Anschluss beleuchtete Manuel Maciejczyk,<br />
Geschäftsführer des Fachverbandes<br />
Biogas, die Problematik der neuen TA<br />
Luft, nachdem er das Aktuelle aus der Geschäftsstelle<br />
berichtete. Die Firma Emission-Partner<br />
sieht der neuen TA Luft relativ<br />
gelassen entgegen, da es technische Lösungen<br />
für die neuen Grenzwerte gäbe, wie<br />
im Anschlussreferat deutlich wurde. Wobei<br />
den beteiligten Betreibern natürlich klar<br />
ist, dass die Grenzwertverschärfungen mit<br />
zusätzlichen Investitionen einhergehen.<br />
Die neue Düngeverordnung war das zentrale<br />
Thema nach der Mittagspause. Manuel<br />
Maciejczyk erläuterte den aktuellsten<br />
Stand der Düngeverordnung und AwSV.<br />
Konrad Offenberger von der Bayerischen<br />
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)<br />
zeigte Strategien unter Maßgabe der neuen<br />
Auflagen auf.<br />
Den Abschluss bildete das dritte Problemthema<br />
„Fahrsiloanlagen“. Hannes<br />
Geitner erläuterte anhand eines Praxisbeispiels,<br />
warum Fahrsiloanlagen zunehmend<br />
in das Visier der Behörden geraten und<br />
sensibilisierte die Betreiber, verstärkt auf<br />
gute Führung der Siloanlagen zu achten.<br />
Den Abschluss bildete ein Fachvortrag von<br />
Dr. Hansjörg Nußbaum (LAZBW Aulendorf)<br />
zum richtigen Fahrsilomanagement und<br />
nachhaltiger Fahrsilosanierung.<br />
Autor<br />
Rainer Weng<br />
Regionalgruppensprecher<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Tel. 0 90 85/96 09 33<br />
E-Mail: rainer.weng@biogas-alerheim.de<br />
86
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Verband<br />
Regionalgruppe Oberbayern<br />
Kommunalpolitiker besuchen<br />
Regionalgruppentreffen<br />
Einen spontanen Besuch statteten der<br />
Erdinger Landrat Martin Bayersdorfer und<br />
die Bürgermeisterin der Gemeinde Lengdorf,<br />
Gerlinde Sigl, den Biogasbetreibern<br />
bei deren Regionalgruppentreffen ab und<br />
informierten sich ebenso wie die oberbayrischen<br />
Mitglieder über das Thema<br />
Öffentlichkeitsarbeit. Bis zu 150 Kilometer<br />
waren die etwa 80 Zuhörer angereist<br />
und ließen sich von Eva-Maria Haas, Geschäftsführerin<br />
„Unsere bayerischen Bauern<br />
e.V.“ über die gleichnamige Kampagne<br />
informieren.<br />
Dr. Claudius da Costa Gomez, Hauptgeschäftsführer<br />
des Fachverbandes Biogas<br />
e.V., referierte zusätzlich über die<br />
Zukunft von Biogas und versuchte die<br />
Besucher hierauf einzustimmen. Helene<br />
Barth, Fachreferentin Mitgliederservice<br />
und selbst Anlagenbetreiberin in Erding,<br />
zeigte zum Einstieg in den Abend Bilder<br />
des Besuches von der bayrischen Umweltministerin<br />
Ulrike Scharf auf der Biogasanlage<br />
Hintermaier in Fraunberg und rief<br />
die Anwesenden auf, selbst Politiker auf<br />
ihre Anlagen einzuladen, um die Technologie<br />
vorzustellen und so aktiv Öffentlichkeitsarbeit<br />
zu betreiben. Im Rahmen der<br />
Veranstaltung wurden auch die regionalen<br />
Vertreter für Oberbayern gewählt.<br />
Foto: Fachverband Biogas e.V.<br />
Von links: Landrat Martin Bayersdorfer, Bürgermeisterin<br />
Gerlinde Sigl, Betreibersprecher Michael Pellmeyer, stellv.<br />
Betreibersprecher Hans Poller, Hauptgeschäftsführer<br />
Dr. Claudius da Costa Gomez, Präsidiumsmitglied Sepp<br />
Götz, stellvertretende Regionalgruppensprecher Christian<br />
Rinser und Mathias Lohmayer, Regionalgruppensprecher<br />
Martin Barth.<br />
Autorin<br />
Helene Barth<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Tel. 0 81 61/98 46 60<br />
E-Mai: info@biogas.org<br />
Regionalgruppe Südwürttemberg<br />
Politikerfachgespräche zu Flexibilisierung<br />
Die seit vergangenen Hebst begonnenen<br />
Fachgespräche mit der Bundes- und Landespolitik<br />
führten diesmal nach Erbach bei<br />
Ulm. Auf Initiative von Edgar Müller und<br />
mit Unterstützung des seit Januar gewählten<br />
neuen Kreissprechers Daniel Jerg (für<br />
den Alb-Donau-Kreis) wurden Gespräche<br />
mit Vertretern der in der Landesregierung<br />
beteiligten Parteien CDU und GRÜNE geführt.<br />
Der rege und intensive Austausch zu aktuellen<br />
Fragen, die Biogasanlagenbetreiber<br />
im Kreis betreffen, fand auf der Biogasanlage<br />
von Edgar Müller statt. Dazu konnte<br />
er im Beisein von Fachverbands-Hauptgeschäftsführer<br />
Dr. Claudius da Costa Gomez,<br />
Otto Körner und dem Regionalgruppensprecher<br />
Franz-Josef Schenk die beiden CDU-<br />
Landagsabgeordneten Paul Nemeth – seines<br />
Zeichens energiepolitischer Sprecher<br />
der CDU-Landtagsfraktion – und Manuel<br />
Hagel als Wahlkreisabgeordneter und Generalsekretär<br />
der Landes-CDU begrüßen.<br />
Auch Ronja Kemmer als Bundestagsabgeordnete<br />
des Wahlkreises ließ es sich nicht<br />
nehmen, ebenfalls mit den knapp 40 Biogasanlagenbetreibern<br />
zu diskutieren. Der<br />
Termin mit den GRÜNEN fand in kleinerer<br />
Runde in Stuttgart statt. Als Gesprächspartner<br />
hatten sich die Landtagsabgeordneten<br />
Jutta Niemann, energiepolitische<br />
Trotz sehr ernster Gespräche gute Stimmung: Unsere<br />
Biogasanlagenbetreiber mit (3.v.li) Dr. Claudius da<br />
Costa Gomez, rechts folgend Manuel Hagel, Ronja<br />
Kemmer, Paul Nemeth und Edgar Müller.<br />
Sprecherin, Dr. Bernd Murschel, umweltpolitischer<br />
Sprecher der Landtagsfraktion,<br />
und der Wahlkreisabgeordnete Jürgen Filius<br />
zur Verfügung gestellt.<br />
Gegenstand der sehr intensiven Gespräche<br />
war das Thema Flexibilisierung, das vor Ort<br />
an der Biogasanlage eindrücklich mit den<br />
beträchtlichen Investitionen in „Hardware“<br />
veranschaulicht werden konnte. Dabei<br />
Foto: Fachverband Biogas e.V.<br />
konnte deutlich gemacht werden, dass Biogas<br />
als Bestandteil der Energiewende durch<br />
seine Qualität als Ausgleichsenergie ergänzend<br />
zu Wind und Sonne unverzichtbar ist.<br />
Entscheidend für die Genehmigungspraxis<br />
ist, dass mit der Flexibilisierung keine Erhöhung<br />
der Biogasproduktion verbunden<br />
ist, also nicht mehr Mais benötigt wird,<br />
sondern es bei den bisher produzierten<br />
Biogasmengen bleibt.<br />
Was sich vergrößert, ist ausschließlich<br />
der „Verbrennungsmotor“, die installierte<br />
BHKW-Leistung. Beispiel: Eine vollständige<br />
Abschaltung in der Nacht und<br />
Verlagerung der Stromproduktion auf die<br />
Tageshälfte bedeutet eine Verdopplung<br />
der Motorgröße. Diese Information muss<br />
in allen Gesprächen zum Verständnis von<br />
Flexibilisierung als wichtigste Botschaft<br />
vermittelt werden.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. RU Otto Körner<br />
Regionalreferent Süd<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Gumppstr. 15 · 78199 Bräunlingen<br />
Tel. 07 71/18 59 98 44<br />
E-Mail: otto.koerner@biogas.org<br />
87
Verband<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Regionalgruppe Schwarzwald<br />
Mitgliederservice:<br />
vor Ort!<br />
Erstmalig seit Gründung der Regionalgruppe Schwarzwald<br />
im Fachverband Biogas e.V. war der sonst nur<br />
vom Telefon her bekannte Mitgliederservice vor Ort. In<br />
Person von Marion Wiesheu kam die stellvertretende<br />
Referatsleiterin aus Freising in den Schwarzwald. Die<br />
behandelten Themen in Wiesheus Vortrag begannen mit<br />
dem schon fast klassischen EEG <strong>2017</strong> mit den Fragen<br />
zu Ausschreibungen, zu Flexprämie, Flexzuschlag und<br />
Flexdeckel einschließlich der neu vom Fachverband erstellten<br />
Checkliste Flexibilisierung, technischen Vorgaben<br />
und Maisdeckel. Die rege Beteiligung durch Fragen<br />
der Teilnehmer bei den weiteren Themen wie Abdeckpflichten<br />
von Gärproduktlagern, Stromsteuerbefreiung<br />
oder Anlagenregister zeigte das im Verlauf des Abends<br />
wachsende Interesse der Anwesenden. Es folgten noch<br />
Erläuterungen zu den neuen Formaldehydgrenzwerten,<br />
der EEG-Umlage bei Eigenstromnutzung, dem Nachhaltigkeitsnachweis<br />
für Zündöl und natürlich wurde auch<br />
das Neueste zur Düngeverordnung besprochen.<br />
Im Herbst feiern wir 10 Jahre Regionalgruppe Schwarzwald<br />
– da werden wir gemeinsam mit den Neuwahlen unserer<br />
Regionalgruppen-Vertreter eine kleine Geburtstagsfeier<br />
veranstalten. Dazu sind Ideen herzlich willkommen!<br />
Regionalgruppe Schleswig-Holstein<br />
Wahlkampf bei der<br />
New Energy<br />
Wahljahr in Schleswig-Holstein und ein ungewöhnlicher Politikerandrang bei<br />
der New Energy. Schon beim Eröffnungsrundgang konnte die Landesarbeitsgemeinschaft<br />
Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein auf dem Stand des<br />
Fachverbandes Biogas zwei Minister begrüßen. Dr. Robert Habeck betonte,<br />
wie wichtig die gemeinsame Arbeit der Verbände für die Umsetzung der Energiewende<br />
sei und nahm sowohl Lob als auch Kritik des Fachverbandes auf.<br />
Bei der Thematik Einspeisemanagement hat Schleswig-Holstein mit Ausnahme<br />
von Biogasanlagen mit Wärmeauskopplung von der Abschaltung eine<br />
positive Sonderrolle eingenommen. Nachbesserungsbedarf gibt es allerdings<br />
in anderen Bereichen. So wünschen sich die Betreiber ein landesweit einheitliches<br />
Vorgehen in der Genehmigungspraxis, um Rechtssicherheit bei investierenden<br />
Anlagenbetreibern zu erhalten. Wirtschaftsminister Meyer stellte<br />
insbesondere die große Bedeutung der Erneuerbaren Energien für die regionale<br />
Wertschöpfung in den Mittelpunkt.<br />
Erfreulich waren für den Fachverband Biogas die Aussagen der Parteien beim<br />
energiepolitischen Gespräch. Alle betonten, dass Biogas ein wichtiger Baustein<br />
für die Umsetzung der Energiewende sei. Im Detail wurde deutlich, dass<br />
man Biogas im Ausgleich der volatilen Energien sieht und sich auch bei den<br />
Inputmaterialien Veränderungen wünscht, wobei Ingbert Liebing (CDU) die<br />
Vorzüglichkeit des Maises durch die hohe Gasausbeute schon sah. Grundsätzlich<br />
sprach sich auch Thomas Hölck (SPD) für die Bedeutung der Energiewende<br />
in und für Schleswig-Holstein aus, gab aber auch zu, dass manche<br />
Landesverbände der SPD da durchaus andere Schwerpunkte sehen würden.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. RU Otto Körner<br />
Regionalreferent Süd<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Gumppstr. 15 · 78199 Bräunlingen<br />
Tel. 07 71/18 59 98 44<br />
E-Mail: otto.koerner@biogas.org<br />
Autorin<br />
Dipl.-Ing. agr. Silke Weyberg<br />
Regionalreferentin Nord<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Ostring 6 · 31249 Hohenhameln<br />
Tel. 0 51 28/33 35 510<br />
E-Mail. silke.weyberg@biogas.org<br />
Am 05. und 06. April <strong>2017</strong><br />
auf der new energy world,<br />
Leipzig, Foyer Ost, Stand 13<br />
Besuchen Sie uns<br />
am 28. und 29. Juni<br />
auf der interCOGEN in Karlsruhe<br />
SICHERE ERNTE.<br />
GARANTIERT.<br />
edenundteam.de<br />
Direktvermarktung von Strom aus Biogas.<br />
Wir handeln, Sie profi tieren:<br />
• 100 % der Marktprämie, ohne Abzüge<br />
• Monatliche Ausschüttung ohne weiteren<br />
Aufwand<br />
• Einsatz moderner, sicherer Fernwirktechnik<br />
• Garantierte Zusatzerlöse aus Viertelstunden-<br />
Energiehandel und Regelenergievermarktung<br />
• Integrierter Ansatz von Stromhandel und<br />
Technik<br />
Haben Sie Fragen zur Vermarktung?<br />
88<br />
natGAS Aktiengesellschaft<br />
Jägerallee 37 H<br />
14469 Potsdam<br />
Deutschland<br />
Telefon: +49 331 2004 140<br />
Fax: +49 331 2004 199<br />
E-Mail: info@natgas.de<br />
Web: www.natgas.de
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Verband<br />
Erneuerbare-Energien-Tag<br />
Niedersachsen<br />
Eine Großveranstaltung plant der Fachverband<br />
Biogas gemeinsam mit dem BWE<br />
Niedersachsen/Bremen. Am 19. Oktober<br />
findet der erste Erneuerbare-Energien-<br />
Tag in Niedersachsen im Rahmen des 4.<br />
Windbranchentages in Hannover auf dem<br />
Messegelände statt. Rund 700 Akteure aus<br />
dem Erneuerbare-Energien-Bereich werden erwartet.<br />
Im Mittelpunkt der Veranstaltung wird eine Diskussion<br />
mit den Spitzenkandidaten zur Landtagswahl in<br />
Niedersachsen stehen. Bei Ministerpräsident Stephan<br />
Weil (SPD) steht der Termin genau wie bei Umweltminister<br />
Stefan Wenzel im Kalender. Fest zugesagt<br />
haben bereits Dr. Bernd Althusmann, der Spitzenkandidat<br />
der CDU, und Dr. Stefan Birkner, ehemaliger<br />
niedersächsischer Umweltminister und Spitzenkandidat<br />
der FDP. Gemeinsam werden die Vertreter der<br />
Erneuerbaren Energien den Kandidaten auf den Zahn<br />
fühlen, um den Wahlkampf in Niedersachsen einzuläuten.<br />
Aber nicht nur die Politik steht im Fokus, sondern<br />
auch Fachthemen werden in den unterschiedlichen<br />
Foren bearbeitet. Im Biogasbereich wird es um das<br />
Thema Güllevergärung gehen. Außerdem wird die<br />
Veranstaltung abgerundet von einer Ausstellung im<br />
Convention Center der Messe Hannover. An der Ausstellung<br />
interessierte Unternehmen können sich im<br />
Regionalbüro des Fachverbandes gern melden.<br />
Regional<br />
büro<br />
NORD<br />
Netzwerk Bürgerenergiegesellschaften in<br />
Niedersachsen gegründet<br />
Zur Unterstützung und zum Erhalt der Akteursvielfalt<br />
hat das Niedersächsische Ministerium für Umwelt,<br />
Energie und Klimaschutz ein Netzwerk Bürgerenergiegesellschaften<br />
ins Leben gerufen. Die Aufgaben des<br />
Netzwerkes sind u.a. Bündelung und Stärkung der Interessen<br />
der Bürgerenergiegesellschaften, Erschließung<br />
neuer Geschäftsfelder und die Vernetzung zwischen Erzeugung<br />
und Verbrauch. Mit einer Auftaktveranstaltung<br />
wird dieses Netzwerk am 10. Mai die Arbeit vorstellen.<br />
Der Fachverband Biogas ist als aktiver Part dabei und<br />
wird mit 3N gemeinsam das Thema Satelliteninfrastruktur<br />
als Potenzial für die E-Ladeinfrastruktur aufgreifen.<br />
Interessante Projekte aus ganz Niedersachsen werden<br />
vorgestellt und Netzwerke sollen geknüpft werden, um<br />
gemeinsam die Energiewende in Niedersachsen voranzubringen.<br />
Autorin<br />
Dipl.-Ing. agr. Silke Weyberg<br />
Regionalreferentin Nord<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Ostring 6 · 31249 Hohenhameln<br />
Tel. 0 51 28/33 35 510<br />
E-Mail. silke.weyberg@biogas.org<br />
89
Verband<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Tagungsteilnehmer<br />
besichtigen die „Flex-<br />
Biogasanlage“ des<br />
Agrarunternehmens<br />
Pfersdorf eG.<br />
Direktvermarktung<br />
und Flexibilisierung<br />
Foto: Anja Nussbaum/Thüringer Bauernverband e.V.<br />
Unter diesem Schwerpunktthema fand am<br />
7. März die erste Thüringer Biogasfachtagung<br />
in diesem Jahr statt. Zum Thema<br />
passend wurde als Veranstaltungsort das<br />
südthüringische Reurieth ausgewählt. Hier<br />
betreibt seit zehn Jahren das Agrarunternehmen<br />
Pfersdorf eG eine Biogasanlage,<br />
die im Jahr 2016 begonnen hatte, die Entscheidung<br />
zum flexiblen Anlagenbetrieb erfolgreich umzusetzen.<br />
In bewährter Weise haben die Veranstalter Fachverband<br />
Biogas e.V., Thüringer Bauernverband e.V. (TBV)<br />
und die Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft<br />
(TLL) wieder ein anspruchsvolles Vortragsprogramm<br />
zusammengestellt. Der neugewählte Präsident des<br />
TBV, Dr. Klaus Wagner, eröffnete mit seinem Grußwort<br />
die Tagung.<br />
Sehr herzlich in Thüringen begrüßt, referierte anschließend<br />
Dr. Helmut Loibl, Rechtsanwalt aus Regensburg,<br />
zu den komplexen Anforderungen, die nach dem EEG<br />
<strong>2017</strong> speziell jetzt auf die Anlagenbetreiber zukommen.<br />
Neben den Chancen und Risiken, die das EEG<br />
<strong>2017</strong> bietet, legte Dr. Loibl in seinen Ausführungen<br />
besonderes Augenmerk auf die Fragen der Kostenoptimierung<br />
und auf die zukünftigen Erlösmöglichkeiten<br />
aus Flexibilisierung, Wärmeverkauf und aus Zusatzeinnahmen,<br />
die der Strommarkt bietet. Sehr wichtig ist<br />
weiter, dass die Biogasanlagen sehr sorgfältig zu prüfen<br />
haben, ob die Anforderungen, die die Ausschreibungen<br />
stellen, auch zu realisieren sind.<br />
Zu dem immer wieder auch im Mitgliederservice des<br />
Fachverbandes angesprochenen Thema der Anlagenzertifizierung<br />
sprach Joachim Kohrt von 8.2 Consulting<br />
AG aus Hamburg. Die Frage Einheiten- und Anlagenzertifikat<br />
– wer braucht was ? spielt bei der Erweiterung<br />
der Anlage für die Flexibilisierung eine nicht zu unterschätzende<br />
Rolle. Für den zweiten Teil der Vortragsveranstaltung<br />
war es gelungen, fünf Direktvermarkter<br />
Regional<br />
büro<br />
ost<br />
einzuladen, die ihre Unternehmen kurz vorstellten und<br />
die Gelegenheit nutzten, in der Diskussion, in der Pause<br />
und nach Schluss der Veranstaltung mit den Teilnehmern<br />
ins unmittelbare Gespräch zu kommen. Der<br />
Einladung nach Reurieth folgten die Firmen Energy-<br />
2market, natGAS, GASAG Berliner Gaswerke AG, Next-<br />
Kraftwerke AG und Clean Energy Sourcing AG. Als Fazit<br />
aus den vielen Kontakten war bei den meisten Anlagenbetreibern<br />
deutlich eine Art Aufbruchstimmung zu verspüren<br />
nach der Art: Wir müssen jetzt verstärkt etwas<br />
tun, müssen jetzt Entscheidungen treffen, in welche<br />
Richtung wir die Anlagen weiter betreiben wollen. In<br />
der Direktvermarktung, aber auch in flexibler Fahrweise<br />
nach Auslaufen der EEG-Vergütung.<br />
Praktische Erfahrungen mit der Flexibilisierung wurden<br />
vom Gastgeber der Fachtagung und Geschäftsführer<br />
des Agrarunternehmens Pfersdorf und Vizepräsidenten<br />
des Thüringer Bauernverbandes, Toralf Müller, sowie<br />
vor dem zuständigen Planer für die Flexibilisierung,<br />
Dr. Herbert Markert, vermittelt. Dabei wurde sehr anschaulich<br />
die enorme Komplexität der Anforderungen<br />
an die Erweiterung einer Biogasanlage für die flexible<br />
Fahrweise aufgezeigt.<br />
Fast die Hälfte der mehr als 110 Teilnehmer nutzten<br />
nach Beendigung der Fachtagung die Gelegenheit,<br />
die Pfersdorfer „Flex-Biogasanlage“ zu besichtigen.<br />
Die nächste Biogasfachtagung findet am 7. Juni in der<br />
Bauernscheune in Bösleben statt.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. Volker Schulze<br />
Regionalreferent Ost<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Alfred-Hess-Str. 8 · 99094 Erfurg<br />
Tel. 03 61/26 25 33 66<br />
E-Mail: volker.schulze@biogas.org<br />
90
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Verband<br />
Zerkleinerung von<br />
Strohmist und Maisstroh<br />
Biomaster 80<br />
der kompakte Shredder zur Auffaserung von Substrat<br />
für eine noch wirtschaftlichere Biogasanlage!<br />
Biogas Höre GmbH<br />
Mühlenstraße 31<br />
78359 Orsingen<br />
Tel 07774 6910<br />
m. 0171 2288310<br />
Fax 07774 929 709<br />
info@hoere-biogas.de<br />
www.hoere-biogas.de<br />
BEKON®<br />
Das etablierte<br />
Anlagen-Konzept.<br />
Das BEKON® Trockenfermentationsverfahren bietet<br />
effiziente und modulare Systeme für die Biogaserzeugung<br />
aus Abfallstoffen. Die ideale Lösung für Kommunen,<br />
private Entsorger und die Landwirtschaft.<br />
BEKON GmbH<br />
Feringastraße 9<br />
85774 Unterföhring / GERMANY<br />
Telefon: +49 89 9077959-0<br />
kontakt@bekon.eu<br />
bekon.eu<br />
91
Verband<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Landesverband Erneuerbare Energien NRW<br />
plant Gründung von Regionalverbänden<br />
Regional<br />
büro<br />
West<br />
Der Landesverband Erneuerbare<br />
Energien NRW e.V.<br />
(LEE) ist in NRW schon<br />
mehrere Jahre für die EE-<br />
Branche unterwegs und<br />
politisch aktiv. In NRW<br />
arbeitet der Fachverband<br />
Biogas e.V. eng mit dem Landesverband<br />
erneuerbare Energien zusammen. Dies ist<br />
nicht nur örtlich bedingt, denn man teilt<br />
sich in Düsseldorf ein gemeinsames Büro,<br />
sondern hat für alle Beteiligten mehrere<br />
Vorteile.<br />
Von der Historie her ist der Landesverband<br />
sehr windorientiert. Der Fachverband Biogas<br />
e.V. kann hier alle anfallenden Fragen<br />
zum Thema Biogas beziehungsweise Bioenergie<br />
abdecken. Die Synergie funktioniert<br />
hier schon seit Jahren gut. In NRW<br />
ist der LEE politisch sehr gut vernetzt. Der<br />
Fachverband Biogas e.V. hat hier die vorhandenen<br />
Verbindungen schon mehrfach<br />
nutzen können.<br />
Das große Ziel der Erneuerbaren-Energien-Verbände<br />
ist es, zu einem großen Dachverband<br />
zu fusionieren, dies gestaltet sich<br />
als keine leichte Aufgabe und wird eher<br />
ein langfristiges Projekt. Um politisch<br />
erfolgreich zu sein, führt wohl kein Weg<br />
daran vorbei. Der LEE will noch stärker<br />
regionale Akteure der Erneuerbaren-<br />
Energien-Branche in Nordrhein-Westfalen<br />
zusammenführen. Daher plant der Landesverband<br />
Erneuerbare Energien, fortan<br />
auch auf regionaler Ebene die verschiedenen<br />
Unternehmen und Akteure aus den<br />
Bereichen der Windenergie, Solarenergie,<br />
Bioenergie, Geothermie oder Wasserkraft<br />
sowie insgesamt aus den Verbrauchssektoren<br />
Strom, Wärme und Mobilität zusammenzuführen.<br />
Ziel einer stärkeren Vernetzung in den Regionen<br />
ist es, regionsspezifische Potenziale<br />
gemeinsam zu erkennen und zu nutzen,<br />
um so als starke Branche in der jeweiligen<br />
Region auftreten zu können und auch entsprechend<br />
wahrgenommen zu werden. Die<br />
Struktur der regionalen LEE-Netzwerke<br />
soll sich dabei an den verschiedenen Planungsräumen<br />
für die Regionalplanung in<br />
NRW orientieren.<br />
Es ist geplant, in allen Regierungsbezirken<br />
einen solchen Regionalverband zu gründen.<br />
Das heißt, neben dem bereits gegründeten<br />
Regionalverband Düsseldorf/Niederrhein<br />
werden noch ein Regionalverband Köln/<br />
Rheinland, Münster/Münsterland, Arnsberg/Sauerland<br />
und Detmold gegründet.<br />
Wir bitten Sie, sich an diesen Regionalverbänden<br />
des LEE NRW e.V. zu beteiligen.<br />
Wenn Sie jedoch aktiv dabei sein wollen,<br />
müssen Sie erst Mitglied werden im LEE.<br />
Hierzu können Sie die Beitragsordnung auf<br />
der Homepage des Vereins einsehen. Des<br />
Weiteren können Sie auch dort die Termine<br />
für die Vorstandswahlen der Regionalverbände<br />
ansehen. Es wäre schön, wenn in<br />
allen Regionen mindestens ein Vertreter<br />
unserer Branche in diesen Regionalverbänden<br />
Präsenz zeigt.<br />
Autor<br />
M.Sc. Ulrich Drochner<br />
Regionalreferent West<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Corneliusstr. 16-18 · 40215 Düsseldorf<br />
Tel. 02 11/99 43 36 95<br />
E-Mail: ulrich.drochner@biogas.org<br />
Sicherheit durch Füllstandsüberwachung ...<br />
... mit dem Kugelschalter KSS (seitlich) bzw. KST (oben):<br />
• Prüfen auf sichere Funktion jederzeit von außen ohne Aufstauen möglich<br />
• Nur ein bewegliches mechanisches Teil, mit dem die VA-Schwimmerkugel<br />
den außerhalb des Gasbereichs liegenden NAMUR-Sensor sicher schaltet<br />
Jetzt schon<br />
nachrüsten – bald<br />
wird die Füllstandsüberwachung<br />
zur<br />
Pflicht!<br />
• Alle mechanischen Teile aus VA<br />
• Keine aufwendige Elektronik<br />
• Draht- und Sensor-bruchsicherer Aufbau mit Ex-i-Trennschaltverstärker<br />
Seitz Electric GmbH Saalfeldweg 6 86637 Wertingen / Bliensbach<br />
08272 99316-0 info@seitz-electric.de www.seitz-electric.de<br />
92
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Verband<br />
Komponenten für Biogasanlagen<br />
Tragluftfolienabdeckungen • gasdichte Rührwerksverstellungen<br />
Xylem Rührwerks- und Pumpentechnik • Schaugläser<br />
Wartungs- und Kontrollgänge • Über/Unterdrucksicherungen<br />
Emissionsschutzabdeckung, etc.<br />
Industriestraße 10 • 32825 Blomberg • info@nesemeier-gmbh.de<br />
Tel.: 05235/50287-0 • Fax 05235/50287-29<br />
Gasdruckerhöhung<br />
für Biogas, Erdgas, Klärgas, etc.<br />
Zum Einsatz in den Ex-Zonen 1 und 2 gemäß der<br />
ATEX Richtlinie 2014/34/EU<br />
MAPRO® Gasverdichter sind keine Zündquellen<br />
NEU! Wartung zum Festpreis<br />
Unsere Produkte:<br />
Seitenkanalverdichter<br />
0-800 mbar | 0-1900 m³/h<br />
Radialventilatoren<br />
0-155 mbar | 0-2600 m³/h<br />
www.erdbecken.de<br />
0 49 44 - 91 69 50<br />
Erdbecken<br />
zur Lagerung von<br />
Gülle, Gärrest, belastete<br />
Wässer, Rübenmus<br />
Wir beraten Sie gern!<br />
Am Dobben 14<br />
26639 Wiesmoor<br />
Drehschieberkompressoren<br />
0,5-3,5 bar | 22-2900 m³/h<br />
Mehrstufige-Zentrifugalverdichter<br />
0-950 mbar | 0-3550 m³/h<br />
MAPRO® Deutschland GmbH<br />
www.maprodeutschland.com<br />
E-Mail: deutschland@maproint.com<br />
Tel.: +49 (0) 211 98485400<br />
Elektro<br />
Hagl<br />
Ihr Partner<br />
in Sachen<br />
BHKW<br />
Komplettmodule 30kW-530kW<br />
Gas & Diesel Service<br />
+ Motoren Generatoren<br />
+ Notstromaggregate<br />
+ Schaltanlagen<br />
+ Installation<br />
AGW_Anzeigen_85x57_2016_RZ.indd 1 02.03.2016 09:35:03<br />
www.biogas-hagl.de · T. 0 84 52 . 73 51 50<br />
Repowering<br />
Flexibilisierung<br />
Lastmanagement<br />
Wärmespeicher<br />
Tel. 0461 3183364-0<br />
www.greenline-energy.de<br />
Die Radlader der 8er-Serie:<br />
stark, standsicher, effizient.<br />
Allradlenkung, effizienter<br />
Antrieb, großes Einsatzspektrum,<br />
beeindruckende<br />
Standsicherheit und<br />
niedrige Betriebskosten –<br />
die Kramer Radlader<br />
setzen Maßstäbe!<br />
DE_KA_EMENA_AD_agrar_Landwirtschaft_175x56,5mm_3mm_Beschnitt_1703410.indd 1 05.04.17 17:42<br />
93
„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist sie zu gestalten.“ (Willy Brandt)<br />
www.biogas.org // www.schulungsverbund-biogas.de // www.biogas-convention.com<br />
– 1 –<br />
Verband<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Materialien für Ihre<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Sie planen ein Hoffest, bekommen eine Schulklasse<br />
zu Besuch oder werden zum Wärmelieferanten?!<br />
Der Fachverband bietet Ihnen für (fast) jede Gelegenheit<br />
die passenden Materialien.<br />
Immer wenn<br />
wir Energie brauchen,<br />
kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht,<br />
bei Wind und Wetter.<br />
Regional. Verlässlich.<br />
Klimafreundlich.<br />
Shop<br />
Fachverbands-Flyer<br />
Der Fachverband Biogas e.V. stellt sich vor<br />
DIN lang-Format, 6 Seiten<br />
Bestellnr.: KL-001<br />
für Mitglieder kostenlos<br />
Tel. 030 2758179-0<br />
Fax 030 2758179-29<br />
berlin@biogas.org<br />
Hauptstadtbüro<br />
Invalidenstr. 91<br />
10115 Berlin<br />
Jetzt<br />
neu<br />
Dem Klimaschutz verpflichtet.<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstraße 12<br />
85356 Freising<br />
Tel. 08161 984660<br />
Fax 08161 984670<br />
info@biogas.org<br />
Engagiert. Aktiv. Vor Ort.<br />
Für Betreiber.<br />
Wissenschaftler.<br />
Hersteller.<br />
Institutionen.<br />
Interessierte.<br />
Biogas Journal<br />
Sonderhefte<br />
Die aktuellen Hefte finden Sie<br />
auf der Homepage (www.biogas.org)<br />
DIN A4-Format<br />
Bestellnr.: BVK-14<br />
Preis auf Anfrage<br />
Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 50073 | 18. Jahrgang<br />
www.biogas.org März 2015<br />
Bi GaS Journal<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche<br />
Flexbetrieb: eine ökonomische<br />
Analyse S. 10 an den Fahrplanbetrieb S.<br />
Gasspeicher: Anforderungen<br />
30<br />
www.biogas.org Februar 2016<br />
Bi GaS Journal<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche<br />
Neue TRGS 529<br />
ernst nehmen S. 12<br />
SondeRheFt<br />
Stadtwerke Rosenheim bilden<br />
Kleinanlagenpool S. 65<br />
Direkt vermarktung<br />
BHKW<br />
Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 5 073 | 19. Jahrgang<br />
Sicherheitsrelevante<br />
dokumentationspflichten S. 24<br />
d<br />
SoNdeRheFT<br />
www.biogas.org April 2016<br />
Bi gAS Journal<br />
Statements zum einsatz<br />
von Prozesshilfsstoffen S. 38<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche<br />
Wildpflanzen: verbesserte<br />
Saatmischungen S. 6<br />
!<br />
SICHERHEIT<br />
Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 5 073 | 19. Jahrgang<br />
neues vom Mais-Silphie-<br />
Mischanbau S. 19<br />
BGJ Anlagensicherheit BUCH 2016.in d 1 25.01.16 12:10<br />
SonderheFt<br />
Sommersubstrat: Buchweizen<br />
und Quinoa S. 24<br />
EnErgiEpFlAnzEn<br />
BGJ Energiepflanzen 2016 BUCH.indd 1 18.03.16 14:36<br />
Broschüre<br />
Biogas-Wissen<br />
Grundlegende Informationen rund um<br />
die Biogasnutzung in Deutschland<br />
DIN A5-Format, 28 Seiten<br />
Bestellnr.: BVK-23 (deutsch)<br />
bis zu 20 Ex. kostenlos<br />
darüber 50 Cent / Broschüre<br />
Aufkleber für Ihre Braune Tonne<br />
21 x 10 cm<br />
Bestellnr.: KL-020<br />
5 Stück kostenlos –<br />
bei größerer Menge<br />
bitte nachfragen<br />
Fachverband_Biotonnenaufkleber_RZ.pdf 3 03.05.16 13:43<br />
Biogas<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
Vielen Dank, dass Sie trennen!*<br />
1kg Bioabfall Biogasanlage Dünger<br />
*Aus einem Kilogramm Bioabfä len produziert eine Biogasanlage 240 Wh Strom.<br />
Je weniger Plastik in der Biotonne landet, desto sauberer der Dünger und desto höher die Energieausbeute!<br />
BIOGAS Wissen_Kompakt<br />
6h Strom<br />
www.biogas.org<br />
Broschüren<br />
Biowaste to Biogas<br />
DIN A4-Format, 68 Seiten<br />
Bestellnr.: KL-021 (englisch)<br />
Branchenführer<br />
Güllekleinanlagen<br />
DIN A4-Format, 28 Seiten<br />
Bestellnr.: BVK-42 (deutsch)<br />
ein Heft kostenlos<br />
bei mehreren Heften berechnen<br />
wir Versand und Verpackung<br />
Biogas safety first!<br />
DIN A4-Format, 68 Seiten<br />
Bestellnr.: KL-024 (englisch)<br />
ein Heft kostenlos<br />
bis 10 Stück 5 Euro / ab 10 Stück 4 Euro<br />
ab 20 Stück 3 Euro pro Broschüre<br />
(zzgl. Versandkosten)<br />
BIOGAS Know-how_1<br />
Biowaste<br />
to Biogas<br />
BIOGAS Know-how_2<br />
BIOGAS Wissen_1<br />
Branchenführer<br />
BIOGAS<br />
Safety first!<br />
Guidelines for the safe use<br />
of biogas technology<br />
Güllekleinanlagen<br />
- - - 116 mm - - - - - - - - - - - > < - - - - - - - - - - - 118 mm - - - - - - - - - - - >< - - - - - - - - - - - 118 mm - - - - - - - - - - - > < - - - - - - - - - - - 116 mm - - - - - - - - - - - ><br />
mer<br />
ert und je nach Bedarf in Energie umgewandelt<br />
al kein Wind weht und keine Sonne scheint.<br />
Stromnetze und ist für die technische Umsete<br />
von entscheidender Bedeutung.<br />
Energiedörfer mit Biogas<br />
Biogas eignet sich hervorragend für die<br />
lokale Energieversorgung – und für neue<br />
Energiekonzepte in Kommunen und<br />
Regionen. Zahlreiche Wärmenetze, die<br />
teilweise genossenschaftlich betrieben<br />
werden, unterstreichen dieses Potenzial.<br />
Regionale Wertschöpfung<br />
Biogasanlagen produzieren dort Energie,<br />
wo sie gebraucht wird: In den Regionen.<br />
Das Geld für den Bau, den Betrieb und<br />
die Instandhaltung der Anlagen bleibt<br />
vor Ort – und fließt nicht in die Taschen<br />
der Ölmultis. Das sichert die regionale<br />
Energieversorgung und ist ein aktiver<br />
Beitrag zur Friedenspolitik.<br />
Faltblatt<br />
Biogas to go<br />
Der Fachverband Biogas e.V. ist mit über<br />
4.800 Mitgliedern die größte deutsche<br />
und europä ische Interessenvertretung der<br />
Biogas-Branche.<br />
Ziel der Verbandsarbeit ist es, die Biogaserzeugung<br />
und -nutzung für die bundes weite<br />
Strom-, Wärme- und Kraftstoff versorgung zu<br />
erhalten und auszubauen.<br />
Handliche Fakten zur<br />
Biogasnutzung<br />
11,8 x 11 cm<br />
Bestellnr.: BVK-37<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12<br />
85356 Freising<br />
A +49 (0)8161 984 660<br />
m info@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
bis zu 20 Ex. kostenlos<br />
darüber 50 Cent / Heft<br />
Wissen_to go<br />
BIOGAS<br />
Biogas to go<br />
Handliche Fakten<br />
zur Biogasnutzung<br />
Biogas kann alles<br />
Biogas ist der vielseitigste erneuerbare Energieträger. Das umweltfreundliche<br />
Gas kann sowohl zur Strom- und Wärmegewinnung wie<br />
auch als Kraftstoff eingesetzt werden. Damit ist Biogas eine wichtige<br />
Säule für die bürgernahe und bezahlbare Energiewende!<br />
Strom aus Biogas<br />
Biogas versorgt schon heute Millionen Haushalte in<br />
Deutschland mit klimafreundlichem Strom. Bei der<br />
Stromgewinnung im Blockheizkraftwerk entsteht automatisch<br />
auch Wärme.<br />
Wärme aus Biogas<br />
Mit Biogaswärme können zum Beispiel private Haushalte,<br />
kommunale Einrichtungen wie Schulen, Schwimmbäder<br />
und Turnhallen, Gewerbebetriebe oder Gewächshäuser<br />
beheizt werden.<br />
Kraftstoff aus Biogas<br />
Zu Biomethan aufbereitetes Biogas kann als klimafreundlicher<br />
und effizienter Kraftstoff von jedem CNG<br />
(compressed natural gas)-Fahrzeug getankt werden. Mit<br />
dem Biomethanertrag von einem Hektar Wildpflanzen<br />
kann ein Pkw einmal um die Erde fahren.<br />
Samentütchen<br />
Bunte Pflanzenmischung für Garten und Balkon<br />
Bestellnr.: KL-003<br />
für Mitglieder kostenlos<br />
01.04.16 10:34<br />
FLOWER POWER — Blühstreifenmischung<br />
Biogas bringt Farbe ins Feld<br />
Bunt blühende Pflanzen auf dem Acker und im Garten sehen<br />
nicht nur hübsch aus, sie bieten auch vielen Insekten und<br />
Wildtieren wertvollen Lebensraum.<br />
Biogasanlagen können aus ihnen am Ende des Sommers sogar<br />
noch Strom und Wärme erzeugen.<br />
Treiben Sie’s bunt und säen Sie mit. Für mehr Artenvielfalt!<br />
Inhalt (4 gr) Ringelblume, Sonnenblume, Malve,<br />
Phacelia, u.a.<br />
Aussaat<br />
April bis Mai (1gr/ m²)<br />
www.biogas.org<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich. Biogas kann’s!<br />
Machen Sie mit!<br />
www.farbe-ins-feld.de<br />
94<br />
Bestellungen bitte per E-Mail an info@biogas.org
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Verband<br />
Deutschland verfehlt alle<br />
Ziele im Wärmesektor<br />
BEE fordert Preisschild für Klimakiller CO 2<br />
und Förderstopp fossiler Heizungen.<br />
Gastbeitrag von Harald Uphoff, kommissarischer Geschäftsführer<br />
des Bundesverbandes Erneuerbare Energie (BEE) e.V.<br />
Aktuell werden noch immer 90<br />
Prozent der Wärme und Kälte<br />
mit fossilen Energien erzeugt.<br />
Vor allem im Gebäudebestand<br />
müssen Effizienzmaßnahmen<br />
und die Umstellung auf saubere Energien<br />
wie Solarthermie, Wärmepumpe und Biomasse<br />
deutlich beschleunigt werden. Ohne<br />
eine grundlegende Transformation des Wärme-<br />
und Kältemarktes (Wärmewende) wird<br />
die Energiewende nicht erfolgreich sein.<br />
Um dem entgegenzusteuern, muss aus<br />
Sicht des BEE die Wärme- und Kälteversorgung<br />
spätestens bis 2040 vollständig<br />
dekarbonisiert werden, und zwar sowohl<br />
im Gebäudesektor als auch im Bereich der<br />
Prozesswärme. Dafür sind im Kern drei Elemente<br />
entscheidend: Luftverschmutzung<br />
darf nicht länger finanziell belohnt werden.<br />
Das bedeutet, dass zum einen der Ausstoß<br />
von Kohlendioxid endlich ein Preisschild<br />
bekommen muss und zum anderen, dass<br />
fossile Heizungen nicht länger gefördert<br />
werden dürfen. Zudem sind Änderungen im<br />
Ordnungsrecht notwendig, um die Schritte<br />
für eine saubere Wärme- und Kälteversorgung<br />
voranzubringen.<br />
Wie das aussehen soll, hat der BEE zusammen<br />
mit seinen Mitgliedern und<br />
Spartenverbänden und unter Zuhilfenahme<br />
der wissenschaftlichen Institute ifeu,<br />
Hamburg-Institut und unter Anwendung<br />
des systemorientierten Ansatzes des Malik<br />
Sensitivitätsmodells nach Vester erarbeitet.<br />
Das Ergebnis ist die Wärme- und Kältestrategie<br />
„Effizient Erneuerbar: Was jetzt<br />
zum Gelingen einer Erneuerbaren Wärmewende<br />
getan werden muss“.<br />
Klimaschonend Heizen und Kühlen kann<br />
nur mit einem echten Kurswechsel weg von<br />
Erdöl, Erdgas und Kohle gelingen. Dazu<br />
muss sich das Ausbautempo Erneuerbarer<br />
Wärme um den Faktor 4 beschleunigen<br />
und alle Erneuerbaren Wärmetechnologien<br />
müssen deutlich ausgebaut werden. Die<br />
„Effizienzstrategie Gebäude“ der Bundesregierung<br />
geht allein für den Gebäudesektor<br />
je nach Szenario von einer notwendigen<br />
Steigerung der Erneuerbaren Wärme bis<br />
2050 zwischen 70 und 270 Prozent gegenüber<br />
dem Jahr 2008 aus und hat dabei<br />
noch nicht die Klimaschutzbeschlüsse von<br />
Paris berücksichtigt.<br />
Wärmewende: Das ist zu tun<br />
Ein wichtiger Baustein ist bzw. war die<br />
Umsetzung des Gebäudeenergiegesetzes<br />
(GEG). Der Gesetzentwurf ist im Koalitionsausschuss<br />
gescheitert. Damit jahrelange<br />
Vorarbeiten nicht umsonst gewesen sind,<br />
muss die nächste Bundesregierung hier<br />
mutig vorangehen. Bei einem Neuanlauf<br />
sollten die positiven Ansätze, die in den vorbereitenden<br />
Gutachten enthalten waren, in<br />
das Gesetz aufgenommen werden.<br />
Der Bestandsschutz für ineffiziente Heizanlagen<br />
muss deutlich eingeschränkt werden.<br />
Darüber hinaus braucht es kurzfristig<br />
ambitioniertere, einfachere, flexiblere und<br />
kosteneffiziente ordnungsrechtliche Vorgaben<br />
für den Gebäudesektor. Dabei sollten<br />
Verbraucher und Investoren individuell<br />
entscheiden dürfen, welche Lösungsansätze<br />
ihren Bedürfnissen am besten entsprechen.<br />
Die Brennstoffpreise für fossile Energien<br />
senden bisher keine ausreichenden Preisimpulse<br />
für einen Umstieg auf Erneuerbare<br />
Energien. Das liegt auch daran, dass die<br />
Umweltschadenskosten fossiler Energieträger<br />
bislang nicht angemessen in den<br />
Preisen abgebildet werden. Dies wäre<br />
durch fiskalpolitische Maßnahmen grundsätzlich<br />
möglich. So liefern die Energiesteuern<br />
kein einheitliches CO 2<br />
-Preissignal<br />
an die Märkte. Der BEE sieht daher eine<br />
wirksame CO 2<br />
-Bepreisung als dringend notwendigen<br />
Schritt.<br />
Ein CO 2<br />
-Preis auf fossile Brennstoffe im<br />
Wärmesektor schafft nicht nur faire Wettbewerbsbedingungen,<br />
sondern motiviert<br />
die Verbraucher darüber hinaus zu einem<br />
klimafreundlichen Umgang mit Raumwärme<br />
und Warmwasser. Damit sich CO 2<br />
-Sparen<br />
lohnt und Mehrkosten für die Verbraucher<br />
vermieden werden, schlägt der BEE<br />
eine Rückerstattung für die Bürger und<br />
Unternehmen vor. Der einzelne Verbraucher<br />
erhält also einen pauschalen Betrag<br />
zurück: Hat er vorher viel CO 2<br />
eingespart,<br />
bleibt ihm Geld übrig; hat er viel CO 2<br />
ausgestoßen,<br />
bleibt ihm weniger übrig. Dadurch<br />
wird Klimaschutz belohnt.<br />
Da bislang die Kosten für Umwelt- und<br />
Klimaschäden fossiler Energieträger kaum<br />
in den Wärmepreisen abgebildet werden,<br />
sind die fossilen Brennstoffe deutlich privilegiert.<br />
In einem sinnvollen Fördersystem<br />
dürfen Steuermittel künftig nicht mehr für<br />
die Förderung von fossil befeuerten Heizungen<br />
verausgabt werden. Steuermittel<br />
sollten stattdessen in Erneuerbare Heizsysteme<br />
fließen, sodass diese attraktiver<br />
als fossile werden. Denn eine spürbare<br />
Dynamik lässt sich am besten mit technologieoffenen<br />
und marktbasierten Instrumenten<br />
entfachen, die Verbrauchern und<br />
Unternehmen die freie Wahl lassen, wie sie<br />
ihre Klimabelastungen reduzieren können.<br />
Sinnvoll ist ein Fördersystem im Sinne der<br />
Klima- und Energieziele, wenn es technologie-,<br />
aber nicht brennstoffoffen ist.<br />
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass<br />
bei einer weitgehenden Beschränkung auf<br />
Förderpolitik selbst mit hohen Fördervolumina<br />
von bis zu 17 Milliarden Euro bis<br />
2020 und hohen Fördersätzen die Ausbauziele<br />
der Erneuerbaren Wärme sowie die<br />
Energie- und Klimaziele nicht zu erreichen<br />
sind. Erheblich größere Anstrengungen und<br />
darüber hinausgehende Maßnahmen in allen<br />
Sektoren sind also notwendig.<br />
95
Produktnews<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Neue Ex-Messumformertechnologie für Multigas-Applikationen<br />
Egal, ob betriebliche, regelungstechnische<br />
Bedürfnisse oder ein Energiemanagement<br />
nach ISO 50001 im Vordergrund stehen,<br />
Thermische Strömungssensoren TA 10 und<br />
TA-Di überzeugen mit Präzision, Langzeitstabilität<br />
und Wirtschaftlichkeit. Bei der<br />
neuen Generation von Sensoren kann dasselbe<br />
Gerät für eine Vielzahl von Gasen auch<br />
in Ex-Bereichen der Kategorie 3G und 3D<br />
(Zone 2 und 22) eingesetzt werden, ohne<br />
dass es einer Neukalibrierung oder Rücksendung<br />
an den Hersteller bedarf. Dies eröffnet<br />
die Möglichkeit, nur ein Basisgerät einzusetzen<br />
oder auch auf Lager vorzuhalten.<br />
Eine Vielzahl von Gaskennlinien, wie zum<br />
Beispiel für Luft, Druckluft, Sauerstoff,<br />
Stickstoff, Kohlendioxid, Argon,<br />
Stadtgas, Erdgas, Methan, Tracergase,<br />
Wasserstoff, Helium, Deponie-<br />
und Biogase können durch den<br />
Anwender mittels Tasten und Display<br />
oder eines WiFi Access Point<br />
ausgewählt und in wenigen Sekunden<br />
zum passenden Gerät einfach<br />
konfiguriert werden. Eine dreh- und<br />
schwenkbare Rundantenne sorgt<br />
für optimalen Empfang entweder<br />
als eigener Hot Spot oder bei der Integration<br />
in ein bestehendes WLAN. Alternativ zu zwei<br />
analogen Ausgängen und einem Mengenimpulssignal<br />
stehen optional Anbindungen für<br />
unterschiedliche Bussysteme zur Verfügung.<br />
Das Messgerät U10b mit Daten-Visualisierung<br />
auf dem Smartphone.<br />
Kontakt: Höntzsch GmbH<br />
Gottlieb-Daimler-Str. 37, 71334 Waiblingen<br />
Tel. 0 71 51/17 16-12<br />
E-Mail: info@hoentzsch.com<br />
www.hoentzsch.com<br />
Foto: Höntzsch GmbH<br />
WANGEN BIO-FEED<br />
Kostengünstig, leistungsstark, von hoher<br />
Qualität und mit flexiblen Einsatzbereichen –<br />
die neu entwickelte Pumpe WANGEN BIO-<br />
FEED bietet diese Vorteile. Die Pumpe ist<br />
speziell für Anlagen konzipiert, die die vorhandene<br />
Schneckentechnik am Feststoffdosierer<br />
mit der Flüssigeinbringung kombinieren<br />
wollen.<br />
Technik/Details:<br />
ffGroßvolumiges Mischgehäuse.<br />
ffPumpgehäuse mit drei Anschlüssen<br />
DN150 und einem Anschluss DN400,<br />
zur einfachen Einbindung in der bestehenden<br />
Anlage. Diese können zusätzlich<br />
als Reinigungsöffnungen und zum Spülen<br />
des Mischgehäuses genutzt werden.<br />
ffRobuster Lagerstuhl für sichere<br />
Kraftaufnahme.<br />
ffModerne Dichtungstechnik<br />
(LDW-Patrone).<br />
ffAusgereifte, robuste Kardangelenke<br />
mit Zuführschnecke.<br />
ffFlexible Antriebswahl.<br />
ffProblemloser Flüssigeintrag bei nassen<br />
und wässrigen Feststoffen ohne zusätzliche<br />
Flüssigkeit möglich.<br />
ffEinfaches Wechseln der Verschleißteile<br />
durch das innovative X-LIFT Schnellwechselsystem.<br />
Wechselbar mit wenigen<br />
Handgriffen und ohne Demontage<br />
der Pumpe aus dem Rohrleitungssystem.<br />
Die WANGEN BIO-FEED bietet vielfältige<br />
Einsatzbereiche. Des Weiteren können diese<br />
besonderen Eigenschaften der WANGEN<br />
BIO-FEED in industriellen und kommunalen<br />
Anwendungen zum Einsatz kommen.<br />
Kontakt: Pumpenfabrik Wangen GmbH<br />
Simoniusstr. 17, 88239 Wangen<br />
Tel. 0 75 22/997-0, E-Mail: mail@wangen.com<br />
www.wangen.com<br />
Foto: Pumpenfabrik Wangen GmbH<br />
Vorbehandlung des Biogassubstrats durch „Bio-Master 80“<br />
Der elektrisch betriebene Schredder ist mit einem<br />
schnell laufenden Rotor mit 12 wuchtigen Schlegeln<br />
bestückt. Er verarbeitet eine Vielzahl von Ausgangsstoffen.<br />
Foto: Biogas Höre GmbH<br />
Die Firma Willibald ist seit über 40 Jahren<br />
mit Zerkleinerungstechnik sehr erfolgreich<br />
im Abfall- und Kompostbereich tätig. Gemeinsam<br />
mit der Firma Biogas Höre GmbH<br />
wurde der Stationäre Substrat-Schredder<br />
„Biomaster 80“ entwickelt.<br />
Für eine bessere und schnellere Verarbeitung<br />
und Vergärung der Biogassubstrate empfiehlt<br />
es sich, diese zu schreddern und dadurch<br />
aufzufasern. Deutliche Kosteneinsparungen<br />
sind beispielsweise möglich, wenn günstiger<br />
Festmist, Landschaftspflegematerial oder<br />
Maisstroh eingesetzt werden kann. Diese<br />
Substrate müssen allerdings zerkleinert werden.<br />
Hier kommt der „Bio-Master 80“ zum<br />
Einsatz. Neben Mist können beispielsweise<br />
auch Kartoffeln, Zuckerrüben oder Grassilage<br />
geschreddert werden.<br />
Die meisten Nutzer integrieren diesen Elektro-Schredder<br />
in ein Fördersystem, um den<br />
Verarbeitungsprozess zu automatisieren. Die<br />
großen Vorteile des „Bio-Master 80“ sind robuste,<br />
einfache und bewährte Technik, hohe<br />
Durchsatzleistung bei geringem Stromverbrauch,<br />
niedrige Verschleiß- und Betriebskosten,<br />
unempfindlich bei Fremdkörpern.<br />
Kontakt: Biogas Höre GmbH<br />
Mühlenstr. 31, 78359 Orsingen<br />
Tel. 0 77 74/69 10, E-Mail: info@hoere-biogas.de<br />
www.hoere-biogas.de<br />
96
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
Produktnews<br />
Made in Germany<br />
Qualität setzt sich durch – seit 1887<br />
• Tauchmotorrührwerke GTWSB<br />
mit/ohne Ex-Schutz<br />
• Tauchmotorpumpen AT<br />
• Drehkolbenpumpen DK<br />
• Vertikalpumpen VM/VG<br />
• Über-/Unterdrucksicherung<br />
Franz Eisele u. Söhne GmbH u. Co. KG • Hauptstraße 2–4 • 72488 Sigmaringen<br />
Telefon: +49 (0)7571 / 109-0 • E-Mail:info@eisele.de • www.eisele.de<br />
B<br />
EIS-ME-M-17009_AZ_Motiv-B_85x56.5_RZ.indd 1 31.01.17 18:38<br />
Ihre Alte ist nicht dicht?<br />
Dichten durch Beschichten!<br />
Beschichtung als Betonschutz<br />
und / oder Dämmung,<br />
ihrer alten oder neuen<br />
Biogasanlage / Güllebehälter.<br />
Tel. 03525/8753610<br />
www.nilpferdhaut.de<br />
WIR BAUEN...<br />
Rundbehälter<br />
aus Stahlbeton.<br />
BEHÄLTERBAU<br />
BIOGASANLAGEN GÜLLEBEHÄLTER SILOS<br />
WOLF SYSTEM GMBH | 94486 Osterhofen | 09932 37-0 | WWW.WOLFSYSTEM.DE<br />
GÄRRESTTROCKNER<br />
Bis zu<br />
€ 100.000,–<br />
KWK-Bonus im<br />
Jahr, gesetzlich<br />
gesichert!<br />
Made in Germany, langlebig, wartungsarm.<br />
4 Disco-King-Modelle: 280, 400, 560 oder 800 kW.<br />
Schon über 50 Gärresttrockner im Einsatz.<br />
www.biowatt.de • Tel 040 60533608 • Plug and dry!<br />
97
IMPRESSUM<br />
Biogas Journal | 3_<strong>2017</strong><br />
IMPRESSUM<br />
Zum weiteren Ausbau des Wachstumsbereichs Gärproduktmanagement<br />
suchen wir ab sofort einen engagierten<br />
Berater (m/w)<br />
Gärproduktmanagement<br />
Ihre Aufgaben:<br />
• Sie sind zentraler Ansprechpartner für unsere Kunden<br />
• Angebotserstellung und Verkaufsabschluss<br />
• Sie entwickeln den Bereich mit dem zuständigen Produktmanager<br />
stetig weiter<br />
Ihr Profil:<br />
• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium mit Fachrichtung<br />
Agrarwirtschaft oder Verfahrenstechnik<br />
• Großes verkäuferisches Talent, durchsetzungsstark, serviceund<br />
kundenorientiert.<br />
• Hohe Reisebereitschaft, teamfähig und flexibel<br />
Wir bieten Ihnen:<br />
• Ein abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet<br />
mit viel Gestaltungsspielraum und Perspektive<br />
• Individuelle Einarbeitung<br />
• Dienstwagen, auch für die private Nutzung<br />
Wir freuen uns über Ihre aussagefähige Bewerbung! Bitte senden<br />
Sie diese bevorzugt per E-Mail an bewerbung@agrikomp.de.<br />
Mehr Informationen unter: agrikomp.com/de/biogas/beruf-karriere<br />
BIOGASTECHNIK – Wir kennen uns aus. I www.agrikomp.de<br />
Herausgeber:<br />
Fachverband Biogas e. V.<br />
Dr. Claudius da Costa Gomez (V.i.S.d.P.)<br />
Andrea Horbelt (redaktionelle Mitarbeit)<br />
Angerbrunnenstraße 12 · 85356 Freising<br />
Tel. 0 81 61/98 46 60<br />
Fax: 0 81 61/98 46 70<br />
E-Mail: info@biogas.org<br />
Internet: www.biogas.org<br />
ISSN 1619-8913<br />
Redaktion:<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Fachverband Biogas e. V.<br />
Tel. 0 54 09/9 06 94 26<br />
E-Mail: martin.bensmann@biogas.org<br />
Anzeigenverwaltung & Layout:<br />
bigbenreklamebureau GmbH<br />
An der Surheide 29 · 28870 Ottersberg-Fischerhude<br />
Tel. 0 42 93/890 89-0<br />
Fax: 0 42 93/890 89-29<br />
E-Mail: info@bb-rb.de<br />
Internet: www.bb-rb.de<br />
Druck: Druckhaus Fromm, Osnabrück<br />
© Countrypixel | www.fotolia.com<br />
Biogaskongress <strong>2017</strong><br />
26. / 27. September in Bayreuth<br />
Jetzt<br />
anmelden<br />
Alle Infos unter www.fnr.de/biogaskongress<br />
Auflage: 10.000 Exemplare<br />
Das BIOGAS Journal erscheint sechsmal im Jahr auf Deutsch. Zusätzlich erscheinen<br />
zwei Sonderhefte und zwei Ausgaben in englischer Sprache.<br />
Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich<br />
geschützt. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des<br />
Verfassers wieder, die nicht unbedingt mit der Position des Fachverbandes<br />
Biogas e.V. übereinstimmen muss. Nachdruck, Aufnahme in Datenbanken,<br />
Onlinedienste und Internet, Vervielfältigungen auf Datenträgern wie CD-<br />
Rom nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung. Bei Einsendungen<br />
an die Redaktion wird das Einverständnis zur vollen oder auszugsweisen<br />
Veröffentlichung vorausgesetzt. Für unverlangt eingehende Einsendungen<br />
wird keine Haftung übernommen. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe<br />
sinnerhaltend zu kürzen.<br />
Ideeller Partner<br />
Medienpartner<br />
98
Ganzheitliche Biogas-Prozess-Optimierung<br />
99
JETZT DAS WICHTIGSTE ERLEDIGEN<br />
UND KEINE ZEIT FÜR<br />
KLEINIGKEITEN VERLIEREN!<br />
„Ich bestell‘ meine<br />
BHKW-Zündkerzen<br />
bequem und günstig<br />
im Online-Shop.<br />
So kann ich mich<br />
um Wichtigeres<br />
kümmern.“<br />
Heiner de Fries, Biogasanlagenbetreiber<br />
Denso GK3-5<br />
ab 24,50 €/Stk.<br />
Beru 18 GZ 46<br />
348,50 €/Stk ab 12 Stück:<br />
gratis Einstellwerkzeug<br />
und Koffer dazu!<br />
BHKW-Zubehör: Einfach, schnell und günstig online kaufen:<br />
Denso GE3-5<br />
ab 24,50 €/Stk.<br />
www.EMISSION-PARTS.de<br />
Bequem online bestellen und 2 % sparen:<br />
im BHKW Zubehörshop von Emission Partner.<br />
www.emission-parts.de<br />
Tel.: +49 44 98 92326 26<br />
shop@emission-partner.de<br />
Wir verstehen Biogas!